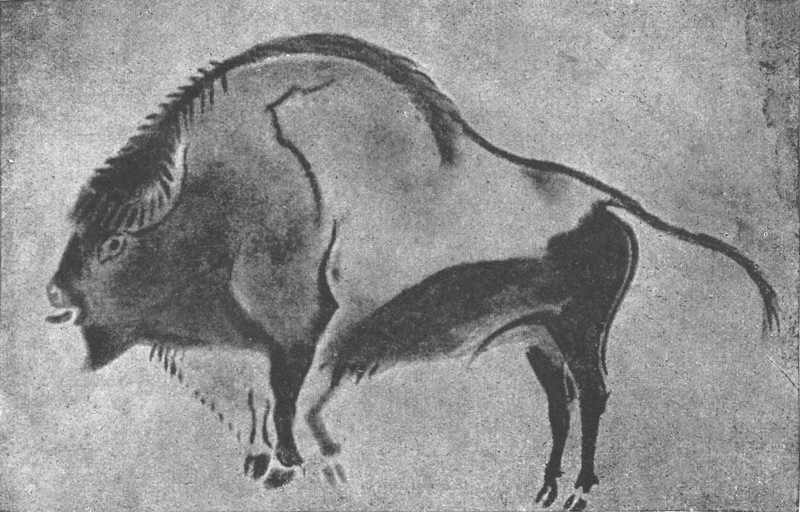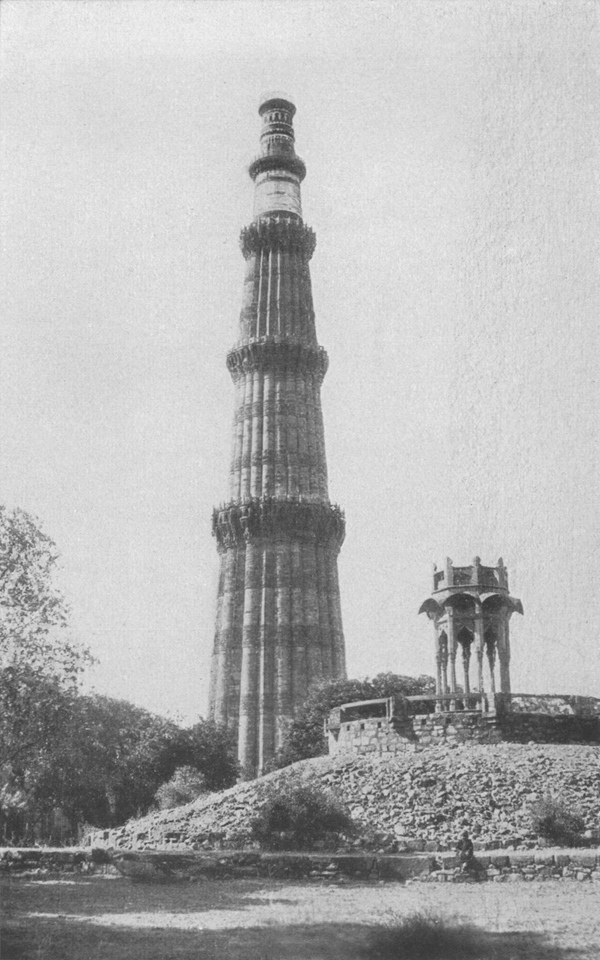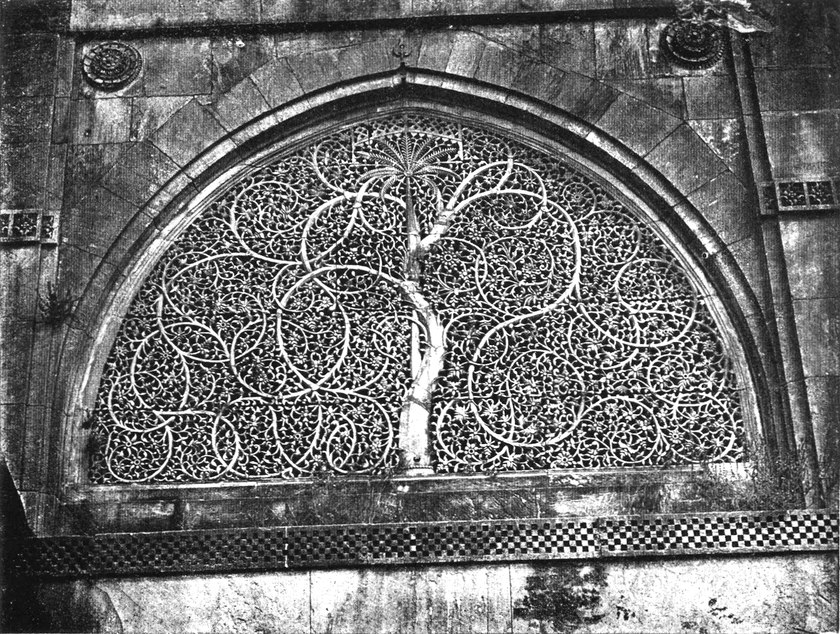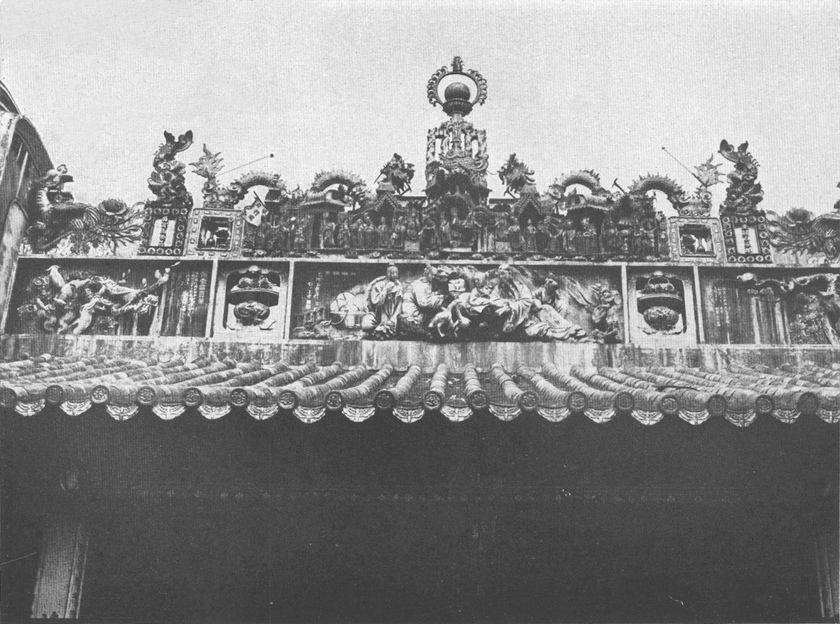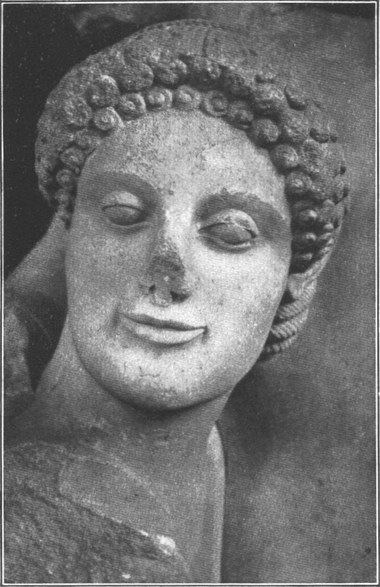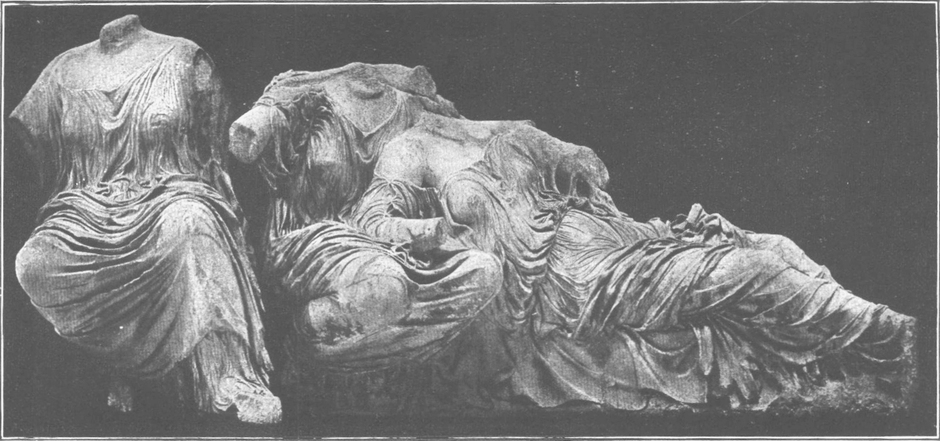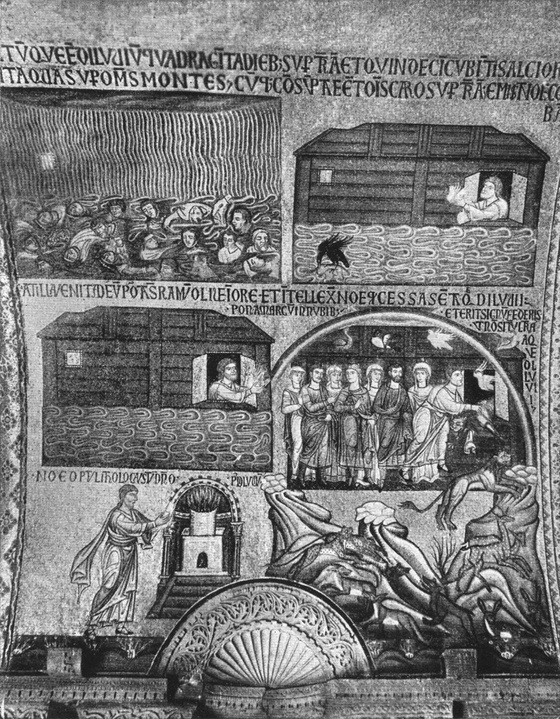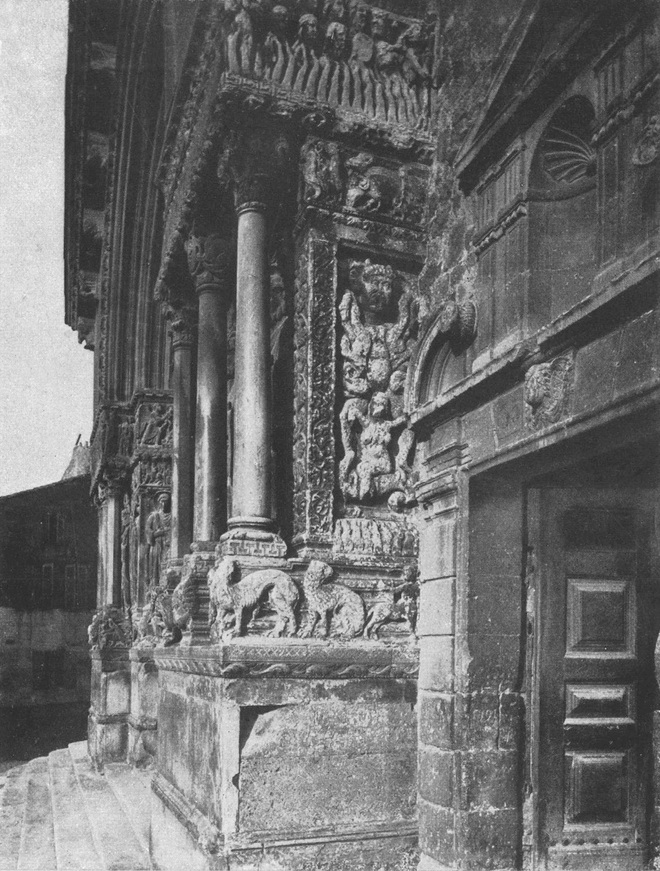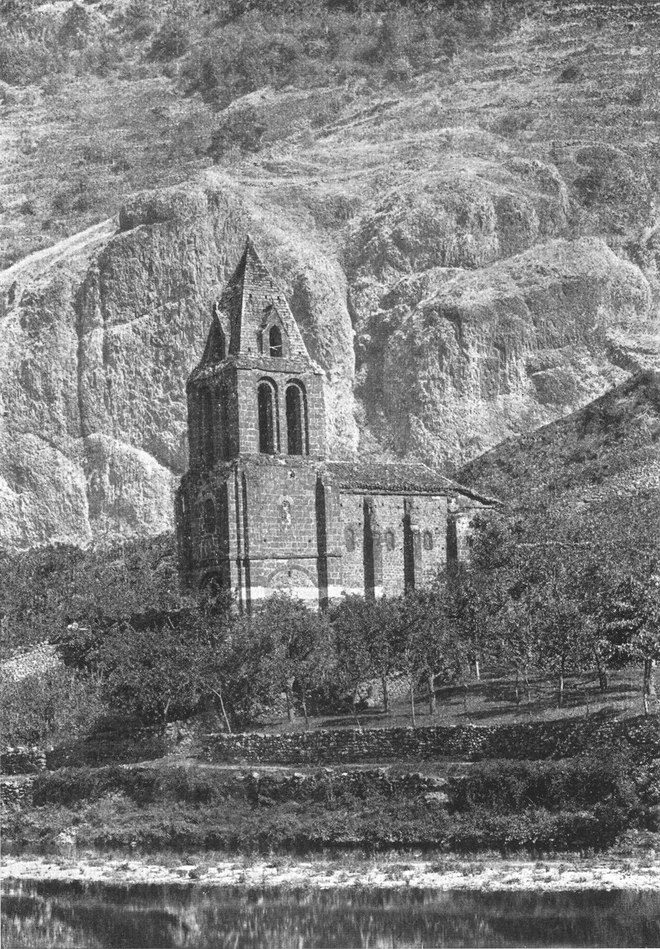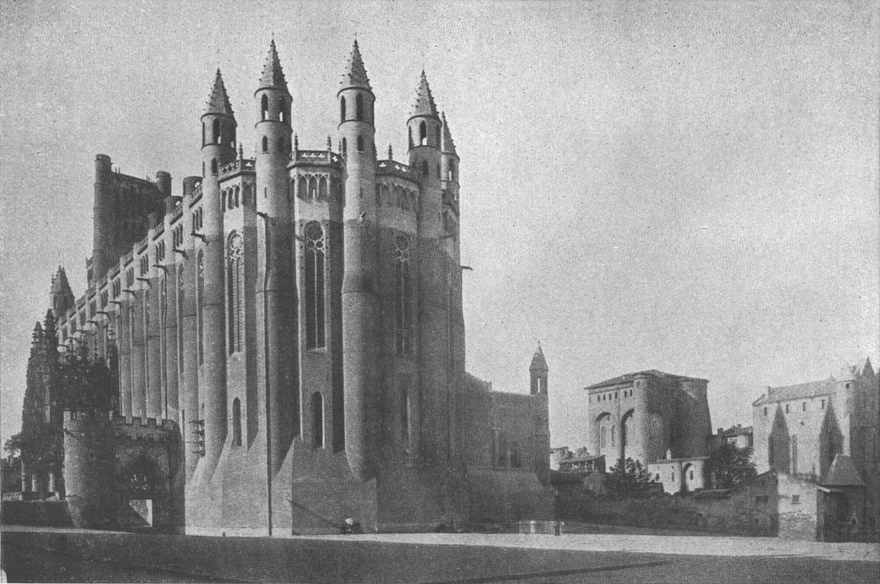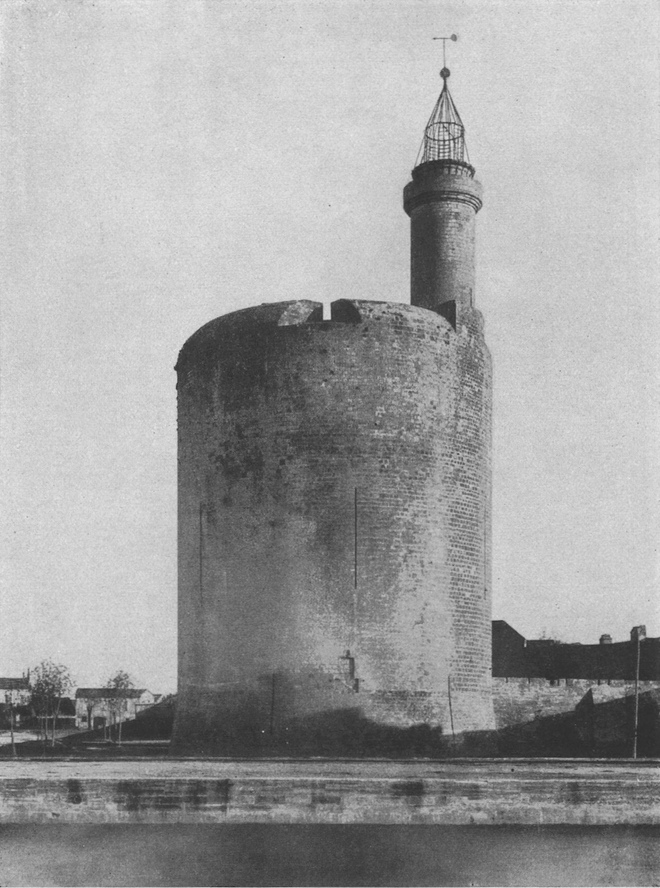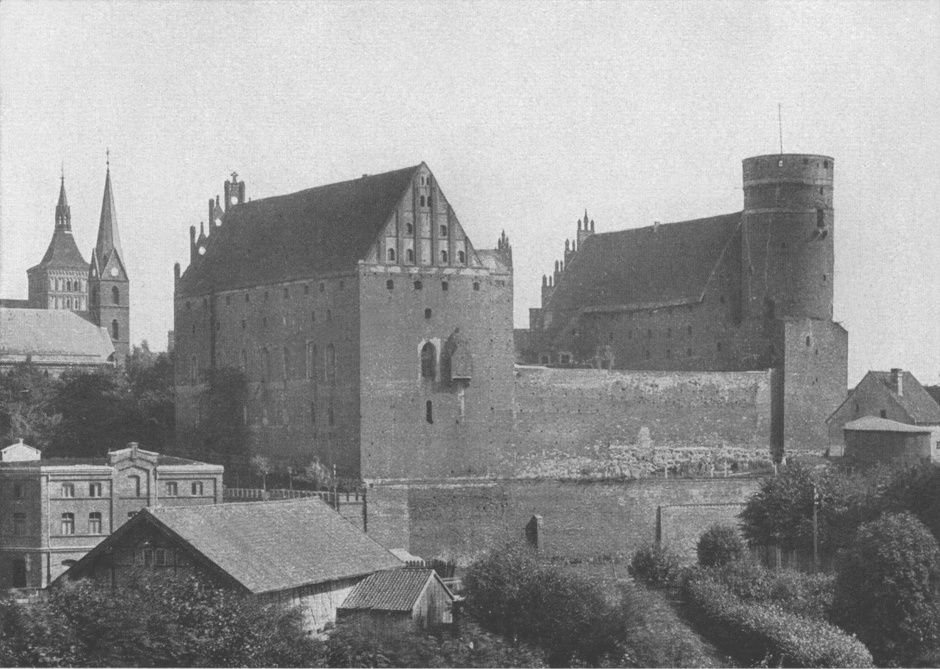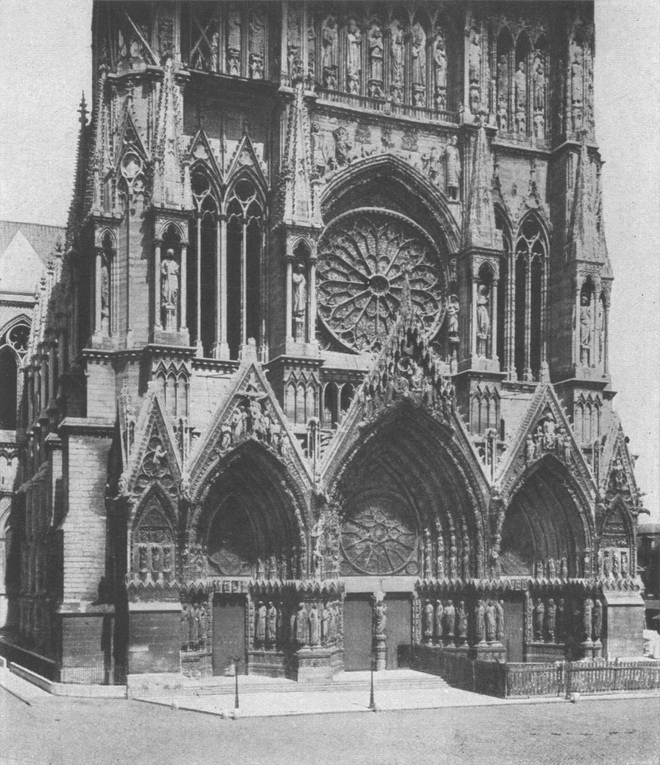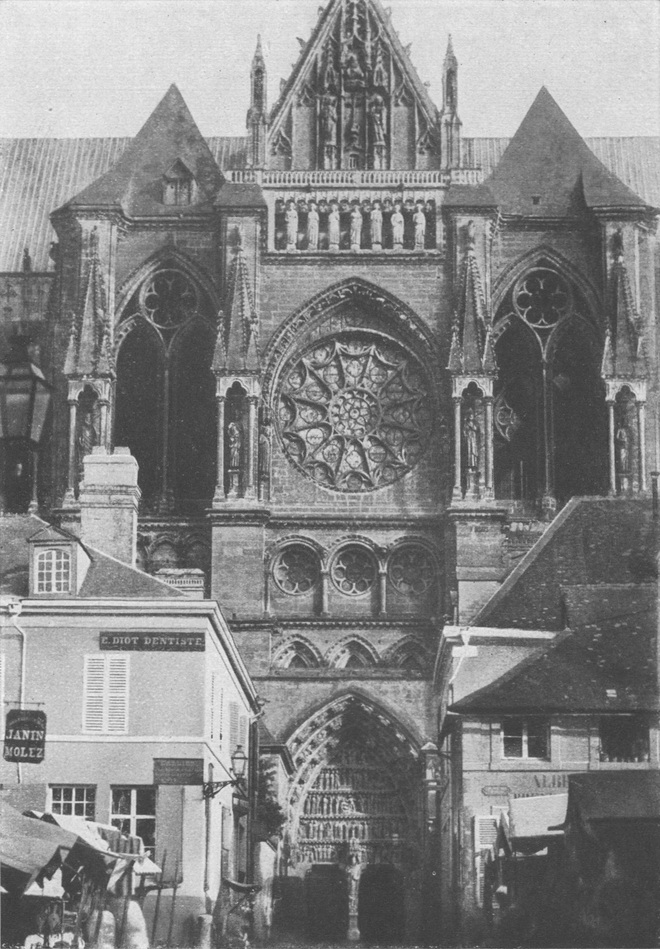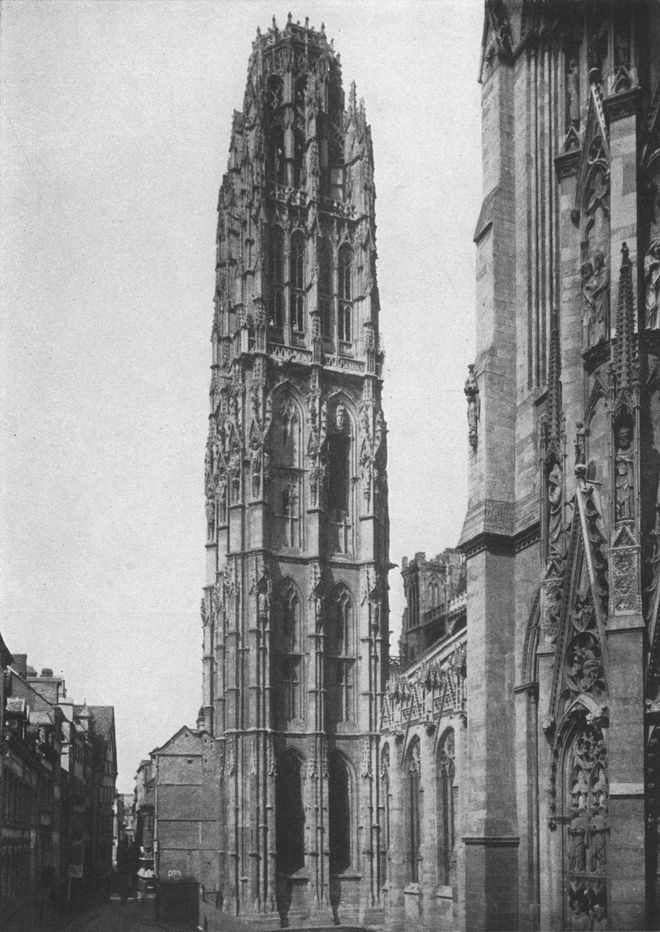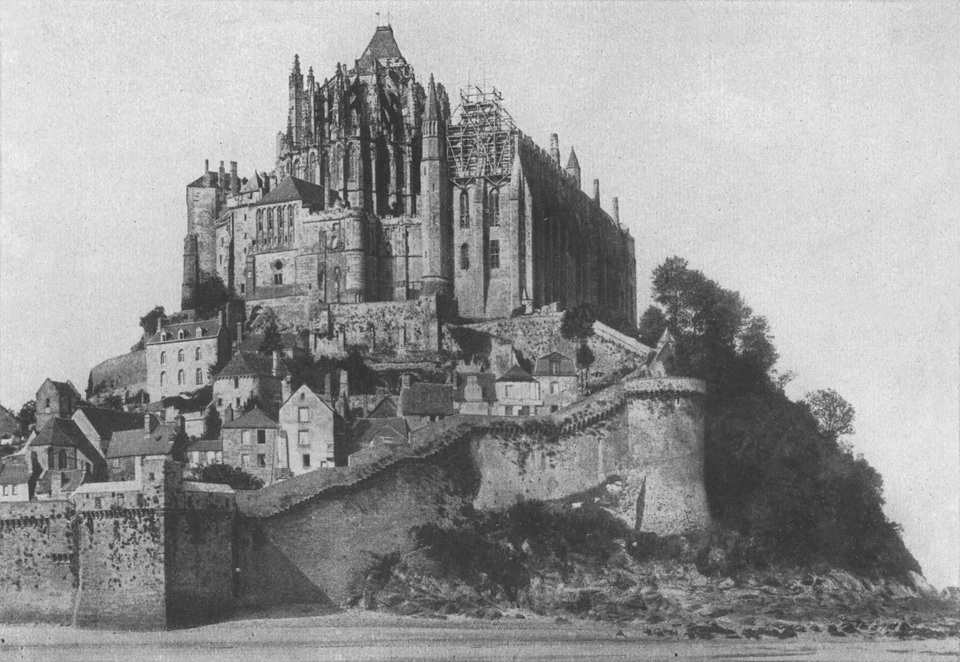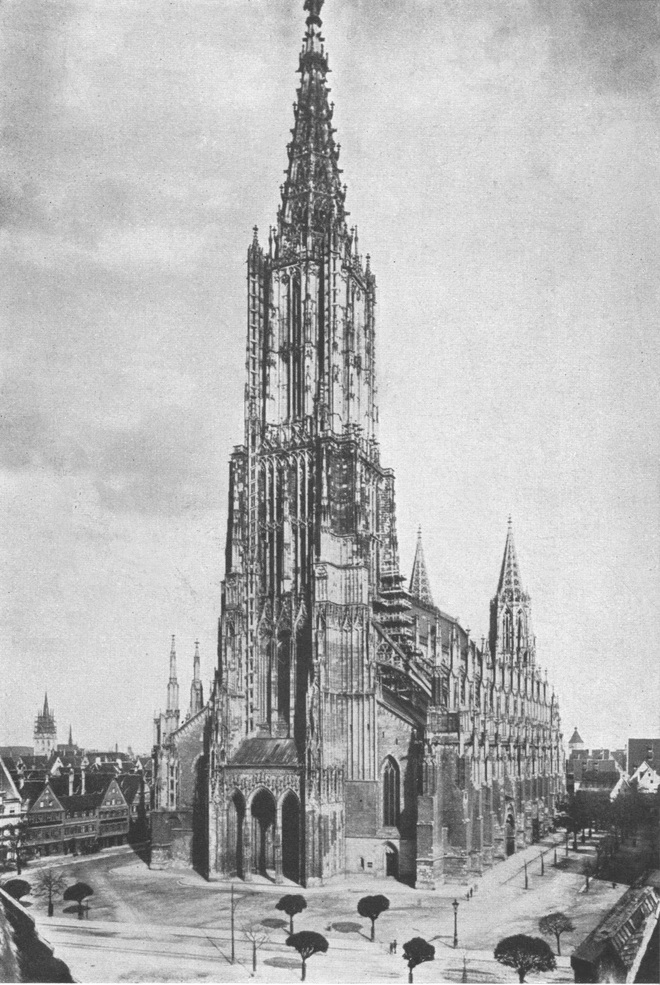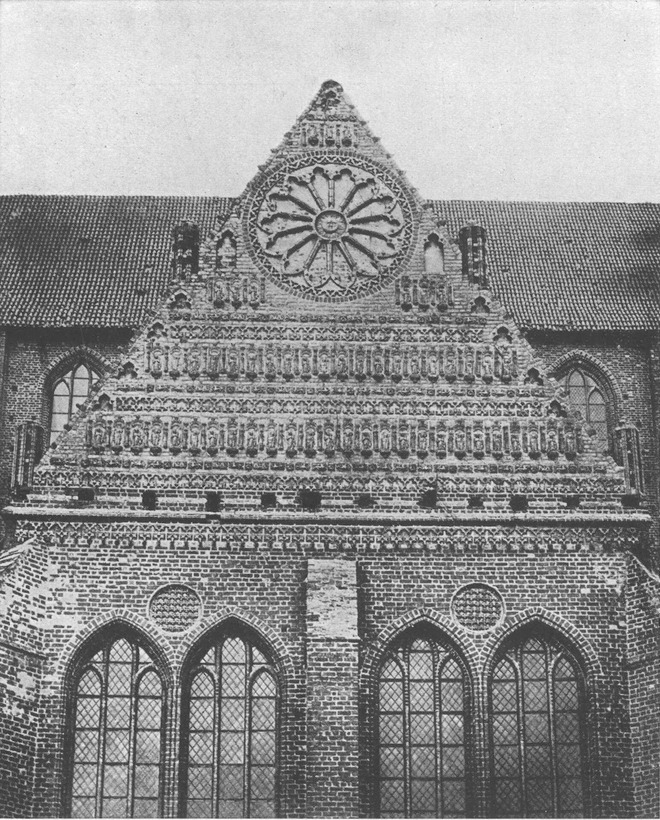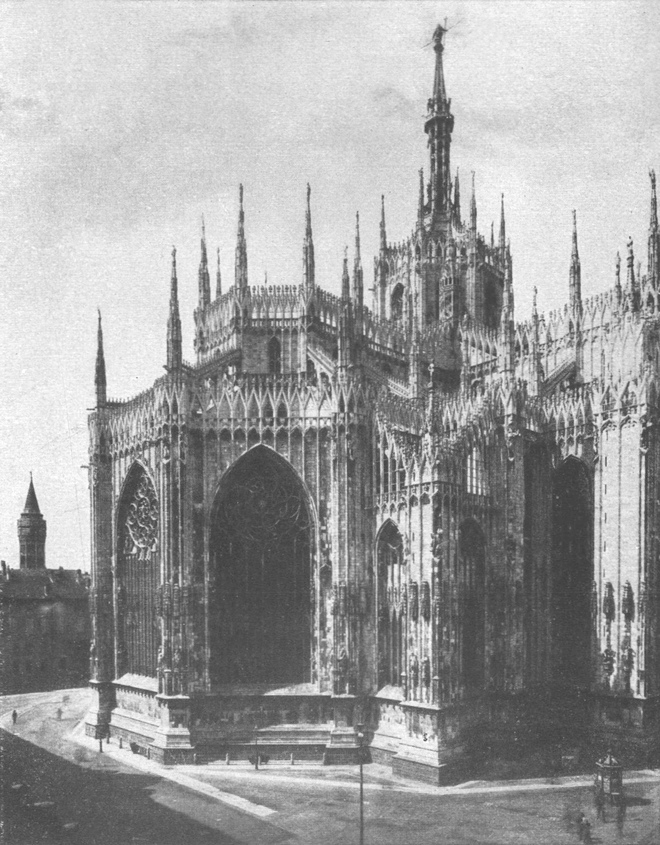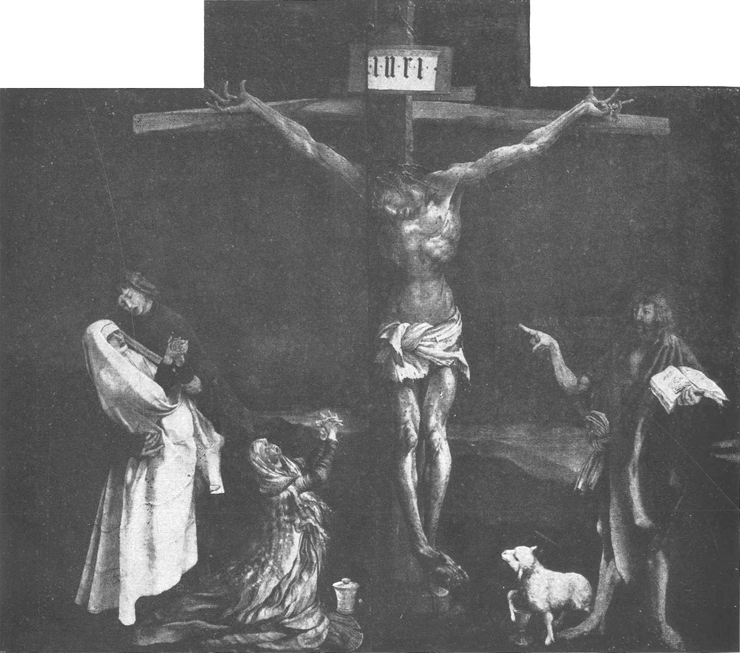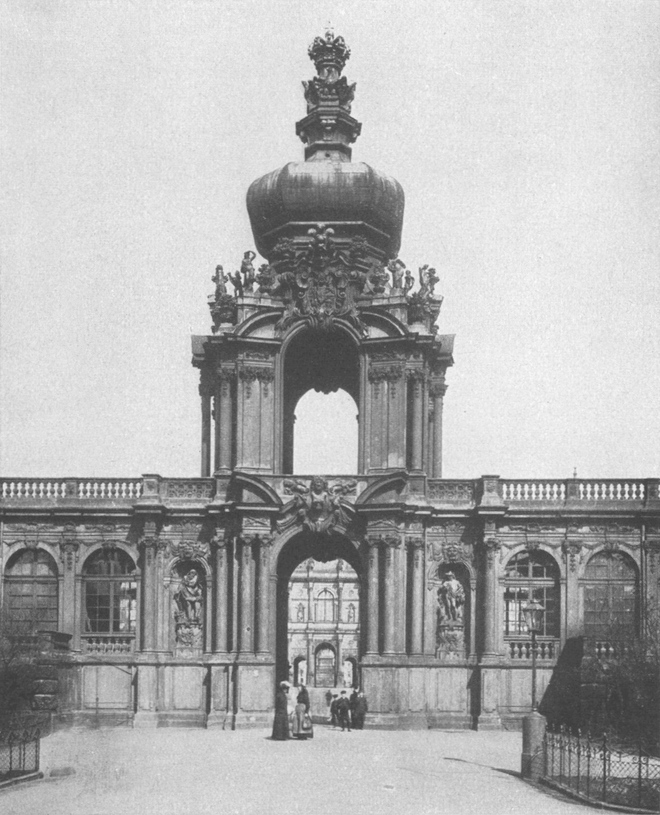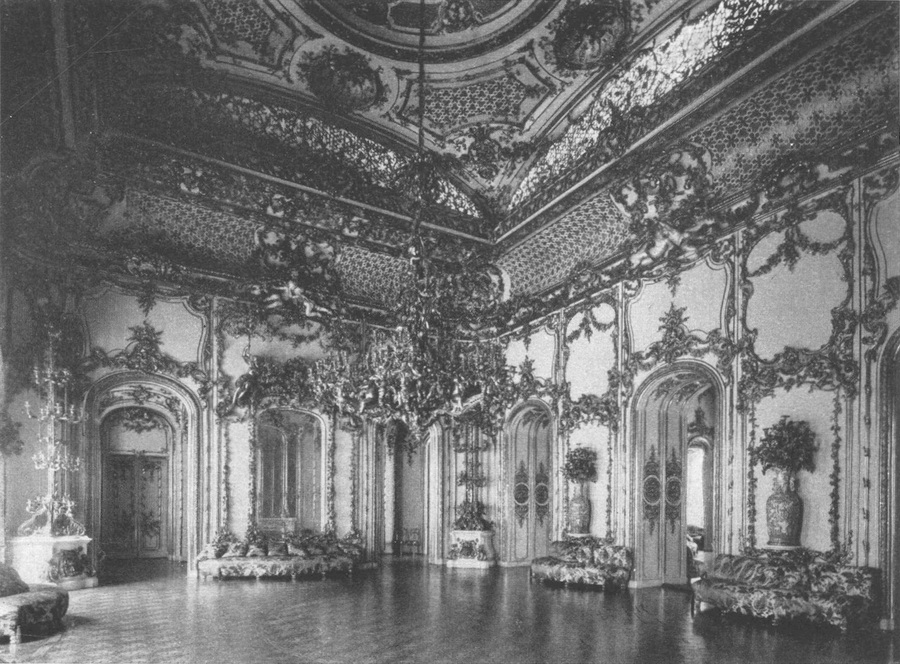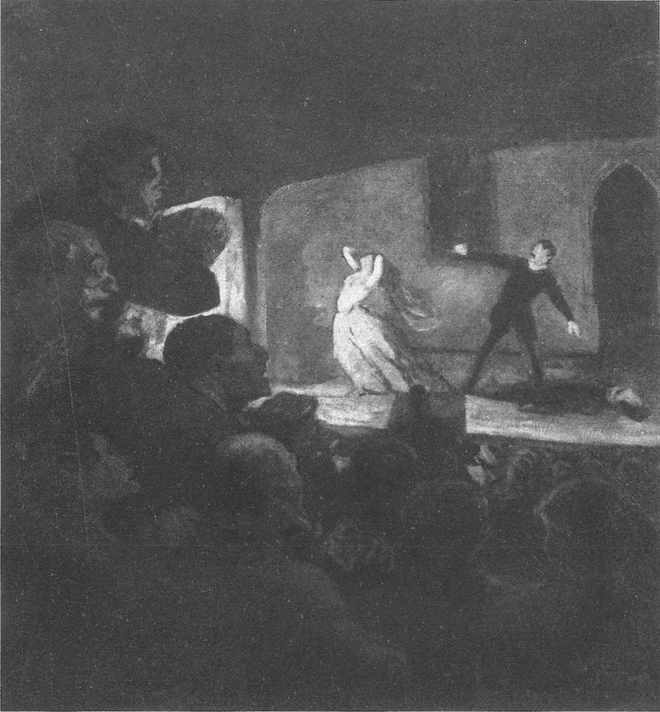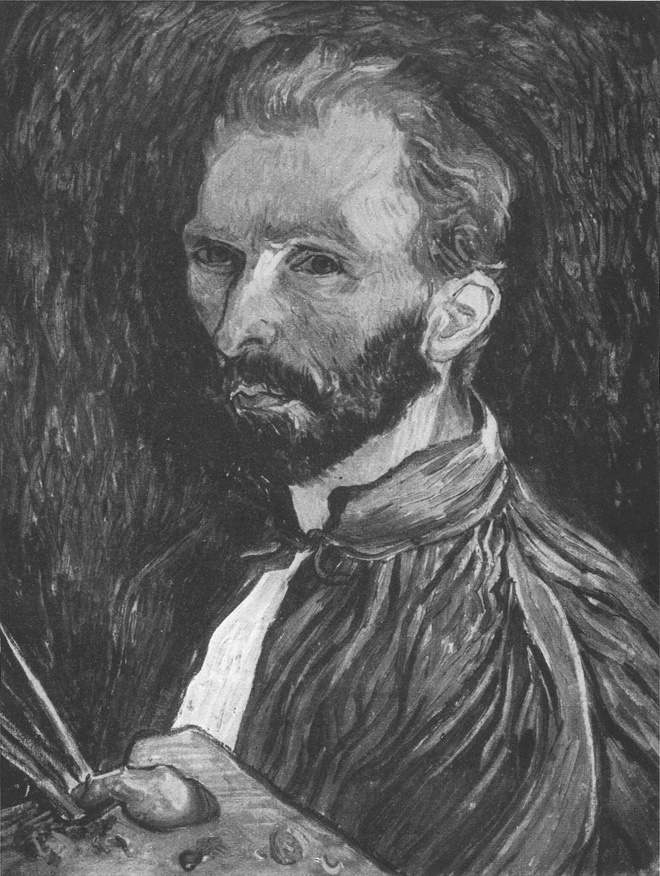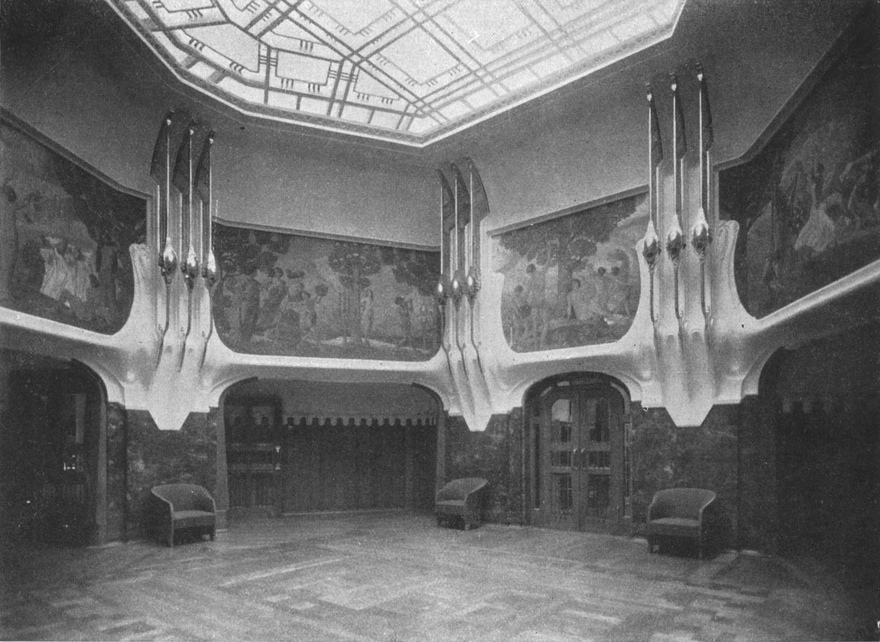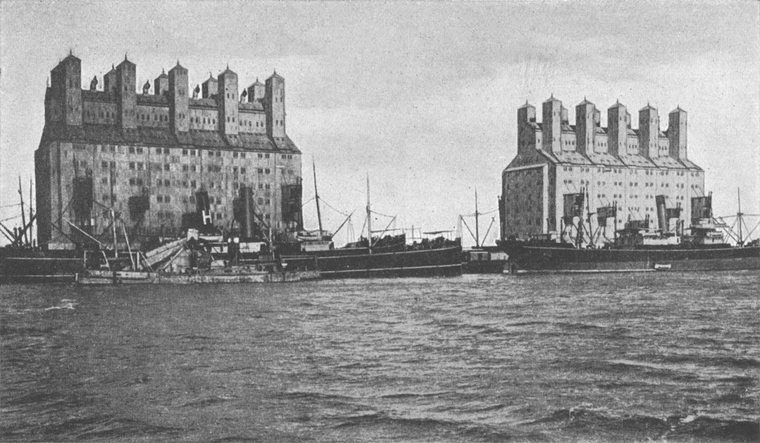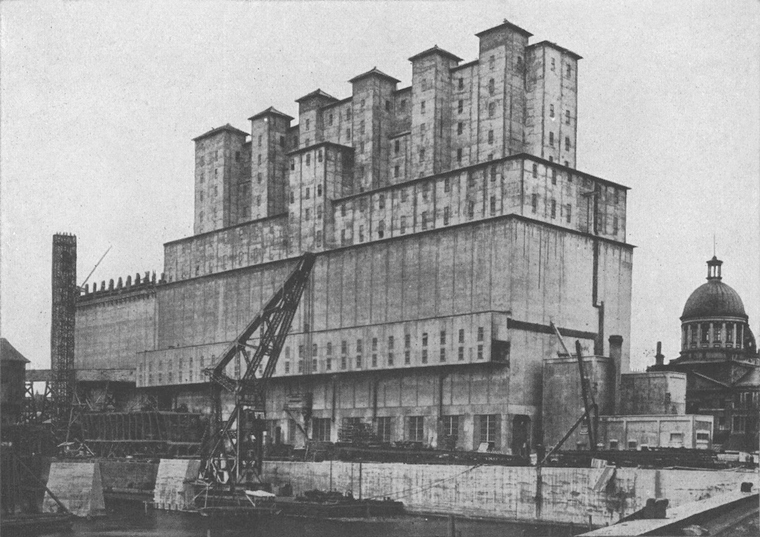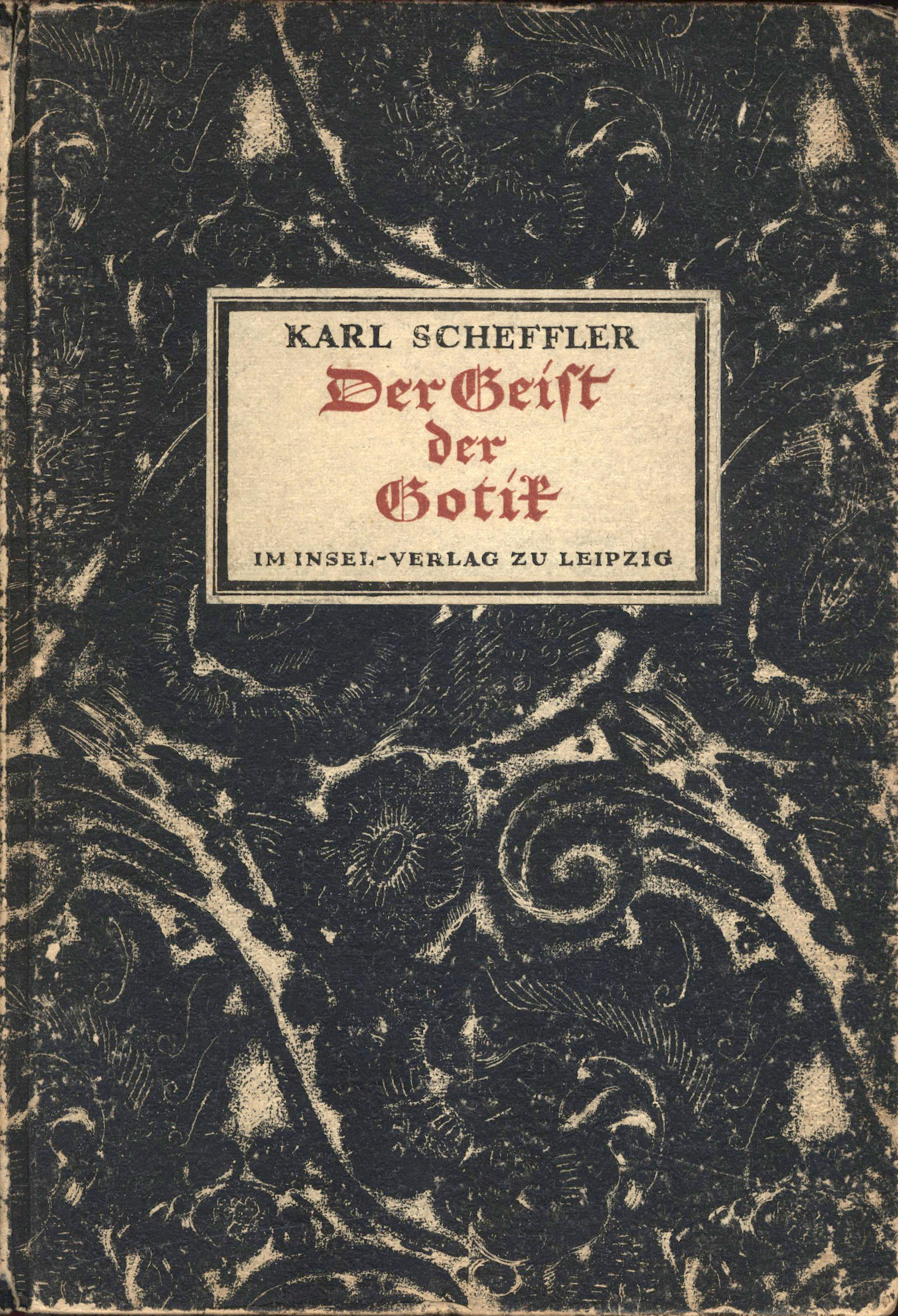
Title: Der Geist der Gotik
Author: Karl Scheffler
Release date: September 9, 2023 [eBook #71602]
Language: German
Original publication: Leipzig: Insel-Verlag
Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1917 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Die Fußnoten wurden an das Ende des Texts verschoben.
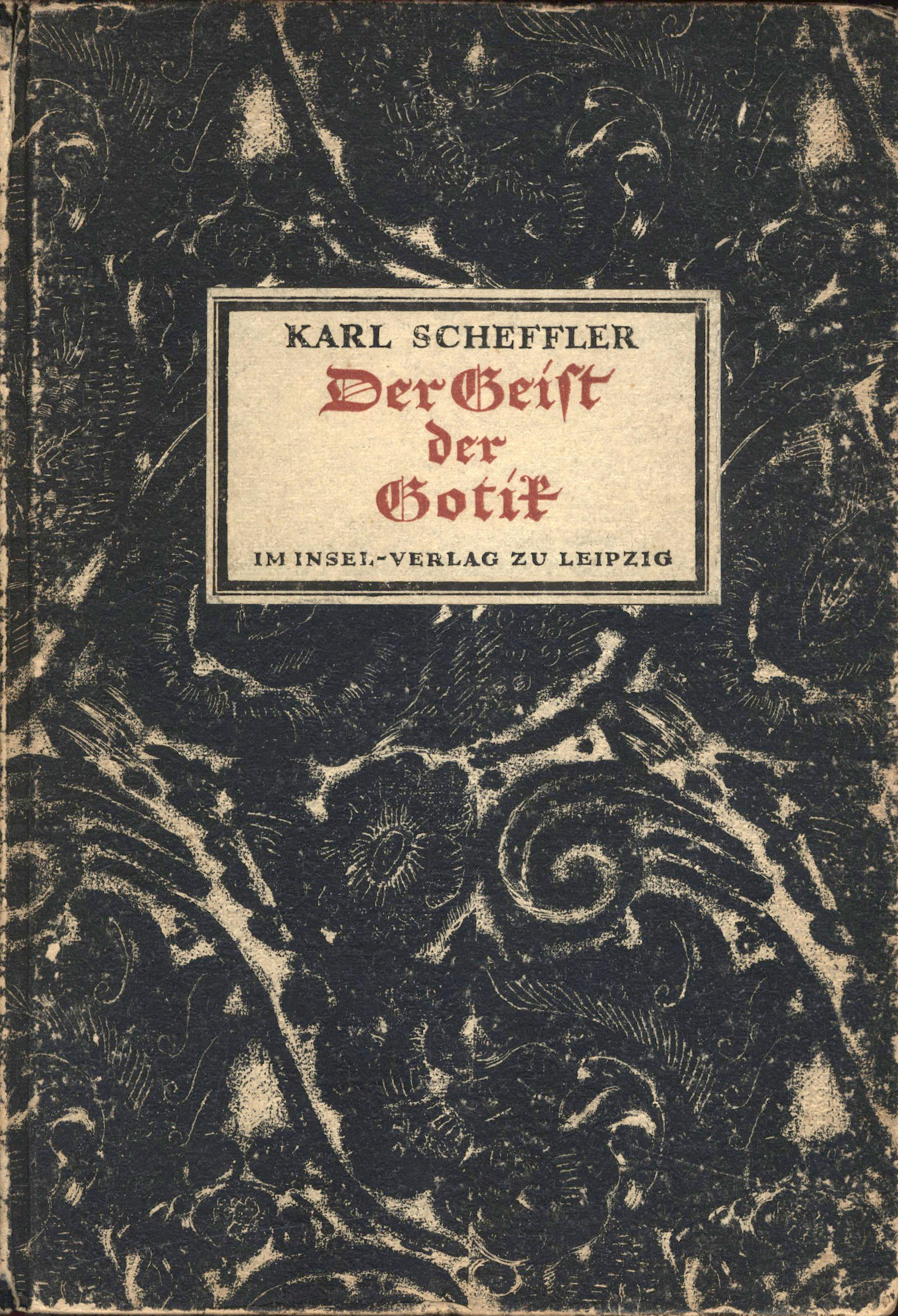

Von
Karl Scheffler
Mit 107 Abbildungen
Im Insel-Verlag zu Leipzig
1917

[S. 5]
Die Gedanken, die auf den folgenden Seiten ausgesprochen sind, haben mich zwei Jahrzehnte lang beschäftigt. In vielen meiner Arbeiten sind sie schon erörtert worden, ja, wer sich die Mühe gibt, danach zu suchen, findet sie in meiner ganzen Kunstauffassung. Ich habe mich entschlossen, sie mehr systematisch nun zusammenzufassen, weil die Zeit dafür günstig scheint. In den letzten Jahren haben einige unserer besten Kunsttheoretiker verwandte Anschauungen vertreten und sie — jeder in seiner Weise — zu Werkzeugen der Forschung gemacht. Und es mehren sich die Anzeichen, daß in der Kunstbetrachtung überhaupt ein grundsätzlicher Wandel vor sich geht. Wenn mehrere gute Köpfe gleichzeitig auf dieselbe Idee verfallen, so ist damit bewiesen, daß es sich nicht um subjektive Spekulationen handelt, sondern um eine objektive Erkenntnis. Es mag darum nützlich sein, das Problem einmal in seinem ganzen Umfang wenigstens anzudeuten.
Zu der Wichtigkeit, die ich dem Gedanken von der Polarität der Kunst beimesse, steht das Volumen dieses Buches freilich in keinem Verhältnis. Ich benutze die Gelegenheit, das Bekenntnis abzulegen, daß ich dieser Arbeit über den „Geist der Gotik“ gern viele Jahre meines Lebens gewidmet hätte, daß ich sie am liebsten erweitern möchte zu einem umfangreichen, auf genauen Spezialforschungen und vielen Reiseerlebnissen beruhenden, von einem reichen wissenschaftlichen Abbildungsmaterial erläuterten Werk. Die Erfüllung dieses Wunsches ist mir[S. 6] dauernd versagt. Notgedrungen begnüge ich mich, das schöne Problem aphoristisch zu behandeln und intuitiv gewonnene Resultate vorzulegen, ohne sie im einzelnen auch empirisch zu beweisen. Ich bin mir bewußt, daß dieses nicht eigentlich ein Buch ist, sondern nur etwas wie eine Einleitung zu dem Werk, das mir vorschwebt. Es ist nur eine Disposition; jeder kleine Abschnitt könnte zu einem ausführlichen Band erweitert werden.
Die Abbildungen sollen dem allgemein Gesagten als einige konkrete Beispiele zur Seite stehen. Manches hätte charakteristischer gewählt werden können, wenn alle gewünschten photographischen Vorlagen in der Kriegszeit hätten beschafft werden können. Um so dankbarer bin ich denen, die mir geholfen haben, dieses Resultat wenigstens zu erzielen. Für einige schwer erreichbare Vorlagen bin ich vor allem zu Dank verpflichtet den Herren Otto Bartning, Professor Peter Behrens, Reg.-Baumeister Ernst Boerschmann, Prof. Dr. Heinr. Bulle, Dr. Curt Glaser, Geheimrat Dr. Peter Jessen, Karl Robert Langewiesche, Hans von Müller, Stadtbaurat Prof. Hans Poelzig, Dr. Emil Waldmann, Frau Hedwig Fechheimer und den Verlagen Bruno Cassirer, Georg Hirth, Julius Hoffmann, Wilhelm Meyer-Ilschen und E. A. Seemann.
[S. 7]
Nach einem Ausspruch Goethes deutet alles Theoretisieren auf ein Stocken oder Nachlassen der schöpferischen Kräfte. Dieses Wort hat die Kraft eines Lehrsatzes und gilt ebensowohl für die Völker wie für die Individuen. Aus ihm allein könnte man schon schließen, wenn nicht andere Anzeichen noch in Fülle vorhanden wären, daß es kritische Jahre für die schöpferischen Kräfte der Kunst gewesen sein müssen, als jene groß gedachten Theorien aufkamen, die nun schon einhundertundfünfzig Jahre lang das geistige Leben Europas beherrschen und deren Schöpfer in Deutschland so große Geister wie Winckelmann, Lessing und Goethe gewesen sind. Die Theorien sind in dem Augenblick aufgetreten, als in den Künsten mit den Formen des Barock und Rokoko die ursprüngliche Gestaltungskraft abklang und als mit dem Klassizismus eine kritisch abgeleitete Kunst, eine Bildungskunst, heraufkam. Auch jetzt war die Theorie, wie edel die Gedanken und Forderungen, wie genial die Vertreter immer sein mochten, ein Notprodukt; ihre Verkünder standen im Dienste einer Kultursehnsucht, sie fühlten sich — selbst schöpferische Geister — unbefriedigt von der Zeit und wollten eine allgemeine Vollkommenheit erzwingen. Wer die Kunsttheorien von Männern wie Lessing oder Goethe kritisiert, muß betonen, daß sie und viele ihrer Genossen als Persönlichkeiten und Begabungen viel mehr waren als Theoretiker — selbst dann noch, wenn man von ihren poetischen Arbeiten absieht. So strittig ihre Kunstlehren sind, so groß stehen ihre kunsttheoretischen[S. 8] Schriften doch da als Denkmale eines klassischen Schreibstils und einer vorbildlichen Methode, Gedankenfolgen mit architektonischer Klarheit zu entwickeln. Diese Männer werden nicht kleiner, weil sie in einem Punkte geirrt haben, denn ihr Irrtum war der einer ganzen Zeit, er war eine notwendige Folge des „Stockens oder Nachlassens der schöpferischen Kräfte“ in den bildenden Künsten. Heute, wo diese Kräfte sich wieder regen, würden so lebendige Geister ganz woanders stehen. Lessing hätte in unsern Tagen wahrscheinlich mit seiner zielsicheren Logik einen Anti-Laokoon geschrieben und würde orthodoxe Anhänger der Laokoonlehre mit eben jenem heiteren Witz verfolgen, der seinerzeit die Herren Lange und Goeze getroffen hat. Und Goethe würde vielleicht den herrlichen Instinkten seiner Jugend glauben, würde mehr seiner eingeborenen gotischen Natur folgen, die den „Faust“ hervorgebracht hat, und nicht einem abgeleiteten klassizistischen Bildungsideal so unbedingt vertrauen.
Die Gefahr der von unsern Klassikern meisterhaft formulierten Kunsttheorien, die den Deutschen noch jetzt heilig sind, besteht darin, daß diese Lehren nur die Hälfte der menschlichen Kunstkraft gelten lassen. Die Kunst ist von diesen großen Begriffsreinigern nicht als eine Ganzheit mit zwei Polen erfaßt und dargestellt worden. Sie lebten auf der einen Hemisphäre der Kunst und vergnügten sich dort an ihren Spekulationen; die andere Halbkugel blieb für sie im Dämmer, und sie sprachen davon mit einem gewissen Schauder. Keiner glaubte, daß auch diese andere Welt einmal im Mittagslicht daliegen könne. Und doch war unter den Gesetzgebern wenigstens einer,[S. 9] der vor allen andern berufen gewesen wäre, eine neue Lehre von dem Zusammenhang aller bildenden Kräfte zu geben: Goethe. Während auf ihn mehr oder weniger alle Lehren zurückweisen, die die Natur als ein unzerstörbares Ganzes nehmen, während er in der Natur an Polarität und Stetigkeit, an Metamorphosen und an feste Gesetze des Formwerdens glaubte, hat er die Kunst — die doch eine zweite Natur, eine Natur auf dem Wege über den menschlichen Willen und die menschliche Erkenntniskraft ist — nicht so umfassend gesehen. Vielleicht weil er Künstler war und sich als solcher für ein bestimmtes Klima entscheiden mußte. An die Formen der Kunst ist er kritisch, ausscheidend herangetreten, hat sich für eine bestimmte Formenwelt begeistert und eine andere verurteilt. Überzeugt, durchaus objektiv vorzugehen, hat er — und mit ihm seine ganze Zeit — tendenzvoll gewertet. Und so ist der Begriff zur Herrschaft gelangt. Es war das Unglück jener Zeit, daß die Theorie nicht einer lebendigen Kunst folgte, sondern eine neue Kunst schaffen wollte, daß sie sich über den Künstler stellte, anstatt neben und unter ihn. Auch waren die großen Werke der Vergangenheit, die den Theoretikern als Muster galten, nur unvollkommen aus Kopien und Nachahmungen bekannt; die bedeutendsten Beispiele waren noch nicht gefunden. Es war fast unmöglich, von konkreten Vorbildern aus ein wünschenswertes Ganzes zu denken. Im Gegenteil: von einem für wünschenswert gehaltenen Ganzen aus wurden Forderungen für alles einzelne festgestellt. Und dieses eben ist der Weg des Begriffes. Nichts ist dem Denken über Kunst gefährlicher als[S. 10] Mangel an Anschauungsstoff und Herrschaft des Begriffs. Denn jeder Begriff, so grenzenlos er scheinen mag, ist hart begrenzt und stößt immer irgendwo mißtönend mit der Unendlichkeit des Lebens zusammen. Wogegen in jeder sinnlich geborenen Empfindung immer das ganze Lebensgefühl enthalten ist, etwa so, wie in jedem Naturausschnitt die ganze Natur zu sein scheint. Dieses ist das große Geheimnis des reinen Gefühls: daß im Augenblick das Ewige, im Beschränkten das Unbegrenzte, im Zufälligen das Gesetzmäßige aufglänzen. Nur wer die Kunst aus der Erfahrung der sinnlichen Empfindungen denkt, hat sie in ihrer Totalität; wer sie begrifflich meistern will, besitzt sie immer nur in Teilen. Darum haben die schaffenden Künstler, in all ihrer Einseitigkeit, ein so fruchtbares Verhältnis zur Kunst. Sie wählen, gruppieren und werten aus dem Instinkt, ihre Gedanken werden von der leidenschaftlichen Liebe geboren, während sich beim Theoretiker nicht selten die Liebe erst am Gedanken entzündet.
Als Kind eines genialisch gesteigerten Denkens über die Kunst ist nun vor anderthalb Jahrhunderten eine Idee hervorgetreten, die freilich etwas Blendendes hat und die darum auch heute noch fast unumschränkt herrscht. Sie spricht sich aus in dem Lehrsatz, der Endzweck der Künste sei „das Schöne“, und die Wirkung der Künste auf das menschliche Gemüt müsse ein Vergnügen sein. Lessing sagt im „Laokoon“, daß bei den Alten die Schönheit das höchste Gesetz der bildenden Künste gewesen wäre, und daß darum alles andere, auch von uns, der Schönheit untergeordnet werden müsse. Diesem Lehrsatz ist die Frage entgegenzustellen:[S. 11] Was ist Schönheit? Ist Schönheit etwas ein für allemal Feststehendes? Fragt man die Kunstgeschichte um Rat, so zeigt es sich bald, daß die Schönheit, wie unsere Klassiker sie verstanden, nicht das Endziel der Künste sein kann, sondern daß sie eine Begleiterscheinung ist, ähnlich etwa wie die Wohlgestalt des menschlichen Körpers nicht der Zweck, sondern eine von selbst sich ergebende Eigenschaft der organisierenden Natur ist.
Gäbe es eine absolute Schönheit in der Kunst und dürfte folgerichtig nur sie gelten, so wäre alles andere neben ihr niederen Grades. Das haben unsere Theoretiker ja auch behauptet. Man ist sogar so weit gegangen, zu sagen, diese Schönheit wäre nur einmal einem auserwählten kleinen Volke, den Griechen, gelungen, und die Nachgeborenen könnten nichts Besseres tun, als sich nach ihnen richten. Das kommt aber einer Bankerotterklärung der Menschheit gleich. Es ist unmöglich, das Wesen der Kunst von der Schönheit aus zu bestimmen. Der junge Goethe war dem Zentrum des Problems näher, als er, hingerissen von einem Erlebnis des Auges, vor dem Straßburger Münster stand und das Wort fand: „Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist, und doch so wahre, große Kunst ja oft wahrer und größer, als die schöne selbst.“ Mit diesem Wort ist das Wesen der Kunst wie mit einer einzigen Linie umschrieben. Der Wille der Kunst ist es, bildend zu sein und ein Inneres so auszudrücken, daß es ein Äußeres wird. Der Ausdruck eines inneren Zustandes, das ist das Entscheidende. Die Schönheit umfaßt nur die Hälfte, sie zielt auf den Genuß, sie[S. 12] befriedigt Glückseligkeitsbedürfnisse und das Verlangen nach ruhiger, heiterer Harmonie. Das Glück aber ist in der Kunst ebensowenig das Höchste wie im Leben. Um ein Wort Lessings zu variieren: auch in der Kunst ist das Streben nach Glück und Schönheit mehr als der Besitz von beiden. Der Welt des Kunstgefühls gehören ebensowohl die Empfindungen des Schreckens, die Dissonanzen des Charakteristischen, die Monumentalität des Erhabenen an. Auch die Formen des Willens, die das Groteske erzeugen, gehören zur Kunst; denn die Kunst ist vor allem ein Akt des Willens und darum ihrer Natur nach elementar. Auch sie setzt vor die Form das Chaos, vor die Harmonie das Übermaß und die Urkraft vor die Schönheit. Die Kunst entsteht im kleinen nicht anders, wie die Welt im großen entstanden ist. Wie die uns heute umgebende Landschaft kaum etwas gemein hat mit der von der menschlichen Hand noch unberührten Landschaft, wie die kultivierte, in soziale Rhythmen gebrachte Landschaft etwas anderes ist als die vorgeschichtliche, aus Gottes Hand hervorgegangene, und wie die Schönheit der vermenschlichten Landschaft nicht höher gewertet werden darf als die Gewalt der ursprünglichen, so darf auch eine klassizistisch geglättete und veredelte, so darf auch die „schöne“ Kunst nicht absichtsvoll der ursprünglichen Kunst als etwas Höheres entgegengestellt werden. Es darf nicht heißen: dieses ist richtig und jenes ist falsch, sondern es muß heißen: die Kunst geht lebendig in Metamorphosen durch die Zeiten dahin, sie kennt nicht „Ziele“, sie kennt nur Bewegung, und auch für sie ist der Weg das Ziel. Wie kein einzelner Sterblicher die ganze Wahrheit hat, wie die[S. 13] Wahrheit vielmehr unter alle ausgeteilt ist, so ist auch die Kunst als Ganzes nie im Besitz eines einzelnen Volkes oder einer bestimmten Zeit. Alle Stile zusammen erst sind die Kunst.
Aus der Lehre, das Endziel der Kunst sei die Schönheit, hat sich folgerichtig die Verkündigung eines Ideals ergeben. Nun hat aber jedes Ideal etwas Autokratisches, etwas Ausschließendes. Es duldet nicht seinesgleichen neben sich, es kann seinesgleichen gar nicht geben, wie die Pyramide nur eine Spitze haben kann. Daneben ist in jedem Ideal etwas Einschmeichelndes und Betörendes. Es pflegt den Wahn, es gäbe im Leben und in der Kunst etwas Absolutes, wo doch alles Sterbliche und von Sterblichen Geschaffene irgendwie bedingt sein muß. Und indem es angeblich zum Streben nach dem Höchsten auffordert, lähmt es von vornherein die Flugkraft, weil es den Strebenden immer mehr oder weniger zur Nachahmung verdammt und ihn unselbständig macht. Nur unproduktive Menschen und Zeiten konstruieren das Ideal, sie geben sich mit seiner Hilfe eine Wichtigkeit, die sie nicht haben; naive Menschen, willenskräftige Völker tragen ihre Ziele im Instinkt, niemals aber drücken sie sie begriffsmäßig mit Idealforderungen aus. Wie es denn auch bezeichnend ist, daß unsere großen Dichter wohl Idealforderungen für die bildende Kunst aufgestellt haben, nicht aber für die Kunst, worin sie selbst Meister waren, für die Poesie. In unserm Falle hat die Idee vom absoluten Ideal in der Kunst unser Volk, ja, unsere Rasse lange Zeit hindurch blind gemacht für das eigentlich Bildende der Kunst. Besonders die Deutschen haben schwer gelitten unter der Idealisierungstheorie, weil sie alle geistigen[S. 14] Dinge immer bis zur letzten Konsequenz verfolgen und gründlich sind bis zur Selbstvernichtung. Noch heute ist dem Deutschen das Wort „Idealismus“ etwas Heiliges, vor dem die Kritik anhält; das Wort bezeichnet etwas Sittliches. Und doch lehrt die Erfahrung, daß dem unbedingten Idealismus zumeist der Jüngling verfällt, der Werdende, der noch nicht mit sich selbst einig Gewordene, der Sehnsüchtige, ja Unzufriedene. Wendet man diese Erfahrung auf das Ganze an, so zeigt es sich, daß der deutsche Idealismus, der uns in unseren Augen über die anderen Völker erhebt und uns zu dem auserwählten Volke zu machen scheint, auch ein Produkt der Not ist, ein Mittel, um über eine gewisse Unfertigkeit und Unbegabtheit hinwegzukommen, und ein Zeichen dafür, daß das Wollen noch bedenklich größer ist als das Können. Der deutsche Idealismus ist das Werkzeug einer Schwäche, die Kraft werden möchte. In der Kunst hat gerade das Ideal die Deutschen seit anderthalb Jahrhunderten verhindert, das Nächste zu tun, hat ihre Blicke nach Wolkenkuckucksheim schweifen lassen, wo es besser gewesen wäre, einfach, vernünftig und besonnen vom Handwerk auszugehen. Der Idealglaube hat die Tradition verdorben. Er macht das deutsche Volk ehrwürdig, aber er hat es auch problematisch gemacht; er verleiht uns — vielleicht — „Wichtigkeit vor Gott“, aber er verhindert den Einfluß auf die Menschen. Er macht im Inneren unsicher und — in der Folge — begriffsüchtig, lehrhaft und hochmütig nach außen. So fruchtbar ein lebendiger Idealismus sein kann, wenn er still und unbewußt in der Brust des Individuums glüht und alle Taten adelt, so gefährlich ist er,[S. 15] wenn er als Begriff zum Bewußtsein erwacht und sich Herrschaft anmaßt. Geht man die Geschichte der deutschen Kunst in den letzten hundertundfünfzig Jahren durch, so zeigt es sich, daß das griechische Vollkommenheitsideal zwar eine Kunst aus dritter und vierter Hand nachhaltig gefördert hat, ja daß es sogar allgemein eine gewisse edle Afterkultur zu schaffen fähig gewesen ist; zugleich aber hat es die eigentlich schöpferischen Kräfte, die naiven Talente bedroht und sie gezwungen, sich abseits zu entwickeln, es hat die geniale Begabung einsam gemacht und in die Verbannung getrieben. Und so ist eine tiefe Kluft entstanden, die quer durch unsere Kultur geht. Dieser stolze Idealismus erweist sich als ein Danaergeschenk; er macht oft blind für die Grenzlinie, die Wahrheit von Lüge scheidet und echte Empfindung von Schwärmerei; er peitscht auf und verhindert doch zugleich das Schöpferische, er predigt das Absolute und läßt nur das Bedingte entstehen. Während die Zeit ganz unharmonisch war, ja eben weil sie es war, hat dieser Idealismus die Harmonie gepredigt. Da aus sich selber aber niemand imstande war, harmonisch zu werden, so wurde als Muster in der Kunst der griechische Stil aufgestellt.
Ein Stil! Es ist das Eigentümliche des begrifflichen Idealismus, daß er lieber von einem Stil redet, als von bestimmten Kunstwerken. Oder er macht das einzelne Kunstwerk zu einem Stilsymbol. In Deutschland sind zum Beispiel die einflußreichsten Theorien an ein Kunstwerk geknüpft worden — an die Laokoongruppe —, das keineswegs zu den guten griechischen Arbeiten gehört, in dem die spezifischen Eigenschaften des griechischen[S. 16] Formwillens nur sehr bedingt enthalten sind, ja das recht eigentlich dem Formenkreis des griechischen Barock angehört und dessen Lobpreisung von seiten Lessings, Goethes und ihrer Geistesverwandten beweist, wie sehr dieses Geschlecht, das so viel von der „edlen Einfalt und stillen Größe“ der Antike sprach, im Instinkte noch den Barockempfindungen des achtzehnten Jahrhunderts unterworfen war. Es ist damals der grundsätzliche Fehler gemacht worden, Stil und Qualität miteinander zu verwechseln; man meinte, ein Kunstwerk sei schon wegen seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stil — zum griechischen Stil — gut und besser als jedes andere. Darin liegt eine folgenschwere Verwechslung der Art mit dem Grad. Die Art kann überhaupt nicht kritisiert werden, weil sie gar nicht vom Willen abhängig ist, sie kann nur konstatiert werden, kritisieren kann man allein den Grad. Kunststile lassen sich ebensowenig kritisch vergleichen, wie man die Buche mit der Tanne qualitativ vergleichen darf. Man sagt ja auch nicht, der Granit sei besser als der Sandstein, man sagt nur, er sei härter. Der Stil eines Volkes ist der Abdruck seines Willens, seiner ganzen Eigenart, wie sie im Wind und Wetter der Geschichte geworden ist; auch der Stil ist ein Naturprodukt, er kann nicht anders sein als er ist und muß darum hingenommen werden wie ein Schicksal. Er kann nur naturgeschichtlich beurteilt werden. Es geht ebensowenig an, zu sagen, der eine Stil sei richtig und der andere sei falsch, wie man eine Sprache richtig oder falsch nennen darf. Es gibt begünstigte Kunststile, die sich in einer, viele Hemmungen beseitigenden Umwelt entwickeln, und es gibt andere, die sich mühsam[S. 17] durchringen müssen und die dabei eine mehr knorrige Formenwelt hervorgebracht haben — wie es vokalreiche und konsonantenreiche, harte und weiche, mehr wohllautende und mehr charakteristische Sprachen gibt. Man mag so weit gehen, zu sagen, daß es talentvolle und weniger begabte Völker gibt und daß dieses Mehr oder Weniger sich deutlich in den Kunststilen ausdrückt. Selbst damit aber hat das von einem begabten Stil getragene Kunstwerk nichts Entscheidendes gewonnen; das Entscheidende bleibt immer die schöpferische Persönlichkeit. Auch eine Sprache kann den Dichter fördern oder hemmen, sie kann für ihn bis zu gewissen Graden „dichten und denken“; aber sie kann nicht den Dichter machen. Ein Stil kann mit seinen Regeln bestenfalls das Schlechte verhindern, Kunstwerke aber kann er nicht spontan hervorbringen. Kurz: die Qualität des Kunstwerks ist in den wesentlichen Punkten vom Stil unabhängig, ja sie beginnt erst jenseits der Stilform. In dieser Hinsicht ist es von tiefer Bedeutung, daß die großen Kunstwerke aller Zeiten und Länder einander verwandt erscheinen. Homer ist dem Dichter des Nibelungenliedes, Sophokles ist Shakespeare näher verwandt, als Schiller es einem seiner mittelmäßigen Epigonen ist. Damit ist nicht gesagt, der Stil sei unwesentlich, denn er ist ja das Formenklima, in dem der Künstler heranwächst; nur darf die Zugehörigkeit zu bestimmten Stilformen nicht zum Kriterium des Wertes oder Unwertes gemacht werden. Und das eben ist in Deutschland, in Europa im letzten Jahrhundert geschehen. Dieser Vorgang ist um so unnatürlicher, als es eine fremde, in einer südlichen Kultur einst gewordene Formenwelt gewesen[S. 18] ist, der die Deutschen sich zugewandt, die sie als Vollkommenheitsideal verkündet haben. Soll schon ein Stilideal aufgestellt werden, so liegt es doch am nächsten, die im eigenen Lande organisch gewachsenen Kunstformen als vorbildlich zu bezeichnen. Der auf germanische Initiative zurückzuführende gotische Stil aber ist von den Gesetzgebern unserer Ästhetik geradezu verfemt worden. Als unsere Literatur auf ihrer Höhe stand, wurde den bildenden Künsten von den Schöpfern einer klassischen deutschen Schriftsprache eine fremde Formensprache gezeigt, mit der Forderung, diese müsse das den Deutschen eigentümliche Idiom werden. So war es, wie gesagt, in ganz Europa. Aber die anderen Nationen haben verstanden, das Griechische mehr zu französieren, zu anglisieren, zu italienisieren; wir allein sind so „objektiv“ gewesen, daß wir nur schüchtern eine Verdeutschung des Griechischen gewagt haben. Wir haben geglaubt, glauben es wohl noch heute, es gäbe einen Normalstil.
Wohin diese Meinung geführt hat, das liegt vor aller Augen: sie hat eine Epigonenkunst gezeugt. Eine Epigonenkunst, die als Bildungsresultat bewundernswürdig ist, die bei alledem aber wie ein Laboratoriumserzeugnis erscheint. Aus den Theorien ist eine Kunst hervorgegangen, die lehr- und lernbar ist, eine gelehrte Kunst, kurz: die Akademie. Das Streben nach der absoluten Schönheit hat zu einem trüben Eklektizismus geführt. Und hat zu gleicher Zeit einen temperamentlosen Naturalismus aufkommen lassen. Denn beides, Stileklektizismus und Naturalismus, sind einander keineswegs entgegengesetzt, sie sind miteinander verwandt. In Zeiten, wo aus den Meisterwerken[S. 19] der Vergangenheit und der Fremde Einzelformen losgelöst und in anderem Zusammenhang, zu anderen Endzielen verwandt werden, wo die einst genial gebildeten Formen der Alten mit gelehrtem Wissen nachgeahmt werden, macht sich der Künstler auch von der Natur in subalterner Weise abhängig. Das griechische Ideal konnte nicht eine neue Klassik heraufbeschwören, denn diese fließt allein aus dem elementaren Willen, es hat nur den klassizistischen Stil geschaffen. Und das große Naturgefühl der Alten hat nicht das moderne Naturgefühl selbständig gemacht, sondern unfrei. Das neunzehnte Jahrhundert ist eine Epoche der stückweisen Kunst- und Naturnachahmung, der Formflauheit, der sentimentalischen Ideologie gewesen. Es haben in ihm die Künstler der mittleren Linie geherrscht, während die wahrhaft Selbständigen verfolgt und vernachlässigt worden sind. Wir haben uns gewöhnt, inmitten einer abgeleiteten Bildungskultur zu leben, als sei dieser Zustand normal. Das heute lebende Geschlecht weilt, vom ersten Tage seines Daseins ab, in einer unerfreulichen klassizistisch-naturalistischen Umwelt, entstanden aus dem Kompromiß, den der verstiegene Idealismus und das rohe Bedürfnis eines wirtschaftlich schnell erstarkten Siebzigmillionenvolkes geschlossen haben. In unseren Städten ziehen, zu seiten der geraden, breiten Straßen, in Reihen die Palazzofassaden dahin. Die ganze architektonische Formenwelt ist irgendwie gräzisiert oder italienisiert; wir haben uns in verkünstelte Verhältnisse hineingelebt, als könne es nicht anders sein.
Um so merkwürdiger ist das Erlebnis, wenn wir aus den gleichmäßigen Straßen mit den akademischen Bauformen unversehens[S. 20] einmal in alte Stadtteile geraten, in enge Gassen mit hochgegiebelten Bürgerhäusern und auf Plätze, wo mit dunklen Massen ein gotischer Dom mächtig emporsteigt. Es scheint plötzlich ein Urlaut zu erklingen, ein erschütternder Schrei des Willens. Dieses Erlebnis stellt sich, schwächer oder stärker, auch vor gewissen Werken des Barockstils oder vor den Resten romanischer Bauten ein. In allen Fällen erlebt man die Form mit einemmal anders, viel intensiver, unmittelbarer und lebendiger. Es spricht der Wille, der vor langer Zeit einst elementar in die Formen hineingetragen worden ist, und dieser Wille ergreift den Nachgeborenen und reißt ihn mit fort. Man fragt gar nicht nach Schönheit oder nach einem Formenideal; es ist genug an der starken inneren Bewegung und an dem Glück, das mit solcher Bewegung verbunden ist. Dieses Glück müssen nun aber doch auch die großen Männer gefühlt haben, denen wir die Lehre vom griechischen Kunstideal verdanken. Auch sie haben vor diesen alten Bauwerken gestanden; und daß sie nicht blind daran vorübergegangen sind, davon zeugt wenigstens der Dithyrambus des jungen Goethe vor dem Straßburger Münster. Warum hat Goethe diese herrlichen Jugendinstinkte verleugnet, warum hat er später auf alles Gotische ärgerlich gescholten und es barbarisch genannt? Wären die Führer alle mit ihren Kunstgedanken naiv vom Eindruck ausgegangen, hätten sie mehr dem Instinkt geglaubt, so würden sie den Deutschen doch einen weiten Umweg erspart haben. Daß sie sich um das Erlebnis der Anschauung nicht groß gekümmert haben, ist ein Beweis dafür, wie sehr der Verstand das Gefühl zu tyrannisieren[S. 21] vermag und welche Macht kritische Tendenzen ausüben können. Viele hundert Jahre haben die Wunderbauten der Gotik den Deutschen, den Europäern vor Augen gestanden, und sind für die Kunst doch wie nicht vorhanden gewesen; der Idealbegriff hat über sie hinweggesehen. Dann und wann hat es wohl Zeiten der Reaktion nach einem allzu einseitigen Klassizismus gegeben. Unter den Künstlern im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ist sogar eine gewisse Schwärmerei für das Gotische aufgekommen, und auch das Barock ist zeitweise wieder nachgeahmt worden. Aber es blieb in allen Fällen bei einer sentimentalischen, halb literarischen und epigonenhaften Romantik. Erst in der letzten Zeit ist ein tieferes Verständnis für das Gotische erwacht, in dem Maße, wie die Kenntnis des Anschauungsmaterials zu dem Gefühl geführt hat, daß die gotischen Kunstwerke keineswegs Gebilde mittelalterlicher Roheit oder Werke des Unvermögens sind, sondern nur der Teil einer größeren, über die ganze Erde verbreiteten Formenwelt, und daß die gotische Form jener anderen Form, die im griechischen Stil die reinste Ausprägung erfahren hat, gegenübersteht wie der Winter dem Sommer, wie der Sturm der Ruhe, daß es sich um eine Formenwelt handelt, die man schon darum nicht kritisch ablehnen kann, weil sie unter gewissen Bedingungen überall ähnlich entstanden ist und immer wieder entstehen wird. Diese Einsicht wird uns erleichtert, weil wir inzwischen von einer lebendigen Kunst belehrt worden sind und weil unmittelbar gewonnene Erfahrung ersetzt, was uns von dem persönlichen Genie Lessings oder Goethes abgeht. Wir haben, mit Zweifeln und[S. 22] Entzückungen, das Werden und Wachsen einer neuen Malerei in Europa erlebt, die der Kunst der alten Holländer kongenial ist. Wir haben gesehen, wie ein neuer Stil in der Kunst entsteht. Eine solche Lehre aber wirkt zurück auf die Kunstauffassung überhaupt. Nicht eine Theorie, sondern tausend Erfahrungen haben uns bewiesen, daß Stilfragen nicht Qualitätsfragen sind, daß jeder Stil aber eine Kraft ist, eine Kollektivkraft, und daß diese Kraft sich notwendig auf einen der beiden Pole beziehen muß, in denen die ganze Welt der Kunst hängt.
Bevor nun im folgenden von den beiden Formenwelten der Kunst, von dem Gegensatz zweier ewig wiederkehrender Stilbewegungen gesprochen wird, muß auf die Schwierigkeit hingewiesen werden, die beiden Formenkomplexe mit kurzen Worten treffend zu bezeichnen. Der Titel dieses Buches lautet „Der Geist der Gotik“. Doch ziele ich weit über die Grenzen dessen hinaus, was in der Kunstgeschichte der gotische Stil genannt wird. Dem Begriffe der Gotik ist Prähistorisches und Ägyptisches, Indisches und Barockes, Antikes und Modernes, Fernes und Nahes eingeordnet worden. Ebenso schwierig ist es, das Gegenspiel des gotischen Geistes, nämlich jene Formenwelt, die in der Kunst der alten Griechen am reinsten verkörpert worden ist, mit einem Wort zu umschreiben. Klassisch darf sie nicht heißen, weil wir uns gewöhnt haben, alles Meisterhafte so zu nennen, weil ein Werturteil mit diesem Wort verbunden ist; und klassizistisch darf man nicht sagen, weil darin ein herabsetzender Nebensinn enthalten ist. Es ist schlechterdings unmöglich, Bezeichnungen zu finden, die nicht mißzuverstehen sind; es[S. 23] möge darum bei den Worten „gotisch“ und „griechisch“ bleiben, um das ganz Allgemeine zu bezeichnen. Das, worum es sich handelt, muß aus der Fülle der Vergleiche anschaulich werden. Ist der Leser erst einmal im Besitz einer sicheren, wenn auch wortlosen Vorstellung, so kann er der Schlagworte entraten. Das Wesentliche liegt immer jenseits aller Worte. Notwendig ist nur, daß der Leser sich bei der einmal gewählten Terminologie beruhigt, daß er sich vom Wort und von dem damit verbundenen konventionellen Begriff nicht irreführen läßt und sich bei allen allgemeinen Bemerkungen konkrete Kunstwerke vor Augen hält.
[S. 24]
Während ich das erste Wort suche, um diese Ausführungen zu beginnen, muß ich des Augenblickes gedenken, als sich der Gedanke vom ewigen Dualismus der Kunst zum erstenmal deutlich in mir bildete. Es geschah, als ich eines Tages zum Fenster hinaussah und eine Schar von Tauben beobachtete, die sich auf dem Dach und den Gesimsen des gegenüberliegenden Hauses tummelten. Einige der Tauben flatterten auf, flogen im Kreise und ließen sich schwebend nieder, andere hockten auf den Gesimsen oder verfolgten sich im Paarungstrieb. Im stillen Hinsehen fiel es mir auf, daß alle Bewegungen, die rein automatisch vor sich gehen, das Emporsteigen, Fliegen, Schweben und Niedergleiten, daß alle rein körperlichen Funktionen, die unwillkürlich ausgeübt werden, angenehm und „schön“ wirken, daß dagegen Formen des Charakteristischen, ja des Grotesken entstehen, wenn die Tiere im Banne einer psychischen Regung sind, wenn sie etwa erschreckt um sich äugen, einander ängstlich fliehen oder brünstig suchen. Die beiden Gruppen von Bewegungen stellten sich meinem Auge als grundsätzlich verschieden dar. Die erste Gruppe enthält die gymnastisch glücklichen, und darum die harmonischen, die ornamentalisch schönen Formen; die zweite Gruppe umfaßt die leidvollen Formen, die sich dem Häßlichen nähern. Die Formen der ersten Gruppe schmeicheln dem Auge, die anderen haben dagegen etwas Frappierendes. Solange sich die Kräfte automatisch balancieren, stellt sich beim Betrachter ein reines ästhetisches Vergnügen ein; wenn sich der[S. 25] Wille der Tiere aber im Gehirn konzentriert und die Bewegungen psychischen Impulsen unterworfen sind, finden Ausschaltungen und partielle Lähmungen statt, die ornamentalische Schönheit ist dahin, das Bild ist dann als bedeutende Erscheinung eindrucksvoll, nicht aber als ein Reiz angenehm. Mit dieser einen Erfahrung des Auges war mir plötzlich ein Schlüssel gegeben. Die Beobachtung an sich ist nichts Besonderes, aber sie war für mich und zu jenem Zeitpunkt etwas Besonderes. Das wurde schon dadurch offenbar, weil sie von jenem Gefühl des Glücks begleitet war, das sich einstellt, wenn der Mann fühlt, wie er wächst und wie Entscheidendes in ihm vorgeht. Es mußte von der einen Erfahrung gleich auf ein Ganzes geschlossen werden: die beiden Gruppen von Bewegungen teilten mir im Augenblick die ganze Kunst, die ja nichts anderes ist als ein großes Bewegungsgleichnis, in zwei Hemisphären, deren jede ihre besonderen seelischen Voraussetzungen und eine ihr eigentümliche Formenwelt hat, in zwei Kräftegruppen, die sich bekämpft haben, solange es eine Kunstgeschichte gibt, und die sich in aller Zukunft bekämpfen werden.
Am anschaulichsten ist der Kampf dieser beiden Formenwelten in Europa ausgetragen worden. Zwei Stile haben von je in Europa geherrscht und während der Zeiten, die von geschichtlicher Erkenntnis erhellt werden, einander den Vorrang streitig gemacht, zwei primäre Stile, ursprüngliche Formenschöpfungen, die in einem grundsätzlichen Gegensatz zueinander stehen. Wenn man sie als den griechischen und gotischen Stil bezeichnet, so weiß jedermann, was gemeint ist, trotzdem die Worte ungenau[S. 26] sind. Ungenau ist das eine Wort, weil das Griechische, wie es hier verstanden wird, nicht eine Formenwelt umfaßt, die fertig dem Geiste eines einzigen Volkes entsprungen ist, und weil die griechische Form anderseits entscheidenden Anteil hat an vielen europäischen und außereuropäischen Stilwandlungen bis auf unsere Tage. Und ungenau ist auch die Bezeichnung „gotisch“, weil das Gotische im Sinne meiner Auffassung keineswegs nur ein Gebilde des nordischen Mittelalters gewesen ist, sondern irgendwie immer gegenwärtig war, wenn in Europa oder sonstwo etwas Neues mit elementarer Kraft zutage trat. Jedenfalls aber handelt es sich um zwei grundsätzlich sich unterscheidende Bildungskräfte, und jede Zeit, jedes Volk müssen eine Entscheidung darüber treffen, welcher dieser Kräfte sie sich vor allem anvertrauen wollen. Wie diese Entscheidungen getroffen worden sind, das in der Geschichte der europäischen Kunst zu verfolgen, ist von großem Reiz. Oft ist der Entschluß vom Volksinstinkt, vom Zeitgeist schnell und kühn gefaßt worden, oft auch nur zögernd und ungewiß. Wie für ewige Dauer haben sich die südlichen, die romanischen Völker der griechischen Formen bemächtigt; die nordischen Völker dagegen haben dauernd geschwankt zwischen dem Griechischen und dem Gotischen. Es gibt Mischstile und Kompromisse und höchst seltsame Metamorphosen. Alles aber weist letzten Endes doch zurück auf den einen großen Gegensatz, der in der Natur selbst begründet ist.
Die beiden Formenwelten, die mit den Worten „griechisch“ und „gotisch“ gleichnishaft bezeichnet werden, begünstigen hier vor allem den Willen zum Ausdruck und dort die Ehrfurcht vor[S. 27] dem Gesetzlichen. In der griechischen Baukunst sind alle Einzelformen auf lange, man darf sagen auf ewige Dauer gestellt. Die Säule hat etwas Endgültiges, es ist daran nicht zu viel und nicht zu wenig getan, es ist eine Formel gefunden, die an erschöpfender Knappheit nicht übertroffen werden könnte. Ebenso stellt sich das schön gegliederte Gesims als eine formale Quintessenz dar, als das Ergebnis einer bewunderungswürdigen Zusammenarbeit vieler Geschlechter und Individuen, als das Werk einer von allem störenden Subjektivismus gereinigten Phantasietätigkeit ganzer Zeiten. Eben um ihrer Endgültigkeit willen konnten diese reinen, überpersönlichen Formen so bequem übernommen, angewandt und abgewandelt werden. Auf griechische Bauformen gehen ja sowohl die Formen der römischen Baukunst wie die Formen der über ganz Europa, über die ganze Welt verbreiteten italienischen Renaissance zurück. Keiner gotischen Bauform wohnt eine solche Allgemeingültigkeit inne. Die gotischen Formen erscheinen vom Augenblick geschaffen, die Persönlichkeit hat an ihnen mehr Anteil, und eben darum können sie nicht leicht übernommen und umgebildet werden. Gegenüber der griechischen Form wirkt die gotische fast improvisiert; sie ist nicht so sehr ein Extrakt als vielmehr das Gebilde des Augenblicks. Die griechischen Säulenordnungen konnten nach bestimmten Regeln angewandt und in fast wissenschaftlicher Weise variiert werden: an den Kapitellen und am Steingebälk konnten Tausende von Sklavenhänden fortmeißeln, weil die Formen regelmäßig wiederkehren, weil sie eine unendliche Vervielfältigung geradezu bedingen. Der griechische Stil reiht gleiche[S. 28] Formen aneinander, er will die Wiederholung derselben Form, und eben darum bedarf er bei der Ausführung nicht so sehr großer, schöpferischer Persönlichkeiten als vielmehr geschickter und sorgfältiger Arbeiter. Alles in diesem Stil ist auf Gesetzmäßigkeit gestellt, es herrscht die Regel, der Kanon, das Wissen um die Wirkungen und um die überlieferbaren, meßbaren und erprobten Verhältnisse. Innerhalb der gotischen Formenwelt aber konnte dem sklavischen Arbeiter nur weniges überlassen werden. Denn dort ist eigentlich nicht eine Form genau wie die andere, jede Form erscheint spontan geschaffen und — selbst dort, wo ihr Charakter konventionell festgelegt ist — von einem subjektiven Willen durchgebildet; dadurch kommt in jede Form ein eigensinnig genialisches Eigenleben. Nicht die Wiederkehr des Gleichen ist das Prinzip der gotischen Bauweise, sondern die Abwandlung eines Formprinzips durch viele Möglichkeiten; nicht Regelmäßigkeit wird erstrebt, sondern Mächtigkeit oder Freiheit und Fülle. Das Wesentliche in der gotischen Form sind nicht Gesetz und Regel, sondern es ist die unmittelbare Ausdruckskraft. Es wird nicht ein endgültiges, ein sozusagen destilliertes Verhältnisleben der Teile erstrebt, es wird nicht ein Kanon der reinen Proportionen geschaffen, sondern es muß das wirkungsvolle Verhältnisleben in der gotischen Kunst vom Künstler eigentlich jedesmal von neuem intuitiv gegriffen werden. Dadurch wird die Wirkung sehr unmittelbar, doch haftet ihr auch viel Einmaliges, ja etwas Einzigartiges an. Um einen griechischen Tempel, einen römischen Palast, eine italienische Renaissancekirche gut zu bauen, genügten unter Umständen die[S. 29] Tradition, die Erfahrung, das Wissen, die Kenntnis des Kanons und der Praxis; um aber einen gotischen Dom wirkungsvoll zu türmen, dazu gehörte in erster Linie schöpferische Kühnheit. Die griechisch-italienische Bauweise könnte gegebenenfalls ohne geniale Begabungen bestehen und doch eine gewisse Höhe halten, die gotische Bauweise aber muß ohne ursprüngliche Genialität gleich maniriert und konventionell werden. Eben darum setzt die gotische Form selbständigere Arbeiter und willenskräftigere Persönlichkeiten voraus. Nur eine an Individualitäten, an Temperamenten reiche Zeit ist reiner gotischer Formenschöpfungen fähig. Schon aus diesem Grunde bleibt der gotischen Form die unendliche Ausdehnungsmöglichkeit und die allgemeine Anwendbarkeit versagt. Denn Persönlichkeiten und Temperamente sind nicht zu allen Zeiten da, sorgfältige, genaue Arbeiter aber sind stets zu erziehen.
Auch in der Natur steht einem Prinzip der langen Dauer überall ein Prinzip des schnellen Antriebs gegenüber. Die Natur will ebenfalls die ewige Wiederkehr des Gleichen oder doch des Ähnlichen; aber sie will auch immer ein Neues. Sie will zugleich die Regel und den Überschwang. Paradox könnte man sagen, die Natur sei ebensowohl griechisch wie gotisch. Wie aber in der Natur der orgiastischen Fülle der Schöpfungskraft, dem Übermaß des Triebhaften die regelnde Ordnung, die eherne Notwendigkeit beschränkend und formgebend gegenübersteht, und wie der Elementardrang des Schöpfungswillens wiederum dafür sorgt, daß das heilig ordnende Gesetz niemals formalistisch erstarrt, wie ein ewiger Kampf ist zwischen Unruhe und[S. 30] Ruhe, zwischen Rausch und Besonnenheit, zwischen Ungeduld und Geduld, und wie das Resultat dieses Kampfes ohne Ende eine Welt ist, die immer wieder frisch und herrlich ist, als sei sie eben aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen — so wirken auch in der Kunst aufeinander Maß und Übermaß, Ruhe und Unruhe, Geduld und Ungeduld, so geht auch dort aus diesem ewigen Kampf erst das Bedeutende ursprünglich und mannigfaltig hervor. In der Kunst wirkt, wie in der Natur, eine zentrifugale und eine zentripetale Kraft; in der Kunst wie in der Natur heißen die beiden entscheidenden Gewalten Antrieb und Hemmung, Freiheit und Gesetz. Der künstlerische Bildungstrieb des Menschen hat sich dualistisch spalten müssen, um im Höchsten schöpferisch werden zu können. Etwa so, wie die Natur den Menschen in Mann und Weib zerlegt hat, um sich zu erhalten und fortzupflanzen.
In diesem Sinne ist die gotische Form die männliche, sie ist die zeugende und anregende Form. Sie ist die Form des heroischen Affektes. Auch dort, wo sie scheinbar nüchtern vom profanen Bedürfnis ausgeht. Denn während sie rein zweckmäßig bestimmt zu sein scheint, steigert sie das Zweckmäßige unversehens zum Monumentalen. Man denke an die mittelalterliche Verteidigungsarchitektur. Es ist strenge Zweckarchitektur, ohne Zierat, ohne rein darstellende Formen, nur aus Mauern, Zinnen und Türmen gebildet. Sie sollte den Feind abhalten. Aber zugleich sollte sie ihn schrecken und einschüchtern, das heißt, sie sollte eine Wirkung auf seine Seele ausüben. Darum wurden Formen gewählt, deren Wucht voller Drohung war, die kriegerisch[S. 31] wirkten und eine Macht repräsentierten; und so geriet das Fortifikatorische wie von selbst zur düsteren Großheit und starren Unbedingtheit. Das Einfache wirkte nicht mehr nüchtern zweckhaft, sondern wie ein Symbol des Dräuenden und Wehrhaften. Diese Übersteigerung ins Symbolische aber ist einer der wesentlichen Züge alles Gotischen.
Aus dem Burgenbau, aus der Befestigungsarchitektur ging organisch der Kirchenbau hervor. Der trotzig auf Selbstbehauptung bestehende Wille erstrebte die mächtige Wirkung, aus dem groß begriffenen Bedürfnis wurde die Idee abgeleitet; diese Idee aber wurde mit der Zeit selbständig und wuchs ins Geistige, ins rein Künstlerische hinein. Die Stimmung, die den primitiven gotischen Kunstwerken anhaftet, wurde zum Motiv an sich erhoben. Um die Stimmung aber künstlerisch auszudrücken, mußte eine Formenwelt geschaffen werden, die sich aus lauter Stimmungselementen zusammensetzt. Das will sagen: aus Elementen, die neun Zehntel des Lebens, der Natur, der menschlichen Empfindung ignorieren, um dem einen Zehntel desto einseitig stärker zum Ausdruck zu verhelfen, aus Elementen, die das Objekt vergewaltigen, die alle helfen, ein einziges mächtiges Gefühl zu illustrieren und die alle erfüllt sind von der Leidenschaft, einen bestimmten Willen auszudrücken, ihn zu steigern und zu motivieren. Jede gotische Kunstform will vor allem dieses: motivieren. Sie ist nicht vom Zweck genesen, wie die griechische Form. Alle Formen der Gotik, sowohl dort, wo sie sich einfach, wuchtig und primitiv, wie auch dort, wo sie sich darstellend, reich und barock geben, weisen irgendwie immer auf[S. 32] etwas Konstruktives. Das sichtbar Konstruktive jedoch nimmt in der Baukunst die Stelle ein, die der Naturalismus in der Malerei einnimmt. Nun ist aber dieser Konstruktionsnaturalismus der Gotik nicht zu profanen Zwecken, sondern um der künstlerisch-symbolischen Wirkung, um des starken Ausdrucks willen da. In allem Gotischen ist die Frage nicht zu lösen, ob zuerst die Konstruktion oder die künstlerische Vorstellung dagewesen ist. Die Antwort ist so schwierig wie die Beantwortung der Frage, ob zuerst das Huhn oder das Ei dagewesen sei. Konstruktion und Form werden im Gotischen zugleich und eines durch das andere immer gefunden. Neuerungen, wie der Spitzbogen und das Pfeilersystem, sind erst möglich geworden, als eine mit sich selbst noch unbekannte Sehnsucht nach Mitteln ausschaute, dunkel ihr vorschwebende Wirkungen zu realisieren. Es mag mit solchen technischen Entdeckungen gehen wie mit den geographischen, die auch erst erfolgen, wenn der von Expansionstrieben genährte Instinkt zweckvoll wissenschaftlich Schiffe ausrüstet. Dieses aber ist so recht das Wesen des gotischen Geistes: ein mit sich selbst unbekanntes mächtiges Lebensgefühl in neue Kunstformen zu kleiden, urweltliche Instinkte artistisch zu rechtfertigen und aus der Notdurft des Lebens unmittelbar eine zwar naturalistisch gebrochene, aber auch geheimnisvolle Formenwelt abzuleiten. So ist es im Mittelalter gewesen, als auf der Grundlage des Zweckmäßigen und des tektonisch Mathematischen eine betörende Romantik aufblühte, ein Urwald von Form, wimmelnd von Leben und Gestalt. Der erregte Wille führte das Bedürfnis über sich selbst hinaus — bis an die Grenzen der[S. 33] Phantastik. Der Raum wurde überhöht, seine natürlichen Mauergrenzen wurden gesprengt, ein System von Pfeilern wuchs, voll eines dröhnenden Rhythmus, steil in die Höhe, das Licht selbst wurde romantisiert, indem man es durch farbige Fenster leitete, und in allen Teilen des Doms — der ein Gesamtkunstwerk der Architektur, Plastik und Malerei war — begann ein Spiel mit der Konstruktion, mit dem Zweckhaften, bis alles Materielle sich schließlich im Transzendentalen verlor. Hier wird die andere Seite des gotischen Geistes offenbar: seine Lust an der Fülle, seine romantische Schmucklust. Das Gemäuer bedeckte sich mit phantastisch reichem Zierat, mit Menschen- und Tiergestalten, mit Blättern und Blumen, mit tektonischen und malerischen Formen bunt durcheinander — scheinbar willkürlich und doch logisch geordnet nach einem Gesetz der Empfindung. Alles einzelne weist zurück auf etwas Individuelles, im dunkelsten Winkel noch betätigt sich das sehnsüchtig bildende Talent; über allem einzelnen aber steht einigend ein großer, leidenschaftlicher Kollektivwille. Alle Menschen haben irgendwie Anteil an den Wunderbauten der mittelalterlichen Gotik; aber alle bleiben sie auch anonym. Und dieses eben ist ein Charakteristikum des Geistes der Gotik überhaupt: er lebt sich in Massenkundgebungen aus; seine Ideen können zwar nur von Persönlichkeiten verwirklicht werden, aber sie schließen auch jede Persönlichkeit ein. Daher dieser bezeichnende Trieb zum Rauhen und Kolossalen einerseits und zur Fülle des Details anderseits, daher diese heftige Neigung zur Phantastik der Quantität. Beides, der Kolossaltrieb und der Formenüberschwang,[S. 34] die primitive Nacktheit sowohl wie die Schmuckfülle, weisen auf eine geistige Unruhe zurück. Diese Unruhe setzt sich immer dann in künstlerische Wirkungen um, wenn sich eine Kraft von hartem Druck befreit, wenn ein Kampf stattfindet, wenn Sehnsucht, Unruhe und Trotz sich um ein Höchstes bemühen, während ein rauhes Klima, arme Lebensformen, Not und Mühsal den titanisch erregten Willen beschränken. Der Empordrängende vor allem will ungewöhnliche Denkmale seines Willens errichten, er denkt in steinernen Babelgedanken. Alle gotische Kunst deutet auf einen Zustand des Gemüts, der eintritt, wenn sich der Geist aus phantasievoller Dämonologie, aus schaudernder religiöser Ergriffenheit zur Gewissensfreiheit selbständig durchringt. In Augenblicken, wo ein Volk in der Mitte dasteht zwischen unbedingter Anbetung und Geistesfreiheit, wo es sich selbst wachsen fühlt und auch die Lust des Wachsens, geraten die Werke am größten und reichsten im Sinne des Geistes der Gotik. Beruhigte, saturierte Völker kennen nicht diese elementaren Willensausbrüche in der Kunst. Darum sind vor allem werdende Völker, die noch auf Morgenstufen weilen, Völker mit Jünglingstemperament, voll vom Geiste der Gotik. Oder auch die alternden Völker, in denen eine neue Unruhe erwacht und neue Begierde. Auch glückliche Völker, die in einem heiteren Klima leben, fassen die Kunst nicht so ekstatisch auf, sie suchen mehr das Glück und den Genuß; die Gotiker dagegen sind nie heiter, ruhig und harmonisch, sie werden gepeinigt von einem Verantwortlichkeitsgefühl, ihre Kraft ist nicht frei von Angst, ihr Wille ist voller Leidenschaften. Darum[S. 35] bedeutet ihnen auch die Tradition nicht viel. Ihnen schwebt als Ideal immer etwas Phänomenisches vor. In ihrer Kunst herrscht die Stimmung. Der gotische Mensch hat ganz den einseitigen Druck der Kräfte. Er lebt innerlich ruckweis, nicht stetig. Und dieses gilt ebensowohl für ganze Völker wie für die einzelnen Talente, für die Individuen, die ihrer Natur nach als Gotiker anzusprechen sind, und für ganze Künstlergeschlechter, die vom Geiste der Gotik regiert werden.
Im Gegensatz hierzu suchen Völker und Individuen, die auf die griechische Formenwelt eingestellt sind, nicht den Affekt, sondern die Beruhigung. Selbst wenn sie einmal das Ungeheure unternehmen, setzen sie Wohlklang und Harmonie allem anderen voran; sie schaffen das Kolossale nur, um zu prahlen, nicht aus einem eingeborenen Hang zum Phänomenischen. Wenn sie das Übergroße schaffen, so sind es nur Vergrößerungen des eigentlich für eine mittlere Größe Gedachten. Im allgemeinen sagt ihnen das Mittlere und eine gewisse Normalempfindung zu. Die Baukunst des griechischen Menschen geht nie sichtbar und absichtsvoll vom Zweck und von der Konstruktion aus, sie ist nicht naturalistisch und ebensowenig romantisch-symbolisch. Der Zweck und die Konstruktion fügen sich willig dem schönen Schein. Die Architektur ist rein darstellend; darum bedarf sie gar nicht der Anstrengung, die nötig ist, wo etwas an sich Profanes aufs höchste idealisiert werden soll, darum gerät die Form auch nirgends zum gewaltsam Charakteristischen. Die Bedürfnisse treten in einem Klima, das die Mitte hält zwischen eisiger Kälte und tropischer Hitze, bei weitem nicht so anspruchsvoll hervor;[S. 36] das Materielle der Zwecke erscheint von vornherein mehr aufgehoben, jedes einzelne Bauglied hat ein dekoratives Eigenleben, das sich auch erhält, wenn es für sich allein betrachtet wird, und alles Statische ist wohlklingend geworden. Die Bauwerke scheinen nicht so sehr, wie die des gotischen Geistes, einzelne Individuen zu sein, sie sind vielmehr Gebilde des reinen Wohllautes und Verkörperung eines sehr durchgebildeten Stilprinzipes. Eine Cella und ringsherum Säulenreihen: das ist der griechische Tempel; vier Mauern mit regelmäßig angeordneten Fensteröffnungen auf einem Rechteck errichtet, edel gegliedert von Pfeilern und Gesimsen: das ist der italienische Palast. Da nun aber das Ganze dekorativ ist, da jede Form ein Wohlklang ist, so kann diese Bauweise auf Häufungen verzichten. Darum ist sie im allgemeinen einfach und ein Kind der Selbstbeschränkung. In der griechischen Formenwelt dominiert das Klare, das formal Endgültige. Alle Anstrengung erscheint überwunden, das Gerüst des Bauwerks ist wie mit blühendem Fleisch bedeckt, ohne daß aber die Gelenke undeutlich würden, ohne daß die gymnastische Elastizität der Glieder verloren ginge. Die Kunst des griechischen Menschen weist, wo und wann immer sie uns entgegentritt, auf eine Gemütsverfassung, die nicht ekstatisch erregt ist, sondern besonnen, die nicht religiös gefärbt ist, sondern weltlich. Diese Gemütsart will weniger, daß das Kunstwerk drohe, als vielmehr, daß es schmeichle; sie ist nicht unruhig nach dem Neuen, sondern glücklich im Besitz. Darum ist der griechische Mensch wie von selbst ein Verweser der Tradition. In seinen Künsten geht das[S. 37] eine immer scheinbar ohne Anstrengung aus dem anderen hervor. Wo der gotische Mensch das Gefühl des Werdens rauschhaft und doch auch leidend erlebt, da genießt der griechische Mensch sein Werden und Sein als Glück. Das gibt seiner Kunst die stolze Ruhe, das Aristokratische, es löst die Spannungen und schafft die Harmonie. In der gotischen Kunstwelt geht der Mensch mehr sittlich wollend vor, in der griechischen mehr ästhetisch genießend. Benutzt man einmal die Terminologie Nietzsches, um die Gegensätze zu bezeichnen, so könnte man die gotische Welt die des dionysischen Geistes, die griechische Welt aber vom apollinischen Geiste geschaffen nennen.
Man möchte das Gotische sentimentalisch nennen, trotzdem in diesem Wort ein herabsetzender Nebensinn verborgen ist. Das Sentimentalische muß entstehen, weil die Formen des gotischen Geistes nicht in erster Linie aus einer freien Vernunft, sondern aus dem stark okkupierten Gefühl fließen. Die Kunstform dient einer reizbaren Idee, nicht einer zufriedenen Sinnlichkeit, das macht sie sentimentalisch. Das Sentimentalische in diesem Sinne ist die Hälfte der Menschennatur. Mit ihm zusammen hängt jenes große Erstaunen vor der Welt, jenes tiefe philosophische Wundern, worauf alle Religion letzten Endes zurückgeht. Die sentimentalische Natur gibt sich einem schreckhaften Gottgefühl hin, sie steht immer mehr oder weniger im Banne eines Schuldgefühls, einer mystischen Lebensfurcht. Aus dieser Furcht aber geht dann eine besondere Art von Willen hervor; es wohnen darin die Instinkte, die göttlichen und die tierischen, eng beieinander, und es ruht darin embryonisch die Idee, die, über alle Vernunft,[S. 38] über alle Realität hinaus, dem Leben das Unbedingte abtrotzen möchte, die nicht davor zurückschreckt, zum Himmel selbst eine Jakobsleiter anzulegen, worauf die Engel herab- und hinaufwallen. In diesem Sentimentalischen ist jenes Dämonische enthalten, worauf Goethe so oft zurückkam und das in ganzen Völkern sich ebensowohl zeigt wie in großen Individuen. Es „wählt sich gern etwas dunkle Zeiten“, wie Goethe meinte, es übt eine besondere Anziehungskraft aus, und nicht selten ist darin die Größe dem Diabolischen gesellt. Auch im Geiste der Gotik ist immer mehr oder weniger von dieser Dämonie. Das erklärt den oft beängstigenden Formenspuk aller gotischen Kunst, es erklärt die Hysterie und die krankhafte Heftigkeit des Empfindens neben einer eiskalt erscheinenden Spekulation und erhellt die Frage, warum diese Kunst so oft mehr bildend ist als schön.
Der griechische Mensch erschafft die Formen der Ruhe und des Glückes, der gotische Mensch die Formen der Unruhe und des Leidens.
**
*
Es leuchtet ein, daß in den beiden großen Kunstwelten gewisse formale Grundtendenzen immer wieder hervortreten müssen, wo und wann die einzelnen Formen auch entstehen und wie verschieden die besonderen Bedingungen der Zeit, der Rasse, der Umwelt auch sein mögen. Alle Kunstformen des gotischen Geistes weisen — ob sie nun vor tausend Jahren geschaffen sind oder gestern, im Morgen- oder im Abendland und so viele nationale Sonderbedingungen dafür auch maßgebend gewesen sind — denselben[S. 39] Temperamentszug auf; und ebenso gehen alle Kunstformen des griechischen Geistes, wie immer sie auch abgewandelt und angewandt werden, auf dasselbe bildende Prinzip zurück.
Ein allgemeines formales Merkmal in diesem Sinne ist es, daß vom gotischen Menschen mit Vorliebe die Vertikalrichtung betont wird, vom griechischen Menschen mehr die Horizontalrichtung. Im Gotischen strebt die Form immer schnell und gewaltsam nach oben, im Griechischen will sie beharren im Zuständlichen, sie erscheint breit gelagert. Die Gotik: das ist der Turm. Was immer der gotische Geist auch angreift, es drängt ihn, die Massen zu türmen, die Formen steil hinaufzuführen und sie nach oben zuzuspitzen; wogegen der griechische Geist in horizontal gestuften Plänen architektonisch denkt, in Stockwerken und Gesimsführungen, in Friesen und Bändern. Und das gilt nicht nur für die großen Baumassen, sondern auch für alle architektonischen Einzelformen und Ornamente, es gilt nicht nur für die Architektur, sondern für die Künste überhaupt. Man erkennt das verschiedenartige Temperament, wenn man die nach der Last begierige griechische Säule mit dem gotischen Pfeilersystem vergleicht, in dem alle Schwere spielerisch überwunden erscheint; wenn man dort auf die horizontal gereihten Perlschnüre und Eierstäbe, auf Palmetten und Akanthusornamente, auf die Triglyphen und Konsolen, auf die Stockwerksteilungen, Dachgesimse und Dachentwicklungen blickt und hier auf die Pfeilerbündel und kühn springenden Strebepfeiler, auf die wie trillernde Kadenzen an den Turmwänden und -spitzen hinaufeilenden Steinkrabben, auf die ungehemmt emporsteigenden Mauern[S. 40] und die spitz in die Luft schneidenden Dächer und Türme. Man hat den Gegensatz, wenn man sieht, wie im Griechischen der Grundriß immer einfach orientierend ist, im Gotischen aber zur Hälfte desorientierend und zur anderen Hälfte überorientierend. Wenn man dort ruhig zum Ziel hingeführt wird, so wird man hier entweder dahin geworfen, oder es bewegt sich das Raumgefühl in einem wunderlichen Irrgarten. Wenn auf der einen Seite der Drang herrscht, den Raum durch feste Mauern abzuschließen, bestimmt zu umgrenzen und ihn dem menschlichen Maße anzunähern, so herrscht auf der anderen Seite die Lust an der Wölbung, am Ausweiten, am Durchbrechen fester Grenzen, am Unbestimmten. Und auch dieses alles wird wieder zur Höhentendenz. Was im Griechischen ein Saal ist, das wird im Gotischen zur Halle, was dort ein abgeschlossener architektonischer Bezirk ist, wird hier zu einer Raumfiktion. Wo dort alle Räume streben, einander ähnlich zu sein, da suchen sie sich hier in jeder Weise zu unterscheiden, indem sie übereinander hinausgehen.
Dieser Gegensatz geht gleichmäßig durch alle Künste. In den Statuen, wie sie einem steinernen Volke gleich vor den Mauern und Pfeilern gotischer Dome, zwischen farbigen Fenstern im Schiff und Chor dastehen, wie sie, rhythmisch zu Verbänden geordnet, die Spitzbogenportale füllen und im feierlichen Tempo, mit verzückt bewegten Leibern, über Gesimse und Balustraden dahinwandeln, ist eine besondere Schlankheit, ein sich Dehnen und Sehnen, ein sich Recken in die Länge, kurz dieselbe Vertikaltendenz, wie im Ganzen des Gebäudes. Den Statuen[S. 41] der griechischen Stilkreise fehlt diese absichtsvolle Übersteigerung, es fehlt dieser Drang, einer unaufhaltsam emporschnellenden Turmarchitektur formal zu folgen; im Griechischen sind die Verhältnisse der Gestalten „richtiger“, die Vertikale ist nicht mehr betont, als die Natur sie betont, und in den Giebelfeldern lagern die Gestalten beruhigt beieinander. Herrscht innerhalb des Vertikalstils eine primitive, eine hölzerne Anmut, so erscheint sie innerhalb des Horizontalstils elastisch und natürlich. Bei den gemalten gotischen Heiligen fallen die Gewänder gerade herab, um am Boden dann mit zackiger Heftigkeit oder Koketterie zu zerknittern; bei den gemalten Gestalten der griechischen Formenwelt fügen sich die Linien der Gewänder zu fließenden Ornamenten. Sind die Bewegungen dort absichtlich steif und hieratisch, so sind sie hier dem Leben nachgebildet und dann gefällig gemacht. Die Figur griechischer Art steht auch, in Plastik und Malerei, anders als die Figur gotischer Art auf den Füßen da. Bei jener unterscheidet man deutlich Standbein und Spielbein, diese steht gleichmäßig auf beiden Beinen, wodurch eine gewisse sprechende Ungeschicklichkeit, eine psychologisch ausdrucksvolle Unbeholfenheit hervorgerufen wird. Eben diese gedankenvolle Unbeholfenheit aber sucht die Gotik. Sie drückt damit das In-sich-versunken-sein des statuarisch dargestellten Menschen aus. Die griechische Statue hat durchweg Beziehung zu etwas außerhalb Liegendem; in ihr ist der Impuls des Handelns dargestellt, sie zeigt den Jüngling im Kampf oder Wettspiel, das Mädchen, wie es sich zum Tanz oder zur Opferhandlung anschickt: sie interessiert auch durch das, was[S. 42] sie gewissermaßen dramatisch ausdrückt. Die gotische Statue bleibt dagegen ganz im zuständlich Symbolischen. Sie hat nur Beziehungen zu sich selber oder zu einer überwirklichen Legende; sie wendet sich nicht an den Menschen und seine Interessen, sondern unmittelbar an Gott. Die griechische Figur ist vom Bildhauer von vornherein plastisch gedacht, sie ist von Anfang an artistisch angeschaut; die gotische Figur verdankt ihre Entstehung einer Vorschrift der Kirche, sie ist den Legenden entnommen und darum recht eigentlich im Ursprung unplastisch. In ihr wird aber das Unplastische mit höchster Anstrengung plastisch, architektonisch und in jeder Form künstlerisch gemacht, und eben dadurch entsteht die ungemein eindringliche Form, die unbeholfene Monumentalität, die hölzerne Grazie, die tief beseelte Starrheit und eine ergreifende menschenferne Stimmung. Der griechische Geist nimmt es ernster mit der Durchbildung der Form; der gotische Geist nimmt es ernster mit der Idee. Darum wird die Form hier ideenhaft unbedingt. Der Geist der Gotik will nicht ausgleichen, er wählt seine Formen allein unter dem Gesichtspunkt, ob sie aus derselben Empfindungswurzel wachsen, ob sie von derselben Art sind, ob sie die Farbe eines bestimmten ungebrochenen Willens tragen. Einheitlichkeit, Eindeutigkeit ist ihm alles. Der griechische Geist aber wählt die Stellungen und Formen nach ihrer kontrapunktischen Reinheit, nach ihrem Reizwert; er sucht die psychische Wohlgestalt, den schönen Menschen, die schöne Kleidung, und er verschönert das Modell, wenn es an sich nicht schön genug ist: er neigt zum Idealisieren des Physischen, wie der gotische Geist zur Übersteigerung des Psychischen neigt.[S. 43] Darum scheut sich dieser nicht vor dem häßlichen, aber ausdrucksvollen und charakteristischen Menschen, ja, er liebt es, den Menschen zu proletarisieren, in dem Sinne etwa, wie das Christentum es getan hat. Es gerät der Mensch im Gotischen wie von selbst zum Persönlichen und im Griechischen zum Typischen. Auch das ist eine Folge der schönen, ausgeglichenen Form hier und der grotesken, in die Länge gezogenen Form dort. Es handelt sich um zwei Handschriften der Menschheit: die eine strebt in ihrer weichen edlen Rundung und Bestimmtheit zum Kalligraphischen, die andere ist eine ungleiche, steile und nicht immer klar leserliche Charakterschrift.
Ein anderer formaler Unterschied besteht darin, daß die gotische Baumasse immer wie modelliert, das griechische Bauwerk dagegen tektonisch gefügt erscheint. Jenes gleicht dem Werk eines Bildhauers, eines Modelleurs, dieses gleicht der Schöpfung eines die Teile zusammensetzenden Werkmeisters. Gotische Bauwerke kann man den halb phantastischen Gestalten der Saurier vergleichen, ungeheuer im Ausdruck, aber verschwommen in vielen Einzelformen, hinter unheimlich schönen Schalen und Krusten den Gliederbau halb verbergend, von der eigenen Masse behindert und in der Ausbildung gewisser Organe noch amphibienhaft ungewiß. Das griechische Bauwerk aber ist wie ein edles, wohl durchgebildetes Tier unserer Lebenszone, überzeugend in den Bewegungen, klar in den Gelenken und rassig in der Ökonomie der Mittel. Man könnte, um anders zu vergleichen, die Berge modelliert nennen — modelliert von der die Erdrinde faltenden Kraft, von der Zertrümmerung, vom Erdrutsch, von[S. 44] Verwitterung und Wasserspülung wie vom Finger eines Erdgeistes —, den Baum mit Stamm, Zweigen, Blättern und Blüten dagegen als ein organisches, tektonisches Gebilde der Natur bezeichnen. Die Vergleiche sind primitiv, sie weisen aber doch auf einen wesentlichen Punkt. Sie weisen zum Beispiel darauf, daß bei einem tektonischen Bauwerk die Symmetrie konsequent durchgeführt sein muß, daß das modellierte Bauwerk aber immer mehr oder weniger die Willkür der Asymmetrie aufweisen wird. Der ganze Rhythmus muß hier und dort ein anderer sein. Im Kunstwerk des griechischen Geistes fließt der Rhythmus schnell, aber ruhig und sicher dahin, wie die Gewässer in einem tiefen, gleichmäßigen Strombett; im gotischen Bauwerk ist der Rhythmus fast gewalttätig, doch stellen sich der Strömung Hemmungen entgegen, wodurch Brandungen und Strudel entstehen. Ein Formengedränge ergibt sich, in dem notwendig Unbestimmtes und Vielfältiges ist, gegenüber dem Bestimmten und Eindeutigen der tektonisch geordneten Form. Tatsächlich setzt die gotische Bauweise in ihren entwickelten Stadien ein ungeheures tektonisches Können, einen starken „logischen Formalismus“ voraus, ja tektonisches Genie, denn es muß das Gewagteste, das Unerhörte praktisch möglich gemacht werden; nur nimmt man dieses Können nicht wahr, weil der Stil nicht den Ehrgeiz hat, im ganzen tektonisch zu wirken, weil ihm das Konstruktive nur Mittel ist, um Stimmungen zu erzielen. Auch die griechische Einzelform hat dann viel von der sauberen Bestimmtheit, von der klaren Gliederung der tektonischen Architektur, wogegen die gotische Einzelform zur malerischen Unbestimmtheit[S. 45] drängt. Sie ist mehr modelliert als gezeichnet, mehr plastisch als linear. Die griechische Form ist immer irgendwie reliefartig, die gotische ist kubisch. Diese wächst aus der Masse hervor und ist untrennbar damit verbunden, jene erscheint mehr wie gefügt. Das griechische Kunstwerk besteht aus geistreich verbundenen Teilen, das gotische ist immer ein einziges, untrennbares Ganzes. Wenn dort die Formen gereiht und wie Bänder um das Gebäude gelegt werden, so wuchern sie hier vegetativ auf dem Gemäuer, in sich selbst verschlungen oder heftig nach oben strebend, als suchten sie das Licht.
Auch das Flächenleben ist sehr verschieden. Wenn ein Bauwerk des griechischen Geistes nur fünfzig verschiedene Flächen hat, so weist das gotische davon tausend auf. Der gotische Geist begreift den Raum reicher. Man darf nicht sagen sinnlicher oder phantasievoller, weil der Raum im griechischen Bauwerk auf seine Grundelemente zurückgeführt worden ist, was ebenfalls höchste Phantasietätigkeit voraussetzt. Der Gotiker aber kann sich im Empfinden des Raumes kaum genug tun, ihm schillert der Raum wie in Millionen Facetten. Die Flächen sind nicht mehr mit dem Winkelmaß zu messen, die Formen fangen mit jedem Detail die Brechungen des Raumes tausendfältig auf, und darum vibriert das Kunstwerk immer in einer unruhigen Pracht von Licht und Schatten. Die griechische Raumauffassung beruhigt, die gotische beunruhigt. Dort spricht das Mathematische des Raumes, hier spricht sein Geheimnis, sein Grauen. Die Auffassungen sind so verschieden, wie die Zeitempfindung in den Dramen der Griechen und in den barocken Dramen Shakespeares[S. 46] grundsätzlich verschieden sind. Dort werden Raum und Zeit exakt begriffen, hier romantisch.[1] Im gotischen Kunstwerk scheint der Raum unaufhörlich in Bewegung zu sein, im griechischen scheint er fest zu stehen. Der griechische Mensch baut gewissermaßen mit Luftwürfeln, dem gotischen Menschen ist der Raum etwas Flüssiges. Dort gilt nur die positive Form, hier auch die negative; dort denkt man an das mathematische Gesetz der Teilung, hier empfindet man die unendliche Melodie des Raumes; dort zentralisiert, hier dezentralisiert man gern. Im Griechischen ist die Schwere gebändigt, im Gotischen wird sie verneint. Das wirkt nicht nur auf die Materialbehandlung insofern[S. 47] zurück, als der Gotiker jedes Material zu entmaterialisieren strebt, sondern es wirkt auf jede Einzelform zurück. Der griechische Mensch bevorzugt die gerade und die einfach geschwungene Linie, er kommt mit wenigen Formelementen aus; der gotische Mensch braucht, trotzdem er einseitiger ist, ja eben darum, viele Formelemente, er kultiviert die reich bewegte und vielfach gebrochene Linie. In der griechisch-italienischen Ornamentik herrscht die gleichmäßig sich verjüngende Kurve, die symmetrisch geordnete Arabeske, und es werden wenige Naturformen in einer strengen, aber immer auch sinnlich durchgefühlten Stilisierung benutzt; in der gotischen Ornamentik ist die Zierform zugleich naturalistisch und abstrakt und sie bildet sich ununterbrochen um. Dort herrscht in der Kunstform ein gemäßigtes Klima, hier ein tropisches. Was dort Knochen und Gelenk ist, das ist hier Knorpel und Wirbel; was dort wie eine weiche Haut erscheint, mutet hier an wie eine schuppige Hülle. Die Form bewegt sich in Rillen und Schwellungen, in Brechungen und Lähmungen und kann sich im einzelnen an Motivation gar nicht genug tun; aber sie erfüllt dabei nicht entfernt so viel Funktion wie die griechische Form. Diese scheint immer gemächlich und auf Umwegen das Ziel zu erreichen, während sie in Wahrheit den kürzesten Weg nimmt; die gotische Form scheint nach dem Ziel gewaltsam hinzuschnellen, doch geht sie tatsächlich den weiteren Weg und verliert sich nicht selten unterwegs. Das griechische Ornament scheint nur ein Klang zu sein und ist doch durchaus argumentierend, das gotische ist mit Eigenbedeutung beschwert, aber es zweckt mehr zu einem stimmungshaften als[S. 48] zu einem architektonischen Ganzen. Auf der einen Seite ist die Form konsonierend, auf der anderen liebt sie die Dissonanz, den übermäßigen und den verminderten Akkord; die griechische Formensprache ist auch in der bildenden Kunst, so könnte man sagen, vokalreich und gesangartig, die gotische Formensprache ist reich an Zischlauten und charakterisierenden Schärfen. In der ganzen Kunst des griechischen Geistes sind der innere Sinn, der das Lebensgesetz intuitiv nachfühlt, und der äußere Sinn, der die organischen Ausprägungen des Lebensgesetzes sinnlich wahrnimmt, restlos in Übereinstimmung gebracht; in der gotischen Kunst kämpft die innere Vorstellung mit der äußeren Anschauung. Dort fördern darum Natur und Kunst einander, hier vergewaltigen sie sich gegenseitig; dort ist ein göttliches Genießen, hier ein titanenhaftes Kämpfen.
**
*
Als die Italiener dem mittelalterlichen Stil des Nordens den Namen „Gotik“ gaben, wurden sie insofern von einem richtigen Instinkt geleitet, als sie ausdrücken wollten, daß in dem nordischen Stil die Elemente des Barbarischen enthalten seien. Falsch war nur die verächtliche Betonung, die in den Ausdruck gelegt wurde; wie es denn immer sehr primitiv ist, wenn Völker und Rassen einander Geringschätzung zeigen. In Wahrheit ist auch die Bezeichnung eines Kunststils als barbarisch ein Charakteristikum, nicht ein Werturteil. Wenn es uns anders erscheint, so liegt es daran, daß eben jetzt das Wort „barbarisch“ wieder einmal zu einem weltgeschichtlichen Schimpfwort gemacht worden ist. In Wahrheit umschreibt der Begriff des[S. 49] Barbarischen nicht einen Zustand der Bildungsunfähigkeit, der Unbegabtheit und Unwürdigkeit, sondern einen Zustand der Ursprünglichkeit und Naturnähe, der sich einer festen Normierung mehr oder weniger widersetzt. Der Gegensatz des Barbarischen ist ein Zustand, in dem die Norm herrscht, wo der Mensch und die Natur jenem lebendigen Formalismus unterworfen sind, den man sich gewöhnt hat Kultur zu nennen. Beide Formen sind notwendig und ergänzen, ja durchdringen einander; sie unterscheiden sich nicht wie schlecht und gut, sondern wie zwei Kräfteströme, die sich hier anziehen und dort abstoßen, die aber zusammen erst das schöpferische Genie der Menschheit ausmachen. Gegeneinander wirkend schaffen sie den Wechselstrom der Kunstgeschichte. Es ist nicht so, daß alle Völker im Anfang ihrer geschichtlichen Laufbahn barbarisch sind und im Laufe der Jahrhunderte kultiviert werden. Wer so denkt, verwechselt die kultivierende mit der zivilisierenden Kraft. Ein Volk wird mit der Bestimmung zum Barbarischen oder zum Kultivierten geboren, oder es ist auch bestimmt, ein Kompromißvolk zu werden. Die höhere Produktivität wird von der Anlage nicht berührt. Wie Mozart ein mit der Bestimmung zur Kultur geborenes Talent gewesen ist und wie Beethovens Genie in seinen höchsten Werken noch barbarisch anmutet, wie Raffael und Michelangelo sich artverschieden gegenüberstehen, wie dieses aber nicht ohne weiteres auch Gradverschiedenheit bedeutet, so stehen sich auch ganze Völker artverschieden gegenüber. In den barbarischen Völkern bleibt immer, wie sie sich auch abmühen, etwas Dunkles, Wildes und Gewaltsames, in den kultivierten[S. 50] ist etwas Heiteres, Klares und Müheloses. Es wäre zu wenig, mit halbem Zugeständnis dem gotischen Geist zuzugeben, er habe für eine Erneuerung und Verjüngung, für eine gesunde Barbarisierung zu sorgen, wenn der griechische Geist in seinem edlen Kulturgehäuse formalistisch zu erstarren droht. Der gotische Geist ist viel mehr als nur ein Anreger und Wiedererwecker. Er stellt recht eigentlich das zeugende Prinzip in der Kunst dar. Er ist, wie gesagt, der männliche Teil in der Kunst. Alles Männliche ist und bleibt im Wesen barbarisch, muß es schon sein um seiner starken Aktivität willen. Völker, die die Bestimmung haben, sich zu kultivieren, die die Probleme der Kunst lange austragen und endlich die Schönheit gebären, sind im wesentlichen weibliche Völker. Der gotische Geist tritt überall, wo er sich manifestiert, befruchtend, revolutionierend auf, aber er muß das Harmonisieren, er muß die Kultur des Glücks dem weiblichen griechischen Geist überlassen. Er steht so recht in seiner Glorie da in unruhigen Zeiten, wenn neue Ideen gären, wenn Probleme zu lösen und Aufgaben gewaltsam zu bewältigen sind. Ihm ist die Heroenzeit des Geistes gemäß. Nicht Zufall ist es, daß der gotische Geist in Europa so lange mit dem Christentum in gleichem Schritt dahingegangen ist und in Asien mit jenem religiösen Gefühl, das dem Christentum in manchem Zuge verwandt ist. Der gotische Geist gehört seiner ganzen Natur nach zu jenem, man könnte wieder sagen: barbarischen religiösen Gefühl, das auf heftige Sehnsucht zurückzuführen ist, auf einen unstillbaren Vervollkommnungstrieb; er gehört zu jenen Religionen — ob sie nun Christentum, Buddhismus[S. 51] oder sonstwie heißen —, die das Individuum mit der ganzen Schwere der Verantwortung belasten, es unmittelbar vor Gottes Angesicht stellen und es zwingen, sich von Mund zu Mund mit dem ewig Unbegreiflichen auseinanderzusetzen. Völker und Individuen, die von Natur geschaffen sind, das Leben schwer zu nehmen, die zur Mystik, zur Askese neigen, die geborene Philosophen sind und von den sittlichen Forderungen nicht loskommen, kurz die Idealisten des Religiösen, die den kirchlichen Formalismus am leichtesten aufgeben, weil sie zwischen sich und Gott keinen Mittler dulden, sind instinktiv stets auch Vertreter des gotischen Geistes in den Künsten. Ihnen stehen die Vertreter des griechischen Geistes gegenüber als Menschen, deren Religiosität recht eigentlich heidnisch ist. Heidnisch nämlich in dem Sinne, als ihre Religion nicht auf Beunruhigung abzielt, sondern auf Beruhigung, auf eine Entlastung, als viele Mittler — seien es nun Götter, Götzen oder Heilige — nicht entbehrt werden können und als die Menschen den Drang haben, ihre Sorgen und Nöte abzuwälzen, damit sie Welt und Leben glücklich genießen können. Diese heidnische Religiosität des griechischen Menschen ist immer staatenbildend, weil sie auf Konventionen beruht und nichts dem einzelnen überläßt; sie ist praktisch, weltlich und mehr eine Sache der Organisation als eine Sache des stetig sich erneuernden geistigen Triebes. Darum ist diese heidnische Geistesrichtung bestimmt, kultivierend zu wirken; und es haften jener anderen religiösen Geistesrichtung, die zu einem steten Protestantismus neigt, die Merkmale des Barbarischen ein für allemal an. Damit ist schon angedeutet, daß in allen christlich gefärbten[S. 52] Kunststilen die Schöpfung der Form in erster Linie eine Angelegenheit des Laienelementes mit seiner primitiven, aber elementaren Bildnerkraft ist, daß in jeder heidnisch gefärbten Kunstkultur aber der entscheidende Einfluß beim Kenner, beim Fachmann liegt. Dort schafft das Genie des Instinkts, hier das Genie der Bildung. Alle Formen des gotischen Geistes sind von einer naiv tiefsinnigen Laienempfindung umgeben, als von ihrer Lebensatmosphäre; wogegen die Formen des griechischen Geistes immer anmuten, als seien sie aus der Hand des exakt arbeitenden Meisters hervorgegangen. Jene Formen sind oft unsicher im Technischen, im Handwerklichen, aber sie drücken vollkommen einen inneren Zustand aus; diese Formen dagegen sind selbst dort, wo sie allgemein und leer in der Empfindung bleiben, immer doch technisch und handwerklich einwandfrei. Im Gotischen sind die Formen heftig und unbeholfen zugleich, im Griechischen sind sie maßvoll und von sicherer Haltung. Darum bringt die gotische Formenwelt so recht die Kunststile hervor, die ganzen Nationen bis hinab zum Letzten gehören, die ihrem ganzen Wesen nach volkhaft sind; und es gehen aus der griechischen Formenwelt die Stile hervor, die ihrem Wesen nach aristokratisch und höfisch sind. Dort ist die Form vor allem symbolisch, hier ist sie repräsentativ; dort bleibt sie im wesentlichen im Bezirk der Sakralkunst, hier wird sie weltlich und hilft den Vornehmen das Leben schmücken. Die griechische Form ist ausdehnungsfähiger und wandlungsfähiger als die gotische, sie nimmt mehr teil am täglichen Leben und an den profanen Aufgaben. Darum folgt sie auch mit so viel Leichtigkeit[S. 53] der Zivilisation; sie hat recht eigentlich zivilisierende Kraft. Alle kolonialen Kunstformen, das ist bezeichnend, sind irgendwie abgeleitet vom Griechischen. Keine barbarische Kunstform kann in diesem Sinne der Zivilisation über die Grenzen eines bestimmten Bezirks hinaus folgen. Sie hat nur dann Bedeutung und Kraft, wenn sie ganz von innen heraus wirkt, wenn sie hervorbricht wie eine innere Nötigung. Sie kann nicht, wie die griechische, gelehrt und gelernt werden. Woher es denn kommt, daß sie nicht so sehr internationale Geltung gewinnt, sondern mehr im Nationalen bleibt.
Der Unterschied wird noch deutlicher, wenn man auf die Entartungsmerkmale der beiden Formenwelten blickt. Naturgemäß muß sich die griechische Form mehr als die gotische auf dem Boden fester Traditionen entwickeln. Die Entartung äußert sich bei ihr darum so, daß sie formalistisch erstarrt. Aber selbst dann behält sie noch eine gewisse Haltung und Würde; sie kann nie ganz wertlos werden, wie schematisch sie auch auftritt. Sie wird in der Entartung akademisch, aber auch so bleibt sie noch anwendungsfähig. Die gotische Form dagegen hat mehr die Neigung, sich selbst zu zerstören, ihr wichtigstes Entartungsmerkmal ist der barocke Überschwang. Wo sie rein auftritt, da erstarrt sie nicht, sondern sie stirbt an der Erschöpfung. Über lange Zeiträume erhalten kann sie sich nur, wenn sie einen Bund mit der griechischen Form eingeht, wenn sie einen Kompromiß großer Art schließt — wie es etwa in der ägyptischen Kunst geschehen ist — und wenn sie aufgenommen wird von einer selbstherrlich regierenden Konvention.
[S. 54]
In der Kunstgeschichte wechseln die griechischen und die gotischen Formenwelten miteinander ab, sie bestimmen und beeinflussen einander, durchdringen sich bis zu gewissen Graden und wirken im ewigen Wechselspiel gegeneinander. Aber man darf gegenüber diesem Spiel der Kräfte ebensowenig von Entwicklung sprechen, wie man es etwa vor meteorologischen Erscheinungen tun dürfte. Wärme und Kälte werden bis ans Ende aller Tage den Ausgleich suchen und dabei Erscheinungen des Sturms und der Windstille, des Hochdrucks und des Tiefdrucks hervorrufen. Auch die Begegnungen der beiden formbildenden Kräfte dürfen nicht verwechselt werden mit dem Ablauf vom Tieferen zum Höheren, vom Einfachen zum Vielfachen, vom Primitiven zum Kultivierten. Die Kontraste stehen sich für alle Zeiten gegenüber; wenn die Erscheinungsformen auch immer andere sind, der Gegensatz an sich ist unverrückbar.
Es ist ja sogar bedenklich, von Entwicklung innerhalb eines bestimmten Stiles zu sprechen, da es sich auch dort nicht eigentlich um eine Veränderung vom Tieferen zum Höheren handelt, selbst wenn man von Jugend, Reife und Alter eines Stils sprechen will. Es handelt sich im Grunde nur um Bewegungen, und jeder Bewegung entsprechen bestimmte Formen. Die Jugend, die Zeit der Reife und die des Alters haben ihre eigene Ausdrucksweise, haben besondere Stärken und besondere Schwächen, aber sie sind nicht ohne weiteres qualitativ verschieden. Wenn von Entwicklung gesprochen werden soll, mag es so geschehen, daß man sagt: die Folge von Bewegungen, die jeder Stil gesetzmäßig zu durchlaufen hat, drückt sich immer[S. 55] in bestimmten Formen und Formwandlungen aus. Und an diesen Formwandlungen hat der Temperamentsgegensatz, der hier mit den Worten „griechisch“ und „gotisch“ bezeichnet wird, immer irgendwie Anteil. Jeder Stil, ob er nun ein Niederschlag des griechischen oder des gotischen Geistes ist, beginnt damit, eindeutig und streng den Ausdruck für Grundempfindungen zu suchen, er beginnt — mehr oder weniger — charakterisierend und symbolisierend. In jedem archaischen Stil ist ein naturalistischer Wille monumental und symbolisch geworden. Die Natur wirkt heftig auf den Künstler, und heftig ist der Wille, sich die Natur mittels der Form zu unterwerfen. Das will sagen: alle Stile, selbst die griechischen, beginnen mit Zügen des Gotischen. Dann folgt eine Zeit der inneren Beruhigung. Die Formen werden klarer und heiterer, sie werden mehr auf Typen zurückgeführt, und das Objekt tritt mehr vor das Subjekt; das Tempo wird maßvoller, die Feierlichkeit erscheint weltlicher, und die Form wird mehr schmückend als ausdrucksvoll. In dieser Periode sind selbst die gotischen Stile irgendwie vom griechischen Geiste erfüllt. In der letzten Periode endlich wird die Form barock. Alles Barocke aber ist eine bestimmte Art des Gotischen. Die Kunst wird auf dieser Stufe virtuos, weil viele Erfahrungen technischer Art gesammelt worden sind und weil zugleich das Gefühl der Menschen wieder unruhig wird. Auch die virtuose Form ist eine Form des Überschwangs, wie die primitive; nur ist der Wille jetzt nicht mehr hoffnungsvoll, sondern skeptisch, ja zum Teil verzweifelt. Die Form ist nicht mehr elementar und starr, sondern unruhig bewegt. Ihre Heftigkeit ist spielerisch[S. 56] und kokett, blasiert und spöttisch, die Ausdruckslust gibt sich überwiegend dekorativ. Jede Stilentwicklung endet damit, daß das Subjektive wieder die Überhand gewinnt. Zuerst äußert sich in einem Volke immer der Wille zur neuen Tat. Alles ist im Werden: das Religiöse, Staatliche und Soziale, und eben darum gerät die Form um so heftiger und tendenzvoll bestimmter. Dann folgt eine Zeit des Besitzgefühls, der Sicherheit, Gewißheit und der Freude an sich selber, was auf die Form aristokratisierend wirkt. Endlich kommt eine neue Unruhe auf, eine intellektuelle Unruhe, die Zweifelsucht erhebt sich, die zersetzende Reflexion schafft neue Ungewißheit, und die Form wird dadurch in einer bestimmten Weise wieder bis zum Grotesken getrieben. Der Wille steht wieder auf, doch ist er jetzt ohne die großen Ziele der Jugend, es ist in ihm etwas Nervöses, und oft häuft er die Formen nur, weil er sie nicht in allen Teilen neu gestalten kann. Wie das Individuum in der Jugend und im Alter sentimentalisch ist, nicht aber in der Mitte des Lebens, so sind es auch die Völker. Das Werden und auch das Vergehen — das ein umgekehrtes Werden ist — sind sentimentalisch, das Sein aber ist es nicht. Zuerst ist die Form voller Mystik, dann wird sie exakt, sie endigt im Überschwang.[2] Die[S. 57] gewaltsam vereinfachte und die gewaltsam vermannigfachte Form sind von derselben Art, so verschieden sie auch scheinen mögen; gemeinsam stehen sie der reinen, der objektivierten Form gegenüber. Sowohl der Anfang wie das Ende werden von der Stimmung beherrscht, in der Mitte aber ist die Auffassung positiv. Die verschiedenen Gemütszustände, die die Formwandlungen der Stile bestimmen, kann jedes Individuum in sich selber nachfühlen. Denn Formen der Kunst haben immer etwas Handschriftliches, auch wenn sie von ganzen Völkern niedergeschrieben werden, sie drücken unwillkürlich innere Zustände aus. Es ist so, daß jede Jugend etwas Grundsätzliches will, daß sie ethisch denkt, in Übersteigerungen, daß sie unruhig ist, aber absolut im Wollen und auf wenige Formeln eingeschworen; in der Zeit seiner Reife genießt der Mann dann sich selbst, sein Dasein scheint ihm gesichert, er denkt mehr empirisch als ethisch, mehr real als utopisch, mehr sachlich als persönlich; je mehr der Mensch sich dann aber dem Grabe nähert, je näher ihm das Mysterium des Todes kommt, desto unruhiger wird er wieder, desto gleichnishafter erscheinen ihm alle Dinge, und desto mehr stellt sich ein neues Pathos ein. Jenes Pathos, das Ausdruck eines Leidens ist. Übersetzt man diese inneren Zustände in Kunstformen, so müssen Gebilde herauskommen, wie sie sich darstellen[S. 58] auf den drei Stufen jeder ungestört verlaufenden Stilbewegung. Es erscheint zuerst das archaische Kunstwerk, dann das sogenannte klassische und am Ende das barocke. Untrennbar verbunden mit den Seelenzuständen sind stets die Formen des optischen Erlebnisses; die Farben, die Linien, die plastischen Massen scheinen immer Symbole der inneren Energie zu sein. Jede Form ist, in diesem Sinne, eine Kraft, die einer seelischen Kraft entspricht. Das Gefühl des Menschen betont Formen, wodurch es vor sich selber bestätigt wird, und es verwirft die ihm widersprechenden. Das ist, in nuce, das Wesen jedes Stilwandels.
Dieses gilt ebensowohl für den Stil der einzelnen Künstler. Auch in dem Lebenswerk großer Künstlerpersönlichkeiten findet ein typischer Formwandel statt, auch dort hat jedes Lebensalter seine bestimmten Formen, auch dort wird die Zeit der Lebensmitte immer irgendwie im griechischen Geist regiert und das Alter von den Formen des gotischen Geistes. (Die Werke der Jugend freilich sind weniger charakteristisch, weil sie noch nicht selbständig sind, weil in ihnen noch das Ringen mit dem Handwerk sichtbar ist.) Gerade bei den größten Malern, Bildhauern und auch Architekten aller Zeiten ist dieses Hinübergleiten von griechischer Ruhe zu einer bewegten Altersgotik deutlich nachzuweisen; jedes große Lebenswerk endet mehr oder weniger barock.
Es drückt sich also der eine fundamentale Formenkontrast vielfältig aus: einmal in der Anlage der Rassen und Völker, sodann in dem Ablauf aller Stile und endlich in der Anlage[S. 59] und Entwicklung der einzelnen Künstler. Die Natur bedient sich nur eines einzigen Kunstgriffes; mit ihm aber erzeugt sie eine unübersehbare Mannigfaltigkeit. Eine staunenswerte Fülle der Erscheinung wird hervorgebracht, weil das Gesetz vom Dualismus der Kunst an die Bedingungen von Raum und Zeit gefesselt ist. Wir sehen die Rassen, Völker und Individuen hier mit der Bestimmung, mit dem Temperament zur gotischen und dort zur griechischen Form ihre historische Mission erfüllen; wir sehen daneben jede Rasse, jedes Volk durch drei Entwicklungsstadien dahingehen und dabei einmal mehr dem gotischen und ein andermal mehr dem griechischen Geiste zuneigen; und wir sehen endlich auch jedes Individuum mehr als Griechen oder mehr als Gotiker geboren werden und für sich selbst ebenfalls jene typische Entwicklung durchmachen. Bei den Rassen erstrecken sich die Metamorphosen der Form über Jahrtausende, bei einzelnen Völkern über Jahrhunderte, bei den Individuen über Jahrzehnte. Das eine Volk beginnt, wenn ein anderes am Ende seiner schöpferischen Kraft steht, Jugend und Alter, Alter und Jugend begegnen sich, und immer wieder beginnt derselbe Weg, in der Idee gleichartig und doch auch wieder ganz verschieden der Ausdehnung, der Zeitdauer und der Führung nach. Absichtsvoll mischen sich reaktionäre Willensregungen in das Spiel der Kräfte; und auf allen Stufen werden Kompromisse geschlossen. Das ergibt eine unendliche Fülle der Erscheinung. Neben Völkern gotischer Art wohnen solche von griechischer Anlage; und zwischen ihnen leben Völker, die unentschieden hierher oder dorthin schwanken. Es begegnet das[S. 60] Nordische dem Südlichen, das Exotische dem Gemäßigten; und jedes hat seine besondere Existenzbedingung. So vermengen sich die Formen bis zum Unabsehbaren. Um so mehr, als die einzelnen Künstler mit ihrem persönlichen Willen hinzukommen, der einmal mit dem Willen der Gesamtheit übereinstimmt, ein andermal ihm aber auch widerspricht. Es gibt geborene Griechen in den Gebieten des gotischen Geistes und Gotiker innerhalb der griechischen Stiltendenzen; es gibt Talente, die in ein ihnen nicht gemäßes Formenklima verschlagen sind und andere, die ganz an ihrem Platz sind. Zuweilen kommt es vor, daß die Scheitelpunkte gleichartiger, aber verschieden langer Kurven in einem Punkt zusammenfallen, daß der Wille eines genialen Individuums sich mit dem seines Volkes, seiner Rasse begegnet. Dann gibt es in der Kunstgeschichte einen helleren Klang, es ist dann, als steigerten sich zwei Töne von gleicher oder verwandter Schwingungsdauer. Aber es kommt ebenso häufig vor, daß sich die Individuen mit ihrer Zeit nicht zusammenfinden können, wo beide disharmonisch aufeinanderprallen. So verwirren sich die Fäden zu einem scheinbar unlöslichen Knäuel. Die verschiedenen Tempi, das harte Nebeneinander im Raum und der Umstand, daß dasselbe Gesetz an sehr verschiedenartige Massen gebunden ist, machen es, daß die Willensströme scheinbar chaotisch durcheinander, übereinander laufen. Es sieht oft aus, als gäbe es überhaupt keine Ordnung, als sei alles zufällig und gesetzlos. Alle diese geistigen Wellenbewegungen aber verfließen nun ebensowenig gestaltlos ineinander, wie es die Wellen des Wassers tun. Wie hier jede Welle Richtung und Form[S. 61] behält, wie die verschieden langen und hohen Wellenbildungen übereinander hingleiten, nicht aber verschmelzen, so wird auch in der Kunst jede Bewegung für sich begonnen und zu Ende geführt. Das ist es, was der Kunstgeschichte den Anblick eines bewegten Meeres gibt. Wie aber die Formen aller Wellen schließlich auf zwei Grundkräfte zurückzuführen sind, auf eine Kraft, die hebt, und eine andere, die das Erhöhte in die Fläche zurückzwingt, so sind auch in der Kunst alle Formen letzten Endes zwei Bildungskräften unterworfen. Zwei Bildungskräften, die notwendig wie Naturgewalten auftreten und die zwei Formen des menschlichen Willens überhaupt sind. Das Ganze ist im Grunde das Spiel zweier Energien: es ist der Widerstreit von Ruhe und Unruhe, von Glück und Leiden — zur Form erstarrt. Durch alle Künste, durch das ganze Leben sogar kann man diese beiden Energien verfolgen; indem man sie anschaut, bietet sich einem der Grundgedanke einer ganzen Philosophie dar. Der tausendfältige Wechsel, wie die beiden Kräfte, die eine mehr diesseitig, die andere mehr jenseitig orientiert, sich suchen und fliehen, locken und bekämpfen, wie sie sich durchdringen und auch wieder zur fruchtbarsten Einseitigkeit treiben: das ist die Geschichte der Kunst.
[S. 62]
Je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto mehr fließen dem anschauenden Geiste das religiöse Gefühl und der künstlerische Bildungstrieb ineinander. Heute sind Kunst und Religion ja so streng getrennt, daß sie sich kaum noch in konventioneller Weise finden können, und daß man schon auf einzelne Künstler blicken muß, um zu verstehen, wie jeder elementaren Formschöpfung eine religiös gefärbte Bewegtheit der Seele zugrunde liegt. Ursprünglich aber war die Kunst eine Schöpferin von Formen, mit deren Hilfe die Gottheit angebetet wurde. Und diese Formen nahmen wie von selbst immer gotischen Charakter an, weil sie heftigen Affekten, weil sie dem Leiden der Kreatur entsprangen. Alle Kunstformen der vorgeschichtlichen Menschen — auch die wilden Völker können ja in gewissem Sinne als vorgeschichtlich bezeichnet werden — haben diesen gotischen Leidenszug. Der vorgeschichtliche Mensch dachte bei seiner künstlerischen Tätigkeit überhaupt nicht an den Menschen, er schuf nicht für seinesgleichen, wollte nicht erfreuen, nicht unterhalten oder dekorieren, sondern er wandte sich ausschließlich an die dunklen Gewalten. Mit Furcht, Grauen und Begierde. Er forderte mittels der Kunstform, er sicherte sich mit ihrer Hilfe, er beschwichtigte damit die ewig über ihm hängende Drohung.
Ein ungemein wertvolles Material bieten nach dieser Richtung die in den letzten Jahren entdeckten Höhlenmalereien prähistorischer Menschen. Man hat im wesentlichen Tierzeichnungen[S. 63] gefunden, die mit spitzen Werkzeugen in die Felsenwände geritzt und dann mit den wenigen erreichbaren Ockerfarben getönt worden sind. Als diese Zeichnungen bekannt wurden, ging eine große Verwunderung durch die Welt. Sie galt der ungemeinen Sicherheit, womit die Gestalten und Bewegungen der Tiere charakterisiert und auf die Grundelemente zurückgeführt worden sind. In das Dunkel, wie diese Kunstgebilde entstanden sind, fällt ein Licht, wenn man erfährt, daß die Zeichnungen nicht die Höhle haben schmücken sollen — denn sie sind oft in verschiedenen Lagen übereinander angebracht und finden sich auch in den engsten und dunkelsten Winkeln und Spalten, wo der Zeichner nur mit einem brennenden Kienspan und in unbequemer Lage hat arbeiten können —, sondern daß sie sich als Beschwörungen der „Medizinmänner“, die damals in einer Person Priester und Künstler gewesen sein müssen, darstellen, daß sie den Zweck verfolgten, den Jägerstämmen die Nahrung zu sichern. Es muß der Glaube geherrscht haben, das Abbild eines Tieres habe die Kraft, dieses selbst zu sich hinzuziehen. Die Zeichnungen müssen Äußerungen sein des sogenannten Totemismus, magische Formeln, die darauf abzielten, die umliegenden Jagdgründe zu bevölkern. Das würde auch den mystisch gesteigerten Naturalismus der Form erklären. Ein heftiger Wille wollte sich einen Teil der Natur unterwerfen. Es handelt sich offenbar um Gedächtniszeichnungen von Jägern, um Erinnerungsbilder von Menschen, die die Form direkt aus der Natur nahmen, sie zugleich aber durch ein heftiges Verlangen subjektiv steigerten und einem Kultus dienstbar machten.[S. 64] Diese frühesten Kunstformen entsprechen den sinnlich-übersinnlichen Tänzen, die ebenfalls einen beschwörenden Charakter hatten. Da sie einen Zwang ausüben sollten, sind sie nicht ins Gefällige geraten, sondern ins charakteristisch Monumentale. Und dieses eben verleiht ihnen den gotischen Zug. Diese uralte Kunst stellt sich dar als ein Ausfluß innerer Unruhe; sie wendet sich unmittelbar an die Dämonen, es ist eine Kunst des Dunkels und doch auch wieder eine Kunst, die auf einer höchst lebendigen Anschauung der Natur beruht.
Zwischen diesen vorgeschichtlichen Höhlenmalereien und den künstlerischen Äußerungen der wilden Völkerstämme besteht, wie auch die Ethnographen bestätigen, eine grundsätzliche Ähnlichkeit. Sie ist festzustellen, wenn man die Kunstformen der Neger und Südamerikaner, der Buschmänner und Eskimos, vor allem die Kunst der Jägervölker untereinander und mit den Reproduktionen von Höhlenmalereien vergleicht. Zwar finden sich bei den wilden Völkerschaften der geschichtlichen Zeit auch Kunstformen, die einem reinen Schmuckbedürfnis dienen; selbst Schmuck und Putz aber weisen dann noch darauf hin, daß die Form ursprünglich aus einem inbrünstig betriebenen Fetischismus stammt. Die geschnitzten Götzenbildnisse wirken immer noch wie eine zur Raumform gewordene Beschwörungsformel. Es ist ein Irrtum, wenn man diese Plastik mit einem Mangel an Können erklären will. Positive Formen lassen sich nicht negativ erklären. Natürlich spricht das Unvermögen mit; das Entscheidende ist aber der einseitige Strom des Willens. Das Wesentliche der Form besteht darin, daß sie mit einer tragisch[S. 65] anmutenden Naivität begriffen worden ist. Mit ungebrochenem Nachdruck wird z. B. das Konkave empfunden, ebenso unbedingt stellt sich das Konvexe dagegen, und so rundet sich plastisch ein Kopf, der über alles Schreckliche, Groteske und Karikaturhafte heraus von einer gewissen erschütternden Großheit ist. Da der Ausdruckswille stark ist, stellt sich wie von selbst auch die formale Wirkung ein. Es ist nicht ein Formales im Sinne einer anmutigen Schönheit, sondern ein Formales, das die Empfindungen aufrührt, das mit Geheimnis und Drohung beschwert ist und das aus einem starken Erleiden des Lebens hervorgeflossen ist. Es ist eine Form im Geiste der Gotik, ein Ornament des Willens, eine Arabeske der Leidenschaft.
**
*
Eine menschenferne Inbrunst der Anbetung hat auch gestaltend hinter den Formen der ägyptischen Kunst gestanden, obwohl diese auf einem ganz anderen Niveau steht und an das Höchste rührt, was Menschen gestaltet haben. Vom Stilpsychologen wäre vor allem die Frage zu beantworten, wie es kommt, daß die Formen der ägyptischen Kunst, die wie unter heftigen Zwangsvorstellungen immer wieder spontan entstanden zu sein scheinen, sich zugleich einer mehrere Jahrtausende währenden Konvention gehorsam gefügt haben. Die ägyptische Form gibt sich ruhig bis zur Starrheit; aber es ist eine Ruhe voll gewaltsamer Spannung, voller Schwermut und Grauen. Selten hat sich der Geist der Gotik unbedingter und größer im Plan offenbart, als in den Pyramiden — sie wirken wie stilisierte Berge —, als in den mit titanischem Formgefühl aus dem gewachsenen Felsen gehauenen Riesenfiguren,[S. 66] in denen die Stimmung der Wüstenlandschaft verdichtet erscheint und die mit einer solchen höheren Wirklichkeit dastehen, daß die lebenden Menschen zu ihren Füßen ganz kurios anmuten. Gotisch wirken die glatten, nicht einmal durch Fugen aufgeteilten Mauern der Tempel, die den Eingang festungsartig flankierenden Pylonen, die mit kühner Abstraktionskraft gezeichneten Reliefs an Wand und Säule und die wie mit stummer Drohung blickenden, in sich verschlossenen Gestalten der Plastik. Aber dann führt der Weg durch Säulenhallen mit wagerecht lagerndem Gebälk, und man weilt in einer Formenwelt, woran auch der griechische Geist großen Anteil hat. Auch dieses Griechische ist noch gotisch, was die einzelne Säule in ihrer Vertikaltendenz und mit ihren wuchtigen Formen, was die monumentale Gliederung der Gesimse beweisen; aber es ist doch die griechische Ordnung da, der griechische Ausgleich von Last und Stütze, der Sinn für das Logische, Vernünftige und Diesseitige. Die ägyptische Kunst löst das Problem, in einem übersinnlich und weltlich repräsentativ zu sein, sie ist sowohl barbarisch wie kultiviert. Der Fürst war zugleich oberster Priester; die Religion ist eine Sache des Staates geworden und gibt sich orthodox. Der Mensch betet immer noch an mittels der Kunstform, doch ist das Gebet auch eine große Geste nach außen. Die Kunst opfert der unsterblichen Seele der Abgeschiedenen, aber es werden die Opfer auch mit einem gewissen weltlichen Machtstolz dargebracht. Die religiöse Ergriffenheit hat sich so oft und so lange in denselben Gedankengängen bewegt — weil dem wie auf einer Wüsteninsel lebenden Volke von außen nie ein[S. 67] Zweifel, eine Störung kam —, bis die Gedankengänge schließlich die Kraft ewiger Gesetze angenommen haben. Daher die seltsame Mischung von gotischer Unruhe und griechischer Beruhigung. Das Leiden hat sich in Fatalismus verwandelt. Das Gotische in der ägyptischen Kunst ist ein Wille, der Kolossalität erstrebt, der die Form kantig macht, sie wie auf letzte Formeln zurückführt und das äußerlich Ungeheure auch zu einem innerlich Ungeheuren macht. Gotisch ist der leidenschaftliche Trieb eines ganzen Volkes zum Symbol, ist die Gesinnung, woraus jene Statuen hervorgegangen sind, die nicht ein Handeln oder ein Begehren ausdrücken, sondern die mit erhabener Melancholie wie in sich selbst versunken sind und, über alles Leben hinweg, ins Grenzenlose zu blicken scheinen. Gotisch ist endlich die Stimmung eines starken Sündenbewußtseins. Wie eine Unterströmung fließt überall aber auch griechischer Geist. Nicht zufällig mündet diese Kunst aus in den alexandrinischen Kolonialformen, nicht ohne Ursache ist sie stellenweis ohne harten Übergang in die dorische Form übergegangen. Die mächtige Vertikaltendenz ebbt ungezwungen ab zum Horizontalen, aus hieratischer Frontalität und marionettenhafter Reliefstrenge der Gestalten bricht eine Anmut hervor, daß es oft ist, als hebe die Form leise den Fuß zum Tanz; der Rhythmus wird gefällig, das Naturgefühl objektiver und die Modellierung sinnlicher. Nie sind mit größerem Sinn die beiden Formenwelten einander angenähert worden. Afrika, Asien und Europa sind gleicherweise in dieser Kunst; wie sie mit ihren Formen in der Folge denn ja auch mehrere Weltteile gespeist hat. Zwischen ewiger Unfruchtbarkeit[S. 68] und exotischer Fülle, zwischen Wüste und Oase ist diese Kunst geworden; sie starrt ins Nichts und ist zugleich mitten im blühenden Leben, sie ist asketisch und auch voller Animalität: sie steht ganz im Zeichen der Sphinx. In ihr ist die Brunst der Natur, ein erhabener urweltlicher Spuk und auch geistige Freiheit. Sie setzt Millionen fronende Sklavenhände voraus; während Fürsten und Priester sich aber der Sklavenheere bedienten, um Machtsymbole zu schaffen, verkörperte sich in der Form unversehens das Genie des Sklaventums. —
Eine ähnliche Stimmung ist in der babylonischen Kunst. Auch dort wächst griechischer Geist heran auf dem Boden einer grandiosen gotischen Gesinnung. Der Gedanke des Turms von Babel, von dem die Legende berichtet, ist ganz ein gotischer Gedanke; und die Idee der Stufenpyramide, die auf ihrer Spitze das Allerheiligste trug, um damit dem Himmel nahe zu sein, entspricht dem gotischen Drang zu türmen. In den bekannten assyrischen Reliefs kündigt sich in der Modellierung der Glieder die griechische Objektivität an; der unerbittliche Parallelismus, der heftige monumentale Naturalismus der Komposition aber weisen auf gotisches Temperament. Wie man denn wohl allgemein sagen darf, daß die semitische Rasse ihrer ganzen Anlage nach der heftigen Form zuneigt. Ihr ist die spekulative Inbrunst eigen, die Schonungslosigkeit gegen sich selbst und jenes Genie des Leidens, die Voraussetzungen einer gotischen Geistesanlage sind.
**
*
[S. 69]
Was in dieser Geistesanlage problematisch ist, offenbart sich nirgends stärker als in der indischen Kunst. Dort ist die Form zugleich gewaltig und unklar. Von den über Gräbern und Reliquien errichteten pyramidenförmigen Bauten bis zu den Pagoden, deren Konturen Raketenbahnen gleichen, von den Monolithen, die deutlich als Phallussymbole erkannt werden, bis zu den minarettartigen Türmen, die erst unter mohammedanischer Herrschaft gebaut worden sind: überall erhält sich der Eindruck, daß die Form im Banne einer dunkeln Dämonologie steht, daß sie immer mehr ausdrücken sollen, als Raumformen es eigentlich können. Mit unheimlichem Nachdruck, die Bewegung durch eine rippen- und rillenförmige Plastik noch steigernd, schießen eng beieinanderstehende Pagoden aus dem Boden, wie Siedelungen von Riesenpilzen; stufenförmig sind dann wieder Pyramidentürme steil hinaufgeführt, die an der Spitze in kostbaren Tempelgebäuden enden und die mit einer solchen Fülle von Form bekleidet sind, daß es Flächen nicht mehr gibt, daß man vor lauter Gliedern nicht mehr den Körper sieht: eine Vereinigung urwüchsiger Kraft mit barockem Überschwang. Die Tempelbezirke, die „heiligen Hügel“, gleichen ganzen Städten mit Mauern und Toren; Gebäude erhebt sich neben Gebäude, Turm neben Turm, alle Formen streben, zielen, züngeln nach oben, beseelt von einem fast hysterischen Höhendrang. Oder es bohren sich die Tempel basilikaförmig ins Gebirge; man betritt sie durch Türen, die wie offene Rachen von Ungetümen gebildet sind, und wird im Innern von seltsam profilierten Gewölben, von gedrückten, massigen, untersetzten Formen empfangen, die in[S. 70] anderer Weise wieder die Seele in Unruhe, Bangigkeit und Schrecken versetzen. Was an Einflüssen griechischer Art sichtbar wird, wo der bauende, meißelnde und malende Sinn versucht hat, Glieder und Gelenke, Kapitäle, Konsolen, Gesimse und Säulen zu bilden, wo Formen verarbeitet sind, die auf alten Handelswegen vom Abendland eingeführt wurden — das alles ist abgeirrt zum Grotesken und Gebrochenen. Kein Bauglied ist eigentlich funktionell, jedes einzelne ist symbolisch; aber es ist symbolisch mehr in einem dichterischen als in einem architektonischen Sinne. Alles ist gewaltsam und materialwidrig geschweift, gekuppelt und vielfach bewegt übereinander gefügt; überall gewittert die Kolossalität, ja die Monstrosität, ein Grauen geht von der schwülstigen Form aus — aber diese Form hat auch die künstlerische Kraft, das ganze Leben in ein Märchen zu verwandeln. Die indische Kunst ist mit allen Instinkten eine Sakralkunst. Wie die Naturkräfte in der Vegetation des Landes zu kochen und in der Tierwelt mit zusammengedrängter Phantasie zu arbeiten scheinen, so kreist eine tropische Urkraft auch in den Formen der Kunst. Lapidar und ausschweifend ist die Form in einem, spekulativ vergrübelt und brünstig; sie zittert vor Erotik und ist zugleich philosophisch lehrhaft. Ihr fehlt straffe Konzentration, sie fließt hier auseinander, und ballt sich dort zusammen. Alles Getier des Landes erscheint an den Tempelwänden, daneben reiche Pflanzenmotive, Konsolen und Gesimse, auf denen groteske Gestalten hocken, Reliefs und Rundplastiken, Nischen und Türmchen, Pfeiler und Säulen, Balustraden und Maßwerk — nirgends ist ein freies Plätzchen, es[S. 71] wimmelt auf der Tempelwand die Form, wie der Urschleim von werdender Gestalt wimmelt. Wie von selbst drängen sich Vergleiche auf. Romanisches scheint in der Form zu sein und Barockes, man denkt an die Dekorationslust der Frührenaissance, an ägyptisches und an das chinesische Rokoko; aber bei aller Fülle bleibt die Kunst fragmentarisch. Ihr ergeht es wie jener arischen Rasse, die von den nordwestlichen Bergen zu den Gefilden Indiens einst erobernd herabgestiegen ist und von der die ganze Bevölkerung Europas ihre Herkunft ableitet: in den Kindern erst ist zur Besinnung gekommen, was in der Mutter noch schlief. Alle europäische Philosophie und Religion weist auf das mythenreiche Indien; so weist auch vieles in der europäischen Kunst auf die ganz vom Geiste der Gotik erfüllte indische Form — auf das indische Formlabyrinth, das unter dem Druck einer ungeheuren Lebensverantwortung entstanden zu sein scheint.
Übersichtlichkeit und Gliederung kommt erst mit dem islamitischen Einfluß in die indische Kunst. Aus der Durchdringung geht eine klarere, zierliche Romantik hervor. Mit hundert Erkern baut sich eine Fassade auf, so daß die Straße wie mit tausend Augen angesehen wird. Mit graziöser Bestimmtheit steigen nun die heiligen Türme empor, von märchenhaft reich gemeißelten Kranzgesimsen und Balustraden stockwerkartig geteilt. Neben dem Buddhatempel erhebt sich die Moschee und der mehr griechisch gegliederte Gräberbau. Die Formen werden mehr tektonisch, das Ornament sinkt in die Fläche hinein, der Charakter der Bauwerke wird heiterer und weltlicher in dem Maße, wie Allah über Buddha siegt. Auch jetzt bleibt noch[S. 72] ein gotischer Grundton — wie ja die ganze islamitische Kunst, vom Morgenland bis tief hinein nach Spanien, immer reich gewesen ist an Zügen einer gotischen Ausdruckslust; aber die Problematik ist überwunden. Ein Eroberervolk, das leicht im Sattel war, hat die einer ausschweifenden Phantasie hingegebene Rasse der Inder nicht nur mit dem Schwert besiegt, sondern auch kulturell.
**
*
Eigenartig ist der Anteil, den der Geist der Gotik an der Kunst Ostasiens hat, deren Mutterland China ist. In der chinesischen Kunst erkennt man zwei verschieden gerichtete Tendenzen, die sich aber gut vertragen, ja, sich sehr eigenartig zu einem Stilorganismus verbunden haben. Die Baukunst wird beherrscht von entschiedenen Horizontaltendenzen. Die Gebäude breiten sich durchweg flach aus, die Bauweise ist leicht, dem Material fehlt die zur Monumentalität nötige Schwere, der Grundriß ordnet die Räume nebeneinander und bringt sie auf klare Achsen. Wo sich mit entschiedener Vertikalbewegung die Pagoden erheben, da handelt es sich im wesentlichen um indischen Einfluß, der zugleich mit dem Buddhismus eingedrungen ist. Auf der andern Seite gibt sich nun aber ein fast zügelloser Wille zum Ornament kund, die Lust an einer eigenwilligen, naturalistisch abstrakten Dekoration. Dieser Überschwang und der fast frugale Sinn in allem rein Tektonischen widersprechen sich im Grunde, und die Folge ist ein Kompromiß. Ein Kompromiß, der dem Chinesen aber nicht zum Bewußtsein kommt. Die Folge[S. 73] ist, daß der Geist der Gotik in der chinesischen Kunst nicht monumental auftritt, sondern mehr im ästhetischen Spiel. Er gibt sich eigentlich nur in den Einzelkünsten zu erkennen, in der Malerei, der Plastik, dem Kunstgewerbe: er ist im Baudetail, nicht im Ganzen der Baukunst. Man versteht am besten, wie die Mischung zustande gekommen ist, wenn man sich das europäische Rokoko, dessen gotische Freiheit auf dem Boden einer klassizistischen Baukunst herangewachsen ist, im Raum und in der Zeit vervielfältigt und gesteigert denkt. Auch die geistige Disposition ist hier und dort verwandt. Das religiöse Gefühl des Ostasiaten scheint letzten Endes auf einer dunkeln Dämonologie zu beruhen, auf dem Glauben an Naturgottheiten und auf Ahnenkult. Die philosophische Mystik des Buddhismus konnte Einfluß gewinnen, weil die Seele des Chinesen dafür bereit war. Auch in seinem Gemüt wohnt das geheime Grauen, auch seine Religiosität hat den Leidenszug und ist eben darum aggressiv und heftig. Zugleich aber ist der Chinese von einer feinen natürlichen Klugheit, die ihm Mäßigung und Überlegenheit gibt; er ist auch ein kultivierter Verstandesmensch, ein philosophischer Moralist und als solcher ein Skeptiker von Natur. Neben Buddha, ja über Buddha gar stellt er Laotse und Konfutse, die beiden großen Nationalweisen. Auch deren Weisheitssprüche haben für ihn die Kraft religiöser Grundsätze. Der Chinese ist ein Weisheitsfreund, der in der Phantasie mit Naturdämonen verkehrt. Wie die Detailform an das Rokoko erinnert, so hat die geistige Verfassung eine gewisse Ähnlichkeit mit der der Enzyklopädisten des achtzehnten Jahrhunderts. Dieser geistreiche,[S. 74] philosophische Intellektualismus hat dem religiösen Sinn der Chinesen das Revolutionäre, das Fanatische genommen, er hat das religiöse Gefühl temperiert; und damit ist auch die Gebärde der Kunst, die Form, anmutig geworden, alles urweltlich Heftige hat sich in nationale Eigenwilligkeit verwandelt, das Elementare ist kokett geworden, der Drang zum Unbedingten ist spielerisch, das Groteske kostbar, das Hieratische graziös und die Fülle raffiniert geworden. Das Gotische wird von einem ganzen großen Volke Jahrtausende hindurch als eine Art von Zopfstil erlebt. Die gotische Form tritt nicht in Bauwerken oder groß modelliert auf, sondern mehr ziseliert, geschnitzt, gezeichnet und gemalt. Eine Fülle von Phantastik, Romantik, Naturalismus, Abstraktion ist in dem Formgekräusel der Ornamentik; aber es überschreiten diese Eigenschaften niemals doch die Grenzen des Ornaments. Die ganze Zierkunst steht gewissermaßen im Zeichen des Drachens; aber sie scheint auch immer eingeschlossen wie von einem festen Rahmen. In der Malerei geht das Naturgefühl auf das Charakteristische; doch rundet sich dieses immer in der geistreichsten Weise den dekorativen Wirkungen zu. Aufs äußerste wird die künstlerische Handschrift gepflegt. Die Malerei wird zu einem virtuosen Exerzitium mit dem Pinsel, jeder Pinselstrich hat struktive Bedeutung. Dargestellt wird von der Malerei immer nur der Augenblick; doch untersteht diese Augenblickskunst einer strengen Konvention, die so wenig schwankt, daß das Neuere dem Ältesten noch durchaus verwandt ist. Alles in der chinesischen, im weiteren Sinne in der ostasiatischen Malerei wird beherrscht vom Willen zu jener Stimmung,[S. 75] die das Objekt vernichtet, um es neu zu schaffen. Die Bilder sind wie „Gedichte ohne Worte“. Alles: Mensch, Tier, Pflanze und Landschaft, ist für die Augennähe dargestellt, ist auf mittlere und kleine Formate gebracht, und doch ist die Form nie kleinlich, die Skulpturen sind wie Hieroglyphen, das Götzenhafte selbst gibt sich blumenhaft still. Der gotische Geist drückt sich in dieser Kunst vorwiegend lyrisch aus, er offenbart sich in Arabesken, die wie das Spiel einer vom ewigen Geheimnis lebenden Weisheit sind. Wir sehen ein Volk, das es verstanden hat und noch versteht, seine gotischen, seine barbarischen Instinkte mit Raffinement zu genießen, das es versteht, seine Leiden ästhetisch auszukosten. Nach außen hat sich dieses Volk mit einer Mauer umgeben, und nach innen hat es sich wirksam vor der Selbstverzehrung gehütet.
**
*
Wenn wir uns der Kunst in Europa zuwenden, so fällt es auf, daß vor allem das Tempo ein anderes ist. In Asien sind tausend Jahre oft wie ein Tag gewesen; dort sind von alters her große Völker über weite Landstrecken verteilt, es haben nicht, wie in Europa, unaufhörlich Wanderungen, Beeinflussungen und Durchdringungen stattgefunden. Darum haben sich dort die Stilformen mehr konstant erhalten. Dafür fehlt aber auch die Steigerung, die ehrgeizige Veredlung. Wenn man alle Form, die der Geist der Gotik hervorbringt, als die Form des Leidens anspricht, so ist zu beachten, daß der Europäer anders leidet als der Asiat. Der Europäer ist ein Mensch[S. 76] der Aktivität, darum leidet er heftiger, aber auch kürzer; seine Ungeduld drängt die Leiden dramatisch zusammen, in seinen Leiden ist Sehnsucht nach Glück, es ist ein Kampf voller Affekt und Leidenschaft. Der asiatische Mensch leidet mehr passiv, mehr in der Form einer geduldigen Schwermut, einer etwas trägen Melancholie. Sein Leiden setzt sich um in Fatalismus. Darum fügt sich auch seine Kunstform so unbedingt einer die Jahrhunderte, ja die Jahrtausende beherrschenden Konvention. In den asiatischen Künsten tritt die Kunstform des Leidens, die ihrer Natur nach eigentlich spontan ist, immer mehr oder weniger erstarrt auf; sie hat viele Züge des Monomanischen und ist ethnographisch bedingt. Der Zustand des Leidens ist chronisch, im Gegensatz zur europäischen Kunst, wo der Geist der Gotik sich mehr akut äußert. Damit hängt es dann auch zusammen, daß in der asiatischen Kunst die Formen des gotischen und des griechischen Geistes fest miteinander verbunden erscheinen, wogegen in Europa ein dauernder Kampf stattfindet und immer wieder neue Versuche gemacht werden, die beiden Formenwelten fest gegeneinander abzugrenzen.
Ganz gelungen ist diese grundsätzliche Trennung freilich keinem europäischen Stil. „Leid will Freud, Freud will Leid!“ Ein reines Glück, ein reines Leiden gibt es nicht; darum gibt es auch kaum einmal irgendwo die ganz reine Form. Man kann selbst in der Kunst der alten Griechen, also recht eigentlich im Gebiete des griechischen Geistes, eine heimliche Gotik konstatieren. Und zwar findet man manches von der gotischen „Stimmung“ nicht nur in den dorischen Ordnungen, nicht nur in den[S. 77] archaischen Werken, die noch auf ägyptische Einflüsse weisen, sondern es bricht die Form des Affektes selbst in einigen Werken der klassischen Reife hervor. Manche Formführung der Vasenmalereien oder der Tanagrafiguren ist kaum noch griechisch, im Sinne, wie das Wort hier gebraucht wird, zu nennen. Die Gewalt der Form in den Gewändern der sitzenden und liegenden weiblichen Gestalten im Ostgiebel des Parthenon ist fast schon als ein erhabenes Barock anzusprechen, also auch als eine Form aus dem gotischen Empfindungskreis. Die „weise Mäßigung“ war nicht dauernd durchzuführen, das Temperament einzelner Künstler suchte immer wieder die Grenzen zu überschreiten. Überall, wo die Form in der Kunst der Griechen beängstigend groß oder heftig wird, äußert sich der Geist der Gotik. Aber es geschieht wider Willen, weil der eingeborene Trieb zuweilen stärker ist als die Absicht. Grundsätzlich hat der Grieche die Hälfte der menschlichen Empfindung seiner bildenden Kunst ferngehalten. Er hat, wie Pandora, die Übel des Daseins in eine Büchse verschlossen, um die Freuden desto reiner zu genießen. Daß es im wesentlichen gelungen ist, macht ihn zum Helden der Kunstgeschichte; während es aber gelang, konnte er nicht verhindern, daß auf geheimnisvolle Weise zuweilen auch die Formen des Leidens aus der Spitze des Werkzeuges unversehens hervorsprangen.
**
*
Das römische Reich hat die griechische Form in jeder Weise übernommen; doch hat sich daneben immer auch mehr oder weniger[S. 78] eine eingeborene barbarische Leidenschaftlichkeit, ein kühner Wirklichkeitssinn und eine aggressive Unbedingtheit des Willens erhalten. Am Anfang und am Ende der römischen Kunst hat sich auch der gotische Geist mit einer gewissen nachdrücklichen Gewalt durchgesetzt. Die etruskische Kunst ist ganz erfüllt von einer geheimen Gotik, so viel Anteil auch die griechische Kolonialform äußerlich daran hat. Selbst die Künstler aus Griechenland, die im etruskischen Italien die Grabkammern ausgemalt und die Grabfiguren modelliert haben, sind dem Einfluß einer düsteren, schweren Hadesfurcht, einer fast ägyptischen Abstraktionskraft und wilden Unmittelbarkeit der Anschauung unterlegen. Das Lapidare der etruskischen Form hat zuweilen etwas Erschreckendes. Die Form ist bis zum Bersten angefüllt mit individuellem Leben, ein roher, aber erhabener Weltschmerz ist darin enthalten, sie illustriert das Gefühl von Menschen, denen das Leben unheimlich war, und legt mit visionärer Sicherheit in die Abbilder der Wirklichkeit etwas Monumentales. Man begegnet Einzelformen, die man fast gleichlautend später im Romanischen und Gotischen wiederfindet. Etwas Antigriechisches, etwas Nordisches ist in der etruskischen Kunstform: eine werdende Nation spricht in Urlauten.
Dann kam das Reich der Römer. Die Kunst der Griechen wurde übernommen, ihre Werke wurden als Beute im schnell erstarkenden Rom aufgehäuft, eklektizistisch genutzt, unendlich vervielfältigt und dem Etruskischen verbunden. Da aber die Kunstform der Griechen bis zur Vollkommenheit bereits ausgebildet war, so hat in Rom nicht eigentlich eine Fortentwicklung auf[S. 79] derselben Linie stattfinden können. Das wahrhaft Eigentümliche des römischen Geistes ist erst wieder in der Kaiserzeit hervorgetreten, als das Bewußtsein der Macht und ein riesenhaftes Selbstgefühl die Römer vom griechischen Genie, von der griechischen Kultur unabhängiger werden ließen, als der Millionenstadt Bauaufgaben größten Stils gestellt wurden. Je mehr sich die römische Baukunst in ihrer Spätzeit dem Nutzbau, dem Kolossalbau zugewandt hat, desto mehr sind auch die ursprünglichen etruskischen Instinkte wieder erwacht. Diese Einsicht wird dem Heutigen erleichtert, weil im Laufe von zwei Jahrtausenden die äußere Haut griechischer Kunstformen von den Bauwerken der römischen Kaiserzeit abgeblättert ist und nur noch die gewaltigen Baukerne stehengeblieben sind. Was ich in meinem „Tagebuch einer italienischen Reise“[3] das Amerikanische der römischen Baukunst genannt habe, das bis zum Symbolischen gesteigerte groß Profane, das zweckhafte Monumentale in den Brückenbauten, Basiliken, Thermen, Stadtmauern, Aquädukten und Gräberbauten, im Pantheon und Kolosseum — das ist eine Manifestation des gotischen Geistes, weil es die Äußerung eines heftigen Willens ist. Diese Bauten der Spätzeit sind weit entfernt von der Mäßigung und Harmonie der griechischen Architektur. Man erblickt eine unerhörte Fähigkeit des Mauerns und Wölbens, mit ingenieurhafter Leichtigkeit werden Riesenspannungen bewältigt. In diesem kriegerischen Willensvolk muß damals eine Unruhe gewesen[S. 80] sein, wie sie dem Tode vorhergeht. Denn wie aus zehrender Unrast heraus sind diese prahlenden Babelgedanken der Baukunst entstanden. Niemals vorher ist in Rom so stark das Soziale gefühlt worden, wie damals, als in der Großstadtbevölkerung die Idee des Christentums wie ein Sauerteig zu arbeiten begann. Selbst das von den Cäsaren Geschaffene hat eine stark demokratische Note. Nachdem Rom jahrhundertelang fremde Kunstwerte zusammengerafft hatte, hat es am Ende einen Großstadtstil geschaffen, voll riesenhafter Sachlichkeit und voll von Zügen des gotischen Geistes.
Dieser Geist spiegelt sich auch in dem großzügigen Naturalismus der Bildnisskulptur, in vielen barock aufgelösten Formen der Wandmalereien und in dem Zug zum Illusionistischen, zum Stimmungshaften, der die plastischen Dekorationen mehr und mehr beherrscht. Überall bricht am Ende einer Epoche, die nach außen ganz dem griechischen Geist gehört hat, die charakteristisch-groteske Form hervor, und an ein Ende knüpft sich bedeutungsvoll ein Anfang.
**
*
Denn jetzt trat das Christentum stilbildend hervor, und damit wurde recht eigentlich die gotische Kunstform in Europa anerkannt.
Formal freilich wirkte die römische Tradition und alles Griechische noch lange fort, denn die Form wandelt sich langsamer als die Gesinnung, das Feste langsamer als das Flüchtige, wie die Luft sich schneller erwärmt als das Wasser. Die Gewöhnung[S. 81] des Auges und der Hand können durch einen anders gerichteten Willen nicht so bald und nicht vollständig aufgehoben werden. Aber ein vollständiger Stilwandel mußte doch eintreten, weil die fortwirkende römische Form nun einer andern Tendenz dienen mußte, weil die alte Sprache benutzt wurde, Gedanken auszusprechen, die vorher nicht einmal gedacht worden waren. War vorher viel Gotisches heimlich schon in der herrschenden griechischen Form gewesen, so war das Verhältnis nun so, daß Griechisches offensichtlich in der gotischen Stilform erhalten blieb. Wenn man in Kunstgeschichten liest, den Künstlern der frühchristlichen Epoche seien die technische Sicherheit und der strenge Kunstsinn der Römer verlorengegangen, der neue Primitivismus sei auf einen Mangel am Können zurückzuführen, so ist das ein Irrtum. Die Völker haben, wie die Individuen, stets die Begabung ihrer Interessen, das heißt, sie können immer, was sie wollen — was sie wollen müssen; und sie vermögen das außerhalb ihres Interessenkreises Liegende um so weniger zu vollbringen, je bestimmter der Wille sich äußert. Zwitterhaft ist die frühchristliche Kunstform nicht aus Mangel an Können, sondern weil ein außerordentlich starkes neues Lebensgefühl sich der antiken Sprache bedienen mußte. Das Griechische und Gotische haben in den Jahrhunderten der christlichen Kunst mächtig miteinander gerungen, zwei Weltanschauungen haben einen Kampf um die Form ausgetragen. In diesem Kampf mußte der Geist der Gotik siegen, weil das Schwergewicht der Kunst verlegt war: es wurde verlegt von außen nach innen, vom sinnlich Objektiven in das Erlebnis[S. 82] der Seele. Man kann es so ausdrücken: früher war der Mensch in der Welt gewesen, als ein Teil davon, jetzt war die ganze Welt nur noch im Menschen, sie galt nur noch, insofern sie gedacht, empfunden und sittlich gewertet wurde. Das mußte zu einer Umwertung der Form führen. Die Form mußte abstrakt und ausdrucksvoll werden, sie mußte zur Hieroglyphe einer religiösen Mystik werden und sich zugleich, wenn sie sich nicht im Unbestimmten verlieren sollte, gründlich naturalisieren. Sie mußte zeichnerisch bestimmt werden, weil sie die Idee umschreiben sollte, und sie mußte zugleich stimmungshaft sein, um transzendentale Vorstellungen verwirklichen zu können. Sie mußte weltfern, menschenfern sein und doch auch wieder unmittelbar nahe am Leben. Ein neuer Darstellungsstoff kam in die Kunst: die religiöse Legende. Diese Aufgabe war mit der griechischen Form nicht zu lösen. Die Form sollte nun die Eigenschaft haben zu erzählen, etwas Zeitliches sollte in ideale Raumwerte verwandelt werden. Wie die griechische Form den Zustand dargestellt hatte, so sollte die gotische nun den inneren Vorgang darstellen. Aus diesen Gesichtspunkten wurde die römische Stilform von der frühchristlichen Kunst verwandelt. Da lag es nun aber nahe — um so mehr als der Sitz der christlichen Macht in Byzanz den äußeren Anlaß gab —, auch orientalische Einflüsse an der Stilbildung teilnehmen zu lassen. Denn die orientalische Form hat, wie gezeigt worden ist, von Natur Züge gotischer Art; ihr ist jener Leidenszug eigen, dessen Monumentalisierung die Kunst der frühen Christen so leidenschaftlich erstrebte. Zum dritten endlich traf der Wille zu einem[S. 83] neuen Stil, nachdem er im Orient befruchtet worden war, im Norden und Westen Europas überall auf die ursprüngliche Ornamentik kaum schon zivilisierter Völker, auf die abstrakten, ersten Kunstäußerungen der germanischen und keltischen Rassen, auf jene merkwürdige Drachenromantik und Liniensymbolik, die ihrem ganzen Wesen nach gotischer Art sind. Und auch dieses verleibte die frühchristliche Kunst sich ein.
In welcher Weise die Elemente gemischt und zur Einheit gezwungen worden sind, erkennt man vor den Miniaturmalereien und Mosaiken der ersten zehn christlichen Jahrhunderte am besten. Der Ursprung der Miniatur läßt sich zurückverfolgen bis in die hellenische Kolonialstadt Alexandria, bis zu Einflüssen aus der ägyptischen Kunst; er liegt weiterhin in den Mönchsklöstern des Südostens — womit der Mönch zum erstenmal als Künstler in der Geschichte auftritt —, und es führt der Weg dieser Kunst dann durch Europa bis an die westlichsten Grenzen. Es klingt die Stimmung der späten römischen Malereien aus, es tritt die hieratische Strenge und die Unendlichkeit des orientalischen Formempfindens hervor, und es mischen sich die Charaktere einer fetischhaften germanisch-keltischen Ornamentik hinein. Und Ähnliches gilt von den Mosaiken, die wie vergrößerte Miniaturen wirken, während den Miniaturen wieder die Monumentalität der Mosaiken zuweilen innewohnt. Es spricht für die Größe und Reinheit des bildenden Willens, daß weder hier noch dort eine Spur von illustrativer Banalität vorhanden ist, trotzdem es sich um die Darstellung epischer Stoffe handelt. Nicht nur die Technik hat die Mosaiken davor bewahrt,[S. 84] unmonumental zu werden, sondern die auf höchste symbolische Gestaltung gerichtete Gesinnung der Künstler und der Gemeinde. Das Mosaik an der gewölbten Decke und an der kaum gegliederten Wand wirkt raumbildend in all seiner Legendenromantik; es ist architektonisch und hat nichts vom Tafelbild. Die Formen, die Gestalten treten hervor, als hätte der Raum selbst sie hervorgebracht, als hätte er sich in ihnen gleichnishaft zusammengezogen. Die Farben ahmen in keiner Weise die Natur nach; auch sie haben eine architektonische Funktion zu erfüllen, sie wölben den Raum höher, dehnen ihn ins Ungewisse und machen aus jeder Apsis ein kostbar schimmerndes Allerheiligstes. Doch sind die Gestalten auch wieder weit mehr als nur architektonisch: sie sind Träger tiefsinniger Menschlichkeit. Sie stehen wie in sich erstarrt nur da, sind einer uniformierenden Konvention nur unterworfen, weil das heimliche Seelenleben sonst leicht alle Form sprengen könnte, weil ein heftiger Ausdruckswille sich vernichten würde, wenn er sich nicht selbst in Fesseln schlüge. Die strenge Form ist ein Selbstschutz. In der Starrheit gärt ein Wille, der begierig war, eine ganze Welt nach seinem Bilde neu zu gestalten. Der Allgemeinbegriff Gotik zieht sich hier zusammen in seine Urzelle: er weist auf das Volk der Goten, dessen Bildungskraft sich an der römischen Kunst entzündete und sich von den letzten Griechen belehren ließ.
Auch in den Bauwerken erkennt man den neuen Willensimpuls, so unscheinbar, puristisch und sektenhaft sie sich in den ersten christlichen Jahrhunderten auch gegeben haben. Auf antiken Resten oft fußend, von römischen und orientalischen[S. 85] Überlieferungen lange noch abhängig, kam immer stärker doch der Wille zur Wölbung, das heißt, der Wille zur Höhe, zum Ausdruck, wurde immer deutlicher der Trieb erkennbar, die Achsenwirkung so zu übersteigern, daß der Blick zwischen Säulen und Pfeilern wie durch einen Korridor zu einem mystischen Zielpunkt gewaltsam hingerissen wurde. Das konnte um so unbedingter in dem Maße geschehen, wie die neue Religion nun Angelegenheit des Staates wurde und wie die Kirche, der Ritus als Grundrißbildner auftraten. Schüchtern wagt sich dann auch der Turm hervor, der im Kunstgebiet des gotischen Geistes eine so wichtige Rolle spielt. Überall zeigt sich der Wille, den Betrachter aus dem glücklichen Gleichmaß des Gefühls aufzuschrecken und ihn gewaltsam in Bewegung zu setzen. Die Empfindung wird in die Höhe hinaufgeführt oder mit fast schmerzhaft starkem Rhythmus vorwärtsgeschnellt, sie wird mystisch betäubt oder hart an die Grenzen des Daseins erinnert. Je langsamer und gemessener scheinbar die Gebärde der Form ist, um so mehr ist sie geladen mit Bewegung, Unruhe und Sehnsucht.
**
*
Dieser frühchristliche Stil ist recht eigentlich eine Kunst der Gemeinde, eine Kundgebung des Laiengenies. Er hätte sich von den fremden und den antiken Einflüssen sicher ganz frei gemacht, wenn es schon in seiner Macht gelegen hätte. Daß diese Selbstbefreiung vom griechischen Kunstgeist aber auch in den folgenden Jahrhunderten, in jener Epoche, die man die[S. 86] des romanischen Stils nennt, nicht gelungen ist, daß auch dann noch neben der erstarkenden Gotik der Sinn für griechisches Gleichmaß immer einhergegangen ist, daß der Drang zum Vertikalen immer wieder ausgeglichen worden ist von der Horizontaltendenz und daß der romanische Stil in seinen repräsentativsten Bauten zu einem imposanten Kompromiß geworden ist: dafür sind andere Gründe entscheidend gewesen. Auch geistig sind am sogenannten Romanischen zwei Kräfte beteiligt. Die religiöse Bewegung drang in immer fernere Länder, immer größere Volkskomplexe wurden davon ergriffen, der Erlösungsdrang einer ganzen Menschheit nahm bald teil an der neuen Lebensidee. Dadurch wurde das gotische Empfinden außerordentlich gestärkt und ins Monumentale hinaufgetrieben; die Kunst repräsentierte mehr und mehr mit dem Religiösen und Symbolischen auch eine Machtidee, der Kollektivwille war begierig, sich selber Denkmale großer Art zu schaffen. Zugleich aber büßte das schön erregte Laiengefühl in dem Maße, wie es staatlich organisiert wurde und wie große Völker daran teilnahmen, etwas ein, das man die soziale Unschuld nennen könnte. Je weiter das neue Christenreich sich ausdehnte, desto mehr bedurfte es der Organisation, brauchte es einen regierenden Klerus, ein geistiges Oberhaupt und Exekutivbeamte. Jede Herrschaft aber hat die Tendenz, weltlich zu werden. Und jede weltliche Gesinnung wird irgendwie die griechische Form in der Kunst bevorzugen. Auf die Herrschgewalt des Klerus, der sich seine Baumeister und Bildhauer selbst in den Klöstern erzog, wie er sie haben wollte, auf die hierarchische Organisation des[S. 87] tausendjährigen Christentums ist denn auch jene griechische Formenwelt zurückzuführen, wovon das Gotische im romanischen Stil überall durchdrungen wird — am meisten im Kirchenbau, am wenigsten im profanen Burgenbau. Sehr deutlich kann man freilich den romanischen Stil nach Ländern unterscheiden und hier mehr ein Vorwiegen des gotischen, dort mehr des griechischen Geistes konstatieren; dennoch ist dieser Stil eine allgemein christlich klerikale Kunst und im wesentlichen übernational. Er geht dem engeren Staatsgefühl, dem Nationalbewußtsein vorher. Es ist der Stil eines neuen Glaubens und darum im Ursprung ganz volkhaft; die Ausführung aber lag in den Händen mönchischer Künstler, die der Ordensdisziplin unterstanden, die als Träger der Bildung und Kultur nach Rom blicken mußten und von Kloster zu Kloster, von Land zu Land wanderten, die nationalen Sonderbedingungen wohl berücksichtigend, aber auch nur soweit es sich eben tun ließ. Die Ausführung des riesenhaften gotischen Baugedankens ging aus von einer Geistlichkeit, die sich in der Kirche von der Gemeinde mehr und mehr absonderte. Diese ängstliche Sorge für die Rangordnung, die der christlichen Idee letzten Endes widerspricht, brach auch künstlerisch den unbedingten Willen. Es wurden zum Beispiel in der Kirche dem durch die Raumgasse des Mittelschiffs auf den Altar stürmisch zueilenden Blick künstlich Schranken und Hemmungen in den Weg gestellt; es wurde mit der Basilika zuerst ein Säulen- und Pfeilersaal geschaffen, in dessen Tiefe das Allerheiligste glüht, und dann wurde der Gemeinde verboten sich zu nähern. Dieser Widerspruch, der naturgemäß im Grundriß sowohl wie[S. 88] im Aufriß der heiligen Gebäude formalen Ausdruck finden mußte, ist bezeichnend für den romanischen Stil überhaupt. Niemals sind in Europa der Geist der Gotik und des Griechentums mächtiger und kampflustiger aneinandergeraten, niemals ist ein Kompromiß größeren Sinnes geschlossen worden. Es ist noch heute ergreifend, dem Wettstreit zuzusehen von leidenschaftlichem Höhenwillen und besonnener Horizontalordnung, von modellierendem und zeichnendem Formgefühl. Die Baukörper sind klar und groß gegliedert, immer läßt sich vom Äußeren der Grundriß deutlich ablesen, und alle Teile fügen sich in tektonischer Ordnung zusammen; dann brechen aus der Masse aber auch steil und wuchtig die Türme hervor, als hätte sich das Temperament nicht länger zügeln lassen. Auf der einen Seite sieht man strebende und lagernde Teile sich ausgleichen, ruhige Flächen sich ausbreiten, alles Ornamentwerk sich bündig einordnen und die Motivationspunkte der Konstruktion beleben; man sieht überall die Merkmale eines gebundenen Raumsystems, sieht mit Hilfe von festen Säulen- und Pfeilerordnungen ideale Raumeinheiten wiederkehren und die Symmetrie sich durchsetzen. Auf der andern Seite gibt es nicht ein einziges Bauwerk, worauf man weisen und sagen könnte: dieses ist der romanische Typus; die Bauweise schwankt fortgesetzt, der Wille ist ewig im Fluß, mit stetig sich erneuernder Kühnheit wird der Raum hoch und höher gewölbt, wird die Masse mehr und mehr aufgelockert, werden die Ornamentformen immer mehr zu Arabesken des Ausdrucks. Eines beschränkt immer das andere. Ganz unbedingt tritt der Geist des Gotischen nur in der Zweckarchitektur,[S. 89] in den festungsähnlichen Anlagen der Zeit zutage. Schmucklos, dräuend steigen die Mauern, Türme, Bastionen und Torbauten empor, wie Symbole der Wehrhaftigkeit. Von diesen düster großartigen Bauwerken erhalten zuweilen ganze Landschaften den Charakter. Die Form hat etwas Gebirgeartiges.
Selten ist ein Kompromiß so fruchtbar geworden wie in der romanischen Kunst. Die beiden Urkräfte der Kunst drängen gewaltsam gegeneinander, und da keine nachgeben will, sieht es aus, wie wenn zwei Ringer, die in Wahrheit beide ihr Letztes hergeben, unbeweglich in einer schönen Gruppe dastehen.
**
*
In dem Stil, der von der Kunstgeschichte im engeren Sinn als Gotik bezeichnet wird, ist die Form des heftigen Willens dann ganz eindeutig hervorgetreten. Dieser Stil ist formal eine Reinkultur, er ist eine der wenigen absoluten Formschöpfungen der Geschichte, er hat primären Charakter, ist die Tat einer Zeit und einer Rasse, in denen das Genie des Leidens aufs höchste schöpferisch geworden, die Tat einer Phantasietätigkeit, die fort und fort von heiliger Unruhe gespeist worden ist. In der Epoche, die ungefähr das dreizehnte, vierzehnte und zum Teil auch das fünfzehnte Jahrhundert noch umfaßt, ist die Welt vom Menschen neu entdeckt worden, das Leben ist vom Temperament, von einer rastlosen Sehnsucht, von Erkenntniskraft und Freiheitsgefühl, von einem elementaren Wachstumstrieb in neuer Weise gesehen worden; mit neuer Heftigkeit ist[S. 90] der uralte Kampf der Seele mit den Wirklichkeiten ausgekämpft worden. Der gotische Stil ist ein formaler Niederschlag jener Lebensgesinnung, die später in den Historien vom Doktor Faust zum Ausdruck gekommen ist, ein Niederschlag jenes Willens, der jedem Individuum die ganze Verantwortung für das Leben aufbürdet, der jeden einzelnen schonungslos mit der Gottheit ringen läßt und ihn selbständig einen Weg zu suchen zwingt durch die Irrsale des Daseins. Hinter dem gotischen Stil steht eine Gesinnung, die man als einen schöpferischen Protestantismus bezeichnen kann. Die Schöpfer dieser Kunstform hatten den Sinn der Urchristen — und zugleich waren sie Opfer einer scharfen Skepsis. Sie konnten in einem Atem anbeten und lästern, glauben und zweifeln; sie standen erregt zwischen Gott und Teufel da, zwischen Mystik und Rationalismus, zwischen Grauen und Überlegenheit. Die Menschen erwachten in jener Zeit zu sich selbst. Nicht zur Objektivität; das geschah erst in der Renaissancezeit, als die Menschen sich intellektuell vom All zu scheiden begannen, als sie Distanz zu den Dingen und zu sich selber nahmen. Aber zum Gefühl ihres Lebens, ihrer Selbstverantwortung, ihrer Macht und diktatorischen Befugnis erwachten die Menschen. Sie wurden in einer erhabenen Weise neugierig; sie begannen zu fragen. Das machte sie alle im Geiste schon zu Protestanten, lange schon vor dem Ereignis, das die Geschichte als Reformation bezeichnet. Nicht zu kritischen, purifizierenden, sondern zu schöpferischen Protestanten. Das Laiengenie erwachte, der Volkswille trat als Bauherr und Bildner auf. Der Stil, der Gotik heißt, ist recht eigentlich ein Volksstil,[S. 91] er ist demokratisch, er hat den Rhythmus eines erregten Kollektivwillens und die Linie des Freiheitsdranges. Denn der Freiheitsdrang hatte noch nicht zersetzend gewirkt, er hatte die Masse nicht auseinandergesprengt, sondern zusammengeschweißt, weil er nicht aus der Reflexion, sondern aus dem Gefühl kam.
Die Rasse, die die neue Formenwelt geschaffen hat, wohnte in den nördlichen Ländern Europas. Sie kehrte eben aus den Kreuzzügen mit freierem Blick, reichen Erfahrungen und gefestigtem Willen zum Eigenen zurück, erfüllt vom Eifer jungen Erkennens, von der Freude am Wissen, am Denken, am Können; sie litt gewissermaßen unter der Fülle aufgespeicherter Kraft und sehnte sich nach Entladung. Da sich das Leben jetzt in den Städten zu zentralisieren begann, da die Begabungen miteinander in engste Berührung kamen, mußte der Schöpfungsakt mit explosiver Heftigkeit vor sich gehen. Wie ein Wunder entstand, sich emportürmend über die aufschäumenden Volksmengen, eine reich gegliederte, von nie gesehenen Reizen verklärte Baukunst. Hatte der herrschsüchtig denkende Priestersinn die ruhige Größe der romanischen Bauten gefördert, so schuf sich das seiner Tüchtigkeit, seiner Selbstbefreiung freuende Laientum den phantastisch reichen Gedanken der Gotik. Dieser Gedanke ist germanischen, ist im engeren Sinne fränkischen Ursprungs. Niemals hätte der der griechischen Ordnung hingegebene Geist der Romanen eine solche Überfülle der Bildnerlust gewagt, nie hätte er das Spitzbogenprinzip ersinnen und so phantasievoll exakt anwenden können, nie hätte er diese[S. 92] mystisch tiefen Gewölbegrotten des Raums, diese Wälder von Pfeilern, dieses üppige Geranke von kletterndem Ornament, nie hätte er die Willkür in der Ordnung und die Ordnung im scheinbar Regellosen gewagt. Die Gotik ist in allen ihren Formen ungriechisch. Der Pfeiler steht der Säule als ein Kunstgebilde anderer Art gegenüber, die glatt abschließende Decke hat keine Beziehung zur spitz strebenden Wölbung, die griechische Proportion hat in jeder Weise andere Wirkungsgesetze als die gotische. Alle Arbeitsbedingungen sind anders. Der Stein wurde entmaterialisiert, die Schwere wurde scheinbar aufgehoben, die Wand wurde vernichtet, die Raumgrenze ungewiß gemacht, und alles zielte auf eine Stimmungssynthese. Die schwierigsten Probleme sind mit einer Leichtigkeit gelöst, als sei es ein Nichts. Die Bildhauer und Maler sahen sich Legendenmotiven gegenüber, die für einen im Geiste des Griechentums erzogenen Künstler überhaupt nicht zu lösen sind, die ihn widernatürlich und unsinnlich anmuten müssen; eben aus den Schwierigkeiten haben die Gotiker aber ein neues Stilgefühl, einen neuen Formencharakter von schlagender Ausdruckskraft abgeleitet. Dem Künstler war keine Idee zu unsinnlich, kein Motiv zu grotesk oder zu naturalistisch, keine Konstruktion zu kühn, keine Masse zu ungeheuer, kein Affekt zu stark, keine Fülle zu groß: alles bewältigte er, brachte er organisch zusammen, so daß die Formenwelt aus Gottes Hand hervorgegangen zu sein scheint. Die Formen sind des höchsten Pathos fähig, der Wucht, der Gewalt eines fast schmerzhaften Rhythmus; aber sie bergen auch einen frühlingshaften Reichtum, das Zarte, das Zierliche[S. 93] und Kokette. Sie beginnen romanisch ernst und endigen mit barockem Überschwang. Die Linie kann ägyptisch starr sein, doch auch geistreich beweglich und übermütig wie die chinesische Linie oder wie das Rokoko. Alles einzelne wird beherrscht von der Vertikaltendenz und ist zugleich voller Rastlosigkeit. Die Formen streben, steigen, klettern, wachsen und züngeln nach oben. Oder sie verschlingen sich, fliehen in sich selbst zurück und kreisen in unablässiger Bewegung. Niemals ruht die Form aus, alles an ihr ist Leben und Affekt. Dieselbe Temperamentslinie umschreibt menschliche Figuren, Fensterwölbungen, Kreuzblumen und Turmsilhouetten, das Große und Kleine untersteht demselben Formgesetz. Die ganze Natur, das ganze Leben ist in diesem Transzendentalgedanken, der Gotik heißt: das Erhabene und Groteske, das Häßliche und Schöne, das Geschaute und Gedachte, Natur und Unnatur, das Wirkliche und Phantastische, Menschen, Tiere und alle Pflanzen der Umwelt, Teufelsbestien, Madonnen und Blumen. Eines lebt durch das andere; die Architektur ist Skulptur, und die Skulptur ist ganz architektonisch. Die Gotik kennt nur das Gesamtkunstwerk; sie ist eine Mutterkunst und eben darum eine Volkskunst im höchsten Sinne.
Die Bewegung war so mächtig, daß sie auch nicht gleich aufzuhalten war, als die Renaissancegesinnung heraufkam, als die einige Kunst in Künsten auseinanderfiel, die Persönlichkeit mehr isoliert hervortrat und als, infolge einer halb wissenschaftlichen Objektivität, die griechische Formenwelt wieder bevorzugt wurde. Die Gotik wirkte fort, durch die ihr innewohnende Schwungkraft. Die Ausdruckslust zuckte den nordischen Künstlern[S. 94] lange noch im Handgelenk, auch als sie sich bereits der italienisierten Formen bedienten. Diese italienischen Formen wurden unversehens umgebildet, sie wurden gotisiert und gerieten dabei nicht selten ins Pittoreske und Manierierte. Vor allem aber wirkte der gotische Drang fort in einzelnen bedeutenden Persönlichkeiten, in nordischen Naturen, die Gotiker im Temperament waren, die sich nun aber in eine halb griechische Formenwelt versetzt sahen. In einem Maler wie Dürer ist das Gotische mit dem Griechischen eine höchst merkwürdige Verbindung eingegangen; ein Künstler wie Grünewald steht wie in der Mitte da zwischen Gotik und Barock; und in den Niederlanden erweisen sich Naturen wie van der Goes oder Brueghel als schöpferische Gotiker trotz ihrer Renaissance. Das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert sind reich an Auseinandersetzungen zwischen den beiden Formenwelten. Durch den gegebenen Dualismus sieht sich das Genie gezwungen, eine persönliche Synthese zu finden. Dabei tauchen in Fülle wunderschöne Einzelprobleme auf, die alle in ihrer Weise der Erkenntnis vom Wesen des gotischen Geistes etwas hinzufügen.
**
*
Die Geschichte der Renaissance, wie sie sich vor allem in Italien abgespielt hat, ist im ganzen eine glänzende Manifestation des griechischen Geistes. Nicht, weil die Formen der antiken Kunst aufgenommen und neu bearbeitet worden sind, sondern weil der Italiener der Renaissance dem alten Griechen menschlich verwandt war, weil er ähnlich wie dieser empfand, dachte und[S. 95] wollte. Es ist bezeichnend, daß der Ablauf der italienischen Renaissancekunst ganz ähnlich gewesen ist wie der der alten griechischen Kunst, daß man für jeden repräsentativen italienischen Künstler fast ein Gegenbild in der griechischen Kunst nennen kann. Dennoch hat auch jetzt wieder der Geist der Gotik Einfluß gewonnen und, ebenso wie in Griechenland, vor allem zu Beginn und am Abschluß der Epoche. In der Mitte wird das Gotische nur noch als Persönlichkeitsäußerungen in einzelnen Werken sichtbar.
Abgeleitet sind die Formen der jungen italienischen Kunst vom frühchristlichen Stil. Das will also sagen: von einem Stil, der der geistigen Stimmung nach durchaus gotisch war, im rein Formalen aber vielfach auf römische Überlieferungen zurückging. Was in den Bildern der Sienesen oder Giottos und seiner Schule gotisch wirkt, ist ebenfalls mehr die Gesinnung als die konkrete Form. Die gotische Stimmung kommt zustande, weil bestimmte Akzente der Form betont und andere Akzente unterdrückt erscheinen. In Wahrheit ist schon in den Werken der Frühitaliener viel von dem Renaissancegeist, der im folgenden Jahrhundert zur Herrschaft gelangen sollte; es kündigt sich schon die Freude an der singenden und klingenden Linie an, die Lust an der objektiven Naturanschauung, an einer schönen Weltlichkeit und an der architektonischen Rhythmisierung aller Teile. Aber dieser Instinkt scheint noch streng beherrscht von religiöser Disziplin, von einer welt- und menschenfernen Inbrunst, von einem Befehl des Gewissens, die leidende Kreatur darzustellen. Seltsam mischen sich das schwere Pathos des christlichen[S. 96] Weltschmerzes und der bel canto heidnischer Lebensfreude. Die Gestalten stehen noch da als Träger tragischer Schicksale, aber sie wandeln sich auch mehr und mehr um zu schönen Körpern, die nichts wollen als nur da sein. Das sich auflösende Urchristentum kämpft mit dem immer mächtiger heraufkommenden Staatskatholizismus. Nordisch Germanisches und südlich Romanisches erscheinen eng verbunden; in der Kunst spiegelt sich die politische Situation der Zeit ab. An den Palazzobauten hat die zweckhafte Monumentalität des nordischen Burgenbaues ebensoviel Anteil wie eine neu erwachende Lust an heiterer griechischer Ordnung, sie halten die Mitte zwischen charakteristisch symbolischen und szenarisch repräsentativen Wirkungen. Die Plastik verkörpert noch Ideen und seelische Impulse, aber sie möchte auch schon das Leben an sich darstellen. Die Künste sind schon innerhalb eines neuen Griechischen, aber sie sind noch von strenger dorischer Gesinnung erfüllt. Und das Dorische ist eine Form des Gotischen.
Mit ganz anderem Charakter tritt das Gotische am Ende der Renaissancebewegung wieder hervor, nachdem es sich zwei Jahrhunderte lang nur in einigen Werken grüblerischer oder heftiger Persönlichkeiten in seltsamen Verkleidungen hervorgewagt hatte. Es tritt hervor, ohne die bis dahin gültige griechische Formensprache preiszugeben, es äußerte sich, indem es die Renaissanceformen verändert, übersteigert und mit Unruhe erfüllt: es tritt hervor als Barock. Dieser Stil ist lange Zeit als eine „Entartung“ der Renaissance angesprochen worden, in Wahrheit ist er aber etwas Neues, er stellt eine seltsame Renaissance der Gotik[S. 97] dar auf den Grundlagen griechischer Formen. Der Vorgang war so, daß ein neuer geistiger Impuls in die europäische Menschheit kam, eine neue Erregung. Das Barock ist nur zum Teil eine Alterserscheinung, ist es nur insofern, als die Unruhe des Zweifels, der Skepsis und der Hoffnungslosigkeit darin zum Ausdruck kommt; zugleich manifestiert sich im Barock aber auch der Wille eines neuen Zeitalters, einer sich intellektuell und sozial verjüngenden Weltanschauung. Aus dieser Begegnung von Müdigkeit und Frische, von Griechischem und Gotischem ist einer der merkwürdigsten Mischstile entstanden, die die Kunstgeschichte kennt. Im Barock tritt wieder, wie in der Gotik, nur weniger rein und naiv, weniger allgemeingültig, ein schöpferischer Protestantengeist hervor. Michelangelo, der diesem Stil entscheidende Geburtshelferdienste geleistet hat und in dem der Kampf des gotischen mit dem griechischen Menschen in tragischer Weise fast verkörpert erscheint, war ein geistiger Aufrührer, ein Rebell, er war ganz und gar Unruhe. Und nicht anders empfanden die Künstler, die nach ihm kamen, im Süden und Norden. Daß in der Folge die Jesuiten vor allem das Barock in den von ihnen gebauten Kirchen reich entwickelt haben, spricht nicht gegen den gotischen Zug im Barock. Die Jesuiten, als Führer der Gegenreformation, lenkten in ihrer Weise die Religion wieder der Mystik, der Tiefe, der Empfindung zu, sie erstrebten wieder Einfluß auf die desorientierte Seele. Sie waren im Geistigen kühn und unbedingt, kühner in manchem Gedanken als die Nachfolger Luthers und anderer Reformatoren. Sie gaben die Kirche der Gemeinde zurück und ließen das Langhaus[S. 98] wieder aufleben, den gotischen Basilikagedanken. Nicht zufällig gewannen die Klöster, wie im Mittelalter, wieder Einfluß auf die Kunstgesinnung. Die Kunst sollte wieder einer überweltlichen Idee dienen. Freilich haben die Jesuiten die neue Form oft in theatralischer Weise ausgestaltet, haben sie veräußerlicht, gehäuft und haben ebensosehr die Betäubung wie die Ergriffenheit des Laien angestrebt. Aber sie haben den neuen Stil trotzdem mächtig gefördert und geholfen, wieder ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, in dem jedes Teilchen Bezug zu einem romantisch großen Ganzen hat. Man darf das, was hier Protestantengesinnung genannt wird, nicht gleichsetzen mit dem, was die Kirchengeschichte so nennt. Die Träger jenes Protestantismus, der hier gemeint ist, sind nicht nur die von den Gemeinden bestellten Pastoren der evangelischen Kirche im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert gewesen, sondern es waren auch die Jesuiten und alle anderen Orden, die der Verweltlichung der Religion entgegenarbeiteten. Vor allem aber waren es die Gelehrten, die Dichter wie Klopstock, Wieland, Lessing, Herder, Goethe und Schiller, Philosophen wie Kant und Leibniz, Musiker wie Bach und Beethoven. Um nur von Deutschen zu reden. Dieses sind die wahren, nicht kanonisierten Heiligen der protestantischen Kirche. Und diese alle waren ihren Instinkten, ihren Schöpfungskräften nach Barockmenschen. Trotzdem einige von ihnen theoretisch den griechischen Geist verherrlicht haben. Sie alle, die Freidenker und die Jesuiten, waren in verwandter Weise neue Gotiker, weil sie sich begegneten in einer neuen Art von Scholastik. Sie alle waren Vertreter eines[S. 99] neuen Willens, einer neuen intellektuellen Romantik, Vertreter einer neuen Sehnsucht. Und dasselbe gilt von den bildenden Künstlern. Rembrandt ist ganz ein Barockkünstler, das heißt also ein Gotiker, so gut wie Shakespeare es als Dichter war. Eine heimliche Gotik ist in den großen Bildniswerken des Franz Hals, wie sie in anderer Form in dem barocken Formenrausch des Rubens ist. Es ist schon bezeichnend, daß das Barock sich nicht in Italien am reichsten entfaltet hat, trotzdem Michelangelo sein Ahnherr ist und Maler wie Tintoretto und dessen spanischer Geistesverwandter Greco dem neuen Stil sein gotisches Geheimnis mit herrlicher Gewaltsamkeit entrissen haben, sondern daß die nordischen Länder recht eigentlich der Boden für das klassische Barock geworden sind. Dem Italiener war dieser Stil, der auf neue Verinnerlichung abzielte, trotzdem er so heroisch und brünstig auch die laute Wirkung suchte, nicht dauernd notwendig, wohl aber den germanischen und den mit germanischem Wesen gemischten Völkern. Dem nordischen Temperament war dieser leidensselige, phantasievolle Stil einer spekulativen Selbstberauschung, war dieser Drang zur Fülle, war diese Selbstverschwendung, dieser romantische Formalismus notwendig. Zwei Bedingungen kamen zusammen und steigerten sich: ein neues Freiheitsgefühl und eine erhöhte Genußfähigkeit, bürgerliche Tüchtigkeit und höfische Repräsentation. Die reinste, wenn auch nicht stärkste Form des Barock, das Rokoko, ist keineswegs nur der Stil einer Hofgesellschaft; es ist im Kern ganz bürgerlich, ganz vom gotischen Instinkt erfüllt. Jede Form stammt vom bürgerlichen Talent. Man könnte das Rokoko den Stil[S. 100] der Enzyklopädisten nennen, jener klugen Atheisten, Pantheisten, Aufklärer und Vorläufer der großen Revolution, die der Zeit ein neues geistiges Gepräge gegeben haben — trotzdem vom Rokoko zugleich auch der Puder, der Reifrock und Galanteriedegen nicht fortzudenken ist. Aus dieser doppelten Tendenz, einer geistigen und einer gesellschaftlichen, erklärt sich die Bravour, die Routine, die Virtuosität des Rokoko und des Barock überhaupt; es ergibt sich daraus das Gekünstelte im Ursprünglichen, das Gewagte und Maßlose neben dem Eleganten und Schmeichelnden, das Kokette in der Abstraktion der Form. Johann Sebastian Bach ist ebenso gotisch, ebenso barock, wie Johann Daniel Pöppelmann, der Erbauer des Dresdener Zwingers. Wo immer man auf barocke Architekturen blickt, erkennt man, wie unter den Einzelformen italienischer Art ein gotischer Wille atmet. Der Vertikaldrang läßt sich von den horizontalen Gesimsführungen nicht aufhalten, alles endigt wieder irgendwie in Turmgedanken. Nicht ohne Ursache ist die Treppe eines der liebsten Motive der Architekten dieser Zeit. Trotz der tektonisch gedachten Einzelteile ist das Ganze mit mächtigem Pathos wie aus der Masse heraus modelliert; und trotz der Renaissancetraditionen streben die Achsen der Grundrisse mit einer Macht auf ihr Ziel zu, daß der Betrachter gewaltsam fortgerissen wird und daß die Achse eines Gebäudes zuweilen zur Orientierungslinie eines ganzen Gebäudekomplexes wird. Das Gotische im Barock ist der Größen- und Ausdehnungsdrang nach der Höhe und Tiefe, ist die Lust an der ekstatischen Wirkung, ist die Freude am Vielfältigen, am reich Dissonierenden[S. 101] und der Trieb zur Synthese, zum Gesamtkunstwerk, ist die Übersteigerung des Rhythmus, die Verwischung der Raumgrenzen, wozu Architektur, Plastik und Malerei gleichermaßen helfen müssen; gotisch ist die mit Kuppeln, Hallen und Wandelgängen arbeitende, von Prachtwirkungen träumende Bauphantasie, ist die ganz auf Stimmung, auf Lichtwirkungen und Entmaterialisierung bedachte Baugesinnung. Der Raum wird ungewiß, über das Sein siegt der Schein, die Entfernungen sind nicht mehr zu messen, die Luft selbst wird zum Element der Architektur. Gotisch ist endlich der mächtige, wildbrandende Wellenschlag der Form, ist die nach Stimmung lüsterne Abstraktion darin und der Kampf, den sie dem Auge darbietet.
Zur höchsten Stilreinheit hat das Barock es freilich nicht gebracht. Diese Formenwelt war künstlich aus zwei Teilen zusammengesetzt. Die Weltlichkeit der Mächtigen gebrauchte den erwachenden bürgerlichen Freiheitssinn zu ihren Zwecken; und das bürgerliche Genie diente noch der Autorität. Darum fehlt die höchste Selbstverständlichkeit, die letzte Einheit; darum wurde dieser Stil auch in der Folge so gründlich mißverstanden. Die Empfindung, die das Barock geschaffen hatte, reichte nicht aus, um das heraufkommende Zeitalter der bürgerlichen Selbständigkeit zu regieren. Dazu bedurfte es noch einer anderen Eigenschaft: der Bildung — einer alle einzelnen befreienden, revolutionierenden und arbeitstüchtig machenden Bildung. Als sich diese Bildung dann aber am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ausbreitete, erstickte sie das künstlerische Temperament, ließ sie nicht Raum für naives Formgefühl.[S. 102] Die Folge war, daß das Wissen um die griechische Form aushelfen mußte, daß die lateinische Sprache auch in der Kunst gewissermaßen zur europäischen Gelehrtensprache wurde. Die Menschen brauchten Ruhe, um den ungeheuren Lehrstoff der Zeit verarbeiten zu können. Darum konstruierten sie sich ein beruhigendes Vollkommenheitsideal und folgten ihm als Nachahmer.
Doch davon ist im ersten Kapitel, wo die Lehre vom Ideal untersucht wurde, schon die Rede gewesen.
**
*
Die letzte Manifestation des gotischen Geistes fällt in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Sie ist sehr merkwürdig und psychologisch folgendermaßen zu erklären.
Die absichtsvoll geförderte moderne Bildung mit ihrer einseitigen Geistesdisziplin hat das kritische Vermögen stark entwickelt, hat zugleich aber auch die intuitiven Fähigkeiten verkümmern lassen. Der empirisch vorgehende Verstand hat alle Erscheinungen des Lebens zergliedert, hat sie wissenschaftlich erklärt und nur das Beweisbare gelten lassen; die ganze Natur ist mechanisiert worden, bis sie vor dem Geist der Bildungshungrigen dastand wie ein berechenbares Produkt von Ursachen und Wirkungen, von „Kraft und Stoff“. Es sind im neunzehnten Jahrhundert große Fortschritte in der Erkenntnis dessen gemacht worden, was sich reflektiv bewältigen läßt; erkauft sind diese Fortschritte aber durch eine radikale Entgötterung. Welt und Leben sind ihres Geheimnisses beraubt worden, sie hörten für die einseitig Intellektuellen auf, das große Wunder zu sein. Die Folge davon war, daß mehr und mehr, trotz des Stolzes auf die[S. 103] neuen Errungenschaften, die Stimmung einer tiefen Verzweiflung um sich griff. In dem Maße, wie die Welt in ihren kausalen Zusammenhängen scheinbar verständlicher wurde, wuchs auch der Pessimismus. Die Mystik des Lebens schien unwiederbringlich verloren, der Glaube war im Tiefsten erschüttert; jedermann meinte hochmütig dem Schöpfer in die Werkstatt sehen zu können; und der Mensch ist ja nun einmal so geartet, daß er nicht länger verehrt, was er zu fassen imstande ist, weil er die eigene Beschränktheit zu genau aus dem ständigen Verkehr mit sich selber kennt. Während das Gehirn triumphierte, wurde die Seele elend. Langsam spürten die Menschen, daß ihnen ein innerer Schatz abhanden gekommen war, daß sie unvermerkt zu Fatalisten geworden waren. Das Vertrauen auf sittliche Endziele des Lebens ging verloren, und von den Gipfeln exakter wissenschaftlicher Wahrheiten starrte der Bildungsmensch in das absolute Nichts.
Als dieser Zustand gefährlich zu werden drohte, hat der menschliche Geist wieder einmal aus eigener Kraft ein Heilmittel, hat er etwas wie ein geistiges Serum produziert. Es gelang ihm, wie es ihm im Verlaufe der Geschichte schon unzählige Male gelungen ist, die Schwäche in eine Kraft zu verwandeln, aus der lähmenden Passivität der Seele eine neue Aktivität, aus dem Leiden eine neue Willenskraft zu gewinnen. Als der Mensch verzweifelt in die von seinem eigenen Verstand entgötterte Welt starrte, begab es sich, daß sich in einer neuen Weise das große Erstaunen wieder einstellte. Zuerst war es nur ein Erstaunen über die grausame Phantastik der Situation, über die Kälte der[S. 104] Lebensatmosphäre, dann aber wurde wahrgenommen, wie eben in dieser Gefühllosigkeit des Lebens eine gewisse Größe liegt, daß im Zentrum dieser eisigen Gleichgültigkeit eine Idee gefunden wird, von der aus die ganze Welt neu begriffen werden kann. Das neue Wundern, das über den Menschen kam, richtete sich nun nicht mehr auf das Einzelne der Natur, denn dieses glaubte man ja ursächlich verstehen zu können, sondern es richtete sich auf das Ganze, auf das kosmische Spiel der Kräfte, auf das Dasein von Welt und Leben überhaupt. Mit diesem sich erneuernden philosophischen Erstaunen aber tauchten zugleich merkwürdige Urgefühle auf, Empfindungen von urweltlicher Färbung. Ein neues Bangen und Grauen stellte sich ein, eine tragische Ergriffenheit. Hinter der vom Verstand entgötterten Welt erschien eine neue große Schicksalsgewalt, eine andere, namenlose Gottheit: die Notwendigkeit. Und als diese erst gefühlt wurde, da stellte sich auch gleich eine neue Romantik ein. Die Einbildungskraft trat nun hinzu und begann die Erscheinungen mit den Farben wechselnder Stimmung zu umkleiden. Alle zurückgehaltenen Empfindungen brachen hervor und nahmen teil an der neuen, aus einer Entseelung erwachsenen Beseelung der Welt. Auf dem höchsten Punkt hat sich das analytische Denken von selbst überschlagen und hat der Synthese Platz gemacht, das Verstehen ist einem neuen Erleben gewichen.
Die Kunst aber ist recht eigentlich das Gebiet geworden, auf dem dieses moderne Welterlebnis sich dargestellt hat. Wie neben der einseitigen Bildungskultur, neben der Verehrung der Erfahrung als Höchstes der Eklektizismus, die Nachahmungssucht,[S. 105] die Unselbständigkeit und ein falscher Idealismus einhergegangen sind, wie alle Künstler dieser Geistesart mehr oder weniger zur Sterilität verdammt gewesen sind, so ist von dem neuen großen Erlebnis des Gefühls, von dem produktiv machenden philosophischen Erstaunen eine eigene optische Sehform abgeleitet worden. Diese Sehform, aus der ein moderner Kunststil hervorgegangen ist und die in wenigen Jahrzehnten in großen Teilen Europas zur Herrschaft emporgestiegen ist, wird in der Malerei Impressionismus genannt. Die Sehform entspricht genau einer Form des Geistes; dieses moderne Geistige aber ist seiner seelischen Beschaffenheit nach gotischer Art. Der Impressionismus ist die letzte Form des gotischen Geistes, die bisher historisch erkennbar wird. Gotisch ist der Impressionismus, weil auch er das Produkt eines erregten Weltgefühls ist, weil ein Wille darin Form gewinnt, weil die Form aus einem Kampf entspringt, weil er in die Erscheinungen die seelische Unruhe des Menschen hineinträgt und weil er die künstlerische Umschreibung eines leidenden Zustandes ist. Alles im Impressionismus ist auf Ausdruck, auf Stimmung gestellt; die Darstellung des Atmosphärischen ist nur ein Mittel, Einheitlichkeit und Stimmung zu gewinnen; dieser Stil ist neuerungslustig, revolutionär und hat von vornherein im heftigen Kampf mit leblos gewordenen Traditionen gestanden. Auch im Impressionismus hat die Kunst wieder protestiert und geistig vertiefend gewirkt. Sie hat den Blick von der griechischen Normalschönheit der Klassizisten heftig abgelenkt. Zudem handelt es sich um eine ganz bürgerliche Kunst, um eine Offenbarung des Laiengenies.[S. 106] Diese neue Sehform geht nicht dem Häßlichen aus dem Wege, sondern sie hat das sozial Groteske geradezu aufgesucht; sie ist naturalistisch und romantisch in einem, sie spürt im Unscheinbaren das Monumentale auf und im Besonderen das Kosmische. Der einfache Entschluß zu neuer Ursprünglichkeit hat eine moderne Formenwelt geschaffen, der Wille, die Erscheinungen als Eindruck naiv wirken zu lassen, hat einen Stil gezeitigt, in dem der Geist des Jahrhunderts sich abspiegelt.
Auch in der Baukunst ist dem Klassizismus und Renaissancismus des neunzehnten Jahrhunderts eine neue Gotik gefolgt. Sie äußert sich in dem Interesse für groß begriffene und symbolhaft gesteigerte Zweckbauten, die den Zug zum Weltwirtschaftlichen, der unserer Zeit eigen ist, verkörpern; sie äußert sich in einer neuen Neigung zum Kolossalen, Konstruktiven und Naturalistischen, in der entschiedenen Betonung des Vertikalen und der ungebrochenen nackten Formen. Gotisch ist das Ingenieurhafte der neuen Baukunst. Und wo sich die Architekten um rein darstellende Formen bemühen, um Ornamente und motivierende Zierformen, da geraten sie wie von selbst in eine heftige Bewegungslust, sie kultivieren die abstrakte Form und das Ausdrucksornament. Die Linienempfindung weist unmittelbar oft hinüber zum Mittelalter und zum Barock, ohne daß man aber von Nachahmung oder nur von Wahltradition sprechen dürfte. Das am meisten Revolutionäre ist immer auch das am meisten Gotische. Und die profanen Zweckbauten nehmen, wo sie ins Monumentale geraten, wie von selbst oft Formen an, daß man an Fortifikationsbauten des Mittelalters denkt. Ein[S. 107] unruhiger Drang nach Mächtigkeit, der die ganze Welt erfüllt, gewinnt in den Speicherbauten, Geschäftshäusern und Wolkenkratzern, in den Industriebauten, Bahnhöfen und Brücken Gestalt; in den rauhen Zweckformen ist das Pathos des Leidens, ist gotischer Geist.
Überall freilich ist die neue gotische Form auch innig verbunden mit der griechischen Form. Denn das Griechische kann, nachdem es einmal in Europa heimisch geworden ist, nie wieder vergessen und ganz aufgegeben werden; immer wird es irgendwie Anteil behalten und gegenwärtig sein. Denn es enthält Lösungen, die sich dem menschlichen Geiste um ihrer Allgemeingültigkeit willen aufs tiefste eingeprägt haben. Es wird unmöglich sein, die griechische Form jemals wieder ganz aus der europäischen Kunst zu entfernen. Jede neue Manifestation des gotischen Geistes wird auf Mischstile hinauslaufen. Entscheidend wird es für diese Mischstile aber sein, wo der Nachdruck liegt, ob die Gesinnung mehr der griechischen Ordnung oder dem gotischen Ausdruckswillen zuneigt. Daß auch die ihrer Herkunft nach griechische Form im Sinne einer gotischen Gesamtstimmung benutzt werden kann, hat dieser flüchtige Gang durch die Geschichte bewiesen. Er beweist auch, daß der Geist der Gotik unendlich verwandlungsfähig ist, daß er in immer neue Formen zu schlüpfen vermag und doch stets er selbst bleibt, daß er immer und überall bildend am Werk sein wird, wo der Willensimpuls einer Zeit, eines Volkes oder eines schöpferischen Individuums sich unmittelbar in Kunstformen verwandelt.
[S. 108]
Ich begnüge mich mit diesen Anmerkungen über die Stilbewegungen des gotischen Geistes und mache mit Bewußtsein dort halt, wo die Kunst von den Lebenden nicht mehr historisch gewertet werden kann. Ich vermeide es, von der neuesten Kunst zu sprechen und von dem, was darin wieder auf eine Form des gotischen Geistes hinzuweisen scheint; ich vermeide es, das Wort „Gotik“ zum Schlagwort eines Programms zu machen und mit Forderungen als ein Führer zu neuen Zielen des gotischen Geistes hervorzutreten. Jedes hat seine Zeit und seinen Platz. Man kann als ein heftig Wollender vor sein Volk hintreten, kann ihm neue Ziele weisen, die man als segensreich erkannt hat, und kann die Besten zur schöpferischen Unruhe, zu neuen Elementargefühlen aufzuwiegeln suchen. Oder man kann, wie es in diesem Buch versucht worden ist, rein der Erkenntnis folgen, kann versuchen, im höchsten Sinn sachlich zu sein und naturgeschichtlich zu forschen, wie die künstlerisch bildende Kraft des Menschen beschaffen ist. Aber man kann nicht beides zugleich tun. Es versteht sich, daß der heftig Wollende nicht seine Erkenntniskraft unterdrücken kann und soll und daß der Erkennende nicht aufhören kann, einen persönlichen Willen zu haben. Die Betonung muß aber dort auf dem Willen, hier auf der Erkenntnis liegen, wenn nicht eine heillose Verwirrung aller Begriffe die Folge sein soll.
Von dieser Verwirrung haben wir genug gesehen, haben wir übergenug noch heute vor Augen. Die unendliche Unordnung[S. 109] des Formgefühls, die bezeichnend für das neunzehnte Jahrhundert ist, kann auf eine solche Vermengung des Willens und der Erkenntnis zurückgeführt werden. Die Kunstwissenschaft, die berufen ist, der Erkenntnis allein zu dienen, hat geglaubt, sie müsse führen, müsse dem Künstler, dem Volke das Ideal zeigen und ein Gesetz des künstlerischen Schaffens aufstellen. Und die Kunst anderseits, die ganz ein Kind des Willens ist, hat sich aufs Gebiet wissenschaftlicher Erkenntnis begeben und hat dort ihre beste Kraft: die Sicherheit der instinktiven Entscheidung und die Unbefangenheit eingebüßt.
Es muß endlich wieder begriffen werden, daß alle Kunstwissenschaft, ob sie die Kunst nun historisch, formenkritisch oder psychologisch untersucht, nur konstatieren darf. Sie kann nur empirisch hinter der Produktion einhergehen und aus einer gewissen Distanz anschauen. Die Kunstwissenschaft darf keinen Willen, keine programmatische Absicht haben: sie hat Naturgeschichte zu treiben und alle persönlichen Sympathien und Antipathien dem Objekt unterzuordnen. Es ist so, wie es in dem Gedenkblatt Wundts auf Karl Lamprecht heißt: „Vorauszusagen, was die Zukunft bringen wird, ist nicht Sache des Kunsthistorikers, und ebensowenig fühlt er sich gedrungen, für etwas Partei zu ergreifen, was sie bringen könnte oder sollte.“ Darum darf der Kunsthistoriker nicht diese Form ablehnen und jene bevorzugen. Paßt irgendeine geschichtlich gewordene Kunstform in eine Kunsttheorie nicht hinein, so ist damit nichts gegen die Kunstform bewiesen, sondern nur etwas für die Enge der Theorie. Auch Formen der Natur können ja nicht abgelehnt[S. 110] werden; Kunstformen aber sind mittelbare Naturformen. Für die Kunstwissenschaft besteht das Ideal darin, jenem imaginären Punkt außerhalb des irdischen Getriebes nahe zu kommen, von dem Archimedes träumte. Es darf für sie keine Rücksichten, keine Grenzen geben, das Leben, die Kunst müssen ihr zu einem ungeheuren Ganzen werden, und jedes Stück Kunstgeschichte muß sein wie der Ausschnitt einer Universalgeschichte der Kunst. Auch der patriotische Standpunkt hat keine Geltung. Das Wunder, wie alle Rassen, Völker und Individuen an dem ewigen Leben der Kunstform beteiligt sind, ist zu groß, als daß es nationalistisch eingeengt werden dürfte. Muß aber so der nationale Standpunkt aufgegeben werden, das heißt, darf der wissenschaftlich Erkennende an dem triebartigen Willen seiner Nation nicht einmal teilnehmen, um wieviel weniger darf er da seinem kleinen persönlichen Willen, dem Trieb seiner Natur folgen und ihn in scheinbar sachliche Argumente ummünzen!
Ganz anders aber als der Kunstgelehrte steht der Künstler da. Er bedarf keiner Kraft so sehr als des Willens. Er kann Neues nur schaffen, kann die lebendige Form nur hervorbringen, wenn er sich einseitig für bestimmte Empfindungsmassen entscheidet, wenn er eine Wahl trifft und rücksichtslos ablehnt, was seinen Trieb zu hemmen imstande ist. Der Künstler darf sich nicht nur für ein bestimmtes Formideal entscheiden, sondern er muß es tun, er darf nicht objektiv werden, sondern muß lieben und hassen. Es ist sein Recht, unter Umständen seine Pflicht, ganze Stilperioden abzulehnen, ja zu verachten; nämlich dann,[S. 111] wenn seine Schöpfungskraft dadurch gewinnt. Er darf geschichtlich gewordene Formen der Kunst für seine Zwecke ändern, aus ihrem organischen Verband reißen und umgestalten, sofern sein Verfahren nur zu etwas wertvoll Neuem führt. Auch darf er alle Mittel anwenden, um seine Zeit mitzureißen. Lebt der Wissenschaftler von der Vergangenheit, so zielt der Künstler in die Zukunft, geht jener empirisch vor, so verfährt dieser intuitiv. Um neue Formen, einen neuen Stil zu schaffen, muß er spontan sein bis zur Gewaltsamkeit; er kann als Handelnder nicht, wie der betrachtende Gelehrte, Gewissen haben. Die Wahl wird ihm zur Pflicht in dem Augenblick, wo er sich für bestimmte Formen entscheidet; aus der Fülle der Möglichkeiten muß er die eine Möglichkeit greifen, die ihm selbst, die seinem Volke, seiner Zeit gemäß ist.
Möchten sich dieses unsere Kunstgelehrten ebensowohl wie unsere Künstler endlich gesagt sein lassen. Möchten jene ihre Hände von der Kunst des Tages lassen, die sie mit ihren Theorien nur verwirren, und diese auf den Ehrgeiz, wissenschaftliche Kenner des Alten zu sein, endgültig verzichten. Und möchten die Kunstfreunde sich klar werden, daß sie wohl beim Künstler wie beim Gelehrten stehen können, ja sogar abwechselnd bei diesem oder jenem, daß sie es aber nicht zur selben Zeit mit beiden halten können, ohne weiterhin Verwirrung zu stiften. Was uns not tut, sind reinliche Abgrenzungen. Diese Mahnung steht nicht ohne Grund am Schluß dieses Buches. Sie soll, soweit es möglich ist, verhindern, daß dieser kurze Beitrag zu einer Naturgeschichte der Kunst programmatisch ausgenutzt wird, daß sich[S. 112] auf ihn die berufen, die im Gegensatz zum griechischen nun ein gotisches Ideal verkünden möchten, und daß auch diese Arbeit mit zur Ursache wird, das Wort „Gotik“ zum Modewort von morgen zu machen. Diese Gefahr droht seit einiger Zeit. Man spricht vom gotischen Menschen, von der gotischen Form, ohne sich immer etwas Bestimmtes dabei vorzustellen. So sehr ich selbst als wollender Deutscher, als triebhaft empfindendes Individuum für die Zukunft mit jenen Kräften in Deutschland, ja in Europa rechne, die vom Geiste der Gotik gespeist werden, so sehr empfinde ich auch die Gefahr, die darin liegt, wenn dem Worte „gotisch“ allgemeiner Kurswert zuteil wird. Das Wort könnte dem Gedanken schaden, ja könnte ihn in falsche Bahnen lenken. Wenn der Geist der Gotik sich in den kommenden Jahrzehnten wieder eigentümlich manifestieren will, so ist es am besten, das Wort „Gotik“ wird als Programmwort überhaupt nicht genannt. Im stilgeschichtlichen Sinne wird das Neue um so ungotischer aussehen, je gotischer es dem innersten Wesen nach ist. Soll schon ein Programm verkündet werden, so kann es nur dieses sein: Klarheit über das Vergangene gewinnen, mit eisernem Willen, das eigene Lebensgefühl zu formen, in die Zukunft gehen und, weder dort noch hier, sich vom Wort, vom Begriff tyrannisieren lassen!
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig.
Fußnoten:
[1] Auch der alte Streit, wie im Drama die Zeit begriffen werden soll, ist nicht zu lösen, wenn man die eine Art richtig und die andere falsch nennt. Auch hier handelt es sich um dieselben beiden Stilprinzipien. Denn es herrscht der große, naturgewollte Dualismus der Form nicht nur in den bildenden Künsten, er ist vielmehr auch in den Künsten der Zeit nachzuweisen. Und naturgemäß hängen von dem Stilprinzip auch in der Dichtung und in der Musik alle Einzelformen ab. Der Dramatiker, der im Sinne des griechischen Menschen die Einheit des Raumes und der Zeit als Grundsatz anerkennt, wird von diesem Prinzip aus sein Drama im Ganzen und in allen Teilen aufbauen müssen; seine Handlung wird durch den Zeitsinn ein besonderes Tempo, eine bestimmte Gliederung, eine eigene Motivation erhalten, sie wird ganz von selbst zur Konzentration, zur Typisierung und zur Idealisierung neigen. Wogegen das Zeitgefühl, wie es zum Beispiel in den Dramen Shakespeares so charakteristisch zum Ausdruck kommt, die Handlung auflockern muß; es muß die Handlung weniger dramatisch und mehr lyrisch und romantisch-episch machen, dafür aber auch mehr theatralisch wirksam — mehr sensationell in ihrer psychologischen Sprunghaftigkeit. Es gibt ein Drama des gotischen, des barocken Geistes (seine Entwicklungslinie ist von den alten christlichen Mysterienspielen bis zur Shakespearebühne und weiter bis zur Romantik zu verfolgen), und es gibt eines des griechischen Geistes, beide Formen aber sind — unterschieden bis in die Temperamentsfärbungen der Verse sogar — in ihrer Art notwendig, beide können klassisch sein, weil es zwei Arten von künstlerischem Zeitgefühl gibt. Es ließen sich überhaupt die beiden Formenwelten in allen Künsten nachweisen — auch in der Musik —; man könnte, von dem fundamentalen Gegensatz ausgehend, eine Naturgeschichte der ganzen Kunst schreiben.
[2] Die Entwicklung drückt sich formal etwa so aus, wie Heinrich Wölfflin es in seinem Buch „Kunstgeschichtliche Grundbegriffe“ dargelegt hat. Wölfflin hat, als vorsichtiger Historiker, der keinen Schritt tut, bevor er den Boden untersucht hat, der seine Theorie tragen soll, den Weg vom einzelnen Kunstwerk aus gewählt. Er hat in seinem Buch die Formen und Formwandlungen des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts untersucht; dem Leser überläßt er es, von den gewonnenen Erkenntnissen auf das Ganze zu schließen. Seine Feststellungen lassen sich im wesentlichen als allgemeingültig bezeichnen. Um die Metamorphosen innerhalb eines Stils zu bezeichnen, hat er fünf Begriffspaare gebildet, die sich folgendermaßen gegenüberstehen: 1. das Lineare und das Malerische, 2. das Flächenhafte und das Tiefenhafte, 3. die geschlossene und die offene Form, 4. Vielheit und Einheit, 5. absolute Klarheit und relative Klarheit. Mit diesen Gegensätzen läßt sich in der Tat operieren. Doch könnte man vielleicht noch den viel zu wenig bisher beachteten Gegensatz der warmen und der kalten Farben hinzufügen. Wölfflin spricht nur von den formalen Wandlungen, die sich vollziehen, wenn ein Stil aus seinem zweiten Stadium in sein drittes eintritt. Nicht weniger bedeutungsvoll sind die Wandlungen, die zwischen der ersten und zweiten Periode vor sich gehen.
[3] Italien. Tagebuch einer Reise. Mit 118 ganzseitigen Bildertafeln. 4. bis 6. Tausend (Leipzig 1916).