
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Bergabhang, riesiger, gelber, zerklüfteter Felsenrücken am Westufer des Genezarethsees; – hier, sagt die Legende, hier ist der Ort der Bergpredigt.
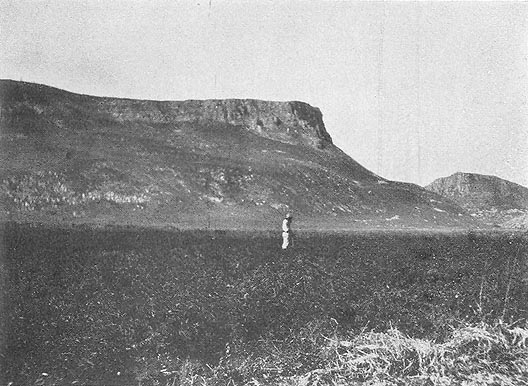
Berg der Predigt
Unser Automobil fährt am Fuße des Berges die Straße entlang, holperig über spitze Steine am Ufer des Sees, Kapernaum zu. Die Straße ist neu. Schotterhaufen. Auf ihnen sitzen rittlings junge Männer, klopfen Steine. Junge Mädchen, gebückt, mit Spaten in den Händen, zerschlagen die hervorstehenden, ebnen die Steine auf der Straße.
Im Vorüberfliegen reißen wir die Mützen von unsern Köpfen: »Schalom!« Die Jungen, die Mädchen winken uns nach, erwidern den Gruß, den Friedensgruß, – es sind die Unsrigen!
Einen Blick noch zurück auf den Berg der Bergpredigt, – die Augen bleiben auf den hellen, kleiner werdenden Gestalten haften, die Steine hacken, am Fuße des riesigen kahlen Abhangs.
Die Legende –
Und da liegt schon, an das Wasser geschmiegt, von den Wellen bespült, Magdala: zehn elende Araberhütten. Weiter vor uns aber, in tiefem Grün, der Bananenhain der jüdischen Kolonie Migdal.
Galiläa.
Galil!!
Und auf der Chaussee, die von Tiberias aufsteigt gen Nazareth, hacken sie Steine, die Unsern. – Oben auf den Hügeln, engelweiß zwischen schwarzen Zypressen, hebt sich das Franziskanerkloster zum Himmel. Die Gabrielskirche der Griechen. Klöster, Klöster. Zarter Gesang aus 2 den Türmen der Beschaulichkeit. Unten aber, im weißen Staub, im brennenden Sonnenlicht: klopf, klopf. Junge jüdische Knaben, jüdische Mädchen, von weit hergekommene, bauen die Straßen des Landes, die zu den Klöstern der friedlichen Gottesruhe führen. An manchen Orten, an vielen Orten, in allen Teilen Palästinas, in Samaria, Judäa, zwischen Dan und Bersheba, im Norden und Süden bauen sie im Sonnenbrand die Straßen ihres Landes Israel.
Woher seid ihr gekommen? Was sucht ihr hier? Steine zu klopfen kamt ihr über das Meer? Aus den Städten Europas, von den Straßen, glänzend im elektrischen Licht, aus warmen Elternhäusern, von Universitäten, Lehrerinnenschulen, hieher auf die harten Wege des wilden Landes? Steine zu klopfen acht Stunden und mehr im Sonnenbrand? Wer seid ihr?
Wer sind diese?
Blicke fliegen uns nach, freundliche Blicke, lächelnd-frohe auch zuweilen –
Schalom!
Diese Frage und immer wieder diese: was hat sie hergetrieben? Tausend Antworten gibt Palästina auf diese Frage.
Mit vielen jungen Einwanderern, alten Arbeitern, langjährigen Kolonisten habe ich über diese Frage gesprochen, mit manchem eingehend, unter vier Augen. Keiner hat mir dieselbe Antwort auf diese Frage gegeben. Denn eine schematische Antwort auf Fragen des innersten Gewissens gibt nur ein Mensch, der ohne Gefühlsleben ist oder ohne eigne Gedanken, oder einer, der Angst hat. Diese jungen und älteren Menschen aber, die ein unbewußtes Drängen nach dem alten Land der Väter, nach Zion getrieben hat und treibt, es sind keine Dutzendmenschen, sondern Menschen mit hochentwickeltem, sehr wachem und an großen Dingen geschultem Gewissen, und sie geben sich 3 schonungslos und wahrhaftig Rechenschaft darüber, was sie in Palästina erwartet und was sie dort zu leisten haben werden.
Nur über die Natur, das Wesen, das Geheimnis ihrer Sehnsucht nach Zion, nach dem Lande Israel vermögen sie sich keine klare Rechenschaft zu geben.
Was ist Zionismus?
Ist er eine religiöse Bewegung?
Ist er die nationale Bewegung eines zerstreuten Volkes, das zur Einheit strebt und gelangen will auf diesem ihm vor zweitausend Jahren entwendeten Heimatboden?
Ist er die Klassenbewegung der arbeitenden Juden, zum Lande, zur Scholle, zur fruchtbaren Erde zurück?
Ist er der metaphysische Zug eines Volkes nach einem Punkt des Erdballs, an dem sein Verhängnis sich erfüllen soll?
Oder – ist es Flucht vor Pogromen? Beleidigungen? Flucht vor der Notwendigkeit des Klassenkampfes mit all seinem Schauerlichen in der verdüsterten Exil-Heimat, die jetzt manchem vielleicht in hundertfachem Maße Exil, Galuth geworden ist. Ist es Abenteuerlust, die junge Menschen in Scharen nach dem jahrtausendealten steinigen Lande vorwärtsstößt oder zurückkehren heißt? Ist es Überdruß an der niedergehenden, allzu langsam verendenden Zivilisation dieses todgeweihten Abendlandes?
»Nationalismus! Wir sind eine Nation. Uns treibt das nationale Bewußtsein des jüdischen Volkes, der jüdischen Rasse vorwärts.« Ich erwiderte darauf: »Euer Geschichtsbuch ist das Alte Testament. Die Thora-Rolle enthält die Geschichte eures Volkes. Welche Nation hat noch eine Chronik ihrer Geschichte, die an heiligen Feiertagen in Gotteshäusern verkündet wird? Euer Trieb nach Palästina, das ihr Erez Israel nennt, ist ein religiöser, kein nationaler.«
Darauf antworteten mir nicht wenige: »Wir sind Atheisten.« 4
Ich wäre in solchen Diskussionen sicherlich rascher vorwärts gekommen, hätte ich statt des tausendfach gefälschten und entwürdigten, des vage und trügerisch gewordenen Wortes Religion, das Wort Messianismus gebraucht.
Dort am Fuße des Ölberges, gegenüber dem Harams-Wall, der weiten, wunderhellen Stätte, wo einst der alte Tempel stand – eine versteckte Quadermauer ist von ihm geblieben – reihen sich, den Berg hinauf, ungezählte jüdische Gräber. Dort, zu Füßen Jerusalems, im Tale Josaphat, am aufsteigenden Hang des Ölbergs, soll einst die Posaune des Gerichts und der Auferstehung ertönen. Sie wird die Juden dorten nicht erwecken, die Abertausende sterbenswilliger Juden, die von weit her gewandert sind, – allein um der Seligkeit des Grabes teilhaftig zu werden.
Etwas vom Irrsinn der Kreuzfahrer muß in all den jüdischen Siedlern, Kolonisten, Arbeiter-Pionieren: den Chaluzim dieser neuen Zeit lebendig sein. Der Wunsch, das Land der Väter wirtschaftlich neu zu erobern, wäre des ungeheuren Triebs nach Palästina nicht würdig; nur unbefriedigend könnte er den unaufhörlich anschwellenden Zug der heutigen Juden nach Zion, nach Erez Israel erklären.
Ist eine Nation zerstört, wenn man ihr die Heimat nimmt?
Die Juden, jahrtausendelang im Exil, geben die Antwort: Nein.
Wenn man sie mit Schwert und Feuer ausrottet? Neun Zehntel der Armenier haben die Türken vom Erdboden weggefegt, zertreten, vernichtet. Aber sie sind heute da. Man spürt das Walten ihres ungebrochenen nationalen Willens sehr deutlich an der Eigenart ihrer Politik, die sich im Orient immer weiter behauptet.
Wenn man sie aushungert, politisch, wirtschaftlich, kulturell zugrunde richtet? Nicht eine Eigenart des Österreichers ist in seiner Katastrophe zuschanden worden.
5 Ob ein Volk in seinem eignen Land verelendet oder verstreut in allen Ländern der Fremde, des »Exils« dahinlebt, – sein Unzerstörbares erleidet keinen Abbruch. Es bleibt. Es sublimiert sich in einzelnen Individuen. Man mag ihm das Recht, sich als Nation zu betrachten, absprechen, man mag ihm den Boden unter den Füßen wegziehen, – all das ändert an seinem innersten Bestand nicht das Geringste.
Der Nationalismus ist in den Völkern sehr stark. Im Orient zumal, wo er in Formen religiöser Tradition auftritt. Wir, die wir an den notwendigen Kampf und an die Auflösung der Klassen glauben; wir, die wir an die Verbrüderung der Menschen, an die Menschheit glauben, wir müssen uns diesen starken Feind heute klarer als je vergegenwärtigen. Wir müssen erkennen, gegen welche zwingende atavistische Kraft im Menschengeschlechte wir anrennen.
Um sich als Nation fühlen und behaupten zu können, brauchten die Juden nicht wie Antäus die Berührung mit der Heimaterde. Sie sind als Einheit auch in der Diaspora mächtig genug.
Sie sind, in der Zerstreuung über den Erdball, das Salz der Erde geblieben. Die Menschheit ist schmackhafter durch sie. Sauerteig der Entwicklung sind sie. Die Geschichte der großen, von Rußland ausgehenden Bewegung zeugt von ihrer Gegenwart, von der Sendung ihrer schwellenden Kraft.
Warum bleiben die Ostjuden, voll dieses messianischen Höhentriebs zur Zukunft, nicht daheim, im Osten, der ihnen kaum mehr Exil, kein Galuth mehr heißen kann? Warum arbeiten sie nicht an dem großen Werk der Befreiung mit, das, von Rußland ausgehend, in langsamem Kampf, heroischer Anspannung die Welt umzuformen unternommen hat? Warum drängen sie nach einem Winkel Asiens hin, wo ihre Geschichte vor zweitausend Jahren aufhörte, – statt dort zu bleiben, wo ihre Geschichte,. die Geschichte der Gesamtmenschheit, heute anhebt?
6 Flüchteten sie bloß vor der Notwendigkeit, dem düsteren Muß des Kampfes, in beschauliche Abseitigkeit, flüchteten sie vor der Zeit, – ich würde dieses Buch nicht schreiben. Ich würde die Deserteure, die Verräter schmähen und verfluchen.
Aber die jungen Menschen, die Palästina jetzt aufnimmt, die Stärksten, Gläubigsten unter ihnen – bauen, tastend, irrend, von Fehlschlägen nicht entmutigt im Urväterland an der Neuen Welt. So wie in ihrer Exilheimat im Osten Europas, auf Irrwegen, unter Fehlschlägen, in blutiger, langsamer Umwandlung sich jetzt die neue Heimat, das Neue Zion der Menschheit ans Licht ringt.
Administration, Kolonisationswerk und Aufbau, Formation der Parteien, Theorie der Arbeit und Organisation der Arbeitenden – alles befindet sich im jüdischen Palästina heute noch im Zustand des Experimentes. Das Problem des Nationalismus desgleichen. Unendliche Ströme Tinte werden über dieses Problem in der Diaspora ausgegossen, trotzdem ist es in Palästina bei weitem noch nicht zur Klarheit gediehn.
Die kleine jüdische Minderheit Palästinas, diese menschliche Auslese des Besten im Judentum dieser Zeit, hängt mit der großen Judenheit der Diaspora eng zusammen. Die Theoretiker des Zionismus meinen: die große Zahl der über den Erdball verstreuten Juden solle eben das Recht der verhältnismäßig geringen Zahl der Juden, die Palästina aufnimmt, auf ihre Heimat rechtfertigen. Es verhält sich genau umgekehrt. Die jungen Arbeiter-Pioniere rechtfertigen die Judenschaft der Welt durch das Opfer, das sie ihrer chimärischen Heimat in der Steinwüste des Urväterlandes darbringen.
Es ist nicht das Volk der Bedrückten, heimatlos und verzagend über den Erdball Irrenden, das jetzt im Zwischendeck vor den Riffen Jaffas ankommt. Es ist eine selbstherrliche, selbstbewußte, starke und zukunftgläubige Schar, 7 die von dem Freibrief, der Deklaration des englischen Imperialismus ohne große Dankesbezeugung Gebrauch macht.
Die Balfour-Deklaration vom 2. November 1917, die den Juden die nationale Heimat gewährleistet, bietet wohl Anlaß zur Heimkehr der Juden nach dem alten Land der Verheißung. Aber was sich in diesem alten Lande abspielt, die Besitzergreifung Palästinas durch die Juden, geschieht durch einen höheren Willen, aus höherem Gesichtspunkt, als ihn der Begriff Heimat umzirkeln kann.
Fünfzehn Millionen Juden sind heute über den Erdball verstreut. In Amerika leben von diesen fünfzehn drei; in Sowjetrußland ungefähr fünfviertel Millionen. Acht Millionen sind Ostjuden – Polen, Ukrainer, Rumänen, Letten usw. Von diesen acht ist die Hälfte, wie es erwiesen ist, außerstande, sich selbst ausreichend zu ernähren. Sie lebt, wenn nicht von Almosen oder im nackten Entsetzen des tiefsten Elends, von unproduktiven Berufen. Diese Ostjuden sind es, die nach Palästina die kräftigsten, arbeitsfrohesten, gläubigsten Pioniere entsenden. Der Chaluz ist Ostjude.
Dieses Land Palästina,
dieser schmale, bergige Landstreifen zwischen dem Mittelländischen Meer und dem Jordan, El Arisch und Acco – drei Fahrstunden breit, elf Stunden weit, dieser schmale Landstreifen Palästina, siebenundzwanzigtausend Quadratkilometer, von siebenhunderttausend Menschen bewohnt,
es ist ein jahrtausendelang, von den Türken, von Tamerlan systematisch verwüstetes, ausgerodetes, brachgelegtes, entvölkertes Land;
heute trägt es nur Steine; Felsblock um Felsblock muß der Ackerbauer mit seinen Händen aus dem Erdreich heben,
und erntet doch jahrelang nur Steine, statt Brot; 8 dieses sumpf- und fieberdurchzogene Land, wüst, gefährlich und verlassen,
im Sommer von berauschenden Blumen überwuchert, die doch nur Unkraut sind, und eine Sorge mehr für den Arbeiter auf dem Felde und in den Bergen,
im Winter von Regengüssen heimgesucht, die die ausgetrockneten Flußbetten jäh mit reißenden Wassern überschwemmen;
dieses wilde, steinige, verlassene Land um Jerusalem, einst Saron, Kanaan, das Verheißene Land der Wüstenwanderer; dieses harte Land, das, fußbreit um fußbreit schwere Arbeit, strotzende Gesundheit, unbegrenzten Opfermut zerreibt, aufzehrt, verschlingt,
es ist heute die Heimat der Erwählten aus der Judenschaft, die es langsam, langsam wieder zum Blühen erwecken, es ist Zuversicht, Kraft der Gegenwart und Zukunft des verstreuten Volkes.
Wohlfahrtsinstitutionen, Hilfsvereine, Alliancen, einzelne Fromme und Reiche, wie der Pariser Rothschild, haben es vor siebzig, vor vierzig Jahren den ersten Siedlern ermöglicht, sich in Palästina ansässig zu machen. Diese frühen Kolonisten waren zum größten Teil Studenten, junge, der Verfolgung und Mißhandlung müde, unter den Qualen der Exilheimat zusammenbrechende Kleinbürger.
Theodor Herzl, Verkünder und Vater des neuen Zionismus, des zionistischen Gedankens, wie er heute in der Welt lebendig ist, starb 1904. Er war ungarischer Jude aus Budapest, und sein Zionismus datiert von Paris her, wo er liebenswürdige Plaudereien für ein österreichisches Bürgerblatt verfaßte.
Herzls Zionismus schreibt sich nicht vom Jahre 1883 her, in dem der Ritualmordprozeß von Tisza-Eszlár sich in seiner Heimat abspielte, der Prozeß, der hauptsächlich das elende proletarische Judentum Ungarns schlug, – sondern von 9 1894, vom Dreyfus-Prozeß, von der Welle des Antisemitismus, die damals die hohe jüdische Bourgeoisie in einem ihrer vornehmsten Angehörigen bedrohte. Der Zionismus Herzls ist Angelegenheit der jüdischen Bourgeoisie gewesen.
Heute steuert die gesamte jüdische Diaspora, vielmehr ein namhafter Bruchteil derselben, dazu bei, daß der Drang der Zionssehnsüchtigen sich auf dem Boden der Urväter erfülle. Diese aber sind die Ärmsten, Elendsten aus dem europäischen Osten.
Der Zionismus des heutigen Palästina ist eine Angelegenheit des jüdischen Proletariers; – aber, wie ich es erklären werde, eines Proletariats sonderlicher Art.
Ich fuhr von Triest auf einem der schönen Eildampfer des Triester Lloyd am Tage ab, an dem das Fest des »unbekannten Soldaten« gefeiert wurde. Bekränzte Eisenbahnzüge rollten an diesem Tage durch ganz Italien, brachten Särge nach Rom, Aquileja. In den Särgen lagen zerstückelte Gliedmaßen, klappernde Gebeine, die einst Menschen gehört hatten. Leichen, unbekannte, von niemand auf der Welt zurückgefordert und beweint. An den Stationen, durch die diese tragischen Züge fuhren, kniete die Bevölkerung vor den Schienen. Witwen, Waisen schluchzten. Fahnen flatterten im Windhauch des vorbeirollenden Zuges. Die ungeheure, pathetische Lüge von der Dankbarkeit der Welt jenen gegenüber, die sich für eine ephemere Gesamtheit opfern, taumelte geschmückt, beflaggt, betränt durch das Land. Aus dieser Feier, die den Molo des Triester Lloyd überflutete, fuhr die »Vienna« hinaus, durch die Bai, nach Süden.
Unten im Zwischendeck lehnte eine kleine Gruppe junger Menschen an der Reling. Es waren etwa zwanzig, und sie sangen, als das Schiff sich vom Damm fortschob. Sie sangen die »Hatikwah«, den Hoffnungsgesang, die Nationalhymne der Juden. Ich ging dann hinunter und gewann Freunde unter ihnen.
10 Ein junger Bursche wies mir gleich seine Papiere. Neunzehn Jahre alt, Schüler des Rigaer Konservatoriums; er hatte schon in Konzerten gespielt, ein Zeitungsblatt enthielt seine Photographie. Sein Onkel, Besitzer eines Kleidergeschäftes in Chicago, das wöchentlich vierhundert Dollar Gewinn abwarf, eines Hauses und Bankdepots, in dem unter anderem Liberty-Bonds für fünfundzwanzigtausend Dollar lagen, war bei der lettischen Regierung um Ausreise-Erlaubnis für den Jungen nach Amerika eingekommen. (All diese Angaben über Vermögensverhältnisse fordert die amerikanische Einwanderungsbehörde; das Familienmitglied, das man herüberkommen läßt, soll der öffentlichen Wohlfahrtspflege nicht zur Last fallen.) »Ich habe mir meinen Paß geholt,« sagte der Junge, »aber ich fahre nach Erez Israel, nicht nach Amerika.« »Sie werden in keinem Haus mit Lift wohnen, sondern in einem Zelt. Sie werden nicht in schönen amerikanischen Kleidern herumgehn, sondern die Erde umgraben. Sie werden vielleicht krank und müde werden von Fieber und unmäßiger Arbeit. Sie werden sich sehr nach Chicago sehnen!« sagte ich dem Jungen. »Sie werden kaum viel Zeit zum Geigenspiel finden; ihre Hände werden rauh und ungelenk werden, wenn sie erst ein paar Monate lang den Spaten führen oder die Pferde lenken müssen!« »Was soll ich in Amerika? Ich gehe nach Erez Israel.« Es war ein Chaluz.
Schon vor den Klippen Jaffas, wo in der Ferne die Berge Judäas vor dem verschleierten Blick des Einwanderers auftauchen, – weit vor der Küste des Verheißenen Landes, beginnt für die im Zwischendeck das bittre Zion.
Es war, dort unten in unserem Schiff, nur eine kleine Gruppe, etwa zwanzig junge Männer und Frauen. Ich hörte dann, es seien in Triest von den Leuten, die mit der »Vienna« abfahren sollten, etwa achtzig zurückgehalten worden. »Quarantäne«. Dieser Begriff, diese Maßregel dient einer Methode, einer Politik, die ihren Ursprung in ganz anderen 11 Gebieten als der Hygiene hat! Ein großes Schiff, die »Carniolia«, war vom Lloyd vor Monaten bereits für den Massentransport palästinischer Einwanderer ausgebaut, das heißt umgebaut worden, – ein Wink der englischen Regierung unterbrach (nach dem Maipogrom in Jaffa) diese Vorbereitungen. Die Gefahr der Einschleppung von Seuchen durch ostjüdische Chaluzim ist ein Vorwand. In Wirklichkeit will die englische Regierung die Einwanderung großer Massen von Juden nach Palästina unterbinden. Es sollen auch nicht zu viele aus dem bolschewisierten Osten nach Palästina kommen. Darum schert man den Zwischendeckern das Haar. Hält sie in den Häfen zurück. Befördert sie in vergitterten Wagen von einer Desinfektionsbaracke in die andre. Desinfiziert ihre Habseligkeiten zuweilen so gründlich, daß diese sich in ihre chemischen Bestandteile auflösen. Läßt wohl auch den Kranken im Spital von Alexandrien oder Port Said zum Skelett abmagern, von levantinischen Hafenhalunken wie Sudanneger schikanieren. – Die Behörden kennen tausend Mittel, die Einwanderung zu zügeln, den Einwanderer abzuschrecken.
Die zionistische Exekutive, die Kommission der Zionisten im Ausland wie in Palästina kennt diese Methoden gar wohl. Kämpft wohl auch gegen sie an.
Indes: ich weiß nicht, ob sie ihr gar so unwillkommen sind.
Ungerufen, ungemeldet strömen durch Häfen Italiens, der Levante, des Schwarzen Meeres Einwanderer nach Palästina. Die meisten quälen, hausieren sich schon bis zum nächsten Ziele, der Hafenstadt, wo ihr Schiff wartet, durch, kommen mittellos in Jaffa an. Nur für einen geringen Bruchteil haben wohlhabende Verwandte das Überfahrtsgeld bezahlt. Schon die Ausschiffungssteuer von wenigen Piastern für den neu Eingetroffenen muß in Jaffa, in Haiffa von der zionistischen Kommission an die Bootsleute entrichtet werden. Der Chaluz, die Chaluza findet in den leeren Taschen keinen Piaster mehr. Eine 12 Kopfsteuer von einem Pfund ägyptischer Währung wird von der englischen Regierung für jeden Einwanderer erhoben. Diese Verfügung (sie wurde ebenfalls nach dem Maipogrom erlassen) dient angeblich zur Beruhigung der einheimischen arabischen Bevölkerung. Die Juden sollen selber die Kosten ihres Unterhalts bestreiten, der arabische Steuerzahler wird für den Eindringling nicht in Kontribution gesetzt werden!
Die zionistische Kommission bedrückt schwere Sorge. Sie lebt von der Hand in den Mund. Lauert auf die Post aus Amerika. Auf den Scheck. Das Geld für die Ausbootung, für die Landungsgebühr, für jedes Zelt, in dem der Einwanderer provisorisch untergebracht ist, für jeden Bissen, den er ißt, für jeden Schuh, jeden Spaten, jeden Nagel im Haus, jeden Fußbreit Landes, das gekauft, jeden Fußbreit, der kolonisiert werden soll, – für alles, alles, alles muß das Geld aus den Ländern der gültigen Valuta kommen, das heißt also: aus Amerika. Der Osten Europas stellt nur die Menschen bei.
Woher die Kopfsteuer nehmen für die Zwischendecker im Schiff, das am Horizont auftaucht? Woher die täglichen zwölf Piaster für Nahrung und Unterkunft der Ankömmlinge? Wenn das Geld aus Amerika ausbleibt, rennt die Kommission mit vor Angst gesträubtem Haar durch die Bureaus. Arbeitslosigkeit droht. Im November langten zwölfhundert Neue in Jaffa und Haiffa an.
Am liebsten möchte die Kommission – sie gesteht es nicht ein, aber es ist kein Geheimnis, es sickert durch – am liebsten möchte die Kommission der Zionisten zusammen mit der englischen Regierung und mit den wilden arabischen Nationalisten: »Stop! Stop Immigration!!« rufen, eine Hand aufheben nach allen Hafenplätzen der Erde: »Kommt nicht herüber! Wir haben kein Geld für euch, daher auch keine Arbeit. Bleibt – aus Idealismus! – wo ihr seid. Wir wissen nicht, was wir mit euch beginnen sollen. Wartet 13 ab. Sonst kommt die Katastrophe. Wir sehen sie nahen. Manche meinen, sie sei schon über uns.« Und mit erhobener Stimme: »Wollt ihr, daß wir schließlich den Industriekapitalismus hereinlassen sollen, um Arbeit für euch zu finden? wollt ihr, die ihr im Galuth Proletarier gewesen seid, Ausgebeutete im Heiligen Lande werden? Stop!«
Aber die Einwanderung läßt sich nicht stoppen. Durch tausend Kanäle, tausend Filter von Gegenmaßnahmen, Quarantäne, Krankheit, Hunger, Gefahr und Qualen strömen und strömen, wild und begeistert, die Scharen der jungen Juden, jungen Jüdinnen ins Land Israel.
Aus Polen wandern nach beglaubigten statistischen Aufzeichnungen monatlich dreißigtausend Juden aus.
Besonders unter den amerikanischen Juden, die ja zum überwiegenden Teil aus Osteuropa stammen, wird der Ruf laut: wo bleiben diese Dreißigtausend? warum könnt ihr (das heißt die zionistische Organisation) nicht fünfzig-, nicht hunderttausend nach Palästina bringen, in Palästina unterbringen?
Man kann zwischen dem Auswanderungsbedürfnis der jüdischen Massen aus den Ländern des Galuth und der Notwendigkeit der Einwanderung jüdischer Massen, der Besetzung Palästinas mit diesen Massen gegenwärtig kein richtiges Verhältnis herstellen. Die jüdische Einwanderung in Palästina ist nicht nur Notwendigkeit des Weltjudentums, sondern Notwendigkeit des Landes Palästina selbst. Die heimische Bevölkerung der Araber sieht diese Notwendigkeit wohl ein, – sie bringt es ja selber nicht fertig, das verwüstete Land wieder aufzubauen, aufzuforsten – auch die englische Regierung hat keine Veranlassung, diese Notwendigkeit zu verneinen. Vor allen anderen Klagen und Anklagen klingt der zionistischen Kommission diese ins Ohr: warum versteht ihr es nicht, trotz Behörden, Gegenmaßnahmen, dem steigenden Drang derer aus dem Osten Europas nach Zion Rechnung zu tragen, – wo ja 14 die Notwendigkeit der Einwanderung erwiesen und auch von Nichtjuden anerkannt ist? Die Zustände Palästinas erteilen die Antwort darauf: Geldnot. In Europa, in Amerika aber ist man andrer Meinung: man behauptet, die zionistische Organisation kranke an inneren Gebrechen. Sie sei in ihrer jetzigen Gestalt nicht existenzberechtigt. Es werde zu viel Geld für kostspielige Amtslokalitäten in den großen Städten des Galuth, viel zu viel für die Gehälter der leitenden Persönlichkeiten, für Propagandareisen und ähnliches vertan, darum rinne die Traufe in Palästina, unter der sich so viele Hände recken, zu spärlich. Der ganze Apparat der zionistischen Organisation müsse auf neuer Grundlage umgeschaffen werden, sonst sei der Zionismus in Gefahr und die Katastrophe unvermeidlich.
Die Katastrophe! Man hat der Möglichkeit ihres Eintreffens in Palästina zu lang ins Auge geschaut. Man sagt dort: Käme sie doch nur! Die Juden der Welt würden sich auf ihre Pflicht besinnen. Wir müßten nicht bei der Ankunft jedes Schiffes vor Grauen über das Morgen erstarren. Wüßte man doch in der Welt, daß wir seit langem mitten im Alp der täglichen Katastrophe leben.
Die Klippen von Jaffa, sie sind keine Metapher; es sind wirkliche Klippen, boshafte, zackige Riffe, die bei rauher See das Landen der Schiffe und das Ausbooten der Passagiere unmöglich machen. Dann muß das Schiff nach Haiffa weiterfahren; oft aber gelingt es erst in Beirut, den Einwanderer an Land zu setzen.
In Haiffa sah ich im Haus der Chaluzim einen neu eingetroffenen Transport junger rumänischer und ukrainischer Arbeiter. Das große Haus war überfüllt. Es gewährte nur dreihundert Aufnahme. Unten im Garten, der mit Palmen und Agaven gar herrlich auf die offne Bucht bis nach Acco und dem blauen Libanon in der Ferne blickt, waren Zelte errichtet, in denen weitere Hundert Platz fanden. Furchtbarer Regenguß hatte den Boden unter 15 diesen Zelten aufgewühlt, Bettzeug, Matratzen, alle Habseligkeiten der Bewohner durchtränkt. Im Speisesaal, einer ehemaligen Kapelle, saßen die jungen Menschen bei Tische. Der erste Gang der Mahlzeit bestand aus Chinin.
Ich ging mit den Herren vom Einwanderungsamt an den Tischen vorüber. Welch wunderbarer Menschenschlag! Kräftig, froh, mutig, geschwellt vom Atem des aufgehenden Abenteuers: Israelland, der Erfüllung des Traumes seit Kindheitstagen, Erwartung der Arbeit, der Muskeln und Seele entgegenglühten.
Glühend auch vom Fieberschauer, den das mörderische Klima über den Europäer verhängt.
Freunde, Genossen, ihr meines Stammes!
Nicht lange, drei, fünf Wochen lang, steht der Chaluz unter Obhut der zionistischen Kommission. Dann muß er weiter für sich sorgen.
In Jaffa, Haiffa, in Jerusalem registriert zugleich mit dem Einwanderungsamt die Histadrut, kooperative Vereinigung und Arbeitsnachweis der Arbeiterparteien, die Ankömmlinge, verteilt sie übers Land an Stellen, in die Gewerbe, die Arbeiter verlangen, in die landwirtschaftlichen, städtischen, in den Straßenbau.
Der Weg, den der Chaluz durchzumachen hat, bis er in die ersehnte landwirtschaftliche Stelle vordringt, ist mitunter ein langwieriger Schmerzensweg, und nicht jeder legt ihn heil an Körper und Seele zurück.
Der Beginn ist zumeist beim Straßenbau, bei der Entwässerung und Trockenlegung von Sümpfen, beim Hausbau, vielen Formen der Bauarbeit, die mit einer Gesamtbezeichnung »Schwarzarbeit«, »tschornaja robota« genannt werden; – aus guten Gründen.
Die schwere Arbeit des Steineklopfens, des Mauerns und Bauens im Sonnenbrand, des Bis-an-die-Knie-im-Sumpf-Stehenmüssens entspricht nicht den Wünschen, aber auch 16 nicht den physischen Bedingungen der jungen Arbeiter und Arbeiterinnen. Es sind Notstandsarbeiten, – sie fallen, soweit es sich um den Straßenbau handelt, nicht dem Säckel der zionistischen Kommission zur Last; die englische Regierung teilt sie aus. Man drapiert wohl diese Not mit der Formel: alle Arbeiten im Lande, die letzte, schwerste, schwärzeste so gut wie die hellste, freudigste, müsse von den Unseren geleistet werden. Keine dürfe abgelehnt werden. Nur so könne das Land restlos erobert werden. Aber es ist immerhin die bare Not, die auf den heißen Straßen die Jungen und die Mädchen ihren Hammer führen läßt. (In Tel-Awiw sah ich einen Studenten der Chemie, der drei mit Sandsäcken beladene Kamele trieb; fröhlich schritt der Chaluz hinter seinen Kamelen drein; es war »weiße« Arbeit.)

Arbeit im Sumpf
Die Kwisch (Straße) zehrt an Muskeln und Nerven des Chaluz, an dem einzigen Gut, das ihm übrig bleibt, wenn die Kommission ihre schützende Hand von ihm zieht: seinem Idealismus, seiner Liebe zum Urväterland. Er arbeitet schließlich nicht mehr aus Liebe zu Erez Israel, sondern um nicht zu hungern oder betteln zu müssen.
Der Weg zum Boden, zur Scholle ist weit, weit. –
In mancher dieser Schwarzarbeitergruppen verbrachte ich denkwürdige Stunden.
An der Straße Haiffa-Jemma liegt eine, nach ihrem bulgarischen Führer benannte, im ganzen Land bekannte Gruppe. In ihr – etwa vierzig junge Männer, drei, vier junge Frauen arbeiten da beisammen – sind viele Nationen Europas, alle Parteien der palästinischen Arbeiterschaft vertreten. Die Gruppe zieht seit Jahren im Lande herum, baut einmal in Galiläa, dann irgendwo im Süden Straßen und Häuser; – die Leute scheinen an dieser Art Arbeit, an der freien Ungebundenheit des Umherziehens Gefallen gefunden zu haben.
So wollten einige, mit denen ich eingehend sprach, von der sonst so innig begehrten Seßhaftigkeit auf Grund und 17 Boden nichts wissen. Lieber von Kwisch zu Kwisch! Sie verdienen vierzig Piaster täglich, eine große Summe, auch für palästinische Begriffe. Für Nahrung und Unterkunft sowie für sonstige Sporteln mußten sie allerdings täglich 20 Piaster an die Organisation abführen; aber es ließ sich leben in der Gruppe.
Manche hatten bandagierte Hände, andere litten unter der Malaria, aber – es war Samstag – man aß gut, hatte sogar den süßen Wein Rischon le-Zions auf den Tischen stehn, unterhielt sich und sang, ehe man zum Fußballspiel hinunter an den Strand ging. Ich traf da auf Genossen, die mir manches Wissenswerte über die Struktur der Arbeit und des Zusammenlebens der Gruppe zu erzählen wußten. (Auf meiner ganzen Reise durch Palästina wurde ich durch meine vorjährige Reise nach Sowjetrußland arg beeinträchtigt; ich mußte mehr berichten, als mir berichtet wurde.) Ende des Jahres sollte die Kwischarbeit aufhören, dann hoffte die Gruppe bei dem Häuserbau in Tiberias oder Jerusalem Verwendung zu finden. Wenn die Kommission bis dahin Geld für diese Bauten haben wird. – –
Auch eine andere, nicht minder mutige und frische Gruppe besuchte ich an einem Sabbatvorabend, am anderen Ende Palästinas, in Bersheba. Sie baute dort die Friedhofsmauer um die Gräber englischer Soldaten. (Bei Bersheba hat Allenby die entscheidende Schlacht gewonnen.) Auch diese jungen Leute schienen mit ihrem Leben einverstanden zu sein und ihre Arbeit zu lieben. Zwar war die Mauer bald beendet, und man wußte nicht, wohin die nächste Arbeit die ganze Gruppe mitsamt ihren Zelten verschlagen werde, ob man beisammen bleiben oder jeder nach einer anderen Richtung gehen werde, – aber der Vorabend war gekommen, man aß, trank (Tee diesmal), rauchte und ließ sich einen Vortrag über Sowjetrußland halten. – Einer von den Fröhlichsten saß plötzlich neben mir und sagte: ›Können Sie uns sagen, was aus uns werden soll? Wir 18 wissen es nicht. Werden wir Arbeit bekommen oder wird man uns verhungern lassen?‹ Drüben sang man. Es klang schön im Zelt beim Friedhof. ›Eines nur wissen wir, jeder von uns: – wir bleiben im Land. Keiner denkt daran, zurückzugehn. Mag kommen, was will.‹ Es war in Bersheba. – In jener anderen Gruppe aber, auf der Straße nach Jemma, setzte sich ein junger Deutscher zu mir, während die anderen tranken und einen lustigen Chorgesang anstimmten. Er setzte sich zu mir, blickte mir in die Augen und sagte: ›Wir singen und haben Wein, und haben auch Arbeit und leben in den Tag hinein. Aber schauen Sie nicht in uns, wie es dort aussieht. Wir sehen nichts vor uns!‹ Bald darauf war die ganze Kwisch auf den Beinen, – denn drunten fuhr der General über ihre unfertige Chaussee; – darüber später!

Chaluzim in Chulda
In einem Sumpf, bei der Kolonie Chulda in den Bergen Judäas, auf dem Weg von Jerusalem nach Jaffa, stieß ich auf junge Ungarn, die dort Betonbauten ausführten. Es waren vierzehn junge Leute aus Budapest, zum Teil Absolventen der bautechnischen Schule, gebildete und intelligente Jungen im Alter von zwanzig bis siebenundzwanzig. Geschlagen schon von der Schwere ihrer Arbeit; Malaria; bandagierte Hände; zerfetzte Kleider, schlammdurchtränkte, undichte Stiefel. Sie klagten, fühlten sich zurückgesetzt, vermuteten, daß man ihnen zu harte Arbeit zugeschanzt habe, weil sie mit den anderen Arbeitern in der Kolonie keine rechte Gemeinschaft hatten, – die sprachen Hebräisch, sie nicht, auch auf Jiddisch konnten sie sich nicht miteinander verständigen, außerdem knauserte man hier mit der Nahrung, wohl, um das Defizit zu verringern; die Ungarn murrten und saßen abseits. Ich stellte die Frage an sie, wie an alle: »Was hat euch herüber geführt? Ihr kommt ja aus dem Lande Hortys, der Mörderdetachements; ihr wißt wohl etwas von Pogromen, Massaker von Menschen und Ideen. Aber seid ihr nur Flüchtlinge oder hat euch noch etwas anderes aus der raffinierten Stadt 19 hieher in die sumpfige Steinwüste getrieben?« Sie gaben zu, daß es ideale Gründe waren, die sie, die intellektuellen, anspruchsvollen jungen Leute, nach Palästina gelenkt hatten. ›Jeder von uns,‹ sagte der Wortführer der Gruppe, ›kommt, von seinem Idealismus getrieben, hieher. Aber schon in Jaffa, sobald der Fuß auf den Boden dieses Landes tritt, – sieht man sich um: wo ist der Idealismus geblieben? Ins Wasser gefallen, vermutlich! Der Kampf ums Dasein hat begonnen. Der schreckliche Kampf mit der Wirklichkeit. Wer nach einem Monat dieses Kampfes noch von seinem Zionsideal faselt, dem lachen wir ins Gesicht: Komödiant!‹ Das sind sicherlich Ausnahmen.

Chaluz-Lager in Judäas Bergen
Eine Tatsache aber will ich vermelden. Sie ist nicht zu unterschlagen. Sie soll gehört werden in der Welt. Wenn in den Bethäusern der Juden der Rabbi im schwarzgestreiften Totenhemd sich über die Gemeinde aufreckt, und die Worte der Anrufung, der Beschwörung ertönen, dann neigen sich in einem Erschauern die Köpfe der Menge, und die Menschen versenken sich in Gott. So müßte, was ich zu sagen habe, mit den Worten anheben, in die Worte ausklingen, die die Formel der Anrufung bilden, einer Beschwörung zugleich der Menschen wie des ewigen Schicksals.
Auf dem Wege zwischen Jaffa und Jerusalem, abseits von der großen Fahrstraße, befindet sich bei der Stadt Ludd, dem alten Lydda, das große zentrale britische Militärlager. Ein Schwarm schottischer Soldaten kam uns entgegen. Sie hatten es sich, nach einer Frühübung in der brennenden Tropensonne, bequem gemacht, ihre blondrote Brust glänzte; sie hatten zwei Dudelsackpfeifer an der Spitze ihres Zuges, die mit vollen Backen »Bonny Dundee« bliesen; die Burschen marschierten fröhlich daher und riefen uns etwas in unser Auto hinein.
Nicht weit aber von dieser Straße war die Stelle, wo, unter Aufsicht bewaffneter britischer Soldaten, ein dunkler Haufe an der Straße arbeitete – so wurde berichtet – ein dunkler Haufe: die berühmte Straßenbaugruppe von Ludd.
20 Ich hörte von verschiedenen Seiten Näheres über diese Kwisch bei Ludd. Hier arbeiten ägyptische Fellachen zusammen mit unseren Chaluzim. Es ist eine schwierige Arbeit; ist es die Straße, die Luft, Sümpfe? Es kommt dort oft Desertion vor. Die englische Militärbehörde hat nun, um dies Davonlaufen der Fellachen, das den Bau der Straße gefährdet, zu verhindern, eine Abstempelung der Straßenarbeiter angeordnet. (Vor Beginn der Arbeit und während der Ruhepausen müssen diese Leute niederhocken; – damit man sie besser kontrollieren könne, offenbar. Ich sah einmal, auf einem palästinensischen Bahnhof, eine solche Gruppe rastender Fellachen, wie das Vieh hingehockt, es waren etwa sechzig; zwei Tommys rauchten an den beiden Enden der Herde gemächlich ihre Pfeifen, Bajonett auf dem Gewehr.)
Der Stempel wird auf die nackte Schulter gedrückt. Weder Schweiß noch Wasser vermögen ihn abzuwaschen. Monate später noch kann ein Ausreißer an diesem Stempel erkannt und zurückgebracht werden; – ins Gefängnis vermutlich. Da unsere Chaluzim sich zu dieser Arbeit, dieser Notstandsarbeit gemeldet haben, was ist da natürlicher, als daß man auch ihnen den Stempel aufdrückt. Die englische Regierung verwendet den intelligenten Chaluz lieber als den faulen und indolenten Fellachen, – aber der demokratische Grundzug des englischen Charakters – der sich ja im Orient ganz besonders deutlich zeigt! – läßt eine wenn auch nur unwesentliche Nuance in der Behandlung des eingeborenen und des zugewanderten Arbeiters in derselben Gruppe nicht zu.

Chaluzim
Auf der Straße von Ludd, im berühmten Ludder Kwisch, arbeiten die Unsern mit einem Stempel auf der Schulter. Sie arbeiten, um das Land aufzubauen durch ihre Arbeit, ›um Erez Israel durch unsere Arbeit, jede Arbeit zu erobern.‹ Es ist ja die Heimat der Juden, die Heimat, die ihnen gehört hat vor zweitausend Jahren; das Land, in das Moses nach vierzigjähriger Wüstenwanderung das Volk der Juden 21 geführt hat, hinaus aus Mizraim, der Sklaverei. Sie sind guten Mutes, die Unsern, auf der Landstraße bei Ludd. Sie haben ja Arbeit.
Höre, Israel!
In vielen Kwischim macht sich unter den jungen Arbeitern, den jungen Arbeiterinnen (denn in all diesen Gruppen sind auch junge Mädchen, die dieselben schweren Arbeiten leisten, wie die Männer) steigende Unruhe bemerkbar. Die wenigen Ausnahmen – ich sprach eben von ihnen – abgerechnet, die wenigen jungen Leute abgerechnet, die eine Art Genugtuung an diesem schweren, doch ungebundenen Leben haben, wollen die meisten Kwischarbeiter bald von ihrer gegenwärtigen Beschäftigung befreit werden. Sie fordern Grund und Boden, auf dem sie sich niederlassen, den sie bebauen können. Tausende warten auf den Kwischs, daß man sie ansiedle. Man hat es ihnen versprochen. Viele waren schon in Polen, in der Ukraine Landarbeiter. Viele haben sich auf landwirtschaftlichen Schulen, bei Bauern in Deutschland vorgebildet, eingearbeitet.

Samaria
Große, weitgedehnte, wenn auch noch mit Steinen übersäte und nicht genügend entwässerte Strecken Landes, im fruchtbarsten Teil Palästinas, der Jesreel-Ebene, des oberen Jordangebietes, in Saron, in den Bergen Samarias, Judäas hat ja der Jüdische Nationalfonds schon Land angekauft. ›Warum gibt man uns dieses Land nicht?‹ klagen die Ungeduldigen. Jetzt im Herbst zur Regenzeit, wo tagelange wilde Güsse die Arbeit auf den Straßen und in den Sümpfen verhindern, stauen sich Scharen unbeschäftigter Kwischleute, Schwarzarbeiter vor den Türen der zionistischen Kommission, den Bureaus der Arbeiterorganisationen in Jerusalem, Tel-Awiw. Hungrig und rebellisch rufen sie: ›Land! Gebt uns Land! Wir wollen es bebauen! Ihr habt doch genug Land gekauft, warum habt ihr Geld zum Landkauf, das heißt für den Effendi, oder den Patriarchen, dem ihr es abkauft und nicht genug zur Kolonisation, das heißt 22 für uns, uns! Ihr kauft zuviel Land und kolonisiert zu wenig. Es liegt brach, und uns läßt man auf den Straßen Steine klopfen oder hungernd in den Städten lungern. Ihr seid wohl bessere Kaufleute als Kolonisatoren! Das Landkaufen und Feilschen macht euch mehr Spaß als die Sorge um die Kleinarbeit der Kolonisation?‹
Sie wissen wohl nicht, oder nur wenige unter ihnen wissen, daß auch diese großartigen Landkäufe nur mit geringen Anzahlungen, ungenügenden Mitteln durchgeführt sind! Und sie können es von den mit ihnen vor den Türen antichambrierenden Delegierten aller möglichen kleinen und großen, nahen und entlegenen Siedlungen erfahren, wie schwer es ist, aus der Kommission die nötigsten, für drängende Arbeit erforderlichen Summen herauszulocken. Wie wertvolle Arbeitskraft wochenlang bei solchem Harren und Bangen in Jerusalem, in Tel-Awiw brach liegt, wie der erzwungene Aufenthalt der Delegierten in den Städten, die teure Eisenbahnfahrt, an dem schmalen Säckel der notleidenden Siedlungen zehrt! – –
Ich sprach in Jerusalem mit Ussischkin, dem obersten Mann der zionistischen Exekutive in Palästina, über die Unruhe unter den Chaluzim, auf den Kwischim, bei der »schwarzen Arbeit«. Ein Mann von bedeutender Klugheit, unbeschränkter Energie; zäh und in seine Aufgabe verbissen, die er verteidigt und durchführen wird bis ans bittere Ende. Auf dem Kongreß von Karlsbad, vor wenigen Wochen erst hatte die Exekutive ihre Politik mit diesen Worten definiert: Wir müssen so viel Chaluzim wie möglich nach Palästina bringen und ansiedeln, damit wir ein Gegengewicht gegen die arabische Übermacht haben. (Von den siebenhunderttausend Einwohnern Palästinas sind nur siebzigtausend Juden!) Jetzt strömen die Scharen der Einwanderer ins Land – nun, es ist kein Strom, wir kennen die Gründe! – aber die, die nun einmal hier sind, erfahren, daß man Land kauft und kauft, – und dabei müssen sie in Jaffa, in Jerusalem lungern, wenn sie sich nicht in Schwarzarbeit 23 verzehren. Natürlich schreien diese erschöpften oder erbitterten Menschen: ›Euer Landkauf ist Bluff! Wozu so viel Land, wenn ihr zu wenig Geld für seine Bebauung habt?‹
Der kühle und besonnene Mann der Exekutive antwortet darauf: ›Diese Wünsche können nicht berücksichtigt werden. Vorwürfe dieser Art treffen uns nicht. Kaufen wir heute kein Land, so entgeht uns eine günstige Gelegenheit. Der Effendi, der Klerus treibt die Preise in die Höhe und wir können morgen zusehen, auf welche Weise wir hier Fuß fassen. Wir müssen alles, was wir haben, aufwenden, um Land zu kaufen. Ohne Landbesitz ist der Zionismus eine Seifenblase. Wir sind keine Rattenfänger. Niemandem gaukeln wir verführerische Spiegelungen von Dingen vor, die es nicht gibt. Jeder, der hier noch Steine klopfen muß, um zu leben, ist für die Ansiedlung vorgemerkt. Die Älteren stehen obenan in der Liste, die zuletzt Angekommenen müssen Geduld üben. Verliert einer Geduld und Mut und Nerven, so kann ihn dieses Land nicht brauchen. Wir kämpfen. Man muß einsehen, daß wir unser Bestes leisten.‹
Der Chaluz aber, dessen Arbeit auf der Kwisch aufgehört hat, zieht seine Stiefel aus, packt seine paar Bücher, die er mit nach Palästina gebracht hat, in sein zweites Hemd, – falls er noch etwas der Art besitzt, schwingt Schuh und Buch und Hemd auf den Buckel und marschiert barfuß und mit leerem Magen über selbstgefertigte Straßen nach Jerusalem oder Jaffa, um zu sehen, wie er sein Leben weiterfristet.
»Ich bin a armer Chaluz
Chaluzl aus Poilen,
Ich loif af Stiefelach,
Stiefelach ohn Soilen!«
Das Schwergewicht dieses Buches, all dessen, was ich über Palästina auszusagen habe, liegt in diesen Verhältnissen, dem Wesen, den Lebensmöglichkeiten und den Lebensbedingungen der Chaluzim. Ich versuchte, zu 24 erkunden, und ich versuche, zu schildern, wie es mit ihrer Arbeit, ihren Arbeitstheorien bestellt ist; wie es in ihren Herzen, in ihrem Verstand aussieht; was sie für Palästina, für die Juden der Welt, was sie für die Menschheit und die Zukunft der Menschheit bedeuten. Alles, was ich zu sagen habe, ruht in diesem Gebiet: Chaluz. Es ist die eine, die zentrale, die alles andere übertönende Frage des Zionismus. Es ist aber auch eines der bedeutungsvollsten Probleme der großen, allgemeinen, sozial-religiösen Bewegung dieser Zeit. Chaluz bedeutet Pionier. Es ist vielleicht nicht der Boden Palästinas allein, den dieser Pionier bereitet.
Die Parteien der jüdischen Arbeiter in der Diaspora finden ihre Fortsetzung, besser gesagt, ihre Verwurzelung in den sozialistischen Vereinigungen der palästinensischen Arbeiterschaft.
Dem rechten Flügel der »Poale Zion« (»Arbeiter Zions«) entspricht in Palästina – ungefähr – die »Achduth Haawoda« (»Vereinigung der Arbeit«). Der aus den Diasporaparteien »Hapoel Hazair« (»Vereinigung der jungen Arbeiter«) und »Zeire Zion« (»Jung-Zion«) gebildeten gemeinschaftlichen Organisation der »Hitachduth« entspricht in Palästina – ungefähr – die um einige Grade radikalere »Hapoel Hazair«. Dem linken, ausgesprochen kommunistischen Flügel der »Poale Zion«, Wiener Richtung, der jetzt um Aufnahme in die dritte Internationale nachgesucht hat, entspricht in Palästina die (nach den Maipogromen) von der englischen Regierung verfolgte, dezimierte, im Lande nur mehr illegal arbeitende Partei der »Boruchows« (sie ist nach dem Gründer der Welt-Poale Zion, dem bedeutenden russischen Theoretiker des Sozialismus und Hebraisten benannt), die auch nach den Anfangsbuchstaben ihres offiziellen Namens »Miphleget Poalim Zionistim Iwriim« mit etwas verächtlicher Betonung die »Mopsi« genannt wird.
Wenn ich bei dieser letzteren Partei nicht mehr zu sagen brauche, daß sie ihrer europäischen Organisation »ungefähr« 25 entspreche, so bedeutet das: sie hat ein ganz klar umzirkeltes Programm, nämlich Moskau; und auch: daß all die anderen palästinensischen Parteien, durch die geographische Distanz (aber nicht allein durch sie), in der sie sich zu den Diaspora-Organisationen befinden, von diesen wesentlich abweichen.
Die »Boruchows« (ihre Zahl ist eine numerisch äußerst geringe) lehnen im Prinzip jegliches Mitwirken an öffentlichen, an Regierungsarbeiten ab. Sie bekennen sich hierdurch aktiv wie durch passiven Widerstand zum Kampf gegen die englische Macht, die, wie Moskau betont, aus Palästina eine englische Kolonie zu formen bestrebt ist. Wenn die »Boruchows« sich trotzdem bei Arbeiten der bekämpften Art betätigen, so tun sie es aus der Erwägung, daß Zellen geschaffen und eine gemeinschaftliche Organisation jüdischer und arabischer Arbeiter versucht werden muß. Beim Bahnbau in Haiffa hatten sie bei diesem Beginnen einen ausgesprochenen Fehlschlag zu verzeichnen. Auf solch primitive Art läßt sich die Erfassung des vollkommen unentwickelten Arabers nicht durchführen. Die »Boruchows« betonen ferner: daß man den Industriekapitalismus ja wohl nach Palästina hereinlassen müsse, und zwar in seiner extremsten, »amerikanischsten« Form, damit definitive Verproletarisierung des jüdischen Arbeiters im Heiligen Land ihn auf das Niveau und in engste Gemeinschaft mit dem niederen, ausgebeuteten arabischen Landproletarier herabdrücke. Dann, meinen die »Boruchows«, und nur dann werde eine organisatorische Vereinigung des jüdischen Einwanderers und der eingeborenen – jetzt noch feindseligen – Landbevölkerung zu erzielen sein. Sonst, meinen sie, – und ich muß sagen, mit vollem Recht! – sei vom Standpunkt des konsequenten Marxismus betrachtet, das Problem »Palästina« unlösbar. Sie sehen nüchterner und klarer als alle anderen die Katastrophe, die ökonomische wie die des Rassen-Zusammenstoßes, über das Land hereinbrechen, falls diese letzte Phase, die Kapitalisierung Palästinas, gegen 26 die sich heute das Gefühl auflehnt, nicht bald eintritt. Die »Boruchows« beurteilen die Lage des heutigen Palästina sehr pessimistisch. Aus dem, was sie die Krise des palästinischen Zionismus nennen, sehen sie keinen Ausweg. Aber sie geben dem Willen Ausdruck: trotz aller Aussichtslosigkeit sei die Gesamtarbeit in Palästina mit allen Mitteln aufrecht zu halten; – denn es gäbe kein Zurück!
Ich komme nun auf das »Ungefähr« der anderen Parteien Palästinas zu sprechen.
Die Arbeiterparteien haben in Palästina ein ganz anderes Aussehen als in der Diaspora. Man wäre versucht zu sagen: Palästina verträgt gar kein Parteiwesen. Die Parteien Palästinas entsprechen gar nicht der Wirklichkeit. Sie sind lediglich atavistische Erinnerungen an die Zerklüftung der westlichen Menschheit, in der Alten Welt, die im Zersetzungsprozeß dahinschwindet. Fragt man nach der spezifischen Richtung, dem Programm dieser oder jener Partei, nach der Distanz, in der sie sich von der Nachbarpartei rechts oder links befindet, so erhält man ungenügenden Aufschluß. Im Grunde verschwimmen die Konturen der palästinischen Parteien; einzelne Persönlichkeiten, Führer von Gruppen färben und bestimmen das Wesen der Parteien viel deutlicher, als aus Europa geholte oder übernommene Programme. Es verhält sich so: daß hier im Urväterlande sich eine Arbeiterschar zusammengefunden hat, die in einer überpersönlichen Gemeinschaft die verwilderte Heimat und in ihr die Zukunft aufbauen will. Das Licht über Zion hebt die Abschattungen der Partei auf, – es erscheint bei aller Differenzierung der Tendenzen und Persönlichkeiten eine geeinte Phalanx von Arbeitern an Zion.
Darum könnte ich mir heute, in Tel-Awiw oder Jerusalem, wohl irgendwelche Verzweiflungsausbrüche von Chaluzim vorstellen, – aber keinen Streik. Darum gibt es in der palästinischen Landwirtschaft keinen Achtstundentag. Darum würde ich, obzwar in Palästina Menschen von 27 höchster Intelligenz beisammen sind, Rebellen gegen jede Vermechanisierung des Arbeitsprozesses, das heißt des werktätigen Individuums, – der Einführung des Taylorsystems ohne Warnung beistimmen. Denn diesen Arbeitern ist ja um ihre Idee, ihre Illusion Erez Israel zu tun. (Nun, die mitgebrachte russische, die angestammte Ghetto-Indolenz, Trägheit der »breiten Natur«, Nachgeben der Nerven, fügt der Arbeit Palästinas, auch ohne aktive Sabotage, genug Schaden zu.)
Russisch ist aber auch, daß es in Palästina letzten Endes so viele Parteien gibt wie Arbeiter. Jeder hat seine Theorie der Arbeit, seiner eigenen, der seiner Gruppe, der der Gesamtheit. Im Galuth legte er die heiligen Bücher aus, in Palästina Marx.
Palästina befindet sich, ich wiederhole es, noch im Stadium des Experimentes. Für das Experiment bietet die Arbeit den ergiebigsten Boden. Vor allem aber die Kolonisationsarbeit.
Ich bin in etwa zwanzig Siedlungen, Arbeitergruppen, Kolonien Palästinas herumgekommen; habe das Land, den Boden der Ebenen und der Berge in seinem wüsten Urzustand, im Stadium der ersten Vorbereitungen zur Bebauung und auch in jenem der Reife und des Triumphs gesehen.
An zwanzig Orten habe ich Menschen im Schweiße ihrer Stirnen härteste körperliche Arbeit verrichten sehen, – aber der Fluch des verlorenen Paradieses lastete mit nichten auf dieser Arbeit; – denn ich habe diese selben Menschen wenige Tage nachher, auf dem Landarbeiter-Kongreß in Haiffa, ihre Arbeitsmethoden, Theorien, Entdeckungen mit voller Energie und hinreißender Kraft der Überzeugung vortragen und verteidigen gehört.
Und da sich in Palästina jede Arbeitsmethode in der Formation der Gemeinschaft, die die Arbeit ausführt, widerspiegelt, diese jene, jene diese entscheidend beeinflußt, – weiß ich nun, wie über Palästina, auch etwas genauer, als 28 ich es wußte, ehe ich den Menschen Palästinas begegnet bin, über den Sinn dieser Zeit Bescheid.
Die soziale und kolonisatorische Bewegung der jungen Arbeiter verfolgt heute zwei Richtungen:
die eine strebt auf gemeinsam bewirtschaftetem Gebiet die große Kwuzah (Gruppe), das heißt, die große Gemeinschaft an,
die andere, die der Moschaw Awdim (Arbeitersiedlung), das engere und innige Zusammenwirken kleiner Familiengruppen, von denen jede ihr Stück Land selbständig bewirtschaftet.
Die große, kooperative Gemeinschaft vereinigt unter kommunistischen Prinzipien alle Berufsgattungen in zentralisierter Form zu gemeinsamer Produktion und Konsum,
die Siedlungsgenossenschaft, die mehr auf Privateigentum basiert, erinnert in ihrer Methode des Zusammenwirkens kleiner Gemeinschaften stellenweise, man könnte sagen, an das utopische Ideal der anarchistischen Föderation auf großem Gebiet frei beisammenlebender Nachbargruppen.
Dies wäre auch so zu formulieren: im heutigen Palästina wollen sich zwei Arten von Landwirtschaft durchsetzen,
die extensive der großen Kooperative
und die intensive, die allein die kleine Gruppe durchführen kann.
Für die letztere spricht vieles. Praktische Erwägungen. Manche wichtige Pflanzenart, die Durra, der Sesam, deren Anbau bisher vernachlässigt worden ist, Gemüsearten, insbesondere die Aubergine, ein bekömmliches Nahrungsmittel, gedeihen nur bei intensiver Wirtschaft. Kleinviehzucht, Bienen und Raupenzucht erfordern den Kleinbetrieb. Auch ist die Regelung der Arbeit bei solcher Art von Landbewirtschaftung leichter, da Sommer- wie Winterarbeit ungefähr die gleiche Zahl von Arbeitern erfordert. 29 Während bei extensiver Wirtschaft die Erntezeit Zuziehung von Hilfsarbeitern nötig macht, bleiben im Winter viele von den vereinigten Arbeitern der Kwuzah unbeschäftigt.
Für die große Gemeinschaft aber spricht, mit der Notwendigkeit der Bebauung und Bepflanzung ausgedehnter Gebiete, vor allem der Geist dieser Zeit, der die Menschheit vom Privateigentum zum Sozialismus, von der kleinen Familiengruppe zur großen Kooperative führt, in der das Eigentum des Einzelnen in das der Allgemeinheit aufgegangen ist.
Die Arbeitersiedlung findet ihre Anhänger hauptsächlich unter den älteren Arbeitern Palästinas, vor allem unter den verheirateten. Die jungen Einwanderer und Einwanderinnen der Nachkriegszeit aber sind begeisterte Bejaher der großen Kwuzah, der kommunistischen Gemeinschaft.
Der Geist dieser Zeit hat ja den jungen Chaluz aus der Alten Welt, in der er das Scheitern der hergebrachten Wirtschaftssysteme miterlebt hat, nach Palästina gebracht. Wie sollte er daran denken, die verendende Welt hierher in die neue herüber zu pflanzen? Er läßt sich daher auch zu keiner Art von Wirtschaft zwingen, benutzen oder mißbrauchen, die seinen sozialen Prinzipien widerspricht. Er opfert sich gern für das Land, in dem er seiner Gesinnung gemäß leben kann. Die Zionistische Kommission ist klug genug, den Chaluz gewähren zu lassen. Dem Fortschritt feindlich Gesonnene murren: die Kommission sei ja merkwürdig scharf links gerichtet. Aber jeder, der die Verhältnisse kennt, weiß: die Arbeitswilligkeit, die Freude an seiner Arbeit, der Opfersinn des Chaluz ist der einzige Posten auf der Haben-Seite der palästinischen Wirtschaft dieser Tage.
Die Zionistische Kommission hat der großen Kwuzah wie der Moschaw Awdim auf dem Boden des jüdischen Nationalfonds große Gebiete zur Durchführung ihrer Pläne überlassen. Beide befinden sich in der fruchtbaren Jesreel-Ebene Nieder-Galiläas; sie heißen Nurriss und Mallul. 30
Die großen sozialen Experimente Palästinas werden auf dem Boden des Jüdischen Nationalfonds unternommen. Die Kommunisten der Kwuzah wie die Siedler Malluls leben von dem, was ihnen die Zionistische Kommission aus den amerikanischen Sammlungen zuweist. Jede Art Arbeit, das für den Ankauf von Inventar nötige Geld, die Kredite für die Bewirtschaftung des Bodens, die gesamte Existenz der Arbeiter und ihrer Organisationen, Wohl und Wehe des jüdischen Palästinas fließt aus freiwilligen Spenden philanthropisch gesinnter Zionisten in der Diaspora; nur zum kleinsten Teil aus Beiträgen der jüdischen Arbeiterparteien der Weltorganisation.
Das ist das merkwürdige, zweideutige, beunruhigende Problem des palästinischen Sozialismus!
Es erhebt sich vor dem aufrichtigen und zu Ende denkenden Sozialisten, der sich diesem Problem gegenüber sieht, die Gewissensfrage: darfst du zu solcher Art Sozialismus »Ja« sagen, für sie deine Stimme erheben? oder wäre es nicht besser, jene Quelle privater Wohltätigkeit versiegte, und das jüdische Palästina verdorrte in der Katastrophe, die die einen fürchten, die anderen herbeisehnen? Haben die Genossen mit ihrem »Es gibt kein Zurück!« recht, oder gibt es heute noch ein Zurück?
Am stärksten interessiert den Sozialisten, der sich in Palästina umsieht, das neuartige überraschende Gebilde der »Gduth Haawoda«, der Arbeitsarmee.
Das ist eine radikale Formation, nach russischem Muster aufgebaut und von rein kommunistischen Grundsätzen bestimmt; zugleich eine Arbeiter- und militärische Organisation, die ihre Mitglieder unter strengen Bedingungen äußerer und innerer Disziplin zur Arbeit und zum Selbstschutz unter Waffen anhält.
Die Idee zur Gduth entstammt dem russisch-jüdischen Legionär Josef Trumpeldor, dem Märtyrer der jungen palästinischen Kolonisation, der vor zwei Jahren bei der 31 Verteidigung der kleinen obergaliläischen Niederlassung Tel-Chai gegen marodierende Beduinen gefallen ist. Aus russischen Gefängnissen führte ihn die Revolution in die Freiheit. Er kämpfte als Kapitän im englischen »Zion Mulecorps« an vielen Fronten und zog mit Allenby in Jerusalem ein. Ich habe sein Bild in ganz Palästina gesehen. In Zelten, Baracken, Steinhäusern, neben denen Weizmanns, des Präsidenten, und Herzls, des Schöpfers der Zionistischen Weltorganisation, – an Orten, wo Arbeiter lebten und sich versammelten; öfter, als die der beiden anderen.
Das geistige Haupt, Führer und Apostel der heutigen Gduth ist der junge russische Jude Jehuda Kopelewitsch, Freund und Genosse, auch Kerkergenosse Trumpeldors.
Die Gduth – Kern der »großen Kwuzah« von Nurriss – arbeitet in disziplinierten Bataillonen auf dem Lande, das ihr vom Jüdischen Nationalfonds zur Verfügung gestellt wird; sie übernimmt auch die Straßenarbeit, die ihr von der englischen Regierung, die Entwässerungs-, Bau- und Pflanzungsarbeiten, die ihr von der Kommission wie von den Kolonisten zugewiesen werden. Ihr Grundsatz ist, und sie hofft ihn in Nurriss durchführen zu können, daß die Gemeinschaft alles in eigenen Werkstätten zu produzieren hat, was für ihren Bedarf notwendig ist, – vorerst Kleider und Schuhe, später landwirtschaftliche Geräte usw. Wie die Einkünfte aus der gemeinsamen Arbeit, sind auch die Ausgaben zentralisiert. Die Gduth entsendet die Genossen, die sich ihr angeschlossen haben, zu jeder Art von Arbeit, nach Maßgabe der Notwendigkeit der Arbeit und des Interesses der Genossen. Auch Araber nimmt die Gduth auf, falls diese mit den Grundprinzipien der Organisation einverstanden sind und sich der Disziplin fügen wollen. Nach Ablauf eines Probemonats erteilt der geschäftsführende Ausschuß die Genehmigung der Aufnahme des Genossen, der Genossin in die örtliche Gruppe, der sie angehören. Diese verstreuten Ortsgruppen entsenden Delegierte in die Zentrale, die aus sich den geschäftsführenden Ausschuß wählt. 32 Die Zentrale teilt nicht nur die Arbeit an die Mitglieder aus, sondern »befriedigt auch die Kulturbedürfnisse, deren ihre Mitglieder im Lebenskampfe bedürfen«. Sie sorgt für Bibliothek, Vorträge, Unterricht, Kinoaufführungen usw. Bei mangelhaften Erträgnissen örtlicher Gruppen steht dem zentralen Rat das Recht zu, solche Gruppen aufzulösen und unter die anderen Gruppen der Organisation zu verteilen. Jedes Mitglied der Gduth hat sich im Waffendienst für die Verteidigung der Gemeinschaft auszubilden und zu vervollkommnen. In dem Fragebogen, den der Aufzunehmende ausfüllt, steht neben der Rubrik: in welchem landwirtschaftlichen Berufe, Gewerbe oder Kunstzweig der Genosse in der Heimat gearbeitet habe, diese: bei welcher Waffengattung oder Sanitätsdienst er oder sie gedient habe?
In dieser Form – von der Arbeit für die Gemeinschaft zum (wie ich ausführen werde, sehr nötigen) Waffenschutz dieser Arbeit und dieser Gemeinschaft übergehend – will die Gduth eine ethische Form des Militarismus schaffen.
Die Gduth – an ihrer Spitze steht außer Kopelewitsch der anerkannte Organisator von Nurriss, der Ukrainer Lefkowitsch – verfügt schon heute über eine große Mitgliederzahl, und ihr Ansehen unter den jungen Arbeitern befestigt sich von Tag zu Tag. Sie wird durch das Beispiel ihrer Arbeit und ihrer sittlichen Auffassung des Problems der »großen Gruppe« die Arbeiterorganisationen Palästinas sicherlich beeinflussen. Man sagte mir, daß sie bereits eine Vereinheitlichung aller Arbeitstarife in Palästina erzielt habe. Für uns Nichtpalästiner ist sie wichtig, weil sie, an dem entgegengesetzten Ende anhebend, gleiche Ziele verfolgt wie die »Arbeitsarmee« Trotzkis, die von der Demobilisierung stehender Kampfformationen des Roten Heeres ihre Bataillone bezieht. Ob die Zentralisierung in radikalster Form in Palästina berechtigt und befähigt ist, die Gesamtarbeit des Landes zu lenken, darüber muß die Zukunft entscheiden. Daß dieser Wille zur Zentralisierung sich (wie in Rußland) selber ad absurdum führen kann, 33 bewies auf dem Kongreß von Haiffa ein Antrag des Delegierten Bin Gorion (eines Mannes von unbestreitbar interessanten Einfällen, doch mit unangenehmem »Kommissär«-Beigeschmack), der von jedem in der Gduth Organisierten bedingungslose Unterwerfung unter die Verfügungen der Zentrale, eine Art Mizraim mit Tarifen, forderte. Über diese wilde Zumutung ging der Kongreß ohne Debatte zur Tagesordnung über.
Immerhin kann man in Palästina hitzige Übertreibungen an sich gesunder Theorien oft beobachten. Die Kommission hätte solchen Fällen gegenüber einen schweren Stand; – es erweist sich aber, daß die Notwendigkeiten des Lebens, Einsicht in die gegebenen Verhältnisse des Landes und der in den Menschen selber begründeten Bedingungen der Entwicklung die jungen Heißsporne oft zur Nachgiebigkeit bestimmen. Die Kommission und die junge Arbeiterschaft kommen sich sozusagen auf halbem Wege entgegen, und die Arbeit wird gefördert. Im Grunde handelt es sich ja um diese Arbeit allein.
Gespräch zwischen Kopelewitsch und mir, vor dem Landwirtschaftlichen Museum in Jerusalem.
Ich: »Was seid ihr für Kommunisten?! Wie die alten Chalukkaleute hier in den Bethäusern ihr Leben aus Spenden frommer Wohltäter fristen, – wie die alten Kolonisten anno dazumal ihren Unterhalt aus den Fonds der französischen »Alliances«, des Deutschen Hilfsvereins, aus den Millionen des Barons Rothschild usw. zogen, – so baut ihr euren Kommunismus auf den Beiträgen auf, die amerikanische Kapitalisten einer im Grunde gutbürgerlichen Organisation, der Zionistischen Kommission, überweisen. Chalukka-Kommunisten!! Der Kommunismus expropriiert in anderen Ländern den Kapitalismus, den er dort vorfindet. Ihr expropriiert kleinweise den amerikanischen Kapitalisten, je nach dem Posteinlauf; die Gutmütigkeit oder das »Wir wollen nicht wissen, was mit unserem Geld geschieht!« des amerikanischen Zionisten.«
34 Kopelewitsch: »Der Kapitalismus muß uns die Möglichkeit schaffen, daß wir kommunistisch leben können.«
Das Jüdische Landwirtschaftsmuseum in Jerusalem, eine Schöpfung des Leiters der Zionistischen Kolonisationsarbeit, Jakob Ettinger, zeigt in mustergültiger Übersichtlichkeit und Vollendung neben den Gesteins- und Tierarten des Landes Proben von allem, was dem steinigen Boden Palästinas abgerungen werden kann: Korn, Obst, Baum.
Die Schrift, die Legende, aber auch der Chronist Flavius Josephus, berichten von den herrlichen Wäldern, Gärten, wogenden Feldern und üppigen Wiesen des Landes. Wo sind sie geblieben? Wo Kanaan, Mamre, der Eichenforst des heiligen Tabor?

Der heilige Tabor, einst dicht bewaldet
Stein, Fels, Sumpf; hier und dort wild ein Fleck Unterholz, zarte Wurzeln von Ziegenherden zernagt und vernichtet; ein paar Olivenbäume in Gruppen; von hohen stacheligen Kaktushecken umgebene Baumpflanzungen, Getreidevierecke arabischer Bauern; und im Lande verstreut, auf Bergen, in Ebenen, Oasen, vereinzelt grüne Landstriche, Eukalyptushaine, Orangen, Bananen, Traubengärten jüdischer Siedler und Kolonisten.
Auf der Reise nach Jaffa bestieg ich in Port-Said das kleine Schiff »Merano« des Triester Lloyd. Wir blieben anderthalb Tage liegen, weil wir Bretter zu laden hatten. Auf den Brettern waren die Worte »Orangenkisten für Jaffa« zu lesen. Das Holz kam aus Österreich. Es gibt also in Palästina keinen Wald. Das Holz für Orangenkisten muß die Steiermark liefern!
Der Boden hat aber auch keine Kohle, kein Öl, kein Eisen. Ja sogar die Steine taugen an Orten, wo man sie zum Bauen gut brauchen könnte, nicht viel. In Tel-Awiw am Strand entsteht eine Silikat-Ziegelfabrik. Der Stein um Jaffa ist zu porös.
In die Kolonien, die seit vierzig Jahren und darüber bestehen, muß Gefrierfleisch aus Australien, müssen Eier, 35 Butter, Reis, Kartoffeln, ja Tomaten (aus Ägypten) eingeführt werden. (Dafür findet man, in Kairo in Alexandrien, eine Tagereise von den Orangengärten Jaffas bei Obsthändlern Apfelsinen aus Kalifornien und Florida.)
Was produzieren denn diese alten Kolonien, die vierzigjährigen? In den Kellereien des Barons Rothschild, in Rischon-le-Zion, ruht der schwere süße Wein Palästinas. Die Ausfuhr stockt; – Amerika ist »trocken«, das ägyptische Pfund, die Währung des Landes, steht hoch, die Welt ist arm.
Der Jude deckt auf dem Land, in den Städten seinen Bedarf an Lebensmitteln zumeist beim arabischen Krämer, im Bazar. Aber der Araber kauft nicht beim Juden.
Der Araber ist überhaupt bedürfnislos. In Tennen trampelt er das Korn aus den Halmen, mahlt es in Mühlen, wie die es war, an deren Rad gebunden Simson neben dem Ochsen im Kreise lief. Seine Nahrung sind flache Fladen, Melonen und Kaffee. Seine Zelte sind grobe Matten auf Stangen, sein Trinkgefäß enthaarter Ziegenbalg. Lebt er in Dörfern, so sind seine Hütten aus Lehm, und wenn es zwei Tage hintereinander geregnet hat, so schmilzt solch ein Dorf zu einer Kotlache nieder. Das Klima löst die Wohnungsfrage des Arabers auf die einfachste Weise, – kaum dreißig Tage im Jahr ist der Aufenthalt unter schützendem Dach Notwendigkeit.
Ein Dutzend Effendis, das heißt wohlhabende eingesessene Familien besitzen das Land, das der Nationalfonds für die Kolonisation braucht. Der Effendi läßt von seinem verelendeten Pächter oder Arbeiter nur einen geringfügigen Bruchteil seines Bodens bearbeiten, der Rest liegt brach. Verkauft er sein Land, so fährt der Effendi nach Kairo, wenn möglich ohne seine Weiber, und sieht dort gute Tage.
Hartnäckige Arbeit vermag aus dem Boden alles zu ziehen, was große Menschenmassen im Lande für ihre Nahrung, Kleidung, alle Erfordernisse ihres leiblichen Lebens bedürfen. In manch einer von den zwanzig Siedlungen, 36 die ich in Judäas Gebirge, im Alluvialgebiet im nahen Transjordan, südlich des Genezarethsees, in der Jesreel-Ebene besucht habe, sprossen schon wieder die Bäume, keimt das Getreide, reifen die Früchte des sagenhaften, versunkenen Kanaan.
Die jüdische Landwirtschaft Palästinas muß vor allem trachten, die Bedürfnisse der jüdischen Bevölkerung im Lande zu decken.
Ich begleitete Jakob Ettinger auf einer Inspektionsreise durch die Siedlungen Galiläas. Agronom und Sozialist; Kenner des Bodens und der Menschen; Berater nicht nur, sondern Freund der Arbeiter, die ihm vertrauen und denen er hilft. Menschen einer wunderbar reinen und vollwertigen Art begegnet man in Palästina; ich habe manch einen in der zionistischen Kommission angetroffen; ihre Tätigkeit löst die zuweilen beklemmende Unstimmigkeit auf, die sich bei der Gegenüberstellung: Chaluz – Exekutive einstellt.
Ettinger hatte den speziellen Auftrag, Siedlungen, deren Ertrag den Erwartungen der Kommission nicht entsprach, auf ihren Strukturfehler zu untersuchen; sie durch technische Hilfsmittel zu sanieren; im ärgsten Falle aufzulösen und den Siedlern diese Notwendigkeit verständlich zu machen. Wir kamen in Siedlungen, in denen gemischte Farmarbeit, Pflanzung und Viehzucht eingeführt werden sollte. Hier gab es oft tief in das private Leben der Siedler einschneidende Fragen zu erörtern, – Frauen mußten zugezogen werden, die sich auf Gemüsebau und Kleinvieh verstanden; den Siedlern mußte nahegelegt werden, daß Familiengründung zur Stabilisierung der kleinen Niederlassung vonnöten sei, weil das Kommen und Gehen der ledigen Genossen, die hier nur kurze Zeit arbeiteten und es dann anderswo versuchten, die Farm um jede Möglichkeit der Entwicklung brachte. In anderen Siedlungen war die persönliche Sicherheit der kleinen Zahl Arbeiter, auf weiter wilder Öde, durch Beduinenstämme in den 37 umliegenden Bergen gefährdet, – solche Siedlungen mußten verstärkt oder verlegt werden; oft war solche Maßregel auch aus Gründen der Intensivierung der Arbeit durch die größere Arbeiterzahl nötig. Bei Erörterungen dieser Art ging's nicht ohne Herzbrechen ab. Unser Weg führte aber auch in Siedlungen, in denen es lediglich Bericht, Wünsche und Vorschläge der Siedler entgegenzunehmen galt.
Wiederholt hielten wir uns in den beiden berühmten Siedlungen Kinereth und Degania auf, die in vielfacher Beziehung für das gesamte Siedlungsproblem Palästinas charakteristisch sind. –
Degania wurde vor zwölf Jahren von der Jüdischen Kolonisationsgesellschaft auf Jordantal-Boden gegründet und an eine Arbeitergenossenschaft abgegeben, die dort nach ausgesprochen kommunistischem Prinzip lebt und arbeitet, mit Erfolg arbeitet und in mustergültiger Harmonie lebt. Sie ist bereits seit mehreren Jahren imstande, die Hälfte ihres Reingewinns an den Nationalfonds zurückzuzahlen, und amortisiert auf diese Weise die in Land, Häuser und Geräte gesteckten Summen der Kommission. Die Bodenfläche dieser Siedlung beträgt etwas über dreitausend Dunam (der Dunam = gleich neunhundert Quadratmeter).
Deganias Erfolg hat die Kommission zum Ankauf eines weiteren großen Landstriches in der Jordanebene veranlaßt, so daß sich dort, in meilenweiten Abständen von der ursprünglichen, jetzt Degania Aleph genannten Siedlung, die kleineren Farmen Degania Beth und Degania Gimmel gebildet haben.

Der Jordan
Degania Aleph besitzt ein steinernes Haus, große Stallungen, schönen parkartigen Garten, in dem Orangen und Mandelbäume blühen. Wo ehemals Sumpf war, um die Siedlung herum, erhebt sich jetzt ein gewaltiger Eukalyptushain; über den Jordanarm, der aus dem Genezarethsee an der Siedlung vorüberfließt, bauen die Arbeiter Deganias jetzt eine Brücke. In dieser gut bewirtschafteten und 38 gedeihenden Siedlung von etwa fünfzig Arbeitern (darunter fünf Familien, – es gibt auch einen Kindergarten von sechs, in Degania geborenen Kleinen) hat sich eine so innige Gesinnungs- und Arbeitsgemeinschaft ausgebildet, daß das sozialreligiöse Prinzip des Kommunismus gleichsam aus dem Boden gewachsen, wie ein starker Baum Menschen und Raum überschattet. Die glückliche Harmonie der meist jüngeren Leute fördert die ökonomischen Bedingungen. Die Arbeiter sind in ihrer Arbeitsteilung aufeinander abgestimmt, Abwanderung findet nur selten statt, und der Ruf der Gruppe bewirkt, daß sich Zuwachs aus den besten und tüchtigsten Elementen der palästinischen Arbeiterschaft einfindet.
Indes birgt dieser Idealzustand eine nicht zu unterschätzende Gefahr in sich. Der Umstand, daß man durch seine Arbeit imstande war, eine »Ehrenschuld« gegenüber der Kommission abzutragen, ist schon ein Hebel privatkapitalistischen Ehrgeizes, der die Siedlung über andere hinauf hebt und sie von der im großen ganzen schwer ringenden und mit Verlusten arbeitenden Mehrzahl der jüdischen Siedlungen des Landes abtrennt. Man darf sagen, daß sich in Siedlungen, die sich selbst erhalten, ohne Defizit arbeiten, sehr bald eine peinlich individualistische Auffassung des Problems der Gesamtheit und des Besitzes an eigenem Boden einstellen kann. Widersprüche dieser spezifisch palästinischen Art (Kommunismus der kleinen Gruppe mit privatkapitalistischem Einschlag) begegnet man heute oft; es ist das Prinzip Mallul; es zu bekämpfen wird Nurriss aufgerichtet, strebt die Gduth, die Armee der Arbeit an.
In Degania Gimmel, eine halbe Stunde Autofahrt von Aleph, haben sich zwölf junge Menschen niedergelassen. Der wiederholte Besuch dieser kleinen Siedlung in der weiten Einöde des Transjordantals wird mir, das weiß ich, lange in Erinnerung bleiben.
Diese zwölf jungen Menschen – Ukrainer und Russen, darunter vier Frauen – haben das riesige Gebiet ihrer 39 Siedlung selbständig bearbeitet, beackert, bepflanzt. Die Freude an dem Zusammensein, der gemeinschaftlichen Arbeit und Verantwortung prägte sich schon in der Sauberkeit und Wohnlichkeit ihrer kleinen primitiven Holzhütten aus, in denen ihre Schlafräume sich befanden, der Schuppen für Geräte, der Speise- und Leseraum, darin unsere Beratung vor sich ging. Von den zwölf kamen nur sechs, vier Männer, zwei Frauen, zu uns herein, die anderen blieben draußen bei ihrer Arbeit, obzwar der Tag schon sank, obzwar sie wußten, daß der Besuch Ettingers ihre vitalsten Interessen betraf. Wir wurden mit Tee und Kuchen bewirtet. Während die Verhandlungen begannen, sah ich mich in der kleinen Baracke um. Ich fand eine kleine Bibliothek, deren Zusammensetzung charakteristisch genug war, – ich habe in vielen Hütten und Zelten ungefähr dieselbe feststellen können: hebräische Bücher, mitgebrachte, zumeist über Landwirtschaft, Chemie; Übersetzungen moderner Skandinavier, Originale von Achad Haam, deutsche: die psychoanalytischen Schriften von Freud; ein Band Nietzsche, ein Band Tagore. Freud und Marx – der eiserne Bestand der Chaluz-Bibliothek! Sehr oft Bücher und Broschüren von Hans Blüher. (Viele deutsche und österreichische Chaluzim, aus der Wandervogel-, der freien deutschen, der Blauweiß-Bewegung, erkundigten sich bei mir nach Blüher, seinen neuen Schriften, seinen Wandlungen, Anwandlungen.)
Draußen um die kleine Siedlung zog sich, nach allen Regeln der Kunst und unter Aufsicht englischer Offiziere verfertigt, ein Schützengraben. Die jungen Menschen von Degania Gimmel wußten nur zu gut, welche Gefahr sie zu jeder Stunde des Tages, in der sie hinter ihrem Pflug, der Nacht, in der sie mit dem Gewehr auf dem Rücken um ihre Hütten herumgingen, bedrohte. Die Araberstämme in den Bergen des Transjordan! Und sie waren zwölf. Aber sie widerstanden. Widersetzten sich. Sie wollten nicht aufgelöst, nicht mit dem größeren Degania Beth vereint werden, sie wollten bei ihrer Erde bleiben, die sie, hier draußen, weit 40 weg von den anderen, brauchte. Sie bearbeiteten ihr Stück, ein großes, weites Stück Landes, das sehr viel Pflege erforderte, sie hafteten solidarisch für ihr Stück Land. Brachte man sie weg, verfiel es. Hier, in der Einöde, waren sie zu Hause. In der Nachbarschaft jener Bergstämme. Seit einem Jahr schon verteidigten sie, mit Pflug und Gewehr, das Land, das ihnen zur Bebauung überlassen worden war, ihres. Ein föderalistisches Zusammenarbeiten mit Beth und Aleph war durch den Zusammenhang der drei Deganioth gegeben. Aber sie wollten Wege und Methoden finden, um ihre Arbeit zu intensivieren, stärker und konsequenter zu gestalten, um ihre kleine Gemeinschaft, so wie sie war, aufrecht zu erhalten, um nicht in eine andere, fremde Gruppe aufgehen zu müssen.
Hier sah ich die Verwurzelung des jungen Chaluz mit dem Boden der Urväter. Hier erlebte ich es an einem rührenden Beispiel, welche Art Selbständigkeit der Boden, die Idee, der Glaube in diesen aus dem Exil Stammenden, Verfolgten, Bedrückten, Heimatlosen entwickelt hatte. Kreuzfahrer – Puritaner, vom Felsen Plymouths ausgegangen, um in der Wildnis, von feindlichen Stämmen umlauert, ein Gottesreich durch Arbeit aufzurichten – aber diese da – keine Zeloten, Kinder des Friedens, keine starrköpfigen, verbohrten Sektierer, sondern von herrlichem Frohsinn erfüllte Söhne, Töchter eines neuen Zeitalters. Opfer bringen sie dar, mit jedem Atemzuge, jedem neuen Morgen, der sie noch leben sieht in der gefährdeten Einöde. Opfer bringend: harte Arbeit, Entbehrung, körperliche Not und Niederbrechen, von herrlicher Zuversicht erfüllt, bauen sie den Altar des Dritten Tempels auf den Ebenen Erez Israels.
Viele frohe, glückliche Menschen leben, jung, stark, unter der Sonne der alten steinigen Heimat. Ich sah mir diese jungen, arbeitenden Menschen an, die, um unseren Tisch sitzend, mit dem Leiter ihrer Arbeit, ihrem Freund ernst und ruhig, aber im Innersten aufgewühlt, über die tiefsten 41 wichtigsten Fragen ihres Stück Landes, ihrer Arbeit, ihrer Existenz sprachen. Es waren die reinsten, schönsten jungen Menschen, die ich in meinem Leben gesehen habe.

Terrassenbau, Judäa
Hoch auf dem Berge, auf einem mit Mühe dem Felsgeröll abgerungenen Plateau über der Siedlung Kinereth, am Südwestende des Genezarethsees, leben fünfundzwanzig junge Arbeiter und Arbeiterinnen. Vom Sturmwind umbraust, der aus der tiefen Schlucht des Jordantales, von den Bergen Gileads herüberfliegt, bauen sie dort Terrassen aus Steinen, die sie aus dem Boden heben, herbeischleppen, aufeinandertürmen, als Schutzmauern für Öl- und Mandelbäume, Trauben und Feigenbäume, die sie dort pflanzen werden. Seit acht Monaten leben sie in windverwehten Baracken, kämpfen mit Stein und Wind und den Widerständen des schwer ergründlichen tückischen Bodens um Ertrag und Erfolg ihrer Arbeit. Auch diese war eine frohe und glückliche Gruppe. Sie war dort oben vom Sumpffieber verschont, erfrischt von Wind und Kühle, ihres Lebens froh. Instruktoren sollten hierher, gemischte Farmwirtschaft, neue Siedler, die die Kolonie ausbauen, festigen. Berg-Kinereth war mit allem einverstanden. –

Kinereth
Aber unten, im alten Kinereth, der weitberühmten alten Siedlung Galiläas, der ältesten am Genezarethsee, blickten wir in betrübte Gesichter.
Diese Kolonie will nicht recht gedeihen. Der Bodenbesitz Kinereths umfaßt sechsthalbtausend Dunam, es stehen steinerne Häuser da, ringsum sind große, ertragreiche Gemüseplantagen angelegt, hier war auch die Lehrfarm für Mädchen eingerichtet gewesen, der Hof mit Stallungen gibt Möglichkeit zur gemischten Farmarbeit unter den günstigsten Bedingungen, – aber es ist ein Kommen und Gehen in dieser Kolonie, eine Unrast und Mangel an Zusammenhalt, der die Arbeit hemmt und zuweilen ganz unterbricht. Sind es intime Momente der Unvereinbarkeit der Temperamente und Charaktere, die 42 diese Kolonie zum Sorgenkind Palästinas machen? Viele von den ersten Ansiedlern sind tot, die neuen können zusammen mit den alten, eingesessenen, die Form, die innere Form des Zusammenhaltes nicht herstellen, die allein alles Äußere, alle äußeren ökonomischen Formen der Existenz beeinflußt und bestimmt. Solche tragischen Unstimmigkeiten vernichten oft alle günstigen Vorbedingungen, heben jede Möglichkeit der Sanierung durch äußere Mittel und Methoden auf. Ernsteste Arbeit wird vertan, der Boden mag hergeben, was und soviel er kann, die Siedlung verdorrt. Es ist, als hätte jede Gruppe, jede dieser Kolonien ihren Schutzgeist oder Dämon. Die tüchtigsten, zum Opfer willigsten und fähigsten Menschen werden an Orten wie diesem schwach, matt, werfen bald die Flinte ins Korn, nicht selten das Leben von sich. Die Entbehrungen, die die Arbeit dem Einzelnen auferlegt, werden nicht freudig getragen, weil jeder sich einzeln von ihnen belastet fühlt; die Frage reckt sich hoch: – ob die Gemeinschaft diese Last rechtfertigt? Viele junge Menschen fliehen aus solchen Gemeinschaften zurück in das Land des Exils, woher sie kamen, verderben dort. Die Übriggebliebenen aber bedrückt Verzweiflung. –
Auf meinen Fahrten durch die Kolonien und Siedlungen Palästinas bin ich mancher Tragödie dieser Art begegnet. Es sind lebende und sehr wache und empfindliche Menschen, die das heutige Palästina an der Arbeit sieht. Ihre Schicksale sind oft schwer zu lenken. Es bedarf der ganzen, vollen Menschlichkeit und Klugheit von Männern wie Ettinger und der Aufbauer Palästinas, Dr. Arthur Ruppin, um hier Rat und Hilfe zu wissen. –
Im benachbarten, glücklichen Degania lebt und dichtet der alte Arbeiter Gordon, verdienter Patriarch der Chaluzbewegung. Hat er an das Schicksal jener Kolonie drüben am Ufer des Sees Galiläas gedacht, als er, nach einem ukrainischen Lied, dieses neu dichtete – 43
»Auf dem Pripjetschick
Brennt a Feierl,
Un dos Herz is kalt –
Weil die Alten sennen
Toiten schon lang –
Un die Jungen alt. –«
Oft hörte ich die melancholische Weise, an Freitagabenden, an Samstagabenden, in Zelten und Baracken singen. An vielen Orten, von jungen Arbeitern, jungen Mädchen, frischen Stimmen und auch müden. –
All diese Kolonien, Siedlungen, neue und alte, stehen unter fortgesetzter Kontrolle der Kommission. Das hat seine Vorzüge und Nachteile.
In den Niederlassungen, sowohl kommunistischer Art wie in denen, wo mehr privatkapitalistische Initiative vorherrscht, weiß der Arbeiter und Siedler, daß für Defizite die Kommission mit ihren Mitteln aufkommt.
Dies kann Demoralisation zwiefacher Art erzeugen.
Wozu die Anstrengung? Die Kommission gleicht den Verlust aus! –
Aber auch das Gegenteil mag eintreten. Eine Gruppe mag trotz jahrelanger Anstrengung fortgesetzt mit Verlust arbeiten, weil sie verhältnismäßig große Summen für nicht direkt produktive Arbeit ausgeben muß, Sumpfentwässerung, Pflanzung junger Bäume, die erst in vier bis fünf Jahren Früchte tragen werden, – vornehmlich aber darum, weil sie für dringende Anschaffungen von der mit Geldnot kämpfenden Kommission nur ungenügende Summen erhält und dadurch bei wichtigsten Arbeiten behindert ist. Dann tritt, durch Einsicht der Fruchtlosigkeit aller Bemühungen, leicht Müdigkeit ein, Indolenz, Gehenlassen, hol's der Teufel, und die Wirtschaft ginge zugrunde, griffe die Kommission nicht mit rettender Hand ein.
(Hierher gehört ja auch das Antichambrieren der Genossen, das wochenlang Auf-Geld-Warten vor dem Tor der 44 Kommission in Jerusalem. Das Knausern am falschen Ort und auch überstürzte Hast bei der Ansiedlung von Arbeiterfamilien an ungenügend entwässerten Sümpfen. Die Siedlung, in der ich die Ungarn traf, war zwölf Jahre alt, der Sumpf immer noch nicht reguliert. In Chedera mußten drei Generationen von Kolonisten an Malaria sterben. Statt die Entwässerung sumpfiger Stellen großzügig, auf ersten Anhieb, zu bewerkstelligen, führt man sie langsam, jahrelang, während dort schon gepflanzt und gebaut wird, durch, sehr zum Schaden von Leben und Energien, – ein Fehler der Organisation, über den ich manche Klage anhörte.)
Andererseits aber – kam ich mit Doktor Ruppin und Ettinger eines Tages in eine kleine Siedlung, nahe beim Meer, südlich von Jaffa. Wir traten in das Haus des Wortführers der Siedler ein, ein nettes Haus, mit einem gut gehaltenen Hühnerhof, den die Frau bewirtschaftete und der sich sehen lassen konnte. Der Hausherr – er wohnte und arbeitete seit zehn Jahren dort, hatte das ihm zugewiesene Stück Land erfolgreich bebaut, schickte seine Kinder in die Schule, ins nahe Rischon-le-Zion – der Hausherr rückte bald mit einer Bitte heraus: die Kommission möge ihm zwei Kühe kaufen, er wolle seine Wirtschaft vergrößern. Es drängt sich nun die Frage auf: wo in aller Welt ist es noch Brauch, daß ein Bauer, der an die zehn Jahre auf seinem Stück Boden haust und es zu Wohlstand gebracht hat, sich an eine Kommission wendet, um sich von ihr Kühe schenken zu lassen? Kann er selber keine Kühe kaufen oder auch durch eine Kreditgenossenschaft beschaffen, so hat er eben ohne Kühe weiter zu wirtschaften.
In der jüdischen Stadt Tel-Awiw aber erzählte mir jemand eine gute Geschichte von einem reich gewordenen Hausbesitzer, der an Mieten monatlich sechzig Pfund einnahm, aber, wenn eine Fensterscheibe in seinem Hause eingesetzt werden mußte, ins Bureau des Barons Rothschild lief, um sich die Scheibe »vom Baron« schenken zu lassen. Er hatte vor vierzig Jahren sein kleines Anwesen, 45 mit dem er anfing, aus den Wohltätigkeitsorganisationen »des Barons« empfangen, und die Gepflogenheit des Schnorrens war ihm geblieben. –
Auf dem Landarbeiterkongreß in Haiffa, dessen ich schon Erwähnung tat, bildete der Übergang von der Subvention zur Anleihe einen der Hauptpunkte der Besprechungen. Auch von einer Arbeiterbank war die Rede, die, unabhängig von der zionistischen Kommission Darlehen vermitteln würde. Die wirtschaftliche Sicherung der Arbeit in Palästina soll also in eine neue Phase eintreten. –
Auf diesem Kongreß war viel von der Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft, der kollektiven Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber der Erde die Rede. Es fiel das Wort von den »Sklaven der Erde«! Aber es erwies sich, daß die Erde, die zu bebauen, zu erneuern man ins Land gekommen war, all diese Intelligenzen der hart arbeitenden Menschen beschwingt und befruchtet hatte. Die enge Verbundenheit des Zionpilgers mit dem geliebten Heimatboden gebar seltsam schöne Seelenblüten. Oft waren die Reden von Pathos getragen, die Gebundenheit an gegebene Möglichkeiten und die Nöte des Tags vergessen, schwärmerische Pläne mit aus der Erfahrung geschöpften Theorien verquickt; man wußte nicht recht, zum Schaden oder zum Nutzen der praktischen Durchführbarkeit beider; Weltanschauungen prallten aneinander, begegneten sich, bekämpften sich in der Region der Ideen, hoch über der nüchternen Wirklichkeit.
So war's mit den Weltanschauungen: Mallul und Nurriss – der Moschaw Awdim und der Gduth Haawodah.
Indes, beide haben schon sichtbaren Niederschlag gezeitigt, sind Wirklichkeit geworden, wenn auch nur noch Umrisse von lebenden, lebensfähigen Gebilden.
Auf unserer Fahrt durch die Ebene Jesreel hielten wir uns in einem Zeltlager auf, das den Namen Mallul führte, und verweilten in einem anderen, dieses war Nurriss. 46
Nur ein paar Worte zu Mallul. In dieser Siedlung, deren geistiger Führer Elieser Joffe ist, sind vorläufig achtzig Familien in Zelten untergebracht. Jede dieser Familien will hundert Dunam Landes zur selbständigen Bebauung haben, soll aber vorerst nur fünfzig erhalten. Die restlichen fünfzig nach dem Verlaufe von fünf Jahren, wenn es sich erwiesen haben wird, daß eine Familie imstande ist, ein Gebiet von über fünfzig Dunam ertragreich zu bewirtschaften. Bei der Ansiedlung dieser Leute soll der Fehler vermieden werden, den die Jüdische Kolonisationsgesellschaft seinerzeit begangen hat, als sie den Siedlern zu viel Boden zuwies, woraus Vergeudung der Kräfte, aber auch Verfall und Brachliegen des Landes sich ergab. Die Siedler von Mallul, zum Teil ältere Leute, sind Pächter des Nationalfondsbodens und haben jährlich vom Anzahlungspreis dieses Bodens zwei Prozent an den Nationalfonds gemeinschaftlich abzugeben.
Der Boden ist für die Bebauung günstig, die Ebene aber an dieser Stelle von Fieber heimgesucht, – Frauen und Kinder der Siedler mußten ins hochgelegene Nazareth überführt werden.
Nurriss liegt tiefer südöstlich in der Ebene Jesreel, in der Nähe der Station Affule der Haiffa-Damaskus-Bahn. Alte Namen steigen auf, – es ist die Ebene des Armageddon, der völkermordenden Schlacht; Sunem verbirgt sich in den Ausläufern des Gilboagebirges, das zu Basan gehört, dem Fürstentum Ogs. Hier entspringt aus tiefer Felsengrotte die Goliathquelle, ihr Wasser zieht sich in regellos sumpfigem Gelände durch das ganze Gebiet Nurriss.
Sechs Reihen Zelte erheben sich vor der Goliathquelle; hundertundzwanzig Menschen leben dort, aber es sollen sich ihnen bald weitere dreihundert zugesellen, – Leute der Gduth, ungefähr sechzig Familien, eine Gruppe der »Haschomer Hazair«, der »jungen Wächter Palästinas«, und die berühmte kommunistische Kwuzah deutscher und 47 tschecho-slowakischer Intellektueller aus Chefzibah bei Chederah.
Die Hundertzwanzig – nur wenige unter ihnen haben das dreißigste Jahr hinter sich – Männer und Frauen, Russen, Deutsche, Arbeiter und ehemalige Studenten, auch ein Christ ist da, ein alter Zimmermann – leben erst seit kurzem in der jungen Niederlassung. Sie kennen sich zum Teil noch gar nicht, die Gemeinschaft, die unter ihnen besteht, ist vorerst eine rein prinzipielle. Nur wenige sind verheiratet, – jene sechzig Familien, von denen ich sprach, sollen drüben, auf den Hügeln jenseits der Bahnstraße angesiedelt werden, dort ist der Boden gesünder. Zwischen der Goliathquelle und jenen fernen Hügeln erstreckt sich das Gebiet Nurriss, ein weites, unabsehbares Feld, von Bergen gesäumt.
An der Quelle waschen junge Mädchen die Wäsche der Hundertzwanzig. In modischen Schuhen und engen Röcken, die noch aus Lodz, Odessa, München herübergebracht wurden, trippeln sie über die spitzen Steine, knien an trocknen Stellen nieder und bearbeiten die Hemden und Hosen mit breiten Klöppeln. Im Bach, der aus der Grotte fließt und sich zum Sumpf verbreitet, an den Rändern des regellosen Wasserlaufs, auf der Kwisch, die von den Zelten zum Bahndamm führen soll, stehen, bis an den Gürtel nackt, junge Männer mit Spaten, die glänzende Haut bronzen gebeizt von der prallen Sonne. Vorn, in der Nähe des Sumpfes, schaufeln Frauen große Steinblöcke aus dem Boden, Fußbreit um Fußbreit, jäten zähes Unkraut, sammeln Stein und Kraut in Körbe, die sie dann fortschleppen. Ich spreche ein junges Mädchen an, das mit einem solchen schweren Korb sich zu schaffen macht. Sie ist Wienerin, Studentin der Philosophie. Weit, am Ende des Feldes, bei der Bahn, fährt ein Gasolinmotor amerikanischen Ursprungs, ein Dampfpflug, langsam über den entsteinten, schwarzen, fruchtbaren Boden. In der Siedlung, höre ich, arbeitet ein junges Mädchen, Mitglied jenes Newyorker Klubs junger Jüdinnen, der den Pflug 48 gespendet hat. Als das Geld beisammen, und der Pflug gekauft war, hatte man eine Halle in der Vorstadt Bronx gemietet, den Pflug, mit Girlanden schön geschmückt, in die Mitte der Halle gestellt und rings um ihn tanzte der Klub Foxtrott. Jetzt rattert der Gefeierte schwer und weithin hörbar über das Feld. Das Wiedersehen, sagte man mir, soll rührend gewesen sein.
Ein riesenhafter junger Kerl sitzt auf dem Bock, und hinter dem Traktor bäumt sich die Erde in mächtigen Schollen. Weit weg, so weit, daß man ihn nicht sehen kann, aber noch auf Nurrissgebiet, arbeitet ein zweiter Traktor. In wenigen Tagen wird die Arbeit beendet sein. Die Mädchen auf den steinbesäten Wiesen, die Jungen im Sumpf, arbeiten mit angespannten Muskeln.
Ein Auto kommt über die Wiesen heran. Ihm entsteigen drei junge Leute mit Gewehren. Es ist der Selbstschutz, den die verstreuten Siedler der Jesreel-Ebene gemeinschaftlich unterhalten. Das Auto fährt von Siedlung zu Siedlung. Es verbindet die entlegenen miteinander; sie fühlen sich beschützt und in guter Hut. Aber es gibt noch andre Beschützer der Siedlungen.
Ein Cowboy, wunderbarer brauner Junge, in Khakihemd, Rauhreiterhut, Lederhosen, macht seine Runde um Nurriss, auf prächtigem Pferd. Er galoppiert an uns vorbei. Grüßt. Wir lachen ihm zu: »Schalom!« Er hat ein gutes Gewehr geschultert, einen Patronengürtel um die Brust geschnallt. Sein Gaul ist von edlem Geblüt, der Junge läßt ihm die Zügel. Im Hui ist er dort oben, auf dem Hügel über der Goliathquelle, wo die Steinhäuser der ausquartierten Araber stehn. Als man das Land vom Effendi gekauft hat, erwarb man zugleich, am anderen Ende des Emek, neues Land für die arabischen Arbeiter, die Nurriss jetzt verlassen mußten. Sie werden es an ihrem neuen Wohn- und Arbeitsort viel besser haben, als an dem alten; finden dort gutes Land, das sie zu günstigen Bedingungen zu eigen erhalten sollen.
49 Vor ihren Häusern, die sie bald verlassen werden, sitzen ein paar arabische Arbeiter, im Burnus, rauchen und schauen auf das Leben hinunter, das sich am Fuße des Hügels, um die Quelle, vor den Zelten und auf dem sumpfdurchzogenen Feld abrollt. Mit silbernen Armreifen um die braunen Gelenke, blau tätowiertem Kinn, die Augen von Kholstreifen umrändert, stehen ihre Frauen bei ihnen. Das Land gehört jetzt den Juden. Sie stehen und sitzen da, bunt gekleidet, regungslos. Sie blicken hinunter auf die Schar von weiß und hellgelb gekleideten jungen Menschen, die dort, im Sonnenbrand, über die weite Ebene verstreut arbeiten; Steine zerhauen, schleppen, (der Araber pflügt um den Stein herum); den alten Sumpf zuschütten; eine Straße bauen; Unkraut jäten; in den Zelten aus- und eingehen, wo Nähmaschinen rattern, Schreibmaschinen klappern, wo gehämmert, gekocht, geplättet wird.
Bunt gekleidet und stumm blicken die Araber und ihre Frauen hinunter auf die von unbegreiflichem Leben und unbegreiflichen Menschen erfüllte Ebene.
Langsam und bedächtig reitet der junge Cowboy mit seinem Gewehr und seinen Patronen um den Raum der schweigsamen Arabergruppe herum. Gewehr, Reiter und Pferd sind im Sonnenglanz in eins gewachsen. Es ist der Schomer, der Wächter, ein Nachkomme jener Schar, die dort unten von der Goliathquelle, unter Josuas Befehl, ausging, das Land zu erobern, die Philister zu besiegen, vor Jahrtausenden. An dieser Quelle hat Josua die Probe über seine Krieger verhängt: vor dem Marsch ließ er sie aus der Quelle trinken. Wer wie ein Hund das Wasser mit der Zunge aufleckte, wurde aus der Schar gestoßen. Nur die mit vollem Mund schlürften, durften dem Heer weiter angehören.
Langsam und bedächtig reitet der junge Schomer an den Arabern vorüber, gibt dann seinem Pferd die Sporen und jagt hinunter zu den Zelten.
50 Rings um die Zelte zieht sich ein tiefer Schützengraben. Er ist tiefer und kunstvoller gebaut als jener um Degania Gimmel. Der Schützengraben um Nurriss hat Laufgräben und Verbindungsgräben. Ein Huhn kann nicht über ihn hinüberhüpfen, er ist breit und tief. An einer Stelle ist, mannstief in die Erde gegraben und mit Sandsäcken bombensicher geschützt und gedeckt, ein Lazarett. Ich springe in den Graben, öffne die Tür des Raums: vier sauber hergerichtete, gebrauchsfertige Betten, mit schneeweißen Überzügen, ein Schrank mit Verbandzeug. – –
Die Hundertzwanzig gehören der Gduth an. Sie wissen alle gut mit der Waffe umzugehen, Viele von ihnen haben im Weltkrieg gekämpft. Auch in der jüdischen Legion, an den Dardanellen, am Suezkanal, in Palästina, mit Trumpeldor, zuletzt bei der Verteidigung der jüdischen Kolonien, vor Jahren in Galiläa, in diesem Frühling in Jaffa, bei Chederah, bei Petach-Tikwah, vor Wochen noch in Jerusalem.
Auch die »Haschomer Hazair« und die Chefzibahleute, die beiden politisch radikalsten Gruppen Palästinas, sind handfeste Burschen. Man will diesen starken und enthusiastischen jungen Menschen, deren Opfermut erprobt ist, die von der Malaria am ärgsten bedrohte, von den aggressiven Araberstämmen der Hügel ringsum am leichtesten zu überrumpelnde Gefahrzone von Nurriss als Wohnort anweisen.
Sie werden Nurriss verteidigen. Sie werden nicht angreifen, aber sie sind auch keine Pazifisten, keine freiwilligen Märtyrer. Sie sind waffenkundige Schützer ihres Landes, ihrer Gemeinschaft. Sie verteidigen nicht nur ihr eignes, sie verteidigen auch das Leben ihrer Idee. Ihr Anführer ist ein tartarischer Bergjude. Seit langem Siedler und Polizist im Emek. Mit Revolver und Peitsche im Gürtel geht er zwischen den Zelten und dem Hügel der Araber auf und ab. Die Araber wissen, wer er ist. Sie blicken zu ihm hinunter, er zu ihnen hinauf. Sie kennen einander. –
Dies ist Nurriss, die Heimat der jüdischen Arbeitsarmee. 51
Vor dem Krieg gab es in Rußland, in der Nähe von Poltawa, Jekaterinoslaw, Cherson, Odessa, Homel jüdische Ackerbauerkolonien, Dörfer mit rein jüdischer, Landwirtschaft treibender Bevölkerung. Trotz unerhörter Bedrängnis und Verfolgung durch eine depravierte Regierung, durch die korrupte Beamtenschaft, hielten sich, ja gediehen diese Siedlungen. Im Krieg wurden sie zerstört.
Viele Chaluzim stammen aus solchen russischen Kolonien, sind Ackerbauer gewesen, ehe sie nach Palästina kamen. Andre waren Gärtner, Schmiede, Tischler, Mechaniker, Schneider und Mützenmacher; kleine Händler, Buchhalter, Drucker, Uhrmacher. Dann gibt es Lehrer unter ihnen, Ärzte, Schriftsteller, Musiker, sehr viele Studenten. Aus allen großen Städten Deutschlands, Österreichs, der Tschechoslowakei, aus tausend Winkeln kleiner Städte und Dörfer Osteuropas, des Balkans. Sie alle, Bauern, Arbeiter, Intellektuelle, hat derselbe Trieb zusammengeführt – zur alten Heimat, aber mehr, weniger bewußt, auch der Trieb, Abgetanes, Erledigtes, die Schmach der bankrotten Zivilisation mit einem einzigen Ruck endgültig hinter sich zu werfen. Aus Verrottung, Halbheit, Lüge wollten sie heraus und vorwärts schreiten in das Land, das aufgebaut werden sollte um den Preis maßloser Opfer. Wie das Land, das kulturell um viele Jahrtausende hinter der heutigen Welt zurückgeblieben ist, vollen Einsatz der Persönlichkeit beansprucht, so auch die Form der Gemeinschaft, der diese jungen Menschen, Bauern, Arbeiter, Intellektuelle zustreben, die die Form der heutigen Gemeinschaft weit hinter sich läßt.
Viele meinen, sie folgten dem Glauben ihrer Väter. Viele auch, – der Glaube an ferne kommende Geschlechter sei es, der sie nach Palästina führe. An Utopie glauben manche. Alle an Reinheit ihres Willens, ihres Opfers.
Aber es liegt ein Irrtum, ein tiefer Fehler der Struktur auf dem Grunde dessen, was heute in Palästina geschieht.
52 Die jungen Intellektuellen, Arbeiter, Bauern, aus den Ländern des Ostens und des Westens, sie leben heute in Palästina, in engstem Beisammensein und -arbeiten das Leben des Proletariers, das schwere Leben des Landproletariats. Indes – dieses Proletariat stellt keine Klasse vor, wie in den Ländern des Galuth, sondern eher ein gleichmäßig proletarisiertes Ghetto, inmitten und abgetrennt von der Umwelt. Sie proletarisierten sich, freiwillig und für ihr Land, Intellektuelle, Bauern und Arbeiter, aber sie blieben als Proletarier unter sich. Um ihre Gemeinschaft erhebt sich die Ghettomauer. Sind sie aus dem Galuth vor der Notwendigkeit des Kampfes der Klassen geflohen oder vor der Notwendigkeit, in der großen Klasse Gemeinschaft mit Nichtjuden zu haben? (Diese selbe Frage macht die jüdischen Arbeiterparteien des Galuth zu solch problematischen Gebilden. Diese selbe Frage wollen die »Boruchows« lösen, indem sie solidarische Proletarisierung von Juden, Beduinen und Fellachen fordern.) Haben die Chaluzim die Klasse noch nicht entdeckt? Oder wollen sie, um den Preis ihres Opfers für das Land und ihre Gemeinschaft, eine neue Form von Klasse aus sich selber heraus gestalten? Eine, die zu ihrem Triumphe des Kampfes gegen andere Klassen nicht bedürfte? Eine, die stark genug wäre, um in ihrem Triumphe die Ghettomauern, die auch die Klassen trennen, niederzureißen – zugleich mit ihrer eigenen?
Ein anderer, tief zweideutiger Irrtum oder Widerspruch ist es, den das ökonomische Prinzip des palästinischen Kommunismus aufweist. In einer vorzüglichen Studie des Genossen Nier über die »Kwuzoth« in Palästina finde ich folgende Sätze: » . . . bei den jüdischen Arbeitern in Palästina hat sich eine eigenartige, naive Vorstellung vom Sozialismus ausgebildet. Nicht die Vergesellschaftung der Produktionsmittel wird als Grundforderung des Sozialismus erachtet, . . . sondern die Beseitigung des Eigentümers. Sie betrachten den Sozialismus . . . als eine Möglichkeit, 53 persönlich ehrlich zu sein, nicht auszubeuten und nicht ausgebeutet zu werden . . . Vom sozialistischen Standpunkt ist es nicht wesentlich: wer der jetzige Eigentümer des Bodens ist, ob der Nationalfonds oder die (ältere) jüdische Kolonisationsgesellschaft, ebensowenig: auf welche Weise das Inventar beschafft wird. Die Hauptfrage ist die Art und Weise der Verteilung des Arbeitsproduktes . . . Die Kwuzoth sind in Wirklichkeit private Wirtschaften, nur daß sie nicht einer Einzelperson, sondern einer Gruppe von Eigentümern gehören . . .« und Nier fügt hinzu: »Unsere ganze weitere Arbeit muß im Sinne der Gründung von neuen Kooperativen energisch fortgesetzt werden. Alle bestehenden Kooperativen müssen in einem Organisationsapparat verbunden werden, welcher in Zukunft den Staatsapparat bilden und im geeigneten Augenblick alles im Lande in die Hand nehmen wird.«
Nun, die Gduth ist ein Schritt auf diesem Wege, und die Distanz vom bäuerlichen Kommunismus Rußlands zum zionistischen Palästinas wird eben durch das Maß des Opfers bestimmt! –
Die Aufsicht über Arbeit der Gruppe oder Siedlung obliegt der Gemeinschaft. Sie ist das Kontrollorgan über die Arbeit, wie über alle Formen der Organisation und Aufrechterhaltung der Gemeinschaft der Gruppe selber. Abende und halbe Nächte vergehen in Zelten und Baracken mit der Erörterung wichtigster Fragen der äußeren und inneren Lebensnotwendigkeiten und Bedingungen. Es ist die Stimmung und das Milieu des revolutionären Rußlands. Dort wie hier Zusammenwirken Intellektueller mit Praktikern der Arbeit, gegenseitiges Sichstützen, Sichverständigen gemeinsames Schicksal. Aus solchem Zusammenwirken schöpfen besonders befähigte und einsichtige Genossen ihre Kraft zur Leitung der gesamten Gruppe. Aber es ist dann doch nur die Stimme der Gesamtheit aller Genossen, die sich aus dem Einen erhebt.
54 In besonders radikal gerichteten Gruppen werden solchen Einzelnen nicht die Befugnisse eingeräumt – Reisen nach Jerusalem, zur Kommission, Unterhandlung mit revidierenden Mitgliedern der Kommission, Delegation zu Konferenzen, um nur die äußeren Funktionen zu nennen! – wie in politisch minder fortgeschrittenen; sondern hier ist sozusagen das Sowjetsystem schon überholt durch das freie anarchistische, das nur der Gemeinschaft als solcher, im wörtlichen Sinne, das Recht zuspricht, über Wohl und Wehe der Gemeinschaft zu wachen. Doch vollzieht sich auch in Gruppen dieser Art die Auslese des Tüchtigsten, Gläubigsten, dessen Vorschläge das stärkste praktische Resultat erzielt haben, auf wunderbar freundschaftliche Weise.
Erstaunlich ist das Maß der Intelligenz dieser jungen Leute, die Beredsamkeit, mit der sie ihre Arbeitsmethoden sowohl wie die gewissermaßen transzendentalen Theorien ihrer seelischen Gemeinschaft, aus der ihre Arbeit entspringt, zu formulieren vermögen. Ironiker meinen, die Arbeit in Palästina beweise recht deutlich, daß zuerst das nächtliche Geschwätz bei Tee und Zigaretten da gewesen sei und dann erst die Arbeit auf dem Feld, und ich selber habe einmal gesagt: jeder Ackerbauer, den ich auf dem Feld angetroffen habe, hätte, derweil er mit der rechten Hand den Pflug führte, mit der Linken seinen Marx aufgeschlagen vor der Nase gehalten. Aber es würde in Palästina dem, der die Einsetzung eines von oben, das heißt von der Kommission bestimmten Aufsehers über die Arbeit der Gruppen vorschlagen wollte, bös ergehen. Man kennt diese Einrichtung nicht nur im Orient, wo überall, wo drei Eingeborne Arbeit leisten, ein Kerl mit Stock oder Peitsche müßig daneben steht, sondern auch in den sogenannten zivilisierten Ländern, wo er Hetzvogt – Speed boss – genannt ist. In Palästina diktiert Glaube, Reflexion und die Erkenntnis der baren Notwendigkeit sämtliche Formen der Arbeit und des Zusammenlebens. 55
Zuweilen begegnet man in Palästina Menschen, die mit dem, nur dem Ahnenden, dem Wissenden, dem Liebenden sichtbaren Nimbus des Führers über Land und Menschen und die Idee wachen. Einigen dieser Erlesenen bin ich in langem, freundschaftlichem Beisammensein nähergekommen, habe die Schönheit ihres Wesens, die reinstes Opfer heißt, ergründen dürfen. Es sind nicht die anerkannten, von allen genannten, mit besonderen Befugnissen ausgestatteten obersten Funktionäre; zum Teil sind's wenig hervortretende, obskure, aus russischen Kerkern, aus Sibirien durch die Revolution befreite Individuen. Zuweilen Menschen von höchster Bildung, vollendeter Kultur. Verehrung umgibt sie. Die Klarheit ihres Wesens, unendlicher Hingabe fähig, entfaltet gegen ihren Willen entscheidende Macht über Seelen, Schicksale von Weggenossen, Schicksale des Landes. Nennen junge Menschen ihre Namen, so lebt vor dem Fremden Erinnerung auf: Gestalten des Alten Testaments und des zu unrecht »Das Neue« benannten. Der biblische Arme, der von den Menschen gekreuzigte und für die Menschheit auferstandene Wanderer nach Emmaus begegnet dem Fremden, Suchenden, Sehnsüchtigen zuweilen an einer Biegung der Straße, unter einem finsteren Tor, in Städten und Einöden des jüdischen Palästina in herrlicher Menschengestalt, unerwartet und köstlich.
Vor Jahren, bei einem Streik der Textilarbeiter von Lawrence im nordamerikanischen Staat Massachusetts, trugen junge Mädchen ein Banner im Zuge, mit der Inschrift:
»We want Bread, and Roses too!«
(Wir wollen Brot, aber auch Rosen.)
Mehr als einmal fielen mir diese rührenden Worte ein, wenn ich in Palästina jungen Frauen begegnet bin.
Die jungen Frauen, die nach Palästina kommen, verheiratete und unverheiratete, stammen zum großen Teil aus Bürgerhäusern, aus geistigen Berufen. Lehrerinnen, 56 Studentinnen, wenig Arbeiterinnen. Bei den unverheirateten wird man in vielen Fällen ohne Mühe Zwist mit der Familie, Unzufriedenheit mit Beruf und Umgebung als treibendes Motiv der Auswanderung erkennen können.
Sie übernehmen mit überschwenglicher Begeisterung härteste, schwerste Arbeit, aus dem Gefühl, daß sie der gleiche Drang nach Palästina geführt habe, wie ihre männlichen Genossen, daß sie daher an den Arbeiten teilhaben müßten, die diese leisten. Doch die Steine sind hart. Die Sonne heiß. Die Körbe schwer. Der Tag lang. Manche unter diesen jungen Frauen brechen bald zusammen, oft hoffnungslos, fürs Leben mit schwerer Unterleibskrankheit geschlagen. Auch der Gemüsebau, das Unkrautjäten, Bestellen der Felder, Früchtepflücken und Verpacken, beliebte, leichtere Arbeiten, erweisen sich auf die Dauer als zu drückend für zarte Organismen. In wenigen Siedlungen nur ist gemischte Farmarbeit, Bienenzucht, Kleinviehzucht eingeführt. Die Kommission läßt es sich nun angelegen sein, diese jungen Frauen dazu zu bestimmen, daß sie in den Straßenarbeiterzelten, in Siedlungen und Kolonien, auch in den Privathäusern der großen Städte Frauenarbeit leisten, das heißt waschen, kochen, nähen, und von den Arbeiten lassen, die Männermuskeln beanspruchen. (Mädchenfarmen gab es und gibt es in Nieder- und Obergaliläa, eine ausgezeichnete Erzieherin, Frau Schochat, hat in Jaffa eine Haushaltungsschule für junge Chalueoth eingerichtet.) Die jungen Frauen aber, an die solches Ansinnen herantritt, sind tief unglücklich. Es ist ja Dienstbotenarbeit, die man ihnen zumutet! Haben sie ihre geistigen Berufe aufgegeben, um zu kochen, zu waschen, zu nähen?! Erst in Siedlungen, in denen gutes Einvernehmen zwischen den Genossen und Genossinnen besteht, gliedert sich die Arbeit auf natürlichste und effektive Weise, die Frauen bescheiden sich und leisten Arbeiten, die ihrem Wesen und ihren Kräften entsprechen. In älteren Siedlungen aber und überhaupt solchen, in denen gemischte Farmarbeit geleistet wird oder Kinder 57 leben, führen die Frauen jede Art nötiger Arbeit freudig aus, und das bestimmt nicht selten entscheidend die Prosperität der gesamten Gruppe.
Der Mangel an Frauen ist ein schweres Hindernis der palästinensischen Kolonisationsarbeit.
Auch spielt bei dem Zusammenleben von vielen Männern und einer geringen Zahl von Frauen in Siedlungen und Kwischgruppen das sexuelle Moment seine verhängnisvolle Rolle. Indes ordnet sich diese Frage, aus der natürlichen und gesunden Lebensweise der jungen Menschen, infolge ihrer hohen ethisch-sozialen Moralbegriffe im großen ganzen leichter und vernunftmäßiger in das Problem der Gemeinschaft ein, als Außenstehende meinen sollten. Hypererotik als Kriegsfolge richtet in verderbten Städten sicherlich gefährlichere Verwüstungen an als hier in diesen Siedlungen, überall, wo harte körperliche Arbeit geleistet wird. Den Engländern, Arabern, Christen – aber auch anderen »Andersgläubigen«, davon spreche ich später! – ist es ein Greuel, daran zu denken, was wohl um Himmels willen in jenen Zeltlagern vorgehen mag, in denen wochen- und monatelang dreißig oder vierzig junge Männer und fünf oder sechs junge Frauen einträchtig beisammenleben! (Zuweilen findet man Gelegenheit, solche sittlich Entrüsteten darüber aufzuklären, wie diese selben jungen Männer und Frauen ehedem in ukrainischen Ghettokellern beisammen hausten, wochen- und monatelang, während oben auf der Straße Pogrome wüteten – um sie über Kräfte der Seele zu belehren, um ihre bangen Befürchtungen zu zerstreuen.) –
Jedoch: das Beisammenleben von jungen verheirateten oder verlobten Paaren mit alleinstehenden, sich vereinsamt fühlenden Männern trübt das Leben der Paare oft nicht minder schwer als das der Einschichtigen. Manches traurige Schicksal vollendet sich dann in der Stille, abseits vom Wege, weit von den Zelten, in Nacht, Einsamkeit, Verzweiflung. –
58 Die Eheschließungen in Siedlungen und Farmen vollziehen sich zumeist in erfrischender Einfachheit; ohne sonderliches Pathos; ohne Standesamt, Kirchenbehörde; heiter und gottgefällig.
Aus einem Brief, den mir Freunde zur Verfügung stellten:
»Es tut mir wirklich leid, daß Ihr meinen letzten Brief nicht bekommen habt, in welchem ich über die Neuigkeiten der letzten Tage berichtete. Nun wißt Ihr: ich habe am Vorabend des Neujahrstages geheiratet. Es tut mir eines sehr leid, daß ich Euch nämlich nichts davon sagte, das heißt, ich gehe Euch ja soweit nichts an, der arme Notleidende ist ja nur J., aber insoweit geht es Euch doch etwas an, denn es wurde ein großer Festabend daraus. Ich wußte selbstverständlich vorher gar nichts, aber ich will Euch alles pünktlich erzählen, wie es war. Daß J. krank war, das wißt Ihr ja. An dem Tage, an dem man ihn ins Krankenhaus brachte, wurde konstatiert, daß er Typhus hatte und so ist er vierzehn Tage im Krankenhaus gelegen. Daß daraus bei uns beiden der Gedanke zur Tat gereift ist, das ist nach Freuds Psychoanalyse eine ganz erklärliche Sache. Bei Freud habe ich es zwar nicht gelesen, aber mir und J. war es sehr erklärlich. Nun er kam Donnerstag vor Neujahr nach Hause. Am Samstag vor Neujahr kam G. und am Sonntag früh kam J. zu G. und sagte: ›Was sagst du dazu, daß ich heirate!‹ ›Nun, das ist ja ein gefundenes Fressen für unsere Chawerim (Genossen)!‹ Trotzdem wir nicht wollten, daß gefeiert wird, wurde sofort das ganze Jordantal auf den Kopf gestellt. Ein berittener Bote wurde von Kwuzah zu Kwuzah geschickt und so wurde Hochzeit gemacht. Ich habe selbstverständlich bis zum Abend gearbeitet, gerade eine symbolische Arbeit. Ich habe nämlich Windeln für den Kindergarten gewaschen, wobei mir J., der schon seine Hochzeitsuniform angetan hatte, geholfen hat. Wenn mich meine Mutter gesehen hätte, Jesus Christus, am Hochzeitstag und sie wäscht! 59 usw. Am Vormittag, als sich die Geschichte verbreitet hatte, bearbeitete ich mein Gemüse. J.'s Bruder erfuhr das und kam mit der Mistgabel. Auf dem Weg zum Mist kam er, ich schnellte auf, auf mich zugestürzt, küßte mich und schrie sein Masseltoff (Glückwunsch). Und dann machte ich meine Hochzeitseleganz und bin fix und fertig zum Heiraten. Währenddessen wurde der Speisesaal festlich aufgeputzt, wobei sich besonders J. E. hervorgetan hat. Als wir zwei in den Saal traten, wurden wir stürmisch begrüßt. Ich ging, selbstverständlich, dem Triebe der Gewohnheit folgend, an meinen alten Platz neben Sch., wurde aber mit Gelächter zurückgeführt. ›Du mußt doch neben dem Chosen (Bräutigam) sitzen!‹ Das hatte ich ganz vergessen. Dann erfüllte den Saal fröhliche Stimmung, alle Gesichter glänzten, alle lächelten mit Liebe und Ernst uns entgegen. Plötzlich spricht es hinter unserm Rücken, die Kinder bringen uns Blumen, während uns die kleine Sarah mit sehr schöner Betonung einen Glückwunsch sagt. Und wieder Stille und wieder Ernst. Dann werden stumm die Gläser gefüllt. G., unser alter guter G., steht auf und sagt uns den Segen. Nicht jenen üblichen, althergebrachten, zur Form gewordenen Segen der Rabbiner, nein, er sagt wenige, warme, von Gefühl durchzitterte Worte, aus denen seine Unbeholfenheit, großen Gefühlen Ausdruck zu geben, herausklingt. Auch J. sprach und begann seine Rede mit den Worten: . . . Damit wurde die Wunde berührt, die in X. nicht zu heilen ist (der Tod des Begründers). Dann wurde getanzt. Ch. (die Witwe des Begründers von X.) hat zum erstenmal seit dem Tod ihres Mannes an einem Feste teilgenommen und als wir mitten im Kreise herumtanzten, wurde aus dem großen ein kleiner Kreis und zwar tanzten J. und ich. Es kam Ch. zu uns, in ihrem schwarzen Kleid, und tanzte zu dem Lied: »Alles ist gut und schön«. Sie sang und tanzte, bis ihr Lied in krampfhaftes Weinen überging und auch C. J.'s Bruder, geht aus dem Kreis, 60 laut schluchzend. Das wurde mir so schwer, und ich bin aus dem Zimmer weggelaufen und habe geweint. Nun ist alles vorüber . . .«
Ich hörte von Hochzeiten, bei denen das Brautpaar sich unter einer regelrechten Chuppe (dem Baldachin) den Brautkuß gab. Der Baldachin war ein Tischtuch auf vier Gewehrläufen, aus denen nach der Zeremonie vierzig Schüsse gegen den Nachthimmel abgegeben wurden. Das Ehepaar zog in ein eigenes Zelt oder Zimmer, sonst änderte sich nichts im Leben der Kwuzah.
Die gemeinsamen Tafeln, an denen Siedler und Arbeiter speisen, sind zumeist sehr gut bestellt. Man ißt reichlich in Zelten und Baracken. In mancher Gruppe lebt man so kommunistisch, daß das Hemd nicht dem gehört, der es am Leibe trägt, und daß ein Brief wochenlang liegen bleibt, weil das Geld zu sehr verpönt ist, als daß sich ein Piaster für Porto im Besitz der Kwuzah vorfinden könnte; – aber man ißt überall gut, so gut, daß der Besucher seine helle Freude an der freundlichen Bewirtung haben dürfte, – fühlte er nicht während des Kauens schwere Bedenken in sich nagen. Wo gibt es noch Ackerbauer, wo Arbeiter, die im Sumpf stehend Zigarette um Zigarette rauchen? Kosten für Unterkunft und Küche kommen in vielen Kwuzoth fast den Löhnen der Arbeiter gleich! Geringsten Anspruch an Küche – und Keller! – stellen Deutsche und Amerikaner. Galizier, Söhne kleiner Händler und Gewerbetreibender, Ungarn schon bedeutend höhere. Zucker gibt's überall reichlich zum Tee und Kaffee. Zigaretten ebenso. Eine große Sorge der Kommission: wie könnten die täglichen Kosten für Ernährung (in manchen Siedlungen oder Straßenbaugruppen bis zu fünfzehn Piaster für die Person) auf acht oder sechs reduziert werden? Wir kamen oft zufällig zur Mittagsstunde, zuweilen zum Abendessen in irgend eine Kwuzah oder Kwisch Galiläas oder Judäas und nahmen an der gewöhnlichen Mahlzeit teil, die aus Gemüse- 61 oder Milchsuppe, Reis, Kartoffeln, Fleisch (in geringen Mengen), Kompott, Kaffee und reichlich bemessenem Brot aus gutem Mehl bestand. In Jerusalem aß ich in der Arbeiterküche für neun Piaster ein allerdings vortreffliches Mittagessen. In der Tell-Awiwer Arbeiterküche gibt es zu Mittag, auch an Wochentagen, Huhn oder Beefsteak. Fragt man die Besitzerin, ob denn solches Menü nicht zu kostspielig und vornehm sei, da ja in ihrem Eßsaal gewöhnliche Arbeiter verkehrten, noch dazu welche, deren Lohn und Arbeitsmöglichkeiten viel, wenn nicht alles zu wünschen ließen, – so erhält man in beleidigtem Tone zur Antwort: »Es sind doch balabatische Kinder!« (das heißt Kinder von Hausbesitzern, vornehmer Leute Kinder!)
Die Ausgaben für die Küche – es muß ja, außer einigen Gemüsearten, ein wenig Mehl und ein wenig Milch, so ziemlich alles eingeführt werden, verschlingen Unsummen und vergrößern die Defizite der Gruppen in bedenklichem Maße.
Auch der »Spaziergänger« zehrt an der schmalen Kasse der Gruppe und hilft, ihr Defizit zu türmen. Der »Spaziergänger« ist eine liebenswürdige, aber auch einigermaßen gefährliche Erscheinung im kommunistischen Siedlungswesen des heutigen Palästinas.
An Feiertagen, doch auch an Tagen der Woche, sind Hunderte von jungen Arbeitern unterwegs; sie besuchen Nachbarsiedlungen, auch entferntere, Kwischs und Stadtgruppen; werden überall freundlich aufgenommen, umsonst untergebracht und beköstigt. Diese weitherzige und großzügige Auslegung der kommunistischen Gemeinschaftsidee bringt es mit sich, daß in berühmten und vielbesuchten Siedlungen, Kinereth und Degania zum Beispiel, der einzelne ansässige Genosse monatlich zwei bis drei Pfund für Gäste bezahlen muß. Jeder Vorschlag, die Besucher fortan zu einer Vergütung ihrer Aufenthaltskosten zu veranlassen, scheiterte bisher an der Ablehnung der Genossen in den Siedlungen, die von ihrem kommunistischen 62 Grundsatz nicht lassen mochten. Daraus ergibt sich manche Plage für den Siedler. Der berufsmäßige Besucher zum Beispiel, der Arbeitsscheue und Schmarotzer (auch dieser aus der russischen Literatur wohlbekannt!) zieht von Gehöft zu Gehöft, sieht bei den Arbeitenden als unbekümmerter Zeltgenosse und Mitesser herrliche Tage.
Hie und da verfallen die Wirte auf amüsante Ideen, um einem allzu lästigen Gast nahezulegen, das beste wäre, er trollte sich. So taten es jüngst auf einer Kwisch Burschen mit einem umherziehenden Liedersänger. Während er, es war am Abend nach der Arbeit, dastand, sang und nicht aufhören wollte, schlichen sich die Burschen in den Stall, trieben ihre vier Maulesel in die Baracke, stellten sie in einer Reihe vor dem Barden auf und hinter diesem geduldigen Publikum verflüchtigte sich die Kwisch in die Nacht hinaus.
Die Einrichtung der »Spaziergänger« besteht also weiter, zum Ärger der Kommission, und trotz gewissenhaften Abwägens der Einkünfte und Ausgaben jeder Gruppe und Siedlung im weiten Land. Sie ist nicht willkürlich zu dämmen oder abzustellen. Sie ist ein lebendes Glied an dem Körper der kommunistisch fühlenden und wirtschaftenden Gemeinschaft.
Besuche, die einer gewissen Komik nicht entbehren, erhält die Kwuzah zuweilen von der sogenannten Judenmission. Diese aus englisch-amerikanischen und deutschen Quellen gespeiste protestantische Organisation hat es insbesondere auf die rätselhaften Straßenbauarbeiter und -arbeiterinnen abgesehen, die ihr wahrscheinlich im höchsten Grade bekehrungsbedürftig erscheinen. Ein biederer schwäbischer Geistlicher aus Haiffa fährt an Freitagabenden und Samstagen unermüdlich von Kwisch zu Kwisch. Er setzt sich freundlich und teilnehmend zu den jungen Menschen, deren Seelenheil er im Auge hat und sie hören ihm taktvoll und mit Interesse zu. Wenn er dann, nach Stunden 63 eifrigen Hineinredens in die kleine Schar, von hinnen zieht, mag es geschehen, daß er die Chaluzim fragt: ob er aus einem oder einer unter ihnen wohl einen Christen gemacht habe? Irgendein mit besonderem Witz gesegneter Chaluz stellt dann an den wohlmeinenden Pastor die Gegenfrage: ob es vielleicht den Chaluzim durch ihre Diskussion gelungen sei, aus dem Herrn Geistlichen einen Christen zu machen?
Hört! – Gesang und Tanzweisen! Nach Tages Mühen, zur nächtlichen Weile, aus Zelten, die matt leuchten, aus Baracken, deren Fenster hellen Schein werfen hinaus, weit in die schweigende Ebene, über den ruhenden See, den weithin ragenden Felsrücken – –
Draußen, am Rand des Schützengrabens, der frischen Mauer um die Peripherie der Siedlung, macht der Wächter mit seinem Gewehr die Runde. Er summt die Melodie heimlich mit, aber sein Ohr ist scharf und sein Auge bleibt wach. Seine Füße stampfen nicht den Rhythmus des Tanzes im Zelt, im Barackensaal, – in starkem Marschschritt kreisen sie um die Niederlassung, die er beschützt.
Aus der Verbundenheit der jungen Menschen in Siedlungen und Zelten des alten Landes, Verbundenheit in Arbeit, Verantwortung, Lebensgemeinschaft, Gefahr und Liebe sind beschwingte Harmonien aufgekeimt, Blumen einer neuen, sonderbaren Volksdichtung.
Schöne, ach zu seltene, zu kurze Abendstunden, die ich mit euch verlebt habe, ihr jungen Menschen, wie kurz, wie selten; – Gruß, Freunde, dort hinüber zu euch! Eure hebräischen Gesänge konnte ich nicht verstehen, aber ihr sangt sie und indem ich euch anblickte, tönte mein Herz in manchem Rhythmus mit und verstand seinen Sinn auch ohne Worte. Und jetzt noch verbindet sich mir zuweilen, in der noch jungen Erinnerung, eine Folge von Klängen mit heiliger Landschaft, dunklem gezacktem Mauertor, mit Gedenken heiliger Gemeinschaft unter der nachengleich 64 auf tiefem Sternenmeer dahinschwimmenden Sichel des östlichen Mondes.
Es sind noch nicht viele von diesen neuen Chaluz-Dichtungen aufgezeichnet. Die bekanntgewordenen werden mündlich verbreitet, eben von jenen »Spaziergängern«, die sie aus ihrem Entstehungsort an eine entfernte Abendtafel mitbringen; so finden sie ihren Weg vom Norden nach Süden, von Ebene zu Berg. – Jeder, jede hat ja aus der Galuthheimat ein Lied, einen Gesang, eine Tanzweise mitgebracht; aus Litauen, Polen, Kleinrußland, aus dem Ghetto, aus Synagogen, aus chassidischen Kreisen. Wild verzweifelte, anklägerische hörte ich: den Sang vom alten Rabbi, der den Machthabern dieser Welt, wie sie ihn bedrängen, mit Bibelworten und Anrufung Gottes und der Propheten entgegnet. Jenen schaurigen: Jesaja 5, vom unfruchtbaren Weinberg:
»Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel,
Und die Männer Judas
Seine Pflanzung, daran er Lust hatte.
Er wartete auf Recht, siehe, es ist Schinderei;
Auf Gerechtigkeit, siehe, so ist's Klage?«
Sie singen ihn nach schwerer Mühe des Tages, nach schwerer Schlacht gegen die Feinde. Sie singen die unsterblichen Worte zu einer seltsam aufreizenden chassidischen Weise.
Viele lustige Lieder gibt es auch, es sind ja zumeist lustige Lieder, die man singt, aus der Frohheit der Gemeinschaft, der Freude an dem Leben unter Brüdern. Aber es ist der jüdische Frohsinn, die schwere, geschlagene Seele bedrückt, verzerrt den Rhythmus, und durch den heitersten dieser Gesänge tönt der zum Sterben traurige Unterton der Klage gegen das übermächtige Schicksal hindurch, das das Volk seit Jahrtausenden bedrängt, – eben jene Klage Jesaja, das schaurige Warum.
Ist sie etwa nicht da, diese Klage, in dem übermütigen Lied vom Rabbi Elimelach, der, »als er ist geworden fröhlach, hat gerufen nach den Zimbelern, den zwei«? Und auch 65 »Remele, dem Melamed« hoffe ich zu begegnen in der Sammlung, die jetzt der junge Dichter Bistritzki herausgeben will. Und den Versen des alten Gordon, von denen ich einen bereits abgeschrieben habe, möchte ich Leser wünschen, im alten Land und den neuen Ländern ringsum.
Aber wer kann ihn schildern, den heißen, irren chassidischen Taumel, der sich der Gemeinschaft bemächtigt, wenn die Gesänge Herz und Hirn weit genug fortgerissen haben von Sinn und Beziehung zur Wirklichkeit. Dann sind es nur mehr Worte, Namen, an denen sich die Seele entzündet, und sie führen auf abschüssigem Wege rasch zum Tanz hin, zu kreisender Auflösung.
Nur Erinnerungsworte, Andeutung nur von tiefen, unerklärten, unverständlichen Dingen, von Liebe und Hingabe an dieses Land, an den Nächsten, die Gemeinschaft, an eine irdische, selige Erlösung. Mit geschlossenen Augen, den Kopf emporgeworfen, mit wiegendem Körper, in schmerzhafter Ekstase, stoßen sie die Worte hervor:
»Aj–ajaj Galil,
Aj–ajajaj Galil!
Aj–ajajaj Kinereth,
Aj–ajajaj Kinereth!«
Und Karmel! Hermon! Die Landschaft, und die Menschen, die dort leben und die man verließ und die dort weiter leben! Das steinige Land ruft man an, und in dem Land den rätselhaften, lockenden Gott, den unbekannten, dessen Ruf man gefolgt ist. Und singend und tanzend, in fast heidnischer Entzückung schwillt der Rhythmus der Lobpreisung durch die Nacht, wilder Psalter, Opferdienst durch Ton und Bewegung:
»Ajajajaj Galil! Ajajajaj Karmel!«
Und es mag sein, daß der Fremde, der Gast erbebt, weil sich in ihm der Schauer hoher, unaussprechlicher Gefühle erwachend regt . . .
»Ajajajaj Karmel! Ajajaj Karmell!« 66
Das hebräische Gymnasium in Tel-Awiw erhebt seine imposante Stukkaturfassade am Ausgang der Herzl-Straße, gegenüber vom Einwanderungsamt. Direktor Dr. Mossinson, ein Mann von vielerlei Verdiensten, führt mich von Hörsaal zu Hörsaal. Dann ist Pause, und wir bleiben oben in der Galerie stehen, von der man den Blick auf den Garten um das breit angelegte Haus, auf Straße und Häuser ringsum hat; auch in die Fenster des Einwanderungsamtes kann man hineinschauen von unserem Standort.

Herzl-Straße und -Gymnasium, Tel-Awiw
Unten im Garten tummeln sich die Schüler und Schülerinnen. Es sind Kinder und junge Leute aller Altersstufen, vom kurzen Höschen bis zum Stimmwechsel. Zum größten Teil sind es Kinder seßhafter Tel-Awiwer Bürger, auch der Kolonisten aus den alten ehrwürdigen Orten Rischon le Zion, Petach-Tikwah, Sichron-Jakob, südlich und nördlich von Jaffa. Sie repräsentieren so etwas wie eine heranwachsende, selbstbewußte jüdische Bourgeoisie. Sie sind sozusagen die zweite Generation, die dritte, ja die vierte, sie haben bereits ihre Ahnen; – während die dort draußen vor dem Gitter, die jungen Männer und Frauen, die sich auf der Straße vor dem Einwanderungsamt drängen, Leute von heut früh sind, eben Hereingekommene, Zeltbewohner, sozusagen Nomaden, auf alle Fälle Fremdlinge, – um nicht zu sagen: Eindringlinge.
Die Kinder lärmen froh im Garten umher. Jenseits des Gitters lärmen Chaluzim und Chaluzoth – um Arbeit. Sie belagern das Amt. Oben der tüchtige junge Gordon hat seine Not mit ihnen.
Die Kinder schauen durch das Gitter zu jenen hinüber, die auf der Straße stehen. Die auf der Straße aber haben keine Zeit, durchs Gitter zu schauen. In ihren gelben Hemden, breiten Cowboyhüten stehen sie da, und ihr Stimmengewirr steigt laut, den Lärm der Kinder übertönend. Diese wissen: es sind die Chaluzim. Es sind die Chaluzoth. Auf den Ebenen, auf den Bergen, heute hier, morgen dort, werden sie ein Leben unter der Sonne führen, reiten, Wagen 67 fahren, abends Arm in Arm über die Straßen ziehen, singen und tanzen. Sie sehen sie an, die Kinder, jene dort in ihren Khakihemden. Dort, jenseits des Gitters beginnt die Freiheit.
Direktor Mossinson klagt: »Wie soll ich Disziplin unter meinen Schülern und Schülerinnen aufrechterhalten? Ohne Disziplin ist keine Schule zu führen, ohne Disziplin kann ich keine tüchtigen Menschen erziehen. Sie glauben gar nicht, welchen Schaden diese »Romantik« dort drüben unter meinen Schülern und Schülerinnen anrichtet!«
Er sagt »Romantik« mit der »–«-Betonung. Er klagt über dieselbe Rubaschka-Romantik, das heißt die Romantik der Träger des russischen Hemdes, die jenen Engländern, Arabern, Christen und »Andersgläubigen« (von denen ich bald spreche) ein Dorn im Auge ist. Es ist eine Welt für sich, jene dort hinter dem Gitter, die Welt, in deren Bezirken ich mich nun zwei Monate getummelt habe. Es sind auch junge Menschen; viele kaum noch der Schule entwachsen. Sie haben die Vorteile mitsamt den Vorurteilen der Bourgeoisie hinter sich geworfen, in deren gehegtem Bereich diese dahier, um die Schule, sich noch befinden. Soll man den Kindern den Glauben rauben, jene dort draußen seien die romantischen Idealfiguren ihrer Jugend, ihr Leben in Freiheit, Arbeit, Gefahr, Körper an Körper mit dem Schicksal das Erstrebenswerte, höchstes Gut und Ziel? Vielleicht verstehen die Kinder wirklich nur den Teil dieses Lebens, der Ungebundenheit, unbekümmertes Drauflos bedeutet, vielleicht dringt eines Kindes Blick überhaupt nicht tiefer als bis zur Rubaschka. Aber die Zeit zieht ihre Kreise, kreist ein, reißt auch dieses Schulgitter nieder, die bürgerliche Ghettomauer um Tel-Awiw.
Gefährlicher ist es, wenn junge und ältere Arbeiter, auf Kwischs, in Siedlungen, das Leben der Genossen romanhaft idealisieren, nach außen hin bengalisch beleuchten; wenn sich, in der Arbeit und der Gemeinschaft, durch irgendwelches von außen hineingetragene oder im Innern 68 aufwuchernde Element ein fatales: »Was sind wir doch für Kerle!« breitmacht!
Ich selber weiß mich nicht von jeder Schuld frei. Ich habe, Zeile um Zeile, versucht, Übertreibung zu vermeiden; Menschen und Verhältnisse zu zeigen, wie sie sind. Hie und da wurde ich, während ich diesen Bericht schrieb, trotz selbst auferlegter Zurückhaltung, mitgerissen. Von dem, was ich in Palästina erlebte und empfand, auch in dieser Ferne, hingerissen, und bin doch alt genug.
Ich erzählte von dem jungen Rigaer Chaluz, dem ich auf der Reise von Triest nach Alexandrien auf der »Vienna« begegnet bin. Sein Gegenstück sozusagen lernte ich auf der Reise von Tel-Awiw nach Kairo kennen, am Tage, der mich fort von Palästina führte. Im Zug, der durch die Sinai-Wüste dem Suezkanal zu eilte, setzte sich ein junger Mensch zu mir. Fünfundzwanzig Jahre alt, Mechaniker aus Haiffa, mit der Übernahme einer Maschine in Kantara an der ägyptischen Grenze betraut. Ein intelligenter und gut aussehender Bursche, Sohn russisch-jüdischer Eltern, die vor dreißig Jahren ins Land gekommen waren. Er selbst in Haiffa geboren; Schüler der Technischen Gewerbeschule in seiner Vaterstadt, später eines Meisters aus der deutschen Kolonie am Fuße des Karmel, der ihm eine tüchtige Ausbildung in seinem Fach erteilt hatte. Der junge Mann liebte seinen Beruf und sein Land. Mit den Chaluzim hatte er keine Verbindung. Er wußte von ihnen, war einem und dem anderen begegnet, lebte aber in steinernem Haus bei seinen Eltern ein wohlgeordnetes, bürgerliches Dasein, hatte auch gute Einkünfte aus seinem Berufe. Wir sprachen über Palästina. Dann über Deutschland. Er war nie aus Palästina herausgekommen. Plötzlich zog er aus seiner Tasche ein paar Postkarten, auf denen Skulpturen dargestellt waren. Ich muß sagen: es waren ziemlich mittelmäßige Skulpturen, moderne französische, ein weiblicher Akt, eine allegorische Gruppe. Das war sein großer Schmerz. 69 Er fühlte das Zeug zum Bildhauer in sich. Aber es gibt keine Kunstschule in Palästina. »Ich habe nie eine richtige Skulptur gesehen!« Niemand konnte ihn in der Kunst unterweisen. Die Kunstschule Bezalel in Jerusalem verfertigt nur kunstgewerbliche Gegenstände, nach antiken Formen der Tradition und zum Gebrauch reicher Durchreisender. »Nicht einmal Modelle gibt's in Palästina!« klagte der junge Mechaniker. Ich sagte ihm: »Sie verdienen ja viel Geld, leben bei Ihren Eltern, haben keine kostspielige Laune zu befriedigen. Können Sie nicht in zwei bis drei Jahren hundert Pfund ersparen und ein Jahr lang an einer Berliner oder Münchener Kunstschule studieren?« Er erwiderte: »Hundert Pfund? Sie glauben, ich hätte das Herz, mit hundert Pfund in der Tasche nach Europa zu fahren, wo hier im Land soviele junge Menschen herumgehen und hungern?«
Ich dachte, als ich Tel-Awiw verließ, ich könne nun unter meine palästinensischen Erfahrungen einen Schlußstrich ziehen. Ich zog ihn erst in Kantara.
Nicht zum besten ist es mit dem Bildungswesen im jüdischen Palästina bestellt. Was ist wichtiger: eine Dreschmaschine oder eine Bibliothek? Eine Pumpe oder ein Lehrer?
Ich erinnere mich an Kämpfe, die auf dem Karlsbader Zionistenkongreß um ein Obergeschoß der Jerusalemer Bibliothek geführt wurden. Und ich habe in der Heiligen Stadt die Nöte des Bibliothekars, meines verehrten Freundes Doktor Bergmann, miterlebt. Aber ich will hier nur davon sprechen, daß es viel zu wenig, daß es kein Geld für das Bildungswesen in kleinen Siedlungen und auch größeren zu geben scheint.
Die Frage: wie sollen die Kinder auf diesen Siedlungen erzogen werden? wer soll sie erziehen, ja beaufsichtigen? – diese Frage erhebt sich drohend vor den Siedlern, und es ist noch keine Lösung für sie gefunden.
70 Die Siedlungen sind zum Teil noch jung, es sind noch kaum Kinder in diesen Siedlungen; aber was soll geschehen, wenn Kinder aufwachsen, Unterricht benötigen?
Es gibt ein Kinderdorf, – Kfar Gileadi, doch dies ist ein Waisenhaus, für Kinder von im Kampf gegen die Araber gefallenen Legionären, Schomrim, eingerichtet. In Orten wie Degania A gibt es Kindergärten, in denen von den arbeitenden Frauen turnusweise eine die Kleinen beaufsichtigt. Große Kwuzoth, Siedlungen wie die von Nurriss, vermögen einen Lehrer, eine Kindergärtnerin zu besolden. Im allgemeinen besteht die Absicht, in Niederlassungen, in denen fünfzehn Kinder leben, einen Lehrer zu schicken, der von der ganzen Gruppe entlohnt, einen Teil des Tages an der Feldarbeit teilnehmen, im Hauptberuf aber Lehrer bleiben soll. Wandernde Arbeiter-Lehrer gibt es, die tagsüber die Pflichten der Kwischbauern, der Siedler und Pflanzer teilen, die Erwachsenen am Abend in Wissensfächern unterweisen, die zum Bereich ihrer Tagesarbeit gehören oder ihrem Bildungsdrang Genüge tun. Denn die meisten der jungen Menschen, die auf Straßen und Ebenen, Bergen und Sümpfen so angestrengt arbeiten, sind, wenn auch »Sklaven ihrer alten Erde«, doch nicht gewillt, zu verbauern. Ihre intellektuellen Fähigkeiten, ihr Streben nach Bildung ist wach; sie wollen dem alten Land mit Pflug und Hammer, aber auch mit Wissen und Geist dienen. Die Wünsche der Seele sind durch die Anspannung der Muskelkraft nicht abhanden gekommen.
Alle Formen des Kwuzah-Bildungswesens sind gegenwärtig vage und unzureichend. Man weiß augenblicklich nicht, wie man es zuwege bringen wird, die im Sinne der Landwirtschaft unproduktive Arbeit des Lehrers in das Gesamtbudget einzufügen, so, daß das gefürchtete Defizit nicht allzu hoch anschwillt. Noch weiß man, wie es mit Siedlungen sein soll, in denen eine kleine Zahl junger Kinder steter Pflege bedarf und nur wenige Frauen sind. Andererseits aber hat das immerhin hohe geistige Niveau der Siedler 71 an manchem Ort eine gewiß altkluge Überreiztheit der Kleinen bewirkt, die an den Tafeln der Großen sitzen, ihre Unterhaltungen mitanhören, in die Sorgen und Sinnesrichtung der Kwuzah eingeweiht werden, keine gleichaltrigen Spielgenossen haben.
Ich sprach schon von den merkwürdigen, durch den Zufall zusammengewehten Bibliotheken, die man in Kwischzelten, in den Baracken der Siedler antrifft. Diese kleinen Büchersammlungen verdienten die Aufmerksamkeit der zionistischen Kommission im selben Maße, wie etwa Schulen, Gymnasium usw. Denn ihr Bestand ist bitter empfundene Notwendigkeit und wo sie mangeln, klafft eine Wunde. Den Grundstock bilden hebräische Bücher, Originale, aber auch Übersetzungen moderner Autoren. Solcher Übersetzungen gibt es indes nur sehr wenige. Es müßten fachtechnische Werke, Klassiker, gute deutsche und englische Bücher heutiger Autoren in die Kwuzoth und Kwischim. Der Versuch, zirkulierende Bibliotheken zusammenzustellen, wird unternommen, scheitert aber an den völlig unzureichenden Mitteln. Und doch wäre die Befriedigung des geistigen Hungers dieser jungen Palästinenser von derselben Wichtigkeit wie die Sorge um ihr leibliches Wohl. Überall, wo für den Kolonisationsfonds gesammelt wird, müßten für Chaluz-Bibliotheken Bücher, Zeitschriften gestiftet werden. Schon erwähnte ich den Namen Hugo Bergmanns, des Leiters der Jerusalemer Nationalbibliothek. Wenn einer, so ist dieser edle Freund und Berater der jungen Arbeiter berufen, die wichtige Organisation der Chaluz-Bibliotheken für Kwuzah und Kwisch in die Hand zu nehmen.
Palästina kennt drei Schichten jüdischer Einwanderung: den Kolel, der in talmudische Zeiten zurückreicht, die Bilu, die um die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ins Land kamen, und seit 1905, dem Jahre der ersten großen russischen Revolution, die Chaluzim. Derselbe Geist hat alle drei nach Palästina getrieben. Aber Zeit, Verhältnisse, 72 Mißverständnisse haben die drei Scharen einander entfremdet, Feindlichkeit unter ihnen bewirkt.
Für die Kolelim, das heißt Landsmannschaften, sorgte die Chaluka, der Anteil, eine Art Almosen, Subvention rein philanthropisch-religiöser Art; jene frühen Einwanderer waren ja, wie die Mönche und Nonnen christlicher Glaubensbekenntnisse, zum Beten bestellt, Ausleger der Schrift, Pilger zu den heiligen Stätten, wo sie begraben zu werden wünschten. Fromme Einzelpersonen und Organisationen in aller Herren Länder gaben diesen ihren Landsleuten – Armen, Gläubigen und Weisen, was ihres Lebens Notdurft erheischte. Bis in die letzten Jahre funktionierte der Apparat der Chaluka. Die Empfänger des Anteils konnten sorgenlos ihre Gebete verrichten, Riten innehalten. Erst die Not der Kriegszeit schnitt ihre Bezüge jäh ab (die bereits durch die für Zwecke der Arbeit und Kolonisation sammelnde zionistische Organisation schwer beeinträchtigt waren), und die Frommen und Weisen betätigen sich jetzt in allerlei kleinen Gewerben, ohne darüber ihre Gebete und Riten zu vernachlässigen. Daß sie auf die Zionisten nicht gut zu sprechen sind, versteht sich von selbst.
Die Bilus (das Wort ist eine Zusammensetzung der Initialen von: Beth Jacob Lechu Wenelcha, das heißt »Haus Jakob, laßt uns gehen!«) waren russische Studenten, – die ersten wirklichen Kolonisten des jüdischen Palästina. Es gab unter ihnen manchen in seiner Heimat bekannten Revolutionär – es war ja die Zeit, da die jungen Studenten Rußlands unter das Volk gingen, die Narodniki-Bewegung! – aber den Impuls gaben doch die Pogrome, die gesellschaftliche Entrechtung im Galuth. Einige dieser Bilu kamen mit etlichen Rubeln in der Tasche nach Palästina, wußten aber über das Land und die Bedingungen der Kolonisation so gut wie nichts. In der Kolonie Petach-Tikwah (»Tor der Hoffnung«), in Rehoboth fingen sie ihre Tätigkeit an, unter Entbehrungen, die zum Teil jene unserer heutigen Chaluzim weit hinter sich lassen. (In Rehoboth lebten 73 welche lange Zeit in Erdhöhlen, viele gingen an dem Sumpffieber zugrunde, ohne die Mittel zur Drainage zu kennen und zu benutzen.) Heute fühlen sich die Bilus, für die Stiftungen des Pariser Rothschild, deutsche Hilfsvereine, französische Allianzen, russische und andere Organisationen ausgiebig sorgten, als Aristokraten des jüdischen Palästina. Auf die jungen Sozialisten, die jungen Kommunisten, ihr Fleisch und Blut, blicken sie mit unverhohlenem Ärger, unverhohlener Geringschätzung herab. Um die Ursache dieser Verachtung zu erfahren, befragte ich einen und den anderen »Aristokraten« um seine Meinung über den Chaluz und erhielt ergiebige Antwort: Wesen und Gehaben der Chaluzim, ihre »Experimente«, das heißt die Summen, die die Kommission für Nurris Leute und ähnliche aufwendet, der mangelnde Respekt des Chaluz vor der jüdischen Tradition (und dem Bilu?) – all dies Gründe für die Ablehnung. Einer der Ehrwürdigen aber sagte mir klipp und klar: ›Ich – ich bin mit fünftausend Rubeln herübergekommen!!‹ –
Sie verstehen die neue Zeit nicht, verkennen den Zusammenhang zwischen ihrem Zionsglauben und dem Glauben ihrer heutigen Nachfolger. Sie sind die Aristokraten, diese aber sind das Proletariat!
Nun, die Chaluzim würden sich eins lachen über ähnliche Narreteien, wäre da nicht ein boshafter Nebenumstand, der mit Mißgunst nur allzu milde bezeichnet ist.
In keinem Problem des heutigen Palästina tritt die Trennung des bürgerlich-verknöcherten Einwanderers früherer Zeit und des geistig-politischen Proletariers der neuen so scharf zutage wie im Problem der Lohnarbeit, der Stellung des jüdischen eingesessenen Kolonisten zum arabischen Hilfsarbeiter und zum jüdischen der Kwuzah.
Rischon le Zion ist eine der ältesten, sicherlich die berühmteste aller Kolonien des jüdischen Palästina. Eine Stunde südlich von Jaffa; der schwere süße Wein Judäas lagert in Rothschilds Rischoner Kellereien.

Rischon le Zion
Unser Automobil fährt durch eine breite, langgedehnte, ungepflasterte Straße, die mit ihren ebenerdigen oder stockhohen, von kleinen Vorgärten umgebenen Häuschen (Synagoge, Verwaltungsgebäude, ein Hotel haben etwas schmuckeres Aussehen), mit ihrer Baumreihe zu beiden Seiten den Eindruck einer bessarabischen oder kleinrussischen Dorfstraße macht. Als wir am Ende dieser Straße die Gemarkung Rischons verlassen, tanzen plötzlich Dutzende nackter brauner Bälger vor unseren Rädern herum – genau wie am Rand eines polnischen Dorfes Zigeunerkinder! – sie kommen von den Hügeln herunter, wo in offenen schwärzlichen Zelten die arabischen Arbeiter, Fellachen, Beduinen der Kolonie leben. Nach vielen Fährnissen, Steckenbleiben im bodenlosen Schlamm der Straße, die nach dem benachbarten Ness Ziona führt, kehren wir gegen Abend wieder nach Rischon zurück und fahren nun die Dorfstraße entlang ans andere Ende der Kolonie. Hier laufen, aus einem Gewirr kleiner elender Holzhütten und Verschläge, die mit Blechstücken vernagelt und Lappen geflickt sind, aufgeregt und keifend jemenitische Juden auf uns zu. In unserem Auto sitzen Ettinger und Doktor Ruppin. Die Jemeniten klagen über die elende Behausung, in der man sie hier am Rande der Kolonie seit Jahren zu leben zwingt. Wir können auf sechs kleine, aus Ziegeln gebaute Häuser verweisen, die, gegenüber von ihren Bretterbuden, gerade jetzt eine Gruppe junger jüdischer Arbeiter und Arbeiterinnen für sie errichtet. Die Jemeniten klagen: sechs Häuser – es ist zu wenig für sie!
Die jungen Juden der Baukwuzah erbauen jene sechs Häuser, in die die Jemeniten umlogiert werden sollen, im Auftrage der zionistischen Kommission, nicht etwa der Kolonisten von Rischon le Zion. Die alten reichen Kolonisten von Rischon haben dafür kein Geld. Sie lassen ihre jemenitischen Glaubensgenossen seit Jahren am Rande ihrer Kolonie in Hütten und Verschlägen hausen, – die Kommission in Jerusalem muß eine Kwuzah bestellen, 75 damit sie in Rischon für die Jemeniten Häuser baue! Die Rischoner Kolonisten verwenden, wohlgemerkt, keine jüdischen Arbeiter, – sondern jene Zeltbeduinen und Fellachen am anderen Ende ihrer Kolonie. Die sind wohlfeil, bedürfnislos, geben sich mit minimalen Löhnen zufrieden. Aber die jungen jüdischen Arbeiter laufen mangels Beschäftigung zu Hunderten hungernd durch die Straßen des benachbarten Jaffa, Tel-Awiw. Sie können mit den arabischen Lohnarbeitern nicht konkurrieren, ihre Organisationen haben höhere Tarife aufgestellt, den tiefen Lebensstandard der Araber werden sie nie erreichen. Daher lehnt der jüdische Kolonist den jüdischen Arbeiter ab. Das ist ein Exempel.
Das andere aber ist: Chedera.
Chedera liegt nördlich von Jaffa, ist um achtzehnhundertneunzig gegründet worden. Auch die Kolonisten von Chedera stellten arabische Lohnarbeiter ein, die in Dörfern nahe der Gemarkung lebten. Die Frauen besonders und die Kinder dieser Araber, die zum Mandelpflücken verwendet wurden, begnügten sich mit minimalen Löhnen, und der Ertrag der Kolonie war ein großer, befriedigender. Während der Maiunruhen dieses Jahres aber drangen diese selben arabischen Lohnarbeiter in Chedera ein und haben die Kolonie halb verwüstet. Darauf schworen die Leute von Chedera einen feierlichen Eid, – daß sie nie wieder arabische Hilfskräfte verwenden wollten! In der Nähe Chederas, in Chefzibah, hatte sich ja auch jene berühmte deutsch-tschecho-slowakische Chaluz-Gruppe angesiedelt, von der ich bereits gesprochen habe.
Nun ist die Chefzibah-Gruppe abgewandert, um nicht zu verhungern, – denn die Chedera-Kolonisten beschäftigen wieder ihre alten Feinde, die Araber, die vor kaum fünf Monaten gegen sie gekämpft haben. Arabische Lohnarbeit ist billig, der Chaluz kann mit dem Araber nicht konkurrieren.
Es ist schwer, angesichts ähnlicher Vorfälle Ruhe zu bewahren, – wenn man versteht, welche Idee hier frivol 76 aufs Spiel gesetzt ist, welche Ansteckungsgefahr in solch zynischer Immoralität eingeschlossen ist, und auch: welche Gefahr einer plötzlichen Explosion oder Eruption!
Schon haben junge, hungrige und beschäftigungslose Chaluzim ihrer Erbitterung auf drastische Weise Luft gemacht. In der jüdischen Vorstadt Jaffas, Tel-Awiw, haben sie arabische Arbeiter von einem Neubau weggejagt, den ein jemenitischer Jude aufführen ließ. Der Bau hat dabei etlichen Schaden erlitten. Der Jemenit beklagte sich darauf in einer berüchtigten, antizionistischen Araberzeitung über die jungen Juden, die ihm diesen Streich gespielt hatten. Selbstverständlich schlug die judenfeindliche Presse Palästinas aus dem Vorfall Kapital. Es hieß: zetteln erst einmal die Juden hierzulande gegen ihre eigenen Glaubensgenossen einen Pogrom an, da werden der englischen Regierung endlich die Augen aufgehen! Wir warten auf den Augenblick!
Aber die Organisationen der jüdischen Arbeiter halten ihre Leute noch in fester Disziplin. Solidarität verhütet die Katastrophe.
(Übrigens wurde jener Jemenit mit dem großen Bann belegt und aus der Glaubensgemeinschaft ausgestoßen.)
An einzelnen Orten Palästinas haben jüngere Siedlergruppen das Problem der gering bezahlten Lohnarbeit auf schöne, der kommunistischen Gesinnung gemäße Weise zu lösen versucht. Um eine allzu schwere Belastung der Gruppe und damit das Defizit zu vermeiden, zogen die Siedler von ihrem eigenen Lohn einen Bruchteil ab und wiesen ihn ihren, für Mandelpflücken und ähnliche niedere Leistungen gering entlohnten jüdischen Hilfsarbeitern zu.
Ein Wort zum Thema: jemenitische Juden.
Diesen von der südöstlichen Küste des Roten Meeres eingewanderten Halbarabern, das heißt auf dem kulturellen Tiefstand der Araber verbliebenen Juden, sind in Palästina an vielen Orten eigene Siedlungsbezirke zugewiesen worden. 77 Die Jemeniten bestellen ihre Felder und bebauen ihr Land auf ordentliche Weise, aber eine richtige Verbindung zwischen den aus Europa eingewanderten Glaubensgenossen und den Jemeniten besteht nicht. Ihre Lebensweise, die Art, wie sie wohnen, ihre Sprache, ihr Aussehen (es sind olivbraune Leute von kleinem Wuchs, spärlichem Bart, langem, bläulichschwarzem dünnen Haupthaar, wie degenerierte Sepharden anzusehen) scheint ihnen einen Platz abseits von der europäischen Einwanderung zugewiesen zu haben. Es wäre zuviel gesagt, wollte man behaupten, Chaluz und Bilu behandle den Jemeniten, wie die Puritaner die nordamerikanischen Indianer behandelt haben und heute die Weißen den Neger behandeln. Es bleibt aber trotz der Glaubensgemeinschaft, die den Jemeniten dem Juden näher bringt als etwa den (ebenfalls stammverwandten) Araber, eine tiefe Kluft, eine kulturelle und Rassenfremdheit bestehen.
Einem anderen, nicht minder fremdartigen, sonderbaren Element der jüdischen Einwanderung bin ich im galiläischen Sedschera begegnet: den Gerim. Wörtlich übersetzt besagt das Wort Ger = Schützling. Die Gerim sind russische Sabbatarier, die Juden geworden sind, weil sie in jüdischer Umgebung den Sabbat halten können. Fragt man einen Ger, der noch ganz den Habitus eines Muschik hat: Warum bist du Jude geworden? dann gibt er zur Antwort: Weil ich, wie Ihr, den Sabbat halte; weil es bequem ist, den Schächter zum Nachbarn zu haben, der mir das Huhn schlachtet. Der Ger legt auch Gebetriemen, befolgt die Riten seiner Nachbarn, spricht mit diesen hebräisch (auch mit seiner Frau und seinen Kindern); bricht aber ein Streit zwischen dem Ger und einem Juden aus, so wird der Ger den Juden doch mit dem russischen Schimpfwort: Zsid (Jude!) zu beleidigen suchen. – –
Mit den Templern, den deutschen Kolonisten, hält der jüdische Kolonist gute Nachbarschaft. Der High-Commissioner, Palästinas höchster Beamter, der englische Jude 78 Herbert Samuel hat die deutschen Templer, die der Krieg aus ihren Kolonien in Jerusalem, Haiffa und in der Ebene Saron bei Jaffa vertrieben hatte, wieder ins Heilige Land zurückgeführt. Es war eine der ersten Taten Sir Samuels. Die englische Regierung unterstützt sogar die deutschen Siedler in ihren Arbeiten, obzwar sie viele ihrer besten Häuser zu Zwecken der Administration mit Beschlag belegt hat, auf andere aber hohe Abgaben eintreibt.
Die Templersiedlung in Haiffa am Fuße des Karmel, die kleinen Niederlassungen Sarona und Wilhelma bei Jaffa, mit ihren sauberen und gut gebauten Häusern, hübschen gepflegten Blumengärten, in bestem Zustand gehaltenen Wegen und netten Menschen sind Freude und Erquickung.
Man wird traurig, fährt man, etwa auf dem Heimweg von Petach-Tikwah, das einem verwahrlosten polnischen Ghettodorf nur zu ähnlich sieht, durch die schwäbische Kolonie Sarona mit ihren violetten Rabatten; denkt man, durch den bodenlosen Schmutz der Straße bei Rischon le Zion oder der Straße Mea Schearim in Jerusalem watend, an jene Häuserreihen am Karmel. Man fragt sich: lohnte sich der ungeheure Energieaufwand jener alten jüdischen Kolonisten und ihrer europäischen Gönner, wenn das Resultat nichts weiter ist als ein Bankkonto, arabische Lohnarbeit, diese beschämenden bessarabischen Dorfstraßen?! Verrät sich die Gesinnung jener ehrwürdigen »Aristokraten« nicht in dem Zustand ihrer Häuser und Wohnorte? In der Kultur, den äußeren Merkmalen ihres täglichen Daseins? – Wie wird Nurriss in vierzig Jahren aussehen? . . .
Stil, Schönheitssinn ist allein beim Eingeborenen zu finden. Wahrhaftig, – jeder Araber ist ein Schmaus fürs Auge. Wie der letzte Bettler seine Lumpen trägt, das verrät aus dem Boden gewachsene, ununterbrochene, ungebrochene Tradition. Burnus, Kopftuch, Pantoffel der Männer, Kleidung der Frau (des Fellachen) und ihre Ringe, Spangen, Ketten, ja der Zuschnitt und die Farbe 79 der Säcke, die der Araber seinem Kamel auflädt, zeugen von einer versunkenen, nur mehr dem Auge wahrnehmbaren Periode uralter, intensiver Kultur. Jeder Buchstabe im Koran ist ein Ornament. Das bescheidenste Andachtshaus ein Kunstwerk, das die Dürftigkeit oder die primitive Überladenheit, den Ungeschmack und die Trivialität der christlichen und jüdischen Bethäuser erst recht hervortreten läßt. Die ehrwürdigsten dieser christlichen Kirchen, in Jerusalem, Bethlehem, Haiffa sind mit ihren tausend Lampen, Exvotos, schlechten Bildern Labyrinthe aller Stilarten. Die Synagogen allein, die einen Einschlag von Orient aufweisen – wie die der Damaszener, Aleppoer und Bucharen – erträglich.
Die Kultur des Arabers hat mehr als die abendländischer Völker ihren Ursprung im Religiösen. Heute noch bestimmt dieses Religiöse die Atmosphäre, in der sich der Araber bewegt. Lernt man ihn in seinen Vorstellungen von Recht und Pflicht kennen, seine Einschätzung der Frau, des Kindes, des Herrn und Knechtes, des Fremden und seinesgleichen, so ist er ein primitives Ungeheuer, vom westlichen Menschen durch jahrtausendeweite Kluft getrennt. Gefährlicher Barbar, gegen den es nur zweierlei Schutz gibt: – Gold und Waffe. Aber sieh denselben Menschen an, wenn er seinem Gott naht. An den heiligen Stätten seines Glaubens, bei Sonnenaufgang, Untergang, mitten im Gewühl profaner Menge verklärt sich seine Erscheinung, steigert sich sein Wesen plötzlich auf mystische Weise. Er scheint in Höhen zu wachsen, wohin ihm niemand mehr folgen kann, der nicht, wie er selbst, den zwingenden Atem des rätselhaften Orients im Blute empfangen hat.
Indes, man ginge sicherlich fehl, wollte man das Problem des heutigen Arabers, der arabischen Masse, mit der man es in Palästina zu tun hat, aus der Religion zu erklären und zu lösen suchen. Ebenso irrt der, der eine Verbindung des heutigen Arabers mit dem eingewanderten Juden auf rein kultureller Basis erstrebt. Auf dem Zionistischen Kongreß 80 in Karlsbad verstieg sich ein verdienstvoller Berliner Professor zur Behauptung: an der Universität in Jerusalem müsse ein Lehrstuhl für arabische Literatur eingerichtet werden, – das werde die Rassen mit einem Schlage einander näherbringen und versöhnen. Und der Theoretiker Kalvariski möchte, nach dem Muster jener ägyptischen, christlich-moslemischen Klubs, Vereine schaffen, in denen sich Juden und Araber begegnen und eine Verständigung zwischen den Brüdern des gleichen alten Stammes angebahnt werden sollte. Er vergißt, daß hinter den Juden nicht gleich starke treibende Kräfte stehen, wie hinter den Christen in jenen ägyptischen Klubs, die einer ausgesprochen englandfeindlichen, von Frankreich und dem Vatikan inspirierten Orientpolitik als Werkzeug dienen.
Wer nicht in Palästina war, nicht die Fellachen und Beduinen am Rande der jüdischen Kolonien gesehen hat, sollte über die Araberfrage und den palästinensischen Araber nicht mitsprechen. Ja sogar für den, dessen Fuß niemals das Gebiet des rätselhaften Transjordanien betrat, der nicht weiß, welche Moralbegriffe, welche Anschauungen in bezug auf Eigentum und Ehre unter den unerforschten Völkern jener Nachbarterritorien herrschen, ist höchste Vorsicht geboten. Man kann ebensowenig eine geographische und kulturelle Linie zwischen die unbekannten und ungezählten Massen des Transjordan und die siebenhunderttausend palästinensischen Araber ziehen, wie man sich an einen Kodex, feste Dogmen halten kann, die es auf Grund praktischer Erfahrung ermöglichten, den jüdischen Einwanderer vor der zehnfachen Übermacht zu sichern.
Ich hatte Gelegenheit, mit dem jungen Gouverneur von Bersheba über die sonderbaren Bräuche, die Vorstellungen von Recht, Leben, Eigentum zu sprechen, die ihm auf seinem exponierten Posten, wo die Straßen von Trans und Zis sich berühren, oft unterkommen mögen. (Er muß sogar – als britischer Beamter! – Streitigkeiten schlichten, für die nur Überlieferung unter den Völkern des Transjordan 81 rechtliche Handhabe bietet!) Beispiele: Blutrache verquickt sich mit Eigentumsentschädigung. Kehrt eine entführte Frau mit einem Kinde heim, so hat der entführende Stamm an ihre Sippe eine größere Zahl von Ziegen, Schafen, Kamelen zu entrichten, als wäre sie ohne Kind heimgekehrt. Wird ein Bruder getötet, so schwankt die Zahl von Kamelen und Ziegen gegenüber der Entschädigung, die für einen Schwiegersohn oder Großvater zu zahlen ist. Mord findet seine Sühne ebensogut in der Art des rächenden Mordes wie in materiellem Gegenwert. Die Zahl der Weiber, die ein Land-Effendi in seinen Harem sperrt, wird nicht durch sein erotisches Grundbedürfnis bestimmt, sondern von dem Umfang der Arbeit, die es in seinem Haus und Feld zu leisten gibt. Findet er, aus irgendeiner Verwandtschaft mit Auffassungen von Ehe, Familie, Gesittung westlicher Völker, Genüge an einer einzigen Gattin, die er liebt, so kann es doch vorkommen, daß die Frau ohne ärztlichen Beistand und Medizin einfach stirbt, weil der Effendi für Arzt und Arzenei fünf Pfund mehr ausgeben müßte, als eine frische Frau kostet, die er ihrer Sippe abkauft.
Der Besitzbegriff des Arabers, des Moslem, gegenüber der Frau verbindet sich mit religiösen Vorstellungen und Gesetzen, die seinen geschlechtlichen Egoismus rechtfertigen und verklären. Man kann sich wohl vorstellen, welcher Abgrund den Araber, der seine Frau nur im weiten schwarzen Kleid, einen dichten schwarzen Lappen vor dem Gesicht, über die Straße gehen läßt, vom Chaluz scheidet, der mit der Chaluza nach Sonnenuntergang singend über dieselbe Straße zieht.
Der niedere Araber, so sagte man mir oft, verfolgt den jüdischen Arbeiter, den er arbeiten sieht, mit geringerem Haß als den jüdischen Städter, dessen Arbeit ihm nicht begreiflich ist, und den Kolonisten, für den er harte und schlechtbezahlte Fron leistet. Ich kann an solche Wertungen nicht glauben (wie ich überhaupt nicht an den primären und primitiven Haß des Arabers gegen den Juden 82 glaube). Der freundliche Blick auf den arbeitenden Fremdling und die Verbundenheit auf Grund der gemeinschaftlichen Arbeit setzt ein viel höheres ethisches Niveau voraus, als es der Araber heute besitzt. Im Gegenteil, – sieht der Fellach den unbegriffenen Chaluz auf eine Stufe der materiellen Anspruchslosigkeit heruntersteigen, die der seinen ähnelt, so wird er wohl stutzig werden, und der Respekt, den er vor fremder Herrenrasse immer noch empfindet, wird ihm rasch abhandenkommen.
Hier habe ich vom tiefstehenden Araber gesprochen, von den in kultureller wie in wirtschaftlicher Beziehung niedrigsten Schichten des palästinensischen Arabers. Anders verhält es sich mit den Oberen, den Effendis. Jene Fellachen, Beduinen, sind Taglöhner, kleine Pächter, schwer ausgebeutete Landsklaven der Großgrundbesitzer, eines Dutzends von Familien, die das Land zum großen Teil in Händen halten und denen es der Nationalfonds abkaufen muß; – aber im Grunde sind diese, die Oberen, die Effendis, auch nichts weiter als willenlose Werkzeuge französisch-vatikanischer Interessengemeinschaft.
Die Effendis sind enttäuscht. Sie erwarteten mit den Eindringlingen unerhörten Geldsegen im Lande. Jude bedeutet auch im Orient: Geld. Die Juden kamen wohl mit gewaltigem, die Welt durchdröhnendem Geschrei nach Palästina, brachten jedoch weniger Geld mit, als man erhofft hatte. Mancher Effendi hatte sich bereits in schwere Schulden verstrickt, hoffend, daß er sein Land zu hohem Preise loswerden könne, – nun ist er enttäuscht und rächt sich. Der andere Grund für Unzufriedenheit aber ist: Fellachenarbeit ist durch die Konkurrenz des jüdischen Arbeitgebers teurer geworden, der Fellach nicht mehr so ganz das vegetierende Halbtier, seit die neuen Juden im Lande sind.
In Jerusalem kommt es nicht selten vor, daß arme jüdische Lehrer, kleine Beamte, die monatelang mit Wechseln bezahlt werden, den Kredit arabischer Händler im Bazar beanspruchen müssen. Daß der Jude ihm nicht davonläuft, 83 weiß der Araber wohl; er verachtet die Juden darum nicht minder. Nun genießen aber diese selben Juden, diese kleine und, wie man sieht, wirtschaftlich gar nicht so sonderlich gestützte Minderheit im Lande doch den besonderen Schutz der Regierung. Sie verfügen über einen Nationalrat, eine Exekutive, die ihre Interessen gegenüber der Regierung wahrnimmt, – während der an Zahl zehnfach überlegene Araber keine solche Behörde besitzt. Man hat einmal die Frage an mich gestellt: ob die »nationale Befreiungsbewegung« der Araber einem wirklichen inneren Bedürfnis des arabischen Volkes entspreche oder ob sie nur als Mache der Effendis anzusehen sei, die die Einwanderung der Juden aus eigennützigen Motiven verhindern wollen? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Sie beruht auf komplizierten Voraussetzungen. Die großen Mächte hinter dem Araber meinen den Juden ebensowenig wie den Araber selbst, wenn sie mit beiden ihr Spiel treiben. Spricht man in Jerusalem über den letzten Pogrom, so mag es einen oder den anderen aufgeklärten Araber geben, der augenzwinkernd nach der Riesenkaserne des französischen Klosters vom Sacré Cœur schielt, in dem französische Generale der syrischen Besatzungsarmee mit vatikanischen Missionaren aus und ein gehen. Zuweilen aber schielt er um fünf Häuser weiter, bis ans Damaskustor, wo im englischen Gouvernementshaus der judenfeindliche Storrs sitzt, ein Herr mit pilatischen Allüren, – von dem noch zu sprechen sein wird.
Der angebliche Rassenhaß des Arabers gegen den stammverwandten Juden ist ein Resultat des Weltkriegs. Vor neunzehnhundertvierzehn gab's keine Pogrome, war die Rassenfrage nicht akut und gefährlich. Für den moslemischen Araber ist ja Palästina, trotz Abrahams, Rahels, des Haram und Josaphats, trotz vielen gemeinsamen religiösen Besitzes, Tradition und Erwartung, bei weitem nicht, was es für den Juden ist. »Des Arabers Zion heißt Bagdad, – 84 sein Moses ist Harun al Raschid«; – ich hörte diesen Satz in einem Vortrag Sokoloffs, und er leuchtete mir ein. Auch ist ja das Zentrum moslemischer Kultur nicht in Jerusalem gelegen, sondern in der altehrwürdigen Moschee und Universität Al-Azhar in Kairo. Ganz andere als nationalistisch-religiöse Motive setzen den Moslem gegen den Juden in Bewegung.
Das trübe Spiel der Mächte um die Herrschaft im Orient erfährt eine Komplikation dadurch, daß sich unter den jungen Arabern offenkundig eine ausgesprochen england-freundliche Strömung bemerkbar macht. Während der alte Araber, von der Türkenherrschaft her unzivilisierbar, der Kultur Europas feindlich, unverständiger Asiat, ein Spielball jener christlich-französischen Interessen bleibt, steht die junge Generation der Araber unter dem starken Einfluß der englischen Schulen und Lyzeen, die die französischen Missionsinstitute und die deutschen verdrängt haben und in denen den jungen Leuten mit der englischen Sprache, mit englischem Sport und High-Church-Gesinnung, Vorliebe für englische Sitten, eine rechte Dosis Anglomanie eingeflößt wird. Mit kluger Geschicklichkeit hat der englische Imperialismus es in kurzen vier Jahren verstanden, im Araber die Tendenzen zu wecken, die er für seine Weltherrschaft an diesem exponierten Punkt am besten brauchen kann.
Manche Leute wollen bemerkt haben, daß in den anglisierten jungen Arabern durch die Arbeit der Engländer bereits Sympathien für die zionistische Einwanderung aufgekeimt sind. Auf alle Fälle ziehen durch das palästinensische Arabertum widerspruchsvolle und einander kreuzende Strömungen, die dem Lande und den Menschen eines Tages gefährlich werden könnten.
Der Schützengraben um die jüdische Siedlung in der Ebene und in den Bergen ist und bleibt bittere Notwendigkeit. 85
»Und es geschah hinfürder, daß der Jünglinge die Hälfte taten die Arbeit, die andere Hälfte hielten Spieße, Schilde, Bogen und Panzer. Und die Obersten stunden hinter dem ganzen Hause Juda,
die da bauten an der Mauer und die da Last trugen von denen, die ihnen aufluden, mit einer Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe.«
Nehemia 4, 10. 11.
Seit Nehemia hat sich an dem Schicksal des Juden im alten Vaterland wenig geändert.
Im November-Pogrom, wenige Tage vor meiner Ankunft in Palästina, hallten Kampfrufe durch die Straßen der Heiligen Stadt, wie dieser:
»Das Land ist unser Land. Die Juden sind unsere Hunde!«
und:
»Geist Mahomets, erhebe dein Schwert!«
Wäre die junge Judenschaft an diesem zweiten November nicht gut ausgerüstet zur Stelle gewesen, im alten Judenviertel bei der Klagemauer wäre keiner und keine mit dem Leben davongekommen. (Man soll mit solchen Aussprüchen vorsichtig verfahren, aber ich weiß, was ich sage. –) Der Chaluz hat neben der Kelle das Schwert führen gelernt, darum ist die Judenschaft Palästinas nicht verloren. Er hat die Waffe in starker und reiner Hand, denn es geht auf jenen Ebenen, in jenen Bergen, um den Bau des Dritten Tempels, des Tempels im Geiste.
Schützengräben und Laufgräben, Unterstände und die Lazarettverschläge von Nurriss sind nicht von heute. Die Bauart des arabischen Hauses mit seiner hohen steinernen Umfriedung, die Lage der Städte auf strategisch gesicherten, schwer zugänglichen Punkten weist auf eine stete Gefahr hin, die dem Menschen vom Menschen droht, auf die Notwendigkeit, sich zu verteidigen, das ganze äußere Leben auf diese Notwendigkeit einzustellen. Jerusalem selbst, aus Felsen in die Höhe steigend, von tiefen Wasserbetten umgeben, gleicht heute noch einer Festung, die schwer zu 86 erstürmen ist. Jeder Jude in Palästina lebt sein Leben im »Qui vive!« dahin. Es ist ein schweres Leben, und man muß seine Nerven bewahren, um es zu ertragen. –
Eine Gelegenheit belehrte mich, auf welche Weise die Gefahr an den Nerven der Unseren zehrt und zerrt. In Haiffa, wo ja der Sitz des gefährlichsten, antijüdischen, arabisch-nationalistischen Aktionskomitees ist, am ersten Abend der Kongreßtagung der Landarbeiter erhob sich plötzlich in der engen Gasse Geschrei. Oben verstummten wir. Ein Pogrom? Überfall? Man verhielt sich ruhig. Es dauerte eine ganze Weile. Aber es war bloß das benachbarte Kino, dessen Vorstellung geendet hatte und dessen Publikum ins Freie strömte.
Tags darauf geschah folgendes. Es war eben Abend geworden. Die Debatten waren erregt und laut geführt. Da stieg wilder Lärm, Feuerschein, Eisenschlag von der Straße herauf. Fackeln nahten dort unten unserm Haus, in dem der Arbeiterklub, die Arbeiterküche sich befanden. Besessene Tänzer schwangen Schwerter, erhoben Schilde über ihre Turbane, hielten sich an den Händen und taumelten wüst die enge Straße entlang. Vor dem Haus setzten sich zwei auf mitgebrachte Stühle nieder, und der wilde Fackelreigen tobte minutenlang um sie herum. Als ginge es um Blut, sausten Damaszenerklingen auf kleine runde Stahlwehren nieder, die Fechter sprangen aufeinander zu, johlten unbändige Lust, Wut, Freude am Geräusch des Eisens auf dem Eisen. – Wieder erlitten unsere Verhandlungen eine Unterbrechung. Weg vom Fenster! Es ist Haiffa. Wir sind Juden. Man weiß, wir sind hier oben beisammen. Die Gasse ist eng. Die Treppe schmal. Über die Dächer geht's ins Leere. Umzingelt man das Haus, wirft eine Fackel herein, entkommt keiner.
Ich blickte in blasse Gesichter. Aber sie waren ruhig. Der Widerschein der Fackeln allein flackerte auf ihnen. Einige Minuten vergingen, dann verzog sich der 87 Fackeltanz und das Schwerterschlagen nach dem großen Platz zu.
Es war nur ein kleines Spiel gewesen, eine Art Freudentanz: Freunde bereiteten jungen Neuvermählten ein Ständchen. Ich folgte den Fackeln einige Straßen weit. Lustbezeigung, Freudenausbruch, bestialische Wildheit. Wie, – wenn diese da einmal Ernst machen, Zorn schwillt, der Name des Propheten fällt?
(Aber auch aus solcher verhältnismäßig harmloser Fantasia kann sich höchst Reales entwickeln. Wie damals, beim Empfang in Bethschean, im alten Basan, Ogs Hauptstadt, dem obersten Beamten des Landes Sir Herbert Samuel jener Speer über den Kopf wegflog, jene Schüsse ins Auto nachgesandt wurden. Es handelte sich ebenfalls nur um eine Fantasia, ein Schaugepränge der Eingeborenen zu Ehren des High Commissioners. Als vor der ersten Nummer des Programms ein schwarzes Kamel mit einer verschleierten Frau langsam vor Sir Samuel vorübergeführt wurde, wußten die Kundigen im Gefolge Bescheid.)
Zwei große hebräische Tageszeitungen erscheinen in Palästina: »Doar Hayom« (»Daily Mail«) und »Haarez« (»Das Land«). »Doar Hayom«, konservativ kapitalistisch, wie sein Taufpate und Vorbild gelb gefärbt (gelb nicht gerade als Farbe des Juden gedacht!), ein Organ der reaktionären Bnej Binjamins, das heißt der Söhne der alten Kolonisten, jener jüdischen Pseudo-Aristokratie, der Alt-Eingesessenen; im ganzen ultra-englisch orientiert. »Haarez«, liberal, dem Chaluz gegenüber freundlich und entgegenkommend, ohne seine bürgerlichen Prinzipien zu verleugnen.
Die radikale Arbeiterschaft besitzt eine vorzügliche, auf bestem literarischen Niveau stehende Wochenschrift: den »Hapoel Hazair«. –
Man darf den erwähnten jüdischen Tagesblättern füglich vorwerfen, daß sie die Araberfrage mit äußerster, wenig angebrachter Behutsamkeit anfassen. Daß man aus ihnen 88 kaum die ganze Schwere der Lage in Palästina erkennen wird. Daß in ihnen selten ein Ton jener Verzweiflung anklingt, die in den weitesten Kreisen der jüdischen Bevölkerung stets latent ist, jäh hervorschießt, sobald die Araberfrage berührt wird. Ja sogar Pogrome werden durch diese Presse nicht nachdrücklich genug als das charakterisiert, was sie in Wirklichkeit vorstellen.
Liegt dabei Absicht der Vertuschung vor oder bloß die Tendenz, Palästina und die Weltjudenschaft nicht zu irritieren? Geschieht es aus politischen Motiven, so darf man füglich von Schwäche und Zaghaftigkeit sprechen, – die arabische Presse ihrerseits kann sich in der Verhetzung der Massen und Fälschung der evidenten Tatbestände kaum genug tun.
Das Merkwürdige bleibt, daß diese arabischen Hetzblätter von christlichen Arabern redigiert sind. Ihre Verbundenheit mit jener Hochburg Sacré Cœur ist unverkennbar. (Ein einziges arabisches Blatt, von mohammedanischen Arabern redigiert, befleißigt sich eines freundlichen Tones gegenüber den Juden. Aber es ist klein und ohne Einfluß.)
Von der jüdischen Tagespresse erwächst also der judenfeindlichen arabischen kein Gegengewicht durch entschlossene Betonung des eigenen Standpunktes. Judenfreundliche Engländer (aus Kreisen der Regierung) fragten mich: »Warum versagen die Juden gerade in solchen Fällen, wenn sie, ungerecht angegriffen, dem Pöbel ausgeliefert werden sollen? Wo sie doch in der Welt gar nicht laut genug ausposaunen können, daß sie nun ihre nationale Heimat, ihr jüdisches Palästina errungen haben!« Großmannssucht außen, Schwäche innen, – dem Araber eine einzige Angriffsfläche, sehr willkommen seinen Hintermännern, die die Situation gar nicht zu verschärfen brauchen.
Auch in anderen politischen Mißgriffen zeigt sich Ängstlichkeit der Zionisten gegenüber Mächten und Tendenzen 89 im nichtjüdischen Palästina. So hörte ich Klage führen über die allzu bescheidene, von gewisser Seite gänzlich unterdrückte Geldforderung an England für die jüdischen Schulen in Palästina, – wo doch die arabischen von der englischen Regierung mit namhafter Subvention unterhalten werden.
Elieser Ben Jehuda heißt der ehrwürdige und streitbare Gelehrte, in dem die Juden Palästinas den Vater des neuen Hebräisch, das sich in Schulen, Siedlungen, in der täglichen Umgangssprache durchgesetzt hat, erkennen. Vor zwanzig, vor zehn Jahren schwirrten in Palästina noch Dutzende Jargons durcheinander; jeder hatte aus dem Galuth seinen eigenen mitgebracht. In den Schulen galten Jiddisch, sephardischer Dialekt, Französisch und Deutsch als Unterrichtssprache. Heute hört man in Häusern, Straßen, auf den Ebenen, und in den Bergen fast ausschließlich das Hebräisch, das vor vierzig Jahren nur in Ben Jehudas Hause von Kindern und Erwachsenen gesprochen wurde. Wie im amerikanischen Schmelztiegel der Nationen die englische Sprache Einheit bewirkt, so arbeitet heute der jüdische Nationalismus mit dem Mittel der hebräischen Sprache rücksichtslos an seiner Kräftigung. Ben Jehuda schreibt seit Jahren an einer hebräischen Enzyklopädie. Viele Gelehrte – kleine Sonderlinge und Schwärmer unter ihnen, deren Palästina eine Fülle besitzt! – bauen die Sprache ins Moderne aus, assimilieren die alten Idiome der veränderten Lebensform des Tages. Ben Jehuda sagte mir, seine Aufgabe sei gegenwärtig, das alte Hebräisch der Bibel zum alltäglichen Gebrauch herzurichten, zu korrumpieren. Ich fragte ihn, ob es seinem Wunsch entspräche, verwandelte sich die heilige Sprache in einen palästinensischen, arabisch-levantinischen Jargon, was bei der geringen Festigung der Sprache und dem unaufhörlichen Zustrom östlicher Einwanderung unausbleiblich sei. Aber darauf bekam ich nur zu hören, daß Hebräisch eine nationale Notwendigkeit sei.
90 Im übrigen haben die »Hapoel Hazair«, also eine der radikalen Arbeiterparteien, das Hebräisch als Umgangssprache unter ihren palästinensischen Genossen eingeführt, und heute wird in den, dem Nationalismus am extremsten widerstrebenden Kwuzoth und Kwischim hebräisch gesprochen. Somit darf der Europäer nichts dagegen haben, daß Fanatiker die Bibel nach gedanklichen Equivalenten für Automobil, Benzin, Flugzeug, Fünfuhrtee und Flirt durchstöbern.
Er darf sich auch darüber nicht aufhalten, daß Kinder, die in ihren Schulen hebräischen Unterricht genießen, zuhause mitleidig und mit unverhohlener Geringschätzung auf ihre Eltern herunterschauen, wenn sie diese bei Fehlern im Hebräischen ertappen. –
Es ist ein wahrer Rausch von Hebraismus über die Judenschaft Palästinas gekommen; wilde Unduldsamkeit; ausgesprochen chauvinistischer Mißbrauch der Sprache zu Zwecken, die mit dem Geist des Judentums gar nichts mehr gemein haben. Mir selbst wurde eine bittere Kostprobe verabreicht, von der mir einige Zeit lang übel in der Herzgrube war.
Ich hielt in der Aula einer Schule in Jerusalem einen Vortrag über Rußland, der von Arbeitern und bürgerlichen Intellektuellen besucht war. Da ich des Hebräischen nicht mächtig bin, sprach ich deutsch. Der Führer der palästinischen Arbeiterschaft, Ben Zwi, hatte den Vorsitz, mein Freund, der gelehrte Hugo Bergmann, übersetzte. Es waren in der großen Zuhörerschaft nur wenige, die nicht deutsch verstanden, – ich merkte das an der spontanen Zustimmung, die manche Pointe meiner Ausführungen unterstrich. Weder der Vortrag noch die Diskussion (die Redner sprachen hebräisch, ihre Reden wurden mir übersetzt) löste auch nur den geringsten Protest gegen mich aus, der es gewagt hatte, in Jerusalem öffentlich in einem fremden Idiom zu sprechen! Nächsten Morgen erfuhr ich aus einem Artikel Ben Jehudas im »Doar Hajom«, ich sei ein 91 Verräter an der jüdischen Sache Palästinas, Diener fremder Götzen, der ein neues Galuth in die Heimat geschleppt habe, ein Entweiher der Stätte, an der ein Kampf gegen die bösen Mächte des Exils geführt worden sei; die pathetischen Sätze klangen in einem Appell an das Land aus, solche Entweihung fortan nicht zu dulden . . .
(Welcher Lärm! Sollte der »Doar Hajom« etwa mein Thema gemeint haben, indem er auf mein Deutsch losschlug?)
Ein paar Tage nach diesem Ereignis besuchte ich die Kolonie Chulda. Eine schöne Farm, mit gemischter Bewirtschaftung. Die Siedler haben einen steinernen Stall gebaut, in dem sie uns ihren Stolz, eine neu eingeführte Kuh holsteinischen Geblüts zeigten. Unter der Kuh saß die Chaluza und molk. Immer, wenn die Kuh einen Satz fort vom Milchkübel machte, rief die Melkerin: »Aber, Mariechen!« Mit der Kuh sprach die Chaluza deutsch, mit uns hebräisch. Das Zweckgemäße dieser Doppelsprachigkeit kam mir lebhaft zum Bewußtsein. Ich fragte die Chaluza, ob die Kuh mehr Milch geben wird, wenn sie erst auf den Namen »Mirjam« hört. –
Vielleicht betont man in Palästina das Hebräisch als nationale Sprache auch deshalb mit solcher Leidenschaftlichkeit, weil Jiddisch ein grotesker, verdorbener Mischmasch ist. Viele Chaluzim scheinen sich des Jiddischen, ihrer Muttersprache, geradezu zu schämen. Herr Gordon in Tel-Awiw zeigte mir einen Fragebogen, auf dem ein Einwanderer in die Rubrik Muttersprache: »Esperanto« geschrieben hatte. Und doch ist das Jiddisch eine lebende, eine höchst lebendige Sprache, in manch einer Beziehung. Es ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. In mehr als einer Beziehung ist es Esperanto; über die Welt zerstreut, lesen Millionen Hunderte jiddischer Zeitungen; es ist die Kongreßsprache der jüdischen Welt-Arbeiterorganisationen; es hat seine Literatur, seinen Liederschatz; jüdisches Folklore ist ohne das Idiom der Chassidim Nonsens. Unter der nationalistischen 92 Oberfläche des palästinischen Hebräisch lebt es ohne Zweifel ungemindert und ungebrochen weiter.
Am heftigsten wird das heutige neue Hebräisch in Palästina natürlich von den alten Juden des vorzionistischen Kolel bekämpft. Sie gebrauchen die heilige Sprache nur in den hohen Stunden des Kults, verwerfen ihre Profanierung durch den Alltagsgebrauch zusammen mit anderen Neuerungen des Zionismus, der ihnen in tiefster Seele zuwider ist.
Und neben dem Hebräisch, das sich durchsetzt, dem Jiddisch, das kraft seiner Weltberechtigung lebt und besteht, erhalten sich in Palästina noch die mit arabischen Elementen untermengten Idiome der Sefarden, Jemeniten und Halebiner.
In diesem Zusammenhang ist das hebräische Herzl-Gymnasium in Tel-Awiw zu erwähnen. – Vor dem Krieg zählte es etwa achthundert Schüler. Jetzt sind es sechshundert. Das Gymnasium erhält von der Regierung keine Unterstützung; die zionistische Kommission trägt zu seiner Erhaltung viertausend Pfund bei, an Schulgeld nimmt es sieben- bis achttausend ein. Es wird in fortschrittlichem Geiste geführt, – so war sein Direktor Mossinson der Erste, der es gewagt hat, in öffentlicher hebräischer Schule Teile der Bibel barhäuptig vorzulesen, – die Bibel als Geschichtsbuch aufzufassen. Andere Reformen der Schule, die aus Amerika stammen und den Unterricht wie die Schulgemeinschaft betreffen, haben ihren Weg aus Tel-Awiw nicht heraus ins Breitere, nicht einmal nach dem nahen Jerusalem gefunden, in dem ja ganz andere Gesetze, starreres Festhalten an alten Formen gelten, die ganze Struktur des Lebens der Gesellschaft, der Bildung, von alter geheiligter Tradition bedingt ist.
Der Bannfluch der Orthodoxen wird aber nach einer ganz anderen Richtung geschleudert, als nach dem Herzl-Gymnasium von Tel-Awiw. Dieses scheint, als Institution und 93 Klassenprivileg einer geringen Oberschicht den Orthodoxen nicht so gefährlich, als die niederen Schulen der neuen Einwanderung, in denen sich die Errungenschaften der Zeit im Unterricht der Kinder durchzusetzen suchen.
Die Schulen der Orthodoxen künden sich bereits auf drei Straßen Distanz durch höllischen Lärm an. Geht man auf die Quelle des Geschreis zu, so gewahrt man einen niederen Raum, in dem ein befezter Türke in breitem schmutzigem Mantel mit einem Stock in der Hand vor einer Tafel steht. Der Stock prügelt auf die Schultafel los, daß sie tanzt und ächzt; in zehn Bänken sitzen etwa fünfzig Rangen, der älteste zwölf Jahre, und brüllen im Chor heilige Zeilen aus den alten Schriften vor, – um durch das Getöse, den gottgefälligen Spektakel, sich die Silben, die Worte und ihren verborgenen Sinn, der ihnen in ihrem Alter ja noch gar nicht aufgehen kann, gründlich einzuverleiben. Es ist der Cheder. Nebenan aber die Jeschiwah, in der junge Knaben in die tieferen Geheimnisse der heilig-ehrwürdigen Bücher eingeweiht werden.
Die Schulen der Zionisten haben durch Unterricht in weltlichen Fächern und Wissenschaften das alte Schriftauswendiglernen und Schriftauslegen ersetzt und aus dem Felde geschlagen. Im ganzen besitzt Palästina etwa hundertunddreißig rein hebräische Schulen; mit sechshundert Lehrern, dreitausend Schülern. Außerdem drei Lehrerseminare. Da es keinen Schulzwang gibt, können Orthodoxe ihre Kinder in den Cheder, Neologen ihre in die neuen Schulen schicken. Es gibt jüdische Familien, in steigender Zahl, die ihre Kinder in christliche, von Engländern geleitete Schulen schicken. Es gibt zuweilen auch arabische Kinder in hehräischen. –
In der Überspannung des Hebräischen als nationale Sprache liegt eine nicht geringe Gefahr für das Judentum Palästinas. Das Land ist englische Dominion. Im besten Falle ist es heute eine solche. Es ist aber auch ein Land der Araber, in dem die Juden eine erschrecklich geringe 94 Minderheit vorstellen. Die englischen Behörden brauchen für ihre Beamtenschaft Juden, die nicht hebräisch allein, sondern mindestens noch englisch sprechen können. (Dieser Umstand wird allmählich doppelsprachigen Unterricht bewirken.) Um sich im Lande halten zu können, werden die Juden sich des Idioms der überwiegenden Menge der Bevölkerung zu bedienen verstehen müssen. Zum Englischen kommt das Arabische.
Will der palästinische Jude seinen Zusammenhang mit der Welt nicht verlieren, darf er aus dem Hebräischen nicht sein ein und alles machen. Es gibt einen Zusammenhang mit der Welt, der im Augenblick wichtiger ist als die Wiedererweckung, die künstliche Galvanisierung einer toten Sprache zu einem Scheindasein. Erreicht der nationalistische Sprachenrausch seinen Höhepunkt, so werden viele junge Palästiner die Isolierung von der übrigen Welt am eigenen Leibe erfahren müssen.
In einen entlegenen Winkel der Welt verschlagen, muß das jüdische Palästina den sprachlichen Kontakt mit den Ländern des Galuth aufrecht zu halten suchen.
Hebräischer Chauvinismus wird fallen – mit der Einsicht der durchbrechenden sozialen Verbindung der Gesamtheit.
Vom Dache des Hauses gesehen, das das Haus des Pilatus genannt wird, ist die Heilige Stadt ein nach Osten geneigter, nach Osten abfallender Berghang, eng Dach bei Dach. Die Stadtmauern und Wälle senken sich tief in Felsenklüfte hinab, leere steinerne Strombetten, in denen hier und dort an sagenschweren Stätten noch ein Fußbreit Wasser schwillt, – Hinnom: das Höllental Gehenna, Kidron: das auch Josaphat genannt ist und das der Fuß des Größten unter den Juden allnächtlich betrat, wenn der Weg zum Ölberg zu erklimmen war, der Flußlauf El Dschôz, aus dem der Skopus aufsteigt. Dies weiße Gewirr von flachen Dächern und gelblichen Mauern, ohne Grün, abfallend in schroffer Senkung nach Osten, ist die Heilige Stadt, deren du 95 gedenken sollst, die Hände auf die Augen gepreßt, in deiner letzten Stunde.
Und zu Füßen des Haram, der heute eine heilige Stätte der Moslems ist und wo, aus Quadern der Erinnerung getürmt, nur mehr dem Gläubigen unter den Juden sichtbar, der Alte Tempel steht, der vielfach erbaute, wieder zerstörte, tief unten in der Kidron-Kluft, Sarg bei Sarg, aufsteigend aus steinernem Becken des Flußlaufs, dehnt sich eine unendliche, grenzenlose Stadt der Toten. Zutiefst Absalons Grab, der spitze Kegel, Zachariä Grab und das Josaphats, der Felsentempel. Über diesen beiden aber, den sanft emporführenden Hang des Ölbergs mit weißen flachen Platten sprenkelnd, die steinernen Särge. Namenlose Gräber von Juden, namenlos und ohne Zahl.
Die Heilige Stadt, die ewig Lebende, blickt nach Osten. Die Stadt der Toten, auf den Ölberg klimmend, blickt die Heilige Stadt an. So will es die Ewigkeit. Gedenket, gedenket Jeruschalajims, ihr Lebenden, ihr Toten.
Ehe die Sonne über dem Ölberg aufgeht, ruft der Muezzin hoch oben vom Minarett des Haram, schluchzend, klagend, dann wie Vogellaut jubelnd zum Himmel Gebet und Mahnung empor.
Frühschein fällt auf den lieblichen weiten Plan, die blauen Mauern der Omarmoschee erstrahlen, ein Strahl der Sonne fällt durch die edelsteinfarbigen Fenster auf den grauen, unförmigen Felsenriesen, den die Moschee umschließt; – der Fels Moria ist's, der Mohamed auf seinem Fluge in den Himmel zu folgen versuchte, der Fels, auf dem Abraham seinen Sohn opfern wollte; der rätselhafte Stein erglüht vom Widerschein der Sonnenfarben durch das strahlende Bunt der Scheiben. Jetzt erwacht die Stadt.
Glocken klingen auf, hier und dort, aus Klöstern, Kirchen, Domen, dumpfe und schwer schlagende, helle, rasch schwätzende wie Kindeslachen.
Stumm bleiben allein die wenigen versteckten Stätten der Juden, vergraben im Gemäuer der alten Stadt Zion; 96 gedämpften Tones, bedeckten Hauptes klagt, singt, jubelt, schluchzt der Jude sein Gebet. Es darf nicht, wie Andacht der anderen, aus dem Raum empor zum Himmel klingen.
In den schmalen, windungsreichen Straßen ist das geschäftige Leben des Alltags schon im Gange, tummelt das Treiben durcheinander. Unter den Torbogen, in dem langgedehnten, rauchig düsteren Bazar feilscht, drängt, schiebt sich die Masse der zusammengepferchten Orientalen. Hier herrscht nicht der laute, fröhliche Lärm des Muski Kairos, das behaglich in den Tag-Hineinleben des kaffeetrinkenden, nargilehschmauchenden, aus vollem Bauch lachenden ägyptischen Handelsmannes, – ein dumpfer, geduckter, verschlagen-gefährlicher Orient schwelt unter verrauchten, moderigen Deckenwölbungen, die die Straßen überdachen. Die Läden der Händler sind tiefe, kellerartige Verliese. Die ganze alte Stadt scheint ein unlösbares Labyrinth niedriger, ruinenähnlicher Häuser, von denen man nicht weiß, sollen sie höher gebaut werden eines Tages oder sind sie im Bau stecken geblieben, weil sie verfallen sollen.
Wie Schlammadern laufen alte krumme Gassen zwischen den gegeneinander vorgeneigten Mauern der Häuser. Die hochgebauten Klöster blicken mit vergitterten Fenstern auf die winkeligen Wege nieder, durch die eilige Gestalten in weißen Kutten, wehenden Talaren sich an ihre schweren Tore drängen, rasch von der wohlumfriedeten geheimnisvollen Stille aufgenommen werden.
Diese Stadt hat drei Feiertage in jeder Woche. Donnerstag abend beginnt der der Mohammedaner, Freitag abend der der Juden, am Sonntag morgen der der Christen. Drei Religionen der Menschheit leiten ihren Ursprung von diesem wall- und kluftumstarrten düsteren Gemäuer her.
Vom Berg Zion ausgehend, auf dem Chaluzim eine neue Synagoge bauen, komme ich am Haramstor vorbei, hinter dem in Omars Moschee der Fels der Moslem schwebt, und 97 trete in die Via Dolorosa ein, folgend den Fußspuren Christi zur Schädelstätte.
Jeder Schritt, den ich über die spitzen Steine der steilen Straße zurücklege, treibt mich tiefer in die sanfte Gewalt des Menschensohnes; läßt mich inniger, blutiger erkennen, wie verwandt ich mich seiner aus Liebe geborenen, durch Tod gekrönten Lehre fühle. Die wunderbare Blume der Passion erblühte, erhob sich aus dem edlen Boden des reinen Judentums: Liebe zu den Ärmsten, Kampf gegen den Bedränger, Erlösung aus Sklavenfron. Ihr Heiligenschein ist: Verkennung, Verhöhnung, Marter und Opfertod. Ihr Duft erfüllt das endlose Tränental der Menschheit.
Ist es nicht die gleiche Religion, die heute, nach tausenden von Jahren, aus demselben Boden, dem edelsten des Judentums aufblüht, in den Ebenen Galiläas, in den Bergen Judäens, aus herrlichen Seelen junger Menschen?
Einen Augenblick lehne ich mich, unter dem Bogen, von dessen Höhe die Worte »Ecce Homo!« gesprochen wurden, an die Hausmauer, schließe die Augen. Schneller, als der Gedanke vermag, fliegt das pochende Gefühl hinüber zur unheiligen Stadt, zum öden, geräuschvollen Trottoir, zu dem Haus, einem Gasthof, »Eden« genannt, in dem zwei andere große religiöse Menschen für ihren Glauben gekreuzigt wurden, eine bestialische Rotte von Söldnern Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg ermordet hat, Apostel eines neuen, aufdämmernden Weltgeschickes.
Wo beginnt, wo endet die Lehre? Warum müssen es immer Juden, von Juden Geborene sein, über deren Märtyrertod, gekreuzigten Leichen die Sonne der neuen Zeitalter in die Höhe steigt?
Die heiligen Stätten der Menschheit im Orient sind, wenn sie nicht unverrückbar und unleugbar fest zum Himmel starren wie die Pyramiden von Gizeh, zumeist apokryph; nur durch jahrhundertealte Anbetung geheiligte Irrtümer. So die Geburtskrypta in Bethlehem; so die Grabeskirche 98 in Jerusalem. (Golgatha erhob sich aller Wahrscheinlichkeit nach am entgegengesetzten Ende der Via Dolorosa, außerhalb der Stadt, auf dem vom General Gordon entdeckten Hügel vor dem Damaskustor.) Allesamt aber werden diese heiligen Stätten, echte und falsche, dem Andacht suchenden Fremden durch Scharen von menschlichem Ungeziefer: Führern, Reliquienhausierern, Kameltreibern, Wahrsagern, Kupplern, Erpressern und Bettlern verleidet und unterschlagen, ja, im vollen Sinne des Wortes unterschlagen, gestohlen.

Der Weg nach Bethlehem (Rahels Grab)
Die heiligen Stätten der Christen in Palästina sind zudem Schau- und Tummelplätze der irrsinnigsten Fehden, Eifersucht, blutigen Kämpfe der Mönche aller Glaubensbekenntnisse: Katholiken, Griechisch-Orthodoxen, Armeniern, Kopten.
In der Grabeskirche drückte man sich bei den Feiern (den heidnischen Feiern) des heiligen Feuers die Gedärme aus dem Leib, um die eigene Kerze vor den anderen anzuzünden. In der Geburtskirche zu Bethlehem aber, wo die arme Krippe gestanden haben soll, das Öchslein brüllte, das Eslein schrie, die drei Könige knieten, zeigt dir der Führer Löcher von Revolverkugeln in den Wänden. Dort unten haben sich – wohl in der Weihnachtsnacht? – armenische und griechische Mönche eine Schlacht geliefert, bei der es zwei Tote gab und außerdem die Brokatumkleidung der heiligen Mauern in Flammen aufging; – man sieht noch die Brandspuren über der Pritsche des Soldaten, der dort Tag und Nacht sitzt, schläft, schnarcht, wahrscheinlich auch Zigaretten raucht und darüber zu wachen hat, daß die Hüter des Heiligtums sich nicht wieder in die Haare fahren, totschießen und mit Feuerbränden um sich werfen, wenn sie ihre Lampen an der Stelle anzünden, wo der Heiland geboren wurde.
Jede Konfession hat nämlich ihre Lampen. Die Römisch-Katholischen kommen aus ihrer Kapelle über der Krypta herunter, sperren ein Gitter auf, hinter dem ihre Lampen 99 hängen, zünden sie an, sperren das Gitter wieder zu und verfügen sich in ihre Kapelle zurück. – Die Armenier desgleichen. – Die Griechisch-Orthodoxen desgleichen. – Jede Konfession hat ihre eigene Kapelle, die die große Geburtskirche über der Krypta vereint. Die Armenier haben auf die Marmorfließen, die von ihrer Kapelle zum Eingang der Krypta führen, einen Teppich gelegt, er ist so kunstvoll schräg abgeschnitten, daß die benachbarten Römisch-Katholischen auf dem nackten Steinboden gehen müssen, wenn ihr Weg sie zum selben Eingang führt. (Da ist auch das berühmte Fenster über einem kleinen Seitenaltar. Hundert Jahre lang war es von dichtem Spinnweb bedeckt, weil jede Konfession eifersüchtig und argwöhnisch darüber wachte, daß die andere den Dreck nicht unbefugterweise von den Scheiben wische. Da kam der protestantische General Allenby, eroberte das Heilige Land, zeigte einem Tommy mit dem Daumen das ehrwürdige Streitobjekt, – und weg war Spinnweb und Legende!)

Kotl Marawi
Am Kotl Marawi – das ist die Klagemauer – stehen und liegen Beter und Beterinnen vom frühen Morgen bis zur späten Nacht. Weinende Weiber reiben ihre nassen Gesichter an die uralten Quadern, hocken auf dem Boden und schmiegen sich an die Mauer wie ein Kind an seine Mutter. Hüpfend verneigen sich alte Männer in Sterbemänteln vor den Steinen, schlagen ihre Stirnen an die kalte, glattgescheuerte Fläche, Knaben im Kaftan, pelzverbrämtem Hut und langen Stirnlocken psalmodieren, scheu zur Seite blickend, nach dem Fremdling. In die Fugen zwischen die Riesenblöcke sind Nägel getrieben, jeder Hammerschlag ein Gebet um Gesundheit. Ein Gichtbrüchiger humpelt heran, schöpft aus einer Steinmulde Regenwasser, reibt sich Augen, Hals, Gelenke ein. Tief drin in den ausgewaschenen, zerbröckelten Fugen brennen kleine Kerzlein, rötlich, blinzelnd. Dies ist der heilige Ort, alles, was vom alten Tempel blieb, die Herrlichkeit Salomonis 100 sonst nur Wort und Hauch. Ein enger Hof oder Paß zwischen Mauern, kaum fünfzig Schritte lang; die Quadern reichen hoch, aber noch tiefer unter das Straßenpflaster, das man nicht entfernen darf, um sie bloßzulegen. Der einzige Wallfahrtsort der Juden. Herdengleich liegen, lagern orientalische Gestalten, von weit her gekommene, Jemeniten, abessynische, moghrebiner Juden mit ihrem Führer zu Füßen des Steinwalls, der zum Himmel steigt. Vier, fünf enge winklige Gassen vorher schon kündet Winseln kniender, hockender Armer, Männer und Frauen, steinalter aber auch jüngerer, dem Nahenden den Kotl an. Laute Klage hört man nur von diesen Bettlern, nicht von den Betern bei der Mauer. Nur hier und da schluchzt am Kotl eine der weinenden Frauen wie ein wundes Tier laut auf. Wendet sich der Fremdling zum Gehen, so unterbrechen Dutzende von Betern, weinenden Weibern, Pilgern ihr Gebet, drehen sich mit einem Satz nach dem sich Entfernenden um und strecken Hände vor ihm aus – Bakschisch, Bakschisch!! Die heiligen Stätten des Orients lassen einen bitteren Nachgeschmack zurück.
Mit ihren niedrigen, in der Erde vergrabenen, Rattenlöchern mehr als Menschenbehausungen ähnelnden Wohnhöhlen, ist die alte heilige Stadt eine ewige Gefahr für ihre ärmeren Bewohner, Juden, Christen und Moslems. Unglück, Elend, Pestilenz brüten in diesen Schlupfwinkeln, in die die Sonne nie hinunterreicht. Schmutz, Rauch, Fäulnis vergiften die arme Bewohnerschaft in den Ruinenhaufen und unfertigen Häusern. Für die Juden, die in der Nähe der alten Mauer, in unmittelbarer Nachbarschaft der bösesten Elemente unter der arabischen Bevölkerung hausen, ist die Gefahr schrecklich. Kein Entrinnen, wenn ein Pogrom entfesselt ist! Beim letzten drang der Feind in Häuser ein; an die Wand genagelt, in Betten gemordet, in dunkeln Winkeln fand man die Toten: arme jüdische Krüppel, Kranke, schwangere Frauen.
101 Fort mit den Bewohnern der Altstadt. Hinaus ins Freie mit ihnen. In den neuen Stadtteil vor dem Jaffator! Man vernimmt immer mehr Stimmen, die das rufen. Räumt die alte Stadt, die heilige. Sie soll ein Wallfahrtsort werden, ein Museum – wie das römische Forum, wie der Sahararand mit den Pyramiden und der Sphinx bei Kairo. Räumt die heilige Stadt. Ins Freie!
Doch im magischen Bannbereich des alten Gemäuers, um das sich die Täler Hinnom und Josaphat ziehen, webt neben dem geschäftig profanen ein eigenartiges, tiefes, heimliches Leben. Seltsame eigenwillige Geister wohnen, hausen, brüten hier und dort; ihr Lebenstrieb sättigt sich an der tiefen Magie des Ortes. Schlurfende, geheimnisvolle Schritte nachts von der Klagemauer hinüber zur Straße der Schmerzen. Innerhalb der verbotenen Stadt – der Haramstore und Wälle – gestikulierende Gestalten, übermenschlich groß in ihrer Anbetung, hingeworfen unter dem wimmelnd übersäten Himmel, Elmsfeuer auf den Spitzen ihrer in Begeisterung emporgereckten Hände. Ein Menschenschlag, gebannt nach Osten blickend, aus Klöstern, Synagogen, Moscheen, selig fast schon wie jene in den Gräbern unterm Ölberg, in den Gräbern aller Friedhöfe rings um die Wälle der Stadt, lebt im heiligen Ort, erlöst durch Glauben vom irdischen Weh. Der Irrsinn – Irrsinn der Wallfahrer, Kreuzfahrer, Zionsbauer – unter der nüchternen Oberfläche jedes Einzelnen glimmt der Funke des ewigen Feuers. In tausend kleinen Verrichtungen praktischer und verschrobener Art, in der Beschäftigung und Spekulation mit Dingen der archäologischen, antiquarischen, religionsphilosophischen, folkloristischen Forschung, der Geologie, Tierkunde, ungezählter spezialisierter Zweige menschlichen Wissens, verrät sich die unlösbare, tief geheimnisvolle Verbundenheit des Individuums mit dem Boden, der magischen Wiege des Menschengedankens!
Sieh dort die Blinden, die zahllosen Blinden, wie sie mit schräg vorwärts gestützten Stäben sich durch die Menge 102 tasten. Ihre Gesichter spiegeln nicht die Verzweiflung über den gestorbenen Sinn, die entwichene Welt. Sie sind verklärt, denn vielleicht ist ihre Finsternis Purpur, wie der Schein es zu sein pflegt, der um Sonnenuntergang in ungeheurem Lichtrausch, wie Nordlicht des Ostens, über dem Bergrund aufflammt, aus dessen Kessel Jerusalem sich erhebt.
Der Blinde in der Heiligen Stadt ist ein Heiliger, sein Gebrechen spricht ihn selig.
Der Wahnsinnige, der Aussätzige in der Heiligen Stadt ist heilig, selig gesprochen von seinem Gebrest. –
Schwer beladen mit Säcken, in denen vielleicht Mehl, vielleicht Steine sind, steigen kleine graue Eslein, von einem Araber getrieben, langsam die Straße von Josaphat zum Dorf Shiloah hinauf. Langsam und ergeben schreiten die beladenen Tiere ihren Weg. Ihr silbernes Fell ist so silbern, ihre zarten Ohren rosig im Innern. Ihre großen, gelb geränderten Augen blicken nieder auf die spitzen, harten Steine. Ein Ruf des Arabers, sie bleiben stehen, nicht rastend, geduldig und treu, auf Ruf oder Stockschlag wartend, der sie wieder gehen heißen wird. Ohne Regung, sanft und silbern, stehen sie im Bazar, an den Ring eines Türpfostens gebunden, und die vorbeidrängende Menge stößt sie, tritt auf ihre dünnen, so leicht verwundbaren Beine.
Sprecht ein Gebet, Menschen, sofern ihr euch eines erinnert, führt euer Weg an einem Eslein vorüber, das, schwer beladen, treu und mit gesenktem Kopf am Wegrand steht!

Die Stadt Nablus (Sichem)
Dort oben, auf dem Kamm des Ölbergs, zieht eine Karawane von Kamelen über die Straße, nach Sichem. Auf beiden Seiten ihres Höckers mit Kisten beladen, die leise bei jedem Schritt schaukeln, ziehen sie ihre Straße dahin. Schön sind sie gestaltet im klaren Abendschein. Mit weichen Schritten, eine melodische wellige Linie vom schlanken Kopf und Hals zu den hohen wohlgestalteten Beinen, schreiten die edlen Tiere die steigende Straße hinan. Blaue Perlenketten tragen 103 sie um den Hals, gegen den bösen Blick. Das erste in der Reihe, der Anführer, trägt auf seinem Kopf einen Turban, wie ein Mensch. Hinter ihm, in blauem Burnus und rotem Kopftuch, geht der Araber mit langem Hirtenstab, hinter dem letzten in der Reihe drei andere, in weißbraunen Filzmänteln, das wallende gelbe Kopftuch mit schwarzem Roßhaarkranz an den Schädel gedrückt. Eins der Kamele ist zu schwer beladen. Sein Höcker zuckt unter der unerträglichen Last, die Kisten schwanken arg zu beiden Seiten. Es hebt den Kopf, sieht mit seinen schwarzen gleißenden Augenscheiben den Himmel an, wendet den Hals heftig nach rechts, nach links, und stößt einen klagenden Schrei aus, wie ein leidender, ungerecht leidender Mensch. (Einen ähnlichen Schrei hörte ich von einer irrsinnigen Bettlerin, die in ihren Lumpen, nahe beim Golgathahügel, ein paar Schritte vor dem Gouvernementshaus, auf einem Mauerstumpf saß und auf Almosen wartete. Nur einen einzigen Laut stieß Mensch und Tier aus, dann Stille.) –
Vom Skopus, an dem Hause des Mufti vorbei, drängt eine riesige Ziegenherde zu Tal. Hinter ihr drei arabische Reiter. Die Ziegen haben langes, zottiges Fell, sind schwarz oder ockergelb mit karminrot gestreifter Wolle über den Rücken zum Bauch nieder in Strähnen; ihre Köpfe schmal; ihre Ohren bedecken die Hälfte des Kopfes, hängen in breiten Lappen tief zum Halse. Labans Herden steigen nieder von den Bergen Samarias! Die Straße ist nicht breit genug für diese Fülle, diesen Reichtum. Wie eine dunkle Wolke zieht die drängende, treibende Masse hinunter gegen das Tor der Heiligen Stadt.
Wo sind die Vögel geblieben? Die seligen Herden des Himmels, die lebenden Wolken, beneidet und von Sehnsucht verfolgt, wo sie im Norden das Firmament umkreisen, am südlichen Horizont untertauchen? Es ist Herbst. Der Himmel müßte bedeckt sein von Vogelschwärmen! Aus allen Ländern der kalten Zone sind sie ja fort. Auf dem 104 Mittelländischen Meer, in Ägypten, am Lauf des Nil, am Sahararand bei den Pyramiden durchforschte ich den Himmel nach unseren Vögeln, nirgends erblickte ich welche. Wo sind die Störche, die Schwalben, die Millionen frierender kleiner Leiber, die kleinen Pfeile, die beschwingten Schwätzer vom breiten buschigen Baum in Hiddensöe?
Ein Adler, ein paar dunkle Geier kreisen langsam über dem Ölberg . . .
Ich sah keine Vögel aus dem Norden, all die Zeit, die ich hier unten im Süden verbrachte. Keinen der ungezählten Züge, die uns im Herbst verlassen, die zu uns im Frühling wiederkehren. Ich sah sie nicht über der Wüste, nicht über den Bergen, nicht über den Städten. Wohin fliegen die Vögel, wenn es kalt wird und dunkel?
An den Abenden, wenn die Sonne hinter den Bergen Judäas versinkt, steigen Wanderer die harten Wege der Täler aus Achat- und Onyx-Gestein zum Ölberg empor. Hier ist Gethsemane, ein wohl umhegter Gartenfleck mit bunten Blumen und tausendjährigen Olivenstämmen. Und hier, wo die kleine Kapelle in winzigem Gärtlein steht, hat Jesus geweint über die Stadt.
Steil zieht der Weg hinan zum Kloster der Russen auf der Höhe des Ölbergs, dem hohen Turm, von dem man westwärts Jerusalem und Judäa erblickt, ostwärts das Tote Meer, den Jordan und die Berge Moab.
Hier, mühsam steigend, müde und von schmerzlichen Sorgen geplagt, denke nach, weine, du Wanderer, über die Lehre, den Tod, die sterbende Lehre, den vergeblichen Tod jenes Besten unter den Juden.
Weine über diese Welt, in der aus einem Juden Christenglaube geboren wurde durch Mitleid für die Elenden; in der, von seinem Volk, dem er Milde, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft für die Ärmsten und Verstoßensten gepredigt hatte, ein überirdisch herrlicher Mensch auf rauhem Kreuz verblutet ist.
105 Nicht als Stifter eines neuen Glaubens ist der Christus der Christen gefallen, sondern als Verkünder eines sozialen Gesetzes, das die niederen Instinkte des Volkes bedrohte. Heute erhebt es sich wieder, das Gesetz und die Lehre, aus der Mitte der Besten unter den Lebenden. Und soll abermals gekreuzigt werden in den Besten der Lebenden.
Weine, weine, wenn du noch Tränen hast, über die Völker dieser Welt, die sich nach dem Morden vereinigten, um zu rauben, zu plündern, um einander auszurauben, auszuplündern. Schaue hinüber nach Norden, wo die Wolga sich in die Kaspische See ergießt, wo schuldlose Millionen Hungers sterben müssen, damit die Völker besser rauben, gründlicher plündern können. Weine, wenn du es noch vermagst, über die Lüge des Glaubens, die Schmach des Menschen, über dieses Hinleben im Heute, über die, die dieses Leben im Heute Leben nennen. –
Aber jetzt zerrinnen die Berge Moab im Blau wie Gletscher von Sand im Abendrot. Erloschene Spalten, Züge von zerfallendem Gestein senken sich zum bleiernen Spiegel des Toten Meeres dort unten. Zerstobene Welten dämmern in Unwirklichkeit hinüber. Der Himmel über deinem Kopf erstrahlt in weitem Bogen hellgelb, orange, violett, blau-rötlich, gralsrot. Hoch, ein ungeheures, nie gesehenes Zelt von durchsichtigem Blut, magisch und unerklärlich, einen kurzen Augenblick nur ehe es zu Asche zerfällt. Lieblich und furchtbar bist du, Himmel, ob den Zinnen der Heiligen Stadt.
Ein Rätsel, Gott allein bewußt, ist das Licht, der Odem, die Stille über Jerusalem. Noch leuchten, wie kleine Phosphorstriche, die kleinen Gräber gegenüber vom Haramswall, am Hang des Ölbergs über Josaphat. Dann, mit einem Schlage, versinkt alles, und der Sternenhimmel des Südens, betörend mit Myriaden unbekannter Gestirne tut sich ungeheuer auf.
Eine Glocke tönt. Noch eine.
Der schluchzende Ruf des Muezzin, aufsteigend, abbrechend auf dem höchsten Ton.
106 Aus dem Dorf Shiloah melancholisches Eselsgeschrei. Hier oben ist es schon ganz dunkel. Ein wagrechter Pfeil von Licht, von einem über die Straße schießenden Automobil, schwirrt meilenweit durch die Finsternis.
Unten in der alten Stadt, die versunken ist, seltene, schüchterne Lichter. Wenig Licht in engen Fenstern, verhängten, durch die hereinbrechende Nacht. – –
Jenseits der Wälle, der alten Mauern, draußen vor den Westtoren der Stadt, dem Jaffator, dem Damaskustor, ist ein Gürtel von Leben, pulsierend und heutig. Breite Straßen ziehen sich hinaus und hinüber, gegen Westen, Nordwesten, den Gebirgen Judäas, den Straßen Samariens zu. Hier stehen neue Häuser, in modernem Geschmack und Ungeschmack errichtet, Mietskasernen, Geschäftsstraßen, Villen reicher Araber und Juden, ein Gewimmel von kreuz und quer über Hügel und Mulden laufenden Gassen und einzelnen Komplexen auf nacktes Gestein draufgesetzter Gebäudeblöcke.
Umsonst schleuderte der letzte Papst seine Enzyklika gegen die Stadt vor den Toren des heiligen Jerusalem. Das Leben der neuen Zeit läßt sich aus diesen Straßenzügen nicht mehr verbannen. Nur schwer hält der Lebenstrieb der Menschen sich vor der Entweihung der Bannmeile zurück. Der Lärm von Wagen, Automobilen, durchrattert Straßen und Gassen. Tanzhallen gibt es und Trinkstuben in der neuen Stadt. Betrunkene englische Soldaten johlen durch die Nacht. Gegenüber von einem Klostergarten hat sich ein Kino aufgetan, vom Balkon schmettert Blechmusik. In der Jaffastraße handelt, feilscht der Einheimische, der Fremde; alle Nationen, alle Glaubensbekenntnisse. Üble levantinische Zivilisation lebt sich aus; unaufhaltsam breitet sich der kosmopolitische Gürtel um den Kern des alten geheiligten Zion. –
Die Straße der Hundert Tore, Mea Schearim, öffnet ihre Pforte zum weitverzweigten Ghetto der Kolelim; des 107 ungarischen, siebenbürgischen, rumänischen, bessarabischen, polnischen Chaluka-Volkes. Aus riesigen, von Dutzenden Familien bewohnten Höfen, endlosen engen Reihenhäusern, aus hundert und aberhundert Toren quillt und quillt das Treiben des Ghettos hervor; jeder Kolel hat sein Heimatsgaluth mitsamt seinen Sitten und Lastern getreu hierher ins alte Land verpflanzt. Drüben, jenseits des Hügelabhangs zieht sich das steinerne Viertel der Bucharenkolonie hin. Sie war vor dem Krieg die reichste der Kolelgemeinden, jetzt ist sie wie jene von Mea Schearim verarmt, ihre Bewohner nähren sich von tausend kleinen Ghettoberufen, Handel und Handwerk.
Auf einer Freitagabend-Wanderung findet der Fremde in diesen jüdischen Vierteln das erstaunlichste, überraschendste Vielerlei von Synagogen, Betstuben, Riten und Sekten beisammen. Hinter Hunderten lichtstrahlender Fenster tönt Singsang, steigt Gebet, wuchtet Chor. Endlos sind die Varianten in Kultform, Brauch, in der Bauart der Räume, der Kleidung der Beter. Die Bucharen in ihren bunten orientalischen Seidentalaren, die Damaszener, Halebiner, Beyrouther, Sphardim, Marokkaner, Jemeniten, im Tarbusch wie Türken, ihre Betstuben wie Moscheen anzuschauen, breite Säle mit herrlichen Teppichen belegt, ein Diwan um die Wände, in diese eingegraben tiefe Regale mit heiligen Folianten Rücken bei Rücken. Die Aschkenazen, Chassidim in schwarzen, blauen oder roten Samtkaftanen mit pelzverbrämten breiten Schlachzizenhüten auf den langbelockten wirrbärtigen Köpfen, aufsteigendes, jäh niederfallendes Durcheinanderschreien, schlenkernde Gesten um die Empore, die in der Mitte des Raumes sich erhebt, und auf der eine hohe, vom Totenmantel ganz bedeckte Gestalt beschwörende Rufe zum Ewigen emporsendet; silberne Geräte, Leuchter, Thorabehälter; mit goldenen Ornamenten, Früchten, Reben reichbestickte Vorhänge vor dem Allerheiligsten niederwallend. – In manchem Hause eines Reichen gab es einstmals zwei Synagogen, eine für den 108 Besitzer, seine Freunde, die Schriftgelehrten, die andere für jeden, der daherkam, Pilger, Fromme, Bettler, Müde. Es waren richtige Kapellen wie in den Häusern von Fürsten, Mächtigen der Erde; große, mit kostbaren Teppichen geschmückte, mit Bibliotheken sorgfältig geschriebener heiliger Bücher ausgestattete Räume; jetzt gehört all dies nur mehr der Erinnerung an eine versunkene Welt an, ein abgeschlossenes Zeitalter, dessengleichen nie wieder aufdämmern wird.
Jawohl, – endlose Abstufungen von Sitten, Gebräuchen, Vorurteilen, Dogmen und Wahnvorstellungen trennen Viertel von Viertel, Straße von Straße, ja Haus von Haus. Sekten über Sekten hausen hier in dem Ghetto vor den Toren der Heiligen Stadt beisammen, alle vom gemeinsamen Magnet auf der Burg Zions, auf dem Berge Davids angezogen, untereinander unversöhnlich gespalten und zerfallen. Fanatiker, kleine haßzerfressene Rechthaber, geeint nur in ihrem gemeinsamen Abscheu für den die Bräuche mißachtenden, Unreines essenden, am Samstag fahrenden, rauchenden, frei daherstreichenden Chaluz, der ihnen die Goldquelle abgegraben hat.
Wie viele Seelen leben in Mea Schearim, in der Bucharenkolonie, in Nachlath Scheba, in den Montefiore-Häusern? Kein Mensch weiß es. Man kann es in Samuel nachlesen: Volkszählung ist Sünde, sie wird vom Herrn mit Seuchen und Pestilenz bestraft. Sucht man die zum Abendgebet nötige Zahl von Teilnehmern zusammen, so zählt man: »kein ein, kein zwei, kein drei.« Diese vage, ungreifbare, undefinierbare und unzählbare Masse von Menschen soll eine Nation bilden . . .
Begegnungen alter strenggläubiger Misrachisten mit Reformjuden, Neuerern führen oft zu schrecklichen, wilden Szenen auf Straßen innerhalb und außerhalb des Ghetto, zu Zusammenstößen gefährlicher Art. Wage es nicht, am Sabbat im strömenden Regen mit einem Regenschirm in der 109 Hand auf die Straße zu gehen! Mit deiner Frau, Arm in Arm, ja auch nur nebeneinander und in gleichem Schritt, dich in Mea Schearim zu zeigen! Gotteslästerung!!
Oft aber ereignen sich auch seltsam rührende, jahrtausendalte Trennungsmauern niederreißende, Mißverständnisse jäh, mit einem Schlag schlichtende Begebenheiten . . .
Während des letzten Pogroms im November befand sich das Hauptlager des Selbstschutzes in einer kleinen, versteckten Aschkenazen-Synagoge in der Altstadt Jerusalems. Dort standen die jungen tapferen Chaluzim mit ihren Waffen, von dort schwärmten sie auf das Signal der Gefahr aus, dorthin wurden sie verwundet oder sterbend gebracht, dort wurden die Toten gebettet, dorthin schleppten wunderbare beherzte jüdische Mädchen in Suppenterrinen, Lebensmittelbehältnissen Waffen und neue Munition. – Zu den Gebetsstunden kamen die Frommen aus der Altstadt unter Lebensgefahr in ihre Synagoge, die jetzt Heerlager geworden, und manche kehrten um, als sie die Entweihung erblickten: Männer ohne Kopfbedeckung im Saal, Frauen im Raum der Thora, die Essenden auf den Bahren, die Verwundeten, die Leichen auf dem Stroh. – Aber es gab auch Einsichtigere unter den alten frommen Juden. Die blieben stehen, weinend am Eingang ihres Gotteshauses. Weinend näherten sie sich ihren jungen, waffentragenden Brüdern, und einer sprach zu diesen:
»Ein Gebot habt Ihr erfüllt, –Ihr habt das Leben unseres Volkes geschützt. Wollt Ihr nicht ein zweites erfüllen, endlich Gebetriemen legen und beten, wie es sich gebührt? Wollt Ihr es nicht für unseren Ewigen tun?« –
Ein neues großes Wohnviertel der Jerusalemer Judenschaft ist im Entstehen begriffen. Auf dem Gebiet des griechischen Kapitels hat die zionistische Kommission ein ausgedehntes Stück Landes erworben, es zieht sich von der Jaffastraße weit hinunter bis an das Kloster des Heiligen Kreuzes. Dort sollen die Juden aus der gefährlichen alten 110 Stadt angesiedelt werden, ein jüdischer Bazar entstehen, Amtsgebäude, Schulen, Villenstraßen und Wohnviertel. In großen Siedlungen beisammen hausend, kann der Jude sich leichter beschützen gegen den äußeren Feind, der seine Existenz bedroht. Gegen den inneren aber, der in Mea Schearim haust, den Geist der Unduldsamkeit und Zwietracht, schützt allein der Dritte Tempel, der im Geiste gebaut werden soll.
Tel-Awiw, »der Frühlingshügel«, ist die erste rein jüdische Stadt Palästinas und der Welt. Die Stadt, in der es in der Woche nur einen einzigen Feiertag gibt, – den, der am Freitagabend beginnt.
Es ist ein Vorort Jaffas, ein paar Kilometer nördlich vom Hafen am Strand erbaut, eine Villenstadt, die sich vom Bahndamm und den Orangenplantagen im Land bis an das Meer hinunter erstreckt, Dünen aufreißt, auf Dünen klettert; breite, wohlgeplante und splendid angelegte Avenuen, prächtige Häuser, die inmitten gepflegter Gärten stehen. In den schönen Anlagen tummeln sich nach der neuen Mode gekleidete junge Männer und Frauen; der Dialekt von Odessa beherrscht die Stadt, man hört mehr Russisch als Hebräisch; aus den Stockwerken der Villen tönt Klaviergeklimper; im Gymnasium an der Herzl-Straße ist ein Festsaal, in dem Konzerte, Rezitationsabende abgehalten werden; es gibt Kinos; man tanzt, flirtet ausgiebig; die Regenzeit heißt »Saison«; der Stadt haften bösartige Spitznamen an: »der Grunewald« Palästinas, »Heringsdorf«, das Seebad der reichen Juden. –
Der Chaluz, der in Jaffa an Land steigt, empfängt hier den ersten Eindruck vom Land seiner Sehnsucht. Er sieht die Aristokratie, die Patrizier, die reichen Bourgeois in ihren Villen, mit ihren seidenen Frauen, in der Wolke ihres üppig wuchernden Klatsches. Der Chaluz nimmt die Mütze vom Kopf, vergißt zuerst den Mund offen vor Staunen, faßt sich dann und spricht: »Hier wohnen die reichen 111 Unsern. Schad, daß wir hungrig sind. Ich möcht auch in acht Zimmern wohnen und Klavier spielen, statt zu Vieren im Zelt, und alle Nächte tanzen die Schakale um mein Bett herum wochenlang!«
Er läuft aufgeregt zwischen dem Bahndamm und dem Gymnasium hin und her, die Herzl-Straße, die Lilienblum-Straße, die Allenby-Avenue auf und ab, er kennt die Ämter, der Histadrut, das Einwanderungsamt und das Haus der Chaluzim. Er kennt auch alle die kleinen wilden Cafés und Garküchen und weiß, bis zu welchem Betrage es im einen und im anderen Kredit gibt. Er weiß nur nicht, wann er es so weit gebracht haben wird, daß er auch in acht Zimmern wird wohnen können, ein Bankkonto haben und Araber in seinen Orangenplantagen für sich arbeiten lassen. –
Will man gerecht sein, muß man betonen, daß es in Tel-Awiw nur einen äußerst geringen Prozentsatz dessen gibt, was man »reiche Bourgeois« nennt. Es gibt schon welche, das ist wahr, und der Chaluz, wenn er hungrig ist, geht unwirsch und verbittert an ihren Fenstern vorüber und denkt sich sein Teil. Aber die erdrückende Mehrzahl der Tel-Awiwer sind Beamte, Lehrer, Ärzte, Architekten. Einer lebt vom andern. Wie im Ghetto von Mea Schearim lebt in diesem gehobenen Ghetto einer vom andern. Ohne Verbindung mit der arabischen Umwelt entwickeln sie sich auf ihrem eigenen Fleck und Bereich durch ökonomische Inzucht.
Vor einem Jahr noch floß das Leben Tel-Awiws in geordneten Bahnen und mäßigem Tempo dahin; den entscheidenden Aufschwung brachte der Maipogrom in Jaffa, nach dem die Juden aus der alten Stadt Jaffas dort drüben an der Küste Hals über Kopf in die Judenstadt Tel-Awiw herüberzogen, wo man sie noch in hurtig zurechtgezimmerten Baracken wohnen sehen kann. Die Notwendigkeit, die versprengten und gefährdeten jüdischen Einwohner Jaffas in Tel-Awiw anzusiedeln, steigerte die Bautätigkeit, brachte erhöhtes Leben, regte den Verkehr Tel-Awiws an. (Genau so 112 wird es in jenem neu entstehenden Stadtteil an der Jaffastraße vor Jerusalem zugehen, wenn erst, nach den besten Mustern moderner Städte geplant und entworfen, Geschäftsstraßen, Bazare, Avenuen und Villenviertel sich dort erheben werden, zur Erbauung von Chaluz und Araber, Juden und Christen.)
Gegenwärtig schießen Häuser, Villen, ganze Stadtteile wie Pilze in die Höhe zwischen dem Bahndamm und dem Strand, zwischen der Silikatfabrik und dem Viertel Newe Zedek, das an Jaffa anschließt und im Mai der Schauplatz jener wütenden Pogrome war. Chaluzim kommen und gehen zwischen den unfertigen Häusern, waten durch den tiefen Sand der noch ungepflasterten Avenuen, schieben Karren mit Ziegeln daher, rühren Kalk an, stützen Gerüste in die Höhe. Häuserchen entstehen, sozusagen über Nacht, dünn, mit Wänden zum Umblasen, mit Treppen, über die man keine Katze hinaufjagen möchte. Baufällige Häuserchen, geboren kaum, sozusagen schon im Mutterleibe dem Tode, ihrem eigenen und dem ihrer Bewohner geweiht.
Die Häuser der Wohlhabenden, aus gutem Material, solid und stattlich, – die Häuser der kleinen Handwerker, des niederen Halbproletariats aber rasch zurechtgeschustert, mit ungenügendem Fundament, Sprüngen im Boden und in den kaum getrockneten Umfassungsmauern. Ein Windstoß mag solchem Menschenheim das Dach vom Kopfe entführen, ein Regenguß es bis in den Keller durchlöchern.
Unbegreiflich die Sorglosigkeit, mit der diese Stadtviertel gebaut werden, unzulänglich, gefährlich, auf den Schein der Vollendung hin berechnet. Ich gehe starr vor Staunen durch die unebenen Sandwege zwischen einer Gruppe solcher neuen Häuschen durch, die eine Bankgesellschaft durch einen ungarischen Baumeister für ihre Angestellten errichten läßt. Eines von diesen Kartenhäusern ist schon fertig. Die Fenster sind eingesetzt, die Schwelle bemalt, das Dach sitzt tatsächlich auf dem Stockwerk. Vor meinen Schritten der Sand ist voll von weggeworfenem Baugerät, wertvollem Werkzeug, Ziegeln, Blechstücken, Röhrenfragmenten.
113 Betäubender Lärm dringt aus dem verschlossenen Häuschen ins Freie heraus. Sind es die Besitzer, die Bewohner des Hauses, die dort drin ein Freudenfest zelebrieren, weil sie ihr Haupt nun endlich unter einem Dache zur Ruhe legen können? Leise und indiskret schleiche ich an ein Fenster des Erdgeschosses heran und blicke durch die Scheiben.
Sechs Chaluzim in mörtelbesprengten Kitteln, Mützen schief auf dem Kopf, singen da drin, fassen sich an den Schultern und tanzen mit zurückgeworfenem Gesicht einen berserkerhaft wilden Siegestanz, besessenen Rikudl, zu Ehren ihres wohlgelungenen Werkes . . .
Mit dem stillen Wunsch, der Boden Tel-Awiws, des Frühlingshügels, möge sich nicht auftun unter ihren stampfenden Sprüngen und sie allesamt verschlingen, diese Aufbauer des Landes Israel, ziehe ich mich vom Fenster zurück und verschwinde in der Richtung des Zeltlagers am Strand, das, zum Bersten voll von jenen begeisterten Scharen, den Neueingetroffenen, wenig Erwünschten, ängstlich nach dem Horizont des Mittelländischen Meeres auslugt, – ob dort nicht wieder ein neues Schiff auftaucht mit begeisterten Scharen, neu Eintreffenden, wenig erwünschten Aufbauern des Landes Israel.
Auf dem Kamm des Ölbergs, von wo man den Blick auf die Heilige Stadt und zugleich auf das Tote Meer hat, steht eine deutsche Pfalz. Mit einem deutschen Turm, der romanische Bauart vortäuscht, einem deutschen Dach, dicken Umfassungsmauern, vorzüglichen sanitären Einrichtungen, im massiv wilhelminischen Prunk hingedonnert, ehemals mit dem Bronzestandbild Wilhelms des Kreuzfahrers geschmückt und nach der Kaiserin Augusta Victoria benannt. Diese deutsche Pfalz ist zur Zeit Amtsgebäude des englischen Obersten Kommissärs Sir Herbert Samuel. Inmitten wilhelminischen Prunks haust der oberste Beamte der palästinischen Regierung zwischen der Heiligen Stadt 114 und dem Toten Meer, – den Blick krampfhaft gegen Westen, nach London gerichtet, der Hauptstadt des Orients.
Ich war bei Sir Samuel, hatte eine Audienz bei ihm. Die Aussicht, die man auf dem Wege zu seinem Haus genießt, ist berückend: rechts unten im Flußbett El-Dschôz die Felsengräber, linker Hand in der Tiefe die Jordanmündung, das Tote Meer, die Wüste Judäas, die bläulich-rosigen Berge Moabs. Während der ganzen Fahrt freut man sich auf den Augenblick, da die Zeremonie vorbei sein und man auf dem Rückweg die Berge Moabs zu rechter Hand, die Felsengräber zur linken unter sich erblicken wird.
Sir Samuel ist ein außerordentlich vornehmer und liebenswürdiger Mann. Offenbar ein sehr guter Mensch. Auch fromm. Er betet an Samstagen. Tut er es unten in der Stadt, in dem Viertel Mea Schearim, in dem der Bucharen, so hüllt er sich in den Sterbemantel der Sekte, in deren Synagoge er gerade zu Gast ist. Seine Frau habe ich bei einer großen offiziellen Angelegenheit, dem Empfang der amerikanisch-zionistischen Ärzte-Organisation »Hadassa«, eine hebräische Ansprache halten hören. Freunde versicherten mich, Lady Samuels Hebräisch habe glaubwürdig geklungen. Kam im Text: Palästina vor, so sprach sie von »Erez Israel«.
Ich war kurz vor meiner Audienz längere Zeit in Galiläa herumgefahren und mein Mund floß über von dem, was ich gesehen und mit dem Herzen erlebt hatte. Ich versuchte, zu erkunden, ob Samuel einen Begriff, eine Ahnung habe von dem, was in Galiläa unter den jungen Menschen der Siedlungen vorgeht. Ich sprach von den Chaluzim; von ihren Kämpfen um eine Lebensform; ihrem Glauben, ihrer Opferfähigkeit; ich sprach von den Gefahren, in deren Mitte sie leben. Davon, daß man alles tun müsse, um sie zu schützen. Auch davon, daß ihre Gesinnung des Schutzes bedürfe.
Samuel ließ mich reden und antwortete dann in freundlichem Tone mit typischen, wie auf einer Maschine vervielfältigten Worten, deren schablonenhafte Formulierung genau 115 damit übereinstimmte, was ich bereits unten im Gouverneurhaus vor dem Damaskustor, hier und dort von einem offiziellen Engländer, Juden und Christen, unter anderem auch vom jungen Gouverneur Bershebas zu hören bekommen hatte. Takt! Takt gegenüber den Arabern. Die Juden müssen Takt besitzen und an den Tag legen, dann werden sie mit den Arabern fertig werden. Im übrigen habe er in Galiläa die Gendarmerie so eingerichtet, daß sie zu einem Drittel aus Juden besteht. Auch Tscherkessen seien dort stationiert, Bergjuden.
Vom Chaluz schien er keinerlei Vorstellung zu haben. Wahrscheinlich war ihm Leben, Gehaben, Gesinnung, innerer Trieb dieser Menschengattung ein Buch mit ebensovielen Siegeln wie jedem beliebigen Christen. Ich glaube sicher, der Gedanke an die Zelte am Wegrand, in denen vierzig junge Männer mit vier jungen Frauen beisammen hausten, war ihm genau so peinlich, wie jedem Engländer, dessen Leben zwischen Tee und Eiern mit Speck zum Frühstück und Smoking zum Dinner mit darauffolgendem Bridge dahinfließt. Ich mußte ihm auf Treu und Ehre versichern, daß ich seine Worte nicht in Form eines Interviews »in meiner Zeitung« veröffentlichen werde. Das fiel mir um so leichter, als er mir während jener fünf Viertelstunden nichts Wesentliches gesagt hat.
Im Grunde macht Sir Herbert den Eindruck eines englischen Beamten. Eines sehr korrekten, pflichttreuen, bewährten englischen Verwaltungsbeamten. Man weiß von ihm, daß er innerhalb der Grenzen, die ihm von seiner Obrigkeit (wie von seiner eigenen Natur) gezogen sind, die Sache der Juden warm und ehrlich verficht. Daß er die Einwanderung in dem Sinne zu regeln trachtet, der der Weltjudenheit – aber auch der zionistischen Kommission – zugleich und vor allem seiner Londoner Oberbehörde genehm ist. Man weiß ferner, daß er den Landkauf fördert, damit die Juden Fuß fassen können.
Aber wo war er, als jene drei armen Juden verurteilt wurden, nur weil sie sich beim letzten Pogrom in Jerusalem 116 mitten im Gewühl befunden hatten, aus dem eine Bombe geflogen kam? Aufs Geratewohl hat man die armseligen Drei aus der Masse herausgeklaubt und eingesperrt. – Obzwar von der Seite der Araber ebenfalls eine Bombe in die Jeschiwa, ins Chaluzhaus der Altstadt geworfen wurde! Schreckliche Geschichten. »Aber nicht so wichtig, eher aufgebauscht. Tumulte, nichts weiter.«
Tumulte? Wirklich nur Tumulte? Mag sein, von London aus betrachtet; wie der Vatikan in solchen Vorkommnissen vielleicht auch weiter nichts sehen mag, als bedauerliche, den Juden aufs Kerbholz zu schreibende Störungen der heiligen Stille in der Stadt Christi.
Auf alle Fälle ist der oberste englische Beamte bemüßigt, mit großer Geschicklichkeit, unendlichem Feingefühl zwischen dem englischen Liberalismus und dem palästinischen Judentum hin und her zu lavieren. Es ist ein schwieriger Posten, den Sir Herbert innehat. Ich glaube kaum, daß es noch einen politischen Posten in der Welt gibt, der so schwierig wäre, – den des Vizekönigs von Indien eingeschlossen, der ja ebenfalls von einem englischen Juden, Lord Reading, das heißt Rufus Isaacs, bekleidet ist.
Den obersten Regierungsposten in Palästina auszufüllen genügte kein Beamter, kein Beamter von noch so hohen Fertigkeiten, Klugheit, Takt und Routine. Ein neuer Moses wäre vonnöten. Ein großer Führer mit den zwei Strahlenbündeln aus der Stirn aufwärts zum Himmel, – nicht in einer Ordensuniform mit Tropenhelm und goldenem Säbel.
Vielleicht war es überhaupt ein Fehler, daß man die oberste Regierungsstelle in Palästina einem Juden anvertraut hat.
Als im Juli neunzehnhundertundzwanzig die Militärverwaltung durch Zivilverwaltung abgelöst wurde, hätte man unter den tüchtigen, erfahrenen und taktfesten Oberbeamten Englands für diesen Posten vielleicht einen dem Zionismus freundlich gesinnten Christen ausfindig machen können. 117 Es gibt ja deren in England nicht wenige. Die Edelsten unter den Christen der angelsächsischen Rasse verstanden und liebten den Gedanken Zions von jeher: Palmerston, Byron, Shelley, Moore, Arthur Balfour. Wie es, aus Gerechtigkeitssinn, Mitleid mit dem Unterdrückten, Empörung gegen den Tyrannen unter den Vornehmsten und Besten der englischen Gesellschaft Philhellenen gab, Pro-Sinnfeiner, Anhänger Ghandis, Mitstreiter für Sowjet-Rußland gibt. Das Volk der Juden, die jüdische Rasse hat sicherlich viele einflußreichen und tatkräftigen Freunde unter den Engländern.
Daß man einen Juden als High Commissioner nach Palästina schickte, war eine weltgeschichtliche Geste. Sie hat Englands Politik nicht gefestigt, auch nicht genügend drapiert. Die Christen in Palästina – und anderswo! – die Araber erwidern diese englische Geste mit einer anderen, nämlich mit ziemlich unverhülltem Fäusteschütteln. »Daß man uns einen Juden hierher geschickt hat, in die Stadt unseres Erlösers,« sagte mir ein englischer Presbyterianer in Jerusalem, »das haben wir Christen wie eine Ohrfeige empfunden. Christus soll hier wohl zum zweitenmal gekreuzigt werden!« In El-Kantara aber, am Suezkanal gab ein dort Wache stehender Tommy einer bekannten Dame, die ihn fragte, ob er gern auf seinem Posten stünde, die charakteristische Antwort: »Er wäre lieber daheim in Tipperary, statt hier die Bahn zu bewachen, die die Engländer gebaut haben und die jetzt ein Jude gekauft hat!«
Die Araber freuen sich über den jüdischen Oberkommissar ebensowenig. Jene Lanze in Bethschean, die aus der Faust des Arabers gegen das hohe gesalbte jüdische Haupt geschleudert wurde, flog aus einem der Haiffaklubs, wo der Nationalismus der Araber unter vatikanischem Segen mit den Orientaspirationen der französisch-syrischen Machtpolitik unter einer Decke spielt, über das gesteckte Ziel hinaus. Sicher ist auch, daß es im englischen Unter- wie Oberhaus erst seit der Balfour-Deklaration eine unverhüllte 118 antisemitische Strömung gibt. Und daß in der Stadt Jerusalem ein antizionistischer Gouverneur, der vielfach angefeindete und verhaßte halb-levantinische Engländer Storrs seine ausgesprochen christliche Sonderpolitik treiben darf.
Im Grunde meint England, wenn's von Palästina spricht, den Suezkanal und nicht das »Nationale Heim der Juden«. Es meint auch die Straße, die von London nach Mesopotamien führt. Es operiert mit realen Werten, wenn es die Juden begünstigt und mit ebensolchen, wenn es, um die gefährlichen Bestrebungen schwer faßbarer Kräfte zu paralysieren, die von Teheran über den Jordan dringen, die vom Süden her die immense Welle Ghandi über Aden nordwärts verpflanzen, Araber-Interessen in den Vordergrund stößt. An dem Zionismus liegt England wohl wenig. Der Chaluz gibt sich keiner Illusion hin in bezug auf die Sentimente der englischen Behörde. – –
Einmal sah ich etwas Symbolisches vor meinen leiblichen Augen sich abrollen: an dem Samstagnachmittag, den ich in jener Kwischgruppe an der Straße Haiffa-Jemma in angeregtem Gespräch mit bulgarischen, deutschen und russischen Genossen verbrachte, hörten wir von unten, vom Strand her, plötzlich das betäubende Geratter eines stoppenden Motors. Einige von unserer Tafelrunde sprangen auf, liefen vor die Baracke. Sie schrien sogleich zu uns herein: »Kommt!« Unten, auf ihrer halbfertigen Straße, war ein mächtiges Automobil zwischen den spitzen Steinen stecken geblieben. Der Chauffeur und zwei Soldaten waren aus dem Wagen gesprungen und begannen die Steine rechts und links vor den vorderen Rädern mit vollen Händen aus dem Weg zu werfen. »Die demolieren unsere Kwisch!« rief man neben mir. »Renn hinunter, schreib die Nummer vom Car auf!!« Schon war einer, ein riesenhafter, bärenbreiter Chaluz, mit gewaltigen Sprüngen unten auf der Straße und redete erregt auf die Soldaten ein. Die aber achteten, als wär er Luft, gar nicht auf ihn, sondern warfen 119 weiter, rechts und links mit vollen Händen die mühsam geglätteten Steine der Kwisch auseinander. Aus dem Automobil war ein englischer General gestiegen; Goldtressen, Khakiuniform, regenbogenfarbige Ordensstreifen, Monokel, Reitstöckchen. Auch er ignorierte unseren Genossen, der erregt auf die Leute einredete, so laut, daß wir ihn hier oben auf dem Hügel hören konnten.
Drei, vier andere waren mit hinuntergelaufen, um ihre Kwisch zu verteidigen. Vor dem Auto starrte nun ein tiefes Loch. Jetzt kurbelte der Chauffeur den Motor an. General und Soldaten stiegen eilig in den Wagen. Der breite, bärenhafte Chaluz pflanzte sich vor dem Wagen auf, die Arme ausgebreitet: »Stop!!«
Das Auto fuhr. Mit Höllengeratter ins Loch, hinauf, im vollen Schwung auf den Chaluz los. Ohne auszuweichen, ohne von seiner Richtung einen Finger breit abzuweichen, fuhr es geradenwegs auf den Menschen los, der dastand, mit offenen Armen seine Arbeit verteidigend. Wäre der Chaluz nicht im letzten Bruchteil der allerletzten Sekunde mit einem Satz zur Seite gesprungen, das Generalsauto hätte ihn kalt überfahren, ohne seinen Kurs zu ändern.
Wir sahen uns an, wir vor der Baracke. Verstanden uns, ohne ein Wort zu wechseln. –
Es gibt Mißvergnügte in Palästina, die von mangelndem Rückgrat, von Ängstlichkeit, ja politischer Unfähigkeit der palästinischen Zionistenbehörde sprechen, wenn bei Verhandlungen dieser mit den Engländern sich wieder ein Echec der Judenschaft ergibt. Wie damals bei der Subventionierung arabischer und Nichtsubventionierung jüdischer Schulen. Wie zuletzt bei der Verteilung von gutem, fruchtbarem und als Hinterland der bedrohten galiläischen Siedlungen besonders wichtigem Regierungsboden aus altem Sultansbesitz im Jesreelgebiet – an nomadische Beduinenfamilien, statt, wie's ursprünglich geplant und halb und halb versprochen war, an ehemalige jüdische Legionäre! 120 Dieser Mißerfolg ist als schwerer Verlust der zionistischen Sache zu buchen, in moralischer wie materieller Hinsicht. Der Boden ist vorzüglich; die Lage der verstreuten jüdischen Siedlungen im Emek durch die neue Nachbarschaft in hohem Maße gefährdet; die Mißachtung für die jüdischen Legionäre hat tief verstimmt. Solche Episoden wiederholen sich.
Die Orientpolitik Englands ist, zumal von Palästina aus gesehen, merkwürdig schwankend, unsicher, widerspruchsvoll geworden; weder Juden noch Araber kennen sich mehr in ihr aus, noch trauen sie ihr. Die jüdische Arbeit leidet unter dieser Unberechenbarkeit; die Spannung zwischen Rassen, Volksgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften wächst; Unbehagen und stete Irritation. –
Im letzten Jahr hat Sir Samuel in Jerusalem eine Rabbiner-Versammlung aus Vertretern der verschiedensten Richtungen, eine Art Synhedrion einberufen und mit nachdrücklicher Feierlichkeit eröffnet. Dem Judentum in Palästina sollte, das war wohl die Absicht der Engländer, eine Art geistlicher Behörde geschaffen werden. Jetzt besteht eine weltliche Mittelbehörde zwischen der englischen Regierung und der Judenschaft Palästinas, ein aus drei Köpfen bestehender »Nationalrat«, dessen Vorsitz Doktor Jacob Thon führt und dessen Mitglieder David Yellin, der zweite Bürgermeister Jerusalems und Ben Zwi, einer der Führer der palästinischen Sozialisten sind. Es ist eine weltliche, politische Vertretung der Juden. Soviel ich gehört habe, besitzt sie geringen Einfluß auf die Entschlüsse und Entscheidungen der Regierung; ihre Tätigkeit ist mehr eine informatorische.
Als die Frage aufgeworfen worden war, wer die Nachfolge der Türken in Palästina antreten, welche von den in Palästina ansässigen Nationalitäten, Glaubensgemeinschaften die Führung übernehmen solle, da war die Rede ursprünglich von einer Internationalisierung des Landes, sodann von einem Kondominium zweier Mächte. Für die Juden war es wünschenswert, daß England die Macht über 121 Palästina behalte, weil es Sympathien für das Judentum besaß und die wichtige Fähigkeit, zu kolonisieren, wenn auch mit wenig einwandfreien Mitteln.
Bis heute ist die Frage: ob England das Mandat über Palästina erhalten oder nur Schutzmacht bleiben werde, ungelöst. Nebenbei bemerkt, ist diese Frage auch nur von zeitlich beschränkter Bedeutung. Mit dem Fall des imperialistischen Gedankens wird ja auch das Problem der Kolonisierung in sich zusammensinken. Die Macht imperialistisch regierter Völker, Kolonien zu halten, zu unterhalten, ist im Schwinden und wird bald ganz hinfällig sein. –
Die Juden erstreben in Palästina gewiß keinen jüdischen Staat, sondern eine jüdische Autonomie, aus der sich ein jüdisches Palästina entwickeln könnte. Sie werden, wie ich es wiederholen muß, durch die Undurchsichtigkeit von Englands Orientpolitik in ihrem geordneten Aufbau, den Möglichkeiten einer ruhigen Entwicklung und Festigung ebenso schwer behindert, wie in ihren primitivsten Arbeiten, Einwanderung, Kolonisation usw. durch den zuweilen katastrophalen Geldmangel.
Es gibt Pessimisten, die bereits strategische Untersuchungen über den künftigen Schauplatz eines englisch-französischen Konfliktes in Palästina anstellen. Andere, noch schwärzer Sehende prophezeien eine Sturmflut, die die Völker des Ostens gegen den am weitesten vorgeschobenen Posten europäischer Kultur werfen werde, nämlich gegen das palästinensische Judentum, das dabei überrannt und auf der Strecke liegenbleiben soll. –
Oft mußte ich mich, wenn Nöte, Gefahren, die alpähnliche Schwere der Arbeit in Palästina vor meinen Gedanken aufstiegen, über mir zusammenzuschlagen drohten, an die alte talmudische Legende erinnern: Schiffbrüchige retten sich auf eine kahle Insel mitten im Meer. Der Boden ist harter Fels. Schütter wachsen hier und dort Moosbüschel. Die armen Siedler beginnen ihr Leben, arbeiten so gut es geht. Nach Zeiten schweren Kampfes mit dem Boden, 122 während sie ein Feuer anzünden, um sich zu erwärmen, setzt sich die Insel plötzlich in Bewegung und schwimmt mit ihnen fort. Die Insel war der Rücken eines Fisches.
Dieses Bild, diese Legende kam mir in den Sinn, betrachtete ich in Palästina das Leben, die Arbeit der Juden. Aber ist der Fisch, der davonschwimmt, Palästina? Er ist die ganze, heutige Welt.
Winston Churchill hat vor einem Jahr in Jerusalem eine Ansprache gehalten und folgendes aus der Schule geplaudert: »Es gebe im heutigen Judentum drei Tendenzen: Konservatismus, Zionismus, Bolschewismus. England wolle die beiden ersten benutzen, um die letzte wirksam zu bekämpfen.« –
Genossen der radikalen Richtung sagten mir: »Die jüdische Weltbourgeoisie bereite sich, im Dienste und unter dem Protektorat des englischen kapitalistischen Imperialismus, in Palästina ihr künftiges Heim vor, – die Chaluzim seien, ohne es zu wissen, vorerst ausgenutzte, später beiseitegeschobene Pioniere der jüdischen Weltbourgeoisie.« –
Das alles mag kraß und gewalttätig übertrieben sein, im Gedanken wie im Ausdruck. Vielleicht irren sich beide, der englische Imperialismus, die jüdische Weltbourgeoisie, wenn sie mit dem Chaluz für irgendwelche mehr oder minder versteckten Ziele operieren. Vielleicht verschlingt die dritte, befehdete Tendenz im Judentum zuletzt doch noch englischen Imperialismus, jüdische Bourgeoisie mitsamt all den Neunmalweisen und Neunmalmächtigen dieser Zeit, – die kein Rechenexempel ist. Keins, das so restlos aufgeht, wie jene es ausgeklügelt haben. –
Sicher ist, daß niemand unter den aktiven Sozialisten, den Sozialisten, die die Aktion als Notwendigkeit der Zeit erkannt haben, nach Palästina geht. Europa, Amerika sind und bleiben der Schauplatz der kommenden entscheidenden Klassenkämpfe. Jene »Boruchows«, konsequente Anhänger der dritten Internationale, bilden, einstweilen im Schatten, 123 die Zelle. Sie warten Hereindringen, Erstarken, Überwuchern des Weltkapitalismus, das Aufsaugen der arbeitenden Massen zum geeinten Proletariat ab, um im weltgeschichtlichen Augenblick, in dem die Entwicklung den Orient mitsamt Palästina mitgerissen haben wird, an Ort und Stelle zu sein, das Nötige zu unternehmen.
Schwer begreiflich: wie man Zionist sein und nicht nach Palästina gehen mag. Bist du Zionist, so ist dein Platz nicht in Europa, nicht in Amerika, allein in Palästina. Zionisten im Galuth kommen mir zuweilen vor wie Mitglieder einer wissenschaftlichen Gesellschaft, eines Vereins von Amateuren, der eine Südpol-Expedition ausrüstet.
Wer aus Palästina zurückkehrt, wundert sich über die schier uferlose Fülle des um die Kernfrage des Zionismus: das Leben und die Arbeit der Siedler in Palästina herum Gesprochenen, Geschriebenen, Phantasierten. Der Zionismus ist nachgerade ein Tummelplatz für literarische Übungen, Organisationssucht, Vereinsmeierei geworden; die sozialen, die politischen und nichtpolitischen Parteien innerhalb des Galuthjudentums leben sich auf diesem Tummelplatz aus, reiben sich aneinander, bringen Konfliktsstoffe zur Explosion, schlagen ihre Schlachten. Die unerhörte Vielfältigkeit der Probleme, die sich um die Idee Palästina gruppieren, erschreckte und verblüffte auf dem Karlsbader Zionistenkongreß, – und doch ist der Zionismus so einfach, natürlich, kristallklar, sieht man ihn an Ort und Stelle in Wirksamkeit: Arbeit, Glaube, Gefahr, – Opfer.
Der Galuthzionismus hat seine Berechtigung allein in dem positiven und unmittelbaren Dienst, den er jenen Arbeitenden, Gläubigen, Gefährdeten, sich für das Große Opfernden zwischen dem Mittelländischen Meer und dem Jordan leisten kann. –
Ich habe vor anderthalb Jahren mit manchem jüdischen Volkskommissar im Moskauer Kreml über die Frage des 124 Zionismus, und die Stellung der Bolschewiki zu den in Rußland verbliebenen und auch zu den nach Palästina ausgewanderten russischen Zionisten gesprochen. Einer der klügsten, leichtzüngigsten dieser Kommissäre verriet mir: es sei nicht ausschließlich der Nationalismus, den sie den Zionisten verübelten, – sondern auch der Umstand, daß so viele starke und gläubige Menschen, die ja im Grunde das Gleiche wollten, worum Rußland mit der Welt ringt, sich freiwillig in ein Exil begeben, fern vom Schuß, abseits von der entscheidenden Bewegung, von der sie doch abhängig sind und einst Nutzen ziehen werden; und daß Rußland dadurch soviel bitter nötige, bedeutungsvolle Kraft verlorengeht.
Hie und da bin ich auch in Palästina, und gerade bei den dem Lande auf treueste, tiefste Weise Hingegebenen einem heimlich verwurzelten Zweifel begegnet: ob soviel Energie nicht an unüberwindliche Widerstände vergeudet sei, nicht in Europa, im Zentrum des großen Geschehens besser, intensiver und mit stärkerer Wirkung verwendet wäre.
Während das offizielle Palästina von der Balance der Großmächte und ihrer Orientpolitik abhängig ist, hat der Sozialismus in Palästina einzig und allein die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Umwandlung zur Voraussetzung, die sich jetzt in Europa und Amerika vollzieht.
Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß nur eine große, soziale Umwälzung, wie die es ist, die die dritte Internationale anstrebt, den tückischen und verhängnisvollen Kampf zwischen Arabern, Juden und Christen wird beenden können – zugleich mit der Niederringung des Weltimperialismus, der hinter diesen Kämpfen steht, sie schürt, sie benutzt. Unter der Sowjetherrschaft verstummte mit einem Schlag der jahrhundertealte Krieg zwischen Tartaren, Grusiniern, Bucharen, Armeniern. Der Sozialismus weist den einzigen Weg zur Schlichtung, zur Aufhebung nationalistischer Fehden. Allerdings sind die Völker des Orients vom Sozialismus noch weit entfernt.
125 Über den Weltentwicklungen der Politik, der sozialen Zusammenhänge aber steht die große utopische Gemeinschaftsidee der neuen Menschheit, die sich gegenwärtig in Palästina regt, in Seelen, die geringen Zusammenhang mit dem aktiven Weltprozeß dieser Zeit haben. Die Idee, die hier in Leben und Wirklichkeit umgesetzt wird, könnte indes ihren im Mystischen ruhenden Einfluß auf jenen Weltprozeß ausüben. Der religiöse Sozialismus Palästinas ist zeitlos, von keinem zeitlichen Maß bedingt.
Eine der stereotypen Fragen, die man in Palästina von Nichtjuden immer wieder zu hören bekommt, ist:
»Why are jews so excited?«
Warum sind die Juden so aufgeregt? Was ist das für eine ewig erregte, ewig unruhige, ewig unzufriedene Rasse!!
Man ruft den Juden zu: Ihr macht viel zu viel Lärm in der Welt um Palästina. Ihr müßt es wohl tun, um Geld für das Land zu bekommen. Aber ihr dürft es andererseits nicht tun, denn die Araber fühlen sich durch dieses andauernde Weltgeschrei irritiert und beunruhigt.
In gewisser Beziehung ist die Anklage berechtigt. Echt jüdisch: alles muß auf einmal erreicht sein; das jüdische Kleinbürgertum womöglich in drei Monaten zum Ackerbau umerzogen werden; die Exekutive soll im Handumdrehen perfekt funktionieren; die Widerstände sind enorm – zugegeben – aber warum funktioniert sie nicht wie ein Uhrwerk, diese Exekutive? warum schwankt sie – wie die englische Regierung zwischen Juden und Arabern – zwischen den Radikalen und den Orthodoxen, der Gduth und den Misrachi; warum ist zwischen den Extremen das Zentrum der Exekutive so schwach?
Echt jüdisch: nach zweitausendjähriger Unterdrückung soll die Selbstherrlichkeit des Handelns, der Kraftentfaltung und Betonung der eigenen Autorität in der Welt sich über Nacht einstellen. Die Utopie zur Wirklichkeit werden, ohne Verzug. –
126 Palästina ist in der Tat ein erhitztes, überreiztes Land; bis an den Rand angefüllt mit höchster Intelligenz, Begeisterung, Glut des Glaubens und Wollens, Spannkraft der Seelen. Oft ist es einem, als sollte die aufgestapelte, zusammengedrängte Energie der Rasse das kleine Land wie Dynamit sprengen.
Überschwengliches Verantwortungsgefühl, aber auch engherziger Fanatismus überschlagen sich zuweilen; ein junger Mensch steht auf vor meiner Erinnerung. Er kam in Tel-Awiw zu mir; nannte sich, wie die meisten, die sich in Palästina festsetzen, mit hebräischem Vatersnamen, hatte seinen europäischen mitsamt seinem Doktortitel abgelegt und vergessen. Er gehörte jener radikalsten Gruppe der »Haschomer Hazair« an, die jetzt nach Nurriss soll. Ich sprach mit ihm über Landauer, Eisner, Lewine, Trotzki, Luxemburg. Er fuhr auf: »Abtrünnige, Verirrte, die ihr eignes Volk verlassen haben!« Er sagte noch: »Vermessene, hochmütige Juden, die sich zutrauen, Führer der Allgemeinheit sein zu können!« Aber im Grunde meinte er: sie alle, Trotzki, Landauer, Luxemburg seien zu gut dazu, um Führer einer vagen Masse aus Juden und Christen und Heiden zu sein, – was heute allein nottue, Beruf und Pflicht jedes Juden sei: für den Juden, das Judentum zu kämpfen und zu sterben. –
Keinem Menschen steht das Recht der Entscheidung zu: ob diese Menschen in Palästina ihre Kraft nicht besser in Europa hätten verwenden können, nicht besser getan hätten, in Europa zu bleiben, als nach dem steinigen Urväterland auszuwandern.
Palästina beweist, daß in der heutigen Welt reinster Wille zum religiösen Kommunismus lebt. Hätte ich, vor einem Jahr, aus Rußland Zweifel an der Idee des Kommunismus heimgebracht, Palästina hätte mir die Sicherheit wiedergegeben. Die Idee lebt. Alle Klassen des zivilisierten Weltjudentums arbeiten an diesem Kulturideal Zions, unbewußt jene dem Kommunismus am stärksten 127 widerstrebenden amerikanischen kapitalistischen Geldgeber, bewußt der sich proletarisierende Chaluz auf den Ebenen, in den Bergen Erez Israels. Der Opfermut dieser kleinen, erlesenen Schar, der biblischen kleinen Herde, von der das Evangelium Johannis spricht, strahlt zurück auf das verstreute Volk der Juden in der Diaspora, – nicht anders, als ehedem der Geist der französischen Humanisten, der deutschen Philosophen, in der Gegenwart der Geist Moskaus auf die Welt zurückstrahlt, Kräfte entwickelt, ans Licht hebt.
Aber dies ist's nicht allein, was im heutigen Palästina brauend, neblig, unsicher, unheimlich sich vorbereitet.
Dies nicht allein.
Oft, auf den Achat- und Onyx-Pfaden, die zum Ölberg hinaufführen, oft im Tal Josaphat, auf der Brücke über dem Gehinnom, oft auch am Ufer des stillen Genezarethsees oder in einem Zelt, einer Baracke mitten in Einöden, auf steilem Berggrat, an der Straße – in Zelten, Baracken, die vom fröhlichen Lärm des Freitagabends widerhallten – überfiel mich plötzlich kalter Schauer, ein Entsetzen, Ahnung hoher, überirdischer Dinge.
In prophetischen Büchern und Gesängen, der Schrift – die heute mehr Menschen und ernstere durchforschen als je zuvor – ist von einer Märtyrerklasse, einer Märtyrerschar, von Israeliten im Fleische und im Geiste die Rede, die am Eingang einer neuen Zeit die Schwelle hüten. Die neue Zeit ist das Reich jenes, der kommen wird. Und jene Schar, jene Klasse von Israeliten wird die Schwelle mit ihrem Blute röter färben, als der Sonnenaufgang rot war über ihm, der auf silbernem Eslein durch das Tor der Heiligen Stadt geritten ist, über dem, der mit hellem Turban auf taubenweißem Zelter durch das östliche Tor in die Stadt sprengte. Opfertod soll das Reich jenes bereiten, dessen Kommen prophetische Worte und Sätze künden, wie es je und je bereitet wurde, bereitet wird, 128 durch das Leben und Sterben der Edelsten, in denen der Funke am hellsten glüht.
Das uralt neue, Jahrtausend um Jahrtausend am Horizont des Menschheitsgeschehens neu aufleuchtende Paradies der Verbrüderung, der Milde, Gerechtigkeit, des jüdisch-christlichen Kommunismus steigt auf im Osten, überschattet mit seiner Fata Morgana die sichtbare Welt, die ihren Glanz verliert. Die Träger des uralt neuen, ewigen Gesetzes, die herrlichen jungen Juden Palästinas stehen, Pflug und Gewehr in starker Faust, Liebe und Gerechtigkeit auf den Stirnen, an der Schwelle der neuen, furchtbaren Epoche. Sollen sie die Märtyrerklasse, die erlauchte Schar sein, die das Opfer bringt?
Ist das die tiefe, unerklärliche, metaphysische Ursache, die ein Volk nach dem Punkt des Erdballs ziehen heißt, wo sich sein Verhängnis erfüllen soll? Ist das die Ursache des Dranges, des Stromes, des sich stauenden, stockenden, wieder losbrechenden, unhemmbaren Zuges der Besten, Reinsten, der Erlesenen nach Erez Israel?
Sei getrost, du kleine Herde.
Gott ist mit dir.
In der alten Heiligen Stadt, unweit der Stelle, wo einst der Tempel sich erhob, in verfallenes Gemäuer gebettet, ruht ein kleiner Teich: der Teich Bethesda, heute Birket Israin, »Teich Israels« genannt. Sein Spiegel ist klar. Das Wasser still. Woher kommt es? Eine unterirdische Quelle speist den kleinen Teich, leitet das Wasser hinauf zwischen das Gemäuer, hebt es nicht, senkt es nicht, hält es stets auf gleicher Höhe. Der Spiegel ist klar.
Hie und da aber bemächtigt sich des kleinen Teiches unerklärliche Bewegung. Sein Wasser schäumt auf, wirft Wellen, schlägt stürmisch an die Mauern, die es einfassen.
Dann kommen Krüppel aller Art, Blinde, Lahme, Elende aus der ganzen Stadt herbeigelaufen, drängen sich weinend 129 und wehklagend ins Gemäuer. Der Engel!! Der Engel hat das Wasser berührt!!
Krüppel, Kranke, Unglückliche steigen ins Wasser des kleinen Teiches, das mit einemmal Heilkraft gewonnen hat. Sie steigen tief in das Wasser hinunter, entsteigen ihm als Gesunde. Das Wunder des Glaubens, der Engel selber hat sie berührt. Der Teich Israels hat sie geheilt.
Solch ein Teich Israels, solch ein Teich Bethesda, aus unterirdischer, geheimnisvoller Quelle gespeist, ist das heutige jüdische Palästina. Lange ruhte es still. Jetzt hat der Engel es berührt.
In dieses aufgerührte, vom Engel berührte Bad möge das Judentum der Welt steigen und dort Genesung finden.