
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Deutsch von Alexander Eliasberg
Im Vergleich zu Leo Tolstoi, der mütterlicherseits vom heiligen Großfürsten Michael von Tschernigow, den die Tataren zu Tode gemartert hatten, abstammte, und väterlicherseits von Pjotr Andrejewitsch Tolstoi, dem Liebling Peters des Großen, dem Vorsteher der Geheimen Kanzlei und dem Häscher des Zarewitsch Alexej, – war Dostojewski, der Sohn eines Stabsarztes und einer Kaufmannstochter, geboren zu Moskau im Armenspital im Stadtteile Boschedomka, am äußersten Ende der Stadt, in der Tat das Mitglied einer »zufälligen Familie«. Der erste Eindruck seiner Kindheit war, wenn nicht direkt Armut, so doch jedenfalls große Beschränkung. Die Familie hauste mit fünf Kindern in einer Wohnung, die außer Flur und Küche eigentlich nur zwei Zimmer hatte. Der hintere Teil des Flurs, der nur von einem Fenster erleuchtet wurde, war durch eine dünne Bretterwand abgeteilt, und der auf diese Weise gewonnene halbfinstere Raum diente den beiden ältesten Brüdern, Michael und Fjodor als Kinderzimmer. Einer der Brüder, Andrej Michailowitsch, berichtet: »Unser Vater wiederholte gerne, daß er ein armer Mann sei, daß seine Kinder, besonders aber die Söhne, sich selbst ihren Weg bahnen müssen und nach seinem Tode an den Bettelstab kommen würden.« Im Jahre 1838 schrieb Dostojewski aus der Ingenieurschule: »Mein lieber guter Vater! Können Sie denn wirklich denken, daß Ihr Sohn zuviel verlangt, wenn er Sie um eine Unterstützung angeht?«
»Ich will aber Ihre Notlage berücksichtigen und gänzlich auf Tee verzichten,« heißt es in diesem Briefe weiter. Fast zu derselben Zeit schreibt er seinem Bruder: »Du klagst über deine Armut. Auch ich bin nicht reich. Du wirst mir wohl gar nicht glauben wollen, daß ich beim Auszug aus dem Lager nicht eine Kopeke besaß; unterwegs hatte ich mich erkältet (es regnete den ganzen Tag, und wir waren ohne Obdach); ich war krank vor Hunger und hatte dabei kein Geld, um mir die Kehle mit einem Schluck Tee anzufeuchten.«
So beginnt das Leben Dostojewskis in Armut, mit der ihn sein Schicksal bis an sein Lebensende verfolgte und die weniger auf äußeren Umständen als auf seinen inneren Eigenschaften beruhte. Es gibt Menschen, die kein Geld auszugeben verstehen und denen das Sparen ein natürliches, sogar von ihrem Willen unabhängiges Gesetz ist; es gibt andere Menschen, die nicht zu sparen verstehen und deren ebenso natürliche Eigenschaft die Verschwendungssucht ist.
Nach dem Zeugnis seines Bruders wußte Fjodor Michailowitsch niemals, »wieviel er von allem besaß«, – von Geld, Kleidern und Wäschestücken. Dr. Riesenkampf, ein Deutscher, der auf Ersuchen eben dieses Bruders im Jahre 1843 mit Dostojewski in Petersburg zusammenwohnte und seinen Wohnungsgenossen an deutsche Genauigkeit zu gewöhnen suchte, »traf Fjodor Michailowitsch in folgendem Zustande an: er besaß keine Kopeke Geld und ernährte sich von Milch und Brot, die er dazu noch auf Pump bezog.« – Dr. Riesenkampf berichtet: »Fjodor Michailowitsch gehörte zu den Menschen, in deren Gesellschaft man gut lebt, die aber selbst ständig Not leiden. Man bestahl ihn ganz ohne Erbarmen, er war aber in seiner Vertrauensseligkeit und Gutmütigkeit nie zu bewegen, der Sache auf die Spur zu kommen und die Dienerschaft und deren Anhang, die alle von seiner Sorglosigkeit profitierten, des Diebstahls zu bezichtigen.« – »Sogar das Zusammenleben mit dem Doktor,« fügt der Biograph hinzu, »wäre für Dostojewski beinahe zu einer ewigen Quelle neuer Auslagen geworden. Er war bereit, jeden Bettler, der zum Doktor als Patient kam, als einen lieben Gast aufzunehmen.«
Leo Tolstoi erzählt in seinem Bericht von der Volkszählung, daß er im Ljapinschen Nachtasyle vergeblich nach genügend armen und einer Unterstützung würdigen Leuten gesucht hätte, unter die er siebenunddreißig Rubel, den Rest der ihm von reichen Moskauer Wohltätern zu diesem Zweck anvertrauten Summe verteilen könnte. Man darf wohl mit Bestimmtheit behaupten, daß Dostojewski eine ähnliche Aufgabe ohne Schwierigkeiten bewältigt hätte.
Es ist überhaupt interessant, diese natürliche Freigebigkeit Dostojewskis, seine Fähigkeit, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen, mit der ebenso natürlichen, wenn nicht Sparsamkeit, so doch jedenfalls Unfähigkeit, Geld zu verschwenden, Tolstois zu vergleichen. Bei dem einen wie bei dem andern sind diese Eigenschaften außerhalb des Willens und des Bewußtseins begründet. Der eine ist als Ansammler von Gütern und Hauswirt geboren, der andere – als Verschwender und ewig obdachloser Wanderer.
Dostojewski hatte gar nicht nötig, sich immer vorzuhalten, daß Geld etwas Böses sei, und daß man sich von jedem Besitz lossagen müsse: er litt bittere Not und legte dem Geld, wenigstens in seinem Bewußtsein, große Bedeutung bei, so oft er aber welches in Händen hatte, ging er damit so um, als ob es für ihn nicht einmal etwas Böses, sondern purer Unsinn wäre. Er liebte das Geld, oder bildete sich ein, es zu lieben; doch das Geld liebte ihn nicht. Tolstoi haßte das Geld, oder glaubte es zu hassen; doch das Geld liebte ihn und kam von selbst in seine Hände.
Man kann, übrigens nicht nur in bezug auf Geld, sondern auch auf alle andern irdischen Güter im Schicksale Tolstois das Walten einer anziehenden und im Schicksale Dostojewskis einer abstoßenden Kraft erkennen. Dostojewski wußte anscheinend selbst um die Existenz dieser unheilvollen Macht in seinem Leben; er pflegte aber alle seine Leiden den Mängeln seines eigenen Wesens, seiner »Lasterhaftigkeit« zuzuschreiben. »Ich habe ein entsetzliches Laster,« gesteht er seinem Bruder, »ich bin unerlaubt egoistisch und ehrgeizig.« – »Ich bin so ehrgeizig, als ob man mir die Haut vom Leibe gezogen hätte, und jeder Lufthauch tut mir weh,« sagt der Held der Erzählung: »Aus dem dunkelsten Winkel der Großstadt«, der in mancher Beziehung an Dostojewski erinnert. – »Turgenjew und Bjelinski haben mich neulich wegen meines unordentlichen Lebenswandels ausgeschimpft.« – »Ich bin nervenkrank und befürchte ein Nervenfieber. Ich bin so liederlich, daß ich gar nicht mehr ordentlich leben kann.« In ähnlichen Geständnissen steckt aber wohl kaum echte Reue. Es sind eher etwas traurige und erstaunte Selbstbetrachtungen. »Weiß der Teufel,« bemerkt er, »wenn du mir etwas Gutes gibst, mache ich mit meinem Charakter ganz bestimmt das Schlechteste daraus.« Ein anderes Mal, nach vielen Jahren, sagt er anläßlich seiner Verluste im Roulette zu Baden-Baden: »In allen Dingen gehe ich bis an die äußersten Grenzen; mein Leben lang habe ich nie Maß halten können.« Dies ist es vielleicht, was die Weisheit unserer Zeit, die so sehr alle »äußersten Grenzen« fürchtet, Dostojewski nicht verzeihen konnte.
»Wenn du mir etwas Gutes gibst, mache ich mit meinem Charakter ganz bestimmt das Schlechteste daraus« – die Richtigkeit dieser Selbstbetrachtung zeigte sich, wie mir scheint, besonders deutlich in der Petraschewski-Affäre, die Dostojewski so teuer zu stehen kam.
Man kann sich unmöglich vorstellen, was ihn in diese Sache hineingezogen hat. Sozialistische Utopien waren seiner Natur nicht nur fremd, sondern direkt zuwider. Was ihm schon damals den stärksten Widerwillen gegen den Sozialismus einflößte und ihn zugleich veranlaßte, seine Aufmerksamkeit den Versuchen der modernen Menschheit, ein irdisches Leben ohne Gott und ohne Religion aufzubauen, zuzuwenden, – war der moralische Materialismus dieser Lehre. Nach dem Berichte eines Augenzeugen machte Petraschewski auf Fjodor Michailowitsch einen abstoßenden Eindruck, »weil er Atheist war und sich über die Religion lustig machte«. Auch die leichtsinnigen Anschauungen Bjelinskis über die Religion weckten in Dostojewski jenen grenzenlosen, blinden Haß, der in ihm auch nach vielen Jahren mit neuer Kraft aufloderte, so oft er an Bjelinski, diese angeblich »ekelhafteste, stumpfsinnigste und schändlichste Erscheinung des russischen Lebens«, dachte. In seinem »Tagebuch« vom Jahre 1873 gibt er sehr boshaft und geistreich den angeblich spöttischen, in der Tat aber nur, wenn ich nicht ein anderes Wort gebrauchen soll, einfältigen Bericht Bjelinskis über ihre philosophischen Gespräche wieder, in denen der russische Kritiker den späteren Schöpfer des »Idioten« zum Atheismus zu bekehren suchte. »So oft ich Christus erwähne,« erzählt Bjelinski, »verändert sich sein Gesichtsausdruck, als ob er weinen wollte.« – »›Glauben Sie mir. Sie naiver Mensch‹, fiel Bjelinski wieder über mich her,« sagt Dostojewski in seinen Erinnerungen, »›Glauben Sie mir: wäre Ihr Christus in unseren Tagen zur Welt gekommen, so wäre er der unscheinbarste und gewöhnlichste Mensch geworden; bei der modernen Wissenschaft und den treibenden Kräften der heutigen Menschheit, hätte er sich gar nicht behaupten können‹«. – »Dieser Mensch beschimpfte in einem Gespräch mit mir Christus!« Dostojewski kann sich selbst nach dreißig Jahren nicht beherrschen und wütet, als ob das Gespräch erst am Vorabend stattgefunden hätte. »Dieser Mensch beschimpfte Christus, und doch hätte er es nie unternehmen können, sich selbst und alle die Leute, die die Welt bewegen, mit Christus zu vergleichen. Er konnte unmöglich einsehen, wie kleinlich, gehässig, ungeduldig, gemein und vor allen Dingen ehrgeizig sie alle sind. Er hat sich nie die Frage vorgelegt: Was könnten wir denn an seine Stelle setzen? Doch nicht uns selbst, die wir so schlecht sind? Nein, er hat sich nie irgendwelche Gedanken über seine eigene Schlechtigkeit gemacht; er war mit sich im höchsten Grade zufrieden, und darin äußert sich eben der niederträchtige, schändliche Stumpfsinn seiner Person.«
Wenn also jemand am Sozialismus, wenigstens an dem, den die damalige Regierung verfolgte, unschuldig war, so war es natürlich Dostojewski. Er wurde zum Märtyrer einer Sache, an die er keinen Augenblick glaubte, die er vielmehr mit seiner ganzen Seelenkraft haßte, und wäre um dieser Sache wegen beinahe zugrunde gegangen. Was zog ihn denn so zu diesen Leuten hin? Vielleicht dasselbe, was ihn sein ganzes Leben lang gezwungen hatte, so sehr nach dem Schwierigsten, Unglücklichsten, Grausamsten und Schrecklichsten zu streben, als ob er ahnte, daß er ein Martyrium durchmachen müsse, um das volle Maß seiner Kräfte zu erreichen? Oder war es nur ein »Überschreiten der äußersten Grenzen« und ein Spielen mit der Gefahr mitten unter politischen Verschwörern, wie er auch immer und überall mit der Gefahr spielte, – später im Kartenspiel, in der Wollust, in mystischen Schrecken?
Acht Monate saß er in der Peter-Pauls-Festung. Einer seiner Genossen begann in der Gefangenschaft den Verstand zu verlieren. Fjodor Michailowitsch las aber in der Festung zwei Beschreibungen von Reisen ins Heilige Land und die Werke des heiligen Demetrius von Rostow. »Die letzteren,« schreibt er, »haben mich sehr interessiert.« Er erwartete die Verkündung des Todesurteils und bekam es auch tatsächlich zu hören.
»Als man die Verurteilten nach dem Ssemjonowschen Platze gebracht und drei von ihnen an die Pfosten gebunden hatte,« berichtet Speschnjow, »war Fjodor Michailowitsch zwar tief erschüttert, verlor aber nicht die Fassung. Er war bleich, bestieg aber ziemlich rasch das Schafott; er zeigte eher nervöse Hast, als Gebrochenheit. Man wartete nur noch auf das Kommando »Feuer!«, und alles wäre vollbracht. In diesem Augenblick winkte man mit einem Tuch, und die Hinrichtung wurde sistiert. Als man aber Grigorjew, – es war derselbe, der noch in der Festung den Verstand zu verlieren begonnen hatte, vom Pfosten losband, wurde er blaß wie der Tod und verlor endgültig den Verstand.« Nach dem Zeugnis eines der Delinquenten »wurde die Nachricht von der Begnadigung von vielen durchaus nicht als ein Glück, sondern eher als Beleidigung aufgenommen«, oder, wie sich Dostojewski später ausdrückte, »als eine häßliche und überflüssige Beschimpfung«.
Diese Augenblicke, die Dostojewski in Erwartung eines nicht nur wahrscheinlichen, sondern ihm in fünf Minuten bestimmt bevorstehenden Todes verbracht hatte, hatten seinem ganzen späteren geistigen Leben ein unauslöschliches Mal aufgeprägt; sie hatten gleichsam den Gesichtswinkel, unter dem er die ganze Welt betrachtete, verschoben: er hatte etwas begriffen, was ein Mensch, der nie in Erwartung eines sicheren Todes geschwebt hat, unmöglich begreifen kann. Das Schicksal hatte ihm eine gewisse große Erkenntnis verliehen, eine seltene Erfahrung, ein neues Maß für alles Sein; und diese Gaben gingen nicht verloren, sondern wurden von ihm zu erstaunlichen Entdeckungen ausgenützt. »Denken Sie mal nach,« sagt Dostojewski durch den Mund seines »Idioten«: »Nun, nehmen Sie zum Beispiel die Folter: da gibt es Schmerzen und Wunden, körperliche Qual, die aber lenkt einen doch von den seelischen Qualen ab, so daß einen bis zum Augenblick des Todes nur die Wunden quälen. Den größten, den quälendsten Schmerz aber verursachen vielleicht doch nicht die Wunden, sondern das Bewußtsein dessen, daß, wie man genau weiß, nach einer Stunde, dann nur nach zehn Minuten, dann nach einer halben Minute, sogleich, noch in diesem Augenblick – die Seele den Körper verlassen wird, und daß du dann kein Mensch mehr sein wirst, und daß es doch unfehlbar geschehen muß. Das Entsetzliche ist ja gerade dieses ›Unfehlbar‹. Gerade wenn man den Kopf unter das Messer beugt und dann hört, wie es von oben klirrend herabglitscht – gerade diese Viertelsekunden müssen die furchtbarsten sein! . . . Wer hat es denn gesagt, daß die menschliche Natur fähig sei, diesen Tod ohne die geringste Geistesverwirrung zu ertragen? Und wozu diese häßliche, überflüssige, so unglaublich überflüssige Beschimpfung des Menschen? Vielleicht gibt es irgendwo einen Menschen, dem das Todesurteil verlesen worden ist, der diese Qualen bis zum letzten Augenblick durchkostet und dem man dann gesagt hat: ›Geh, dir ist die Strafe erlassen.‹ Ja, solch einer könnte dann vielleicht erzählen. Von diesen Qualen und diesem Entsetzen hat auch Christus gesprochen.«
Die Zuchthausstrafe ertrug er mit großer Demut. Er beklagte sich nicht und liebte es nicht, wenn ihm die andern ihr Mitleid zeigten. Er bemühte sich, seine Erinnerungen an das Zuchthaus ebenso zu veredeln und zu idealisieren, wie die Erinnerungen an seine Kindheit; er sah in der Strafe eine strenge, aber heilsame Lehre, ohne die er keinen Ausweg zu einem neuen Leben hätte finden können. »Ich murre nicht,« schreibt er seinem Bruder aus Sibirien, »dieses ist mein Kreuz, und ich habe es verdient.« Wenn er auch wirklich nicht murrte, so darf man nicht außer acht lassen, was diese Demut ihn kostete.
»Ich war nahe daran, zu verzweifeln. Es ist schwer wiederzugeben, was ich in dieser Zeit alles durchgemacht habe.« – »Diese vier Jahre betrachte ich als eine Zeit, in der ich lebendig begraben, in einem Sarge eingekerkert war. Ich kann dir, lieber Bruder, gar nicht schildern, wie schrecklich diese Zeit gewesen ist. Es war eine unaussprechliche, unendliche Qual, denn jede Stunde und jede Minute lastete wie ein schwerer Stein auf meiner Seele. Während der ganzen vier Jahre gab es keinen Augenblick, in dem ich nicht gefühlt hätte, daß ich im Zuchthause bin. Wenn ich auch hundert Bogen vollschreiben wollte, könnte ich dir doch keinen Begriff von meinem damaligen Leben geben. Denn so etwas muß man zumindest selbst gesehen, – ich sage gar nicht, durchgemacht haben.«
Alles, wonach sich Leo Tolstoi immer sehnte, wonach er strebte und was in seiner Anschauung oft sehr tief gewesen sein mag, doch in die Tat umgesetzt einer Spielerei ähnlich sah: – Verzicht auf den Besitz, körperliche Arbeit, Annäherung an das gemeine Volk, – dies alles mußte Dostojewski in Wirklichkeit durchmachen, und dazu noch mit einer so erdrückenden Härte, wie man sie sich überhaupt nur denken kann.
Der Halbpelz und die Ketten des Zuchthäuslers waren für ihn durchaus kein abstraktes Symbol, sondern ein wirkliches Zeichen seines bürgerlichen Todes und seiner Ausstoßung aus der Gesellschaft. Mag Leo Tolstoi noch so viele Bäume für arme Bauern fällen, mag er noch so viel im Schweiße seines Angesichts pflügen, – es wird immer weniger eine Arbeit, als eine Art Sport, asketische Übung und Gymnastik sein. Ebenso wie ein Mensch, der irgendeinen bestimmten körperlichen Schmerz niemals empfunden hat, ihn sich unmöglich vorstellen kann, so sehr er sich auch Mühe gibt, ihn sich zu vergegenwärtigen, so kann auch derjenige, der niemals wirkliche Not gelitten hat, sie unmöglich verstehen, soviel er auch über sie nachdenkt und diskutiert.
In dieser Hinsicht war Dostojewski glücklicher als Tolstoi. Im ersten Jahre seines Zuchthauslebens mußten die Sträflinge zwei Monate lang Ziegelsteine von den Ufern des Irtysch auf eine Entfernung von etwa siebzig Klafter zu einem Kasernenneubau, über den Festungswall hinüber schleppen. »Diese Arbeit,« erzählt Dostojewski, »gefiel mir sogar nicht übel, obwohl mir der Strick, mit dem ich die Steine tragen mußte, ständig die Schultern wund rieb. Doch die Wahrnehmung, daß diese Arbeit meine körperlichen Kräfte stärkte, machte mir Freude.« Welch ein Unterschied zwischen Dostojewski und dem pflügenden Leo Tolstoi!
Wenn ihm die Wahrnehmung, daß die Arbeit seine körperlichen Kräfte stärkt, Freude macht, so ist es doch keine abstrakte, symbolische Arbeit. Er wußte, daß wenn es ihm einfallen würde, einmal zu dieser Arbeit des Ziegeltragens, die ihm solches Vergnügen bereitete, nicht zu erscheinen, – ihn Flüche und Prügel der Zuchthauswache und Rutenstrafe von der Zuchthausobrigkeit erwarteten.
Leo Tolstoi hatte einmal eine durchaus exakte und richtige, doch für sein ferneres Leben eigentlich ganz unnütze mathematische Rechnung angestellt: nämlich, daß er einem alten Bettler hätte zweitausend Rubel geben müssen, damit seine Gabe den zwei Kopeken des Zimmermanns Ssemjon gleichkäme. Er war sogar im Zweifel, ob er überhaupt berechtigt sei, den Armen zu helfen, und diese Zweifel scheinen von ihm auch heute noch nicht gelöst zu sein. Dem Zuchthäusler Dostojewski konnten solche Zweifel überhaupt nicht kommen. Das Leben selbst hatte sie für ihn gelöst, indem es ihn in eine Lage versetzte, wo er kein Almosen geben, sondern welches empfangen mußte.
»Es war bald nach meiner Ankunft im Zuchthaus,« erzählt Dostojewski. »Ich kehrte von der Morgenarbeit ganz allein mit einem Soldaten unserer Wache zurück, und da begegneten mir unterwegs eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter, einem etwa zehnjährigen Mädchen, das wie ein Engel reizend war. Ich hatte beide schon einmal gesehen. Die Mutter war eine Soldatenwitwe. Ihr Mann, ein junger Soldat, war während seiner Untersuchungshaft im Lazarett gestorben, als auch ich dort in der Gefangenenabteilung lag. Die Frau und sein Töchterchen waren zum Abschied hingekommen, und beide hatten herzbrechend geweint. Als nun die Kleine mich erblickte, errötete sie und flüsterte der Mutter schnell etwas zu; diese blieb sogleich stehen, suchte ihr Schnupftuch hervor, löste den Knoten und gab der Kleinen eine Viertelkopeke, die mir sogleich damit nachgelaufen kam: ›Da, Unglücklicher, nimm um Christi willen dies Kopekchen!‹ sagte sie, indem sie mir gerade vor die Füße lief und sich bemühte, mir die kleine Münze in die Hand zu drücken. Ich nahm ihr ›Kopekchen‹, und die Kleine kehrte vollauf befriedigt zu ihrer Mutter zurück. Ich habe lange die kleine Münze aufbewahrt.« Soviel uns auch die Biographen Tolstois versichern, daß es ganz unwesentlich sei, ob er sein Vermögen auch tatsächlich verteilt habe, denn er habe aufgehört, daraus irgendwelchen Nutzen zu ziehen, müssen wir uns doch sagen, daß Tolstoi wohl nie in seinem Leben jene Scham und jenen Stolz, jenen Schmerz und jene Freude gekannt hat, die Dostojewski, als ihm das Kind das Almosen reichte, empfunden hat.
»Wir standen in der Kirche zusammengedrängt dicht bei der Tür, auf dem letzten Platz, von wo aus man nur die tiefe Stimme des Diakons hörte und hin und wieder den schwarzen Talar und das Silberhaar des Geistlichen sah. Ich dachte daran, wie ich früher als Kind zuweilen auf das am Eingang der Kirche zusammengedrängte Volk geschaut hatte das vor dicken Epauletten zur Seite trat, oder vor einem wohlgenährten Herrn oder einer aufgeputzten, doch sehr frommen Dame, die alle unbedingt zur ersten Reihe strebten und auch dort noch jeden Augenblick bereit waren, um einen besseren Platz zu streiten. Damals hatte es mir geschienen, daß dort am Eingang anders gebetet wurde als bei uns: dort betete man so still und andächtig, mit so aufrichtiger innerer Demut. – Jetzt stand ich selbst auf diesem Platze, ja nicht einmal auf diesem! Wir waren gefesselt und gebrandmarkt, uns mieden alle, und man fürchtete uns sogar. Jedesmal gab man uns Almosen, und ich weiß noch, wie mir das sogar gewissermaßen angenehm war, es lag eine gewisse verfeinerte, ganz besondere Empfindung in diesem eigenartigen Freudegefühl. ›Mag es nur, mag es denn sein, wenn es einmal so ist!‹ dachte ich. Die Sträflinge beteten andächtig und ein jeder von ihnen brachte jedesmal seine armselige Kopeke mit, sei es für ein Licht oder sei es für die Sammelbüchse. ›Auch ich bin doch ein Mensch.‹ dachte oder fühlte er vielleicht, wenn er seine kleine Münze hineinwarf, – ›vor Gott sind alle gleich . . .‹ Das Abendmahl nahmen wir nach dem Frühgottesdienst. Als der Geistliche mit dem Kelch in der Hand die Worte sprach: ›. . . und nimm mich auf wie den Schächer,‹ – da knieten alle mit einem Mal nieder, während die Ketten aufklirrten, denn ein jeder schien die Worte buchstäblich auf sich zu beziehen.«
Diese Erfahrung gab Dostojewski das Recht, später zu behaupten, daß er mit dem einfachen Volk gelebt habe und es gut kenne. Und als er zugleich mit den andern Zuchthäuslern innerlich die Worte nachsprach: »Nimm mich auf wie den Schächer,« so betrachtete er nicht abstrakt, sondern fühlte und maß mit seinem ganzen Wesen den Abgrund, der das einfache Volk von der zivilisierten Gesellschaft trennt; den Abgrund, an dessen Saume Tolstoi in seinen literarischen und moralischen Betrachtungen sein Leben lang dahingeglitten war.
Dostojewski schrieb die Entstehung seiner Epilepsie dem Aufenthalte im Zuchthause zu. Wir wissen aber nach einem andern Zeugnis, daß er an dieser Krankheit schon als Kind gelitten hatte. Der »gewesene Staatsverbrecher Dostojewski« behauptet in seinem Briefe an Kaiser Alexander II., daß seine Krankheit schon im ersten Jahre seines Aufenthaltes im Zuchthause aufgetreten wäre. »Mein Leiden,« fügt er hinzu, »wird immer schlimmer. Bei jedem Anfall verliere ich anscheinend das Bewußtsein und alle seelischen und körperlichen Kräfte. Mich erwartet eine vollständige Lähmung, Tod oder Wahnsinn.« Wir wissen, daß es in seinem Leben wirklich Perioden gegeben hat, wo ihm die Epilepsie mit vollständiger geistiger Umnachtung drohte. »Die epileptischen Anfälle,« berichtet Strachow, »wiederholten sich ungefähr einmal in jedem Monat; das war der gewöhnliche Verlauf der Krankheit. Bisweilen aber, wenn auch nur sehr selten, kamen die Anfälle öfter, sogar zweimal wöchentlich.«
»Einmal,« fährt Strachow in seiner Erzählung fort, »es war, wenn ich nicht irre, im Jahre 1863 am Ostersonnabend, kam er ziemlich spät, etwa gegen elf Uhr, zu mir und wir gerieten in ein lebhaftes Gespräch. Ich erinnere mich nicht mehr, über welchen Gegenstand wir gerade sprachen, aber jedenfalls war es ein sehr wichtiges abstraktes Thema. Fjodor Michailowitsch war sehr aufgeregt und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, während ich am Tische saß. Er sagte irgend etwas Großartiges, Frohes, und als ich seinem Gedanken mit einer Bemerkung beistimmte, da wandte er sich mit begeistertem Gesicht zu mir, mit einem Ausdruck, der deutlich verriet, daß seine Begeisterung ihren höchsten Grad erreicht hatte. Für einen Augenblick blieb er stehen, als suche er nach Worten für seinen Gedanken, und öffnete schon den Mund. Ich sah ihn mit Spannung an, denn ich fühlte, daß er etwas Außergewöhnliches sagen, daß ich vielleicht eine Offenbarung hören werde. Plötzlich drang aus seinem offenen Munde ein seltsamer, gezogener, sinnloser Schrei, und er fiel bewußtlos mitten im Zimmer hin.«
Jeder epileptische Anfall war für Dostojewski wie ein ungeheurer Sturz, wie eine Erleuchtung, wie ein sich plötzlich öffnendes Fenster, das ihm einen unerwarteten Ausblick auf das jenseitige Licht gewährte. »Einige Augenblicke lang,« berichtet er selbst, »empfinde ich ein solches Glück, wie es bei gewöhnlichem Zustande gar nicht möglich ist und von dem die andern Menschen gar keine Vorstellung haben. Ich fühle in mir und in der ganzen Welt die vollkommenste Harmonie, und dieses Gefühl ist so stark und so süß, daß man für einige Sekunden dieser Seligkeit zehn Jahre seines Lebens, vielleicht sogar sein ganzes Leben hingeben könnte.« – Aber nach den Anfällen befand er sich immer in einem schrecklichen Zustand. Er konnte seinen Kummer und eine gewisse gesteigerte Sensibilität kaum überwinden. Das Wesen dieses Kummers bestand nach seinen eigenen Worten darin, daß er sich als Verbrecher empfand und den Wahn nicht abschütteln konnte, eine unbekannte Schuld, ein ungeheures Verbrechen laste auf ihm.
Wer weiß, vielleicht berühren wir in diesem Punkte das, was im Wesen Dostojewskis, in seiner körperlichen und seelischen Organisation am ursprünglichsten und unbegreiflichsten ist? Laufen nicht in diesem Knotenpunkt alle Fäden des Knäuels zusammen? Und hat man nicht zuweilen den Eindruck, daß gerade diese Anfälle, diese plötzlichen Entladungen einer unserer Erforschung unzugänglichen, doch vielleicht stumm in uns allen ruhenden und gleichsam wartenden Kraft die körperliche Hülle Dostojewskis, jenes Gewebe aus Fleisch und Blut, das die Seele von allem scheidet, was jenseits von Fleisch und Blut liegt, feiner und durchsichtiger als bei den andern gemacht haben, so daß er durch diese Hülle Dinge sehen konnte, die vor ihm noch kein Sterblicher geschaut hat?
»Ich habe noch nie im Leben,« sagt Dostojewski, »ein Werk anders als gegen Vorausbezahlung verkauft. Ich bin ein Proletarier unter den Schriftstellern, und wenn jemand meine Arbeit will, so muß er mich im voraus bezahlen.« Dieser Mensch, der einen solchen Stolz besaß, einen solchen, wie er sich ausdrückte, Ehrgeiz, »als ob man ihm die Haut vom Leibe gezogen hätte und ihm jeder Lufthauch weh täte«, dem vielleicht die Freiheit des Künstlers nicht weniger heilig ist als dem Grafen Tolstoi, schämt sich trotzdem nicht, »des Geldes wegen zu schaffen« und für seine Arbeit wie ein gewöhnlicher Tagelöhner Lohn zu empfangen. Er nennt sich selbst einen »Postgaul«. Er schreibt, um zum Termin fertig zu werden, dreiundeinhalb Druckbogen in zwei Tagen und zwei Nächten. Und er gesteht mit einer Offenheit, die Tolstoi als der Gipfel marktschreierischer Schamlosigkeit der von ihm so sehr verachteten »Literatur« erscheinen mußte: »In meinem Schriftstellerleben ist es mir oft vorgekommen, daß der Anfang eines Romankapitels oder einer Erzählung sich in der Druckerei oder Setzerei befand, während das Ende noch in meinem Kopfe saß, doch unbedingt über Nacht geschrieben werden mußte.« – »Die Arbeit aus Not, des Geldes wegen hat mich erdrückt und aufgefressen.« – »Werden denn meine Leiden je ein Ende nehmen? Ach, wenn ich Geld hätte und versorgt wäre!« – das ist der ewige Schmerz, der nie verstummende Schrei seines Lebens. Manchmal verflucht er die Not, wenn er im Kampfe mit ihr erschöpft ist; doch er schämt sich ihrer nie.
Besonders schwer waren für ihn die vier Jahre von 1865 bis 1869, die vielleicht den vier Jahren Zuchthaus die Wage halten. Das Schicksal war ihm, genau so wie vor seinem ersten Unglück, zunächst günstig. Die von ihm herausgegebene Zeitschrift »Wremja« (= »Zeit«) hatte Erfolg und warf so viel ab, daß er bereits hoffte, sich von seiner Not einigermaßen erholen zu können, als ihn plötzlich eine unerwartete und unverdiente Zensurstrafe ereilte. Wegen eines harmlosen und mißverstandenen Aufsatzes über die Polenfrage wurde seine Zeitschrift verboten. Es war ein Mißverständnis ähnlicher Art wie bei der Untersuchung der Petraschewski-Affäre. Diese beiden Mißverständnisse, die ihn zuerst durch das Todesurteil und die Zuchthausstrafe, und später durch einen vollständigen Ruin beinahe vernichtet hätten, sind jedenfalls bemerkenswert.
Um dieselbe Zeit starben, einer nach dem andern, sein Bruder Michail Michailowitsch, sein bester Freund und Mitarbeiter an der »Wremja«, der Kritiker Apollon Grigorjew und seine erste Frau Maria Dmitrijewna Dostojewskaja.
»Und so war ich plötzlich ganz allein auf der Welt zurückgeblieben,« schreibt er an den Baron Wrangel, »und es wurde mir schrecklich zumute. Mein Leben war mitten entzweigebrochen . . . Ich hatte wirklich nichts, wofür ich noch leben sollte. Sollte ich neue Verbindungen anknüpfen, mir ein neues Leben aufbauen? Selbst der Gedanke daran war mir widerlich . . . Mein Bruder hatte seine Familie ganz mittellos zurückgelassen, und sie hätte betteln gehen können. Ich war ihre einzige Hoffnung, und sie alle, die Witwe und die Kinder, umstanden mich und erwarteten von mir Rettung. Meinen Bruder hatte ich unendlich geliebt; konnte ich denn die Seinigen verlassen? Wenn ich das Erscheinen der »Epoche« (eine Zeitschrift, die an Stelle der verbotenen »Wremja« getreten war) fortsetzen wollte, hätte ich sie und mich ernähren können; selbstverständlich nur, wenn ich mein Leben lang vom frühen Morgen bis spät in die Nacht gearbeitet hätte . . . Außerdem mußte ich die Schulden meines Bruders bezahlen, denn ich wollte nicht, daß sein Andenken irgendwie beschmutzt wäre . . . Ich ließ (die letzten Hefte der »Epoche«) zugleich in drei Druckereien drucken und schonte weder Geld, noch Gesundheit und Kräfte. Ich war der einzige Redakteur, las alle Korrekturen, plagte mich mit den Autoren und der Zensur, arbeitete fremde Aufsätze um, war in ewiger Suche nach Geld, blieb bis sechs Uhr morgens auf und schlief kaum fünf Stunden täglich; und als ich endlich in die Zeitschrift Ordnung gebracht hatte, war es schon zu spät.« Die Zeitschrift ging auch endgültig ein.
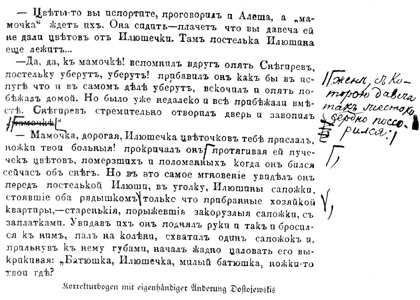
Korrekturbogen mit eigenhändiger Änderung Dostojewskis
Nun blieb ihm nur eines von zweien übrig: Schuldgefängnis oder Flucht. Er wählte die letztere und floh ins Ausland.
Hier lebte er vier Jahre in unbeschreiblicher Not.
Einen gewissen Begriff von der äußersten, beinahe unglaublichen Not – er war damals schon der Autor von »Raskolnikow« und der große russische Schriftsteller (feinfühligere Kritiker hätten in ihm bereits den weltberühmten Dostojewski sehen können) – geben uns seine Briefe an Apollon Maikow aus Dresden vom Jahre 1869.
»Im letzten halben Jahre,« schreibt Dostojewski, »habe ich mit meiner Frau solche Not gelitten, daß unsere letzte Wäsche auch heute noch im Leihhause ist; (erzählen Sie niemand davon,)« fügt er in Klammern verschämt und schmerzvoll hinzu. »Ich werde jetzt meine letzten und unentbehrlichsten Sachen verkaufen müssen und dabei für irgendeinen Gegenstand, der hundert Taler wert ist, zwanzig Taler bekommen; dies alles werde ich zur Errettung dreier Menschenleben tun müssen, wenn er mit seiner, wenn auch zustimmenden Antwort noch lange zögern wird.« Dieser er, dieser letzte Strohhalm, an den er sich wie ein Ertrinkender klammert, ist ein gewisser Herr Kaschpirjow, der Herausgeber der Zeitschrift »Sarja« (»Morgenrot«), ein Mensch, den er gar nicht kennt, den er aber anfleht, ihm zweihundert Rubel zu schicken. »Da es ihm aber möglicherweise schwer fallen wird, meine Bitte zu erfüllen, bitte ich ihn, er möchte mir vorläufig nur fünfundsiebzig Rubel schicken (um mich aus dem Wasser zu ziehen und nicht sofort untergehen zu lassen) . . . Da ich die Persönlichkeit Kaschpirjows gar nicht kenne, schreibe ich ihm in außerordentlich ehrfurchtsvollem, wenn auch etwas energischem Tone (ich fürchte, daß er sich irgendwie verletzt fühlen wird, denn der ehrfurchtsvolle Ton ist übertrieben, und der ganze Brief scheint mir etwas dumm aufgesetzt zu sein).« Nach kaum vier Wochen schreibt er wieder an Maikow: »Von Kaschpirjow habe ich bisher noch keine Kopeke erhalten, nur leere Versprechungen! Wenn Sie nur wüßten, in welcher Lage wir uns jetzt befinden. Wir sind ja unser drei: ich, meine Frau (Dostojewskis zweite Frau Anna Grigorjewna), die das Kind stillt und folglich ordentlich essen muß, und das Kindchen (die neugeborene Ljuba), das bei unserer Not so leicht erkranken und sterben kann!« – »Glaubt er (Kaschpirjow) vielleicht,« fährt Dostojewski fort, »daß mein Brief, in dem ich meine Notlage schilderte, nur eine Stilübung war? Wie kann ich arbeiten, wenn ich hungrig bin und sogar meine Hose versetzen mußte, um mir die zwei Taler fürs Telegramm zu verschaffen? Hole der Teufel mich und meinen Hunger! Aber sie, meine Frau, die jetzt ihr Kind stillt, mußte selbst ins Leihhaus gehen und ihren letzten warmen wollenen Rock versetzen! Hier schneit es aber seit zwei Tagen (ich lüge nicht, schauen Sie nur in den Zeitungen nach!). Wie leicht kann sie sich erkälten! Kann er denn nicht begreifen, daß ich mich schäme, ihm dies alles zu erklären!« Und so geht es weiter: immer dieselben Wiederholungen des gleichen Themas, eintönig und nutzlos wie das Stöhnen bei wahnsinnigem Schmerz. Es sind keine Geschäftsbriefe mehr, sondern Delirien; keine Klagen, sondern Schreie der Verzweiflung.
»Und sie fordern von mir Literatur!« schließt er wutschäumend. »Kann ich denn in solcher Verfassung schreiben? Ich renne herum und raufe mir die Haare, und kann nachts nicht schlafen! Ich zerbreche mir den Kopf und rase! Ich warte! Oh mein Gott! Bei Gott, bei Gott, ich kann die Einzelheiten meiner Notlage gar nicht schildern: ich schäme mich es zu tun! . . . Und dabei verlangen sie von mir künstlerische Abgeklärtheit, eine Poesie ohne Spannung und Trübung und weisen mich auf Turgenjew und Gontscharow hin! Mögen sie nur sehen, in welcher Lage ich arbeiten muß! . . .« Und so war sein ganzes, oder fast sein ganzes Leben.
Das Streben zur absoluten Vollkommenheit, die Befriedigung seines eigenen künstlerischen Gewissens war für Dostojewski eine Lebensfrage. »Glauben Sie nur nicht,« schreibt er an Maikow im selben schrecklichen Jahre 1869, »daß ich Pfannkuchen backe: wie schlecht mir auch manches, was ich schreibe, gerät, so ist doch die Idee des Romans und ihre Ausführung mir Armem, d. h. dem Autor, teurer als alles in der Welt! Denn es handelt sich bei mir nicht um Pfannkuchen, sondern um eine mir überaus wertvolle Idee, mit der ich mich schon lange herumtrage. Selbstverständlich werde ich sie verpatzen, doch was soll ich machen?« – »Sie werden es mir kaum glauben wollen: manches Kapitel, zu dem ich mir drei Jahre lang Notizen gemacht und das ich dann endgültig niedergeschrieben habe, verwerfe ich schließlich, um es neu zu schreiben und dann wieder zu verwerfen.« Als er mit dem Schlusse eines seiner schönsten und tiefsten Werke, des »Idiot«, beschäftigt war, klagte er: »Der Roman ekelt mich an, so unzufrieden bin ich mit ihm . . . Jetzt will ich für den dritten Teil meine letzten Kräfte zusammennehmen. Wenn ich den Roman verbessere, komme ich auch selbst in die Höhe; wenn nicht, so bin ich verloren.« – »Alle zehn Tage habe ich einen Anfall und dann bin ich immer fünf Tage wie bewußtlos. Ich bin ein verlorener Mensch!«
»Und doch habe ich immer den Eindruck, als ob ich erst jetzt mein Leben beginne,« gesteht er in einem seiner verzweifelten Briefe. »Es ist komisch, nicht wahr? Es ist die Zähigkeit einer Katze!« – »Ich habe ihn in seinen schwersten Augenblicken gesehen,« erzählte Strachow, »so nach der Sistierung der Zeitschrift, nach dem Tode seines Bruders und in verzweifelten Geldkalamitäten; nie ließ er aber den Mut sinken, und ich kann mir überhaupt keine Umstände denken, die ihn hätten erdrücken können. Besonders erstaunlich war es bei seiner großen Sensibilität, bei der er sich fast nie beherrschen konnte, sich vielmehr ganz seiner Aufregung hingab. Es war als ob das eine dem andern nicht nur nicht hinderlich, sondern geradezu förderlich wäre.« »Ich habe eine schier unerschöpfliche Lebenskraft in mir!« sagt Dostojewski selbst in einem seiner Jugendbriefe, und am Vorabend seines Todes hätte er dasselbe mit den Worten Dmitri Karamasows wiederholen können: »Ich werde alles überwinden, alle Leiden, wenn ich mir nur jeden Augenblick wiederholen kann: Ich bin! Unter tausend Qualen – Ich bin! Ich winde mich unter der Folter, doch ich bin! Ich sitze im Turm, doch ich bin und sehe die Sonne; und wenn ich die Sonne nicht sehe, so weiß ich, daß sie ist. Und wissen, daß die Sonne ist, heißt leben.«
Und gerade in diesen vier Jahren schreibt er, durch den Tod des Freundes, des Bruders und der Gattin erschüttert, von Gläubigern bedrängt, von der Regierung und von den Feinden der Regierung verfolgt, von den Lesern unverstanden, in Einsamkeit, Armut und Krankheit in rascher Reihenfolge seine bedeutendsten Werke: im Jahre 1866 »Raskolnikow«; 1868 den »Idiot«; 1870 schreibt er »Die Dämonen« und faßt den Plan zu den »Brüdern Karamasow«. Ich will noch mehr sagen: nach all dem, was er geschrieben hat, wie gewaltig es auch ist, kann man sich unmöglich vorstellen, was er hatte schaffen wollen und unter andern Verhältnissen auch hätte schaffen können. »Selbstverständlich,« sagt Strachow, der mit der inneren Geschichte seines Schaffens vertraut war, »hat er wohl nur den zehnten Teil aller Romane, die in seinem Geiste völlig ausgereift waren und die er oft viele Jahre lang in sich herumgetragen hatte, niedergeschrieben; einzelne erzählte er uns sehr ausführlich und mit großer Begeisterung; doch die Zahl solcher Themen, die er auszuarbeiten keine Zeit fand, war wohl unendlich.«
Tolstoi, der die ganze russische Literatur mit einem Irrenhaus verglichen hatte, blieb dieser Ansicht sein Leben lang treu. Sein Leben lang suchte er seine Rechtfertigung und seine Heiligkeit in der Lossagung von der Kultur und Gesellschaft, in der Flucht zum einfachen Volk, in der Abtötung des Fleisches und in körperlicher Arbeit, in allem, nur nicht darin, wozu er von Gott berufen schien. Dostojewski hat aber durch sein ganzes Leben gezeigt, daß ebenso wie in alten Zeiten Könige, Gesetzgeber, Krieger, Propheten und Märtyrer Helden sein konnten, in der heutigen Kultur einer der letzten Helden – der Held des Wortes, der Schriftsteller ist.
Wenn man das Leben Tolstois mit dem Dostojewskis vergleicht, kann man leicht in Irrtümer und Ungerechtigkeiten verfallen: von dem ersteren wissen wir alles, während wir von dem letzteren nicht nur nicht alles, sondern möglicherweise höchst wichtige Dinge nicht wissen; denn nach verschiedenen Andeutungen in seinen Briefen, nach mündlichen Überlieferungen und ganz besonders nach dem, was von seiner Persönlichkeit in seinem Werke enthalten ist, dürfen wir vermuten, daß es in ihr ein ganzes Gebiet gibt, welches uns verborgen ist. Man muß es den nächsten Freunden Dostojewskis, die sich die Mühe gegeben haben, uns seine Lebensbeschreibung zu überliefern, lassen, daß sie immer taktvoll und pietätvoll, vielleicht sogar übertrieben pietätvoll gegen das Andenken des Verstorbenen waren; jedenfalls waren sie aber gar nicht fähig, das, was die Apokalypse »satanische Tiefen« nennt und was Dostojewskis Natur so sehr verwandt war, zu verstehen. Selbst ein so feiner und scharf denkender Kopf wie Strachow hat die Persönlichkeit Dostojewskis, ich will nicht sagen, idealisiert, doch sehr vereinfacht, gemildert, abgestumpft, geglättet und auf das allgemeine Mittelmaß gebracht.
Jedenfalls muß man, wenn man den Menschen Dostojewski betrachtet, berücksichtigen, daß er als Künstler ein unwiderstehliches Bedürfnis hatte, die gefährlichsten und verruchtesten Abgründe des menschlichen Herzens zu erforschen; besonders aber die Abgründe der Wollust in allen ihren Äußerungen. Zwischen der erhabensten, vergeistigten, an religiöse Verzückungen grenzenden Wollust des »Engels« Aljoscha Karamasow und der Wollust des bösen Insekts, »des Spinnenweibchens, das sein eigenes Männchen verzehrt«, liegt die ganze Skala, liegen alle Abstufungen und Schattierungen dieser geheimnisvollsten aller menschlichen Leidenschaften in ihren krassesten und krankhaftesten Perversionen.
Es existiert das Manuskript eines ungedruckten Kapitels aus den »Dämonen« mit der Beichte Stawrogins, in der er unter anderm von der Schändung eines kleinen Mädchens erzählt. Diese Beichte ist eine der stärksten Schöpfungen Dostojewskis, und sie klingt so erschreckend aufrichtig, daß man diejenigen, die dieses Kapitel selbst nach dem Tode Dostojewskis nicht veröffentlichen lassen wollen, wohl verstehen kann: hier liegt etwas, was »die Grenzen« der Kunst überschreitet: es ist zu lebenswahr. Doch im Verbrechen Stawrogins, selbst da, wo es am niedrigsten ist, kann man noch immer einen gleichsam unverlöschlichen dämonischen Abglanz dessen, was Schönheit war, die Majestät des Bösen erkennen. Dostojewski schreckt aber auch vor der Schilderung der alltäglichsten und gemeinsten Unzucht nicht zurück.
In allen diesen Schilderungen Dostojewskis liegt eine solche Kraft und Kühnheit, eine solche Fülle neuer Entdeckungen und Offenbarungen, daß sich im Leser oft die beängstigende Frage regt: konnte er denn dies alles nur durch objektive Beobachtungen an anderen Menschen erfahren? Ist es denn ein bloß künstlerisches Interesse? Selbstverständlich brauchte er nicht eigenhändig die Alte zu ermorden, um Raskolnikows Gefühle kennen zu lernen. Selbstverständlich müssen wir hier vieles auf Rechnung der hellseherischen Kraft des Genies setzen; vieles, ob aber auch alles? Wenn wir auch annehmen, daß es in den Handlungen und im Leben Dostojewskis nichts gegeben hat, was dieser verbrecherischen, jedenfalls »die Grenzen überschreitenden« Neugierde des Künstlers entsprochen hätte, so werden wir uns doch fragen, wieso in seiner Vorstellung derartige Bilder überhaupt auftauchen konnten. Denn die Phantasie Tolstois, die ja oft in nicht weniger tiefe, wenn auch andere Abgründe der Wollust hinabgestiegen ist, war solcher Vorstellungen nie fähig.
Doch ich wiederhole, daß der Erforscher der Persönlichkeit Dostojewskis hier im Dunkeln tappt. Es gibt keine klaren und zuverlässigen Zeugnisse, auf die man sich stützen könnte. Es gibt nichts als Andeutungen, von denen ich eine bereits angeführt habe: nachdem Dostojewski, der damals fünfundzwanzig Jahre alt war, seinem Bruder von seinem Interesse für verschiedene »Minnchen, Klärchen, Mariannchen usw.« und davon, wie ihn Turgenjew und Bjelinski »wegen seines unordentlichen Lebenswandels ausgeschimpft haben«, berichtet hat, schreibt er ihm (in einem andern Brief): »Ich bin nervenkrank und befürchte ein Nervenfieber. Ich bin so liederlich, daß ich gar nicht mehr ordentlich leben kann . . .«
Hier noch eine Andeutung, die zwar ein anderes Gebiet berührt, doch ebenfalls einen Maßstab für die Extreme gibt, in die Dostojewski nicht nur in seiner Phantasie, sondern auch in Wirklichkeit zu verfallen fähig war. »Mein lieber Apollon Nikolajewitsch,« schreibt er an Maikow aus dem Auslande im Jahre 1867, »ich fühle, daß ich Sie als meinen Richter betrachten darf. Sie haben Herz und Gemüt . . . Es fällt mir nicht schwer. Ihnen meine Sünden zu beichten. Was ich Ihnen heute schreibe, ist nur für Sie allein bestimmt. Überliefern Sie mich nicht dem Gericht der Menge. – Als ich durch die Gegend von Baden-Baden reiste, beschloß ich, einen Abstecher dorthin zu machen. Mich peinigte ein verführerischer Gedanke: zehn Louisdor zu riskieren und vielleicht zweitausend Franken zu gewinnen . . . Das Gemeine ist, daß ich schon früher einige Mal gewonnen hatte. Am schlimmsten ist aber, daß ich einen schlechten und übertrieben leidenschaftlichen Charakter habe . . . Der Teufel trieb gleich am Anfang mit mir seinen Scherz: in drei Tagen gewann ich ungewöhnlich leicht viertausend Franken . . . Die Hauptsache war das Spiel selbst. Wissen Sie, wie es einen hereinzieht! Nein, ich schwöre Ihnen, es war nicht die Gewinnsucht allein . . . Ich riskierte weiter und verlor. Ich verlor nicht nur das Gewonnene, sondern auch das eigene Geld bis zum letzten Pfennig; ich war in fieberhafter Erregung und verlor alles. Dann begann ich meine Kleidungsstücke zu versetzen. Anna Grigorjewna versetzte ihr Letztes. (Dieser Engel! wie tröstete sie mich . . .)« Es folgen Bitten um Geld, die selbst, wenn man die intime Freundschaft zwischen Dostojewski und Maikow kennt, erniedrigend erscheinen: »Ich weiß es ja, Apollon Nikolajewitsch, daß Sie selbst kein überflüssiges Geld haben. Niemals hätte ich mich an Sie mit einer Bitte um Unterstützung gewandt. Doch ich ertrinke, bin schon ertrunken. In zwei, drei Wochen werde ich keinen Pfennig mehr besitzen, der Ertrinkende streckt aber seine Hand aus, ohne seine Vernunft zu fragen . . . Außer Ihnen habe ich niemand, und wenn Sie mir nicht helfen, gehe ich zugrunde, gehe gänzlich zugrunde! . . . Mein Teurer, retten Sie mich! Ich werde es Ihnen mit lebenslänglicher Freundschaft und Anhänglichkeit bezahlen. Wenn Sie selbst nichts haben, borgen Sie doch bei jemand für mich. Verzeihen Sie, daß ich Ihnen so schreibe . . . Lassen Sie mich nicht im Stich! Gott wird es Ihnen vergelten. Erlaben Sie mit einem Tropfen Wasser meine Seele, die in der Wüste verschmachtet! Um Gottes willen!« Bemerkenswert ist in der letzten Wendung vom »Tropfen Wasser« und der »Seele, die in der Wüste verschmachtet« die niedere Geziertheit der Sprache. Es ist derselbe Stil, in dem seine komischen Helden, die jede Selbstachtung verloren haben, wie der versoffene Marmeladow oder der abgefeimte Hauptmann Lebjadkin, ihre Armut schildern. Dostojewski weiß wohl selbst nicht, was er spricht.
Das sind ja nur Kleinigkeiten. Wir wissen aber, daß Dostojewski sich auch in wichtigeren Dingen oft »hinreißen« ließ. So bildete er sich in einem Anfalle jugendlicher Selbstüberschätzung ein, daß er mit seinem »Doppelgänger« Gogols »Tote Seelen« übertroffen habe. So warf er in seinem blinden Haß gegen Bjelinski diesem vielleicht nicht genügend scharfblickenden, doch unbedingt anständigen Mann »gemeine Bosheit« und »stinkenden Stumpfsinn« vor. In demselben Brief, in dem er Maikow von seinen Verlusten im Spiele erzählt, gibt er auch die bedeutungsvolle Verallgemeinerung seiner sittlichen Persönlichkeit: »In allen Dingen gehe ich bis an die äußersten Grenzen; mein Leben lang habe ich nie Maß halten können.« Wir müssen hinzufügen, daß er die »Grenzen« nicht nur aus Überfluß an Kraft, sondern oft aus Schwäche und aus Mangel an Selbstzucht überschritt.
Wenn das Leben Tolstois dem jungfräulichen reinen Wasser einer unterirdischen Quelle gleicht, so gleicht das Leben Dostojewskis dem Feuer, das aus denselben Urtiefen emporlodert, doch mit Lava, Asche und erstickendem Qualm vermengt ist. Das Feuer der Liebe, welches das ganze Leben Dostojewskis durchdringt und läutert, leuchtet sogar in den alltäglichsten Einzelheiten seines Lebens. In einem Briefe an Maikow empfiehlt er diesem seinen Stiefsohn, der seine Mutter verloren hat: »Sascha ist ein guter Junge, ein lieber Junge, der niemanden hat, der ihn lieben kann . . . Ich will mit ihm mein letztes Hemd teilen und werde es immer tun!« Jeder, der selbst geliebt hat, wird fühlen, daß es keine leeren Worte sind und daß Dostojewski wirklich bereit ist, mit seinem Jungen das »letzte Hemd« zu teilen, ohne dabei wie Tolstoi abstrakte Betrachtungen anzustellen, ob er das Recht habe, Arme zu unterstützen.
»Nach den begeisterten Rufen, Händeklatschen und Kränzen, mit denen man ihn bei seinen öffentlichen Vorträgen ehrte,« berichtet Strachow, »pflegte er zu sagen: ›Ja, ja, das ist ja sehr schön, doch die Hauptsache verstehen sie alle nicht!‹«
»In jedermanns Kopf,« sagt Dostojewski selbst, »bleibt immer etwas zurück, was man unmöglich den andern Menschen mitteilen kann, auch wenn man ganze Bände darüber schreiben und es fünfunddreißig Jahre lang vorkauen wollte; es bleibt in dir immer etwas zurück, was sich aus deinem Gehirnkasten nicht hinausdrängen läßt und ewig bei dir bleibt; du wirst damit auch zu Grabe getragen werden, ohne deinen vielleicht wichtigsten Gedanken jemand mitgeteilt zu haben.« –
Betrachten wir das Gesicht Dostojewskis, das selbst in seiner Jugend »nie jugendlich erschienen ist«, mit den Schatten und Falten des Leidens auf den eingefallenen Wangen, mit der großen kahlen Stirne, die die ganze Klarheit und Größe seines Verstandes ausdrückt, mit den stumm klagenden, wie im Krampfe der »heiligen Krankheit«, der Epilepsie, verzerrten Lippen, mit dem trüben, gleichsam nach innen gekehrten, unaussprechlich schweren Blick der etwas schielenden Augen, der Augen eines Propheten oder eines Besessenen. Was in diesem Gesicht am schmerzvollsten erscheint, ist eine eigentümliche Unbeweglichkeit in der Bewegung, der in äußerster Anspannung aller Kräfte plötzlich zu Stein erstarrte Aufschwung. –
». . . Nun sagt man mir, um mich zu trösten, daß ich wohl noch mehr Kinder haben werde,« schreibt er an Maikow nach dem Tode seiner Tochter Ssonja. »Aber wo ist Ssonja? Wo ist das kleine Geschöpf, für das ich, ohne zu übertreiben, gerne den Tod am Kreuz erleiden würde, damit es nur am Leben bliebe? – Je mehr Zeit darüber vergeht, um so quälender wird die Erinnerung und umso lebendiger steht das Bild der verstorbenen Ssonja vor mir. Es gibt Augenblicke, die ich kaum ertragen kann. Sie hatte mich schon gekannt; als ich an ihrem Sterbetage aus dem Hause ging, um Zeitungen zu lesen und noch keine Ahnung davon hatte, daß sie nach zwei Stunden sterben sollte, verfolgte sie so aufmerksam alle meine Bewegungen und sah mich mit solchen Augen an, daß ich es auch heute noch vor mir sehe, und die Erinnerung wird von Tag zu Tag lebendiger. Nie werde ich sie vergessen, nie wird mein Gram ein Ende nehmen! Und wenn ich einmal ein anderes Kind bekommen sollte, so weiß ich gar nicht, wieso ich es werde lieben können, wo ich die Liebe hernehmen werde. Ich will nur Ssonja.« Er liebt das Kind seines Fleisches nicht nur im Fleische, sondern auch im Geiste, das heißt christlich; er liebt seine Ssonja nicht um seiner selbst willen, sondern um ihretwillen, als ein selbständiges, unvergängliches und unersetzliches Individuum.
Unwillkürlich denkt man daran, was Tolstoi einmal zu einem Fremden über seinen treuesten Freund gesagt hat, über seine Gattin Sofia Andrejewna, die ihm ihr ganzes Leben hingegeben, die ihn nicht nur geliebt, sondern auch Mitleid mit ihm gehabt hatte, die während dreißig Jahren für ihn wie eine zärtliche Mutter gesorgt hatte: »Einen Freund werde ich mir unter den Männern suchen, und keine Frau kann mir einen Freund ersetzen. Warum lügen wir unsern Frauen vor, daß wir sie als unsere besten Freunde betrachten? Das ist doch Lüge?« Welch ein kaltes und grausames Wort! Es ist grausam, vielleicht aber unschuldig, gar nicht gehässig und wenn nicht im christlichen, so doch im heidnischen Sinne schön; es drückt die Kälte seines ganzen Lebens aus, die Kälte der unterirdischen Quelle.
Jedenfalls ist das Feuer Dostojewskis ebenso heilig wie die Kälte Tolstois. Von mir wenigstens kann ich behaupten: wenn ich auch etwas Schlechtes, Verbrecherisches oder Schändliches aus dem Leben Dostojewskis – wenn es darin überhaupt dergleichen gab – erfahren hätte, so würde sich sein Bild für mich nicht verdunkeln und der ihn umgebende Heiligenschein würde nicht erlöschen, denn ich fühle, daß das in ihm lodernde Feuer alles besiegt und geläutert hat. Auch er selbst fühlte in sich die Kraft dieses läuternden Feuers. Es gab ihm seine Lebenskraft und es gab ihm auch den Tod. »Ein inneres Fieber verbrennt mich, jede Nacht habe ich Schüttelfrost und hohes Fieber, ich magere furchtbar ab,« schreibt er noch einige Jahre vor seinem Tode. Strachow berichtet, daß er in der zweiten Hälfte des Jahres 1880, als er gerade die »Brüder Karamasow« beendigt hatte, ungemein abgemagert und erschöpft war. »Er lebte augenscheinlich nur noch von den Nerven, denn sein Körper hatte schon einen solchen Grad von Abgezehrtheit erreicht, daß ihn der erste, geringste Stoß zerbrechen konnte. Am erstaunlichsten war dabei seine Unermüdlichkeit in der geistigen Arbeit.« Im Jahre 1881 erkrankte er an einem heftigen Emphysem, der Folge eines Lungenkatarrhs, an dem er die letzten neun Jahre seines Lebens gelitten hatte. Als er das Nahen des Todes fühlte, wünschte er zu beichten und zu kommunizieren. »In entscheidenden Augenblicken seines Lebens,« erzählt Strachow nach den Mitteilungen von Frau Dostojewski, »pflegte Fjodor Michailowitsch die Bibel, die er in seiner Sträflingszeit bei sich gehabt, aufs Geratewohl aufzuschlagen und die ersten Zeilen der aufgeschlagenen Seite zu lesen. So tat er es auch jetzt: er schlug die Bibel auf und bat seine Frau, ihm die aufgeschlagene Stelle vorzulesen. Es war der vierzehnte Vers aus dem dritten Kapitel Matthäi: ›Johannes wehrete ihm und sprach: Ich bedarf wohl, daß ich von dir getauft werde; und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Halte mich nicht auf; also gebühret es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.‹ Als er diese Worte hörte, sagte er zu seiner Frau: ›Hörst du? – Halte mich nicht auf – also werde ich sterben.‹ Er verschied auch tatsächlich nach einigen Stunden.«