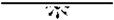|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In einer stillen Seitenstraße der Westvorstadt Berlins, wo die Häuser weitläufig im Grün stehen, lag, umgeben von einem anmutigen Garten, ein kleines einstöckiges Haus. Im Sommer war es bewohnt gewesen. Damals sah man wohl im Vorübergehen helle Mädchenkleider aus dem Grün leuchten und spielende Kinder in den Steigen; als aber der Herbst kam und über die Bäume ein brauner Ton ging und das Laub des wilden Weines sich rot färbte, waren mit den fallenden Blättern auch die Sommergäste fortgezogen, und nun tanzte nur noch das raschelnde Laub in den Steigen und auf der Veranda machten sich die Sperlinge breit. Ein alter Mann, der von dem Besitzer des Hauses als Portier und Gärtner hineingesetzt war, blieb dort. Er bewohnte ein kleines Zimmer im Nebengebäude und abends sah man sein einsames Licht durch die Zweige scheinen.
Die Vorhänge waren niedergelassen und über der Thür hing ein Zettel mit der Inschrift: »Zu vermieten;« allein es war nicht wahrscheinlich, daß dies im Winter geschehen würde. Die Zeiger der alten Uhr über der Hausthür vollendeten Tag für Tag ihre Kreise und der einsame Pendelschlag hallte in den schweigenden Nächten durch die öden Räume, indes draußen die Büsche durchsichtig wurden und die Steige sich mit fallendem Laub füllten. Der Triton in dem Bronzebecken blies seinen feinen Wasserstrahl nicht mehr in die Luft, er bot den traurigen Anblick einer vergeblichen Bemühung dar; die Sperlinge setzten sich auf seine Nase und sein Muschelhorn, und eines Morgens war sein Wasserbecken verschneit und der weiße wollige Schnee lag auf allen Vorsprüngen seines bräunlichgrünen Körpers. So kam Weihnachten heran und es schien, als wolle das neue Jahr alles beim alten lassen. Aber an einem der ersten Tage des Januars kam ein Wagen vorgefahren, aus dem ein Herr stieg und sich dem alten Gärtner als der Doktor Wilhelm Haidau zu erkennen gab. Er begehrte das Haus zu besichtigen, da er mit dem Besitzer über den Ankauf in Unterhandlung stehe. Infolge dieser Besichtigung kam der Kauf zum Abschluß, und somit geschah es, daß das einsame Haus mitten im Winter wieder Bewohner erhielt und ein neues fröhliches Leben in seine Räume einzog; denn mit dem Doktor kam ein schönes zwölfjähriges Mädchen, das aus großen braunen Augen unschuldig und heiter in die Welt schaute. Oben in dem Giebelzimmer, das ihr zur Wohnung angewiesen war, erschien eine Welt von Blumen, die im seltenen Schein der Wintersonne freundlich durch die Scheiben leuchteten, und unten aus dem großen Wohnzimmer, das Herrn Haidau zu seinen Studien diente, strahlte zur Abendzeit wieder der freundliche Schimmer der Lampe in die Nacht des Gartens hinaus.
Die Tage glitten dahin; immer häufiger und länger schien die Sonne in das Giebelzimmer; immer später wurde die Lampe am Abend entzündet, und ehe man's gedacht, war der Frühling ins Land gekommen. Er brachte Schneeglöckchen, die zwischen ihren grünen spitzen Blättern die Glöckchen wiegten; er brachte Krokus, die mit plötzlichen Farben in dem schwarzen Gartenlande standen; er brachte Veilchen, die mit dunkelblauen Augen schüchtern aus dem neubegrünten Rasen lugten. Er ließ ein leuchtendes Grün über die Stachelbeerbüsche gehen, an deren bräunlichen Glöckchen die neuerwachten Bienen summten, und dort, wo der alte Gärtner emsig grub und hackte, ging von dem neugestärkten Boden ein frischer, kräftiger Erdgeruch auf.
An einem schönen Frühlingsabend, als das kleine Mädchen im Garten Veilchen suchte, kehrte Herr Haidau von einem Ausgange zurück, und in seiner Begleitung befand sich ein junger Mann von anziehendem Aeußeren. Die Kleine sprang dem Doktor mit einer Hand voller Veilchen fröhlich entgegen, doch als sie den Fremden bemerkte, blieb sie zögernd stehen.
»Meine Pflegetochter Hedwig,« sagte Herr Haidau, »und dies ist mein alter Freund, der Maler Bergwald, der uns nun oft besuchen wird.«
Als nach dem Abendessen die Freunde vor dem großen runden Tische saßen und kein Ende finden konnten, von alter und neuer Zeit, Bestrebungen und Arbeiten sich zu unterhalten – denn nach einer langen Zeit der Trennung hatten sie sich heute zufällig wieder zusammengefunden – da überkam Hedwig, die in einer Bildermappe blätterte, die Frühlingsmüdigkeit, ihr Kopf sank auf den runden Arm, die Locken fielen darüber hin und sie schlief sanft ein. Als der Maler dies bemerkte und ihm in einer Pause des Gesprächs die ruhigen, sanften Atemzüge der Schlafenden zu Gehör gekommen waren, deutete er auf das Kind, das er den ganzen Abend schon mit einem Ausdruck neugieriger Verwunderung betrachtet hatte, und sagte: »Wenn ich nun nicht augenblicklich erfahre, wie du zu diesem Kinde kommst, so sterbe ich auf der Stelle an unbefriedigter Neugier. Wie, um alles in der Welt, kommst du zu einer Pflegetochter?«
Haidau lächelte. »Das ist eine ganze Geschichte,« sagte er.
»Natürlich ein Roman,« rief Bergwald, »eine Geschichte, wie sie nur Sonntagskindern passiert.«
»Sie ist sehr einfach,« sagte Haidau, »ich will sie dir erzählen. Vor drei Jahren hielt ich mich meiner archäologischen Studien wegen in Schwerin auf, dessen Altertumskabinett für nordische Altertümer von großer Reichhaltigkeit und für den Forscher von hervorragender Wichtigkeit ist. Ich wohnte im Hotel du Nord und ging regelmäßig des Morgens früh an den Ort meiner Studien. So begab es sich denn, daß ich bald auf ein kleines Schulmädchen aufmerksam wurde, das eine Strecke lang mit mir denselben Weg hatte und mir durch seine Anmut und die auffallende Einfachheit und Nettigkeit seiner Kleidung auffiel. Ich redete es eines Tages an, und es stellte sich bald eine Art freundschaftlichen Verhältnisses zwischen uns heraus, das dadurch zum Ausdruck kam, daß wir gegenseitig aufeinander warteten, um den kurzen Weg gemeinschaftlich zu machen. Ich hatte mich so an das freundliche Geplauder mit dem anmutigen Kinde gewöhnt, daß ich es schmerzlich empfand, als eines Morgens meine kleine Freundin, trotzdem ich länger wartete als gewöhnlich, nicht erschien. Auch an den folgenden Tagen ward ich ihrer nicht ansichtig, bis sie endlich nach einiger Zeit eines Morgens etwas blasser als gewöhnlich und ohne Schulmappe an der Ecke der Salzstraße stand und mich erwartete. Sie trug mir schüchtern die Bitte vor, sie zu ihrer Mutter zu begleiten, die sehr krank sei und fortwährend den Wunsch äußere, mich zu sprechen. Dies erfüllte mich zwar einigermaßen mit Verwunderung, allein ich drückte dem Mädchen sofort die Bereitwilligkeit aus, ihm zu folgen. Es führte mich in eine jener engen Straßen, die in der Nähe des Theaters gelegen sind; wir gelangten in ein winkeliges, schiefgesunkenes Haus und stiegen eine schmale und dunkle Treppe empor, die zu der kleinen unter dem Dach gelegenen Wohnung führte. Ich fand dort in einem überaus freundlichen, aber ärmlichen Zimmer eine Frau, die in einem Lehnstuhl, von Kissen gestützt, saß und trotz der geisterhaften Blässe und Durchsichtigkeit ihrer Züge immer noch schön war. Sie machte eine matte Handbewegung, mich zu begrüßen, und sprach mit schwacher Stimme: ›Ich danke Ihnen, mein Herr, für die große Güte, die Sie bezeigt haben, daß Sie der Anforderung einer Unbekannten so freundlich Folge leisten. Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen eine Störung bereite; allein die Angst meines Herzens und die Sorge um mein Kind haben mich zu diesem Schritt getrieben.‹
»Sie hatte die kleine Hedwig hinausgeschickt und erzählte mir ihre Geschichte. Nach fünfjähriger Ehe hatte ihr Mann sich eine Veruntreuung von Geldern in seinem Amte zu schulden kommen lassen und war, seine Frau und sein Kind dem Elend und der Schande überlassend, nach Amerika entflohen. Die Frau hatte sich und ihr Kind, da sie sehr geschickt in Handarbeiten war, ernährt, so gut sie konnte; schließlich war ihr eine kleine Erbschaft zu Hilfe gekommen, die aber zum Teil durch die jetzige Krankheit aufgezehrt worden war.
»›Ich weiß, daß ich sehr bald sterben werde,‹ sagte die arme Frau, ›und daß dann mein Kind schutzlos und allein in der Welt stehen wird. In schlaflosen Nächten habe ich erwogen und gesonnen, was zu thun sei, und immer sind Sie mir eingefallen, von dem mein Kind mir oftmals erzählt hat. Ohne Sie zu kennen habe ich mein Vertrauen auf Ihre Güte gesetzt und mich in meiner schweren Sorge zuletzt entschlossen, Sie zu bitten, einer armen Frau, die niemand weiter auf der Welt hat, hilfreich zu sein und ihr zu raten, was sie thun soll. Ich werde meiner Tochter so viel hinterlassen, daß es genügen wird, ihre Erziehung zu vollenden, allein dennoch ist mein Herz schwer, weil ich nicht weiß, in wessen Hände sie geraten wird, und wessen Augen über sie wachen werden, wenn ich nicht mehr bin.‹
»Sie schwieg und sah mich mit den geistergroßen, dunklen Augen angstvoll an, und ich bemerkte, daß die weißen durchsichtigen Hände mit dem feinen, blauen Geäder leise zitterten. Ich sprach die Hoffnung aus, daß sie wieder gesunden würde und dergleichen mehr, allein sie schüttelte leise den Kopf dazu; ach, ich glaubte bei ihrem Anblick ja selber nicht daran. Ein tiefes Erbarmen befiel mich, bei den Zeichen der Sorge und Angst, die diesen zarten, gebrechlichen Körper zittern machten; ich sagte ihr, so gut ich vermochte, beruhigende und sanfte Worte und versprach zuletzt, alles zu thun, was in meinen Kräften stände, das Schicksal der kleinen Hedwig zum Besten zu kehren. Sie ergriff mit den beiden schwachen Händen meine Rechte und drückte sie sanft, während ihre Augen dankbar in den meinen ruhten, und mich überkam ein unendliches Mitleid und ein tiefes Gefühl der Teilnahme für dieses arme Weib, so daß ich leise die zarten Hände streichelte. Ich hatte die Empfindung, als begegnete ich endlich der Glücksblume meines Lebens, danach ich alle Zeit getrachtet, allein zu spät, schon hat sie das welke Haupt gesenkt, und in kurzem wird sie verblüht sein und ewig für mich verloren. Ach, lieber Freund, es sind wenige, die ihr begegnen, wenn sie eben morgenfrisch den schüchternen, unberührten Kelch dem Lichte eröffnet, und wenigen ist es vergönnt, in vollem Zuge den reinen unversehrten Duft des frischen Lebens einzusaugen.
»Ich will kurz berichten, was weiter geschah. Ich betrieb die Sache so gut ich vermochte, und als die Frau gestorben war und ich weiße Rosen hatte auf ihr Grab pflanzen lassen, ward ich zum Vormund der kleinen Hedwig ernannt, und die Sorge lastete auf mir, was nun weiter werden sollte. Es widerstand mir, das Kind in eine Pension zu geben. Ich habe diese gemeinschaftlichen Dressierinstitute nie geliebt. Für Knaben geht es an, aber Mädchen sollen, wenn es irgend erreichbar ist, in der Familie aufwachsen. Ich dachte an verschiedene mir bekannte und verwandte Familien; allein ich konnte mich ebenfalls nicht entscheiden, dies Kind, das mir lieb geworden war wie eine Tochter, ganz aus der Hand zu geben. So schwankte und grübelte ich hin und her, bis mir wie eine plötzliche Eingebung die Frage kam, warum ich das Mädchen nicht selber behielte, um meine ganze Kraft und mein innigstes Bemühen daran zu setzen, ein echtes und gutes Menschenkind aus ihr zu erziehen, wie es mir vorschwebte als Ideal, unberührt von allem Kleinlichen und Peinlichen, das frei und edel und schön, unbeirrt durch das trübe Gewirr der Menge, den hellen Pfad des Lichtes wandelt. Und wie du siehst, also ist es geschehen,« schloß Haidau, indem er mit der Hand auf das schlafende Kind deutete.
Der Maler hatte gleich zu Anfang sein Skizzenbuch hervorgeholt und während sein Freund sprach eifrig gezeichnet. Jetzt nahm er das Blatt heraus und reichte es Haidau hin. Er hatte Hedwig dargestellt, wie sie mit dem Köpfchen auf ihrem runden Arm schlafend ruhte, und Licht und Schatten der Lampe lieblich und anmutig auf ihren reinen Zügen lag. Die alte Wanduhr in der Ecke hob schnurrend aus und schlug zehn; der Maler stand auf, strich leise mit der Hand über die weichen Locken des Kindes und nahm Abschied.
Haidau versuchte Hedwig zu wecken, allein sie schlief den festen, tiefen Schlaf der Frühlingsmüdigkeit und der Kindheit; trunken sank der Kopf wieder auf den weißen Arm zurück. Er rief Anna, seine alte Wirtschafterin, nahm das Kind leise und vorsichtig auf den Arm und trug es die Treppe hinauf. Die zarte, rosige Wange lag an der seinen; die dunklen Locken fielen über seine Schulter hinab und die sanften Atemzüge streiften sein Angesicht. Dann überließ er sie der Sorge der alten Anna. Als diese wieder herunter kam, sagte sie: »Schläft das Kind! Ich habe sie ausgezogen und sie ist nicht aufgewacht, nur einmal hat sie den Arm ein wenig aufgehoben und die Augen ein klein bißchen aufgemacht und hat gesagt: ›Gute Anna.‹«
*
Die Zeichnung, die Bergwald an diesem Abend gemacht hatte, ward das erste Blatt einer Sammlung, die sich in den Jahren vermehrte und allerlei kleine Momente aus dem Leben des schönen Mädchens darstellte, Arabesken, die ihre Wurzeln in der Wirklichkeit hatten, aber mit allerlei sinnigen Ausläufern und Schnörkeln ins Märchenhafte und Phantastische hinüberrankten. Kleine winzige Erlebnisse wurden so mit dem Schimmer der Poesie und Kunst umglänzt und mit anmutigen Erfindungen verwebt, die im Laufe der Zeit fast den Charakter der Wirklichkeit annahmen. Da war ein Blatt, das einem Sommerausfluge seinen Ursprung verdankte und Hedwig darstellte, wie sie, einem Waldmärchen vergleichbar, unter spielenden Sonnenlichtern im Grase saß und Kränze flocht aus Blumen, die ihr eilfertig und beflissen von Hasen und Eichhörnchen, schillernden Eidechsen und kleinen Waldvögeln zugetragen wurden. Ein kleines Mäuseabenteuer, das Hedwig eines Nachts in ihrem Schlafzimmer erlebt hatte, gab dann wieder Veranlassung zu einem ganzen Mäusemärchen mit Verlobung, Hochzeit, Kindtaufe und Begräbnis, das auf mehreren Blättern gar lustig dargestellt war. Der Maler hatte einen kleinen Hausgeist erfunden, der den Namen Pumpelchen führte, mit rotem Käppchen und grauem Röcklein bekleidet war und auf den Bildern häufig wiederkehrte. Einmal hatte die alte Anna eine schöne Vase zerbrochen, die noch ein Andenken von Hedwigs Mutter war. Bergwald nahm heimlich die Stücke mit und ließ sie von einem geschickten Mann wieder zusammenfügen. Dann stand sie eines Tages wie unversehrt wieder da und ein Blatt steckte darin, das sie in halbfertigem Zustande darstellte, und Pumpelchen mit einer großen Brille auf der Nase war eifrig beschäftigt, sie wieder zusammen zu kitten. Pumpelchen kam als Begleiter der ersten Früchte des Jahres und schleppte sie in Körben oder mächtigen Tüten herbei; einmal mußte er sogar seinen Freund Rumpelchen aus dem Nachbarhause zu Hilfe nehmen, und beide brachten wie Josua und Kaleb eine riesenhafte Weintraube angetragen.
So füllte sich, indes die Jahre verstrichen, eine ansehnliche Mappe mit derlei Bilderchen, und das Kind wuchs zu einer schönen Jungfrau empor, wie eine seltene Blume, die von sorglichen Gärtnern behütet und bewahrt am Ende als ein holdes aufgeblühtes Wunder den Raum mit neuem ungekanntem Duft erfüllt. Während sie unbefangen und heiter den Uebergang von der Kindheit zur Jugend zurücklegte, indes Körper und Geist immer schöner und anmutiger erblühten, waren die beiden Männer zu anderen Empfindungen gelangt, die sie jedoch beide sorgfältig vor der unberührten Jugend des Mädchens zu verschließen bestrebt waren. Jedoch wer weiß, wie der erste Funke in ein so junges Herz springt; es kam eine Zeit, wo es oft wie ein träumender Glanz in den dunklen Augen lag, wo die Brust von unverstandenen Seufzern sich stärker hob und senkte, und wie ein leichter Nebelschleier ein heimlich sinnender Ausdruck über ihren Zügen lag. Noch bot sie unbefangen jeden Morgen und jeden Abend dem Pflegevater den Mund zum Kusse dar; noch lehnte sie ahnungslos, welches Feuer von ihr ausströmte, sich harmlos an ihn, wenn die Gelegenheit dies darbot, und noch saß sie, in ein Buch mit ihm blickend, Seite und Schulter kindlich anschmiegend, bei ihm und wußte nicht, daß der Mann neben ihr mit starkem Willen den Wunsch niederhielt, sie an sich zu reißen und ihren Mund mit heißen Küssen zu bedecken. Eines Abends waren beide in einer Vorstellung von Romeo und Julia gewesen. War es die heiße Glut, die aus diesem Bühnenspiel vulkanisch sich ergießt, die solche Wirkung ausübte, oder war es, daß der Moment gekommen war, da ein Feuer das andere entzündet, die Blicke beider begegneten sich während der Vorstellung einmal, wie durch eine innere Gewalt; noch nie hatten diese Menschen sich also angesehen. Nur einige Augenblicke hafteten die Augen fest ineinander, und doch genügte dieses kurze Anschauen dem Mädchen, das plötzlich aufgejagte Blut glühend in die Wangen zu treiben und den jungen Körper mit süßem, ungekanntem Schauer zu durchrieseln. Sie sprachen fast nicht mehr an diesem Abend miteinander und schienen gänzlich allein ihre Teilnahme dem Schauspiel zu widmen, und als sie nach Hause fuhren, war trotz des engen Wagens ein neutraler Luftraum zwischen ihnen, der von keiner Seite überschritten ward.
Als Hedwig am anderen Morgen ins Zimmer trat, stand Haidau am Fenster und sah sinnend in den Garten hinaus. Er wendete sich, allein kein leichter, elastischer Schritt eilte ihm flüchtig entgegen wie sonst; zögernd blieb Hedwig in der Mitte des Zimmers mit niedergeschlagenen Augen stehen. Haidau ging ihr entgegen, sie erhob die Augenlider und blickte mit sanftem Erröten verwirrt neben ihm ins Leere. Es war, als stände unsichtbar ein Engel mit feurigem Schwerte zwischen ihnen. Sie gaben sich scheu die Hände und gingen schnell auseinander, jedes aus einem anderen Fenster in den Garten blickend, wo nichts zu sehen war.
Es waren mancherlei Erwägungen, die Haidau veranlaßten, diese Gefühle, die bei ihm langsam und unwiderstehlich erwachsen waren, vor dem jungen Mädchen zu unterdrücken und geheim zu halten. Außer daß er fast doppelt so alt war als sie, so widerstrebte es auch seinem ehrlichen Sinn, von dem Vorteil Nutzen zu ziehen, daß Hedwig außer ihm und Bergwald fast keine jungen Männer kennen gelernt hatte. Er war vierunddreißig Jahre alt geworden, ohne daß ihm die Liebe, einige flüchtige Jugendneigungen abgerechnet, näher getreten war – die Leidenschaft hatte deshalb um so tiefer und nachhaltiger sein Gemüt erfaßt, und es handelte sich bei ihm um das Glück des Lebens. Er befand sich in der Lage eines Mannes, der ohne Nachdenken sich in dem Besitze eines kostbaren Schatzes befunden und sich seiner harmlos erfreut hat. Plötzlich aber wird dieser beglückende Besitz angefochten und es gilt, ihn von neuem zu erwerben oder gänzlich zu verarmen.
Bergwald sah und empfand die Lage des Freundes und verschloß in der tiefsten Brust die eigene Neigung. Er bemerkte die plötzliche Veränderung des Verkehrs zwischen den beiden geliebten Menschen; er sah mit dem scharfen Auge der Liebe, wie die Neigung zu Haidau in Hedwigs Herzen heranwuchs, wie sie im Gespräch stockte, wenn sein Schritt draußen vernehmlich ward, wie sie heimlich an seinen Zügen hing und doch vermied, ihm in die Augen zu sehen, wie sie alles vernahm, was er sprach, wie durch ein Wunder von Scharfhörigkeit, selbst wenn es aus der fernsten Ecke war, und wie plötzliches Erröten und holde Verwirrung bei den kleinsten Anlässen über sie kam.
*
Um diese Zeit trat eines Abends spät Bergwald aus dem Garten des Freundes, um in seine Wohnung zurückzukehren. Vorher schon war ihm, als er zufällig eine Weile aus dem Fenster geblickt hatte, bei dem matten Schein der Straßenlaterne eine männliche, in einen Mantel gehüllte Gestalt aufgefallen, die trotz des novemberlichen Schlackerwetters, ohne zu weichen, sich auf der Straße hin und her bewegte und durch die Lücken des mit spärlichem Herbstlaub bedeckten Buschwerkes seltsame beobachtende Blicke auf das Haus warf. Er erinnerte sich, denselben Mann bereits heute am Tage, als er zu Haidau ging, bemerkt zu haben. Hedwig hatte am Fenster gestanden und der Mann im langsamen Vorübergehen sie mit seinen finsteren schwarzen Augen, die unter halb ergrauten Brauen wie zwei lauernde Höhlentiere lagen, unverwandt angesehen, so daß Hedwig, als sie es plötzlich bemerkte, fast erschreckt zurücktrat. –
Dieser selbe Mann trat aus dem Schatten plötzlich auf Bergwald zu und sprach mit einer Stimme, die einen harten, etwas fremdländischen Klang hatte: »Verzeihen Sie, mein Herr, wenn ich Sie anrede – sind Sie ein Freund des Doktors Haidau?« Bergwald bejahte verwundert diese Frage. Der Fremde blickte ihn scheu an und sagte: »Ich habe mit diesem Herrn in einer besonderen Angelegenheit zu verhandeln und würde sehr dankbar sein, wenn ich eine Vermittelung fände. Es betrifft das junge Mädchen, das bei ihm wohnt.«
Ein plötzlicher jäher Verdacht durchzuckte Bergwald und schnürte ihm das Herz zusammen, allein er bezwang sich schnell und sagte ruhig: »Womit kann ich dienen?«
Die beiden Männer schritten nebeneinander eine kleine Weile schweigend her; der Fremde zögerte offenbar, den Anfang mit seiner Mitteilung zu machen. Endlich sagte er: »Ist Ihnen hier nicht ein Lokal bekannt, woselbst wir uns ungestört besprechen können?«
Der Maler antwortete: »Meine Wohnung befindet sich ganz in der Nähe, es wäre vielleicht der geeignetste Ort.« Der Fremde warf einen schnellen, mißtrauischen Seitenblick auf seinen Begleiter, jedoch schien sein Vertrauen sogleich wieder zurückgekehrt, und er folgte ihm schweigend.
Bergwald ließ den Fremden in das Atelier, das zugleich als Wohnzimmer diente, eintreten, indem er einen Moment zurückblieb und seinem Diener eine Anweisung erteilte, die diesen mit schreckhafter Verwunderung zu erfüllen schien. Dann trat er ebenfalls ein, rollte zwei bequeme alte Lehnsessel und einen kleinen Tisch an den Kamin, der von einer dunklen Kohlenglut erfüllt war, warf einen Block frischen Buchenholzes auf und fragte, nachdem der Fremde sich gesetzt hatte: »Was wünschen Sie zu trinken? Rotwein, Rheinwein, Erlanger Bier?«
»Wenn ich ohne Umstände ein Glas Warmes haben könnte!« sagte dieser.
Der Maler ergriff einen bereitstehenden Theekessel und setzte ihn auf die Kohlen. Dann ging er an einen Wandschrank, holte eine Flasche Rum und die nötigen Gläser herbei.
»Junggeselle?« fragte der Fremde.
Bergwald nickte.
»Sind gut eingerichtet!« sagte der andere und begleitete diesen Ausspruch mit einer Art von dumpfem innerlichen Geräusch, das wahrscheinlich ein beifälliges Lachen vorstellen sollte.
Danach saßen beide eine Weile zurückgelehnt, starrten in die Flamme des Kamins und schwiegen. Das neu aufgelegte, etwas feuchte Holz wehrte sich gegen die züngelnde Flamme, zuweilen knackte und schoß es in ihm und manchmal stieß es zischend einen feinen, weißen Dampfstrahl aus.
»Es betrifft also das Mädchen,« sagte der Fremde endlich. »Ich komme aus Kalifornien. Ich kenne ihren Vater. Er hat mir einen Auftrag an sie gegeben.«
»Lebt der Vater noch?« fragte Bergwald rasch.
Der Fremde warf ihm einen schnellen lauernden Blick zu: »Das wollt' ich meinen!« sagte er dann, »reicher Mann geworden, schätze ihn auf vier Millionen Dollars.«
»Welcher Art ist Ihr Auftrag?« fragte der Maler scheinbar gleichgültig, indem er anfing den heißen Grog zu mischen.
»Also mein Freund Winter sagte zu mir,« sprach der Fremde, »›Braun,‹ sagte er, ›du willst nach Deutschland reisen?‹ ›Jawohl,‹ sagte ich, ›will mir das alte Nest mal wieder ansehen, wo ich geboren bin.‹
»›Verdammt,‹ sagte er, ›ich hätte auch wohl Lust dazu, aber ich habe da so gute Freunde bei der Justiz, und ich fürchte, sie lassen mich nicht wieder fort, wenn ich einmal da bin.‹ ›Verstehe schon,‹ sagte ich, ›geht hier manchem so. Sie sind darin kleinlich in Deutschland.‹ Na, Winter kriegt mich nun am Knopf zu fassen und sagt: ›Du könntest mir 'n großen Gefallen thun, Braun, und brauchst das Geld dabei nicht zu sparen. Ich habe eine Frau und ein hübsches kleines Mädchen dort zurückgelassen. Nach den Erkundigungen, die ich habe anstellen lassen, ist die Frau bereits gestorben, aber das Mädchen lebt noch, es ist mit einem gewissen Doktor Haidau, der ihr Vormund ist, nach Berlin gezogen. Weißt du, alter Junge,‹ sagte er dann weiter zu mir, ›ich bin jetzt reich und werde alle Tage reicher, aber älter werd' ich auch und habe niemand um mich, der mir angehört. Siehst du, wenn du nun deine Geschäfte in Deutschland besorgt hast, da kannst du mal bei dem Doktor Haidau vorgehen und ihm in meinem Namen schön danken, daß er sich so viele Mühe gegeben hat, und ihn mal fragen, mit wieviel tausend Dollar ihm dafür gedient ist, und dann bringst du meine Tochter mit hierher nach San Francisco.‹«
Der Fremde lehnte sich in seinen Stuhl zurück und that einen tiefen Zug aus dem dampfenden Glase. Dann nahm er, offenbar an stärkere Rationen gewöhnt, die Rumflasche und füllte es wieder.
Bergwald trank ebenfalls und sagte dann mit scheinbarem Gleichmut: »Wenn nun aber Herr Doktor Haidau sie nicht hergeben will?«
»Er wird müssen!« sagte der Fremde; »der Vater hat doch ein Recht auf die Tochter!«
»Wenn nun aber der Vater seine Rechte verscherzt hat?« sagte Bergwald in eindringlichem Tone.
»Wieso?« fragte der Fremde verwundert.
»Hat er sie nicht verlassen in zartem Alter und ihr nichts mit auf den Weg gegeben, als die Schande eines gebrandmarkten Namens? Ein fremder Mann hat sich ihrer angenommen, als ihre Mutter starb, und sie erzogen mit Hingebung und Liebe, daß sie schön und rein geworden ist an Geist und Körper. Was hat ihr Vater für sie gethan? Er hat sie in die Welt gesetzt und sie verlassen. Und nun, da er alt wird und fühlt, daß er einsam ist, da möchte er gern mit Geld erkaufen, was für alle Schätze zu kostbar ist. Fühlen Sie denn nicht, Herr Winter, daß Ihre Rechte verscherzt sind, und daß Sie keinen Anspruch mehr haben?«
Der Fremde fuhr zusammen und wurde totenblaß: »Sie versprechen sich . . . Braun . . . Braun . . .« sagte er heiser.
»Glauben Sie, mir gegenüber diese Komödie durchführen zu können?« sagte Bergwald, »ich wußte gleich von Anfang an, wer Sie waren.«
Der Mann griff wie unwillkürlich nach seiner Busentasche, allein er zog schnell die Hand wieder zurück und langte nach dem Glase, das noch gefüllt auf dem Tische stand, führte es mit zitternder Hand zum Munde und stürzte den brennenden Inhalt hinab. Dann tastete er unsicher mit den Händen auf der Lehne des Stuhles und sagte, scheu zur Seite blickend: »Sie sind ein so nobler Herr, Sie werden mich nicht verraten!«
Dieser antwortete nicht, sondern füllte das geleerte Glas des anderen und dann entstand wiederum eine Pause, nur unterbrochen durch das leise Flackern der tanzenden Flammen im Kamin und ein plötzliches Geräusch, wie das Rucken eines Stuhles draußen vor der Thür. Winter fuhr auf: »Was war das?« rief er.
»Nur mein Diener!« sagte Bergwald gleichmütig.
Winter begann nach einer Weile wieder zu sprechen.
»Ich will erzählen, wie es mir ergangen ist. Das Geld, das ich mitbrachte nach Amerika, war bald verzehrt, und dann wäre ich fast verhungert, wenn ich nicht mit Straßenfegen meinen Unterhalt verdient hätte. Später habe ich mit allerlei anderen Beschäftigungen mein Heil versucht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Schließlich kam das Goldfieber wieder einmal über die Leute, und ich schloß mich einem Zug an, der in Kalifornien sein Heil versuchen sollte. Da habe ich denn mit Goldgraben ein paar Jahre vertrödelt. Es ist harte Arbeit, Herr, und es kommt selten ein Goldgräber zu etwas. Meistens hatte ich nur mein Auskommen, und wenn es mal einen größeren Fund gab, da waren die Spielhäuser und Trinksalons, die ihn bald wieder verschluckt hatten. Und die Gesellschaft ist auch nicht nach jedermanns Geschmack. Wenn es da mal zu 'ner kleinen Meinungsverschiedenheit kommt, da behält meistens nur der recht, der seinen Revolver am schnellsten aus dem Gürtel, ein scharfes Auge und eine feste Hand hat. Nachher ging es mit den Silberbergwerken in Nevada los, und wie gierige Fliegen strömten die Menschen von allen Seiten dort zusammen. Nun war ich aber auch mit der Zeit klug geworden und hatte gefunden, daß es nur die Dummen sind, die bei ihrem mühseligen Schweiße hacken und graben und pochen, und daß es für die Pfiffigen leichtere Arten gibt, schnell Geld zu machen. Ich fing an mit meinen paar hundert Dollar zu spekulieren und Kuxe zu kaufen und zu verkaufen; ich lernte alle Pfiffe und Kniffe kennen, die dort dem gewiegten Geschäftsmann bekannt sein müssen, und baute mein Glück auf die Dummen, die sich auch wie überall als ein solides Fundament erwiesen. Schließlich, als das erste Fieber nachließ und der Schwindel anfing ein Ende zu nehmen, ging ich mit dem erworbenen Vermögen nach San Francisco. Man darf nicht penibel sein in Kalifornien, die anderen sind es auch nicht – ich hatte nun genug gelernt, um zu wissen, wie es gemacht wird, um sein Vermögen in kurzer Zeit zu vermehren.
»Zu Anfang meines Aufenthaltes in dieser Stadt ging ich eines abends nach Schluß des Geschäftes durch einen Teil der Vorstadt, wo die Häuser in freundlichen Gärten liegen. Da sah ich hübsch angezogene Kinder in den Steigen spielen und sah, wie ein Börsenmakler, den ich kannte, von seinem Kontor nach Hause kam und seine Tochter, ein schönes vierzehnjähriges Mädchen, ihm entgegenlief und ihn küßte. Ich weiß nicht, wie es kam – mir wurde ganz weichlich zu Mute und mir fiel ein, daß ich in Deutschland auch eine kleine Tochter hätte, mit so dunklen Augen und solchen braunen Locken, und fing an zu rechnen und rechnete heraus, daß das Kind in demselben Alter sein müsse wie diese da. Später kamen mir diese weichlichen Gedanken öfter und wenn ich junge, hübsche Mädchen sah, da dachte ich immer an meine Tochter, und wenn sie in Seide und Sammet gingen und mit Diamanten um sich blitzten, da dachte ich, das sollte meine Tochter auch haben. Später malte ich mir aus, wie ich ihr eines von den schönen Häusern einrichten wollte, in denen die reichsten Leute der Stadt wohnen, mit Goldgeschirr und Silbergeschirr und seidenen Gardinen und überall Knöpfe, wo man nur zu drücken braucht, wenn die Dienerschaft kommen soll. Und alles mit bunten Vasen und Dingerchen und Kästchen, wie es die Weiber lieben, und Papageien in goldenen Bauern und Löwenäffchen und kleine bunte Vögel. Den schönsten Wagen sollte sie haben mit milchweißen Schimmeln und darin fahren wie die anderen reichen Damen, und vornehm zurückgelehnt über den Fächer hinwegblicken und alle die Stutzer in den Straßen verrückt machen. Wenn sie einen von diesen haben wollte, so wollte ich ihn ihr geben, den schönsten und elegantesten, der zu finden ist. Oder wenn sie höher hinaus wollte, auf einen Baron oder einen Grafen, die dort zu Lande als Seltenheiten von auswärts bezogen werden – nun, in Deutschland laufen ja genug von der Sorte herum, die froh sind, wenn sie eine schöne Frau und ein paar Millionen Dollar dazu kriegen – da hätte ich ihr einen von den ganz echten, mit zweiunddreißig Ahnen kommen lassen. Aber es war noch nicht genug Geld da, und ich schaffte und raffte weiter, bis es genug war. Da habe ich mir denn einen Paß auf den Namen Braun verschafft und bin hergekommen, um meine Tochter zu holen.«
Während Winter sprach, hatte Bergwald den Entschluß gefaßt, es nun und nimmer zu dulden, daß der Mann seinen Plan zur Ausführung bringe. Nach seiner Anschauung hatte er das Recht auf seine Tochter vollständig verscherzt und konnte es auch durch diese leichte Art von Reue, die noch zum großen Teile eigentlich nur Egoismus war, nicht wiedergewinnen. Der Gedanke, dies holde, reine und unschuldige Wesen an einen Menschen von so niedriger Gesinnung auszuliefern, schnürte ihm das Herz zusammen. Solle alle diese seltene Schönheit und Tugend verloren sein, um einen Menschen, der allezeit gemein gehandelt hatte, ein Amusement auf seine alten Tage zu bereiten? Er beschloß, demgemäß zu handeln.
»Ich will nicht lange Worte verlieren,« sagte er, »aus dieser Sache kann nichts werden. Ich verlange von Ihnen, daß Sie morgen Berlin verlassen und unverweilt in Ihre jetzige Heimat zurückkehren.«
Winter sah ihn sprachlos an, sein graugelbes Gesicht war noch fahler geworden und die ohnehin schon schmalen Lippen seines glattrasierten Mundes schlossen sich fest zusammen, so daß nur noch eine feine Linie zu sehen war. Aber seine scheuen, lauernden Augen zogen sich bald vor dem festen, klaren Blick Bergwalds zurück und starrten ungewiß in die brennende Kohlenglut. Endlich sagte er mit heiserer, gepreßter Stimme: »Sie werden einem Vater nicht die einzige Tochter nehmen wollen, den alleinigen Trost seines Alters.«
»Der Vater hat diesen Trost nicht verdient,« sagte Bergwald, »und ich werde niemals dulden, daß dieses Mädchen von den reinen, edlen Höhen des Lebens hinabsteigen soll zu den niedrigen Regionen, in deren Sümpfen und Miasmen ihr Vater allein zu atmen gewohnt ist.«
»Ich werde meine Tochter schon zu finden wissen, auch ohne Ihre Beihilfe,« sagte Winter trotzig.
»Sie werden keinen Schritt thun, ohne meinen Willen,« rief Bergwald, »denn Sie sind in meiner Hand. Sobald Sie auch nur den Versuch einer Annäherung wagen, mache ich dem Gericht die Anzeige von Ihrer Anwesenheit!«
Die Hand des anderen war leise wie eine Schlange unter seinen Rock geglitten und tastete dort hastig und heimlich nach einem verborgenen Gegenstand, während die finsteren Augen mit tödlichem Haß auf Bergwald gerichtet waren. Dieser blickte den Gegner kalt und ruhig an, und während er mit den Fingern sanft aus den Tisch trommelte, sagte er leichthin: »Inkommodieren Sie sich nicht, Herr Winter; an der Thür sitzt mein Diener. Er hat in jeder Hand einen sechsläufigen, scharfgeladenen Revolver von Löwe und Compagnie. Er hat Auftrag, bei dem geringsten verdächtigen Geräusch sofort in der Thür zu erscheinen. Er hat bei den Scharfschützen gedient, Herr Winter!«
Der also Angeredete hatte sogleich seiner Hand eine andere Wendung gegeben und brachte nun mit einem Grinsen, das wahrscheinlich ein freundliches Lächeln bedeuten sollte, eine große, etwas fettige Brieftasche hervor und fing an, eine Tausenddollarnote nach der anderen auf den Tisch zu zählen, wobei er jedesmal einen lauernden Blick auf Bergwald warf, der ihm mit kalter Verwunderung zusah. Sodann strich er sie plötzlich alle wieder ein, nahm ein Checkformular hervor und sagte in widerlichem, schmeichlerischem Ton: »Was mache ich denn da? Einem so noblen Herrn darf man nicht mit Kleinigkeiten kommen. Ich werde eine Anweisung geben auf meinen Bankier. Was soll ich schreiben? Zwanzigtausend?« Da Bergwald noch immer kalt und verwundert blickte, fing er an sich zu steigern: »Dreißigtausend? Vierzigtausend?« Nun ward er unruhig und sagte endlich: »Fünfzigtausend! Eine schöne Summe und hierzulande ein Vermögen. Sie haben nichts zu thun, als sie einzustreichen. Fünfzigtausend Dollar, mein Herr! Es sind rund zweihunderttausend Mark!«
Bergwald nahm das Papier und warf es in den Kamin.
»Es ist genug geredet,« sagte er und erhob sich. »Sie kennen meine Meinung von der Sache. Spätestens übermorgen müssen Sie Berlin verlassen und ohne Aufenthalt nach Amerika zurückkehren, sofern Ihnen Ihre Freiheit lieb ist.«
Da Winter sah, daß sein bestes Mittel hier nichts verschlug, was ihn mit großer Verwunderung und mit einer Art von Schrecken erfüllte, so geriet er in jenen starren und gelähmten Zustand, der solche Menschen befällt, wenn sie ihr letztes und sicherstes Hilfsmittel machtlos versagen sehen, wie eine Erbse von einem Panzerschiff abprallt. Er wußte sich nicht mehr zu helfen und fand sich kraftlos einem Widerstande gegenüber, dessen Motive er nicht verstehen konnte und dessen Stärke ihm rätselhaft war. Er starrte hilflos eine Weile vor sich hin, griff dann mit zitternder Hand nach dem Glase und trank es leer. Er sandte noch einen scheuen Blick auf die ruhigen, unerbittlichen Augen seines Widersachers und erhob sich schwerfällig. Ein Schauer lief durch seinen Körper, er griff nach seinem nassen Mantel, der auf einem Stuhle lag, und zog ihn unbehilflich an. Dann schritt er langsam, ohne ein Wort zu sagen, auf die Thür zu. Bergwald eilte ihm voran, schickte den Diener beiseite und öffnete dem Manne selber die Hausthür. Ohne einen Gruß und ohne ein Wort zu sagen, trat dieser in den strömenden Regen und in die finstere Nacht hinaus.
*
Bergwald ging am anderen Morgen in das Hotel und erkundigte sich nach dem Herrn Braun. Es hieß, er sei plötzlich erkrankt und der Arzt sei bei ihm. Wahrscheinlich infolge des naßkalten Novemberwetters, in dem er gestern noch lange umhergewandert sein mußte, denn er war erst gegen zwei Uhr vollständig durchnäßt nach Hause gekommen, und befördert durch die heftige Gemütsbewegung, war eine Krankheit bei ihm ausgebrochen. Der Hotelkellner, der zur gewohnten Zeit ihm den Kaffee bringen wollte, fand ihn bei unverschlossener Thür stöhnend und besinnungslos in feuchten Kleidern auf dem Bette liegen. Der Arzt erklärte gegen Bergwald die Krankheit für nicht ungefährlich, hoffte aber eine baldige Besserung bei Anwendung richtiger Mittel und guter Pflege versprechen zu können. Bergwald, der mit dem Wirte bekannt war, besprach das Notwendige mit diesem, sorgte alsbald für eine tüchtige Krankenwärterin und beschloß, selber täglich zweimal nach dem Alten zu sehen. Die Krankheit nahm aber gegen die Vermutung des Arztes einen schlimmen Verlauf; es traten heftige Fieber auf, so daß Bergwald genötigt war, einen kräftigen Wärter zu mieten, um den wild Phantasierenden in seinem Bette zu halten. Zuweilen hatte er dann lichte Augenblicke, wo er still vor sich hinbrütete oder, wenn Bergwald zugegen war, diesen mit dem scheuen Blicke des wilden Tieres verfolgte, das seinen Bändiger zugleich haßt und fürchtet. Schließlich stellte der Arzt eine Krisis in Aussicht, von deren Verlauf der Ausgang der Krankheit abhängig sein würde; den Eintritt derselben vermochte er jedoch nicht genau zu bestimmen.
Um diese Zeit erhielt Haidau durch einen Hotellaufburschen einen Zettel, auf den mit zitternder Hand folgende Worte mit Bleistift geschrieben waren: »Herr Doktor Haidau wird gebeten, mit seinem Mündel Hedwig Winter sobald als möglich zu kommen. Es handelt sich um Tod und Leben.« Darunter stand der Name und die Zimmernummer des Hotels.
Haidau, den diese Botschaft mit einem peinlichen Schreck erfüllte, machte sich mit Hedwig, der er jedoch von dem Inhalt des Zettels nichts mitteilte, sofort auf den Weg.
Man führte sie in das Zimmer, wo der Fremde lag; Bergwald war nicht zugegen. Winter hatte sich, durch Kissen unterstützt, im Bett aufrecht setzen lassen, er sah schwach und hinfällig aus, und in seinen Augen war es wie ein Glanz, der im Begriff ist zu erlöschen. Als Hedwig eintrat, leuchteten wie durch ein Wunder diese Augen noch einmal auf und ein milder Schein verklärte die unschönen zerstörten Züge: »Meine Tochter!« sagte er mit schwacher Stimme, indem er versuchte, die kraftlosen Arme auszustrecken. Sie sah mit den großen dunklen Augen den Kranken mit ängstlicher Verwunderung an und dann fragend zu Haidau empor.
»Es ist dein Vater,« sagte dieser fast tonlos.
Das junge Mädchen überkam eine seltsame Verwirrung. Sie hatte ihren Vater kaum gekannt und hatte sich gewöhnt, an ihn als einen Toten zu denken. Nun sah sie vor sich einen bleichen, leidensvollen Mann, der sie mit dem Tochternamen anredete, als sei er aus dem Reich des Todes noch einmal zurückgekehrt, nur um ihr die Hand zum Abschied zu reichen.
Sie schritt auf das Bett zu, kniete nieder, ergriff die abgezehrte Hand des Sterbenden und schaute in die unbekannten Augen des Mannes, der ihr auf Erden am nächsten stehen sollte. »Vater,« sagte sie mit leiser Stimme. Der Kranke hob das zurückgesunkene Haupt empor wie erfrischt von dem Klange dieses Wortes.
»Ich gehe nun fort,« sagte er, »weiter weg, als der andere meinte . . . weiter weg, woher ich nicht wiederkommen kann. Ich mach' es gründlich ab.«
Sie beugte sich nieder und ihre Thränen fielen auf seine Hand.
»Ich wollte dich mit mir nehmen, aber der andere hat's nicht gewollt. Er ist fort. Er soll jetzt nicht kommen. Ich fürchte mich vor ihm.«
Hedwig verstand natürlich diese Reden nicht.
»Du sollst wieder gesund werden, Vater,« sagte sie, »ich will dich pflegen!«
Er schüttelte leise den Kopf: »Ich habe genug,« sagte er und sank machtlos wieder zurück. Dann kam es wie ein Traum über ihn, in seine Augen trat ein seltsamer Glanz, indes sie in die Leere hinausblickten. Er fing an, abgerissen vor sich hinzureden: »Das schöne Haus – kein schöneres in der ganzen Straße . . . der Thürklopfer blitzt wie Gold . . . Wir wollen anpochen . . . Bum, bum, bum . . . Aha, es wird geöffnet . . . Sehr schön: Goldgeschirr und Silbergeschirr und seidene Gardinen . . . Wie das blitzt . . . Es duftet so süß . . . Ah, meine Tochter . . . Schneeweiße Seide mit echten Perlen . . . Es ist nur das Hauskleid . . . wir haben noch schönere . . . zehn Schränke voll . . . Was stampft und schnaubt da draußen? . . . Es sind die Schimmel . . . Milchweiß und ohne Fehler . . . Nun fahren wir . . . Wie sie gaffen . . . Ja, es ist meine Tochter . . . Willst du einen davon haben? . . . Den blonden mit den Augengläsern und dem langen Schnurrbart . . . Ja, heiraten mußt du . . . Ja gewiß . . . es müssen Enkel kommen! . . . Du kleiner Schwarzkopf, wie heißt du? . . . Gustav? . . . wie dein Großvater . . . Komm, du sollst reiten! . . . Du willst fort? . . . O bleib!«
Er starrte in die Luft hinaus, als sähe er jemand in der Ferne entschwinden. Dann wendete er sein Gesicht und sah Hedwig an seinem Bette knieen und Haidau neben ihr auf einem Stuhle sitzen. Eine seltsame Erleuchtung ging über sein Antlitz; er raffte sich mit letzter Kraft auf, ergriff die Hände der beiden und legte sie ineinander. Dann nickte er ein paarmal heftig und sank mit einem pfeifenden Laut in die Kissen zurück.
Es war totenstill im Zimmer; man vernahm nur das Ticken der Taschenuhr, die auf dem Tische stand, und das leise Schluchzen Hedwigs, die ihr Gesicht in die Kissen gedrückt hatte. Endlich trat die Krankenwärterin hinzu und drückte dem still Dahingestreckten geschäftsmäßig die Augen zu. »Es ist vorbei!« sagte sie.
*
Haidau wurde nachträglich durch Bergwald über den Zusammenhang dieser Vorgänge aufgeklärt und vermochte seine Handlungsweise zu verstehen, während Hedwig, als sie alles erfuhr, vor einem dunklen Rätsel zu stehen glaubte und einen inneren Schauder vor Bergwald empfand, den sie nicht zu überwinden vermochte. Dieser ordnete nach diesem Ausgang der Sache seine Angelegenheiten und verschwand aus Berlin, um sich bald darauf einer naturwissenschaftlichen Forschungsreise anzuschließen.
Haidau verheiratete sich nach einiger Zeit mit Hedwig Winter; an das kleine Haus in der Vorstadt sind jetzt neue Räume angebaut, und in den Steigen des hübschen Gartens erschallt an schönen Tagen zuweilen das Gekrähe eines kleinen Weltbürgers, der auf dem Arm der Amme zappelt und auf den Namen Gustav hört.
Gar vieles mildert die Zeit. Es ist gegründete Aussicht vorhanden, daß auch in Hedwigs Herzen die Empfindungen sich mildern, die es einst gegen Bergwald erfüllten, und daß noch einmal eine Zeit kommt, wo dieser den kleinen Gustav auf den Knieen schaukelt und alles vergessen und vergeben ist.