
Title: Feierabende: Lustige und finstere Geschichten
Author: Peter Rosegger
Release date: October 15, 2019 [eBook #60500]
Most recently updated: October 17, 2024
Language: German
Credits: Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by The Internet Archive)
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1886 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und regional gefärbte Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Passagen wurden nicht korrigiert. Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) werden als Umschreibungen (Ae, Oe, Ue) dargestellt.
Das Inhaltsverzeichnis wurde vom Bearbeiter der Übersichtlichkeit halber an den Anfang des Textes verschoben. Die Fußnote wurde an das Ende des betreffenden Abschnitts gesetzt.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Lustige und finstere Geschichten
von
P. K. Rosegger.
Vierte Auflage.
Wien. Pest. Leipzig.
A. Hartleben’s Verlag.
1886.
(Alle Rechte vorbehalten.)
|
Erster Theil:
Lustige Geschichten.
|
|
|
|
Seite
|
|
Sommerabende
|
|
| Das Mirakelkreuz | |
| Der Schäfer von der Birkenheide | |
| Herrn Pastor Meneschild’s Hochzeitsreise | |
| Der Fremde im Vaterhause | |
| Als Hans der Grethe schrieb | |
| Wie ein Kaiserjäger fensterln ging | |
| Arthur heißt er | |
| Eine Schatzgräberhistorie | |
| Sanct Josef der Zweite | |
| Der Wolfl von Kirchberg | |
| Der Junge und der Alte | |
| Graf Adlerstamm auf der Hahnenjagd | |
| Studentenpulver | |
| Eine Eisenbahngeschichte | |
| Naturforscher auf der Alm | |
| Eine mit Geld | |
| Die Abelsberger Chronik | |
|
Der Burgermeister von Abelsberg
|
|
|
Der Brückenwirth zu Abelsberg
|
|
|
Der Schulmeister von Abelsberg
|
|
|
Der Thurmbau zu Abelsberg
|
|
|
Zu Abelsberg beim Spielchen
|
|
|
Ein Abelsberger Kalbskopf
|
|
|
Die Abelsberger der Majestät
|
|
|
Die Abelsberger Touristen
|
|
|
Ein Abelsberger auf dem Vesuv
|
|
|
Das reiche Jahr eines Abelsbergers
|
|
|
Ein junger Abelsberger in der Residenz
|
|
|
Eine Abelsberger Heiratsgeschichte
|
|
|
Der Abelsberger Baßgeigenkrieg
|
|
|
Wie Abelsberg bekehrt worden ist
|
|
|
Eine Abelsberger Katze
|
|
|
Zu Abelsberg wieder wer geworden
|
|
|
Ein Abelsberger Heutrog
|
|
|
Zweiter Theil:
Finstere Geschichten.
|
|
|
Winterabende
|
|
| Ein Weg zur Schuld | |
| Die guldene Grethe | |
| Der Waldbrand | |
| Hier auf dieser Straßen hat mich Gott verlassen | |
| Es reigt in Lust ein Liebespaar | |
| Trotzköpfe | |
| Am Fenster der Liebsten | |
| Was der Franz Schlager für ein Wildpret schoß | |
| Der Gang zur Mutter | |
| Mein einziger Sohn | |
| Der Sündensteg | |
| Der Thürmer von Münsterwald | |
| Aga | |
| Drei Stunden vor dem Sterben | |
Lustige Geschichten und die Abelsberger Chronik.
u den besten Dingen dieses Lebens — alle Arbeitenden wissen es — gehört der Feierabend. Er ist besser als der Feiertag, denn die Ruhe durch die Ermüdung nach vollbrachter Arbeit, die Ergötzung ist verklärt durch das Bewußtsein erfüllter Pflicht, und daß dem Feierabend etwa der Ruhetag folgt, ist ein Vorzug, dessen sich der Feiertag selbst nicht zu erfreuen pflegt.
Solchen Feierabenden widme ich dieses Buch. Der erste Theil desselben ist heiter, wie ein Sommerabend. Wer aber den Genuß des Sommerabends dem lustigen Theile dieses Büchleins vorzieht, dem ist der Verfasser auch nicht böse, er wartet mit seinen kleinen Geschichten gern, bis die Stunde kommt, in welcher Jemand etwas Lustiges zu brauchen hat. Die kleinen Erzählungen und Schalkheiten sind in aller Herren Länder zerstreut gewesen; ist den losen Dingern zwischen dem lächerlich ernsten und grausam vernünftigen Zeug, das ihre Nachbarschaft war, unheimlich geworden, sie hielten sich für bedrückt, verlangten Befreiung und ein kleines Reich für sich zu bilden. Weil sie bisweilen ein wenig ungezogen und[S. 6] boshaft waren, so ließ man sie ziehen — und ist auf solche Weise diese Ansiedlung „Lustige Geschichten“ entstanden. Jetzt verlegen sie sich auf Wohlthun, denn Frohsinn verkürzt die Zeit und verlängert das Leben.
Nicht überflüssig wird es aber sein, mein Leser, wenn Du auch Deinen eigenen Humor mitbringst, denn für einen guten Spaß gehören allemal Zwei: Einer, der ihn macht, und Einer, der ihn versteht.
Der Verfasser.
Eine dramatische Idylle.
Personen:
Brandsteiner, Besitzer eines Bauernhofes.
Rosel, seine Tochter.
Peter, Großknecht bei Brandsteiner.
Abendliche Gebirgsgegend. Rechts ein dichtverzweigter Baum, an dessen Stamm ein Marienbild in Form der Martertafeln hängt. Im Hintergrunde Wiesengelände, ganz rückwärts Hochgebirge.
1. Scene.
Rosel
(kommt von rechts in schmucker, aber nicht zu bunter Bauerntracht, Kittel von blauer Farbe, Schürze braun und weiß gesprenkelt, mit Kopftuch, in Hemdärmeln, welche über den Ellenbogen zurückgestreift sind. Einen Heurechen über der Achsel.)
Wär’s halt in Gott’snamen wieder Samstag und Feierabend. Und für mich schon gar, für mich hat die Werktagszeit jetzt ein End’ und der Feierabend, der anhebt, dauert wer weiß wie lange.
(Man hört einige jauchzende Töne einer Flöte).
Ja, da steht er beim Zaun und bläst die Seitenpfeifen.
Peter
(aus dem Hintergrunde rechts. In Gebirgstracht: Hohe Bundschuhe, grüne Strümpfe, Lederhosen hellrothen Brustfleck mit grünem Hosenträger, grünem Hut, in Hemdärmeln, eine Heugabel über der Achsel, die Flöte in der Hand).
Mein tausendliebs Pfeiferl, wenn du einmal jodelst, so tanzen alle Heuschöber, so fangen alle Engel im Himmel zu hupfen an.
(Auf den Baum spähend.)
Meine Drosselschlingen da oben. Leer ist sie. Meinetwegen, der Vogel gehört ja in die freie Luft, dazu hat er die Flügel. Unsereins hat eh’ keine Federn. Unsereins — bei meiner Treu, wenn ich der lieb’ Herrgott wär g’west, wie wollt’ ich aus so einer ellenlangen Wochen kamod sechs funkelnagelneue Sonntäg g’macht haben und den siebenten hätt’ ich als Draufgab geben. — Jegerl, die Rosel! Was guckst denn alleweil in’s Gras hinein? Weißt heut’ kein saubers G’sangl?
Rosel.
Sollst es gleichwohl wissen, daß es mir die Stimm’ verschlagen hat.
Peter (lustig).
Stimm’ verschlagen!
Rosel.
Ich bitt’ Dich gar schön, hör’ mir auf, ich kenn’ mich nit aus und ich mag auch Dein’ Seitenpfeifen nit leiden; ’s thut mir davon der Kopf so weh und ’s hebt mir die Brust zu zittern an. (Für sich:) Mein Herz möcht’ zerspringen, hör’ ich ihn spielen!
Peter.
Nu halt ja, wenn Du schon wehleidig bist, kann’s ja lassen!
(Steckt die Flöte in den Hosenträger.)
Aber jetzt in gescheiter Weis, Dirndl, hast Dir’s überlegt? Schau, laß mich nit mehr lang’ fragen und warten, beim Warten kriegt gar der ewige Jud weiße Haar. Schau, Roserl, für was wären wir denn zusammen aufg’wachsen, für was thät ich dienen in Dein’ Vater sein’ Haus, für was thät ich mein klein derspart Sachel nit glei vertrinken und verspielen, wenn ich nit alleweil auf was G’scheiter’s thät warten. Wenn ich Dich nit wüßt’, wär’ ich schon lang’ ein Lump! Schau, Roserl!
Rosel.
Red’st aber heut’ wieder unbesinnt daher. Hast ’leicht geschlafen seit Peter und Pauli?!
Peter.
Nu, ich glaub’ nit!
Rosel.
Und hast es nit g’hört singen von den Spatzen auf dem Dach? Sollst es wohl wissen, ich geh’ in ein Haus, wo alleweil Sonntag ist.
Peter (lustig).
Du, Roserl, da nimm’ mich mit!
Rosel.
Ja, Du Hupfinsfeld, Du thätst just passen hinein. — Daß ich Dir’s sag’, Peter, wir haben nichts miteinander zu schaffen — ich muß in’s Kloster.
Peter (ironisch).
Geh! In’s Kloster willst! Hast Recht, dort brauchst nit zu schwitzen im Heu’n und beim Kornschnitt, dort hast ein’ Schatten.
Rosel.
Wärst ’leicht Du auch mein Feind, der mir das noch schwerer machen möcht’, was ich so schon kaum ertragen kann. —
Peter.
Wer mehr tragt, als er mag, der ist ein Narr, hat mein Vater gern g’sagt. Wirf’s ab, was Dich druckt, gleich ist Dir leichter. — In’s Kloster, bei meiner Treu, was die Leut’ heutzutag’ für närrische Gedanken kriegen! — Schau, Roserl, daß ich Dir’s sag’, Du bist eine saubere, eine rechtschaffene Dirn, Du arbeitest für Drei und denkst für Zehn. Wie der lieb’ Herrgott Deine Händ’ erschaffen hat, da hat er nit gemeint, daß Du mit denselben alleweil den Rosenkranz wutzeln sollst und wie er Dir den Kopf aufgesetzt, hat er an eine rührsame Hauswirthin denkt, und wie er Dir Dein Herzerl eingelegt — Roserl, denk nach, was mag ihm dabei eingefallen sein? — Bei meiner Seel’, schad’ wär’s um Dich!
Rosel.
Meinst ich hätt’s nit auch schon bedacht? Aber es bleibt mir kein Ausweg — ich bin verschenkt. Mein Vater hat mich in einer bösen Stund versprochen in’s Haus Gottes hinein; wenn er jetzt sein Wort wieder zurücknehmen wollt’, so könnt’ er ’leicht Schaden nehmen an seiner armen Seel’. Ich selber will mich nicht fragen, will mir denken, die Kirchenglocken klingen tausendmal schöner, als die Kühglocken — — freilich wohl, meine lieben Küh auf der Weid’, und gar du, meine Schecklo — wie ich dich vergeß, das weiß ich nicht. Wer bringt dir den Klee, wer wird’s bedenken, daß du den Sauerampfer nit magst, wer legt dir die Streu, wie’s dir recht ist!
Peter.
Und meinetwegen schaust ’leicht gar nit um? ’s kann sein, ’s hätt’ mich mein Vater auch verschenkt — und Roserl, ich geh’ mit Dir!
Rosel.
Möcht’ wissen, für was Eins Dich brauchen thät!
Peter.
Weißt, Dirn, ’s gibt kein Käferl auf der Gassen und kein Steindl auf der Straßen, das kein Anwerth hätt’. — Zu was Eins mich brauchen thät? — Die Meßnerei studir’ ich! Du singen und beten in Deiner Zellen, ich dazu den Glockenstrick reißen von Früh’s Morgen bis in die späte Nacht hinein — Du, wir thäten was ausrichten! Spaß und Ernst, Roserl, mich bringst nimmer weg von Dir! So schau, magst mich denn gar nit?
Rosel.
Wennst wegen dem meinst, grad feind will ich Dir nit sein. Wennst kein dalkerter Bub wärst — ein anderer statt Dein thät das recht Steigl ’leicht gar noch finden.
Peter.
Blind bin ich auch nit, Gott sei Dank, und Dein Sperreden kunnst justament lassen.
Rosel.
Ein Anderer thät statt mit der armen Dirn — mit’m Vater reden.
Peter (jauchzend).
Das hab’ ich ja gewußt, daß Du mein Herzkäferl bist! Mit dem Alten komm’ ich schon auf gleich!
(Rechts ab.)
Rosel (allein).
(Ihm nachblickend.) Wenn er zu früh schreit, so fürcht’ ich, er wird zu früh heiser. (Sinnend.) Sauber gewachsen ist er — na, da steh’ ich und hab’ närrische Gedanken und vergeß’ auf meine Küh. Ich seh’s schon, ich taug’ nimmer auf d’Welt. — Die Schecklo wird freilich wohl dreinschauen! Will ihr’s schon auseinandersetzen, sie ist a g’scheit’s Vieh, wird’s einsehen. Je, heut’ sind meine Küh noch all’ oben im Waldschlag. Soll ich ’leicht wieder ’s Heimgang-Liedl singen, daß sie mir kommen? Hart ankommt’s mir heut’, das Singen, aber na:
(Links singend ab.)
2. Scene.
Der Brandsteiner
(tritt von links auf. Hohe Bundschuhe, weiße, grobwollene Strümpfe, verblaßte Lederhose, braune Weste mit grünem Hosenträger, blaues Barchentjäckchen, auf dem schon halb ergrauten Haar eine buntgestreifte Zipfelmütze, deren Quaste über die Achsel herabgeht. Der ganze Anzug muß abgeschossen aussehen, weil er das Werktagskleid ist. Der Mann ist eine rauhe, derbe Gestalt, die Bewegungen sind ungelenk und sehr langsam. — Er hat ein kurzes Pfeiflein im Munde und schlägt mit Stein und Schwamm Feuer.)
(Murmelnd.) Schon eine sakrische G’schicht das! Sein Lebtag zu früh soll sich Eins nichts vornehmen. Wie wenn er mir’s z’Fleiß thät, der dort oben! Von morgen ist der reich’ und angesehen Brandsteiner allein auf sein’ Hof. — ’s Weib liegt im Freithof, die Dirn ist davon. — Wennst nit brennen willst, so laß’s bleiben, bitten werd’ ich dich nit!
(Schleudert Stein und Schwamm von sich.)
Die Dirn sagt mir nit ja und nit nein. Irr kunnt Einer werd’n. — Aber er hat Recht, mein Bruder, der Pfarrer, was a Schickung ist, ist a Schickung; gegen unsern Herrgott kommt Einer nit auf, der geht sein’ eigenen Kopf nach — alleweil sein’ eigenen — und ’s wird schon ’s Beste sein.
(Man hört von rechts auf einer Flöte ein lieblich-melodisches Lied.)
Blast mir der Bua schon wieder das G’sangl — er kann’s halt nit lassen. Weil — (bewegt) weil mir ’s Wasser in die Augen kommt — was ich einmal nit will. Ich muß mein’ Mann stellen. Aber Gott tröst’ Dein’ Seel’, mein lieb’s Weibl, ’s ist halt Dein G’sangl, hast es alleweil gar so, gar so gern g’sungen.
(Peter tritt auf.)
Hab’ nichts dagegen, Bua, wannst das Stückl blast, kann nichts dagegen haben, aber in Ehren halt mir’s und nit zum Gspaß und Zeitvertreib brauch mir’s! Weißt, Peter, Du wurd’st mir’s nit glauben, aber richtig ist’s: Das Stückl[S. 14] und Liedl hat mich und mein Weib z’sammbracht vor fünfundzwanzig Jahren und wie oft, wie oft haben wir’s nachher gesungen miteinand, bis der Schaufelmann den Takt dazu geschlagen hat und — (unwillig) ei, geh’ mir weg, mag gar nit d’ran denken!
Peter (für sich).
’s Eisen wär warm.
Brandsteiner.
In so weit recht, daß D’ da bist. (Vertraulich.) Laß was red’n mit Dir, Peter! Hab’ Dir sagen wollen, daß Du morgen um eine neue Dirn umschaust.
Peter.
Dirn? Für wen?
Brandsteiner.
Bei wem bist denn? Ich brauch’ eine Dirn für’s Haus, für den Stall. Frag’ um, morgen auf dem Kirchplatz!
Peter (trotzig).
Das thu’ ich nit.
Brandsteiner.
Um eine handsame, fleißige, kennst Dich ja aus bei dem Weibervolk. — Was schaust denn so sauer, hast ein Wespennest g’schluckt?
Peter.
Acht Jahr hab’ ich Euch gedient, Bauer, und Ihr seid zufrieden mit mir gewesen. Ich weiß recht gut, was einem Knecht ansteht, heut’ aber — Brandsteinbauer, ich verlang’ meinen Feierabend, und für den Sonntag laß’ ich mir nichts schaffen. Daß ich Euch um eine Dirn umschau, das thu ich nit!
Brandsteiner.
Du Tollpatsch, was hast denn?
Peter.
Weil ich keine find’ für die Rosel, weil keine gewachsen ist in der Pfarr’ für die Rosel, weil auf der Welt keine mehr aufsteht für die Rosel, weil es eine Sünd’ und Schand’ ist, Bauer —
Brandsteiner (heftig).
Bist mir still!
Peter.
Nein, ich red’. O, jetzt ist Feierabend, jetzt bin ich mein eigener Herr und nicht Euer Knecht und ich trau’ mich wohl, daß ich Euch sag’: Wenn Ihr die Rosel in das Kloster schickt, so habt Ihr kein Gewissen und kein Herz im Leib, so betrügt Ihr den Herrgott im hohen Himmel oben, so raubt Ihr Euch selber aus, so bringt Ihr auf eine saubere Manier Eure Tochter um’s Leben. Und ich bleib’ kein’ Stund’ mehr in Eurem Haus und ich geh’ zum Gericht und verklag’ Euch, und ich geh’ zum Pfarrer, daß er Euch nit losspricht bei der Beicht, und ich bitt’ meinen Namenspatron, den heiligen Petrus, daß er Euch zur letzten Stund’ die Himmelsthür versperrt und ich — bei Gott und allen Heiligen, das größte Unrecht ist’s auf dem weiten Erdboden!
Brandsteiner.
(mit den Händen seinen Kopf haltend).
Sie verfluchen mich! Und ich kann’s nit ändern, bei meiner armen Seel’, und wir wissen uns All’ miteinander nit zu helfen!
Peter (dumpf).
’s ist mir so herausbrochen, Bauer, und wenn Ihr mich niederschlagt und wenn wir zu Grunde gehen All’ miteinander — mir schon alleseins. Sagen hab’ ich Euch’s müssen.
Brandsteiner (milder).
Kunnst ’leicht mein bester Freund sein, Peter, meinen thät’st es nit schlecht, aber versteh’n thust es nit. Ich versteh’s ja selber nit, ’s ist Keiner auf der Welt, der ’s wenden kunnt. Schau an dieses Kreuz auf dem Eichbaum, da hab’ ich’s gelobt, vor fünfundzwanzig Jahren, daß die Rosel in’s Kloster geht.
Peter.
So eine Lug reden, Bauer, das steht Euch gar nit gut an. Vor fünfundzwanzig Jahren habt Ihr noch gar keine Rosel gehabt. Ich weiß ihr Alter recht gut!
Brandsteiner.
Schreist auch gleich so herrisch dazwischen, wie ein Unhold. — Weil wir schon reden, laß’ Dir’s erzählen. Steht Dir gut an, wennst ihm zuhörst, dem alten Mann, hast ja selber noch nichts erfahren. Zu derselben Zeit, wie ich im heiligen Brautstand gewesen bin, da ist unten auf der Bachwiesen, wo Ihr heut’ das Heu habt geschöbert, noch der finstere Wald gestanden und die ganze Gegend herum ist eine halbe Wildniß gewesen. Rechtschaffen gern bin ich gangen zu meiner Braut in’s Dörfel hinab und oft ist schon die stockfinster Nacht da, wie ich heraufsteig zu mein’ Haus. Da ist einmal, kannst mir’s glauben, Peter, dieselbe Stund’ geht mir mein Lebtag nit aus dem Kopf — ist einmal, wie ich so daher trott, hinterrücks ein ketzermäßiges Pfnausen gewesen[S. 17] — saust mir ein großmächtiger Bär nach. Ich, das weißt, heb’ Dir an zu laufen, verlob’ mich in der Geschwindigkeit auf den Luschariberg, aber das Haus mag ich nit mehr derreichen. Just, daß ich noch zu rechter Zeit den Baum dort derlang — mich hinaufstemm, ist das Schindvieh schon da. Morgen zeig’ ich Dir den Schuh, Peter, wo er hineingebissen hat; aber nit grad den Schuh, den Fuß hätt’ er auch gern noch dazubeißen mögen. Ich in der Todesangst mach’ das heilige Vornehmen: Ein geweihtes Kreuz laß’ ich aufrichten auf diesem Baum, daß Jeder, der vorbeigeht, sein Vaterunser betet. Aber der Bär, wild wie ein höllisches Thier, hat brummt und brüllt und seine Augenräder haben gefunkelt, daß es ein Graus war. Gewühlt hat er im Erdboden und gescharrt an der Baumrinden, daß die Fetzen sind geflogen und — Jesus, Peter, wenn Du das gesehen hätt’st! Zu steigen hat er ang’hebt hinauf nach dem Stamm und ich hab’ sein gluthheißes Schnauben schon g’spürt in allen Gliedern. Ich wohl gleich dem Wipfel zu, aber die Bestie mir nach und alle Aeste haben sich bogen. Herrgott in Dein’ Reich! schrei ich, wenn ich Dir schon die heilige Kirchfahrt verricht’ auf den Luschariberg, wenn ich Dir schon das Kreuz aufstell’ zur Ehr Deines bittern Leidens — was willst Du noch! Was soll ich Dir geben, daß Du mich errettest aus dieser Noth! — Sterben, mein Peter, sterben will halt kein Mensch, und doch gar zu bitter wär’s im glücklichen Brautstand! Da fällt mir’s ein in der höchsten Bedrängnuß: Mein Kind, meinen Erstgebornen schenk’ ich Dir, Du himmlischer Herr! — — (Ruhiger): Und schau, wie ich das Wort so hab’ ausgerufen, da hör’ ich schon die Leut’ vom Haus, wie sie herbeieilen und es blitzt schon der Schuß und das wilde Ungeheuer kugelt zusammen. — Das ist der letzte Bär gewesen, den sie[S. 18] in unserer Gemein erschossen haben. — Die Kirchfahrt hab’ ich verrichtet, das Kreuz hab’ ich aufgestellt am Baum — jetzt hab’ ich noch das Letzt’ zu thun.
Peter.
Ihr seid gut an mit unserem Herrgott, Brandsteinbauer, und ich halt, es läßt sich ein vernünftig Wörtl mit ihm reden. Bin der Meinung, daß, wenn Ihr ihm sagen thät’s, ’s wär’ Euer einzig Kind; Ihr hättet ihm den Erstgebornen versprochen und nit den Letztgebornen — so wär’ ich der Meinung — —
Brandsteiner.
Ja, Peter, wenn ich’s wissen thät, daß er nit etwa Unrecht verstund’. — Wenn’s ein Bübel gewesen wäre, mein Erstgeborner, nu, so hätt’ ich ihn in die Studie geben, wäre ein geistlicher Herr worden, wie mein Bruder, der Pfarrer; das hätt’ sich geschickt und hätt’ uns Ehr’ bracht. Weil’s aber ein Dirndl hat sein müssen, so heißt’s mit ihm in’s Kloster hinein. Weiß mir keinen andern Weg.
Peter.
Nu, halt ja. Weil wir denn schon so von der Rosel reden, ’leicht geht sie ungern fort von heim und von ihrem Vater — leicht ist sonst auch noch wer da, den sie nicht gern verläßt — weil’s in so einer G’mein allerhand Leut’ giebt. ’s kunnt sich wunderlich schicken, daß ich selber so Einen wissen thät.
Brandsteiner.
Bist ein herzensguter Bursch, Peter!
Peter.
Gelt! Nu, nachher kunnt ich ihn ja nennen.
Brandsteiner.
Aber zeitweis steckst Du Deine Nasen ein wenig weiter, als sie lang ist. Die Rosel weiß, wie’s steht, ist ihr Lebtag ein frommes Kind gewesen und thut’s vom Herzen gern.
Peter.
Nu ja, Bauer, hab’ halt gemeint, weil ich just dabei bin, daß ich mich ausred’ —
Brandsteiner.
Gar nit vonnöthen, Peter. Wenn ich in der Wirthschaft Deinen Rath brauch’, so laß’ ich Dich schon rufen. Was ich aber mit mir und mein’ Kind abzumachen hab’, dafür weiß ich meinen Bruder, den Herrn Pfarrer. Der versteht’s. ’s ist ein Glück für die Rosel, sagt er, wenn sie so der Welt Gefahr entflieht. Und Gottes Braut zu sein, da kann kein Mensch auf Erden höher steigen. Freilich wohl wird’s richtig sein. Unsereins hat nit studirt und kann sich die Sach’ nit so auslegen.
Peter.
Und Ihr wollt Eure alten Täg in der Einschicht verleben und der große alte Brandsteinerhof soll in fremder Leut’ Händ’ kommen?
Brandsteiner.
Der Mensch hat sein Leben vom Herrn, hat seine Kinder vom Herrn, hat sein Vermögen und Alles vom Herrn. Ich opfer’ das meine wieder auf zu seiner Ehr’. Dieselb’ Meinung hat auch mein Bruder, der Herr Pfarrer. — Du aber, Peter, laß’ Dir kein graues Haar wachsen, wir führen derweil die Wirthschaft fort und das Korn wird geschnitten[S. 20] auch ohne die Dirn. Vergiß’ auf morgen nit, was ich g’sagt hab’!
(Neigt sich, aber nicht auffällig, vor dem Kreuz, rechts ab.)
Peter (allein).
Das Korn wird geschnitten auch ohne die Dirn. — (Sich auf die Stirne schlagend.) Warum, du dalkerter Bub’, hast ihm’s nit gesagt, was nit sein wird, ohne die Dirn! Warum, du Blödling, hast ihm’s nit g’sagt, daß du morgen vom Haus gehst und zu den Soldaten, daß du dich niederschießen laßt auf dem weiten Feld, weil du ja so kein Heimatland hast und keinen Werth, weil keine Glückseligkeit mehr sein soll auf der Welt, weil der Mensch nur z’weg ist, daß das Korn geschnitten wird! (Auf das Kreuz hinblickend.) Das Mirakelkreuz! Weil’s dahier einen Bären niederbrennt haben. Soll ’leicht gar noch ein Vaterunser beten davor? Ich brauch’ Dich nit! (Spöttisch.) Und boshaft ist er auch noch! Nit nur, daß er das kindisch’ Gelöbniß nit hätt’ sollen annehmen, schenkt er dem Bauer nur ein einzig’ Kind, und ein Dirndl dazu, damit nur Alles recht zuwider hergehen soll. Ah, meinetwegen! Mag mit dem Herrgott keine Händel anfangen; er wird’s schon einmal einsehen. (Ein Geräusch auf dem Baum.) Aha, jetzt hat’s Einen! Armes Flederl, g’rad zum Feierabend hat’s Dich erwischen müssen. ’s mag Eins aus dem Erdboden kriechen oder in den Lüften fliegen, vom Unglück, vom Unglück ist halt Kein’s frei. ’leicht hast gar wollen Dein’ Schatz aufsuchen im Laub. Nu wart, Kleiner, für heut’ schenk’ ich Dir’s. Und ein andermal sei gescheit und geh’ nimmer in die Fallen.
(Steigt auf den Baum.)
3. Scene.
(Es beginnt zu dunkeln. Im Hochgebirge des Hintergrundes dämmert nach und nach ein Alpenglühen auf. Man hört von der Ferne das Geschelle der heimziehenden Heerde.)
Rosel
(tritt links auf mit einem Blumenstrauß).
(Gegen die Coulissen gewendet.) Geh’, Schecklo, geh’, Alles mußt auch nit haben. Das Sträußl kriegst mir heut’ nit, das kriegt wer Anderer. (Zu sich:) Hart genug kommt’s mir an, und bei meiner Treu’, ich bin eine kindische Gredl! Aber probirn thu ich’s doch. Zu der ich jetzt geh’, die hat einen heiligen Namen. Die Trösterin der Betrübten will ich sie heißen, ’s kunnt sein, es ging doch gut aus. Für Uebel nehmen kann sie mir’s nit. — Schecklo, ’leicht bleiben wir nachher beinand’. — (Zagend gegen das Kreuz.) Wenn ich wissen thät! — Das Mirakelkreuz ist’s freilich wohl; Herrgott ist auch keiner d’ran. Ja, wenn ich wissen thät! — All’ mein Lebtag hab’ ich die Red’ g’hört, vor einem Kreuz ohne Herrgott thät auch ein sündhaft Gebet was derlangen. — Beim Herrgott richt’ ich nichts aus mit meiner Bitt’, dem hat’s mein Vater versprochen. So schleich ich jetzt zu unserer lieben Frau. — Nein, aber — wenn ich wissen thät! —
(Tritt ganz zum Bilde und beginnt es langsam mit den Blumen zu zieren.)
Weil heut’ die heilige Samstagnacht, so hätt’ ich Dir die Blümlein bracht, Nagerln sind’s und Rosmarin und Herzenstrost und Immergrün und Vergißmeinnicht zur schönsten Zier, Du liebe Jungfrau Maria! Nit, daß ich’s sag’, aber wie Du bist, giebt’s gar keine schönere Frau im Himmel und auf Erden. Und die Röselein stehen Dir gar so gut; wer wird sie bringen und wer wird Dich zieren, wenn ich nimmer bin? Ich hätt’s gethan mit Sorgen und Freuden,[S. 22] aber ich muß ja fort in’s Kloster gehen. Ich hoff’ Dich wohl auch dort zu finden, aber so finster ist dasselbige Haus, daß ich mein’, ’s kunnt Dir leicht lieber sein in der schönen guldenen Welt, unter dem grünen Baum. Wie wollt’ ich dableiben bei Dir und zu jeder Samstagnacht ein Kränzlein winden. — Nachher, wenn ich’s bedenk’, daß mit der Zeit auch mein Vater alt wird und schwach — möcht’ wissen, wer ihm beistünd’ in seiner Mühsal! — Und deswegen, in’s Kloster will ich halt nit gehen. Mein’ Vater getrau ich’s nit zu sagen, der hat’s mit dem lieben Herrgott schon Alles ausgemacht. Und weil mir so angst und bang ist, so komm’ ich zu Dir, Maria rein, und thät Dich bitten zu tausendmal, daß Du meinetwegen redest mit Deinem Sohn. Du, wenn Du willst, bringst es leicht zuweg, daß der Handel wieder zurückgeht. Und das soll er bedenken, Dein lieber Sohn Jesus, wenn er schon einmal so viel gethan hat, daß er den Leuten zu Lieb’ am Kreuz gestorben ist, so wird er sich wegen meiner Bitt’ schon auch nit aufhalten. Er steht auf mich nit an. Ich bin eine einfältige Dirn, beim Beten schlaf’ ich ein und bin gar sündhaft noch dazu, und in’s Kloster, ich sag’s rund heraus — in’s Kloster taug’ ich nit. Du Maria rein, bist die Himmelskönigin und hast das größte Recht; Dein göttlicher Sohn ist ein gutes Kind, der wird Dir Deine Fürbitt’ gewiß nit abschlagen. (Stürzt nieder auf die Knie.) ’s ist ja nit von Stein, Dein Herz, und Du wirst mich nit verlassen in meiner Noth!
(In der Ferne läutet das Abendglöcklein. Alpenglühen.)
(Leise.) Ist das schon Deine Stimm’, Dein Jawort? So bedank’ ich mich viel hundertmal, und sag’ vergelt’s Gott bis in den Himmel hinauf! (Zutraulicher.) Und nachher, Du liebe, gnadenvolle Mutter Maria, weil wir so weit richtig[S. 23] und bekannt sein thäten, so hätt’ ich halt noch eine schöne Bitt’. ’s ist nur z’weg’n dem, weil ich — wenn ich’s auch meiner Tag nit will sagen — die Seitenpfeifen gar so von Herzen gern hör’ — und — aber für übel nehmen mußt mir’s einzig nit, schau, Du unsere liebe Frau; daß ich eine kindische Gredl bin, das weißt gleichwohl schon lang’ — und Dein lieber Sohn auch. Und ich hätt’ g’meint, weil ich schon einmal ein Dirndl bin, und weil’s schon heißt, daß der Herrgott ’s Büaberl z’wegen Unsereins g’macht, so wurd er’s nit verlangen, daß — ’s ist halt just so eine Sach’ und ich red’ mich rechtschaffen hart! Uh mein, uh mein! (Leise zum Bilde.) Der Peter liegt mir im Sinn! — ’s ist nur z’wegen dem, weil ich mich allein nit ausweiß. Treusein, dasselb’ thät ich versprechen von Herzen gern —
4. Scene.
Brandsteiner
(der gehorcht hatte, sichtlich bewegt, aber schmollend).
Immer eine Andere thät zu dieser Stund’ den englischen Gruß beten! Aber versteht sich, Du mußt extra was haben. Kannst ein saubers Gebetl da, wer hat Dir’s denn g’lernt?
Rosel
(nach einem kurzen Kampf mit sich, dem Vater an die Brust fallend).
Mein Vater, zu tausend Gott’swillen, ich weiß mir nimmer zu helfen! Die Brust möcht’ mir auseinander springen vor lauter Angst und Weh!
Brandsteiner.
Du kindisch, Du kindisch, jetzt hebst mir auf einmal so an! Was hast es nit gleich gsagt? Wenn ich weiß, daß Du nit willst fort von heim, ja so knie ich halt nieder vor[S. 24] diesem Kreuz und bettel dem lieben Herrgott mein Wort wieder ab. Wenn er denn schon meint, es müßt gelöst werden, mein Leben kunnt er ja nehmen dafür. Wenn nur Eins wär’, daß ich im Frieden leben und sterben kunnt, wenn er nur ein Zeichen thät geben bei diesem Baum, bei diesem Kreuz, daß er einverstanden wär’ mit meiner Bitt’!
(Ein kurzes Rauschen auf dem Baum.)
Rosel (lebhaft).
Vater, ein Vogel ist geflogen!
Brandsteiner
Sei still’, es ist schon dämmerig, ’s kunnt eine Fledermaus sein g’west.
Rosel
(gegen das Alpenglühen).
Was das für Zeichen sind, Vater, meiner Tag hab’ ich den hohen Steinkogel nit so rosenroth brennen gesehen.
Brandsteiner (für sich).
’s ist grad, wie wenn sich das Felsengebirg für mich schämen thät, daß ich dem dort oben mein Wort nit will halten. O, wenn zu dieser Stund’ nur Eins von Allen, die heimgegangen sind vor mir, zurückkommen thät auf ein Wörtl, nur auf ein Sterbenswörtl, mit der Botschaft, wie ich d’ran bin!
(Von dem Baume hört man leise das lieblich-melodische Lied auf der Flöte.)
Brandsteiner (jauchzend).
Jessas, Jessas, mein G’spiel und mein Brautliedl! Mein herzgetreu’s Weib giebt mir ’s Zeichen! Hast mich denn doch noch verstanden und giebst mir mein Wort wieder z’ruck, Du[S. 25] gütiger Herrgott im Himmel. (Lachend, eine Thräne im Auge). Hab’ Dich schon g’seh’n, der Peter ist oben! Ist ja allseins, meiner Seel, ’s ist ja allseins — wie der Bot’ heißt! Geh, geh, so steig aba, bist schon sicher, heut’ ist kein Bär nimmer da!
Peter
(hüpft vom Baum herab).
Hätt’s auch nimmer ausgehalten länger da oben; ist gar ein verzauberter Baum, jed’s Astl fangt zu plaudern an, schier g’freuliche G’schichten. Das ist a Baum!
Rosel
(schämt sich, zu sich).
Mein Eid, jetzt hat er Alles g’hört. Alles hat er g’hört!
Peter.
Und weil das schon so ein närrischer Baum ist, auf dem allerhand Gelöbnisse wachsen, so hab’ ich mir selber gleich auch lustig ein’s ababeutelt. Wenn ich die Rosel zum Weib krieg’, hab’ ich g’sagt, bei meiner armen Seel’, so zünd’ ich alle Samstag zur Feierabendzeit ein gluthrothes Amperl an, da beim Mirakelkreuz. Ja, ein g’weicht’s Lichtel muß unsere liebe Frau dennoch wohl haben. Und das werd’s einsehen, Brandsteinbauer, mit der lieben Frau kann Ein’s kein’ Feindschaft anheben und das Nachtlichtl könnt’s ihr nit nehmen!
Brandsteiner (für sich).
Bin selber so gewesen; im Liedl von ihr steht meine ganze Jugend geschrieben.
Rosel (verlegen).
Dasselb’ wär völlig auch mein Gedanken, ’s wär’ eine Schand’ und ein Spott und ’leicht auch eine großmächtige[S. 26] Sünd’, und ich denk’, das Nachtlichtl muß man ihr freilich wohl zukommen lassen.
Brandsteiner (lustig).
Nachher ging’s aus, nachher wär’ ich nimmer allein und — — ich kenn’ mich selber nit vor lauter Freud’! — Jetzt muß der Jung’ schon gescheiter sein wie der Alt’; ich will kein’ Schuld haben und Du magst selber schau’n, Peter, wie Du mit Dem dort oben auf gleich kommst!
Peter.
Ich komm’ auf gleich, dasselb’ fürcht ich mich nit. (Gegen Rosel.) Der Erstgeborne taugt für die Leut’: aber ich denk’, die Rosel ist nicht der letzt’ Erstgeborne auf dem Brandsteinerhof; ’leicht ist später einmal Einer dabei, der sich besser schickt in’s Haus Gottes hinein.
Rosel
(ihm den Mund verhaltend).
Ich bitt’ Dich gar schön, thu’ nichts versprechen; ’s kunnt auch keiner dabei sein — ging die z’widere G’schicht von vorn’ wieder an.
Brandsteiner.
’s ist vorbei — sie geben nimmer nach. In Gott’snam’, weil’s denn schon ist! Nachher hätt’ All’s seinen Theil; — aber mein Bruder, der Pfarrer —?
Peter.
Der kommt auf den Ehrenplatz bei der Hochzeitstafel!
(Vorhang fällt.)
er Schäfer von der Birkenheide war ein Schäfer nach dem Herzen Gottes. Er war im Verhältniß zu anderen Schäfern blutjung und im Verhältniß zu seinen Schafen steinalt. Er hatte gelbgoldiges Haar, das er sich alljährlich zur Herbstschur mit der breiten Wollenscheere vom Haupte schnitt. Er war schlank und hoch gewachsen, wie die weißen Birkenstämme, zwischen welchen er den Sommer hindurch lebte und die Schäflein weidete. Von diesen Birkenstämmen schälte er eines Tages ein zartes weißes Rindenhäutchen los und schrieb darauf die Worte: „An die Gais-Esther im Fischgraben. Es ist mein guter Rath, daß Du Deine Gaisen auf die Birkenheide treibst. Hierum giebt es Brombeerlaub, das mögen wir nicht alles überkommen. Ich laß Dich schön grüßen.
Titus, der Schäfer auf der Birkenheide.“
„Da schau, das schreib ich der Esther,“ sagte er zu seinem Freunde, dem grauen Widder, der ihm über die Achseln schnupperte.
„Halt her!“ blökte der Widder, und als ihm der Brief nahe genug war, um lesen zu können, fraß er ihn auf.
Das gute Verhältniß der beiden Freunde war nun für lange Zeit gestört und die Esther kam nicht auf die Birken[S. 28]heide. Der Widder genoß unter seinen Schafinnen vergnügliche Zeiten; aber dem Schäfer war das Herz schwer, und als sich einmal eine Ziege aus dem Fischgraben auf die Birkenheide verirrte, herzte sie der Titus und flüsterte ihr in die Ohren: „Thu’ mir die Esther grüßen!“
„Thu’ es selber!“ mäckerte die Gais und lief davon.
Und am nächsten Samstag that er’s selber. „Esther,“ sagte er, „ich muß Dir was anvertrauen, ich bin ein Narr.“
„Je, das weiß ich schon lang’!“ lachte die Esther.
„Laß mich nur ausreden; Narr vor lauter Lieb’ zu Dir.“
Da jauchzte die Esther schier auf vor Lachen und lief weg.
Der arme Titus hielt sich den Kopf mit beiden Händen, denn der wollte auch davonlaufen und den Schäfer allein lassen mit seinem blutenden Herzen. „Ach, hätte ich meinem Vater gefolgt!“ klagte er, „wäre ich ein Seelenhirt geworden anstatt ein Schafhirt! Nun sehe ich’s wohl, die Welt ist eitel.“
Er war gar nicht dumm, der Titus; er war belesen und that spintisiren, wie es schon so Schäferbrauch; zuweilen zwar sah er ein wenig blöde und albern aus, aber er war ein Schalk und Philosoph durch und durch. — Krieg’ ich schon mein Mädel nicht, so werd’ ich gar ein Pfaff!
Es giebt Leute, die erst dann nach der christlichen Heiligkeit streben, wenn sie mit der Welt umgeworfen haben. So ein Fuchs war also auch der Titus. Nicht gar weit von der Birkenheide in einem alten Schlosse wohnte ein Häuflein grauer Brüder. Sonntags predigen und Werktags betteln war ihr ehrsam Handwerk, und es gab keine Gasse und keine Straße in der Gegend, in deren Staub nicht die Sandalen der grauen Brüder zu verspüren waren.
Da saßen in der Klause auf der Birkenheide einmal zwei Männer zusammen, so ein grauer Bruder und unser[S. 29] Schäfer. Der graue Bruder ließ sein behendig Redewerk klappern und fuhr mit den Händen bekräftigend hin und her, auf und nieder. Der Schäfer that nichts, als fort und fort gemächlich das Haupt neigen: er glaube Alles, er sei mit Allem einverstanden.
Zuletzt, als sie auseinander gingen, wattirte der Titus all die zahl- und grundlosen Säcke des ehrwürdigen Bruders mit Schafwolle aus. Es war die ganze Herbstschur.
Und als der Pater fort war, ging der Titus mit verschlungenen Armen unstet über die Heide und zählte an den Tagen und Stunden, die ihn noch von der Aufnahme und Einweihung in den geistlichen Stand trennten. Dann zog er ein Büchelchen aus der Tasche, das er zum Gegengeschenk für die Herbstschur bekommen hatte. Das Büchelchen war tausendmal mehr werth als die Herbstschur, denn es war das Brevier; aber des Schäfers Gedanken wollten nicht weilen in den vergriffenen Blättern, sie flatterten wie Schmetterlinge weit in der Gottesluft herum, tänzelten um die weißen Birkenstämme, um die blökende Heerde, flimmerten gar in den Fischgraben hinab und umgaukelten die Gais-Esther. — Ja, Die wird gucken, wenn sie hört, der Titus wird ein geistlicher Herr! Ja, nachher wird sie’s glauben, daß in einem Schäfer auch was stecken kann. Ja, nachher wird ihr leid sein. Ja, geschieht ihr schon recht! — Bei seiner ersten Predigt wird sie gewiß auch dabei sein. Ja, die erste Predigt! Ja, die muß er sich wohl prächtig einstudiren.
Der Schäfer stieg auf eine Felswand und blickte mit Befriedigung nieder auf die Schafheerde, die sich unten versammelte. Hierauf hub er an zu reden:
„Geliebte Brüder im Herrn!“ Er machte eine Pause, dann wiederholte er die Worte noch einmal, redete aber nicht[S. 30] weiter. Er stand lange auf dem Felsen und wendete sein Haupt nach allen Himmelsgegenden; aber er schwieg. Sein Schweigen hatte eine kleine Ursache — es fiel ihm nachgerade gar nichts ein. Die Schafe schüttelten ihre Wolle, so viel ihnen die gestrige Scheere noch am Leibe gelassen hatte; sie waren enttäuscht. Sie hatten gemeint, der Schäfer wolle ihnen vom Felsen herab gesalzene Brotstücke zuwerfen, wie er sonst zuweilen that. Nun versicherte er sie blos seiner Brüderlichkeit. Sie gingen blökend auseinander.
Der Titus aber tröstete sich: Mach’ dir nichts d’raus, daß du dermalen noch nicht weiter kannst im Worte Gottes. Erst bei der Salbung kommt der heilige Geist über dich. Sanct Peter ist ein Fischer gewesen und ist ein grundgescheiter Apostel geworden; und doch ist nach dem Sprichwort ein einziger Fischer dreimal so dumm wie drei Schäfer zusammen.
Der Titus hatte, wie die allermeisten Schäfer, eigentlich sein Lebtag zu den Barfüßern gehört; ja er trug nicht einmal Bindesohlen, und wenn er sich einen Scherben oder einen Splitter in die Fußsohlen stieß, so schnitt er ihn gelassen mitsammt einem Stück Haut heraus und pfiff dabei, etwa wie ein Schuster, der eine alte Schuhsohle zertrennt. Die härene Kutte ist wärmer wie eine Zwilchjacke, „die mehr Fenster hat, als das Kaiserhaus“ und durch welche der innere Mensch an allen Ecken und Enden herauslugt. Ferner ist erbetteltes Brot sorgloser zu genießen, besonders wenn man es in ein Gläschen Wein tunkt, als Hirtenkost, die heute eine Seuche vergiftet, morgen ein Dieb davonträgt. Also was konnte der Titus verlieren? Das Predigen und Beichthören sammt allem Zubehör bringt der Geist. Vielleicht wird der Titus gar noch Oberer!
Am Vorabende des Michaelfestes war’s. Der Titus hatte seine Schafe bereits in die Sicherheit des Stalles gebracht, und zwar zum letztenmal. Er hatte seinem Bauer wie der ganzen Welt heute den Dienst aufgesagt. Morgen geht’s in’s Kloster und das Novizenjahr hebt an. An diesem letzten Abende ging der Titus noch einmal in die Birkenheider Kirche, in der er getauft und gefirmt worden war; es war ihm feierlich zu Muthe; und sollte er ja selbst noch taufen und die Sacramente spenden, wie der geistliche Herr Caplan, der dort vom Pfarrhof-Fenster herabschaut und als Prediger und Beichtvater weit und breit berühmt ist.
Die Kirche war leer und weitete sich bereits in der abendlichen Dämmerung. Zuerst kniete der Schäfer in seinen Stuhl und betete. Es war ihm sehr ernst mit dem Gebet und sein Entschluß stand fester als je. Dann stieg er die Stufen des Altars empor, breitete die Hände auseinander und sagte: Dominus vobiscum! Sogleich aber erschrak er über den Frevel, den er trieb, und trollte sich von den Stufen herab.
Dort an dem Pfeiler prangt die Kanzel; die vier Evangelisten stehen Wacht und darüber auf dem „Hut“ schwebt der heilige Geist. So möchte der Titus doch herzlich gern wissen, wie sich’s auf einem wahrhaftigen Predigtstuhle steht. Und es ist ja sonst kein Mensch in der Kirche, der darob ein Aergerniß nehmen könnte. Husch ist der Schäfer auf der Kanzel. Nu, da geht freilich eine andere Luft und Alles fühlt sich so geweiht an und vom heiligen Geiste tropft schon die Eingebung nieder. Hätt’ ich euch nur da, Ihr sündhaften Birkenheider, Ihr; niederpredigen wollt’ ich Euch, daß All’ des Teufels wär’! dachte sich Titus, wartete aber nicht, bis sie kamen, sondern stieg würdigen Schrittes wieder zu den leeren Kirchenstühlen nieder.
Dort im Winkel neben dem Taufstein steht der Beichtstuhl. Außen auf dem Bänklein ist der Schäfer schon gekniet. Inwendig ist er aber noch nie gesessen. Am Altare ist der Geistliche der Opferpriester, auf der Kanzel der Apostel, hier im Beichtstuhle ist er an Gottes Statt, also der liebe Herrgott selber. Was aus einem Menschen nicht Alles werden kann! Aber wunderlich muß sich’s doch sitzen da d’rin, auf des lieben Herrgotts Kanzleisessel. Husch hockt der Titus im Beichtstuhl und legt sich halb aus Vorwitz, halb zum Schutze gegen den Teufel die vorhandene Stola um den Nacken. Zwar ist es da noch finsterer wie draußen und man riecht die Sünden aus allen Fugen und Ecken. Gar gemüthlich ist das nicht. Schon will der Schäfer den Beichtstuhl wieder verlassen, als ein Weiblein in die Kirche torkelt und sich unweit vom Beichtstuhle in eine Bank setzt. Jetzt kann der Titus nicht hervorkriechen, die Alte verlästerte ihn in ganz Birkenheid als einen Frevler. Es heißt also noch ein wenig sitzen bleiben anstatt Gottes; das Weiblein hat nur ein paar Vaterunserchen auf dem Herzen und wird wohl bald wieder davonhumpeln.
Aber, anstatt dieses davonhumpelte, humpelten zehn andere daher und bald kam auch jüngeres Volk, Mädchen, Männer und Kinder, und die Kirchenstühle füllten sich und die Leute thaten ihre Rosenkränze hervor, und zuletzt kam gar der Meßner und zündete zahlreiche Kerzen an.
Dem Schäfer wurde sehr unbehaglich; er that den dunkelblauen Vorhang ein bißchen herfür, daß sie ihn doch zum Mindesten nicht sehen konnten, wenn er schon während der ganzen Vesper im Beichtstuhle sitzen bleiben mußte.
An der Sacristeithür klingelt’s, die Orgel beginnt zu tönen, der Herr Pfarrer tritt zum Altar. Der Titus spürt[S. 33] einen gewaltigen Stich im Herzen. Das ist die Michaeli-Andacht, und bald kommt jetzt der Caplan, um Beicht zu hören. Sollte aber der Schäfer hervortreten vor Aller Augen, vor Alter Zungen, die in alle Weiten reden: Was hat denn Der im Beichtstuhl gemacht? Noch gehört er nicht hinein, oder ist er ein Narr oder gar ein schlechter Mensch? — Nein, er bleibt im Versteck, und wenn der Caplan wirklich kommt, so verkriecht er sich unter den Sitz hinein; jetzt gilt’s klug zu sein auf alle Mittel und Weis’.
Langsam näher und näher rückten die Leute dem Beichtstuhl. Ein hübsches demüthiges Mägdlein schob sich sachte und sachte vor und suchte ein wenig, und so gut es die Bescheidenheit erlaubte, hinter den Vorhang zu gucken, ob der geistliche Herr wohl schon sitze. Richtig, es rührt sich die blaue Stola. Das Mädchen hält sofort sein weißes, zierlich geglättetes Handtuch sittsam vor den Mund und hüstelt sich aus; und als sonach das Herz entkorkt ist, kniet sie nieder auf das Bänklein und reckt das Köpfchen gegen das vergitterte Beichtfenster.
Der gute Schäfer ist in Todesangst. Zu erkennen geben kann er sich um keinen Preis. Durch ein Unbeachtetseinlassen des Beichtkindes auffallend machen darf er sich auch nicht. Sollt’ er nun also den Beichtvater spielen? Es wäre der entsetzlichste Frevel, aber — giebt es einen andern Ausweg? Und ist der Titus nicht schon Priester im Herzen? Er meint es nicht schlecht, er legt nur so ein bißchen das Ohr an’s Gitter und braucht ja das Beichtkind nicht anzuhören, es nicht loszusprechen.
Zu allem Glücke ist es im Beichtstuhle sehr finster; die Orgel klingt, Alles ist in der Andacht. Mit dieser einen sündigen Magd wird der Titus doch wohl fertig werden.
So legte er denn das Ohr an’s Gitter.
Das Mädchen ließ gar nicht lange auf sich warten. Zuerst kam das Gebet von der offenen Schuld; dann kam ein Häuflein Sünden, lauter Scheidemünzen, wie sie so jedes ordentliche Beichtkind hat und haben muß. Dann stockte es.
Der Schäfer saß auf glühenden Kohlen. Es ist kein Grund da, um die Lossprechung zu verweigern; und spricht er los, so läuft sie hin und empfängt die Communion. Richtig, sie ist beim Abendgebet eingeschlafen, hat sie gesagt; ja, dann kann keine Lossprechung ertheilt werden, ehe sie sich gebessert hat. Schon will das der Titus mit verstellter Stimme sagen, da kommt das Beichtkind noch mit etwas vor. Es stottert und schluchzt. — „Ja, und dann, Hochwürden, daß — daß ich halt den Liebsten nicht vergessen kann,“ fährt das Mädchen heraus. „Und es läßt mir keine Ruh’ bei Tag und Nacht, und ich weiß, es soll nicht sein und ich hab’ mir’s selber gethan, ich bin übermüthig gewesen und er hat gemeint, ich mag ihn nicht und jetzt geht er in’s Kloster.“
Der Schäfer fährt zurück und lugt. Gottswahrhaftig es ist die Gais-Esther vom Fischgraben.
„Ich hab’ mir’s selber gethan,“ klagt das Mädchen wieder, „und jetzt weiß ich mir bei meiner Seel’ nit zu helfen und vergessen kann ich ihn halt nimmer.“
Sie schweigt und harrt erwartungsvoll, was ihr der Beichtvater wohl rathen mag.
Diesem wird’s schier selber dumm und er meint, der ganze Beichtstuhl hebe an mit ihm zu tanzen. Aber im Kerne ist der Titus eben gerade kein Narr, er merkt es sogleich, was diese Stunde bedeutet. Sein Herz drückt er mit aller Gewalt hinab unter die Bank. Dann lehnt er sich so hin und murmelt abgewendeten Antlitzes: „Hm, hm, das ist freilich[S. 35] bös’. Da müssen wir mehr darüber reden, liebes Kind, weißt Du was, komm heute um’s Gebetläuten in des Pfarrers Obstgarten.“
Das Mädchen schwieg eine Weile, dann stotterte es ängstlich: „Wär schon recht, ja, Hochwürden, aber im Obstgarten ist halt kein Beichtstuhl nicht und keinem Menschen will ich meine Sach’ anvertrauen, als nur dem lieben Herrgott.“
Da war es dem Schäfer im Beichtstuhl, als müsse er hell aufjauchzen. „Dein Liebster ist gewiß der Schäfer von der Birkenheide?“ fragte er flüsternd.
„Ei freilich ja, der Titus halt.“
„So kann ich Dir’s im Beichtstuhl sagen, er hat mich ja gebeten d’rum, der Schäfer ist bei mir in der Beicht gewesen; er geht nur desweg’ in’s Kloster, weil er Dich nicht kriegt; der läuft Dir noch nach in Dein Haus; denn schau wie er Dich lieb hat, Esther, glauben kannst es nimmer!“
Zum Glück hatte der Organist dem heiligen Michael zu Lieb’ alle zwölf Register aufgezogen, und so verstand die Esther den leidenschaftlichen Ausbruch des Beichtvaters nur halb. Und dem aus Rand und Band gekommenen Schäfer dünkte es die höchste Zeit, daß er das Kreuz schlage und den Schieber zuklappe. Die Orgel schwieg, die Vesper war aus, die Leute bliesen ihre Lichter ab und verließen nach und nach die Kirche. Auch die Esther schlich dem Ausgange zu, voll Sorg’ und Liebesnoth — und heut’ ist ihr am Beichtstuhl das Herz nicht leichter geworden.
Der Schäfer entschlüpfte seinem unheimlichen Verstecke, und als er wieder unter freiem Himmel stand im kühlen Berghauch und Abendroth und die Stämme der Birkenheide dort oben wie glühende Nadeln leuchteten, da that er einen Athemzug, mit dem er ein ganzes, neues, glückseliges Leben einsog.
Und wie der Beichtvater gesagt hatte, der Schäfer lief dem Mädchen noch an diesem Abende nach in ihr Haus — „denn schau, wie Der Dich lieb hat, Esther, glauben kannst es nimmer!“
Sie hat’s aber doch geglaubt und nach wenigen Tagen erhielten die grauen Brüder auf Birkenrinde geschrieben den Bericht: „Ich kann nicht kommen, ich hab’ mir ein Weib genommen und bleibe der Schäfer von der Birkenheide.“
n den Maien ist’s gut freien, hatte der junge Pastor Meneschild, der Curat von Schladernbach gedacht, hatte sich ein Weibchen genommen in den Maien.
Selbiges Weibchen war ihm lang genug arg im Wege gewesen bei den Sonntagspredigten; und wie der Aar mit seinem Blicke das Hühnervieh bannt, daß es vor Schreck und Angst erstarrt, so hatte das große schwarze Auge des Wirthstöchterleins vom Kirchenstuhl aus den sonst sehr erbaulichen Vortrag des Predigers oft nachgerade derart gehemmt, daß der gute Meneschild erröthend und erbleichend mitten im Text sein „Ewigkeit Amen“ sagte.
Solchen Zuständen mußte ein Ende gemacht werden, und das um so rascher, als der Kaufmannssohn und der Oberlehrer des Ortes auch täglich ihren Humpen beim Wirthstöchterlein tranken. Und das war um so verdächtiger, als gedachten Herren eine Nachbarschänke weit handsamer gelegen gewesen und der Wein in derselben zumeist viel vorzüglicher war, als das starke Getränke des Schladernwirths, das zum großen Theile weiter oben im Gebirge noch die Mühlen und Holzsägen trieb. Aber der Schladernwirth brachte jedes Getränke an den Mann, wenn er nur sein schwarzäugig Töchterlein Kellnerin sein ließ.
Das letzte Glas schenkte Fronele dem Herrn Pastor ein. Man sagt, er habe es nicht ausgetrunken, sondern habe, unbeschadet von demselbigen Glase, mit dem Mädchen und dem Schladernwirth den Hochzeitstag besprochen.
Gut soll die Hochzeit ausgefallen sein, doch hätten der junge Kaufmannssohn und der Oberlehrer des Ortes sich dabei viel zu oft die Ehre genommen, mit der Braut zu tanzen. Da brach der Herr Pastor — es war zur frühen Nachmittagsstunde — das Fest plötzlich ab und fuhr mit seinem Fronele davon. Beim Kaufmann kaufe sie nichts, lesen und schreiben könne sie, und er, der Pastor Meneschild, wolle mit seiner Braut allein sein. Von jeher war der Pastor ein Freund des Hochgebirges und im Hochgebirge wollte er seine Brautnacht feiern. Lustig rollte der Wagen durch das Thal, Gegenden zu, von denen die Braut sagte, sie seien sehr, sehr romantisch. Aber den guten Pastor Meneschild interessirte heute kein Stein, ergriff kein Wasserfall, rührte kein Röhren der Hirsche und Springen der Rehe. Den rechten Arm schlang er um seine junge Frau, mit dem linken deutete er auf eine noch ziemlich ferne Berghöhe: „Dort hinter jenem Berge, Fronele, liegt das Alpendörfchen, wo wir weilen werden. Du glaubst es gar nicht, wie es dort schön ist.“
Doch war es nicht so leicht, hinter den Berg zu kommen. Die Wege wurden steiniger, zerrissener, hie und da stürzte ein Wildbach nieder von den Höhen, denn im Hochgebirge schmolz der Schnee. Der Wagen mußte umkehren; das junge Ehepaar drang zu Fuße weiter und Meneschild trug sein herzig Bräutchen buchstäblich auf den Händen über manche Schlucht, über manches Wasser.
Ein Holzhauer kam des Weges, der erbot sich, mit seinen kräftigen Armen die junge Frau über die unwirthlichsten[S. 39] Stellen zu geleiten. Der Pastor schoß einen wüthenden Blick; was will denn dieser Mensch? Ich werde die junge Frau schon selber führen.
Der Weg ging durch malerische Schluchten einem entgegenbrausenden Wildbache entlang. Manches Donnern hallte in den Wänden, denn weiter drin im Gebirge stürzte manche Schnee- und Erdlawine nieder. Das junge Ehepaar rastete auf einem Stein. „Nicht wahr, das ist eine prächtige Hochzeitsreise, Fronele?“ sagte der Pastor und wiegte das Weibchen auf seinen Knieen.
„Ja freilich,“ antwortete das Fronele, „und wann gehen wir wieder nach Schladernbach zurück?“
„Du süßes Kind!“ entgegnete der Pastor, „bin ich Dir nicht genug?“
„Ei ja freilich bist Du mir genug!“ rief die Braut und tätschelte mit beiden Händen die glatten Wangen des Pastors, wie sie es als Schänkin gewohnt war, „Du bist ja mein Meneschild, schau, Du bist mein lieber Schatz!“
„Und Raum ist in der kleinsten Hütte!“ flüsterte der selige Pastor.
Sie gingen weiter; Fronele mußte das Kleid schürzen, es rieselte viel Wasser über den Weg. Selten dürften so zarte Jungfrauenfüße diesen rauhen Bergpfad noch betreten haben.
Der Wildbach wurde reißender und schwoll von Minute zu Minute. Und endlich kam unser Pärchen zu einem gar verfänglichen Punkt. Rechts hatte es die Wände und Klüfte eines Steinbruches, links den wüthenden Gebirgsbach, an dem jenseitigen Ufer unter dem Schatten eines Waldhanges stand eine Hütte. An dieser Stelle nun führte der Steig vermittelst eines schmalen Steges über den Fluß.
Der Pastor blieb stehen, starrte auf den schwanken Stegbaum, an welchem schon die Wellen brandeten und sagte in feierlichem Tone:
„Da stehen die —“
„Ochsen am Berge!“ ergänzte Fronele.
„Nein, am Wasser!“ berichtigte Herr Meneschild. „Rutschen wir auf allen Vieren hinüber, Fronele, Du bist eine flinke Schänkin, Du bist das Wasser gewohnt.“
„Nicht als Schänkin,“ gab die junge Frau den Spott zurück, „aber bei Deinen Predigten hab ich das Schwimmen gelernt.“
„Du Blitzmädel, Du!“ rief der Pastor lustig drein, „nicht sowohl meine Predigten sind wässerig gewesen, als aber meine Zähne haben mir gewässert, sah ich das Fronele sitzen im Kirchenstuhl.“
So waren sie guter Dinge; und von der Hütte her kamen ein paar Männer, Steinbrecher nach ihrem Aussehen, starke, verwegene Kerle; diese sollten nun dem Paare über das Wasser helfen. Sie prüften den Steg; der Eine trat ein paar Schritte auf den bereits gefährdeten Baum und streckte der ängstlich anrückenden jungen Frau die Hand entgegen.
„Der Herr soll dieweilen nur drüben bleiben,“ rief der Mann, „für drei Leut’ hält’s der Sakra nimmer!“
Sofort happerte das Fronele über den brausenden Bach und kam an der Hand des Steinschlägers glücklich an das jenseitige Ufer.
In demselben Augenblick aber, als der Mann schon zum zweiten Wagestück Anstalt machte, fluthete donnernd ein gewaltiger Schwall heran, Steine und Eisstücke und entwurzelte Bäume brausten nieder, hochauf bäumte sich der Steg und ging mit den wilden Fluthen — den Weg alles Zeitlichen.
Der Pastor hatte — um nicht selbst von dem Strome erfaßt zu werden — zurückspringen müssen, schier bis an die Wand. Nun er sah, der Steg war davongeschwemmt, und an diesem Abende plötzlich gelöst auf Erden, was Vormittag im Himmel gebunden worden — da schlug er die Hände zusammen über dem Haupte.
Die Männer jenseits des Wassers aber lachten derb und riefen, er, der Herr Pastor, möge sich gedulden, diese Fluth sei nur die Folge der Schneelawinenstürze und würde in wenigen Stunden vorüber sein; einstweilen möge er um das junge Frauchen keine Sorge hegen, es könne ausruhen in der Hütte und werde nach Möglichkeit gepflegt werden. Er, der Herr Pastor, selber möge sich in eine der Felsnischen setzen, und die Nacht, die ja nicht sehr lang sei, wohlgeschützt daselbst zubringen.
Auch Fronele legt ihre hohlen Händchen an den Mund und rief herüber, aber ihre Worte waren in dem Brausen des Wassers nicht zu verstehen. Sie wurde von den zwei Waldmännern in die Hütte geführt; der Pastor konnte es durch das Gestrüppe nicht sehen, ob sie willig ging, oder ob sie sich sträubte. Nun hub er an, und eilte das tosende Ufer auf und ab, aber er fand keine Brücke, die ihn hätte hinübergetragen in das gelobte Land. Und endlich konnte er gar nicht mehr vorwärts, das noch immer wachsende Gewässer erfüllte die ganze Breite und Länge der Schlucht; und er mußte wieder umkehren zum Steinbruch, wo er doch zum Mindesten das Dach der Klause sah. Wüthend nahm er seinen Stock und peitschte die Fluthen, wie jener morgenländische Feldherr; „was der Himmel zusammengefügt!“ rief er aus, „das sollst du nicht trennen!“ — Aber ach, die Elemente sind von jeher heidnisch gewesen, und so haben auch die Alpen[S. 42]wässer den Bibelspruch nicht verstanden, haben immer wüster gewirthschaftet, und von einem Hinüberkommen konnte gar keine Rede sein. Es begann bereits zu dunkeln.
Vor wenigen Wochen hatte der Pastor eine sehr schöne Predigt gehalten über den Werth und die Macht der Resignation. Er hatte dazumal an Einen Fall nicht gedacht: an eine Brautnacht ohne Braut; und die Resignation drohte nun der Verzweiflung zu weichen. Drohte aber nur, denn der Pastor Meneschild war stark. Er kletterte ein wenig den Felsen hinan, ob er nicht etwa doch durch das Fenster der Hütte seine Ehefrau erblicken könnte. Wohl kamen sie nun wieder aus der Klause hervor, die Männer, und auch Fronele mit ihnen.
„Fronele!“ seufzte der Pastor, da fiel etwas neben ihm nieder und zischte in demselben Augenblick in Flammen auf. Zündhölzchen hatten sie drüben an einen Stein gebunden und herübergeworfen, damit sich Robinson im Steinbruche Feuer machen konnte. Aber die Hölzchen entzündeten sich im Falle und verbrannten auch ein Streifchen Papier, auf welches Fronele einige Worte geschrieben hatte. Nur den süßen Namen „Fronele“ hatte das Feuer noch übrig gelassen in der Ecke, und diesen küßte nun der Pastor mit unsäglicher Inbrunst. Hierauf versuchte er, sich in Ergebenheit zu üben und machte Feuer. Das Feuer leuchtete hell in den Felsen und zeigte von fern nur, was der Einsiedler that, während das, was jenseits des Wassers vorging, in um so größerem Dunkel lag.
Wieder sauste ein Ding durch die Luft und bald auch ein zweites, ein drittes, Knollen fielen neben dem Pastor nieder und einer flog ihm sogar an den Kopf. — „Was? bewerfen sie mich noch mit Steinen, diese Vermaledeiten!“ brach er aus, aber bei näherer Prüfung waren es keine[S. 43] Steine, waren es Erdäpfel, die ihm mit dem Bedeuten, daß er sie zum Nachtmahl braten möge, zugeworfen worden waren.
Das rührte den guten Pastor und er gedachte mit frommem Sinne des Mannafalles in der Wüste.
Mit möglichster Gelassenheit genoß er dieses sein Abendmahl, dann horchte er, ob von der Steinschlägerhütte herüber denn gar nichts zu hören sei. Es rauschten die Fluthen, es donnerten die Lawinen im Gebirge; eine große Wildheit war in der ganzen Natur; nur die Sterne standen am Himmel.
Und daß der Himmel zu all’ dem noch lächeln konnte, das ärgerte den Herrn Pastor am meisten; die Zähne biß er aufeinander, und so legte er sich in einer Nische auf den Sand. Aber es war kein Ruhen und Rasten; sein Lebtag hatte er nichts so Hartes empfunden als dieses steinerne Bett. Ja, diese Nacht, die man sonst nicht zu den unangenehmsten Nächten im Leben zählt, hat der gute Pastor Meneschild stets als die schrecklichste Zeit seines Erdenwallens bezeichnet.
Um Mitternacht, in Folge eines sehr beunruhigenden Traumes, stand er auf und wollte in den Fluß springen; aber unverrichteter Sache kletterte er wieder in seine Nische zurück. In seiner Nische kniete er nun hin und betete, und lachte letztlich hell auf darüber, daß er durch die Hochzeit zu einem Einsiedler in der Felsenhöhle geworden sei.
Spätere Betrachtungen widmete er den Steinschlägern; die Männer hatten ihm just nicht sehr jung, aber auch nicht sehr alt geschienen; bärtig und sonngebräunt von Aussehen, mochten sie herb und keck sein, wie ihre Eisenhämmer. Mag schon ein Mann solchen Leuten im Walde nicht gern begegnen, um wie viel wehrloser muß ihnen ein zartes Weib gegenüberstehen. Die goldenen Ohrgehänge wären noch zu verschmerzen — aber wenn sie ihr den Brautring raubten...!
Nochmals sprang der Pastor auf und eilte hinab zu dem Fluß. Und siehe, in der Morgendämmerung sah er’s, das Wasser hatte abgenommen, gewaltige Steinblöcke, von Gischten umbraust, ragten aus der Fluth. Mit der Tollkühnheit eines Verzweifelten sprang er in schrecklichen Sätzen von einem Stein zum andern über den Fluß, und wie ein Löwe, der seinen Zwinger durchbricht, stürzte er der Hütte zu.
Die Thür war in Angeln offen, kein Mensch zu Hause. Vier bis fünf leere, zerdrückte Strohnester grinsten ihm entgegen; des Weiteren keine Spur von einem Bewohner.
„Entführt!“ stöhnte der arme Pastor und Hören und Sehen wollte ihm vergehen.
Da war es zur selbigen Stunde, daß ein helles Jauchzen erscholl drüben im Steinbruch. Herr Meneschild schlug sein umflortes Auge auf, und siehe, dort drüben, wo er diese entsetzliche Nacht verbracht, standen die Steinschläger und bei ihnen das Fronele.
Und in demselben Augenblicke kamen zwei geschwätzige Weiber mit Klaubholzbündeln hinter der Hütte herabgestiegen. Diese gaben sich mit Bücklingen dem Herrn Pastor als die Weiber der Steinschläger zu erkennen, die Früh in den Wald gegangen wären, um Holz zum Kochen der Morgensuppe zu sammeln. Ihre Männer aber seien noch früher aufgebrochen, um mit der jungen Frau Pastorin, die in der Heuscheune gut geschlafen habe, weiter unten einen Steg über den Bach zu suchen und auf diese Weise zeitig in den Steinbruch zu gelangen.
Und nun war neuerdings das Wasser zwischen den Eheleuten. Einen zweiten kühnen Sprung über die noch immer wüthenden Fluthen fand der Pastor nicht für gerathen und[S. 45] so harrte er im Angesichte seiner jungen Frau, bis ein neuer Steg geschlagen war. Dann aber stürzten sie sich in die Arme, als wären sie aus verschiedenen Welttheilen zusammengekommen.
Nachdem sie hierauf in der kleinen Hütte ein Frühstück genossen und sich von der Steinschläger-Familie zartsinnige Verschwiegenheit erbeten hatten, kehrten sie zurück nach Schladernbach und rühmten laut die kleine Hochzeitspartie im Gebirge.
In Schladernbach hatte es die Nacht zuvor einen Stegbaum ausgeschwemmt. Der Herr Pastor erkannte ihn insgeheim als den weggerissenen Steg vom Steinbruch. Er erstand das boshafte Stück Holz und will daraus zu Trutz eine Wiege bauen lassen.
ie Thür geht auf, in den Saal tritt der Institutsvorsteher.
„Anderlacher Franz!“ ruft er.
„Hier!“ antwortet ein zwölfjähriger Junge aus dem Pusterthale. Ja, das war der Anderlacher Franz, der Sohn des Hegers „unter der Alm“, den sein Vater nach Innsbruck geschickt hatte, um „geistlich“ zu werden.
„Ein Brief!“ sagte der Vorsteher.
„O je!“ riefen die andern Jungen, „ein blinder — der hat keine rothen Augen!“
Der Anderlacher Franz war fast der Einzige im Institut, der niemals einen jener Briefe bekam, welche durch die fünf rothen Augen des Petschafts den Empfänger so freundlich anlachen. Franzens Vater wußte nicht, daß ein Mensch, wenn er zu essen und zu trinken, ein Gewand und ein Dach hat, auch noch Geld brauchen könne. Sein Bauernhaus lag im Gebirge — für ein Bauernhaus zu hoch, für eine Almwirthschaft zu tief, für ein „Kleingütel“ gerade recht. Macht nichts. Wenn aus diesem Hause ein geistlicher Herr hervorgeht, dann hat es mehr, als seine Schuldigkeit gethan.
Nun, der kleine Franz drängte sich freudig zwischen seinen Collegen durch, um den Brief in Empfang zu nehmen.
Damit begab er sich eilig hinaus auf den langen Gang zu einer Stelle, wo durch das Hoffenster Licht hereinfiel; er wollte nicht, daß ihm beim Lesen ein neugieriges Auge über die Achsel gucke. Das Schreiben war zwar von seinem Vater, aber es war doch wieder nicht von seinem Vater — und die Genossen brauchen es nicht zu wissen, daß sein Vater nicht schreiben kann.
Und richtig, der Franz kennt die Schrift sogleich — der Herr Pfarrer von St. Agnes ist es wieder. Der gute alte Herr hat den Jungen selbst nach Innsbruck gebracht und seitdem schreibt er ihm Alles nach, was daheim vorgeht und was Vater, Mutter, Ahne, Schwester und Bruder ihm sagen lassen.
In dem heutigen Brief steht Folgendes:
„Lieber Franzel!
Ich hoffe, daß Dich diese Worte in guter Gesundheit finden werden, wie Du ja vernünftig bist, dieses größte Geschenk Gottes dankbar zu behüten.
Durch das Semesterzeugniß, welches Du Deinem letzten Briefe beigelegt, hast Du den Deinen und mir eine rechte Freude gemacht.
Besonders freut es mich, daß es mit dem Latein so gut geht; das Rechnen wird sich schon machen. Nur fort so, lieber Franz! Bei Deinen Eltern ist Alles wohlauf, Dein Vater sagte mir, daß die Großmutter schon die Wochen zählt, bis Du auf die Vacanzen kommst. Es sind deren nur mehr neun. Wir wollen dann recht heiter sein und darfst mir nicht jeden Tag auf den Berg hinauf, bleibst im Pfarrhof, und bis dahin wird auch die neue Kugelbahn fertig sein.
Bei Deinen Eltern daheim wirst ohnehin keinen Platz haben. Dein Vater, scheint es, will Dir die Sache nicht schreiben, aber ich muß Dir’s doch verrathen, was daheim vorgeht.
Vor einiger Zeit — ich glaube, es ist schon drei Monate — haben sie bei Dir daheim Einquartierung erhalten. Es ist unbequem und ganz absonderlich. Ein junger Mensch ist gekommen und der hat sich festgesetzt und läßt sich gar nicht mehr fortbringen. Und das nicht genug, er nimmt das ganze Haus in Anspruch und will bedient sein; ist dazu noch unglaublich wählerisch an Nahrung und Allem, was man ihm aus Güte thut — kurzum, er spielt den Herrn im Hause. Die Leute müssen noch freundlich mit ihm umgehen und allerlei Rücksichten beobachten — ich weiß nicht, ob sich der junge Student mit diesem Menschen wird vertragen können.
Nun, es wird sich Alles thun, Franzel, bleibe nur hübsch brav und vergiß nicht auf Deine Eltern und auf Deinen väterlichen Freund
Josef Paumgartner,
Curat zu St. Agnes.“
Dem Briefe beigelegt, in ein feines Papier gewickelt, war ein Guldenschein, über den sich der Knabe den Kopf zerbrach, was der Pfarrer von St. Agnes aus der Stadt dafür geschickt haben wollte. Im Schreiben fand sich darüber keine Bemerkung.
Aber noch mehr Kopfzerbrechens verursachte dem Burschen der Bericht über den seltsamen, fremden Menschen, der in sein Elternhaus gekommen sein soll. Warum ihn nur der Vater nicht fortschickte, wenn er so herrisch und zuhabig ist? Im Hause ist ohnehin nicht überflüssig viel Sach’, was soll[S. 49] noch ein Fremder mitschmarotzen! Ob denn der Vater etwa einen Gläubiger hat, der sich so unsauber eindrängt? Ob er nicht gar etwa das Haus an Jenen verkauft hat? — Nein, nein, heimlich, das thut der Vater nicht. Der hat kein Geheimniß vor der Mutter und die Mutter hätte sicherlich Alles schreiben lassen.
Oder? —
Jetzt hatte er’s und das war’s, das mußte es sein — albern, daß es ihm früher nicht eingefallen. Ein Executions-Soldat. Hatte der Vater nicht so oft erzählt von Executions-Soldaten, die vom Amte dem Bauer in’s Haus geschickt werden, wenn der nicht zur rechten Zeit die Steuer erschwingen kann? Werden in’s Haus geschickt und bleiben sitzen und lassen sich gut geschehen und spielen den Herrn, bis das Geld erlegt wird. Und da bläht sich hernachen so Einer auf, und je mehr er — sagt der Vater — in der Kasern’ hat kuschen müssen, desto närrischer stranzt er sich und muß Alles zuweg sein, was er verlangt. — Der Franzel selber hatte einen solchen Schüsselreiter gekannt. Ein Kroat war’s, konnte auf deutsch nur Braten, Butter und Kuchen sagen und wenn die Mutter nicht jeden Tag damit aufzuwarten vermochte, Etliches auf deutsch gotteslästerlich fluchen. Der Vater fand sich beim Steueramt um einige Gulden im Rückstand, weil das für dasselbe Jahr verkäufliche Stück Vieh in einen Abgrund gestürzt war. Nun blieb der Soldat so lange im Haus, bis der Anderlacher bei guten Nachbarsleuten das Geld zusammengebracht hatte. Das währte wochenlang, der Kroat aß dreimal so viel auf, als was das Steuergeld ausmachte, lag größtentheils auf der Ofenbank und vernebelte des Vaters Tabak oder er ging im Kuhstalle um und stellte der Magd nach, die vor ihm kreischend davonlief, wie die[S. 50] Henne vor dem Geier. Bis endlich das Steuerbüchel gedeckt war, hatte der Kerl auf gut deutsch schelten gelernt und ohne „Vergeltsgott“ und ohne „Dankdirgott“ ist er davon gegangen.
Kein Zweifel, so Einer hält auch jetzt das Elternhaus belagert, so Einer liegt ihnen auch jetzt in der Schüssel, auf der Ofenbank und weiß Gott wo sonst überall herum.
In einem nächsten Brief nach Hause stellte der Anderlacher Franz unter anderen die zwei Fragen: „Ist der lästige Mensch noch im Haus und was soll ich dem Herrn Pfarrer für den geschickten Gulden einkaufen?“
Antwortete wieder der Pfarrer: „Der Mensch ist immer noch im Hause und der Gulden, lieber Franzel, gehört Dein. Wenn ich Dir’s nicht geschrieben habe, so hättest Du Dir’s selber denken können. Heute liegt das Geld zur Heimreise bei; sei vorsichtig. Im Posthause zu Brixen frage dem Hans Halbscheid nach, mit dem fahre bis Bruneck. Wir erwarten Dich mit Freuden.“
Ein herzensguter Mann, der Herr Pfarrer — aber diese verdächtige Einquartierung daheim!
Die Vacanzen sind da.
Als der Franzel sein Zeugniß bekommt, muß er an sich halten, daß er nicht laut aufjauchzt; das thäte sich im Lehrsaal doch nicht schicken. Der Franzel ist in seiner Classe der Erste.
„Das giebt noch einen Bischof,“ scherzte der Professor. „Vor Zeiten zwar hat man den Frömmsten dazu gemacht, aber heute steckt man den Gescheitesten unter die Schnabelhaube. Mußt Dir aber nichts einbilden, Anderlacher.“
Bischof hin und Bischof her — der Franzel geht jetzt heim auf die Alm. Da giebt’s Vogelfangen zu stellen, Forellen zu fischen, zu reiten auf des Kronenwirths Braunen und die[S. 51] Kugelbahn ist auch fertig! Vielleicht läßt sich sogar mit dem Executionssoldaten was anfangen: leiht er nur sein Gewehr — im Schachen giebt’s Spatzen.
Flink packt er seine sieben Sachen in eine Handtasche, hängt um sein graues Jäcklein mit dem Sammtkragen, das Seitentäschchen, birgt noch die Reisedecke in den Wagen und den großen Regenschirm. Oh, dieser Regenschirm ist seine Pein; was hat er dieses Schirmes wegen schon für Verfolgung ausstehen müssen! Aber die Mutter hat’s nicht anders gethan, hat gesagt, als er fort nach Innsbruck ging, sie hätte keine ruhige Stund’, wenn er den Regenschirm nicht mitnehme, man wisse niemals, was für ein Wetter einfalle. So nahm der Junge das Unding, das größer war, als er selber, unter den Arm und trug es in die schöne Stadt Innsbruck. Dort bei den Collegen ging das Gehetze los, sie nannten ihn den Paraplui-Jackel und wenn er den Schirm einmal aufspannte, so drängte sich die ganze johlende Rotte unter denselben herbei und sie stießen ihn hin und her wie Böcke. Es war keine Ruhe, bis der arme Franzel den Schuldiener bat, das rothe Ungeheuer zu verbergen. Aber wie die Mutter gesagt hatte, daß er den großen Regenschirm mit nach Innsbruck nehmen solle, so hatte der Vater ihm eingeschärft, daß er denselben wieder nach Hause bringen müsse. Darum wählte nun der Student zur Abreise eine dunkle Abendstunde und noch einmal schwang er sein Tuchkäppchen mit dem glänzenden Schildchen zum Scheidegruß der schönen Hauptstadt von Tirol — und fröhlich ging’s der Heimat zu.
Was waren ihm die Berghöhen so sonnig und die Morgenschatten so thaufrisch! Was wuchsen ihm an den Füßen die Flügel, gleich dem steinernen Knaben auf dem Hause der Handelsschule zu Innsbruck, was ging ihm das Herz auf!
An der Siller schnitt er sich einen Haselstock, den braucht er unterwegs, und kommt er heim, so mag’s etwan auch nicht schaden, wenn der fremde Mensch sieht, er bringe so was mit.
*
**
Am Samstag-Abend ist’s, vor Jakobi.
Im Hause unter der Alm ist’s schon um drei Uhr Feierabend. Der Samstag-Abend gehört unserer lieben Frauen. Der Hausvater läßt die Arbeit im Walde ruhen, kommt hemdärmelig, wie er an Sommertagen stets umgeht, in’s Haus. Auf dem Filz hat er auch immer die Hahnenfeder, die holt er sich gelegentlich selber von der Luft herab. Mit heiler Haut kommt er selten vom Hage heim, hat’s an den Kleidern keinen Riß, so giebt’s am Finger eine Schramme. Es ist wohl wahr, er ringt mit der Arbeit trotz, wenn er dabei ist. Ihr seht auch kein Fleckel an seiner Hand, an seiner stets luftigen Brust, an seinem Gesicht, auf welchem nicht einmal eine Wunde war. Vernarbt und verwegen sieht er aus, der knorbelige Mann mit dem buschigen Schnurrbart; da er jetzt in die Stube tritt, sagt er zu seinem Weibe: „Du, Mutter, klenk’ (nadle) mir das Leible z’samm!“
Wahrhaftig, das Leible ist arg auseinander, aber die Hausfrau setzt sich auf den Schemel: „Na, duck’ Dich her, Vater!“ und bald ist Alles geschlichtet.
Jetzt schickt er sich an, seine Pfeife zu laden — geschnitzt hat sie der Rinleger-Sepp. Und das barfüßige Tonele muß mit dem funkelnden Stahlzänglein in die Küche um eine glühende Kohle. Dieweilen kommt schon das Büble gesprungen, klettert auf des Vaters Knie, will „reiten nach Wien, in die Kaiserstadt hin“, und das Maidle kettet dienstfertig des Vaters Lendengurt loser und das Kleinste — das erst seit Kurzem[S. 53] seine eigenen Händchen entdeckt hat, und wie sie brauchbar sind zum Anpacken — langt nach der Pfeifen-Quaste oder gar kecklich nach dem „Schnauzbart“, unter dem von Zeit zu Zeit — der Anderlacher ist haushälterisch im Genuß — ein dünnes Rauchwirbelchen hervorquillt. So sitzt er mitten unter den Seinen und schaut ernsthaft drein — aber inwendig, da schmunzelt sein Herz. Er spricht nicht von Glück, aber er hat es.
Warum nur die Weibsleute keinen Feierabend haben?
Der Rinleger Sepp ist ein alter Spintisirer, der erklärt Alles, der weiß auch, warum an Samstagen die Weibsleute keinen Feierabend haben, sondern bis spät in die Nacht in Haus und Scheuer beschäftigt sind, während die Mannsleute schon ihren Vergnügungen nachgehen, oder ihrer Ruhe obliegen. „Denen mit dem langen Haar und mit dem kurzen Verstand hat Gott desweg die Samstagsrast versagt, weil sie doch nicht thäten rasten, sondern vor dem Spiegel stehen und Haar flechten und Hoffart betreiben. Da ist’s gescheiter, Kübel waschen, Töpfe scheuern und Fußboden reiben. Wollen sie schon was putzen, so ist’s von wegen der himmlischen Freud’ besser, sie putzen was Anderes, als sich selber.“
Das Maidle soll noch mit dem Garnsträhn fertig werden, der über den Haspel gespannt ist; denn wenn über den Sonntag im Hause ein unabgezogener Faden bleibt, sei’s am Rocken, sei’s am Haspel, sei’s am Spulen, sei’s beim Nähkorb — so kommt gleich die Maus der Gertrudis und beißt den Faden ab oder webt allerlei Verdruß hinein.
Die Anderlacherin hat eben auch keine Ruh’, sie ist ein recht „g’schmackiges“ (anmuthiges) Weibchen, sie schafft an der Wiege. ’s ist ein süß’ Geschäft, süßer als Feierabend. —
Das sagt auch die alte Ahndl (Großmutter), die sich ebenfalls um die
Wiege zu thun macht und nicht eher Frieden findet, als bis sie den
Platz erobert hat. Der „süße Namen“ JI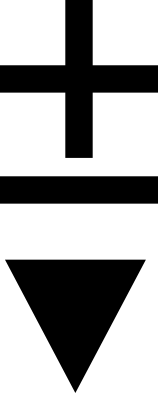 IS, der zu Häupten der
Wiege gemalt ist, macht’s nicht aus; aber das Büberle, das Lieberle,
das drinnen liegt! Geschaukelt will der kleine Martin sein, wenn er den
Leuten den Gefallen thun soll, jetzt, da noch die sonnengoldigen Bäume
zum Fenster hereinschauen, schon zu schlafen.
IS, der zu Häupten der
Wiege gemalt ist, macht’s nicht aus; aber das Büberle, das Lieberle,
das drinnen liegt! Geschaukelt will der kleine Martin sein, wenn er den
Leuten den Gefallen thun soll, jetzt, da noch die sonnengoldigen Bäume
zum Fenster hereinschauen, schon zu schlafen.
„Kindlein haben gut schlafen,“ meint die Ahndl, „Kindlein träumen immer vom Himmelreich.“
Sie schaukelt und singt:
Das alte Mütterlein lullt sich dabei schier selber in den Schlaf, das Martinele hingegen thut die Aeuglein hell auf und zappelt mit den Beinchen unter der Decke und just heut’ will es nicht zur Ruh’ kommen.
’s ist aber auch kein Fried’ im Haus — ein ketzerhaftes Poltern vor der Thür und schnurgerade will der Hund von der Kette ab und — sonst doch so ein gescheites Thier — bellt er und winselt heute, wie närrisch.
„Geh’ Maidle, schau, was draußen hergeht.“
Das Maidle macht kaum die Thür auf: „Herr Jesseles, der Franzel!“
Ein Geschrei durch’s kleine Haus: „Der Franzel ist da!“
Ein Herbeistürzen aus der Küche, aus der Kammer, vom Hofe herein. Nur der Vater — so sehr ihm auch die Freude aus den Augen leuchtet — trottet langsam, er weiß, der Junge läuft ihm nicht davon. Die Mutter, schier schämig vor dem Herrn Sohn, wischt mit der Schürze den Arm, daß er tauglich wird zum Willkomm; sie denkt: ein bissel wird sie wohl schon geweiht sein, seine Hand. Das geschäftige Maidle hat ihm die Reisetasche abgenommen und den Regenschirm — gottlob, diesen Regenschirm! Vom Kronenwirth die Burga bringt den Handsack herein. So kommen sie zusammen..
„Gott Ehr’ und Dank, daß Du nur da bist!“ schreit die Mutter.
„Grüß’ Gott, Franzel!“ sagt der Vater schmunzelnd.
Der Franz sagt gar nichts, er lächelt nur ein wenig und da hat er richtig noch seine beiden Grübchen hinter den Mundwinkeln! — Man weiß nicht, ob sie sich Alle die Hände gedrückt haben; Kuß hat’s keinen gesetzt. So ein Küssen ist nicht der Brauch dort im Gebirge, wo die Tannen wachsen.
Die Ahndl ist im ersten Freudenschreck in den hintersten Ofenwinkel gerannt und an ihre Rockfalte hat sich das größere Knäblein geschmiegt, dem ist diese Rockfalte zu aller Zeit der sicherste Hort. Nun schleicht das Mütterchen mählich hervor und luget unter der Achsel dessen durch, der dort Vater, hier Sohn ist, ihr Kind, das ihr die anderen Kleinen in den Arm gelegt. Sie luget auf den Franzel hin.
„Gewachsen!“ murmelt sie, „gottunmöglich gewachsen!“ Und endlich fällt sie drein mit ihren Herzensworten und hält dem schönen heimkehrenden Enkel zitternd die alten Hände entgegen.
„Und bist heut’ schon von Bruneck her?“ fragt der Anderlacher. Drauf ist die Sprache vom Wege und daß er rechtschaffen steil ist und ob der Brunecker Postmeister den Schimmel vom Kronenwirth noch habe? — Was schiert er sich jetzt um solche Sachen, der Anderlacher, aber er will reden und es fällt ihm gar nichts Anderes ein. Das alte Mütterlein kann sich länger nicht mehr halten. „Du Franzel“, lispelt sie dem Jungen zu, „jetzt haben wir aber Einen im Haus, den Du noch gar nicht kennst!“
„Ja richtig!“ sagt der muntere Student, „der Pfarrer hat mir’s geschrieben, hat sich der Kerl noch nicht getrollt?“
Sie schauen sich gegenseitig an.
„Sicherlich wieder so ein Soldat?“
Jetzt wendet sich die Mutter, daß der Blick frei wird auf die Wiege, jetzt hebt sie das kleinwinzige Martinele auf: „Ja, Franz, der ist gekommen, dieweilen Du z’Innsbruck bist gewesen.“
Da macht der Bursche große Augen: Der!
„Er will Dein Bruder sein,“ sagt die Mutter.
Der Franz ist still und macht ein merkwürdig herziges Gesicht. — Noch in der Reiserüstung streckt er lächelnd die Arme aus nach dem Brüderchen. Aber der Kleine sträubt sich baß, stemmt das nackte Händchen trotzig gegen des Angreifers Brust, dann halb in Furcht und halb im Vertrauen blickt er ihm wie sinnend in’s braune Auge und jetzt will’s ihm schier bedünken, dem kleinen Martinele, der junge Mann hätte gute Aehnlichkeit mit dem Tonele, mit dem Maidle und Allen.
Der Maler — Franz Defregger ist sein Name — hat diese liebliche Scene geschaut und in einem Bilde, „Die Brüder“ genannt, zu unserer Lust dargestellt.
Und das kleine Martinele, ein wenig zurückhaltend noch, aber im Ganzen nicht ungern trachtet es hinüber zu Dem, der es so liebherzig anblickt.
Glücklich ist die Mutter und der Vater luget gar stolz und vergnügt auf seine zwei Buben, als wollt’ er zu jedem der beiden sagen: Schau, da hab’ ich auch noch so Einen! — Ja, Gottlob, die Tiroler kommen nicht ab; unter der Alm stehen sie nach der Orgelpfeife, und der Rosenkranz, noch ist er nicht zu Ende! Drauf schielt er so schalkhaft hin, was sich der zwölfjährige Bursch’ nur dabei denken mag. Und dem Großmütterchen wird jetzt warm bis in die Zehenspitzen hinab und sein altes Auge leuchtet noch einmal auf und sein Fühlen ist Segen und nichts als Segen für die Brüder, die sich so gefunden. Wie ihre Arme, so sind nun ihre Leben in einander verschlungen, sie werden zusammenstehen in unlöslicher Brüderlichkeit auf dieser harten Welt. Großmutter sieht den Tag, da steht das Martinele vor dem Altare in der Kirche zu St. Agnes, aber nicht mehr so klein als heute; zu seiner Seite die Braut, rechtschaffen und schön — und aus der Sacristei kommt der Bruder, der geistliche Herr, und giebt, treuen, feuchten Auges wie heute, dem Martinele das, was er selbst nicht hat — ein liebes Weib.
st sie daheim, die Kühgretl?“ rief eine schnarrende Männerstimme zum Fensterchen herein in den Stall, „ein Briefel von der Post hätt’ ich da, gehört der Margarethe Krautwascherin. Schreibst Dich ja so, Gretl?“
Die junge, rothwangige und flachshaarige Magd, die just unter der scheckigen Kuh saß, den Melkzuber zwischen den Beinen, erhob sich jetzt: „Die bin ich, die Gretl, ja freilich bin ich sie, und von wegen — gelt, Er ist so gut und thut ein Eichtl warten, da muß ich wohl den Bauern fragen, ich sag’, ’s steht wo zu lesen und er wird’s wissen, wie ich mich schreiben laß’. Mich däucht wohl, Krautwascherin, ja, mich deucht wohl.“ Und etwas leiser, zutraulicher: „Auf dem Briefel steht’s ’leicht d’rauf? Und von wem denn?“
„Gar von einem Kaiserlichen. Ist zu weiten Landen, kann selber nicht mehr durch’s Fensterl rucken, ruck halt Du, sein Briefel, hinein. Wirst ihn nix kennen, Gretl, Hans Kinigl heißt er.“
„Uh Jessas, aber na!“ jauchzte das Mädchen auf, „bin ich aber erschrocken! Auweh!“ Die Milch sickerte zur Hälfte auf die Streu. Dann leise murmelnd: „Jetzt hab’ ich aber Schaden than, uh mei, jetzt hab’ ich Schaden than!“
Der Bote war fort. Die Gretl wischte ihre Arme und Finger säuberlich an der Schürze ab, und nahm dann völlig furchtsam das Brieflein vom Fensterbrett. Sie guckte es an, sie kehrte und wendete es: „Mein Lebtag, der Hansl hat geschrieben. Und verpetschirt ist er auch, ganz verpetschirt. Wer macht mir ihn auf? Ich nicht, ich trau’ mich nicht d’rüber.“ Sie guckte noch lange, sie ging in den dunkelsten Winkel, weil die Scheckige gar so interessirlich herüberglotzte. „Brauchst derweilen just nicht Alles zu wissen.“ Im Geheimsten öffnete sie den Brief mit Müh’ und Noth — was er denn schreibt, wie’s ihm denn geht? Gesund wird er mir leicht doch sein. — Daß er gar zuletzt muß kriegführen gehen!?
Die Kuh schellte an der Kette und schnupperte. Sie kannte den Hans recht gut; wie er in derselbigen Nacht stecken blieben ist im Fenster, das ist eine dicke Glasscheiben gewesen.
Endlich war der Brief offen, entfaltet und überrascht rief die Gretl aus: „Der Närrisch, das ist aber ein rechter Närrisch!“ Sein Conterfei war oben an der Ecke des Briefes, sein leibhaft Conterfei mit dem Czako, dem weißen Röckel und der blauen Hose, frisch und hell gemalt, und der Schnurrbart dabei. „Jegerl, uh mein! Aber sauber ist er, freilich wohl rechtschaffen sauber. Und wie er ihm gewachsen ist, so viel gewachsen, der Schnauzbart! — Na, der Hansl, was wird er denn schreiben? — Jessas, jetzt kann ich nicht lesen! Wer hätt’ mir’s denn gelernt? Daß so ein Briefel kunnt kommen, auf so was hätt’ Eins von Klein auf ja gar keine Gedanken. Aber na, daß ich nicht lesen kann!“
Sie preßte das Papier wohl zum Mund und langsam glitt die Hand damit nieder gegen den Busen so jung,[S. 60] und zart — ließ den Brief dort ruhen. Plötzlich aber zuckte sie ihn weg: „Sapperwald, Hansl, das darf nicht sein! Nein, Hansl, das darf nicht sein!“ Und noch lebhafter flüsternd: „Ich bitt’ Dich um Alles in der Welt, sein darf’s nicht!“ — Dann später, wie aus einem Traum erwachend, ruhig: „Weil Eins meint, er wär’s selber — wie er da so sauber gemalt ist.“
So lehnte sie im dunkeln Winkel an ihrem Bettchen. Da zeterte draußen vom Hause her plötzlich eine Stimme: „Gretl, ja weiger, was ist denn das heut’, bist ’leicht in den Milchzuber gefallen? Hast keinen Fuß nit? Hast keinen? So ein junges Mädel wie Du, hat meine Mutter allfort gesagt, soll nit so lang müßig sein, als eine Taube ein Korn aufpickt. Ich, wie ich in den jungen Jahren bin gewesen, über drei Zäun’ bin ich gesprungen, hab’ ich ein Federl sehen liegen. Und heutzutag — Muß ich Dir weiter helfen vom Kuhstall heraus?“
Die Bäuerin war’s. Schnell verbergen den Brief unter dem blauen Busenlatz, an dem heut’ ein Schnürchen war zersprungen, und der Arbeit zu. Im Dienst, im Bauerndienst! ’s ist halt eine schwere Sach’; wenn so ein Mägdelein auf einen Buben wollt’ denken, beileib nit, das wär’ Sünd’, so viel Sünd’!
Die Gretl hat an demselbigen Tag Alles verkehrt angefaßt. Die Streu im Hof kratzte sie mit der Mehlschaufel zusammen, und als sie auf der Tenne Korn in den Mühlsack fassen sollte, wollte sie es mit der Streugabel thun, und als sie zu Mittag die Suppe salzen sollte, da hat sie das ganze Salzfaß in den Waschkessel geschüttet. Sie hatte ja das ungelöste Räthsel des Schreibens auf dem Herzen — die arme Gretl.
Am Nachmittag, als sie die galten zwei Kühe einspannte und damit auf die Granitzwiese um Futter fuhr, sagte sie zu sich selbst: „Die Christl kunnt schon lesen, sie braucht ja ein Betbüchel in der Kirch’, die Christl.“
Die Christl war des Schwanenwirths Weiddirn, die an Kirchtagen auch die Gäste bedienen half, die auch den Hans Kinigl kannte, rechtschaffen gut kannte. Und die Christl war Gretl’s G’spanin, wenn’s am Frohnleichnam zum Kranzelaufsetzen kam. Indeß, ohne daß Eine von der Andern wußte, allbeide waren dem Hansl verbunden; er hat nie was d’rein geredet, wenn sie, weiß gekleidet, das Kranzel im Haar, bei der Procession gewesen sind; er hat, wie’s ja Recht und Sitte ist, die Knöpfchen seines Rosenkranzes abgebetet und nicht ein Wörtl hat er geplaudert.
So ist er nachher gestellt worden, haben ihn abgemessen — er ist halt lang genug gewesen — ist blieben beim Militär. Ein sauberer Soldat ist er worden, der Kaiser nimmt halt von seinem Land’ die schönsten Leut’. Ich thät’s auch. Jetzund ist seitdem schon ein ganzer Sommer vorbei.
Die zwei Kühe trotteten hin über den Steinweg, der Granitzwiese zu, und der Karten knatterte und die Gretl, die drauf saß und in süßen Gedanken war, wurde recht arg dabei geschüttelt. Freilich so ein Schütteln und Hopsen ließe man sich gefallen, wenn Eins nur das Lesen hätt’ gelernt. Versterben kunnt man, hat man seinen Brief in der Hand und weiß nicht, was er Einem schreibt.
Sie war schon dort, wo der Wald aufhört und die Wiese anhebt — that sie auf einmal einen Juchschrei und sprang vom Karren. Sie hatte die Christl gesehen, die hinter dem Zaun drüben Eschenlaub sammelte.
„Bist ’leicht auch da, Christl?“ schrie sie hinüber, „geh’, magst nicht ein Eichtl herüberhupfen zu mir, ich zieh’ Dir zwei Stangen aus.“
Aber die Stangen waren störrig und die Lücke in dem Zaun nicht so leicht gemacht. So lehnten sich Beide nur daran und ließen die Stangen und Stecken, wie sie waren, dazwischen.
„Wirst es nicht meinen, ich hab’ was Neues bei mir,“ sagte die Gretl freudestrahlend, „einen Soldatenbrief von Hans — ja von Hans, freilich, und sein Pultree (Porträt) ist auch dabei, und für mich, für die Margaretha Krautwascherin gehört er, der da — der Soldatenbrief.“
Die Christl hatte mit beiden Händen emporgezuckt: „Geh’, laß schauen!“
Sie sah den gemalten Krieger an. Sie steckten die Köpfe zusammen, Christl’s Hände zitterten fast und wollten der Andern das Papier aus den Fingern zerren.
„Na, Du, auslaß ich ihn nit!“ sagte Gretl, „aber dasselb’ bitt ich Dich, lesen thu mir ihn; kannst dafür wissen, was d’rin steht. Gelt, Christl, lesen, das wirst mir nicht versagen, nit, gelt?“
Da versetzte die Andere: „Weißt, Gretl, das ist halt so, sagen will ich Dir’s wohl, wie’s ist. Drucklesen schon, aber Schriftlesen, weißt, das hab’ ich halt nicht gelernt. Vom Herzen gern, daß ich’s thät.“
Die Gretl war durch dieses Wort niedergeschlagen. „Ja so,“ sagte sie dann kleinlaut, „das Schriftlesen, dasselb’ kannst nicht. Das ist mir aber schon rechtschaffen unlieb; jetzt, was heb ich an? — Ja so, nur Drucklesen. Und Schriftlesen, dasselb’ nicht, meinst. Nu, wenn Du’s halt nicht kannst. Aber na, ich weiß mir jetzt frei keinen Rath. Ich weiß mir keinen[S. 63] Menschen in der Gemein und ich trau’ mich nicht; freilich trau’ ich mich nicht. — Ging Dir halt nicht von statten, meinst, das Schriftlesen? Wenn Du’s aber dennoch in Gottesnamen thät’st probiren — leicht ging’s, Christl.“
„Einen thät’ ich wohl wissen, der’s kunnt,“ sagte die Christi nach einigem Nachdenken, ein wenig unsicher, wie lauernd; „will Dir’s wohl sagen, der alt’ Schmiedrochel ist ein grundgelehrter Mann.“
„Der alt’ Schmiedrochel, meinst?“
„Kennst ihn doch, den alten, tauben Mann — stocktaub — kennst ihn ja.“
„Freilich wohl, aber — Christl, weißt, das ist so, der soll’s halt nit wissen, das mit dem Hansl. Mein Vormund ist er, der Rochel.“
„Um so besser,“ rief die Christl.
„Nein, ich — weißt, er soll’s halt nicht wissen, und — wirst steh’n bleiben, Scheckin! Obst mir gleich steh’n bleibst, Scheckin! — Er leid’ts nicht, daß ich mit dem Hansl was hab’ — ich weiß, daß er’s nicht leid’t — freilich nit.“
„So braucht er auch von der ganzen Geschicht’ nichts zu wissen,“ sagte die Christl wie schalkhaft; „mußt ihn den Brief denn gerad’ still lesen lassen? Laut soll er ihn lesen, Dir vorlesen soll er ihn, und ich sag’ Dir’s, bei seiner Taubheit, er versteht kein Wort davon — kein Wort.“
Da hob die Gretl ihr frisches einfältiges Gesichtchen: „Meinst? Ja — weißt, ich versteh’ das zu wenig, hab’ mein Lebtag keinen Buchstaben angeschaut, mein Lebtag keinen. Aber, ich hätt’ doch gemeint, wenn er den Brief selber lesen thät’, daß er’s ’leicht wissen kunnt, was d’rin steht.“
„Aber ich bitt’ Dich gar schön, Gretl, was Du heut’ für einen Unsinn redest! Wenn er laut liest und kein[S. 64] Wort hört, wie soll denn das sein, auf alle Mittel und Weis’!“
„Ja freilich wohl, ich laß’ Dir’s gern gelten.“
„Sagst halt, mußt ihm’s aber ordentlich in’s Ohr schreien, mir thät’ er zugehören, der Brief, von meiner Muhm in Kirchbach, und ich hätt’ Dich damit geschickt und ließ ihn bitten, er soll Dir ihn lesen, daß Du mir’s kunnt’st sagen, was d’rin steht.“
„Das ist gescheit — wird wohl gescheit sein,“ versetzte die Gretl, „bist ein’ ausbündige Dirn, Du. Du wärst die Erst’ bei der Hochzeit, thät’ mich der Hansl heiraten. — Wie’s aber grasen, meine Küh; wollen ’leicht das Futter lieber im Magen, wie auf dem Karren heimbringen. Schaut völlig so aus. Dank Dir Gott, Christl, für den guten Rath, und laß Dir Zeit und Weil zum Laubrechen — ja, laß Dir Zeit!“
Das Mädchen eilte zu den Kühen, mähte das Futter, füllte den Karren in hoher Schichte, spannte an, fuhr heim.
Die Christl aber lauerte hinter dem Zaun und kicherte: „leicht ist sie wirklich so dumm und zeigt den Brief ihrem Vormund. Und weiß der alte Luzifer die Geschicht von Hans und Gretl, nachher stehen die Zwei nimmer zusammen. Nachher, mein lieber, sauberer Schatz, weiß der Briefbot’ mein Fensterl auch zu finden. Hi, Hansl, hott, Gretl!“ Und laut: „Kei (kippe) die Fuhr nicht um, Gretl!“
„Selb gieb ich schon Acht, freilich, selb gieb ich schon Acht!“ rief diese noch aus dem Walde zurück.
Die gute Gretl ging neben ihren Kühen her. Wieder zog sie das Briefchen hervor: „Schau, Scheckin, das schickt mir der Hans!“ Sie hielt das Papier den Rindern hin, diese glotzten es an, lesen konnten auch sie nicht.
Und als es Feierabend war, schlich die Gretl fort vom Haus, wo sie diente, und hinein in die Thalschlucht gegen die kleine Schmiede. Aus dem Schornstein sprühten Funken, der Alte war noch in der Werkstatt.
Mit Bangen und Zagen nahte sie ihrem Vormund, ihrer einzigen Stütze, seitdem Vater und Mutter gestorben.
„Die Dirn ist da,“ brummte er, als sie in die Schmiede trat. Mägde und Weibervolk genug, aber „Dirn“ gab’s ihm nur eine einzige auf der Welt, seine Mündel; Dirn, das war ihm der zärtliche Ausdruck für Schützling, Tochter, Kind.
Ehe das Mädchen noch ordentlich über die Schwelle kam, es stolperte schier, rief es: „Von der Schwanenwirth-Christl bin ich geschickt, den Brief da soll mir der Vatermann lesen und laut, das ich’s ihr kann sagen, der Schwanenwirth-Christl.“
Dreimal mußte es die Worte dem Alten in’s Ohr schreien, ehe dieser seine rußigen, mächtigen Glasaugen hervorholte.
„Was wird’s denn sein? So einen Brief lesen, wird auch just keine Hexerei sein!“ Er machte sich aber doch wichtig.
„Von der Schwanenwirth-Christl ihrer Muhm’ ist er!“ rief das Mädchen befangen schnell.
Der Alte wendete sich gegen die ausschnaufende Esse, daß der Brief, den er nun öffnete, roth beleuchtet war: „Kreuz und Eisenstern übereinand, da ist ja gar ein Kaiserjäger oben!“
„Halt ja, ein Soldat, halt ja,“ zitterte die Gretl, „der Schwanenwirth-Christl ihrer Muhme ihr Sohn.“ —
„Der Schwanenwirth-Christl ihrer —“
„Muhme ihr Sohn. Ja freilich, freilich wohl. Laut, nur gleich laut lesen, weil — weil ich nicht recht Zeit hab’. Muß gleich wieder heim, aber gleich wieder.“
Der Alte verstand kein Wort. Er las bereits. Mit dem einen Fuß trat er den Blasebalg, daß er an der Esse eine Leuchte hatte. Mit dem andern stand er fest, recht fest. „Du verschwefelt’s Volk!“ rief er plötzlich. „Also vorlesen soll ich Dir die Schrift, vorlesen? Recht gern. Innigstgeliebte Margaretha! — steht’s geschrieben.“
Da war’s dem Mädchen wie zum Umfallen. — Taub ist er freilich, aber so heraus hat er’s geschrieen, er kunnt’s verstanden haben. „Just gar so laut, dasselb’ ist keine Nothwendigkeit, Vatermann.“
„Ich grüße Dich tausendmal und wünsche, daß Dich mein Schreiben in bester Gesundheit antreffen möge. Ich bin Gott sei Dank gesund und mache Dir zu wissen, und daß ich vor etlichen Tagen zum Corporal avancirt bin und ich in ein’ Jahr auf Urlaub zu Haus kommen werde, was mich wegen Deiner so freut, vielgeliebte Margaretha, und ich denk’ bereits Tag und Nacht auf Dich, und Dein Zellerpreverl trage ich auf der Brust, daß mich mit Gottes Hilf’ kein’ Kugel trifft. So schau’ ich aus, wie das Gemal (Gemälde) da oben, und ich bitte Dich, daß Du mir getreu bleibst, und glaube der Leut’ Reden nicht, weil sie einen Neid haben auf uns Zwei. Und ich möcht’ auch wissen, das von der letzten Kirchweih, wie ich fortgangen bin, wird Dir nicht geschadet haben.“ Der Alte hielt inne, starrte das Mädchen an. Dieses sagte mit einer packenden Keckheit: „Hör schon, Vatermann, recht gut hör ich, freilich!“ Und der Alte fuhr fort: „Und sei so gut, thue auf mein tuchenes Gewand schauen, von wegen die Schaben, und schreib’ mir paar Zeilen, wie[S. 67] es Dir geht und was Neues ist, und für den Brief brauchst nicht zahlen. Und auf Dich kann ich nicht vergessen bis in den Tod, innigstgeliebte Margaretha, und so vielmal als Stern sein am Himmelszelt und Tropfen im Meer und Blümlein auf der Welt, sollst Du von mir gegrüßet sein. Halt mir nichts für Uebel, und ich schließe mein Schreiben im Schutze Gottes und verbleibe bis in’s kühle Grab
Dein
Johann Kinigl,
Corporal, 27. Infant.-Reg. König der Belgier.“
Der alte Schmiedrochel schüttelte sehr lange den Kopf. — „Von der Muhme das!“ sagte er endlich.
„Ja,“ rief die durch den Brief entzückte Gretl, „der Schwanenwirth-Christl ihrer —“
„Dirn!“ rollte jetzt die Stimme des Alten dazwischen wie ein niederstürzender Eisenklumpen. Da sah die gute Gretl Alles verrathen, verloren. Still war’s, nur der Blasebalg pfauchte.
„Er hat mir’s versprochen,“ hauchte das Mädchen, ihre Finger ineinanderhäkelnd und sehr laut, „’s Heiraten hat er mir versprochen und es hat so sein müssen, weil der Herr Pfarrer hat predigt, die Ehen werden im Himmel geschlossen.“
„Ja, und die Thorheiten auf Erden begangen. Heiraten! Und einen Habenichts vom Militär! Hörst, Einer, der einmal den Tornister auf dem Buckel trägt, gewöhnt sich den Höcker nicht mehr ab, hängt, hat er sonst nichts, den Bettelsack um.“
„’s schickt sich nicht, daß ich was red’, Vatermann, aber mich deucht halt, rechtschaffen fleißig bei der Arbeit wär’ der Hansl, rechtschaffen fleißig und brav; thut nicht trinken und nicht spielen; kann schreiben wie der Herr Verwalter und thut manigsmal gern in den Büchern lesen —“
„Ja, in solchen ’leicht, wo man die Blätter mit dem Knie umwendet. Marsch in Deinen Stall, Dirn! — Mein Lebtag hab’ ich noch kein Mädl gesehen, das Einen heiraten will, der gar nicht da ist. — Kommt der Hans heim und er red’t noch wie heut’, und Du hast ein’ ehrliche Frag’ — ich halt Dich nit auf. Jetzt weg mit dem Wisch da, den brauch’ ich nit!“
Glückselig erfaßte sie das Papier und seine Hand zu Dank und eilte ihrem Hofe zu.
Am nächsten Sonntag besorgte der Vatermann das Antwortsschreiben in ihrem Namen:
„Lieber Hans!
Das Schreiben laß bleiben. Kommst heim, bist brav, sollst mich haben.
Margaretha Krautwascherin.“
Wie war sein Brief so gut und treu und „gottsunmöglich“ schön, und wie war diese Antwort so kurz und kalt. Die Gretl litt viel Marter und Pein, aber sie vermochte nichts über den Alten, nur daß sie noch heimlich zwei Blümlein in den Brief zu schmuggeln verstand. Ein Vergißmeinnicht und eine brennende Lieb’.
eimweh, wie ein Alpenkind! So geht das Wort. Das Wort ist begründet; ist’s aber auch das Heimweh? Wer möchte sich nur so sehr sehnen nach den Felsen, nach den Wäldern, nach den Hängen, die den Menschen alle Bequemlichkeit versagen, die ihm kein gutes Stück Brot und keinen Tropfen Wein geben.
Aber das Alpenland umarmt und speist sein Kind mit reiner, leichter Luft, erquickt es mit frischer, klarer Quelle, und zu tausendmal ist’s wahr: das Alpenkind, das lebt von der Luft.
Wenn der Bergsohn in der Fremde weilt, und es kommt das Heimweh in sein Herz, und er denkt an seinen fernen Ort und an seine Menschen zurück, und er denkt wohl gar an ein Wesen, das er mehr liebt, als all’ die Anderen, dann steht’s trüb um ihn; und wenn er den Gedanken nicht unterdrücken kann, so wächst und wächst derselbe und erschwert das Gemüth und wird zur Pein.
Wie sieht der Arme aus? Er wandelt und wankt einsam umher, ist blaß und gebrochen, ist unfähig zu Allem, ist gleichgiltig für Alles, was ihn umgiebt; er will nicht leben und will nicht sterben, er möchte nicht im Königsschlosse sein, er möchte nicht im Himmel sein, er möchte[S. 70] daheim sein. Der Schlaf ist sein Einziges, der Traum führt ihn in die treue, stille Heimat — desto qualvoller ist das Erwachen. Er fühlt ein namenloses Verlassensein, er meint, die Heimat mit allem Lieben und allen Geliebten sei ihm für immerdar verloren.
Wohl dem, der in solcher Zeit heimkehren kann, wenigstens auf einige Tage, dadurch wird er geheilt und vermag die Fremde dann zu ertragen.
Wie mancher Junge, den sie zu den Soldaten genommen, ist aus Gemüthsweh desertirt und in seine Berge geflohen, oder er ist geblieben, hat geduldet — ist gestorben. Hätte er in seiner Krankheit auf einige Zeit heimkehren dürfen, es wäre ihm die entehrende Strafe erspart geblieben, oder er hätte viele Jahre noch gelebt in der Fremde und in der Heimat wieder.
Aus vielen ähnlichen Fällen, die mir bekannt sind, will ich hier einen der gemüthlicheren erzählen, der sich unweit von meiner Heimat zugetragen hat.
Das Regiment lag in Laibach. Josef Fallner, ich hatte vorzeit manches Röcklein für ihn gemacht, war dem Regimente zugetheilt, aber er war befreit vom Tagesdienste und theilweise auch vom Reglement, weil er in Diensten des Obersten Wenisch stand. Anfangs war das dem Josef nicht lieb, denn er hätte das Gewehr lieber und sicherer geführt, wie den Kehrbesen; er hatte zur Fahne geschworen, und nun mußte er des Morgens mit der Bettblache eines alten Brummbartes wirthschaften. Indeß gab sich das; denn im Laufe der Zeiten fiel ihm mancher Zwanziger in den Sack und der überklang das Gebrumme des Obersten stets beiweitem.
Freilich ist das nicht die ganze Geschichte von unserem Kaiserjäger, sondern erst die Einleitung.
Josef Fallner war jung und verliebt, der Oberst Wenisch aber war alt und auch verliebt. Wenn nun die beiden Männer in eine und dieselbe Maid... kurz, es wäre eine närrische Combination und eine tragische Situation. Indeß die Thatsachen sprechen anders. Die Erwählte des Obersten war eine große, dicke Dame, die in manchen Stücken lebhaft der Austria ähnelte, welche der Alte in seinem Zimmer aufgehangen hatte, nur daß sie viel jünger war und viel älter aussah als besagte Allegorie. Josef’s Herzensgebieterin aber war sehr jung und schön und durch und durch sehr liebenswürdig. Alle Augen im ganzen Krainerland zusammen waren nicht so schön als die ihrigen, und in ganz Laibach war keine Zuckerbäckerin, die so süße Küsse hatte als sie. Nur einen Fehler hatte sie, welchen Josef nicht verwinden konnte, sie war nämlich nicht in Laibach, sondern auf einem Bauerngut bei Mürzzuschlag in Steiermark.
Freilich bestritt der Kaiserjäger nicht, daß auch er selbst einst dort lebte, ja sogar dort geboren und assentirt wurde; aber Thatsache blieb es auch, daß er Minna schon länger als ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hatte.
Wenn der Oberst und die „Austria“ im Kabinet waren, so stand Josef im Vorzimmer oder er saß wohl auch und sann. Was er sann, das wäre schwer wiederzugeben, weil er sich dessen selbst nur dunkel bewußt war; aber er ahnte es und ich ahne es auch, um so mehr, da er aus seinem Brüten nicht selten plötzlich aufsprang, einen Fensterflügel aufriß und gegen die Karawanken hinauf rief: „Minna, ich halt’ es nicht mehr aus, ich desertir’!“
Da war es dem Josef immer, als ob er über das Gebirge und durch die Lüfte her die Antwort vernommen hätte: „Ja, komm’ nur!“
Zwar nicht zu selten schrieb er ihr Briefe mit Versen und blumigen Rändern, aber die letzte Zeit her wurden ihm ein paar gar nicht beantwortet. Er zweifelte zwar nicht an ihrer Treue, aber vielleicht hatte sie dieselbe im Laufe des halben Jahres einem Andern geschenkt. Haben nicht gerade die treuesten Mädchen der schönen Tugend genug, um Viele damit zu beglücken?
Im Frühjahr war’s, da wurde plötzlich das Regiment nach Wien abberufen. Josef jubelte über diesen Befehl — jetzt fährt oder marschirt er in wenigen Tagen an Mürzzuschlag vorüber, sieht seine Heimat und auch Minna wieder.
Ei, der Kaiserjäger denkt und der Oberst sagt: „Josef, das Regiment geht nach Wien, auch ich werde per Eilzug nach Wien abreisen; bleib Er indes da und hüte Er das Haus, längstens in zwei Tagen bin ich wieder hier. Was glotzt Er denn so blöd drein, Er, Er —“ Er gab dem Diener einen zweideutigen Namen, der indes Josef’s inneres Leidwesen weder vermehrte noch verminderte.
Der Kaiserjäger war so aufgeregt, daß er dem Alten nachschwor: „Geh’ nur, Oberst, ich vernichte Dir derweil Deine Austria!“
Aber die Austria ging auch mit nach Wien, nur die wahrhafte Austria, das Bild blieb, und der arme Josef blieb in diesem Krain, das — wie zum Trotze — alles Schöne sonst hatte, nur seine Minna nicht.
Der Oberst und seine Herrin waren fort, Josef war in den weiten, öden Gemächern allein. — Dann schlug er sich auf die Stirne und brüllte: „Wenn ich närrisch werde, so ist dieser Oberst schuld!“
Jetzt wirbelte der Tambour. Die Musik klang, das Regiment zog durch die Gassen dem Bahnhofe zu.
In diesem Moment kam unserem verzweifelten Kaiserjäger ein herrlicher Gedanke, er überlegte ihn nicht erst, er führte ihn gleich aus. Er warf seinen Mantel und seine Patrontasche um, er stülpte den Tschako auf den Kopf, er schloß die Thür des Vorzimmers ab, eilte auf die Gasse und marschirte in „Reih’ und Glied“ mit den Anderen dem Bahnhofe zu.
Die Ausführung des Planes gelang so leicht und ohne alles Hinderniß, daß einem schreibseligen Erzähler hier kaum etwas zu bemerken übrig bleibt. Selbst in Mürzzuschlag ging um Mitternacht das Aussteigen, ohne bemerkt zu werden, das Sichverlieren in den Hallen des Bahnhofes und das Hineilen über die Flur gegen das bewußte Bauernhaus hinauf einfach und ohne die geringste Beschwerde.
Jetzt wirst Du an das wohlbekannte Fensterlein klopfen, und Minna wird es öffnen und ausrufen: „Josef, Josef! Ei, das ist nicht möglich!“ — Aber es ist doch möglich und Du bist da, und wenn Du sie umarmest und küssest, so wird sie es begreifen — aber in zwei Stunden mußt Du wieder auf dem Bahnhofe sein.
Josef ist glückselig.
Er athmet die frische Alpenluft, er sieht und fühlt die Heimat wieder, wenn auch im Dunkel; das Heimatland ist selbst mitten in der Nacht schöner, als die Fremde im klaren Sonnenschein. Und dieses Süße und Wohlige war doch nur Zierde und Umrahmung zum bewußten Fensterlein.
Jetzt kommt er zum Hause, naht der rückseitigen Kammerwand und klopft an’s Fensterlein. Es bleibt still. Er klopft mehreremale und lauter; jetzt hört er etwas im Innern, es ist ein langgezogenes Schnarchen. „Minna!“ ruft er leise und klopft noch stärker; wenn er wegen Minna einmal von[S. 74] Laibach nach Mürzzuschlag fährt, so schlägt er wohl auch noch die Scheibe ein!
In unserem Kaiserjäger steigt schon der Aerger auf, aber in dem Momente wird seine Aufmerksamkeit vom Fenster ab und auf was Anderes gewendet. Plötzlich packen ihn nämlich ein paar rauhe Hände am Rockkragen, reißen ihn zurück, und schon sausen verschiedenartige Körper auf seinen Rücken nieder. Er stemmt, er wehrt sich, aber der feindlichen Hände sind vier und sechs geworden. Es läßt sich in einer solchen Situation nicht viel Vernünftiges denken, aber unter all’ den lebhaften Eindrücken, welche die sonderbare Umgebung auf Josef machte, rang sich in ihm doch die Frage empor: „Teufel, wer prügelt mich da?“
Diese Worte waren wie ein Zauberspruch. Wie auf’s Commando ließen die Hände und die Stöcke ab, und drei Stimmen riefen zugleich: „Himmel und Erde, der Josef! Aber Josef, wie kommst denn Du hierher?“
Der schob sich den Rock und die zerknitterte Patrontasche zurecht und brummte.
„Wenn wir Dich etwa geschlagen haben, Josef, so verzeih’ uns, wir haben gemeint, Du bist der Bachnatzl, der in jeder Nacht zum Fenster unserer Schwester kommt und Minna keine Ruh’ läßt.“
Da rief der Kaiserjäger lustig aus: „Schwäger, grüß’ Euch! Na, dem Bachnatzl hat’s ’golten? Schon recht, Schwäger, hättet Ihr ihn nur noch kräftiger durchgebläut, hättet Ihr ihm seine Säbelbeine abgeschlagen, diesem verdächtigen Mauser!“
Die Chronik erzählt, daß Josef jubelte — jubelte über die Schläge, die er von den Brüdern seiner Minna erhalten, sie waren ja dem verhaßten Nebenbuhler zugedacht. Wohl[S. 75] erzählt die Chronik auch von einer zerschlagenen Patrontasche und von blauen Flecken hinter einem grauen Mantel; aber dies Alles tritt in den Hintergrund, nachdem Josef in der Stube bei Minna sitzt und die Versicherung vernimmt, daß sie freudig auf ihn warten will, bis er seine Jahre ausgedient haben werde.
Die drei Brüder Minna’s wollten das ganze Haus aufwecken und schreien: „Der Josef ist da!“ Aber dieser verbat sich’s. Kaum daß er Minna in den Armen hielt, so war’s schon wieder Zeit zum Aufbruch. Am Bahnhofe schlug das Signal des Zuges nach Süden.
Zwölf Stunden später steckte der Kaiserjäger den Schlüssel an die Thüre des Vorzimmers seines Herrn; es war Alles noch wie gestern.
Noch an demselben Abend kam auch der Oberst von Wien zurück: „Was hat Er gemacht, Josef, während meiner Abwesenheit?“ fragte er seinen Diener.
„Geschlafen, Herr Oberst,“ war die Antwort, „aber mir hat viel geträumt.“
„Was hat Er denn für blaue Beulen hinter den Ohren?“
„Weiß Gott, Herr Oberst, ich steige im Traum oft so umher!“
Der Schalk!
enn wir fahren, so brauche ich nicht zu gehen, mochte meine Taschenuhr gedacht haben, denn als der Zug in den Wiener Südbahnhof brauste und ich nachsehen wollte, wie viel wir Verspätung gehabt hatten, fand ich das nette Knödelchen stehen. Ich trieb sie neu auf, ich laborirte mit einer Stecknadel im Werke, es war vergebens; selbst das unbeschreibliche Schütteln und Stoßen des Einspänners, der mich in mein Hotel räderte, war nicht im Stande, die Uhr aus ihrer Betäubung zu wecken. Sofort begab ich mich noch an demselben Abend, obwohl es schon spät war, zu einem Uhrmacher; denn meine einzige Begleiterin, die mir buchstäblich sehr am Herzen lag, die mir Rath und Antwort wußte für alle Fragen der Zeit, sie durfte nicht krank sein!
Ich fand im ganzen Stadttheil nur mehr eine einzige, kleine Uhrmacherwerkstatt offen. In derselben saß vor einer grünbeschirmten Petroleumlampe ein kaum erwachsenes Mädchen, welches eifrig bestrebt war, die Gehäuse verschiedener Cylinder- und Ankeruhren blank zu machen.
Als ich eintrat, erhob es sich und fragte: „Was wünschen?“
In dem Augenblick, als ich der kleinen Uhrmacherin in’s Auge blickte und bestrebt war, meinen Wunsch zu[S. 77] proclamiren, fühlte ich in meiner Westentasche lebhaftes Ticken; aha, jetzt geht sie wieder, dachte ich mir, aber es war nicht die Uhr, es war mein heftig pochendes Herz gewesen.
„Mein Fräulein,“ sagte ich, indem ich die Uhr aus der Tasche zog, „sie will nicht gehen.“
„Schön! Ist sie aufgetrieben?“
Ich fühlte mich im Drange des Momentes berufen, der Kleinen irgend etwas Artiges zu sagen, denn es gab unter allen Zifferblättern, die an der Wand herumhingen, keines, das so mild und weiß gewesen wäre, wie ihr Gesichtchen. Mit lebhaftem Bedauern dachte ich an meinen staubigen Reiseanzug, an die Wirren meiner Haare; doch welcher müde Reisende würde noch am Abend wegen eines Geschäftes im Uhrmacherladen Toilette gemacht haben!
„Aufgetrieben, ja,“ antwortete ich, „mein silbernes Cylinderchen da spielt offenbar Cabale gegen mich, um in die Hand eines so liebenswürdigen Fräuleins —“
In diesem Augenblick flog die Thür auf und ein eleganter junger Mensch trat herein.
„Servus, Malchen! — Numero sicher?“
„Morgen, Arthur; Papa kann den Moment kommen, er wird mich nach Hause begleiten!“
Der junge Mann hatte seine Cigarrette auf ein Pult gelegt und mit der unbefangensten Miene von Wien drückte er dem Fräulein einen Schmatz auf das liebe Zifferblättchen, welches eben die gute Stunde zeigte.
„Arthur, leb’ wohl! Morgen also!“
„Morgen neun Uhr Abends. Adieu, Herz!“
Der junge Mensch nahm wieder seine Cigarrette und eilte fort.
„Und bis wann wollen Sie sie haben, mein Herr?“ fragte mich das Mädchen gleichgiltig, indem sie meine Uhr an einen Nagel hing.
„Bis morgen vielleicht,“ sagte ich, „bekomme ich eine Marke?“
„Werden Sie die Uhr selbst holen?“
„Jedenfalls.“
„So brauchen Sie keine Marke. Haben Sie also die Güte, sich morgen im Laufe des Nachmittags anzufragen! ’schamster Diener!“
Ich stand wieder auf der Gasse und ich dachte nach, wie das sonderbar ist, wenn ein so reizendes Mädchen plötzlich zu einem „gehorsamen Diener“ wird.
Am andern Morgen zog sich der Lohndiener meines Hotels eine sehr ernste Rüge von mir zu, weil er meine Kleider nicht ganz in den gewünschten Zustand versetzt hatte.
Ich wollte heute einmal Alles sehr blank und glatt haben.
Der hübschen Uhrmacherstochter halber, meint Ihr? I bewahre! Ich hatte ja Besuche bei Freunden, bei Gönnern vor — und wenn’s auch ein wenig der Sackuhr wegen gewesen wäre, die ich heute abzuholen hatte! — Kurz und gut, der Lohndiener erhielt seine Rüge.
Unmittelbar nach dem Frühstück ließ ich mir die Haare schneiden und las dabei die Morgenblätter. Das ist von der Natur so weise eingerichtet, daß, während die Augen Morgenblätter lesen, die Ohren für den ewig sprudelnden Redequell des Friseurs frei sind. Nachdem dieser den Rapport entgegengenommen hatte, daß die Haare am Hinterkopfe glatt zu scheeren und vorn nur zu stutzen seien, begann er, begleitet von dem Wispern der Scheere, zu sprechen. Fast in[S. 79] einem einzigen Athemzuge sprach er vom Wetter, vom Theater, von Regenwürmern, von Arbeiterversammlungen, von Apolloseifen, vom Stefansthurme, von Schlafröcken, von der Pferdebahn, vom Donaubad u. s. w. — Plötzlich rief er aus: „Pardon!“
„Was haben Sie?“
„Soll ich Euer Gnaden nach der neuesten Façon etwa die Locken auch vorn glatt scheeren?“
„Pfui Teufel, so geschmacklos!“
„Ich dächte, Fieschi?“
„Aber nein, sag’ ich, blos stutzen!“
„Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung, Euer Gnaden, es geschah im Eifer der Unterhaltung, ich hab’ Euer Gnaden ganz glatt geschoren.“
Ich sprang auf, blickte in den Spiegel, taumelte zurück — Gott im Himmel, das war nicht geschoren, das war ja förmlich rasirt!
Was war zu machen? Ich klagte nicht, ich fluchte nicht — in stiller Resignation verließ ich das Haus und der Hut sank mir tief in die Stirne.
Die Herren, bei denen ich meine Aufwartung machte, verwanden es; doch, wo ich Damen vorgestellt wurde, da gab es in einemfort zu lachen; da wurde der Hund oder der Vogel oder die Katze, oder was Anderes vorgeschützt, das so „urkomisch“ sei, aber ich wußte wohl, daß es der geschorene Chinese war, der das Zwerchfell so unwiderstehlich reizte.
Ich suchte nach beruhigenden Gedanken: für den Sommer ist’s am Ende ja praktisch so, und bis der Winter kommt, ist Alles wieder ausgeglichen; also nur kein graues Haar wachsen lassen, es wird schon noch dunkelbraunes kommen!
Sofort durchzog ich wieder mit lustigem Gemüthe die Stadt, bestieg den Stefansthurm, besuchte einige Galerien und verschaffte mir eine Eintrittskarte in das Opernhaus.
Gegen Abend begab ich mich in mein Uhrmachergeschäft. Malchen war wieder da und rieb Gehäuse und Silberketten blank; am Pulte saß ein mürrisch aussehender alter Mann und feilte an einem Messingdraht.
„Wünschen?“ fragte mich das Mädchen, als ich eingetreten war.
„Vielleicht meine Uhr schon fertig?“
„Haben Sie die Güte — die Marke!“
„Fräulein verabreichten mir keine, als ich gestern die Uhr da ließ.“
„Werden entschuldigen, mein Herr, bei uns ließen Sie keine Uhr!“
„O gewiß, mein Fräulein, Sie werden sich noch erinnern, es war schon spät, kurz vor der Sperrstunde, als ich sie brachte.“
„Es war wohl ein Herr da, der mir eine silberne Cylinder übergab.“
„Ja, ja, das war ich.“
„Oh, bitte, Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß ich meine Kunden nicht kenne. Jener Herr, dem ich keine Marke gab, wird seine Uhr persönlich holen.“
„Will Dir wer was herauslügen, Mali?“ brummte der Alte an seinem Pult.
„Aber sehen Sie mich doch nur an, Fräulein!“ sagte ich.
Sie sah mich an; „jener Herr trug lange dunkle Haare,“ bemerkte sie.
„Du ewiger Himmel, ich war ja beim Haarschneider!“ rief ich, doch der Alte schrie dazwischen: „Sie, Sie Aben[S. 81]teurer, Sie, wenn Sie nichts vorzuweisen haben, so haben Sie auch nichts zu holen. ’s ist die Polizei in der Nähe!“
„Aber Fräulein!“ flehte ich, den Alten vollständig ignorirend, „ich kann’s ja beweisen, daß ich es war, der die Uhr brachte und dem Sie keine Marke verabfolgten; — es war auch sonst noch Jemand da —“
„Du lieber Gott, wie viel Dutzend Jemande kommen des Tags über!“ lachte das Mädchen.
„Derselbe Jemand aber kam zur späten Abendstunde,“ sagte ich leise, „und möglich, daß er heute wieder kommt — Arthur heißt er!“ Damit that ich einen kurzen, aber vielsagenden Blick nach dem Alten.
Das Mädchen wurde einen Moment verlegen und meinte dann: „’s wird denn doch sein; Sie waren da; o, entschuldigen Sie, mein Herr, daß ich Sie nicht auf den ersten Augenblick — bitte, da ist Ihre Uhr, hoffe, daß sie jetzt ganz vortrefflich gehen wird!“
Ohne ein Wort zu sagen, zahlte ich die Kleinigkeit für die Reparatur. —
„Vielmals um Entschuldigung!“ hauchte die schöne Mali nochmals.
„Bitte, bitte!“ entgegnete ich, verließ die Werkstatt und eilte dem Opernhause zu.
„Arthur heißt er!“ Das war meine Empfangsmarke, mit der ich mich auswies, daß ich den Tag früher in der Werkstatt war. Und die Uhr — sie geht heute noch und bringt mir gute und böse Stunden.
Vielleicht macht es schön Malchen so mit Arthur.
ann mich nicht entsinnen, daß die Geschichte von Guido Haidenlang je noch bei einer Christenlehre erzählt worden wäre. Sie ist aber just nicht übel und kann zu Nutz und Frommen sein.
Der Guido Haidenlang war ein Torfstecher und hatte dieses Handwerk in der Hoffnung gewählt, dabei irgend einmal einen vergrabenen Schatz zu finden. Seitdem seine Annamirl sich über ihn hinweggeheiratet hatte, mochte er mit lebendigen „Schätzern“ nichts mehr zu thun haben; hingegen beherzigte er die Sagen von dem unermeßlichen Gold und Silber, das seit Pharaos Zeiten auf der Moorheide begraben liegen soll.
Oftmals, wenn Guido zur Nachtzeit mit seinem Spaten über die Heide ging, sah er blaue Lichter flimmern; er eilte ihnen wohl nach, denn so Lichtlein sind Goldes- und Silberschein und der begrabene Schatz bittet durch sie um Erlösung. Aber die blauen Flämmchen zogen in die Kreuz und Krumm, und einmal, da stak der gute Guido jählings bis über seinen Ledergurt im Sumpf. Das war ein arges Nachtquartier und die Lichter umkreisten und neckten ihn fürchterlich und der Mann sank tiefer und tiefer und sein rother Brustfleck mit der leeren Brieftasche stak mit ihm schon zur Hälfte im[S. 83] Schlamm. So hatte er es wahrhaftig nicht gemeint, er wollte mit dem Schatz im Sonnenlichte leben, aber nicht mit demselben lebendig begraben sein. Was that er in seiner Noth, er that ein Gelübde zur heiligen Gertrudis: „Du großmächtige Schutzfrau gegen böse Anfechtungen und Hexenspuk, Dir empfehl’ ich meine arme Seel’ und meinen Leib, der in der Schlammass’ steckt. Hilfst Du mir aus meiner Noth, so bin ich nicht der Mensch, der Dir das vergessen wollt’. Wirst sehen und bei meiner sündigen Seelen: ich erbau Dir eine prachtschöne Capelle oben auf dem Birkenberg!“
Das läßt sich Sanct Gertrudis nicht zweimal sagen; für eine prachtschöne Capelle streckt sie allfort gern eine Hand aus. So fügte sie es denn, daß in derselben Nacht ein paar Bauersleute über die Moorheide gingen, den Guido schreien hörten und ihn aus seiner tiefen Versunkenheit zogen.
Und Guido war nicht der Mensch, der Wohlthaten so leicht vergessen konnte. Zwar die Bauersleute stellte er unwirsch zur Rede, was sie denn zur Nachtzeit auf dem Moore zu suchen hätten? er und er alleinig sei der Torfstecher. Aber Sanct Gertruden gegenüber fühlte er sich verpflichtet, sein heilig Wort einzulösen und zu ihrem Ruhme die prächtigschöne Capelle auf dem Birkenberge zu erbauen. Und wie war die Bedrängniß nun groß! Seine alleinzige Seele hatte er verpfändet und keinen guten Groschen Geld hatte er im Vermögen, um das Kirchlein erbauen zu können. — Hätte etwa der Leser einen Rath gewußt? Gewiß nicht; nun also, was giebt es da zu lächeln? — Der gute Guido wußte wohl, ihm stand ein böses Leben und Sterben und weiß Gott, was noch bevor, konnte er sein Versprechen nicht halten. Wenn er um aller Heiligen willen endlich nur den Schatz fände! Die Capelle zu bauen wär’ ihm zur höchsten Freude.
Aber es verging Jahr und Tag und der Guido stach Torf zu seinem Unterhalte; doch der Schatz — es war gerade, als ob der Böse darauf säße — den Schatz stach er nicht.
Da stieg er eines Tages traurig hinan zu dem Birkenberge und suchte noch einmal alle Winkel seines Hirnkastens ab nach einer Idee, wie Geld zu schaffen für den gelobten Bau.
Auf der Höhe, wo der Waldweg zieht und wo das Kirchlein stehen sollte, fand der Guido etwas Seltsames. Hier, im hellgrünen duftigen Heidekraut, von Blüthen umweht, von Hummeln umläutet, lag ein Mensch im Sterben. Es war ein alter Mann mit langem grauen Barte; er lehnte an einem großen dunkelgrünen Bündel, hielt eine Hand krampfig an die Brust und ächzte.
Als dieser den Torfstecher herankommen sah, wendete er sich etwas und murmelte: „Gelobt sei Gott!“ Dann streckte er zitternd seine Hand aus und sagte: „Guter Mann, Euch sendet der Herr. Ein Greis muß hier einsam und hilflos versterben.“
Guido war entsetzt und wollte sich sogleich wenden, aber der alte Mann bat mit brechender Stimme, ihn nicht zu verlassen. „Sterben,“ stöhnte er, „sterben kann ich wohl auch allein; aber mein Kind zu weitest im Ungarland, ein blutarm Studentlein.“ — Dann zog er mit bebender Hand ein ledern Täschchen aus dem Brustlatz: „Nehmt es, Ihr guter Mann Gottes, das ist mein Geld. Mein Sohn wird nach mir forschen, und wenn Ihr hört, daß wer nach dem Samuel Amsel frägt — nur mein Jacob kann’s sein — so gebt ihm das Geld und sagt, der Vater wär’ jählings verstorben auf der Wander und Ihr hättet sein letzt’ Wort erfüllt um Gottes willen. Ich bitte Euch, seid so mein Brudermann[S. 85] und thut mir das; eine größere Wohlthat könnt Ihr nimmer vollbringen auf Erd’.“
Er starb und Guido hatte das lederne Täschchen in seiner Hand. Und als nach Tagen die Leiche von anderen Leuten aufgefunden und begraben war, wie ein Fremdling, bei dem man weder Habe noch Papiere gefunden — da saß der Torfstecher in seiner Hütte und öffnete das Täschchen. Es war Geld darin, viel Geld....
Wie hat hierauf Guido die Sache überlegt? — Ja, dachte er, das ist ein Jud’ gewesen; der hat gewiß andere Leut’ um das Geld betrogen. Und sein Sohn ist auch ein Jud’ und würde das Geld jüdisch verwenden und damit gewiß andere Leute um noch Mehreres betrügen. So Dinge muß man abwenden. Ei, wie trifft es sich aber gut! Ich will nichts von dem Gelde sagen, will davon der heiligen Gertrudis die Capelle bauen lassen und darin recht fleißig für den Juden und seinen Sohn beten. So ist uns Allen geholfen.
Darauf sind der Jahre sieben vergangen, da stand auf dem Birkenberge das neue Kirchlein und leuchtete mit seinen weißen Mauern und seinem rothen Dache weit in das Land hinaus.
Guido war bewegsam und lächelte freundlich zu dem Lobe der Leute, das ihm gespendet wurde. Doch war er stets erregt und drängte den Bildhauer, daß doch auch das Altarbild, die heilige Gertrudis, bald fertig werde, denn es verlangte ihn schon sehnlichst, in der neuen Capelle zu der Heiligen zu beten. Es war ihm zur nächtlichen Stunde zuweilen gar arg zu Muthe. Auch war der alte Jude schon mehrmals zu seinem Bett gekommen und hatte nach fälligen Zinsen gefragt. So ein Jude vergißt und vergiebt in Geldsachen nichts, gar nichts und wäre er gleich zehnmal gestorben.
Als Guido nun aber zur Gertrudis beten konnte, die im Nonnenmantel auf dem Altare stand, da wurde es ihm besser. Er grub Torf und stieg jeden Tag hinauf zur Capelle und betete für den alten Israeliten und seinen Sohn und auch auf die gute Meinung, daß er endlich einmal den Schatz auf der Moorheide entdecke.
Aber als Guido älter und älter wurde, da hub es an, ihm wieder schlechter zu werden und als er endlich dem Alter nahte, in welchem der Jude mit dem grauen Barte gewesen sein mochte, da begann es in seinem Kopfe zur Nachtszeit gräulich Spectakel zu treiben, und stetig stand der Jude am Bett und zerrte ihm die Decke vom Leib und hüllte ihn zu mit seinem langen grauen Bart. Und das war ein böser Bart und jedes Haar war ein giftig Schlänglein, das fürchterlich nagte und biß. Vergebens rief Guido die heilige Gertrudis; aber eine brave Nonne geht zur Nachtszeit in keines Mannes Zimmer. Gertrudis kam nicht.
So raffte sich denn der Torfstecher in seiner Verzweiflung einmal von seinem ruhelosen Lager auf und eilte im Mondscheine auf den Birkenberg zur Capelle. In derselben fiel er nieder auf die Erde und rief mit lauter Stimme:
„Gertrudis, meine Schützerin, steh mir bei! In jeder Nacht kommt er zu mir, der alte Jude, der Samuel Amsel, und will sein Geld wieder haben!“
Siehe, da erhob sich hinter dem Altare plötzlich eine Stimme: „Der Samuel Amsel! Wo ist er? Wo ist mein Vater?“
Ein junger Mann sprang hervor. Ein Mann, der schon mehrmals in der Gegend gesehen worden war, als Jäger, oder wie er Pflanzen und Steine sammelte und das Gebirge untersuchte. Es war ein schöner, freundlicher Junge und er[S. 87] genoß vielen Respect bei den Leuten. Auch auf die Moorheide war er gekommen und hatte darauf mit Instrumenten hantirt, als ob er ebenfalls den Schatz suchen wollte. Ja, mehr noch, vor der Hütte des Torfstechers, die im Wäldchen stand, war er mehrmals schon gesessen und hatte mit Guido’s Nichtchen geplaudert, das gar hübsch und gescheit und viel manierlicher war, als der Alte.
Es war im Städtchen bei einer Muhme erzogen worden und nur zur Sommerszeit manchmal beim Oheim im Einödhäuschen. Guido hatte sich aber nicht getraut, den Jüngling zur Rede zu stellen darüber, weshalb dieser auf der Moorheide so herumsteche oder auf der Bank bei seiner Nichte sitze. Und so hatte sich der junge Mann auch nicht verantwortet und überhaupt niemals näher mit dem Alten verkehrt.
Oft hatte sich der Geologe, als welcher der fremde junge Mann in der Gegend herumging, so weit in’s Gebirge verstiegen, daß er keine Menschenwohnung fand und im Freien übernachten mußte. So hatte er auch gestern spät Abends auf dem einsamen Birkenberge in der stets offenen Capelle Obdach gesucht und sich hinter dem Altare in seinen Mantel geschlagen, bis zur Morgenfrühe, da er wieder weiterziehen wollte. Er ruhte gut auf dem Stein. Freilich kam auch zu ihm der Jude mit dem grauen Barte, der ihm seit vielen Jahren verschollen war; doch er kam in lieber, freundlicher Traumgestalt, denn es war sein Vater.
Da er nun aber plötzlich des Vaters und seinen Namen rufen gehört hatte, fuhr er empor und auf den Alten zu, der angstgemartert vor dem Altare lag. Guido war wortlos vor Schreck, er stöhnte und bat mit den Händen um Gnade.
Er hat Alles gestanden. Und eine Inschrift auf dem noch vorhandenen ledernen Täschchen hat Alles erwiesen.[S. 88] „Was soll es weiter,“ sagte der fremde Mann, „mich verlangt nur meines Vaters Grab zu wissen. Geld hätte mich nicht gehoben, das muß eigene Arbeit thun.“
„Oh!“ rief der Alte verwirrt. „Wenn Du der Jacob Amsel bist, so ist die Kirche Dein; sie ist von Deines Vaters Geld erbaut. Aber die Gertrudis schenk’ mir heraus, die muß mir auf der Moorheide was helfen suchen.“
„Das Kirchlein schenke ich den Gläubigen,“ sagte der Geologe, „auf der Moorheide aber giebt es sonst nichts zu suchen, als was Du lange schon gefunden hast. Du alter Torfgräber, seit vielen Jahren hast Du vom Schatze der Heide gezehrt.“
Der junge Gelehrte hatte bei dem Gerichte Fürbitte gethan, daß der alte, einfältige Mann seine letzten Tage noch im Sonnenlichte verleben durfte. Hingegen hat er um dessen sittiges Nichtchen gefreit und dasselbe in den Banden der Ehe mit sich geführt. Das Kirchlein steht heute noch auf dem Birkenberge. Der Geologe läßt es vor Verfall bewahren, ihm ist es das theure Denkmal der Sterbestätte seines Vaters. Er selbst aber hat aus der Erde Tiefe schon manchen Schatz gehoben, den der Torfgräber in seinem Wahne vergebens würde gesucht haben. Von allen Schätzen der liebste aber war ihm sein Mariechen. Den legte er als echter Judensohn auf gute Zinsen an, und es verging kein Jahr, ohne daß Interessen fällig wurden. Der alte Jacobssegen ging reichlich in Erfüllung.
enn es erlaubt ist, es zu leben, so ist es doch auch erlaubt, es zu erzählen. Wer’s nicht glauben will, der komme mit mir in’s Kärntnerland, in das Thal der Gurk.
In diesem Thale lebt Josef der Zweite.
Koloman der Zimmermann ist ein frommer Mann; er macht jeden Tag um ein Stündlein früher Feierabend als seine Gesellen, um aus P. M. Vogel’s Heiligen-Legende die Lebensbeschreibung des betreffenden Tagesheiligen zu lesen und sich an dem dazugehörigen „Lehrstück und Nachfolge“ zu erbauen. Koloman ist ein großer Freund der Heiligen Gottes und seit lange her schon ist es sein ernstlicher Entschluß, in ihre Fußstapfen zu treten, ihnen ähnlich zu werden. Der Entschluß ist sogar ausgeführt worden. Nur begann der Koloman nicht mit seinem eigenen Namenspatrone, von dem in dem ganzen Buche nicht eine einzige Zeile zu finden, sondern — und zum Unglücke — mit der Nachfolge des heiligen Paulus, des heiligen Augustinus, und führte mit Salbung und Ausdauer ein rechtes Heiden- und Luderleben; als es jedoch zur Bekehrung und Buße kommen sollte, da wählte er sich wieder irgend einen anderen Heiligen als Vorbild; und würden es nur seine Mittel erlaubt haben, er[S. 90] hätte sich am liebsten an die heiligen Könige, Fürsten und Päpste gehalten, deren Nachfolge jedem guten Christen allzeit noch am erquicklichsten war.
Indeß kam Koloman der Zimmermann auf keinen grünen Zweig; da sagte ihm einmal sein Beichtvater, ein alter Priester:
„Koloman, Du möchtest Dir’s bequem machen und auf einer Rosensänfte in den Himmel getragen werden; oh, Du bist ein Feiner! Koloman, Du bist ein Heide über und über!“
Bei Gott, das war grob. Koloman wartete gar nicht auf das Kreuz der Absolution, er stürzte vom Beichtstuhl hintan und beschloß, sich einen anderen Seelenfreund zu suchen.
Nicht gar weit davon, in einem Kloster, lebt ein junger frommer Priester, ein sanftmüthiger und demüthiger Mann, ein blasser, mildäugiger Jüngling, ein heiliger Aloisius von der kleinen Kopfglatze an bis hinab zur großen Zehe.
Zu diesem ging nun Koloman der Zimmermann, und wählte ihn zu seinem Beichtvater.
„Ja, mein Freund im Herrn,“ sagte der neue Seelenarzt und fuhr mit dem weißen Sacktuch über sein friedenumstrahltes Antlitz, „ja, mein Freund, es ist wohl nöthig, Ihr müßt Euch einen bestimmten Heiligen als Vorbild wählen und bei demselben verbleiben in allen Versuchungen und Widerwärtigkeiten dieses Lebens, bis Euch Gott die Krone der Auserwählten auf das Haupt wird setzen.“
„Wenn mir der geistliche Herr halt etwa so einen Handsamen thät wissen!“ meinte der Koloman.
„Wählt Euch den heiligen Aloisius,“ rief der Beichtvater.
„Selb’ nicht,“ sagte Koloman, „selb’ ist ja schon zu spät.“
„Schade,“ versetzte der Priester, „aber vielleicht den heiligen Johannes in der Wüste?“
„Wollt’ mir gleich gefallen, thät ich nur den wilden Honig und die Heuschrecken ein bißle lieber essen.“
„So entschließt Ihr Euch wohl für einen heiligen Blutzeugen und Märtyrer; da haben wir die glorreichsten Exempel an St. Stefanus, St. Paulus, St. Laurentius, St. Bartholomä —“
„Dem die Haut abgezogen ist worden?“ unterbrach der Koloman.
„Hingegen steckt er jetzt in einer himmlischen Haut!“ rief der Priester; „und wir haben ferner den heiligen Andreas, wir haben St. Blasius, wir haben die Nothhelfer und vierzig Märtyrer — nun?“
Der Koloman schüttelte nur so den Kopf. — Wohl wahr, diese Welt sei grundschlecht, aber gerade übel sei sie nicht, und wisse er, der Koloman, nur, daß ihn der Herr auch wieder bei Zeiten vom Tode auferwecken wolle, er würde sich gern den heiligen Lazarus zum Vorbilde nehmen.
„Ja, mein Freund, wenn Ihr mit solchen Prätensionen kommt, so ist Euch schwer zu rathen,“ sagte der junge Beichtvater und lächelte voll Sanftmuth. „Wolltet Ihr nicht, wie die heilige Elisabeth, Euer Hab und Gut den Armen, oder wie die heilige Hema, die, wie Ihr wißt, besonders in diesen Bergen hochverehrt wird, Euer Vermögen der Kirche weihen?“
„Gern,“ sagte der Koloman, „aber im Testament, wenn’s noch Zeit wär’ und mein Weib nichts dagegen hätt’.“
„Ihr lebt im Ehestand?“ fragte der Priester völlig überrascht.
„Ja, bisweilen, und so seit ein paar Jährchen her,“ antwortete der Koloman; „angerathen ist’s mir worden, daß[S. 92] ich heiraten sollt’, und der heilige Büßer Franziskus, lese ich, ist auch verheiratet gewesen.“
Der Priester schwieg ein Weilchen.
„Ah, Freund,“ sagte er dann, „Ihr habt noch weit dahin, Euch von den irdischen Begierden frei zu machen. Im Vereine mit Euerer Ehegattin müßt’ Ihr gegen den Bösen streiten. — Euer Weib geht doch auch häufig zur heiligen Beichte?“
„Recht passabel,“ sagte der Koloman, „und wenn’s leicht ging’, so möcht’ ich auch sie mit mir in den Himmel hinaufschleppen.“
„Ein neuer Beweis Eueres christlichen Sinnes,“ bemerkte der Beichtvater; „wie wäre es doch, lieber Freund, wenn Ihr dem heiligen Josef nachfolgen wolltet? Auch Josef war ein Ehemann und ein Mann nach dem Herzen Gottes —“
„Und Zimmermann!“ rief der Koloman aus, „Zimmermann wie ich. Ja, das ist ausgezeichnet, auf den heiligen Josef hatt’ ich bei Gott ganz vergessen; freilich, freilich, der ist der Rechte, und — nicht wahr, Hochwürden,“ setzte er kleinlaut bei, „geschehen ist ihm nichts? — gesteinigt, enthauptet, oder so was? — nicht? — Punctum, beim Josef verbleib’ ich.“
In Folge dieses vortrefflichen Vorsatzes wurde dem Koloman die Lossprechung „von allen seinen Sünden“ ertheilt; „Auch von den zukünftigen?“ fragte er noch in äußerst unbedachter Weise, allein der Beichtvater hatte zum Glücke schon den Schuber geschlossen.
Als Koloman heim zu seinem jungen Weibchen kam, erzählte er viel Gutes und Schönes von dem frommen Ordenspriester, und sofort begann er sein Haus nach dem biblischen Style der heiligen Familie einzurichten.
Er führte das Zimmerhandwerk fort, hobelte und leimte und war gottesfürchtig dabei. Auch lebte er eine Zeit lang in Entsagung; und sein Weib — das sich auch den jungen Klostergeistlichen zum Beichtvater erwählt hatte, — theilte mit ihm gern diese Entsagung, und so führten sie ein beschauliches und erbauliches Leben.
Koloman hatte den Frieden des Leibes und der Seele; und einmal brachte ihm sein Weib einen Lilienstamm — (es war aber eine Zwiebeldolde) — nach Hause, auf daß er ganz und gar der zweite heilige Josef sei.
Zu diesem Zwecke hatte sich der Koloman auch den Bart wachsen lassen, und in seiner Stube trug er gern einen langen, farbigen Rock und Sandalen an die Füße gebunden. Tabakschnupfen konnte er wohl nur insgeheim, hingegen wußte er, wenn Jemand zugegen war, sehr salbungsvoll zu hobeln und hatte auch häufig die Augen gegen Himmel gerichtet, außer wenn ihm irgend welcher Arbeitslohn in die Hand gelegt wurde, da guckte er sofort auf das Geld, ob nicht etwa ein falscher Silberzehner dabei.
So verging die Zeit. Wohl alltäglich las der Koloman sein Capitel aus der Heiligen-Legende, aber allen Büßern und Märtyrern sagte er es in’s Gesicht: „Ihr Hascherle, was seid Ihr gegen mich? Ich bin Josef, der Sohn Isak’s, der Sohn Jacob’s!“
Da geschah es einmal, daß Maria, sein Weib zu ihrem Manne sagte:
„Koloman, hast gutes Kirschbaumholz liegen?“
„Warum?“ versetzte er.
„Nein, ich frag’ nur,“ antwortete das Eheweib und blickte demüthig zur Erde und beschäftigte sich mit den Häkelchen ihrer Joppe.
Nach mehreren Tagen sagte sie wieder: „Koloman, wenn Du Kirschbaumholz liegen hättest, so ein Wieglein könntest Du einmal zimmern.“
Der Sohn Isak’s und Jacob’s machte ein langes Gesicht: „Eine Wiege? Wieso denn? — Wieso denn das, Maria?“
Sie zuckte die Achseln und schlug ihre Augen demuthsvoll zu Boden.
Der Koloman ging verstört umher, las die Legende, sann, las wieder — stützte sein grauendes Haupt lange auf die Hand.
Sollte denn diese Familie thatsächlich so fromm sein, daß Zeichen und Wunder an ihr geschähen?
„Warum nicht?!“ fuhr der Zimmermann auf und eilte sofort schnurstracks zum Seelenfreunde, ihm freudig zu erzählen, was in seinem Hause geschehen.
Der junge Priester ging eben im Klostergarten spazieren, und als er den Koloman so aufgeregt und hastig auf sich zueilen sah, setzte er seine Füße aus, so weit es die Kutte nur gestattete, und floh durch das Buschwerk davon.
In der „heiligen“ Familie kam ein Kindlein an. Der Nährvater giebt es genug auf Erden, aber wer insonderheit Sanct Josef den Zweiten zu sehen wünscht, im Gurkthale, wie gesagt. Und als Lilienzweig — ein welker Zwiebelstengel ist das Zeichen seines Hauses.
ie ist übel beleumundet, die Jungfrau zu Feistritz. Sie hat seinerzeit viele Männer zugrunde gerichtet. Sie ist jetzt eine alte Jungfer, trägt eine eiserne Pfaid und schmachtet für ihre bösen Thaten, die sie voreinst begangen, seit vielen Jahren schon im Burgverließ zu Feistritz am Wechsel.
Ich bin dazumal — es war vor Jahren — an den Schauerdenkmalen menschlicher Grausamkeit still und hastig vorübergeeilt, habe mich der Natur zugewendet, die so schön und erfreulich ist. Durch das Otterthal bin ich gezogen dem Wasser entlang, habe vor mir die duftblauen Berghänge gesehen mit den schimmernden Sandriesen und die grauen, regenschweren Wolken des Himmels darüber. Und hier auf dem Hügel in der Stille und Einsamkeit steht eine Kirche, uralt und ehrwürdig zu schauen. Ihre Mauern sind röthlich wie Gold, tragen Spuren von alter Tage Noth, von des Feuers Wuth, von der Türken Gewalt. Die gothischen Fenster sind ausgebrochen, da starrt die Dunkelheit hervor, und Eulen und Fledermäuse sind des Herrn Anbeter in diesem Gotteshause. Ein schlankes Thürmchen ragt über den dachlosen Wänden und grüßt hinan zu den bewaldeten Höhen des Otters und zu den Zinnen des Wechsels.
Das ist die Wolfgangskirche bei Kirchberg. Unterhalb des Hügels an der Straße steht ein Opferstock mit der Inschrift: „Frommer Christ, opfere hier zum Wiederbaue der Wolfgangskirche!“
Ein Maidlein kam des Weges, das schlug zuerst ein regelschönes Kreuz über sein junges, hellblühendes Gesicht; dann that es sein Sacktuch hervor und an einer Ecke desselben band es einen Knopf auf, wickelte eine kleine Münze heraus und ließ sie in den Opferstock kollern. Das war ein gar schauerlich hohles Hallen in dem Kasten, und ich trat zu dem Mädchen und sagte: „Es ist schön, daß die Jungfer auch ihr Scherflein zur Wiederherstellung dieser prächtigen Kirche beiträgt, aber wenn der heilige Wolfgang nicht hilft, die blutigen Heller der Vorübergehenden werden es nimmer vermögen.“
„Der heilige Wolfgang wird schon helfen!“ antwortete das Mädchen, und leise für sich setzte es bei: „Der muß helfen, ’s kann gar nicht anders sein.“
Dann that es noch einen unsteten Blick zur Kirche empor und schritt hastig fürbaß.
Nicht weit davon im Orte Kirchberg steht ein Baum, der viele hundert Jahre älter ist als die alte Kirche auf dem Hügel, er ist wohl der älteste Baum in unserem Vaterlande: sie nennen ihn die tausendjährige Linde. Auf einer Bank im Schatten dieser Linde saß ein Bauernbursche und trank Most. Er legte seine geschlossenen Fäuste schwer auf den Tisch und brütete vor sich hin. Oben rauschte es in dem undurchdringlichen Laub, der Flügel einer Lindenblüthe tanzte nieder und fiel in das Glas hinein. Der Bursche hob seinen Kopf und murmelte: „Mit dem ist mir nicht geholfen. Was anders will ich haben!“
Er trank sein Glas zur Neige; ich setzte mich zu ihm, da wollte er sich sogleich erheben. Aber die Kellnerin kam mit einem frischen Glase, das er schon früher begehrt haben mochte; so ließ er sich wieder auf den Sitz nieder.
„Fortweg bin ich ein ordentlicher Mensch gewesen, und jetzt werde ich ein Lump!“ murmelte er. Er war sehr roth im Gesichte und seine großen dunkeln Augen blinzelten lebhaft. Es war ein hübscher, intelligent aussehender junger Mann.
„Das wäre aber doch schade!“ erlaubte ich mir der Bemerkung des jungen Mannes zu entgegnen.
„Ja freilich ist’s schad’!“ lachte er, schon etwas erhitzt von dem Getränke. „Wer weiß, wie viel Lumpen unter diesem Baume schon gesessen sind. Ich bin der Erste und der Letzte nicht, dem’s so geht. Ich hab’ kein Haus und Hof und kein Geld, und desweg verleg’ ich mich jetzund auf’s Saufen.“
Ich schwätzte hin und schwätzte her, und da erfuhr ich’s endlich: der Vater seiner Herzliebsten, ein reicher, starrtrotziger Grundbesitzer, habe zu ihm gesagt: „Du Wolfl, bis in der alten Wolfgangskirche wieder ein Altar steht, laß’ ich Dich davor mit meiner Tochter trauen. Und eher nit!“ Es war ein förmlich Gelöbniß.
Aber in der Wolfgangskirche, wo der Altar stehen sollte, lag ein großer Schutthaufen, wuchsen Brennnesseln darauf. Die frommen Christen sollten die Kirche wieder aufbauen! Eher denn das geschieht, wachsen auf dem Wechsel die Feigen. Dem Burschen war schon ein gescheiter Gedanke gekommen; er hatte an den Besitzer von Kirchberg und der Wolfgangskirche — an den Erzbischof Rauscher nach Wien — ein Brieflein geschrieben: „Gnaden bischöflicher Herr! Die christlichen Leut’ in Kirchberg und auch in der Gegend herum möchten[S. 98] so gern die alte Kirche wieder haben und zum heiligen Wolfgang darin beten, und auch für den guten bischöflichen Herrn. Wollte Er nur was geben um Gottes willen, daß die Kirche wieder könnte hergestellt werden; der hochwürdige Bischof thät sich damit eine hohe Stufe in den Himmel bauen.“
Was war die Antwort auf dieses Schreiben? — Die Leute könnten auch in der neuen Kirche beten, und er, der Erzbischof, brauche keine Stufen in den Himmel, er fahre mit Roß und Wagen hinein. — Das heißt, so hatte dem Wolfl einmal geträumt; in Wahrheit war gar kein Brief und gar keine Antwort.
Der Wolfl hatte mir so seine traurige Geschichte erzählt, wir wurden gute Bekannte, und letztlich begleitete er mich hinauf zur Hermannshöhle. Aber den heiligen Wolfgang brachte er nicht mehr aus dem Kopf, und er erzählte, wie der Mann Gottes als Einsiedler in dieser Höhle gelebt habe, wie große Mirakel darin geschehen seien, wie aber mit der Zeit die Menschen so schlecht geworden, daß sie gar den Eingang in die heilige Höhle nicht mehr gefunden hätten und daß erst viele hundert Jahre nachher ein armer Hirte diese Grotte wieder entdeckt habe.
Nach solchen Erörterungen krochen wir in den Berg. Eiskalte Luft wehte uns entgegen und der Wolfl zündete eine Fackel an. Durch hohe, schmale Gänge schritten wir, da weitete sich der Raum; wir standen still und sahen und hörten die Natur arbeiten in ihrer geheimen Werkstatt. Schier traumhaft und kindisch ist hier die Natur. Mit Kalkstein, aus dem sie sonst die gewaltigsten Gebirge aufgeführt hat, treibt sie hier ein Kleingewerbe, oder vielmehr sie spielt damit; sie hat dem Menschen seine Künste abgelauscht und will sie vorwitzig betreiben. Da ist sie Bergmann und zieht[S. 99] Schachte und Stollen, da ist sie Baumeister und führt Tempel und Hallen auf; da ist sie Bildhauer und schafft die seltsamsten, launigsten Gebilde; aber sie schämt sich ein wenig damit, denn sie hat eine etwas ungeübte Hand für derlei und sie will ihre Spielereien verstecken in die hintersten Winkel.
Der Mensch hat sie doch gefunden und er bestaunt die Natur, die selbst in ihren kleinsten Zügen Größeres schafft als eben der Mensch mit all’ seiner Macht. Und wie sie schalkhaft thut, die große Schöpferin hier in der Erde Schoß! Da macht sie einen Frosch aus Kalk und einen Todtenkopf aus Stein. Dann fällt ihr das Treiben der Leute ein und sie thut völlig ernsthaft, die Schäkerin, und formt eine Glocke, eine Kanzel, eine Pickelhaube — aber ehe das Ding noch fertig, verwischt sie es schon wieder, als ärgere sie sich selbst über das kindische Treiben. Der Mensch kommt ihr aber gar so voreilig entgegen mit seiner Phantasie und lügt ihr die stolzesten Wasserfälle, die schwellendsten Weintrauben heraus, und Alles, was er selber träumt, das sieht er hier bei mattem Fackelschein in den Tropfsteinen. Der Riesen-Hermaphrodit allerdings, der ist ohne alle Phantasie zu finden, und die Natur versteckt sich dahinter und kichert.
Plötzlich standen wir vor einem Sumpf, in dessen Wasser sich unsere Fackel spiegelte. „Das ist der Teich,“ sagte mein Begleiter; „’s ist ein kleiner Bub’ in der Gegend, der zieht sich mutternackt aus und badet sich da drin, wenn er dafür einen Sechser kriegt. Wenn die Wiener kommen, da verdient sich der Bub’ einen Haufen Geld; den ganzen Tag schwappelt er da im Wasser herum, und das soll bei so einer Beleuchtung was Wunder seltsam anzuschauen sein. Die Wiener haben den Buben so verführt, und bei der[S. 100] nächstletzten Osterbeicht ist er desweg nicht losgesprochen worden.“
Wir gingen und krochen lange Zeit hin und her, stiegen auf und nieder, Hunderte von Stufen; und als wir in einer schauerlichen Grotte standen, voll grauer Zacken und wüster Spalten und ungemessener Tiefen, da sagte mein Bursche: „Gucket da hinab, da geht’s schnurgerad’ der Höllen zu. Wüßt’ ich gewiß, daß ich mein Herzlieb nit und gar nit thät kriegen — mitsammt der Fackel wollt’ ich mich hinabstürzen zu dieser Stund!“
Und ein wenig später faßte er mich am Arm und rief: „Ihr seid gewiß reich oder mit dem Bischof wohlan. Geht, lasset mir die Wolfgangskirche bauen und einen Trau-Altar hineinsetzen, sonst fahren wir allbeid’ in die Höllen hinab!“
Dann lachte er und sagte: „Ja, das ist eine Zeit, und mit dem Spaß muß man sich die Verzagtheit vertreiben. Wie närrisch, wollt’ ich mich denn in die Höll’ stürzen, so lang’s noch Wirthshäuser giebt auf der Welt! Trinken will ich und meinen Rock und meine Hosen vertrinken, aber in der Pfaid will ich hingehen zu ihrem Herrn Vater und sagen: ‚Schaut den saubern Lumpen an, den habt Ihr zuweg gebracht!‘“
Als wir wieder eine Weile gegangen waren in dem unterirdischen Labyrinth, da hing plötzlich eine Laterne nieder vor unserer Nase. Der Wolfl zündete die Laterne an und zog sie durch einen Strick zur Höhe. Sie tanzte an Tropfsteingebilden und Felsmassen empor, bis das Licht nur ein winziges Sternchen war, und dann fragte er mich, ob ich an die Höhe glaube.
Bald darauf deutete mein Führer durch eine enge Spalte, aus welcher uns die ewige Nacht entgegenstarrte: „Hier ist der Weg nach Kranichsberg.“
Die Höhle sollte sich bis in das eine Stunde entfernte Schloß Kranichsberg erstrecken?
Der Wolfl behauptete es. Zur Türkenzeit hätten sich die Leute vom Schlosse aus in diese Höhlen geflüchtet.
„Und jetzt kommt, jetzt sollt’ Ihr was Schönes sehen!“ sagte der Bursche, ließ mich eine hohe Leiter hinansteigen und führte mich durch eine sehr enge, feuchte Kluft, in welcher fallende Tropfen an der Fackel zischten. Dann krochen wir durch niedrige Engen, und nun erlosch plötzlich die Flamme. Jetzt waren wir in der dichtesten Finsterniß und weiß Gott wie tief unter der Erde! Der Wolfl lachte, stieß ein Brett beiseite, und siehe — das helle, holdselige Tageslicht und das weite Thal und der grüne Wald lächelten uns entgegen.
„Wen die Welt nimmer freut, der muß nur einmal in so ein Loch hinabkriechen,“ bemerkte mein Bursche, „hab’s allweg so gehalten, und letztlich ist Einem doch der helle Tag lieber wie Alles miteinander.“ Bauersleute thun sonst selten solche Reden, darum überraschten sie mich an diesem Burschen. „Ja,“ sagte er, „wenn’s Einem halt nicht gut geht, so denkt man über Vieles nach; und jetzt schaut Euch den Berg einmal von auswendig an, er ist nicht uneben, ist grün über und über; man soll’s nicht glauben, daß es da drin so schauderhaft sein kann.“
So hatte ich mit dem Wolfl Kirchberg und die Hermannshöhle gesehen. Als ich mich von dem tiefverzagten und doch schalkhaften Burschen trennte, sagte ich zu ihm: „Nur alleweil wacker, lieber Freund! Siehe, Du hast stetig den Berg vor Augen, den sie Wechsel heißen. Auch mit Dir kann sich noch ein guter Wechsel ereignen und ’leicht kommt doch noch ein Mann, der in der Wolfgangskirche Dir den Altar der Liebe baut.“
Es ist ein prophetisch Wort gewesen. Ein paar Jahre danach kam ich wieder in die Gegend, da hatte das alte Gotteshaus auf dem Hügel ein schimmerndes Schindeldach, und im Innern, wo der Schutthaufen gelegen, stand ein freundlicher Altar.
Ich weiß nicht, ob der brave Dechant des Ortes um das starre Gelöbniß des reichen Bauers wußte und ob ihn die Liebesnoth des armen Wolfl dauerte — doch er ließ milde Gaben sammeln und davon die alte Kirche wieder herstellen.
Zum Glücke war der Wolfl mittlerweile doch kein „Lump“ geworden, wie es sein heilig Fürnehmen gewesen, sondern ein braver, fleißiger Bursche geblieben. Und vor dem neuen Altar in der alten Wolfgangskirche ist er mit seinem Herzlieb getraut worden.
Heute mag er nimmer hinabsteigen in die Höhle, denn es freut ihn die Welt hier oben.
a, na, Seppel, das mußt nicht thun. So was muß der Christenmensch meiden. Für’s Erst’ bist noch zu jung, und für’s Zweit’, wenn Einer alt genug ist, denk’ auf die Sünd’! Auf die Sünd’ mußt denken, Seppel! — Die anderen jungen Leut’ wären auch so, meinst? Schlecht genug, Seppel. Du mußt gescheiter sein. Kunnt’st Dich leicht in’s Elend setzen, nachher ist’s zu spat, nachher denkst an die Vatersred’ und kannst Dir nimmer helfen. Denk’ auf die Kümmernuß! Weiberknecht sein, Tag und Nacht arbeiten, daß Kein’s verhungert! Ja, mein Du, wenn das nicht wär! Die Sünd’ und die Sorg’! Wirst nit so dumm sein und mit solchen Rössern spazieren fahren. Thät’st mir derbarmen! Blutig thät’st mir derbarmen! Heut’ ist’s noch früh genug. Ich, wenn ich der gescheit’ Seppel thät sein — auf der Stell’ ging ich ihr absagen.“
„Zuweg soll denn ich Keine gern haben, das möcht’ ich wissen. Der Vater hat doch auch Eine genommen.“
„Scham’ Dich, Seppel, daß Du mir Deine Mutter nachred’st (mißgönnest)! Du bist dabei gewiß nicht zu kurz kommen. Auf Deiner Mutter wachst heut’ der grün’ Wasen, die laß mir in Ruh’!“
„So meint der Vater, daß ich’s sollt’ sein lassen?“
„Daß Du’s sollst sein lassen, Seppel. Schau fleißig zum Arbeiten und Beten, schmeckt Dir des Tag’s das Essen und des Nachts der Schlaf — hast keine Anfechtungen. Und kannst es schon gar nicht g’rathen (entbehren), daß Du was thust, das unnöthig ist, so rauch wegen meiner ein Pfeife Tabak. Nur mit keiner Weibaten gieb Dich ab.“
„Und just eine Weibate hätt’ ich mögen.“
„Weil Du ein Trutzbock bist! Hell mir zu Trutz! Ich sag’ Dir’s in Güten, Seppel: Du bist noch minderjährig, vergiß nicht, wer Dein Vater ist.“
„Gewiß nicht. Ich bedenk’s auch, warum er’s ist.“
„So! Ich versteh’s, was Du meinst, Giftmaul. Ist das die Ehrfurcht, die Du Deinem Vater schuldig bist? Bursch’, bring’ mich nicht in’s Grab!“
„Ich sag’ nichts mehr, ich bin schon still, und jetzt geh’ ich schlafen.“
Das ist zwischen dem alten Toni-Bürsch und seinem dreiundzwanzigjährigen Sohn die Abendunterhaltung gewesen.
Der Alte betete sein Abendgebet; das erste Paternoster weihte er seinem Sohn, das zweite derselbigen, die sein Seppel gern sah; das dritte für sein verstorbenes Weibel, daß es in Frieden ruhen bleibe; das vierte betete er um einen guten Schlaf für sich selber, denn er hatte großen Kummer von wegen Derselbigen, die seinen Jungen in Versuchung führte.
Der Seppel that aber nicht, wie er gesagt hatte; er ging in den Haarspinnhof und klopfte dort an das Kammerfenster der Christine.
„Gieb Fried, Dein Angehen mag ich nicht leiden!“ begehrte die Christine drinnen auf, aber so leise, daß es Niemand im Hause hören konnte.
„Was redest denn, Christl, wenn Du noch nicht wissen kannst, was ich will,“ sagte der Seppel, „ich bin nur da, daß ich Dir’s sag: mit uns Zwei — was wir ausgeredet haben — ist’s dieweilen noch nichts. Ich verlieb’ mich nicht, ich bin noch eppas zu jung. Wart’ halt; wenn’s mir gach einfallt, daß ich komm’!“
Sie sagte kein Wort, und er ging davon. Und war zufrieden mit seiner Feinheit — Die Christine sah er gern, das stand fest, wie die Erde. Aber sie war eine Kalte. So viel jung und sauber, aber so viel kalt. Wenn Eine auf jede Frage nichts als „na“ sagt, so ist das keine Sach’. Jetzt hat er ihr abgesagt — sie soll nur warten, ’leicht wird sie wärmer — und im Grunde sind Beide noch so jung, daß sie nichts versäumen. Dieweilen wird er großjährig und hernach hat der Vater nichts mehr dreinzureden. Auf seinen Vater muß der Mensch doch achten, auf daß es ihm wohlgehe. Und von wegen der Erbschaft auch. — Deswegen war’s fein vom Seppel, und wenn Einer so in rechter Friedsamkeit weiter lebt und all’ Tag seine Uhr aufzieht, so wird er nach und nach doch großjährig. Nachher stellt er sich mit ausgespreizten Beinen hin vor den Vater, steckt die Hände in die Hosentaschen, so tief es geht und sagt: „Na Vater, itzo wollen wir halt einmal probiren, wie’s mit den Weibsbildern ausschaut. Ist der Vatersegen zu haben, so wird’s uns g’freuen; ist er nicht zu haben, so soll’s desweg keine Feindschaft geben.“ — Beim Seppel kommt’s ja doch nur mehr auf ein Jahr an, daß es ein Schaltjahr ist, wird auch zu verwinden sein, wird die Christine noch um einen Tag wärmer. Der Seppel vertreibt die Zeit auf einem Holzschlag drüben im Neuviertel, und kommt nicht oft heim. Deswegen ist Einer Mann, daß er seine Sach’ derwarten kann.
Es war ganz genau, wie er sich’s gedacht hatte, das Jahr wurde täglich um einen Tag kürzer, und die Christine im Haarspinnhof täglich um einen Tag wärmer. Da erhielt der Bursch eines Tages Nachricht, der Toni-Bürsch lasse sagen, der Seppel möge einmal heimkommen, möge doch auf den Vater nicht ganz vergessen.
Das ist auch wahr, dachte der Sohn, auf meinen Vater darf ich nicht vergessen, jung ist er auch nicht mehr; wenn der Mensch einmal im Siebenundsechzigsten steckt, denkt er halt auf’s Testamentmachen. — Und geht heim, und findet den Vater, Gottlob, rechtschaffen gesund und rührig, und der Mann hat einen Schneider im Haus. Der Schneider macht ein kohlschwarzes Tuchgewand; im Vorhause zimmert der Tischler aus sechs Brettern...
„Aber, Vater, wer wird denn auf so was denken?“ sagt der Sohn.
„Willst mich Du zuletzt noch gar bevormunden?“ sagt der Vater, „ein solches Leben gefreut mich nicht mehr. Ich denk’ ich bin alt genug dazu.“
„Warum nicht gar! Wie der Vater jetzt ausschaut: noch dreißig Jahr dermacht er’s.“
„Verhoff’s. Für weniger laßt sich’s der Mensch kein nußbaum’nes Ehebett kosten. — Wirst wohl bei der Hochzeit sein, Seppel!“
„Ja, wer — wer denn?“ fragte der Sohn.
„Mein lieber Bub’,“ sagte jetzt der Alte und blickte den jungen Mann liebreich an, „ich hab’s bedacht und Du hast mir so viel arg derbarmt. Keine Mutter haben, ein Waisel sein — ’s ist eine arme Sach’. Nachher, wenn man’s bedenkt, ich brauch’ auch wen, gesetzt, daß ich gesund bin, und gesetzt, daß ich einmal mühselig werd’. Und auch[S. 107] eine Sündhaftigkeit ist’s, so ein lediges Daherleben, und es sind die jungen Gedanken noch da.“
Jetzt antwortete der Seppel: „Das verstehe ich nicht. Wenn bei mir etwa einmal die jungen Gedanken da wären, gleich thät’s heißen: Denk’ auf die Sünd’! Auf die Sünd’ mußt denken, Seppel. Was hat der Vater denn gesagt, wie ich selbunder die Christel hab’ wollen nehmen? Das vierte Gebot hat müssen herhalten und die Sündhaftigkeit. Bei mir ist’s Gernhaben sündhaft, bei Euch das Alleinbleiben, jetzt möcht’ ich wissen, wie Einer dem Teufel auskommt.“
„Kommt ihm nicht aus, Seppel, hast Recht!“ sagte der Alte, „aber zeigen muß ich sie Dir doch, Deine neue Mutter. Hab’ sie da im Stübel d’rin. Geh’, Christel, geh’ heraus ein wengel!“ Stand sie da.
Dem Seppel ist im ersten Augenblick so dumm gewesen, als wenn ihm ein härener Sack über den Kopf geworfen worden wäre. Als er sie aber eine Weile angeglotzt hatte, sagte er: „Soll das eine Fopperei sein?“
Sie schüttelte den Kopf, als wie Eine, die nein sagen will.
Da wendete sich der Sohn zum Vater und sprach: „Vater hin, Vater her, jetzt red’ ich anders. Ihr habt die Unrechte erwischt, das ist die Meine. Die laß ich nicht aus, ehevor setzt’s was!“
„Das Geschrei ist nicht vonnöthen,“ sagte der Alte verbissen, „wir sind auf gleich und haben uns ehrlich Wort gegeben. Aber wenn sie meint! Ich bin nicht der Mensch, der wen zwingt und ’s kommt nur d’rauf an, daß sie es selber ausspricht, welchen sie haben will, den Jungen oder den Mann.“
Der Seppel bebte vor Zorn, aber er bezwang sich und fragte die Christine: „Na, welchen denn?“
„Der bei mir bleibt, und das Gernhaben nicht verschiebt über’s Jahr. Bildest Dir was ein auf Dein Jungsein! Wir fragen bei Euch Mannsleuten nicht viel um’s Alter, mußt wissen, aber bei uns Weibsbildern hat’s Eil!“
„Das ist Recht!“ machte der Alte, „Christel, thu’ ihm’s nur tüchtig sagen. Hätt’ sich früher um Dich sollen bekümmern; der Lecker, jetzt möcht’ er was dreinreden.“
„Ich werd’ noch mehr dreinreden!“ rief der Seppel und stellte sich fürchterlich vor dem Vater auf.
„Du sei still!“ fuhr die Christine drein und schob den Burschen bei Seite, „er ist Dein Vater. Aber der meine ist er nicht, und ich red’.“
„Hast schon Recht, Christel, red’ Dich nur aus, ist mir allemal lieber,“ drauf der Alte.
„Wird Dir schon genug werden, Toni-Bürsch,“ sagte sie, „Dein ehrlich Wort? Na, ich bedank’ mich! Du hätt’st mich sauber drankriegt; jetzt, und noch zu rechter Zeit seh’ ich’s ein, Du bist ein Falscher!“
Er fing ihren Arm und rief: „Wohl gewiß nicht, Christel, ich schau Keine an, außer Dir!“
„Das glaub’ ich gern, aber gegen Dein eigen Kind bist falsch. Bis auf die jetzige Stund’ hab’ ich’s nicht gewußt, daß Du den Seppel von mir hintan gehalten hast, weil es Dich selber noch gelust’ nach einer jungen Dirn. Die Höll’ hast ihm heiß gemacht; und dieweil er Dir nachgeben und Vaters wegen die Liebste verlassen hat, wirfst ihm heut’ vor, daß er sich besser um mich hätt’ kümmern sollen. Er ist eine Lettfeigen, aber er ist ein gutes Kind; Du bist ein schlechter Vater und kunntst leicht ein noch schlechterer Mann sein. Toni-Bürsch, von Dir hab’ ich genug!“
Der Schneider war aufgesprungen, der Tischler hobelte nicht mehr — es bleibt ja Alles aus!
„Macht’s nur weiter, Handwerkerleut,“ sagte der Seppel, „wird schon Anwerth haben. Die Christel nimmt mich.“
„Das mußt erst sehen,“ sagte diese — und war fort.
— Standen Vater und Sohn sich gegenüber und sahen sich an.
„Geh, Seppel, thu’ nicht so grimmig schauen,“ sagte der Alte süß, „einen Spaß wirst doch verstehen.“
„Ist mir lieb. Ein Spaß soll’s gewesen sein, will auf nichts Anderes denken. Aber von heut’ an bin ich großjährig.“
Der Alte ließ es gelten und redete nichts mehr drein. An einem der nächsten Tage ging der Seppel zur Christine und sagte: „Dirndl, der Schneider und der Tischler sind fertig.“
Nun —? Was sagte sie dazu? Es war ihr recht.
m Ramsauerthale steht die alte moosbärtige Fichte, an welcher das Wunder geschehen ist. Dort hat der Graf Adlerstamm den Hahn und der Preiner-Michel den Bock geschossen.
Im Frühjahre war’s, als der Graf in Nimrods kecker Rüstung in’s Thal fuhr. Der Oberförster — Hans Schrödinger heißt er, der uns nachher die Geschichte erzählt — hatte für Jagd und Wild zu sorgen. Er war rathlos. In die nahe Holzknechthütte ging er hinüber, hieß den Vorhacker, den Preiner-Michel mit sich, und als sie allein durch den Wald gingen, und der Michel seinen Tabaksbeutel vom Rücken herüberzog, wo er ihn im Gurte stecken hatte, und seine Pfeife füllte, sagte der Förster: „Möcht’ ich wissen, wie wir das anfangen.“
„Ist was anzufangen?“ fragte der Michel.
„Der Graf ist da und will morgen Früh einen Auerhahn schießen.“
„Dem gehört die Jagd, der kann’s thun.“
„Der kann’s nicht thun,“ sagte der Oberförster.
„Warum? Heuer giebt’s ja Hähne genug, weiß selber einen oder zwei. Der Herr Graf muß halt gut auf den Stand geführt werden.“
„Das ist zu wenig, mein Lieber, der Graf trifft nichts. Es muß was geschehen. Jetzt, denk’ Dir einmal, ist’s heuer das zehnte Jahr, daß der Herr auf den Hahn kommt, und hat noch nicht ein einzig Federl geschossen. Er wird Dir endlich verzagt, verkauft die Jagd, und das wär’ arg; Du weißt, Michel, er giebt —“ und machte mit den zwei Gebefingern eine bedeutsame Geste. „Kurz, er muß morgen den Hahn schießen. Aber wie, Freundchen, wie? Wenn ich mir das nur anzuschicken wüßt’.“
„Binden wir ihm den Hahn auf den Baumwipfel,“ meinte der Preiner-Michel, nahm seine angestopfte Pfeife zwischen die Vorderzähne und steckte den Tabaksbeutel wieder in den Gurt.
„Anbinden,“ sagte der Förster, „d’ran habe ich schon gedacht, aber es ist zu wenig; er trifft ihn nicht.“
„Wenn er zwei- und dreimal hinaufbrennen kann?“
„Trifft ihn nicht. Der Graf ist kurzsichtig, das weißt, hat keinen festen Ansatz und keine sichere Hand und keine Geduld und Ruh’; dem fehlt nicht mehr, als Alles zum Jäger.“
„Nachher kunnt ich keinen Rath geben,“ sagte der Michel.
„Es giebt nur Ein Mittel,“ versetzte der Förster mit leiser Stimme, als traute er nicht einmal den Bäumen, „und weil es das einzige ist, so muß es ausgeführt werden.“
„Nachher ist’s ja recht.“
„Aber dazu brauch’ ich Dich, Michel. Los’ einmal.“
Und sie blieben stehen und der Förster brachte dem Vorhacker was bei.
„Na Du,“ sagte dieser plötzlich laut auflachend, „das thu’ ich nicht!“
„Kannst es ganz ruhig thun; ’s ist gar keine Gefahr. Er schießt zum mindesten eine Klafter weit an Dir vorbei.“
„Zu dem Geschäft such’ Dir einen Andern, Förster.“
„Nun, zu Deiner Beruhigung — Du weißt ja, daß ich dem Herrn den Büchsenspanner abgebe — werde ich das Gewehr blind laden.“
„Das ist eine Red’. Jetzt hast mich. Wo will der Herr Graf den Hahn schießen?“
„Oben im Donnerwald, etwa bei der Zwiselfeichten. Je weiter und schwieriger der Weg, desto größer das Vergnügen. Kennst ja das, von den hohen Herren. Und um drei Uhr, wo’s g’rad noch die rechte Finstern hat. Nicht vergessen auf’s Balzen!“
„Ist recht.“
Sie verabredeten noch Manches und verloren sich im Walde. —
Um Mitternacht wird der Herr Graf höflich geweckt. Er beladet sich mit Allem, was dem alten Jägersmann an den Leib steht. Und wenn der Förster meint, das oder das sei heute nicht nöthig, so sagt der Graf fürsichtig, ’s wär’ immerhin besser, man hätt’s bei sich. Es ist eine klare stille Nacht.
„Excellenz!“ sagte der Förster unterwegs, „heut’ gilt’s Einen. Ich sag’s. So schön ist mir noch Keiner gestanden, wie der heutige.“
„Soll Sein Schade nicht sein. Doch — hat Er’s gehört, jetzt? Ist das nicht ein Schuß gewesen?“
„Wahrhaftig,“ lachte der Förster, „auf’s Haar wie ein Schuß; das hat mich anfangs auch immer getäuscht. Nein, Excellenz-Herr, eine Lawine ist im Höllgraben drüben abgegangen. Das ist um diese Zeit nichts Seltenes.“
Je höher sie emporkamen gegen den Donnerwald, desto leiser wurde ihr Gespräch. Als sie bei der Rothbuche waren und horchten, hörten sie das erstemal balzen. Nun hub das Laufen an, um dann, während der Hahn wieder schwieg, starr wie ein Baumstrunk still zu stehen.
So waren die beiden Jäger allmählich zur Zwiselfeichten gekommen, in dessen buschigem Gewipfel das Thier schnalzte und balzte, daß es eine Lust war.
Der Förster führte den Grafen auf den rechten Standpunkt und fragte flüsternd, ob er dort oben den Hahn wohl sehe.
„Wohl, wohl! ’s ist ein sakrisch mächtiger Kerl.“
„Natürlich, das schwarze Bündel dort ist der Baumwipfel. Daneben, der kleine Punkt....“
„Gut, gut!“ entgegnete rasch der Graf und fuhr mit dem Schaft zur Wange. — Puff! war auch schon der Knall da. Man meinte, schier zu früh, aber siehe — diesmal Glück! Das Thier rauschte herab von Ast zu Ast und schwer fiel es nieder auf den Boden.
Der Graf sprang hinzu, jauchzte, jubelte; es war auch ein prächtiger Vogel. — Das Telegraphenamt! Allsogleich berichten der Gemahlin, den Freunden: Vivat, den Hahn geschossen. Morgen großer Schmaus! —
Ein herrlicher Vogel fürwahr! und gerade mitten in die Brust getroffen! Aber — was hängt doch daran? An den Klauen hängt ein Knollen — was das sein mag? — Sogleich ist Licht gemacht — welch’ eine Erscheinung?! In die Klauen verhakt lag ein vollgedunsener Tabaksbeutel.
„Verdammter Esel!“ fluchte der Förster für sich und rasch setzte er bei: „Der erste Fall in meiner Praxis, Excellenz-Herr, wo mir das vorkommt, was erzählt wird, daß Auerhähne[S. 114] bisweilen in die Nähe der Holzarbeiter dringen und verschiedene Gegenstände, die die Leute irgendwo bei Seite gelegt, mit sich forttragen. Ich wette, diese Tabaksblase ist ein solcher Raub. Seltsam, seltsam!“
Der Graf starrte drein und sagte kein Wort. Den Vogel ließ er liegen; auf dem kürzesten Weg eilte er dem Bahnhofe zu. Und der Michel kletterte verzagt von der Zwiselfeichten, von welcher er früher den todten Vogel herabgeschleudert hatte.
„Was kann denn ich dafür!“ betheuerte er dem Förster, „Ihr seid zu früh dagewesen. Wie der Schuß fällt, hängt der Vogel noch fest an meinem Gurt. Ich reiß’ ihn eilends los, nu, und hab’ halt meinen gottverblitzten Beutel mit hinabgeworfen.“
In acht Tagen war das Revier verkauft.
a gingen einmal drei Studenten auf Vacanzen. Sie machten eine Bergreise im Salzburgischen und hatten viel Courage und wenig Geld. Der Eine, Markus Frischer, hatte in Berchtesgaden wohl eine kleine, zierliche Dose herausgefeilscht und dieselbe hübsch mit Schnupftabak gefüllt, um dem zu besuchenden Pfarrer in Sanct Barbara damit ein Geschenk zu machen. Das sollte bei dem geistlichen Herrn — einem weitläufigen Verwandten Frischer’s — eine feine Aufnahme und noble Bewirthung bezwecken. Als sich der Herr „Vetter“ aber nur mit einem einzigen Glase sauren Weines und etlichen Stücklein Brotes, die er selber vorschnitt, einstellte, ließ der Enttäuschte in den Wirren des Abschiednehmens die Berchtesgadner Dose heimlich wieder mitgehen.
Dann kamen sie in’s Pinzgauische hinüber, in das Wildschützenland.
„Hier wohnen lauter fromme Leute,“ sagte Studio Grußing, Candidat der Juristerei, der größte und kühnste von den Dreien, „in den Bauernhöfen, wo wir zusprechen, wollen wir fleißig geistlich werden und einstens unsere heiligen Messen lesen für die Wohlthäter. Werden dabei nicht verhungern, versteht Ihr? Aber Geld! Es giebt pulverisirte[S. 116] Tausender genug zerstreut im Lande, es wäre beim Zeus doch schmählich für so drei Kreuzköpfeln —“
„Freunde!“ rief Stroche, der älteste und verschlagenste vom Kleeblatt, „Ihr wißt, ich kenne diese Gegend und die Leute, die ihres Aberglaubens wegen so berühmt sind, wie etwa die Oberammergauer ihrer Passionsspiele halber. Es giebt anderswo auf der ganzen Welt keine Pinzgauer mehr. — Und jetzt habe ich eine Idee.“
„Ah, Ideen hast Du viele,“ rief Grußing, „zeige endlich nur einmal, daß Idealisten auch praktisch sein können, denn die böse Welt will das nicht glauben.“
„Ich werde sie überzeugen,“ versetzte Stroche trocken. „Frischer, willst Du mir zum allgemeinen Besten Deinen Schnupftabak zur Verfügung stellen? Die Dose magst für Deine alten Tage behalten. — Und Du, Bruder Grußing, willst Du Dich einmal ein bißchen todtschießen lassen?“
„Oh, mit Vergnügen!“ rief der Gefragte.
„Schön,“ sagte Stroche, „so werden wir morgen Geld haben. — Der schwarze Hannes ist wieder ausgebrochen, merkt Euch das!“
Sie lugten ihn an und dachten: Ist ein komischer Kautz, der Stroche.
Dann stiegen die Drei in’s Gebirge hinan, einem Hirtenhause zu, das versteckt war zwischen Wald und Wänden. Unterwegs hatte Stroche mit dem „Jusdoctor“ viel zu reden, und es wurden in einem Versteck die Kleider umgekehrt und der Plaid in Form eines alten Bauernmantels aufgeheftet, es wurde mit ausgepreßtem Kräutersaft das Gesicht Grußing’s braun gefärbt, es wurde das Hinken auf dem linken Fuß eingeübt und Mehreres dergleichen. Dann gingen die Zwei, Stroche und Frischer, in die Halterhütte. Der[S. 117] Halter — Duckmichel hießen sie ihn — war ein kleiner, rühriger und doch unbeholfen und blöd aussehender Mann; nur in dem stets halbgeschlossenen Auge hatte er jene stechende Gluth, die bei fanatischen und abergläubischen Leuten so häufig zu bemerken ist. Und die ganze Hütte war inwendig mit geweihten Weidenzweigen, Amuleten, Alraunen u. s. w. behangen.
Die beiden Studenten — Stroche war nicht ganz fremd im Hause — wurden mit bäuerlicher Höflichkeit, die ein Gemisch ist von Naivetät und Koketterie, empfangen und mit Brot, Butter und süßer Milch bewirthet. — Thäten allbeide auf geistlich studiren, hätten ein heißes Jahr hinter sich — die siebente Schul’, wo der Theolog mit dem Teufel die erste Bekanntschaft machen müsse.
„So, so,“ sagte der Duckmichel und klopfte an dem Fingernagel des Daumens die Asche seiner Pfeife aus. „So, so! Thuen die Herren nur essen und trinken! Gesegne Gott, wir haben noch was in der Kammer. Ist wohl vergunnt! — Die siebente Schul’, die schwarz’ Schul’, heißt’s, mein’ ich —? Na, gelt, weiß es ja. — Viel dicker auf’s Brot streichen, junger Herr, die Butter! Recht schad’, daß uns der Honig ist gar worden. — Schau, schau. — Vor nächst Jahren sind auch einmal so Herren heroben gewesen; die haben dem Nachbar da unten, dem Schlederer-Ferl — heißt er — der Müh werth ein bissel ein Studentenpulver gegeben.“
„Aha,“ murmelte Stroche seinem Genossen einen recht absichtlich vielsagenden Blick zuwerfend, „ägyptisches Pulver meint er.“
Der Halter lugte und lauerte, war überzeugt, sie hätten Studentenpulver bei sich. Dieses ist ein gezaubertes Schießpulver, das nicht knallt — für Wildschützen eine gute Sach’.
Stroche erhob sich nun einmal und ging hinaus in’s Gebüsch, wo Grußing im Brombeerlaub lag. „Du,“ flüsterte er zu diesem, „es geht prächtig, der Dummkopf ist allein zu Hause und er hat selber von dem Pulver angefangen. Puppe Dich eilig in Deinen Räuberstaat, schleiche dort auf die Felsbank, und pflück’ Erdbeeren so lange, bis ich vor der Hütte laut rufe: „Feuer!“ Dann wird der Hahn knacken und wie Du das hörst, so stürze zusammen — vergiß nicht drauf!“
Es war schon früher Alles verabredet gewesen, und so genügte die kurze Weisung, nach welcher Stroche sogleich wieder in’s Haus eilte. Darauf kam der Halter mit Ingwerbranntwein. Der Student blickte zum Fenster hinaus auf die gegenüberstehende Felswand.
Der Duckmichel hätte gern vom Studentenpulver gesprochen, man merkte es ihm an. Er redete so herum von Venedigerkapseln, deren Feuer den Schuß die doppelte Weite trägt; von Suchkugeln, die jenes Ziel — sei es wo immer — aufsuchen, an welches der Schütze beim Losdrücken denkt. Dann fragte er: was denn immer Neues in der Welt?
„Neues genug, aber nicht viel Gutes,“ sagte Stroche, auf die gewohnte Sprechart der Landleute eingehend. „Habt’s schon gehört, in der Kufsteinerfestung — der schwarze Hannes ist wieder ausgebrochen.“
„Soll’s doch wahr sein?“ rief der Halter, und blinzelnd: „Der braucht den Hörndlbuben (Bezeichnung für den Teufel).“
„Siehst Du, der Mann sagt’s auch!“ rief der eine Student dem andern zu. „Sakra, bei dem wär’ ein Geld zu verdienen!“
„Wieso das, mit Verlaub?“ fragte der Halter und machte einen langen Hals gegen den Sprecher, auf daß dieser das Ohr für die Antwort näher hätte.
„Ei!“ versetzte Stroche, „sind ja doch dreihundert Ducaten auf des Räubers Kopf gesetzt!“
Der Halter schlug einen Lacher: „Den einbringen! Da müßt’ Einer ein wenig mehr können, als Birnen sieden.“
„Na, mit gewöhnlichen Mitteln geht es nicht, das geb’ ich zu,“ sagte der Student, und zu seinem Genossen: „Aber das Aegyptische, das thät’s wohl!“
„Weil —“ meinte nun der Duckmichel angelegentlich, „weil wir schon davon reden, wie ist das, mit dem Aegyptischen?“
„Ja, guter Mann, das ist das Studentenpulver, von dem Ihr vorhin gesprochen habt,“ flüsterte Stroche geheimnißvoll, „nicht allein, daß dieses Pulver nicht kracht, Ihr wißt es ja: es löst an Anderen jede Hexerei auf. Kein Zweifel, der Hannes macht sich unsichtbar, macht sich schußfest — aber vor diesem Pulver“ — er deutete gegen seine Brusttasche — „ist Alles umsonst. Doch, sprechen wir von was Anderem. — Ich verwett’ meine arme Seele, wir haben gestern da unten bei Hüttau den schwarzen Hannes gesehen.“
„Na, seid mir aber so gut!“ hauchte der erschrockene Halter.
„Ganz nach der Beschreibung. Dieselbe Figur, dieselben kohlrabenschwarzen Haar’, derselbe Lodenkittel; und hinkt er nicht am linken Fuß?“
„Jesses, freilich, freilich!“ versetzte der Halter, „hat ihn a einmal ein Standar in’s Knie geschossen.“
„Punctum, er ist’s gewesen!“ rief der Student und schlug die Faust auf den Tisch. Dann faßte er in heller Freude den Genossen an beiden Rockflügeln: „Bruder, vielleicht gelingt’s uns, den Vogel abzuschießen. Jetzt bin ich aber tausendmal froh, daß ich eine Portion Pulver zu mir gesteckt hab’![S. 120]“ Dann wieder zum Halter: „Na, wie geht’s immer, Vetter? Mitunter ein wenig wildern, was? Läßt sich denken, ein Gebirgsbewohner. Nu, ’s ist ja recht.“
„Wohl, wohl, aber —“ fuhr’s jetzt dem Manne heraus, „Studentenpulver thät Einer halt brauchen. Weil wir schon einmal dabei sind: die Herren haben ganz gewiß eines im Sack?!“
Der schlaue Student schwieg einen Augenblick. „Nu,“ sagte er dann, „etwelches trägt man schon bei sich, wenn auch nicht viel, ’s ist ein kostspielig Ding!“
„Allzuwenig,“ meinte nun der Halter, „wollt’ ich nicht hergeben dafür. Was thät’ der Schuß denn kosten?“
„Ist ja nichts für Euch,“ sagte Stroche mit der Hand abwehrend. „Der Schuß kostet einen Thaler.“
Jetzt gab der Halter nicht mehr nach, bis der Studiosus sein braunes Pulver, sorgsam in Papier gewickelt, hervorgezogen hatte. — „Es kann aber höchstens für acht oder zehn Schuß reichen.“ — Der Mann holte seine Geldtasche, feilschte eine Weile und murmelte dann: „’s wird die Herren nicht kränken, aber probiren möcht’ ich’s doch erst.“
„Das versteht sich,“ sagte der Student und sein Auge war durch’s Fenster auf die gegenüber liegende Felswand gerichtet.
„Bei Gott!“ flüsterte er, „jetzt wird mir die Sach’ schon verdächtig. Seht Ihr nichts dort? Schon eine Weile kriecht Euch im Gewände so eine Creatur herum, die — — ein Spitzbub will ich sein, wenn das nicht der leibhaftige schwarze Hannes ist!“
Die anderen Zwei sahen jetzt die Gestalt auch. Der ganze schwarze Kerl, wie er hinkt und sich duckt und späht — ’s ist der flüchtige Räuber.
„Der ist unser!“ knurrte Stroche mit leuchtendem Auge, „das ist einmal ein rechtes Ziel zur Prob’ für’s Pulver. Ich bitt’ Euch, Mann Gottes, einen Kugelstutzen!“
„Ah na,“ sagte der Duckmichel, „da schieß ich selber.“
„Um so besser, Ihr habt ein gutes Auge. Aber Freund, das Gewehr ist doch nicht schon geladen?“
„Noch nicht,“ antwortete der Halter, „haben die Herren, wie sie da heraufgingen, keinen Schuß gehört? Da hab’ ich meinen Stutzen auf einen Raben losgedrückt.“
„Gut,“ sagte der Student, „nichts schlechter, als wenn die beiden Pulvergattungen zusammenkommen.“
„So viel weiß ich wohl selber,“ brummte der Michel und lud das Gewehr mit einer Bleikugel und dem braunen Studentenpulver.
Sie schlichen vor’s Haus. Der Mann im Gewände schien Beeren zu pflücken.
„Man merkt es seiner Sorglosigkeit wohl an, daß er sich für unsichtbar hält,“ versetzte Frischer.
„Ja, unser Pulver!“ lispelte der Andere, „aber, Vetter, zielet gut, und wartet bis ich rufe.“
Der Halter spannte das Schloß, und fuhr mit dem Gewehre zur Wange. Stroche blinzelte entzückt seinem Genossen, dann rief er laut: „Feuer!“ In demselben Augenblicke loderte die Mündung des Laufes, gellend knallte der Schuß.
Die beiden Studenten stießen einen Schreckruf aus und erbleichten. Pulverrauch verdeckte ihren Augen, was vorging drüben an der Felswand.
Der Halter aber wendete sich höhnisch gegen den bebenden Stroche: „Ist das Euer Pulver, das nicht kracht?“
„Was ist geschehen?“ stöhnte dieser, „wie so kann das sein! Da giebt’s ein Unglück!“
Hierauf stellte sich der Duckmichel, das Gewehr fest auf die Erde stemmend, gerade vor die Studenten hin und sagte gelassen: „Meint Ihr denn, Ihr sauberen Herrlein, Unsereiner ist gar so dumm? — Nasses Pulver schon ist mir zuwider, viel weniger schieß ich mit Schnupftabak. — Studentenpulver! Oh, wir kennen den Spaß schon seit lange! Hab’s auch recht gut gehört, was Ihr da unten im Strupp mit Eurem Spießgesellen beredet habt. Hab’ mich unterhalten bei Eurer Gescheitheit. Und so müßt Ihr mir’s schon zu gut halten, daß ich das echt geladene Zeugel losgeschossen habe, weil mir der Vogel da drüben einmal gar so prächtig auf der Mücke gesessen ist.“
„Jesus und Maria!“ jammerten die beiden Studenten, „was ist mit unserem Kameraden geschehen?“
Jetzt löste sich der Rauch und vom Felsen heran eilte Grußing, hoch in der rechten Hand einen todten Falken haltend, der ihm nach dem Schusse förmlich in den Schoß gefallen war.
„Den Vogel will ich Euch schenken,“ sagte der Halter, „spannt ihm hübsch die Flügel aus und nagelt ihn über Eure Bücher an die Wand, daß Ihr’s ja nicht vergeßt, wie wir Bauersleute gar so abergläubisch und dumm sind. — Ist noch Buttermilch anständig?“
Wie Duckmäuser schlichen die drei genarrten Musensöhne davon. Sie leben heute noch. Geistlich ist keiner geworden; alle drei sind Advocaten auf dem Lande, haben immer noch viel Courage und wenig Geld. Aber das Studentenpulver schnupfen sie selber.
nd sieben Plagen kamen über Aegypten. — Es wären sicherlich acht gekommen, aber die Eisenbahner sind damals noch nicht gewesen. — So ergänzte ein Landmann des Gailthales das zweite Buch Moses, zur Zeit, als sie im Thale die Eisenbahn bauten. Die „Eisenbahner,“ wo sie das erstemal einfallen, sind der Schrecken der Gegend. Die böhmischen Erdgraber graben nicht allein dort, wo die Bahn werden soll, sondern auch auf allen Erdäpfeläckern der Nachbarschaft. Die italienischen Steinschlager schlagen nicht allein Steine, sondern auch Bauern, wo sich diese den Fremdlingen entgegenstellen. Aber die schlimmsten dabei sind die deutschen Ingenieure selbst. Da kommen sie mit ihren Schnüren und Meßstangen und fahren Dir d’rein, Bauer, über Wiesen, Felder und Gärten, die bisher Dein und Deiner Vorfahren unangetastetes Eigenthum sind gewesen. Im Grundbuch steht’s und da ist es fest wie der Erdboden. Kein Erdbeben und kein Feuer hat dieses Eigenthum angegriffen, das Wasser hat vielleicht einmal den grünen Rasen zerrissen, aber den Platz hat es nicht mit fortgeschwemmt. Als vor vielen hundert Jahren der Dobratsch niedergebrochen war, da hat er wohl das Thal begraben, aber er hat einen Berg dafür hingestellt, auf dem wieder was wachsen konnte.[S. 124] Und selbst die Franzosen, als sie da waren, haben das Eigenthum der Leute geschont. Und jetzt kommen auf einmal die Ausmesser und sagen: „Hier wollen wir unsere Eisenbahn bauen und diesen Weidegrund und diesen Garten mußt Du uns dazu geben!“ — „Nein,“ sagst Du, „der ist meinen Voreltern nicht feil gewesen und ist auch mir nicht feil.“ — „Wir bieten Dir dafür diese oder diese Summe,“ sagt der Ingenieur, „dann aber mußt Du uns den Grund abtreten!“ — „Mußt?! Was ist denn das für ein Eigenthum,“ sagst Du, „das man mir in einem Rechtsstaat nehmen kann, wann man will? Mir ist gerade an diesem Fleck Erde gelegen und um Geld ist er nicht feil.“
Es hilft Dir nichts, das Gesetz ist stärker, als Dein Wille, Bauer, und — das ist gut. — Wenn’s auf Euch Bauern ankäme, lebten wir heute noch wie die Wilden und das Eigenthum wäre erst recht nicht gesichert. Ueberall und zu jeder Zeit, wo es geordnete Staaten gab, hat der Einzelne zum Wohle des Ganzen opfern müssen. Warum zahlt Ihr die Steuern, warum laßt Ihr Eure Söhne in den Krieg? Feldfrucht und Söhne sind doch auch Euer Eigenthum. Ihr seht die Nothwendigkeit des Krieges nicht ein — ich auch nicht — und Ihr gebt doch die Soldaten. Ihr seht die Nothwendigkeit der Eisenbahnen nicht ein, aber Ihr werdet sie nicht hindern können, denn alle Welt weiß: da die Eisenbahnen einmal sind, so müssen sie sein und kein Mensch wird sie mehr aus der Welt schaffen.
Wer sich widersetzt, der geht zugrunde.
Das Gesetz verlangt, daß dem Bauer für ein der Eisenbahn abgetretenes Grundstück um ein Erkleckliches mehr gezahlt werde, als es unter Brüdern werth ist. Das Gesetz ist also auf Seite der Bauern, dann aber zwingt es.
Beim Schotterhans haben sie’s nicht auf den Zwang ankommen lassen und ist zu Nutz und Frommen eine Geschichte davon zu erzählen.
„Ei geht, ei geht,“ sagt der Schotterhans, „da mögt Ihr reden, was Ihr wollt, was mein ist, ist mein, und ich geb’ meinen Grund nicht her. Ich laß mein Haus nicht niederreißen, in dem meine Voreltern gelebt haben; ich will sterben in dem Haus, in welchem meine Voreltern gestorben sind.“ Aber die Eisenbahn ist so tracirt, daß dieses Stück Grund gar nicht zu umgehen ist und just, wo des Schotterhans Haus steht, muß die Bahn darüber. Das weiß der Hans recht gut. Es ist ihm insgeheim auch nicht der Vorfahren wegen, man erinnert sich noch, wie er seinen alten Vater auf dem Todbett behandelt hat. — Aber der Vorwand ist schlau, Hans, und viel Geld läßt sich herausschlagen.
Nicht mehr als viertausend Gulden ist die ganze Besitzung werth, das Haus ist schon im Einfallen. Aber man bietet dem Hans achttausend.
„Nein!“ schreit der und denkt: „Haben müssen sie’s, sonst können sie ihre ganze Eisenbahn nicht bauen.“
„Nun denn, Schotterhans, wie viel verlangt Ihr eigentlich für dieses armselige Anwesen, das kaum zehn Klafter in der Breite hat?“
Da nimmt der Hans den Mund voll und sagt: „Sechzehntausend Gulden.“
— Gut, denkt sich der Ingenieur, bei sechzehntausend Gulden hört seine Pietät auf. Die Bahn hier geht auf einem Damm. Was kostet eine Brücke über Haus und Grund des Schotterhans? — Hier wird eine eiserne Brücke gebaut und der Hans kann im Hause seiner Vorfahren leben und sterben.
Nach wenigen Monaten braust über das Dach des Schotterhauses das Locomotiv hin. Der Hans starrt das schwarze Ungeheuer drohend an. Es pfeift auf ihn.
Der Hans will Proceß führen; die Doctoren weisen ihn ab, die Leute lachen ihn aus. Grund und Boden gehören ihm, aber nicht der Raum über seinem Giebel.
Um tausend Gulden möchte er nun das Anwesen unter der Brücke verkaufen. Er findet keinen Käufer. Er wird wahnsinnig und stirbt — wie er’s stets gewünscht hatte — im Hause seiner Vorfahren.
m Nachsommer des Jahres 1875 war’s, als eines Tages in einem steierischen Almwirthshause helle Verwunderung herrschte.
Der alte Fritz, der krumme, bucklige Botengeher, sonst ein gar ernsthafter Mann, hatte die Mär gebracht: „Die Naturforscher sind im Land!“
„Was?“ schrie Alles.
„Sie kommen gar auf die Alm.“
„Wer?“
„Sie rücken schon an.“
„Du heiliger Sanct Sebastiani!“ rief hierauf die hübsche Almwirthin und sog nach altem Brauch aus ihrem Pfeifchen, das zu ihrer heute schier vornehmen Aufgeputztheit freilich nicht recht passen wollte; aber sie hat’s einmal im Mund und wir können nichts machen. Um ihre rothen Lippen ist’s Schade, daß sie geräuchert werden. „Redlich wahr,“ rief sie, „es ist kein Fried’ auf der Welt. Eh’ vor Zeit ist alle fingerlang der Türk’ da. Nachher ist der Franzosenrummel g’wesen. D’rauf rücken gar die Preußen an, und jetzt wären auf einmal die — die — wie hast gesagt, wie heißt der Feind?“
„Du närrische Frau Wirthin, Du!“ rief der alte Botengeher, „das ist ja kein Feind nicht!“
„Was denn? So red’, wenn Du was weißt!“
„Die Naturforscher, das sind lauter hochgelehrte Männer, Wirthin, denk’ Dir g’rad einmal den alten Schulmeister von der Radau. Du weißt, der hat schneeweiße Haar und thut rechtschaffen Tabak schnupfen; hat aber — mußt wissen — seine großen Glasaugen auf und sitzt Tag und Nacht bei seinen alten Büchern und G’schriften, und ist ein gar gelehrter Herr, und ein bissel zaubern —“ der Fritz ließ einen forschenden Blick umherschießen — „’s selb’ kann er auch.“
Die Wirthin saß recht breit auf einem Stuhle da, hielt die Arme über dem Busen gekreuzt, in einer Hand die Pfeife, und that nichts, als den Kopf schütteln.
Der Bote schob das leere Schnapsgläschen vor sich über den Tisch hin: „Geh’, Almwirthin, noch ein paar Tröpfel von Deinem guten Geist.“
„Alle guten Geister lobt unser Schickbot’,“ rief ein Schalk unter den Halterleuten, die beim Ofen saßen.
„Ja Du, und daß ich Dir’s sag’, Frau Wirthin,“ fuhr der Fritz fort, „die Naturforscher, das sind halt auch so weißhaarige Herren, wie der Radauer Schulmeister; haben aber — rath’ ich — noch größere Glasaugen, wie der, weil sie ja noch viel mehr Bücher lesen und viel gelehrter sind und noch viel flinker zaubern können. Ja, Leut’, ’s ist kein Spaß nit, die Naturforscher haben die Welt erfunden!“
Jetzt schlug die Wirthin ihre Hände zusammen, daß es klatschte: „Die Welt haben sie erfunden?! — Na, Du, Fritzl, die Welt, die hat der Gott Vater erschaffen!“
Der Fritzl nippte von dem neu angekommenen „guten Geist“, den der Almwirth selber aus Ingwerwurzeln brannte.[S. 129] „Der Gott Vater!“ murmelte er dann vor sich hin, „kann eh’ sein. — Aber — nachher möcht’ ich schier wetten, daß der Gott Vater selber zu den Naturforschern gehört.“
„Geh’, geh’!“ rief Einer vom Ofen her, „bist leicht auch so Einer, der einen neuen Glauben aufbringen will?“
„Nu, nu,“ besänftigte der Alte, „sag’s halt nach, wie ich’s gehört hab’. Dahinter ist schon was und die Naturforscher sind im Land, das läßt sich nicht leugnen. In der Grazerstadt drin haben sie die alten Herren recht in Ehren gehalten. Den ganzen Schloßberg, hab’ ich gehört, hätten sie vor Freud’ angezunden über und über — so viel hätten sie beleuchtet. Bei allen Fenstern — und es giebt viel Fenster in so einer Stadt — hätten sie die Fahnen herausgereckt und Einer hätt’ gar auf die Dominikanerkirchthurmspitz’ eine Fahn’ gesteckt. — Muß wohl was dahinter sein, Unsereiner kann sich das nicht auslegen.“
So hatte der Fritz erzählt und desweg die helle Verwunderung im Almwirthshaus.
Da war zufällig die Agatl, die junge Schwaigerin (Sennin) von der Schoberalm im Hause gewesen, als der Bote Solches und Mehreres lautbar gemacht hatte. Und Agatl ging jetzt gedankenvoll, wie noch selten, ihrer Hütte zu. — Wenn es richtig war, daß die uralten, hochgelehrten Herren kommen auf die Alm und ’leicht auch in die Schoberhütte, dann mag sie wohl was vorrichten. Butter und Käs werden so Leut’ nicht mögen. Da stellt sie’s schon gescheiter an. Das Stubengesiedel scheuert sie rein ab und den Tisch deckt sie mit einem blühweißen Tuch und stellt eingefrischte Gentianen und Herbstzeitlosen drauf, und etwa noch etliche Heiligenbildchen dazu, daß die ehrwürdigen Herren sehen, die Schwaigerin Agatl weiß, was sich schickt. — Dann[S. 130] hat sie — die Agatl — auch noch extra was mit ihnen zu reden.
So wird’s gedacht. Dann naht der Tag des Ereignisses. —
— Die Gelehrten waren von allen Gauen Deutschlands zusammen gekommen in die freundliche Murstadt, um sich gegenseitig kennen zu lernen, schöne Reden zu halten und auf das Wohl der Wissenschaft und auf die Einigkeit des großen deutschen Vaterlandes steierischen Wein zu trinken. Welch’ ein Aufsehen hatte es daher gemacht, als zu Graz in jenen Tagen, in welchen an den Wohnungen aller Freisinnigen Kränze prangten und Fahnen flatterten, auch an der hohen Thurmspitze der Dominikanerkirche eine schwarzgelbe Fahne wehte — eine Huldigung der freien Wissenschaft. Alle frommen Herzen waren außer sich über diesen unerhörten Frevel der Dominikanermönche; am entsetztesten und rathlosesten aber waren — diese Dominikanermönche selbst. Sie waren unschuldig an der Beflaggung ihrer Kirche, die Fahne war über Nacht auf die Thurmspitze gekommen, und zwar auf ganz unerklärliche Weise. Kein Gerüste und keine sonstige Spur war an dem Thurme zu sehen und die Flagge oben am römischen Kreuze wehte in salbungsvoller Jubelstimmung hoch über der festlichen Stadt. Die geistlichen Herren hielten Rath, wie das arge Zeichen möglichst rasch da oben entfernt werden könne.
„Ein Gerüste bauen,“ meinte ein Sachverständiger, „kostet aber zweihundert Gulden.“
„Diese verfluchten Heiden!“ rief Einer.
„Wer den Fetzen ohne Gerüst hinaufgeschafft hat,“ sagte ein Anderer, „der soll ihn auch ohne Gerüste wieder herabtragen.“
Aber wer hat den „Fetzen“ hinaufgeschafft? Wo ist der Thäter? Die Polizei fahndete nach demselben, entdeckte ihn aber nicht. Endlich am zweiten Tage, nachdem sich Graz an der Dominikanerfahne sattsam belustigt und die Mönche sich daran sattsam geärgert hatten und immer noch rath- und thatlos waren, nachdem aber Viele auch die Muthmaßung ausgesprochen hatten, es sei ja möglich, daß der liberale Orden der Dominikaner es mit der neuen Wissenschaft halte — meldete sich ein alter Militär-Veteran, ein ausgesuchter Turner und Kletterer, und erklärte sich bereit, für ein gutes Entgelt die Fahne vom Thurme herabzuholen. Die Dominikaner begrüßten einen solchen Retter in der Noth mit offenen Armen. Als aber der Veteran lustig an der Außenseite des Thurmes emporkletterte, oben kunstgerecht die Fahne losband und dieselbe mit einem lauten „Hoch“ auf die Naturforscher und auf Oesterreich schwang — da war es offen, kein Anderer als Der konnte die Flagge auf die Thurmspitze gepflanzt haben. Das unten versammelte Volk jauchzte ihm entgegen; doch unter diesen Jauchzenden lauerte auch die Polizei. Konnte aber die Polizei einen alten, braven Haudegen fassen, der auf hoher, wenn auch kirchlicher Zinne Oesterreichs Farben entfaltet und Oesterreich ein Prosit gebracht hatte? Unter den Mönchen aber war Einer, der die Zähne knirschte und die Faust ballte hinan gegen den Thurm. Dies sah der alte Soldat; allsogleich band er die Fahne wieder fest am Kreuze, stieg fröhlich den gefährlichen Weg wieder herab, die Flagge wehte oben wie vor und eh’, und die Menge umjubelte den Kletterer.
Nach vielem gütigen Zureden von Seite der Behörde verstand sich endlich der Veteran, die gute alte Reichsfahne von der Thurmspitze zu entfernen. Er bekam hierauf selbst[S. 132]verständlich seine reglementsmäßige „Straf’“, aber seine Richter blinzelten ihm heimlich zu, und dem wackeren Veteran soll es — weiß die Fama — sein Lebtag nie besser ergangen sein, als in jenen vierzehn Tagen, in welchen er seiner „gesetzwidrigen Handlung“ wegen im Arrest saß.
Diese Fahnengeschichte, hier als kleine Abschweifung erzählt, war das Lustigste bei dem Naturforschertage zu Graz. Im Uebrigen waren die Herren endlich des vielen Fetirens satt; Ausflüge in die schönsten Landschaften der Steiermark wurden veranstaltet und freudigen Herzens zogen die Gelehrten den grünen, lebendigen Bergen zu. Nach Hang der Charaktere, nach Art der Studien theilten sich die Wege. Der eine führt in die sonnigen Auen des Unterlandes zu alten, merkwürdigen Burgen und gastlichen Schlössern, zu den Weingärten und Gesundheitsbrunnen; der andere geht unterirdischen Zielen zu, wo in der Kohle, in den Versteinerungen die Spuren vergangener Jahrtausende ruhen, oder die Schätze des Metalls vergraben liegen. Der dritte Weg endlich leitet empor zu lichten, reinen Höhen, zu interessanten Steinen und Pflanzen, zu den Naturspielen der Luft und des Lichtes, zu den leichtlebigen Thieren und zu der kreuzsauberen Agatl. Mancher ist gar mit der Büchse ausgezogen.
Eine gute Anzahl hatte den Weg auf die Berge gewählt.
Als die Herren gegen die Radau kamen, gesellte sich der Pfarrer des Ortes zu ihnen, lud sie freundlich in seinen Baumgarten zu einem Glase Wein mit Zugehör und bat die Gäste schließlich, wenn sie auf der Alm, wo voraussichtlich viele Landleute versammelt sein würden, etwa irgend welch’ eine Begrüßung oder Rede zu halten gedächten: sage bei derlei Reden gefälligst Worte und Abhandlungen zu vermeiden, welche leichtlich geeignet sein könnten, die guten, ein[S. 133]fachen Leute in ihrem alten Glauben zu verwirren. Er, der Seelsorger, halte diese Bitte für seine Pflicht. Des Weiteren möge Jeder sagen und thun, was ihm beliebe.
Ueber solche Maßregelung huben einige der Herren an zu murren: „Wenn uns das freie Wort verboten ist auf den Bergen, wo doch die Freiheit wohnt, dann lieber verzichten wir auf die Alpenfahrt!“ Und sie kehrten um, eine Stätte suchend, wo sie nach Herzenslust ihre Stimme ertönen lassen und ihren pathetischen Gefühlen Luft machen konnten. Der größere Theil jedoch versprach dem besorgten Seelsorger gern seine kleine Bitte zu berücksichtigen, maßen ja im Uebrigen ihr Wirkungskreis auf den Höhen des steierischen Arkadiens ein ganz unbeschränkter war.
Sie kamen zum Almwirthshause, wo der alte Fritz schmunzelnd im Winkel saß und sich an der Verwirrung der Wirthin ergötzte, die etliche Gläser in Scherben schlug, bevor es ihr gelang, die begehrten Erfrischungen auf den Tisch zu schaffen. Sie kamen zu den Halterhütten, wo in allen Gelassen neugieriges Bauernvolk lauerte, welches, die Gefahrlosigkeit der Situation einsehend, allmählich hervorschlich. Und sie kamen auch zur kleinen Behausung der Schwaigerin Agatl.
Agatl wurde, als sie die lustige Gesellschaft nahen sah, irre an der Welt und an sich selber. — Alte, weißköpfige, ehrwürdige Herren, auf Stäbe mühsam gestützt und jeder ein großmächtiges Buch unter dem Arm — so hatte sie es erwartet. Und jetzt zog singend und polternd ein Haufe junger, hübscher, schwarz- und blondbärtiger Männer voll Heiterkeit und Possen in ihre Hütte ein. Nur, daß sie noch rechtzeitig die Heiligenbilder unter die Bettdecke verbergen konnte — da stürmten sie auch schon in aller Lustigkeit in die Kammer. Die Herren nahmen sie keck an der Hand und[S. 134] streichelten ihr die erröthenden Wangen; dann wollten sie Milch und Butter haben für’s Erste; und trieben es lauter und unbändiger, als die Bauernburschen, wenn sie heraufkamen an den Sonntagen.
Und das — meinte die Agatl bei sich — sollten die Herren sein, die dem lieben Gott Vater die Welt hätten erschaffen helfen? Das sollten die großen Gelehrten sein, die — wie der Fritz erzählt hat — den Dampfwagen ausstudirt hätten, und den Telegraph, und das Zacherlpulver, und den Blitzableiter, und die Sonnenfinsternisse, und die Erdbeben, und das Photographiren (wie die Agatl ein Bildniß vom Hansel hat), und die Medicinen, die Salben für Gift und Gall’, und die künstlichen Kopfhaar’ — ’s ist ganz verwunderlich, was man schon hört in der Welt und was die neue Mod’ Alles aufbringt. Und von so leichtfertigen Leuten soll das Alles kommen? — Aber sauber sind sie und fein, ’s selb’ muß man ihnen lassen. Der dort mit dem falben Schnurrbart schon gar — ist hell noch blutjung. Der kann aber das Handdrücken, wie sie’s ihr Lebtag noch nicht so kräftig verspürt hat. Die Milchschüssel ist, gottsdank, so auf den Tisch gestellt, daß er, der Blutjunge, den Rahm mag „derlangen“. So simulirte die Agatl. —
Herr Doctor Willibald war er benamset, derselbige, welcher bei seiner Ankunft der jungen lebfrischen Schwaigerin so wacker die Hand gedrückt hatte. — Ein leiser Gegendruck, den er aber doch erklecklich wahrgenommen hatte, sagte ihm, daß er hier ein günstiges Object für seine Forschungen gefunden haben dürfte. Doctor Willibald war nämlich nicht blos Naturforscher, sondern insgeheim auch ein bißchen Philosoph und Aesthetiker und erforschte in des Menschengeschlechtes schönerer Hälfte gern die Herzen und Nieren.
Die meisten der Herren Naturforscher hatten sich draußen gelagert, „wo klingen alle Auen“. Dort erfreuten sie sich eines gesegneten Mahles mit Naturbraten und Naturwein, erfreuten sich der Naturschönheit und zwanglosen Natürlichkeit. Allmählich zogen sich die Landleute herbei, wurden zutraulich, zeigten den gelehrten Herren „Donnerkeile“, die in der Erde gefunden worden, „Irrwurzeln“, die im Walde wüchsen und Jeden, der „unbesinnt“ darauf trete, von dem rechten Weg ab und in die Irre führten; zeigten Walpurgisblümlein und Marienkraut, mit denen man „wetter- und butterhexen“ kann, zeigten „Hexeneier“, wie sie auf Moorheiden zu finden, und mehr solch’ merkwürdige Dinge, mit denen sie den gelehrten Herren etwas Neues vorlegen wollten, das gewißlich bisher noch nicht erforscht worden wäre. Aber die Herren waren mit Allem schon bekannt. Den Donnerkeil nannten sie Bergkrystall, das Hexenei war ihnen ein Pilz. Ueber die Irrwurzeln lachten sie und sagten: „Ihr lieben Leute steigt Euer ganzes Leben auf Irrwurzeln herum.“ Der Herr Doctor Willibald hingegen behauptete kurz und entschieden: es gebe gar keine Irrwurzel; das, was der Aberglaube so nenne, sei blos die Wurzel des Weiderich. — Uebrigens kümmert sich der junge Mann weder um den Weiderich, noch um seine Genossen, noch um die paar Jägersleute, die ein todtes Reh vorbeischleppten, welches sie einem Wildschützen abgejagt hatten. Während die Anderen draußen lustig essen und trinken, sitzt er am Herde bei der Schwaigerin und schwätzt.
„Agatl,“ sagte er, konnte aber den Namen nicht mundgerecht aussprechen, weil er von den Gegenden der Mitternacht kam, in welchen die Zunge schon ein wenig anders gewachsen ist, als in dem sangreichen Himmelsstriche der Alpen, „Agatl, Sie sind ein prächtiges Mädchen!“
„Eh’, Du Tollpatsch!“ rief die junge Schwaigerin aus, „wird der Herr noch eine Weil’ Sie zu mir sagen! Bin ja kein Stadtfräulein nicht.“
Hierauf sind sie Du und Du zusammen geworden.
Als das Agatl mit seinem Korbe hinab in die Matten ging, um den Kühen grünes Futter für den Abend zu holen, begleitete sie der junge Doctor und sah ihr zu, wie sie all’ die schönen Pflanzen und Blumen, die der Botaniker so sorgsam hegt, so genau studirt, so haarklein beschreibt in den Büchern; die der Dichter so rührend besingt und die das Rind so gern frißt — mit der Sense niedermähte. Noch versuchte der junge Gelehrte dem Mädchen einige Blumen zu erklären; sie ließ ihm aber nichts gelten, sie hatte ihre eigene Naturgeschichte.
„Ja,“ sagte sie, „jetzt, das sind die Liebfrauenschühlein, die ziehen die verstorbenen Jungfrauen an, wenn sie in’s Himmelreich eingehen. Und das ist der Herzensschlüssel, den man den hübschen Buben auf den Hut stecken muß, dann schauen sie um, auf dem Kirchweg, wenn Eins hinten drein geht. Und das ist die brennende Lieb’, die alle sieben Jahr’ nur einmal treibt. Und das — kennst Du das auch nicht? — das ist die blühende Untreu.“
„Das trifft man auch unten an,“ bemerkte der Naturforscher.
„Ja,“ sagte sie, „das wächst überall.“
„Bei Dir kann man ja allerhand lernen,“ versetzte der Gelehrte.
„Oh, wegen deswegen,“ antwortete das Mädchen, „ich weiß schon noch mehr; aber mir fällt’s jetzt nicht ein.“
Die Herren dort drüben auf der Au richteten sich an zum Abzuge. Die Agatl merkte es und sagte leise und vertrauensvoll zum jungen Doctor: „Wollt’ gern, Du bliebst bei mir bis zum Abend!“
Groß und innig war das Auge, mit dem sie ihn jetzt anblickte, und ein Hauch der Schwermuth lag in dem Worte: „Ich wollt’, Du bliebst bei mir!“
„Du herziges Kind!“ lispelte Willibald, „meine Kameraden mögen ziehen, wohin sie wollen, ich bleibe bei Dir!“ Er drückte ihr wieder die Hand — die rechte und die linke, und preßte sie und walkte sie eine Weile in der seinen. Sie sah ihm dankend in das Angesicht.
Die übrigen Herren hatten mit ihren funkelnden Instrumenten noch allerlei Beobachtungen angestellt; sie hatten das Wasser der Quelle geprüft — es roch aber nach gar nichts. Sie hatten herumgehämmert an den Steinen und nichts gefunden, als daß sie Funken gaben, wenn man in sie dreinhieb. Und endlich hatten sich die Forscher zwischen den Zerben und Schwaighütten hin verloren.
Herr Doctor Willibald blieb zurück. Er sah in stiller Glückseligkeit dem flinken, heiteren und blühenden Mädchen bei dessen Arbeiten zu. Sein Auge ergötzte sich an ihrem glatten, schlanken Halse, an welchem auch nicht die mindeste Spur von einem Kropfe war, wie solche doch der Naturbeschreibung nach in Steiermark gut gedeihen sollten. Er ergötzte sich an ihren Flachshaaren und trillerte sogar das Liedchen, er wolle wegen „dem Dirndl sein Flachshaarl ein Spinnradl werden“. Er ergötzte sich an ihrem rothen Lippenpaar, zwischen welches sie ein Steinnelkchen gelegt hatte. Er ergötzte sich an ihren runden Armen, über welche die weißen Aermel zurückgeschlagen waren bis über das Grübchen des Ellbogens hinein. Er ergötzte sich an der jugendlichen milden Hebung des Busens, an der ganzen anmuthsreichen, geschmeidigen Gestalt. Mit einem Wort, er ergötzte sich an der Almerin.
Als es draußen endlich zu dunkeln begann und der Gelehrte noch immer in seine Naturstudien versunken war, kam der Hirte mit den Kühen von der Weide und leitete sie in die Ställe; kam auch ein junger Bursche mit einer Gemse auf dem Rücken den Berg heran und fragte unsern Willibald, ob er in der Hütte übernachten wolle. Dieser brummte ein unverständliches Wort; der Bursche schritt fürbaß und begab sich rückwärts in den Stallboden. Agatl stand an dem flackernden Herdfeuer und ihre Wangen waren doppelt roth und ihre Augen leuchteten doppelt — sie war doppelt schön.
Schier ein bißchen schämig hatte sie ihren Gast aus den fernen Mitternachtsgegenden gefragt, was sie ihm aus ihrer kleinen Vorrathskammer für den Abend vorsetzen dürfe. „Agatl,“ hatte der Herr geantwortet, „ich esse mit Dir aus Einer Schüssel.“
Darauf war der Abend immer dunkler und die Schwaigerin immer verlegener geworden. Sie hatte ein vielgroßes Anliegen. — Aber es ist halt schwer, mit so einem weltfremden Herrn. — Freilich ein großer Gelehrter! Wissen thät’ er sicher was gegen die böse Sach’....
Endlich schlich sie vom Herde gegen den Tisch, fuhr über denselben mit der Schürze und es lag doch kein Staub darauf. Dann ging sie zum Fenster und sah hinaus; ’s war all’ stockfinster. Dann ging sie zur Wanduhr und wollte dieselbe aufziehen, war aber ohnehin das Gewicht ganz oben, weil sie es erst vor zehn Minuten aufgerollt hatte. Endlich ging sie zum Butterkübel und blieb davor eine Weile stehen und lugte verstohlen gegen Willibad hin. Und schießlich that sie ein paar Schritte zu demselben und flüsterte: „Jetzt, Herr, wenn ich rechtschaffen bitten dürft’, daß Er ein bissel mit mir ginge — lang’ thäten wir uns nicht aufhalten.“
Der junge Mann ging mit ihr — leisen Schrittes und im Herzen Erwartung. Sie führte ihn in den Stall. Sie leitete ihn an der Hand zwischen den Streuschichten und Futterhaufen hin. Und als sie im Finstern waren, hauchte das Mädchen dem Fremden zu, er möge doch recht Acht geben, daß er nicht falle. Hierbei zündete sie die Laterne an und sie standen vor den Kühen.
„Die da,“ sagte nun die Agatl mit einem schweren Athem, und deutete auf ein braunes Rind mit großem Euter, „die da wär’s halt. Was hab’ ich sie nicht mit Weihwasser angesprengt über und über! Jeden Tag drei Palmkatzel geb’ ich ihr auf den nüchternen Magen, ’s schlägt nicht an und ’s will nicht schlaunen. Dreidoppelt muß es verhext sein, das arme Vieh, ich kann’s anders nicht glauben. Seit Bartelmei her giebt sie schon die blutrothe Milch. Jetzt, was ist zu machen?“
Der Doctor war verstimmt, er schüttelte das Haupt. Da setzte sich die Schwaigerin auf den einfüßigen Stuhl und molk das braune Rind. Und in der That, die Milch war ganz röthlich.
Kurz sprach der Naturforscher seine Meinung aus, der Zustand hätte nicht viel zu bedeuten; es gebe ein Kraut, das, von den Kühen genossen, die rothe Farbe in die Milch bringe. Auch könne eine kleine Ueberfütterung daran schuld sein. Er nehme sich für die Auskunft ein Küßchen. Sie wendete nichts dagegen ein; als sich Willibald aber anschickte, sein Honorar zu holen, da rief die Agatl hell: „Hansel!“
Sogleich guckte ein Blondkopf durch eine Wandlücke von der Scheune heraus. Es war der Bursche, den Willibald Tags zuvor als Jäger mit der Gemse gesehen hatte. Jetzt sagte der Hansel: „Soll ich Dir was, Agatl?“
„Daß ich Dir’s sag’, morgen kommen die Küh’ auf die Oberweid’,“ rief das Mädchen.
„Das weiß ich ja eh’,“ brummte der Bursche, und zog sich wieder zurück.
Einen Augenblick war’s still und der Erzähler vermuthet, es habe sich im ganzen Stalle nachgerade gar nichts geregt. Doch nahmen die Dinge allmählich eine solche Gestalt an, daß die Agatl abermals mit scharfer Stimme den Namen „Hansel“ rief.
Als der Hansel da war, sagte mißmuthig der Herr Doctor Willibald: „Ja, wie bemerkt, von einer Zersetzung durch die Hitze wird sie kommen, die rothe Milch. Adieu!“
Und er ging nachdenklich davon. Unterwegs nach Radau hinab murmelte er mehrmals zu sich selber: „Ich habe heute behauptet, daß es keine Irrwurzeln gebe, und bin an diesem Tage selbst auf eine solche getreten.“
Die Agatl und der Hansel aber blieben oben.
er Junge, der Samuel, trieb’s, — er trieb die Ziegen auf die Weide und hütete sie.
Er suchte sich Himbeeren auf und Brombeeren, und aß, und war er satt, so pflückte er sie in einen Korb, und war der Korb voll, so aß er wieder, und war er das anderemal satt, so legte er sich in den Schatten und schlief. Schlief und träumte von Roß und Reiter, oder von der Marianka, oder von seinem Vater mit den Silberlingen.
Diese Silberlinge!
Diese sollen noch von dem dreißigjährigen Krieg hergerührt haben — vielleicht eines braven oder schlimmen Söldners Sold; den Besitzer wechselt das Geld, aber es ist ihm niemals anzusehen, in wessen Händen es gewesen ist; und so weiß man auch von der Geschichte der Silberlinge nichts Rechtes. So viel steht fest: aus jener kriegerischen Zeit stammend, waren sie gewohnt, vergraben zu sein. Und so hielt sie der Sammel — der alte — denn begraben, nicht in einem ehernen Sarge, sondern in einer eisernen Wiege, denn nicht todt waren sie, sondern im Schlafe lagen sie und einer glorreichen Urständ schlummerten sie entgegen. Doch sollten sie — wie Kaiser Rothbart — so lange als möglich schlummern und nur zur Zeit der größten Noth geweckt[S. 142] werden. Das war der für den alten Graben-Sammel alleinseligmachende Glaube und diese Religion lehrte er auch seinem Sohn.
Und als der Alte starb, sagte er zum Jungen: „Mich — thust am besten — grabst ein, aber den Schatz — wenn Du einmal auf ihn anstehst — grabst aus. Er liegt oben unter der Söllertann’ vom Stamm gegen Sonnenaufgang fünf Schuh tief vergraben. Thu’ ihn grüßen!“
Der junge Sammel that’s, legte den Vater in die Kühle und sah sich nach dem Schatz um. Es war in der Richtigkeit, in einem eisernen Topf wohl verwahrt, verdeckt mit Stein, verklebt mit Harz, ruhten friedlich neben einander und über einander die lieben Silberlinge, die Bildnisse jener Fürsten und Feldherren, die voreinst so mörderisch gegen einander Krieg geführt hatten. Der junge Erbe dachte nicht sowohl daran, wer sie waren, sondern weit mehr daran, wie viele ihrer sein mochten im Topfe. Er zählte die Silberhäupter, so ehrwürdig alt, und wieder so jugendlich glatt und klingend. Es war eine große Heerschaar; der junge Sammel hätte damit ohne Blutvergießen einen siegreichen Feldzug halten können. Aber er beschloß, den schweren Eisentopf wieder in die fünf Schuh tiefe Rast zu legen, und nach des Vaters Wort die Recken erst zu rufen zur Zeit der Noth.
Er konnte demnach fröhlich die Ziegen weiden und sorglos unter dem Schatten ruhen — zuweilen sogar bei den Seinen in der Nähe der Söllertanne.
Unter ihr selbst aber nie — schon um keinen Verdacht zu erregen. Die Tanne stand nicht auf seinem, sondern auf des Söllerbauers Grund. Der Graben-Sammel hatte keine Scholle zu eigen. Doch war der Schatz unter der Tanne gut geschirmt, selbst wenn der Baum zusammenbrechen sollte,[S. 143] selbst wenn — kurz in allen Fällen. Der Boden war steinig und unfruchtbar und nur von wilden Büschen bewachsen; da konnte es Niemandem einfallen, zu pflanzen, zu ackern — und selbst in diesem Falle lag die eiserne Wiege so tief, daß sie nicht entdeckt werden konnte.
Es hätte sich Alles fein geschlichtet — wäre nur die Marianka nicht gewesen.
In den ersten Jahren ging’s ja noch. Da gesellte sich der Sammel — wollte er sich überhaupt gesellen — gern zum Förster, der oft durch den Wald kam und Verschiedenerlei zu erzählen wußte von Hirschen, Rehen und Raubvögeln. Je größer der Sammel wurde, desto reizender beschrieb der Förster das Pürschen und desto nachdrücklicher warnte er den Jungen vor dem Wildern. Das verdroß den Sammel, und er ging dem Jäger nicht mehr zu, er lag im Waldschatten und dachte an die Marianka.
„Was lobt er mir denn die Jägerei, wenn sie mir verboten ist! Bei der Marianka hat er nichts zu loben und nichts zu verbieten. Die Marianka, das ist mein Revier.“
Die Marianka war die Tochter des rothen Fok, eines Einwanderers aus dem Böhmerlande, der seit etlichen Jahren beim Söllerbauer wohnte, das Teichgraben, Pechsammeln und Branntweinbrennen betrieb, rothe Haare, einen rothen Bart, ein rothes Gesicht, einen rothen Namen und eben auch die blühende Tochter Marianka hatte.
Die Marianka war beim Söllerbauer als Schafhalterin, und kam schon die Zeit heran, wo die Hirtin weniger sicher ging vor den Burschen, als die Schafe vor den Wölfen.
’s war kein Wunder — bei meiner Treue! Wenn sie stand auf dem Hügel und Schelmenliedchen sang, oder wenn sie saß, gelehnt an einen Stein und sann und im Sinnen[S. 144] einschlummern wollte, da war sie werth, daß man sie lieb hatte, da war sie werth, daß man sie herzte, und da war sie im Stande, daß sie Einem eine kecke Ohrfeige gab.
Das war’s ja! Wem’s passirt ist, der denkt nicht gern daran, wem’s nicht passirt ist, wie etwa dem Sammel, der denkt an’s Mädchen im Walde, an sein Weilen bei ihr — aber spricht nicht gern davon.
Der Sammel und die Marianka — nun, Ihr mögt Euch’s ja denken. Am liebsten hätte der Grabenbursch auch diesen Schatz vergraben — so eifersüchtig war er. Ihr erging es nicht besser, und wären wir jetzt mitten in der Liebesgeschichte.
Da sagte der rothe Fok eines Tages zum Graben-Sammel: „Na, junger Kerl, willst sie nehmen, die Marianka?“
„Was giebst d’rauf?“ fragte der Bursche.
„Was ich d’rauf geb’? So groß ist Deine Lieb’?“ begehrte der Fok auf. „Was ich d’rauf geb’? Nicht einen Knopf. Erstens hab’ ich nichts, und hätt’ ich was, so thät’ ich’s zweitens selber brauchen. Mein Alles ist die Marianka, und was sie kostet, das muß sie werth sein.“
Schlich der Sammel davon. Aber nach etlichen Tagen erhielt der Fok durch den Schulbuben des Söllerbauers folgenden Brief:
„Lieber Fok!
Ich liebe die Marianka von Herzen und mit Schmerzen, und sie heiraten ist mein ernstlicher Willen, aber umsonst thue ich’s nicht. Ein Weib, das Geld hat, bleibt lang’ schön, hat mein Vater gesagt. Ich weiß Keine, aber ich such’ Eine mit Geld; denn ich habe auch nichts. So lang’, bis ich eine Rechte finde, werde ich die Marianka noch lieb haben. Dein aufrichtiger
Sammel.“
So ein Brief da!
Aber der Fok war nicht einmal sehr überrascht. Er gewann Achtung vor dem Burschen. Was der Sammel wollte — war es nicht ganz ehrenwerth? Die reichsten Leute thun’s, Vernunftheirat nennen sie’s. — Die Armen haben um so mehr Grund dazu. Eine mit Geld!
Anders ging’s dem Liebhaber. Der war dem Schulbuben eine lange Strecke nachgelaufen, um ihm den Brief wieder abzunehmen. Der Knabe aber meinte, der Sammel wolle den Botenlohn wieder zurück haben; er lief daher, was er konnte, um sich und den Botengroschen in Sicherheit und das Schreiben an den rechten Mann zu bringen. Der Grabenbursche war nun in Verzweiflung; denn plötzlich war ihm jetzt das — was man Herz nennt — rebellisch geworden und rief: Jetzt hast Alles verdorben. Ist mir die Marianka hin, so lauf’ ich Dir auch davon, häng’ Du an meinerstatt den Geldbeutel in die Brust!
Den Geldbeutel? Die Silberlinge?
In einer Mondnacht ging der Sammel hinauf zur Söllertanne, grub den Topf aus, zählte die Münzen, ob er’s denn wagen dürfe, mit ihnen den kostspieligen Ehestand anzutreten. Jammerschade wär’s wohl um dieses schöne Geld! — Er grub es noch tiefer ein und murmelte: „Wird’s wie der Will’, ihr bleibt da drin liegen. — Ich hab’ zwei Hände, sie hat zwei Hände, sind deren vier, der Mägen dieweilen nur zwei. Mit Gotteshilf’ dürft’s gehen auch ohne Topf.“ —
Freilich hat er nicht bedacht, daß Tannenbäume Ohren haben können, insonderheit wenn Pechschaber sitzen im Geäste. Pechschaber, die in der Nacht schaben, weil es ihnen beim Tag nicht immer erlaubt ist.
Zur selbigen Zeit — er wurde gesehen — ging der Fok einmal wie gewöhnlich mit seinem Pechsack aus — und hatte auch eine großmächtige Kraue bei sich.
Und der Sammel ließ es nun ein Weilchen anstehen, spähte aber an Sonntagen nach den Mädchen der Gegend aus. Die Wohlhabenden waren meist schon versprochen, weil die Mehrzahl der Burschen so liebt, wie der Sammel. Die Reichen waren hochmüthig, weil die Mehrzahl der Mädchen so denkt, als wie die Burschen: Lieb’ ohne Geld ist kein Schick auf der Welt. — Zudringlich und fügsam waren nur die Armen, die Häßlichen und die Alten. Die Marianka — die arme — wurde ganz blaß und tiefäugig vor Kränkung, und alle Gedankensünden, die sie am Osterfeste zu beichten hatte, betrafen den Grabenburschen.
Oft und oft ging sie hinaus in den finsteren Wald und hatte fromme Vorsätze und bekränzte das alte Muttergottesbild, welches an einer Eiche hing, auf die gute Meinung, daß ihr der liebe, verteufelte Sammel nicht sollte verloren gehen.
Der Sammel hütete stets seinen Schatz unter der Tanne. Nun eben ja, warum nicht?
Da sah er eines Tages im Frühling, wie der Söllerbauer auf seinen Feldern die ausgeackerten Steine sammeln und dieselben unter der Söllertanne zusammenführen ließ. — Da haben sie gut liegen, wenn sonst auch nichts will wachsen.
Bald war über den vergrabenen Silberlingen des Sammel ein breiter, hoher Steinhaufen geschichtet. Im ersten Augenblick entsetzte sich der junge Mann darüber, im zweiten dachte er: Was denn? Um so besser geschützt ist das Geld; und mir soll das ein Zeichen sein, daß ich einer Heirat wegen die schönen, alten Silbernen nicht heben werde.
Er litt Liebesnoth, schien aber an das Freien nicht mehr zu denken.
Da kam eines Tages der Fok zu ihm: „Na, Bärenhäuter, hast denn keine Schneid’ mehr? Willst die Marianka?“
„Zahlst die Hochzeit? Zahlst die Kinderschuh’?“
„Die Hochzeit, bei meiner Seel’, die zahl’ ich. Und die Kinder verliebter Leut’ gehen barfuß. Aberst — daß ich Dir’s schon sag’ — zubind’ ich ihn nicht, den Geldbeutel, vor meiner Tochter! Ist auch nicht viel d’rin, etlich’ Gulden des Jahr’s — so lang mir der Herrgott die Gesundheit schenkt — etlich’ Gulden fallen schon aus. Ein Hunderter zum Anfangen — was meinst?“
Ein Hunderter zum Anfangen, da kann man schon was meinen!
„Ist eine Red’, Fok,“ sagte der Sammel, „ich pack’ sie zusamm’!“
„Eine Red’!“
Ein Wort — ein Mann. Das Wort war für den Fok, der Mann für die Marianka.
Bald darauf wurde das Kirchenthor bekränzt. Das waren die Kränze, welche das Muttergottesbild im Walde der Marianka zurückerstattete — die Hochzeitskränze.
Am Tage nach der Hochzeit legte der Fok einen nagelneuen Hunderter auf den kleinen Tisch im Grabenhäuschen, dabei drückte er das eine Auge zu, so daß die Marianka sagte: „’s wird nicht der letzte sein, Sammel, so oft er ein Auge zuthut, ist allemal was dahinter.“
Da hat der Mann das Weib in Freuden umfangen. Mitunter ist die Liebe ein Feuer, das mit Geld genährt werden muß. Gar manche wärmende Herthaflamme in Stadt und Land würde ohne solche Nahrung verlöschen.
Um dieselbe Zeit war’s, daß sich der Fok das unfruchtbare Stück Boden an der Söllertanne erwarb, sich hart am Steinhaufen eine Hütte aufrichtete und eine kleine Branntweinbrennerei anlegte. Auf den nahen Wildflächen wuchsen so viele Vogel-, Heidel- und andere Beeren und allerlei wilde Baumfrüchte, aus denen der gescheite Fok mit seiner Retorte den guten Geist hervorzubeschwören verstand, der in ihnen stak.
Der Schwiegersohn wußte wieder nicht, sollte er sich ärgern oder freuen darüber, daß der Alte seinen Silberschatz gewissermaßen in Belagerungszustand versetzt hatte, doch kam der Sammel auch hierin wieder folgendermaßen in’s Reine: Der Schatz ist sicher unter dem Steinhaufen, aber er ist noch sicherer, wenn neben dem Steinhaufen wer wohnt. Nur zu wissen braucht er nichts davon, mein lieber Schwiegervater, der Branntweinbrenner. — Der Sammel fürchtete nur Eins: es könnte der Fok auf dem Steinhaufen einmal ein blaues Flämmlein sehen, oder ein geisterhaftes Winseln hören, wie derlei an Stellen, wo Geld vergraben liegt, gern vorkommt. Er fragte daher den Branntweinbrenner einmal: „Glaubt der Vater Fok an Geister?“
„Freilich,“ antwortete Jener, „ich leb’ ja davon, und — nimmt man’s recht, Du auch.“
„Und was denkt Er über der Leut’ Reden von vergrabenen Schätzen?“
„Narr!“ rief der rothe Fok, „wer wird denn seinen Schatz vergraben! Vor Zeiten hat man’s gethan; heutzutag braucht Jeder den seinen im Haus.“
Der Sammel war beruhigt. — Der Alte weiß nichts von seinen Silbernen in der Erde. — Er, der Sammel, kam zwar auch nicht zu ihnen, denn der Fok ist fast immer zu[S. 149] Weg und der Steinhaufen läßt sich heimlich nicht so leicht abtragen. — So mag das Geld in Gottesnamen ruhen bis auf spätere Zeiten. Der Graben-Sammel braucht’s jetzt ja nicht; er verdient sich, sie verdient sich und jedes Jahr kriegen sie ein Sümmchen vom Schwiegervater.
’s ist eine prächtige Ehe. Ein paar Kindlein rücken an, sie brauchen nicht barfuß zu gehen. So lieb ist’s, wenn sie mit ihrer Mutter auf’s Feld trappeln, und sie weist ihnen die Frucht, die aus der Erde herauf steigt, wo sie vor Monaten begraben worden war. Das Vöglein pickt noch Korn auf. Die Marianka ahnt nichts von einem zu tief vergrabenen Korn, das ein schlauer Vogel ausgehoben und auf fruchtbares Erdreich gebracht hat. Des Sonntags, wenn das Ehepaar in die Kirche geht, sieht es ganz stattlich aus und der Pfarrer stellt es als Muster allen Eheleuten auf. Zu einem guten Theil war es wohl der jährliche Geldbetrag, der das Glück in’s Grabenhäuschen brachte, indem er davon die Noth und den Kummer verbannt hielt. Die Leutchen arbeiteten und sparten, sowie es der Sammel gewohnt war und die Marianka gelernt hatte, und wäre das insoweit eine ganz moralische Erzählung.
Im neunten Jahre ihrer Ehe sagte der Sammel einmal zu seinem Weibe: „Was ich ein Narr war, daß ich Dich ohne Geld nicht hab’ nehmen wollen! Du bist ein treues Weib, ein arbeitsames, ein häusliches Weib, eine rechtschaffene Mutter. Du bist mein Schatz und einmal will ich Dir noch eine rechte Freude machen. Marianka, ich habe ein Geheimniß — noch von meiner Junggesellenschaft her.“
Die Marianka erschrak. Aus seiner Junggesellenschaft? Das kann was Sauberes sein. —
Der Fok war betagt geworden. Stundenlang saß er auf dem Steinhaufen und sein rothes Haar wurde fahl, und seine Wangen waren noch roth, wenn die Enkelkinder spielten am Steinhaufen zu seinen Füßen.
„Ihr Kinder,“ sagte er einmal, „was wird’s sein, wenn Euer Aehndl (Großvater) nicht mehr dasitzt auf der Wacht, wenn Euer Vater die Steine auseinanderwirft?“
Einige Tage nachher war er gestorben, war todt gefunden worden draußen im Walde und auf der Bahre heimgetragen und begraben.
Gestorben, begraben — und von dieser Zeit an blieb das Jahrgeld aus. Der Fok hatte nichts hinterlassen, als die Bretterhütte, die armselige Schnapsbrennerstätte und ein paar alte Plutzer.
Da dachte der Sammel: Wie gut es ist, wenn man sein Erspartes hat! Jetzt will ich meinem braven Weibe die Freude machen.
Und eines Abends nahm er den Spaten und den Korb und sagte zu ihr: „Also jetzt geh’ ich!“
„Wo willst denn heut noch hin?“
Da war er schon davon. In der Vollmondnacht ging er zur Söllertann’, warf den Steinhaufen auseinander, grub die Erde auf — sie lag nicht allzufest, doch gab’s ein schweres Stück Arbeit. Schon klang der Finkenschlag aus der Tanne und der Sammel war noch immer nicht beim Topf. Er verdoppelte seine Hast, bohrte tiefer und tiefer — und wenn er durch die ganze Weltkugel ein Loch graben muß — der Sakermenter wußte, daß sie rund ist — er giebt’s nicht auf, bis er den Schatz gefunden. Endlich, als über dem fernen Waldessaum das Morgenroth glühte, war der Schatz erreicht.
Dieser fand sich gut verwahrt und mit Harz verklebt, aber als ihn der Sammel hob, war er schreckhaft leicht. Mit zitternder Hand riß er den Deckel herab, und siehe — siehe — alles Silber war dahin.
Hingegen aber!
Hingegen lagen im Topfe nagelneue Banknoten — nagelneue, die erst vor wenigen Monaten in Umlauf gekommen waren. — Und als sie der Sammel in wirrer Aufregung zählte und wieder zählte, da gaben sie eine bedeutend höhere Summe, als jene des Silbers gewesen war. Und tief unten auf dem Boden des Topfes lag ein beschriebener Zettel:
„Mußt mir schon verzeihen, Schwiegersohn, daß ich von den Jahreszinsen Deines eigenen Geldes die Aussteuer meiner Tochter bestritten habe. Ich selbst bin arm wie eine Kirchenmaus, und Euch Zwei hätte ich doch gern glücklich gesehen. Ganz sind die Zinsen darauf nicht hingegangen, den Rest lege ich hier in den Topf zum Capital, das durch den Austausch des Silbers um’s Papier selbst eine größere Ziffer bekommen hat. Der Topf ist neun Jahre lang leer gewesen. Ich hätte anstatt der Banknoten auch das Sparkassebüchel hineinlegen können, aber Du weißt etwan gar nicht, was das ist, und hättest es im Zorne können vertilgen. — Schwiegersohn, treib’s fort, wie ich’s getrieben habe, laß’ das Geld wachsen, es arbeitet für Dich und Deine Kinder, und sei nicht übel auf den alten Fok, der es gut mit Euch gemeint hat.“
„O, du alter, siebendoppelter Fuchs! Hast Du mich aber was zum Narren gehalten!“ brummte der Sammel, und in demselben Athem: „Na, vergelt’ Dir’s Gott, vergelt’ Dir’s Gott!“
Das Loch warf er mit Steinen voll; die Banknoten trug er heim zu seinem Weibe: „Siehst Du, daß ich mein Erspartes hab’!“
„Jeses und Josef, wie so denn?!“
„Verliehen war’s!“
Und hat sie in dem guten Glauben belassen, als wäre ihre Aussteuer die heilige Ersparniß ihres Vaters gewesen.
Wer heute freien mag, ich rathe ihm des Graben-Sammel’s älteste Tochter an, eine Brave, Saubere — Eine mit Geld!
as Jagdrecht ist eine prächtige Sache; aber ich kenne viele Grundbesitzer und Gemeinden, die es nicht ausüben. Es leite die Jagdlustigen von der Berufsarbeit ab — sagen sie — es verführe die Jugend zum Müßiggang, und die kostspielige Passion wäre nicht so bald mehr aus dem Kopf zu bringen; es verlocke zur Uebervortheilung des Nachbars, gar zu Diebstählen, und es koste manchem ungeschickten Schützen seine gesunden Glieder oder die eines Anderen. Und schließlich ginge bei willkürlicher Selbstbenützung der ganze Wildstand zugrunde. Sie verpachten daher das Revier und zahlen mit dem Pachtschilling ihre Steuern.
Die Abelsberger denken nicht so; sie sind viel zu liberal. Die Abelsberger haben in ihren Wäldern gejagt, so lange noch das Pulver nicht hätte knallen sollen; und sie sollten es jetzt unterlassen, da es krachen und ganz ungenirt von allen Wänden wiederhallen darf? Nein. Die Abelsberger üben das Jagdrecht selber aus. Es gibt kein höheres Fest, als wenn sie Jagdtag haben; da setzt’s Hallodria, Räusche, Püffe, Abenteuer, kurz alles Mögliche, nur kein Wildpret. Das Wildpret haben die Wildschützen in Sicherheit gebracht.
Ach, die Wildschützen, die sind eine Landplage für die guten Abelsberger. Der Gemeindevorstand — sie heißen ihn „Burgermeister“ — der Burgermeister also und sein Bursche mögen noch so streng sein — es hilft nichts. Und wollten sie die Wilddiebe alle einsperren, so — — wären in Abelsberg ’leicht die bravsten Leute die längste Zeit auf Viehhandel aus oder auf Kornkauf oder auf Wallfahrten oder auf sonst was; und so — munkelt man — könnte es sich zutragen, daß eines Tages die Kinder keine Schule hätten und daß zum Sonntag der Gottesdienst ausbliebe, weil — der Herr Pfarrer verreist.
’s ist eine böse Sach’, und der Burgermeister, ein Ehrenmann über und über, bricht in ein gräßliches Fluchen aus, wenn eine Gesellschaftsjagd schlecht ausfällt, und der ganze Gemeinderath flucht mit, daß, von den Flüchen mehr erschreckt als von den Schüssen, allenfalls ein allerletztes Häslein noch eilig über die Grenze setzt.
Jagdaufseher war der Gemeindediener, aber der Gemeindediener war nicht mehr sehr gut zu Fuß, denn im rechten Bein hatte er die Gicht, und das linke war ihm vor Jahren in Böhmen abgeschossen worden. — So war’s voreh’; dann ist’s anders geworden.
Es war weise vom Burgermeister, als er eines Tages im Rathe folgendermaßen das Wort ergriff: „Daß ich sag’, nach meinem Versteh’n: Die Jagd, verpachten thun wir’s nit; denn wegen warum? Unsere Buben werden Soldaten, die müssen das Schießen lernen!“ Patriotisch war er immer, der Abelsberger Vorstand; und dann fuhr er fort: „Aber das sag’ ich, nach meinem Versteh’n, einen schärferen Jagdwachter müssen wir haben. Ich rath’, wir lassen einen Militärsmann kommen, einen Ausgedienten; so Einer ist[S. 155] respectabel und kann laufen. Die Gemeindedienerei betreibt er uns auch; so Einer ist pünktlich und kostet nicht viel. Ich sag’, wir machen Ja darüber.“
Sie machten Ja darüber.
Etliche Tage nachher trat der Soldaten-Schorsch das Amt an. Er war ein Veteran, kernfrisch und baumstark und feinschneidig, schleppte einen langen klirrenden Säbel — Gemeindegut — und trug einen wuchtigen Schnurrbart, der keck aufgespitzt war, wenn sich der Mann in guter Laune befand, der aber schauderlich zerzaust sich über die Backen hinaussträubte, wenn der Mann wild war; und wenn er in’s Fluchen gerieth, da standen selbst den Abelsbergern die Haare gegen Himmel. Das war nun der neue Gemeindediener und der „Jagdwachter“.
„Daß Er’s weiß, Schorsch,“ redete ihn der Burgermeister bald nach der Aufnahme an, „wenn Er seine Sach’ in Ordnung hält, so kommen wir gut miteinander ab. Wird sich bei mir nit zu beklagen haben. Einmal hat Er die Kanzlei rein zu halten; unter dem verwichenen Diener ist meine Stube da fortweg ein Schweinstall gewesen. Weiters hat Er die Gemeindeschriften zu vertragen. Um Mitternacht, wenn Sperrstunde ist, muß Er von Wirthshaus zu Wirthshaus gehen. Ist wo ein Raufhandel, so muß Er dabei sein. Die freie Zeit muß Er im Wald umgehen, und das mag Er sich hinter die Ohren schreiben: wenn ein Stück Wildpret fehlt, so wird Er darum hergenommen. Wenn Er einen Wildschützen sieht, einfangen! Und ist’s wer immer, hört Er, Schorsch, ist’s wer immer — einfangen und in den Arrest treiben. Verstanden?“
Der Schorsch legte seine Hand an das Ohr, dann schritt er kerzengerade und mit rasselndem Säbel davon.
Versah sein Amt gut, der neue Gemeindediener. Er reinigte die Kanzlei, daß sie blank wie eine Wachtstube war; er „vertrug“ die Schriften, anfangs freilich einigemale ganz buchstäblich; zur Sperrstunde ging er in die Wirthshäuser, wo ihn sogar mehrmals der Burgermeister einlud, an seinem Tische Platz zu nehmen, und bei jedem „Raufen“ war der Schorsch dabei. Bei solcher Pflichttreue verfehlte der leutselige Vorstand nicht, seinem neuen Diener mitunter einen freien Tag zu gönnen, an welchem sich derselbe nach Wunsch und Wahl gütlich thun konnte.
An einem solchen Tage im Herbste war es auch, daß der Schorsch, nachdem er sich vom Dienste losgemeldet hatte, mit einer gewaltigen Commißpfeife zwischen den Zähnen, gelassen in den Wald hinaus schlenderte. Er ließ sich gehen, und wenn er aus dem großen Tiegel schmauchte, so wichen ihm vor den Häusern auch die Bauern nicht aus. Wenn der Mann sonst aber im Soldatenschritt einher marschirte, die Zähne aufeinanderbiß und mit den finsteren Augen dreinstach, da hatte er gefährliche Steuerbogen in der Tasche.
Heute hatte er den Schnapsplutzer drin, und damit strich er in den schattigen Wald hinaus. — Wenn ich einen Hirsch sehe, dachte er bei sich, so macht mir das Spaß, und sehe ich einen Wilddieb, so bin ich auch heute der Diener meines Herrn.
So stieg er immer weiter durch die Wälder hinan und in die Wildniß hinein. Und als er gegen eine hohe Felswand kam, an welcher wilder Epheu emporrankte, an welcher hoch das knorrige Nest eines Habichts klebte, fand der Schorsch die Wand so romantisch, daß er sich in ihrem Schatten niederließ und seinen Plutzer entkorkte. — Es wäre ein anmuthiges Stündchen geworden, da hörte er plötzlich einen Schuß.
Sofort war der Soldat auf den Beinen. Den Säbel hob er empor, daß er nicht klapperte im Gestein und Gewurzel, und so schlich er der Richtung zu, in welcher der Schuß gefallen war.
Nach einigem Suchen fand er was. Im Waldesdunkel kauerte ein Mann und weidete einen erschossenen Rehbock aus. Und der Mann war der Burgermeister von Abelsberg. — Wie? Ist denn heute Jagdtag? fragte sich der Schorsch. Kreuz-Bomben und Mordsstern, heute ist nicht Jagdtag. Halt, Kerlchen, wir Zwei werden näher bekannt. — Aber es ist ja der Burgermeister! — rief in ihm eine andere Stimme. — Thut nichts, dachte sich der Gemeindediener wieder, wer wildert, ist ein Wilddieb. Was er sonst noch ist, ist mir alleseins. Das Schießen ist jetzt nicht erlaubt; gestern erst hat der Vorstand das neue Verbot ausgeschickt. Und thät er’s redlich, so brauchte er das Gewehr nicht zu zerlegen, das dort stückweis im Busche steckt. Ah, mein Herr, desweg hast Du heute den Wildwächter beurlaubt! Nun, wollen anfangen. — Wenn’s aber der Burgermeister selber ist! warnte noch einmal die andere Stimme. — Halt! flüsterte der Schorsch, und stemmte seinen Zeigefinger mitten auf die Stirne hin. Hat er mir nicht selber eingeschärft, der Ertappte sei wer immer: einfangen! — Des höllischen Satans will ich sein, wenn das nicht eine Falle für mich ist. Er hat mich abgespäht und will versuchen, ob ich ein treuer, unbestechlicher Bursche bin. Nicht aufsitzen, Schorschl! Fein angespielt! Nur nicht aufsitzen!
Etliche Secunden später schlug der Gemeindediener dem eifrig fleischernden Vorsteher keck die flache Hand auf die Achsel: „He da!“
Fast kollerte der Wilderer vor Schreck über und über.
„Aufstehen!“ commandirte der Soldat, „wir gehen mitsammen.“
„Aber, Schorsch, aber Schorschl!“ stotterte der Ertappte, „es ist ja — es war ja —“
„Rehbock über die Achsel! Flink!“ rief der Diener mit schneidiger Stimme.
„Na, so thu’ Er — hi, hi — — thu’ Er doch die Augen auf, Schorschl!“
„Ich mach’ keinen Unterschied.“
„Aber — Er sieht’s ja, hi hi, ein Spaß, ein kleiner Spaß —“
„Im Namen des Gesetzes arretirt!“
„Aber, so mach’ Er keine Dummheiten, Schorsch!“
„Marsch!“
„Hör’ Er! Das verbitte ich mir!“
„Ich brauche Gewalt!“ knirschte der Wildwächter und griff an den Säbel. Aus seinen Augen funkelte der Zorn, unter seinem zerfetzten Schnurrbart wirbelten die haarsträubendsten Flüche hervor.
Im Cabinet, in der Kanzlei ist der Gescheitere Herr; im Walde ist’s der Stärkere. Höhergestellte, einflußreiche Personen lassen sich bisweilen erbitten, aber ein so alter Soldatenkerl ist nicht zu bestechen. Die Feder sträubt sich, es zu schreiben, daß der Herr Burgermeister von Abelsberg als eingefangener Wilddieb mit dem Gemeindediener Schorsch gehen und den Rehbock selbst auf dem Rücken mitschleppen mußte.
Der Vorstand machte mehrmals unterwegs die unglaublichsten Versuche, sich aus dem Arg zu ziehen. Mit dem Ausreißen und Fliehen war’s ein- für allemal nichts, denn der schwere Bock war ihm so fest auf den Buckel geschnallt, daß[S. 159] der solcher Strapazen ungewohnte Mann froh sein mußte, wenn ihn das heillose Thier nicht zu Boden ritt. Mit Drohungen richtete er nichts aus; dabei blieb der Schorsch ganz gleichmüthig; ist’s eine Falle für mich, dachte er, so darf ich nicht eingehen, und ist der Herr Vorstand ein wahrhaftiger Dieb, so muß ich ihn stellen. Da versuchte es der Arretirte mit Versprechungen; hundert Stück feine Cigarren für’s Erste; eine goldene Sackuhr für’s Zweite; und endlich, da sie dem schönen Abelsberg immer näher kamen, seine älteste Tochter für’s Dritte. Die Folge davon war, daß der Soldat in Wuth ausbrach und mit geballter Faust dem Rehbock einen solch’ derben Schlag versetzte, daß der Burgermeister darunter taumelte.
Und als sie endlich zur Linde kamen, wo die ersten Häuser von Abelsberg anheben, blieb der Vorstand stehen, klopfte mit steifem Arm dem Gemeindediener auf die Achsel und lächelte: „Brav, Schorschl! Er hat die Prüfung glänzend bestanden, Er ist ein wackerer Mann; Er ist bei uns sein Lebtag lang versorgt.“
„Wohl,“ schmunzelte der Soldat, „’s hat aber auch Müh’ gekostet, und deswegen möchte ich eine Zeugenschaft haben, daß die Sach’ pflichtgetreu ausgeführt worden ist.“
„Ei, das werde ich Ihm gern bestätigen und die Abelsberger wissen ja vom Jux; aber die Schulkinder dürfen uns so nicht sehen, weiß Er, die Kinder — des Respectes wegen, versteht Er?“
„Mit Verlaub!“ sagte der Schorsch gemessen, „die Schulkinder sollen es wissen, daß in Abelsberg auch der Burgermeister eingesperrt wird, wenn er stiehlt. — Marsch!“
Mitten durch den Marktplatz trieb er den wankenden Vorstand dem Gemeindehause zu. Bald waren sie umrungen[S. 160] von lärmendem, höhnendem Volke. Einige Gemeinderäthe eilten herbei; vor diesen salutirte der Schorsch:
„Vermelde gehorsamst, daß ich hier einen Wilddieb eingebracht habe!“
Bei der Sitzung sahen sich die Väter der Gemeinde mit großen Augen an und murmelten: „So hätt’s uns auch geschehen können. — Der Soldaten-Schorsch ist ein prächtiger Kerl, den müssen wir bei seinem Regiment recommandiren. Abelsberg ist für ihn kein Platz.“
Und am nächsten Tage ist der Rehbock verzehrt worden im Festsaale des Gemeindehauses. Noch lange werden die Abelsberger von ihrem Burgermeister sprechen, „der sich herabgelassen, auf eigene Rechnung und Gefahr die Rechtschaffenheit eines Jagdwachters zu erproben“.
Der Burgermeister ist mit solcher Lösung zufrieden.
Der Brückenwirth zu Abelsberg war ein etwas heruntergekommener Mann; nicht sowohl weil er früher oben auf der Hirschau das große Bauerngut besessen hatte und jetzt herunten an der Brücke Haus hielt, als vielmehr weil das Hirschengut voll Reichthum gewesen war, während das Brückenwirthshaus halb im Wasser und ganz in Schulden stak.
Das Wasser thut’s freilich nicht, würde Martin Luther gesagt haben. Ich bin nicht so gelehrt, wie der Martin Luther, sage aber kühnlich: Der Wein thut’s auch nicht immer. Der Brückenwirth hatte Wein, ja sogar sehr viel Wein getrunken, aber für ihn lag im Weine nicht die Wahrheit, sondern die Armuth.
Herabgekommen, blutarm, voll von Schulden, Saufaus! das waren so die Bezeichnungen, unter denen der Brückenwirth schmachtete. Ja, schmachtete! Wie konnte er so viele Schulden haben? Seit er den Hirschenhof verkauft und das Wirthshaus gepachtet hatte, wollte ihm kein Mensch was borgen. Ihm fehlte nur Eins, um ein wohlhabender Mann zu sein — der Credit.
Der Kaufmann in Abelsberg hatte kein anderes Capital, als den Credit, aber der betrieb sein großes weitverzweigtes Geschäft, das trug ihm Zinsen und er war ein reicher Mann, eine Stütze der Gemeinde, ein Förderer der Künste, ein Weltmann, der lebte und leben ließ. Der Brückenwirth wußte, daß er um keinen Heller weniger besaß, als der reiche Kaufmann, daß er aber trotzdem ein Bettler war. Solches legte er sich so nahe an’s Herz, daß er vor Schwermuth in eine harte Krankheit verfiel.
Dem Arzte vertraute er’s, daß die Welt doch schön sei, und daß er nichts so ungern thue, als sterben. Der Arzt versetzte, er solle daran nicht denken, er, der Doktor, wolle seine Schuldigkeit schon thun.
Aber der Nachbar war da, der ließ bei dem Kranken anfragen, welche Sorge er — der Brückenwirth — getroffen hätte, daß er — der Nachbar — zu seinem letzt’halbjährigen Pacht käme.
„Ich habe für Alle Sorge getragen,“ sagte der Brückenwirth mit schwacher Stimme, „wenn ich nur nicht Alles, aber gar Alles auf die letzte Stunde verschoben hätt’! — Ist er denn nicht da?“
„Wer?“ fragten ihn die Anwesenden.
„Der Notar. Den Notar will ich da haben. Und daß er Tinte und Feder mitbringt.“
Der letzte Wille also! Der Notar läßt nicht auf sich warten, und Tinte und Feder hat der Mann immer im Sack. Zeugen lassen sich auch finden; ganz Abelsberg wollte dabei sein, um zu hören, was denn der Brückenwirth für eine Hinterlassenschaft haben werde.
„Seine Schulden verschreibt er den Gläubigern,“ hieß es.
„Nur seine Gurgel möchte ich haben, die ist an ihm das Beste,“ rief ein Spaßvogel. Dieweilen machte drinnen in der Krankenstube der Brückenwirth sein Testament.
„Hätt’s lieber auch verkaufen sollen, die Liegenschaften von meinem seligen Weib,“ sagte er, „die Wirthschaft ist unter fremden Händen nicht besser geworden; alle Jahr’ einmal hinreisen, das ist zu wenig gewesen. — Nu, in Gott’snam’. Was da ist, das will ich redlich verwenden. Kinder sind keine. Sind um und um keine da. So, jetzt thu’s der Herr aufschreiben.“
Die Feder war schon lange naß gewesen.
„Die Neudorfer,“ hub der Kranke an, „die haben jetzt drei Kirchenglocken; so wollen die Abelsberger viere haben. Die vierte soll angeschafft werden. Nachher — das auch aufschreiben: Beim hintern Altar — der heiligen Magdalena thut ein frischer Anstrich noth, hat schon so viel abgefärbt, letzt’ Zeit her. — Das Schulhaus braucht ein neues Dach. Für’s Armeleuthaus will ich — daß tausend Gulden kommen sollen. Und extra eine Stiftung von wieder tausend Gulden für arme Waisenkinder aufschreiben. — Nix danken, Leut’, nix danken. Wer’s hat, der kann’s ja wohl geben, und um so lieber, wenn er fort muß von dieser Welt, und er sich den Himmel kann kaufen. — Aufgeschrieben ist’s? Nachher wär’s so weit richtig. Und — wenn sie mich auf die Bank legen, so thut’s suchen im Bettstroh....“
Er war erschöpft und schwieg. Sofort verbreitete es sich in Abelsberg und der Ortsschneider rannte von Haus zu Haus und verkündete es frohlockend: „Der Bruckenwirth — wer hätt’ sich das vorgestellt! Viertausend Gulden im Sommer (er wollte wegen Neigung zum reinen Hochdeutschen nicht sagen: in Summa) hat er zu wohlthätigen Zwecken vermacht! Ja Leut’, bei Dem seiner Leich’ müssen die Abelsberger was thun. Der große Conduct mit Musik! Nur jammerschad’, daß wir die vierte Glocke nit schon haben; aber wollen ja nichts auslassen, so geizige Leut’, ehvor sie hin sind.“ Er hielt inne, war selbst erschrocken über die Wendung seines Gedankenganges. Und die Abelsberger trafen vielseitige Vorbereitungen zu einem prachtvollen Begräbniß. Windlichter! Flor! Die Weiber flochten an Kränzen; der Schulmeister zeichnete ein Grabmal mit der Aufschrift:
„Wenn er nur stirbt!“ bemerkte der Schuster Ferdl bedenklich.
In demselben Augenblicke klang die Glocke auf dem Thurme.
„Verschieden!“ murmelte der Schneider und zog wehmuthsvoll seine Haube vom Kopfe.
Es war aber nur die Eilfglocke, welche die Abelsberger alltäglich um die Mittagszeit zum Essen rief.
Der Brückenwirth lebte noch; lebte sogar am Abende noch. In derselben Nacht ließ die Schusterin ihre Hausthür offen; sie war die „Leichanlegerin“ von Abelsberg. Aber sie[S. 164] wurde nicht geholt. Der Doctor war die ganze Nacht bei dem Kranken geblieben; trotzdem fühlte sich der Brückenwirth am nächsten Morgen besser.
Und nach vierzehn Tagen war er gesund.
Jetzt gaben sich die Leute die Thür in die Hand, um den Genesenen zu beglückwünschen; und Jeder versicherte, es wäre ihm so viel unendlich hart gewesen, dieweilen der Herr Scherger auf dem Krankenbett gelegen, und Mancher gestand, er hätte gar heimlich eine heilige Mess’ gezahlt auf die gute Meinung, daß halt die Krankheit nicht übel ausgehen sollt’, na, und weil Ein’s das nicht mitansehen kunnt, wenn der best’ Mensch von der ganzen Gemein’ hinaus auf den Friedhof getragen werden thät.
„Das habe ich gar nicht gewußt, daß mich die Abelsberger gleichwohl so viel gern haben,“ sagte der Brückenwirth. Aber jetzt erfuhr er’s mit tausend Freuden, wie gut es ihm die Leute meinten, wie sie ihm beisprangen in Allem mit Rath und That. Das Brückenwirthshaus war nun stets besucht, der Wirth geehrt. Bei der nächsten Wahl wurde er Gemeinderath. Da das Geschäft besser ging, so zahlte er allmählich seine Schulden. Die Gläubiger wollten das Geld kaum nehmen: sie wüßten es nirgends so gut aufgehoben als beim Brückenwirth.
Oft bei verschlossenen Thüren las der Wirth sein Testament. — Na, es war ja recht: wenn die Abelsberger eine vierte Kirchenglocke haben wollen, so soll eine angeschafft werden; der Magdalena thut ein Anstrich noth; es schaut schon gar überall das Holz aus ihr hervor. Das Schulhaus braucht ein neues Dach — es ist ja wahr! und wer wollte nicht, daß das Armenhaus tausend Gulden bekäme und so auch die armen Waisenkinder? Wer’s hat, der kann’s geben.[S. 165] Suchen mögen sie, wenn er auf der Bank liegt, suchen im Bettstroh....
Gefunden hätten sie freilich nichts.
Aber jetzt, wenn er stirbt, werden sie auch was finden. Der Credit war durch das Testament hergestellt und dasselbe Testament hat heute, wenn der Herr Hans Michel Scherger mit Tod abgeht, volle Inhaltlichkeit und Rechtskraft. Die vierte Glocke hängt schon heute auf dem Thurm; sie läutet Manchem zum Verscheiden, aber der Brückenwirth lebt und ihr Klang verkündet immer wieder neu seinen Credit.
War ein revolutionärer Geist, der alte Schulmeister von Abelsberg. Wie die Welt war, so gefiel sie ihm nicht, und wie sie ihm gefallen mochte, so war sie nicht. Und das that in seinem Herzen bitterlich graben. Gegen die Schulkinder hatte er nichts, die waren ihm nur der etwas unfruchtbare Acker, aus dem sein saures Brot erwuchs. Im Schweiße seines Angesichtes bearbeitete er die spröden Furchen der Schulbankreihen mit dem Spaten seines Linealscheites, und jätete Unkraut und säete Weizen — zumeist taube Körner, die keine Keimkraft hatten. In Gottes Namen!
Aber die Eltern von den Kindern. Da stak’s! Schickten sie dem Schulmeister Brot, so wollte er Würste, und gaben sie Würste, so verlangte er Schinken. Und bekam er Schinken, so sagte er, es wäre eine Schande, daß man ihm nicht auch den Krenn dazu reichte. Oftmals kriegte er aber gerade den Krenn allein, wenn ihm Einer oder der Andere derb die Meinung sagte.
Der Herr Pfarrer war ihm auch nicht recht. Beim Altar war er ihm zu still, da konnte der Schulmeister nicht respondiren. Bei der Predigt war er ihm zu laut, denn der alte Herr predigte häufig von den Tugenden der Sanftmuth und Genügsamkeit, und wenn er Beispiele dieser Tugenden anführte, so deutete er nie gegen das Chor, wo der Schulmeister stand. Auf den Amtmann hatte er eine besondere Galle. Der gewann beim Kartenspielen dem Schulmeister das Geld ab und hielt sich für seine Kinder einen Hauslehrer. Wer wird den Hauslehrer nur zahlen? Der Amtmann nicht, die Gemeinde wird ihn zahlen. Das ist eine Schmarotzerei, so ein Amtmann muß fallen. Freilich paßt Keiner besser für das Abelsberg-Schildburg, als dieser Herr, dem wider Willen schon allerlei Abelsberger Stückeln gelungen waren. Gescheite Amtmänner giebt’s anderwärtig; der hiesige ist ein abgedankter Feldwebel. Schon gut.
Den finstersten Ingrimm aber hegte der Schulmeister gegen den Gutsherrn, der im Winter zwar in der Residenz lebte, im Sommer aber auf Hoch-Abelsberg wohnte und sich zu allerlei Gelegenheiten mit Volksaufzug und Blumensträußen und Kranzmädchen feiern ließ, als wie ein Herrgott. Was hat der hohe Herr im alten Schloß den Pfarrer und den Amtmann zu Tische zu laden, zu seinen Jagden, Scheibenschießen und anderen Festlichkeiten zu ziehen, wenn der Schulmeister daheim bleiben muß! Soll der Lehrer des Volkes denn ewig am Hungertuche nagen? Will man den Unterricht unterdrücken, damit sich die Dummheit und die Gewalt um so breiter machen kann? Wohlan! Es kommt eine andere Zeit! Die Großen wird man von ihrer Höhe stürzen...! — Darum sagte ich: ein revolutionärer Geist. Und so kam es, daß der Schulmeister etwas mißliebig war bei den Leuten.
Und eines Tages im Winterfasching, als der Schulmeister eben die Geige von der Wand nahm, um damit im Wirthshause bei einer Freimusik aufzuspielen und sich so ein paar Groschen für die Fastnacht zusammenzufiedeln — ging die Thüre auf. Der besäbelte Gemeindediener und der befrackte Amtmann traten herein, und Letzterer bedeutete dem Schulmeister, daß heute das Geburtsfest des hochgebornen, wohledlen und gestrengen Gutsherrn wäre.
„Ist vielleicht gar das Musiciren verpönt?“ fragte der Schulmeister bissig.
„Keineswegs,“ antwortete der Amtmann, „doch zeigen wir Euch an, daß Ihr laut hohen Auftrags hiermit verhaftet seid!“
„Wer? Ich? Ich, der Schullehrer, verhaftet?! Mein Herr!“
Es gab eine Scene. Während sich im Städtchen Alles auf das Fest rüstete, wurde der Schulmeister in den Gemeinde-Arrest von Abelsberg gethan. Dort saß er eine Woche lang, saß in der Fastnacht, saß am Aschermittwoch.
Und als die Schule wieder beginnen sollte, wußte sich der Amtmann nicht zu helfen; er schrieb an den Gutsherrn in die Residenz:
„Wohledler, gestrenger und gnädigster Herr! Unterzeichnete Behörde untersteht sich unterthänigst anzufragen, was mit dem Schulmeister, an welchem der gnädigste Befehl vollzogen worden, weiters zu geschehen habe. In devotester Ehrerbietung das Amt Abelsberg.“
Der Gutsherr schrieb nach einiger Zeit zurück: „Was für ein Schulmeister und was für ein Befehl? Ich weiß nichts. Unterzeichnet
L. L. von S.“
Darauf schrieb das Amt in Abelsberg: „Hochgeborner, gnädigster Herr! In Anbetracht des Auftrages, welchen Hochdieselben zu dero feierlichem Geburtsfeste zu geben geruhten und welcher dahin lautete, den Schulmeister einzuschließen, rapportirt ein Gefertigtes dienstschuldigst, daß besagter Auftrag respectirt und ausgeführt worden ist und Delinquent sich bis dato in Gewahrsam befindet. In ehrfurchtsvollster Erniedrigung
Amt Abelsberg.“
Hierauf ein umgehendes Schreiben vom Gutsherrn:
„Amtmann, Ihr seid ein Esel. Laßt Euch Schreiben Nr. I erklären.
L. L. von S.“
Deß war der Herr Amtmann etwas indignirt. Er besprach sich mit seinem Schreiber und Beide kamen endlich darin überein, daß das Geschätzte Nr. I vom gestrengen Herrn in Sachen des Geburtsfestes mißverstanden worden sei. Dasselbe lautete wörtlich:
„Komm diesmal nicht nach Abelsberg, wünsche aber, daß das Fest wie gewöhnlich und mit Einschluß des Schulmeisters gefeiert werde.
L. L. von S.“
Der Schreiber vermuthete, daß der gnädige Herr etwa könne gemeint haben, mit in’s Fest und zum Festessen solle man den Schulmeister, der ja sonst seiner Widerhaarigkeit wegen oftmals umgangen wurde, einschließen, und nicht in den Gemeindekotter.
„Ja!“ machte der Amtmann die Achsel zuckend, „mit mir muß man ohne Umschweife reden, ich kenne keine Zweideutigkeit.“
Noch an demselben Tage wurde der Schulmeister auf freien Fuß gesetzt, jedoch mit dem strengen Bedeuten, in Zukunft sich besser zu hüten!
Der Schulmeister war überzeugt, daß ihn seine aufrührerische Gesinnung in das Gefängniß gebracht habe und befliß sich, fürder sanftmüthiger zu sein.
Die Neudorfer hatten an ihrer Pfarrkirche zwei Thürme, so wollten die Abelsberger an der ihren auch zwei Thürme haben.
Der eine, der schon stand, war recht sauber und schlank und hatte oben ein Kröpflein, an welchem die Schwalben allerlei Narretheien und Liebschaften trieben, und hatte ein paar Glocken, die täglich dreimal zum Essen läuteten, und hatte eine Uhr, die den Schlaraffen von Abelsberg zu Lieb’ kurzen Tag und lange Nacht machte. Die Nacht aber ist den Abelsbergern der eigentliche Tag, da sind sie munter, da sind sie beim Zeug. Ihr „Zeug“, das ist der Schoppen und das Kartenspiel und wieder der Schoppen, und um sechs Uhr Abends ist zu solchem Tagwerk der Morgen, und um neun Uhr ist Mittag, und um zwölf Uhr ist Abend, und Jeder geht gleich am Abend nicht gern heim, Mancher bleibt noch gern ein wenig „in die Nacht hinein“.
So schöne Zeitrechnung macht der Thurm mit seinen Glocken und mit seiner Uhr. Darum giebt es Leute zu Abelsberg, die sagen: „Wenn’s bei Einem Thurme schon so schön ist, wie müßt’s erst sein, wenn wir zwei Thürme hätten!“
Andere freilich meinen, das wäre dummes Geschwätz, ein zweiter Thurm wäre schon recht, aber nur zur Ehre Gottes.
Im Rathe aber saß ein Lästerer, der sagte: „Ich stimme nicht für zwei Thürme, jeder Ochs hat zwei Hörner.“
Der mußte auf der Stelle abdanken.
Alle Anderen wollten einen zweiten Thurm; so stand Einer auf und sprach das Wort: „Geld zusammenschießen!“
Der Mann mußte abdanken.
Endlich hielt ein Dritter eine Rede und sprach: „Wenn, meine Herren, jeder Ochse zwei Hörner hat, so wird mein erster Herr Vorredner auch zwei Hörner haben —“
Der Mann wurde mit einem „nichtendenwollenden“ Applaus unterbrochen; nach einer längeren Weile erst konnte er fortfahren: „Und wenn, meine Herren, der Thurm zur Ehre Gottes erbaut werden soll, so kann und darf das doch wohl nicht durch profane Mittel geschehen. Meine Herren! Jeder von uns kann auf die Brust schlagen und sagen: Mein Geld ist sündig! (Bravo!) Ich bediene mich nicht des schärfsten Ausdrucks, wenn ich sage, es wäre Gotteslästerung, aus solchem Stoffe dem Herrn einen Thurm zu bauen. (Sehr gut!) Mein Vorschlag ist daher folgender: Die Mittel zum Thurmbaue mögen nur durch schlichte, ungebuchte Beiträge frommer Seelen, durch Almosen beschafft werden. Ich stelle den Antrag, daß in der Kirche an jener Seite, wo der zweite Thurm sich erheben soll, ein Opferstock aufgestellt werde, in welchen der wohlhabende Mann frommen Sinnes seine Silberlinge, sowie die arme Witwe ihren Pfennig legen mag. Die Verwaltung der Opfercasse darf unbedenklich unserem ehrenwerthen Küster Thomas Reckenschlauch übertragen werden.“
Ueber solche Rede hätten sie den Antragsteller am liebsten allsogleich zum Burgermeister gemacht. Leider war das dritte Jahr des alten noch nicht um.
Der Opferstock für Spenden zum Bau des zweiten Thurmes wurde in der Kirche aufgerichtet; der ehrenwerthe Küster Thomas Reckenschlauch wurde zum Cassenwart gemacht — und so war der Same gelegt zum Thurme, der sich dereinst neben dem alten erheben sollte, oben mit einem Köpfchen, an welchem die Schwalben allerlei Narretheien und Liebschaften treiben, mit ein paar Glocken, die täglich dreimal zum Essen läuten, mit einer Uhr, die kurzen Tag und lange Nacht macht.
Das Ding keimte. Die arme Witwe kam mit ihrem Pfennig und der reiche Mann kam — auch mit seinem Pfennig. Silberlinge sind zu profan für einen Thurm Gottes.
Der Küster waltete treu seines Amtes und war — nebstbei gesagt — nicht der Mann, der den Abelsberger in sich verleugnete. Die Kirche hielt er die längste Zeit des kurzen Tages sorgsam geschlossen — stand ja doch der „goldene Hirsch“ offen zu jeglicher Stunde. Jener goldene Hirsch, den der wackere Küster einmal in einer sinnigen Rede verherrlicht hatte: „Der Hirsch gemahnt an uns selbst, die wir uns sehnen nach dem Kruge, wie der Hirsch nach der Quelle. Das Goldene an dem Hirschen versinnlicht uns, daß der Wirth zum „goldenen Hirschen“ eitel Gold begehrt von seinen Hirschen, denen, während sie im Hirschen sitzen, daheim von den Weibern bisweilen die Geweihe aufgesetzt werden. Darum lebe der Hirsch! Er lebe hoch!“
Der ehrenwerthe Küster Thomas Reckenschlauch trug an seinen Geweihen eben nicht schwer — ihm war das Trinken[S. 172] schon lieber, als das Küssen — so trank er und trank wie ein Abelsberger.
Da geschah es eines Abends, oder vielmehr eines Morgens, als es — wie er so schön sagte — „vom Zechen zum Blechen kam,“ daß er sein Geldbeutelchen vermißte. Gottswahrhaftig, das lag daheim bei seinem Weibe. Bevor er aber noch den „goldenen Hirschen“ um einen Credit angehen will bis auf morgen — eigentlich nur bis auf heute — bis er nach Hause geht, sich ausschläft und wiederum kommt — entdeckt er in seiner Hosentasche das Opfergeld für den Thurmbau, das er Tags zuvor erst aus dem Opferstock genommen hatte, wie er es allwöchentlich zu thun pflegt. Das reicht für die Zeche — es bleibt sogar noch etwas übrig.
Was? Uebrig bleiben? Nein, das läßt sich ein Abelsberger nicht nachsagen. Was nützt die Thurmspitze, wenn der Thurm versoffen ist! „He, Wirthshaus! Frisch eingeschenkt, wir bleiben sitzen.“
Und als es morgen ward und der letzte Knopf vertrunken war — der letzte Knopf vom Thurmgeld — da stand der Küster Thomas Reckenschlauch auf. That aber nicht gut daran, denn auf der Stelle wollte er wieder umfallen. Indeß, es ging und der Weg schräg über den Kirchplatz hin war nicht zu verfehlen. Anfangs allerdings hielt sich der Küster etwas zu sehr rechts, um später ein bißchen zu viel nach links abzuschwenken. Als er mitten auf den Platz kam, blieb er stehen, so gut es ging und starrte auf den Kirchthurm hin und begann zu kichern. — „’s ist richtig“, stammelte er, „das Thurmgeld — er steht schon — der zweite. Ach — der Tausend, was das schön ist! Ganz wie in Neudorf! Hi, hi! Zwei Thürme auf der Abelsberger Kirchen!“
Und taumelte entzückt nach Hause.
Eine angenehmere und billigere Bauart giebt’s nicht. Und nachdem nun der ehrenwerthe Küster Thomas Reckenschlauch die Entdeckung gemacht hat, wie man in Abelsberg Thürme baut, so soll es nicht allzuselten geschehen, daß er sein Geldbeutelchen beim Weibe daheim läßt und zufällig immer nur die Wochenausbeute vom Opferstock im Sack hat — und daß er dann beim Nachhausegehen regelmäßig auf der Kirche den zweiten Thurm neben dem ersten stehen sieht.
Und der Küster räth es Jedem, der in Abelsberg zwei Thürme haben will: „Geh’ hin und thu’ desgleichen!“
Sollte es zwar nicht erzählen, denn ich hab’s nicht gesehen. Sie schlossen sich dabei ein — der Herr Pfarrer von Abelsberg und sein Bruder, der Hochbergreichhofer. In der Oberstube saßen sie und ließen sich’s gut geschehen und spielten Karten. Aber nicht etwa ein verbotenes Spiel! — i bewahre — beim Pfarrer! „Brandeln“, „Zwicken“, ein wenig „Mauscheln“ mitunter, das war der Zeitvertreib.
„Na, ich dank’ schön für einen solchen Zeitvertreib!“ sagt zwar der Hochbergreichhofer, kommt aber nichtsdestoweniger jeden Sonntag von seinem Berg herab, läßt sich zur Jause laden, versitzt den ganzen Nachmittag bei seinem Herrn Bruder und verspielt jedesmal sein ganzes Geld.
Hingegen muß er stets auf dem Ehrenplatz sitzen, an der Wand auf weicher Lederbank, während der Pfarrer ihm gegenüber mit dem Holzstuhl fürlieb nimmt. Und hernachen — wie schon angedeutet worden — ganz abgeschlossen waren sie doch nicht von der Welt. Die Köchin durfte in[S. 174] die Oberstube — und das lohnt sich im Pfarrhof immer, denn mit leeren Händen erscheint so ein Frauchen selten. Sie ist ja Herrin der Küche und von Allem was dazu gehört, und an ihrem Schürzenband hängen die Kellerschlüssel. Was also den alten Wein anbelangt — er war ein Jahrgänger mit dem Hochbergreichhofer, der in dem gesegneten Vierunddreißiger-Jahr zu dieser Welt gekommen war — und was die gut geräucherten Schinken betrifft und den Gugelhupf und den Kaffee, und dann den wohlgetrockneten Knaster, den sie aus langen Pfeifen rauchten, so konnte der brave Hochbergreichhofer das Sonntagsspielchen bei seinem Herrn Bruder nimmer missen. Mit Speis’ und Trank suchte er sich, so gut es ging, zu entschädigen für die Zwanziger, die aus seinem weltlichen, hundsledernen Geldbeutel allzu frommen Sinnes dem geistlichen Herrn zusprangen. Der Hochbergreichhofer hatte doch das Kartenspielen von Jugend auf getrieben und war nicht arg dabei zu Schaden gekommen. Aber im Pfarrhofe versagte ihm das Glück.
Trotzdem ging er jeden Sonn- und Feiertag zum Nachmittagssegen und machte nach demselben den kleinen Besuch beim Herrn Bruder, den er erst spät Abends häufig mit etwas verrücktem Schwerpunkte verließ.
„Grüß’ Dich, grüß’ Dich, Bruder!“ empfing ihn der Pfarrer, „setz’ Dich doch auf Deinen Platz.“
„Aber immer auf dem Polstersitz, nein, Bruder, das geht doch nicht; der geistlichen Weih’ gehört die Ehr’ zu!“
„Bitte, Du bist der Gast! Nur keine solchen Umstände!“
So oftmals der edle Wettstreit, bis endlich Jeder stets wieder auf dem alten Fleck saß bei der Gottesgab und beim Gebetbuch des Teufels, wie der Herr Pfarrer die Spielkartenblätter nannte. Und wenn dann das gut gebratene[S. 175] Schweinerne kam, so schob der Pfarrer Messer und Gabel hin und rief: „Bruder, stich die Sau!“ Das that der Hochbergreichhofer wohl hier in Natur, aber in den Karten vermochte er’s selten. Oft genug kam ihm ein guter Trumpf in die Hand, aber der geistliche Herr spielte mit so schlauer Berechnung, daß der Bauer einmal rief: „Du, Herr Bruder, geistlich Weih’ ausgenommen, Du hast falsche Karten!“
„Lapp!“ lachte der Pfarrer, „das kannst ja anders machen. Nimm für’s nächstemal Deine Karten mit.“
„Das ist eine Red’.“
„Aber, was ich Dir sagen wollt’, Bruder. Am nächsten Sonntag geh’ nicht in die Predigt, ich rath’ Dir’s.“
„Ja, hörst, wesweg soll ich denn nicht in die Predigt gehen?“
„Weißt Bruder, nächsten Sonntag ist das Evangeli von dem ungerechten Haushälter und da muß ich einmal gegen das Kartenspielen predigen. Die Leut’ wissen Deine Passion, kunnt Dir unangenehm sein in der Kirch’.“
Ging der Hochbergreichhofer also nicht in die Predigt; die Leute aber sagten nach derselben: „Scharf ist’s niedergangen heut’, höllisch scharf, und seinen Bruder hat er gemeint. Ist er nicht in der Kirch’ gewesen, der Hochbergreichhofer?“
Der aber ging wie gewöhnlich zum Nachmittagssegen und hatte richtig sein eigenes Spielkartenbüschel bei sich. Er traute dem Herrn Bruder nicht mehr recht; der hatte beim Spiel auch immer einen so schiefen Blick, sah ihn an und sah doch wieder an ihm vorbei — ein rechter Judasblick, die geistlich’ Weih’ in Ehr’!
Und als er in die Stube trat, rief der Pfarrer: „Na, grüß’ Dich, Bruder, setz’ Dich wieder auf Dein Platzl. Hast Karten bei Dir?“
Sie spielten mit den Karten des Hochbergreichhofers; der Pfarrer hatte wieder den schielenden Blick, der dem Partner wohl über die Achsel, aber nie in’s Auge sehen konnte, und der Bauer verlor, wie immer.
Da kam diesem plötzlich der Zorn: „Was schaust mir denn nicht in’s Gesicht, Pfarrer? Hast ein schlechtes Gewissen?“
Zum Glück kam in diesem Augenblick die Köchin mit dem gebratenen Huhn. Sie war noch ein recht reputirliches Frauenzimmer und allerweil woltern nett angezogen. Heute hatte sie gar eine Pfingstrose im Haar, that einen Blick über den Hochbergreichhofer hin an die Wand und ordnete die Rose.
Was denn da ist, an der Wand? dachte der Bauer, wendete sich und sah — den Spiegel.
Die Faust mit dem Kartenfächer fest auf den Tisch gepreßt erhob er sich langsam — starrte in den Spiegel, in welchem sein ganzes Kartenspiel offen lag — starrte dem Pfarrer in’s Angesicht und murmelte: „Jetzt, Herr Bruder, jetzt bin ich gescheit. Ja, hörst, wenn Du einen Kameraden hast, der mir in die Karten schaut, nachher — nachher glaub’ ich’s gern!“
Der geistliche Herr that einen schreckhaft lauten Lacher. „Endlich!“ rief er, „endlich einmal! Na, Zeit ist es, daß Du gescheit worden bist. Hättest mir aber noch eine Weil’ stillgehalten unter dem Spiegel, wär’ mir nicht unlieb gewesen, hätten von Deinem Gelde noch lange gut gegessen und getrunken.“
„Und wär’ Dein Spitzbubenstückel gar nicht aufgekommen, so wär’s Dir noch lieber gewesen!“ sagte der Hochbergreichhofer.
„Geh’, gift’ Dich nicht!“ rief der Pfarrer und lachte noch immer, „laß’ uns jetzt essen und trinken, heut’ wird es das letztemal sein, daß Du die Jause zahlst.“
Der Tabak-Simerl lehnte an seinem Tabakskasten und hatte — gestehen wir’s offen, denn es läßt sich nicht leugnen — einen Rausch. Auf dem Kasten stand eine Flasche, die sich in dem Verhältnisse, als sie geleert worden war, verdoppelt hatte, so daß sie jetzt dastand — zwei in eins und eins in zwei — wie die siamesischen Brüder.
Es war zwölf Uhr Mittags. Da schellte es an der Thür. Der Postbote trat ein und überreichte dem Tabak-Simerl ein Briefchen. Der Simerl that’s mit umständlicher Mühe auseinander und las nicht ohne Umstände:
„Lieber Freund und Simerl!
Bei uns ist gemetzgert worden. Erweis’ mir die Ehr’ und komm’ heute Mittags 11 Uhr zu mir zum Kalbskopf.
Mit Grüßen
Jacob K.
Bäckermeister.“
„Das ist schön von ihm,“ dachte oder sagte der Simerl zu sich, „daß er mich zu seinem Kalbskopf einladet. Aber um eilf Uhr, und jetzt ist’s schon zwölf! Du verfluchte Post! Ob er mir’s nicht zu Fleiß thut, dieser sikraments Postschreiber, dieser neue, der mir jetzt auch schon den Tabak wegnehmen will, und gar anhebt die Leut’ zu rasiren, mir zu Trutz ihnen das letzte Haar auskratzt mit Putz und Stingel, daß gar kein’s mehr wachst, und ich verdursten kann, wie ein Schwamm auf dem Ofen; zu Fleiß, daß er mir meine[S. 178] Briefe alle verspätet zuschickt. Keinen rostigen Pfennig verwett’ ich, er unterschlagt mir auch noch welche. Dem thu’ ich noch was an! Vor der Hand soll er’s jetzt erfahren, wie’s taugt, wenn man gefoppt wird. Einen Narren muß er mir machen, und giften muß er sich heut’, und ausgelacht muß er werden vom ganzen Dorf. Ich thu’ ihm’s an, oh, ich bin nicht so dumm!“
D’rauf setzte er sich hin und schrieb an den Postbeamten folgende Zeilen:
„Lieber Postschreiber!
Bei uns ist gemetzgert worden. Erweisen mir die Ehr’ und kommen heut’ Mittags um 1 Uhr zu mir zum Kalbskopf.
Mit Grüßen
Jakob K.
Bäckermeister.“
Vor dem Fenster ging gerade ein Söhnlein des Bäckermeisters vorüber, das rief er an: „Du Bübel! Du gehst ja an der Post vorbei. Gelt, Du bist so gut und giebst mir den Brief geschwind dem Postschreiber hinein. Da hast einen Kreuzer, der gehört Dein.“
Das Knäblein lief mit dem Briefchen zum Postbeamten. Der Tabak-Simerl lachte sich in die Faust.
Und als es Eins geschlagen hatte, ging er hin und schlich um das Haus des Bäckers Jacob und lugte durch das Fenster, wie dumm der Postschreiber dastehen werde, wenn er zum Kalbskopf erscheine und hören müsse, der Kalbskopf sei schon vor zwei Stunden verspeist worden, auch wäre der Postschreiber gar nicht dazu geladen gewesen.
Aber als der Simerl durch’s Fenster guckte, da sah er, wie der Bäcker Jacob und der Postbeamte in heiterster Laune beim Kalbskopf und beim Weine saßen.
„’s ist einmal gedeckt für einen Zweiten,“ lachte der Bäckermeister, „und ist’s der Eine nicht, so ist’s der Andere. Und will ich’s aufrichtig sagen: Sie, Herr Postmeister, sind mir lieber als wie der alte besoffene Griesgram. Aber, wissen Sie was, machen wir Bruderschaft: Sollst leben!“
Lustig stießen sie an und der Simerl zog mit langer Nase ab. Er konnte sich das Ding gar nicht zurechtlegen. Noch einmal las er seine Einladung zum Kalbskopf, und nun klärte sich’s auf. Da stand’s ja schwarz auf weiß, genau, wie er’s selbst dem Postschreiber geschrieben hatte: „Erweis’ mir die Ehr’ und komm’ heute Mittags um 1 Uhr —“
Wie der Irrthum möglich war? Der Tabak-Simerl hatte in seinem Dusel den Einser doppelt gelesen.
Diesen Kalbskopf vergißt er nimmer, man könnte sagen: er liegt ihm im Magen, trotzdem, oder eben, weil ihn ein Anderer speiste; aber nein, der Simerl hat eher das Gefühl, als wie wenn ihm das Ding auf den Schultern säße. — In solch’ ungewissen Stunden schleicht er hinab zu seinem Kellerfäßchen und entschädigt sich mit
„Geschehen muß was!“ sprach der Vorstand im hohen Rathe zu Abelsberg, „denn warum muß was geschehen? Weil uns oberen Orts ist kundgemacht worden, daß sie in drei Tagen durchfährt. Sie hat’s gern, wenn was ist, und von den Abelsbergern wird was erwartet.“
„Aber was! Ich hab’ noch keinen blassen Nebel davon,“ rief der Hirschenwirth, „ist Dir was eingefallen, Vorstand?“
„Bei einem Haar wär’ mir was eingefallen,“ berichtete dieser, „just ein klein bissel ist mir die Nacht zu kurz worden. Die ganz’ Nacht hab’ ich mich zerstudirt, daß mein Weib schon toll ist worden, und g’rad wie mir was will in den Kopf kommen, geht der Morgenstern auf, und aus ist’s, gar ist’s mit dem Simuliren.“
„Darf ich reden?“ fragte der Färbermeister.
„So viel Du willst,“ sagte der Vorstand, „ich weiß eh nichts mehr.“
So sagte der Färber: „Was werden wir denn machen? Ich denk’, so ein Volksfest richten wir her; die Oberziller Musikbande, den Zitternschlager-Maxl, einen Triumphbogen da oben bei der Mauth, ein Paar Baumkraxler, ein paar rinnende Weinbrunnen und wenn sie kommen, daß ein feister Ochs niedergeschlagen wird auf dem Platz!“
Die Idee war groß, er blickte in die Runde des hohen Rathes. Aber der Rath Hufschmied stand auf und sagte: „Das ist nichts, das hat sie hundertmal schon gesehen und besser, als wir’s zuweg bringen. Das Triumphbogenbauen ist keine Kunst, wo so viel G’reisig zu Handen ist, als wie bei uns, und das Ochsenniederschlagen auch nicht. Wir müssen in die Zeitung hineinkommen! Wir müssen was machen, was die Majestät noch nicht gesehen hat, was Kopf und Fuß hat und was den Abelsbergern Ehr’ macht. — Na ja, versteht sich, daß ich was weiß. Unser Volk im Feiertag, in seinen Lustbarkeiten vorstellen, auf das halt’ ich nichts; die Herrschaften, wenn sie nie was Anderes sehen, thäten ’leicht glauben, hierzuland hätten wir alleweil Sonntag. Bei ihrer Arbeit muß man den Leuten zuschauen; das wird[S. 181] die hohen Herrschaften unterhalten und sie lernen was dabei. Desweg sag’ ich, daß wir da ober Abelsberg an beiden Seiten der Landstraße in Gruppen die Arbeiter, als den Landmann, den Handwerker, den Jäger, den Halter, den Holzhauer und wie sie halt alle sind, mit ihren Verrichtungen aufstellen — und wenn die Wägen kommen, sollen die Leut’ flink arbeiten. Das ist mein Rath.“
Der Mann, der die Schrift führte, wollte sofort in die Chronik schreiben, daß am 24. August des Jahres 1828 nach Christi Geburt im Rathe zu Abelsberg eine gescheite Rede gehalten worden wäre. Der Vorstand nahm nun das Wort und sagte: „Ich halte nichts darauf, daß unser Volk allemal im Feiertag und Lustbarkeit da ist. Die hohen Herrschaften lernen nichts dabei. Den Leuten muß man bei ihren Arbeiten zuschauen, und so ist meine Meinung, daß da oben an der Landstraße Arbeitsleute aufgestellt werden sollen: der Bauer, der Schlosser, der Rastelbinder und wie sie halt alle nacheinander her sind — und daß sie fleißig arbeiten, wenn die Wägen vorüberfahren. — Sein die Manner mit mir einverstanden?“
„Vorstand!“ rief ihm der Rath Schneider zu, „für das wirst Du Baron!“
Der Hufschmied machte ein langes Gesicht. Der Vorschlag des Vorstandes wurde angenommen. —
Nun gab’s ein paar Tage lang Arbeit über Arbeit. — Den Rastelbinder brauche man eigentlich nicht dabei, bedeutete man dem Vorstand, denn es wäre keine einheimische Figur, die käme nur so zu gelegener Zeit aus Schlovakien daher. Aber der Handel und Wandel des Landes müsse zum Ausdrucke kommen, daß die Majestät ein vollständiges Bild von dem Leben und Treiben der Bevölkerung ge[S. 182]winne. Es wäre nur zu verhüten, daß nichts dabei vorkäme, was auf den Landesvater einen unangenehmen Eindruck machen könne.
Und am vierten Tage sollte die Durchfahrt des Kaisers Franz stattfinden. Des alten Kaisers Franz, der noch auf keiner Eisenbahn fahren konnte, der im Gerüttel seiner Wagen, im Ceremonientaumel seines Gefolges, im plebejischen Staube der Straßen über Land reisen mußte, wollte er die Zustände seines Reiches prüfen und von seinen treuen Völkern einmal Huldigungen entgegennehmen.
Er hatte Feste und Aufzüge, ihm zur Ehr’ gebracht, nicht ungern, denn für gar Manches war ihm das Bewußtsein seiner Kaiserwürde eine hohe Genugthuung.
So bewegte sich um 11 Uhr des 28. August die Wagenburg gen Abelsberg heran. Eine halbe Stunde vor dem Städtchen begannen die Wunder. Auf dem Felde ackerten Bauern und säeten Korn; gleich daneben klangen die Sicheln der Schnitter, die Sensen der Mähder und die Arbeiter hatten ihre bunteste Sonntagstracht an.
Am Berge war ein Stollen, aus welchem flinke Knappen reines Erz schafften, und ein paar Eisenhämmer schmiedeten Sensen, Pflüge und Schwerter. Im Wäldchen jodelte der Holzhauer und hallten stürzende Bäume. Der Hirte trieb eine Heerde schöner, bekränzter Rinder über die Au, die Sennin molk unter dem Schatten einer Tanne ihre Kuh und der Jäger schoß gerade im Augenblicke, als der kaiserliche Wagen herankam, einen ausgestopften Auerhahn vom Lärchbaum. Das Wunderbarste aber waren die Obstbauern, welche von alten Holzbirnbäumen die feinsten Butteräpfel schüttelten, und die Winzer, welche aus Erlen- und Weidengebüsch Trauben schnitten. Es ging nicht anders, und wenn das[S. 183] ganze Land zusammengerückt sein sollte auf etliche Joch oberländischen Grundes, so mußte das Erz wohl einmal im eitlen Sand und der Wein auf Weidenstäben wachsen. So unerhört fruchtbar war der Boden bei Abelsberg, und der Obersthofmeister schrie dem Kaiser zu: „Eure Majestät, aber das ist ja prächtig! Was Eure Majestät für ein Land haben!“
Seine Majestät, höchst erfreut von dem fröhlichen Aufzuge, wollte den Ortsvorsteher sprechen. Noch dauerten an beiden Seiten der Straße die Vorstellungen; auch ein Hochzeitszug und ein Taufgang war dabei und Volkslieder wurden gesungen und zum Schlusse, dort wo die bekränzte Mauth prangte — kauerten etliche Krüppel, ein Cretin und ein paar zerhauene und zerschossene Militärs mit Weib und Kind im Straßenstaub und wimmerten mit aufgehobenen Händen um Almosen. Denen war’s Ernst.
Der Hof stutzte sehr — gar sehr stutzte er über eine solche durchaus nicht anspruchslose Pointe der Festlichkeit — und nach dem Ortsvorstande, der mit seinem Rathe auf dem Marktplatze tief geknickt stand, wurde nicht mehr verlangt.
Vor dem Thore des Posthauses standen sechs streuende Blumenmädchen, aber die Wagen rollten vorüber und hielten nicht in Abelsberg.
Der hohe Rath war aus Rand und Band. Das Bettelgesindel verhaftete er sofort; aber der Cretin grinste und die alten Krieger mit ihren elenden Familien meinten, sie hätten gehört, daß das ganze Land bei dem Aufzuge vertreten sein sollte, und da hätten sie gedacht, die viele Armuth, die da sei, gehöre so zu sagen auch zum Lande, sie hätten des Weiteren gerechnet auf etliche Silberbatzen oder einen warmen Löffel Suppe, was freilich eine ganz verfehlte Rechnung gewesen wäre.
Der Bürgermeister wollte diese Leute, die das schöne Fest so jämmerlich verdorben hatten, in den Kotter stecken lassen. Das ließ der Rath Hufschmied nicht gelten. Das Betteln, sagte er, sei zwar in Abelsberg verboten, aber vom Mauthbalken auswärts sei es von jeher erlaubt gewesen.
Der Schelm!
Er ist aber später Vorstand geworden.
Wie nur plötzlich die Natur so schön geworden ist! Erst seit etlichen Jahren. Es lebten wohl auch früher einzelne Leutchen, die einzelne Gegenden „wirklich romantisch“ fanden; heutigentages aber sind alle Wälder und Berge so herrlich! Und der Sonnenaufgang!
Wer hätte das vor dreißig Jahren vermeint, daß auch der Sonnenaufgang Mode werden sollte!
Mode! O du heilige Welt Gottes, vergieb mir dieses Wort. Aber du weißt es ja doch selber am besten, wie Wenigen, die doch deine ewig großen und lebendigen Pfade gewandelt, es einst eingefallen ist, dich seligen Herzens zu bewundern, dich anzubeten. Wohl, es mögen die lieblichen Bilder deiner Gärten und Auen, deiner Frühlingstage und Sommernächte zu allen Zeiten Beseligung in dem Menschengemüthe wachgerufen haben; vor dem Brausen des Sturmes, vor dem Ernste der Einsamkeit, vor den Gewalten des Hochgebirges aber sind die Kinder der Welt zurückgeschaudert, wie vor einem übermächtigen Feinde.
Und heute — je wilder die Gegend, desto schöner; natürlich, wenn gute Wege in derselben angelegt sind und comfortable Wirthshäuser. Zarte Frauen mit ihren zarten[S. 185] Kindern steigen heute auf Berge, auf denen sonst nur der Gemsjäger und der arme Kräutersammler geklettert; es geht prächtig; und wenn eine Eisenbahn schnurstracks den Berg hinanläuft, um so besser. Oben steht gar ein Hotel, da ißt und trinkt man, schreibt sich in’s Fremdenbuch und findet Alles unvergleichlich.
Weil im neunzehnten Jahrhundert die Natur denn gar so schön geworden!
„Touristen!“ Die Sache ist so schnell gekommen, daß die deutsche Sprache gar kein Wort dafür in Bereitschaft hatte und bis heute noch keines hat. Ja, gewiß, Sommerfrischen, Gebirgspartien, Touristen — das sind Modesachen. Vorläufig noch. Wir werden die Natur einst wirklich suchen, nicht blos an heiteren Sommertagen, sondern auch, wenn sie finster blickt und grollt, auch wenn sie in der ehernen Majestät des Winters ruht. Denn wir werden unsere große, heilige Mutter lieben und insgeheim an ihren Busen fliehen aus dem Drange der Welt.
Selbst an den Abelsbergern darf hierin nicht ganz verzweifelt werden. Und sie sind ja heute schon große Naturfreunde, die Abelsberger. Erstens liegt Abelsberg ja in einem freundlichen Gebirgsthale, und zweitens hat ein Abelsberger Wirth über die Thür seines Hauses einen grünen Baum malen und seine Herberge demnach „Zum grünen Baum“ benamsen lassen. Und nicht allein das, des Wirthes Sinn für Natur erstreckt sich sogar bis in den Keller, in dessen bauchigen Fässern — es ist keine Fabel, wahrlich nicht! — Naturwein und blos Naturwein lagert. Und wer eben Sinn dafür hat — zwischen den Fässern auch das Plätschern eines Wasserbrünnleins hört sich anmuthig. Allerdings, Sitzgarten ist keiner beim Haus; ist auch keine Frage danach. Ein echtes[S. 186] Tröpflein trinkt sich auch in der räucherigen Gaststube gut. Was Sommerabend! Die Abelsberger gehen nicht in’s Wirthshaus, um Sommerabende zu genießen.
Wohl aber nehmen sie den Zeitgeist wahr, der — wie Poeten so schön sagen — heute in den Blättern säuselt — in den Zeitungsblättern nämlich. Sie sind für’s Erste daher wacker liberal, die Abelsberger, denn: „Fortschritt und Freiheit!“ sagt der Tischler, und hat diese Worte in sein Bierglas stechen lassen.
Da standen nun schon seit Jahren zu jeder Sommerszeit Aufsätze in der Zeitung von der schönen Schweiz. „Ja, die Schweiz!“ meinte der Webermeister, „von wo der Schweizerkaffee und der Schweizerkäs kommt — weiß schon davon!“
Allmählich dann zogen sich — dem Blatte nach — die Naturschönheiten der Schweiz auch in’s Tirol und Salzburg herein, und plötzlich in dem letzten Jahre war eine ganz einzige Großartigkeit aufgetaucht im eigenen Lande, der Steiermark. Die Admonter Gegend, das Gesäuse und Eisenerz konnten die Zeitungen gar nicht genug rühmen. Diese hohen, schroffen Berge, diese wilden Schluchten, diese sausende Enns! In der Schweiz wahrhaftig nicht schöner zu finden! — Und mitten hindurch die Eisenbahn und Touristen aus allen Weltgegenden, und es ist eine wahre Schande, das Gesäuse nicht gesehen, den Reichenstein und den Buchstein nicht bestiegen, das Hochthor und den Damischbachthurm nicht bewundert zu haben.
Da thaten sich die Abelsberger zusammen. „Zu meiner Zeit, wie ich als Bursche durch’s Ennsthal gewandert bin,“ sagte der Sattler, „da ist mir nichts aufgefallen; weiß nur, daß ich in schauderlich wilde Gegenden gekommen bin, und[S. 187] daß ich bei einer Kohlenbrennerei Wasser getrunken habe. Nu, heute mag’s anders sein.“
„Leute,“ rief der Tischler, „thun wir zusammen, machen wir eine Tour in’s Gesäuse!“
Das zündete. Eisenbeschlagene Schuhe, Bergstöcke, Weinflaschen, Würste, Schinken, Spielkarten — eine „Hetz“ muß es geben! — Mägdlein wollten sie auch werben zur Partie. Der Binder und der Pfleger und der Schulmeisterssohn und Andere — ihrer neun Stücke sind’s, die mit Hall und Schall und hellem Uebermuth, wie’s Touristen ansteht, den Eisenbahnzug besteigen.
Das herbstliche Wetter ist heiter, rein, kühl — ganz gemacht für Gebirgstouren. Die daheim bleiben müssen, denken in Wehmuth an die lustige Reise, und beim Wirth „Zum grünen Baum“ sitzen sie Abends, und folgen im Geiste ihren touristischen Mitbürgern auf die höchsten Berge und in die lauschigsten Winkel der Sennhütten.
Am dritten Tage kehrte die Gesellschaft zurück. Sie war etwas angegriffen, stark ermüdet, und die Meisten hatten Schürfe, blaue Beulen an Gesicht und Händen und Risse in den Kleidern. Trotzdem wurden sie sofort in’s Wirthshaus gezogen, wo sie wacker aßen und tranken, denn — sagten sie — die Wirthshäuser hätten sie unterwegs nur von auswendig gesehen. Naturgenuß sei ihre Hauptsache gewesen! — Hierauf sollten sie erzählen.
„Ja!“ sagte der Binder gedehnt, „erzählen! — Das muß Einer selber gesehen haben — nicht wahr?“
Seine Genossen bestätigten es.
„Diese Berge!“ rief der Weber, „diese Hochöfen in Admont, na!“
„Ihr seid doch auch im Stift gewesen?“
„Im Eisenerzerstift, jawohl! So eine Kirche! Nix Zweit’s giebt’s nit!“
„Und auf dem Reichenstein?“
„Da schaut’s grad’ einmal her!“ versetzte der Schulmeisterssohn, und wies seine zerschundenen Hände vor; „aufwärts, da ging’s, bis wir in’s Edelweiß kamen. Bis an die Knöchel, sag’ ich Euch, geht Einem das Edelweiß, just zum Niedermäh’n, auf Ehr’! Dann, wie wir zum Eis gekommen sind zu den Gletschern, nicht wahr zu den Gletschern?“ wendete er sich an die Genossen.
„Na, ich dank’!“ stimmten diese bei, „das sind ein bißl Gletscher!“
„Und der Sonnenaufgang“, sagte der Pfleger, „lohnend, höchst lohnend! — Und, in dem Gebirg ist Euch eine Sonne! — ’s ist ein Gaudium gewesen. Aber halt das Herabsteigen! Sind wir Euch nicht schnurgerade niedergefahren über die Steinleuten! So gleich etliche zehntausend Fuß! Gerad’ ein Sauser ist’s gewesen, sind wir herunten auf dem Boden gestanden.“
„Nu,“ fügte der Schulmeisterssohn bei, „und da haben wir uns so zerschunden.“
„Und Deine blauen Flecken im Gesichte?“ fragte man den Sattler.
„Ja, dem seine blauen Flecken,“ rief der Schulmeisterische; „nicht um fünfzig Gulden giebst Du sie her, Sattler, gelt? — Hat Euch der Sakra nicht mit einem Steinbock gerauft? Na, und ob!“
Die Leute schlugen über solch unerhörte Abenteuer die Hände zusammen.
„Aber ein Sträußel Edelweiß oder Speik hättet Ihr doch mitbringen sollen!“
„Ihr schwätzet beim Ofen, wie Ihr’s versteht. Jeder hat seinen Hut voll Edelweiß gehabt, das versteht sich. Und wie der Kampf mit den drei Lämmergeiern nicht ist, so bringen wir die schönsten Buschen heim.“
„Kampf mit den Lämmergeiern?“ fragten die Leute, und brachten den Mund nicht mehr zu.
„Haar’ lassen hätten wir können! Sind noch froh gewesen, daß wir heil davon gekommen; die Alpenblumen und die paar Hüte sind zu ersetzen.“
„Herr Gott, das war eine Tour!“
— Sie waren die bewunderten Helden des Städtchens.
Einige Zeit darauf kam an den Vorstand von Abelsberg folgendes Schreiben:
„Tauern, den 30./9. 1875.
Werther Herr Bürgermeister!
Zu meinem Bedauern muß ich Sie mit einer Angelegenheit belästigen. Vor etwa acht Tagen kam eine heitere Gesellschaft von neun Personen in mein Haus, die, wie sie vorgab, aus Abelsberg sei. Die Herrschaften schienen eine Gebirgspartie vorgehabt zu haben, blieben jedoch einen und einen halben Tag und zwei Nächte bei mir und ließen sich zu meinem Vergnügen Küche und Keller wohl munden. Wie es bei solchen Gelegenheiten schon zu geschehen pflegt, wurden sie lustig, sangen, tanzten und unterhielten sich mit den Weibsleuten der Nachbarschaft, die sie zum Tanze beigezogen hatten. Auch die Burschen der Umgegend, Holzknechte zumeist, fanden sich ein; da entspann sich zwischen diesen und den werthen Herren Abelsbergern ein Streit, der Weibsbilder wegen; sie wurden leider handgemein, wobei zu meinem großen Bedauern die Abelsberger sehr den[S. 190] Kürzeren zogen. Die Herrschaften waren gezwungen, das Weite zu suchen und dürften mit einigen diesbezüglichen Spuren nach Hause gekommen sein. — Ganz erklärlich ist es unter solchen Umständen, daß in der Eile vergessen wurde, die kleine Gasthausrechnung zu begleichen, die Euer Wohlgeboren zu unterbreiten ich hiemit die Ehre habe:
| Zwei Abendessen |
für 9 Personen
|
23
|
fl.
|
70
|
kr.
|
| Ein Mittagsessen |
detto
|
15
|
„
|
98
|
„
|
| Zwei Frühstück |
detto
|
8
|
„
|
10
|
„
|
| Wein für 9 Personen |
26
|
„
|
48
|
„
|
|
| Dem Stubenmädchen für Depurgationen |
—
|
„
|
80
|
„
|
|
|
Für eine Weinflasche à 40 kr., und drei Fensterscheiben à 30 kr., zusammen |
1
|
„
|
30
|
„
|
|
|
Summa
|
76
|
fl.
|
36
|
kr.
|
|
Um gefällige Notiznahme bittet
achtungsvoll ergebenst
Peter Streicher, Gasthausbesitzer in Tauern.“
Der Burgermeister veranstaltete zu Ehren der wackeren Touristen eine Nachfeier beim „Grünen Baum“. Nachdem die Gefeierten neuerdings und stets mit mehr Nachdruck und in helleren Farben ihre seltenen Abenteuer an der sausenden Enns und bei der Besteigung des „eilftausend Fuß hohen Gletschers Reichenstein“ dargethan hatten, sagte der Burgermeister, er sei von der Gemeinde beauftragt, den kühnen Mitbürgern ein Ehrendiplom hiermit zu überreichen — und las feierlichen Tones die Gasthausrechnung des Peter Streicher vor.
Thomas Treibaus ist ein ehrsamer Viehhändler aus Abelsberg. Er hat sein Lebtag viele Ochsen gemästet und ist auch selbst dabei fett geworden. Indeß ließ er sich nicht bethören von den Reichthümern und Rindern dieser Erde, sein Sinn stand nach Höherem. So hoch seine Ochsen auch die Hörner tragen mochten, wenn sie vor dem vollen Barren standen, so hoch die Kälber auch ihre kleinen Schweife schwangen, wenn sie lustig und flink über die Wiese hüpften — sein Sinn stand höher.
Da hatte er einmal — es war zur goldenen Zeit, als er, ein Knabe noch, die Kuheuter auf der Weide aussaugte, wenn ihm sein Dienstherr zur Strafe für unachtsames Hüten das Mittagmahl vorenthielt — hatte er also einmal durch einen alten Hausirer die Sage von dem feuerspeienden Berge[1] gehört. Und diese Sage hat einen Funken geworfen in sein Gemüth, hat — so zu sagen — sein bißchen schlummerndes Ideal entzündet, und das glühte und brannte nun Jahre und Jahre in den Tiefen seines Herzens, doch ohne daß es Lava spie.
Nebstbei, daß Thomas Treibaus Kälber trieb, Kühe handelte und Ochsen mästete, ging das Dichten und Trachten seiner sehnenden Seele dahin, einmal den feuerspeienden Berg zu sehen und — Ehre seinem Mannesmuthe! — zu besteigen.
Und das sollte der Glanz- und Höhepunkt seines vielbedeutenden Lebens sein, das sollte ihm Ruhm sein im Lande und für späte Zeiten.
Thomas hatte schon Bilder gesehen von dem berühmten Berg, und Guckkastenmänner kamen zu Zeiten in die Gegend,[S. 192] die hatten das Ungeheuer in einem Kästlein, ganz wie es leibte und lebte und spie. Dieser Berg mit seinem glühenden Rachen ist nicht wie der allfort funkensprühende Schornstein der Schmiede im Thale, nicht wie ein wildausbrechender Kohlenmeiler! Dieser Berg ist der Hölle Thor und Schlot; wenn der Teufel eine arme Seele holt, so flattert er mit seinen ungeheueren, kohlschwarzen Fledermausflügeln da hinein! — Das weckte Treibaus’ Sehnsucht erst auf, denn was ein rechter Viehhändler ist, darf sich vor Hölle und Teufel nicht fürchten.
Und als nach und nach die gute Zeit gekommen war, da sein Bäuchlein groß, seine Aeuglein klein, sein Näschen roth und sein Beutel schwer geworden, da gedieh sein Lebenswunsch: „weit und tief in’s Wälschland hinein!“ zur Reife. Als er hierauf, dem Ideale zuwallend, durch Tirol kam und durch die Lombardei, war es zum erstenmal, daß er die Leute nicht gut verstand. Auf der ganzen Reise interessirte ihn nichts, als der schiefe Thurm zu Pisa, vor dem er drei Stunden lang mit offenem Munde stand, und die fontana trevi in Rom, wo versteinerte Ungeheuer zwar nicht Feuer, aber Wasser spieen.
Dann zog er tiefer nach Süden. Er fühlte es wohl, wie es von Tag zu Tag heißer wurde, er nahte — dem feuerspeienden Berge.
Weiteres ist von dem Vorleben des wackeren Thomas Treibaus nicht bekannt. —
Als ich an einem Septemberabende 1872 am Hafen von Neapel auf und ab schlenderte, um mir das seltsame Treiben dieses merkwürdigen Volkes zu betrachten, sah ich einen wohlbeleibten, aber behenden Mann in Knielederhose und grünberandeter Lodenjacke mit einem Cicerone lebhafte Gesten[S. 193] machen. Ich sah so von Weitem hin, ich sah, wie der Mann keck die Füße auseinander stemmte und mit den Händen zuweilen auf sein wohlgepflegtes Bäuchlein schlug. Trotz des unabsehbar breiten Strohhutes, der das völlig kreisrunde Gesicht des Mannes halb bedeckte, und trotz der nackten Waden über den hohen Bundschuhen, sagte ich nachdrücklich zu mir selbst: „Ich will doch ein Lump sein, wenn das nicht ein Abelsberger Viehhändler ist!“
Ich lauerte noch ein wenig. Da hub er behäbig an, seine Aermel zu zerren, zog den Rock aus, daß er in seinen weiten Hemdärmeln, mit seiner schwarzen Weste, die eine Reihe mächtiger Silberknöpfe und eine schwere, thalerbehangene Uhrkette trug, und mit einem breiten, weiß ausgenähten Ledergurte dastand. Nun war für mich kein Zweifel mehr — ein Landsmann. — Zu allem Ueberflusse hörte ich ihn noch brummen: „A Viehhitz’ das, und bis in die spat Nacht eini!“ Darauf sehr laut und immer mit den Händen fuchtelnd zum braunen, verschmitzt lächelnden Italiener: „Na, so versteht’s denn wahrhafti nit Deutsch? Auffi, da auffi möcht’ ih!“ Er deutete gegen den Vesuv, über dessen Spitze ein leichter Rauch zog. Ein Redeschwall brach los aus dem Munde des Cicerone, aber ein wälscher Redeschwall; und mein Landsmann schüttelte das Haupt und wollte weiter trippeln.
Da rief ich, auf ihn zueilend: „Vetter, grüß Gott!“
Zuerst war er einen Augenblick verdutzt, dann aber schrie er, die Hände ausbreitend: „Jessas, Jessas, das — ja, das ist ja wieder einmal an ordentlicher Mensch — a Landsmann! — Freili, freili — na, ih trau mir’s z’sagen: o fett’s Paar Ochsen kunnt mir die Freud’ nit machen! — Grüß Ihna Gott! Sag’n S’, Landsmann, sein S’ a z’weg’n dem da kemma?“ Er deutete gegen den Vesuv.
Das war das Finden und Binden — er schwur mir ewige Freundschaft. Wir gingen in eine Osterie, dort erzählte er mir seine Lebensgeschichte und sein höheres Streben nach dem feuerspeienden Berg, wie er sich wundere, daß dieser weltberühmte Berg grün und grau wie alle anderen Berge still dastehe, nicht ringsum glühe und kaum ein Rauchwölklein habe — wie es sich schier nicht des weiten Weges lohne, wie er den Berg aber trotz alledem morgen mit dem Frühesten zu besteigen gedenke.
Ich hatte auch dieselbe Absicht, und so beschlossen wir, zusammen die Partie auf den Vesuv zu machen.
Ich habe nie noch einen glücklicheren Menschen gesehen, als meinen Viehhändler an demselben Abend.
„Heut’ zahl’ ich Alles!“ rief er wiederholt, seine schweren Fäuste mit den Hemdärmeln auf den Tisch schlagend; und wie sein Antlitz so lachte und leuchtete, da war es Vollmond in der Weinstube.
Am andern Morgen — es lag noch Finsterniß über den Wassern — war es meines neuen Reisegefährten Erstes, daß er mir zeigte, wie er seinen rothen Regen- und Sonnenschirm praktisch zu einem Bergstock eingerichtet habe. Dann sagte er ernst und ergriffen: „Also heute! Heute! Und das Paraplui da heb’ ich mir auf zum ewigen Andenken!“ Der gute Mann fühlte sich verpflichtet, angesichts seines großen Zieles möglichst hochdeutsch zu sprechen.
Wir fuhren bis zum nächsten Städtchen Resina. Dort nahmen wir zwei graue Esel und einen braunen Führer und begannen die Wanderung aufwärts.
„Vor Banditen fürcht’ ich mich gar nicht, gelt?“ sagte Thomas, als er so neben mir auf dem Esel wackelte. Er wollte fragen, ob er wohl Recht habe, daß er sich nicht fürchtete.
„Und wenn Einer kommt, meiner Seel’, ich schlag’ zu!“ er hob seinen Regenschirm, setzte aber beruhigt bei: „Na, so leicht kann nichts geschehen, es sind unser Fünfe.“
Mein Esel warf ihm einen dankbaren Blick zu.
Wir ritten zwischen berankten Gartenmauern hin und durch ein Wäldchen von Obstbäumen und an Weingärten entlang. Der Morgen graute und die schwarze Masse des Berges vor uns stach deutlicher von dem Himmel ab. Wir bogen nördlich und sahen hinaus über das Meer, auf welchem in der Dämmerung wie vor der Schöpfung Nebel und Wasser noch nicht gesondert schien. Da kamen wir über braune, schrollige Lavaströme — hier stieg mein Thomas zum erstenmale ab, befühlte den rauhen, schründigen Boden und schüttelte den Kopf.
„Wie könnten das schön fruchtbare Auen sein,“ sagte ich, „aber der Vesuv!“
„Ueberhaupt,“ entgegnete mein Landsmann, „das italienisch Land ist nicht das, was der Leut’ Reden daraus macht. Was, südlicher Himmel! Der ist auf unseren Bergen just so blau und rein! Die Sonne hier scheint gar nicht heller, aber heißer wie daheim, und das — halt, Eselein, schmeiß mich nicht ab! ’s ist aber auch ein verdrumpfter Weg in diesem italienischen Paradies, ’s giebt überall so viel Steine, wie bei uns daheim, und Heiden und Sümpfe und Nebel. Wein wär’ schon recht, wenn er nicht warm wär’; die Feigen wären süß, wenn man sich damit nicht den Magen verderben thät. Und sonst auch, im Brot ist kein Salz, in der Suppe kein Schmalz, und Knödel ist schon gar keins zu sehen. Jetzt, frag’ ich, was ist das für ein Land?“
Mein Thomas war bei diesen Worten so böse geworden, daß er seinem Esel Eins in die Weichen gab.
„Und doch,“ versetzte ich seiner Rede, „soll Italien das Wunderland sein, wo ein offenes Herz und ein offener Sinn auch das schönste Ideal durch eine noch schönere Wirklichkeit übertroffen findet.“
In diesem Augenblick strauchelte mein Esel, daß ich schier über die Lavaschollen gepurzelt wäre, und das Gespräch war unterbrochen.
Es war licht geworden, unten reihten sich Städte an Ruinen, Landhäuser an Mauertrümmer, Gärten an Schuttlehnen. Das Meer lag in matter Bläue, dort und da ein weißes Segel, wie ein vom Himmel gefallenes Sternchen. Ueber Neapel zog sich ein Nebelstreifen weit hinaus auf die hohe See.
Als wir zur Einsiedelei kamen, hätte mein Thomas für sein Leben gern den Einsiedler gesehen. Aber der Gute hatte sich wahrscheinlich des Abends zuvor zu lange kasteit, und so ruhte er nun noch in den Fed—, das heißt auf der härenen Decke.
Im Wirthshause des Observatoriums angelangt, genossen wir Wein und Trauben und unser Führer erzählte uns von den Zerstörungen, welche der letzte Ausbruch des Vesuv in der Umgegend angerichtet hatte. Unter den zahlreichen Verunglückten war auch sein Bruder, welcher auf der Wallfahrt nach St. Giuseppe von dem Unheil erreicht wurde.
„Und Vieher sind doch keine zu Grunde gegangen?“ fragte Treibaus theilnehmend. Zum Glücke hatte ihn der Bursche nicht verstanden.
Die Esel ließen wir beim Observatorium. Der Führer begann seine mitgetragenen Stricke in Bereitschaft zu halten, und es kam eine äußerst schwierige Fußwanderung den Kegel hinan. Glatt und schroffig und schründig ist die Lava, und[S. 197] dann wieder wollen die Füße versinken in schwarzen Aschenstaub. Wir waren auf der Nordwestseite, folglich im Schatten, obwohl die ganze herrliche Gegend unten lange schon im reinen Sonnenlichte lag. Der Himmel war tiefblau, aber je näher wir der Höhe kamen, desto mehr umhüllte ihn eine dunstige, röthliche Atmosphäre und wir rochen Schwefel. Wir sahen, wie der Rauch da oben emporqualmte, wie er immer röther und glühender wurde, und wie — „Jesus Maria!“ rief Thomas, „g’rad’ jetzt hebt er an zu speien!“ und wollte abwärts eilen.
Der Sonnenball stieg empor just über dem Krater durch den wirbelnden Rauch, roth und sprühend, wie ein Klumpen Gluth. Der Führer drängte, half uns weiter und bald waren wir zu Rande. Zu Rande an den Kratern, den dampfenden Schründen und Klüften, bunt in hellen Farben, wie Salamander, tief dröhnend zuweilen, grollend, ächzend, wie ein Leidenschaftskampf im Herzen, wie ein böses Gewissen — der feuerspeiende Berg, der Hölle Thor und Schlot.
Mein erschreckter Blick wendete sich zurück zu dem milden, sonnigen Lächeln der Welt. Nun lag Neapels glitzernder Halbmond in Reinheit da. Rückwärts die grüne, mit Städten und Villen besäete Ebene von Casoria; dann zogen sich hin die milden, sammtähnlichen Höhen von Camaldoli, die schroffen Berge der Inseln Procida und Ischia — dann die unabsehbare Meeresweite, an Bläue und Klarheit wetteifernd mit dem Himmel. O, das Meer mit seinem zarten Sonnengefunkel in den Wellen, mit dem lieblichen Spiel der winzigen Segel und Masten, mit seinem Horizont, so weit und unerreicht, den nur die Sehnsucht mißt!
Weiter links die dunkeln Berge von Capri und die lichten Felswände von Sorento, und der dämmerige Gebirgs[S. 198]zug des Monte Albino, und das liebliche Sarnothal mit der röthlichen Trümmerstätte Pompejis.
Uns gegenüber aber, im Nordosten, ragen in einem wilden Halbkessel die kahlen, todten Wände des eingestürzten Kraters Somma, eine Ruine der Hölle, — und in weiter Ferne die Höhen des Monte Matese und Vergine.
Mein Landsmann sah durch unser Fernrohr eine Weile unverwandt in die Ebene hinab und machte dabei ein äußerst vergnügtes Gesicht. „Recht weichleibig,“ murmelte er, „ganz semmelfärbig, man meint, es müßt Mürzthaler Race sein!“
Eine Heerde Rinder entzückte ihn.
Ich nahm ihn am Arm und führte ihn unter Leitung des Cicerone in den Wildnissen der Vesuvkrone umher.
Man kann nicht hingehen und hinabgucken in den Krater, wie in eine Krautgrube; Hitze, Schwefeldampf und Rauch drohen den Kühnen zu ersticken. Da dampfende Schründe, heiße Lavaklöße und Schollen; dort hat sich die Erde gespalten und Gluthschein röthet die Wände, aber wuchtige Blöcke sind darüber hingeworfen. Und wer sich darüber hinwagt zum Krater, und Rauch und Dunst lassen ihn einen Blick hinabthun, der prallt bleichen Gesichts zurück und stammelt: „Der Mensch versuche die Götter nicht!“ Schroff stürzen die schwarzen oder buntfarbigen, schründigen Wände nach innen ab und der Trichter theilt sich unter phantastischen Gebilden in mehrere Krater, deren unergründliche Tiefen nicht einmal den Ton zurückgeben von einem Stein, den man in sie schleudert. Freilich ist da unten ein ewiges Dröhnen und Donnern, oft wild, wie das Knurren des Löwen, dann wieder bang und schwer, wie das Röcheln eines Sterbenden.
Aus allen Spalten und Klüften dringt der Rauch. Dort in der Schramme sehe ich gar helle Lava glühen; sehe ich[S. 199] die Essen der Cyklopen und höre ich ihr Pochen auf dem Amboß der Urgefelse? — Wie tief und gewaltig, Du schrecklicher Hephästos, ist Deine Werkstatt!
Ein mächtiges Donnern — der Führer riß uns mit großen Schritten zurück. Da zitterte unter uns der Boden und Asche und Steine flogen aus den Schlünden.
„Geht’s weiter, ist das eine schauderhafte Sach’!“ sagte Thomas kleinlaut, „jetzt fahr’ ich gleich wieder ab.“
Doch der Führer hielt ihn zurück, zog ein paar Eier aus der Tasche, legte sie in eine Spalte, und reichte sie uns nach ein paar Minuten hartgesotten als Gabelfrühstück. Das brachte meinem Landsmann wieder das Selbstvertrauen. Eier am Herde des Vesuv gekocht hat man nicht zu jeder Vormittagsjause! Die Schalen that er sorglich in ein Papier und steckte sie in die Tasche — zum ewigen Andenken.
Bald darauf machten wir die Entdeckung, daß unsere Schuhsohlen verkohlt waren. „Schau, schau,“ sagte Thomas, „das wundert mich, die meinen sind vom Pinzgauerschlag.“ In seinen rothen Regenschirm hatte ein glühendes Aschenstäubchen ein Loch gefressen. „Bravo!“ rief Thomas aus, „auch das ist ein Andenken an den feuerspeienden Berg für meine Kinder und Kindeskinder!“
„Ah,“ entgegnete ich, „das hat mir der Vetter gar nicht erzählt, daß er verheiratet —“
„Je nu, das heißt“ — er trocknete sich den Schweiß von dem Vollmond — „na, das ist schon eine barbarische Hitz, da heroben!“ Von seiner Familie weiter keine Rede mehr.
Ich hätte den Führer und meinen guten Landsmann zur Rückkehr schier am liebsten vorausziehen lassen, um mich allein auf einen Lavablock zu setzen und am Brandopferaltar der Natur Gottes Herrlichkeit in stiller Seele zu feiern.
Da kam mein Gefährte: „Na, Sie, versetzen thu’ ich Ihna nit!“ Und noch volksthümlicher: „Hiazt hab’n ma’s g’seh’n, und hiazt geh’n ma hoam.“
Ich glaube, er hat es buchstäblich ausgeführt und ist von Neapel geradewegs in sein Abelsberg gefahren, um dort durch seine Eierschalen und den verbrannten Regenschirm beredtes Zeugniß zu geben von dem „feuerspeienden Berg“ und als kühner Besteiger desselben unvergänglichen Ruhm zu ernten.
[1] So wird im Volksmund der Vesuv genannt.
Es hat eine Zeit gegeben, da die Ober-Abelsberger Bauern über alle Maßen gescheit gewesen sind. Dann später kam die Schule, und die hat das gute Volk recht heruntergebracht. Da haben sie die Jahre her so höllisch viel gelernt, daß sie jetzt nachgerade gar nichts mehr wissen.
Oder erkennt es heute in der Sylvesternacht Einer, was für ein Jahr kommen wird? Ich glaube nicht. Die alten Ober-Abelsberger hingegen haben es aus den Zeichen erkannt, denn dazumal hat man an die Zeichen noch geglaubt und weil man daran geglaubt hat, so sind sie auch zugetroffen. Heute geschieht kein Wunder mehr, weil sich die Leute nur darüber lustig machen würden.
Einstmals hat man die Offenbarungen geehrt; und es ist nicht etwa, daß ich den schönen Namen erdichte, er hat wirklich so geheißen, der Eberhard Weisheit. Und hat den Namen verdient, denn er war der weiseste Bauer im Ober-Abelsberger Gau.
Der Eberhard Weisheit hat seiner Väter ehrwürdige Sitten stets geachtet und gehalten, hat in der Christnacht[S. 201] seine Ochsen mit Weihrauch beräuchert, hat hinter den verdächtig aussehenden Bettelleuten Abspülwasser auf den Weg gießen lassen, daß das Gesindel keine böse Macht über sein Haus haben konnte, und so ist er in der Sylvesternacht auch auf den „Kreuzweg“ gegangen, um unter Gebet und frommen Betrachtungen zu ersehen, ob ein armes oder ein reiches Jahr im Anzuge sei.
Es ist arg genug, daß es heutzutage Leser giebt, denen man die Sache des Langen und Breiten erklären soll und noch froh sein muß, wenn sie überhaupt dazu stillhalten.
Wenn man in der Sylvesternacht auf einen Kreuzweg geht, das heißt, auf einen Punkt, wo sich mehrere Wege kreuzen, so kann Einem auf diesem Kreuzwege ein Mann begegnen. Es mag ein weltfremder Mann sein, er mag auch in der Gestalt eines guten Bekannten erscheinen. Man soll ihm nicht ausweichen und soll ihm auch nicht in den Weg treten. Man soll nicht grübeln. Wenn dieser Mann leicht und leer einherschreitet, dann mag man still nach Hause gehen und den Riemen neunmal um’s Geldsäcklein winden, denn es kommt ein schlechtes, armes Jahr. Wenn hingegen der Mann auf dem Kreuzwege unter schwerer Last daher keucht, dann soll man lustig in’s nächste Wirthshaus eilen und sich selbst zur nachtschlafenden Stund was Gutes anthun, wohl auch Anderen was zukommen lassen, denn es wird Alles gut, es wird sehr gut, es kommt ein reiches Jahr.
Also war’s in einer solchen Nacht, daß der Eberhard Weisheit gegen die zwölfte Stunde hinaus auf die Steinheide ging, wo ein Kreuzweg war und wo auch richtig ein hölzernes Kreuz stand, bei dem es nicht selten gespensterte. Es war eine Nacht, in der man nicht gern einen Hund vor die Thür jagte; er war aber kein Hund, er war ein E—[S. 202] Eberhard Weisheit, und dieses Geschlecht hat sich von jeher nicht viel aus Schnee und Sturm gemacht.
Am Kreuze stand er still und ließ sich einmal recht anstöbern.
Es war, als ob auf jedem Wege, wie sie hier aus allen vier Weltgegenden zusammengingen, ein anderes Wetter heranbrauste und als ob Wind und Kälte und Schnee und Eis gerade den Kreuzweg zu ihrem Turnierplatz gewählt hätten. — Weichlinge liegen in den Kissen vergraben und morgen, wenn sie aufstehen, sagen sie: Ein neues Jahr — was wird es bringen? und schauen dumm drein. Der Eberhard wird’s wissen und wird still sein.
Siehe — dort kommt schon was! — Ein schwarzer Punkt im Gestöber, langsam bewegt er sich, doch kommt er näher und näher. ’s ist ein schwerfälliges Wesen, ein Mann, ein unter großer Last tief gebeugter Mann. Keuchend wankt er unter einer Masse, die sich schwer um seine Schultern schmiegt, und wankt vorüber.
Der Eberhard Weisheit hatte anfangs ein Kreuz über Gesicht und Brust geschlagen, hatte dann dieser Erscheinung mit Wohlgefallen zugesehen, und nun sie wieder verschwunden war, ging er ziellos im Schnee hin und her und entschied sich endlich für das Bachwirthshaus. Denn dort pflegten Bergknappen von Seewald späte Zecher abzugeben. Als er hinkam, sah er vor dem Hause am Troge, wo die Fuhrleute ihre Pferde zu füttern pflegten, den Mann vom Kreuzweg stehen und seine Last auf den Trog stützen. Der Eberhard Weisheit trat in die Stube.
„Noch spät auf?“ sagte der Wirth.
„Schon früh auf!“ antwortete der Eberhard.
„So wünsch’ ich glückselig Neujahr!“
„Hat sich schon angemeldet. Bring’ mir eine Maß auf einmal, Wirth, und da draußen vor dem Haus rastet Einer, dem schick auch einen Krug voll hinaus. Er hat’s wohl verdient, und ich bin der Zahler.“
Wenn er der Zahler ist, so wird er an seinem Tisch nicht allein sitzen bleiben müssen. Lustig geht’s her und draußen trinkt Einer den Krug aus und denkt: Das neue Jahr hebt nicht schlecht an, der Wein hat mich wieder rechtschaffen stark gemacht und jetzt, meine liebe Sau, jetzt gehen wir’s wieder an.
Lud frisch auf und hastete weiter.
Am nächsten Morgen, als der Eberhard Weisheit endlich nach Hause kam, trat ihm nichts Erfreuliches entgegen. Die Knechte stöberten in der Umgebung des Hauses herum und suchten im Schnee nach Spuren; die Hausmutter weinte, und schrie: „Meine Alte! ’s ist noch keine so feist gewesen, seit ich im Haus bin, und just die muß er mir holen. Aber wart’, wart’, Dieb, wenn ich Dich unter die Finger krieg’! Ich will Dir sagen, was im Weisheithof eine Sau kostet.“
Da fragte der Eberhard etwas befangen und unsicher, was denn los sei?
„Ja!“ rief das Weib, „mit Dir habe ich auch was zu reden! Was hast Du in den Nächten außer Haus herumzustromern? Aus dem Wirthshaus kommst, merk’ ich! So! da hast einen Denkzettel dafür! Und jetzt laß Dir sagen, daß sie uns heut’ über Nacht die beste Sau im Stall gestochen und fortgeschleppt haben. Die Spur geht über die Steinheide gegen den Kreuzweg und weiter hin hat sie der Schnee verweht. Was willst jetzt, wenn der Fasching kommt, für ein Fleisch essen, möcht’ ich wissen! Wo wirst den Speck nehmen! Na, ich sag’s: das neue Jahr hebt schön an!“
Jetzt hat der Eberhard sich einen schlichten, zweisilbigen Namen gegeben, hat sich vor die Stirne geschlagen und hat weiter kein Wort mehr gesprochen. Es ist dazumal nicht laut geworden, daß der Eberhard Weisheit in jener Sylvesternacht am Kreuzwege seinen Schweinsdieb für das reiche Jahr gehalten hatte und ihn beim Bachwirth mit Wein tractiren ließ. Aber, wenn seither die Rede ist vom Kreuzweg und was man auf demselben für Offenbarungen haben könne, schlägt sich der Eberhard sachte seitab. Nach wie vor hält er der Väter Glauben in Ehren, bleibt in der Sylvesternacht aber hübsch daheim und sperrt den Schweinstall zu.
Ein Junge aus Ober-Abelsberg kam in die Hauptstadt, um zu studiren. Unter seinen Professoren hatte der treuherzige Knabe mehrere Gönner, wovon ihm Einer eines Tages für sich und einen Freund zwei Eintrittskarten schenkte. Die Eintrittskarten galten für eine philosophische Vorlesung, welche der betreffende Professor in einem öffentlichen Saale halten sollte. Der junge Student aus dem Dorfe freute sich schon den ganzen Tag auf den Abend der Vorlesung, und sein Kummer war nur der, daß er unter seinen wenigen Bekannten keinen Genossen fand, welcher die zweite Eintrittskarte angenommen hätte. Die Studenten wollten den Abend lieber im Freien zubringen, als den Herrn Professor anhören, dessen Stimme sie ohnehin recht gut kannten.
Als die Stunde kam, ging der wißbegierige Junge nach dem Saale der Vorlesung und war betrübt, daß der Schatz, den er in der Tasche trug, zum Theile unverwerthet bleiben sollte. Da sah er an der Gassenecke einen schlichten,[S. 205] anspruchslosen Mann stehen, dem Anzuge nach vielleicht ein Bahnschaffner oder so etwas. Ah, dachte sich der kleine Student, dem kann ich einen Gefallen thun, der ist gewiß froh, wenn er meinen Herrn Professor einmal hört.
„He, Vetter!“ rief er dem Manne zu, „wenn Sie was profitiren wollen, so kommen Sie mit!“
„Ich bitte!“ entgegnete der Andere und ging mit dem Jungen. Dieser gab an der Pforte die zwei Karten ab, die Beiden traten in den Saal. Die Vorlesung begann. Der Student hörte mit Begeisterung zu, in der Hoffnung, all’ die schönen Worte, die er heute anhörte, dereinst in den höheren Schulen auch zu verstehen. Neben ihm stand bewegungslos wie ein Baum der Mann von der Straßenecke. — Das ist ein dankbarer Mensch, dachte sich der Student. — Der Kleine wird vielleicht einen Schützer im Gedränge, einen Begleiter auf dem Heimweg haben wollen, dachte der Andere.
Nach der Vorlesung sagte der Junge zu seinem Manne: „Nichts danken, mich freut’s, wenn’s gefallen hat. Behüt’ Gott!“ Und er wollte im Trosse davon.
„Ich bitte,“ warf der Andere rasch ein und hielt den Jungen am Arme fest, „ich bekomme neunzig Kreuzer. Ja, neunzig; für die Stunde ist des Nachts sechzig, und anderthalb Stunden bin ich zu Diensten gestanden.“
Der unglückliche, unerfahrene Bursche aus dem Dorfe hatte einen Dienstmann mit in die philosophische Vorlesung gezogen. Geld hatte er keines im Sack. Der Auftritt wurde laut; der Junge war sprachlos vor Schreck und Aerger. Der Professor kam und that, was vielleicht an seiner Stelle noch Keiner gethan hatte: er entschädigte Einem seiner Zuhörer mit neunzig Kreuzern die in der Vorlesung verlorne Zeit.
Die Gallbeißerin zu Abelsberg war mit ihrem ersten Manne bereits fertig geworden, hatte von ihm ein zwei Stock hohes Haus geerbt, und die Kleider. Was kann eine Witwe mit den Kleidern ihres Seligen machen? Sie kann mit den Kleidern ihres Seligen nichts Vernünftigeres machen, als wieder einen Unseligen hineinstecken. Ihren ersten Gatten hatte sie aus Liebe geheiratet, aus Liebe zu seinem zweistöckigen Hause. Nun ist es aber nicht wahr, was Poeten sagen, nämlich, daß der Mensch nur einmal liebe. Im nachbarlichen Städtchen Neubrunn lebte ein Kaminfeger, der Witwer war und nach einer Frau suchte, die ihm bisweilen den Kopf wasche. Dieser Mann hatte sich ein drei Stock hohes Haus zusammengefegt; was Wunder denn, daß er die Liebe der Gallbeißerin erregte.
Der Bäckermeister zu Neubrunn, ein guter Bekannter der Gallbeißerin und Freund des Kaminfegers, übernahm die Vermittlung und drückte seine Freude darüber aus, daß hier zwei Häuser zusammenkämen, die übereinandergestellt fünf Stock gäben! Bald ging die Verlobung vor sich, zu welcher der Kaminfeger mit musterhafter Sorgfalt allen Ruß von seinem Gesichte wusch, um darzuthun, daß er noch fein und glatt und nicht alt sei, und zu welcher die Gallbeißerin ihr Gesicht mit etwas verdünntem Karmin anstrich, um darzuthun, daß sie fein und roth und noch jung sei.
Allsobald nach der Verlobung begannen die Vorbereitungen zur Hochzeit, wozu der brave Bäckermeister zu Neubrunn sein Möglichstes that. Die Gallbeißerin ließ sich ein den fünf Etagen entsprechendes Brautkleid verfertigen; der Bräutigam aber holte sich aus irgend einem hohen Schornsteine eine Lungenentzündung herab und legte sich damit zu[S. 207] Bette. Mittlerweile war das Brautpaar auf den Kanzeln zu Abelsberg und Neubrunn feierlichst verkündet worden; zu Neubrunn nach dem dritten Aufgebote hatten die Kirchenmusikanten sogar mit Trompeten und Pauken einen schallenden „Tusch“ aufgeführt, weil der Bräutigam seinerzeit auf dem Chore mitmusicirt hatte. Der Arzt jedoch war der Ansicht, daß die Hochzeit zu verschieben sei, erstens, weil der Bräutigam noch nicht gesund, und zweitens, weil er todtkrank wäre. Man stelle sich den Schmerz der Braut vor, als sie solchermaßen das dreistöckige Haus in Gefahr sah. Sie beschwor den Arzt, Alles aufzubieten, um zu retten, was zu retten sei, und sie besprach sich mit dem Bäckermeister, ob nicht der Ehevertrag sofort könnte ausgefertigt werden? was der Meister bejahte und ein Uebereinkommen auf Gütergemeinschaft sehr befürwortete. Es geschah, aber der Notar — wie solche Leute schon in Allem auf das Umständliche und Verwickelte hinausspielen — schrieb unter den Ehevertrag als letzte Klausel: „Dieser Contract tritt mit der kirchlichen Trauung obgenannten Paares in Giltigkeit.“
Der Tag der Trauung war da, der hochzeitliche Festsaal, Küche und Keller waren bereit, aber der Arzt erklärte die Trauung in der Kirche für unmöglich, da eingetretenen Symptomen nach der Bräutigam nur wenige Stunden mehr zu leben habe.
„Ist denn nicht ein Stock mehr zu retten!“ wimmerte die Braut und sank auf den Lehnstuhl. Bald hernach stürzte sie hin an’s Bett und rief: „Mein Geliebter, mein Einziger, ich will Dein Weib oder Deine Witwe sein. Noch in dieser Stunde soll uns der Pfarrer trauen!“ Der Kranke faßte gerührt ihre Hand und dankte für ihre Lieb’ und Treue. Aber er wisse nicht, ob er das Opfer annehmen dürfe.
Es sei kein Opfer! rief sie, und auch der Bäckermeister legte sich in’s Mittel, daß der Kranke den Willen zur Trauung im Bette gebe und somit der Herzenswunsch Beider erfüllt werde, es gehe dann aus, wie Gott es wolle.
So wurde, da Alles so weit gediehen war und keinerlei Hindernisse mehr obwalteten, die Trauung „einfach und würdig“, wie die Gallbeißerin es wünschte, am Krankenbette vollzogen. Die Hochzeitsgäste, an der Spitze der Bäckermeister und die Braut, begaben sich hierauf vom Krankenbette weg in den Gasthof zum Festmahle, bei welchem es gar heiter herging, die Braut viel mit Wein geehrt und sogar der Sterbende leben gelassen wurde.
Sie waren gerade beim Schaumwein, den der noble Bäckermeister beigestellt hatte und bei welchem wieder wacker angestoßen werden sollte, als die Nachricht kam, der Bräutigam sei ruhig im Herrn entschlafen. Die Braut weinte Eins und dachte bei sich: Ach, was bei solchen Gelegenheiten die Ceremonien lästig sind!
Am andern Morgen, während auf dem Thurme die Todtenglocken klangen, bestieg die Gallbeißerin thränennassen Auges ihr ererbtes Haus bis in den dritten Stock. Den an Zins rückständigen Parteien der Dachkammern kündete sie die Wohnung, dann stieg sie, getragen von dem Nimbus des Schmerzes, der seine Thränen nach außen und seine Wonnen nach innen kehrt, wieder zur Erde nieder.
Am Hausthore erwartete sie der Bäckermeister, noch ein bißchen übernächtig, aber nichtsdestoweniger nüchtern. Er zog sie mit zurück in den Flur, er habe mit ihr eine kleine Angelegenheit zu besprechen.
Es wäre wohl allzufrüh, an diesem Tage schon! lispelte sie, das Auge zu Boden schlagend. Er aber meinte, es gebe[S. 209] Angelegenheiten, die nicht früh genug in’s Reine gebracht werden könnten. Er sei von jeher ein Mann der Ordnung gewesen, und auch sie, die Gallbeißerin, kenne er von dieser höchst ehrenwerthen Seite. Er habe — und damit zog der Bäckermeister ein Papier aus der Tasche — einen Schuldbrief in der Hand, nach welchem er vor einundzwanzig Jahren dem Kaminfegermeister Ignaz Kratzer, nunmehr ihrem seligen Gatten, eine Geldsumme geliehen habe, diese Summe sei im Laufe der Zeit durch den vereinbarten Zinsfuß auf mehr als fünfundzwanzigtausend Gulden angewachsen. Dieses dreistöckige Haus sei unter Brüdern kaum sechzehntausend Gulden werth, ein anderes Vermögen sei nicht da und es freue ihn — den Bäckermeister — daß sein ehrenwerther, nunmehr heimgegangener Freund vor seinem Tode noch einen so schönen Ausweg gefunden habe, seiner Pflicht gerecht zu werden. Er sei überzeugt, die Witwe werde das Andenken des Verstorbenen dadurch ehren, daß sie — wozu er bereits die amtlichen Wege betreten habe — ehebaldigst den von ihrem Eheherrn unterzeichneten Schuldschein einlöse. In neue Schulden wolle er sie nicht stürzen sondern erkläre sich in Gottesnamen mit den beiden Häusern für zufriedengestellt.
So sagte er, der Schuldbrief war nicht abzuleugnen und nun kamen für die Gallbeißerin Tage des wirklichen Schmerzes.
Es wäre unerquicklich, ihre gewaltigen Zornausbrüche wiederzugeben, sie führten auch zu nichts. Die beiden Häuser mit den fünf Stockwerken fielen dem Bäcker zu, der diese Heirat schlau nur veranstaltet hatte, damit sich das Vermögen des Kaminfegers vergrößere und somit er zu seinem Gelde gelange.
Die Welt war von jeher schlecht und ist in Abelsberg und Neubrunn nicht besser, als anderswo. Die Gallbeißerin hat daher zum Schaden auch noch den Spott. Der Erzähler wünscht ihr nichts Schlechtes, sagt aber das: Wem auf dieser Erde das Geld die Hauptsache ist, der findet kein Glück und ist auch keines werth. — Der Bäckermeister soll’s auch bedenken!
Auf dem sehr finstern Dachboden des Wirthshauses von Ober-Abelsberg, unter anderen staubigen, rostigen und wurmstichigen Ueberbleibseln vergangener Jahrhunderte, ruhte eine alte, braunangestrichene und dennoch wurmstichige Baßgeige. Man wußte nicht, woher sie kam, man wußte nicht ihr Geburtsjahr und an ihrer Wiege war es gewiß nicht gesungen worden, daß sie dereinstmalen auf dem sehr finstern Dachboden des Wirthshauses von Ober-Abelsberg erbärmlich sollte verderben.
Die letzten Jahre her hatte diese Baßgeige zuweilen noch ein Lebenszeichen von sich gegeben. Flatterte eine Fledermaus über sie hin, oder huschte ein ander’ Mäuslein über ihre Saiten, gleich hub sie wie ein geschwätzig Weib an, ihren Lebenslauf zu erzählen und Lieder zu singen aus den schönen Zeiten ihrer Jugend. Später brummte sie nur noch, wenn der Wind im Dache sauste; seitdem ihr aber die Mäuse alle Saiten abgenagt hatten, lag sie klang- und klagelos in Moder und Staub.
Gerade unter diesem öden Dachgeschosse lag der Tanzboden. Wie pfiffen da oft die Pfeifen und geigten die Geigen, daß alle Hunde des Dorfes aus Nervosität anhuben zu[S. 211] winseln und die Trommelfelle der Tänzer hundertfach durchlöchert wurden von den scharfen, nadelspitzigen Tönen. Aber Keiner hatte geahnt, wie nahe das Mittel war, das mit einem wohlwollenden Gebrumme die Mißstimmung ausglich.
Die lieben possirlichen Rothschwänzchen nisten nicht ungern in altem Gerümpel und so ist unter dem Geschlecht dieser Vögelchen auch ein musikalisches Paar gewesen, das sich in unsere still verlassene Baßgeige eingenistet hat. Dieser Umstand lenkte die Aufmerksamkeit des kleinen Wirths-Friedl — der ein passionirter Vogelfreund war — auf das alte Instrument, so im Dachgeschoß des Hauses ruhte; und eines Tages hub der Junge mit dem Ding ein Staubaufwirbeln und Herumzerren an und störte den Hausfrieden der Rothschwänzchen, und nicht lange hernach kollerte er mit der Baßgeige zur Bodenstiege herab.
Die Geige war den Abelsbergern wie vom Himmel gefallen und es kam der Tischler und leimte die Sprünge und Löcher zu, und es kam der Schulmeister mit der großmächtigen Brille und zog Saiten auf, und als der Abelsberger Jahrmarkt kam, siehe, da brummte im Vereine mit den Pfeifen und Gesängen das altehrwürdige Instrument dem Kirchenpatron seine Verehrung. Es war ein wiedererwachtes Leben — es war eine große ungetheilte Freude in Ober-Abelsberg.
Und wie es an so Jahrmärkten schon ist, nach dem Gottesdienst ging Alles in’s Wirthshaus und auf den Tanzboden; da blieb die Baßgeige nicht zurück. Bringt es schon der Herr Pfarrer zuweg, daß er Vormittag den Wein aus dem Kelch trinkt und Nachmittag aus dem Maßhumpen, so weiß es auch eine altehrwürdige Baßgeige einzurichten, daß sie Vormittags Kirchenlieder jodelt und Nachmittags Ländler[S. 212] und Walzer. Und wenn sie schon Vormittags in Ehrfurcht ihren Bauch eingezogen hatte, so ließ sie nun im Wirthshaus manchen Juchton über den Sattel springen, daß schon all’ die Röcke flogen und die Hosen flatterten. Dem Pfarrer selbst ging’s an die Kutte.
Und so war es nun jahrelang gewesen, daß die Baßgeige den Kirchenchor und den Tanzboden versorgt hatte, bis einmal bei einer mächtig lustigen Hochzeit die heißblütige Braut vom Tanzen zum Umfallen erschöpft, hin auf die Baßgeige sank und ihr den Bauch einsaß. Da hat die Geige wohl gottsrechtschaffen gebrummt.
Aber das war ihr letztes Brummen gewesen für lange Zeit. Erst nach Jahren war es wieder, daß die Ober-Abelsberger sagten: „Wir haben ja keinen Baß nicht, wir müssen der Alten den Bauch flicken lassen.“ Hierauf kam wieder der Tischler mit dem Leim und der Schulmeister mit den Saiten und mit dem Fiedelbogen, und da hing dieser Einen wegen der Himmel über Abelsberg voller Geigen.
Nun kam aber eine Zeit über die Welt, die groß und vielbedeutend geheißen wird von hellgeistigen Männern, die aber nichtsdestoweniger manches Dorf zu einer wahren Narrengemeinde gemacht hat. Wenn es früher in so einem Orte gutmüthige Bauern und ehrsame Handwerker und ein paar bärbeißige Amtmänner und ein paar wohlgenährte Priester und ein paar zaunmarterdürre Kirchendiener und Betschwestern gegeben hat, so trotteten jetzt nur mehr „Liberale“ und „Klerikale“ über die Dorfgasse. Es gab keine anderen Leute mehr, und wenn z. B. die „Liberalen“ männlich und die „Klerikalen“ weiblich gewesen wären, so wäre die Sache bigott leicht geschlichtet gewesen; so aber bestand eine Kluft zwischen Freund und Freund, zwischen Gevatter und Gevatterin,[S. 213] zwischen Vater und Sohn, zwischen Gatten und Gattin, zwischen Pfarrer und Amtmann, und was sehr vielsagend ist, zwischen Kirche und Wirthshaus.
Man hätte meinen sollen, die altehrwürdige Baßgeige, als ein beiden Theilen und Allen gemeinsames Gut, wäre hier das versöhnende Moment gewesen; au contraire, wie die Gebildeten von Abelsberg sagen, die Geige wurde der Gegenstand eines hitzigen, tiefgreifenden Krieges. Der Schulmeister spielte auf dem Chore mit dem Fiedelbogen nicht mehr. Da schickte der neue Regenschori — der nicht blos unter der Fahne der „Klerikalen“ stand, sondern sogar der Fahnenträger selbst war — in das Wirthshaus, um die Baßgeige von ihrem Aufbewahrungsorte zu holen. Aber da hub der Wirth statt der Baßgeige zu brummen an: die Geige gehöre den Liberalen; der Tischler habe einstmalen daran geleimt und der Tischler sei liberal; der Schulmeister habe die Saiten aufgezogen und der Schulmeister sei jetzt liberal; im Wirthshause, wo sie aufgefunden worden, sei ihr Hort gewesen und das Wirthshaus sei — man sehe es ja doch an der aufliegenden Zimmermann’schen „Freiheit“ — liberal. Maßen sei die Baßgeige liberal mitsammt dem Fiedelbogen.
Auf das hin brauchte sich der Pfarrer für den nächsten Sonntag keine Predigt aus dem Evangelienbuch zu citiren. Die Baßgeige war der Gegenstand seiner Betrachtung. Mit einer heiteren Pointe hub der Mann an: Vor Jahren, da die Baßgeige aufgefunden worden, habe Alles gesagt, die Baßgeige sei den Ober-Abelsbergern vom Himmel gefallen. — Demzufolge sei sie klerikal. In der Kirche habe sie zum erstenmal getönt. Der Schulmeister habe sie in Kirche und Wirthshaus gespielt, und der Schulmeister war dazumal klerikal. Und wenn noch die Braut erinnerlich wäre, die einst[S. 214]malen der Geige den Bauch eingesessen habe, so sei darauf zu bemerken, die Braut sei heutzutage die Frau des Kirchendieners. Und wenn er — der Pfarrer — endlich behaupte, das Instrument sei seinerzeit für die Kirche angeschafft worden, so werde Keiner sein im Orte, der das Gegentheil beweisen könne, und die Baßgeige sei somit klerikal und gehöre ein- für allemal den Klerikalen.
Die Gründe des Herrn Pfarrers waren drastisch, nur schade, daß kein einziger Liberaler in der Predigt war. Die Liberalen saßen im Wirthshause und sangen kecke Trinklieder und die Geige gab den Baß dazu. Da dachte sich eines Abends der Herr Caplan: Wozu so lang’ mit Worten fechten, so laßt uns endlich Thaten seh’n! — und schlich durch Nacht und Nebel in das Wirthshaus und entführte die Baßgeige in den Pfarrhof.
Von nun an bekam die Sache einen rasch handelnden Gang. Die Liberalen gingen auf’s Bezirksgericht und strengten eine Klage an, gegen den Pfarrer wegen Aneignung unrechtmäßigen Gutes. — „Albernheiten!“ sagte das Bezirksgericht, „so einer alten Baßgeige wegen kommt eine ganze Gemeinde in Harnisch. Geht heim und versöhnt Euch friedlich.“ Und die Liberalen gingen heim und trugen die Baßgeige zurück in das Wirthshaus.
Hierauf gingen die Klerikalen zum Dechant und beklagten sich wegen räuberischer Eingriffe in ihr Besitzthum. Der Dechant sagte, sie sollten nur nicht nachgeben, sollten zum Bischof gehen, einstweilen aber die Baßgeige wieder in den Pfarrhof zurücktransportiren. Sofort verschwand die Geige wieder aus dem Wirthshaus. Da gingen denn die Liberalen zum Landesgericht. „Geht, schert Euch nicht,“ sagte das Landesgericht, „verschenkt den Scherben!“ — „Aber es handelt[S. 215] sich nicht mehr um die Baßgeige, es handelt sich um das Recht, um die Ehre!“ sagten die Ober-Abelsberger. Aber das Landesgericht wies sie ab. So waren sie auf Selbsthilfe angewiesen; sie stürmten den Pfarrhof und eroberten die Baßgeige wieder zurück in das Wirthshaus.
Nun begaben sich die Klerikalen zähneknirschend zum Bischof. „Ja, meine Lieben,“ sagte der Bischof, „nur standhaft sein. Haben sie nur erst die Baßgeige, so nehmen sie Euch auch die Orgel, und haben sie diese, gehört auch das Chor ihnen und sie rauben Euch zuletzt die Kirche mitsammt dem Thurm. Ich allerdings kann nichts für die Sache thun, aber steht nur männlich selbst dafür ein.“ Männlich selbst dafür einstehen, das hieß: die Baßgeige aus dem Hinterthürchen des Wirthshauses wieder in den Pfarrhof schleppen.
So geschah es. Da machten sich die Liberalen auf und begaben sich mit schwarzen Röcken und weißen Cravaten — weiß Gott! — zum obersten Gerichtshof. Der wußte schon von der Geigengeschichte und ließ die Leutchen gar nicht vor. Jetzt kam es auf nichts Geringeres an, als des Pfarrers Kuhmagd zu bestechen, daß diese die Köchin besteche und ihr den Schlüssel zur Rumpelkammer entlocke.
Und nach wenigen Tagen, als der Pfarrer und der Caplan brevierbetend am Wirthshause vorübergingen, hörten sie d’rin johlen und tanzen und die wohlbekannte Stimme der Baßgeige.
Jetzt luden sie alle Parteigenossen zu einer Versammlung ein und beteten zum heiligen Geist um Erleuchtung. Und als sie gebetet hatten zum heiligen Geist um Erleuchtung, da hielten sie Rath und beschlossen einstimmig, eine Deputation zum heiligen Vater zu senden, auf daß durch des Statthalters Christi Wink die Baßgeige der Kirche erhalten bleibe.
Die Liberalen hielten auch eine Versammlung und stärkten sich dazu mit dem edlen Saft der Gerste. Und als sie sich gestärkt hatten mit dem edlen Saft der Gerste, da hielten sie Rath und beschlossen: Gehen die zum Papst, so gehen wir zum Kaiser!
Nach wenigen Wochen zogen zwei Deputationen von hinnen, die eine gen Rom, die andere gen Wien.
Die alte arme Baßgeige aber lehnte in einem einsamen Winkel des Wirthshauses, und — war tief verstimmt über den närrischen Hader, dessen unschuldige Ursache sie war, und der entzweiend und zersetzend selbst in die Familien eindrang und den Wohlstand der Gemeinde ernstlich gefährdete. — „Ach,“ so seufzte sie oft, „wäre ich wieder oben unter dem Dache und nisteten in mir wieder die friedlichen Vögelein — wie wäre mir wohl!“
Zur selbigen Zeit war es, daß ein Zigeunerschwarm durch das Dorf kam und bettelte und stahl, und den lustigen Bauern Musik machte im Wirthshaus. Ein alter Zigeuner war dabei, der hatte mehr Runzeln im Gesicht, als er all’ sein Lebtag schon Stuhlrichterprügel bekommen haben mochte, aber kohlschwarze Augen und einen kohlschwarzen Bart. Der sah die Baßgeige lehnen im Winkel und hub sie an zu streichen. Da horchten die Ober-Abelsberger auf — jetzt erst hörten sie, wie eine Baßgeige klingt! Jetzt erst nickten sie die Köpfe und lispelten: „Ist nicht ohne, der Ober-Abelsberger Geigenkrieg!“ Das Blut wurde ihnen heiß bei der absonderlichen Musik, zu tanzen huben sie an, die Männer und Weiber, die Liberalen und Klerikalen, Alles durcheinander — toll zu tanzen huben sie an. Der alte Zigeuner spielte und schmunzelnd ließ er seine dürren Finger über die Saiten der alten Geige zucken und der Fiedelbogen spritzte süßgiftige[S. 217] Töne aus. Ganz schauderhaft wurde in derselben Nacht getanzt und getrunken und ehe noch der Morgen graute, lagen die Ober-Abelsberger unter Tischen und Bänken und in den Winkeln herum — Männer und Weiber, Liberale und Klerikale — Alles durcheinander.
Die Zigeunerbande aber war in Nacht und Wind davongezogen, und — was der Papst und der Kaiser auch gesagt haben mögen — die altehrwürdige Baßgeige ist von derselbigen Nacht an nicht mehr gesehen worden in Ober-Abelsberg.
Sie ist ja allbekannt, die Predigt von Pater Abraham a Santa Clara, in welcher er von der Sünderin Magdalena sprach. „Und auch unter meinen Zuhörern sitzt eine solche Magdalena! Wollt Ihr’s wissen, welche? Dort! Paßt auf, ich werfe dieses mein Buch nach dem Haupte der Sünderin!“ Er hob zum Wurfe aus; alle weiblichen Zuhörer, alle duckten die Köpfe. — „Was?“ rief der Prediger, „ich hab’ geglaubt, es wäre nur Eine dabei!“
Und ein andermal: „Die Jungfrauen der Wienerstadt all’: auf einem Schubkarren getraue ich mir sie hinauszufahren!“ Das war denn doch etwas zu viel für die hohen Herrschaften der kaiserlichen Residenz. Der Pater wurde aufgefordert, sein Wort öffentlich zu widerrufen. „Ich widerrufe gar nichts,“ sagte er bei seiner nächsten Predigt, „wie gesagt, auf einem Schubkarren! Ich hab’ ja nicht angegeben, wie oftmals ich fahren will!“
Der gute Pater Abraham freilich, der konnte es thun und konnte stets entschlüpfen, wie es nicht Jeder kann, der es will.
Auch der Herr Seelsorger von Ober-Abelsberg wollte ein Pater Abraham sein, denn Abelsberg war Euch mitunter schon gar ein liederlich Nest. — „Bei uns dahier,“ rief er in einer seiner Predigten, „bei uns dahier liegen die Junggesellen und Jungfrauen alle noch in der Wiegen! Auf allen Gassen und Straßen, beim Aufstehen und Wirthshausgehen, bei der Arbeit und bei der Schüssel, beim Rosenkranz bis zum Amen sind Männlein und Weiblein beisammen. Ein wildes Ehebett ist die ganze Gemein’, na, da möcht’ der Teufel Euer Pfarrer sein!“
Reckten sich bei dieser Predigt in den Kirchenstühlen einige Köpfe höher. Der Richter macht schon den Mund auf. — „Ah na,“ denkt er, „in der Kirch’ heb’ ich keinen Unfried an,“ und duckt wieder zusammen und läßt das Hochgewitter von der Kanzel ruhig über sich ergehen und murmelt: „Schrei’ Du nur zu da oben und hau’ die Faust nur rechtschaffen in die Kanzel ’nein: morgen wirst heiser sein.“
Und als der Seelsorger oben besagtermaßen genugsamlich Scheiter in die Hölle getragen hatte, zündete er den Haufen an, will sagen: machte seinen Zuhörern durch eine schauderliche Darstellung des ewigen Feuers die Hölle heiß. Ein ordentlicher Schwefelgeruch war in der Kirche schon zu verspüren, manches alte Männlein vergoß Angstschweiß und manches alte Weiblein zog seine Beine ein, weil es an den Zehen schon die ewigen Flammen zu spüren vermeinte. Und das junge Volk, dem zu Ehren die Predigt eigentlich gehalten wurde, in die Fäuste kicherte es hinein und unter den Bänken trat es sich einander mit den Schuhspitzen.
Der Herr Pfarrer hatte sich für den selbigen Mittag einen prächtigen Appetit herausgepredigt. Und — ganz wie der Richter berechnet hatte — am andern Tag war der Herr[S. 219] Pfarrer so heiser, als wäre seine Luftröhre über und über mit Bärenpelz ausgefüttert.
Wurde an diesen Tagen einmal ganz besonders höflich an die Thür geklopft. — „Sicherlich wieder so eine verdächtige Kindstauf’!“ murmelt der Pfarrer und reißt, weil er zu einem derben „Wer ist’s?“ keine Stimme hat, die Thür auf. Wird aber sofort gelassener, als er im Vorhause eine große Zahl von Männern aus seiner Gemeinde erblickt. Alle haben, wie der Herr Pfarrer erschienen, die Hüte eilig vom Kopf gerissen, sind sich mit der flachen Hand mehrmals über das Haupt gefahren, um die allweg widerspenstigen Locken zu glätten; treten hierauf in’s Zimmer und der Aeltesten Einer hebt an so zu reden:
„Wir haben schon die Grobheit, Hochwürden, daß wir gleich so uneben in’s Haus hereinkrachen. Küssen die Hand! — Und was wir halt sagen wollten —“
„Setzt Euch, liebe Leute, so viel Sessel zur Verfügung stehen,“ lud der Pfarrer leutselig ein.
„Bedanken uns; mögen schon auch stehen. Und daß wir gleich g’radweg reden — der Sonntagspredigt wegen thäten wir halt da sein. Gottswahrhaftig, Hochwürden, das ist ’mal ein wahres Wort gewesen, so recht ein Pfarrherrnwort; sakra ’nein das hat uns an’griffen. — ’s ist wohl richtig, unsere Gemein’ ist hundsschlecht über und über, ’muß eine Veränderung nehmen — wohl, wohl, Hochwürden!“
Der Pfarrer lächelte wehmüthig und flüsterte salbungsvoll: „Gott walt’s!“
„Das ist gewiß!“ sagte der Sprecher, „und wir Männer sind zusamm’gestanden und haben gesagt: Und wollt’ sich Einer schon vor der Höllen nicht scheuen, so kunnt’s doch ’leicht zeitlich einen schlechten Schick haben. Wissen uns eh[S. 220] schon nicht mehr aus mit den ledigen Kindern, die der Gemein’ heut’ in der Schüssel liegen und in Alterstagen wieder in der Schüssel liegen werden. Und ein Spott ist’s auch. Desweg, ’s muß eine Veränderung nehmen. — Jetzt, was mich angeht, mich selber, wie ich dasteh’, ich verbleib’ wie ich bin; thät’s nit mehr im Stand sein, daß ich in meinen alten Tagen noch ein’ Unehr’ wollt’ aufheben. — Und so“ — er wendete sich zu seinen Mitmännern — „redet jetzt Ihr Eure Sach’.“
Ein stämmiger Bursch trat hervor: „Ich dank’ mein Mädel ab, muß eh zu den Soldaten.“
Ein rothbärtiger Geselle: „Mein’ Dirn, die lass’ ich nit! Aber die Gemein’, die duldet uns nit und wir wandern aus.“
Ein behäbiger Bauer stellte sich vor den Pfarrer: „Ich heirat’ die Meine gleich auf der Stell’!“ und trat zurück.
Ein Anderer: „Thät’ meinen Schatz auch heiraten; kriegen aber nicht die Erlaubniß dazu; untreu werden will ich nicht, jetzt, was fang’ ich an?“
„Wie der Will’,“ belehrte der Seelsorger, „mußt sie aufgeben, die schlechte Bekanntschaft, mußt schön in Ehrsamkeit leben.“
„Werd’s halt einmal probiren,“ versetzte der Andere und trat zurück.
Ein schwarzer und wildnarbiger Kohlenbrenner schritt herfür:
„Rechtschaffen bedanken muß ich mich für die scharf’ Predigt, hätt’ sie eh schon lang’ gern verjagt, meine Liebste; glaubt Ihr, es wär’ gegangen, das Biest? Jetzt aber kann ich ihr bei; dem hochwürdigen Herrn seine Sonntagspredigt halt’ ich ihr vor — da läuft sie zuweitest davon.“
Ein Holzhauer sagte: „Ganz lassen werd’ ich halt meine Kathel nicht können; ’s ist ein blutarm’ Ding; daß ich ihr des Sonntags ein Seidel zahl’, beim Kirchenwirth, ich sag’, ’s selb kann mir die christlich’ Nächstenlieb’ nit wehren.“
„Gewiß nicht,“ antwortete der Pfarrer, „wenn’s beim Seidel nur auch bleibt!“
„Und wär’s letztlich eine Halbe, weil ich auch mittrink’?“
„Ja, ja, aus der Halben wird eine Ganze!“ rief der Pfarrer, „bete mein Sohn, nach des Herrn Wort: Führ’ uns nicht in Versuchung!“
„Wohl, wohl,“ sagte der Holzhauer, „will schon fleißig beten.“
Ein Bauernknecht schlich heran, walkte den Hut mit beiden Händen und flüsterte: „Wenn’s d’rauf ankommt, Hochwürden, so brauch’ ich gar Keine, aber zum Waschen und Flicken muß Einer wen haben. Und halt auch, daß Einer, der kein’ Vater und kein’ Mutter und kein’ Geschwister nit hat, daß er immereinmal doch gern ein Eichtel plaudern wollt’ mit einem Menschen und gern wen mögen wollt’, der ihn ein bissel lieb thät haben.“
Ein alter Bartstrupp humpelte vor: „Und ich auch, Hochwürden, möcht’ mich halt bessern. Meine Liebschaft ist auch nichts nutz.“
„Ihr seid ja verheiratet,“ sagte der Pfarrer.
„Das wohl, aber meine Alte, die ist Euch häßlich wie die Nacht und bös wie eine wilde Katz’, und Branntwein saufen thut sie wie ein Loch und fluchen thut sie wie ein Husar. Mit so Einer zu leben, das wird sicherlich eine Todsünd sein.“
„Geht mir weg, Ihr seid ein Lästerer!“ rief der Seelsorger.
Torkelte der Alte gegen die Thüre.
Ein Anderer trat hervor: „Ich hab’ Zwei, aber ich bring’ sie nit weg, ehvor ich sie nicht bezahlt hab’, was ihnen gebührt. Aber...“ weil der Pfarrer eine gar finstere Miene machte, „ich nehm ’s Geld schon zu leih’n.“
„Ich hab’ meiner Tag keine Weibsleut mögen!“ krähte ein gelbes Runzelgesicht aus der Menge hervor, „aber weil ich jetzt hör’, daß die Sach’ gar so groß Sünd’ ist, so kunnt Eins schier neugierig werden.“
„Na, na, unser Herr Pfarrer hat Recht, es muß eine Veränderung geschehen,“ sagten Mehrere.
„Ist brav, ist brav,“ versetzte der Seelsorger und reichte ihnen die Hände, „und das ist mir der schönste Tag in meinem Seelsorgerleben. Wie werde ich glücklich sein, einst mit meiner lieben Gemeinde im Unschulds- oder Bußkleide vor Gottes Thron erscheinen zu können!“
Einige wollten sich schon zum Gehen wenden, da trat der erste Sprecher noch einmal hervor und sagte mit fast schüchterner Höflichkeit:
„Hätten wir halt zuletzt eine recht schöne Bitt’, hochwürdiger Herr Pfarrer.“
„Nur frisch damit heraus, liebe Kinder, wenn’s in meiner Macht steht, von Herzen gern.“
„’s ist halt der Gemeinde wegen,“ fuhr der Redner beklommen fort, „und daß mit Gottes Hilf’ ein anderer Geist in die Leut’ thät kommen. Daheim im Pfarrhof, selb wollen wir nicht reden, selb ist der Herr Pfarrer sein eigener Herr, aber halt auf der Gasse und beim Spaziergang im Wald, so beim Predigtstudiren — da thäten wir halt wohl schön bitten, daß der hochwürdige Herr Pfarrer die Frau Haushälterin nit wollt’ mitnehmen.“
Hab’ früher zu sagen vergessen, daß der Pfarrer von Ober-Abelsberg ein leidenschaftlicher Schnupfer war; er zog jetzt die Dose hervor und nahm drei, vier Prisen hart hintereinander und bot hierauf Jedem die offene Dose hin. Und Jeder tunkte höflich seine Finger ein und schnupfte und jetzt brach ein Niesen los von allen Seiten. „Helf Gott! Helf Gott!“ riefen sie einander zu. Und der Pfarrer sagte: „Helf’ uns Gott Allen miteinander!“
Im Pfarrhofe zu Abelsberg bei Tische saßen immer ihrer Drei. Der Pfarrer, die Katze und der Caplan. Besteck hatte die Katze keines. Ja, hätt’ ich ihre scharfen Zähnchen, wollt’ nicht fragen nach Messer und Gabel, und ihr zartes, langes Zünglein ist brauchbarer als wie der feinste Silberlöffel. Am liebsten saß sie dem Pfarrer auf dem Schoß, wo der Talar stets ein rechtes Grüblein machte; saß nicht ungern auf dem Tisch, am Rande des Tellers; bekostete zuweilen auch die gemeinsame Schüssel, ob wohl in Salz und Schmalz das richtige Verhältniß obwalte, wie es die geistlichen Herren am liebsten hätten. Und war dieses richtige Verhältniß da, so aß sie sich für’s Erste selbst ohne alle Umstände satt.
Der Pfarrer hatte seinen rechten Spaß mit dem possirlichen Wesen, ja hing mit Freundschaft an demselben und schob ihm nicht die schlechtesten Bissen zu, gar mitunter solche, auf die bereits schon der Caplan ein Auge geworfen hatte.
Nach einer Weile ereignete es sich, daß der Pfarrer auf einige Zeit verreiste. Der Caplan hatte mittlerweile Gemeinde- und Hauswesen zu verwalten — that’s auch mit Umsicht[S. 224] und Gewissenhaftigkeit. Aber Eins wollte er dieweilen vollführen; gegen den Liebling des Pfarrers, der keine Messe las, keine Predigt hielt und keine Sünden vergab und im Pfarrhofe doch mindestens so gut, wenn nicht besser gehalten wurde, als der Caplan — gegen die Katze schmiedete er Ränke. Aber ihm waren die Hände gebunden — wenn der Herr nach Hause kommt, wird sein erster Blick in den Bettwinkel sein, wo der Liebling seine Wohnstatt hat.
Giebt es denn aber kein Mittel, das graue Unwesen für immer vom Tische fern zu halten? Nach dem Crucifixe, das über dem Tische an der Wand hing, glitt des Priesters bedrängter Blick. An demselben Tage fiel ihm eine kleine Hundspeitsche in’s Auge, die beim Sattlermeister im Auslagkasten lehnte. Da kam ihm plötzlich die Erleuchtung. Er kaufte die Peitsche, und als es Essenszeit war und er sich allein zum Tisch setzte, kam wie immer die gute Katz’ herbei. Der Caplan nahm salbungsvoll das Crucifix in die rechte, die Hundspeitsche in die linke Hand — hielt ersteres der Katze vor und mit der letzteren — schwaps! ging’s über des Thierleins Rücken. Mit Einem Satz war die Katz’ davon.
Aber bei der nächsten Mahlzeit erschien sie wieder. Der Priester nahm in die Rechte das Crucifix, in die Linke die Peitsche und that wie das erstemal. Husch war sie weg.
Ein drittesmal nahte sie schon mit einigem Zagen, aber sie nahte, und der Caplan that wie das erste- und das zweitemal.
So ging’s etliche Tage fort. Da kam der Herr Pfarrer heim. Recht froh und heiter, daß wieder Alles in Ordnung ist, setzen sie sich zu Tische und die Gottesgab’ läßt nicht warten und läßt sich niemals, heute am allerwenigsten spotten.
„Aber wo ist denn mein Katzel?“ frägt der Pfarrer.
Lugt auch der Caplan um. „Dort hinter dem Ofen hockt’s ja.“
„Merkwürdig, daß es heute nicht zum Tisch kommt!“
„Wirklich, Herr Pfarrer, das nimmt mich auch Wunder. Ich merke schon seit ein paar Tagen so etwas. Mir fiel es sogar schon ein, was die Leute sagen — mag aber nicht d’ran glauben.“
„Die Leute?“ meint der Pfarrer, „was sagen sie denn?“
„Nein, ich glaub’s nicht. ’s ist so ein abergläubisches Geschwätz, nur daß man davon spricht. — So eine Katz’, sagen die Leute, wenn sie altert, thät’ eine Hex’ werden und sich keinem Crucifix in die Nähe getrauen.“
„Paperlapap!“ sagt der Pfarrer.
„Na, versteht sich. Ein Altweibergeschwätz.“
„Ist nur um ein Probiren zu thun,“ meint der Pfarrer, „na, Kätzle, komm’, komm’ her zu mir!“
Dieser trauten Einladung vermag das Thier nicht zu widerstehen, es naht und steigt dem Herrn auf den Schoß. Der Pfarrer langt nach dem Crucifix, aber kaum die Katze dieses in seiner Hand erblickt und ein inneres Gesicht hat von einem andern Gegenstand, ergreift sie in wilder Hast die Flucht.
Die beiden Priester blicken sich lautlos an.
„Merkwürdig!“ sagt der Pfarrer endlich.
„Seltsam!“ entgegnet der Caplan.
„Wenn’s so ist, muß ich das Vieh aus dem Haus thun,“ sagt der Pfarrer.
„Das wäre jammerschad’!“ versetzt der Caplan.
Bald war die Katze beim Abdecker. Aus ihrer Haut wurden Hundspeitschen geschnitten.
Eine junge Witwe aus Schlesien war eingewandert, hatte sich in der Nähe von Abelsberg einen schönen Bauernhof gekauft und war die Großhofbäuerin.
Zu dieser Großhofbäuerin kam eines Tages ein Kleinhäusler aus der Gegend, ein junger, hübscher Mann. Der setzte sich in der Vorlauben auf eine Bank und wartete, bis ihn wer ansprach.
Wartete nicht lange, so kam die Großhofbäuerin aus der Stube und fragte ihn, ob er auf Jemanden warte.
„Ach na,“ sagte der junge Mann, „Großhofbäuerin, ich bin wieder wer geworden.“
„Was bist?“ fragte die Bäuerin.
„Wieder wer geworden bin ich,“ antwortete er.
„Ich weiß ja gar nicht, wer Du sonst bist,“ sagte die Bäuerin.
„Ich bin nicht gar viel,“ sagte er, „ich bin sonst der Teichgräber Franzl, und heut’ Nacht bin ich wieder wer geworden. Jetzt weiß ich mir halt nicht zu helfen und weiß nicht, wo ich hingehen soll.“
Da entgegnete sie: „Wenn Du — wie Du sagst —- wieder wer geworden bist und Du weißt sonst nirgends hinzugehen, so kannst ja bei mir bleiben. In so einem Hof hat man fortweg Leute vonnöthen, die wer sind.“
„Es ist wohl recht hart,“ meinte hierauf der Franz, „wenn man wieder wer geworden ist und man hat keine Seel’, an die man sich halten könnt’.“
„So halte Dich an mich,“ sagte die junge Bäuerin, „bist wer und stellst Deinen Mann, so werden wir uns leicht verstehen. Nur nicht so verzagt sein! Schau’ mich an einmal!“
„Wär’ schon recht das —“
„Kannst gleich in Dienst treten, wenn Du willst. Ich brauche just einen kernigen Mann — bis ein Bauer im Hause ist.“
„Wär’ schon recht,“ meinte der Franzl, „aber halt mein Weib —“
„Ja, bist denn verheiratet?“ rief sie.
„Na,“ sagte er, „heut’ Nacht bin ich wieder wer geworden.“
„Da bin ich mir zu dumm,“ rief die Bäuerin ärgerlich, „das verstehe ich nicht. Traudel, geh’ her zu Dem, vielleicht bringst Du’s heraus, was es mit Dem ist.“
Die Küchenmagd kam herbei und sagte: „Mit dem da? Das weiß ich schon, was es mit Dem ist. Mit Dem ist es eine harte Sach’.“
„Wesweg denn?“
„Aber er hat’s ja gesagt, Bäurin, und er sagt’s ja.“
„Daß er wieder wer geworden ist, sagt er.“
„Nun also, Bäurin?“
„Ist das denn eine harte Sach’, wenn man wieder wer geworden ist?“
„Ich kann mir’s denken,“ versetzte die Magd, „und die Bäurin sollt’s beiläufig wissen, wie hart es sein kann, wenn Einer Witwer geworden ist?“
„Witwer? Wer ist Witwer?“
„Aber jetzt muß ich schon lachen, Bäurin,“ rief die Küchenmagd, „da steht er, der Witwer. Heut’ Nacht ist ihm sein Weib verstorben.“
„O weh!“ sagte die Großhofbäuerin; „ja, Franzl, warum hast Du das nicht gleich gesagt? Warum denn nicht gleich, Franzel?“
„Er hat’s ja schon zehnmal gesagt!“ rief die Magd.
Die Großhofbäuerin hat nämlich nicht abelsbergerisch verstanden. Aber der Häusler Franz hat besser sprechen gelernt. Er ist nun wirklich wieder wer geworden — er ist Großhofbauer geworden.
Der Kreuzhäusel-Hans war arm daran, war Alles schuldig bis auf seine neun Kinder. Das Häusel und das Vieh waren ihm schon versteigert worden, und jetzt ging’s an den Stall.
Der Nachbar Türken-Sepp nahm’s zeitig wahr. „Du,“ sagte er zu seinem Schwager, dem Baumzapfer-Lenz „morgen wird zu Ober-Abelsberg der Kreuzhäusel-Stall versteigert; möcht’ gern dabei sein, muß aber morgen in’s G’reut hinüber; ist dort ein spottwohlfeiler Schimmel zu kaufen. Hab’ die Gutheit, Schwager, und geh’ zur Versteigerung, und wenn der Heutrog — ’s ist ein nagelneuer Trog, der mir just will passen — wenn der an die Reih’ kommt, so biete für mich mit. Gelt, ich kann mich verlassen?“
„Freilich, das ist gewiß,“ betheuert der Lenz, „recht gern, daß ich für Dich mitbiete.“
Aber auf dem Heimweg denkt sich der Lenz: ein spottwohlfeiler Schimmel wär’ zu haben drüben im G’reut? Ei, den geh’ ich mir holen morgen in aller Früh. Aber der Heutrog? — Da begegnet ihm sein Gevatter, der Spitzborsten-Toni. „He, Gevatter,“ ruft ihm der Lenz zu, „könntest mir einen großmächtigen Gefallen thun, morgen über Tags. Des Kreuzhäusel-Hans Stall wird versteigert; bist gewiß auch dabei. Ich möcht’ für einen guten Bekannten den Heutrog[S. 229] haben — ein nagelneuer Trog. Wolltest mir hübsch keck mitbieten darum!“
„Mein Gott, von Herzen gern, und das macht mir ja gar keine Müh’ und Plag’,“ meint der Toni; und der Lenz ist seiner Sorge enthoben und macht sich des andern Morgens zeitig auf den Weg in das G’reut, um, noch ehe der Türken-Sepp sich einfindet, den spottwohlfeilen Schimmel zu kaufen.
Mittlerweile aber hat der Türken-Sepp erfahren, der Schimmel sei nicht mehr zu haben. So kann er sich bei der Versteigerung ja leicht selber einstellen und braucht den Lenz nicht zu belästigen. Doch, nun sieht er’s, auf den Schwager ist kein Verlaß — gar keiner; der Baumzapfer-Lenz ist bei der Versteigerung gar nicht zu sehen. Dafür aber ist — als die Reihe an das bewußte Einrichtungsstück kommt — der Spitzborsten-Toni wie versessen auf den Trog. Der Toni hat das nagelneue Prachtstück bereits von drei auf sieben Gulden hinaufgetrieben.
„Achti!“ ruft der Türken-Sepp.
„Neuni!“ sagt der Spitzborsten-Toni.
Da beißt sich der Sepp in die Zunge. „Zehne!“ versetzt er bissig.
„Eilfi!“ ruft der Toni und denkt: Ich zahl’s ja nicht, der Trog kommt für meines Gevatters Bekannten.
Der Starrschädel! flucht der Sepp bei sich selber, den tauch ich noch nieder; der Türken-Sepp darf nicht zu Schanden werden. „Zwölfi!“ schreit er.
„Dreizehni!“ brüllt der Toni.
„Vierzehni!“ der Sepp. Beide sind in der Hitze — Fünfzehni! — sechzehni! — siebzehni! — Alles lacht über die beiden Trotzköpfe, die um den Heutrog kämpfen.
— Achtzehni! — neunzehni! —
„Zwanzig Gulden! Fixsaker einmal!“ schreit der Sepp.
„Einundzwanzig!“ stöhnt der Toni.
„Auch gut,“ denkt sich der Türken-Sepp, „bei dem laß’ ich ihn; jetzt sitzt er in der Wolle.“
„Einundzwanzig zum Ersten!“ ruft der Beamte, „zum Zweiten! — zum Drittenmal!“
Der Hammer fällt. Der Toni hat den Heutrog.
„Du Narr!“ lacht Alles, „der Klotz ist nicht fünf Gulden werth.“ Der Türken-Sepp kichert noch am meisten darüber, daß der Partner aus reiner Prahlsucht in die Falle gegangen.
Zur selben Stunde reitet der Baumzapfer-Lenz auf seinem erstandenen Schimmel herbei. — „Gevatter!“ ruft ihm der Toni zu, „ich hab’ keck mitgeboten, da ist der Heutrog.“
„Ist mir rechtschaffen lieb,“ sagt der Lenz, „komm, Schwager Sepp, bist ja auch da; gleichwohl ich selber hab’ in’s G’reut hinüber müssen, ist Dein Willen gethan worden; mein Gevatter, der Spitzborsten-Toni, hat die Gutheit gehabt, hat für Dich den Heutrog erboten.“
Da wird dem Türken-Sepp übel bis in die Leber hinein; jetzt hat er sich selber gesteigert, hat mehr denn vierzehn Gulden aus seinem eigenen Beutel herausgeschrieen.
„Mach Dir nichts d’raus!“ rief der Toni lachend, „Sepp, der Heutrog ist was für Dich, bigott, für Dich selber!“
Der Türken-Sepp fluchte hinein in den nagelneuen Trog. Die Leute lachten gewaltig. Der Kreuzhäusel-Hans, der arm’ Tropf, lachte noch am meisten.
Finstere Geschichten.
eit altersher war es in unseren lieben deutschen Spinnstuben und Heimgarten Sitte, die langen Winterabende nicht allein mit Gesang und Scherz, sondern auch mit Gespenstergeschichten zu vertreiben.
Nun hat aber in unserer hellilluminirten Zeit der Glaube an Gespenster aufgehört. Weil jedoch die langen Winterabende nicht aufgehört haben und das allgemeine Bedürfniß nach Grauen und „Gruseln“ auch noch vorhanden ist, so weiß sich der Erzähler nicht anders zu helfen, als jene Gespenster vorzuführen, die leider nicht abgeleugnet werden können, jene Dämonen, mit denen Jeder von uns jeden Tag in heißem Streite liegt und die — wie schrecklich oft — zur tiefsten Tragik unseres Lebens werden.
Demnach können das keine lustigen Geschichten sein — sie werden unheimlich, finster und stürmisch sein, wie die Winternächte.
Der Dichter — und ginge sein Sinn noch so sehr nach dem Heiteren und Lichtvollen, mit dem er sich und die Mitmenschen erquicken und erfreuen möchte — er darf die Schatten dieses[S. 234] irdischen Lebens nicht verneinen, er muß bisweilen zeigen, wie man in denselben irren und fallen kann. Aber einen Leuchtthurm muß er bauen, der die Thaten und Opfer der Nacht milde bestrahlt, daß auch dort noch Liebe und Versöhnung sei, wo die vom Lichte geblendeten Kinder der Welt erbarmungslos richten.
Die Darstellung tragischer Schicksale bezweckt nichts weniger, als dem Skepticismus und Pessimismus Vorschub zu leisten; in der Thatsache, daß der Schuld naturgemäß die Strafe folgt, ist der beste Beweis, daß die Welt von einem Principe der Gerechtigkeit beherrscht wird. Die Offenbarung dieses Principes — und ginge sie auch durch Elend und Jammer — muß für uns unter allen Umständen trostreich sein. Wenn wir das Verhängniß anklagen, welches den Menschen in diesem Leben schuldig werden läßt und ihn dann der Pein übergiebt, weil sich alle Schuld auf Erden rächt, so geben wir zu, daß dieses Verhängniß einer größeren Macht, der Gerechtigkeit, unterworfen ist. Daraus folgt, daß wir der Zuversicht sein dürfen, die größere Macht werde endlich siegen, und uns — indem wir sie erkennen — Kraft verleihen, die Dämonen zu besiegen, bevor sie uns schuldig werden lassen.
Sollte sich in dem nachstehenden zweiten Theile dieses Buches eine Erzählung finden, in welcher der tückische Zufall mehr als die Gerechtigkeit, das Traurige mehr als das Tragische vorzuherrschen scheint, so wird in derselben auch die Wendung zum Frohen und zum Frieden nicht vermißt[S. 235] werden. Ein Leid, welches vor der Schuld kommt, nennen wir Prüfung und ist — wird sie mit einer gewissen sittlichen Kraft ertragen — eben so heilsam, als im Falle der Schuld die Sühne.
Muthwillig habe ich keinen von den Handelnden dieser Erzählungen in den Abgrund gestürzt; sollte es aber doch nicht sein, daß ich darin nach dem Vorbilde eines allmächtigen Gottes gehandelt habe, so möge ein solcher nach dem meinen handeln.
Der Verfasser.
eim Wiesenwirth am Zechtisch kauern zwei Männer und schnarchen. Man sieht von ihnen nur die struppigen Häupter, das eine röthlich behaart, das andere grau. Die Gesichter sind in die Aermel gepreßt. In den halbgeleerten Weingläsern, die davor auf dem Tische stehen, schwimmen ein paar ertrunkene Fliegen.
Bei einem andern Tisch, der am Ofen steht und der eigentlich eine Bettstatt ist, welche des Tages mit einer Holzdecke überschlagen eine Gasttafel bildet, sitzt ein junger Mann, der bäuerliche Kleider trägt, sonst aber recht städtisch aussieht. Er hat die Haare glatt nach rückwärts gefettet, und zwar so, daß sie in der Mitte den schneeweißen Scheitel bilden, und er trägt etwas feingekämmten Backenbart. Er scheint zu der neuzeitlichen Secte der Touristen zu gehören, welche auf allen hohen Bergen herumklettern und alle hübschen Landmädchen beunruhigen. Der junge Mann beim Wiesenwirth hat auch schon eines. Es ist die schöne Wirthstochter, die Walpa, die feurige Augen hat und jenes reiche, rothbraune Haar, das nur auf den Häuptern der Heißblütigsten und Begehrsamsten wächst.
Als die Walpa dem jungen Touristen das Weinglas vorgesetzt, hat er ihre Fingerchen erhascht, hat sie hierauf an[S. 238] der Hand gefaßt und weiß an ihren nackten runden Armen immer weiter hinanzutasten. Beim Grübchen des Ellbogens angelangt, jagt er ihr einen Schrei aus, denn sie ist „bremselig“. Die beiden Schläfer schlafen behaglich weiter.
Des kecken Städters weiße Hand umspannt des Mädchens Oberarm, so weit das Hemd zurückgeschlagen ist; dann will er sie niederziehen auf seinen Schoß, der heute ja in einer dicken Bockledernen steckt. Das Mädchen sträubt sich eine Weile, dann fügt es sich doch; Walpa ist schon manchem Burschen auf dem Leder gesessen. Manche Gäste haben das gern und zechen dafür um so wackerer, und der Wiesenwirth kann es seiner Tochter nicht oft genug sagen: „Nur fort handsam sein mit den Gästen und unterhaltsam — man weiß heutzutag, seit die Postwagen aufgehört haben, ohnehin nicht mehr, wie man die Kreuzer in’s Haus bringt.“
Da nun die Walpa auf seinem Schenkel sitzt, schlingt der junge Fremde — sie kennt ihn gar nicht, er ist das erstemal im Hause — seinen Arm um ihre Gestalt, beugt sein Haupt so nahe zu ihrem Gesichte, daß sein Athemhauch ihre Wangen bethaut. Dann sagt er leise das Wort: „Aber Du gefallst mir, Mirzel!“ In Steiermark, meint der Tourist, müsse jedes Bauernmädchen Mirzel heißen. Die Walpa dachte, weiß er meinen Namen nicht, so braucht er ihn auch nicht zu wissen. Nun sagte sie: „Will der Herr noch einen Wein?“
„Einen Kuß!“
Wenn Der nicht mehr als ein Seidel trinkt, dachte Walpa, so ist es nicht der Mühe werth, daß ich auf seinem Knie sitz’, und machte sich mit einem entschiedenen Ruck los. Er erhaschte sie und raubte ihr einen Kuß; sie blieb dabei anscheinend kalt, wie eine Marmorsäule. Aber aus ihrem[S. 239] Auge sprühte ein Feuerstrom, vor welchem dem Städter graute. Haß oder Liebe? Er wollte es untersuchen, da traten zur Thüre drei Männer ein.
„Ich komme wieder, mein Kind,“ sagte der junge, hübsche und so freundliche Städter, ihre Hand drückend und ein gutes Trinkgeld reichend, „bleib’ gesund, Mirzel, wir werden noch recht bekannt werden miteinander, Adieu, Schatz!“
Er ging und die Angekommenen traten in Herrschaft.
„Der Wiesenwirth daheim?“ fragte Einer der Dreie.
Das Mädchen deutete auf jenen der Schlummernden, der die grauenden Haare hatte. — „Was darf ich bringen?“
„Weckt ihn auf!“ gebot einer der Ankömmlinge.
„Wenn die Herren mit meinem Vater was zu schaffen haben,“ sagte die Walpa, „so müssen Sie wohl ein anderesmal kommen. Heut’ ist’s nichts, er ist ganz —“. Sie machte eine Geberde gegen die Stirne, anzeigend, daß der Mann heute nicht zurechnungsfähig wäre.
„Wiesenwirth!“ rief der Mann und legte den Stock auf den Tisch, „die Schätzungscommission ist da!“
Der Wirth pfusterte, hob ein wenig sein roth aufgedunsenes verschlafenes Gesicht, murmelte etwas, dann sank das Haupt wieder auf den Arm nieder.
„Lasset ihn,“ sagte ein Anderer, „wir haben ja Alles schon in dem Protokoll, wir wollen heute nur die Objecte mit Beschlag belegen. — Du, Mädchen, bist wohl die Tochter. Nimm die Schlüssel und komm mit uns. Auch ein Kerzenlicht brauchen wir.“
Die Walpa wußte schon, was es geschlagen. Die ganze kleine Wirthschaft war verschuldet. Wenn schlechte Zeiten sind, dann mag das Wirthstöchterlein den Gästen auf den Knieen hocken wie es will — es giebt nichts aus.
Die Gerichtsmänner durchstöberten Kisten und Kästen, Vorrathskammer und Keller, drückten überall das Amtssiegel auf und dann gingen sie ruhig wieder davon.
Da war es öde im Wirthshause, die Walpa saß auf der Ofenbank.
Endlich, als in der Stube die Dämmerung des Abends zu herrschen begann, regte sich der Schläfer mit dem fuchsrothen Haupthaar und verlangte Wein. Es war ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren, knochig und rauh von Figur. Die Wangen und das Kinn waren glatt rasirt, der rothe Backenbart unter den Ohren und der Schnurrbart standen steif und struppig; die Augen waren grau und tiefliegend und die Knochenwände, die darüber hervorstanden, ließen wohl den eisernen Willen vermuthen, der in diesem Kopfe schlummerte. Im Uebrigen waren die Züge so wie bei anderen Bauersleuten, und doch wieder anders; sie waren abstoßend und doch interessant. Als er seine Augen rieb und das Mädchen erblickte, nahm er eine freundliche Miene an.
Jetzt wachte auch der Graukopf auf und schrie nach Wein.
„Ihr habt zu lang’ geschlafen,“ sagte Walpa, „dieweilen sind Gerichtsleut’ dagewesen und haben Alles verpetschirt.“
„Herr Jesses! Bei den Weinfässern werden sie doch nicht gewesen sein!“
„Freilich, auch bei den Weinfässern.“
„So bring’ einen Holzapfelmost!“ befahl der Wirth.
„Ja,“ sagte das Mädchen, „das Mostfassel haben sie auch verpickt.“
„Himmelherrgottsdirn, so trag einen Branntwein her!“
„Ist Alles verschmiert, Vater, und Ihr denkt nur fort an’s Trinken.“
„Na, so bring’ was zu essen!“
„Ja, zu essen haben wir freilich auch nichts, das Mehlkastel und der Schmalztopf sind versiegelt. Wir sind fertige Bettelleut’.“
Jetzt wurde der Wiesenwirth nüchtern. Zuerst polterte er mit dem Mädchen, daß es Alles habe versiegeln lassen, dann fluchte er über das Gericht, über die Gläubiger und über die ganze Welt; schließlich fragte er, ob ein Strick noch im Hause wäre, er hänge sich auf.
Der Andere, der neben ihm erwacht war, lächelte hämisch und murmelte: „Bist ein verzagter Steffel, Du. Weißt ja, daß Du einen guten Freund hast. Ich bleib’ auch jetzt noch bei meinem Wort, und wenn Du ja sagst, Wirth, so reiß’ ich Dich auf eins zwei aus der Klemm’.“ Er fuhr mit der Hand in den Rock und riß eine bauschige Brusttasche aus dem Sack.
„Was hilft mein Jasagen, Du Tropf, wenn die Dirn nicht will!“
„Wenn die Dirn nicht will — nachher — — ist’s freilich was Anders,“ sagte der Rothhaarige und schob die Geldtasche wieder ein.
Der Wirth war aufgesprungen und hatte seine Tochter bei der Hand gefaßt. „Walpa,“ sagte er, „laß’ noch einmal mit Dir reden. Schau, zweiundzwanzig Jahr bist alt. Schöner wirst nimmer, stolz sein, das tragt’s Dir nicht, ’s selb’ magst mir schon glauben. Jetzt freilich noch hupfen Dir allerlei Mannerleut nach. Die werden Dich bald nicht mehr kennen. Nur zum Zeitvertreib bist ihnen gut, heiraten will Dich eh’ keiner. ’s wird Dich reuen, so viel Du Haar auf dem Kopf hast, wenn Du jetzt beim braven Seizmüller nicht ja sagst.“
Das Mädchen hielt die Schürze vor das Gesicht, und ja sagen vom Herzen, das könnt’ sie halt nimmer.
„Was willst denn anheben?“ fragte sie der Vater. „Vielleicht morgen schon kommen sie und werfen uns aus dem Haus. Du kommst, wenn’s gut geräth, in einen harten Bauerndienst; wirst nichts zu lachen haben dabei. Und Dein alter Vater geht mit dem Bettelsack um.“
Seine Augen waren immer naß und roth unterlaufen, an ihnen war eine Gemüthsbewegung nicht zu merken. Hingegen weinte Walpa bitterlich und der Rothhaarige — das war ja der Seizmüller — trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. —
Noch am selben Abend lief die Walpa zu der Nachbarin: „Thorhofbäuerin, ein Stein liegt mir auf...“ Und sie schluchzte.
„Maria und Josef, Walpa, was ist denn geschehen?“
„Weiß mir nimmer zu helfen. Heut’ haben sie uns Alles versiegelt und jetzt soll ich den Seizmüller nehmen.“
„Was sagst?“
„Der Seizmüller giebt das Geld her, wenn ich ihn heirate, und daß sich mein Vater wieder kunnt heraushelfen.“
„Es ist kaum sechs Wochen her, seit er sein erst Weib in den Freithof hat tragen lassen,“ sagte die Thorhofbäuerin.
„Desweg, das gefällt mir schon gar nicht und mich deucht, diesen Menschen heiraten, das kann ich nimmer. Ich hab’ nichts gegen den Seizmüller, aber allweg kommt’s mir vor, das ist für mich nicht der Rechte, und es geht mir halt was zu Sinn. Thorhofbäurin, ich bin schon hell verzagt.“
„Walpa,“ sagte die Bäuerin, „setz’ Dich her und iß mit uns Schmalznocken.“
Dann kam auch der Thorhofbauer herbei, und sagte: „Mit Euch Mädeln ist’s halt ein Kreuz. Ihr wollt’s was, und wißt’s nicht was, und da habt Ihr so allerhand Einbildungen. Ich weiß nicht, warum Du den Seizmüller nicht sollt’st nehmen. Ein braver, fleißiger Mann, der Reichste in der Gegend. Oft eine Andere wär’ zu tausendmal froh über eine solche Heirat, und es ist ja ein Glück, das Euch Gott vom Himmel schickt, jetzt, wo die traurige Sach mit der Pfändung ist. Mit allen Vieren greif zu, Walpa, das kann ich Dir sagen.“
Als sie davon wollte, eilte ihr die Thorhofbäuerin noch bis zur Thür nach und that dort mit leiser Stimme die Frage: „Ja, Walpa, weißt Dir einen Andern?“
„Gar nicht, gar nicht,“ versicherte das Mädchen und hat so ein Geheimniß verschwiegen.
Ungetröstet ging sie heimwärts.
Am andern Tag, als sie zur Messe ging, redete sie mit dem Kirchenvater, dem Erlsberger, was denn der meine.
„Gefreut mich, daß Du meinen Rath verlangst, Dirndl,“ sagte der Erlsberger, „schau, mich geht das Ding nichts an, kann auch nicht sagen, daß ich auf den Seizmüller extra was hielt’; er ist bisweilen ein bissel knopfig; aber ich thät Dir doch rathen, daß Du ihn nimmst. Es wird’s schon thun. Immer eine Ehe, die aus lauter Liebschaft geschlossen wird, ist zuletzt gar nicht glücklich, und immer eine, bei der sich die Zwei anfangs völlig nicht mögen, macht sich nachher recht gut. Das ist halt, wie die Leut’ zusammen geschaffen sind. Eine Einsicht hat er doch auch, der Seizmüller, und wenn er jetzt um Dich anhält, so wird er auch brav auf Dich schauen. Und mußt wissen, Walpa, in solchen Dingen muß man seinen Eltern folgen. ’s ist doch auch was, wenn Du[S. 244] Dir Dein Lebtag lang sagen kannst, Du hast Deinen Vater aus der Noth gerissen, und bei so einem Kind wird der Gottessegen auch nicht ausbleiben.“
„Wenn ich nur ein bissel was verspüren thät,“ meinte die Walpa, „er ist gar so viel herb und wirbt um mich, als wollt’ er — Gott wird’s mir verzeihen — einen Mühlesel kaufen. Ist halt ein trauriger Werber, der keine Lieb’ mitbringt.“
„Wesweg will er Dich denn, wenn nicht aus Lieb’,“ wendete der Bauer ein, „er könnt’ wohl gewiß Reichere haben, als Du bist — auf das mußt Du denken, Walpa, und so mußt Dir’s auslegen.“
„Vergelt’s Gott, Erlsberger,“ sagte nach einer Weile die Wirthstochter, „Ihr habt mir leichter gemacht. Ja, ja ’s wird das Beste sein, ich probir’s.“
„Mit dem Probiren ist’s nichts, Walpa. Sagst ja, so sagst es für’s Leben. Und da möchte ich Dir noch rathen, daß Du, wenn Du Dich schon entschlossen hast, frisch und munter drein gehst. Das Wanken und Zweifeln und Fürchten taugt nichts. — ’s wird schon gehen, er ist brav, ich bin brav und uns hat Gott zusammengeführt — so mußt Dir denken. Nu, Dirndl, wünsch’ Dir viel Glück!“
Darauf, wie sie den Vater sucht, daß sie ihm’s sagte, sie wäre bereit, findet sie ihn unten im Keller. Hat von der Pippe des größten Fasses das Amtssiegel herabgerissen.
„Aber um der Heiligen willen, Vater, was treibt Ihr denn?“
„Trinken.“
„Da sperren sie Euch ja ein!“
„Deß’ will ich mich früher ersäufen.“
Nun sagte sie’s, sie wolle den Seizmüller nehmen
Darauf trank er erst recht.
Keine Zeit war zu verlieren, denn die Gant des Wiesenwirthshauses war ausgeschrieben. Am nächsten Tage wurde die Walpa Braut des Seizmüller. Der Bräutigam lachte viel und zeigte, daß er gemüthlich sein könne. Allsogleich kaufte er ihr im nächsten Städtchen Stoff für ein goldgelbes Kleid und eine hochaufgebauschte Haube mit feuerrothen Bändern, wie sich’s für eine Frau Müllerin wohl geziemt. Aber Walpa dachte, wenn ich diesen Anzug muß tragen, so zeigen die Leute mit Fingern auf mich.
Noch in den letzten Tagen vor der Hochzeit ging Walpa zu ihren Bekannten um, und fragte, wie sie denn dran sei, ob sie den Müller doch nehmen solle? Die Allermeisten riethen dazu, und die ihr davon abredeten, von denen sagten wieder Andere: „Geh, geh, wenn man auf so Leute Reden losen wollt’! Die wissen gegen Jeden was, wenn er heiratet, das ist schon so der Brauch. Aber wenn Du nachher allein dastehst und Hilf’ brauchst, helfen thun s’ Dir nicht.“
In der letzten Nacht vor der Trauung ist der Walpa im Traume die verstorbene Mutter erschienen, die hat gewinkt, hat die Tochter bei der Hand genommen, als wollte sie sie davonführen. Es war ein süßer und dabei wieder ein angstvoller Traum. Die Böllerschüsse haben sie davon geweckt.
Unter den vielen Hochzeitsgästen war auch der Blasius Steiger, ein frischer, sauberer Bursche, den die Walpa wohl kannte. Er war vor zwei Jahren noch als Postillon durch die Gegend gefahren und hatte das Posthorn geblasen, daß es eine Herzenslust gewesen. Beim Wiesenwirth war er stets eingekehrt, wenn auch nur auf ein klein Tröpfel zum Staubhinabschwemmen — länger wollten die Rößlein und die Reisenden nicht warten. Dem Blasi war die Walpa nicht ein[S. 246] einzigmal auf dem Bein gehockt. Der Blasius hatte sie nie geneckt, nie bewitzelt, war immer ernsthaft und freundlich gewesen und hatte immer gerade am Wiesenwirthshaus seine schönsten Weisen geblasen. Hätte Einer die Walpa gesehen, wie sie diesem Blasen zuhörte, so hätte der leicht merken können, daß die Burschen alle genarrt waren, denen sie auf der Ledernen saß. Der hätte ahnen mögen, daß dieses Mädchen nicht so seicht wäre, als es sich wohl geben mußte. Seit der Eisenbahnzeit war der Blasius im Pongau d’rüben gewesen; nun, und heute war er unter den Hochzeitsgästen, eigentlich unter den Musikanten; er blies das Flügelhorn. Nur ein- oder zweimal hatte Walpa den Burschen verstohlen angeblickt — nichts weiter, kein Ehrentänzchen, kein Lächeln, kein freundlich Wort über vergangene Zeit...
Mittags, zehn Minuten nach eilf Uhr, war Walpa das Weib des Seizmüllers geworden.
Nach der Trauung ließ sie sich im Wirthshaus ein Stübchen aufsperren, um die Kleider zu wechseln. Sogleich stand ihr Mann da: „Was willst denn?“
„’s thut mir leid um das schöne Gewand,“ sagte sie, „für’s Essen und Tanzen will ich einen leichteren Rock anlegen.“
„Weißt, Walpa,“ versetzte er, „wenn ’s mir nicht leid thut d’rum, so brauchst keine Umständ’ zu machen. Es geht aus meinem Sack, mußt nicht vergessen.“
„Ich hab’ nur gemeint,“ entgegnete sie leise, „weil’s die Andern auch all’ so machen.“
„Auf die Andern hast gar nicht zu schauen, Walpa; ich bin der Herr, mir hast zu folgen, und das kannst Dir merken ein- für allemal.“
„Hätt’ mir doch gedacht, daß ich von meinen Kleidern anlegen kunnt, was ich selber wollt’ — und das muß ich[S. 247] Dir schon sagen: theuer mag das Kleid wohl gewesen sein, das Du mir gekauft hast, aber sauber ist es nicht.“
„Ja hörst, Weibel, wem willst denn jetzt sonst noch gefallen? Etwa dem Postbuben — den Du voreh so verliebt angelugt hast? Du, das sag’ ich Dir, in solchen Sachen versteh’ ich keinen Spaß!“
Ziemlich schwer ließ der Seizmüller bei diesen Worten die Faust auf den Tisch niederfallen. Walpa sagte kein Wort mehr und behielt das orangenfarbige Kleid und die Flitterhaube mit den feuerrothen Bändern am Leibe. Sie war den einfachen, geschmackvollen Anzug der Oberländerinnen gewohnt, sie wußte wohl, wie fein ihr derselbe ließ. — Nun wäre sie am liebsten gar nicht mehr unter die Leute gegangen, aber sie wollte ihrem Manne keinen weiteren Anlaß zur Unzufriedenheit mehr geben, und so fügte sie sich in das für sie recht traurige Hochzeitsfest.
Der Wiesenwirth war dabei gar lustig; gab’s ja viel Wein und auch daheim waren wieder alle Spundlöcher offen, seitdem der Seizmüller-Schwiegersohn das Gericht und die Gläubiger durch etliche große Banknoten beschwichtigt hatte.
Laut war’s im Festhause, und die Leute können heute noch nicht Wunders genug sagen, wie es doch so lustig gewesen wäre bei des Seizmüllers Hochzeit.
Am andern Tage, als Vater und Gatte noch schliefen, ging Walpa in die Kirche und betete unter heißen Thränen um Gnade und Kraft, sich geduldig in das Ehejoch zu fügen und stets das Rechte zu finden, um den Hausfrieden zu erhalten.
Von der Kirche ging sie auf den Friedhof und legte einen Kranz auf das Grab des ersten Weibes ihres Gatten; der Erdhügel war ganz kahl, nicht ein einziger Grashalm[S. 248] stand darauf. Walpa hatte ihre Vorgängerin nicht näher gekannt, diese hatte immer ganz zurückgezogen in ihrem Hause gelebt und erst von sich sprechen gemacht, als es hieß, ein im Wettersturm niederstürzendes Dachbrett habe die Seizmüllerin erschlagen. — Walpa wußte aber, daß es die Ehemänner nicht ungern sehen, wenn die zweite Gattin das Andenken der ersten ehrt, und darum den Grabkranz.
Etliche Tage später sagte der Müller zu seinem Weibe: „Ich habe gehört, auf dem Freithof d’raußen bei meiner Alten soll so ein Laubwisch liegen. Hast Du’s gethan, so will ich Dir nur sagen, es stünd’ Dir besser an, Du thätst Dich um die Lebendigen kümmern, als um die Todten. Wie schaut denn mein zerrissen Unterleibel aus?“
„Da bitt’ ich Dich wohl um Verzeihung, ich hab’ gar nicht gewußt, daß Du ein Unterleibel tragst.“
„Trag’ auch keins, aber könnt’ eins tragen, und eine gute Hausfrau thät’ wenigstens darnach fragen.“ —
So ist diese Ehe angegangen. Diese Ehe, die zum größten Uebel hat geführt und deren Geschichte über manchem Thore stehen sollte als Warnungstafel: Verbotener Weg!
Der Seizmüller, so heiter und laut lustig er in Gesellschaft und im Wirthshause bei Kameraden sein mochte, so finster, herrisch gab er sich zu Hause. Er konnte keinen Widerspruch leiden, widersprach aber selbst in allen Dingen. Trotz reizte ihn, und auch Milde; und wenn er gereizt war, so schlug sein sonst höhnisches Wesen in einen förmlichen Wuthrausch über — und in solchen Momenten kannte er keine Ueberlegung.
Oftmals hat sich in dem jungen Weibe der Trotz aufbäumen wollen, wenn ihr so sehr Unrecht geschah; dann aber sagte sie wieder: Nur noch ein Eichtel Zeit hab’ Geduld,[S. 249] ’leicht kommt noch ein Friedensengel in’s Haus. Bös’ und schlecht ist er ja doch nicht, mein Mann, nur herb und ein wenig wunderlich; mein Gott, er hat seine Sorgen und Aergerniß in der Wirthschaft. —-
In der Wirthschaft stellte der Seizmüller seinen ganzen Mann. In der Mühle klapperten allfort vier Gänge und daneben ging eine emsige Brettersäge. Dann war auch eine Stampfe für Leinsamen dabei, die jedesmal im Winter, wenn die Säge stillstand, viel verdiente. Die Aecker und Wiesen, die zur Mühle gehörten, wurden gut bewirthschaftet. Freilich that auch die Walpa viel dazu, um durch Güte die Dienstleute und Mühljungen zu beschwichtigen, wenn sie die Grobheit und Unbilligkeit des Müllers zu vertreiben drohte.
Bei solch’ einer Gelegenheit, als sie einem Mühlburschen, der in der Kammer seit einigen Tagen krank lag, eine kräftigende Fleischbrühe zuschanzte, die sonst nicht gebräuchlich war, bekam die Walpa von ihrem Manne den ersten Schlag. „Heimlichkeiten mit dem Mühljungen!“ gurgelte er, berauscht von Wein, dem er immer mehr und mehr zusprach, „wächst sich die Kellnerinliebelei so aus? Walpa, Walpa, Dich muß man anders biegen, mit Gütigkeit richtet man bei Dir nichts!“
Unter Weinen lachte sie auf. — Mit Gütigkeit! so sagte Der, von dem sie kaum ein einzig freundlich Wort noch gehört hatte.
Sonst war sie zu ihrem Vater gegangen, um sich an seiner Brust auszuweinen. Jetzt, ein Jahr nach der Müllershochzeit, lag der Wiesenwirth unter der Erde. In seinem Keller war er todt gefunden worden. Da klagte sie ihre Noth anderen Leuten, und darüber sagte ihr der Gatte einmal: „Du bist schon ein fürnehm Ehweib Du, gehst von Haus zu Haus und bringst Deinen Mann um den guten Namen,[S. 250] machst mich zum Tyrann, zum Wildfang, zu was weiß Gott Alles! Du, Walpa, ich sag’ Dir’s, gieb Obacht, daß es nicht wahr wird, was Du sprichst!“
„O, das ist lang’ schon wahr!“ rief sie aus, „und ich weiß nicht, wie ich mich denn so versündigt hab’, daß ich an einen solchen Menschen hab’ müssen gebunden werden. Kein größeres Kreuz auf der Welt!“
„Ja freilich, winseln und flennen, das ist noch Dein Bestes. Du Betteldirn!“ Und er stieß sie hintan, daß ihr Leib an die Kante des Herdes fiel und sie zusammenbrach.
„So — so —“ stammelte sie mit dumpfer Stimme, „an mir — weiß ich wohl, daß Dir nichts gelegen ist, aber daß Du Dein Kind im Mutterleib — —“
Da lachte er auf und meinte, das müsse man erst untersuchen, ob es sein.
Das Weib lag in einer Ohnmacht.
Tagelang schwebte sie zwischen Leben und Tod, und als sie endlich — der Gatte hatte sie in der Krankenstube kaum ein einzigmal besucht — insoweit gerettet war, daß sie wieder zu denken und zu sinnen vermochte, seufzte sie ein- um das anderemal: „Das ist eine Ehe! o Gott, mein Gott, verlaß’ mich nicht!“
Und im Traume hörte sie das Posthorn klingen; da rief sie mehrmals laut den Namen Blasius. Und aufwachend flehte sie zur Mutter Gottes: „Bewache mich, daß dieses Wort nicht noch einmal über meine Lippen kommt, sonst ist’s mein Verderben.“
Als sie wieder so weit genesen war, daß sie — ein Schatten gegen früher — in das Freie wanken konnte, suchte sie den Pfarrer auf und fragte ihn, ob es denn gar kein Mittel gebe, daß sie von diesem Menschen, dem Seizmüller, wieder[S. 251] befreit würde. Der geistliche Herr riß die Achseln empor und gab ihr schöne Lehren.
„Ei, ei,“ unterbrach ihn die Walpa, „was der Herr da sagt, das hab’ ich lang’ schon gewußt und gethan. Scheiden lassen will ich mich.“
Der Pfarrer machte ein saures Gesicht und lächelte. — „Scheiden lassen — das ist leicht gesagt, meine liebe Seizmüllerin. Von Tisch und Bett könnt’ Ihr Euch trennen, aber vor Gott seid Ihr doch ein Ehepaar.“
„Vor Gott sind wir nie ein Ehepaar gewesen!“ sagte das Weib, „ich bin schier mit Gewalt in diese Ehe hineingedrängt worden, mein Herz hat nichts davon gewußt, und immer ist es nicht gut, wenn das Kind seinen Eltern folgt!“
„Müllerin,“ versetzte der Pfarrer, „das ist keine christliche Red’, und wenn man Euch hört, so könnte man fast meinen, es wäre an Euch selber die Schuld.“ —
Ganz ohne Trost, nur noch rathloser und erbitterter verließ sie den Pfarrhof.
Eine gutmüthige Nachbarin rieth ihr, sie sollte zum Gericht gehen. Sie ging zum Gericht und drängte auf Scheidung.
— Ehescheidung?! Das war was Neues, das war in der Gegend seit Menschengedenken noch nicht vorgekommen.
„Liebe Frau,“ sagte einer der Herren, „zum Eheschließen müssen Zwei sein, und zum Ehetrennen auch. Wird Euer Mann einwilligen?“
„O,“ rief das Weib, „der will wen zum Peinigen haben, der wird sein Lebtag nicht einwilligen.“
„Dann ist nichts zu machen. Das Beste, Ihr versucht es noch einmal, Euch gütlich miteinander zu vertragen. Wenn es Euch recht ist, so wollen wir Euren Mann, den Seiz[S. 252]müller, rufen lassen und ihm seine Verpflichtungen vorhalten, damit —“
„Um Gotteswillen, nur das nicht! Wenn ich schon bei ihm bleiben muß, so darf er’s um all’ mein Leben und Sterben nicht erfahren, daß ich in solcher Angelegenheit bin dagewesen.“
„So geht heim und versucht es noch einmal, es wird sich geben, nur der redliche Willen gehört dazu. Behüt’ Gott!“
— So vernünftig reden sie und wissen nicht, wie es in der Mühle aussieht — Zank und Hader, Trotz und Wildheit, Haß und Gewalt. Die Walpa soll wieder zurückkehren zu ihrem größten Feinde.
Da besann sie sich. Hoch oben auf dem Zinken steht eine Capelle mit einem wunderthätigen Marienbilde. Schon Viele sind durch der Jungfrau Fürbitte befreit worden aus ihrer Noth. Sie stieg mit Mühe den hohen Berg hinan. Und dort oben zwischen den Felsen, wo kein Bäumlein und kein Blümlein mehr wächst, lag sie vor dem Bilde und betete: „Gieb’ mir ein, o Mutter, was ich thun soll! Weise mir einen Ausweg, und wenn schon kein anderes Mittel ist, so laß mich sterben.“
Am Eingang der Capelle stand, von ihr unbemerkt, ein Tourist und hörte ihr zu. — Ein blasses, hübsches Weib betet vielleicht in Liebessehnsucht?
Als sich Walpa erhob, trat er zu ihr; er erkannte sie nicht mehr; sie sah es, das war der junge kecke Städter, mit dem sie vor länger als einem Jahre in ihrem Heimatshause zusammengesessen war.
„Bist ganz allein hier oben?“ fragte der Fremde, „dann will ich Dich führen und will Dir auch den Ausweg weisen, um den Du eben gebetet hast.“
„Wohin wollen denn Sie mich führen, wohin?“
„Einstweilen bis zu den Zirmbüschen hinab, hier geht ein scharfer Wind.“
Walpa stieg an seiner Hand hinab und gedachte dem Fremden, der ihr nun schon das zweitemal freundlich genaht war, ihr Anliegen mitzutheilen.
Auf dem Bergmoos zwischen dichten Sträuchen, die sie wie ein undurchdringlicher Wall umgaben, saßen sie und Walpa schüttete ihr Herz aus vor Dem, der ihr so theilnahmsvoll zuhörte.
Und als sie schluchzend geendet hatte, sagte er: „Was Du da erzählst, das könnte Einem das Herz durchschneiden. Das hält kein Mensch aus; dieser Seizmüller muß eine elende Creatur sein. Von dem mußt Du Dich befreien. Wenn Du es nicht schon so machen kannst oder willst, wie es die Kathrina Schmachegger gemacht hat, deren Proceß vor wenigen Tagen abgelaufen ist, so — nu, so mußt Du es eben anders machen. Du bist hübsch und noch jung, Freundin, Dir kann’s nirgends fehlen. Gehe in die Stadt...“
Nimmer konnte es das harmlose Landweib verstehen, was der Fremde meinte. — In die Stadt gehen, das gefiele ihr schon. Wenn sich nur Alles so einrichten ließe, daß kein Aufsehen entstünde und daß der Seizmüller schließlich nicht etwa ihren Aufenthalt entdeckte. Lieber wäre ihr freilich noch ein anderer Ausweg, als den angetrauten Ehemann so zu verlassen — und was denn die Kathrina Schmachegger gethan habe, von der er vorhin gesprochen?
„Die Schmachegger war eine Bäuerin aus dem Untersaß,“ belehrte der Fremde, „diese hat ihrem Ehegatten, mit welchem sie in Unfrieden lebte, in einer Krankheit, die über ihn gekommen war, den Beistand versagt und ihn verderben[S. 254] lassen. Sie ist aber freigesprochen worden, denn es war doch nicht bewiesen, daß ihre besondere Pflege ihn gesund gemacht hätte. Und es war nur die Unterlassung einer Tugend, zu der das Gesetz Niemanden zwingen kann.“
Darauf hat die Walpa stillgeschwiegen und der Stadtherr, der in’s Gebirge gekommen war, um die Natur zu genießen, hat seinen Arm ausgebreitet, sie möge ihn für den Freund halten, sie möge sich entschädigen für das harte Kreuz, das sie tragen müsse und sie möge dieses Kreuz mit aller Macht abschütteln.
Still war’s; auf solchen Höhen summen keine Mücken und die Vögel hatten sich versteckt in’s traute Heim unter den Büschen. Der Zirm schien höher und höher zu wachsen, ein weißer Schmetterling gaukelte im Zickzack heran.
„So!“ rief die Walpa plötzlich und ihre Stimme war laut, „ein solcher Freund sind Sie? — Nein, lassen Sie mich! Jetzt sitzt doch schon überall der Höllische, wo man hinschaut!“
Sie floh davon, und wie lange der Bergwanderer noch gelegen ist zwischen den Büschen, man weiß es nicht — verlangt es auch nicht zu wissen.
Walpa war wieder zurückgekehrt in die Mühle und hatte sich noch einmal fest vorgenommen, dem Müller ein treues Eheweib zu sein, Alles, was über sie kommen sollte, mit Ergebenheit zu tragen und ihr Herz verhärten zu lassen zu einem Stein.
Wohl, Herzen können verhärten, bleiben aber dennoch heiß und schwer und glückbegehrend. Walpa sah andere Ehen voll stillen, fröhlichen Glückes; sah an ihrem Hause vorbei manch’ freudiges Paar wandeln, manchen Brautzug, sah manch’ Kindlein tragen von den Engthälern heraus gegen die[S. 255] Kirche zur Taufe. Sie könnte es auch so haben. — Ob der Blasius wohl schon ein Weib hat? — Der liebe Schutzengel behüte vor aller Versuchung. — Ihr Mann ist ja auch ein Mensch, sie will ihn schätzen, will ihn pflegen; er hat doch Niemanden auf der Welt als sein Weib. — Die mildesten Worte hatte sie für den Gatten und mit Sorgfalt bereitete sie stets sein Mahl. Er aß es brummend und finster. Wenn er nüchtern war, so hörte sie von ihm kein Wort. — Das war ihre glücklichste Zeit und sie dachte, sagt er nichts, so wird er wohl zufrieden sein. Aber wie selten! — Es verging kein Tag, an welchem sie von ihrem Manne nicht eine Rohheit erfuhr. Er polterte und fluchte und spöttelte und höhnte, er that ihr Schimpf um Schimpf an und wenn sie dagegen auftrat, so ging’s ihr hart wie einer Sklavin, wie einem Hund, den der Zornige mit Fußtritten von sich stößt. Es ging auch die Wirthschaft schlechter und in der Mühle ruhten die Räder öfter, als es Sonntag war. Den Seizmüller reute das Geld, welches er für den Wiesenwirth ausgegeben hatte, anstatt er Brauthabe hätte bekommen sollen. „Wie mich der Teufel nur so hat verblenden mögen!“ rief er im Grimme, „daß mir ein Bettelweib hat können gefallen. Deine Schönheit? Ha, da muß ich lachen! Angethan hat sie mir’s und seit sie in der Mühl’, ist kein Segen mehr.“
Da hob die Walpa zu ihm die gefalteten Hände: „Lieber Mann, so laß mich wieder fort! Ich seh’s ja auch ein, wir taugen nicht für einander, wir können Beide nicht dafür. Ich will ja mein Lebtag lang keinen andern Mann, ich will Dir danken bis zum letzten Athemzug, nur fort laß mich, ich bitte Dich um des heiligen Kreuzes Jesu willen!“
„Ah!“ stieß der Seizmüller schnaubend heraus, „davonlaufen, das geht Dir noch ab, Du Zigeunerdirn. Meinst,[S. 256] ich wollt’ nicht auch meinem Gott danken, wärst Du aus dem Hause? — Thät’st Dir wohl in die Faust lachen, wenn die Leut’ mit Fingern auf mich zeigten: Schau, schau, das ist der alte Esel, dem ist sein Weib durchgegangen! In’s Unglück hast mich schon gebracht, jetzt willst mich auch noch in die Schand bringen? — Jesses, mir zucken gerade die Händ’! In die Mauer wollt’ ich Dich — Du — Du Creatur!“
Er langte nach ihren Locken, sie stürzte davon. Draußen, hart am Mühlbach, sank sie zu Boden.
— Ihrem Leben ein Ende machen? — Noch so jung, so weltbegehrend — und dieses Wütherichs wegen sterben! — — Nein, dafür haßt sie ihn zu sehr. Sie kennt nun ihren Entschluß, sie sinnt nicht mehr, sie weint nicht mehr — in stiller Nacht, während der Mann im Wirthshause sitzt, schnürt sie ihr Bündel und geht davon. Wohin sie kommt, was mit ihr geschieht — alleins. In alles erdenkliche Elend will sie sich lieber stürzen, als bei diesem Teufel leben.
Mit der Hast einer Verbrecherin floh sie, Alles zurücklassend, was ihr eigen war auf Erd’. Mit dem ersten Schritte über die Markung der Mühle hinaus war sie in Acht und Bann der Armuth und Noth. Aber sie kreischte auf vor Lust, als sie sich frei fühlte. So weit man sie noch kennt, ist sie die Müllerin, die mit ihrem Bündel eine drüben in der Scharn erkrankte Muhme heimsucht. Später, wo sie wer anfrägt, ist sie eine Schnitterin aus dem Untersaß und geht aus auf einen Verdienst. — Sie hätte so viel Aehnlichkeit mit der Seizmüllerin in der Transau, sagte ihr ein alt Weiblein. „Ja,“ entgegnete die Walpa, „ich bin mit ihr verwandt.“
„Wie’s nur sein hat mögen, daß die das große Glück mit dieser Heirat hat gemacht?“ meinte das Weiblein.
„Nach der ihrem Glücke verlang’ ich nicht,“ sagte die Walpa.
„So sollt’s letztlich doch wahr sein, was die Leut’ reden?“ warf die Alte ein.
„Wüßt’ nicht, daß die Leute viel drüber thäten reden.“
„Daß der Müller so ein Wildling wär’! sagt man. Allerweil im Rausch. Soll’s denn wahr sein: das erste Weib hätt’ er erschlagen und dem zweiten Weib wollt’ er’s g’rad so machen. — Ich glaub’s schon! Vom Seizmüller glaub’ ich Alles, mit dem ist mein Hansel in die Schule gegangen und der weiß saubere Sachen zu erzählen. Ein durch und durch schlechter Mensch, der Müller. Die arme Haut, die Walpa!“
„Am besten wär’s, der lieb’ Herrgott thät’ sie zu sich nehmen,“ versetzte ein neu hinzugetretenes Weib mit einem Seufzer.
„Geh’, Närrisch!“ rief die Alte. „Die Walpa ist ja keinem Menschen im Weg auf der Welt, aber den Müller soll der leidig Teufel holen!“
„Verzeih’ Dir die Sünd’!“ fiel die Andere ein.
„Na, grimm’ Dich nicht. So eine Sünd’ wird der Herrgott gern verzeihen. Wenn’s Alles wahr ist, was die Leut’ sagen, wahrhaftig, so thät’ ich mir gar kein Gewissen d’raus machen, diesem Menschen was anzuthun.“
„Ich sag’, es soll Jeder Gott danken, dem’s besser geht,“ meinte die Walpa und eilte weiter.
Tagsüber irrte sie in den Bergwäldern. Von Müdigkeit übermannt schlief sie auf einer Steinplatte, über welche der Epheu spann und die Eidechsen hin und her liefen.
Auf diesem Stein — ihr schönster Schlummer war’s gewesen. Im Klange eines Posthorns hatte sie der Jugend[S. 258] fröhliche Zeit gesehen — da fühlte sie plötzlich einen Stoß, als sei die Welt zersprungen. Rasch fuhr sie empor. Es war dunkel im Wald und nur auf den hohen Gipfeln lag des Abends goldreicher Sonnenschein.
Und neben Walpa stand der Seizmüller und grinste. Wie ein geschrecktes Reh sprang sie auf und einen getrennten Fetzen ihres Kleides noch zurücklassend in seiner krampfigen Faust, lief sie den Hang hinab, über das kantige Gestein und der finsteren Schlucht zu. Hinter sich hörte sie das Dröhnen seiner Sprünge, hörte seine schnaubenden Flüche. Gott rief sie an und ihren heiligen Schutzpatron — und huschte durch dorniges Gesträuche und glitt nieder über schroffe Lehnen, daß Moos und Sand in den Lüften wehten. — Sie entkommt ihm, schon ist sie seinen Augen entschwunden und das Brausen eines Wildbaches vereitelt ihm das Geräusch ihrer Schritte. Da steht sie jählings am Wasser und kann nicht weiter. Sie eilt am Ufer auf und ab und hört des Mannes Lachen. Ein wildästiger Tannenbaum, vom Sturme gebrochen, liegt über dem gischtenden Bache. Auf diesen springt sie, um hinüber zu klettern.
Der Mann stürzt ihr nach. Die morschen Aeste krachen. Walpa’s Haare verschlingen sich in’s dürre Gezweige, da faßt er sie — und hier auf diesem unheimlichen Grunde, der Verzweiflung voll und der Wuth, stemmt sie sich wie rasend ihm entgegen und ihre Finger zucken nach seiner Gurgel. So ringt das Ehepaar auf der wilden Brücke, daß der Baumstamm ächzt, und aus dem mächtigen Abgrunde herauf schimmert der Schaum des Bergstroms. — Walpa fühlte, daß es ihr Verderben, wenn sie den verhaßten Mann in diesem Augenblicke nicht zu vernichten vermöge, doch sie vermag nicht aufzukommen gegen des Mannes Kraft, nur einen[S. 259] Augenblick loszumachen sucht sie sich von seinen ehernen Armen, um sich in die Tiefe zu stürzen — da erfaßt er sie noch, reißt sie zurück und schleudert sie hin an das Ufer.
Blutend und betäubt liegt sie im Brombeergebüsch und der Müller, an den Lippen noch den Schaum der Wuth, steht hohnlachend vor ihr. — Leicht hätte man es sehen mögen, daß es ihm zur Lust und Leidenschaft geworden — vielleicht zu seinem höchsten Lebensgenuß — sein armes, hilfloses Weib zu peinigen. Darum hatte er sie verfolgt mit heißer, verlangender Gluth, darum brachte er sie nun tief befriedigt zurück in sein Haus.
Von dieser Zeit an hatte man die Walpa tagelang nicht mehr gesehen. Der Müller klagte es mit bekümmerter Miene den Leuten, sein Weib sei krank und es mache sich in ihr etwas wie eine Geistesstörung bemerkbar. Wohl sei sie bisweilen launenhaft, auch tückisch und trotzig gewesen, aber er habe doch stets die Nachsicht und Liebe mit ihr gehabt, die einem Ehemanne ziemt. Nun aber, wahrscheinlich von einem unruhigen Gewissen gequält, oder vielleicht auch durch andere Zustände verwirrt, litte sie am Verfolgungswahn. So sei sie vor einiger Zeit mitten in der Nacht aus der Mühle davon und in den Scharnwald hinüber, wo sie sich in’s Wasser stürzen wollte. Just daß er — der geängstigte Gatte — noch zu rechter Zeit nachgekommen sei und sie gerettet habe. Seitdem müsse er die Arme bewachen, er hoffe aber, daß durch eine richtige Behandlung sich die Sache wieder schlichten werde.
Walpa war eingesperrt in eine Kammer rückwärts der Mühle, wo der Müller Kornspreu und verdorbenes Getreide gelagert hielt. Auf dem Spreuhaufen lag sie und wühlte die Körner hervor, die sie gierig verschlang. Durch ein ver[S. 260]gittertes Fenster starrte eine kahle Felswand herein, und das ewige Rauschen des Fluders betäubte das Ohr.
„Jetzt sehe ich es klar,“ murmelte sie, „Gott sei Dank, daß ich es endlich sehe. Alle Stege sind gebrochen. Nur ein einziger liegt noch da — nur noch ein einziger. Walpa, das ist ein schwindelnder Steg! — Mein junges Leben, Du bist das Einzige, was ich noch hab’, Dich halte ich fest. — Ob ihn das Gericht verurtheilen thät’, wenn es wissen könnt’, wie er mich martert? Das kann’s aber nicht wissen, er sagt’s nicht und man kann es nicht sagen, weil es nicht zu sagen ist. Gott, der’s weiß, verurtheilt ihn gewiß.“
Aus tiefen Träumen fuhr sie manchmal empor und sagte: „Es ist keine Sünde und die Kathrina Schmachegger hat sich auch geholfen.“ — Dann wieder betete sie ein Vaterunser um das andere und in die Worte: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Uebel“, legte sie ihr ganzes Herz.
Von draußen hörte sie zuweilen das Poltern und Fluchen des Müllers. Dann wieder in den Nächten vernahm sie neben und über sich das Unwesen der Mäuse und Ratten, und oft that sie einen Schrei des Grauens, wenn so ein Thier über ihren Körper lief. Dann des Morgens, wenn die alte, taube Magd mit angstvoller Geberde das spärliche Brot brachte, stellte sich die Walpa schlafend oder starrte in die Finsterniß hinein. — Man wird sie doch wieder freilassen, man muß ja, sonst würden die Nachbarn kommen und die kranke Müllerin sehen wollen. Dann will sie ihre Erlösung vollenden.
Was will sie? So weit hätte sie ihn schon zurückgelegt, den Weg des Leidens, der Schmach, der Anfechtung, der Hölle, daß sie jetzt auf der letzten Station steht? Wiesen[S. 261]wirthstochter! Du, mit Deinem guten, liebevollen Weibesherzen, eine Einzige aus Millionen, die das vollbringt? —
Endlich war die alte Magd einmal davon gegangen, ohne die Thüre der Kammer zu verschließen. Die Walpa blieb noch. Sie sah einem Spiele zu. Nein, es ist nur dem Menschenauge Spiel — dem Thiere ist es Arbeit und Streben nach seinem Lebensziele. Von der morschenden Decke, von der bei jeder Erschütterung in der Mühle der Moder niederstaubte, ging ein feiner Faden herab bis gegen die Füße der Walpa. An diesem Faden strebte eine Kreuzspinne empor.
Jetzt, das soll mir das Zeichen sein und der Richterspruch, dachte Walpa und starrte auf das Thier. Kann es nicht hinauf bis zur Decke oder bricht der Faden, so gehe ich und werfe mich in den Räderdumpf. Kommt die Spinne hinauf, so bringe ich ihn um. —
Das Thier krabbelte träge und langsam und mußte oft rasten. Es war schwer, es war noch weit unten und der Faden schien sich bisweilen zu dehnen. Dann wieder nahm die Spinne einen raschen Lauf, und dann wieder stand sie lange still auf einer und derselben Stelle. Es war ein gespenstig Wesen und das weiße Kreuz auf seinem Rücken — ein Grabkreuz — wem galt es, ihr oder ihm?
Endlich, die Spinne war noch eine gute Elle von der Decke entfernt, wollte sie nicht mehr weiter, ja kehrte sich ein paarmal um, und war dann wieder bewegungslos.
Walpa zitterte, schier stockte ihr der Athem. Das Thier blickte mit seinen vielen großen Augen gegen den Boden hinab. — Soll sie in’s Grab? Ist auch bei diesem Gethier, das kein Gesetz kennt, das tödtet, wenn es nicht selber getödtet werden will, kein Erbarmen?
Plötzlich nahm die Spinne eine Wendung und lief hastig den ganzen Faden empor bis zum Holzmoder, wo sie herfiel über eine im Netze gefangene Fliege.
„Es ist gut,“ sagte die Walpa laut.
„Was ist gut?“ rief der Müller scharf zur Thüre herein, „willst noch trotzen? Heraus geh’!“
Sie ging zu ihm heraus. „Jetzt ist mir schon wieder besser,“ sagte sie heiter, „jetzt, Mann, will ich recht fleißig sein, daß ich die Zeit wieder einbring’, in der ich krank gewesen bin.“
„Ja, möcht’ mich gefreuen!“
„Aber die vielen Ratten in der Mühl’, die muß man doch abfüttern.“
„Die Ratten allein fressen mein Gut nicht auf,“ gab er zur Antwort.
Ihr Gesicht blieb freundlich. Sie ging an ihre Arbeit. Sie stäubte mit Sorge die Kleider ihres Mannes aus, sie überzog sein Bett mit frischer Leinwand, sie setzte ihm das bestgekochte Essen vor und hatte dazu ein gütiges Wort. Und auf all’ seine Rohheiten schwieg sie still.
Am nächsten Sonntag sagte sie: „Hast nichts dagegen, Mann, so wollt’ ich heute gern eine Kirchfahrt verrichten zu Dank für die wiedererlangte Gesundheit. Wolltest mitgehen?“
„Ja, ja, häng’ Dich dem Herrgott nur recht an die Zehen, Du Betschwester, und verscherg’ (verschwärze) mich bei ihm, verschergst mich ja so gern.“
Sie ging hinaus gegen den Markt Salgstein. Sie suchte die ödesten Wege, wo die wenigsten Kirchengänger wandelten. Sie hatte Angst, sie werde sich durch ihre Miene verrathen beim Kaufmann, wenn sie Rattengift verlange. Das mußte sie gut machen, sie mußte sich üben. In einem verlassenen[S. 263] Waldschachen stellte sie sich zuerst vor einen fahlen Baumstrunk, dann vor einen grünen Strauch, endlich wendete sie sich gegen ein Eichhörnchen in den Zweigen, hielt gesittig das Sacktuch in den Händen vor der Brust und sagte halblaut, wie sich Bäuerinnen in Kaufmannsgewölben gern stellen: „Hätt’ auch gern ein wenig was. — Aber das sind saubere Seidentücheln, die kosten gewiß recht viel. Schön sind sie. Ja, daß ich sag, ein Hüttenrauch zum Rattenfutter hätt’ ich gern.“ Sie war aber nicht ganz zufrieden. Ob sie vom Rattenfutter lieber gar nichts sagen sollte? Wenn man Hüttenrauch kauft, so versteht sich’s ja von selbst, daß man es als Rattengift braucht.
Im Kaufladen zu Salgstein waren nach dem Gottesdienste viele Leute beisammen. Walpa verlangte zwei Ellen blaue Hemdschnüre, um fünf Kreuzer Neugewürz und um drei Zehner Hüttenrauch.
„Wozu braucht Ihr den Hüttenrauch?“ fragte der Kaufmann.
„Wir haben so viele Ratten in der Mühle.“
„Da müßt Ihr Euch wohl ausweisen, wer Ihr seid, meine Liebe, sonst darf ich kein Arsenik hergeben.“
„Na, na,“ rief Einer aus der Menge, „bei Der ist’s nicht so gefährlich, das ist die Seizmüllerin in der Transau.“
„Nachher hat’s keinen Umstand,“ sagte der Kaufmann. „Thut das Ding nur gut verwahren, ’s ist ein wildes Gift.“
Als die Walpa auf dem Heimweg an dem Salgsteiner Armenhause vorbeiging, saßen davor etliche Pfründner. Ihr Herz war heute so zum Wohlthun aufgelegt, daß sie alles Geld, welches sie bei sich trug, an die armen Leute verschenkte. Dann eilte sie der Transau zu. Wer sie heute so gehen gesehen, die schöne Frauengestalt, im einfachen Sonn[S. 264]tagsstaate, an welchem nicht Eitelkeit, wohl aber guter Geschmack zu spüren war! Tausend rohe Worte hatte sie darüber erdulden müssen, aber die gewohnte Art, sich zu kleiden, hatte sie den Launen ihres Mannes endlich doch nicht zum Opfer gebracht. Ihr Antlitz war in seiner Blässe nur noch schöner; doch wehte heute über ihre Wangen zuweilen ein rosiger Hauch. Ihr Auge leuchtete in lebensvoller Klarheit, als sie hinaufblickte zu den sangumjauchzten Wipfeln des Waldes und zum Himmelsblau. — Ihr war wohl, wie einer wiedergeborenen Seele. — Man hat nur ein einzig Leben, und das soll man sich wahren, von dem soll man Alles fernhalten, was häßlich ist und verderblich, um das soll man Alles sammeln, was Freude weckt. So auch hielten es die anderen Menschen, sie mochten jung sein oder alt, weltlich oder bigott; so hielt es selbst das Thier und jedes Geschöpf. — Und endlich sollte sie — die Walpa — ja der Welt wieder sein, sollte leben, wie Menschen leben mit jungem frischen Blute und fröhlichem Sinn. Sommerlicher Hauch voll Waldodem spielte um ihr lockig Haupt. Ihr Fuß schien den Kalksandboden des Waldweges kaum zu berühren; es hätte ihr auch weh gethan, heute eine Ameise, ein Würmlein zu zertreten. So freudvoll war sie und die Arme breitete sie aus: Sei mir gegrüßt, mein süßes Leben! — An einer alten Rothföhre kam sie vorüber, an welcher das Bild der Jungfrau mit dem Kinde hing. Diesem Bilde gab sie einen Kranz von Glockenblumen und wilden Lilien.
Zur späten Nachmittagszeit nach Hause gekehrt, fand sie ihren Mann in der Stube auf einer Wandbank ausgestreckt und schlummernd. Lange stand sie da still und blickte ihm in’s Angesicht. Der harte Zug auf demselben war verschwunden, sanfte Ruhe lag darüber hingegossen. — Wie[S. 265] schön war dieser Mann, wenn er schlummerte! — — Als sie so auf ihn hinsah, wurde ihr wieder anders. Seine rechte Hand hing über die Bank hinab, sanft hob und brachte sie dieselbe in eine bequemere Lage. — Er hat Mühsal und Sorgen, wie gut wird ihm das Schläfchen thun!
Auf dem Tische, in Papier halb eingeschlagen, lag neuer lichtblauer Schafwollenstoff für ein Frauenkleid.
— Den hat er mir heute gekauft, ’s wird ja mein Namenstag sein in der Woche! jubelte das Weib im Herzen, nein, er ist gewiß nicht so hart, wie er thut. Er ist doch ein guter Mann. Gott verzeih’ mir Alles! — Ihr Herz wurde warm. Wie wollte sie ihn so gern liebhaben! — — Es verlangte ihr seltsam, ihm einen Kuß zu geben. Sie beugte sich zu ihm nieder — sein Athem roch nach Fusel. Hastig schreckte der Mann auf, sprang empor — starrte sie an und grinste.
„Hast gut geschlafen,“ sagte Walpa sanft.
„Was soll’s denn!“ fuhr der Müller los, „soll ich etwa nicht mehr schlafen in meinem Hause? Was schleichst denn so um mich herum? Willst mir die Augen auskratzen?“
„Geh’, Mann,“ versetzte die Walpa lächelnd, „das ist ja doch nicht Dein Ernst. Weiß es wohl, Du meinst mir’s besser, als Du’s sagen magst. Ich bedank mich für den schönen Rockzeug.“
„Bedankst Dich!“ lachte der Müller auf, „meinst, er gehört Dein?“
„Wüßte nicht, wem sonst,“ sagte sie, „aber weißt eine Andere dafür?“
„Und wenn auch!“ schrie er und starrte sie mit rothunterlaufenen Augen wild an, „hast Du mich etwa gepachtet? Wie viel hast denn ’geben für’s Jahr, he? Zehn Bessere weiß ich, und Du bist mir die Schlechtest’!“
Das war ihr wie ein Stich in’s Herz. Ohne noch ein Wort zu sagen, ging sie hinaus. —
Immer mehr ergab sich der Seizmüller dem Trunke.
In der Gegend hatte sich ein zweiter Müller angesiedelt, ein ferner Verwandter von der Walpa. Er verschlechterte dem Seizmüller das Geschäft; dieser ließ es seine Frau entgelten. Seine Lust war, ihr wehe zu thun, seine Labe der Krug. Sie war ruhig. Oft gab es Stunden, da er in Tobsucht ausbrach und sich sein Weib gar nicht vor ihm sehen lassen durfte. Der Arzt kam in’s Haus, dem weinte sie bitterlich vor.
„Ist traurig, liebe Müllerin,“ sagte dieser, „aber das mag Euch noch trösten: schlecht ist er nicht. Und das mögt Ihr sicher glauben, wenn er Euch wehthut, so ist ihm auch selbst nicht wohl. Er ist krank, er leidet an so einer Art Manie und er kann selber nicht anders.“
— An so einer Art Manie! dachte die Walpa bei sich, daß er neben mir andere Weibsleute hat, denen er Geschenke macht — ist das auch so eine Art Manie? — Seine aufgedeckte Treulosigkeit hatte in ihrer Seele einen Dämon erweckt, den sie früher noch nicht gekannt, der nun fort und fort an ihr rüttelte, wenn sie sonst in Stumpfheit versinken wollte; da bäumte sie sich auf und ihre Nerven bebten und ihr ganzes Wesen dürstete nach einer That.
Ihre Obliegenheiten im Hause besorgte sie mit auffallender Milde und Sanftmuth. Ihr Angesicht war blaß, oft fast fahl, die Augen waren wie eingefallen und dennoch voll seltsamen Glanzes.
„Weiß gar nicht,“ bemerkte in diesen Tagen eine Magd des Hauses, „wie mir neuzeit unsere Müllerin vorkommt; mich deucht alleweil, die lebt uns nicht lang’.“
Vor der Hausthür mehrten sich die Bettler; denn es waren die Gaben größer geworden, und Walpa reichte den Armen mit vollen Händen.
Eines Tages hatte sie einem mühseligen alten Weiblein drei Silberzehner in die Hand gedrückt: „Sieh, das nimm Dir, und thu’ beten für mich!“
Ueber den Hof hinabtorkelnd begegnete die Beschenkte dem Müller, aus Herzensfreude und Dankbarkeit wollte sie ihm die Hand küssen: „Für das viel Geld, Seizmüller, für das viel Geld. Dein Weib hat mir drei Zehner geschenkt. Davon leb’ ich wie ein Graf; vergelt’s Gott bis in den Himmel!“
Eilte der Müller in’s Haus, beschuldigte sein Weib der Verschwendung und ob sie das Geld auf der Straße aufzuheben habe, daß sie dasselbe wieder auf die Straße werfe? und sie sei nur zum Verschleudern da, er sehe schon, er müsse sie todtschlagen, wolle er nicht, daß sein ganzes Hauswesen und er selbst zugrunde gehe. Und gleichzeitig hat er ihr einen Schlag versetzt auf das Haupt, daß sie in die dunkle Nebenkammer taumelte.
Er stand auf seinem Flecke wie angewurzelt still und schrie:
„Komm’ heraus, Walpa, komm’ nur noch einmal heraus!“
Sie meldete sich nicht, kam nicht heraus. Da trat er mit geballten Fäusten in die Kammer und sah, wie sein Weib eben etwas hinter dem Wandschrank verbarg.
„Was hast Du dort! Gieb her!“ schrie der Müller und haschte nach ihrer Hand. Diese war leer.
„Heimlichkeiten?!“ sagte er und grinste vor Hohn und Wuth.
Ihre Gurgel war einen Augenblick wie zugeschnürt, ihre Augen traten schroff hervor; bald aber entgegnete sie voll stumpfer Ruhe:
„So schau, so such’, was ich für Heimlichkeiten hab’, wirst es wohl sehen.“
Vom Gewehr, das an der Wand hing, riß er den Ladstock herab und stöberte mit demselben hinter dem Wandschranke herum. Ein paar halbblinde Mücken kamen zuerst hervor, dann etwas Staub, dann der Fetzen eines Spinnengewebes, dann etliche alte Papierstückchen, dann eine blaßrothe Halsschleife.
Der Müller hob mit dem Stäbchen die Schleife empor und fragte: „Was ist denn das, meine Liebe?“
„Das ist ein Halsband,“ antwortete sie ruhig.
„Das weiß ich wohl, Du Schlange Du,“ versetzte er, „aber warum hast Du denn dieses Halsband vor mir verbergen wollen, he?“
„Weil — weil ich mich nicht getrau, weil Du so hart bist auf mich.“
„Viel tausendmal zu gut bin ich noch für Dich, Du schlechte Creatur!“ schrie er, „jetzt auf der Stell’ sag’ mir wo hast Du dies Halsband her, oder ich erschieß’ Dich ohn’ Erbarmen!“
„Sagen will ich Dir’s wohl, Franz,“ antwortete sie gelassen, „dies Band hab’ ich vor Zeit von einem Buben kriegt; das Band ist schon lang blaß und der Bub’ ist lang schon verstorben, und jetzt weißt es.“
Da lachte der Seizmüller wild auf und rief mit einer Stimme, die man kaum verstand, dazwischen: „So wohl, Walpa, so wohl! Der Bub’ wird noch nicht verstorben sein!“
„Nun, so lebt er noch,“ antwortete sie.
„Ich steh’ ihm nicht gut auf drei Tage. Und Dir, Weib, Dir schlag’ ich die eheliche Lieb’ noch mit Haselstöcken hinein, darauf leg’ ich Dir ein Jurament ab!“ Und er stürzte aus dem Hause.
Die Walpa stand eine Weile wie betäubt und trocknete sich mit einem Tuche das Blut, das ihr aus dem Munde herausfloß.
Dann verriegelte sie die Thür und suchte hinter dem Wandschranke ein blaues Papierchen hervor, das sie in der Eile dort hinabgeworfen, und welches sie dadurch vor den gierigen Blicken des Müllers zu sichern getrachtet, daß sie das alte Halsband als den Gegenstand ihres Geheimnisses ausgegeben hatte. Das Halsband war eine Brautgabe ihres eigenen Mannes gewesen; wäre jedoch dasselbe nicht als fremdes Liebeszeichen vorgeschützt worden, so hätte der Müller weiter gespäht und das blaue Papier mit seinem Inhalte gefunden.
Nun aber hatte Walpa die letzte Brücke hinter sich abgebrochen. Sie wußte, welch’ neue Waffen sie durch ihre Angabe dem Gatten an die Hand gegeben hatte, daß es nun in seiner Macht lag, seine Rohheit gegen sie vor allen Leuten zu rechtfertigen.
Am andern Morgen stieg der Seizmüller zu sehr früher Stunde aus dem Bette. Er wollte auf den Kornmarkt fahren. Draußen klapperte die Mühle, er rief sein Weib; das hörte ihn nicht sogleich. Er tappte im Finstern an seinen Kleidern umher, er riß das Winkelkästchen auf, das in der Ecke hinter seinem Bette stand. Dabei hub er zu lachen an und sein Lachen war wie ein Röcheln. Und als die Walpa kam, fuhr er sie an: „Du, jetzt weiß ich’s, Du kannst leicht Almosen geben. Du hast mir mein Geld gestohlen.“
Ein Aufschrei aus ihrer Brust. Es war ein Schreckruf; er hatte geglaubt, es wäre ein Schrei des Geständnisses gewesen. „Mein Geld ist weg!“ rief er, „sag’, Bestie, wo hast Du meine Brieftasche? Ah, jetzt weiß ich’s, die hast Du Dir gestern hinter der Wandlad’ versteckt, Du falscher Satan!“
„Mißhandle mich nur nicht, ich sage Dir Alles.“
Er ließ sie los: „So sag’ es!“
„Bei meinem Gott, Franz, von Deinem Geld weiß ich nichts.“
„Hexe, Dir will ich die Wahrheit noch herausziehen!“ Und sofort begann ein Auftritt, den der Erzähler nicht schildern kann.
Später, als Licht gemacht wurde, fand sich die Geldtasche auf der Bettdecke des Müllers, auf welche sie aus dem Rocksacke gefallen war.
Walpa kauerte in einem Winkel; sie klagte nicht, sie schluchzte nicht. Kein Mensch hat das schreckliche Beben ihres Herzens vernommen. — Vielleicht erwartete sie nun von ihrem Manne Abbitte. Dieser hatte sich wortlos aber pfusternd angekleidet und plötzlich sagte er: „Wer weiß es, kannst das Geld doch am Leib’ gehabt und mir dasselb’ nur so auf’s Bett hingeworfen haben. Dir trau ich nimmer. — Troll’ Dich jetzt, Du Kröte, und schau, daß ich mein Frühstück krieg’!“
Noch zwei Augenblicke war Walpa nach diesen Worten gekauert in ihrem Winkel. Dann erhob sie sich, richtete ihr Angesicht gegen die Decke des Zimmers empor und ging in die Küche hinaus. Sie war wieder die Emsige, und bald stand das Frühstück auf dem Tische. Walpa ging mit seltsamer Gelassenheit an weitere Arbeiten.
Der Müller, immer noch grollend, schnitt Brot in den Kaffee. Dann aß er und gab indessen durch kurze, hervorgestoßene Sätze Befehl, was während seiner Abwesenheit im Hause zu geschehen habe.
Plötzlich hielt er ein und sah seinen Löffel an. Dann starrte er in die schon halbgeleerte Schale und sog mit der Zunge an seinem Gaumen.
„Du, Walpa,“ sagte er hierauf, und seine Stimme war unsicher, fast weich, „Du Walpa, geh her da. Iß’ mit mir Kaffee: er ist übrigs genug für allzwei.“
Sie schichtete sein Bett auf, ging dann in die Vorstube und überhörte die Einladung.
Erregt, indem er sich mit der flachen Hand über die Stirne fuhr, stand der Müller vom Tische auf und sagte noch einmal in gedämpftem Tone: „Weib, verkost’ mir jetzt den Kaffee!“
Die Walpa stürzte zur Thüre hinaus.
„Herr Jesu! Herr Jesu Christ!“ schrie der Müller, „jetzt hat sie mich vergiftet! — Jetzt bin ich hin! — Du Weib — mußt mit mir!“
Hinaus raste er. Im Vorhause erfaßte er mit krampfhaft zuckenden Armen ein schweres Beil und stürzte damit der Fliehenden nach.
Die Walpa floh über den Hof, floh, an Stock und Pfeiler rennend, durch den Wagenflur, floh in die Mühle — der Müller in wüthender Hast, doch schwankend, ihr nach mit gezücktem Beil und schäumendem Mund. Um den Mehlkasten noch ging der Beiden rasender Lauf, da erreichte Walpa wieder die Thür, schlug diese hinter sich zu und stand im Freien. Noch hörte sie es, wie er innerhalb der Thür mit einem gräßlichen Schrei zusammenbrach.
Dann ging sie im Morgengrauen davon. Sie war ledig und erlöst, sie war frei. Ihr Herz jubelte, ihr Gewissen war leicht und licht, wie nach einer guten That.
Ueber dem Thale thaute ein dünner Herbstnebel; neben dem Wege, auf welchem Walpa hineilte, lagen grünende Rübenfelder und abgeweidete Wiesen, auf denen die blassen Kelche der Zeitlose standen. — Allmählich war es licht geworden. Walpa ging dahin und sah nicht um und für jeden ihr Begegnenden hatte sie einen heiteren Morgengruß.
„Wohin so früh?“ rief ihr ein junger Fuhrmann zu.
„In die Kirch’, wenn Du willst mitgehen.“
„Oh, da vergehst Dich ja, Seizmüllerin, der Weg führt sein Lebtag nicht in die Transau.“
„So wird er wohl wo anders hinführen.“
„Ei freilich, freilich, Seizmüllerin, das ist gewiß.“
Als sie zur Brücke kam, wo der Weg über den Fluß setzt und ein schmaler Steg über den hier sich abzweigenden Mühlbach leitet, begegnete ihr eine lebhafte Schaar von Schulkindern. Die Erfahrung zeigt, daß zur Herbstzeit die Kinder viel lebhafter und lauter sind, als in anderen Jahreszeiten. Naturforscher haben den Grund dafür in der Kühle und Dünnheit der Luft gefunden. So johlten auch heute die Kinder hüpfend und muthwillig heran, neckten sich gegenseitig, schlugen sich mit ihren Hüten, Hauben und Schulsäcken, warfen sich auf die Straße hin und lachten dabei und kletterten auf die Zäune und Sträuche, auf das Brückengeländer auch und hüpften über den Mühlsteg hin und her und warfen Steine in’s Wasser und stießen mit Stangen in die Tümpfe unter den Uferrasen hinein und lärmten in heller Lust, wenn sie eine Forelle aufschreckten. Plötzlich ein Schrei, ein hohes Aufgischten im Flusse und: „Der Michel,[S. 273] der Michel ist in’s Wasser gefallen!“ zeterten die Kleinen durcheinander.
Die Walpa, noch nicht weit von der Stelle, eilte zurück, sah, wie der Knabe, von dem jetzt nur noch ein Fuß hervorstand, im tiefen Wasser davonrann. Ohne Bedacht streifte sie ihren Ueberrock von sich und sprang in den Fluß. Sie rang mit den Wellen, sie verlor allen Grund und Halt, sie fiel um, wallte davon und verschwand unten, wo sich die Weidenbüsche schwer und dunkel über den Fluß wölbten.
Die Kinder schossen planlos umher; nur ein achtjährig Mädchen blieb gefaßt und sagte zu einem andern: „Du, jetzt muß ich zum Pfarrer gehen, daß geläutet wird, weil der Hüttenbaumer Michel und die Seizmüllerin ertrunken sind.“
Da wand sich unten zwischen den Sträuchen die Walpa hervor, in ihrem Arm den bewußtlosen Knaben haltend, aus dessen Mund ein Wasserstrom hervorquoll. Sie legte ihn sofort über der nächsten Feldplanke auf den Bauch, so, daß Haupt und Füße zu beiden Seiten niederhingen, sie preßte alles Wasser hervor und rieb seinen Leib — da hub der Kleine wieder an zu athmen.
Bald kamen mehrere Leute zusammen und der Michel und die Walpa wurden unter freudiger Erregung nach Transau gebracht.
„Heut’ hat die Seizmüllerin den Hüttenbaumer Buben aus dem Wasser gezogen!“ Die Kunde verbreitete sich bald im ganzen Thale. „Sie wäre selber schier dabei ertrunken. Sie ist aber ein kräftiges und muthiges Weib, hat sich und den Knaben mit Noth noch herausgearbeitet. Jetzt ist sie im Pfarrhof unten und der Richter ist zu ihr gegangen und die Herren sind alle beisammen und loben die Walpa; und die Hüttenbaumerleut’ sind auch schon herausgekommen von ihrem[S. 274] Graben und sie wissen gar nicht, was sie der Müllerin Gutes anthun sollen.“
Es war auch so. Die Walpa wollte fort; aber sie stak in den Kleidern der Pfarrersköchin, denn die ihren waren noch nicht getrocknet. Eine große Unruhe war in ihr, aber sie mußte aushalten und für den Abend wollte man zur Feier der Heldenthat eine Unterhaltung anstellen — und dem Müller wollte man es schon zu wissen thun, wo sein braves Weib heute stecke und daß für den Abend auch er selbst in’s Wirthshaus komme.
Da berichtete Einer, der Seizmüller wäre heute gar nicht daheim und dem lauten Klappern nach ginge auch die Mühle schon den ganzen Vormittag leer.
„Ja, sind denn sonst keine Leute auf der Mühl’?“ fragte man.
Der Mühlbursche sei vorgestern davon und die Anderen wüßten nicht Bescheid. Auch könne man gar nicht in die Mühle hinein, sie sei versperrt und es würde doch nöthig sein, daß die Müllerin auf ein halbes Stündchen nach Hause gehe.
Als Walpa gegen die Mühle kam, eilte ihr eine Magd entgegen: „Sie solle doch nicht gar zu hart erschrecken um des lieben Gottes willen, in der Mühle sei heut’ was geschehen.“
Wortlos, aber festen Schrittes ging Walpa weiter. Die Thür der Mühle war bereits weit offen, das Räderwerk war gestillt. Nachbarsleute standen herum, sprachen viel hin und her, und als nun die Walpa nahte, stellten sie sich bei Seite und redeten nichts. Nur Einer trat ihr entgegen: „Müllerin, dieweilen Ihr heut’ so wacker seid gewesen, ist daheim schlecht gehaust worden. Kein Mensch weiß, was ihm widerfahren.“
Er führte sie in die Mühle und deutete im Dunkeln hinter der Thür zu Boden. Dort lag hart am Pfosten der Seizmüller starr und todt.
Die Leute hatten sich herangedrängt, um zu sehen, wie sich das Weib bei dem todten Gatten geberden werde. Jetzt blickten sie sich gegenseitig an. Walpa stand an der Leiche ohne ein Zeichen des Schmerzes, ohne ein Wort der Klage. Nicht einmal Ueberraschung war an ihr zu merken. In grauenhafter Ruhe stand sie vor dem Todten.
„Da kann er nicht liegen bleiben,“ sagte sie endlich, „die Leute sollen ihn in’s Haus hineintragen.“
„Nein,“ versetzte einer der Männer, „das darf nicht geschehen; wir müssen ihn liegen lassen, bis der Arzt und die Herren vom Bezirksgericht da sind.“
„Was wollen denn die?“ sagte die Walpa kalt, „daß er todt ist, das seht Ihr auch, und so hat man nichts weiter zu thun, als ihn zu begraben.“
Die Leute stutzten.
„Der liegt schon lang’ da hinter der Thür,“ bemerkte ein Bauer, „vielleicht seit Früh, da die Müllerin selber noch in der Mühl’ gewesen ist!“
„’leicht sieht sie ihren todten Mann jetzt nicht das erstemal,“ sagte ein Anderer.
„Das schaut seltsam aus.“
„Die zwei Leut’ sollen sich ja spinnefeind gewesen sein.“
„’s geht nicht recht her.“
„Am Ende hat sie ihn umgebracht,“ warf Einer ein.
Sie konnte es gehört haben, that aber nichts desgleichen.
Da stellte sich Einer vor sie hin und rief: „Du, Müllerin, viel wett’ ich nicht, Du hast was angestellt!“
„Ich?“ versetzte sie mit den Augen zuckend, „was kann ich denn angestellt haben?“
„Wird sich weisen!“
Spät Abends kamen Aerzte und Herren vom Gericht. Sie sahen zuerst die Leiche des Müllers und beschrieben, wie sie lag hinter der Thür. Sie sagten: „Es läßt sich ziemlich sicher constatiren, daß er eines natürlichen Todes nicht gestorben ist.“ Die Herren vom Gericht gaben Weisung, daß sofort das Haus bewacht werden solle, so daß Niemand dasselbe verlassen könne. Hierauf stellten sie eine Bank mitten in der Mühle auf, legten die Leiche auf dieselbe hin und ließen mehrere Spanlunten anzünden. Frisch mit dem Messer machten sie sich daran. Ziemlich wortkarg ging die Arbeit vor sich, nur manchmal ein kurzes Gemurmel, ein verständnißvoller Blick.
Nach kaum einer Stunde war der zerrissene Körper mit einem weißen Tuche bedeckt.
Die Herren begaben sich — es war schon Mitternacht — in die Stube der Müllerin. Diese lag angekleidet auf dem Bette und barg ihr Gesicht in das Kissen. Man rüttelte sie auf. Sie strich sich mit Hast die Haare aus der Stirne und starrte den fremden Männern in’s Gesicht.
Einer von diesen erhob seine scharfe Stimme und sagte: „Euer Mann, der Seizmüller, ist durch Arsenik vergiftet worden.“
„So?“ antwortete sie, „dann hat er Rattengift gegessen.“
„Man hat ihm das Gift in den Kaffee gethan!“
„Wer wird ihm denn das Gift in den Kaffee gethan haben?“ sagte sie dumpf.
„Es ist Alles bewiesen. Hier ist der Rest in der Kaffeeschale, die Ihr ihm selbst vorgesetzt habt. Euch hilft gar[S. 277] nichts mehr, Seizmüllerin, gesteht es nur, Ihr habt Euren Mann umgebracht.“
Da fuhr die Walpa zusammen, ein wilder Krampf schien durch ihr ganzes Wesen zu toben. Die Männer standen bewegungslos da und blickten sie an. Nun löste sich allmählich die grauenhafte Starrniß, ihre Arme sanken auf den Schoß und sie hauchte: „Da — da bin ich. Hab’s ja gewußt diese Ehe bringt mich noch an den Galgen.“
Am nächstfolgenden Tage ist sie dem Gerichte überliefert worden.
*
**
Lange ließ man die Seizmüllerin nicht in ihrem Gefängnisse. Wozu soll der Staat ein solches Wesen noch füttern? hieß es.
Eine Woche vor dem Allerheiligenfeste, zur Zeit, da in der Gegend die lautlustigen Kirchweihen abgehalten wurden, führte man die Walpa in den Gerichtssaal. Da stand sie vor dem grünen Tische, auf dem das Crucifix und zwei rothe Kerzen ragten. Hinter dem Tische saßen die Richter. Links davon auf einer Doppelbank waren zwölf Männer, theils in städtischer, theils ländlicher Kleidung. Walpa sah Bekannte darunter. Da war der Thorhofbauer, der ihr einst zur Heirat mit dem Seizmüller gerathen, da war der Erlsberger, der ihr auch nicht abgeredet hatte. Neben diesem saß der Kaufmann von Salgstein, der ihr das Rattengift verkauft hatte; nicht weit von diesem der Hammerschmied, welcher ihr mehrmals, sie bedauernd, zu verstehen gegeben, der wilde Seizmüller würde sie noch eines Tages todtschlagen, so wie er sein erstes Weib todtgeschlagen habe. Und endlich saß noch Einer unter den ernsthaft dreinschauenden Männern, bei dessen Anblick der armen Walpa das Herz weinte. Es war der einstige[S. 278] Postillon, der Blasius Steiger — nun schon glücklich verheiratet — es war der Mann, an den sie liebend so oft gedacht hatte. — Das waren jetzt ihre Richter, die Geschwornen.
Rechts vom grünen Tisch, vor einem Pulte, saß auch ein Bekannter. Es war jener Herr, den die Walpa schon zweimal gesehen hatte. Das erstemal vor etlichen Jahren, noch im Wiesenwirthshause; das zweitemal später oben auf dem Zinken bei der Capelle und bei den Zirben. Er hatte damals Manches zu ihr gesprochen, woran sie seither oft und oft gedacht, er hatte ihr ja einen ganz neuen Lebensweg vorgeschlagen — „er hätte es gewißlich gut mit ihr gemeint“.
Heute trug er einen schwarzen Frack, dessen Aufschläge mit silbernen Borten und Knöpfen geziert waren. Er warf nur ein paar kurze Blicke auf die Angeklagte hin, blätterte dann eifrig in den Schriften und Büchern, die vor ihm lagen und schrieb zuweilen mit dem Bleistift etwas auf ein Blatt.
Nicht weit von der Sünderbank der Walpa, neben welcher zwei Gendarmen standen, wieder an einem eigenen Tischchen, saß endlich ein ganz fremder schwarzgekleideter Mann mit dunklem Vollbarte und blassem Gesicht. Auch der hatte ein Buch vor sich liegen, doch stützte er sein Haupt in die Hand und starrte vor sich in das Leere.
Walpa sah nicht um, merkte aber leicht, daß hinter ihr eine große Menschenmenge versammelt war. Diese flüsterte und war unruhig und konnte den Beginn der Verhandlung kaum erwarten. Endlich begann das Verhör. Der Richter fragte die Angeklagte, was sie veranlaßt habe, ihren Mann aus dem Leben zu schaffen?
„Ich habe mir nicht anders zu helfen gewußt,“ antwortete die Walpa.
Hierauf wurde Punkt für Punkt erörtert, von der Werbung des Seizmüllers bis zu dessen Tode, die Mißhandlungen und Rohheiten, die sie zu erdulden gehabt, ihre Versuche, von ihm loszukommen, der keimende und wachsende Gedanke endlich, sich durch das letzte Mittel von ihrem Peiniger zu befreien.
Walpa gab auf die Fragen, die ihr gestellt wurden, kurze, aber entschiedene Antworten. Eine besondere Aufregung war an ihr nicht zu merken, und als sie der Richter fragte, ob sie denn keine Reue empfinde, die That begangen zu haben, die ihr Lebensglück, vielleicht ihr Leben vernichtet habe, antwortete sie: „Es ist nicht möglich, daß es noch schlechter mit mir wird, als es gewesen ist.“
Nach all dem und Anderem begann sich der Mann zu rühren, der rechts vom Richtertisch bei seinen Schriften saß und während des Verhörs immer in seinem Buche geblättert hatte. Er erhob sich nun, und derselbe, der seinerzeit im Gebirge zu Walpa gesagt hatte: dieser Seizmüller, von dem mußt Du Dich befreien, — begann nun eine Rede zu halten, in welcher er die Gattenmörderin mit den schärfsten Worten anklagte und jeden Erschwerungsgrund angelegentlichst hervorhob. Und seine Rede schloß er mit folgenden Worten: „Sie sehen also, meine Herren, daß hier ein langgeplanter, zielbewußter, meuchlerischer Gattenmord vorliegt. Das schwärzeste Blatt in den Verbrecherannalen heißt Gattenmord. Dieses Verbrechen richtet die Familie zu Grunde und erschüttert dadurch die Grundfesten des Staates. Sie müssen erwägen, wie tief verdorben ein Weib sein muß, das im Stande ist, gerade jenen Mann auf die grausamste Weise[S. 280] zu tödten, der sie als die Liebste erkoren, dem sie ewige Treue gelobt, der sie zur geachteten Stellung der Frau erhoben hat, der ihr Ernährer und Beschützer war. Sie haben gesehen, wie die Angeklagte gerade in der größten Verlegenheit eines zerrütteten Hauswesens, ich möchte sagen: als Betteldirne von dem Seizmüller aufgenommen worden ist, wie der Seizmüller ihren Vater gewissermaßen vor dem Untergange gerettet hat. Wer solche Wohlthaten mit dem Giftbecher lohnt, der verdient das Leben nicht. — Ich habe mich sehr nach Milderungsgründen umgesehen, denn der Staat, welchen hier zu vertreten ich die Ehre habe, kennt keine härtere Aufgabe, als einen seiner Angehörigen vom Leben zum Tode bringen zu müssen. Es mögen in den Fall allerdings Umstände hineinspielen, welche Sie, meine Herren, zur Milde stimmen könnten; aber prüfen Sie strenge! Selbst ein Mann, der Brot entwendet, weil seine Kinder hungern, wird verurtheilt. Was hier vor uns liegt, ist ein kaltberechneter Gattenmord, und die vollständige Reulosigkeit, welche Sie auf dem Gesichte der Angeklagten lesen, sie gelte Ihnen mehr, als alle Erschwerungsgründe, sie mahne Sie, durch ein gerechtes Urtheil weitere Verbrechen zu verhüten. — Was Ihnen etwa noch gesagt werden mag von Menschlichkeit und Milde, so bedenken Sie, meine Herren Richter aus dem Volke, daß Sie nicht geschworen haben, hier Verbrechen zu verzeihen, sondern dieselben nach Gerechtigkeit zu richten. Lassen Sie sich durch falsche Gefühle zu einem milden Urtheile bestimmen, wohlan, so geben Sie allen Ehefrauen, auch den Ihren, meine Herren, das Anrecht, sich ihrer etwa unbequemen Gatten durch ein übelgewürztes Frühstück zu entledigen. Ich verliere weiter kein Wort, ich verlange für die Gattenmörderin Walpurga Wiesamer den Tod durch den Strang!“
Nach diesen Worten ließ sich der Staatsanwalt mit fast gleichgiltiger Miene nieder auf seinen Sitz und ergriff eine Bleifeder, um damit zu spielen. Walpa richtete ihr großes Auge auf diesen Mann, der, wie sie sah, da war, um sie zu verderben. Sie bewahrte auch jetzt noch ihre Ruhe, nur fuhr sie sich mit dem Aermel einmal über die Stirne. Sie erwartete nun von dem Richter das Urtheil. Dieser aber sagte kalten Tones: „Der Herr Vertheidiger.“
Sofort erhob sich der schlanke, blasse Mann, welcher in der Nähe der Angeklagten seinen Platz hatte, und blickte zuerst mit bekümmerter Geberde die Richter und dann die Geschwornen an. Plötzlich nun schoß ein Leuchten aus seinen Augen und er begann anfangs in etwas beißender, dann in warmer Betonung so zu sprechen:
„Meine Herren Richter!
Der Herr Staatsanwalt hat sich Mühe gegeben, mir, dem Sie um Milde und Menschlichkeit Bittenden, Ihre Herzen zu verriegeln. Ich jedoch erkläre, daß ich gefühlvoller Herzen gar nicht bedarf, daß ich in diesem heutigen Falle nur Ihre Vernunft anzurufen brauche, um eine Unglückliche zu retten, die erbarmungslos in den Tod gestürzt werden soll, weil sie in der Nothwehr ihren größten Feind getödtet hat. — Nie noch ist mir mein Fürsprecheramt leichter geworden, als heute, da die Verhandlung so klar und deutlich gezeigt hat, daß weder Böswilligkeit noch schmutziger Eigennutz, noch ein anderer Zug eines schlechten Charakters die begangene That verursacht hat. Lediglich die Liebe zum nackten Leben hat dieses Weib auf die Sünderbank gestoßen. Und wer, meine Herren Geschwornen, wer wollte nicht leben! Lebenwollen ist ein Naturgesetz, dessen sich selbst der hinfällige Greis nicht entschlagen kann, geschweige denn ein warmes[S. 282] Blut von siebenundzwanzig Jahren. Sie haben ja gehört, wie entsetzlich der Seizmüller sein Weib gequält hat, wie er sie beispielsweise wochenlang in einer finstern Kammer gefangen hielt, wie er sie schlug und der Untreue und Unredlichkeit zieh, während er gewissenlos alle Rechte der Frau mit Füßen trat. Sie finden in dem Charakter des Mannes nicht einen lichten Punkt; er war ein ganz schlechter Mensch, dessen empörende Rohheiten durch nichts zu entschuldigen, die für ihn selbst zwecklos waren und sogar für den Psychologen abstoßend und völlig interesselos sind. Sie haben gehört, wie dieser Wütherich seinem sanftmüthigen Weibe wiederholt mit dem Todtschlagen gedroht. Der Seizmüller hätte sein Wort gehalten. Hätte die Walpurga, nachdem Alles vergebens gewesen, sich von ihrem Folterknechte freizumachen, das Los ihrer Vorgängerin theilen sollen? Oder, im besten Falle, meine Herren, sagen Sie selbst, ob es für ein junges, lebensheiteres Weib möglich ist, neben einem Menschen, wie dieser Seizmüller war, zu existiren? Und die Freunde, an die sie sich gewendet in der Noth, haben sie verlassen, ja, haben ihr selbst vielleicht den Gedanken des einzigen, letzten Mittels beigebracht. Lag es doch offen da: diese beiden Menschen mußten geschieden werden. Sie waren ja nicht vor Gott, sondern nur vor den Menschen vermählt. Walpurga hatte den Müller nicht geliebt und nicht erwählt; nur ein Opfer war ihr Entschluß, den Mann zu nehmen; dieses Opfer hat sie ihrem verzweifelten Vater gebracht. Aus einer Tugend, aus der Kindesliebe, ist die That entsprungen, die vor der Welt nun als Verbrechen gelten soll. Sie haben bei der Untersuchung gesehen, meine Herren Geschwornen, welche Kämpfe das arme, einsame Frauenherz durchgerungen hat, bis es dem Dämon der Natur unterlegen ist. Wie unsagbar sie, die[S. 283] wohlerzogene und gesittete Frau, gelitten haben mag, das läßt sich freilich in einer Untersuchung nimmer zeigen. Ich sage absichtlich, die wohlerzogene, gesittete Frau, denn im vorliegenden Falle hat der Vertheidiger wahrlich nicht nöthig, auf die beliebten Milderungsgründe einer schlechten Erziehung hinzuweisen. Auch Unzurechnungsfähigkeit und Irrsinn mag ich gern entbehren, denn meine Clientin hat logisch und so gehandelt, wie sie handeln mußte. Allerdings, wäre die Angeklagte mit größerer Intelligenz oder mit weniger Ehrlichkeit begabt, sie wäre nicht in’s Criminal gekommen, sie hätte leicht Mittel gefunden, den Verdacht eines Mordes von sich abzulenken; und der Seizmüller wäre vor den Augen der Welt eines jähen Todes gestorben, wie auch dessen erstes Weib eines jähen Todes gestorben sein soll. Daß aber die Angeklagte ihre That nicht einen Augenblick geleugnet hat, daß sie selbst in dieser Stunde noch ruhigen Gemüthes dasteht, das beweist: ihr Gewissen klagt sie nicht an, der strengste Richter in der eigenen Brust klagt sie nicht an! — Und fällt es Ihnen nicht auf, meine Herren Geschwornen, daß die Vorsehung durch einen Zufall dem armen Weibe, wenn nicht ihre Beistimmung, so doch ihre Gnade geoffenbart hat? Walpurga hat in derselben Stunde, da ihr Peiniger zur Ruhe ging, einem andern hoffnungsvollen Menschen das Leben gerettet. Wollen Sie, meine Herren Richter, den Tod mit dem Tode bestrafen, so müssen Sie auch das Leben mit dem Leben belohnen. — Wenn mein geehrter Herr Vorredner behauptet hat, Sie gäben durch ein mildes Urtheil Ihren Frauen das Anrecht auf eine gleiche That, so sage ich: das, was Sie an dieser Frau strafen, verschulden Sie in demselben Augenblicke in einem viel höheren Grade. Verurtheilen Sie die Angeklagte, so schwören Sie moralisch zur Tyrannen[S. 284]herrschaft des Ehemannes und begehen einen Verrath an den Frauen. Ja, um es kurz zu sagen, Sie begehen einen Verrath an sich selbst, an der Menschheit und Menschlichkeit, wenn Sie nach dem starren Buchstaben ein bedrängtes Herz mit dem Tode richten, das den Tod nicht verdient. Und wenn Sie, meine Herren aus dem Volke, im Pharisäerstolze das Schuldig fällen, dann steige mit der armen Walpurga Wiesamer auch noch manch’ Anderer mit hinauf zum Schaffot, dann sprechen Sie ein Schuldig über Alle, die mit ihrer ganzen Kraft um’s liebe Dasein kämpfen. — Nein, meine Herren, Sie stiegen aus dem Herzen des Volkes empor zum Richterstuhle, und Ihre Stimme ist Gottes Stimme. Gott ist gerecht und gütig und barmherzig — seien Sie es auch, und lassen Sie dieses Weib, das bisher nichts vom Glücke der Erde genossen, das mit heißer Lebenssehnsucht im Auge stumm Sie anfleht — lassen Sie es leben!“
Erschöpft war der Sprecher zurückgesunken auf den Stuhl. Auch die Walpa ließ sich nieder auf ihre Bank. In ihrem Auge stand eine schwere Thräne.
Der Vorsitzende fragte die Angeklagte, ob sie irgend noch was zu bemerken habe. Sie verneinte mit einem Schütteln des Hauptes. So erhoben sich nun die Geschwornen und schritten in einer langen, ernsten Reihe aus dem Saale in das Nebengemach.
Und nun herrschten im Gerichtssaale jene für das Publicum so aufregenden, für den Angeklagten so gräßlichen Minuten des Schwankens zwischen Freiheit und Kerker, zwischen Leben und Sterben. Staatsanwalt und Vertheidiger saßen anscheinend ruhig auf ihren Plätzen, ihrer Worte Frucht gewärtigend. Der Richter saß zurück in seinen Sessel gelehnt und schloß halb die Augen. Die Angeklagte kauerte auf ihrer[S. 285] Bank und bewegte sich nur ein wenig, so oft sie tiefen Athem schöpfte aus ihrer Brust. Ihre Züge waren wie die Wand so blaß. Einen umflorten Blick that sie gegen das Fenster hin, zum hellen Sonnenschein. Dieses liebe goldene Licht — oder die ewige Nacht! — Welches soll nach menschlicher Satzung nun ihr Antheil sein? —
Endlich ging die Thür auf und in einer ernsten Reihe, wie sie hinausgeschritten waren, schritten die zwölf Geschwornen wieder in den Saal und nahmen Platz in ihren Bänken.
Dann wurde das Verdict der Geschwornen verkündet: Auf den Antrag, schuldig zum Tode durch den Strang, hatten eilf Stimmen mit Ja, eine mit Nein geantwortet.
Walpa hatte es gehört. Sie richtete sich auf und mit fester Stimme sagte sie: „Ich bitte nur um Eins. Laßt mir’s wissen, welcher hat mir das Nein geschenkt?“
Keine Antwort. Finster blickten Richter und Geschworne drein. Nur Blasius Steiger, der einstige Bursche mit dem Posthorn, schlug sein Auge nieder und wurde roth und blaß.
Walpa sah es und aufathmend, hell wie im Jauchzen, rief sie das Wort: „Ich hab’s gewußt, er kann mich nicht verdammen. Nun habe ich gelebt, nun will ich sterben!“
s begeben sich in den Stand der heiligen Ehe: Der Bräutigam Michael Rehling, katholisch, großjährig, Besitzer des vulgo Seesteinerhofes in hiesiger Pfarre. Die Braut Maria Haldegger, katholisch, minderjährig, derzeit in Dienst beim Bauer an der Wand. Dieses Brautpaar wird heute zur Aufdeckung eines allfälligen Ehehindernisses öffentlich verkündet zum erstenmal.“
So las es der Pfarrer von der Seeau auf der Kanzel aus einem großen Papierbogen der Gemeinde vor.
Es war das Fest der heiligen drei Könige.
Die Gemeinde war im Festkleid und in Festfreude versammelt, und vor dem mit frischen Tannenzweigen umgebenen „Krippel“ — der bildlichen Darstellung von unseres Heilandes Geburt — brannten zwei Wachskerzen, die heute nicht, wie sonst gern, nach einer Seite hin abrannen, da es sehr kalt war und das Wachs gefror ganz nahe an der Flamme.
Wenn plötzlich die Thür aufgegangen wäre in allen Angeln, und die heiligen drei Könige mitsammt ihren goldenen Kronen und Schätzen, und ihren Mohren und Kameelen und mit ihrem Stern hochfeierlich durch die Kirche gezogen wären, und hin zum Krippel, es hätte kaum so viel Aufsehen gemacht[S. 287] unter den Leuten, als die Verkündigung der Heirat des jungen Seesteiners und der Maria Haldegger. Der Seesteiner, ein Bursche stramm und frisch, hoch und stolz wie ein junger Tannenbaum, dem der größte Hof gehörte jenseits des Sees. Sein Hof stand da wie ein Schloß, und seine Waldungen waren so groß und weit, daß wenn neun Jäger in demselben zu gleicher Stunde ihre Gewehre abschossen, einer von dem anderen keinen Schuß hörte und keinen Hall. Vorwitzige Leute nannten den Seesteiner den Gaugrafen, weil ihm schier Alles unterthan war weit und breit. Wenn Dich in der Gegend ein böses Wetter überraschte, und Du stelltest Dich unter eine buschige Tanne, so standest Du unter einem Seesteiner’schen Schirmbaum; und wäre auf dem Seesteinergrunde keine Quelle aufgeronnen, die ganze Pfarre hätte verdursten müssen, und die hunderttausend Forellen im See dazu.
Das Altarbild der Seeauer Kirche stellte den heiligen Erzengel Michael dar; aber gar viele Seeauer und Seeauerinnen, wenn sie davor ihre Andacht verrichteten, dachten dabei schier gottlos an den Michael Rehling; der war es eigentlich, was das Altarbild vorstellte: der Schutzengel, der Erzengel, der Patron der Gemeinde.
Und Maria Haldegger war die blutarme Dienstmagd, im Sommer auf der Alm, wie hundert Andere, im Winter beim Bauer an der Wand, bei dem ein Festtag war, wenn sie sich einmal an der Haferbrotsuppe satt essen konnten. Kein Mensch, außer vielleicht ein armer, pechiger Waldteufel, hätte sich um die Maria Haldegger gekümmert, wenn im letzten Sommer mit ihr nicht etwas vorgefallen wäre, was eben nicht gar oft vorfällt.
Ein Prinz, der einen so klingenden Namen hat, daß sie ihn in der halben Welt hören, war auf der Jagd dage[S. 288]wesen, hatte die Maria Haldegger auf der Alm gesehen, hatte sich schauerlich in sie verliebt, und hatte ihr einen Ring geben wollen, der zweimal so viel werth war, wie das ganze Bauernhaus an der Wand. — Die Maria Haldegger aber hatte gesagt: „Nichts für ungut, Herr Prinz, ich bitt’, aber für Guld und Geld und alle Herrlichkeit der Welt ist eine ehrliche Magd nicht zu kaufen. Wollt Ihr’s aber redlich meinen, so fragt bei meinem Pathen an; ich kann nichts versprechen.“ Der Prinz hat sich zufrieden gegeben und die Maria Haldegger nur noch ersucht, daß sie ihm für mehrere Stunden möge Unterstand gewähren auf ihrem Heuboden, da schon die Nacht käme. Aber die junge Magd hat ihm’s rundweg abgeschlagen, und der Prinz ist zornig davon gegangen bis zur nächsten Almhütte.
Zwei alte Seesteiner’sche Jäger, die hinter der Hütte gestanden, haben den Vorgang belauscht und haben ihn erzählt im Wirthshause der Seeau, und jenseits des Wassers, und überall, wo Schick war zum Erzählen.
Da hat denn Alles weit und breit von der Maria Haldegger gesprochen, und der Bauer an der Wand hat nur so lächelnd mit dem Kopf genickt, wie seine wackere Magd im Herbst von der Alm zurückgekommen ist und Rechenschaft abgelegt hat über Alles was sie auf der Alm zu verwalten gehabt.
Es kam der kalte Winter, es fiel klaftertiefer Schnee, es fror der See. Es war stetiges Jagen im Wald, der junge Seesteiner ging oft mit der Flinte am Dorf vorüber, und ging gegen die kleinen Bauerngüter hinaus, und stieg die Holzleiter der Loserwand hinan gegen die Waldhöhen. Zu Weihnachten war großes Eisschießen auf dem See, und jetzt zu Heiligendreikönig wurde, unerwartet wie ein Blitz,[S. 289] vom Himmel im Eismonat, die Neuigkeit von der Kanzel verkündet.
Das also war heute, und als hierauf das Hochamt abgehalten wurde mit dem festlichen Weihrauch und dem feierlichen Orgelklang, betete kein Mensch ein andächtig Vaterunser, und der Pfarrer am Altare selbst berechnete, was bei der Trauung des Großbauers wohl für ihn abfallen könne.
Der Seesteiner saß heute im hintersten Stuhle des Chores; seine Braut war gar nicht in der Kirche. Noch bevor der letzte Segen und die Sprenge — das Bespritzen der Gemeinde mit Weihwasser durch den Priester — zu Ende war, verließ Michael die Kirche und eilte seines Weges.
Er ging nicht über den See seinem Gehöfte zu, er nahm die Richtung gegen die Wand. Als er nach dem tiefen Schneepfade durch die Halde schritt, kreischte ihm eine Stimme nach: „Laß’ Zeit, Herr Bräutigam! Hast aber eilig.“
Die „guldene Greth“ war’s, ein kaum vierundzwanzigjähriges Mädchen mit krausen, gelblichten Locken, falben Augenbrauen und stets gerötheten, zuweilen sommersprossigen Wangen. Sie war mehr klein als groß, hatte eine sehr geschmeidige Gestalt, hatte gern ein Lächeln um den scharfen Mund, konnte schmeicheln und spotten und näschenrümpfen und liebäugeln, wie gar Keine mehr sonst um den ganzen weiten See. Sie war die Tochter einer Häuslerin. Man kannte sie als ein leidenschaftliches Mädchen, zuweilen boshaft, zuweilen gar ein wenig bösartig, und dann doch wieder gutmüthig in hohem Grade. Man nannte sie die „guldene Greth“, weil sie goldhaarig war, und weil sie das Gold wohl zu schätzen wußte, mehr wie manch’ Andere auf der Alm, „die sich im Bettlerstolz aufbläst, daß eine halbe Welt von ihr spricht“.
Die Greth ging zuweilen wurzelgraben und kräuterrupfen auf die Alm, aber ihr wollte ein Prinz nimmer begegnen. —
Der junge Mann blieb nun auf den Ruf unwillkürlich stehen.
„Magst mich heut’ nimmer über den See rudern, junger Herr Seesteiner?“ sagte das Mädchen, ihm näher kommend.
„Der See ist gefroren,“ entgegnete Michael kurz.
„Aber ich bin’s nicht,“ rief sie, „ich weiß noch recht gut eine warme Kirchweihnacht —“
„Wo ich Dich aus Gefälligkeit über den See geführt habe.“
„Wo Du mich an Deine Brust gezogen hast —“
„Weil Du mir sonst im Finstern leicht über den Rand gefallen wärest.“
„Wo Du mir die Liebschaft mit dem Holzmeisterfranzl abgeredet hast —“
„Weil er leichtsinnig ist und sein Lebtag Weib und Kind nicht ernähren kann.“
„Du hast damals gesagt, daß Du meine alte Mutter unterstützen wolltest.“
„Das thue ich, weil sie eine arme Frau ist.“
„Michael, Du hast gesagt, daß Du heiraten wollest, und daß Dir kein Mädchen zu arm und zu gering sei —“
„Das hab’ ich nicht vonnöthen, ich schau nur auf die Bravheit.“
„Und daß Du redlich seiest und keine betrügen wollest!“
„Das hab’ ich gesagt und gehalten.“
„Aber Du hast mich an der Hand genommen, an Deine Brust gedrückt, und ich habe den Franzl fahren lassen, und[S. 291] hab’ Keinen mehr angeschaut, und hab’ gearbeitet im Taglohn, und bin brav gewesen, und nur an Dich hab’ ich gedacht. — Michael, Du bist ein Falscher, hast mich betrogen. Der Teufel soll in Deine Maria fahren!“
Die Greth lief davon, sie war wild anzusehen; sie ballte die Fäuste gegen den Bräutigam, und als sie hinauf kam zum Waldrande, warf sie sich in den Schnee, und schlug mit den Händen um sich, daß der dichte, weiße Staub auseinanderstob nach allen Seiten.
Michael war aufgeregt, aber er schritt nun ruhig weiter, sein Gewissen warf ihm nichts vor. Er stieg über die Leiter die Loserwand hinan und ging über den Hochboden hinaus; dadurch schneidet man den halben Weg ab, der zum Bauer an der Wand führt.
*
**
Ein Windwehen hatte die dicken, schweren Schneemäntel von den Bäumen geschüttelt. Da war es umgekehrt, wie im Sommer; die Waldwipfel waren dunkelschwarz und die Gründe waren lichtweiß. Aber da kam ein Nebel, der legte sich hin über das ganze Waldland, nur die höchsten Berge ragten aus ihm hervor und standen in der Sonne, während unten Alles versunken war in die feuchte Trübe und in die frostige Winterlichkeit. Darüber grämte sich der Wald, und er bekam einen grauen Bart, und allen Geästen und allen Gezweigen wuchsen weiße, zartbezähnte Ränder von unzähligen, glitzernden Nadelchen. Selbst auf der glatten Eisdecke des Sees keimte dieses schneeweiße Moos des Nebelfrostes, daß es knisterte, wenn Mensch oder Thier darüber hinschritt.
Es war sehr schön, und die Städter würden gesagt haben, das ganze Waldland sei versilbert, oder sei aus weißem[S. 292] Candiszucker geformt. Die Leute der Seeau aber greinten über so ein Wetter; es sei den ganzen Tag finster, und doch nicht die Nacht zum Ruhen; es sei frostig, und doch nicht frischkalt, und es werde zu thauen anheben noch weit vor der Zeit.
Im großen Seeauer Wirthshaus wurde zur Hochzeit vorbereitet. Es war eine Unzeit für alle Kälber und Hühner im ganzen Gau, und selbst für die Thiere des Waldes, obwohl die Jagdmonate schon vorüber, und die übrig gebliebenen Hasen und Rehlein sich zu Paaren schon wieder des Lebens freuten. Der Wirth ließ im Keller sein großes, ältestes Weinfaß aufspunden.
Schon tagelang stiegen zu ungewöhnlichen Stunden aus dem Schornstein des Wirthshauses liebliche, blaue Rauchwölkchen auf, und ein hocherfreulicher Geruch reichte sogar bis zum Pfarrhofe hinüber.
Der Pfarrer hatte seine Sache schier gethan; er hatte das löbliche Brautpaar bereits dreimal von der Kanzel würdevoll verkündet, und beim letzten Aufgebot hatte der Schulmeister auf dem Chor einen vollen Tusch blasen lassen, eine Ehre, die er sonst nur seinen Musikanten anzuthun pflegt, wenn einer davon sich ein Weib nimmt.
In der Kirche arbeiteten zwei Meßner, und schmückten den Altar mit allen vorräthigen Bändern und Papierblumen. Die alte Häuslerin vom Ende des Dörfchens, die Mutter der Greth, half auch mit; sie saß in der Sacristei und band mit halberfrorenen Fingern aus immergrünem Reisig einen großen Kranz für das Bild des heiligen Michael. Die „guldene Greth“ aber saß daheim im Häuschen, und starrte in die verlöschende Herdgluth hinein. Ihr Auge funkelte und ihre Züge waren schauderhaft verzerrt. Jetzt fuhr sie sich mit den[S. 293] Fingern in die losen, geschlängelten Locken und riß und zerrte wüthend an ihnen. Dann ließ sie ab, sah auf die ausgerauften zarten Haarfäden in ihrer Faust, that einen wilden Athemzug aus der wogenden Brust und murmelte: „Was soll ich dich ausreißen, du mein goldenes Haar! Ja, wären es seine, wären es die von der Haldeggerin, dann wohl! Pfui, Greth, mit den Haaren fängst nicht an, das thut jede eifersüchtige Dirn. Ich bin nicht eifersüchtig — aber in der Leut’ Mäuler hat er mich gebracht, um meinen Franzl hat er mich gebracht. Was schert mich der dalkert’ Michael mit seiner vornehmen Lahmleidigkeit — aber Seesteinerin hätt’ ich mögen sein, und sie haben mich gar schon so geheißen. Jetzt hab’ ich die Schande und den Spott, jetzt kommt Keiner mehr um mich. Jesus, ich weiß nicht, was ich thu’; wenn nur ein schwer Unglück wollt’ niederfallen, und thät’ uns All’ miteinander erschlagen! Aber ihn und sie um drei Minuten früher als mich, daß ich’s noch kunnt sehen! — —“
*
**
Wenn sie am jenseitigen Seeufer vor dem Seesteinerhause einen Pöller loslassen, so sieht man’s von der Seeau aus wohl aufblitzen, aber man kann bequem bis in die Zwanzig hinein zählen, bis der Schuß kracht. Der Knall fliegt wohl über die glatte Fläche hin, doch er prallt an zahllosen Felsvorsprüngen an, und weckt in den Wänden und Wäldern zahllose Echos auf, bis er endlich an das Ohr der Seeauer schlägt.
Heute aber hört man hier nur den dumpfen Knall, sieht aber kein Aufblitzen. So dicht liegt der Nebel über dem See, daß man ihn — wie die Leute sagen — mit einem Messer könnte in Stücke schneiden.
Es ist ein Januarmorgen. Ein großer Theil der Seeauer steht am Ufer und guckt und horcht. Jetzt fallen drüben drei Schüsse rasch nach einander, jetzt gehen die Hochzeiter ab. In einer halben Stunde sind sie da, denn über das Eis gleitet sich’s leichter mit behendigen Schlitten, als mit Kähnen zur Sommerszeit.
Eine Weile ist es still, daß man völlig den Nebelthau könnte rieseln hören; hüben kein Lärm und Laut, drüben kein Schuß. Dann flüstern die Leute wieder; sie haben dem Brautpaare alle mögliche Ehre vorbereitet. Der Schulmeister rückt mit seinen Musikanten aus, gar die große Frohnleichnamstrommel mit den mächtigen Klingscheiben wird mitgeschleppt. Keiner versucht mehr sein Instrument, es ist Alles schon gestimmt. Die Meßner in der Kirche zünden alle Kerzen an, und das ist am düsteren Morgen ein feierlicher Schein in dem festlich gezierten Raum. — Drei Jungen stehen unter dem Thurm und haben die Glockenstricke in den Händen. Sie warten nur noch auf das Zeichen.
Das Wirthshaus steht still da, aber in der großen Küche schießt ein Rudel Weiber umher, und die Herdflammen knattern wie ein wildes Schlachtfeuer.
Endlich dringt ein Jauchzen her über den See und ein Schellenklingen. Da fächelt ein Mann gewaltig mit seinem Hut. In demselben Momente klingen alle Glocken. Dunkle Massen treten auf der Seefläche aus dem Nebel hervor — rasch werden sie zu Gestalten; die Rosse traben heran, die Schlitten fliegen nach, und auf den Schlitten jauchzend und johlend und hüteschwingend die Hochzeiter.
Bums! fällt die große Trommel ein, und die Trompeten schmettern auf, und die Pfeifen jodeln drein, und von der Loserwand knallen Pöller, daß die Kirchenfenster schrillen.
Der Hochzeitszug ordnet sich rasch, und in der Mitte das schöne, schmucke Brautpaar, so zieht er zur Kirche hinan.
*
**
Sie knieten am Altar, und der Pfarrer legte die Stola um die Hände. In demselben Augenblick huschte die Greth an der offenen Kirchenthür vorüber, und that einen Fluch, und eilte davon.
Sie watete durch den Schnee hinaus in den Wald; die fallenden Eisnadeln strichen ihre gluthheißen Wangen. — Jetzt werden sie getraut, dann ist diese Haldegger Seesteinerin. Ist sie reicher, vornehmer, besser wie ich? — Mir hat er’s verheißen, ihr hält er’s; jetzt reicht er ihr den Ehering. Dann ist lustige Hochzeit den ganzen Tag, und sie heben die Gläser und Trinken zum Gutleben, und sagen Ehrensprüche für das Brautpaar, und singen Spottlieder auf die guldene Greth. — Und wenn der Abend kommt, da fahren sie wieder über den See, fahren ein in den Hof —
Eine unbeschreibliche Gewalt wüthete im Busen der Dirne. Sie eilte am Ufer des Sees dahin; dann rief sie laut: „Und wär’ das Wasser auch nicht zugedeckt, hineinspringen thät’ ich nicht! Ja, wenn ich sie mitreißen kunnt, All’ miteinander — nachher mit Freuden — mit Freuden!“
Sie raste fort. Sie kam in Gefälle und auf wüste Gründe; Rehe und Füchse und wildes Geflügel spürte sich im Schnee. „Jetzt gehe ich und zünde den Seesteinerhof an,“ sagte sie und eilte weiter. Sie lief über den See, sie war gehüllt in Nebel, kein Mensch konnte sie von der Ferne sehen.
Sie kam an’s Ufer. Der Hof lag still da; die Eiszapfen der Dächer troffen rings umher, oder fielen klirrend zu Boden; das war die ganze Wache.
Seitab stand ein Fischerhäuschen. Der alte Fischer Wolf saß davor auf einem Bänklein. Er rauchte eine Pfeife, und zog jedes hervorgeblasene Wölkchen fast gierig mit der Nase wieder an sich. Das ist ein Tabak, wie ihn sonst kein Fischer raucht; der Kaiser raucht ihn. — Der Seesteiner hatte dem Alten zur Hochzeitsfreude eine ganze Schachtel davon bringen lassen. So ein Kraut! Das ist dem Alten das höchste Ereigniß in seinem Leben; die Eisdecke möchte er aufreißen und es den Fischen zurufen: „Laufet, laufet, laufet euere guten Wege; ich rauche Kaisertabak!“
Die Greth schritt rückseits des Häuschens vorüber und schlüpfte durch ein Thürchen in die Stallungen. Kein Mensch war da; Alles ruhig und verlassen. Große Heu- und Strohvorräthe waren hier aufgehäuft; ganze Wände von Hafer- und Roggengarben, noch theilweise mit den Fruchtähren, waren geschichtet und darüber spannte sich das mächtige Gebälke des Dachstuhls und das weite, hohe Schindelgedache. An diese Stallung schließen sich andere Scheuern, Fruchtkammern bis hin zu dem weitläufigen Wohngebäude. — „Das ist Dein Hof, Du schöner, stolzer Seesteiner Michael. Wenn die Brautleute heimkommen, wird’s recht warm eingeheizt sein. Aber so viel finsterer Nebel wird sein, daß sie gar das Haus nicht mehr finden. Morgen stellt Dir der Pfarrer einen Brief aus: ‚Brandsteuerschein für Michael Rehling.‘“ —
Die Greth sucht aus ihren Taschen Zündzeug hervor, da hört sie unter ihren Füßen poltern. Sie erschrickt, legt sich auf den Boden und guckt durch die Bretterfugen hinab. Da unten stehen und kauern an den Barren die Rinder in ganzen langen Reihen. Dort steht eine Kuh und daneben hüpft ein junges, falbes Kälbchen flink umher und legt seinen Kopf an[S. 297] den Hals der Mutter, um den die Hängekette liegt, und macht große, kluge Augen.
Das stoßt der Greth an’s Herz. Sie bewacht ihre Hand; nur ein einziger Strich mit dem Zündhölzchen ist nöthig, und es prasselt und schmettert das Feuer, es wogt der glühende Rauch. Die Thiere brüllen, sie hängen an der Kette; nur das Kälbchen ist frei, aber es läuft nicht zum Ausgang, es verläßt die Mutter nicht. Da stürzen die lodernden Balken nieder — —
Blaß ist das Mädchen geworden, zurückgleiten läßt es das Zündzeug in den Sack, und flieht aus der Stallung und davon, als stehe hinter ihm der große Hof wirklich in Flammen. Jetzt schlug der Kettenhund an. Eine Magd sah zum Fenster heraus: „Uh, da läuft die guldene Greth vorbei, ist die denn heut’ nicht im Dorf? Und ist sie vom Hund so erschrocken? Sie fürchtet sich sonst nicht einmal vor dem bösen Feind!“
Die Greth eilte über die Eisfläche des Sees; bald sah sie nichts mehr vom Ufer, nur den Hund hörte sie noch eine Weile bellen.
Es graute, als wollte schon die Nacht anbrechen. Im Dorfe zünden sie die Lichter an und es klingen die Gläser und die Geigen.
Grethe fühlte, daß sie unsäglich einsam war. — Ueber dem Haupte die dichte graue Hülle; der Himmel hat seine finstersten Wolken auf sie niedergeworfen. Unter den Füßen Eis und Fluthen — ist das eine trübe, kalte Welt!
Ihre Kleider, ihre Haare waren feucht, aber auf ihrer Stirn glühte das aufwallende Blut.
So floh sie über die Oede dahin, sie war das einzige Menschenwesen hier, über und unter den Gewässern. Da[S. 298] stand sie plötzlich still, sie hörte ein Schnalzen, ein Knistern, wie wenn ein Hirt mit der Peitsche knallte. Sie wußte nicht, woher es kam; war das Ufer nahe, zog ein Schlittengespann heran? Sie horchte. Da war wieder Alles still. So still und lind war’s auch in jener Sommernacht gewesen, da sie mit Michael über den See fuhr; die Wellen rieselten leise, lose Fischlein schnappten empor, und da gurgelte das Wasser, und oben und unten leuchteten die Sterne. Michael hielt sie an der Hand und sagte: „Margarethe, schlag’ Dir den Franz aus dem Kopf, der bringt Dich nur in’s Unglück. Schau gut auf Deine alte Mutter; leidet sie Noth, so stehe ich Euch gern bei.“ Später sagte er das vom Heiraten, und daß ihm Keine zu arm und zu gering sei. Sie lag an seiner Brust. — Jetzt sitzen sie im Wirthshaus bei der Hochzeitstafel. —
Wieder ist das seltsame Knistern und ein zwei-, dreifaches Schnalzen, und heran auf der Fläche, und hin an den Füßen des Mädchens in Zick und Zack fliegt eine dunkle Linie — ein Riß — — es berstet das Eis.
Angstvoll beginnt das Mädchen zu fliehen. Sie fühlt den Boden wanken; sie eilt hin über das große Grab, jeden Augenblick kann es sich aufthun.
Endlich aber ist sie aus dem Bereiche der Gefahr; es ist kein Knistern mehr, der Boden ist fest und sicher, wie er seit Monaten war.
Die Greth geht noch eine gute Strecke dahin — der See ist breit — und kommt endlich gegen das Dorf. Die hellbeleuchteten Fenster des Wirthshauses ziehen breite, röthliche Bänder hinaus in den Nebel. Die Greth hat Hunger und Durst, und da oben ist Ueberfluß, da oben ist Pracht und Stolz. Die große Seesteiner-Hochzeit!
Plötzlich kommt ihr ein Gedanke, der noch viel düsterer ist, als dieser Wintertag. — Die Hochzeit wird zu Ende sein, der Seesteiner fährt mit seiner Braut lustig über den See; die Rosse traben und schnauben und schellen, der Schlitten saust hinten drein, die Hochzeitsbänder flattern in der Nacht — der Boden kracht — wankt. — Glückliche Fahrt, Seesteinerleut’! — Es muß so sein, der Himmel will es selbst so haben. Der Michael hat ein Herz gebrochen, nun will er mit einer Andern in die Brautkammer gehen; aber das Brautbett ist im See, im tiefen, kalten Seegrund. Sie, die Greth, thut nichts dazu, Gott hat’s gestellt — sie weiß es nur um eine Stunde früher. —
Hunger und Durst ist vergessen. Die Greth schleicht durch die Dorfgasse und wieder dann am Ufer hin. Da kommt ein Mann über den See. Der alte Fischer ist’s; der hält das Pfeifchen noch immer in der Hand, raucht aber nicht.
„Das ist kein Gehen mehr jetzt, da herüber,“ murmelt er, „’s ist wohl wahr: Paulibekehr, Schlitten weg, Wagen her. Wir brauchen aber den Kahn; der Weg um den See herum ist zu weit und toll verschneit.“
Der Greth fährt’s durch den Kopf: Der Alte geht geradewegs in’s Wirthshaus, verräth die Sach’ und kehrt Alles um. — Sie eilt auf ihn zu: „Gut, Wolf, daß Ihr da seid, hätt’ hinüberlaufen sollen zu Euch, Ihr sollt geschwind aber geschwind zum Bauer an der Wand hinauf, und schrecket Euch nicht, ich denk’ ’leicht gar, Eure Schwester liegt im Sterben!“ Sie erschrak fast über ihr eigenes Wort, aber sie gehorchte dem Rachegefühl.
Des Alten Schwester war Dienstmagd beim Bauer an der Wand und war schon jahrelang krank.
„Ei schau, die Kath,“ sagte der Wolf wie zu sich, oder zur Sterbenden, „will’s Dich doch packen, jetzt auf einmal! Du arme Haut; die Welt ist schon allweg so übel gewesen auf Dich, ist der lieb’ Herrgott doch so gut, und nimmt Dich zu sich. — Ja, ja, ich komm’ schon. Dank Dir Gott, Greth!“ — Er steckte die Pfeife in den Sack, und holperte hastig die Dorfgasse entlang und durch die Halde, und kletterte die Holzleiter der Loserwand hinan und ging hin über die Höhe.
Die Greth eilte ihm nach, und als er davon war, stieß sie an der Wand die Leiter um. Diese fiel lang und schwer hin in den Schnee; das Mädchen lief seitab.
*
**
Es war nicht so arg mit der alten Kath; es hatte auch kein Mensch nach dem Bruder geschickt. — „Diese liederlich Dirn da, jetzt hebt sie zu lügen auch schon an! — Na, weil Du nur nicht schlecht bist, Kath; jetzt geht der Winter vorbei, ich mein’, Du stehst mir wieder auf.“ So sagte der alte Fischer, dann ging er bald wieder davon.
Es war schon Nacht, aber der Nebel hatte sich ein wenig gehoben, es zog ein frisches Lüftchen. — Die Hochzeiter werden doch nicht schon abfahren? dachte der Alte, sie wissen es etwa nicht, daß draußen von der Hirschwand herüber der See einbricht. — Ei, ja, die bleiben heut’ schon noch eine Weil’ beisamm’; ’s ist nur, daß ich mich völlig nit in’s Wirthshaus trau’, sie werden meinen, ich bin da, daß sie mir ein Glasel sollen einschenken. Thun wird er’s gern, der Seesteiner, thät’s aber nicht verlangen; ich hab’ schon meinen Theil und bin zufrieden. — Der Fischer griff nach seiner Pfeife und eilte recht hastig dahin.
Wie er jedoch zur Loserwand kam, da wäre er schier in den Abgrund gepurzelt. Es war die Leiter umgefallen, nun konnte er nicht weiter.
Sollte er umkehren und den weiten Fahrweg gehen? da kommt er wahrhaftig spät in das Dorf hinab.
Er blickt hinaus; sein Auge ist alt, aber er sieht nun in der dunkeln Nacht fast mehr, als am nebeligen Tag. Der Wald, die Felsen sind schwarz bis empor, wo sie wieder in die Nebelschichte hineintauchen. Dorthin liegt die breite, graue Tafel des Sees. Der Seesteinerhof drüben ist nicht zu sehen, vor ihm ragt die finstere Hirschwand. Vom Dorfe da unten ist nichts zu erkennen, als einige rothschimmernde Fensterscheiben. Plötzlich aber klingen Trompetenstöße herauf und Fackeln schweben zwischen den Häusern hinab gegen das Ufer.
Sie gehen, sie sind auf der Heimfahrt.
Den alten Fischer erfaßt eine fürchterliche Angst. — Sie rennen in ihr Verderben und er kann nicht hinab, um sie zu warnen. Er läuft über der Felswand hin und her, und weiß es doch, es giebt keinen Abstieg. Er hebt an zu rufen, aber seine Stimme ist dumpf; unten schallt die Musik, schallt das Gejohle der angeheiterten Hochzeiter. Er hört jauchzen, er hört die Pferde wiehern, hört das lustige Schellengeklingel. Da trennen sich zwei Fackeln von den übrigen und gleiten hinaus über den See.
Der Alte ist in Verzweiflung. Er brummt über das rasche Heimfahren heute, wo man doch sonst die halben Nächte im Wirthshause verschwärmt, er flucht über den Leichtsinn der jungen Leute, die außer ihrem Heiraten schon gar nichts mehr denken mögen. Sie haben kein Thauwetter wahrgenommen die Tage her, sie meinen, wenn im letzten Jahr das Eis erst im März gebrochen ist, so muß es heuer auch so sein.[S. 302] Die merken’s nicht in ihrem Taumel, wenn die Decke kracht, Jesus, und nachher ist Alles vorbei! —
Die zwei Fackeln zogen hin über die Fläche. Immer weiter entfernten sie sich vom Ufer, immer leiser wurde das Schellen der Pferde. Sie waren schon weit draußen, sie nahten endlich der Hirschwand; die Fackeln waren wie zwei Sternchen.
Der Alte starrte hinaus und hielt den Athem an, als wäre sein warmer Hauch im Stande, die Eisdecke vollends zu lösen. Er meinte, sie würden, ja sie müßten stehen bleiben und umkehren. Aber die Sternchen glitten weiter. Da sank der alte Wolf auf ein Knie, schlug die Hände zusammen und rief wild aus: „O, Herrgott, hast denn keinen Schutzengel für sie! Ist der Seesteiner nicht allweg ein braver, wohlthätiger Mensch gewesen, und sein junges Weib von Herzen gut und rechtschaffen! O Gottesmutter Maria rein, so nimm sie Du in Deinen heiligen Schirm!“
Still war die Musik, still lag der See, weit draußen ragte die finstere Hirschwand. Und die Sternlein waren dem Alten verschwunden.
In demselben Augenblicke dämmerte unten im Dorfe ein blutrother Schein auf. — —
*
**
In den zwei größten Stuben des Wirthshauses war die Hochzeitstafel abgehalten worden. Lust und Frohlocken war überall, und Alle sahen in dem jungen Brautpaar ihren König und ihre Königin.
Als das Mahl zu Ende war, und der Pfarrer auf das Wohl des Seesteiners und seiner anmuthigen Frau einen Spruch ausbrachte und mit dem lächelnden Ehepaare anstieß,[S. 303] ging sein Glas in Scherben, und der Wein löschte gar eine Kerze aus und ergoß sich über den Tisch.
Das war keine gute Vorbedeutung; viele Anwesende stutzten; draußen im Vorhause gellte ein wildes Auflachen.
Die Grethe war’s, die eine Weile an der Thür gestanden und durch das Menschengewühle das Brautpaar angestarrt hatte. Ihre alte Mutter, die Gstettnerin, saß in der Küche bei Krapfen und Braten, heute hatte sie in Ueberfluß; sie war ja bei den Vorbereitungen Helferin gewesen. Das alte Weib sah sich nach der Tochter um; die hatte es heute den ganzen Tag wieder nicht zu Gesicht bekommen; wäre sie jetzt da, so bekäme sie auch.
Die Wirthin sah sie wirklich stehen im Vorhause, und sagte: „Geh’ her, Greth, magst was essen, was trinken? Deine Mutter ist auch da.“
Im selben Moment aber zersprang dem Pfarrer das Glas; da kreischte die Greth auf, und verließ das Haus.
Sie ging wieder am Ufer entlang und horchte, ob auch nicht hier die Eisdecke krache. Sie hörte nichts — ja, das Wirthshaus hörte sie, und den Jubel, und immer nur das.
Da kamen sie endlich gar mit Hall und Schall heraus in die Nacht, und als die Schlitten zurecht gerückt, und die Pferde eingespannt wurden, da duckte sich die Greth hinter einen Strauch. Ihr war, als müsse Alles auf sie hinsehen, auf sie zukommen, und sie war ja keine Verbrecherin, sie war unschuldig — der Herrgott hat das laue Wetter gemacht, und das Eis bricht selber ein. — Laut war’s am Ufer, aber zum erstenmal war’s, daß die Greth das Pochen in ihrer Brust hörte, und sie hatte doch nicht darauf gehorcht. Einen Zweig des Hagebuttenstrauches zerknitterte sie in ihren bebenden Fäusten; die Dornen gingen in’s Fleisch.
Endlich zog das Gefährte hinaus auf die Fläche; die Fackeln loderten nach rückwärts, wie blutrothe Fähnchen.
Eine Weile stand die Dirne still, wie eine Säule, dann sprang sie einige Schritte auf den See hinaus und breitete die Arme und that einen heiseren Schrei. — —
Die Fackeln eilten weiter und blickten zurück wie zwei Augen. Wie seine Augen.
Die Greth lief durch die Dorfgasse und rief: „Eilet, eilet zu Hilf’, das Eis bricht ein!“ Sie lief zur Kirchenpforte, der Glockenthurm war gesperrt. Leute eilten zusammen und wußten nicht, was das zu bedeuten. „Kein Mensch holt sie mehr ein!“ schrie das Mädchen und schlug sich in’s Gesicht, und raste wieder hinab gegen den See. Weit draußen schwebten die zwei glühenden Aeuglein.
Sie sah hin. Sie preßte die Hände auf die Brust und that einen fiebernden Athemzug. Ist denn kein Mittel, sie zurückzurufen? Plötzlich fuhr sie sich gegen die Stirn. Rasch holte sie ihr Feuerzeug hervor, eilte, watete im Schnee gegen die Dorfwiese; dort war früher ein Heuschober gestanden. Aber er war eingeheimst. Die Grethe kehrte um. Immer den Blick auf den See gerichtet, lief sie gegen das obere Ende des Dorfes. Die letzte einzeln stehende Hütte, das war ihr Haus und Heim. Sie erreichte es, im Nu hatte sie ein Flämmchen und fuhr damit unter das Strohdach.
Wie ein freigelassenes Vöglein hüpfte die Flamme weiter, knisterte, leuchtete.
Bald war die helle Lohe da, das Dorf glühte im Feuerschein, das Gewände oben war ganz roth, auf der Seefläche spiegelten sich die Flammen.
Während die Leute herbeieilten, und die Achseln schüttelten, weil nichts mehr zu retten war, und nur ihre eigene Habe[S. 305] wahrten, irrte die Greth draußen auf dem See. Sie sah noch die zwei Lichtlein, sie standen auf der Fläche nächst der Hirschwand und waren völlig im Erlöschen. Jeden Augenblick konnten sie erblinden, versinken.
Was da hinter ihr vorging in der Noth des Feuers, in der Verwirrung des Dorfes, das achtete sie nicht; ihr Blick bewachte mit unsäglicher Angst die zwei Aeuglein auf dem See. — Und siehe, endlich leuchteten sie heller, wurden frischer, größer, kamen näher. Da johlte die Greth auf, und das war das lustigste Jauchzen an diesem Hochzeitstage.
Sie waren gerettet.
Das Mädchen zog ihnen entgegen über die Fläche. Sie sah schon das Sausen des Windes in den heranschwebenden Fackeln. Sie fiel den Pferden in die Zügel. „Was ist’s, wo brennt’s?“ rief der Seesteiner aus dem Schlitten. Da stürzte ihm das Mädchen wortlos an die Brust, sank zurück auf den kalten Eisboden, und das Gefährte glitt weiter.
„Das ist ein Hochzeitstag! Seid Ihr auch wieder zurück!“ sagte ein Mann, als der Seesteiner aus dem Schlitten sprang und seinem jungen Weibe den Arm zum Aussteigen gab.
„Nu, Gott sei Lob und Dank, die Gefahr ist wohl vorüber, der Gstettnerin ihr Häusel ist halt niedergebrannt. — Eine Närrische haben wir auch im Dorfe. Ist’s denn wahr, daß auf dem See das Eis einbricht?“
Die Brautleute sahen sich an, und sagten kein Wort. — Das Eis bricht ein auf dem See! — Man konnte in der Dunkelheit nicht sehen, wie sie erbleichten.
Die alte Gstettnerin hatten sie in’s Wirthshaus zurückgebracht; sie verlor kein Wort über ihr zerstörtes Heim, nur ihre Tochter rief sie mit kläglicher Stimme.
Ihre Tochter aber saß an der Brandstätte und wärmte sich. Sie saß zwischen den glühenden Balken und rief ein- über das andermal: „Das Eis bricht ein!“ Und dann lächelte sie. Flämmchen wollten emporhüpfen in ihr goldiges Haar. Es war ihr aber kühl, ach, die Welt war für sie so kalt. Dort stand der kleine Feuerherd — jetzt dachlos in der Nacht; die Grethe kletterte über kohlende Trümmer zu ihm hin.
Da kam von seinem Umweg der alte Fischer vorüber, der wollte sie von der rauchenden Brandstätte entfernen.
„Gehet, gehet Eures Weges,“ rief sie ihm zu, „und wollet Ihr zum Seesteinerhof hinüber, so fahret über Land, auf dem See bricht das Eis. — Ich habe geschwind das Feuer gemacht, daß sie umgekehrt sind.“ Sie sagte ihm noch ein Wort, darob der Alte das Haupt schüttelte. Er eilte zum Wirthshaus und rief schon zur Thür hinein: „Gebt, Leute helft mir die Greth von der Brandstelle wegbringen, sie ist von Sinnen!“
Als sie zu den rauchenden Trümmern kamen, fanden sie das Mädchen am Herde kauern — erstickt und verbrannt.
*
**
An dem Tage, als die arme Grethe begraben wurde, schnalzte und krachte es hin über den ganzen weiten See. Unzählige Sprünge zuckten hin und her, und der Reihe nach brachen die Schollen durch in das dunkle Gewässer. An der Hirschwand waren sie zwei Tage früher durchgebrochen.
Auf dem stundenlangen Landweg verkehrte das Dorf mit dem Seesteinerhofe, bis sich die schwimmenden Schollen im Wasser zerrieben und gelöst hatten. Auf dem Landwege wurde die alte Gstettnerin in das Gehöfte gebracht, wo ihr für ihre letzten, einsamen Tage eine gesicherte, warme Stube[S. 307] bereitet war. Auf dem Landwege ging der Pfarrer in den Seesteinerhof, daß er sich umsehe nach dem jungen Ehepaar, und wie es die heitersten Tage des Lebens begehe.
Aber im schaukelnden Kahn rudert der alte Fischer an einem schönen sonnigen und lebendigen Frühlingsmorgen nach Seeau herüber. Er schritt, ein hölzernes Kreuz auf der Schulter, die Dorfgasse hinan, in den kleinen Kirchhof hinein und zu einem graskeimenden Hügel am Heckenzaun.
Heute noch steht dort das hölzerne Kreuz, und folgende Worte sind darauf geschrieben:
m südlichen Abhange des Grübnergehölzes brennt der Wald. Er brennt schon tagelang und im engen Gebirgskessel liegt so dichter Rauch, daß man von einem Berg kaum auf den andern sehen kann. Stechender Brandgeruch erfüllt das Thal; die Sonne ist eine rothe Scheibe und man vermag sie den ganzen Tag anzusehen. Schon von Weitem hört man das Schnalzen und Knistern der brennenden Bäume und das dumpfe Dröhnen der fallenden Stämme; das sprüht dann zeitweise durch die dunkelbläulichen Rauchwolken hochauf, bis die Flammen und Funken in neuem, frischem Geäste wieder Nahrung finden. Dazwischen hört man das Schreien und Fluchen der Männer, welche da sind, um dem Brande Einhalt zu thun. Die Leute aus der ganzen Gegend sind beisammen, denn es droht ein fürchterliches Unglück.
Der Wald ist groß, er gehört theilweise einzelnen Bauern, die aus Holzkohlen ihren einzigen Erwerb ziehen; theilweise ist er Gemeingut des Dorfes, das davon alle Gemeindekosten bestreitet. Weit zieht sich das herrliche, dunkelbraune Gehölz hin über Hänge und Höhen bis gegen das stattliche Dorf hinein, welches auf der Breitebene liegt, und seine silberweißen Schindeldächer und sein zinnblechernes Kirchthurmdach[S. 309] weit in die Gegend hinausschimmern läßt. Anfangs hatten die Einwohner vor dem Feuer das Gestrüpp und Gesträuch weggeräumt, aber die Flammen griffen höher, sie griffen zu den dichtbemoosten Stämmen und deren Kronen empor, welche die glühende Sonne schon seit Monaten getrocknet und gedörrt hatte. Da machten sich die Leute wohl an das Fällen und Abstocken, aber das Feuer folgte ihnen auf dem Fuße, und Rauch und Hitze zwangen sie zum Einhalten.
„Wenn bis übermorgen kein Regen kommt, so ist der ganze Wald und auch das Dorf verloren!“ jammerten Viele und man war rathlos.
Der Greßbacher war der Einzige, der nicht den Kopf verlor. „Den Grübnerwald müssen wir aufgeben,“ rief er, „aber das Dorfholz ist noch zu retten. Dort vom Ankogel hinab müssen wir abgrenzen. In zwei Tagen haben wir einen mehrere Klafter breiten Strich entstockt, und vor dieser Zeit kommt das Feuer wohl nicht dort hinüber!“
Und so ließen sie im Grübnerwalde den Gluthen und Flammen freien Lauf und arbeiteten nun am Ankogel. Der Grübner, der unten im Thale jenseits des Baches sein Haus hatte, war ein rasender Mann. Er steht am Zaun und muß zusehen, wie dort oben sein ganzer Wohlstand zu Grunde geht. Und wie der Mann so dasteht, derb, rauh und knorrig von oben bis unten, gleich einer der wilden riesigen Hochwaldfichten, die dort drüben brennen, da kann man es in seinen Augen und Zügen sehen, daß auch der Grübner ein brennender Baum, der aber inwendig glüht und lodert, wie wenn der Blitz in ihn gefahren.
Vor vier Tagen war es gewesen, am Samstag spät Abends. Der Bauer schlief schon und Alles war ruhig im Hofe. Da schlägt es plötzlich an’s Fenster, daß die Scheiben[S. 310] klirren, und ein Knecht, der alte Gregor, ruft herein: „Bauer, Bauer, der Wald brennt!“
Der Grübner fährt auf — das ist ja wie am helllichten Morgen! und wie er seine schlaftrunkenen Augen durch das Fenster gegen den Wald wendet, da muß er sie niederschlagen, so grell loht es auf drüben im Gehölze. Sie gingen zu retten, aber da zog ein heißer Luftstrom durch die Bäume, und als am Morgen die Sonne kam, war sie nur eine glanzlose Scheibe. Seitdem brennt es und seitdem hat der Grübner keinen Bissen zu sich genommen. Gearbeitet hat er mit den Anderen Tag und Nacht und dem Feuer geboten: „Du mußt auslöschen!“ Aber das Feuer erlosch nicht. Das waren nicht dieselben Flammen, die daheim auf dem Herde knisterten und ihm Wärme und nahrhaftes Brot bereiteten, das waren böse, unheilvolle Feuerfluthen, aus der Hölle hervorgebrochen, um ihn, den Grübner, zum Bettler zu machen. Und als gar die Leute ihre Arme sinken ließen und nur an den Gemeindewald dachten, da fluchte er über die Menschen und raufte sich die grauen struppigen Haare, als wollte er damit das Moos von den Bäumen zausen — und er schlug sich die Faust in’s Gesicht, daß das Blut niederfloß aus Nase und Mund. „Wenn nur Gott retten kann,“ schrie er auf, „warum thut er es nicht, warum läßt er mich, den fleißigen, arbeitsamen Grübner, jetzt zum Bettler werden?! — Bub’!“ rief er seinem zwölfjährigen Sohne in’s Ohr, „so ist dieser Gott und so sind diese Leute, jetzt siehst Du’s, so sind sie!“
Der Pfarrer war gekommen und wies ihn ob solchen Frevels derb zurecht.
„Wo ist der Gregor?“ rief der Bauer.
Der Gregor war beim Feuer, und als sonst kein Mensch mehr dabei arbeitete, hackte er noch die Aeste von den[S. 311] Stämmen und schleppte sie abseits. Rastlos eilte er durch Gestrüpp und Rauch. Seinen Lodenspenser hatten die Funken bereits durchlöchert und seine langen weißen Haare waren gekraust und roth geworden. Vorgestern war er in seiner Noth beim Caplan zur Beichte und seitdem geht er nicht mehr weg von der Brandstätte, bis das Feuer gelöscht ist.
„Und wenn mein Wald hin sein muß, so soll auch das Gemeindeholz brennen und das Dorf und die ganze Welt!“ schrie der Grübner. Er lachte, als gegen Abend ein starker Luftzug kam und als gar einzelne Windstöße das Feuer doppelt auffachten und die flammenden Reiser hoch über die Wipfel dahintrugen gegen den Gemeindewald und das Dorf. Die Sonne sah man nicht mehr und im Thale war es ganz dunkel geworden. Nur die grellen Flammen leuchteten noch, aber das war heute kein ruhiger Schein, wie in den früheren Nächten, es war ein Flackern und Wogen, und über die Felder und Auen flogen die finsteren Schatten des gepeitschten Rauches dahin. Wild toste der Sturm, die Gebäude ächzten und das Prasseln der Flammen war schrecklich zu hören. Jetzt ließen die Arbeiter ihre Aexte fallen und eilten dem Dorfe zu, um dort zu retten, was noch zu retten war. In wenigen Stunden schon konnte sich das Flammenmeer über den ganzen Wald ergossen haben und an die Dächer des Dorfes schlagen.
Da loderte aus dem schwarzen Abendhimmel ein Blitzstrahl und diesem folgte ein erschütternder Donnerschlag und ein heftiger Regenstrom. Das rauschte nieder wie ein Wolkenbruch, und bald schossen Gießbäche den Thalweg entlang und brausten um Haus und Stall und hinab über den Hang. Um Mitternacht war Alles ruhig und heiter, und der Vollmond schien in das Thal, und aus den Schluchten stiegen[S. 312] schneeweiße Nebel auf. Aller Rauch und Brandgeruch war fort und der Waldbrand war gelöscht. Am Morgen lagen im Grübnerwald zwischen den schwarzen Strünken nur dampfende Brände, und über den ganzen weiten Hang hin lohte keine einzige Flamme mehr. Freilich waren über zwanzig Joch des herrlichsten Stammholzes verloren, aber noch mehr war dem Grübner wider Erwarten davon erhalten geblieben. Und weil das nun einmal so war, so ergab sich der Bauer drein, ließ sich wieder seine Morgensuppe schmecken und machte dabei Pläne, was mit dem ausgebrannten Waldgrund nun weiter zu thun sei.
Genovefa, die Stallmagd, schaffte in der Futterkammer, fütterte die Kalben, molk die Kühe und trieb sie endlich aus und aufwärts gegen das Hochfeld zur Weide. Die Magd war unstet und blickte rechts und links hin, und als sie zur Höhe kam, stieg sie auf die Kreuzwand, blickte ringsumher und horchte. „Gregor!“ rief sie dann. Aber das gab heute keinen lustigen Widerhall vom Walde herüber wie sonst, wenn sie ein Lied sang und die Kühe bei ihren Namen rief; jetzt steht ja kein einziger lebendiger Baum mehr drüben — Alles verdorben. „Gregor!“ schrie sie wieder. Nein, es wird ihm doch nichts geschehen sein; jetzt ist er schon seit zwei Tagen nicht mehr im Hause gewesen, ein ordentlicher Dienstbot’ muß ja immer da sein, ich werd’ ihm das schon sagen — aber er weiß ja sonst selbst, was ein ordentlicher Dienstbot’ zu thun hat. So dachte die Magd bei sich und ging dann wieder in den Hof hinab.
Der Bauer war in der Wagenhütte und stellte die Schlarpfen — ein Fahrzeug, halb Wagen, halb Schlitten, zum Transport des Holzes von den Hängen — zusammen. Er wollte nun die Brände und Strünke seines verbrannten[S. 313] Waldes zu der Kohlstatt hinausführen und sehen, ob daraus noch Kohlen zu gewinnen seien, die an das große Stahlwerk draußen in der Ebene gut zu verwerthen sind. Den Brandgrund wollte er dann reinigen, entstocken, umpflügen und zu einem Acker machen, denn Bäume wachsen auf solch’ einem ausgebrannten Boden sobald nicht wieder. Der Bauer dachte daran und steckte eben ein Rad an die Schlarpfe, als Genovefa vor ihm stand und fragte:
„Aber, Bauer, wo ist denn der Gregor alleweil?“
„Der Gregor? Nu, wenn er nicht auf dem Eschenbaum ist und für die Schafe Aeste herabhackt, dann weiß ich’s nicht.“
„Ja, er ist aber schon zwei Tage nicht mehr da gewesen, es wird ihm doch nicht wo was geschehen sein, Bauer?“
„Ei, nu, und wenn ihm was geschehen wär’, was geht denn das Dich an? Ich bin Bauer und ich hätt’ den Schaden, wenn er sich ein Bein gebrochen, oder den Hals; ich hab’ ihm den Lohn zu geben für’s ganze Jahr, und nicht Du! — — Wird halt bei den Löschern gewesen sein und heut’ Nacht drüben im Dorf geholfen haben — was weiß ich!“
Der Mann schlug den Nagel an die Radachse, daß es klirrte, und er sprach kein Wort mehr.
Genovefa ging traurig in den Stall an ihre Arbeit. Sie war durchaus nicht mehr jung, doch bei ihrem Geschäft noch ganz rüstig; heute aber — heute ging’s nicht. Sie lehnte die Streugabel an die Wand und ging fort. Sie war an den Werktagen noch nie so fortgegangen von ihrer Arbeit, aber heute mußte sie, und sie wußte doch nicht, wer es ihr gebot. Sie eilte über den Bach und jenseits des Thales aufwärts gegen das Gebrände. Da glühte es noch unter den Bränden und Aschen, und die Magd mußte einen weiten Umweg machen, um gegen den Dorfwald zu kommen. Sie[S. 314] wollte in das Dorf hinüber und den Gregor suchen. Aber als sie an die Grenzen des Brandgrundes kam, wo der grüne, frische Wald beginnt, da lag der Gregor auf dem versengten Boden. Er hielt eine Hand tief in das Moos gebohrt. Das Kleid seines linken Fußes war ihm förmlich vom Beine gebrannt, und die Haut war dunkelblau angelaufen und blutete an einzelnen Stellen.
„Jesus — aber Gregor!“ schrie Genovefa.
Der Greis schlug die Augen auf und sagte: „Das ist die Vefa, gelt?“
„Ja, was machst Du denn da? Du hast ja eine fürchterliche Brandwunde; heiliger Gott, ich geh’ schnell um Leute.“
„Das hilft nichts, Vefa, bleib’ nur da und lege kaltes Moos auf das Bein; schau, ich hab’s nicht können in die Erde bringen, die Erde kühlt so was recht ab. — Sag’ mir, wenn Du da vom Weg herauf gegangen bist, brennt es noch wo?“
Die Magd antwortete nicht, sie weinte, legte Moos und Erde auf die Brandwunden und schlug ihr Kopftuch um dieselben.
„Das ist ein großer Schaden für den Grübner, gelt?“ sagte der Mann.
„Nein, wie ist Dir denn das geschehen, Gregor?“
„Das da? Ich war ungeschickt, Vefa, und so ist beim Arbeiten ein brennender Ast auf mich gefallen. Zuerst hab’ ich gemeint, ich muß schreien vor Schmerz, und es ist mir heiß und kalt durch den Leib gegangen. Hab’ auch schon geglaubt, ich muß verbrennen hier, weil ich nicht weiter gehen hab’ können; aber da ist der Regen gekommen und hat das Feuer gedämpft. Vefa, dieser Regen war wohl gut, sonst wär’ der ganze Wald und das Dorf und Alles hin gewesen.“
„Gieb mir doch die Hand, Gregor, ich richte Dich auf und führe Dich heim.“
„Nein, laß die Hand da drin, das ist so kühl — hab’ mir sie ein bißchen stark verbrannt.“
„Aber so mußt Du sterben hier, Gregor!“
„Meinst Du? — Ach nein, wegen so was stirbt man nicht. Schau, sonst bin ich noch stark. Es freut mich auch, daß Du gekommen bist, Vefa. Du bist mir der liebste Mensch auf dieser Welt. Aber jetzt — heute ist es mir erst recht, daß wir nicht geheiratet haben; wenn es geschehen wäre, so wärst Du jetzt eine Bettlerin. — Ei, laß mich, es ist mir so heiß in der Brust — Vefa, wenn ich doch sterben müßte! — Bauer, wenn ich jetzt stürbe, das wäre bös für uns Beide. Schau, ich will Dir jetzt dienen, zehn, zwanzig Jahre, so lang’ ich lebe, und Du sollst mir keinen Kreuzer lohnen, bin schon so auch fleißig. Tag und Nacht werd’ ich arbeiten und Sonntags geh’ ich betteln vor die Kirchthür, daß Du mir auch keine Nahrung zu geben brauchst. Meine Hand darauf, Bauer!“
„Hilf uns die liebe Frau! Gregor, der Bauer ist ja gar nicht da!“
„Nicht? Aber brennen wird’s schon wieder. O lieber Gott, es ist mir nur so heiß. Das macht das dumme Liegen da, hilf mir auf, Vefa, ich weiß nicht, daß ich heute gar so schwach bin.“
Genovefa richtete den Kranken ein wenig auf und betete in Gedanken zu der Jungfrau Maria, auf daß doch Jemand komme und ihr helfe in dieser Noth.
„Hab’ ich Dir das Andere schon erzählt, Vefa? Nicht? So muß ich es aber doch gleich thun. Aber Du mußt mir versprechen, daß Du es Niemand sagst, so lang’ ich lebe.[S. 316] Wenn ich heut’ oder morgen schon sterben muß, und es kann wohl sein, weil mir der Brand zum Herzen kommt, so kannst Du es heut’ oder morgen schon sagen; und wenn ich noch fortlebe, so mußt Du all die Tage das Geheimniß in Dir tragen, sonst sperren sie mich ein, und dann kann ich gar nichts mehr gut machen. — Leg’ mir jetzt Moos auf die Stirn und auf die Wunden da, daß ich denken und sprechen kann. So. Und jetzt mußt Du auch nicht erschrecken, Genovefa; und zuerst mußt Du mir auch noch versprechen, daß Du mir’s glaubst, daß ich nicht schlecht bin; wirst mir’s aber nicht glauben wollen, Vefa, daß ich den Wald angezündet hab’!“
„Jesus Maria! — Gregor!“ schrie die Magd auf, deckte ihr Gesicht mit der Schürze zu und zitterte.
„Ei ja, das hab’ ich mir gedacht, Ihr Weiber seid Alle so, daß Ihr Alles gleich in die Welt hinausschreit. Hätt’ ich’s wohl auch thun mögen, als es brannte, aber was hätt’s genützt? Sollst Dir doch denken, daß es nicht blos Bosheit giebt, sondern auch Unglück, und so eins ist uns jetzt halt auch begegnet. — Am Samstag zum Feierabend bin ich in das Dorf hinüber zum Segen gegangen, um zu beten, daß es regne — das weißt Du. Ist rechtschaffen weit hinüber für Unsereinen, und auf dem Rückweg da bin ich auf einmal so müde geworden mitten im Wald — nu, Du weißt, Vefa, wenn man alt wird — das Korntragen war auch schwer den ganzen Tag. Da hab’ ich mich halt ein wenig hingesetzt auf einen Stein und hab’ mir gedacht: Ein Stücklein Brot wäre jetzt wohl gut. Aber weil du kein Brot hast, Gregor, so zünd’ dir ein Pfeiflein an, das stärkt auch. Hab’ mir darauf das Zündholzkästl aus der Tasch’ genommen, aber die Hölzlein werden bei dem vielen Schweiß einmal zu feucht, sie zünden wohl, löschen aber wieder aus, und keines hat[S. 317] mir brennen wollen. Nehme mir da ein wenig Moos und dürre Reiser, wie sie um mich genug herum liegen, und damit geht’s. Ja, ich glaub’, so beiläufig muß es gewesen sein, ich weiß das nicht mehr recht; ich bin dann noch sitzen geblieben und hab’ ein wenig geschlafen. Als ich wach geworden, hat Alles gebrannt, das Moos, die Reiser, Alles, und an den nahen Baumstämmen ist das Feuer hinaufgestiegen und ist oben auf den Aesten herumgeflogen wie ein Vogel mit goldenen Flügeln. Jesus Maria! denk’ ich, jetzt brennt der Wald! Auf die Reiser bin ich getreten, hab’ meinen Hut und Rock auf die Flammen geworfen, auf die Bäume hab’ ich wollen und das Feuer tödten, ersticken mit den Händen, mit meiner Brust, bin zurück gefallen auf den Boden und wäre zuletzt selber bald mit verbrannt. Das kann ein großes Unglück werden, denk’ ich noch, und lauf’ heim, was ich laufen kann, und weck’ die Leut’... weißt es ja so, Vefa. — Wenn doch nur wieder ein Regen käm’, da — da drinnen brennt’s so wild fort und das kann kein Mensch dämpfen.“
„Aber jetzt geh’ ich, Gregor, und werde den Bauer bitten, daß er sogleich um den Arzt fährt.“
„Nein, aber wenn Du mir den Caplan holst, so ist’s mir schon recht. Ich schlaf’ da derweil, mußt aber bald kommen, Vefa!“
Da lief die Magd fort und lief, was sie konnte, gegen das Haus und dachte unterwegs: Heiliger Gott, jetzt hat der den Wald angezündet!
Als sie zum Grübner kam, rief sie ihm beinahe athemlos zu: „Bauer, ich bitt’ Euch um Gotteswillen, fahrt geschwind zum Bader und zum Pfarrer, der Gregor liegt drüben im Wald, er hat sich völlig verbrannt!“
Der Mann horchte auf. „Verbrannt hat er sich? Was geht denn der Narr zum Feuer! Nu, wegen mir magst in’s Dorf gehen, hab’ nichts dagegen wegen ein, zwei Stunden, aber fahren kann ich nicht, das Roß ist auf der Weid’.“
Dabei nahm der Bauer Stein und Schwamm heraus und schlug sich Feuer.
Die Pfeife zwischen den Vorderzähnen, fragte er dann die rathlose Magd: „Wo liegt er denn?“
Diese schluchzte in die Schürze und entgegnete: „Dort, wo das Feuer ausgeloschen ist.“ Dann trocknete sie sich die Augen und eilte gegen das Dorf.
Im Dorfe war noch große Verwirrung. Da standen im Freien Kästen, Schränke und anderes Geräthe, und die Leute gingen zwischen den Dingen hin und her und sprachen laut und schnell mit einander und lachten. Sie schafften nun die Sachen wieder in die Häuser; die Feuersgefahr war ja vorüber.
Als der Arzt und Caplan im Chorrocke durch den Wald hinabstiegen und Genovefa mit dem Licht in der Laterne vorausging, kam ihnen Gertraud, die Dienstgefährtin der Genovefa, entgegen. Sie hatte den Verunglückten gesucht, aber nicht gefunden und schloß sich nun den drei Menschen an. Als sie schon eine Weile durch den hohen, finsteren Wald hinab gegangen waren und nun gegen die Lichtung kamen, wo das Gebrände anfing, blieb Genovefa stehen und war im Begriffe, ihrer Gefährtin die Laterne zu geben, aber sie schloß den Henkel fester in die Hand und ging noch einige Schritte weiter.
Plötzlich standen sie vor dem alten Knecht. Aber er war todt. Er lag auf dem Angesichte und um ihn herum war das Moos aufgewühlt.
Der Arzt untersuchte die Leiche und sagte dann halblaut zum Priester: „Der Mann hat viel gelitten!“ Dann gingen die zwei Männer wieder durch den Wald hinauf gegen das Dorf.
Genovefa und Gertraud hatten lange vor dem Todten gekniet und gebetet. Die Mittagssonne blitzte durch die hohen Baumkronen nieder und von Zeit zu Zeit hörte man einen Vogel zwitschern. Endlich flochten die Mägde zwei Aeste ineinander, legten den Gregor darauf und trugen ihn gegen den Grübnerhof.
Der Bauer stand an der Thür, hatte die Arme über die Brust geschlagen und rauchte seine Pfeife. Als sie mit dem Todten herankamen, trat er einen Schritt bei Seite, nahm die Pfeife aus dem Munde und winkte gegen die Wand, wo die Bodenstiege war.
Man stellte sofort unter der Stiege ein paar lange Stühle zusammen und legte die Leiche darauf. Da kam die Bäuerin, bedeckte den Todten mit einem Leintuch und zündete daneben ein Oellichtlein an. Dann gingen sie zum Essen und nach dem Essen Jeder an seine Arbeit wie jeden Tag.
Den andern Morgen zogen sie Alle in das Gebrände hinüber und schafften die halbverbrannten Baumstrünke gegen die Kohlstatt hinaus. Die zwei Knechte hieben die noch stehenden Stämme um und schlugen die schwarzen Aeste von denselben. Die Mägde trugen und zogen die halbverkohlten Stücke an bestimmte Plätze, wo dieselben durch die Schlarpfe weiter geschafft wurden. Da Gregor nicht mehr war, so führte der Bauer das Pferd. Dabei hatte er allerlei Gedanken. Der schöne reiche Wald ist nun todt und verbrannt zu Kohlen, aber nicht zu solchen, die man draußen verkaufen kann um Geld. — Der Mann biß sich derb in die Lippen,[S. 320] das Pferd hätte er aus Zorn schlagen mögen mit dem Peitschenstock — aber dann wäre es ihm mitsammt der Schlarpfe hinabgerannt über den Hang und hätte sich gar alle Beine gebrochen.
Gustl, der einzige Sohn des Grübner, kam mit dem Mittagsmahle. „Komm her, Bub!“ schnaubte ihm der Bauer entgegen, und als der Junge bei ihm war, stieß er ihn, daß die Suppe aus dem Topfe floß, und dann schlug er ihn erst, weil er das Essen halb verschütte.
Im Gebrände selbst gab es sonderbare Erscheinungen. Da lagen gebratene Vögel herum und auch ein verkohltes Reh hatten sie gefunden. Das Merkwürdigste war ein Eichhörnchen — oder war’s ein Wiesel, man kannte es nicht mehr recht — es hing an einem Baume und hatte sich fest um einen dicken, halbverkohlten Ast geklammert, war aber ganz schwarz und durchgebrannt bis auf die bleichen Beinchen. Unter all’ dem waren jedoch gar viele lebendige Würmer und Mücken; die sind klein und zart und leben fort hinaus über das Verderben und Unheil, oder sind seit demselben erst zur Welt gekommen.
Aber wie es denn geschehen sein mochte und wie es begonnen hatte? Das fragte der Grübner zehnmal. Es hat doch kein Blitz eingeschlagen in der sternhellen Nacht! Am Ende haben Vagabunden im Walde gelagert und ein großes Feuer angemacht, wie dergleichen Gesindel gern thut, oder — es ist gar von einem Nachbar geschehen aus Schlechtigkeit. Ja, schlecht sind sie genug, diese Menschen, und darum haben sie meinen Wald brennen lassen und nur das Gemeindeholz retten wollen. Der Greßbacher kann’s auch gethan haben, der ist so Einer, der! — So war das Denken des erbitterten Mannes.
Gegen Abend, als er am Wege noch einige Brände auflud, fand er im halbversengten Moose eine Tabakspfeife und ein Zündholzkästlein aus Bein. „Aha!“ rief er aus, „das ist dem Gregor sein Zeug und da liegen die Hölzlein noch herum — hat der mir den Wald —?“
Da trat Genovefa zum Bauer und sagte, daß sie Alles wisse und erzählte auch Alles, was sie wußte, setzte aber hundertmal hinzu: „Seid nicht bös auf ihn, Bauer, zu Fleiß hat er’s nicht than und er hat deswegen sterben müssen!“
Der Grübner schwieg anfangs dazu, aber später sagte er: „Ist mir immer so vorgekommen, daß dieser Mensch mein Unglück sein wird. Warum hab’ ich ihn auch nicht fortgeschickt, hat so kaum das Brot verdient, das er mir gegessen!“
Als Genovefa mit Gertraud allein war, schluchzte sie: „Hast Du gehört, was der Bauer gesagt hat? Nein, Gertraud, wenn er mir all’ meine Finger abhacken thät, so thät’s mir nicht so weh, als wenn er über den Gregor so redet.“
„Und noch dazu jetzt, wo er auf der Bahr’ liegt!“ entgegnete Gertraud; „ich mein’ aber immer, unser Bauer hat gar kein Gewissen; hast Du’s schon gesehen, was er macht, wenn er betet? Nein, man soll so was gar nicht sagen, aber — da hat er in einer Hand den Rosenkranz und die andere hat er im Sack und klimpert mit dem Silbergeld. Das thut kein Christ.“
Am Abend, als Genovefa in’s Haus kam, besprengte sie die Leiche mit Weihwasser und füllte frisches Oel in die Lampe. Dann hatte sie einen schweren Stein auf dem Herzen; morgen soll schon der Begräbnißtag sein, und der Bauer hatte noch gar keine Anstalten dazu getroffen.
Indeß beim Abendessen sagte der Grübner zu den zwei Knechten: „Morgen um das Sonnaufgehen müssen wir wieder im Brand sein, und früher tragt mir den da draußen in’s Dorf hinüber, daß er doch einmal aus dem Hause kommt!“
Genovefa legte den Löffel weg und aß nichts mehr. Alle waren still, und die Knechte zitterten um die Mundwinkel und waren roth im Gesicht. Der Bauer aß und zuckte mit seinen buschigen Augenbrauen und sah nicht nach rechts und nicht nach links. Da hielt Genovefa plötzlich die Hände ineinander und rief laut: „Bauer, gelt, ich darf Euch bitten — Ihr laßt den Gregor ordentlich begraben!“
„Was geht Dich der Gregor an, Du graue Vettel!“ brach der Bauer los; „ich mein’, mit den dummen Liebsg’schichten habt Ihr’s lang g’nug trieben; ist Euch nicht gut angestanden, Ihr alten Stöck’; ich hab’ nur nichts sagen wollen, weil es gar nicht der Mühe werth ist. Aber jetzt, weil Eins auf dem Brett liegt, mein’ ich, soll ’s Andere an dem sündhaften Hallodriren g’nug haben! Nicht? — Nu, und hast noch nicht g’nug, Du alte Krautschreck’, so leg Dich halt hin zu ihm — laß Euch gern forttragen, all’ Zwei, gern!“
Die Knechte machten Bewegungen, aber Genovefa sagte dem Bauer die Worte: „Schmäht mich, wie Ihr wollt, Bauer, aber ihm werft keine Steine nach in die Ewigkeit und begraben laßt ihn christlich. Es ist ja noch ein Kasten von ihm da, es sind Kleider von ihm da; das reicht aus für den großen Conduct; drei Glocken können geläutet werden. Oft und oft hat der Gregor gesagt: Mag mir sonst nichts mehr ersparen, weil ich schon schwach bin und allsonntäglich mein Gläslein Wein haben muß, ohne Tabak thut es sich halt auch nicht — aber für ein ehrlich Begräbniß wird schon noch was übrig bleiben. — Ich bitt’ Euch, Bauer, der[S. 323] Gregor hat Euch fünfundzwanzig Jahr’ treu und fleißig gedient, hat’s immer gut mit Euch und den Eurigen gehalten — laßt ihn christlich begraben!“
„Ja, ja, Kasten und Kleider! Wir wissen’s schon, wie das aussieht. Und glaubt Ihr, das Zeug ist für das Eingraben da? — Kasten und Kleider! Ich mein’, so viel wär’ mein Wald doch werth gewesen, nicht? Keinen Kreuzer geb’ ich, und wenn ein Jud’ käm’ und gäb’ mir drei Groschen für den starren Gregor da draußen — ist recht, ich verkauf’ ihn. Wer zahlt mir den Wald? Wer? — Treu und fleißig gedient, ja — als ob ich ihn dafür nicht auch bezahlt und überzahlt hätt’!“
„Bauer, ich dien’ Euch ein ganzes Jahr umsonst; keinen Groschen verlang’ ich, aber den Gregor laßt christlich begraben!“ bat die Magd wieder.
Der Grübner wischte den Löffel und spielte damit. „Ein Jahr, meinst Du? — Nu, können ja noch reden davon, sollst auch nicht sagen: der Grübner ist ein Stein!“
Nach dem Abendmahle sprach er im Vorhause noch lange mit der Magd, und Genovefa stand darauf die halbe Nacht bei der Leiche und weinte bitterlich.
Am übernächsten Morgen wurde Gregor im großen Conduct unter dem Geläute dreier Glocken christlich begraben. Viele Leute sind mit der Leiche gegangen, und Genovefa hat über all’ das vor Schmerz und Freude geweint. Zuletzt hat sie noch dem alten Einleger Gottfried eine Weihkerze und zwei Groschen gegeben, daß er für Gregor’s Seele bete.
Als der Großknecht an einem der folgenden Tage einmal mit Genovefa allein auf dem Felde war, da das Korn schon reif geworden, sagte er zu ihr: „Das war wohl einfältig von Dir, Vefa, daß Du dem Bauer ein ganzes Dienst[S. 324]jahr geschenkt hast; er hätte den Gregor auch so ordentlich begraben müssen; oder glaubst Du, wir hätten unsern Gespan in einen Sack genäht und auf den Friedhof getragen wie ein Bündel Hafer in die Mühle? O, da hättest Du eher ganz was Anderes gesehen! Ich hab’ damals beim Tisch den Georg schon mit dem Fuß gestoßen — und wie der Bauer nur noch ein Wort sagt von einem solchen Eingraben wie einen Hund, nur ein solches Wort, und wir brechen ein paar Stuhlfüße ab und lehren den Bauer Gott erkennen! Wir hätten es than, und wenn er’s noch eine Weil’ so fort treibt mit Dir, so geschieht was. Glaubst, ich trau’ mich nicht, daß ich jetzt hingeh’ zu ihm und sag’: Grübner, Du bist ein Schuft! Glaubst, ich trau’ mich nicht?“
„Laß es nur gut sein jetzt, Großknecht, und reden wir kein Wort mehr davon. Ich dien’ gern ein Jahr umsonst, wenn der Bauer nur dem Gregor nicht nachflucht — der Todte könnt’ ja kein’ Ruh’ haben im Grab...“
Und sie redeten nicht mehr davon.
Gegen den Herbst kam eine schwere Arbeit. Im Gebrände mußte das Gestöcke entfernt und der Boden umgegraben werden. Mit dem Pflug kann man in solchem Waldgrund nichts anfangen, und so nimmt denn Jedes seinen Spaten oder die Haue und gräbt vom frühen Morgen bis zum späten Abend. In den Frühstunden, da geht’s freilich noch gut, da geben die Bäume, die auf der Anhöhe stehen, ihren Schatten, aber bald guckt die Sonne über dieselben herüber, als ob sie sehen wollte, ob die Arbeiter wohl auch fleißig. Und dann werfen die Leute ihre Röcke weg und graben wieder. Die Sonne bleibt nun da und blickt immer auf die Arbeiter und wendet ihr Gesicht gar nicht weg. Und die Leute wischen sich den Schweiß und graben.
Für Einen, der mit der Haue sein trocken Brot herausgraben muß aus steinigem Grund, schleicht die Sonne gar langsam über den Himmel hin; aber auch für ihn kommt der Abend. Die Schatten des westlichen Bergwaldes werden länger und länger; die Leute richten sich auf, athmen in einigen langen Zügen die frischere Luft ein, fassen den Spatenstiel fester an, und graben. Und erst wenn es dunkel geworden ist und die Haue in den Steinen schon helle Funken giebt, sagt der Großknecht: „Lassen’s gut sein für heut’!“ und die Leute suchen ihre Röcke, nehmen die Haue über die Achsel und gehen heim.
Solche Tagewerke hat auch die alte Genovefa mitmachen müssen, weil im Kuhstall der Gustl, der Grübnersohn, angestellt wurde. „Sonst thut’s mir nichts,“ hatte sie gesagt, „aber das Kreuz will mir völlig abbrechen.“
Und wie nun der ganze Hang bearbeitet war, kam der Bauer mit dem Säetuch und streute Korn in den aufgelockerten Boden. Da ist — wie er gerade um einen kleinen Felsen säete — ein Vöglein vor ihn hingehüpft und hat einige Körnlein aufgelesen. Darüber gerieth der Grübner so in Zorn, daß er einen weiten Sprung machte, um das Thierlein in den Boden zu treten; aber das war lustig auf den nächsten Baum geflattert und der Bauer hatte im Springen sein ganzes Korn auf das Erdreich geschüttet. Nach dem Säen wurde die Erde noch einmal gelockert und der Same eingewühlt — dann war es für dieses Jahr fertig.
Die Witterung war lang’ hinaus schön und die Saat ging auf und grünte noch — endlich aber kam der Winter. Die Leute zogen sich allmählich unter das Dach zurück.
Genovefa, die sonst beim Spinnen die feinsten Fäden zu drehen wußte, die im Stalle zu schaffen verstand wie[S. 326] nicht bald Eine, mußte heuer auf der Tenne den schweren Dreschflegel handhaben. Sie dachte oft dabei, wie Gregor bei der Arbeit so flink und heiter war und für die Winterabende allerhand Geschichten wußte. Sie, die Vefa, hatte damals auch gesungen, jetzt aber hat sie gar keine Stimme mehr und es fallen ihr auch die Lieder nicht ein. Die Lieder kämen nur so beim Kuhmelken, aber jetzt darf sie ja nicht mehr in den Stall, dort hantirt der Gustl und will Alles selbst verstehen. Die arme Magd ist ganz verwaist und einsam. Es kam die Weihnachtszeit und der Bauer ließ jeden Dienstboten vor sein Tischlein rufen und zahlte den Jahrlohn aus. Nur Genovefa ließ er nicht rufen.
Aber der Großknecht fragte den Grübner: „Was ist’s, Bauer, kriegt die Vefa nichts?“
„Das macht Dir gar nicht heiß, Bub’, Du hast Dein Sach’!“
„Aber ich will’s just wissen, kriegt sie was oder nicht?“
„Nein, sie kriegt nichts!“
„So! — Ist recht, Bauer, ist schon recht. Weißt Du, Grübner, die Leute denken sich schon lang’ was von Dir, und ich denk’ mir auch dasselbe, und ich sag’ Dir’s auch, Du bist überhaupt so Einer —“
„So Einer! Was für Einer?“
„Was Du an der Vefa thust — man kann Dir bei Gericht nicht an, das weiß ich, denn Du hast sie überredet — aber schlecht ist es von Dir! — Bauer, Du bist ein elender Schuft!“ Mit diesen Worten spie ihm der Knecht in’s Gesicht.
„Anspeist Du mich?“ krächzte der Grübner und stürzte gegen den Tisch, wo ein Messer lag; „Teufel, ich stech’ Dich nieder!“
Aber in diesem Moment hatte ihn der Knecht am Halse gefaßt und schleuderte ihn gegen den Kachelofen, daß dieser barst und einbrach.
„Jetzt komm’ mit mir, Vefa!“ rief der Großknecht diese im Vorhause an, „komm’, wir gehen zum Dorfrichter, zum Greßbacher — bin so zornig gewesen und hab’ mir nicht mehr zu helfen gewußt!“
Indeß stand der Bauer mitten in der Stube mit blutender Stirne, und die Leute, die über den Lärm zusammengeeilt waren, standen um ihn herum und sein Weib wusch ihm das Blut mit kaltem Wasser weg und schlug dann ein Tuch um seinen Kopf. Der Mann sagte nicht ein Wort, er fragte auch nicht nach dem Großknecht. Der Großknecht hatte seine Kleider genommen und war fortgegangen; es war ihm ganz leicht um die Brust über das, was er dem verhaßten Bauer gethan hatte.
Genovefa aber blieb wie vor im Hause und arbeitete und arbeitete. Auch Gertraud blieb ihrer Gefährtin zu Liebe und von einer fremden Pfarre waren zwei neue Knechte gekommen. So ging es seinen gewöhnlichen Lauf wieder fort. Der Bauer trug lange die Binde um die Stirne und sprach wenig; nur mit seinem Weibe fluchte er und seinen Sohn schlug er, wenn ihn irgend etwas wurmte.
Da geschah im Laufe des Winters einmal ein großes Unglück. Klopfte es um Mitternacht plötzlich an der Schlafkammer des Bauers und Genovefa rief: „Steht doch geschwind’ auf, draußen im Stall giebt’s was, die Vieher röhren fürchterlich.“
Und als sie mit Lichtern in den Stall kamen, lagen zwei Kalben und eine Kuh mit ausgelassenen Eingeweiden da und verendeten. Die wilde Mastkuh war von der Kette[S. 328] los geworden und hatte ihre scharfen Hörner den wehrlosen Nachbarn in die Leiber gerannt. Als der Grübner dies sah, war er über alles Erwarten ruhig, nur befahl er, daß man sogleich den Gustl, der die Aufsicht über den Stall hatte, herbeibringe. Gustl hatte in der Futterkammer sein Bett, aber das war heute leer, der Stallbub’ war nicht daheim. Unter der Decke war’s noch warm, er konnte nicht weit sein. Man schrie und rief ihn beim Namen, aber er gab keine Antwort und kam nicht. Man suchte ihn in der Scheune, auf dem Dachboden im Heu, in der Wagenhütte — er war nirgends.
Jetzt erst wurde der Bauer rasend und blieb es tagelang, denn der Junge kam nicht und Niemand hatte ihn seit der Zeit gesehen. Sofort kam wieder Genovefa in den Stall, aber sie hatte nicht mehr die Freude bei den Thieren wie einst.
„Den Buben schlag’ ich todt, wenn er kommt!“ schrie der Grübner oft und oft, aber es verging der Winter, es kam der Frühling und im Grübnerhof wurde kein Todtschlag begangen. Der Sohn des Hauses blieb verschollen. Die Bäuerin hatte seit der Zeit viel geweint; der Bauer hatte nur manchmal, wenn er so in seiner Mühle auf dem breiten Steine saß, den Kopf geschüttelt und darauf recht fest in das Pfeifenrohr gebissen. — Anfangs war zu glauben, der Gustl sei aus Furcht vor der Strafe nur zum Nachbar geeilt, habe sich dann in eine angrenzende Pfarre geflüchtet und er werde sich schon wieder einstellen im Elternhause. Aber es verging der Frühling und es kam der Sommer und der Junge kam nicht zurück.
„Du Alte,“ sagte der Grübner einmal zu seinem Weibe, „der Bub’ macht mich noch närrisch!“
Das Weib fühlte selbst dergleichen, aber es war überrascht von diesem Wort ihres Mannes; mit einem solchen Ton hatte er schon seit Jahren keines mehr gesprochen. Sie fiel an seine Brust und weinte, aber der Bauer schob sie unsanft weg. „Die Welt ist eine Teufelei, die eigenen Kinder thun Einem die größte Pein an.“
Als der Hochsommer und die Mähzeit vorüber war, wurde es von den Kanzeln aller Pfarrkirchen in der Gegend verkündet, daß August Grübner, er möge sein wo immer, in’s Vaterhaus zurückkehren wolle, es wäre Alles gut und es geschehe ihm nichts zu Leide.
Aber da kam einmal der Dorfbote in den Hof und sagte zum Grübner:
„All’ Euer Ausschreien ist für nichts, Euer Junge ist fort nach Amerika.“
„Muß ich Dich niederschlagen, Lügner!“ fuhr der Bauer den Boten an, aber später setzte er sich auf den Brunnentrog, stützte sein Kinn auf die Hand und brummte: „Mag sein, mag wohl sein!“
Es war ein schöner, warmer Sommer gewesen und die Erntezeit kam früher, als es sonst in jenen Gegenden zu geschehen pflegt. Das Korn am Hange des Waldgebrändes war bereits reif und die Leute, die des Holzweges kamen, wunderten sich über die langen, vollen Aehren, die sie da sahen. In der ganzen Gemeinde gab es kein so herrliches Getreidefeld, als auf dem Waldgrunde des Grübners. Ganz, wie wenn es dieser Sommer hätte gut machen wollen, was sein Vorgänger dahier verbrochen hatte. So ein Waldbrand richtet aber auch ein gutes Kornfeld; alle Gras- und Unkrautwurzeln werden vertilgt und die Erde mit Kohlen reichlich gedüngt.
Das gab vielleicht hundert Metzen, bis Alles in den Säcken — so viel erntete sonst kein Bauer in der Gegend. Das richtete den Grübner auch wieder auf, er wurde herrischer und fluchte wieder mehr mit seinem Gesinde, schlug auch das Pferd kräftiger mit dem Peitschenstiele, kurz, es war neues Leben in ihm.
So begann das Kornschneiden. Da wurde das Haus zugesperrt und Alle mußten auf das Gebrände. Der Bauer hatte die Leute selbst angestellt nach der Reihe über den Hang hinauf.
Voran schnitt Gertraud, die Weidmagd, dann kam ein Knecht. Diesem folgte die Genovefa mit dem zweiten Knecht, dann die Bäuerin und zuletzt der Bauer. Der Bauer fluchte, daß es so langsam gehe, er habe ja nichts zu thun und könnte zehnmal schneller schneiden — was man denn vorn treibe? Aber vorn trieben sie gar nichts Sonderliches, als schneiden, immer schneiden — nur daß sie sich zeitweilig noch das Angesicht abtrockneten. Genovefa hatte doppelt zu trocknen, den Schweiß und ein wenig Naß von den Augen. Sie dachte an Gregor und an die ganze Geschichte, die sich an das steile Kornfeld knüpft. Kein Mensch als sie dachte daran, daß heute der Jahrestag — Gregor’s Sterbetag sei! Als sich am späten Nachmittag die Leute um einen Stein zusammen setzten und Brot und kalte Milch verzehrten, schlich die alte Magd davon, pflückte am Raine einen Strauß von Kornblumen und wilden Mohnblüthen und eilte damit zwischen den Halmen gegen den Wald und zum Platz, wo vor einem Jahr Gregor gelegen und gestorben. Dort war noch das Moos, in welches der Arme seine wunden Glieder zu vergraben gesucht, aber es war nicht mehr versengt, es grünte schon wieder.
Genovefa kniete nieder, legte den Strauß auf den Rasen hin und betete. Thränen flossen ihr aus den Augen, aber das war zarter, kühlender Thau auf diese Stelle — nach den heißen Kämpfen, den glühenden Schmerzen, nach dem Herzbrechen und Vergehen! Und als sie so betete für den einzigen Menschen, den sie geliebt wie einen Bruder, da traf Genovefa ein Schlag in’s Gesicht, daß sie rückwärts taumelte.
„Ein schön Gesindel das, heutzutag; ist das ganze Kornfeld reif, daß schon die Körner ausfallen, geht so eine Creatur in den Schatten und faulenzt! Vefa, Dir muß man’s in den Kopf schlagen, was man will, sonst merkst es nicht. Aber ich werd’ Dir noch genugsam sein, das magst glauben!“
Der Bauer war’s und jetzt trieb er die Magd förmlich vor sich her und selbst, als Genovefa längst schon wieder schnitt, fluchte er noch fort. Der Großknecht kümmerte sich nicht um den Geifernden und redete während der Arbeit mit seiner Vorschnitterin von Diesem und Jenem, vom Waldbrand auch, und es komme ihm vor, als rieche es noch davon.
Ueber solche Reden ärgerte sich der Bauer noch mehr; er wollte, daß unter seinen Leuten den ganzen Tag kein Wort gesprochen werde, damit nur die Arbeit noch besser vor sich ginge. Er würde von rückwärts jetzt noch mehr gedrängt haben; aber er war an eine Stelle gekommen, wo die Halme besonders dicht standen, so, daß einer den andern fast erstickt hatte. Das war dort am Felsen, wo der Bauer beim Säen im Verfolgen eines Vögleins das Korn ausgeschüttet hatte. Wie der Grübner hier so schnitt und hächelte, schrillte die Sichel plötzlich an ein Hartes und in demselben Augenblick stieß der Bauer einen wilden Schrei aus und taumelte zurück.
Was war’s denn? Ja, was war’s, eine halb verweste Menschenhand langte ihm aus den Halmen entgegen. Und als die Leute herbeikamen und das Getreide auseinander schlugen, da fanden sie einen Leichnam kauern.
„Jesus, das ist der Gustl!“ rief die Bäuerin aus, und der Bauer sah die zerfallende Leiche.
Der Mann rang nach Athem und brach zusammen. Als er stürzte, fiel er mit dem Arm in die scharfe Sichel — aber er gab keinen Laut von sich. Stärker war das Mutterherz; es hat wohl geweint, daß es Allen durch Mark und Bein gegangen ist, aber zusammengebrochen ist es nicht. — Für diesen Abend war es Feierabend. Die Leute zogen heim. Die Männer trugen den Bauer auf zwei Stangen.
Jetzt war es wohl recht still und traurig auf dem Grübnerhof. Den Sohn des Hauses hatten sie begraben. Die Leute sprachen noch hin und her, wie es sich doch mit dem armen Jungen zugetragen haben mochte. Er ist vielleicht durch jenen Lärm im Stalle erwacht, hat das Unglück geahnt, hat dann aus Furcht vor seinem Vater die Flucht ergriffen, ist herumgeirrt im Wald und auf dem Hang und dort am Felsen erfroren. Das war die Muthmaßung. Der Bauer lag in seinem Stüblein und hielt die bleichen Hände ineinander. Er bewegte die Lippen, aber er fluchte nicht mehr.
Der Arzt sagte: „Es hat ihn der Schlag getroffen auf dem Felde und es ist gut, daß er in die Sichel gefallen ist und viel geblutet hat, denn sonst wär’ er todt gewesen.“
Da faßte der Kranke einmal die Hand des Arztes und lispelte ihm die Frage zu: „Bader, werd’ ich noch einmal gesund?“
Was der Arzt darauf geantwortet hat, muß nicht gut gelautet haben; denn der Bauer hat sein Weib und die Vefa zu sich rufen lassen und hat das Testament gemacht.
In wenigen Tagen darauf lag der Grübner im Vorhause unter der Bodenstiege, wo vor einem Jahre Gregor gelegen war. Und der Großknecht hobelte in der Zeughütte ein Stück Holz und zimmerte ein Kreuzlein daraus. Und als er fertig war, malte er mit rother Zimmerfarbe auf den Querbalken die Worte: „Hier liegt Gallus Grübner“, und auf die Rückseite des Balkens: „Gott, gieb ihm die ewige Ruh’!“
Am übernächsten Morgen wurde die Leiche im großen Conduct unter dem Geläute dreier Glocken bestattet. Und als der Mann begraben war, gingen die Leute wieder hinüber in’s Gebrände und sichelten noch Tage lang, bis alles Korn ab war. Dann ging es in den Herbst und Winter hinein, und Genovefa arbeitete im Stall und im Haus und wo es was zu thun gab. Aber als die Weihnachten kamen und die Dienstleute von der Bäuerin ausbezahlt wurden, bekam Genovefa wieder nichts. Nun, seit dem Tode des Bauers ist sie eben keine Dienstmagd mehr, sie hat ihr Ableben auf dem Grübnerhof und wird gut gepflegt und braucht nichts zu arbeiten — so steht’s im Testament.
Aber Genovefa arbeitet doch — sie würde sonst krank, meint sie. Nur in der Erntezeit geht sie jedes Jahr an einem bestimmten Tag hinüber auf den Hang, wo immer schönes Getreide steht, und sucht am Waldrande das grüne Sterbebett ihres Gregor auf.
ine, die aus Allgäu herüber kam, hatte am Stamme der Antlistanne den weißen, rindenlosen Fleck zuerst gesehen. Und als sie hinzutrat, zu schauen, wieso man diesen schönen Baum geschädigt habe, bemerkte sie auf dem Splint die Schrift: „Hier auf dieser Straßen hat mich Gott verlassen.“
Was bedeutet das? Und als sie in das finstere Geäste der Tanne emporblickte, stieß sie einen Schrei aus, der wild an’s Gestämme schlug, und lief davon und schrie es von Haus zu Haus, was sie auf dem Baume gesehen.
Jetzt, mein Leser, ist es noch früh genug, daß Du diese Blätter ungelesen wendest. Denn die Geschichte trifft grob und Mancher wird fluchen über die Menschen, über Gott und über den Erzähler. Daß es keine Dichtung ist, das entschuldigt wohl den Erzähler, aber sonst Niemanden.
An einem jener Tage war es, da die Menschen des Dorfes nicht arbeiten wollten, aber auch nicht ruhen — der Tag zum Beten und Sündigen.
Der Küsterssohn Anasti, ein kräftiger, gebräunter, rabenlockiger Mann von sechsundzwanzig Jahren, liegt hingestreckt auf dem Rasen, im Schatten des Obstgartens. Aus seinen[S. 335] Augen funkelt die Gluth, die in ihm loht, der schwarze Bart auf seiner trotzig geschärften Oberlippe ist wie eine Warnungstafel: Weiber mit Feuer sollen nicht zu nahe kommen.
Doch nein, jetzund wird nicht mehr gesündigt. Anasti hat eine Braut, in kurzen Wochen ein Weib. In der Kirche zum heiligen Wolfgang sind sie heute das erstemal aufgeboten worden, er und die schöne Gratina, die einzige Tochter des reichen Spornthalers. Das Glück ist doppelt und dreifach herrlich, weil er weiß, daß ihn Alles darum beneidet. Aber von der Gratina ist es nicht zu verwundern, daß sie eben gerade den Anasti erwählt hat: er ist zwar der Küsterssohn, aber er ist ein Mann. Seine Kraft dient nur seinem Willen und sein Wille entspringt wie ein elektrischer Funke aus den heißen Nervenströmen seines kühnen, stolzgebauten Körpers. So ist Einheit in seinem Wesen und jene rücksichtslose Entschlossenheit, welche die Weiber an den Männern mehr lieben, als die edelsten Eigenschaften der Seele.
Auch Gratina besitzt alles das, was ein Weib dem Manne so sehr wünschenswerth macht — und so steht hier ein Leben zuvor, wie sich’s der dem Teufel Verschriebene nicht vollendeter bestellen könnte und in welchem man nebstbei noch Ehrenmann sein kann. Ein Windhauch bläst die Blüthen der Apfelbäume wie rosige Schneeflocken nieder auf den Ruhenden, der im Gedanken an die Zukunft schwelgt, so gut das eben bei einem Manne gehen mag, der nicht durch Schwärmerei zu lieben gewohnt ist.
„Anasti!“
Der Mann hebt sein Haupt und sieht zwischen Buschwerk des Gartenzauns ein blondes Mädchenköpfchen wiegen.
Suschen! Das schöne Kind des bestverachteten Mannes in St. Wolfgang. Ihr Vater ist zwar ein ehrlicher Mann,[S. 336] sein Gewerbe ist zwar keine Schande, aber ein Spott — er schafft die verendeten Thiere abseits. Das müssen schon die Großherzigeren sein, welche sich herbeilassen, diesen im Gemeindewesen unangenehmsten Dienst zu leisten. Meister Gottlieb war auch gar nicht gedrückt darüber. Er waltete seines Amtes und lebte. Seine zwanzigjährige Tochter Susanna besorgte ihm den Haushalt; sie stand recht gut in dem Ansehen der Leute, obwohl die Männer, denen sie gefiel, nicht recht mit ihr anzubinden wagten, sie wußten selbst nicht warum. „Die ist zu heiß!“ sagte Einer und der Andere. —
„Anasti!“ flüsterte sie jetzt über den Gartenzaun.
„Was willst denn?“ fragte sie der Küsterssohn.
„Dich will ich,“ antwortete sie.
„Warst Du heute nicht in der Kirche?“
„Freilich wohl.“
„So solltest Du’s wissen, daß meine Sach’ mit der Spornthaler-Tochter richtig ist.“
„Deine wäre schon richtig, Anasti, aber meine nicht. Steh’ nur auf und komme zum Zaun her; wirst Dich doch nicht fürchten vor mir?“
Er that einen Lacher und ging zum Zaun.
„Wirst doch nicht schon vergessen haben, daß Du mich auf dem Weg bei der Antlistanne so gern gehabt hast?“ sagte sie.
„Dummheiten.“
„Vorgestern ist’s gerade zwei Monat gewesen, Anasti.“
„Mag ja sein, wer wird denn so was aufmerken.“
„Ihr Männer freilich nicht; wir Weibsleute haben halt einen Kalender nach dem Mondschein. Und Mondschein ist dazumal gewesen, das wirst wissen.“
„Das weiß ich.“
„Seither hat er nimmer gescheint, und es ist schon zwei Monate vorbei.“
„Geh’ heim und rede nicht so albern.“
„Nein, Anasti, ich geh’ jetzt nicht heim und Du bist nicht so dumm, daß Du nicht auch das alberne Reden verstehen solltest.“
„Du fängst mir wieder selber an!“
„Ich verlang’ heute nichts von Dir, ich melde mich nur. Und wenn Ihr gleichwohl vergessen habt auf die Susi, sie wird doch zur Hochzeit kommen, aber vor der Copulation.“
„Susi!“ rief er aus.
„Ja,“ gab sie zur Antwort.
„So bist Du mir?! Jetzt kenne ich Dich! Hab’ ich Dich verführt? Wie eine Schlange bist Du mir nachgeschlichen am Ostersonntag durch den Wald. Hab’ ich Dich angesprochen? Wer hat sich denn an jenem Abend an mich gehängt, weil er sich allein nicht durch den Wald zu gehen getraut? Wem ist denn so um’s Rasten gewesen bei der Antlistanne?“
„Das weiß ich nimmer,“ antwortete sie, „das Rasten ist auch nichts Unrechtes, wenn man müd’ ist.“
„Es hat sich aber gewiesen, daß Du gar nicht müde gewesen bist!“
„Bist ja Du auch nicht müde gewesen und hast Dich doch auch gesetzt und weit näher zu mir, als es hätte sein müssen. Das ist eine Schmach für Dich, daß Du jetzt so unschuldig thust.“
„Ich thu’ nicht unschuldig, aber ich weiß auch, daß Du mir vormachen kannst, was Dir beliebt; Du mußt erst sehen, ob ich Dir’s glauben will oder nicht, daß es ich allein bin, zu dem Du das Vertrauen gehabt hast, daß er Dich durch den Wald nach Hause führt.“
„Ob Du es glauben willst oder nicht, mein lieber Anasti, das ist mir gleichviel, wenn’s nur die Andern glauben.“
„Susi!“ Er stieß mit der Brust an die Bretter und krampfte nach ihr die Finger, sie trat zwei Schritte vom Zaun zurück.
„Schau, wilder Bursche, so bist Du immer,“ sagte sie, „ob Du Eine gern hast, oder umbringen möchtest, gleich allemal mit ganzer Gewalt. Ich sehe, daß heute mit Dir nicht zu reden ist und es hat auch Zeit. Ich gebe Dir’s nur zu bedenken, Anasti, ob Du selber bei den Spornthaler-Leuten absagen willst, oder ob ich es thun soll. Bilde Dir nur nicht ein, mein Lieber, daß ich zurückstehe!“
„Kannst mich zwingen, Schinderdirn’, daß ich Dich heirate?“
„Das nicht. Ich will nur, daß Dich auch die Andere nicht soll haben. Und wie ich den Spornthaler und seine Tochter kenne, wird’s mir gar nicht schwer, daß ich meine Sach’ durchsetze. Behüt’ Dich Gott, Anasti!“
Sie ging davon. Er sah ihr knirschend nach. — Das ist der Teufel von einem Weibe! —
Dann vergingen die nächsten Tage. Ueberall wurden Vorbereitungen getroffen zur großen Hochzeit. Gratina lebte in stillem Glücke. Sie hätte den feinen Verwalterssohn von Oberlahn heiraten sollen. Lange hatten Ehrgeiz und Liebe in ihr gekämpft, endlich hatte letztere gesiegt und sie entschloß sich für den armen Küsterssohn, dessen Herzhaftigkeit sie bestochen hatte, von dessen Liebe sie überzeugt war, auf dessen Treue sie schwor. Ihr Vater ließ ihr in der Angelegenheit freien Willen und war überzeugt, daß seine vernünftige Tochter einen vernünftigen Schluß fassen werde.
In diesen Tagen leitete der Anasti das Gespräch mit ihr einmal auf die Unbeständigkeit in der Liebe, wie solche so häufig vorkäme. Da erfuhr er denn allsogleich, wie seine Braut über dieses Capitel dachte: sie verdammte die Treulosigkeit des Weibes und sie verdammte die Falschheit des Mannes. Sie würde lieber sterben, als untreu sein; und einen treulosen Mann würde sie nicht erst zur Rede stellen, sie würde sich sofort von ihm scheiden lassen. Daher nehme sie Einen, der vor ihr noch kein Verhältniß gehabt, von dem sie die Ueberzeugung haben könne, daß sie seine erste und seine letzte Liebe sei.
Der Anasti machte sonst nicht gern Worte, aber hier sagte er, daß es doch auch viele Weiber geben solle, deren Liebe zum Ehemanne so groß wäre, daß sie manchmal schier lieber durch die Finger sehen, als an eine Trennung dächten.
„Freund!“ antwortete sie darauf, „solltest Du auch mich zu diesen zählen, so könntest Du Dich grob täuschen. Ich will mit Leib und Seele dazuthun, daß Du ein rechtes Weib hast; und so verlange auch ich es von Dir.“
Das war recht klar gesprochen.
Und die Tage vergingen, die Hochzeit war kaum eine Woche mehr fern. So wußte Anasti in einem Winkel von St. Wolfgang wieder einmal das Suschen zu treffen. Er hatte sich vorgenommen, sie beim Herzen zu packen.
„Hast Du mich noch ein wenig lieb, so wirf mir kein Hinderniß in den Weg!“
Sie lachte ihm in’s Gesicht: „Eben deswegen, weil ich Dich zu gern habe, lasse ich Dich keiner Andern. Vielleicht daß Du das Kunststück verstehst: die Eine gern haben und die Andere heiraten — ich nicht.“
„Liebelei ist bei Euch Weibsleuten das Erste und das Letzte und Ihr meint, sonst gäb’s an nichts mehr zu denken.“
„Bei Euch kommt zur Liebelei noch die Falschheit dazu, da braucht man freilich einen Kopf.“
„Nach unserem Kopf fragt Ihr gewiß nicht, schon eher nach unserer Hand, die Euch das Brot erwerben soll; aber ganz gewiß und allemal und auf alle Weise sucht Ihr Das an uns, von dem Ihr nicht sprechen könnt, weil Ihr kein Wort wißt, das groß genug wäre, dies Euer Erstes und Letztes zu nennen.“
„Da gebe ich Dir schon Recht. Euch geht das, was Du meinst, blutwenig an, nur daß für Euch der Spaß dabei ist. Aber unser Glück und Unglück ist daran und was Ihr Lust habt, das müssen wir tausendfach leiden. Die Sünde, die an Euch hängt, müssen wir büßen mit Verderben und Sterben.“
„Glaub’s ja, glaub’s ja,“ beschwichtigte Anasti, „nur können wir nichts dafür. Ich verhoffe, Susi, daß Du mich nicht in’s Unglück stürzen wirst. Wenn es der Straßen an der Antlistanne wegen ist, so bist dabei Du so gut zu Theil gekommen, als wie ich.“
„Oh, viel besser noch!“ rief sie, „und just deswegen bist Du mein.“
„Was ich an Geld thun kann, deß will ich mich ja nicht entschlagen.“
„So!“ sagte sie, „eine Solche bin ich Dir? Oh nein, mein junger Mann, um Geld verkaufe ich Dich nicht. Zwar schätze ich Dich heute lange nicht mehr so hoch, wie einstmals, wo ich mich selber für Dich habe ausgespielt. Aber feil bist mir nicht. Von mir, mein Bübchen, kommst leicht nimmer los!“
„Du bist mir tausendmal verhaßt!“ schrie er.
„Das glaube ich! Wir wollen nur sehen, wer diesmal stärker ist, ich oder Du. Hast Du gemeint, ich wäre so Eine, wie die meisten Anderen — Du wirst gewiß Viele kennen — so bist in einem Irrthum. Haben will ich Dich einmal; ob ich Dich mit meinem Umarmen für mich lebendig mach’ oder erwürgen muß, das ist mir jetzt schon alleins.“
„Untersteh’ Dich, Dirn! Du kennst mich nicht!“ rief er, blaß im Gesicht und mit funkelndem Blick.
„Zwei Tage laß ich Dir noch Zeit, Anasti. Heute ist Mittwoch, am Freitag um zwölf Uhr Mittags melde ich mich im Spornthalerhof.“
„Kannst es thun,“ sagte er mit umflorter Stimme, „nur rathe ich Dir, daß Du früher beichten gehst.“
„Wie meinst das?“
„Man kann nicht wissen, was geschieht.“
Am nächsten Tage schrieb Anasti einen Brief an Suschen, er bitte sie um Leben und Sterben, sie solle ihn nicht zum Aeußersten treiben, denn das möge sie wissen, bevor er sich von der Spornthalerheirat abbringen lasse, geschehe ein Unglück.
Es kam auf diese Zeilen keine Antwort.
Am Freitag früh sah er Susi in der Kirche. Sie war wirklich am Beichtstuhl gekniet und nun stand sie lange und unbeweglich vor dem Hochaltare. Sie schien sehr andächtig zu beten; man sah es ihr nicht an, welche Bosheit sie im Herzen trug. Vielleicht jedoch hatte sie sich besonnen, oder bat jetzt um Gnade, ihre Leidenschaft überwinden, ihm zu Liebe der Rache entsagen zu können.
So dachte Anasti, der es sich gar nicht vorstellen konnte, daß nicht die ganze Welt sich um das Glück seiner Person[S. 342] drehen sollte. — Daß dort in der Gestalt des blonden Mädchens ein unlöschbares Anrecht, eine ewige Forderung stand an sein Leben und an sein Himmelreich, das kam seiner selbstsüchtigen Natur nicht zu Sinne.
„Heute bist Du schon gar ein Andächtiger, Anasti!“ lispelte ihm plötzlich eine Stimme zu und eine Hand legte sich auf seine Achsel, „Du kannst Dein Auge ja vom Altare gar nicht wenden!“
Gratina, seine Braut, stand neben ihm.
Er ging mit ihr aus der Kirche. Sie kehrten im Wirthshause zu, denn Anasti ließ sich neben dem schönen Mädchen aus dem Großbauernhofe gern sehen; und gleichwohl Alles in der Leute Mund kreiste, was an Scheelsucht zu kreisen hat, wenn ein beneidenswerthes Paar zusammenheiratet, so genoß Anasti doch schon jetzt all’ jene Ehren, die ihm ja in wenigen Tagen als dem vielvermögenden Spornthaler gebühren werden. Und einem Menschen wie dem Küsterssohn, der nicht viel wohlhabender war, als wie die Mäuse seiner Kirche, thun derlei Auszeichnungen über alle Maßen wohl.
Nach dem Wirthshause begleitete der Anasti seine Braut hinauf zu ihrem Hofe. Derselbe stand eine Stunde weit im Hochthale oben und der Weg dahin war gut gepflegt, nur menschenleer und ein bischen romantisch. An einer schattenreichen Waldhänge stieg er hinan und in der Tiefe brauste der Scharnbach. Dort, wo hinten das Thal sich zu breiten und das Besitzthum des Spornthalerhofes sich zu dehnen beginnt, ist ein förmliches Felsenthor. Die Schlucht mit dem Bergbache gähnt finster zwischen dem fast senkrecht aufsteigenden Gefelse; der Weg ist in die Wand eingegraben und ein massiges Holzgeländer schützt vor dem Sturz in die Tiefe. Ueber dem Wege prangt ein Bild der Mutter Gottes, deren[S. 343] Herz von einem Schwerte durchstochen ist. Nach diesem Bilde heißt der Punkt an der wilden Schlucht „zur schmerzhaften Mutter“.
Als sie zu dieser Stelle kamen, sagte Gratina: „Da mag der junge Spornthaler auch gleich was anwenden lassen. Wie ich sehe, wird das Geländer schon morsch. Früher ist viel geschehen bei der schmerzhaften Mutter; aber während meines Vaters Zeiten hat sich kein Unglück zugetragen.“
„Freilich muß was angewendet werden,“ antwortete Anasti, „und jetzt schauen wir, daß wir weiter kommen.“
Sie hätte dort an den Haselbüschen gern gerastet. Sie bat ihren Bräutigam, daß er ihr einen Haselstock schneide; sie wolle ein Andenken haben an das heutige Nachhausegehen mit ihm. Er that’s mit Eile und mit einem einzigen Schnitte war der schönste, schlankste Stab gelöst.
„Vor Allem, das sehe ich schon, muß ich Dir einen bequemeren Taschenveitel kaufen,“ bemerkte sie, „Du tragst ja gar ein ungeschicktes Messer bei Dir.“
„Bisweilen kann man’s schon brauchen,“ antwortete er und sie gingen weiter.
Im Hofe war große Beschau. Der Jungbauer wurde in den Ställen, Scheuern, Vorrathskammern herumgeführt; Alles strotzte vor Fülle. Schließlich ließ ihn Gratina durch die nur ein paar Finger breit geöffnete Thür in’s Schlafgemach blicken. Es war völlig fertig. Er wollte einen Schritt hinein thun, um Alles bequem sehen zu können; allein sie zog schalkhaft die Thür zu.
Als es zum Mittagessen kam, entschuldigte sich Anasti, er könne bei demselben heute nicht bleiben. Er habe noch wesentliche Vorbereitungen zum Hochzeitstage zu besorgen, komme vielleicht am Nachmittage wieder.
Er ging, aber nicht um Vorbereitungen zu treffen, sondern vielmehr um ein Hinderniß zu beseitigen, wenn es nöthig sein sollte.
Wenn sie Wort hält und kommt, so ist jetzt die Zeit dazu. —
Er ging hinab gegen die Thalenge der „schmerzhaften Mutter“. Hier müßte sie kommen. — Hier vorbei darf sie nicht und wenn ich sie auf den Armen nach Wolfgang zurückschleppen muß. Ich will es noch einmal mit Güte probiren. Ist sie eine Schlange, so muß sie mit Verheißungen beschworen werden; ist sie ein Stein, so muß sie mit jener Gluth geschmolzen werden, der kein Weib widersteht. Ich setz’ Alles dran, daß sie still bleibt. Es ist schon fast Mittag vorbei; sie hat sich doch wohl besonnen. Sie ist besser, als sie thut: so wird sie auch für ihr Leben einen Freund an mir haben. —
In der Felsennische unter dem Bilde setzte er sich auf einen Haufen von geschlagenen Steinen. Er starrte hinüber in das jenseitige graue Gefelse, an welchem der Wasserstaub emporthaute von den Wellen des Scharnbaches, die unten zwischen den Wänden und Blöcken hin und her geworfen wurden.
Plötzlich schritt Suschen heran.
Er erhob sich rasch und vertrat ihr den Weg. So blieb sie stehen und blickte ihn höhnisch an.
„Das habe ich mir gedacht, daß dahier Einer auf mich warten wird,“ sagte sie. „Ich rathe Dir gut, Anasti, laß’ mich meinen Weg gehen!“
„Wenn Du zum Hof willst, so ist das Dein Weg nimmer!“
„Das will ich sehen!“ rief sie und hob eine Pistole.
Er wich einen Augenblick zurück. „So willst Du mir?“ zischte er und fiel wüthend über das Mädchen her. Der Schuß krachte. „Mein lieb’ Dirndl!“ schnaufte er und rang mit ihr.
„Stich mich nieder!“ stöhnte sie.
„Das brauch’ ich nicht. So ist’s besser!“ Und schleuderte sie mit einem wilden Satze über das Geländer.
Ein einziger Schlag unten im Gestein — und das Wasser brauste fort und fort. —
Anasti lief wegabwärts und dann den Hang hinan in’s Dickicht. Zwei Bauern schritten rasch heran.
„Da ist der Schuß gefallen und da ist Einer in’s Gebüsch gesprungen.“
„Blutspuren seh’ ich auch. Es ist was geschehen. Wir müssen den Wicht fangen.“
Anasti entkam. Sein Halstuch wand er um die blutende Hand, die der Schuß gestreift hatte, damit die rothen Tropfen seinen Pfad nicht verriethen. Aber er sah, daß Alles aus sei.
Im Waldhäuschen einer alten Muhme sprach er zu, schrie ihr einige Worte des Schreckens in’s Ohr, trennte mit einem Schnitte das Tragband von dem Holzkorbe der Alten — eilte damit davon.
An demselben Tage noch fand ihn ein wanderndes Weib aus dem Allgäu im Geäste der Antlistanne leblos.
Und auf dem weißen Splint des Stammes standen die Worte, die noch heute nicht verwaschen sind:
ier will ich die Geschichte erzählen, warum der Hammerl-Hans, der alte, lustige Hammerl-Hans, mit dem erloschenen Pfeifchen im Munde, am Sandhause im Koberwald so still, so gebückt und gedrückt vorbeischleicht.
Der Hammerl-Hans ist ein fahrender Musikant; er spielt durch kleine Hämmerchen ein schier wunderliches Instrument. Es ist eine Art Hackbrett mit hölzernen Saiten. Da liegen auf Strohriegeln etliche dreißig Holzwälzchen, etwa einen Zoll dick und von verschiedener Länge; sie sind so neben und zwischen einander gelegt, daß sie durch Hämmerchen, wie die Saiten eines Hackbrettes gespielt werden können.
Der Hans ist vormalen in den Freisohlergräben Ziegenhirt gewesen. Dort hat er oft den Blockriesen der Holzknechte zugesehen, wie die zerschnittenen und entschälten Baumstämme die Mulden und Rinnen herniederrollen und mit klingendem Schalle in die Kohlstatt fliegen. Und da war dem Hans aufgefallen, daß diese Holzstücke je nach ihrer Größe und Länge einen verschiedenen Klang hatten. Je kürzer das Stück, desto höher und greller das Klingen, je länger der Schaft, desto tiefer und summender das Tönen.
Ein Freund der Tonkunst war der „Gaishalter-Hansl“ von jeher gewesen, und das Ideal seines Lebens: pfeifenblasen oder geigen zu lernen und unter den Dorfmusikanten auf dem Kirchenchor oder im Wirthshause Gott zu loben und die Menschen zu erfreuen. Aber das Instrument kostet Geld, der Schulmeister kostet Geld, das Lernen kostet Zeit, und so hat sich der arme Hansel mit seinem Naturgesang und mit dem Meckern der Ziegen zufrieden geben müssen. Wohl hatte er sich mehrere Pfeifen aus Rohr geschnitten, hatte Blätter von Enzian über die Lippen gespannt und durch das Blasen Töne erzeugt; doch waren ihm derlei Instrumente nicht vollkommen genug.
Als ihm nun aber das vielfältige Schallen der entschälten Holzblöcke auffiel, kam ihm plötzlich der Gedanke: so ein Werkzeug aus Holz, daß man darauf Musik machen könnte! Mit den großen Blöcken ließ sich allerdings nichts anfangen, die gehörten auch nicht sein; aber im Kleinen aus Fichten-Holzstücken ein Spiel einrichten!
Er hat’s versucht, hat lange, lange Zeit damit herumgearbeitet, und so ist allmählich jenes oben beschriebene Instrument entstanden. Mit zwei Hämmerchen hat er es geschlagen, bald auf das eine, bald auf das andere der Stäbchen klopfend, und siehe, es haben dabei die Hunde geheult. Darüber war der Hans entzückt, denn Hunde heulen immer, wenn Musik gemacht wird — so war es denn Musik.
Viele Jahre lang hat es freilich gebraucht, bis das Instrument eine solche Vollkommenheit und der Hans darauf eine solche Fertigkeit erlangte, daß er vor aller Leute Ohren spielen konnte. Dafür thäten sich nun aber die Ohren um so schärfer spitzen. Man hatte wohl schon gehört, wie auf Glöcklein oder auf einer Reihe von Trinkgläsern allerlei[S. 348] Weisen hervorgebracht wurden, aber daß gar die Holzblöckchen, die wild aufgewachsen waren im Walde, musikalisch sein sollten, das war gar aus aller Weise. Sechsunddreißig Stäbchen, von dem kürzesten bis zum längsten, gaben sechsunddreißig Töne, die ganz kunstgerecht mit einander harmonirten. Und jetzt hämmerte der Hans den Leuten vor, was sie wollten: steierische Tänze und wienerische Walzer, heitere Lieder und frische Soldatenmärsche, auch Alpenjodler und Kirchengesänge, was eben die Leute verlangten und — bezahlten.
Da war’s mit dem Ziegenhalten vorbei. Da ging der Hans mit seinem Spielwerk thalauf, thalab, von einem Dorf zum andern, auch zuweilen über die Berge hin in ein anderes Thal, und an der Landstraße weiter auf Märkte, in die Städte; kehrte aber stets wieder bald in seine heimatliche Gegend zurück. Man gab ihm den Rath, er sollt’s versuchen, sollt’ in die Residenz reisen, sollt’ in der weiten Welt sein Glück probiren, er käme nach Jahren gewiß als reicher Mann zurück.
Der Hans that’s aber nicht und er wußte gut, warum.
Wenn er drüben hinter den Bergen war, in einem andern Thal, oder in der Gaustadt draußen, da hatte er, außer in den Stunden, wo er spielte, keine gute Zeit. — „Thut mir halt allerweg ein bissel ant, wenn ich nit daheim bin,“ sagte er einmal im Vertrauen; ging er aber wieder zurück in’s Thal, wo er geboren worden, wo er die Ziegen geweidet, wo er sein Holzinstrument erfunden, so fand er eigentlich doch nichts vor. Heimweh und keine Heimat! Keine Handbreit Erde war sein. Wozu auch braucht er Erde, der Bettelmusikant, er gehört zu jenen Leichtfertigen und Glücklichen, die bei der Theilung der Erde zu spät gekommen. Von[S. 349] seinen Blutsverwandten lebte Keines mehr. Aber die Leute hatte er alle lieb, die in der Gegend der Freisohlergräben und des Koberwaldes lebten. Den Einen hatte er einst die Ziegen gehütet, den Anderen was vorgespielt; die hatten ihn satt gefüttert, wieder andere hatten ihm gute Schuhe machen lassen. Ferner hatten sie bei seiner Musik viel getanzt und gesungen und hatten gesagt: „Wer wollt’ ihm’s ansehen, dem Lappen da, daß er ein solches Kreuzköpfel ist und das ganze Spielwerk selber erfunden hat. So ein Mensch ist hell eine Ehr’ für die ganze Gemein!“ Etliche waren freilich auch, die seine „Holzklemper“ verspotteten — aber gut und in irgend welchem Verhältniß stand er zu Allen; auch sagten Alle „Du“ zu ihm, und hatten stets ein drolliges Wort für ihn wenn er kam, und mancher Gönner der Kunst verehrte ihm ein Pfeiflein Tabak — und das Alles zusammen und vielleicht noch Anderes mit machte es, daß er hinter den Bergen draußen jenes Gefühl hatte, welches wir Heimweh nennen.
Vor Allem hatte er die Kinder lieb, gesellte sich gern zu ihnen, und sie hüpften und schlugen Purzelbäume bei seinem Spiele.
Ein kleines Mädchen wohnte im Hagerhause am Eingang in die Freisohlergräben, dem ging der Hans, wenn er von seinen Wanderungen zurückkehrte, gern zu und immer begrüßte er es mit den Worten: „Schau zum Wachsen, Frieda, Dein Bräutigam trägt schon spannlange Schuh!“
Anfangs hatte sich das Mädchen auf solche Anrede kichernd davongetrollt, später hatte es ausgerufen: „Ja, ich hab’ noch gar keinen Bräutigam!“ und endlich, wie es schon schlank geworden, entgegnete es gar nichts mehr auf die Anrede, sondern blickte auf die Erde nieder. Und da dachte sich[S. 350] der alte Hans: Freilich, freilich, der Mensch, ob klein, ob groß, braucht seine spannlangen Schuh! Und der Frieda seh’ ich’s an, sie hat jetzt einen Bräutigam. —
Auch dem Hans — dem Hammerl-Hans, wie ihn die Leute nannten — wird das Herz einmal geblüht haben. Ob ein Reif in der Frühlingsnacht die Blüthe versengt, ob ein Wettersturm dieselbe verweht hat, ob sie zur Frucht gediehen ist — ich vermag es nicht zu sagen; er erzählt es vielleicht mit seinen Hämmerchen auf den hölzernen Saiten und die Leute verstehen es nicht, oder vermeinen ihre eigenen Geschichten dabei zu hören.
Die Frieda vom Hagerhause hatte blaue Augen und flocht die Locken nicht. Sie war auch Ziegenhirtin, und deswegen hatte sie der Musikant einmal um den Namen gefragt. — Umsonst wollt’ sie den Namen nicht sagen, „er müßt’ ihr ein schönes Stücklein dafür spielen“. Das schönste Stückel was er kann, hatte er ihr vorgespielt. — Von dieser Zeit her ging die Freundschaft und der Spruch von den spannlangen Schuhen. Der Hans wußte gar nicht, wie es war, daß er das Kind so gern sah, und gerade wenn er bei diesem Mädchen saß, murmelte er mehrmals: „Bin wohl recht froh, daß ich wieder daheim.“
Und Frieda war doch fremder Waldleute Kind, und sie war lange, lange noch nicht tausend Wochen alt, und er — schon gebeugt und mit weißem Haar.
Als nun diese Zeit gekommen, in welcher das schlanke Mädchen den Sand auf dem Boden zählte, so oft der Hammerl-Hans das Wort vom Bräutigam sagte, betete er des Abends in seinem Bette um ein Vaterunser mehr als sonst, und mit dem Zusatz: „Auf daß sie halt sollt’ glücklich sein!“
Da trug es sich zu, daß eines Tages vom Koberwald herüber der junge Sandhauser kam, das Mädchen auf der Au bei den Ziegen stehen sah, zu ihm hintrat und das Wort aussprach: „Frieda, jetzt bin ich da um Dich.“
„Ist schon recht,“ entgegnete die Hirtin lächelnd.
„Mein Ernst! In vierzehn Tagen mußt das Herdfeuer im Sandhaus anzünden, und gehst schon heut’ mit, so ist’s mir noch lieber!“
Da wurde das Mädchen ganz blaß. Mit seinem schönen, ernsten Gesichte, mit seinem milden Auge stand er vor ihr und legte die Hand auf ihren Oberarm und warb. Er wußte es nicht, daß er ihr Liebster im Herzen war; sie hatten sich öfters gesehen auf dem Kirchpfad, aber nie ein Wort mit einander gesprochen.
— Ist’s ein Scherz — so vermochte das verwirrte Kind noch zu denken — so kunnt’ er sich bitter versündigen, und wenn’s sein Ernst — — Sie starrte nieder zu seinen Bundschuhen: Eine Spanne mögen sie wohl lang sein..
„Und daß ich frag’, Frieda, hast ein Geld?“
Das Mädchen stieß einen Seufzer aus und flüsterte: „Nicht fünf Groschen.“
„Das ist mir lieb,“ sagte der Sandhauser, „das Geld macht beim Heiraten die meisten Unebenheiten. Na, so hätt’s keinen Umstand; ich, der Blasi, hab’ Haus und Hof, und Du hast den Blasi. Wir machen es auf Güterhalbscheid.“
Sie hat kein Sterbenswörtchen gesprochen, sie hat sich hingelehnt an seine Brust. Doch, als er wieder davon war — ich meine, er ist schnurgerade zum Pfarrer gerannt — da hat sie den Ziegen zugeschrien: „Ja bin ich denn gestorben — denn gestorben, daß ich im Himmel bin?“
Bauers-Brautleute, wenn sie sich einmal erfassen, besinnen sich nicht lang’ — in vierzehn Tagen ist die Hochzeit gewesen.
Wohl ist der Hammerl-Hans mit seinem Instrument um das Lindenwirthshaus geschlichen, aber kein Mensch hat ihn hineingerufen; drin hat ja die vornehme Dorfmusikbande aufgespielt, daß, mein Eid, die Wände haben gegellt, und der Tanzboden unter dem kecken Springen und Stampfen der Burschen hat’s büßen müssen.
— Thät’ nur die Braut ein einzigesmal zum Fenster herausschauen! seufzte der Hans. Aber es wurde Nacht, und hell waren die Fenster beleuchtet. Da ging der Alte über das thaunasse Gras. Er sah Johanniskäfer leuchten, er sah Sternenfunken vom Himmel gleiten; er dachte nichts als daß er es der Braut sagen möchte, welch’ ein großes Glück er ihr wünsche.
Und am Tage darauf zog die Frieda im Sandhause ein. Da konnte es der Hans nicht mehr länger aushalten; er eilte hin und ging vor dem Sandhause so lange auf und ab, bis Frieda ihn bemerkte, zur Thür heraustrat und ganz leise, als käme ihr das Wort noch gar nicht zu, Folgendes sagte: „Grüß Euch schön Gott bei uns. Geht in’s Haus und rastet ab!“
Da ergriff der Alte ihre Hand: „Dich muß man so viel gern haben. Der lieb’ Herrgott segne Dich! Der lieb’ Herrgott segne Dich!“
Dann trat er in’s Haus und lehnte den Kasten, in welchem sein Holzinstrument eingeschlossen war, an die Ofenmauer und setzte sich selbst daneben hin auf die Bank, und sah in der Stube umher, wie Alles so hübsch und heimlich eingerichtet war. Der Sandhauser kam und meinte: Bei[S. 353] der Ofenbank sei kein Sitzen, der Hans solle sich ein wenig an den Tisch begeben. Und bald war ein gewichtiger Laib Brot und ein grüner schwitzender Mostkrug auf dem Tische erschienen.
Der Sandhauser hatte viel aus- und einzugehen, trug in ebenmäßiger Ruhe und doch mit einem gewissen Eifer den einen Gegenstand hin, den andern her. Und auf dem Oberboden und in der Nebenkammer war der behendige Schritt der Frieda zu vernehmen, und bisweilen huschte sie mit einem Kissen, mit einer Decke durch die Stube.
Der Hammerl-Hans kaute langsam an dem schmackhaften Brot, dachte bei sich: Wohl, jetzt thun sie schon nesttragen — und that einen gedehnten Zug aus dem Kruge.
Endlich setzte sich der junge Ehemann zu ihm und fragte: „Na, Hans, kriegen wir gar nichts zu hören?“ — Er hätte das Wort wieder einfangen mögen; er war erstens heute nicht in der Stimmung, auf dem Dreifuß zu sitzen und einer Musik zu lauschen, und zweitens kam’s ja gerade heraus, als wollte er sich für die kleine Jause, die er dem Alten vorgesetzt, bezahlt machen. Er sagte daher, als der Hans schon mit freudiger Hast die Lederriemen seines Kastens aufschnallte: „Na, na, Hans, nicht desweg, nicht desweg. Thu’ sich der Hans ausrasten. Ein andermal.“
„Wohl nit vonnöthen!“ versetzte der Alte rasch, „hab’ mich jetzund rechtschaffen gestärkt. Muß ja dem jungen Ehepaar noch mein Brautliedl vormachen — das wohl, ei, das wohl!“
Sofort that er die Strohriegel auf den Tisch, entfaltete das Instrument und legte es darauf zurecht. In jeder Hand ein Hämmerchen, schlug er zuerst auf eines und das andere der Stäbchen — auch sein Spielwerk muß gestimmt werden!
Töne sind nicht zu beschreiben, und am wenigsten, wenn sie von einem eigenartigen Instrumente kommen, das die allermeisten Menschen noch gar nicht gehört haben. Und so muß sich der Erzähler begnügen zu sagen, daß der Hammerl-Hans auf seinem Zeug gar seltsam zu spielen, die anmuthigsten Melodien hervorzubringen versteht. Etwas komisch berührt nur das hastige Hinundherzucken mit den Armen; in raschem Tempo müssen ja die Hämmerchen fast gleichzeitig in den verschiedensten Gegenden des Tonbrettes sein — jetzt beim brummenden, grollenden Holz, jetzt wieder beim klingenden, schreienden. Das Ganze quillt etwas derb und grell hervor und macht die Nerven zittern. Von der Entfernung gehört, ist es eine weiche, melodische Musik, doch ganz unvergleichbar mit allen anderen Tonspielen.
Zuerst gab der Hans im Sandhause mit sanften Hammerschlägen eine liebliche Volksweise zum Besten. Das lockte die Frieda herbei. Sie schmiegte sich mit Haupt und Gliedern an ihren jungen Gatten und horchte dem Spiele zu. In solcher Lage fand auch der Sandhauser die Musik angenehm, und als das erste Lied zu Ende war, bestellte er ein zweites und zog sein Weibchen nieder auf seinen Schoß.
Das zweite Lied klang schon lauter und kecker, und der Blasi trat dazu mit der Fußspitze den Tact. Das dritte Stück war ein steierischer Tanz, da wiegte sich die Frieda auf den Knien ihres Mannes, bis dieser sie emporhob, selbst aufstand und flüsterte: „Na, Frieda, das thut’s, hopsen wir Eins mit!“
Da hat sie ihren Arm um seinen Hals gelegt und da haben sie jenen Reigen begonnen, der seiner Anmuth und Sinnigkeit wegen wohl den ersten Rang einnimmt unter den Tänzen des deutschen Volkes.
Als der Hans einen Blick that hin auf das Paar, da vergaß er schier auf das Hämmern: die Frieda hob gerade das vorhin an Blasi’s Brust gesunkene Köpfchen und sah dem Gatten in’s Auge. Und diesen Augenblick kann der alte Musikant nimmer vergessen. „Toll,“ murmelte er, „toll haben sie sich gern!“ und suchte wieder in den Tact zu kommen.
Nach dem Steierischen ging ein Walzer los, da glitten die jungen Leute schon rascher durch die Stube, und als das Tonbrett schwieg, hob der Sandhauser den Mostkrug, rief: „Unser Musikant soll leben!“ und trank. — Sie tanzten so gern; sie tanzten das erstemal mitsammen, denn bei der Hochzeit mußte nach der Sitte der Bräutigam mit der ersten Kranzeljungfer und die Braut mit dem Brautführer und anderen Ehemännern reigen.
Dem Hans selber waren heute die Hämmerchen heiß in der Hand. Er begann eine Polka zu schlagen. Ein Jauchzer entfuhr dem jungen Mann; keck faßte er sein Weib um die Mitte und flog mit ihr im Kreise. Rasch ging’s. Es dröhnte der Fußboden unter den Sprüngen, es klirrten die Fenster. Grell, fast wild klapperten die Hämmerchen und dem Musikanten rann es heiß durch’s Mark, sein Spiel war fieberig und ging rascher und rascher. Das tanzende Paar stieß an Bänke und Stühle und schien es nicht zu merken; der Frieda hatte sich das Kopftuch gelöst, es war niedergefallen auf den Boden, war mit den Füßen getreten. Wie im Sturme hin wirbelte ihr schlichtes Kleidchen, und wieder schmiegte es sich weich um ihre Glieder und flatterte um des Tänzers Beine. Darauf hatten sich ihre Locken entfaltet, waren niedergewallt bis zum Gürtel, waren hingeweht über die Schulter des Mannes und um seinen Nacken; in ehernem Krampfe um[S. 356]klammerte sie seine Gestalt, eine Brunst lag auf ihren Wangen, ihr großes Auge blickte starr in das seine und ihre Lippen, halb offen und zuckend, hielt sie den seinen entgegen.
So rasten sie hin unter dem gellenden Schallen des hölzernen Spielwerks — da hatte es plötzlich ein Ende. Eines der Hämmerchen war entzwei gebrochen und das abgebrochene Stück über den Tisch und Fußboden hingekollert. — Ein-, zweimal noch ohne Musik war das Paar durch die Stube geflogen, da sank es hin auf einen Block und stöhnte ein tiefes, langes „Ah!“ Große Tropfen standen auf ihrer Stirn, und Frieda hielt sich fest an des Gatten Schulter und schloß die Augen.
„Du bist ganz damisch (taumelnd)!“ sagte der Sandhauser, „ein wenig frische Luft, ist’s gleich wieder gut.“
Der Alte suchte sein Werkzeug wieder herzustellen. Das Paar erhob sich und wankte in das Freie. Frieda sog durch einen langen, tiefen Athemzug die kühle, reine Luft ein und hauchte: „Ah, Blasi, das thut gut!“
„Ja freilich,“ versetzte er, „frische Luft ist gesund!“
So saßen sie, stets sich liebeinig aneinander schmiegend, erquickten sich an dem frischen Hauche, der von den waldigen Höhen strich und sahen, gedankenlos vielleicht, den lebhaft zwitschernden Schwalben zu, an deren eifrigem Umherschießen nicht zu erkennen war, bauten sie zu dieser Spätsommerszeit an einem zweiten Neste, oder bereiteten sie sich zum Abzuge.
„Jetzt hat’s mir aber in der Brust einen Stich gegeben!“ sagte der Sandhauser plötzlich.
„Jesus Maria!“ rief die Frieda und sah ihn angstvoll an. Er saß ein paar Augenblicke unbeweglich, holte tief Athem und sagte: „Ist schon wieder gut.“
„Gehen wir in’s Haus hinein,“ sprach das junge Weib.
Der Blasi erhob sich langsam und sie gingen in das Haus.
Die Frieda gab dem Hammerl-Hans ein freundliches „Dank Euch Gott!“ So machte sich der Alte auf den Weg und sah noch mehrmals zurück auf den Bau, in welchem ein Glück sich eingenistet hatte, wie er es sein Lebtag bislang nicht gesehen. Als er auf der Anhöhe stand, wo man das letztemal zurücksieht auf das blinkende Schindeldach des Sandhauses, hob der Hans seine rechte Hand und murmelte: „Ich mach’ das Kreuz über Dich!“
Dann ging er davon in der Abendkühle und vergaß sein Pfeifchen anzuzünden, das er im Munde trug.
Der Blasi war mehrmals langsam durch’s Haus geschritten, war zuweilen stehen geblieben und hatte mit einer gewissen Behutsamkeit Athem geholt.
Die Frieda schlich ihm zweimal nach und fragte: „Gelt Blasi, es ist ganz gut?“
„Ja,“ antwortete er.
Das drittemal sagte sie: „Blasi, es ist nicht ganz richtig!“
„Ich werde heute nur etwas früher in’s Bett gehen,“ antwortete er.
Da wurde sie blaß.
Das Bett stand breit und hochgeschichtet oben in der stillen Kammer über der großen Hausstube. Es war bräutlich. Es waren die feinen schneeweißen Linnen überzogen, welche die Frieda von ihrer Pathin zur Hochzeitsgabe erhalten hatte. Und in die zwei linden Kissen waren hellrothe Bänder gestickt. Und in die weiche blaue Decke waren zwei große Herzen eingenäht. Und auf die kopfseitige Wand des Bettes war der „süße Name“ gemalt, mit dem Kreuze, mit dem Herzen und[S. 358] den drei Nägeln. Und darunter standen roth und schlicht die Worte: „Schlaf’ in Gottes Namen!“
In dieses Bett legte sich der junge Sandhauser einen Tag nach der Hochzeit. Die Decke mit den zwei Herzen war ihm lange nicht genug; schier alle Betten des Hauses mußten ausgeplündert werden, um den Mann mit Hüllen zu versehen — so sehr schüttelte ihn der Frost. Und bald war die helle Gluth auf seinem Antlitze und er lechzte nach Wasser.
Noch in der Nacht kam der Doctor von Koberburg heraufgefahren; der sah den Kranken an, deckte dann dessen Brust ab, hub auf dem Brustblatte an zu klopfen und horchte den Tönen, die dabei herauskamen. Die Frieda wartete schier mit eingehaltenem Athem des Ausspruches; allein der Arzt legte die Decke wieder sanft über die Brust des Kranken herauf und sagte nichts.
Erst dem Boten, der wieder mit ihm gekommen war, um die Medicin zu holen, vertraute er, daß eine Lungenentzündung da wäre.
Frieda hatte in selber Nacht nicht eine Minute geschlafen, sie wachte bei dem Kranken, rückte die Decken, rückte die Kissen stets zurecht, reichte ihm Wasser, legte ihm kalte Tücher über die Stirn, als der Kopfschmerz kam, und las in seinem trüben Auge jeden Wunsch. Er lächelte sie an, dann seufzte er wieder, dann bat er sie, daß sie schlafen gehe: „Heute unten in der großen Stube, Frieda; morgen ist’s schon besser.“
Sie wich nicht von ihm. Oft preßte sie die Hände an ihre Brust, und wenn es der Kranke nicht sah, so schlang sie sich selbst ein nasses Tuch um die Stirn.
Als am andern Tage der Arzt wieder kam, fand er die junge Sandhauserin in einem schweren Lodenrock ihres Mannes eingeschlummert bei seinem Bette kauern.
Der Arzt sah sie scharf an, langte nach ihrer Hand, um den Puls zu fühlen, und sagte: „Die Sandhauserin wird auch noch krank werden, wenn sie sich nicht schlafen legt.“
„O nein,“ antwortete sie rasch, „mir fehlt gar nichts — gar nichts —“ Eilig mußte sie den Mund schließen, um das Beben ihrer Kiefer zu unterdrücken.
„Ihres Mannes wegen,“ sagte der Doctor, „darf sich die Sandhauserin gar keine Sorgen machen. — Sie hat die Nacht über nicht geschlafen, die Aufregungen der letzten Tage sind noch vorhanden; sie hat Fieber — muß sich ausruhen, dann wird Alles wieder gut sein.“
„Arg ist’s doch nicht?“ flüsterte sie, „arg — mit ihm?“
„Na, nu — vor Allem muß auch er Ruhe haben. Geh’ die Sandhauserin zu Bette!“
Das war befehlend gesprochen.
Die Frieda beugte sich über den Kranken. „Du, Blasi,“ lispelte sie, „wir müssen schon wieder auseinander. Ich leg’ mich ein wenig nieder.“
Er nickte ihr beistimmend zu.
„Du sollst auch schlafen, Blasi, gute Nacht!“
Er lächelte. Sie drückten sich die Hände.
„Du bist auch heiß,“ murmelte er, „Du mußt Dich nicht kränken, Frieda, wenn nur in der Brust das Stechen gut ist, so stehe ich schon wieder auf.“
Dann gingen sie auseinander.
Der Arzt kam auch zu ihrem Bette, das unten in der großen Stube stand. Und er schickte durch den Boten auch für sie Medicin — ganz die gleiche, wie für den Mann.
Vier Tage hernach, als der Bote wieder nach Koberburg kam, sagte zu ihm der Arzt: „Dieweilen nur Mandel[S. 360]milch trinken, ich komme bald nach. Und — was ich sagen wollte — wenn Du den Geistlichen könntest mitnehmen.“
Als auf dem Thurme das Versehglöcklein läutete, fragten die Koberburger, wen es anginge.
Der Lindenwirth that eben die aus Fichtenreisern gewundenen Hochzeitskränze von der Thür, der sagte: „Die Sandhauserleut’, hab’ ich gehört, die jungen Sandhauserleut’!“
„Das wird wieder eine breite Lug’ vom Lindenwirth sein,“ hieß es. Als der Priester zurückkam, sprach er die Worte: „Eins tragen sie heraus, wenn nicht allzwei.“
Frieda, obwohl schier zu kurzathmig für eine einzige Silbe, fragte hundertmal des Tages, wie es dem Blasi gehe. — Dem ginge es schon besser. — Aber warum er nicht zu ihr herabkäme? — Das hätte ihm der Arzt bislang noch verboten.
Und er: „Was macht denn die Frieda, daß sie gar nicht zu mir kommt?“
— Sie dürfe jetzt nicht zu ihm, hieß es anfangs, sie sei ein junges Blut und könne die Krankheit leicht einathmen. —
„Ich meine allerweg — die hat sie schon eingeathmet.“
Da verleugneten sie es ihm nicht mehr: Allerdings sei sie auch bettlägerig, aber Gefahr sei gar keine — gar keine.
Einmal, mit geschlossenen Augen, sagte der Sandhauser: „Mir ist dem — Hans sein Spielwerk — immer so bekannt vorgekommen. Und hab’s doch nicht gewußt, was es ist. Jetzt weiß ich’s. Es ist eine Charfreitagsklapper.“
Am Abend des sechsten Tages der Krankheit hörte der Blasi auf zu sprechen. Die Wärter und die anderen Leute gingen rascheren Schrittes durch das Haus. Eine alte Magd eilte herunter in die große Stube zum Wandkasten, der nahe am Bette Frieda’s stand.
„Was suchst denn?“ fragte die Kranke.
„Jetzt hab’ ich gemeint, es wär’ der Theelöffel da drin,“ antwortete die Magd und erhaschte gleichzeitig im Kasten eine rothe Wachskerze, welche sie sofort in der Faust verbarg. Frieda hatte es doch bemerkt. „Was brauchst denn — jetzt die geweihte Kerze?“ fragte sie, und indem sie sich etwas aufrichtete, mit greller Stimme: „Du, sag’ mir’s — mein Mann stirbt!“
Die Wärterin suchte sie zu beruhigen; die Kranke sank zurück auf’s Kissen und hauchte: „Er wartet schon, bis ich auch mitgeh’.“
Und ihre Brust bebte heftig bei jedem Athemzug. —
Oben zündeten sie die Kerze an und gaben dieselbe dem Sterbenden in die Hand, der bewegungslos dalag.
Nachbarn und Verwandte kamen und fragten leisen Tones: „Sandhauser, kennst mich noch?“
Er neigte kaum bemerkbar das Haupt.
„Hättest noch ein Anliegen,“ sagten sie, „wir wollten Deinen letzten Wunsch gern vollführen.“
Er blickte sie halboffenen Auges betrübt an. Dann war es, als wollte er die Lippen bewegen, aber es waren nur die Stöße des Athmens.
„Leut’, hebt an zu beten!“ rief die Wärterin.
Da knieten sie nieder um das Lager, an den Stühlen und Schränken und beteten: „Vater unser!“
Die Flamme der Sterbekerze zuckte hin und her und warf ihren Schein auf die lehmblasse Stirn des jungen Mannes, auf welcher zahllose Tropfen standen.
So dauerte es gegen eine halbe Stunde, da sagte die Wärterin plötzlich: „Jetzt kommen die letzten Schöpfer (Athemzüge)! O Herr Jesu Christ, verlaß ihn nicht! O heilige[S. 362] Maria, bitt’ für ihn! O heiliger Josef, steh’ ihm bei! O ihr himmlischen Engel, bewacht seine arme Seel’, thut sie hüten vor dem bösen Feind, steht ihr bei vor dem letzten Gericht! Dir leb’ ich, o Jesu! Dir sterb’ ich o —“
Sie hielt ein und horchte nach seinem Athem. Sie nahm ein Spiegelchen von der Wand und hielt es vor die Lippen des Sterbenden. Die Glasfläche trübte sich etwas; da huben sie wieder an zu beten.
Der Athem ging regellos und matt; die Augen waren ganz zugefallen. Da löschte die Wärterin das Sterbelicht aus und flüsterte den Anwesenden zu: „Er schläft.“ Und sie schlichen davon.
Nach einigen Stunden, als an den Fenstern der nebelige Morgen graute, schlug der Sandhauser die Augen auf, blickte unstet umher und hauchte: „Die Frieda! — warum will sie gar nicht mehr zu mir kommen?“
Ein Nachbar saß bei ihm, der schwieg nach diesen Worten eine Weile; endlich sagte er: „Jetzt ist’s besser mit Dir; aber das ist eine harte Nacht gewesen, Sandhauser.“
„Ja,“ antwortete der Kranke.
Er lag wieder wie im Halbschlummer. Und so verging ein Tag und eine Nacht. Am nächsten Morgen, als es ganz licht geworden war, wendete er etwas das Haupt und fragte: „Wer ist denn unten?“
Und als er keine Antwort erhielt, fuhr er fort: „So viel Leute gehen um — unten in der Stube!“
Er hatte die große Unruhe bemerkt, die im Hause war.
„Der Frieda, wie geht’s ihr denn?“ fragte er.
„Sie ist wohl recht schlecht, Sandhauser,“ versetzte der Nachbar.
Der Kranke hob ein wenig das Haupt und lauerte.
„Es kommt mir heut — nicht recht vor!“ rief er fast laut.
„Ist wohl recht gefährlich,“ sagte der Nachbar, „wir müssen gefaßt sein.“
Die Unruhe im Hause wollte sich den ganzen Tag nicht legen. Einmal wurde unten in der großen Stube gebetet, es war das Murmeln sehr vieler Menschen.
Wieder kam der Arzt zum Kranken. Er erklärte bei diesem die größte Gefahr als vorüber und verschrieb ihm nervenberuhigende Mittel. Im Uebrigen war er kleinlaut und ging bald wieder davon.
„Was ist denn das?“ sagte der Kranke plötzlich, „was thun sie? was wird denn im Haus heut gekocht? Ich riech’ Backwerk.“
Man hatte keine Entgegnung.
„Ihr thut mich martern, Leut’!“ versetzte er. Dann war er wieder still und starrte wie sinnend drein.
Ein paar hohltönende Schläge, die unten schollen, schreckten den Kranken auf.
„Jesus! — Jesus!“ rief er laut, „eine Todtentruhen!“
Sie mußten ihn mit Gewalt im Bette zurückhalten. Er preßte die Hände in’s Gesicht und ächzte: „Sie ist gestorben!“ und hub an, herzerschütternd zu weinen.
Am nächsten Morgen haben sie auf hoher Bahre die Frieda davon getragen. Man hatte ihr den Brautkranz um die Stirn gewunden.
Im Sandhause war es noch stiller, als es vor der Hochzeit war.
Der junge Bauer erholte sich nur langsam, und als er das erstemal in’s Freie ging, hatte der herbstliche Reif die letzten Blümchen vernichtet. Und die Schwalben waren längst davon.
Der Sandhauser verlangte, daß man ihm erzähle, wie Frieda gestorben sei. Man wich der Frage lange aus, endlich aber wurde ihm mitgetheilt: In jener Nacht, da die Leute alle um ihn, den im Sterben Liegenden, versammelt gewesen, sei Frieda ganz allein und still verschieden.
„Gott sei Dank,“ murmelte der Sandhauser. „Da hat sie in Frieden mögen entschlafen. Ihr glaubt es nicht, Leut’, was das schrecklich ist, wenn sie Einem die Sterbekerze in die Hand geben, wenn sie klagen und die Gebete vorbeten, und was Alles dazu gehört. Und nichts kriegst mehr zu hören, als wie: Jetzt mußt Du sterben! Die Todesangst, ihr Leut’! ’s ist grausig!“
Heute ist der Sandhauser, wie man gern sagt, ein Mann in den besten Jahren. Er ist, wie die Leute im Koberwald und in den Freisohlergräben meinen, wieder lebenslustig; doch ob er sich noch einmal verheiraten wird, darüber getraut sich Keiner ihn zu fragen.
Der alte Hammerl-Hans lebt auch noch. Er geht mit seinem hölzernen Spielwerk thalauf und -ab. Er stellt sich lustig und hämmert keck drein; aber man merkt es doch, er hat keine rechte Freude mehr an seiner Kunst und übt sie nur aus, des lieben Brotes willen.
Am Sandhause im Koberwald schleicht er still und gebückt vorbei. Und vielleicht nachsinnend darüber, warum Guteswollen auf dieser Welt so oft zum Bösen ausschlägt, wankt er hin in der Waldeskühle und vergißt sein Pfeifchen anzuzünden, das er im Munde trägt.
a!“ sagte der Flori.
„Nein!“ sagte die Vrona.
„Und noch einmal Ja!“ flüsterte der Bursche — sein dunkles Auge leuchtete.
„Und noch einmal Nein!“ antwortete das Mädchen — ihr blaues Auge zuckte. Sie entwand sich einem kräftigen Arm.
„So,“ sagte der Flori, „eine Solche bist Du, bei der es allemal Nein heißt, wenn der Mann Ja sagt, und eine Solche will mich lieb haben? Eine Solche will mit mir sein in Freud’ und Leid, wie es der Pfarrer sagt?“
„Der Pfarrer hat es noch nicht gesagt, mein lieber Flori.“
„Auf’s Widerpart richtest Du Dich ein! Na, das kunnt’ ein hübsches Zweigespann geben. Geh’, Du hast mich nicht lieb! Adieu, Adieu und in Ewigkeit Adieu!“
Sie sank an seinen Leib, er schob sie von sich und wollte davon; sie hielt aber fest an seinem Arm und rief: „Die Brust reiß’ mir auf und schau’ in mein Herz! — Einzig lieb bist mir, sonst sag’ ich nichts.“
„Will auch nichts hören, aber sehen will ich’s. Beweisen sollst mir’s einmal, was Du mir tausendmal hast gesagt.“
„Wenn Du wissen könntest, mein Flori!“ sagte sie, und ihr feuchter Augenstern wuchs, daß er das Weiße fast verdeckte. „Meinetwegen wollt’ ich Dir Ja sagen, was liegt an mir! Bist mein, ich frag’ nach keiner Jugend und keiner Tugend. Ohne Dich bin ich mir doch nichts werth. Wenn Du Dich aber heut’ mit einer eisernen Ketten an mich bindest, so gehört morgen Dein Leben und Dein Glück nimmer Dir.“
„Dir gehört’s und ich werde Dich nehmen.“
„Du wirst mich nehmen, das glaube ich von Dir gleichwohl, aber ich werd’ nicht wissen, ist’s aus Lieb’ oder aus Muß. Ganz frei sollst Du sein, wenn Du mir vor dem Altar die Hand reichst.“
„Ganz frei, Vrona, das kann gar nicht sein. Vierzehn Tage vor der Hochzeit macht man das Versprechen; das gilt und bindet ehrenhafte Leut’ so fest wie die geweihte Stola. Heut’ ist dieser Tag und heut’, Vrona, mach’ ich Dir mein Versprechen für Zeit und Ewigkeit.“
„Und meinst, Flori, daß Du in vierzehn Tagen mit mir Hochzeit haben kannst?“
„Möcht’ wissen, wer mir das wollt’ verbieten!“ rief der Bursche.
Sie antwortete: „Wer Dir’s wollt’ verbieten! Niemand Anderer als der Kaiser.“
„Wieso der Kaiser?“
„Ich weiß recht gut, daß Du einundzwanzig Jahre alt bist und in drei Wochen mit den Rekruten gehen wirst.“
„Wer sagt das? Kein Mensch hat Recht auf mich. Du weißt, ich bin der einzige Sohn auf dem Schwandhof, meine Eltern sind alt und gebrechlich, die Wirthschaft ist groß — so bin ich frei vom Soldatendienst.“
„Frei bist?“ rief das Mädchen aus — es war ein Jubelruf.
„Und so frei, daß ich Dich noch einmal frag’, ob’s Dir recht ist, wenn wir Hochzeit halten?!“
Ihr war’s recht, sie sagte nicht mehr nein.
Und als sie vom jungen Getanne hinaustraten in den Sommertag, der blendend licht in ihr Auge fiel, war der Bund geschlossen und der Schlüssel in den bodenlosen Abgrund geschleudert.
*
**
Was da geschehen, es lag nicht in der richtigen Reihenfolge und verschob nun das Herz und den Frieden der Menschen.
Der Schwandhof war eines der vornehmsten Bauerngüter im Gau.
Der alte, trotzige Schwandhofer war einstmals hoch und stramm dagestanden wie die Wetterfichte hinter seinem Hause. Vor nichts hatte er sich gebeugt als vor seinem siebzigsten Jahr, vor diesem stand er gedrückt, auf den Stock gestützt, und seine Hand zitterte. Sein Wille stand noch aufrecht und schwang sich wie ein Herrscherstab und wie eine Ruthe über den Hof und die Gründe. Sein Weib war ihm angemessen. Mit vierzig Jahren hatte er die Zwanzigjährige geheiratet und sie getragen und erzogen und geliebt wie ein Kind.
Jetzt schien es bisweilen, als wäre sie der Mann und er das Kind geworden; er wollte es lange nicht glauben, aber sie überzeugte ihn, und ein Glück war’s, daß sich ihr Wille an dem seinen stark gewachsen hatte, daß sie im Ganzen so dachte und schuf, wie es ihr Mann gewohnt war — und so[S. 368] stand der alte Doppelmensch trotz Manchem ungebeugt da. Die meisten Leute behaupteten, die Schwandhoferischen besäßen Geld; Etliche aber sagten: sie wären vom Geld besessen. Nun ja, der Neid!
Sie thaten nichts Schlechtes.
Von besonderer Herzenswärme, aus welcher sonst so viel Lust und so viel Schmerz emporkeimt, wußten sie nichts. Ihr Gemüth, sonst etwa im Augenglanze des eigenen Kindes sich wieder erweichend, hatte sich gefestigt und verknorrt, bis — in seinem fünfzigsten, in ihrem dreißigsten Jahre der Sohn kam. Sie begrüßten den lange erwünschten Stammhalter mit berechnender Freude, hatten des Weiteren aber nicht viel Liebe geboten und nicht viel Liebe geweckt. Der Junge war kernig im Charakter und ehrsam wie die Eltern, auch selbstbewußt und trotzig wie sie.
Der alte Schwandhofer hätte wahrlich noch nicht daran gedacht, das Gut an seinen Sohn zu übergeben; mit dem Gute übergiebt der Bauer nur allzu oft auch seinen Freistand, er wird Knecht — der Knecht seines Kindes, wird bisweilen sogar Bettler, der die Brotkrumen erflehen muß von dem Tische, den er selbst so reich und üppig gedeckt hat. Der Flori ist auch noch viel zu jung; solche Leute, wenn sie in die Wirthschaft gesetzt werden, leben flott in den Tag hinein, denken an nichts, als daß sie „Herr“ sind, zeigen auch den Herrn und blasen ihn noch auf, so gut das Zeug hält, und das Vermögen verrinnt gemach in den Sand.
Das bedenkt der Schwandhofer.
Aber der Dorfrichter giebt ihm noch was Anderes zu bedenken. Der Flori ist seinem Alter nach stellungspflichtig: wie der prächtige Kerl dasteht, so behalten sie ihn auf der Stelle zu den Kürassieren. Will der Schwandhofer den Bur[S. 369]schen losbringen, so muß er ihm Haus und Hof verschreiben. Für die Bäuerin ist das arg. Haus und Hof will sie nicht lassen und den Flori auch nicht. Ihr Mann sagt: zwei Wege seien schlechter als einer, daher müsse man einen davon rasch aufgeben. Er will den Burschen auf Haus und Hof schreiben lassen, aber dem Flori zu verstehen geben, daß Herrenschrift und Bauernwille nicht Ein Ding sei!
So war es veranstaltet an jenem Tage, als der Flori von dem Stelldichein mit der Vrona nach Hause kam. Fest faßte er die Thürklinke, stolz trat er auf die frisch gescheuerte Diele — seit kurzer Zeit fühlte er sich ganz Mann. Er kannte in weiter Runde keinen Herrn. Doch mit dem Vater verlangt’s ihn heute zu sprechen, nur weiß er nicht recht, will er dem Alten einen Befehl geben oder von demselben einen empfangen.
Sie sitzen jetzt in ihrem Extra-Stübel, ihrem kleinen Rathssaale, in welchem die Gesetze für den Schwandhof gemacht werden. Er sitzt im massigen Armstuhl, hat einen Polster unter dem Leder, sie auf der Ofenbank; sie ist ein seltsames Weib: sie ist still, wenn er spricht, und läßt ihn allemal ausreden, ehe sie ihre Meinung abgiebt. Es ereignet sich wohl bisweilen, daß die Meinungen der Beiden so weit auseinander stehen wie Ja und Nein; in solchen Fällen rückt zuerst sie ein Weniges, dann rückt er ein Weniges — sind noch nicht beisammen; sie beginnen wieder zu wenden und zu winden, und endlich stehen sie richtig dort, wo ein braves Ehepaar zu stehen hat: in der Einigkeit. Geht’s an einem Tage nicht, so wird darauf geschlafen, am nächsten Tage geht’s spielend. Und so halten sie zusammen seit dreißig Jahren und bestehen Alles und sind verwunderlich gestiegen an Macht und Ansehen.
Nun tritt ihr Sohn, der Flori, in das Stübchen. Er hatte bisher wohl seinen Sitz im hohen Rath — auf dem Schemel neben dem Wandschrank, auf dem die Stockuhr mit dem Glaskasten steht — aber er hatte keine Stimme. Heute setzt er sich nicht auf den Schemel, heute lehnt er sich mit dem Rücken an die Tischkante, kreuzt die Arme über die Brust und schickt sich an, als wollte er reden.
Der Schwandhofer schaut den Burschen so etwas über die Achsel hin an und stellt ihm ein paar gleichgiltige Fragen über die Wirthschaft.
Da macht der Flori den Mund auf und sagt kernhaft: „Werden wir’s halt angehen!“
Der Alte wendet bis zur Hälfte sein Gesicht, läßt die Augenlider zufallen, als wenn er schläfrig wäre, und murmelt: „Was meinst, Flori?“
„Wenn ich auf’s Haus geschrieben werde,“ meint der Bursche, „so kann ich nicht allein stehen.“
„Setz’ Dich nieder,“ lallte der Alte.
„Ich will heiraten!“ sagte der Flori.
„So!“ antwortete die Mutter in einem merkwürdig kühlen Tone.
„Ich weiß Eine,“ fuhr der junge Mann fort, „und will nicht lange umziehen. In vierzehn Tagen kann Alles vorbei sein.“
Der Alte trommelte mit seinen steifen Fingern auf der Armstütze des Sessels. Endlich versetzte er, noch immer mit schläfriger Miene: „Darf man fragen, wer es ist?“
„Die Vrona. Die Stegbrunnerische Vrona.“
„So!“ sagte nun auch der Alte. Beide schwiegen und der Sohn begann nun seine Wahl mit kurzen Worten zu begründen, die Nothwendigkeit derselben klarzustellen, und der[S. 371] Gründe waren so triftige, daß er den eigentlichen, triftigsten gar nicht einmal anzuführen brauchte.
Die Mutter hatte dabei mehrmals mit dem Kopfe und mit der Hand gezuckt, als wollte sie Fliegen abwehren. Der Vater war starr, wie aus Lärchenholz geschnitzt, dagesessen, und als nun der Sohn ausgeredet hatte und sich anschickte, die Stube zu verlassen, sagte der Alte: „Bleib’ noch ein paar Augenblicke da bei uns, die Sache ist noch nicht ganz in der Richtigkeit.“ Dann stand er schwerfällig auf, stellte sich vor den Burschen, indem er sich auf den Sessel stützte, und begann nun Folgendes zu sagen:
„Mein lieber Flori! Du hast da etwas gesprochen, aber greif’ mit der Hand in die Luft hinein, ob das Wort noch wo herumfliegt. Wirst nichts mehr finden; ich find’ auch nichts. Ich will’s nicht gehört haben und hab’s nicht gehört. Solltest Du einmal heiraten wollen, so weißt, wen Du zuerst zu fragen hast. Deine Eltern, das brauchst nicht zu glauben, weil Du ’s lange schon erfahren hast, wollen Dein Bestes und werden Dir nicht just Die auferlegen, die Du am wenigsten magst, und Du bist gescheit und wirst nicht gerade die Eine aussuchen, die Deinen Eltern am wenigsten ansteht. — Jetzt kannst schon gehen, Flori.“
Der Flori ging aber nicht, sein Auge war wild und sein bebender Mund murmelte: „Soll das eine Antwort sein, Vater?“
„Frag’ wird’s keine sein!“ sagte der Alte.
Nun hub auch die Mutter an.
„Bist denn närrisch worden, Flori!“ rief sie; „Du könntest im Gau und im Kärntnerischen d’rüben keine Unrechtere finden. Die hat Alles beisammen, was für Dich nicht paßt. Sei still und red’ nicht, Lecker! Sie hat die Steg[S. 372]brunnerische Hoffart an sich. Hättest um etliche Jahre früher wohl können erfahren, dieweil solche Leut’ noch Geld haben g’habt, wie ein Bidelmann (Freier) aus der Bauernschaft dort aufgenommen ist; sie haben nicht mich und nicht Deinen Vater angeschaut, in Sammt und Seiden sind sie daherstolzirt, und bei allen Leuten der Hahn im Korb sein, das war ihr Begehren. Jetzt, weil sie ihren Wirthskeller und ihren Kaufmannsladen verhaust haben und so viel als wie Bettler sind worden, jetzt glaub’ ich’s gern, daß ihnen der reich’ Bauersohn gut genug wär’. Auf die Schönheit gehst? Möcht’ schon wissen, wo an Der die Schönheit steckt, und ich rath’ Dir, Flori, such’ sie nicht an der unrechten Stell’! Wie Du heut’ dastehst, denk’, wen Du kriegst und wen Du brauchst! Das möcht’ eine Wirthschaft sein, Du heilige Mutter Gottes! Das Verschwenden und das Feine-Frau-Spielen hat sie gelernt; von einer braven Haushaltung weiß sie nicht so viel, als meine Unterdirn im kleinen Finger hat. Nimm eine Dienstbotin, wenn sie arbeiten kann und hausen, aber Eine, die reich gewesen und arm geworden ist, stellst mir nit auf den Schwandhof, dafür bin ich und der Vater da!“
Der Alte, der sich wieder auf seinen Sessel niedergelassen, nickte beistimmend und kühl, als ob er weiter der Sache nicht genug Wichtigkeit beilegte, um sich darüber zu ereifern. Dem Flori war nun auch ein scharfes Wort aus dem heftig schlagenden Herzen auf die Zunge gestiegen, aber — wie die Weiber schon sind — seine Mutter hub noch einmal an und brachte allerlei gegen die Vrona vor, übertrieb, was das Zeug hielt, und als sie nichts Neues mehr vorzubringen wußte, wiederholte sie das Alte und wurde immer hitziger dabei, bis ihr der Alte zuwinkte: „Geh’, hör’ auf, Hanna, und laß das Traumauslegen sein!“
Da stampfte der Flori mit dem Fuße in den Boden und schrie: „Verflucht! Gegen die Vrona laß ich nichts sagen! Die wird mein Weib!“
Jetzt schlug der Alte sein Auge auf, es war grau und nebelig.
„Du ungeberdiger Laff’,“ sagte er, „zum Schreien und Fluchen ist das freie Feld draußen weit genug. Kannst gleich schauen, daß heute der Schafdung auf den Rübenacker kommt; wie es mir in dem Arm zuckt, glaub’ ich, daß wir Regenwetter kriegen.“
„Vater,“ entgegnete hierauf der Bursche, indem er seine Aufregung niederzuhalten suchte, „seit ich Hand und Fuß rühren kann, habt Ihr mich zur Arbeit gestoßen. Oft manche Stimm’ hab’ ich gehört, wie ich, der einzige Sohn auf dem großen Hof, der Narr sein kunnt’ und ließ mich hin- und herschummeln wie ein Knecht, früh und spat, jahraus, jahrein. Ich hab’ mich nicht anfechten lassen, bin willig und fleißig gewesen — wegen Vaters willen. Wer mich aber jetzt auch noch will unter den Füßen haben, daß ich nicht einmal im Weiben mein Herr sein sollt’, mit dem red’ ich aus einem andern Ton.“
„Hast ganz recht, Flori,“ höhnte der Alte.
„Dem sag’ ich, daß mich kein Gott und kein Teufel von meiner Sach’ abbringt!“
„Herrein!“ schnarrte der Schwandhofer auf ein Klopfen an der Thür.
Der Gerichtsdiener war’s. Ein Papier entfaltete er; um Unterschrift hatte er zu bitten.
„Was habt Ihr denn schon wieder?“ murmelte der Alte.
„Nichts Unangenehmes diesmal,“ antwortete der Bote und las:
„Laut Gesetz vom (Datum, Paragraph und Zahl genau angegeben) kann dem Gesuche des Lorenz Pürgher, derzeitigen Besitzers des vulgo Schwandhofes im Gau und seiner Ehegenossin Katharina Pürgher, Mitbesitzerin auf genannter Realität, Beide gegenwärtig zur selbsteigenen Verwaltung und Führung der Wirthschaft nicht mehr befähigt, wegen gänzlicher Befreiung ihres einzigen Sohnes Florian Pürgher von der Militärpflicht hiergerichts entsprochen werden und hat außer genannten Bittstellern das obwaltende Gemeindeamt die oben als Begründung des Gesuches angeführte Thatsache ordnungsmäßig zu bescheinigen.
Das k. k. Kreisgericht.
N.“
„Was soll mir das?“ fragte der Schwandhofer. „Da steht eine Unwahrheit, die ich nicht unterschreibe. Ich bin gottlob wieder gesund und stark genug für mein Haus. Ich brauch’ Keinen. Gieb her, Bote, das will ich aufschreiben...“
Der Flori fiel dem Alten in die Hand.
„Ist recht,“ sagte der Bauer, „so schreib Du’s auf: Ich nehme mein Gesuch zurück, bleib’ Herr in meinem Haus und laß’ die Stellungscommission mit meinem Sohn machen, was sie will. Na, schreib’, schreib’!“
„Das ist ja Alles nicht nöthig,“ meinte der Amtsbote, „fehlt die Unterschrift, so ist der Wisch ohnehin ungiltig.“
„Dann sind wir fertig!“
„Gefreut mich recht, daß wir in unseren alten Tagen noch so rüstig sind!“ sagte der Bote nicht ohne Spott und verließ die Stube.
Flori war blaß bis in den Mund hinein, sein Auge rollte wild; die Adern seiner Stirne schwollen an, seine[S. 375] Hände ballten sich zur Faust. Aber es geschah nichts, als daß die dumpfen Worte gesagt wurden: „Ich brauch’ Euch nicht. Gebe Gott, daß auch Ihr mich nicht braucht!“
Und Flori trat zu dieser Stunde das letztemal aus der Thüre seines Vaterhauses.
In wenigen Wochen war er Soldat. Ein halbes Jahr später stand er auf der Wacht inmitten der heißen Steinberge der Herzegowina.
Die alten Leute auf dem Schwandhof waren mürrisch und hinfällig. Eines Tages wurden ihnen zwei Dinge in’s Haus getragen: ein schwarzgesiegelter Brief und ein kleines Kind — ersterer kam aus Mostar von der Militärbehörde, letzteres vom Krankenbette der Stegbrunnerischen Vrona.
Beides blieb im Schwandhofe — es war ein Ende und ein Anfang.
ie Jagd war unglücklich ausgefallen. Der Fürst hatte einem Treiber die rechte Hand durchschossen. Der Treiber aber hatte Weib und Kind, sonst aber nichts für sich und seine Familie, als diese Hand; er war Waldarbeiter, und bei solchem Geschäfte muß die Rechte allemal wissen, was die Linke thut, weil sie derselben in Allem beizustehen hat.
Gut war noch das Eine, daß der Fürst es gewesen, der in Unacht den bösen Schuß gethan hatte, und die Leute sagten: „Sei froh, Thoma, jetzt bist versorgt für alle Tage, die Dir Gott vom Himmel giebt!“
Und Gott gab ihm noch manchen Tag vom Himmel, nahm ihm hingegen sein Weib — da stand er, der Krüppel, mit seinem Kinde, einer heranwachsenden Tochter, allein. —
In einem Thale jenes Gebirges steht das Schloß Hollerstein. Es ist ein großes, altes Gebäude, der Sage nach einst von Raubrittern gegründet, von Templern erobert und bewohnt, durch die Türken zerstört und als Jagdschloß für den Fürsten wieder erbaut. Die längste Zeit des Jahres stand Hollerstein leer und wurde nur von einem Vogte bewacht, einem Invaliden aus dem Franzosenkriege. Als nun der eine Invalid starb, kam der andere dran — der Thoma[S. 377] mit der durchschossenen Hand. Der bekam im Schlosse zwei große Stuben und ein kleines Gemach, und darin wohnte er nun und war der alten Mauern und dem blühenden Kinde treuer Wart. Die grauen Steine sind leicht zu hüten, aber ein hübsches Mädchen, das zwischen dem Kinde und der Jungfrau in der Schwebe ist, wie ein Blüthenreis in der Nacht zwischen April und Maien, ist Gefahren ausgesetzt, von welchen der alte Thoma selbst nicht viel Ahnung hatte. Es ist scheinbar eine kühle oder laue, ruhige Nacht, aber es ist dunkel und das Mädchen ahnt, bangt in das Ungewisse hinein. Es fühlt wohl, daß ihm ein anderes Leben kommen müsse — es fiebert leise zwischen Frost und Sonnengluth...
Julina hieß sie. Julina ging nun in das achtzehnte Jahr. — Ich wollte, ich könnte malen, ich würde dem freundlichen Leser ein Bildchen schenken, das er aufstellen sollte an dem trautesten Platze seines Heim. Im rauhen Gemäuer des Schlosses ein Fenster, dessen offene Flügel mit den klaren, sechseckigen Zellenscheiben in der Morgenluft leise fächeln. Das Fenster ist einen Stock hoch in der Mauer, aber die Ranken des Epheu sind doch hinangeklettert und umkränzen die Rahmen und schwingen und schlingen sich über das Gesimse hinein und möchten am liebsten auch das holdsame Mädchen umschlingen, das mit seinen goldfarbigen Locken am Fenster steht und just mit zarter Hand ein Dornröslein befestigt an der blüthenweißen, schmiegsamen Pfaid seines Busens. Sein Lippenpaar ist auch so ein Dornröschen, so knospend, so frisch; und wer ihm in’s große, helle Auge schaut, der kann ein Vöglein d’rin sehen — es ist das winzige Spiegelbild einer Schwalbe, die heiter zwitschernd auf einem Zweige wiegt und dann lustig um den Thurm des Schlosses kreist.
Ja, ihr Närrchen! Wenn schon der immergrüne Epheu und die lose Schwalbe um das Mädchen minnen, wie erst die warmlebigen Burschen des Thales! — Es ist ja so wunderbar, so närrisch, so göttlich auf dieser Welt! — Am Abend, wenn die Schwalbe schon längst in ihrem Neste hockt und den stillen, süßen Freuden des Familienlebens obliegt, und wenn über den steinigen Höhen des Tauern der Mond aufsteigt, schamrothen Antlitzes zuerst wie ein Junge, der das erstemal minnt, doch helleren, keckeren Auges bald die Mauern des Schlosses bescheinend und im Gemache einen scharfen Schatten schneidend aus dem Köpfchen der jungen Maid, die wiederum am Fester steht — zu solcher Abendstunde mögt ihr heimlichen Lauscher wohl einen wunderlichen Gesang hören unten im Haselgesträuche. Anfangs ist es nur eine Entschuldigung:
Gleich darauf mag schon das Geständniß kommen, das Geständniß von warmer Neigung oder einer heißen Herzenssehnsucht; es kann ein glühend Verlangen werden, gemildert nur durch die anmuthig schalkhafte Liebesform, in welche schon die Alten ihre trotzigen Wünsche zu kleiden gewußt haben. Auch den Jungen nun ist ganz dasselbe mundgerecht.
Nicht abhold sind die Mädchen solchem Cultus der Liebe und Julina sang mit ihrer weichen Stimme manche Antwort gegen das Haselgebüsch hinab — bald Gegenneigung, bald Ablehnung, bald Gewährung, bald Spott verkündend. Da knisterte es wohl zuweilen im Strauchwerk, da strebte wohl[S. 379] mancher rüstige Fuß über die rollenden Schuttsteinchen dem Gemäuer zu; aber die Wand war glatt, und gleichwohl man sagt, die Liebe hebe den Menschen in höhere Regionen, hier an der Mauer von Hollerstein vermochte sie nicht einen einzigen der Minnenden bis zu Julina’s Fenstergesimse zu heben.
Nur Oswald, der zweiundzwanzigjährige Sohn des Forstmeisters, vermuthete, daß hier eine Leiter mit zwölf Sprossen bessere Dienste leisten dürfte, als die begehrendsten Liebesliedchen. Von Heim mitbringen konnte er die Leiter allerdings nicht, denn das Försterhaus stand drei Stunden tiefer im Gebirge, und dem Burschen, schlank und glatt und fein, zart und männlich dabei, frisch und heiter — der Abgott aller jungen Weiber, die ihn sahen — dem stand es nicht an, anstatt der Flinte eine Holzleiter zu schleppen auf seiner Achsel dem Schlosse Hollerstein zu. So zimmerte denn Oswald eines Tages im Haselgebüsch unter dem Schlosse die Leiter. Der harmlose Thomas hatte ihm Axt und Bohrer dazu geborgt, denn so eine Leiter — meinte er — sei freilich wohl nöthig für den jungen Jäger, um die schroffe Falkenwand jenseits des Baches zu erklimmen. Und Oswald, der herlebige Junge, hatte selten noch eine Arbeit mit solcher Passion verrichtet, als nun, da er die Sprossen in die Leiter bohrte; von Sprosse zu Sprosse wurde ihm wärmer und als er die letzte, die oberste in’s Holz schlug, murmelte er: „So! meine Mutter hat mir alleweil gesagt, der Mensch soll sich seine Staffel in den Himmel selber bauen. Meine sind fertig.“
Nicht gar weit vom Schlosse steht das Sensenwerk, in welchem zu dieser Zeit der Hammer-Wend Essemeister war. Der Hammer-Wend ist in der Gegend noch heute als ein[S. 380] Mann bekannt, der so hart, spröde und schwarz wie rohes Eisen war, und wenn Der glühte, da stoben die Funken. Es war ein finsterer, rachgieriger Geselle, ein kerniger Arbeiter gleichwohl, aber ein wüthender Raufer und Würger, wurde er gereizt. Keinem war so gefährlich Kleider machen, als diesem, Keiner gab so gutes Trinkgeld, wenn ihm was saß, aber Keiner wetterte auch so wild, wenn im Gewand ein kleiner Fehler war. Indeß diente es als Empfehlung, wenn es hieß: Der arbeitet auch für den Hammer-Wend. Er war über die Dreißiger hinaus in Liebessachen kalt geblieben. Ueber den Wein, die Spielkarten und über die Wilderei hatte er das Weib vergessen.
Als nun aber in der Nähe des Sensenwerkes des Schloßwarts Töchterlein erblühte und selbes in allen jungen Männern des Thales Liebessehnsucht weckte, da fing der Wend plötzlich Feuer und glühte und sprühte schauderlicher, als all’ seine Essen zusammen. Eines Sonntags im Schloßhag, wo Julina just zwei zahme Rehe fütterte, machte er ihr seine Liebeserklärung. Seine Worte waren wie eherne Hammerschläge, wie lodernde Eisenklumpen. Das Mädchen erschrak vor solcher Leidenschaft, wortlos senkte es das Haupt und zitterte wie eine Taube unter dem niederschwirrenden Adler. Das Nahen des Vaters rettete sie. Der Hammer-Wend schritt fürbaß und hielt sich das Mädchen für erobert.
Auch er war nun manche Nacht im Haselgebüsch gekauert, doch sang er nur selten ein Lied, weil seine Minnetöne vom Fenster her nie eine Antwort erfuhren. Er lauerte auf eine Gelegenheit, dem Mädchen zu nahen, und sich dessen Gegenliebe zu versichern. Da fand er eines Abends im Gebüsche den Försterssohn lehnen an einem Steine, süße Lieder singend und süße Antwort empfahend. Vor Wuth bebte der[S. 381] Wend; sein Feind, der ihn schon einmal wegen Wilderei vor Gericht ziehen ließ, sein Feind stand nun zwischen ihm und diesem jungen Weibe. Erst als Oswald mit drei Fingern einen Kuß gegen das Fenster sandte: „Gute Nacht, gute Nacht, mein Schatz!“ huschte auch der Wend davon. Und mit Zähneknirschen schwur er’s, in den nächsten Tagen wieder auf Jagd zu gehen, und zwar mit seinem sichersten Kugelstutzen, und Stände zu suchen, nicht wo der Rehbock springen konnte, sondern wo der Försterssohn vorübergehen mußte.
Julina trillerte noch ein heiteres Schnadahüpfel und legte sich schlafen. So sang sie stets ihren Abendsegen und meinte in ihrer Schalkheit, vielleicht gefalle dem lieben Herrgott das Singen besser als das Beten, denn seinen Vöglein in den Lüften habe er nicht das Beten, wohl aber das Singen gelehrt. — Ein Blitzmädchen war’s!
Und siehe, während im Herzen des Kindes so die Liebe waltete, grub in der durchschossenen Hand des Vaters die Gicht. Die Salben aller alten Weiber der Umgegend waren längst versucht und verflucht; so entschloß sich nun der Alte einmal, einen entfernten berühmten Arzt aufzusuchen, um Linderung seines Leidens zu erlangen. Er ging davon und Julina blieb allein im großen Schlosse, allein bei Tage und bei Nacht.
„Das ist die rechte Zeit,“ sagte der wilde Hammer-Wend zu sich. Und des Abends spät, da Wolken die Sterne des Himmels verdeckten, ging er dem Schlosse zu. Er sann auf Mittel, die hohe Mauer zu überwinden, da fand er im Haselgebüsche die Leiter. Er grinste, er ahnte bald, von wem sie bereitet und wozu sie bestimmt war. Sein Blut glühte, theils aus Liebes-, theils aus Rachbegier. Er lehnte die Leiter an die Mauer und kletterte vorsichtig hinan. Er lauerte,[S. 382] das Fenster war geschlossen; er horchte, im Gemach war es still; er klopfte, das Klopfen war vergebens.
Sollte sie nicht daheim sein? Sollte sie in einer anderen Stube schlafen? Oder gar bei den Ziegen im Stalle? Denn Weiber gehen, wenn sie sich vor Menschen fürchten, gern zu den Thieren. — Schon wollte der Wend wieder zur Erde steigen, da hörte er im Gebüsch ein Rascheln. Er stieg nun nicht hinab; behendig wie eine Katze kletterte er von der Leitersprosse auf einen Mauervorsprung hinaus, schmiegte sich in eine mit wilden Ranken umwucherte Nische, die hart neben dem Fenster war und lauerte.
Unten wurde ein Vierzeiliges gesungen:
Oswald’s Stimme.
Der Wend griff mit behender Hand nach dem Messer, das in der Ledertasche seines Beinkleides stak. „Mein Stoßeisen, Du! Sollst mir heute gut sein!“ so murmelte er knirschend. „Und das schwör’ ich Dir, Jüngling, in dem Augenblick, wo Du ihren Mund anrührst, grab’ ich Dir das Messer ein!“
Hätte Oswald emporgeblickt, er würde zwei Augen haben funkeln gesehen im Geranke. Aber dem arglosen Burschen fiel es nicht einmal auf, wieso die Leiter schon am Fenster lehnte; oder er hielt das als ein Zeichen des Entgegenkommens von Julinen. Zwar hatte sie heute bisher sein Liedchen nicht entgegnet; doch, sie mußte ja vorsichtiger sein[S. 383] als sonst, wenn der Vater daheim, und einem Mädchen, das sich einsam fühlt, vergeht das Singen. — Leichten Blutes stieg Oswald die Leiter hinan. Mehrmals mußte er an den Scheiben klopfen und Julinens Namen flüstern, bis der Fensterflügel sich aufthat.
„Julina! Wachest Du? Ich bin’s.“
„Oswald,“ lispelte das Mädchen und zog die Pfaid über die Brust hinauf bis zum Kinn.
„Ja,“ sagte er.
„Oswald, heute hättest Du nicht kommen sollen.“
Er setzte sich an’s Fenstergesimse, schlang den linken Arm um eine Rankenstange, die zugleich als Gitter diente, und streckte die Rechte dem Mädchen zum Gruße hinein. Sie hielten sich an der Hand, sie flüsterten und der Bursche umschmiegte immer fester ihre weichen Fingerchen.
„Julchen,“ sagte er plötzlich, „wie Du siehst, bin ich hier auf dem Gesimse in keiner geringen Gefahr. Wenn die Ranke bricht, so lieg’ ich unten.“
„Warum soll die Ranke denn brechen?“
„Weil sie Deinen ganzen Burschen halten muß. Und just den Geringsten hast Du Dir nicht ausgesucht. Willst mich wägen?“
„Nach dem Gewicht kauf’ ich nicht,“ spottete sie.
„Ah, Ihr Weibsleut’ schaut’s nur auf das Maß; und allemal, es wäre schad’ um den Deinigen, wenn die Ranke jählings brechen sollt’.“
„Ein bissel wär’s halt freilich schad’,“ lispelte sie und zog seine Hand ein wenig näher an ihre Brust.
„Wenn Du’s meinst, so thätest wohl doch ein christlich Werk, wenn Du mich aus der Gefahr wolltest befreien.“
„Wüßt’ nit, wie Eins das müßt’ angehen.“
„Ich wüßt’ schon, Julina, wie Eins das müßt’ angehen. Da weg vom Fenster sollst mich heißen — zu Dir in’s Stübel hinein.“
„Kunnt mir im Schlaf nit einfallen,“ meinte sie.
„Schlafst ja nit,“ sagte er, „Warum sollte ich nicht ein Eichtl neben Dir sitzen, daß wir über Eins und das Andere plauderten und uns mit einander die Zeit vertrieben?“
Jetzt war im Gestrüppe neben dem Fenster ein leichtes Rascheln.
„Hörst es!“ sagte Oswald, „die Fledermäuse, oder was mir da zusetzt. Nein, lieb’ Dirndl, ich kunnt’s nit verantworten, daß ich Dich in diesem alten G’schloß allein ließe die heutige Nacht. Möcht’s nit auf mich nehmen.“
„Jetzt ist Schlafenszeit,“ sagte sie.
„Magst schlafen so viel Du willst; ich sitz’ daneben und bleib’ schon munter.“
„Gescheiter wird’s sein,“ meinte sie nun, „ich verlaß mich für diese Nacht auf den heiligen Schutzengel, als auf Dich.“
„Das ist gewiß auch; aber Dein Schutzengel, der schickt mich ja her zu Dir. Geh’, lang’ zu Dein Köpfel, ich will Dir was in’s Ohr sagen.“
„Sag’s nur, ich höre es schon,“ entgegnete sie und hielt das Köpfchen zurück.
„Schatz,“ flüsterte er, „hättest wirklich eine so schlechte Meinung von mir, daß Du glauben kunnt’st, ich ging Dir heut’ ohne Bussel fort?!“
„Du Bübel, Du keckes!“ drohte Julina halb im Spaß, halb im Ernst. „Meine Mutter hat gern gesagt: Das Bussel hat einen langen Faden, da hängt allerhand dran und da[S. 385] verzappelt man sich hinein, wie die Mucken in das Spinnenweb. — Hättest nur erst den Arm um meinem Hals, wär’ Dir’s ein Leichtes, in’s Stübel zu rucken; und auf der harten Bank sitzen, das kunnt’ Dir leicht nit lang’ taugen. Flugs ist die Gnad’ Gottes weg und wir kunnten uns von einander nicht erwehren. Und morgen thät’s uns gereuen. Oswald sei gescheit und geh’ heim.“
Da hub es dem Burschen in allen Adern an zu kochen. Des Mädchens innige Worte waren nur Oel in’s Feuer. Er konnte es in dunkler Nacht nicht sehen, wie nahe an ihm das scharfe Messer blitzte. Schon schickte er sich an, durch das Fenster zu steigen, aber die Jungfrau rief den Namen Gottes an und hielt ihn mit zitternden Händen zurück: „Oswald, überwinde Dich! nur heut’ überwinde Dich. Ich hab’s dem Vater versprochen, daß ich tugendsam bin, dieweilen er aus ist. Und mußt auch bedenken, daß heut’ Maria-Namenstag ist, wo vor einem Jahr an diesem Tage Deine Mutter ist gestorben —“
Sie sprach nicht weiter und so wies sie ihn hin, den lieben Burschen, den sie am liebsten mit beiden Armen an ihr Herz gezogen hätte. Mit einem tiefen Athemzuge ließ Oswald ab. Eine Weile saß er noch stumm auf dem Fensterbrett, dann sagte er traurig: „Gute Nacht, Julina!“ stieg rasch die Leiter hinab, warf diese in das Dickicht und eilte davon.
Der Hammer-Wend in seiner Mauernische ließ verblüfft das Messer in die Scheide gleiten. Mit einer Art von Wollust hatte er in seinem Racherausch den angeschworenen Moment zum Stoße erwartet. Jetzt war das Opfer plötzlich davon, er wußte kaum wie. Nun im Grunde, dachte er, um so besser....
Mit einem Satze war der wilde Essemeister auf dem Fenstergesimse. Ein Schreckruf des Mädchens; sie schlägt das Fenster zu. Er stößt es wieder auf; sie erkennt den Hammer-Wend, ein Stoß mit beiden Armen nach seiner Brust — er taumelt zurück, stürzt nieder in’s Strauchwerk.
Den Essemeister Wendelin haben sie in’s Krankenhaus getragen. Der alte Schloßwart ist mit frischen Salben von einem Arzte zurückgekommen und hofft wohl, daß seine Hand sich wieder insoweit stärken wird, um damit den seither in Anwartschaft stehenden Enkel schaukeln zu können; denn Oswald, der junge Förster, hat um Julinen geworben. Und der Epheu rankt fort und fort, und die Vöglein umkreisen lustig schmetternd, kosend, geheimnißvoll lugend und flüsternd das Fenster der Liebsten.
nfangs fing er Schmetterlinge und steckte sie an die Nadel. Dann fing er Spatzen und Finken mit Leimspindeln. Dann fing er Marder und Füchse mit dem Schnappeisen. Dann schoß er einen Hühnergeier aus der Luft. Dann schoß er ein paar Hasen; dann schoß er Rehe und Hirsche, dann schoß er —
Die Geschichte ist schwer wie Blei.
In einem Hochthale des Reichensteinstockes hatte Franz Schlager ein Bauerngütchen. Franz war jung und frisch, und hatte ein prächtiges, herzenstreues Weibchen voll Lieb’ und Gemüth, voll fraulichen Adels der Natur. Bei seiner Arbeitskraft und bei ihrer Häuslichkeit hätten sie vollauf zu leben gehabt, und ihre Hütte war wie gemacht für „ein glücklich liebend Paar“. Aber just in die wärmsten und wonnigsten Nester legt der Teufel am liebsten sein Ei hinein. — Für schlechte Leute, sagte der Franz, habe er sich den Kugelstutzen beigelegt; man wisse doch nicht, was sich in einer so einsamen Gegend Alles zutragen könne. — Ei freilich weiß man das nicht, Du armer Franz Schlager, sonst hättest Du das Schießgewehr gewiß nicht in Dein Haus getragen.
Als er im Oberschachen den ersten Hasen schoß, hörte der Revierwart den Knall, errieth auch den Schützen, da er aber sonst den Franz wohl leiden mochte, so ließ er die Sache verhallen. Als der Franz Schlager sah, das Ding ginge so leicht ab, schoß er das nächstemal einen Rehbock nieder, schleppte denselben mitten in einem Sturmwetter in sein Haus und rief: „Theres, der da gehört Dein, zum Namenstag!“
Selbstgefällig schmunzelnd blickte er sein Weib an und erwartete freudigen Dank. Aber sein Weib begann zu schluchzen: „Das schmerzt mich, Franz, das schmerzt mich hart. Mit einer Blum’ vom Feld, mit einem Stein von der Straßen hättest mir Freude gemacht, wär’ es mir zu Lieb’ vermeint gewesen. Aber eine gestohlene Sach’ schenkst Du mir, so viel bin ich Dir werth....“
Es war zum Erbarmen; so bitterlich hatte er sie noch niemals weinen gesehen. Er schwieg eine Weile.
„Theres,“ sagte er endlich und stellte sich keck vor sie hin: „Mit Fleiß willst mich jetzt kränken, weißt gleichwohl, daß ich’s gut hab’ gemeint.“
„Franz,“ sagte sie, „das weiß ich gleichwohl und schau’, ich lach’ schon wieder, Du giebst mir heut’ ja noch ein ordentliches Bindband (Angebinde). Versprich’ mir’s, mein Franzl, wildern willst nimmer!“
Er nickte mit dem Kopf. Sie umfing ihn mit beiden Armen und lächelte mit feuchtem Auge.
Nicht lange darnach ist dem Paare ein Kindlein gekommen.
Ein Kindlein! — Bin sonst nicht nervenschwach, aber wenn ich dieses Wort schreibe, so zittert mir immer die Hand. Ein Kindlein! Ich denke an die Vaterfreuden, an[S. 389] das Mutterglück. Mit jedem Menschenkinde wird der Erlöser neu geboren, unnennbare Seligkeit guten Elternherzen spendend. Therese ging fast in Mutterliebe auf; sie fühlte kein Herz mehr in ihrer Brust, sie fühlte es vor sich liegen in der Wiege.
Franz arbeitete mit neuem Muth und blickte mit hellerem Auge in die Welt hinaus. — Da sah er hier einen Hasen kauern, dort ein Reh huschen; da hub ihm das Blut zu wallen an, wie lauter glühende Bleikugeln heiß. — Und der jungen blassen Mutter müsse ein frischer Braten gar sonderlich wohl bekommen.
Als Theres wieder todtes Wildpret im Hause sah, zerrte sie den Gatten von der Wiege des Kindes, wo er eben gestanden war, führte ihn in einen Winkel des Vorgemachs und sagte:
„Unser Sohn soll das Wort nicht hören: Franz, Du bist ein Wildschütz’ — ein Dieb!“
Sie ließ ihn stehen und stürzte davon und brach an der Stätte des Kindes zusammen.
„Und Du!“ rief Franz zur Stube hinein, „Du bist ein überspanntes Ding. Thun es Andere auch; wenn Jeder deshalb schon ein Dieb wär’! Der Herrgott hat die Thiere des Waldes für Alle erschaffen!“
„Darauf laß ich mich nicht ein,“ sagte sie, „Du willst das letzte Wort haben; Du weißt so gut, wie ich, was unrecht ist.“ Bald aber erhob sie sich, trat ihm einige Schritte entgegen, faltete zitternd die Hände in einander: „Franz, bös’ hab’ ich’s nicht gemeint. Und wenn Du schon das Unrecht nicht willst sehen, so denk’, es könnt’ einmal zu Deinem Unglück sein. Geh’, mein lieber, mein guter Mann, laß’ das Wildern bleiben!“
„Ich weiß ja, Du willst mir keine Freude gönnen!“ rief er unmuthig und ging davon.
Da hatte sie kein Wort mehr, als den heißen Thränenstrom, der auf das Bettlein des Kindes niederrann. — „Er hat keine Freude. Da ist sein Kind und da ist sein Weib, und er geht in den Wald hinaus und sucht sich eine Freude....“
Was kann mir denn geschehen? dachte Franz; jetzt ist schon gar keine Gefahr — ist ja der Jäger krank und der neue Gehilfe ist noch nicht angekommen. Jetzt ist die Zeit dazu.
Und er nahm wieder das Gewehr unter den Wollenmantel und er ging davon.
Theres bat ihn noch einmal, hielt ihm das Kind entgegen: „Franzele, bitt’ auch Du Deinen Vater! Halt’ ihm das Händlein hin, streichle ihm die Wange; — ’s ist ja Dein lieber, braver Vater, und er bleibt gewiß daheim, bei seinem kleinen Bübel.“
Das Knäblein lächelte, zupfte an dem Bart des Mannes und wollte nicht auslassen.
„Nu, nu,“ schmunzelte Franz, „ich komme ja bald wieder. Nur einen Habicht will ich heut’ aus der Luft brennen, er frißt uns ja sonst die Hühner auf. So Raubthiere muß man austilgen.“
Und er ging pfeifend hinaus in den herbstlichen Wald. Er sah sich nicht mehr um, denn er wußte wohl, Therese stehe noch vor dem Hause mit dem Kleinen und blicke ihm nach mit weinendem Auge.
Und als er in den Wald kam und sein Späherblick die Thierlein sah, die kriechenden, die fliegenden, die springenden — so hub seine Begier gewaltig an zu glühen...
Theres nahm den Kleinen mit auf den Acker und grub Kartoffeln aus der Erde, und war emsig und unermüdlich dabei. Wenn man Herzweh hat, so muß man brav arbeiten, dann wird’s gut.
Heute wollte es aber nicht gut werden. Heute kam eine ganz besondere Angst über das arme Weib, als ob etwas Arges nahe wäre. Sie betete in Gedanken um Schutz für ihren Mann. Dabei kam ihr in den Sinn: Wie kann denn der gerechte Gott Diebe beim Stehlen beschützen! — Aber sie betete: „Du, sein heiliger Schutzengel, beschirme sein Herz, beschirme es vor sündhafter Begier. Er ist ja sonst ein guter Mensch, thut Niemandem was zu Leid und ist gar ein braver Gatte und Vater. Du lieber Gott, das kann ich Dir wohl mit Freuden sagen!“ — Sie schluchzte dabei und grub und grub die Erde auf und grub in Gedanken oft tiefer ein, als die Früchte lagen. Das Knäblein — es war ein halbes Jahr kaum alt — jauchzte hell und verlangte nach der Mutterbrust. Sie vernahm es heute kaum, und als sie den Spaten fahren ließ und zum Kinde kam, war dieses eingeschlummert.
Es ging gegen Abend. Das Gevögel schwieg, die Hühner saßen auf ihren Stangen. — Franz war noch nicht zurück.
Theres hatte lange in’s Weite geblickt; ihre Unruhe war heute wilder Natur. Und als jetzt der späte Abend kam, harrte sie nicht mehr länger. Sie nahm das schlummernde Kind auf den Arm, hüllte es ein mit des Vaters brauner Joppe, verschloß das Haus und ging dem Walde zu.
Kein Ast und kein Baumwipfel rührte sich. Die langen Schatten der Bäume lagen da, junge, wachsende Kinder der Nacht. Theres ging an einer Schlucht hin. Das rauschende[S. 392] Wasser that ihr weh, denn ihr war, als müsse sie diese unheimlich zischenden Stimmen verstehen, und sie verstand sie doch nicht. Sie stieg die Lehne hinan und war sorglich, daß sie das Kind nicht wecke. Neben Büschen von Enzian setzte sie sich auf einen Stein und horchte. Alles schwieg und war im Frieden. — Und wenn ein wildleidenschaftlich Herz pochte im Walde, man müßte es hören von Weitem in dieser reinen Abendruh’. — Die blauen Glocken der Enziane wiegten sich sanft, und es ging doch kein Lufthauch; sie läuteten und man hörte das ewige Klingen der Stille.
Jetzt erwachte das Knäblein. Die Mutter reichte ihm die Brust. Es trank mit Lust. Und das Weib strengte sein Ohr an und meinte einen Laut, einen Schritt ihres Mannes zu hören — und sie hörte doch nichts.
Dann blickte sie die blauen Blumen an, die wie Flämmchen noch leuchteten, da es schon dunkel war. — Irrlichter sollen auch zuweilen in blauen Flammen leuchten. Aber Blumen sind keine Irrlichter; Blumen sind Augen Gottes — so hat’s oftmals die Ahne gesagt. — Und jetzt, Franzele, jetzt blickt uns Gott an mit seinen blauen Augen. Schau, er hat uns lieb; — Gottes Auge wacht auch über dem Vater...
Ein Knall — — da war ein heißer Blitz durch den Busen des Weibes gegangen.
Sie stieß einen lauten Schrei aus — sie preßte das Kind an sich.
Franz Schlager hatte den Schrei gehört, nachdem er die Kugel abgesandt nach dem braunen zuckenden Punkte zwischen den Büschen jenseits der Schlucht — vermeinend ein eben früher aufgestöbertes Reh zu erlegen. Er hörte den menschlichen Ruf und eilte und sprang über Stock und[S. 393] Gestein, die Tiefe hinab, den Hang hinan — und fand sein sterbendes Weib.
Das Kind sog noch an der Mutterbrust, über welche vielarmig die Bächlein des Blutes rieselten. Das Weib war mit matten Bewegungen noch bemüht, das strömende Blut so zu wenden, daß es sich nicht vermische mit der Muttermilch, deren sich das liebe Kind zu dieser Stunde das letztemal erfreute.
Mit wildem Gestöhne stürzte Franz hin, mit bebenden Armen riß er ihr sinkendes Haupt empor. Sie hob noch das Augenlid und sagte leise: „Mein Franz — gelt — das Wildern — laßt sein?“
Er that einen rasenden Schwur, er ließe es sein.
Sie sagte nichts mehr. Noch ein Blick gegen ihr Kind — ein zitterndes Tröpflein in ihrem Auge — — dann war es starr und öde auf dem lieben, trautsamen Antlitz.
Die Enziane läutete still in der ruhsamen Nacht... Auf der Erde war sie nicht gehört, aber in den Himmeln hat diese Sterbeglocke geklungen.
ie Säge stand still, das letzte Brett glitt über die Rutschbalken nieder. Es war Feierabend — Feierabend des Tages und Jahres — Sylvesterabend.
Wolfgang, der junge Sägemeister, stieg langsam von seiner Werkstatt nieder, und sah auf die weißen Bretter hin, auf welchen noch der Staub der Sägespäne lag, und dachte daran, was man Alles daraus machen könne: Tisch und Schrank, Bettstatt und Bank, Wiege und Schrein. — Wiege und Schrein! Am Sylvesterabend denkt sich so etwas gern, besonders, wenn man ein sinniger Kopf ist, wie der Wolfgang, ein altes mühseliges Mütterchen hat drüben in der Seegrub, und daheim ein süßes Weibchen, das der Herr gesegnet hat in den Tagen des Lenzes, als das erste Schwalbenpaar sich einheimste im Dachgiebel des kleinen Hauses an der Amster.
Zu diesem Weibchen schritt nun Wolfgang heim, daß er mit ihm ein glückseliges Jahr schließe und ein neues glückselig beginne. Agatha saß bei ihrem Nähtisch, nähte aber nicht, sondern legte die Hände in den Schoß und blickte träumend auf das Nadelkissen. Aber nicht das Nadelkissen sah ihr geistig Auge, sondern — — o, lieber Leser, wie könntest du verlangen, daß ich wisse, was ein junges Weib, zur Seherin geworden, in solcher Stunde schaut!
Ihr eigener Mann mußte sie wecken, da er die Hand auf ihre Achsel legte, und fragte: „Wie so, Agatha, daß Du mich heute gar nicht gewahrst, wenn ich bei der Thür’ hereinpoltere? Du schläfst ja wie ein Hase — mit offenen Augen!“
Sie ermannte sich rasch aus ihren Träumen, blickte treuherzig zum Manne auf und lächelte.
„’s mag wohl sein, daß das neue Jahr gut anhebt,“ sagte sie dann, und ihre Wangen schimmerten rosig, wie draußen der Schnee im Abendroth.
Es wird ein Kuß gewesen sein, den jetzt der junge Gatte auf die Lippen seines Weibes gedrückt, ein absonderlicher Kuß, dem neuen Jahre vermeint, der Zukunft — dem Kinde.
Und zur Stunde trippelte das alte Zwick-Schusterlein in die Stube; das hatte voran über der Brust das Werkzeugtrühelchen hängen, und hinten über dem Höcker eine große klappernde Traube von Leisten verschiedener Größe und Form — in Holz geschnitzt die Füße der Einwohner von Amsterdorf und Seegrub. Gar Mancher, der auf eigenem Fuße stehen und leben konnte, hatte sich für seinen Fuß eben eigene Leisten anfertigen lassen, und es war daher beim Zwick-Schusterlein nicht richtig, daß es alle Stiefel nach einem Leisten schlage. Aber das harte Tragen! Es war leicht zu errathen, wo diesen Mann der Schuh drückte: hinten auf dem Höcker.
Nun wohl, so rasselte der kleine Alte mit seiner Last zur Thür’ herein, und sagte: „Gewiß Gott zum Feierabend, miteinander! Ich komm’ von der Seegrub herüber, hab’ nur eine Post auszurichten und geh’ gleich wieder. Die alt’ Mutter drüben laßt bitten, wenn’s dem Wolfgang nicht gar zu unhandsam thät sein, daß er heut’ noch ein bissel wollt’ zu ihr hinübergehen.“
Die Eheleute erschraken und fragten gleichzeitig, ob was geschehen wäre, ob sie nicht doch gar krank wäre, die Mutter!
„Auf das kann ich nichts sagen, Sie hat mich durch den Pechölbuben bitten lassen, daß ich’s bei Euch ausricht’. Möcht’ sich nicht schicken, daß ich eine Weil’ nachgefragt hätt’, wegen was, oder warum. Jetzt hab’ ich meine Sach’ ausgerichtet; vergunn’ Euch ein glückseliges Neujahr miteinand und sag’ gute Nacht, Leutel.“
Kaum die letzten Leisten des Schusters zur Thür’ hinausgeklappert waren, sagte der Wolfgang: „Was wird’s jetzt geben? Muß schon was Wichtiges sein, daß sie mich hinüberruft den weiten, schlechten Weg in der Nacht, und in so einer Nacht. Die Mutter verlangt nicht dergleichen ansonst. Arg krank geworden muß sie sein, anders kunnt ich mir’s nicht auslegen. Daß es nur heut’ nicht wär’!“
„Da müßt doch eine alte Kuh lachen, wenn der Wolfgang sich in der Sylvesternacht vor Gespenstern wollt’ fürchten!“ rief das Weib.
„Du bist aber schon gar, Agatha, daß Dir so was kann einfallen. In der Todtenkammer will ich schlafen die heutige Nacht, der Gespenster wegen. Kugelscheiben mit den Todtenschädeln, Gott verzeih’s! — Aber Dich mag ich nicht allein lassen, die heutige Nacht — von wegen dem, was Du vorhin hast gesagt.“
Sie lachte. Damit hätt’s noch lange Zeit. Bis in die Seegrub wäre es nicht ganz drei Stunden, da könnte er leichtlich nach Mitternacht wieder zurück sein; wäre aber nicht vonnöthen, möge sich friedsam ausschlafen in der Seegrub und morgen bei Sonnenschein wohlgetrost nach Hause gehen.
So gut verstand sie das Zureden, daß der Wolfgang den Lodenmantel anzog, den Stock zur Hand nahm und ging.
Es war schon dunkel, als er emporstieg den bewaldeten Bergzug, welcher das Amsterthal und die Gegend der Seegrub scheidet. Das rothe Rad des Mondes ging auf; der Wolfgang warf einen langen Schatten über das Schneefeld hin, und unter seinen Füßen knarrte der Pfad.
— Was es nur geben wird drüben bei der Mutter? Fünfundsiebzig Jahre alt sein, ist eine gefährliche Krankheit. Da rücken sie so an, eins um’s andere, morgen kommt wieder ein neues und man hat seinen Spaß dabei. So Jahre sind wie der Hüttenrauch (Arsenik), den der Roß-Wasti so gern ißt: in rechtem Maße genossen, macht er schön und stark, zu viel bringt Einen um. Die Jahre sind auch so ein Gift.
Als er zur ersten Anhöhe gekommen war, blickte er auf das Dorf hinab, dessen Kirchthurm schon in das Mondlicht emporstand. Die Säge am Bach und das Haus mit der Agatha lag noch im Schatten. Sechzehn Stunden dauert es um diese Jahreszeit, bis die Sonne wieder kommt. Da kann dieweilen viel geschehen im Finstern. Wolfgang, wenn Einer, während Du hinüber zur Mutter gehst, zu Deiner Frau kommt?! Sie ist jung und hübsch, sie wird ihn herzen und küssen, wird ihn lieber haben, als Dich! Du bist zwar noch gar nicht alt, aber etwan kann er noch um ein Erkleckliches jünger sein, als Du, und wenn Du nach Hause kehrst, so wird sie ihn nicht mehr von ihrer Seite lassen, wird ihn an ihre Brust drücken Tag und Nacht..... Du lächelst, Wolfgang, und meinst, das könne schon sein — hättest aber nichts dagegen. Und lieb haben, nicht zu sagen, wie liebhaben wolltest Du den kecken Nebenbuhler, und ihm Alles sein und geben, was an Dir ist, was Du hast und geben kannst. — So eile denn, daß Du bald wieder zurück bist.
Er ging sinnend über die hohe Heide hin, ging durch Wälder und über kahlen, felsigen Grund, wo der Wind allen Schnee weggefegt hatte, und wo auch jetzt eine scharfe Luft ihm Eisnadeln in’s Gesicht säete, daß er kaum im Stande war, die Augen offen zu halten. Endlich war er vor dem großen Kreuze, welches an der Grenze stand, so daß Christus seinen ausgespannten rechten Arm im Gebiete der Amster, den linken im Bereiche der Seegrub hatte. Der Mond war hoch gestiegen und licht wie Silberblick geworden; so sah er über die alten Bäume her auf das Crucifix, mild und ernst, als wollte er sagen: Ich weiß noch eine Zeit, da du hier nicht standest, eine Zeit, da die Erde nichts wußte von einem gekreuzigten Gott. Wenn du heute zusammenbrichst, morscher Holzstamm, so werden sie dich morgen wieder aufrichten — ob eine Zeit kommen wird, daß sie dich, du hehres Bild göttlicher Selbstopferung, nicht mehr erhöhen werden? Und da die Menschheit so tief gesunken sein wird, daß sie das Sinnbild der Aufopferung nicht mehr erfaßt, oder so hoch gestiegen, daß sie seiner nicht mehr bedarf? — Wolfgang, der über das Scharren seiner Säge hinaus bisweilen gern auf den Zeitgeist horchte, hatte häufig ähnliche Gedanken, und so kam es auch, daß er nun, vom Bergkreuze abwärts, im Sinnen über Allerlei den halbverwehten Fußpfad verlor und über die Schneegründe weglos dahinging. Aus dem Thale herauf hörte er schon das Rauschen des Rabenbaches, welcher hoch in den Felsen entsprang und in mehrfachen Stürzen niederbrauste von Hang zu Hang, bis er unten sich als stattlicher Fluß in den Seegruber-See ergoß.
Da Wolfgang seine Richtung genau kannte, so achtete er nicht auf den Fußpfad, sondern eilte flink weiter, um ehestens das Mütterlein zu sehen. Er rüstete sich in Gedanken[S. 399] für alle Fälle, so wie es ja seine Gewohnheit war, das Beste zu hoffen und auf das Schlimmste gefaßt zu sein. Diese Regel ist das gesundeste Kraut gegen den Uebermuth und die Verzweiflung; es wächst auch auf steinigem Boden und mitten im Schnee.
Plötzlich der Tod da. Ein Schritt noch, und der Wolfgang wäre in denselben hineingesprungen. Ein tiefer Abgrund lag vor ihm, er stand an dem äußersten Rande eines Felsens. Umkehren und den ausgetretenen und doch wieder verwehten Fußpfad suchen? Nein. Bei einiger Vorsicht ist im Gehänge der Abstieg leicht zu finden. Er kletterte am Gefelse hinab, rutschte mehrmals im Schnee, schlug dann mit den Füßen etliche Eiszapfen los, wie sie an Abenden von sonnigen Tagen gewachsen waren, wand sich an erstarrten Gesträuchen hin, bisweilen die Ruthe eines Haselnußbusches oder Erlstrauches als Strickleiter benützend; dann stand er auf sicherem Boden still, um zu ruhen. Da wurde er auf ein dumpfes Dröhnen aufmerksam, welches aus dem Gewände zu kommen schien, das ihn umgab. Anfangs glaubte er, es fahre irgendwo eine Schneelawine los, und er suchte sich unter einem Vorsprunge zu schützen. Aber das Dröhnen währte gleichmäßig fort, und Wolfgang bildete sich ein, es bebe davor der Boden. Rathsam fand er es eigentlich nicht, hier so hinunter zu steigen, ohne den Abgrund zu kennen, der wie ein „graues Nichts“ heraufgähnte. Aber, sollte er denn wieder aufwärts klettern mit Lebensgefahr, und im besten Falle den Weg zur kranken Mutter um mehrere Stunden verlängern? — Er stemmte sich auf den Stock und fuhr niederwärts. Im Gerölle ging das Rutschen nicht, wie sonst zur Sommerszeit, da der Boden, auf welchem der Waller steht, sanft vor sich hingleitet; die Steinchen waren fest aneinandergefroren. Um so fröhlicher[S. 400] ging’s über die Schneelehnen. Auf einer solchen ließ sich Wolfgang rasch und mit der kühnen Geschicklichkeit des Aelplers hinabfahren. Als er in eine Mulde kam, wo das Schneefeld sich zu einer kleinen Thalung ausschweifte, fuhr der gute Wolfgang geradeaus in den Boden hinein — und war von der mondbeschienenen Erdoberfläche verschwunden.
Unter der Schneedecke war der Sägemeister in tiefer Finsterniß noch eine Weile über Stein und Sand dahingerutscht, bis ihn ein Felsstück aufhielt. Für den ersten Augenblick konnte er sich nur noch denken: Jetzt hat mich die Erde verschlungen! — Dann war er betäubt.
Allmählich weckte ihn das erschütternde Tosen und der Wasserstaub, welcher aus der Tiefe drang. Er erkannte seine Lage, er hing in der Rabenschlucht über dem großen Wasserfalle des Rabenbaches, welcher zu dieser Zeit hoch oben mit Schnee und Eis eingewölbt war. Sein fahrender Körper hatte das Gewölbe durchbrochen und nun drang der Schimmer der Mondnacht hernieder und zeigte ihm die zuckenden, quirlenden, gischtenden Silberlichter des zu seinen Füßen rasenden Wassers.
„Jetzt heißt’s Obacht geben, Wolfgang, sonst wirst waschnaß!“ sagte er zu sich selber und rückte sich auf seinem Felsenstuhle ein wenig zurecht, daß er nicht weiter rollen konnte, denn hier war das Gerölle nicht gefroren, sondern rieselte fortwährend nieder. Dann überlegte er, wie er diesen durchaus unbehaglichen Verhältnissen wieder entkommen könne, und dabei faßte ihn das Grauen. Emporwärts zu kommen die steile finstere Kluft war nicht möglich, und aus der brausenden Tiefe griffen tausend Arme des Todes herauf. Wolfgang saß still und lehnte sich an die rauhe, triefende Wand und murmelte: Das hätt’ ich nicht gedacht, daß ich die heutige Syl[S. 401]vesternacht beim Wasser zubringen sollte; Andere sitzen beim Wein.
Dann versuchte er’s doch mit dem Aufwärtsklettern; aber er sah, daß er dabei immer tiefer kam, anstatt höher, weil sich um ihn Schnee und Steine lösten. So trachtete er nur wieder mit starkem Arm seinen Felsvorsprung zu erreichen und meinte hernach in seiner Weise: „’s ist überall gut, aber hier ist’s am besten. Will ich halt da sitzen bleiben, bis das neue Jahr kommt; das neue Jahr bringt einen Auswärts (Frühling) mit, der schmilzt mir mein Dach weg; nachher will ich schon hinauskommen. — Nur, daß die Mutter ein Eichtl hart warten wird in Seegrub unten, und die Agatha in Amsterdorf drüben. — O ’s ist hell zum Lachen, daß ich so dumm bin in die Falle ’gangen!“ Es war doch ein Ausruf der Verzweiflung. ’s ist hell zum Lachen, wie ein Mensch auf so schreckbare Art zugrunde gehen kann!
Dann sagte er wieder: „Zugrund’ gehen? Von dem ist ja gar keine Red’. Ich sitz’ da, was fehlt mir denn? Ich rast’ mich aus. Und besinn’ mich. In der Neujahrsnacht macht man sich ja gern ein wenig abseits von den Leuten und denkt nach über Vergangenes und Kommendes. Hätt’ ich nur ein bissel leichter Zeit zum Simuliren; vor mir ist eine sterbende Mutter, hinter mir ein gebärendes Weib. Und der Lump sitzt in der Rabenschlucht und laßt sich’s gut gehen. — Herrgott, rette mich!“
Das Wort schrie er wild in die Felswand hinein; das Tosen des Wassersturzes überbrauste es. Aber der Herrgott hörte es und schickte einen Gesellen. Der guckte mit hellem Auge durch die Oeffnung nieder. Der Mond war’s. Der hüllte mit seinem Dämmerlichte die Schrecknisse erst auf. Die Höhle war wild zerklüftet, aus einer ungeheuren Spalte brach[S. 402] die Wasserfluth in schwarzen, üppigen Wuchten, dann stürzte sie nieder und zerschellte an den Felskanten zu tausend funkelnden Scherben, welche mit neuer Lebendigkeit und Gewalt abwärts schossen in die Untiefe. Von der Höhe hingen abenteuerliche Gestalten in Schneemassen und Eisgebilden nieder und im Nebelstaube schimmerten wunderbar zarte Regenbogenfarben.
„Man sieht was Neues,“ sagte sich Wolfgang. „Nur, daß mich kein Mensch hören kann, wenn sich um Kameradschaft schrei’. Im Traum wär’s mir nicht eingefallen, daß Unsereinem das alte und das neue Jahr in der Rabenschlucht zusammenkommen sollten. Hab’ oftmals das Wort gehört vom Zeitenstrom, jetzt sitz’ ich da und seh’ ihn hinunterstürzen, und mich durchnäßt er mit seinem Thau, bis ich im Frost erstarrt mit hinunterpurzle in’s Wasser. Wenn das der Pfarrer von Amsterdorf thät wissen, das wär’ ihm ein gefundenes Gleichniß auf das menschliche Leben für die morgige Predigt. — Daß nur die zwei närrischen Weiber nicht auf mich thäten warten.“
Noch einmal versuchte er es mit dem Hinanklettern — ohne Erfolg; ein Schneestück fiel von der Wölbung, das ihn schier in den Abgrund geworfen hätte. Er saß wieder auf seinem Stein und drückte sich fröstelnd an die Wand und dachte: „Jetzt wäre für mich die passendste Zeit zum Verzweifeln — es kommt nicht leicht eine bessere mehr. Ich stürz’ mich da hinunter und der Rabenbach tragt mich von selber hinaus zum Seegrub-See. — O, Wolfgang,“ rief er dann, „hast du denn heute deine Morgenandacht unterlassen, daß dir solche Gedanken kommen? Wer wird sich denn umbringen, wenn er so gute Aussicht hat, daß es ohnehin bald vorbei ist! — O Gott, mein Gott im Himmel, allerweg hab’ ich[S. 403] auf Dich Vertrauen gehabt. ’s schaut ganz unmöglich aus, aber Du hast dem Daniel Rath gewußt, wie er in der Löwengrub’ ist gesessen. Wenn Du nur willst, o, Vater unser, der Du bist in dem Himmel!“
Heiße Thränen stürzten ihm aus den Augen, daß er sterben müsse in so jungen Jahren, ohne sein Kind gesehen zu haben.
Da erbarmte sich Gott — jener Gott, den heute die Welt nicht mehr nennen will, weil sie glaubt, daß dessenstatt „Schicksal“, „Zufall“ besser klinge, der aber in dem Herzen und Leben des Volkes noch göttlich waltet, straft und rettet. Dieser Gott des Volkes mit seinen menschlichen Eigenschaften im Superlativ sah in unserer Neujahrsnacht von der Seegrub drei Männer heraufsteigen zur Rabenschlucht. Sie hatten Hauen und Stricke bei sich, denn sie hatten von jeher gehört, daß in der Rabenschlucht ein großer Schatz verborgen sei, der nur in einer Neujahrsnacht, in welche der Vollmond fällt, gehoben werden könne.
Und da dachte Gott: drei Schatzgräber? Die kommen mir just recht mit ihren Werkzeugen, daß sie mir meinen elegisch-humoristischen Sägemeister aus der Rabenschlucht ziehen.
Sie stiegen empor zur felsigen Stelle, deren Ungründe mit Schnee verweht waren, und hörten das Tosen des Wasserfalls. Da sie sich behutsam vorwagten, sahen sie auch das Loch, durch welches der Wolfgang hinabgefahren war, und hörten aus der Tiefe empor die menschliche Stimme. Der erste Gedanke war natürlich: Gespenster! Gespenster sind sonst immer ein Wunder, aber in einer Sylvesternacht an der Rabenschlucht, wo ein Schatz verborgen liegt, sind sie gar kein Wunder. Ein knurrender schwarzer Hund, eine klägliche[S. 404] Stimme, die um Hilfe ruft, oder dergleichen — das ist selbstverständlich. Die Hauptsache ist, sich von derlei nicht abschrecken zu lassen.
Bei näherer Untersuchung jedoch flüsterte einer der Männer: „Keinen Schuhnagel verwett’ ich, da unten steckt schon ein Schatzgräber, der uns zuvor ist kommen.“
„Das wär’ schon der Höllsakra!“ fluchte der Zweite. Aber der Dritte sagte: „Mir scheint eher, da unten ist Einer in der Klemm’, und wollt’ den Schatz gern ungehoben lassen, wenn er selber gehoben wär’!“
Sie redeten eine Weile hin und her, dann rief Einer hinab: „Alle guten Geister loben Gott, aber wenn es ein Mensch ist, so soll er’s sagen.“
Wolfgang sah die Schatten der Köpfe gespenstisch an den mondblassen Wänden gaukeln, verstand aber in dem mächtigen Brausen des Wassers die Worte nicht.
„Probiren wir’s und lassen einmal den Strick hinab,“ rieth Einer von den Dreien, „hängt sich kein Mensch an, so hängt sich der Schatz an.“
„Es kann sich aber auch der Teufel anhängen!“ gab der Zweite zu bedenken.
„Ich glaub’ an keinen Teufel!“ sagte der Eine.
„So?! Hast keine Religion und willst schatzgraben?“
Der Dritte sagte: „Ich glaub’ schon an einen, aber fürchten thu’ ich mich nicht vor ihm. Davor trag’ ich den Gertrudissegen in meine Pfaid genäht.“
So ließen sie den Strick hinab, und da sie merkten, daß unten etwas angelte, stemmten sie sich am festen Boden, daß sie nicht etwa durch den Schnee brächen — und zogen den Sägemeister Wolfgang von Amsterdorf aus der schreckbaren Schlucht.
Als der Wolfgang sah, er wäre befreit, sprang er viele Schritte weit vom Loch hintan und lachte.
Die Anderen fragten ihn, ob er den Schatz habe und bedeuteten, daß er in diesem Falle mit ihnen theilen müsse.
Es brauchte eine gute Weile, bis sie sich verständigten. Der Wolfgang war in der ganzen Gegend als ein gescheiter, respectirlicher Mann bekannt; sie glaubten seiner Darlegung, wie es ihm nicht eingefallen sei, eines Schatzes wegen in die Rabenschlucht zu steigen, sondern wie er sich auf dem Wege in die Seegrub dahin verirrt habe und hinabgestürzt sei. Und nun that einer der drei Männer das herrliche Wort: „Ein braver Mann ist auch ein Schatz, den haben wir gehoben, und jetzt gehen wir heim.“
Sie reichten ihm Schnaps, daß er sich erwärme; sie huben mit ihm auf mondbeschienener Weide ein Ringen an, daß er sich bewege und wieder ordentlich belebe. Dann suchten sie den rechten Weg zur Seegrub hinab und fanden ihn bald. Unterwegs fragte der Wolfgang nach, wie es mit seiner Mutter stände. — Das Weiblein sei im Bett — sonst wüßten sie nichts.
Als Wolfgang zu ihrem Häuschen kam und an’s lichtlose Fenster klopfte, rief drinnen eine Stimme: „Bist Du’s, Wolfl? Ich bin schon wach; steig’ beim Dachthürl herein, die Hausthür’ ist heut’ versperrt, will Dir’s nachher schon sagen, warum.“
Er war gar herzensfroh, daß er sein Mütterchen im gewöhnlichen Zustande fand — zwar mühselig, aber stets heiter.
„Wirst Dir’s nicht denken,“ sagte sie, als er an ihrem Bette saß und beim Aemplein ihr weißes Antlitz mit dem Schlafhäubchen ansah, „wesweg’ ich Dich in der heutigen[S. 406] Nacht herübergeplagt hab’. — Ja, ich muß Dir was sagen, Wolfl — aber gelt, die Agatha ist noch in der Ordnung?“
„Sie laßt Euch grüßen, und weil ich sehe, daß es Euch insoweit gut geht, Mutterl, so will ich wohl gleich wieder heimzu laufen. Lang’ wird’s nicht mehr dauern mit der Agatha.“
„Schau, das hab’ ich mir auch gedacht, und da hab’ ich kein Stündl länger wollen warten mit dem, was ich Dir sagen muß. Wirst sehen, mein Wolfl, was ich Dir für eine falsche Person bin! Weiß recht gut, daß Du das Lotteriesetzen nicht leiden kannst, und so hab ich’s heimlich gethan. Geh’, geh’, die alten Weiber,“ setzte sie bei, „’s ist ein’s wie’s andere. Nu, lachen muß ich auch.“
Und sie lachte und kicherte. Der Wolfgang meinte, daß es für sie wohl gescheiter wäre, sich bisweilen ein stärkend’ Gläschen Wein zu gönnen, anstatt die blutigen Kreuzer in die Collectur zu tragen.
„Und jetzt,“ fuhr sie kichernd fort, „hab’ ich gestern närrischerweis’ einen Terno gemacht.“
Da horchte der Wolfgang auf.
„Hab’ zuerst hell gemeint, der Amtmann foppt mich, wie er mir’s sagt — und richtig ist’s: neunhundert Gulden und noch was dazu. Da d’rin im Bettstroh ist das Geld. — Du zitterst ja frei, Wolfl, hat’s Dich so geschreckt?“
Der Fieberfrost war da. Die Magd wurde geweckt, daß sie eine heiße Brühe bereite. Der Mann trank sie mit Behagen und sagte nichts, wovon der Frost herrühre.
„Jetzt, das ist ein Glück!“ sagte die Alte, „und ich hab’s nimmer ausgehalten und hinübersteigen kann ich auch nicht mehr zu Euch, so habe ich Dich halt kommen lassen. Das Geld nimmst mit; na, Du, das nimmst mit! Was[S. 407] thät’ denn ich’s brauchen, Du Kindisch! — Es ist das Taufgeschenk für Dein Kindel. Du, Wolfl, aber gleich steckst es ein. Das wär’! Thät’st mich bitter kränken. — Und jetzt, wenn Du meinst, daß es daheim nicht mehr lang’ dauern wird, so mach’ Dich wieder auf und thu mir sie grüßen!“
O Mutterherz! mit Dir fängt dein Wolfgang das neue Jahr an. In der Seegrub verließ er Dich, in Amsterdorf fand er Dich. Und als der blasse Mond niedersank und die helle Sonne emporstieg, gesegnet mit einem jungen, blüthenreichen und fruchtbaren Jahre — da drückte der Vater seinen ersten Knaben an’s Herz.
iese Geschichte ist entnommen den Aufzeichnungen eines vielgeprüften Mannes. Sie erzählt von dem Niedergange eines zweifachen Menschenglückes, giebt aber Kunde von dem Siege des Herzens und weist uns schließlich mit wenigen schlichten Worten eine große That der Selbstaufopferung, die uns versöhnt. — In den Papieren eines Gutsbesitzers steht Folgendes zu lesen:
Ich hätte studiren und mich dem Richteramte widmen sollen. Aber ich habe es vorgezogen, ein einfacher Landmann zu bleiben. Ein stilles, arbeitsames Leben zu führen, war mein Sinn. Ich wollte nicht Menschen richten und nimmer von Menschen gerichtet werden. Der Landmann lebt und wirkt an den Stufen des Thrones Gottes, und geradewegs von Gottes Hand empfängt er den Lohn oder die Züchtigung.
Ich erwarb mir ein Gut auf stillem Gelände und führte viele Jahre lang ein glückliches Leben. Ich hatte ein einziges Kind — einen Sohn, und ich war in dem Knaben selbst wieder ein Kind. Es ist wunderbar zu fühlen, wenn man sich ein zweitesmal selbst wieder heranreifen sieht zur Welt, zum Leben, zu all’ den großen Freuden, hinter denen aber die Enttäuschungen schlummern, wie die dürren Blätter des Vorjahres unter dem blühenden Rosenstrauche des Lenzes. Das[S. 409] Kind sieht nicht die dürren Blätter, es sieht nur die hellen Rosen.
Mein Sohn Alfred besaß einen lichten Kopf und ein gutes Herz; will nicht verlangen, daß man es mir, dem Vater, zuversichtlich glaube — aber Alle, die den Knaben kannten, haben es auch gesagt. Sie hatten ihn lieb und hießen ihn einen prächtigen Burschen.
Ich ließ ihn studiren. Er wählte die Technik, die heutzutage die Welt beherrscht, weil ihr der Geist der Wissenschaften ein treuer Diener ist. Alfred war mit Leib und Seele seinem Gegenstande ergeben. Dabei besaß er großen Ehrgeiz, der — wie wohlthätig dieser Charakterzug auch bei jungen Leuten wirken mag — mir doch bei meinem Sohne fast zu überwiegend schien. Jahrelang war mir zu den Vacanzen der Junge mit den glänzendsten Vorzugsclassen nach Hause gekommen, und ich sah Freude in seinen Augen.
Einmal aber, als die Schulzeit schon vorbei war, kam er nicht. Es ging eine Woche vorüber, es ging eine zweite Woche vorüber — Alfred kam nicht nach Hause. In der dritten Woche erst erhielten wir seinen Brief, der folgendermaßen beginnt:
„Liebe Eltern!
Eure etwaige Besorgniß um mich zu zerstreuen, theile ich Euch mit, daß ich diese Zeit in meiner Studirkammer zubringe, um die zwei Vorzugsclassen zu erlangen, die diesmals meinem Semesterzeugnisse entgangen sind u. s. w.“
Der kindische Bursche! Unseres Dorfbaders Sohn hatte nicht Eine Vorzugsclasse in seinem Bogen, noch weniger — dünkt mich — in seinem Kopf, und er war doch heimge[S. 410]kommen zu Muttern und genoß durchaus vergnügliche Vacanzen. — Will damit aber nichts Mißgönniges gegen den Nachbar sagen.
Als Alfred das neunzehnte Jahr erreicht hatte, und vor Vollendung seiner Studien nach Hause kam, da ging unser Unglück an.
Der Gerichtsschreiber unseres Kreisstädtchens hatte eine Tochter, ein hübsches — ja ein schönes Mädchen, wohl ein klein Theil älter als mein Alfred — aber ein bißchen leichtsinnig. Bei Frauen ist Leichtsinn ein noch größerer Fehler als bei Männern.
Von Natur aus war sie ein herzensgutes Mädchen; aber bei den kümmerlichen Verhältnissen ihres Vaters hatte sie keine Erziehung genossen, keine Arbeit gelernt — war keine Häuslichkeit inne geworden. Als des Gerichtsschreibers Tochter wußte sie, daß sie zu der haute volée des Städtchens gehöre; sie war den Vergnügungen ergeben und fehlte auf keinem Balle. Rosa hieß sie; Rosabella wurde sie geheißen. Sie wurde gar viel umschmeichelt, von lockeren Gesellen umworben, aber redliche Freier fanden sich unter ihren Verehrern nicht viel.
Einer jedoch war, ein braver, redlicher Mensch; es war mein Sohn. Alfred war in das junge Weib vernarrt bis zum Scheitel seines Lockenhauptes. Er vergaß in den steten Gedanken an sie die Freuden der Vacanzen, die er sonst so unbefangen und glücklich zu genießen pflegte. Wie ein Träumer ging er herum. Und von Rosa hörte ich, sie zöge sich zurück von ihren Anbetern und wäre kleinlaut und blasser als sonst. Und wenn zufällig von Alfred Baumgartner die Rede sei, so werde sie roth wie ein Hagenröslein; ihr Schlaf wäre fieberhaft, in ihren Träumen rufe sie ungezähltemale den Namen Alfred aus.
Mit meinem Sohne war’s nicht viel anders. Ich sah die Gefahr, die da aufstieg, und warnte den Burschen mit tiefem Ernste.
„Warum?“ rief Alfred einmal, „soll es nicht sein, weil sie eines armen Beamten Kind, oder weil sie um etliche Monate älter, als ich, oder weil ich noch keine Stellung habe, um zu heiraten?“
„Mein Sohn,“ sagte ich, „zu fragen hat der Vater. Ich bin Dir keine Begründung meiner väterlichen Fürsorge schuldig. Ich verstehe die Dinge besser als Du, das kannst mir getrost glauben. Ob Du es für nöthig erachtest, schon an einen eigenen Hausstand zu denken, das ist Deine Sache. Die Tochter des Gerichtsschreibers aber ist kein Weib für Dich.“
Alfred entgegnete kein Wort und ging davon.
Er ging von nun an noch einsamer und träumerischer umher.
Mich dauerte er sehr, der arme Junge; ich kann mir’s zum Theile denken, wie es sein mag, wenn man befangen ist in Liebeswahn, und das junge Blut wogt wie ein Alpensee im Frühlingsföhn, wenn die Lawinen stürzen, und man ist nicht mehr Herr seines Herzens, und hat kein Anrecht in seinem eigenen Haupte — am Steuerrade der Vernunft.
Auf dem Wege in das Kreisstädtchen wurde Alfred oft gesehen.
Und eines Tages kam er nicht zurück in unser Haus. Verschwunden war er aus der Gegend, und verschwunden mit ihm die Tochter des Gerichtsschreibers.
Ein Brief ohne Poststempel kam mir zu; der lautete, wie folgt:
„Mein lieber, guter Vater!
Ich bin stets ein gehorsamer Sohn gewesen, und Euch Ehre zu machen, war mein Bestreben. So soll es auch in Zukunft sein. Aber ich bin erwachsen, und ich glaube das Dichterwort: Des Herzens Neigung ist des Schicksals Stimme. Was da kommen mag, ich muß dieser Stimme folgen. Euch, mein Vater, entbinde ich jeglicher Verantwortlichkeit. Ich verbleibe immerdar Euer dankbarer Sohn
Alfred.“
Mir zitterten die Glieder, mir vergingen die Augen; ich riß den Brief mitten auseinander. — Wer hat Dich so sehr verführt, Du armes, Du gutes Kind? — Und kennst Du nicht auch ein zweites Dichterwort: Der Mensch ist seines Schicksals Schmied? — Und mich, den Vater, willst Du der Verantwortlichkeit entbinden? Alberner Bursche! — Es kann hier nicht gefragt werden, ob Du großjährig bist oder nicht; das aber sei versichert: Du hast einen Vater, der wird Dich vor Verderben bewahren, so lange es möglich!
Sogleich eilte ich, umfassende Anstalten zu treffen, daß den Flüchtlingen nachgestellt werde. Ohne Erfolg; die jungen Leute waren verschwunden. Der Gerichtsschreiber wußte so wenig Auskunft und Rath, als ich. Meine Gattin wurde bitterlich krank; ich hielt mich aufrecht, aber in meinem Kopfe ging’s wirr um. Das einzige Kind verlieren, auf solche Art verlieren, das ist ein Schlag!
Ich konnte das Beginnen meines Sohnes nimmer begreifen. Und hätte er sich auch für den Augenblick von jugendlicher Leidenschaft hinreißen lassen — nicht einmal dieses hätte ich ihm zugetraut — so müßten sein gutes Herz und sein vernünftiger Kopf denn doch endlich die Oberhand gewonnen haben.[S. 413] Es dünkte mich gar nicht möglich, daß der Junge, sonst voll Anhänglichkeit und Liebe zu seinen Eltern, nun plötzlich von uns fortrasen sollte und in sein Verderben. Es geht eine Sage von „gehexter Lieb’“, schier hätte ich daran geglaubt, nur um die Zuversicht an mein Kind zu retten.
Dann wieder dachte ich, Alfred werde das leichtfertige Mädchen längst von sich gewiesen haben, und nur Trotz und Scham würden ihn noch abhalten, heimzukehren. Aber auch Rosa blieb verschwunden. — Es vergingen Monate; sie kehrten nicht heim und blieben verschollen.
Das Ungemach kommt nie zu einzeln; es folgte ein zweites, freilich bei weitem linder, als das erste, aber ich erschrak doch davor. Ich wurde um jene Zeit zu den Geschwornen gezogen. Meine Angst vor dem Richterstuhle, und sollte ich auch selbst darauf sitzen, war nicht geschwunden, war sonderbarerweise noch gewachsen. Aber das Gesetz, das mich rief, war einmal da.
Der Mensch richte nicht über den Mitmenschen! So richte Gott! Des Volkes Stimme aber ist Gottes Stimme! — Nach diesem Grundsatze hat der Gerichtshof die gewaltige Verantwortlichkeit von sich ab- und auf die Schultern des Volkes gewälzt.
Andererseits jedoch war es mir erwünscht, daß mich mein Los auf mehrere Wochen von der Gegend fortrief in die ferne Hauptstadt. Eine Zerstreuung, wie ich sie bedurfte, konnte nur in der Erfüllung einer ernsten, schweren Amtspflicht zu finden sein. Auch hatte ich des Bedauerns und Mitleids der Leute genug; derlei Theilnahme war mir endlich fast so lästig, wie die halbversteckte Schadenfreude Anderer, daß ich reicher Mann mit der gepachteten Moral, wie sie sagten, einen Lumpen zum Sohne und keinen Erben hätte.
Der erste Fall, über den wir Geschworne den Wahrspruch zu fällen hatten, war gleich von seltsamer Natur. Ein junger Mann, von dem vorläufig nichts zu erfahren gewesen war, als daß er Otto Hofer heiße, hatte seine Geliebte ermordet. Es sollen viele mildernde Umstände vorliegen, hieß es, und der Fall gehöre eigentlich in das Bereich der Selbstmorde.
Die Morde und Selbstmorde mehren sich heutzutage in wahrhaft erschreckender Weise; ich war entschlossen, ein schweres Schuldig zu fällen. Wohl kam mir in den Sinn: Sei milde! kennst Du doch die Wege nicht, die Dein eigener Sohn wandelt: — das war nicht Gottes Stimme, denn Gott, der Vater aller Wesen, richtet nach strenger Gerechtigkeit seine entarteten Kinder. Freilich hätte schließlich selbst Gott nicht das Recht, zu richten, denn seine Geschöpfe sind so, wie er sie geartet hat, und seine Allweisheit, die in die Zukunft sieht, hätte den Fall des schwachen Wesens voraussehen müssen, noch ehe dieses erschaffen war.
So spricht in uns das Schuldbewußtsein. Hätte ich nicht den elenden Sohn im Herzen getragen, ich hätte so gottlos gewiß nicht gedacht. So war ich gleichsam jetzt der Mitschuldige aller Missethäter, da ich nicht sowohl diesen, als vielmehr Gott die Schuld gab an ihrer bösen That; denn ich vertheidigte sie ja im Gedanken und klagte den Herrn an. Und ich sollte auf dem Richterstuhle sitzen?!
Ich zitterte wie ein Verbrecher vor dem Eintritt in den Gerichtssaal.
Da kam mir in der letzten Stunde vor dem Beginne der Schlußverhandlung die Weisung zu, ich sei in diesem Straffalle als Geschworner abgelehnt — abgelehnt von dem Angeklagten selbst.
Ich war überrascht und sann nach, ob das Rücksicht oder Mißtrauen sei, und was den Mörder nur veranlassen konnte, gerade auf mich zu verzichten. Wie ich harmlos war!
Da aber mein Interesse für den Fall schon einmal erweckt war, so ging ich doch in den Gerichtssaal und setzte mich unter das zahlreiche Publicum.
Alles war gespannt und flüsterte, erging sich in Vermuthungen und Behauptungen, und man verfluchte den Mörder, noch ehe man ihn sah. Besonders die anwesenden Frauen urtheilten strenge. — „Die Geliebte zu ermorden!“ sagte Eine in lebhafter Entrüstung, „die eigene Geliebte! Entmenschteres kann es nicht mehr geben!“ Die so sprach, war dieselbe Frau, welche ich einige Abende früher im Schauspielhause bei „Romeo und Julie“ bitterlich schluchzen gesehen hatte.
Eine zweite Dame meinte: zu einer That, wie die von dem heutigen Angeklagten begangene, könne nur die reinste und glühendste Liebe fähig sein, die Vereinigung im Tode finden will, wenn solche im Leben vergeblich gesucht werde.
„Na, wir sind ja nicht im Theater,“ antwortete eine streng sittliche Nachbarin ärgerlich, „wo kämen wir hin auf der lieben Welt, wenn die Leut’ solche Ansichten hätten!“
Ich meinte schier dasselbe, enthielt mich aber jeder Aeußerung.
Endlich wurde der Angeklagte mit geschlossenen Händen von zwei bewaffneten Gerichtsdienern vorgeführt. Mir verging das Augenlicht.
Der Angeklagte war mein Sohn. — — —
Er war blaß, gedrückt, aber ruhig. Er hatte in einer kurzen Wendung sein Angesicht gegen den Zuschauerraum gerichtet; ein Blick seines mattleuchtenden Auges war auf[S. 416] mich gefallen. Ein leises Zucken — ich merkte es wohl — ging durch seine Gestalt; dann aber war er wieder gelassen und wendete sein Angesicht nicht mehr in die Richtung gegen mich. — Ich weiß heute noch nicht, wie es mir möglich war, mich zu sammeln. So sah ich mein Kind wieder. Doch, das konnte ja nicht der des schweren Verbrechens Angeklagte sein; der Mörder hieß anders. Oder hatte er den falschen Namen gewählt; um mich zu schonen? Wie sollte das nützen! In der Stadt — gleichwohl diese ziemlich weit von meinem Gute entfernt lag — war er ja doch nicht unbekannt. Die amtlichen Erhebungen waren rasch vollzogen worden und der Staatsanwalt nannte laut — daß mir der Grund des Herzens erbebte — den Namen Alfred Baumgartner: angeklagt des Mordes im Gasthause zum „Pelikan“ am Morgen des 18. Mai 18.. an einem zwanzigjährigen Mädchen, Namens Rosa Weching, durch einen Schuß verübt, nachdem er Letztere als seine Geliebte aus ihrem Elternhause zu Lehnbrück entführt hatte.
Meine Nebensitzenden, die mich kannten, wollten mich hinausführen, da mir unwohl sein müsse. Ich dankte und trocknete mir die Stirne mit dem kühlen Sacktuche. Und ich habe der Verhandlung beigewohnt. Es war das Schrecklichste in meinem Leben. Gewiß, die blutige That wurde doppelt gesühnt — an ihm, an mir.
Die Verhandlung verlief rasch; Alfred war in Allem geständig. Der Staatsanwalt trug ein „Schuldig zum Tode“ an. Mehrere der Geschwornen sah ich mit dem Kopfe nicken.
Der Angeklagte saß bewegungslos wie ein Steinbild auf der Bank. Der Richter fragte ihn, ob er etwas zu bemerken habe, oder ob er jegliche Verantwortung dem Vertheidiger überlassen wolle.
Da erhob sich Alfred von der Armensünderbank und hub an zu sprechen.
Ich kann kein Wort davon vergessen.
„Ihr Herren Richter,“ hub er an, „ich will nicht rechten um mein Leben; das — ich wußte es — war verfallen, ehe ich in dieses Haus geführt wurde. Das Leben ist mir die größte Last, und was mein Vertheidiger zu meinen Gunsten auch sagen mag, Ihr gerechten Richter, ich bitte Euch, verurtheilt mich zum Leben nicht! Die Schuld ist ja der Uebel größtes und ich bin schuldig geworden; — so endet meine Qual! — Aber auf meinen Vater werfet keinen Stein, er hat’s echt mit mir gemeint — ich hab’s früh genug erkannt. Doch, wer vermag seinem Verhängnisse zu entgehen?“
„Pah, Verhängniß!“ unterbrach ihn Einer der Geschworenen, „der Glaube an das Verhängniß ist ein unselig’ Ding und — eine leichtfertige Ausrede.“
„Ihr Alle säßet da in tiefer Schuld!“ fuhr der Angeklagte fort, „hätten Euch das Temperament und äußere Verhältnisse so mitgespielt, wie mir. — Ich wußte, meine Liebe zu Rosa würde den Frieden meines Hauses zerstören; sie wieder wußte, daß sie für meine Verhältnisse keine Hausfrau sein könne. Und wir mußten uns doch lieben. Außer uns ist Niemand dadurch zu Schaden gekommen. Und schließlich: auch wir selber nicht. Wir haben das kurze Glück einem langen, freudenlosen Leben vorgezogen. Soll ich sagen, daß unsere Liebe wahr und heiß gewesen? Ich mag keine Rührscene geben, denn Thränen sind hier nicht am Platz, aber fragen möchte ich Euch Alle: gab es für uns einen andern Ausweg, als den Tod? — Ihr wißt es ja, daß wir, ich und sie, beschlossen, miteinander zu sterben. Ihr habt es in den Briefen gelesen, die wir vor der That an die Unsern noch[S. 418] geschrieben. Wir haben sie versiegelt auf den Tisch gelegt; wir haben mit Ueberlegung und Ruhe gehandelt und leichten Herzens. Das Leben ist der Güter höchstes nicht!“
„Die Gerichtsstube ist kein Declamationssaal!“ rief ein Herr von der Tribüne.
„Ihr staunt und meint, der dem Tode Geweihte habe noch Lust zu Phrasen. Unsere Liebe war groß genug, das Wort zu begreifen. — O, hätte ich doch mit ihr sterben können! Wer mich daran gehindert, der hat mich in den Jammer gestoßen. — Wißt es noch, wie es war. — An meiner Brust liegt ihr Haupt; sie lächelt, sie mahnt, sie bittet, sie fleht mich an, den Entschluß auszuführen. Eine Minute vor ihr wäre ich gern gestorben; doch dünkte mir das zu feige, zu rücksichtslos für meine Braut. Ich will kurz sein, wie die That kurz war, und Euch gern verschonen mit der Beschreibung der letzten Augenblicke — die mir die größten meines Lebens waren. Rasch sende ich die Kugel aus der Doppelpistole in ihr Herz. Sie sinkt lautlos hin, während ich die Waffe gegen meinen Leib richte. Da versagt der Schuß, und mittlerweile eilen die Leute herbei und führen mich davon. — Und jetzt nannten es die Leute einen Mord und mich rissen sie vom Tode weg, um dem Tode mich zuzuführen. Wohlan, sie haben recht; das aber sage ich laut: Die durch mich fiel, aus Liebe habe ich sie getödtet. Jetzt, Ihr gerechten Richter, thut an mir desgleichen.“
Die Hände gefaltet, sank er nach diesen gebrochenen Sätzen zurück auf die Bank.
Darauf erhob sich der Vertheidiger, und seiner langen Rede kurzer Sinn war der:
Der unglückliche junge Mann gehöre nicht in das Criminal, sondern in das Irrenhaus.
Nach all’ dem verließen die Richter und Geschwornen ihre Sitze und gingen in ein Nebengemach, um zu berathen. Ich erhob mich auch und ging hinaus.
Am Thore hörte ich eine Stimme: „Das ist sein Vater, der Tyrann, auf den fällt das Blut!“
Ich sah nicht um; an der Treppe brach ich zusammen.
Als ich wieder zum Bewußtsein kam, waren viele Leute um mich, und Mehrere riefen mir zu, ich solle getrost sein, mein Sohn sei freigesprochen worden.
Daß sie ihn dem Irrenarzt übergaben, das erzählten sie mir nicht.
Ich erfuhr es bald, und ohne ihn noch einmal zu sehen, fuhr ich auf mein Landgut zurück. Das geschwätzige Zeitungsblatt, welches gleichzeitig mit mir zu Hause anlangte, vernichtete ich, ehe es meiner Gattin zu Gesicht kam. Und jetzt bewachte ich meine gute Hausfrau, daß kein fremder Schritt und keine fremde Zunge in’s Haus drang, um ihr das schwere Unglück laut zu machen. Ich hätte gern meine Qual an ihrem trauten Herzen ausgeweint — aber ich wagte es nicht, in ihr zartes, reines Gemüth die ganze Fülle des Jammers zu gießen. Allstündlich blickte sie zum Fenster aus, hoffend, das Nahen ihres einzigen Kindes zu sehen. Mich hat sie mit schwermuthsvollen Augen oft angeblickt; — aber kein Wort der Klage und der Hoffnung hat sie mir gesprochen. Und ihre Haare begannen rasch zu bleichen.
Da habe ich mich wohl oft zurückgezogen in den einsamsten Ort unseres Gehöftes und habe bitterlich geweint. Geweint über das liebe verlorene Kind; geweint über die unendliche Pein, die ein irrendes Kind dem Elternherzen bereiten mag....
Nach mehreren Monaten erhielten wir folgendes Schreiben aus der Hauptstadt:
„Liebste, allerliebste Eltern!
Sie haben mich aus der Anstalt entlassen und behaupten, ich wäre geheilt. Ich weiß nicht, wovon. Da ich leben muß, so will ich zu leben neu anfangen und in einem neuen Lande. Den Heimatsboden kann ich nicht mehr betreten. Meine Eltern, ich flehe Euch an, kommet auf einen Tag zu mir in die Stadt. Mein Vater, meine Mutter, es sehnt sich Euch zu sehen Euer Sohn
Alfred.“
Und als ich nun meinem Weibe Alles mittheilen wollte, sagte sie leise, sie habe ja längst Alles gewußt.
Wir haben ihn aufgesucht, er war völlig stumpfsinnig, aber unter einem heißen Thränenstrom hat er um Verzeihung gefleht für die Kümmerniß, die er uns angethan.
Gott weiß es — wir haben ihm verziehen.
Ferner bat uns Alfred, wenn wir noch einige Liebe gegen ihn haben könnten, um dieser Liebe willen ein jüngeres, noch nicht erwachsenes Schwesterchen der armen Rosa erziehen zu lassen oder selbst zu erziehen. — Wir haben ihm auch diese Bitte gewährt; es ist gewiß sein Gewissen dadurch erleichtert worden.
Dann hat unser einziger Sohn von uns Abschied genommen und wir sind allein mit unseren grauen Haaren heimgekehrt in das stille Landhaus.
Das kleine Mädchen des Gerichtsschreibers haben wir als unser Kind angenommen. Wir hegen und pflegen dieses Kind mit dem ernstesten Streben, es vor Leichtsinn zu wahren,[S. 421] es vor allen Leidenschaften des Herzens zu hüten und eine echte, schöne Frauenseele in ihm heranzubilden.
Es ist unser einziges Kind.
Alfred war in’s Ausland gezogen. Bei einer Flußregulirung hatte er Arbeit gefunden. Nicht lange darnach war er bei einem Floßunglück, wobei er zwei Menschenleben rettete, zugrunde gegangen.
u Kleiner, dort! Den Crispin mein’ ich.“
Der Katechet rief’s, der kleine Crispin erhob sich.
„Du bist ein braver Bub’, geh’, sag’ mir einmal: was ist die Todsünde?“
„Die Todsünde ist eine schwere Uebertretung des göttlichen Gesetzes.“
„Und was bewirkt sie?“
„Durch die Todsünde wird die Seele des geistigen Lebens, das ist der heiligmachenden Gnade Gottes beraubt, und der Sünder wird des ewigen Todes schuldig.“
„Schön!“ sagte der Katechet, „das geht, wie das Vaterunser. Komm’, Crispinus, hol’ Dir Deinen Fleißzettel. Ich weiß, Du kannst mir auch die sieben Hauptsünden, die vier himmelschreienden und die neun fremden —“
„Alle kann ich, Herr Katechet.“
„Recht brav. Nun merket es wohl, meine lieben Kinder: wer in der Gnade Gottes stirbt, der kommt in den Himmel, und wer in der Todsünde stirbt, der fährt in die —“
„Hölle!“ ergänzen die Kinder.
Etliche sind dabei, die nehmen sich vor, in der Gnade zu sterben, denn in die Hölle kommen mögen sie nicht. Und[S. 423] der Crispin schon gar nicht, der kennt das Feuer von seiner Mutter Kochherd, und den Teufel vom Herrn Katecheten; deswegen der Crispin schon gar nicht.
Das Julchen sitzt ebenfalls in der Schulbank, das reckt zwei Finger empor.
„Ja, Juliana, kannst Du auch was?“
Das Mädchen erhebt sich und sagt: „Meine Mutter, die meint halt, wer mit dem lieben Gott gut ist, der braucht sich vor dem — vor dem —“
„Teufel —“
„Nicht zu fürchten.“
Das Mädchen spricht lieber von Gott, als vom — Andern. —
So in der Schulbank. Und später? Später begiebt sich eine grauenhafte Geschichte.
Die klein waren, wurden groß. Der Crispin besonders groß und stark. Er hat eine gute Erziehung genossen, das sieht man schon von weitem. Er kann ein „Betbüchel“ brauchen, und den Katechismus weiß er auswendig. — Was Gott erschaffen, das ist gut und wünschenswerth, sagt er; und das Weibervolk hat auch Gott erschaffen. Und giebt es schon närrisch ein sechstes Gebot, so giebt es auch ein Sakrament der Buße, und im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der Buße thut, als wie — kurz, er hat was gelernt.
Dem Julchen, das ja ebenfalls groß und schön und auch gut geworden war, erzählte er eines Tages unter dem Hollunderstrauch die Geschichte von der Magdalena.
„Geh’,“ gab ihm das Mädchen zur Antwort, „schlecht werden und dann wieder brav werden? Da bleibt Eins doch lieber vom Anfang weg brav.“ Und lief davon.
Unterwegs begegnete ihr Franz, der junge Wachszieher. Mit dem schwätzte sie schon länger. Der war fein, pflückte ein Vergißmeinnicht ab, steckte ihr’s an den Busen: „Sollst auf mich denken.“
„Wesweg’?“
„Schau’, weil ich Dich gern hab’; glaubst mir’s, oder nicht, zum Fressen gern.“
„Das kunnt Jeder sagen.“
„Freilich, sagen kann’s Jeder; und wenn Du bei mir im Zweifel bist, so kommt’s nur auf’s Probiren an.“
„Probiren thun die Frötter, geräth’s, so thun sie’s öfter.“
„Bei so einer ernsthaften Sach’ kunnt’st auch gescheiter reden, Juliana. Gottswahr, ich hab’ Dich gern! Schau’, ich heb’ meinen Finger gegen Himmel.“
„Jesses, Franz, was hebst denn an!“ schrie das Mädchen erschrocken und drückte ihm den gehobenen Arm niederwärts. „Jetzt will er Gott anrufen zu einer Sünd’!“
„Dich lieb haben, ist denn das eine Sünd’?“
„Zwischen uns Zwei’n wohl, weil ich weiß, wie Du’s meinst.“
„Wie mein’ ich’s denn, möcht’ ich wissen! Heiraten will ich Dich.“
„Na, eben d’rum. Und das thät’ die Sünd’ sein. Ich hab’ nichts, und ich denk’, Du hast auch nicht viel mehr. Auf den Bettelstab heiraten!“
„Ich hab’ mein Handwerk gelernt und weiß von keinem Bettelstab.“
„Wie der Will! Aber kein Jurament leg’ mir nicht ab, wo Du noch nicht weißt, was Du halten kannst. Magst ja sagen, was Du willst, nur den Herrgott mach’ Dir nicht zum Feind!“
„Wär’ doch kein rechtes Jurament gewesen,“ meinte der Bursche, „dazu gehören Kerzenlichter und ein Crucifix.“
„Freilich, die Kerzenlichter sind dem Wachszieher allemal das Wichtigste. Ich bin halt anderer Meinung: Ein Wort gehört dazu und ein Crucifix. Das Crucifix, mußt wissen, Franz, das hast nicht weit zu suchen. Dort steht ein Tannenbaum, schau’ ihn an, er steht schnurgerad’ zum Himmel auf und reckt die Arm’ kreuzweis auseinander. Willst noch ein Licht dazu, dort brennt schon ein Sternlein am Firmament.“
„Dirndl, Du bist aber schon gar!“
„Hast mich gleich gern, Du herzensguter Bub’, so rufe desweg’ nicht Gott an; er hört es schnell und schreibt Dein Wort ’leicht mit dem Blitzstrahl an’s Firmament. Wer löscht es aus?“
„Stehen soll’s bleiben!“
„Ja, wenn der Mensch allemal Herr wär’ über sich selber! Ihr Mannsleut’ seid es am wenigsten. — Franz, nur den Herrgott mach’ Dir nicht zum Feind!“
Nach einem Weilchen entgegnete der Bursche: „Bringst es denn über’s Herz, Juliana, daß Du mich so in den Erdboden hinein predigen kannst?“
„Du wachst mir schon wieder heraus!“ lachte das Mädchen. „Mach’ nur kein so hantiges Gesicht. Geh’, gieb mir die Hand! — So. Bist halt doch mein lieber Narr. Behüt’ Dich Gott! Und jetzt geh’ heim.“
Dann gingen sie auseinander.
Als Julchen auf ihren Hof zurückkam, hob wieder Einer den Arm, aber nicht zum Jurament, sondern zum Schlage. Der Bauer war’s, der Steghofer, bei dem das Mädchen[S. 426] diente. Sie war ein Viertelstündchen über die Zeit ausgeblieben.
Der Steghofer — die Leute kannten ihn ja und wissen es noch heute recht gut wie er’s trieb — war ein roher, jähzorniger Mensch; das hat selbst Crispin, das einzige Kind des Hauses, erfahren. Der Himmel hatte dem Manne die größte Gnade versagt; Crispin war nur ein „angenommenes“, ein Stiefkind. Indeß war es allbekannt, daß Crispin der eigentliche Herr des Hofes sei, daß er nach Verzichtleistung oder nach dem Ableben des Alten die Wirthschaft ganz und gar übernehmen werde. Wenn der Bursche trotzdem von dem Steghofer behandelt wurde, wie der niedrigste und verhaßteste Knecht, so lag die Ursache dafür einzig nur in der zuwideren Wildheit des Bauers, der stets was zu verfluchen und zu prügeln haben mußte. Die Mutter war todt. Leser, in dieser einen Nachricht hast Du den Ursprung zu suchen des Schrecklichen, das geschehen wird.
Die Mutter war todt. Die Güte und die Liebe war aus dem Hause getragen, die stets Schlichtende, Versöhnende, willig Duldende war aus dem Hause getragen, noch ehe der Knabe ihren fraulichen Einfluß auf ihn erfahren hatte. Die Willkür, die Leidenschaftlichkeit und Rohheit seines Stiefvaters war sein Elend und sein Vorbild geworden. Aber schlauer war der Junge, als wie der Alte. Er wußte, was der Alte wollte — der Alte wollte viel! Er sah, was der Alte erreichte — der Alte erreichte nichts. Mit Poltern und Schlagen geht es also nicht; man muß es daher viel feiner machen....
Der Alte verfluchte den Jungen laut; dieser jenen still. Letzteres ist gefährlich. Anfangs vertraute Crispin seine Bitterkeit dem Julchen. Dieses sagte, zu ändern wäre es nicht, so[S. 427] solle er darin seinen Mann zeigen, daß er gelassen ertrage, was zu ertragen sei.
„Auch die Prügel?“
„Die halte Dir vom Hals, aber gieb sie nicht zurück; Crispin, nur das nicht. Dieselbe Hand, die den Vater, die Mutter schlägt, hat Gott in Ewigkeit gegen sich.“
„Du hast recht, Julchen, schlagen werde ich nicht.“
Die Jahre waren da und der Crispin wurde Soldat. Draußen in der Welt giebt es viel zu sehen und zu hören, und Menschen aller Gattungen laufen durcheinander und sagen ihre Gedanken, ihre Gesinnungen.
„Luderleben genießen!“ schreit der Eine, „im Himmel giebt’s lauter Betschwestern, da mag ich nicht sein, in der Höll’ finde ich alle lustigen Kameraden wieder.“
„Himmel! Hölle!“ ruft ein Anderer, „lauter Geschwätz. Hin ist hin.“
Was nützt’s, wenn ein Dritter predigt: „Auf Himmel und Hölle bauen nur gemeine, selbstsüchtige Creaturen. Das Gute ist gut, auch wenn es keinen Lohn findet; seiner — des Guten selbst willen — wird der echte und edle Mensch dasselbe üben, und seinen Lohn nur in dem Bewußtsein suchen, Gutes gethan zu haben.“
Gut gemeint vom Dritten auf jeden Fall. Aber was nützt’s einem Menschen wie dem Crispin?
Der Crispin, als er das gehört hatte — bei einer Feierlichkeit, vom Festredner war es gesagt worden, die Militärbande hatte hierauf Musik gemacht, der Crispin das Clarinett geblasen — der Crispin also dachte und blies es in sein Instrument hinein: „Schau’, da hat’s wieder Einer gesagt, das man sich herausnehmen kann: es giebt nichts auf der andern Seiten. Ist schon recht, weiß ich, was ich auf dieser zu thun hab’.“
Jetzt trifft die Nachricht ein, der Steghofer sei schwer erkrankt. Vor Freuden darüber bewirthet der Crispin den Boten bis auf seinen letzten Pfennig. Nun wird er bald Herr im Steghofe sein. Die Dienstzeit vergeht.
Wie der Crispin heimkommt nach Altendorf, findet er Verdruß; sein Stiefvater ist wieder gesund, ist trotziger als vor und eh’.
Als der Bursche das saure Gesicht macht, fährt der Alte auf ihn ein: „Dir ist Einer zuviel im Steghof!“
„Das will ich nicht leugnen,“ erwidert trotzig der Soldat.
„Ja!“ lacht der Bauer — seine Stimme ist aber doch schon heiser — „der Bader hat den Geistlichen schon angeredet, wegen meiner letzten Oelung, der Todtengräber hat schon nach dem Maß gefragt. Hin worden bin ich nicht. Schon Deinetweg’ nicht, Du schlechter Lump! Dir weich ich nicht, gleichwohl Du schon lang’ Deine Kuh auf meinem Grabwasen möchtest weiden.“
Crispin ging dem Alten aus dem Wege. Er knirschte, bohrte die Nägel seiner Finger in das eigene Fleisch. — Soll er denn sein Leben verwarten und Knecht sein, wo doch das Anrecht da ist, auf Haus und Hof! — Er möchte heiraten: er möchte Herr sein. Er wird sich selber helfen.
Der Wachszieher-Franz war Crispin’s Kamerad von Jugend auf. Die Beiden waren recht ungleich, aber just das zog sie zusammen.
„Freund,“ sagte eines Tages Crispin zu Franz, „jetzt schau’ mich an, wie ich da steh’. Vom Fuß bis zum Kopf ein armer Teufel. Keinen Kreuzer Geld. Ich will aber doch ein paar Säcke von meinem Korn verkaufen.“
„Wo hast denn Du Dein Korn?“
„In meiner Tenne, im Steghof, wo denn sonst! Hilf mir die heutige Nacht, daß wir es davontragen. Sollst es nicht umsonst thun.“
„Crispin!“ entgegnete der Franz mit feierlicher Stimme, „Stehlen ist Sünd’, kommst in die Höll’!“
„Bist auch so ein Narr! Hörst, die Höll’ ist letzt’ Jahr abgebrannt; ist nicht assecurirt gewesen!“
„Geh’, Du bist ein Heid’ geworden,“ sagte der Franz.
„Und Du bist ein Christ geblieben und kannst Deine Sünd’ ja wieder beichten. Ist aber keine Sünd’, weil das Korn mein Eigenthum ist.“
Der Franz ließ sich wenden. Der Franz war recht gottselig, grübelte bisweilen gern in religiösen Schriften; im Leben hingegen war er denkfaul und begab sich stets in Allem der Führung seines Freundes. So schlichen sie zur Nachtszeit in den Steghof und trugen Korn davon.
Und an den Sonntagen waren sie im Wirthshaus und lebten in Lust und in Freuden.
Das wohl, ei ja, das wohl! Zog der Franz fleißig Wachskerzen für die Heiligen, die auf der Kirchenwand hingen. Dabei kamen ihm aber einmal Gedanken, denn er fabricirte auch Sterbekerzen: Wenn du gach mit Tod abgehst, Franz! Die schwersten Brocken könntest wohl abladen. Nur, daß halt der Beichtstuhl von einem gesunden Mann so viel strenge Buß verlangt. — Später und Alles auf einmal, wird gescheiter sein.
Und sie trugen nächtlich manchen Scheffel Korn aus dem Steghof.
Und auf einmal, da wurde es laut: der Crispin stehle seinem Vater das Korn. Jetzt war der Teufel los, der[S. 430] Crispin mochte an einen glauben oder nicht. — Einsperren ließ der Alte den Jungen nicht, aber noch ärger bedrücken, noch ärger mißhandeln! Sie trugen einen Haß in sich, stark genug, einander zu zerfleischen.
Das Laster geht geraden Weg.
Der Crispin hatte im Kartenspiele eine neue Sackuhr gewonnen; die gefiel dem Franz. Und eines Tages im Wirthshaus fragte dieser: „Wie willst mir sie verkaufen?“
„Franz,“ sagte der Crispin und zerrte den Kameraden in einen Winkel, „willst Du mir meinen Alten schlagen helfen, so schenk’ ich Dir die Uhr mitsammt der Kette.“
„Hörst, das muß ich mir erst überlegen. Einen schlagen, der mir nichts gethan hat! ’s kunnt leicht nicht recht sein.“
„Ihm selber sicher nicht,“ lachte der Crispin, „indeß, überleg’ Dir’s. Wie er ausmißt, so soll ihm eingemessen werden, und —“ er legte die Hand auf den Rücken, „mir hat er gestern wieder übel gemessen.“
„In der Schrift heißt’s so, wohl war. Na, will mir’s überlegen.“
Sieben Tage später war die Neujahrsnacht. Der Nachtwächter schritt durch das Dorf und über den Friedhof. Er blickte in das offene Grab, welches der Todtengräber zur Winterszeit stets bereit hält und dachte: Wer wird der Erste sein im neuen Jahr, der hinabsteigt? —
Draußen vor dem Zaune huschte eine Gestalt vorbei. Der Crispin ging in das Häuschen seines Freundes.
„Recht, daß Du da bist,“ sagte der Franz, „in solchen Nächten, heilig wahr, ich heb’ mich schon an zu fürchten. Schau, da hab’ ich Blei gegossen. Und was ist heraus[S. 431]gekommen? Da, schau einmal!“ Er hielt dem Kameraden ein Stück Blei hin.
„Was wird’s denn sein?“ lachte der Crispin, „eine Bleikugel ist’s.“
„Bei Leib’ nicht, bei Leib’ nicht. Ein Todtenkopf ist’s.“
„Das mag auch sein.“
Dann schauten sie in das flackernde Oellicht und sagten nichts; es war, als hätten sie Gedanken über den Todtenkopf.
„Aber, daß ich nicht vergess’,“ sagte hierauf der Crispin plötzlich, „da hab’ ich einen Lichten bei mir. Trink einmal.“
Der Andere nahm die Flasche und setzte sie an.
„Nur besser!“ ermuthigte Crispin seinen bescheidenen Freund, „und daß ich Dich frag’ Franz, — hast Du Dir’s überlegt?“
„Was?“
„Ob Du im neuen Jahre eine neue Uhr haben willst?“
„Und wann denn, daß wir ihn dreschen?“ gab Franz die Frage zur Antwort.
„Kamerad,“ sagte Crispin und faßte die Hände seines bereitwilligen Freundes, „heut’ ist Neujahrsnacht. Wir schließen einen Bund, Franz, und wir wollen alleweil zusammenhalten.“
„Das ist brav von Dir,“ antwortete der Wachszieher, „das gefreut mich arg, daß Du mit mir noch Kameradschaft hast, gleichwohl Du Kaiserlicher bist. Schau’, ich thät’s mit den Leuten nicht schlecht meinen, aber nach mir schaut sich kein Mensch um, müßt — thätest Du nicht sein — mutterseelenallein meine Straße trotten. Mit der Juliana ist’s auch nur so eine Frag’. Du bist mir der Best’, Crispin.“
Der Bursche war bei diesem Bekenntnisse ganz weichmüthig geworden. Beide schüttelten sich die Hände.
Dann blickten sie wieder in das Flämmchen und Crispin seufzte.
„Du mußt wohl auch ein Anliegen haben,“ sagte der Franz. Der Andere nickte mit dem Kopfe.
„Kann ich Dir helfen?“ fragte der Wachszieher, um seine Treue sofort zu beweisen.
„Du könntest mir freilich helfen. Geh’, trink’ wieder einmal.“
„Trinken thu’ ich schon, aber verlassen thu’ ich Dich nicht.“
Da wird es in den Zügen des Soldaten lebendig. „Franz, willst Du mir schwören, daß Du mir hilfst?“
„Schwören!“ murmelte der Andere, „einen Eid ablegen? Bei meiner Seel’, das wird doch nicht vonnöthen sein?“
„Man kann’s nicht wissen.“
„Fällt’s mir g’rad ein, was die Juliana einmal gesagt hat: So lang’ kein Jurament ablegen, so lang’ man nicht weiß, ob man’s halten kann.“
„Bist ein Christ, Franz, so wirst wissen, daß der Mensch schon in der Taufe einen Schwur muß ablegen. Und das kleine Kind kann doch am allerwenigsten wissen, was es wird halten können.“
„Da hast freilich wieder recht,“ meinte der Wachszieher, „und es wird doch nichts Unrechtes sein.“
„Franz, schau, ich kunnt’ von Rechtswegen schon Herr sein und ein Weib haben, und ich bin der unglücklichste Mensch auf der Welt!“ Crispin fuhr mit der Hand über seine Augen. „Du könntest mir helfen.“
„So sag’s, so sag’s! Ich bin nicht so, daß ich Dich im Stich’ laß’. Was kann ich Dir denn thun?“
„Rath’ einmal.“
„Wieder Korn tragen helfen?“
„Nein, Franz.“
„Brauchst etliche Groschen Geld?“
„Nein, Franz!“
„Soll ich Dir Eine überreden?“
„Nein, Franz, dazu bin ich selber da.“
„Nun, aber dem Steghofer die Knochen auseinander schlagen?“
„— — Nein, Franz.“
„Ihm das Haus anzünden?“
„Mein Haus? Nein. Weiter, rathe weiter, Franz!“
„Kunnt’ nicht mehr rathen.“
„Kamerad,“ flüsterte der Crispin, „Du mußt mir schwören, daß Du es — aber greif’ zu, trink’, trink’ — Du mußt mir schwören, daß Du es Niemand sagst!“
„Bei Gott und meiner armen Seel’, das kannst Dich verlassen!“
„Und daß Du mir beistehst, und daß Du mir hilfst! Heb’ auf die Hand! Bei Gott und Deiner Seel’! — Du willst nicht? Nicht einmal den Arm heben, mir zu Lieb?“
„Wenn ich nicht einmal der Juliana ein Jurament hab’ abgelegt, dahier kann ich’s noch weniger.“
„Auch gut, an Dir hab’ ich mich getäuscht, bist ein Feigling.“
Dem Wachszieher — wie er merkt, es handelt sich um seine „Ehre“ — vergeht Hören und Sehen. Er hebt den Arm: „Bei Gott und meiner armen Seele!“
Da klingt es draußen in der Winternacht. Die Kirchenuhr schlägt zwölf.
„Ein neues Jahr und ein neues Leben heb’ ich an!“ jauchzt der Crispin. — „Alter Satan, da drüben, Du hast[S. 434] mir heut’ das letztemal gesagt, daß Du mir nicht nachgiebst. Ueber’s Jahr! Früher noch, viel früher!“
„Red’ nicht so, zu der heiligen Stund’!“ mahnt der Franz. „Sag’s lieber gleich, was Du verlangst.“
„Ich? Was ich verlang’?“
„Deinen Willen hab’ ich gethan, jetzt sag’, was Du verlangst.“
Der Soldat zieht den Burschen an sich und flüstert: „Du bringst den Steghofer um.“
Der Franz prallt zurück.
Der Andere starrt ihn an, in seinem blassen Gesicht steht’s zu lesen, wie ernst es ihm ist.
„Du schlechter Mensch!“ stöhnt der Franz und wehrt mit den Händen ab: „Geh’, geh’! — Geh’!“
„Also, Du magst nicht?“
„Mein Lebtag nicht. Mein Lebtag nicht!“
„So. — Also meineidig willst Du sein, Du guter Christ!“ höhnt der Crispin und seine Augen beginnen zu funkeln.
„Daß Du so was verlangst, das hab’ ich nicht gewußt.“
„Und hast doch geschworen!“
„Hätt’ — hätt’ ich Dir das geschworen?“ ächzt der Franz und ringt nach Athem.
„Du hast geschworen, daß Du mir hilfst. Weißt, Franz, anders ist mir nicht zu helfen.“
Der Wachszieher verhüllt sein Angesicht.
„Nun?“ frägt der Soldat.
„Nein,“ ruft Franz, „das thu’ ich nicht. Ein Mörder werden, davor behüt’ mich Gott.“
„Gut,“ sagte der Crispin, anscheinend gelassen, aber lauernd, „so werde ich’s selber thun. Du könntest einen[S. 435] Vatermord verhindern, hörst Du, einen Vatermord! Und thust es nicht. Und brichst den Eidschwur, hast Gott zum Feind und bist ein doppelter Verbrecher. Ich heiß’ Dich einen Schurken, Dein Lebtag lang.“
Der arme Franz — in Wahn befangen — rang die Hände, starrte stumm vor sich hin, schüttelte rathlos den Kopf. Wie ein armer Sünder saß er da. Wie ein Verzweifelter saß er da. Die Hand nicht rühren und ein zweifacher Mörder sein! — Aber Vatermord und Meineid sind die schrecklichsten Gräuel. Einen Mord wird Gott vergeben, einen Meineid nimmer. Der Mord führt einen Menschen aus dieser elenden Welt; der Meineid lügt dem Herrgott frech in’s Gesicht, beschwört ihn, die Lüge ewig zu rächen. Und wenn Du stirbst und den Namen Gottes anrufst — Dein Mund hat falsch geschworen; und wenn der Teufel an Dein Bett kommt und Du willst die Hand zum Kreuzzeichen heben — die Hand hat falsch geschworen. Der Herrgott schreibt den Eid mit seinem Blitzstrahl an’s Firmament. Wer löscht ihn aus? —
Das Blut des Steghofer löscht ihn aus! schreit in ihm der böse Wahn.
„Nun?“ fragte der Crispin wieder.
„Laß’ Zeit! Ich kann nichts sagen.“
„Ist’s denn ein Schad’ um die Bestie?“
„Aber, mein Gott, ihm das Leben nehmen!“
„Sonst nimmt er’s Andern. Weißt Du, wie er gestern die Juliana wieder behandelt hat?“ Der Franz fuhr auf. Der Crispin erzählte mit wenigen Worten. Da unterbrach ihn der Wachszieher: „Sei still, ich thu’s! Sei still.“
Der Crispin nahm das gegossene Bleistückchen in die Hand und sagte: „Bleikugel! Todtenkopf! Was Du willst.[S. 436] Du siehst, dem Alten ist’s Bestimmung. — Da, Kamerad, die Uhr gehört Dein, aber der Steghof sei in sieben Tagen ausgeräumt!“
Der Franz stieß die Uhr von sich, schrie: „Nein! Behüt’ Dich Gott!“ und stürzte aus der Stube — in die erste finstere Nacht des neuen Jahres hinein.
Mittlerweile verging ein Tag und es verging der zweite. Die beiden Freunde sahen sich nicht. Crispin brütete an seinen Plänen fort; an den trägen, weichmüthigen Franz dachte er kaum mehr. Der war für ihn denn doch nicht der Rechte.
Finster ging Crispin umher, er ging im tiefen Schnee und er ging durch die Wälder. Das Hochwild erschrak vor ihm, aber floh nicht, als wisse es: Der jagt anderes Wild, als das vierfüßige. Weit drüben im Bergwald ist eine tiefe, finstere Schlucht, die Natterklamm geheißen. Zur Sommerszeit hörte man in den Untiefen der Natterklamm ein Wässerlein fallen; im Winter lag Eis und Schnee in den Klüften. Hoch über dieser Schlucht führte ein Steg, der nur aus zwei nebeneinandergelegten Bäumen bestand und im Volksmunde der Sündensteg genannt wurde. Vor Zeiten ging die Sage, daß er unter keinem schweren Körper brechen könne, wohl aber unter einer schweren Sünde, die darüber getragen würde, in den Abgrund stürzen müsse. Daher war der Steg von Manchem gemieden worden; da er aber auch unter Solchen nicht brach, welche sich, der Sünde bewußt, frevlerisch darüber wagten, so kam die Sage allmählich in Vergessenheit. Leute, die nach Hallwies hinaus wollten, benützten diesen Steg, weil der Weg durch den Wald bis in den Flecken um eine Stunde kürzer war, als die Fahrstraße dahin.
Der alte Steghofer, hatte er in Hallwies, wo das Steuer- und Gerichtsamt war, Geschäfte, so ging er stets über die Natterklamm.
Ja selbst im Winter, wo Alles sonst die Straße wählte, ging der Alte seinen Waldsteig, wie sehr dieser oft auch verschneit und verweht war.
Auch in diesen Tagen wurde der Bauer, wie es nach Neujahr immer zu geschehen pflegte, in das Steueramt beschieden. So traf er heute im Hofe Anordnungen für morgen, wenn er nach Hallwies gehe.
Crispin lauerte. Ein Gedanke stieg in ihm auf; vielleicht war der Gedanke nicht mehr so jung, vielleicht war er schon reif. — Wenn das da oben der Sündensteg ist, so muß er unter diesem Manne brechen, er muß brechen. — Der Bursche nahm eine Handsäge unter den Wettermantel und eilte damit durch den schneestöbernden Wald gegen die Natterklamm. Er kletterte an den Hängen hin, kroch unter den Steg hinein und sägte die beiden Balken von unten mehr als zu zwei Drittel durch.
„So,“ sagte er, „jetzt bist wieder der Sündensteg und wirst zur rechten Zeit brechen.“
Dann ging er vergnüglich dem Hofe zu.
Juliana hantirte in der Küche und sättigte das Feuer und bereitete das Abendmahl. Dabei war sie flink und heiter und sang in die Flammen hinein. Der finstere, stürmische Alte focht sie gar nicht an; — sie läßt’s ihn treiben, wie er’s treibt und thut ihre Obliegenheit. Der Alte ist eben nicht gescheit und wird schon kindisch. — Heute saß er neben ihr auf dem Herd und fettete seine Schuhe für den morgigen Gang. Er war heute fast wohl gelaunt und mochte das Singen leiden. Eigentlich mochte er das Mädchen, welches[S. 438] sang, auch leiden; Juliana war erwachsen, da fiel es dem Steghofer plötzlich ein, er wolle von nun an anders mit ihr umgehen. Aergeres konnte er diesem trotzigen Buben, dem Crispin, gar nicht anthun, als wenn er die Juliana heiratete.
„Julchen,“ sagte er und rieb emsig an dem Leder, „das Kochen, das kannst. Du wärst richtig eine tüchtige Steghoferin.“
„Kann schon sein,“ antwortete das Mädchen.
„Wirst ihn halt zusammenpacken müssen, den Steghofbauern. Was meinst?“
„Ist mir viel zu wüst. Und Soldat ist er auch noch.“
„Wer?“
„Nun, wer denn? Der Crispin.“
Der Alte beugte sich über den Herd, klopfte mit dem Zeigefinger auf die Brust und flüsterte: „Der Steghofer bin ich!“
„Freilich,“ antwortete der Crispin, der auf einmal in der Küche stand und so hoch war, daß sein Haupt in den Rauch hineinragte. Es war daher nicht zu sehen, welche Miene er zu seinem „Freilich“ gemacht hatte. Er hätte auflachen mögen, als er merkte, wie der Alte noch an’s Freien denke. Aber er hielt sich still, er wußte, der Tod schärfe schon die Sense.
„Morgen reden wir davon,“ sagte der Steghofer zum Mädchen.
„Morgen wird gutes Wetter sein,“ versetzte Crispin in gleichgiltigem Tone, „der Schnee ist steinhart gefroren.“
„Ist mir lieb,“ sagte der Alte, „so brauch’ ich keine Schneeleitern über den Waldsteig.“
„Laß’ mich auch zum Feuer, ich muß mir die Finger wärmen,“ murmelte der Soldat und drängte sich zwischen dem Mädchen und dem Alten zur Herdgluth.
In demselben Augenblicke knallte ein Schuß — gellte ein Schrei — klingelten die Scherben einer Fensterscheibe zu Boden.
Und in demselben Augenblicke eilte ein Mann vom Fenster weg durch die Nacht dahin. „Ist eingelöst!“ stöhnte er laut zum funkelnden Sternenhimmel auf, „das Jurament ist eingelöst!“ Die Schußwaffe schleuderte er weit von sich und floh in den finstern Wald, ohne Ziel und ohne Rast, gleich wie Einer, der es weiß, daß er sich trotz Allem den Herrgott doch zum Feinde gemacht hat.
Franz war es. Er war der Meinung, den alten Steghofer, der auf dem Herde saß, getödtet zu haben. Er hatte es nicht gesehen, wer von seiner Kugel getroffen zu Boden gestürzt war.
„Jesus und Maria! Was ist das!“ hatte Juliana ausgerufen. „Der Franz, der Franz hat geschossen. Der Wachszieher hat hereingeschossen! Ich hab’ ihn durch’s Fenster gesehen!“
Einen Schrei zum „gerechten Gott“ hatte der Gottesleugner noch ausgestoßen. Und dann, von Blut übergossen, das aus seiner Brust emporsprudelte, mit brechender Stimme hatte es Crispin bekannt, was mit dem Wachszieher verabredet war, und wie dieser nun treulos auf ihn geschossen habe.
„Mir,“ gurgelte der alte Steghofer, „mir hätte das gegolten?“ Und dann hastete er hinaus, hinab in den tiefsten Keller, und schloß sich ein, und betete und zitterte die ganze Nacht vor Mörderhänden und vor Kälte. Bald hatten sich um den Steghof Leute versammelt; die Einen legten den todten Crispin auf das lange Brett, die Anderen waren auf, um[S. 440] den Mörder zu verfolgen. Das Schußgewehr hatten sie bald gefunden, und man hatte es als das des Wachsziehers erkannt. Sie wollten es nicht glauben, daß der sanfte, fast blöde und sonst so gottesfürchtige Bursche diese That verübt haben sollte. Die es aber glaubten und den Erhebungen zufolge glauben mußten, die fluchten sowohl über die Scheinheiligkeit des Einen, als über die Glaubenslosigkeit des Andern.
Mit Fackeln durchzogen sie den Wald; eine Menschenspur im Schnee leitete sie gegen die Natterklamm.
„Sollte er denn nach Hallwies hinausgegangen sein?“ fragen sich die Leute.
„Ja, ja, der ist auf kürzestem Wege zum Gericht gelaufen, um sich selbst anzuzeigen,“ gaben sie sich Antwort.
Als sie zur Klamm kamen, zog die Fußspur dem Stege zu — und der Steg war eingestürzt. Die Balken niedergebrochen und in den Eis- und Schneemassen der Tiefen kaum mehr zu sehen. Der Schein der Fackeln vermochte nicht, in den Abgrund zu dringen. Jenseits der Klamm waren die Tritte nicht mehr zu spüren.
„Also hier am Sündensteg!“ sagten die Leute.
Still und mit gesenkten Fackeln kehrten sie in ihre Häuser zurück.
Als sie nach zwei Tagen — es war der siebente Tag nach der Neujahrsnacht — den Sarg des Crispin durch den Wald und an den Felswänden herübertrugen, brauste ein Wettersturm; und als sie den Crispin begruben, machte es der Caplan mit seiner Einsegnung so kurz als möglich. Hingegen begann auf dem Heimweg die alte Haushälterin des Wachsziehers zu erzählen, wie sich der Franz in den letzten Tagen benommen hätte. — Gar wie ein Irrsinniger.[S. 441] Beim Tag nichts gearbeitet, nichts gegessen, alleweil in Büchern geblättert und wie im Traum herumgegangen, bei der Nacht so laut aus dem Schlafe gesprochen, daß sie es in ihre Kammer hören konnte, wie er rief: „Fort muß er! Steghofer, Du mußt fort, ich hab’s meinem Herrgott versprochen!“
Der alte Steghofer war aus seinem Keller kaum mehr hervorzubringen; der Schreck schien in seinem Gehirn etwas zerstört zu haben, die Todesfurcht zerriß seinen Organismus. Nach wenigen Wochen starb er. Juliana war Erbin des Steghofes. Sie konnte sich aber nicht freuen.
In dem darauffolgenden Sommer fanden sie in den Klüften der Natterklamm die Reste des unglücklichen Franz. Sie wurden im Walde begraben. Einer von den Fremden, die aus Hallwies gekommen waren, hielt folgende Grabrede: „Diese einsame Grube und jenes jugendlichen Mannes Grab auf dem Kirchhofe sind zusammen verbunden. Mörder liegen darin — Gemordete liegen darin. Soll ich die Meuchler nennen, denen diese unseligen Menschen zum Opfer gefallen sind? Die Bigotterie und der Unglauben.“ —
Die Gräber sind verwachsen und verwildert. Der Steghof ist verkauft, Juliana hat ihr Glück in einer andern Gegend gesucht und gefunden.
Der „Sündensteg“ ist wieder neu gezimmert; die alte Sage ist durch das Ereigniß aufgefrischt worden; aber Wenige erfreuen sich eines so guten Gewissens, um furchtlos über den Steg zu wandeln.
n der Thurmstube des Stiftes Münsterwald saß ein alter, betrübter Mann.
Die unten wohnten, beneideten ihn um den Fernblick. Was sah er denn? Die schneebedeckten Dachgiebel des Städtchens und matten Sonnenschein darauf. Mit der Sonne geht’s scharf abwärts zu dieser winterlichen Zeit; alle Thäler und Hügel schimmern im Schneeglanz, und es ist doch wie eine Dämmerung und der Tag ist kaum so lang, daß sich die Leute in demselben für ihre Abende vorbereiten können.
„Der liebe Herrgott verbrennt viel Sternlein jetzt,“ meint ein armes Weibchen, das wohl weiß, wie theuer im Winter die Beleuchtung kommt. Kaum da oben die Sterne angezündet sind, spinnen sich die Menschen in ihre Häuser ein. Sie verrichten allerlei kleine Arbeiten, singen Lieder, erzählen Geschichten und der Michel meint: „Heute wär’s draußen gut Ketten lecken!“ Um Gotteswillen, kleiner Wastelbub’, probir’s nicht! Dein Zünglein bliebe unselig kleben am Kettenglied, thät’ in der leidigen Kälte anfrieren auf der Stell’. Mancher ist diesem Bauernspaß schon auf den Leim gegangen. Da ist das Kartenspiel in der warmen Stube unterhaltlicher. Im hohen Sommer ginge nach so langer Dunkelheit schon die Morgenröthe auf; jetzt schlägt der Hammer[S. 443] auf dem Thurm erst die neunte Abendstunde. Sie gehen zu Bette; Keiner denkt daran: wie wird sich der Thürmer die Zeit vertreiben? — Jetzt liegen sie neun Stunden lang, da weckt sie die Glocke zur Rorate auf. Ueber der Welt noch immer die stille, schwere Nacht, daß Einem hart wird um’s Herz und der Gedanke kommt: Wenn’s finster bliebe!
Der Thürmer läutet das Ave-Maria. Süß und hoffnungsreich klingt es hin über die Menschenwohnungen, bis hinaus, wo die Wälder stehen. Verlange Dir nicht am Quell’ der heiligen Töne zu stehen, die schmetternden Hammerschläge zerrissen Dir das Ohr; der Thürmer weiß nicht, wie schön seine Glocken klingen.
Der einsame Mann leitet den Schein seiner Lampe auf das Buch, in welchem die uralten Träume der Menschheit aufgeschrieben sind; er sucht die Sprüche des weisen Salomon, die Psalmen des Sängers David, die Worte der Propheten. Aber er dringt nur auf die todten Blätter, nicht tiefer; sein Mund murmelt:
Das stand nicht in der Bibel, das las er aus seiner Vergangenheit. Er war nicht in der Gegend geboren. Als entfernter Verwandter eines nun längst heimgegangenen Prälaten von Münsterwald hatte er einst die Stelle eines Thürmers und Wartes überkommen. Was war dieser Mann einst lebenslustig gewesen! Aber da hat sich eine Geschichte zugetragen, und seit dieser Geschichte lebt er wie ein Einsiedler auf seinem Thurm, bedient von einer Magd, die nichts hört und gern schwätzt.
Jetzt war ein Tag, da mußte der Alte eine Stunde lang mit allen Glocken läuten. Ein Heil war im Anzug, eine[S. 444] Gnade für Münsterwald. Der Thürmer zog seelenlos an den Stricken, hörte seelenlos das erzene Knallen der Töne — er wußte es wohl: Wenn der Menschenzug, der die Straße heran dem Münster zuwallt, endlos wäre, wenn sie Alle kämen, die Heil und Gnaden hätten, oder beladen wären mit Fluch und Schande — der Eine wäre doch nicht dabei, den lockt kein Glockenklang von Münsterwald.
In’s Städtchen zogen, von der Bevölkerung der Umgegend begleitet, drei Missionäre ein. Die Stiftspriester fühlten sich dem weltlichen Sinne ihrer Sprengel nicht mehr gewachsen; die Leute wollten den Kanzelsprüchen Jener, mit denen sie kartelten, kegelten und krügelten, keinen großen Ernst beimessen. Und so hatte das Stift Apostel herbeigerufen, von denen es hieß, daß sie aus weiten Landen kämen, unter ihren Mänteln Geißelhiebe freiwilliger Kasteiung und unter ihren breiten Hüten bereits einen leichten Anflug von Heiligenschein trügen.
Einer von den Fremden war blaß und hager; dem sah man’s an, wie ernst er es mit Hölle und Teufel nahm; der Zweite, Behäbigere, mochte sich schon etwas mehr an den Himmel halten, ob der nun in jener oder dieser Welt zu finden sei. Der Dritte hatte einen langen schwarzen Bart, sein Gesicht war rauh, sein Auge war herb; er schaute beim Einzug so seltsam scharf an den Häusern umher, auch zu den Giebeln und Thürmen auf. — Ammern, Spatzen, Schneemeisen, sonst, lieber Mann, fliegt in dieser Jahreszeit bei uns nicht viel herum!
Der leise Spott, mit dem die Einziehenden empfangen wurden, verwandelte sich bald in Lob und Bewunderung.[S. 445] Auch die Leute von Münsterwald waren aus Fleisch und Blut gebaut, waren empfänglich für das schmetternde Wort, für die grellen Bilder erhitzter Phantasie, für geheimnißvolle, auf die Sinne wirkende Zeichen, und sie erlagen daher den merkwürdigen Experimenten und Demonstrationen der Jesuitenmission gar bald.
Besonders der Schwarzbärtige, der Pater Christof! Wenn der predigte, da wurde die Kirche zu klein — und das will in Münsterwald was sagen! Der Mann predigte ganz anders als seine beiden Genossen, die mit Allem so übernatürlich thaten und, wie der Kirchweihzauberer, unter dem Dache Wetter machten und sogar Blitze in die Menge warfen, welche die Einen brannten, die Anderen blendeten. Der Schwarzbart that nicht desgleichen, wenn er auf der Kanzel stand, er schrie nicht einmal, aber es waren Brusttöne, in denen er sprach. Es war etwas Warmherziges in der rauhen Stimme, es schien immer, als denke er weniger an seine Worte, als an seine Hörer, und der Mauthner vom untern Thor flüsterte einmal dem Nachbar zu: „Der predigt fast, wie ein Mensch.“
Der Ruf dieses Predigers drang auch auf den Thurm. In der lieben Christnacht war’s, als der alte Mann weinte. Da ruft er die Leute zum Gottesdienst, und er selber hört keine Predigt und keinen Orgelklang, er muß zu den Fenstern hinausschauen, ob in dieser lichterreichen Nacht nicht irgendwo ein Unglück auflodere. Wer frägt nach dem alten Thürmer? Sie vergaßen es längst, was ihm einst widerfahren.
Auf der kleinsten der vier Glocken, die zusammen ein so herrliches Geläute gaben, daß man weit und breit in den Hügeln und selbst in den Bergen drinnen vom Musikspiel zu Münsterwald sprach — auf der kleinsten dieser Glocken[S. 446] stand mit Kreide geschrieben der Name „Valentin“. Es war längst schon Staub darüber, aber der Thürmer wischte ihn an dieser Stelle nicht weg, aus Furcht, die Buchstaben zu verletzen. Wie oft hatte er seit jenem längstvergangenen Tage, da das Söhnlein von der Schule heimkehrend mit der Kreide auf dem grauen Metall seine neue Kunst erprobte, diese Glocke geläutet! Der Name Valentin schwang und klang mit, wenn die Glocke ein Brautpaar zum Hochzeitsamte rief und er schwang und klang mit, wenn der Glockenton eine Bahre hinausbegleitete zu ihrem Grabe. Ihn hat wohl weder zum Einen noch zum Andern ein christlich Geläute geführt! — Da ist ein junges Menschenleben vergangen und verloren. Durch wessen Schuld? — Zu Allerseelen macht der Thürmer stets um einundzwanzig Züge mehr an der Glocke, als die Ordnung war, denn einundzwanzig Jahre zählte Valentin. Nun stand der Alte da und schaute den Namen aus Kreide an — und das war sein Weihnachtsfest.
Am nächsten Frühmorgen stieg er hinab in die Kirche und sah den bärtigen Missionär, den Pater Christof, als dieser seine Messe las. Er sah sein Gesicht und dachte: „Zu dem hätte ich Vertrauen; wollte mich gern einmal aussprechen. Mit jedem Glockenzug schreie ich’s in die Welt, wie mir ist, aber sie verstehen anders.“ So ging er nach der Messe in die Sacristei. Als ihn der Priester sah, stolperte derselbe und fiel dem Alten fast in den Arm. Das war diesem ein gutes Vorbedeuten und er trug dem Missionär seine Bitte vor. Von den Predigten könne er nichts gewinnen, weil er als Thürmer soviel schwerhörig geworden sei, so möchte er zum Beichtstuhl kommen.
Der Schwarzbart stand da, wie eine Bildsäule, so ernst, dann sagte er: „Wenn Ihr schwerhörig seid, so ist der Beicht[S. 447]stuhl nicht der rechte Ort. Wenn es recht ist, so will ich Euch in Eurer Stube besuchen.“
Da wurden dem Thürmer die Augen naß und er sagte: „Ja, der hochwürdige Herr ist wohl ein guter Hirt, der die Sünder aufsucht, aber ich komme schon selber zu Ihm, wenn’s verstattet ist?“
„So kommt Nachmittag, wenn Ihr gespeist und Euch ausgeruht habt, in den Pfarrhof.“
Als der Alte in seinen Thurm hinaufstieg, murmelte er: „So wie Der kunnt er jetzt sein. Was wäre das für mich ein schönes Leben und Sterben, Du heiliger Gott!“ —
Und Nachmittag, als zur Vesper geläutet war und die lichterstrahlende Kirche sich mit Menschen und Leuten (das ist auch in Münsterwald zweierlei) gefüllt hatte, saßen die beiden Männer im abgelegenen Zimmer. Der Priester spielte mit einem schwarzen Kreuze, das ihm über der Brust hing und hörte dem Thürmer zu. Der Thürmer sagte: „Ich habe mir’s überlegt, hochwürdiger Herr, beichten will ich jetzt nicht. Ich fürchte mich allzuviel, daß ich nicht kunnt absolvirt werden. Ich bin kein armer Sünder, wie die Anderen, die jetzt in der Kirche dutzendweise vor dem Beichtstuhl stehen; ich sag’s gleich, ich habe mein Kind umgebracht.“
Der Priester sprang auf; aber gelassener setzte er sich wieder auf seinen Platz — und schwieg.
„Darf ich jetzt anfangen?“ fragte der Thürmer.
„Erzählt, erzählt, was Euch drückt. Ich sage Euch im Voraus, Gott ist gütig.“ So der Priester und that, als wollte er die Hand des Alten erfassen.
„Mir war er’s nicht, mein geweihter Mann,“ sprach der Thürmer, „so schreckbar ist es, sein liebes, bluteigenes Kind verfluchen zu müssen. Ach, das Neugeborne schon ist[S. 448] eine Sünde gewesen — aber eine Sünde, Pater, wie deren auch die Leute in der Kirche d’rüben zu beichten haben. Die Mutter starb, dem Kleinen sang ich’s an der Wiege: Die Lust hat uns verbunden! — Als er größer wurde, hatte mein Valentin Schick für’s Lernen, haben ihn die geistlichen Herren auch zum Ministranten gern gehabt und ist dem Herrn Prälaten der Gedanke gekommen: Wollen einen Priester aus ihm machen. Hätt’ dazu wohl taugen mögen; Altar und Predigtstuhl, das ist fort sein Treiben gewesen. Und hat doch nicht dazu getaugt. O Herr, so ein gottverlassener Mensch, wenn der Priester worden wär’! Ein Dieb, der Bursch. Ja, nicht wahr, da fahren jetzt der geistliche Herr in die Höh’! — Hat brav studirt, der Herr Prälat hat Alles für ihn gethan und bezahlt. — Wie er in seinem einundzwanzigsten Jahr von der achten Schul’ auf Vacanzen heimkommt und uns das Semesterzeugniß hat gewiesen, hab’ ich vermeint, ich müßt’ in die Wolken fahren vor lauter Freud’! Ist der Erste gewesen in seinem Jahrgang! Und was bei ihm selber für eine Lust war. Wie ein junger Hirsch springt er Euch in der Gegend um, und vom Kirchthurmfenster aus hat er mir einmal einen Jauchzer gethan in die Stadt hinab, daß die Leute gar gesagt haben: Wenn solche Kirchenglocken läuten, da wollten sie auch wieder fromm werden. Unser Herr Prälat hat’s zum Glück nicht gehört; das war ein strenger Mann! Und ich für meinen Theil hab’ vermeint, die Jugend müßt’ sich ausjauchzen, und schon gar, wenn der Mensch später einzig nur mehr beten und beten soll. Daß auf Vacanzen die Ersparniß zu wenig wird, mag auch dem Valentin passirt sein, gleichwohl er mir niemals davon was hat merken lassen. Auf einmal in der Morgenfrüh, ich weiß es noch, als wie wenn es gestern wär’ gewesen, der Maria-Himmel[S. 449]fahrtstag war’s — werde ich eilends von meinem Thurm gerufen, auf den Kirchplatz hinab, und da ist ein Leuthaufen beisammen und mitten drin haben sie — mit einem Strick die Hände gebunden — meinen Valentin. Beim untern Thor hat dazumal der Wanschel-Moses, wie wir ihn geheißen haben, sein Häuslein gehabt. ’s ging das Gered’, daß der Moses viel Geld hätt’ besessen und nur deswegen in Münsterwald geduldet gewesen, weil ihm allerlei Leute schuldig waren. Bei diesem Juden hat der gottvermaledeite Theologus einbrechen wollen. O frommer, geistlicher Mann! Was das ist, wenn Einem das eigene Kind auf einmal als Dieb und Räuber vorgeführt wird! Was das ist! Tausend Jahr’ lieber im höllischen Feuer brennen, als das erleben! — Nichts weniger als Solches hätt’ ich an meinem Sohn vermuthen mögen; ein Starrkopf ist er oft gewesen, und jähzornig, wie ich jähzornig bin, sonst war er brav. Und jetzt auf einmal das! — Daß mich der Schlag nicht hat getroffen am selbigen Himmelfahrtstag! Getroffen hat er mich freilich, nur allzuböse, geistlicher Herr, nur allzuböse! — Geleugnet hat er’s, der Schandbub’, wo sie ihn doch im Fenster haben gefangen. Geleugnet hat er’s, wo doch aller Beweis ist dagelegen, daß es nicht anders gewesen sein kann. Daß ein lustiger Student Geld braucht, ist nichts Neues, aber daß er deswegen dem Juden zum Fenster hineinsteigen muß, wird der Pater noch nicht gehört haben. Der Prälat hat’s auch niemalen gehört und hat nichts zum ganzen Handel gesagt, als wie: Wenn der junge Mann beim Juden Geld sucht, so braucht er vom Stift kein’s. — Und aus ist’s gewesen. Alles hat ihn verhetzt: Dieb! Dieb! Sonst hat man nichts gehört auf dem ganzen Platz. Der Valentin hat bei mir wollen Schutz suchen. — Einbrecher! schrei’ ich voll Schand’ und Zorn[S. 450] mir kommst nimmer vor die Augen! Und stoß’ ihn mit der Faust zurück. — Jetzt haben sie ihn geschlagen und gerissen, haben ihn aus der Stadt gehetzt, die staubige Straßen fort — und seit dieser Stund’ hab’ ich meinen Sohn nimmermehr gesehen.“
Der Priester legte seine Hand auf die zitternden Arme des Alten; er zitterte selbst. Der Thürmer fuhr fort: „Der Zorn ist freilich wohl bald vergangen, aber da ist die Reue gekommen, und die ist noch viel fürchterlicher. O, sagt mir doch: Wenn ihn Gott selber verlassen hat, ist es denn unrecht, wenn ihn auch der Vater verläßt?“
„Das himmlische Gesetz, wie das irdische, sprechen den Vater frei, sein Kind zu richten,“ sagte der Missionär. „Und gesetzt, Ihr wäret der Richter Eures Valentin gewesen, hättet Ihr nicht die Thatsache auf das strengste untersuchen müssen, bevor Ihr ein Wort in sein Herz geschleudert, das alle Kindesliebe im Augenblick vernichten mußte? Ihr habt nichts untersucht, Ihr habt nicht an’s Kind gedacht; die Schande, die Ihr auf Euer Haupt fallen sahet, der leidige Zorn war’s, weswegen Ihr Euren Sohn verstoßen habt. Valentin ist an dem Verbrechen unschuldig gewesen!“
„Jesus Maria!“ rief der Thürmer und rang die Hände — aus Verzweiflung — aus Glückseligkeit? Dann setzte er mit starrem Blicke bei:
„Wie wißt Ihr denn das?“
„Könnt Ihr Euch an den Juden Moses noch erinnern?“
„Er ist bald darauf aus der Gegend gezogen. Ich weiß nur, daß er so häßlich als geizig gewesen ist.“
„Häßliche Juden haben oft hübsche Töchter,“ sagte der Geistliche; „sollte der Moses keine solche gehabt haben?“
„Ja, ’s ist schon recht, er hat eine gehabt, derentwegen hat er ja fort müssen, weil sie die Burschen von ganz Münsterwald verhext haben soll.“
„Und könnte sie Euren Valentin nicht auch verhext haben?“
Der Alte horchte auf.
„Könnte er nicht in die Kammer der jungen Jüdin haben steigen wollen?“
„Heiliger Gott!“ rief der Thürmer, „Ihr sagt es doch, warum hätte er das selber nicht gesagt?“
„Meint Ihr, daß Euer Sohn nicht so albern gewesen sein könnte, aus Furcht vor dem Prälaten und der Entziehung der nöthigen Gnaden den Besuch bei der Jüdin zu verschweigen?“
„Nein, nein,“ sagte der Alte, „solcher Dinge wegen, so wichtig sie für meinen Sohn waren, opfert man den ehrlichen Namen nicht.“
„Oder meint Ihr nicht, daß Euer Sohn so ritterlich sein konnte, die Ehre des Mädchens mit seiner eigenen zu erkaufen?“
„Was sagt Ihr da?“ fuhr jetzt der Thürmer wie aus einem Traume erwachend empor, „seid Ihr, Mann Gottes, seid Ihr allwissend? Ja, ja, so war’s, so mußte es gewesen sein, nicht anders! O, ich unseliger Mensch, daß mir erst jetzt ein Licht aufgeht!“
Dann schrie er zornig auf: „Und warum hat er mir’s nicht vertraut? Sag’ mir Einer, warum hat er es seinem Vater nicht vertraut?“
„Hat er nicht zu Euch flüchten wollen? Ihr habt sein Herz getroffen. Ein vom Vater als Dieb und Einbrecher verschrieener Sohn kann nicht mehr zurückkehren.“
„Ich bitt’ Euch, habt Erbarmen und martert mich nicht zu Tode. Um Gotteswillen sagt, wo habt Ihr ihn gesehen? Lebt er? Wo ist er? Ich such’ ihn auf, ich muß meinen Valentin wiedersehen.“
„Er ging über das Meer. Es war Trotz in ihm. Er hat sich dazumal vorgenommen, nicht eher in seine Heimat zurückzukehren, als bis seine Ehre wieder hergestellt ist und sein Vater das Wort zurückgenommen hat. Käme er heute, nach neunzehn Jahren, was meint Ihr? Er würde noch zu früh kommen.“
„Kommen, kommen soll er, ehe ich alter Mann von dieser Welt fort muß! Ich bin von seiner Unschuld nun auf einmal überzeugt, o Gott, erst heute! erst heute! Ja, die Jüdin, es kann nicht anders sein. Kommen soll er, sehen will ich mein Kind wieder.“
„Beruhigt Euch, guter, armer Mann,“ sagte der Missionär, „er wird wohl kommen. In Münsterwald ist er vergessen; das ist der beste Segen für einen ehrlos Gewordenen: vergessen sein. Wenn es aber plötzlich heißt: der Sohn des Thürmers ist wieder da, so werden Einige fragen: der alte Thürmer, hat denn der einen Sohn? Ja, werden Andere sagen, das ist der Dieb, der Einbrecher beim Wantschel-Moses. Ihr müßt von der Geschichte damals ja gehört haben. — Und so wird’s wieder lebendig.“
„Ich will es vom Thurme ausrufen, daß er unschuldig ist,“ sagte der Thürmer.
„Das ist nicht nöthig. Euer Sohn gehört nicht mehr zu Denen, deren Glück und Frieden davon abhängt, was die Leute über ihn sagen. Der Beruf, den er gewählt, giebt Beweis, daß er nicht der Mann ist, der des Mammons wegen beim Juden einsteigt. — Valentin hat in einem katho[S. 453]lischen Priesterhause Nordamerikas seine Studien vollendet, dann stieg er hinab in die ungeheueren Landstriche westlich des Lorenzostromes, um jenen wilden Völkern menschliche Gesittung zu verkünden. Wie oft hat ihn das Heimweh angepackt, das Andenken an den Vater gepeinigt! In den ersten Jahren hat er Euch brieflich seine Unschuld betheuert, aber es kam die Antwort nicht zurück.“
„Ich weiß von keinem Brief!“ sagte der Thürmer.
„Ihr habt ihn eben nicht erhalten, erst viel später habe ich erfahren, daß jenes Schiff, welches das Schreiben an Bord hatte, auf hohem Meere zugrunde gegangen war. So ist es gekommen, daß Ihr von Eurem Sohne nichts mehr gehört habt. Vierzehn Jahre lang hat Valentin mit seinen Genossen in Canada gewirkt, bis sie in Entbehrung aller menschlichen Bedürfnisse fast selbst zu Wilden geworden waren. Ohne Erfolge, nur mit dem Bewußtsein in der Brust, ihre Pflicht erfüllt zu haben, kehrten sie zurück und ich schloß mich aus Sehnsucht, mein Vaterland wieder zu sehen, einer nach Europa abgehenden Missionsgesellschaft an.“
„Wer? Ihr?“ fragte der Thürmer, „ja, waret Ihr denn dabei?“
Da faßte der Priester die beiden Hände des Alten und sagte: „Vater, wollt Ihr Euren Valentin denn gar nicht mehr erkennen?!“
Am selbigen Christabende soll zu Münsterwald das Ave-Marialäuten so seltsam geklungen haben. Die Glocken hatten einen überaus hellen Ton, so daß die Leute sagten: „Es wird das Wetter umschlagen.“ Und als es eine Viertelstunde fort gegangen war, hoben sie ihre Gesichter gegen den Thurm und riefen: „Na, hört er denn heute nicht auf zu läuten?“
Der alte Mann läutete und läutete — vergaß in der Freude auf das Aufhören. —
Die Missionspriester blieben noch einige Tage in Münsterwald.
Immer größer wurde der Andrang zu ihren Predigten und ihren Beichtstühlen. Spät Abends noch stieg der Schwarzbart täglich in den Thurm hinauf. Die Leute meinten, der Pater sei sicherlich ein Sterngucker und betreibe von den Thurmfenstern aus seine Studien.
Einmal, es war am vorletzten Tage der Mission, kletterte auch ein Anderer die finstere Stiege empor, der wohl in seinem Leben nicht gedacht haben mochte, daß er einmal einer gar absonderlichen Angelegenheit wegen auf den Münsterwalder Kirchthurm sollte steigen müssen. Es war der Korbflechter Martin aus Grabendorf, welches Dörfchen als Vorort von Münsterwald gilt. Der hatte heute mit dem Thürmer zu sprechen. Es ging aber ungelenk, denn der Thürmer war schwerhörig und der Korbflechter heiser. Es sprach sich ungern aus, was ausgesprochen werden mußte. Unten durch das Beichtstuhlgitter hatte es sich so leicht hineinflüstern lassen, denn das wußte der Martin, was man dem Beichtvater sagt, das sagt man dem Grab. Und darauf rechnete er. Aber diesmal saß der Schwarzbart drinnen; der war sonst der Gütigste und jetzt auf einmal der Strengste, der verweigerte dem Beichtenden die Absolution.
„Zu Dir hat er mich heraufgeschickt, Thürmer,“ berichtete der Korbflechter Martin, „Dir soll ich es beichten und wenn Du mich lossprechen könntest, so wollte er es auch thun. Das ist hart für mich! Es hat mir ja schon lange kein Gut gethan da drinnen, schon lange hätte ich Dir’s gern anvertraut, aber Du kannst Plaudern, Dir verwehrt’s[S. 455] Niemand, und dann hetzen mich die Leut’ aus, wie sie den armen Valentin ausgehetzt haben. Ich will Dir’s sagen, mein lieber Thomas, Du kannst unchristlich sein und einen armen Familienvater zugrunde richten, kannst es! freilich kannst es! aber darum wird Dein Sohn doch nicht mehr zurückkehren; im Himmel wirst ihn sehen, wenn Du mit mir barmherzig bist!“
„Was weißt Du denn für eine schreckbare Sach’, daß Du einen so großen Anlauf nimmst?“ fragte der Thürmer.
„Dir mag’s vielleicht nicht schrecklich sein, wenn ich Dir sag’, daß Dein Valentin dazumal ganz unschuldigerweis’ fortgejagt ist worden?“
„Das sagst Du mir nicht mehr, mein lieber Martin.“
„Weißt Eins, ist’s gut; aber das Andere weißt Du doch nicht!“
Jetzt hob sich in der Glockenstube knarrend der Hammer. Der Korbflechter zuckte zusammen, aber der Thürmer sagte: „Es wird Dich doch nicht erschrecken, wenn die Uhr schlägt!“
„Oh, seit vielen Jahren kann ich das Uhrschlagen nicht mehr hören,“ versetzte der Martin, „ich fürchte mich vor der letzten Stunde. Ich sag’ Dir’s, Thomas, das Geheimniß möchte ich nicht mehr länger tragen, hör’ mir zu: Daß Dein Sohn als Einbrecher ist ausgeschrieen worden, das kommt von mir!“
„Was ist das?“ rief der Thürmer, „jetzt muß ich aber doch unrecht verstanden haben. Ach, was man taub wird! Sag’s noch einmal.“
„Ich habe den Valentin in Verdacht gebracht,“ sprach der Korbflechter, „der jungen Jüdin wegen ist’s hergegangen, der Tochter des Moses wegen. Die hab’ ich oftmalen auf[S. 456]gesucht, und just das, hab’ ich vermeint, wird mir der Beichtvater nicht verzeihen mögen. Aber das ist noch wundersleicht gegangen; wie ich ihm jedoch das letztere habe erzählt daß ich auf den Thürmerssohn Valentin, der sich auch ein Weniges an die Jüdin gemacht hat, eifersüchtig bin gewesen, daß ich ihm in derselbigen Nacht bei dem Judenhäusel aufgepaßt habe und Leut’ zusammengerufen und ihn abfangen lassen und ausgeschrieen: des Juden Geld hätt’ er sich holen wollen — da ist der Beichtvater mit seinem Latein zu End’ gewesen.“
„Du hast gewußt, daß es nicht um’s Geld? — daß er sich beim Mädel wollte anmelden? Hast Du das gewußt, Martin? hast Du das?“
„Das hab’ ich freilich gewußt. Und just da ist er mir im Weg gewesen.“
„Martin!“ murmelte der Thürmer, „hättest Du — wenn Du schon schlecht hast sein können — ihn beim Prälaten verklagt: der dürfte die Liebschaft zwischen dem Theologen und der Jüdin schon verhindert haben.“
„Wer weiß es?“ warf der Martin ein, „höchstens, daß er den Valentin nicht weiter hätte studiren lassen; da wäre der Valentin in Münsterwald geblieben und mir erst recht im Weg gestanden. Sie hat ihn lieber gehabt, als mich. Wie mir’s dazumal ist gewesen, Thomas! — Heut’ versteh’ ich’s ja selber nimmer, wie der Mensch so sein kann — aber wie es mir dazumal gewesen, so hab’ ich mir heilig wahr keinen andern Rath gewußt, als den: du mußt ihn sicher machen.“
Jetzt drehte sich der alte Thürmer ein wenig, schaute den Korbflechter an und murmelte: „Wie Du dastehst, noch alleweil hübsch bei Person und soweit in Ansehen bei den Leuten, wohl, wohl! — hättest Du vorig’ Jahr nicht Ge[S. 457]meindevorstand von Grabendorf werden sollen? — so kennt man Dir’s bei Gott nicht an, was Du für ein grundschlechter Mensch bist.“
„Mußt nicht so, Thomas, mußt nicht,“ sprach der Andere und hielt seine Hände bittend zusammen, „denk’ Dir, ich bin verblendet gewesen in meiner Begier’ und hab’s nicht wissen können, daß mein Spitzbubenstreich so grob für den Valentin sollt’ ausfallen. Nun, wie ich gesehen, was angerichtet worden ist, da hab’ ich nicht mehr die Kurasch gehabt, daß ich’s laut gemacht hätt’: Er wär’ der ehrliche Mann und ich der Schurk. O, mein Gott, wenn Du wissen könntest, Thürmer, was ich wegen dieser Geschichte schon ausgehalten hab’! Kein aufrichtiges Beten und kein ruhiges Schlafen die langen Jahre her, und so oft ich vom Thurme eine Glocke hab’ gehört, ist’s mir gewesen: jetzt schreit sein Vater wieder zum gerechten Herrgott auf. Was hab’ ich umhergewurmt, daß ich doch einmal etwas vom Valentin hören sollt’; ich habe nichts von ihm gehört; Du auch nicht, gelt, und jetzt weißt, warum ich Dich so oftmals hab’ gefragt, ob Du von Deinem Sohne nichts mehr hättest vernommen, bis Du mich einmal angefahren, was ich mich so viel um den Lumpen zu scheren hätt’! Da hab’ ich genug gehabt, hab’ nicht mehr gefragt — aber still ist’s in mir nimmer geworden. — Und jetzt auf einmal, mein Thomas, jetzt ist mir so leicht, daß ich Dir möcht’ um den Hals fallen, wenn ich nicht müßt’ vor Dir auf’s Knie und bitten: Verzeih’ mir’s, verzeih’ mir’s!“
Da lag der Mann vor dem Alten auf dem Boden; der Alte ließ ihn nicht lange liegen.
„Mir selber hat erst vor etlich’ Tagen Einer verziehen,“ sagte der Thürmer, „so verzeih’ ich Dir auch. Geh’ zu[S. 458] Deinem Beichtvater und sag’ ihm’s; vielleicht kann er Dich absolviren.“
„Aber jetzt,“ murmelte der Korbflechter, seine Augen waren naß, „jetzt kommt freilich erst das Schwerste. Du wirst es den Leuten sagen wollen, wie’s steht; ich kann Dir’s auch nicht verdenken — Du wirst Deinen guten Namen und das Andenken Deines Valentin wieder weiß machen wollen, Du hast ja Recht, und das thät’ Jeder — aber was wird aus mir armem Teufel werden, aus meinem Weib und meinen Kindern?“
Der Thürmer schaute in die Glockenkrone auf, in der erst vor Kurzem wieder das Lied vom heiligen Christ geklungen war und dann nahm er den Martin an der rechten Hand und sprach: „Sei ohne Sorgen. Wenn ich gesagt habe, ich verzeihe Dir, so ist Dir verziehen und vergessen. Es wird keine Rede mehr davon sein. Die alte Zeit ist vorbei, die Leute haben an der neuen genugsam zu schaffen, so sei Alles begraben.“
„Thomas!“ sagte der Martin, „wie bist denn? — Als in der heiligen Nacht diese Glocken gerufen, da haben die Kinder gesagt: Die Engel thäten läuten! ’s ist keine Mär’, Du bist ein Engel!“
„Laß das sein, mein lieber Martin, was ich Dir versprochen hab’, das kommt mir leichter an, als Du glauben magst. Geh’ jetzt heim zu Deinen Kindern!“
„Wirst sehen, Thürmer, was ich noch thu’!“ rief der Korbflechter und knarrte die Stiege hinab.
Am nächsten Tage stieg der Schwarzbart noch einmal in den Thurm hinauf, um von seinem Vater wieder Abschied zu nehmen. — Niemand sollte wissen, wer sich hier gefunden hatte, Niemand sollte ahnen, daß in diesem Pater Christof[S. 459] der vor neunzehn Jahren wegen Einbruch ausgehetzte Valentin stecke.
Und als Vater und Sohn in der Thurmstube noch beisammen saßen und sich bemühten, etwas Wein zu trinken, der da war, um die Betrübniß des Abschieds zu mildern, entstand unten auf dem Kirchplatz plötzlich eine Bewegung, ähnlich der am Himmelfahrtsmorgen vor neunzehn Jahren. Ob das wahr wäre? riefen die Stimmen. „Wir wollen den Thürmer sehen!“
Bevor dieser noch geholt werden konnte, stürmten sie schon die Stiege hinan in die kleine Wohnung des alten Thomas.
Die Münsterwalder hatten auf Valentin nicht vergessen, nur aus Rücksicht für den Alten die Geschichte liegen lassen. Nun war Alles wieder lebendig, und sie schrieen es dem Alten in’s Ohr, was damals der Korbflechter Martin gethan habe.
„Wer hat Euch’s erzählt?“ fragte der Thürmer.
„Der Martin selber. O, Gott, der Valentin!“ riefen sie nun, „wie mag’s dem armen, jungen Mann ergangen sein. Der hat sich gewiß aus Verzweiflung das Leben genommen!“
„Nein!“ sagte der Pater Christof, „seid Ihr doch wunderliche Leute, kaum Ihr ihn von einer Schuld freisprecht, klagt Ihr ihn der andern an. Ein Mord — und der Selbstmord ist auch einer — läßt gar nicht besser, als ein Einbruch. So vertheidige ich den Valentin, er hat sich nicht umgebracht, er steht vor Euch.“
Stand vor ihnen und ging zur selben Stunde wieder von ihnen fort. Sein letztes Wort an die Leute von Münster[S. 460]wald war die Bitte, dem Korbflechter Martin dieser vergangenen Geschichte wegen nichts Schlechtes nachzutragen — das freiwillige Geständniß hätte Alles gelöscht.
Der alte Thomas blieb auf seinem Thurme und blickte den abziehenden Priestern nach, so lange er sie sehen konnte.
Und als die Gestalten verschwunden waren, hob er sein feuchtes Auge gegen Himmel empor. — Dort soll ja für alle Gerechten und Büßer ein Wiedersehen und ewige Seligkeit sein.
as Glöcklein der Dorfkirche klingt hell und freudenreich zu meinem Fenster herein. Einen Sarg tragen sie zum Kirchhof hinaus und bergen ihn unter die kalte Erde. In diesem Sarge liegt ein Dienstbote, der gestern seinen hundertjährigen Geburtstag begangen hätte — aber vorgestern ist er gestorben. Der Armenvater hat schon Anstalten getroffen; das hundertjährige Weiblein hätte gestern eine warme Bettdecke und ein Glas kräftigen Weines bekommen; der Pfarrer hat ihr die Ehre erweisen und sie an seinem Arme in die Kirche vor den Hochaltar begleiten wollen — da ist sie vorgestern in der ruhsamen Abendstunde verschieden. Sie wäre die Gaben und die Ehren nicht gewohnt gewesen, sie hätte sich geschämt bis in’s Herz hinein. Aber der Tag kam näher und näher; es wurde im Dorfe schon gesprochen davon, und die Schulkinder flochten einen Kranz aus Lärchenzweigen und Hollunderlaub. Die alte Aga hätt’ nimmer fliehen mögen, denn ihre Beine sind gewesen wie morsche Hanfstämme im Spätherbst, die hätten sie nicht weiter getragen, als eine Schnecke mag kriechen während der Abendröth’. So hat sie keinen andern Ausweg gewußt und so ist sie verstorben.
Die Ehren sind ihr nicht ausgeblieben; heute hat sie der Pfarrer zu Grabe begleitet, heute hat sie den Kranz bekommen und die warme Decke. Den Wein mag sie trinken am Tage der Urständ’, daß sie Muth kriegt, dem Herrn zu sagen: Ich bin ein armer, ein sehr armer Dienstbot’ gewesen mein Lebtag lang, jetzt bin ich da und bitt’ um den Himmel!
Zum Glück hat ihr heiliger Schutzengel ihren Lebenslauf in sein Notizbüchlein geschrieben, und während er jetzt am Grabe steht und den Stein mit einem Zeichen merkt, daß er ihn mag finden am Tage des Gerichtes, da jeder Schutzengel sein Schutzkind muß wecken — guck’ ich ihm in sein Büchlein, und schreib’ mir flugs heraus den Lebenslauf der alten Aga.
Ihre Mutter ist ein Weib gewesen, das verstanden hat, aus den Stämmen des Waldes Kohlen zu brennen für den Schmied im Thale. Ihr Vater ist ein fröhlicher Jägersmann gewesen im grünen Walde, bis ihn einst drei Männer, Wildschützen, haben erschlagen. Aga hat Wangen gehabt, so blühend, wie die kleinen, rothen Blümlein, die in des Waldes Schatten sind gestanden, und die niemals die Sonne haben gesehen, sondern nur das Morgenroth zwischen den Stämmen. Aga hat Augen gehabt, so schwarz und glühend wie die Kohlen, die in des Meilers Gluthenbrust haben geknistert. Aga hat ein Herzlein gehabt, so lustig und fromm, wie die Lerche, die über dem Wald mit ihrem Flug in’s Himmelblau den Namen Gottes hat geschrieben.
Da ist eines Tages aus dem Thale her ein schöner, vornehmer Mann gekommen, daß er Kohlen besehe und kaufe für die Schmiede seines Hauses, denn er hat ein großes Landgut gehabt und sich die Pflüge und Spaten selber geschmiedet. Der hat Aga gesehen. „Willst Du mit, schönes[S. 463] Kind, in meinen Hof, und mein treues Dienstmägdlein sein? Vielgutes Silber will ich Dir geben, das glänzt besser, wie die Kohlen in Deinem Meiler!“ So hat der Mann gesagt, aber: „Was hilft mir des Silbers vielgutes Glänzen, wenn’s nicht warm macht, wie meine Kohlen. Ich will bei Mütterlein leben und verbleiben,“ so ist die Antwort gewesen.
Das hat sich zugetragen zur Zeit des Heidelbeerblühens. Und als darauf die Beeren gereift und wieder abgefallen waren mitsammt den rothfahlen Blättchen vom Heidegestrüpp — da sagte die Mutter: „Sechzehnmal hast Du die Herbstreife gesehen, Aga; Du bist nun wohl kräftig geworden und kannst morgen in’s Thal hinausgehen, zu sehen, wie die Leut’ leben im Sonnenschein, wie sie sich Häuser haben gebaut und inmitten das Herrgotts-Haus mit hohem Thurm; und daß Du Salz magst kaufen für unsern Hausbedarf.“
Nichts haben sie benöthigt von der weiten Welt, als das Salz, alles Andere ist in des Waldes Hängen gewachsen.
Und so band Aga ihren Hanfrock um und ging viele Stunden lang hinaus gegen das Thal. Da sah sie, wie die Menschen lebten im Sonnenschein und wie sie sich versammelt hielten um das Herrgotts-Haus zu Hunderten und zu Hunderten. Es war ja die Kirchweih. Und vom Thurme drangen Töne nieder, lebendig wie des Himmels Donner und freudenreich, wie der Waldvöglein Sang. Und aus den Häusern zitterten wunderliche Töne heraus, wie sie die Menschen zur Lustbarkeit selbst machten mit Pfeifen und klingenden Fäden. Da wußte Aga ihr Herz nicht zu beruhigen; sie brach in ein helles Lachen aus, daß der Menschen Menge um sie zusammenströmte.
Zur selbigen Stunde hatte sich der schöne vornehme Mann, der zur Heidelbeerblüthe in den Wald war gekommen,[S. 464] zu Aga gesellt, und sagte ihr Worte so freundlich und liebreich, wie sie solche von der Mutter daheim niemalen hatte sprechen gehört. Darauf führte er sie in ein schönes weißes Haus und setzte sich mit ihr an einen Tisch, und darauf brachten Andere dienstfertig funkelnde, durchsichtige Becher und schneeweiße Teller mit gebratenem Fleisch und Backwerk in Ueberfluß.
Aga hatte sich kaum zu essen getraut; ein blaues Tüchelchen that sie hervor: „Und wenn das vornehme Essen da schon mir ist vermeint, so will ich’s der Mutter heimtragen!“
„Das esse Du selber, Mägdlein,“ sagte darauf der freundliche Mann, „ich will Dir schon Geld geben, daß Du der Mutter was Anderes kannst bringen, und bei mir wird Dir nichts fehlen.“ So hat es sich Aga wohl schmecken lassen, und während sie aß, sagte der Mann zu Anderen, die nebenhin saßen: „Das wird fürder mein Hirtenmägdlein sein.“
So hat er sie gespeist und getränkt, hat ihr Geld gegeben, hat sie begleitet bis zur hohlen Buche, wo nach der Leute Reden ein Schatz liegt verborgen. —
Mitten in der finstern Nacht ist’s gewesen, als Aga die zitternde Hand an das Faßlich der Thür hat gelegt, die Mutter hat aufgeschreckt und ihr erzählt von dem freundlichen Mann, der sie gespeist und getränkt und sie mit wohlsamen Bissen habe versehen zum Heimtragen. Drauf hat die Frau nicht sonder Harm die Worte gesprochen: „Ist’s redlich gemeint von dem Mann, so wollen wir itzt beten für ihn!“
Sodann fiel ab das Brombeerlaub, und auf den fettigglänzenden Beeren lag der ätzende Reif und bald auch der Schnee, und es kamen die Tage, da sechzehn Stunden hindurch die Nacht lag über dem Wald, und Mutter und Kind[S. 465] sich fest aneinander mußten schließen, daß Grauen und Sorgen ihre Herzen nicht mochten erklimmen.
Da zogen eines Tages watend im Schnee, der ihnen ging bis an die Lenden, zwei Männer heran gegen der Köhlerin halb vergrabene Hütte, und grüßten mit Anstand und verlangten — das Mädchen. Da fragte die Mutter erstaunt, weß Rechtes das sei, ihre Tochter zu heischen. Und da wiesen die Männer das Recht: sie seien gesandt von dem Manne, der zur Kirchweih Aga das Angeld und das Leihkaufmahl habe gereicht, durch deß’ Annahme das Mädchen sich gesetzlich verpflichtet habe, dem Manne in seinem Hofe ein Jahr lang zu dienen.
Wie war da rathlos die Mutter und trostlos die überlistete Tochter. Doch hätten sie auch dem Gesetz widerstrebt, den kräftigen Männern vermochten sie nimmer zu trotzen, und fortgeführt wurde Aga von der Mutter Hütte. Und die Frau blieb zurück im einsamen Wintergrab, und fuhr mit eisernem Haken dem Meiler in die glühende Brust, und sendete mit dem schneeweißen Rauch empor zu Gott ihr Gebet für das Kind.
Bigott, man meint, das Mägdlein hätte es nicht übel getroffen. Sie war Hirtin im großen Gehöfte und konnte der Mutter manch’ nützliche Gabe senden.
Da der Winter vorbei und die Maßliebchen der Heide ihre weißen Krönchen aufsetzten, da kam mancher Junge zum schönen Hirtenmädchen und freite. Aber Aga hatte gegessen und getrunken darauf, daß sie ihrem Herrn diene ein ganzes Jahr. Sollte aber des holden, ehrsamen Freiers Lieb’ nicht verdorren in des Sommers Hitz’ und nicht verwelken in des Herbstes Frost, und nicht erfrieren in des Winters Kälte, so möchte er wiederkommen zur Weihnachtszeit — sie wolle bei[S. 466] der nächsten Kirchweih nicht mehr essen und trinken für ein künftig Jahr. Aber der schöne, liebreiche Mann, bei dem Aga hat gedient, hat sie eines Tages — als schon der Nachtwächter das erstemal gerufen — gefragt, ob sie nicht die Hausfrau sein wolle in seinem Hofe, da könne sie ein freundlich Stübchen heizen für die Mutter, die jetzt noch im kalten, finsteren Wald sei. Da hat sich Aga gedacht, was das für ein glückliches Kind, das seiner Mutter die alten Tage so liebevoll könnte versüßen. — — —
Darauf hat der Nachtwächter das zweitemal gerufen.
Aga hat zur Kirchweih nicht gegessen und getrunken für ein künftig Jahr, aber, als hernach die Weihnacht ist gekommen, da hat sich kein Freiersmann mehr eingefunden, und der Dienstherr hat gesagt: das Mägdlein könne bei ihm noch eine Weile der Schafe Hut besorgen oder gehen, wohin es ihm beliebe — er halte es nicht auf.
So hat Aga ihr Eigenthum in ein Sacktüchlein gebunden, hat einen Stock in die Hand genommen und ist im Schnee dem Walde zugegangen. Auf der Kohlstatt ist der Meiler verloschen gewesen, in der Hütte auf dem Stroh ist die Mutter gelegen — kalt und starr, mit einem Eistropfen auf der Wange.
Aga ist gegangen zu einem Kleinhäusler am Waldesrain und hat gefragt, wie lange sie müsse dienen und arbeiten?
Darauf hat sie der Häusler angesehen vom Fuß bis zum Kopf, und hat die folgenden Worte gesprochen: „Zehn Jahre lang mußt Du mir arbeiten, daß Du Dein Kind gebärst unter meinem Dache.“
An einem und demselben Tage ist’s gewesen, da ist die Mutter begraben und das Kind geboren worden. Dann haben die zehn Jahre gewährt in langer Noth und Drangsal.
Und als die zehn Jahre vorbei, da ist immer noch gestanden das kleine rothe Blümlein in des Waldes Schatten, aber Aga ist verblüht gewesen. Gott bewahre den Dornstrauch, daß der Sturm seine Rosen nicht mög’ entblättern!
Aga ist Dienstmagd gewesen und sie ist Dienstmagd geblieben, geradeaus siebzig Jahre. Da hat sie das ganze weite Thal wohl dreimal umackert mit bluteigener Hand und zu jeglicher Kirchweih hat sie sich wieder ein neues Jahr der Lasten zugetrunken.
Und als ihre Kräfte dahin waren ganz und gar, da hat sie Umschau gehalten in ihrer Ersparniß. Einen silbernen Zwanziger hat sie zu eigen gehabt; denselben hat sie einst in ihrer Mutter Hütte gefunden und ihn als Erbe bewahrt. Was sie sich sonst erworben in Fleiß und Schweiß, das hat eigene Noth und ihres Kindes Siechthum gefressen. So hat es Aga erfahren, wie die Leut’ leben im Sonnenschein. Da hat sie wohl sehnend gedacht der schattigen Heimat, der sie durch Arglist so schmählich entlockt ward.
Nachdem sie der Gemeinde tausend und tausend Scheffel üppigsten Korns aus der Erde gegraben, saß sie nun altersverwaist auf des Dorfes grüner Markung.
Da haben sie die alte Aga in’s Armenhaus verwiesen. Oft ist sie gesessen auf dem hölzernen Bänklein und hat die halberblindeten Augen aufgemacht, daß noch einmal der Erde farbiges Licht sollt’ hineingleiten in ihre Seele. Sie hat die milden, sonnigen Tage nicht belobt; sie hat der trüben, stürmischen Zeit nicht gegrollt. Ihr ist Alles recht gewesen und sie hat gebetet für die Gemeinde, die ihr das Gnadenbrot nicht wollte versagen. Wie es mit ihr so gekommen war, das hatte sie niemals gefragt. Der schöne vornehme Mann, den sie einst zur Zeit der Heidelbeerenblüthe zum[S. 468] erstenmale hatte gesehen, lag seit fünfzig Jahren schon nicht mehr in seinem Grabe, in das ein früher Tod ihn hatte gestürzt. Wer längst begrabener Todten Asche wollt’ suchen: im Friedhofsgrunde findet er sie nicht mehr. —
So war ein hundertjähriges Leben voll Armuth und Drangsal vergangen, da nahte der Tag der Ehren. Du guter, wohlthätiger Tod, hast sie freundlich diesem Hohne der Erde entführt. — — —
Der Stein ist gemerkt und der Engel geht hin und zeichnet die Geschichte dieses armen Erdenkindes in das Buch des Lebens ein.
Und das Glöcklein der Dorfkirche schweigt.
ie schritten durch den Klosterpark Arm in Arm.
Dominicus bog mit einer Hand das kühle Reisig der jungen Tannen auseinander, denn es ist ein Naturwäldchen, das gerade noch so viel Wildheit übrig läßt, um den Spaziergang reizend zu machen. Der Mann geht fertige Wege niemals mit Lust, er muß sie bahnen können; er will nichts zu Gnaden, will sich seine Straßen selber schaffen.
Der Andere — Lorenz — schürzte sein Ordenskleid, weil es ihm im Gehen hinderlich sein wollte. Schon setzte er seine ganz weltlich-kleinen Füße voran, während sein Kopf sich mehrmals nach rückwärts wendete. Der Guardian war nämlich, was der Guardian sein muß: ein gestrenger Mann, der es nicht gern sah, wenn zwei Priester seiner Abtei Arm in Arm gingen — denn der Orden schreibt Einsamkeit vor; sah es nicht gern, wenn sich Zwei gegenseitig in’s Gesicht lächelten — denn der Orden schreibt Selbstbeschaulichkeit vor; sah es auch nicht gern, wenn Einer zu tief in den Wald hinausging — denn der Orden sprach von den heiligen Mauern. — Nun, wenn’s Ehrwürden nicht gern sieht, so braucht er’s eben nicht zu sehen. So dachten die Beiden und schlichen durch die Büsche.
Es war ein heißer Juni-Nachmittag. Die Klosterglocke schlug drei Uhr.
„In solcher Schwüle kann man nicht arbeiten,“ sagte der eine Priester.
„Nur beten,“ versetzte der Andere.
„Beten? Kannst Du’s jetzt?“
„Beten, wie’s im Buche steht, kann man alle Zeit, wie’s im Herzen steht, nur selten.“
„Wie hältst denn Du’s mit dem Beten?“
„Für Andere kann ich, wann’s nöthig ist; wüßte auch nicht, warum ich ihnen nicht zu jeder Stunde Gutes sollt’ wünschen können. Aber für mich selber beten — Bruder, das geht mir zu seicht, da möchte ich lieber Hand anlegen. Ich möchte was bauen, was schaffen.“
„Warum denn nicht?“ versetzte Dominicus, „Gebete sind Bausteine, Worte sind Werkzeuge; damit hat man das ganze Kloster gebaut. Auch Guardians werden daraus gemacht. Wir sind noch in den Zwanzigern, Freund; müßte doch der Teufel ein Ei in die Kutte legen, wenn’s Einer von uns nicht zur goldenen Kette brächte!“
„Golden, golden — wenn’s doch immer eine Kette bleibt,“ sagte Lorenz gedämpft. „Du, Domini, hast ein Klostertemperament, dem man sicherlich einmal den Prälatenmantel umhängen wird. Bei mir thut sich’s anders. Mein Vater wollte einen Priester zum Sohne haben, darum soll ich — Niemanden zum Sohne haben. Du kennst das Häusel am Rain und den jungen Kopf, der gern zum Fenster ausschaut.... Soll es. Jedermann rühmt das Stift und seine guten Weine.“
Dominicus sah, daß hier keine Entgegnung vonnöthen war; er hob das Haupt und blickte gegen die blauenden[S. 471] Felswände auf. Ueber denselben stand ein Reigen milchweißer, scharfgeränderter Wolken.
„Eine Stadt aus Elfenbein mit Thürmen und Zinnen,“ sagte er, „das himmlische Zion.“
„Ein mißrathenes Gleichniß, Freund, oder Du mußt leiden, daß morgen, heute noch, das himmlische Zion vergangen ist.“
„Bruder! Bruder!“ rief Dominicus, „gieb Acht auf Deinen heiligen Glauben!“
„Komm, Domini, wir wollen zum See hinab.“
„Und Menschen fischen?“
„Will schon trachten, daß Einer im Wasser ist.“
„Wie, Du wolltest —?“
„Baden.“
„Und nicht der Weiber achten, die am Waldrande gern Beeren pflücken? — Einen Stiftsprediger im See zu sehen, was würden sie dazu sagen?“
„Ich möchte wissen, woran sie den Stiftsgeistlichen erkennen sollen! Meinst Du, ich bade mich in der Kutte?“
„Lorenz, verzeihe, Du bist heute frivoler, als je,“ bemerkte Dominicus, machte aber ein Gesicht dazu, dem man es ansah, daß der Vorwurf nicht abschreckend wirken sollte.
„Steigen wir nur hinab,“ sagte Lorenz, „ich glaube, an der Rothen Wand ist ja eine Badestelle; laß sie uns aufsuchen. Mir ist heute, als wäre mir was angethan; ich trage so was Heißes in mir, es jagt mich, es entzückt mich, es brennt mich. Heute wäre mir kein Roß zu hoch!“
„Vielleicht bist Du vom Teufel besessen!“ sagte der Andere.
„Dann laß’ ich mir ihn einstweilen nicht austreiben, Domini!“ rief er und schlang seinen Arm um den Gefährten. „Es ist eine Lust auf dieser Welt!“
„Wenn ich’s redlich will sagen, ich verspür’ auch so was. Es muß heute in der Luft liegen.“
Sie wandelten fort durch den Wald, sie kamen durch dichtbewachsenen Hag aus Buchen- und Haselnußsträuchen, und sie wandten sich in das Dickicht hinein. Sie huschten dahin, schwammen gleichsam im weichen, schattigen Laub, und Dominicus äußerte: „Helfe mir Gott, aber ein wildes Thier zu sein, hätte erst auch sein Schönes!“
„Kannst eins werden, wann Du willst,“ antwortete Lorenz.
Sie kletterten hinab und sahen durch das junge Gestämme den Schimmer. —
Sie standen am See, nahe an der Rothen Wand. Ringsum dichtes Laubgehölze, in welchem jede Knospe lauschend den Finger an den Mund zu halten schien und kein Blatt sich rührte. An der Wand rieselte eine Quelle; der See lag dunkelblau in tiefster Ruhe.
Hier standen die zwei jungen Priester und warfen scheue forschende Blicke um sich. — Dann begannen sie sich rasch zu entkleiden. Stück für Stück warfen sie die Ordenskleider in das Gras — und bald standen sie auf gut weltlich da. Dominicus war glatt rasirt, weil die Regel vorschreibt, am Gesichte die Spuren des Mannes auszutilgen. Die Locken waren kurz geschoren, weil die Regel vorschreibt, dem Teufel auch nicht Ein Haar zum Anfassen bereit zu halten. Am Scheitel war eine runde Glatze ausgeschnitten, weil die Regel durch solches weißes Scheibchen den Heiligenschein andeuten will, der das Haupt verklären soll. — Lorenz trug fast längere Locken, als die Ordensregel dulden wollte; wie junge Schlangen ringelten sie sich um die weiße Stirne und gegen den schlanken Nacken hinab; und er trug schönere und feurigere[S. 473] Augen, als es zum obligaten Blick gegen Himmel unumgänglich nothwendig ist. Auf seiner Oberlippe lag der ersten Reife leichter Schatten.
Ueber dem Buchenwalde her klang leise der Ton der Stiftsglocke, welche vier Uhr schlug. Noch zwei Stunden bis zur Vesper.
Lorenz hob die Hände und rief einem jungen Adler zu, der hoch über dem See schwebte: „Ich wollte, du flögest jetzt zur Kirchenuhr und hieltest mit deinen Krallen den Zeiger fest; wie kann ich mir denken, daß mir in zwei Stunden diese Welt wieder verloren sein soll!“
Dominicus schwieg und ging das sanft fallende Ufer hinab, und das weiche, kühle Wasser stieg empor an seinem schönen, jugendlichen Körper. Seine Glieder schimmerten wie Marmor so weiß durch das Wasser, seine Arme streckte er aus nach der milden Fluth, als drückte er die Wellen, die er schlug, an sein erwachendes Herz.
Lorenz ging einer tieferen Stelle zu und stürzte sich kopfüber in den See. — So verschieden war bei beiden Männern das Erfassen dessen, was ihnen durch das Verbot zur süßen Sünde gemacht wurde.
Lorenz war verschwunden, der genoß die Lust in ihrem tiefsten Grunde, verhüllt vom krystallenen Mantel. Dominicus gab sich nur bis zum Halse hin, sein Haupt stand über der Fläche des Wassers im Sonnenschein. So versuchte er’s, ob der Mensch nicht zu theilen wäre, das Herz der Erde, das Haupt dem Himmel.
Nun, der Himmel schien heute mit dem Haupte allein nicht zufrieden zu sein. — Die Sonne hat seit einer Stunde einen guten Sprung niederwärts gemacht, die Wolkenmauern ragten höher, als vorhin, und ein weißlicher Schleier ging[S. 474] ihnen voraus, in welchen sich die Sonne nun verhüllen wollte. Sie that’s, wurde glanzlos und sank endlich ganz hinter die lichtberänderten Wolken. Da lag der Schatten über dem See, der um so schwerer war, je heller früher der Sonnenschein gewesen. Auch die Luft war schwer und schwül; im Walde sang kein Vogel, am Ufer hüpfte manch’ verlorenes Heupferdchen ohne Schutzengel herum, so daß es plötzlich im Wasser zappelte. Am Steinhange bewegte sich das Kraut der Wildfarrn, tief und schwer Athem schöpfend, träge auf und nieder. Nichts war zu hören, als dort das Plätschern der Felsenquelle und hier das Gischten der Schwimmenden. Lorenz war endlich emporgetaucht und von seinen schwarzen Locken, die in Strähnen über Stirne und Nacken lagen, rieselte das Wasser.
Am jenseitigen Ufer saß in leichtem Sommerkleide eine Mädchengestalt, welche ihre Füße im Wasser badete. Die beiden Jünglinge im See wollten sich wenden und fliehen, aber ein warmer Hauch ging jetzt über den See, kurze Windstöße begannen auf der Fläche zu graben, das Wasser wurde wogend und trieb die Priester gegen das Ufer hin, wo jenes Mädchen saß.
Als das Mädchen die beiden Menschenköpfe von der Weite des Sees gegen sich herangleiten sah, wurde ihm unheimlich. Rasch zog es die Füße aus dem Wasser und floh in das Dickicht hinein.
Lorenz und Dominicus mußten, von den erregten Fluthen gepeitscht, an das Ufer springen und sahen sich nun rathlos nach Hüllen um, da sie ihre Kleider jenseits des Sees gelassen hatten. Dominicus fühlte heiße Lanzenstiche in seinen Körper dringen, wenn er an zwei Augen dachte, die, im Gebüsch versteckt, sich nach ihm richten konnten. Lorenz meinte, es sei[S. 475] auch für sie Beide das Beste, in’s Dickicht zu schlüpfen, und eilte so, aus Angst, von dem Mädchen gesehen zu werden — demselben nach.
Dominicus flocht rasch grünes Laub der Buchen um seinen noch in hellen Tropfen perlenden Leib und umging den rauschenden See, die Kleider zu holen.
Sie hörten das Murren nicht im Gewölke, sie sahen die Habichte nicht, welche über dem See kreisten, sich fast bis in die Nebel erhoben und deren Gefieder dann und wann wie von einem verlorenen Sonnenstrahl getroffen schimmerten. Und sie sahen auch den schwarzen, weißberänderten Schmetterling nicht, der über dem Busche flatterte.
Von der Rothwand wiederhallten die Schläge der fünften Stunde. Dominicus suchte den Gefährten und konnte ihn lange nicht finden. Als auch dieser sein priesterliches Gewand wieder angethan, gellte in den Haselsträuchen ein unterdrückter Schrei, und Lorenz zog den Andern hastig mit sich fort, um nach der Vesper zurecht in die Kirche zu kommen.
„Lorenz,“ sagte Dominicus, „Du bist gotteseifriger geworden im See.“
„Ich wünschte es Dir vom Herzen, Bruder,“ entgegnete der Andere, „daß auch auf Dich der Frieden gekommen wäre, welcher mich nun erquickt. Das erstemal in meinem Leben, daß ich ihn so empfinde.“
Das Wort hat ein Drittes gehört.
Sie stiegen den Hang empor, sie gingen durch den Wald, in welchem die Bäume rauschten, sie eilten dem Kloster zu, dessen Kirchthurmspitze wie ein Degen zum Pariren gegen die Wetterwolken aufstrebte. Leichten und heiteren Gemüthes waren sie, als sie sich zu den Brüdern gesellten, welche zerstreut mit[S. 476] Büchern in der Hand im Parke wandelten und sich nun anschickten, vor dem nahenden Gewitter Obdach zu suchen.
Helles Geläute verkündete die Vesper. Durch die weitläufigen Räume des Stiftes eilten die Priester im Chorgewand. Dominicus und Lorenz schritten feierlichen Ganges durch das hohe Portal.
In der großen gothischen Stiftskirche brannten bereits die Kerzen, sie flackerten, weil der Sturm, der außen toste, auch die weihrauchduftende Luft innerhalb der Mauern unruhig gemacht hatte. In den Kirchenstühlen knieten einige Andächtige und beteten bedrängten Herzens um Erhaltung der Erdfrüchte. Eigennützige Beter sind stets die andächtigsten, und der Glaube ist vor der Gefahr größer, als nach derselben.
Im Chorraume befanden sich an beiden Seiten der großen, reichverzierten Orgel, gelehnt an die Mauer, die Bänke der Chorgeistlichen. Ueber denselben waren zwei Zifferblätter angebracht, die durch lange Eisenstangen mit dem Uhrwerk hoch im Thurme in Verbindung standen. Die metallenen Zeiger auf diesen Zifferblättern deuteten noch einige Minuten vor sechs.
Das Murren und Brausen war mächtig, doch die Orgel übertönte jetzt in tiefen, feierlichen Klängen das Wettertosen. Nun nahte in doppelter Reihe das Chorpersonal; es neigte sich gegen den Hochaltar und vertheilte sich dann in die zwei Bänke an den Wänden. Dominicus war der Mittlere in der rechten Reihe, Lorenz kniete ihm gerade gegenüber. Die Augen Beider wechselten einen Blick, in welchem die weltlichen Stunden, die sie eben verlebt hatten, ausdrucksvoll sich wiederspiegelten. — Das Glöcklein der Sacristei klingelte, der Prälat, von drei Diakonen umgeben, in reichem Ornat, trat zum Altare.
Es schlug sechs Uhr. Die Orgel verstummte, der Gesang begann. Erhaben wie ein Hymnus der Seligen, weich und innig, wie das Ahnen und Sehnen des menschlichen Herzens, schwer und bang, wie die Klage verlorener Seelen — so ertönte das Lied der Priester. Dominicus richtete seinen Blick zur Höhe; Lorenz senkte sein Auge zu Boden; was Ersterer im Geiste sah, das weiß man nicht; was Letzterem sich noch einmal wiederspiegelte, wäre schier zu errathen. Sein Antlitz war geröthet in Andacht — in Andacht dessen, was er schaute. Sein Gedächtniß brauchte nicht weit zu fliegen, was vor diesen eben vergangenen Stunden gewesen in seinem Leben, daran war nichts zu suchen. —
Große Tropfen und Schloßen schlugen an die Fenster; da — jählings war ein wilder Feuerstrom, ein schmetternder Knall — — die Mauern des Gotteshauses schienen gewankt zu haben, die Sänger waren stumm. Die Blasebälge der Orgel schnauften ächzend aus, die Kerzen waren verloschen, dichter Qualm erfüllte den Raum. —
„Der Blitz hat eingeschlagen!“ Dieser Ruf ging durch das Kloster. Alle eilten durch Guß und Hagel der Kirche zu. Mehrere hatten es gesehen, wie die Flammenzungen niedergezuckt waren auf den hohen Thurm. Die Leute in der Kirche taumelten halb bewußtlos umher. Man begab sich auf den Chor; hier lagen die Priester auf dem Boden, in Ohnmacht, nach Athem ringend. Nur zwei knieten noch auf ihrem Platze und falteten die Hände und senkten das Haupt. Sie knieten unmittelbar unter den beiden Zifferblättern, welche die sechste Stunde zeigten. Man rief sie beim Namen. „Bruder Dominicus!“ „Bruder Lorenz!“ — Sie bewegten sich nicht. Man faßte sie an — jetzt sanken sie zu Boden. Die Silberschließen an ihren Chorröcken waren geschmolzen.
Zwei junge Leben waren dahin.
Nun fragen wir Alle: Warum?
Während sie das erste- und einzigemal die Hand ausgestreckt hatten nach dem Ziele junger Herzen, bereitete sich in den Wolken des Himmels schon die Schlachtkeule, und dann schoß der Funke herab auf den Thurm, fand seinen Weg die eisernen Stangen entlang zu den Metallzeigern der Uhr und an diesen senkrecht nieder — in ihr Leben.
Die fünfte, die siebente Stunde hätte den Blitz vielleicht abgewendet! — Was ist über den seltsamen Umstand nicht gesprochen, nicht gedeutelt worden! Und die Moral dieser Begebenheit? Grübelt keiner nach. Das Fatum, der Zufall kennt keine Moral.
Die Todten wurden in einem Saale des Klosters aufgebahrt, und die Zeiger über den Chorstühlen rückten weiter und weiter.
K. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien.