
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Talisman
Ende Oktober des vorigen Jahres kam ein junger Mann ins Palais Royal und stieg, ohne zu zögern, die Treppe zum Spielsaale Nr. 36 empor. Das geschah bald nach der Stunde, um welche das Gesetz, das eine für den Staat so einträgliche Leidenschaft wie das Spiel begünstigt, das Öffnen der Spielsäle erlaubt. »Herr, Ihren Hut, bitte …« rief ihn ein kleiner, ausgeblichener alter Mann mit trockener, knurriger Stimme an; er hockte im Finstern hinter einem Holzschranken, erhob sich nun plötzlich und zeigte sein gemeines Gesicht.
Das Gesetz der Spielhäuser beginnt damit seine Geltung zu erweisen, daß es die Eintretenden ihrer Hüte beraubt. Das ist ein schicksalhaftes Gleichnis wie aus dem Evangelium. Aber viel mehr noch ist es eine teuflische Art von Vertrag, der den Eintretenden zu einer ihm unbekannten Zahlung verpflichtet – und zugleich eine respektvolle Haltung gegen die von ihm fordert, die ihm sein Geld abnehmen werden. Oder möchte vielleicht nur die Polizei, die ja in allen Kloaken der Gesellschaft lauert, die Adressen unserer Hutmacher wissen, wenn die etwa im Futter zu lesen stehn? Oder will man vielleicht gar die Kopfmaße haben, um eine lehrreiche Statistik über die Hirnmenge der Spieler anzulegen? Über diesen Punkt bewahren die Verwaltungen der Spielhäuser strengstes Schweigen. Im Augenblicke, in dem man den ersten Schritt auf den grünen Tisch zu macht, gehört einem sein eigener Hut so wenig mehr, als man sich selber gehört. Man ist dem Spiel zu eigen, Mensch und Geld und Hut und Stock und Mantel. Die dann hinweggehen, grüßt das Spiel mit einem furchtbaren Scherze voll Wirklichkeit: es zeigt ihnen, daß es ihnen doch noch etwas gelassen hat, da es ihnen Hut und Stock und Mantel zurückgibt.
Das Erstaunen, das der junge Mann äußerte, als er eine Nummer für seinen Hut bekam, dessen Ränder übrigens schon ein wenig abgegriffen waren, bewies an diesem Orte eine recht unschuldsvolle Seele. Der kleine Alte, der sicherlich seit seiner Jugend, den furchtbaren Freuden eines Spielerdaseins verfallen war, sah ihn mit einem erloschenen, anteillosen Blick an, in dem ein Philosoph die Elendszeit in Spitälern, das Vagabundendasein der Zugrundegerichteten, die Würgemale der vielen Krankheiten, die Spuren schwerer unaufhörlicher Arbeit und der Heimatlosigkeit in vergifteten Gegenden gelesen hätte.
Dieser Mann mit dem bleichen Gesichte, dessen einzige Nahrung die Armeleutesuppe bei Darcet sein mochte, war die lebendigste und einfachste Formel der Spielleidenschaft. Jede Falte seines Gesichts war eine Spur alter Martern. Sicher trug er seinen kümmerlichen Lohn noch am selben Tage, an dem er ihn bekam, zum Spieltische. Wie ein altes elendes Pferd endlich auch die Peitschenhiebe geduldig erträgt, so nahm er unbewegt das schwere Seufzen, die stummen Flüche und die stumpfgewordenen Blicke der Spieler hin, wenn sie, zugrunde gerichtet, den Saal verließen. Er war das fleischgewordene Spiel. Wenn der junge Mann diesen traurigen Torwächter betrachtet hätte, hätte er sich vielleicht gesagt: »In diesem Herzen gibt es nichts andres mehr als ein Spiel Karten!«
Doch der Unbekannte hörte nicht auf die lebendige Warnung, die die Vorsehung hier errichtet hatte, wie sie den Ekel an die Pforten aller Stätten des Bösen aufgestellt hat …
Entschlossen betrat er den Saal, in dem der Goldklang zauberische Musik machte. Diesen jungen Menschen trieb wahrscheinlich der traurige Gedanke hierher, den Jean-Jacques Rousseau in dem allerlogischesten seiner beredten Sätze ausspricht: »Ja, ich begreife, daß ein Mensch zum Spiele geht, aber nur dann, wenn er zwischen sich und dem Tode nichts mehr sieht als sein letztes Goldstück.«
*
Am Abend haben die Spielhäuser ihre gemeine Poesie, die aber ebenso sicher ihre Wirkung tut wie ein recht blutrünstiges Schauerdrama. Die Säle sind voll von Zuschauern und Spielern, von armseligen alten Männern, die sich hier wärmen wollen – und von erregten Gesichtern; von Orgien, die mit Wein begannen und bald nahe daran sind, in der Seine zu enden. Die Leidenschaft überflutet alles; nur die Fülle der handelnden Personen hindert daran, den Dämon des Spieles von Angesicht zu Angesicht zu sehen. An den Abenden erst werden hier die eigentlichen Ensemblestücke aufgeführt, in denen alle Schauspieler mitschreien und jedes einzelne Instrument des Orchesters seine Stimme mitspielt.
Um diese Zeit sieht man hier eine Menge ehrenwerter Leute, die Zerstreuung suchen und sie bezahlen, wie sie sonst ihr Vergnügen im Theater oder irgendeine Feinschmeckerei für ihr Geld kaufen, oder wie sie sich für billiges Geld in irgendeiner Mansarde Gewissensbisse für drei Monate kaufen.
Wer kann sich die Delirien der Ungeduld in den Seelen der Männer vorstellen, die auf das Öffnen des Spielsaales warten? Zwischen dem Spieler, der morgens spielt, und dem, der abends spielt, ist derselbe Unterschied wie zwischen dem gleichmütigen Ehemann und dem Liebhaber, der unter den Fenstern seiner Schönen auf und nieder streicht. Nur am Morgen erreicht die belebende Leidenschaft und die Begierde ihre ganze gräßliche Schrankenlosigkeit. Um die Zeit erst kann man die richtigen Spieler sehn, die nicht gegessen noch geschlafen, nicht gelebt und nicht gedacht haben, während sie die Gier, ihre verlorenen Einsätze zu verdoppeln, geißelte und die kranke Sucht nach dem trente et quarante in ihnen umging. Um diese Zeit nur kann man die Augen voll entsetzlicher Stille, die Gesichter voll hinreißender Bannkraft und die Blicke sehen, die die Karten an sich reißen und verschlingen möchten.
Die Leute, die bereit sind, sich den Schädel zu zerschmettern, nachdem sie das Schicksal ein letztes Mal versucht haben, erledigen ihre Qualengeschäfte vor der Hauptmahlzeit. Nach acht Uhr gibt es dann nur mehr die Zufallserregungen, die durch den Fall der Karten bedingt sind, etwa wenn Rot oder Schwarz zehnmal nacheinander gewonnen hat. So sind die Spielhäuser also auf ihrer Höhe, wenn die Spielzeit beginnt.
Spanien hat seine Stierkämpfe, Rom seine Gladiatoren – Paris rühmt sich seines Palais Royal, wo die Rouletten das Vergnügen ermöglichen, Blut in Strömen fließen zu sehen, ohne daß man Gefahr läuft, auf dem Fußboden darin auszugleiten. Man muß einen heimlichen Blick in eine solche Arena werfen …
Treten wir ein! Wie nackt alles ist! Die Wände sind bis in Mannshöhe mit fettigem Papier verkleidet. Kein einziges Bild, das ein wenig erheitern könnte, ist zu sehen, nicht einmal ein Haken, der den Selbstmord erleichterte. Die Parkette sind abgetreten und unsauber. Ein ovaler Tisch nimmt die Mitte des Saales ein. Die Einfachheit der Strohsessel, die um den Tisch mit der vom Golde abgenützten Decke eng aneinander stehen, beweist eine sonderbare Gleichgültigkeit gegen den Luxus gerade bei den Leuten, die hierherkommen und um Reichtum und Luxus zugrunde gehen. Diese Gegensätzlichkeit im Menschlichen enthüllt sich überall, wo die Seele schrankenlos der Macht ihrer Triebe gehorcht. Der Liebende möchte die Geliebte in zarte Seide kleiden, in Gewebe des Orients hüllen – und besitzt sie fast immer nur auf einem elenden Lager. Der Ehrgeizige träumt sich bis auf den Gipfel der Macht – und erniedrigt sich mit einer Verbeugung bis in den Kot. Der Händler verkommt in der Tiefe eines feuchten, ungesunden Ladens, während er ein großes Haus bauen läßt, das sein Sohn frühzeitig erbt; den aber verjagt sein Bruder daraus und versteigert es.
Wenn man etwa den Anblick von Küchen und den Geruch der Kneipen ausnimmt, gibt es kaum eine weniger vergnügliche Stätte als solch ein Haus des Vergnügens. Das ist ein sonderbares Problem, daß der Mensch stets im Gegensatze zu sich selber lebt, sich um seine Hoffnungen durch die Leiden seiner Gegenwart betrügen muß und sich dann wieder über diese Leiden mit einer Zukunft hinwegtäuscht, die ihm nicht gehört – und daß er also allen seinen Handlungen den Stempel von Schwäche und Sprunghaftigkeit aufdrückt. Hier auf Erden ist einzig das Unglück vollkommen.
In dem Augenblicke, da der junge Mann den Spielsaal betrat, waren nicht viele Spieler darin. Drei alte Männer mit kahlen Köpfen saßen unerregt um den Tisch. Ihre Gipsgesichter, unbewegt wie die von Diplomaten, verrieten gelangweilte Herzen, die lange schon das Zittern selbst dann verlernt hatten, wenn sie die Besitztümer ihrer Frauen im Spiele wagten.
Ein junger schwarzhaariger Italiener mit olivenfarbiger Haut stützte sich still auf das Ende des Tisches und schien auf die geheimen Vorgefühle zu horchen, die dem Spieler schicksalhaft ihr Ja oder Nein zurufen.
Sieben oder acht Zuschauer standen als Publikum um den Tisch und warteten auf die Schauspiele, die ihnen die Schläge des Schicksals bereiten sollten, auf die Gesichter der handelnden Personen, die Bewegungen des Geldes und der Rechen. Schweigsam standen diese Nichtstuer da, unbeweglich und aufmerksam wie das Volk auf dem Richtplatze, wenn der Henker einem den Kopf abschlägt. Ein großer trockener Mensch in abgetragenen Kleidern hielt in der einen Hand ein Register, in der anderen eine Nadel und zeichnete damit die Reihenfolge des Erscheinens von Rot und Schwarz auf. Es war dies einer jener Tantalusmenschen unserer Zeit, die am Rande aller Freuden ihres Jahrhunderts leben, einer jener Geizigen ohne Schatz, die mit einem eingebildeten Einsatz spielen, eine Art von vernünftigem Narren, der sich mit seinem Hirngespinste über seinen Jammer hinwegtröstete und mit dem Laster und der Gefahr so umging wie die jungen Priester mit der Hostie, wenn sie ihre erste Messe lesen.
Gegenüber der Bank standen zwei oder drei der gerissenen Spekulanten und Fachmänner in allen Chancen des Spiels, wie die alten Zuchthäusler, die auch die Galeeren nicht mehr fürchten; sie waren gekommen, um drei Einsätze zu wagen und den wahrscheinlichen Gewinn, von dem sie lebten, eiligst davonzutragen. Zwei alte Saaldiener spazierten gleichmütig, mit verschränkten Armen, auf und ab, schauten von Zeit zu Zeit aus dem Fenster auf den Garten hinunter, als ob sie den Vorübergehenden ihre gemeinen Gesichter wie ein Aushängeschild zeigen wollten. Der Kartenmischer und der Bankhalter warfen auf die Sitzenden ihren gräßlich leeren Blick und riefen mit dünner Stimme: Faites le jeu! Der junge Mann öffnete die Türe.
Da wurde das Schweigen im Saale plötzlich sonderbar tiefer und neugierig kehrten sich alle Gesichter dem Eintretenden zu. Und es geschah das Unerhörte, daß die stumpfen Greise, die steingewordenen Angestellten des Hauses, die Zuschauer, daß alle – selbst der fanatische Italiener – beim Anblick des Unbekannten eine fremdartige Regung ihres Herzens fühlten. Man muß schon sehr elend und schwach sein, um hier Sympathie oder Mitleid zu erwecken; man muß wirklich schauerlich aussehen, um hier einen Schauer der Empfindung erregen zu können, in diesem Saale, wo die Qualen stumm sein müssen, wo das Elend sich heiter zeigt und die Verzweiflung verschämt ist. Es war wirklich in der ungewohnten Regung all dieser vereisten Herzen ein Etwas von Gefühl, als der junge Mann eintrat; aber schließlich haben selbst zuweilen die Henker über die Jungfrauen geweint, wenn die blonden Köpfe auf ein Zeichen des Revolutionstribunals fallen sollten. Im ersten Augenblick schon erkannten die Spieler im Antlitze des Neulings, daß er von einem furchtbaren Geheimnisse gezeichnet sei. Seine jungen Züge waren von einer fernen Anmut noch wie überhaucht; sein Blick sprach von der Sinnlosigkeit aller Mühen und von tausend betrogenen Hoffnungen. Die trübe Stille des nahen willentlichen Endes gab seiner Stirne die müde kranke Blässe, ein bitteres Lächeln bog die Mundwinkel in feine Falten – der ganze Ausdruck seines Gesichtes war so voll Resignation, daß es weh tat, ihn anzuschauen.
In der Tiefe seiner Augen leuchtete durch die Schleier müd gewordener Lust ein Schimmer geheimnisvolle Genialität. Hatte die Wollust dieses edle, ehedem reine, strahlende Antlitz mit ihren Malen befleckt und erniedrigt? Die Ärzte hätten zweifellos die bräunlichen Ringe unter seinen Augen und die Röte seiner Wangen von einer Krankheit der Lunge oder des Herzens hergeleitet; die Dichter hätten in diesen Zeichen die Zerstörung durch die Wissensgier und viele Nächte, beim Scheine der Studierlampe hingebracht, zu erkennen vermeint. Allein eine Leidenschaft, die sicherer zum Tode führt als jede Krankheit, eine Krankheit, die unerbittlicher ist als Wissensgier und Genialität, versehrte dieses junge Haupt, verkrampfte seine jungen Muskeln und preßte sein Herz zusammen, dem alle Orgien, die Wissensgier und die Krankheit kaum seine Frische hätten nehmen können.
Wie die Verurteilten einen berühmten Verbrecher, wenn er im Bagno ankommt, respektvoll begrüßen, so begrüßten diese in allen Martern erprobten menschlichen Dämonen diesen Menschen der unerhörten Qual und mit der tiefen Wunde – darein ihre Blicke wie Sonden tauchten – und sie erkannten ihn, bezwungen von der Majestät seines Schmerzes, an seiner stummen Ironie und dem eleganten Elend seiner Kleidung als ihren Fürsten.
Der junge Mann trug zwar einen geschmackvollen Frack, aber seine Weste und seine Halsbinde schlossen mit allzu berechneter Vorsicht ab, als daß man darunter hätte ein Hemd vermuten können. Seine Hände waren hübsch wie Frauenhände, aber von recht zweifelhafter Sauberkeit: die Diagnose, daß er seit zwei Tagen keine Handschuhe mehr getragen haben konnte, sagte genug. Daß selbst der Bankhalter und die Saaldiener bei seinem Anblicke einen Schauder fühlten, mochte wohl daher kommen, daß noch ein wenig vom Hinreißenden der Unschuld in diesen zarten, edlen Zügen und den natürlichen Locken seines blonden Haares blühte. Dieses Gesicht war fünfundzwanzig Jahre alt – und alles Lasterhafte darauf erschien als etwas ganz Zufälliges und Bedeutungsloses. Das junge Leben darin kämpfte noch gegen die Zerstörungen der kraftlosen Lüsternheit: die Finsternis und das Licht, das Nichts und das Sein rangen miteinander und zeugten zugleich das Anmutige und das Schauerliche dieses Antlitzes.
Der junge Mann erschien hier wie ein Engel ohne Strahlen, der sich auf seinem Wege verirrt hat; und wie eine zahnlose Alte von Mitleid gepackt wird, wenn sie ein entzückendes Mädchen sieht, das sich verkauft, hatten alle diese ausgedienten Meister des Verbrechens und der Gemeinheit Lust, ihm zuzurufen: »Geh fort von hier!«
Er ging gerade auf den Tisch zu, blieb stehen und warf, ohne nachzudenken, ein Goldstück, das er in der Hand gehalten hatte, auf das grüne Tuch; es rollte auf Schwarz. Dann richtete er seinen Blick, der verstört und still zugleich war, voll des Widerwillens, den alle starken Herzen gegen die marternde Ungewißheit haben, gerade auf den Bankhalter. Das Interesse an diesem Spiele war ein so großes, daß alle die Alten zu setzen unterließen. Nur der Italiener hielt mit allem Fanatismus der Leidenschaft eine lockende Idee fest – und setzte seine ganze Menge Goldes im Gegensatze zu dem Unbekannten auf Rot. Der Bankhalter vergaß seine Ausrufe, die allmählich ein rauher, ununterscheidbarer Schrei geworden waren, sein: »Faites le jeu! – Le jeu est fait! – Rien ne va plus!« Der Bankier gab die Karten. Er schien dem Neuangekommenen Glück zu wünschen; ihm war Gewinn oder Verlust der Unternehmer dieser dunklen Vergnügungen gleichgültig. Alle die Blicke, die an den schicksalsvollen Blättern hafteten, funkelten: denn die Zuschauer sahen hier ein Drama, die letzte Szene eines edlen Lebens, im Schicksale dieses Goldstückes. So aufmerksam sie jedoch abwechselnd den jungen Mann und die Karten ansahen, sie vermochten kein Zeichen der Erregung in seinem kalten, verzichtenden Gesichte zu gewahren. »Rot. Gerade. Passe«, sagte geschäftsmäßig der Bankhalter.
Ein stummes Röcheln brach aus der Brust des Italieners, da er die gefalteten Scheine sah, die ihm der Bankier zuschob. Der junge Mann jedoch begriff seinen Ruin erst, da der Rechen sich ausstreckte, um sein letztes Goldstück zu holen. Das Elfenbein machte ein kleines trockenes Geräusch, während es die Münze pfeilschnell der Menge von Goldstücken zuführte, die vor der Kasse ausgebreitet lag. Der Unbekannte schloß sacht die Augen und seine Lippen wurden weiß. Aber schnell hob er wieder die Lider und sein Mund färbte sich korallenrot. Er suchte sich die Haltung eines Engländers zu geben, für den das Leben keine Geheimnisse mehr hat, und verschwand ohne einen der herzzerreißenden Blicke, die Spieler so oft trostbettelnd auf die Zuschauer richten. So viele Geschehnisse haben in einer Sekunde Platz und so viel Schicksal in einem Würfelfall …
»Das war seine letzte Patrone!« sagte lächelnd der Croupier nach einem Augenblick des Schweigens, indes er das Goldstück zwischen Daumen und Zeigefinger hielt und es den Spielern zeigte.
»So ein verrückter Kerl geht sicher ins Wasser!« sagte einer der Stammgäste und schaute ringsum die Spieler an, die einander sämtlich kannten.
»Na ja!« redete einer der Saaldiener vor sich hin und nahm eine Prise.
»Wenn wir's dem Herrn da nachgemacht hätten …,« sagte einer der Alten zu seinem Gefährten und zeigte auf den Italiener, »was …?«
Alle sahen den glücklichen Spieler an: seine Hände zitterten, während er seine Banknoten zählte.
»Ich habe eine Stimme gehört, die mir ins Ohr schrie: gegen den verzweifelten jungen Menschen muß man mit Erfolg spielen«, sagte dieser.
»Das war kein Spieler,« bemerkte der Bankier, »sonst hätte er sein Geld auf drei Sätze verteilt, um mehr Chancen zu haben.«
*
Der junge Mann ging, ohne seinen Hut zu verlangen. Aber der alte Wachköter hatte den elenden Zustand dieses Filzes bemerkt und gab ihn wortlos zurück. Mit einer maschinenhaften Bewegung legte der Spieler die Nummer hin. Dann stieg er die Treppen hinunter und pfiff dabei so leise hauchend das »Di tanti palpiti …« vor sich hin, daß er kaum selber die köstliche Melodie hörte. Er war bald unter den Arkaden des Palais Royal. Er ging, von einem letzten Gedanken geleitet, bis zur Rue St. Honoré, von da den Tuilerienweg weiter und durchmaß langsamen Schrittes den Garten. Er schritt wie inmitten einer Wüste dahin, stieß gegen Leute, die er nicht sah, und hörte in all dem Lärm nur eine einzige Stimme: die Stimme des Todes. Er war starr nur mehr dem Gedanken hingegeben, den die Verurteilten gedacht haben mochten, da sie der Karren vom Tribunal zum Richtplatz führte, zum Schafott, das rot war von all dem Blute, das seit 1793 vergossen worden war.
Es ist etwas Großes und Erschütterndes um den Selbstmord.
Die meisten Menschen sind nicht gefährdet, wenn sie fallen, wie die Kinder, die aus zu geringer Höhe fallen, als daß sie sich verletzen könnten. Wenn aber ein Mensch im Falle sich zerschmettert, muß er aus großer Höhe gestürzt sein, muß sich im Drängen nach einem unerreichbaren Paradiese bis in die Himmel erhoben haben. Wie gnadelos müssen die Stürme sein, die einen Menschen dahin tragen, wo er den Frieden seiner Seele in der Mündung einer Pistole suchen muß!
Es gibt eine Menge begabter junger Menschen, die in der Enge ihrer Dachstuben hinsiechen und inmitten einer Million Mitmenschen, umgeben von der geldmüden, gelangweilten Gesellschaft, zugrunde gehen, weil sie keinen Freund haben und keine Freundin, die sie tröstete. Wenn man daran denkt, bekommt jeder Selbstmord etwas Gigantisch-Furchtbares.
Wie viele Pläne, im Stiche gelassene Dichtungen, Verzweiflungen und erstickte Schreie, wie viele unnütze Versuche und vertane Meisterwerke in die Spanne zwischen dem freiwilligen Tode und der üppig treibenden Hoffnung, deren Stimme die jungen Menschen nach Paris lockt, zusammengedrängt sind, das weiß nur Gott allein. Jeder Selbstmord ist eine erhabene Dichtung der Schwermut. Wo vermöchte man im Ozean der Literatur ein Buch zu finden, das an Genie mit der Zeitungsnotiz wetteifern könnte:
»Gestern um vier Uhr stürzte sich vom Pont des Arts eine junge Frau in die Seine.«
(Dieser Satz, der schwer von allem Leide der Welt ist, steht in den Zeitungen meist zwischen der Anzeige eines neuen Schauspiels und dem Bericht über ein verschwenderisches Fest, das zur Unterstützung von Bedürftigen gegeben wurde … Mein Gott, wir haben ja so viel Erbarmen für die leiblichen Nöte!)
Neben dieser lakonischen Pariser Meldung verblassen alle Romane und Dramen, selbst jene alte Überschrift: »Die Klagen des alten Königs von Kaernavan, der von seinen Kindern ins Gefängnis geworfen wurde …«, die der letzte Rest eines verloren gegangenen Buches ist, das Sterne zu Tränen gerührt hat, denselben Sterne, der Frau und Kinder verließ.
Der junge Mann war von tausend ähnlichen Gedanken erfüllt, die seine Seele durchflammten, wie inmitten der Schlachten die zerrissenen Fahnen taumeln. Wenn er die Last seiner Gedanken und Erinnerungen einen Augenblick von sich tat, um vor ein paar Blumen, deren Kelche inmitten der Massen von Grün ein leichter Lufthauch weich wiegte, haltzumachen, ging gleich wieder ein Funken des Lebens, das sich unter dem unerträglichen Gedanken an den Selbstmord aufbäumte, durch ihn, und er hob die Augen zum Himmel: doch graue Wolken, schwere Windstöße voll Traurigkeit und dumpfe lastende Luft rieten zum Sterben. Er ging auf den Pont Royal zu und gedachte seiner Vorgänger auf diesem Wege. Er mußte lächeln, als er sich erinnerte, daß Lord Castlereagh das niedrigste menschliche Bedürfnis befriedigt hatte, bevor er sich den Hals durchschnitt, und daß der Chemiker Anger seine Tabaksdose gesucht hatte, um auf dem Wege zum Tode eine Prise zu nehmen. Er untersuchte diese Absonderlichkeiten und forschte in sich selber nach; da kam ihm ein Markthelfer entgegen, er preßte sich an das Brückengeländer, um ihn vorbeizulassen; dabei wurde sein Ärmel staubig. Erstaunt entdeckte er sich dabei, daß er sorgfältig den Staub davon abschüttelte. Als er in der Mitte der Brücke angekommen war, starrte er düster auf das Wasser hinab. »Schlechte Zeit zum Baden!« sagte ein altes zerlumptes Weib im Vorübergehen zu ihm, »die Seine ist kalt und dreckig!« – Er antwortete mit einem kindlichen Lächeln; der Mut zu sterben fieberte in ihm. Plötzlich aber schauderte er, als er von ferne die Baracke erblickte, die in fußhohen Lettern die Aufschrift »Rettung für Ertrinkende« trug.
Er sah die Helfer einer verspäteten Menschenfreundlichkeit vor sich, wie sie wachen und ihre braven Ruder in Bewegung setzen, mit denen sie den Leuten im Wasser die Schädel einschlagen, wenn sie unglücklicherweise noch einmal auftauchen. Er sah im Geiste den Aufruhr der Neugierigen, wenn sie einen Arzt suchen, der die künstliche Atmung versuchen soll. Er las die klagenden, mitfühlenden Worte der Journalisten, hingeschrieben zwischen Festfreuden und dem Lächeln einer Tänzerin. Er hörte das Klingen der Goldstücke, die der Polizeipräfekt den Ruderern für seinen Kopf bezahlen würde. Nach seinem Tode würde er fünfzig Franken wert sein; solange er lebte, war er nur ein begabter Mensch ohne Förderer, ohne Freunde, eine rechte gesellschaftliche Null und dem Staate, der sich um ihn nicht kümmerte, völlig unnütz gewesen.
Im hellen Tageslichte zu sterben schien ihm gemein. Er beschloß, sich in der Nacht zu töten und der Gesellschaft, die die Größe seines Lebens verkannt hatte, einen unkenntlichen Kadaver zu hinterlassen. Er ging den Weg nun weiter und wandte sich gegen den Kai Voltaire; er ahmte das gleichmütige Gehen eines Spaziergängers, der die Zeit totzuschlagen sucht, nach. Als er die Stufen vom Trottoir der Brücke hinabstieg, bemerkte er an der Ecke des Kais die Bücherstände am Brückengeländer. Er war nahe daran, ein paar Bücher zu kaufen – da mußte er lächeln – philosophisch barg er die Hände wieder in den Hosentaschen und wollte eben seine Miene gespielter Sorglosigkeit, in die sich immerhin ein wenig kalte Verachtung drängte, wieder annehmen, da hörte er plötzlich auf eine wahrhaft phantastische Weise ein paar Münzen in seiner Tasche klingeln. Ein Lächeln der Hoffnung erhellte sein Gesicht, glitt von den Lippen über seine Züge und ließ seine Augen in Freude aufleuchten. Dieser Funke von Glück durchlief ihn, wie kleine Feuer noch über schon ausgebrannte Papierstücke hinlaufen, aber wie traurige schwarze Asche legte es sich sofort wieder auf sein Gesicht, als er drei Soustücke aus der Tasche zog.
»Herr, Herr, einen kleinen Sou! Einen Sou für Brot!« Ein junger Schornsteinfeger mit schwarzem gedunsenem Gesicht, in zerlumpten Kleidern, durch die der rußgeschwärzte Körper sah, streckte ihm die Hand entgegen, um ihm die letzten Sous zu entreißen. Zwei Schritte von dem kleinen Savoyarden sagte ein elender alter Mensch, krank und leidvoll, armselig in einen löcherigen Teppich gehüllt, mit dumpfer, klangloser Stimme: »Herr, geben Sie mir, was Sie wollen! Ich werde für Sie beten!«
Als der junge Mann den Greis anblickte, verstummte der und bat um nichts mehr; vielleicht hatte er in diesem todessüchtigen Antlitze ein Leiden, das bitterer war als sein eigenes, erkannt.
»Mitleid, Herr!« schrie der Savoyarde.
Der Unbekannte warf sein bißchen Geld dem Jungen und dem alten Manne zu und verließ das Trottoir, um gegen die Häuser zu kommen. Er vermochte den quälenden Anblick der Seine nicht mehr zu ertragen.
»Wir beten um ein langes Leben für Sie!« riefen die beiden Bettler ihm nach. Vor den Schaufenstern eines Händlers mit alten Stichen begegnete der Mann, der fast schon ein Toter war, einer jungen Frau, die aus ihrem prächtigen Wagen stieg. Er betrachtete genießerisch das reizende Wesen, das blasse Gesicht, das harmonisch ein eleganter Seidenhut umrahmte. Ihre schlanke Gestalt und die hübschen Bewegungen bezauberten ihn. Das Trittbrett raffte ihr Kleid und zeigte ihm die feinen Umrisse ihrer Beine in straffen weißen Strümpfen. Die junge Frau trat in den Laden und kaufte ein paar Albums und einige Reihen von Lithographien; sie zahlte dafür einige Goldstücke, die hell auf dem Kassentisch erklangen.
Der junge Mann stand scheinbar darum auf der Türschwelle, um die hier ausgestellten Stiche zu besehen – und tauschte mit der schönen Unbekannten mutwillig seinen forderndsten Blick gegen einen jener teilnahmlosen Blicke, wie sie zufällig auf die Vorübergehenden fallen. Das war sein Abschied von den Frauen und von der Liebe. Seine letzte mächtige Frage blieb unverstanden, sie rührte das Herz der leichtsinnigen Frau nicht, sie zwang ihr kein Erröten und kein Senken des Blickes ab. Ihr war sie nichts anderes als ein bißchen Bewunderung mehr, der Triumph, Begierde erweckt zu haben, dessen sie sich dann abends rühmen mochte: »Heute war ich hübsch!«
Der junge Mann ging schnell zu einem anderen Schaufenster und wandte sich nicht mehr um, als die schöne Dame wieder in ihren Wagen stieg. Die Pferde zogen an, und dieses letzte Bild des Reichtums und der Schönheit verging, wie sein Leben bald vergehen sollte.
Schwermütigen Ganges schritt er die Kaufläden entlang und sah ohne viel Interesse die ausgestellten Warenmuster an. Als die Läden zu Ende waren, betrachtete er den Louvre, die Akademie, die Türme von Notre-Dame, die des Justizpalastes und den Pont des Arts. Alle die Bauwerke schienen traurig vor sich hin zu blicken, grau vom Himmel getönt, aus dem selten ein wenig Licht brach, das dann Paris fremd und drohend zeigte; denn Paris hat wie eine hübsche Frau die unerklärlichste Launenhaftigkeit in seiner Schönheit wie in seiner Häßlichkeit. So schien die Natur selber mitzuwirken, um den Sterbenden in Ekstasen des Schmerzes zu versenken. Er war die Beute jener bösen Macht, deren auflösende Wirkung vom Fluidum unserer Nerven weitergeleitet wird, und er fühlte allmählich seinen Organismus wie schon verflüssigt und aufgelöst. Die Qualen dieses Todeskampfes gingen wie Wellenschlag durch ihn und ließen ihn die Gebäude und die Menschen nur mehr durch einen Nebel sehen, in dem alles wogte. Er wollte sich dem Beben seiner Nerven und ihrer Wirkung auf die Seele entziehen. Er wandte sich den Antiquitätenläden zu und gedachte seinen Sinnen Nahrung zu reichen oder dort die Nacht im Feilschen um ein paar Kunstgegenstände zu verbringen. Er wollte sich Mut machen, und ihn verlangte nach einer Herzstärkung, wie die Verurteilten, die ihren Kräften für den Weg zum Schafott mißtrauen.
*
Das Bewußtsein des nahen Todes gab dem jungen Mann für eine Weile die Zuversichtlichkeit einer Herzogin, die zwei Liebhaber hat; er trat bei dem Antiquitätenhändler mit kecker Sicherheit und dem starren Lächeln eines Betrunkenen auf den Lippen ein. Er war ja betrunken vom Leben – oder vielleicht schon vom Tode? Er verfiel aber schnell von neuem in das frühere Schwindelgefühl und sah die Dinge wieder in den fremdartigsten Farben oder in einer leichten Bewegung, deren Ursprung wohl das unregelmäßige Kreisen seines Blutes sein mochte, das bald brausend wie ein Wasserfall, bald still und träg wie klares Wasser ging.
Er verlangte einfach, die Magazine durchsehen zu dürfen, ob es darin irgendwelche besondere Dinge nach seinem Geschmacke gäbe. Ein frischer pausbäckiger junger Mensch, mit einer Fischottermütze auf den roten Haaren, übertrug die Aufsicht über den Laden einer alten Bäuerin, einer Art weiblichem Kaliban, die eben damit beschäftigt war, einen Kachelofen mit Majoliken von Bernard Palissy zu reinigen; dann sagte er leichthin zu dem Fremden: »Sehen Sie, Herr, sehen Sie: da unten haben wir nur die gewöhnlichen Sachen. Aber wenn Sie sich die Mühe machen wollen, in den ersten Stock hinaufzusteigen, könnte ich Ihnen die schönsten Mumien aus Kairo zeigen, ein paar schöne Keramiken, ein paar Ebenholzschnitzereien, wirklich herrliche Renaissancearbeit, die wir erst kürzlich bekommen haben.«
In seiner furchtbaren Lage war für den Unbekannten das Geschwätz des Führers und die dummen Geschäftsphrasen dasselbe wie die gemeinen Sticheleien, mit denen die Flachköpfe das Genie umbringen. Aber er trug sein Kreuz bis zu Ende: er tat, als ob er seinem Begleiter zuhörte, und antwortete ihm durch Gesten oder kurze Ausrufe. Aber unmerklich verstand er es, sich das Recht zu schweigen durchzusetzen, und konnte sich nun ohne Scheu seinen letzten Betrachtungen hingeben. Sie waren furchtbar.
Er war ein Dichter; so fand seine Seele hier reiche Nahrung: er mußte die Gebeine von zwanzig Welten anschauen. Auf den ersten Blick boten ihm die Magazine ein ganz wirres Bild, in das alle menschlichen und göttlichen Werke zusammengedrängt waren. Krokodile, Affen, ausgestopfte Riesenschlangen grinsten Kirchenfenster an, schienen nach Büsten schnappen, Lackkästchen haschen und auf Kronleuchter klettern zu wollen. Eine Sèvresvase, auf die Mme. Jacotot Napoleon gemalt hatte, stand neben einer dem Sesostris geweihten Sphinx. Die Anfänge der Welt und die Ereignisse von gestern vermählten sich hier mit einer grotesken Gutmütigkeit. Ein Bratspieß lag auf einer Monstranz, ein Republikanersäbel über einer Arkebuse aus dem Mittelalter. Die Dubarry auf einem Pastell von Latour, mit einem Stern über dem Haupte, nackt in einer Wolke, schien lüstern einen indischen Tschibuk zu betrachten und zu raten, wozu die Spiralen um sein Rohr nütze sein möchten.
Gerätschaften des Todes, Dolche, fremdartige Pistolen und geheime Waffen, waren kunterbunt mit den Gerätschaften des Lebens durcheinandergeworfen: mit porzellanenen Suppentöpfen, Meißner Tellern, durchsichtigen chinesischen Tassen, antiken Salzfässern und feudalen Konfektdosen. Ein elfenbeinernes Schiff mit vollen Segeln schwebte auf dem Rücken einer bewegungslosen Schildkröte. Eine Luftpumpe drang in das eine Auge des Kaisers Augustus, der in regloser Majestät verharrte.
Etliche Bildnisse von französischen Schöffen und holländischen Bürgermeistern, die empfindungslos wie zu ihren Lebzeiten vor sich hinglotzten, erhoben sich aus dem Chaos von Antiquitäten und warfen fahle kalte Blicke darüber hin.
Alle Länder der Erde schienen irgendein paar Trümmer ihrer Wissenschaften und Muster ihrer Künste hierhergebracht zu haben. Auf diesem Kehrichthaufen der Welt fehlte nichts, nicht das Kalumet der Indianer, noch die grüngoldenen Pantoffeln des Harems, nicht der maurische Jatagan, noch das Idol der Tataren. Alles gab es bis zum Tabaksbeutel des Soldaten, dem Ziborium des Priesters und dem Federschmuck eines Thronsessels. Diese Bilder der Verwirrung waren überdies noch von tausend launenhaften, spielenden Lichtern überflogen, voll eines wirren Durcheinanders von Nuancen und des stärksten Gegensatzes von Helle und Finsternis. Das Ohr meinte, abgebrochene Schreie zu hören, der Verstand holte tausend unbeendete Trauerspiele aus dem Chaos, und das Auge glaubte kaum verhülltes Leuchten zu gewahren.
Zäher Staub hatte leichte Schleier über all die Dinge gebreitet, ihre vielen Ecken und Einbuchtungen hatten einen eigentümlich malerischen Reiz. Der Unbekannte verglich anfangs diese drei Säle, vollgepfropft mit Zivilisationen, mit Religionen, mit Meisterwerken und Königreichen, mit Unzucht, Vernunft und Irrsinn, einem reich geschliffenen Spiegel, dessen jede Facette eine Welt darstellte. Nach diesem verschwommenen Eindrucke wollte er die Wahl dessen, was ihm gefiele, beginnen. Doch im Zwange des Schauens, Denkens und Träumens verfiel er der Gewalt, eines Fiebers, das vielleicht von dem Hunger, der in seinen Eingeweiden wühlte, kam.
Der Anblick so vielen Lebens von Völkern und einzelnen, bezeugt von allen diesen überlebenden Beweisen, lähmte vollends die Sinne des jungen Mannes. Der Wunsch, der ihn in diese Magazine getrieben hatte, war gestillt. Er war aus der Wirklichkeit fortgegangen, die Stufen zu einer idealen Welt emporgestiegen und hatte den verzauberten Palast der Ekstase erreicht. Aus Trümmern brach ihm das All in Feuerschrift, wie einst die Zukunft flammend vor den Augen des heiligen Johannes auf Patmos vorbeigezogen war. Eine Fülle schmerzensreicher Antlitze, anmutiger und furchtbarer, finsterer und erleuchteter, ferner und naher, stand in Massen, in Myriaden, in Geschlechtern vor ihm auf. Mit einer Mumie in ihren schwarzen Binden erhob sich Ägypten starr und geheimnisvoll aus seinem Sande – und in ihm die Pharaonen, die ganze Völker begruben, um sich ihre Grabmäler errichten zu lassen; Moses auch, das jüdische Volk und die großen Wüsten. Und sein Blick umfaßte diese ganze alte feierliche Welt. Kühn und hold erzählte ihm eine Marmorstatue in strahlender Weiße, auf eine gebrochene Säule gestützt, die wollüstigen Mythen von Griechenland und Jonien. Wer hätte nicht wie der Unbekannte gelächelt, wenn er hier auf dem feinen Ton einer etruskischen Vase den Tanz des braunen Mädchens vor dem Gotte Priapus und die fröhliche Verneigung vor ihm gesehen hätte? Hier hing eine lateinische Herrscherin ihren verliebten Träumereien nach, und aus ihrem Bilde atmete das kaiserliche Rom: Lager, Bad und Schönheitsgerätschaften einer trägen, träumerischen Julia, die ihren Tibull erwartete. Wie die Zauberkraft arabischer Talismane erweckte der Kopf Ciceros Erinnerungen an das freie Rom. Seiten des Titus Livius schlugen sich auf, und der junge Mann sah vor sich: »Senatus populusque Romanus«: den Konsul, die Liktoren, den Purpurrand der Toga praetexta, die Wortkämpfe auf dem Forum und zornige Völker, die langsam wie die nebligen Gestalten der Träume an ihm vorbeizogen.
Endlich beherrschte das christliche Rom die Bilder. Ein Gemälde tat die Himmel auf: er sah die Jungfrau Maria, auf goldenen Wolken thronend, im Kreise der Engel, den Glanz der Sonne verdunkelnd, und hörte die Wehklage der Unglücklichen, denen die wiedergeborene Eva holdselig zulächelte. Er rührte ein Mosaik aus verschiedenfarbigen Lavastücken vom Vesuv und Ätna an, und seine Seele flog in das kahle, heiße Italien: er nahm an den Orgien der Borgias teil, durcheilte die Abruzzen, sog den heißen Hauch italienischer Liebe ein und berauschte sich an den weißen Gesichtern mit langgeschnittenen schwarzen Augen. Da er einen mittelalterlichen Degen mit spitzenzart gearbeitetem Griff und Rostflecken, die wie Blut waren, erblickte, erlebte er schaudernd nächtliche Liebesstunden, in die die kalte Klinge eines eifersüchtigen Gatten stieß.
Indien mit seinen Religionen wurde vor ihm lebendig, da er eine Gottheit mit spitzer, rautengezierter Mütze, schellenbehängt und in Gold und Seide gekleidet, erblickte. Neben dieser fremdartigen Figur lag eine Matte, schön wie die Bajadere, die sich auf ihr gewälzt haben mochte, und duftete noch immer nach Sandelholz. In einem chinesischen Dämonenbild mit verdrehten Augen, geschlängelten Lippen und qualverzerrten Gliedern wirkten die Einfälle eines Volkes auf die Seele, das, der eintönigen Schönheit müde, die unaussprechlichsten Genüsse in der unerschöpflichen Fülle der Häßlichkeit findet.
Ein Salzfaß aus der Werkstätte Benvenuto Cellinis wies dem Unbekannten den Weg in die Zeit der Renaissance, in die Welt, darin Kunst und Kühnheit blühten, die Herrscher sich bei Folterungen zerstreuten und die Kardinäle in den Armen der Kurtisanen auf den Konzilen den niederen Priestern Keuschheit befahlen.
Er sah die Siege Alexanders in einer Gemme, die Massaker des Pizarro in einer Zündschnurarkebuse und die Religionskriege voll Raserei und Grausamkeit in einer Sturmhaube. Dann wieder standen Bilder des Rittertums lächelnd aus einer herrlich damaszierten Mailänder Rüstung auf, die glänzend geputzt dastand und aus deren Visier die blitzenden Augen eines Paladins ihn ansahen. Dieser Ozean von Möbeln, Erfindungen, Moden, Werken und Ruinen wurde ihm zu einem unermeßlichen Gedicht. Formen, Farben, Gedanken waren darin wieder lebendig – aber nichts wollte sich der Seele als ein Ganzes darbieten. Des Dichters Aufgabe war es, die Entwürfe des großen Malers, der alle diese unzählbaren Zufälligkeiten des Menschendaseins in verschwenderischer Verachtung hingeworfen hatte, zu ordnen und zu vollenden.
Nachdem er sich solcherart der Welt bemächtigt und die Länder, Zeitalter und Reiche betrachtet hatte, kehrte der junge Mann zu den Einzelgeschicken zurück. Er wurde wieder Person, griff nach dem einzelnen und stieß die Geschicke der Völker, die das Individuum erdrücken müssen, von sich. Hier zeigte eine Wachsfigur aus dem Kabinette des Ruysch ein schlafendes Kind – und das bezaubernde kleine Geschöpf mahnte ihn an die Freuden seiner eigenen frühen Jahre. Beim Anblick des zauberhaften Lendenschurzes irgendeines tahitischen Mädchens malte ihm seine heiße Phantasie das schlichte Leben mit der Natur, das keusche Nacktsein der wahrhaften Schamhaftigkeit, die Süße des Müßigganges, der dem Menschen so natürlich ist, und ein ganz stilles Dasein am Ufer eines kühlen träumerischen Baches unter einem Bananenbaume, der ohne Pflege sein köstliches Manna spendet.
Im nächsten Augenblick wurde er zum Seeräuber und umgab sich mit dessen ganzer düsterer Poesie, da er die perlmutternen Farben von tausend Muscheln sah und ihn der Anblick von Schwammkorallen, die nach Tang, Algen und stürmischen Meeren rochen, erregte. Weiter dann bewunderte er zarte Miniaturen, azurene und goldene Ornamente, die eine kostbare Meßbuch-Handschrift zierten, und vergaß die Erregungen des Meeres wieder. Eingelullt von einem Gedanken voll Frieden, vermählte er sich von neuem der Wissenschaft, sehnte sich nach dem feisten Leben der Mönche, ohne Kummer und ohne Genüsse, lag in der Tiefe einer Zelle und sah durch sein Spitzenbogenfenster über die Wiesen, Wälder und Weinberge seines Klosters hin.
Vor einigen Bildern von Teniers zog er den Leibrock des Soldaten, dann wieder das elende Gewand eines Arbeiters an: er ersehnte, die schmutzige verräucherte Haube eines Flamen zu tragen, betrank sich mit Bier, spielte Karten und lächelte einer dicken Bäuerin mit üppigen Formen zu.
Er fröstelte, da er ein Schneebild von Mieris sah – und kämpfte in einem Schlachtenbilde von Salvator Rosa mit. Er liebkoste einen Tomahawk und fühlte dabei, wie ihm das Messer eines Irokesen den Skalp vom Schädel schnitt. Er reichte eine dreisaitige Geige, die er erblickte, einer Schloßfrau, hörte sie genießerisch die süße Melodie einer Romanze spielen und gestand ihr im Abenddunkeln an einem gotischen Kamine seine Liebe: ihr Blick voll Neigung verschwamm im Dämmern.
Er stürzte sich in alle Freuden, griff nach allen Qualen, riß alle Gestalten des Daseins an sich und behing großmütig all das Figurenwerk der leblosen Natur mit seinem Leben und seinen Gefühlen, bis der Hall seiner eigenen Schritte in seiner Seele wie der Laut einer anderen Welt klang, wie das Brausen von Paris hoch oben auf den Türmen von Notre-Dame klingt.
Da er die Wendeltreppe zu den Zimmern im ersten Stock emporstieg, sah er Votivschilde, ganze Rüstungen, geschnitzte Tabernakel, Holzplastiken an die Wände gehängt und auf jeder Stufe stehend. Verfolgt von den sonderbarsten Gestalten, von Schöpfungen, die wunderbar an den Grenzen von Tod und Leben ragten, schritt er in den Berückungen des Traumes dahin. Endlich begann er an seinem Sein zu zweifeln und war wie alle diese seltsamen Dinge hier weder wirklich tot noch wirklich lebendig.
Als er die anderen Magazine betrat, begann es zu dämmern; doch das Licht schien überflüssig vor all den funkelnden Reichtümern von Gold und Silber, die hier aufgehäuft lagen. Die kostspieligsten Launen von Verschwendern, die, nachdem sie Millionen vergeudet hatten, in Dachstuben gestorben waren, lagen in diesem Basar aller menschlichen Wahnsinne vereint. Ein Schreibzeug, das mit hunderttausend Franken bezahlt und nachher für hundert Sous wieder eingekauft worden war, stand neben einem Geheimschlosse, dessen Preis einst für das Lösegeld eines Königs gereicht hätte. Hier zeigte sich das Menschliche in aller Pracht seines Elends, in aller Glorie seiner gigantischen Niedrigkeiten. Ein Tisch aus Ebenholz, ein wahrhaftes Idol eines Künstlers, geschnitzt nach Zeichnungen von Jean Goujon, in mühevoller Arbeit von Jahren entstanden, war vielleicht um den Preis von Brennholz erstanden worden. Kostbare Kästchen und Möbel, wie von Feenhand gemacht, waren hier verächtlich übereinandergeschichtet.
»Sie haben hier Millionen!« rief der junge Mann, als sie in dem letzten Gemach der langen Reihe von Zimmern, die Künstler des vorigen Jahrhunderts mit Figuren geschmückt und mit Gold geziert hatten, anlangten.
»Sagen Sie lieber: Milliarden!« erwiderte der pausbackige Gehilfe, »aber das ist auch noch gar nichts! Kommen Sie in den dritten Stock, da werden Sie erst was sehen!«
Der Unbekannte folgte seinem Führer und kam zu einer vierten Galerie; hier erblickten seine müd gewordenen Augen nacheinander mehrere Bilder von Poussin, eine herrliche Statue des Michelangelo, ein paar bezaubernde Landschaften von Claude Lorrain, einen Gerard Dow, der wie eine Seite von Sterne anmutete, Gemälde von Rembrandt, Murillo und mehrere Velasquez in Farben wie Gedichte des Lord Byron; dann wieder antike Reliefs, achatne Becher und wunderbare Onyxe.
Es gab hier Arbeiten, daß einem endlich selbst die herrlichste zum Ekel wurde; Meisterwerke waren aufgehäuft, daß man vor Fülle die Kunst zu hassen beginnen mußte – und daß die Begeisterung starb.
Der junge Mann kam zu einer Madonna von Rafael – aber er hatte schon genug von Rafael. Für ein Bild von Correggio hatte er keinen Blick mehr. Eine unschätzbare Vase aus antikem Porphyr, die das Entzücken irgendeiner Corinna gewesen war, mit rundumlaufenden Skulpturen, die von allen priapischen Szenen römischer Kunst die schamlosesten sein mochten, erhielt kaum mehr ein Lächeln.
Er erstickte unter den Resten von fünfzig verwichenen Jahrhunderten, er war krank von all den Menschengedanken, erschlagen von Luxus und Kunst, erdrückt unter den wiedererwachten Formen, die wie Ungeheuer, von einem bösen Geiste unter seinen Füßen gezeugt, mit ihm einen Kampf ohne Ende führten.
Wie nach einer gewissen chemischen Anschauung die Welt durch Gase hervorgebracht wurde, vermag vielleicht die menschliche Seele durch eine gewaltige Verdichtung ihrer Kräfte und Ideen furchtbare Gifte darzustellen. Geht nicht vielleicht eine Menge Menschen daran zugrunde, daß irgendein seelischer Zersetzungsstoff, der aus dem inneren Sein stammt, sie zerstört?
»Was ist in dieser Schachtel?« fragte der Unbekannte, da sie in einem großen Kabinett, der letzten Sammelstätte von menschlichem Glanz, Reichtümern und Sonderbarkeiten, anlangten, und deutete unter all dem auf eine viereckige Mahagonikassette, die an einer Silberkette von einem Haken herabhing.
»Der Herr hat den Schlüssel dazu,« sagte der dicke Gehilfe geheimnistuerisch, »wenn Sie das Bild sehen wollen, will ich es wagen, den Herrn von Ihrem Wunsche zu verständigen.«
»Wagen! Ist Ihr Herr denn ein Fürst?«
»Das weiß ich nicht«, erwiderte der Gehilfe. Sie sahen einander einen Augenblick an, einer so erstaunt wie der andere. Da der Angestellte das Schweigen des Unbekannten als einen Wunsch deutete, ließ er ihn in dem Kabinette allein.
*
Hatten Sie schon einmal das Gefühl der Unermeßlichkeit des Raumes und der Zeiten preisgegeben zu sein, da Sie die geologischen Werke von Cuvier lasen?
Hat Sie sein Genie fortgerissen, daß Sie, wie von der Hand eines Zauberers gehalten, über den grenzenlosen Abgründen der Vergangenheit schwebten? Indem die Seele Schicht nach Schicht und Lage nach Lage unter die Steinbrüche des Montmartre oder in die Schieferbrüche des Ural eindringt und der versteinerten Hüllen all der Lebewesen aus vorsintflutlichen Zeitaltern gewahr wird, schaudert sie im Ahnen der Jahrmilliarden und der Völkermillionen, die das schwache menschliche Gedächtnis wie die unzerstörbare göttliche Überlieferung vergessen hatte und deren Aschen und Gräber nun die Oberfläche der Erde bilden, die uns Brot und Blüten spendet. Ist Cuvier nicht der größte Dichter des Jahrhunderts? Lord Byron hat aus ein paar Worten seelische Erschütterungen neu gestaltet – aber dieser unsterbliche Naturforscher hat aus gebleichten Knochen ganze Welten wieder geschaffen, hat aus ein paar Zähnen, wie Kadmos, feste Städte errichtet, hat tausend Wälder mit allen Geheimnissen des Tierlebens aus ein paar Schalen-Überresten neu bevölkert und hat die Geschlechter der Riesen im Fußknochen eines Mammuts wiedergefunden. Diese Gestalten erheben sich nun, wachsen an und erfüllen die Landschaften mit ihren ungeheueren Leibern. Er ist ein Dichter der Ziffern und ist erhaben, wenn er eine Null neben eine Sieben setzt; er erweckt das Nichts, ohne besondere magische Worte auszusprechen; er findet in einem Stück Gips einen Abdruck und ruft uns zu: »Seht her!« Und plötzlich erwacht der Marmor, das Tote wird lebendig, und eine Welt tut sich auf. Nach unzählbaren Geschlechtern von Riesenwesen, nach all den Arten von Fischen, den Völkern und Mollusken erscheint endlich das Menschengeschlecht, das entartete Abbild eines ungeheuren Vorbildes, das der Schöpfer selber zerstört haben mochte.
Vor dieser Stimme einer ungeheuren Auferstehung, die die Stimme eines einzigen Menschen aufruft, wird uns der Brocken Leben, der uns in dem Unendlichen ohne Namen, das wir die Zeit genannt haben, gewährt ist, wird uns unsere Minute Lebenszeit recht erbärmlich. Und wir fragen uns, niedergeworfen durch diese Ruinentrümmer des Universums, wozu all unser Ruhm, unser Hassen und Lieben denn sei, und ob man die Pein des Lebens auf sich nehmen solle, um dann in der Zukunft endlich nichts mehr zu sein als ein unerreichbarer Punkt. Wir haben keine Wurzeln in der Gegenwart – und keiner von uns ist viel mehr als ein Toter, bis nicht etwa sein Kammerdiener kommt und ihm meldet: »Die Frau Gräfin läßt sagen, daß sie den Herrn erwartet.«
Die Wunder der ganzen Schöpfung erzeugten in der Seele des jungen Mannes dieselbe Niedergeschlagenheit, die in den Philosophen im Gedanken an all das Unbekannte der Schöpfung entsteht. Er wünschte sich stärker als je zuvor den Tod. Er warf sich in einen kurulischen Stuhl, und seine Blicke durchirrten das phantastische Panorama der Vergangenheit, das ihn umgab. Die Bilder begannen zu leuchten, die Angesichter der heiligen Jungfrau lächelten ihm zu, und die Statuen färbten sich mit trügerischem Leben.
Das Fieber seines Hirns riß all diese Werke aus ihrem Dunkel in wirbelnde Bewegung, jedes Götzenbild schnitt ihm Grimassen, und die Personen auf den Bildern ließen die ermüdeten Lider sinken. Jede der Gestalten erzitterte, hüpfte, verließ gravitätisch oder leicht, anmutig oder plump, je nach dem Charakter oder dem Stoff, aus dem sie gemacht war, ihren Platz. Ein rechter Hexensabbat zog an dem jungen Manne vorbei.
Doch all diese Eindrücke des Auges, die von einer Übermüdung, einer Überanspannung seiner Sehkräfte und den Launen der Dämmerung erzeugt wurden, erschreckten den Unbekannten nicht. Die Schrecken des Lebens sind machtlos über eine Seele, die mit den Schrecken des Todes vertraut ist. Er begünstigte sogar die Eigenwilligkeiten dieser Erscheinungen, die sich in seine letzten Gedanken drängten und ihm damit das Gefühl, noch zu leben, schenkten.
So tiefes Schweigen war um ihn, daß er bald in stille Träumerei verfiel, die magisch sich mit dem Schwinden des Tageslichtes verdüsterte. Ein letzter roter Glanz kam vom Himmel und kämpfte gegen die Nacht. Der Unbekannte hob den Kopf und sah ein kaum mehr beleuchtetes Skelett vor sich, das wie zweifelnd den Schädel wiegte und ihm zu sagen schien: »Die Toten wollen dich noch nicht!«
Er hob die Hand zur Stirne, um den Schlummer zu verscheuchen, und empfand deutlich, daß ihm im gleichen Augenblick etwas Weiches, Haariges über die Wange strich. Ihn schauderte. Von den Scheiben kam ein schwaches Klirren. Er meinte, diese geheimnisvolle grabeskühle Liebkosung rühre von einer Fledermaus her. Einen Augenblick lang machten noch die letzten Lichter des Sonnenunterganges die Phantome, die ihn umgaben, sichtbar – dann versank das ganze Stilleben in dichtes Dunkel. Die Nacht, die Zeit des Sterbens, war gekommen.
Von diesem Augenblicke an verstrich eine Spanne Zeit, in der er kein klares Bewußtsein der irdischen Dinge hatte, sei es, weil er zu tief in seine Träumerei versunken war, oder weil er dem Trieb zu schlafen nach all den Ermüdungen und quälenden Gedanken nachgegeben hatte.
Mit einem Male glaubte er, daß ihn eine fürchterliche Stimme gerufen habe – und er erbebte wie einer, der in schwerem Angsttraume in die Tiefen eines Abgrundes stürzt. Er schloß die Augen – die Strahlen eines hellen Lichtes blendeten ihn. Aus der Finsternis sah er einen rötlichen Kreis auftauchen, in dessen Mitte ein kleiner alter Mann stand, der ihn mit seiner Lampe beleuchtete. Er hatte ihn weder kommen, noch sprechen, noch sich bewegen gehört.
Diese Erscheinung hatte wirklich etwas von Magie an sich. Der unerschrockenste Mann hätte vor dieser Gestalt, die aus einem der Sarkophage hier gestiegen schien, gezittert, zumal, wenn sie ihn so aus dem Schlafe geweckt hätte.
Die sonderbare Jugendlichkeit in den unbewegten Augen des Phantoms machte endlich, daß der Unbekannte nicht mehr an Übernatürliches dachte; dennoch verharrte er die Weile zwischen seinem Traumleben und der Wirklichkeit in jenem Zustande philosophischen Zweifels, wie ihn Descartes empfiehlt, und stand, wider seinen Willen, unter der Macht der unerklärlichen Erscheinungen, die unsere Klugheit leugnen möchte und die eine ohnmächtige Wissenschaft vergeblich zu deuten versucht.
*
Man stelle sich einen kleinen alten Mann in einem schwarzen Samtgewande, um die Hüften mit einer dicken Seidenschnur gegürtet, vor. Auf dem Kopfe trug er eine ebenso schwarze enganliegende Samtmütze, unter der auf allen Seiten lange Strähne weißen Haares hervorquollen. Das Gewand barg seinen Körper wie ein weites Leichentuch und ließ nichts von menschlicher Gestaltung sichtbar werden, nur ein schmales bleiches Gesicht. Wenn der Alte nicht den hageren fleischlosen Arm, der wie ein Stock war, über den man Stoffe hängt, emporgestreckt hätte, um den Unbekannten mit seiner Lampe zu beleuchten, hätte das Gesicht wie in der Luft schwebend ausgesehen. Ein grauer, spitz zugeschnittener Bart verbarg das Kinn dieses fremdartigen Wesens und machte ihn den jüdischen Modellköpfen ähnlich, nach denen die Künstler Moses dargestellt haben.
Die Lippen dieses Mannes waren so schmal und farblos, daß es besonderer Aufmerksamkeit bedurfte, um die Linie seines Mundes zu erraten. Seine breite, runzlige Stirn, seine fahlen, hohlen Wangen, die unversöhnliche Härte seiner kleinen, grünen, brauen- und wimperlosen Augen konnten den Unbekannten glauben machen, daß der »Mann mit der Goldwage« von Gerard Dow aus seinem Rahmen gestiegen sei. Die Tiefe der Furchen und der Falten rund um die Schläfen verrieten die Feinnervigkeit eines Inquisitors und zugleich ein tiefes Wissen um alle Dinge des Lebens. Diesen Mann zu täuschen mußte unmöglich sein; er schien die Gabe zu besitzen, die geheimsten Gedanken im Grunde der Herzen aufzuspüren. Die Eigenschaften aller Völker der Erde und alle ihre Weisheit war in diesem kalten Gesichte gesammelt, wie die Werke der ganzen Welt in den verstaubten Magazinen aufgehäuft waren. In seinem Gesichte konnte man die stille Erleuchtung eines Gottes, der alles sieht – oder auch die stolze Kraft eines Mannes, der alles gesehen hat, lesen. Für einen Maler hätte es zweier Pinselstriche bedurft, um aus einem Porträt dieses Gesichtes ein schönes Bildnis des ewigen Vaters oder die grinsende, tückische Fratze des Mephistopheles zu machen; denn beides stand darin – das Göttliche in der erhabenen Macht der Stirne und das Teuflische in dem düsteren Hohne des Mundes.
Dieser Mann mußte alle menschlichen Leiden mit unerhörter Stärke in sich zertreten und alle irdischen Freuden in sich ertötet haben.
Der Sterbende schauderte in der Ahnung, daß dieser alte Dämon Bereiche jenseits dieser Welt bewohne und darin ganz allein sei, ohne Genüsse, weil er keine Illusionen mehr hatte – und ohne Qualen, weil er die Lust nicht mehr kannte.
Das war der Anblick, der den jungen Mann überraschte, da er seine Augen aufschlug und aus seinen Gedanken voll Tod und phantastischen Bildern erwachte.
Diese Erscheinung geschah ihm in Paris, in einem Hause des Kai Voltaire, im neunzehnten Jahrhundert, an einem Orte also und in einer Zeit, die Zauberei als eine Unmöglichkeit erscheinen ließen.
Der Unbekannte, der Schüler von Gay-Lussac und Arago, Sohn des aufgeklärtesten Zeitalters und Verächter aller Taschenspielerkunststücke, gab sicher nur einer Ergriffenheit nach, wie wir sie alle uns zuweilen gestatten, um verzweifelten Wirklichkeiten zu entfliehen oder um die Macht Gottes zu versuchen. Er zitterte also vor diesem Lichte und dem alten Mann in der unerklärlichen Ahnung einer außergewöhnlichen Macht; aber diese Erregung haben wir ja alle vor Napoleon oder in Gegenwart eines großen ruhmreichen Mannes, dessen strahlendes Genie uns hinriß, erlebt.
*
»Sie wünschen das Christusbild von Rafael zu sehen, mein Herr?« sagte der Alte höflich, mit einer Stimme, in deren kurzem klarem Wohllaut etwas Metallisches klang. Er stellte die Lampe auf eine zerbrochene Säule, so daß die Kassette voll beleuchtet war.
Bei den frommen Namen Christi und Rafaels machte der junge Mann eine Bewegung der Neugier, die der Kunsthändler zweifellos erwartet haben mochte: er drückte auf eine Geheimfeder. Sofort glitt die Mahagonifüllung in eine Rille, versank lautlos und gab das Bild der Bewunderung frei. Beim Anblick dieses unsterblichen Werkes vergaß der Unbekannte alle Phantasien in diesen Magazinen und die Absonderlichkeiten seines Schlafes – und wurde wieder Mensch; er erkannte in dem Alten ein Wesen aus Fleisch und Blut, ganz lebendig und gar nicht phantastisch – und lebte wieder in der wirklichen Welt. Die zärtliche Besorgtheit und die sanfte Heiterkeit des göttlichen Antlitzes übten überdies ihre Wirkung auf ihn. Ein Hauch des Himmels verwehte die Qualen, die ihn bis ins Mark der Knochen brannten. Das Haupt des Heilandes der Menschen schien aus den Finsternissen, die der schwarze Hintergrund darstellte, aufzusteigen. Ein Strahlenkranz leuchtete hell um sein Haar und sandte sein Licht empor. Seine Stirn, sein Fleisch, jeder Zug strömte wunderbare Kraft beredtester Überzeugung aus. Die purpurnen Lippen sprachen die Worte des Lebens – und der Beschauer horchte dem geheiligten Widerhall in den Lüften, er forderte von dem Schweigen die wunderbaren Gleichnisse – er lauschte in die Zukunft und vernahm das heilige Wort in den Zeichen der Vergangenheit. Das Evangelium war übersetzt in seine anbetungswürdigen Augen voll stiller Einfachheit, darin die Geängstigten ihre Zuflucht haben. Und die ganze christkatholische Religion war in seinem süßen, erhabenen Lächeln zu lesen, das ihre wesentlichste Vorschrift: »Liebet einander« aussprach. Dieses Bild zwang zum Gebete, empfahl Verzeihung, erstickte die Selbstsucht und erweckte alle schlafenden Tugenden zum Leben. Dieses Werk von Rafael hatte teil an der nur der Musik eigenen Zauberkraft: es zwang den Beschauer unter die holde Herrschaft des Erinnerns – und sein Triumph war vollständig: der Maler war vergessen.
Dazu kam noch der besondere Reiz des Lampenlichtes: das Haupt Christi schien sich ferne zu bewegen und Augenblicke lang von einer Wolke verhüllt zu sein.
»Diese Leinwand habe ich mit Goldstücken bedeckt«, sagte der Händler kalt.
»Jetzt heißt es sterben!« schrie der junge Mann auf. Er war jäh aus seiner Träumerei, die ihn aus seinem schweren Geschicke unmerklich in eine letzte Hoffnung geleitet hatte, aufgewacht.
»Ah, ich habe also recht gehabt, dir zu mißtrauen!« rief der Alte, packte die Handgelenke des Unbekannten und umschloß sie wie ein Schraubstock.
Der junge Mann lächelte traurig über diesen Verdacht und sprach sanft: »Sie brauchen nichts zu fürchten. Es handelt sich um mein Leben, nicht um das Ihre. Ich kann Ihnen ruhig meinen unschuldigen Betrug verraten«, fuhr er nach einem Blicke auf den beunruhigten alten Mann fort. »Ich erwartete die Nacht, um mich ohne Aufsehen zu ertränken. Bis dahin wollte ich mir Ihre Herrlichkeiten ansehen. Wer wird einem Mann der Wissenschaften und der Dichtung dieses letzte Vergnügen nicht verzeihen?«
Der argwöhnische Händler musterte mit einem scharfen Blicke das düstere Gesicht seines falschen Kunden, während er ihm zuhörte. Der Ton dieser leidensvollen Stimme gab ihm seine Sicherheit wieder, vielleicht las er auch in diesen bleichen Zügen das dunkle Schicksal, das vordem die Spieler schaudern gemacht hatte: er gab ihm die Hände frei. Aber in einem Reste des Mißtrauens, das ihn eine hundertjährige Erfahrung gelehrt hatte, streckte er nachlässig die Arme gegen einen Anrichtetisch, wie um sich darauf zu stützen – und nahm hier ein Stilett.
»Sind Sie vielleicht so ein überzähliger Staatsbeamter, der seit drei Jahren keine Gratifikation bekommen hat?«
Der Unbekannte konnte während seiner verneinenden Bewegung ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Hat Ihr Vater Ihnen allzusehr vorgeworfen, daß Sie auf die Welt gekommen sind? Oder haben Sie etwas Entehrendes getan?«
»Wenn ich etwas Entehrendes tun wollte, könnte ich weiterleben.«
»Hat man Sie im Theater ausgepfiffen? Müssen Sie vielleicht Gassenhauer komponieren, um das Begräbnis Ihrer Geliebten zu bezahlen? Oder leiden Sie nur an der Geldkrankheit? Oder haben Sie genug von der Langeweile? Wie heißt der Irrtum, der Sie zum Sterben beredet?«
»Sie sollen die Ursprünge meines Sterbens nicht in den gewöhnlichen Gründen suchen, die zum Selbstmorde führen. Um Ihnen eine Enthüllung unerhörter Leiden, die in der Menschensprache gar nicht ausdrückbar sind, zu ersparen, will ich Ihnen einfach sagen, daß ich im tiefsten, gemeinsten und marterndsten Elend bin.« Er fügte mit einer Stimme, deren wilde Entschlossenheit seine vorhergegangenen Worte widerrief, hinzu: »Und ich will nicht betteln, weder um Hilfe noch um Trost.«
»Ah, ah!« Diese beiden Silben, mit denen der Alte zuerst antwortete, waren wie der Laut einer Schnarre. Dann aber sprach er weiter: »Ich werde Sie nicht zwingen, mich zu bitten, und Sie nicht erröten machen. Ich gebe Ihnen weder einen französischen Centime, noch einen levantinischen Para, keinen deutschen Heller, keine russische Kopeke, weder einen schottischen Farthing noch eine Sesterze, noch einen Obolus der Alten Welt, noch einen Piaster der Neuen – ich biete Ihnen nichts an, was Gold, Silber, Scheidemünze, Banknote oder Schatzschein ist; aber ich will Sie reicher, mächtiger, angesehener machen, als es ein konstitutioneller König je sein kann.«
Der junge Mann glaubte, der Alte rede kindisches Zeug, und verharrte erstarrt und ohne Antwort.
»Drehen Sie sich um!« sagte der Händler plötzlich, erhob die Lampe und beleuchtete die Wand gegenüber dem Bilde. »Betrachten Sie dieses Chagrinleder!« setzte er hinzu.
*
Der junge Mann sprang heftig auf und war einigermaßen erstaunt, als er über seinem Sessel ein Stück Chagrinleder an der Wand befestigt sah, das etwa die Größe eines Fuchsfelles hatte. Dieses Stück Leder strahlte auf unerklärliche Weise aus der Tiefe der Finsternis in dem Magazin einen solchen Glanz aus, daß man es hätte für einen kleinen Kometen halten können. Der junge Ungläubige näherte sich dem angeblichen Talismane, der ihn aus dem Unglück retten sollte, und machte innerlich eine spöttische Bemerkung über ihn. Voll begreiflicher Neugier betrachtete er das Leder von allen Seiten und entdeckte bald eine ganz natürliche Ursache für seine Leuchtkraft. Die schwarze Körnung des Leders war so gut geglättet und gebräunt, seine Streifen und Runzeln waren so blank und sauber, daß jede Unebenheit des orientalischen Leders einen kleinen Brennspiegel bildete, der wie die Facetten eines Granats das Licht der Lampe zurückwarf.
Er bewies mit mathematischer Genauigkeit dem Alten die Ursache dieser Erscheinung, – doch dieser lächelte boshaft, ohne zu antworten. Dieses Lächeln der Überlegenheit ließ den jungen Mann argwöhnen, daß ein Scharlatan ihn zum besten halte. Er hatte nicht Lust, noch ein Rätsel mehr ins Grab mitzunehmen; rasch wandte er das Leder um, wie ein Kind, das sich eilt, das Geheimnis seines neuen Spielzeuges kennenzulernen. »Ah!« rief er aus, »hier ist die Spur des Siegels, das die Orientalen das Siegel Salomons nennen!«
»Das kennen Sie?« fragte der Händler und stieß ein paarmal die Luft heftig durch die Nase, was mehr Gedanken Ausdruck verlieh, als es die kräftigsten Worte vermocht hätten.
»Gibt es auf der ganzen Welt einen Menschen, der einfältig genug ist, an so ein Hirngespinst zu glauben?« rief der junge Mann aus, gereizt durch das stumme Lachen und die bittere Verhöhnung darin. »Wissen Sie nicht,« fuhr er fort, »daß der Aberglaube der Orientalen die mystische Form und die verlogenen Zeichen auf diesem Siegel, das eine märchenhafte Macht haben soll, heilig gesprochen hat? Wenn ich daran glaubte, könnte man mich für ebenso dumm halten, als wenn ich an Greife und Sphinxe glaubte, deren Existenz die Mythologie behauptet.«
»Da Sie Orientalist sind,« unterbrach ihn der Alte, »lesen Sie vielleicht den Spruch hier?« Er hob die Lampe ganz nahe an den Talisman, den der junge Mann noch umgekehrt hielt, und zeigte ihm die Zeichen, die in die Zellstruktur der wunderbaren Haut so eingeritzt waren, als seien sie an dem Tiere, dem sie einst gehört hatte, darin gewachsen. »Ich muß gestehen,« rief der junge Mann, »daß ich keine Ahnung von der Art habe, auf die man diese Buchstaben so tief in die Haut eines Wildesels eingraben konnte.« Während er sich lebhaft zu den Tischen voller Raritäten zurückwandte, schienen seine Blicke darauf etwas zu suchen.
»Was wollen Sie?« fragte der Alte.
»Ein Instrument, um das Leder zu zerschneiden, damit ich sehe, ob die Zeichen aufgedrückt oder eingelegt sind.«
Der Alte reichte dem Unbekannten sein Stilett, und dieser versuchte das Leder dort, wo die Buchstaben standen, anzuschneiden; aber kaum hatte er eine dünne Lage aus dem Leder herausgehoben, erschienen die Buchstaben sofort wieder reinlich und völlig gleich denen, die an der Oberfläche waren, so daß er einen Augenblick meinte, gar nichts daran getan zu haben.
»Das orientalische Kunsthandwerk hat seine Geheimnisse, die ihm ganz allein gehören«, sagte er und blickte schon ein wenig beunruhigt auf den Spruch.
Der Alte entgegnete: »Es ist allerdings leichter, sich an die Menschen zu halten als an Gott.«
Die geheimnisvollen Worte waren auf folgende Weise angeordnet:
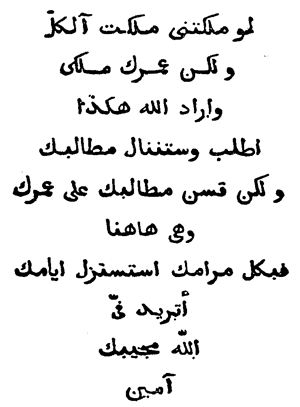
Sie bedeuten in unserer Sprache:
Wenn du mich besitzest, besitzest du alles.
Aber dein Leben wird mir gehören. Gott hat
Es so gewollt. Wünsche, und deine Wünsche
Werden erfüllt. Aber richte
Deine Wünsche auf dein Leben.
Es ist da. Mit jedem
Wunsche nehme ich ab
Wie deine Tage.
Du willst mich?
Nimm! Gott wird
dich erhören.
Es sei!
»Ah, Sie lesen fließend Sanskrit,« sagte der Alte, »sind Sie in Persien oder Bengalen gereist?«
»Nein!« entgegnete der junge Mann, indessen er neugierig dieses gleichnishafte Leder betastete, das sich in seiner geringen Biegsamkeit wie ein Metallblatt anfühlte. Der alte Händler stellte die Lampe auf die Säule zurück, von wo er sie genommen hatte, und richtete auf den jungen Mann einen Blick kalten Spottes, der zu sagen schien: »Der denkt schon nicht mehr an das Sterben!«
*
»Ist das ein schlechter Scherz? Ist das ein Geheimnis?« fragte der junge Unbekannte. Der alte Mann hob den Kopf und sprach schwer und ernst: »Ich kann Ihnen nicht antworten. Ich habe diesen Talisman Männern mit mehr Kraft, als Sie zu haben scheinen, angeboten: sie haben über den Einfluß, den er auf ihr künftiges Geschick haben sollte, gespottet, doch keiner wollte sich zu dem Vertrage, den eine unbekannte Macht so schicksalsvoll anbietet, entschließen. Ich denke wie die anderen. Ich habe geschwankt, ich habe mich enthalten – und …«
»Und Sie haben es nicht einmal versucht?« unterbrach ihn der junge Mann.
»Versuchen! Wenn Sie auf der Säule des Vendôme-Platzes stehen, wollten Sie da versuchen, sich in die Lüfte zu schwingen? Kann man den Hingang seines Lebens aufhalten? Hat je ein Mensch den Tod vom Leben trennen können? Bevor Sie dieses Kabinett betraten, hatten Sie sich zum Selbstmord entschlossen: plötzlich beschäftigt Sie ein Geheimnis und zerstreute Ihnen Ihre Todesgedanken. Sie Kind! Bietet Ihnen nicht jeder Tag Ihres Lebens Rätsel, die interessanter sind als dieses hier? Hören Sie auf mich! Ich habe das liederliche Leben am Hofe des Regenten gesehen. Damals war ich im Elend wie Sie – und habe um mein Brot gebettelt. Trotzdem bin ich hundertundzwei Jahre alt geworden und habe Millionen erworben. Das Unglück hat mich mit Vermögen beschenkt, die Unwissenheit hat mich unterrichtet. In zwei Worten will ich Ihnen ein weniges von einem der großen Geheimnisse des menschlichen Lebens entdecken: der Mensch erschöpft seine Kräfte in zwei instinkthaften Betätigungen, die beide die Quellen seines Daseins versiegen machen. Zwei Worte drücken alle Formen, die diese beiden Ursachen seines Todes annehmen, aus – sie heißen: Wollen und Können. Zwischen diesen beiden Polen menschlicher Handlungen gibt es dann nur noch jene Formel, von der die Weisen Gebrauch machen; ihr verdanke ich mein Glück und mein langes Leben. Wollen verbrennt uns und Können zerstört uns – doch Wissen gewährt unserem schwachen Dasein einen dauerhaften Zustand der Stille.
So ist Wunsch und Wollen in mir tot, getötet durch Gedanken; die Erregung und das Können haben mit dem natürlichen Altern meiner Organe ihr Ende gefunden. Kurz, ich habe mein Leben nicht auf das Herz gestellt, das bricht, noch auf die Sinne, die sich erschöpfen, sondern auf mein Gehirn, das sich nicht abnützt und das alles überlebt. Kein Übermaß hat meinen Körper noch meine Seele versehrt. Aber ich habe die ganze Welt gesehen: ich habe die höchsten Berge Asiens und Amerikas bestiegen, habe alle menschlichen Sprachen gelernt, ich habe unter allen Regierungsformen gelebt. Ich habe einem Chinesen Geld geliehen und als Pfand dafür den Leichnam seines Vaters genommen. Ich habe dem Worte eines Arabers vertraut und in seinem Zelte geschlafen. Ich habe Verträge in allen Hauptstädten Europas abgeschlossen – aber ich habe ohne Bedenken mein Geld in den Wigwams der Indianer gelassen. Kurz, ich habe endlich alles erreicht, weil ich alles verachten lernte. Meine einzige Begierde war: zu sehen. Ist Sehen denn nicht schon Wissen? Junger Mensch, und ist Wissen nicht die Freude an der Anschauung und zugleich die Entdeckung des eigentlichen Inhaltes der Dinge und Besitzergreifung auf die wesentlichste Art? Was bleibt vom materiellen Besitz? Eine Idee.
Urteilen Sie nun selber, wie schön das Leben eines Menschen sein muß, der allen seinen Gedanken das Siegel der Wirklichkeit aufdrücken kann, der in seiner Seele die Quellen seines Glückes und einen wunderbaren Extrakt von tausend Genüssen ohne allen irdischen Makel mit sich trägt. Der Gedanke ist der Schlüssel zu allen Schätzen: er spendet die Freuden des Geizigen, ohne damit seine Sorgen aufzubürden. Indem meine Genüsse immer nur geistige Freuden waren, lernte ich es, über der Welt zu schweben. Meine Ausschweifungen waren die Betrachtungen der Meere, der Völker, der Wälder und der Gebirge. Ich habe alles gesehen, doch ganz ruhig und ohne Ermüdung; ich habe nichts ersehnt und alles erwartet. Ich bin im All wie im Garten meines Hauses lustwandelt. Das, was die Menschen Kummer, Verliebtheiten, Ehrgeiz, Schicksalsschläge und Traurigkeiten nennen, sind für mich die Ideen, aus denen ich mir meine Träume mache; ich fühle sie nicht, ich drücke sie nur aus und übersetze sie; anstatt daß sie mir mein Leben aufzehren können wie den anderen, spiele ich sie mir als meine Theaterstücke vor – und ich unterhalte mich dabei, als ob ich mit inneren Augen Romane läse. Ich habe niemals meine Organe erschöpft, so bin ich heute noch gesund. Meine Seele hat alle die Kräfte, die ich niemals mißbraucht habe, geerbt, und mein Kopf ist heute noch besser eingerichtet als diese meine Magazine. Hier –« sagte er und zeigte auf seine Stirne, »hier sind die wirklichen Millionen. Ich verbringe köstliche Tage, wenn ich mir vernünftig meine Vergangenheit ansehe. Ich rufe mir ganze Länder, Gegenden, Blicke auf die Meere und schöne vergangene Gesichter wieder zum Leben. Ich habe einen Harem des Traumes, darin ich alle Frauen, die ich nie gehabt habe, besitze. Oft sehe ich eure Kriege und eure Revolution wieder vor mir und fälle meine Urteile über sie. Wie kann man es vorziehen, um der leichtsinnigen Bewunderung mehr oder weniger hübsch gefärbten Fleisches, mehr oder weniger runder Formen willen in Fieberzuständen zu leben, wie kann man es vorziehen, alle die Zusammenbrüche eurer betrogenen Hoffnungen auf sich zu nehmen, anstatt die erhabene Fähigkeit zu üben, das All vor das Gericht seiner Seele rufen zu können, und die unermeßliche Freiheit von allen Fesseln des Raumes und der Zeit, die unermeßliche Lust zu genießen, alles umarmen, alles sehen zu können, und sich über die Ränder der Erde zu neigen, um die anderen Sphären zu befragen und Gott selber zu lauschen!«
»Das hier,« sagte er laut und zeigte auf das Chagrinleder, »das ist Wollen und Können in einer Gestalt. Darin ist alles enthalten, eure Ideen von Menschheitsbeglückung, eure ausschweifenden Wünsche und Maßlosigkeiten, eure Freuden, die töten, und eure Schmerzen, die das Leben allzusehr fühlen lassen, denn das Leiden ist vielleicht nur eine furchtbare Art von Genuß. Wer kann die Grenze bestimmen, an der die Lust zum Leiden wird, und die, an der das Leiden eben noch Lust ist? Noch die stärksten Lichter der geistigen Welt sind dem Blicke Liebkosung, während die sanftesten Dämmerungen der physischen Welt ihm wehtun. Kommt das Wort Weisheit nicht von Wissen? Und ist der Irrsinn je anderes als ein Übermaß von Wollen oder Können?«
»Gut also, ich will leben, leben in Übermaß!« sagte der Unbekannte und griff nach dem Chagrinleder.
»Geben Sie acht, junger Mann!« rief der Alte mit unglaublicher Lebendigkeit.
»Ich habe mein Leben in Studien und Gedanken verzehrt – sie haben mir nicht einmal zu essen verschafft,« erwiderte der Unbekannte, »ich will weder der Narr einer Predigt, die Swedenborgs würdig wäre, sein, noch Ihres orientalischen Amuletts – ich will mich nicht von den menschenfreundlichen Anstrengungen hinhalten lassen, die Sie machen, um mich in dieser Welt zurückzuhalten, in der mein Leben ja doch nicht möglich ist … Wir wollen sehen!« setzte er hinzu und preßte den Talisman mit zuckender Hand an sich, während sein Blick auf den alten Mann gerichtet war. »Ich will ein königlich reiches Mahl, ein Bacchanale, das dieses Jahrhunderts, in dem alles, wie man sagt, vollendet ist, würdig sei! Meine Tischgenossen sollen jung, geistvoll, vorurteilslos und ausgelassen bis zur Tollheit sein! Die Weine müssen immer stärker und immer feuriger einander folgen und uns drei Tage lang betrunken machen können. Entflammte Frauen sollen uns diese Nacht verschönen! Ich will, daß rasende, brüllende Ausschweifung uns in ihrer vierspännigen Karosse davontrage bis an die Grenzen der Welt und uns an unbekannten Küsten aussetze! Die Seelen sollen sich bis in die Himmel erheben – oder sich im Schmutze baden; ich mag nicht wissen, ob sie sich erheben oder erniedrigen; es ist mir gleich. Ich befehle dieser düsteren Macht, mir alle Freuden in einer zu schaffen. Ich will die Lüste des Himmels und der Erde in einer Umarmung an mich reißen, um daran zu sterben. Nach dem Trunke wünsche ich ein antikisches Gelage voll unzüchtiger Rasereien, Gesänge, die die Toten erwecken sollen, dreifache Küsse, unendliche Liebesfeste, deren Laut über Paris hinfliege wie der Lärm einer Feuersbrunst, die Ehemänner aus dem Schlafe wecke und sie, selbst wenn sie siebzig Jahre alt sind, verjünge und brennende Gier in ihnen entzünde!«
Ein Auflachen des alten Mannes widerhallte in den Ohren des jungen Wahnsinnigen und brachte ihn augenblicklich zum Schweigen.
»Glauben Sie denn,« sagte der alte Händler, »daß sich plötzlich mein Fußboden öffnen wird, um verschwenderisch gedeckten Tischen und Gästen einer anderen Welt Platz zu machen? Nein, Sie junger Narr! Sie haben den Vertrag geschlossen – damit ist alles gesagt. Jetzt werden alle Ihre Wünsche aufs genaueste erfüllt werden – jedoch auf Kosten Ihres Lebens. Der Kreis Ihrer Tage wird sich entsprechend der Kraft und Zahl Ihrer Wünsche, der geringen wie der maßlosen, verengen. Der Brahmine, von dem ich diesen Talisman habe, hat mir einst erklärt, daß ein geheimnisvolles Zusammenwirken zwischen dem Geschicke und den Wünschen seines Besitzers am Werke sein werde. Ihr erster Wunsch ist recht gewöhnlich: ich könnte ihn erfüllen – aber ich überlasse die Sorge darum den Ereignissen Ihrer neuen Existenz. Sie wollten ja doch sterben! Schön! Ihr Selbstmord ist dann nur aufgeschoben!«
Der Unbekannte, der verwundert und ein wenig gereizt schon die üblen Scherze des sonderbaren Greises anhörte und seine halb menschenfreundlichen Absichten in diesen letzten spottenden Worten erwiesen glaubte, schrie nun: »Das werde ich wohl sehen, ob mein Schicksal sich ändern wird, während ich das Stückchen Kai bis zum Flusse überschreite. Wenn Sie sich wirklich über einen unglücklichen Menschen lustig machen, wünsche ich Ihnen als Rache dafür, daß Sie sich in eine Tänzerin verlieben. Dann werden Sie das Glück der Ausschweifung verstehen lernen und werden vielleicht all die Reichtümer wieder vergeuden, mit denen Sie so weise hausgehalten haben.«
Er ging fort; er hörte nicht mehr den tiefen Seufzer, den der alte Mann ausstieß. Gefolgt von dem pausbäckigen Gehilfen, der ihm vergebens zu leuchten versuchte, durchschritt er die Säle, eilte er die Treppe hinab. Er lief wie ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt wird. In der Blindheit seiner Erregung merkte er nicht einmal, wie unglaublich geschmeidig das Chagrinleder plötzlich geworden war, so daß es sich leicht wie ein Handschuh um seine zuckenden Finger rollte und auch endlich in der Rocktasche, wohin er es gedankenlos steckte, Platz fand.
*
Er stürzte aus der Ladentür auf die Straße und stieß mit drei jungen Leuten, die Arm in Arm gingen, zusammen.
»Vieh!« »Trottel!« waren die anmutigen Namen, die sie einander zuriefen.
»Das ist ja Rafael!«
»Wir haben dich gesucht!«
»Was, Ihr seid es?«
Diese drei Ausrufe folgten der Beschimpfung im Augenblicke, da das Licht einer Laterne, die im Winde schaukelte, die Gesichter der erstaunten Gruppe erhellte.
»Lieber Freund, jetzt kommst du mit uns!«
»Komm nur, die Geschichte erzähl' ich dir im Gehen.«
Rafael ließ sich halb willig von den Freunden, die ihn unter den Armen gefaßt hatten, mitnehmen und gegen den Pont des Arts zu schleppen.
»Mein Lieber,« fuhr der Sprecher fort, »wir sind seit fast einer Woche hinter dir her. In deinem verehrlichen Hotel Saint Quentin (auf dessen Schild, nebenbei bemerkt, die Lettern noch genau so abwechselnd rot und schwarz sind wie zur Zeit von Jean-Jacques Rousseau) hat uns deine Leonarde gesagt, daß du aufs Land gefahren seist. Wir schauen doch wirklich nicht wie Leute aus, die wegen Geld kommen, weder wie Gerichtsvollzieher noch wie Gläubiger oder so etwas. Aber das macht nichts! Rastignac hat dich gestern im Theater gesehen – wir faßten wieder Mut und haben unseren Stolz darein gesetzt, zu entdecken, ob du vielleicht auf einem Baum in den Champs Elysées hängst, ob du jetzt für zwei Sous in einem der Nachtasyle, wo die Bettler sich an gespannte Stricke lehnen und schlafen, übernachtest, oder ob du dich vielleicht in der glücklicheren Lage befändest, in einem hübschen Boudoir zu biwakieren. Aber wir haben dich nirgends gefunden, weder in den Häftlingslisten von St. Pelagie, noch in denen des Zuchthauses. Die Ministerien, die Oper, die Freudenhäuser, Cafés, Bibliotheken, die Listen der Präfektur, die Journalistenzimmer und Restaurants, die Foyers der Theater, kurz alles, was es in Paris an angenehmen und argen Örtlichkeiten gibt, haben wir sorgfältig durchforscht – wir hatten es schwer genug, da wir nach einem Menschen fahnden mußten, der gescheit genug ist, ebensogut bei Hof wie im Gefängnis sein zu können. Wir redeten schon davon, dich wie einen Helden der Julirevolution heilig zu sprechen! Mein Ehrenwort! – du hast uns gefehlt!«
In diesem Augenblick ging Rafael mit seinen Freunden über den Pont des Arts und blickte nun, ohne auf sie zu hören, auf die brausenden Wasser der Seine hinab, aus denen die Lichter von Paris heraufleuchteten. Da er den Fluß überschritt, in den er sich kurz zuvor hatte stürzen wollen, waren die Prophezeiungen des Alten bereits erfüllt: seine Todesstunde war vom Schicksale hinausgeschoben.
»Du hast uns wirklich gefehlt!« setzte der Freund fort. »Es handelt sich nämlich um eine Sache, in der wir dich für den richtigen Mann halten, der die nötige Überlegenheit besitzt. Die Gefahr, daß der König mit seinen Kunststücken die Verfassung verschwinden läßt, ist heute größer denn je. Die schuftige Monarchie, die der Heroismus des Volkes gestürzt hat, war ein leichtfertiges Frauenzimmer, mit dem man lachen und Gelage feiern konnte; aber das Vaterland ist ein mürrisches, tugendhaftes Eheweib, dessen öde Liebkosungen man wohl oder übel über sich ergehen lassen muß. Du weißt, daß jetzt die Macht von den Tuilerien auf die Journalisten übergegangen ist, gerade so wie das Kapital von den Aristokraten des Fauborg St. Germain zu den Finanzleuten der Chaussée d'Antin ausgewandert ist.
Aber etwas weißt du wahrscheinlich nicht: die Regierung, das heißt, die Geldleute und Advokaten, die heute für das Vaterland das sind, was früher die Priester für die Monarchie waren, die Regierung hat plötzlich die Nötigung gefühlt, das gute Volk von Frankreich mit neuen Worten und alten Ideen zum besten zu halten, gerade so wie es die Philosophen aller Richtungen und die starken Geister zu allen Zeiten getan haben. Die Regierung will uns also einreden, wir seien weit glücklicher, wenn wir zwölf Millionen für das Vaterland in Gestalt der Herren Soundso, die ›Wir‹ sagen, zahlen dürfen, statt der elf Millionen für einen König, der ›Ich‹ sagt. Kurz und gut, es soll jetzt, mit einigen hunderttausend guten Franken bewaffnet, eine Zeitung gegründet werden, die eine Opposition zur Befriedigung der Unzufriedenen schaffen wird, ohne freilich damit der nationalen Regierung des Bürgerkönigs zu schaden. Wir sind die rechten Leute für eine solche Zeitung! Wir machen uns über die Freiheit ebenso lustig wie über die Despotie, über die Religion nicht minder wie über den Unglauben. Das Vaterland ist für uns jedoch nur die Hauptstadt, in der man Ideen zu Geld macht und pro Zeile verkauft, wo jeder Tag ein ordentliches Mahl und allerlei Schauspiel bringt, wo es freche Damen im Überfluß gibt, die Nachtmähler erst am anderen Morgen enden, und wo man die Liebe stundenweise mietet wie die Droschken. Paris soll nur weiter das anbetenswerteste aller Vaterländer sein, das Vaterland der Freude, der Freiheit, des Geistes, der hübschen Frauen, der schlechten Kerle und der guten Weine – wenn wir die Zuchtrute der Macht nur nicht selber zu spüren bekommen, werden wir die Macht gerne stützen! Wir, die rechten Gläubigen unseres Gottes Mephistopheles, wollen es auf uns nehmen, die öffentliche Meinung noch dümmer zu machen. Wir werden die alten Schauspieler neu anziehen und ein neues Dach über die Baracke von Regierung nageln. Den Altliberalen werden wir unsere Tränklein eingeben, die alten Republikaner wieder entflammen, den Bonapartismus auffrischen und das Zentrum neu beleben – wenn wir nur innerlich über ihre Könige und Völker lachen dürfen, abends nicht mehr derselben Meinung wie am Morgen sein müssen und bei alledem ein Leben wie Panurg oder more orientali auf schwellenden Kissen führen dürfen! Dir haben wir die Führung in diesem tollen Hanswurststück zugedacht. Wir führen dich jetzt zu einem Festmahle, das der Gründer der genannten Zeitung gibt. Das ist ein Bankier, der sich von seinen Geschäften zurückgezogen hat und jetzt nicht weiß, was er mit seinem vielen Gelde machen soll: so will er es gegen Geist umwechseln. Du wirst dort wie ein Bruder aufgenommen werden: wir werden dich als den König der Mißvergnügten begrüßen, als einen, dessen Scharfblick die Absichten Österreichs, Englands oder Rußlands schon durchschaut, bevor Rußland, England oder Österreich noch Absichten hat. Ja, wir setzen dich zum Herrscher über die Mächte der Intelligenz ein, die der Welt die Mirabeaus, die Talleyrands, die Pitts, die Metternichs und alle die geschickten Leute liefert, die untereinander um die Geschicke der Reiche spielen, wie die gewöhnlichen Leute um ein Glas Kirschwasser Domino spielen. Wir haben dich als den furchtlosesten Burschen hingestellt, der je mit dem furchtbaren Wunderwesen Laster, gegen das die stärksten Geister vergebens gekämpft haben, Brust an Brust gerungen hat – und wir haben sogar behauptet, daß es dich noch nicht unterworfen hat. Ich hoffe, daß du unsere Behauptungen nicht zu Lügen machen wirst. Unser Gastgeber Taillefer hat uns versprochen, alle die kümmerlichen Saturnalien, wie sie uns modernen Lukullusnaturen beschieden sind, mit seinem Feste übertreffen zu wollen. Er ist reich genug, um Größe in die Niedrigkeit und Anmut und Pracht in das Laster zu bringen. Hörst du, Rafael?« unterbrach sich der Sprecher plötzlich. »Ja!« antwortete der junge Mann. Sein Erstaunen, daß seine Wünsche in Erfüllung gehen sollten, war weit geringer als seine Verwunderung über die ganz natürliche Art, wie das geschah. Zwar wollte er nicht an den Einfluß einer magischen Kraft glauben, aber ein tiefes Staunen über den wechselvollen Gang des Menschengeschickes erfüllte ihn.
»Du sagst dein Ja, als ob du dabei an den Tod deines Großvaters dächtest«, sagte ihm der eine seiner Nachbarn.
Nun begann Rafael in einem Tone zu sprechen, dessen Kindlichkeit die Schriftsteller um ihn, diese Hoffnungen des jungen Frankreichs, zum Lachen reizte: »Meine Freunde, mir scheint, wir sind jetzt dabei, richtige schlechte Kerle zu werden. Bis jetzt haben wir unsere Schlechtigkeiten zwischen zwei Trinkgelagen begangen, haben das Leben im Rausche beurteilt und Menschen und Dinge eingeschätzt, während wir verdauten. Wir waren Halunken des Wortes – aber im Tun sind wir Jungfrauen geblieben. Wenn uns aber erst das heiße Eisen der Politik brandmarkt, werden wir in das große Zuchthaus kommen und darin bald unsere Illusionen verloren haben. Wer nur mehr an den Teufel glaubt, darf sich wohl in das Paradies der Jugend und die Jahre der Unschuld zurücksehnen, in die Zeit, da wir fromm einem guten Priester den Mund öffneten, auf daß er uns den geheiligten Leib unseres Herrn Jesus Christus auf die Zunge lege. Meine lieben Freunde, es hat uns soviel Vergnügen gemacht, unsere ersten Sünden zu begehen, weil die Gewissensbisse sie uns versüßt und ihnen den Geschmack gegeben haben – aber jetzt …«
»Oh, jetzt,« sagte der erste Sprecher, »jetzt bleibt uns …«
»Das Verbrechen …«
»Das Wort ist hoch wie der Galgen und tief wie die Seine«, erwiderte Rafael.
»Aber du verstehst mich falsch! Ich rede ja von politischen Verbrechen. Seit diesem Morgen beneide ich nur mehr die Verschwörer um ihre Existenz! Ob meine Phantasie bis morgen aushalten wird – das weiß ich nicht. Aber heute abend empört sich mir das Herz über das ausgeblichene Leben unserer Zivilisation, das einförmig ist wie eine Eisenbahnschiene. Ich bin voll Leidenschaft für das Elend des Rückzuges von Moskau, für die Abenteuer des roten Piraten und das Leben der Schmuggler. Da es keine Kartäuserklöster mehr in Frankreich gibt, wünsche ich mir wenigstens eine Botany-Bay, eine Art Siechenhaus für die kleinen Lord Byrons, die, nachdem sie ihr Leben zerknüllt haben wie eine Serviette nach dem Essen, nichts weiter zu tun wissen, als etwa noch ihre Länder in Brand zu stecken, sich den Schädel zu zerschmettern, sich für die Republik zu verschwören oder nach Krieg zu verlangen …«
»Emile,« sagte Rafaels Nachbar voll Feuer zu dem Redenden, »mein Wort, ohne die Julirevolution wäre ich Priester geworden und hätte irgendwo auf dem Lande ein dumpfes Leben geführt …«
»Du hättest alle Tage das Brevier gelesen?«
»Ja!«
»Du bist ein Idiot!«
»Wir lesen dafür die Zeitungen!«
»Nicht schlecht – für einen Journalisten! Aber sei ruhig, wir gehen inmitten einer Menge von Abonnenten. Weißt du, der Journalismus ist die Religion der modernen Gesellschaft – und das ist doch ein Fortschritt!«
»Wieso?«
»Die Päpste sind nicht verpflichtet, daran zu glauben – und das Volk auch nicht.«
So miteinander plaudernd, wie brave Leute, die seit langen Jahren De viris illustribus gründlich kennen, kamen sie vor einem Hause der Rue Joubert an.
*
Emile war Journalist, er hatte sich im Nichtstun bereits mehr Ruhm erworben als andere mit all ihren Erfolgen. Er war ein kühner Kritiker, feurig und zugleich voll beißenden Spottes – und besaß alle wertvollen Eigenschaften, die sich mit seinen Fehlern vertrugen. In lachender Offenheit konnte er einem Freunde tausend boshafte Epigramme ins Gesicht sagen – denselben aber, wenn er nicht zugegen war, mutig und treu verteidigen. Er spottete über alles, auch über seine Zukunft. Er hatte niemals Geld und war wie viele Männer von Bedeutung unsagbar faul – er vertat vor Leuten, die in all ihren Büchern kaum ein gelungenes Wort zuwege brachten, ganze Bücher in einem Worte. Er ging verschwenderisch mit Versprechen um, löste kein einziges ein und hatte sich aus seinem Ruhm und seinem Glücke ein Kissen zum Schlafen gemacht, auf die Gefahr hin, darauf alt zu werden und eines Tages im Spitale aufzuwachen. Im übrigen war er als Freund verläßlich bis zum Schafott; sein Zynismus war Aufschneiderei – im Grunde war er einfach wie ein Kind. Er arbeitete nur, wenn ihn plötzlich die Lust packte oder ihn die Not dazu zwang.
»Wir gehen jetzt zu einem ordentlichen Fressen!« sagte er zu Rafael und wies auf den Blumenschmuck des Stiegenhauses.
»Ich liebe gut geheizte Vorhallen mit kostbaren Teppichen,« antwortete ihm Rafael; »daß der Luxus schon im Peristyl beginnt, ist selten in Frankreich. Ich fühle mich hier wie neugeboren.«
»Da droben werden wir trinken und lachen, mein lieber Rafael; oh, ich hoffe, daß wir Sieger bleiben und denen allen auf die Köpfe steigen.«
Eintretend wies er mit einer spöttischen Gebärde auf die Gäste in dem goldglänzenden, lichterhellen Salon – die bedeutendsten jungen Leute von Paris, die sie hier begrüßten. Da war ein neuer begabter Maler, der schon mit seinem ersten Bilde dem berühmten Maler des kaiserlichen Frankreichs ein gefährlicher Rivale geworden war. Ein anderer hatte gestern die Herausgabe eines Buches gewagt, das voll junger Kraft und Verachtung alles Literarischen war und der Dichtung neue Wege wies. Etwas entfernter stand ein junger Bildhauer, dessen hartes Gesicht eine gewalttätige Art von Genie verriet, im Gespräche mit einem jener kalten Spötter, die, je nach den Umständen, das eine Mal nirgends eine Überlegenheit zugeben wollen – und sie dann ein andermal wieder überall anerkennen. Dort wieder lauerte der geistreichste der modernen Karikaturisten mit boshaftem Blicke und bissigem Munde auf witzige Epigramme, um sie sofort in Bleistiftskizzen umzusetzen. Dort wieder unterhielt sich der junge kühne Schriftsteller, der besser als alle die Quintessenz politischer Gedanken zu destillieren oder zu kondensieren verstand und sich stets für einen fruchtbaren, schöpferischen Schriftsteller ausgab, mit dem Dichter, dessen Schriften alle Werke der Gegenwart in den Boden gestampft hätten – wenn sein Talent so stark wie sein Haß gewesen wäre. Beide versuchten, nicht zu lügen und doch nicht die Wahrheit zu sagen, und überhäuften einander mit süßen Schmeichelreden. Ein berühmter Musiker tröstete in B-Dur und mit spöttischem Tone einen jungen Politiker, der kürzlich von der Tribüne gestürzt worden war, ohne sich dabei freilich sonderlich wehgetan zu haben. Junge Autoren ohne Stil standen neben jungen Autoren ohne Einfälle, überaus lyrische Prosadichter neben recht prosaischen Lyrikern. Voll Erbarmens für ihre Unvollkommenheiten gesellte sich ein armer Saint-Simonist, der naiv genug war, an seine Lehre zu glauben, zu ihnen, ohne Zweifel, um sie zu seinem Glauben zu bekehren.
Endlich waren noch zwei oder drei von jenen Weisen da, deren Schicksal es ist, jede Gesprächsatmosphäre durch ihren Stickstoff zu verderben; daneben ein paar Schwankdichter voll Bereitschaft, ihre Eintagslichter leuchten zu lassen, die wie das Funkeln des Diamanten weder Licht noch Wärme geben. Etliche Männer, die von ihren Paradoxen lebten, lachten heimlich über alle die Leute, die ihre Bewunderung oder Mißachtung für Menschen und Dinge auf Treu und Glauben hinzunehmen bereit sind, und übten sich jetzt schon in der zweischneidigen Politik, gegen alle Systeme zu wühlen und für gar keines einzutreten. Natürlich war auch der Typus des Besserwissers, der sich über nichts wundert, sich in der Oper mitten in einer Kavatine laut schnauzt, früher als alle anderen Bravo schreit und sofort jedem widerspricht, der seine Meinung vor ihm sagt, da vertreten und war bemüht, sich Aussprüche der Männer von Geist anzueignen.
Unter den Gästen gab es etwa fünf, die eine Zukunft hatten und vielleicht zehn, die Aussicht hatten, für die Dauer ihres Lebens berühmt zu sein; die übrigen der Anwesenden waren mittelmäßige Leute und Tagesberühmtheiten.
Der Gastgeber zeigte die sorgenvolle Fröhlichkeit eines Mannes, den der Abend zweitausend Taler kostet. Von Zeit zu Zeit sah er ungeduldig nach der Salontüre, in Erwartung des Gastes, der noch fehlte. Bald erschien dieser, ein dicker, kleiner Mensch, den ein schmeichelhaftes Raunen begrüßte: der Notar, der am selben Morgen die Zeitungsgründung durchgeführt hatte.
Ein Kammerdiener in Schwarz öffnete die Türe eines weiten Speisesaals, und alle beeilten sich nun ohne weitere Zeremonien, ihre Plätze an dem riesigen Tische zu finden. Bevor Rafael die Salons verließ, sah er ein letztes Mal um sich: sein Wunsch war zweifellos vollkommen erfüllt, Seide und Gold schmückten die Gemächer, reiche Kandelaber ließen im Lichte unzähliger Kerzen die zartesten Details der vergoldeten Friese, die köstliche Bronzeeinlegearbeit und die üppigen Farben der Einrichtung erstrahlen. Kunstvoll angeordnete Gewinde seltener Blumen verströmten süßen Geruch. Alles bis zu den Vorhängen war unaufdringlich vornehm, das Ganze war voll eines unbeschreiblich anmutigen Zaubers, der auf die Einbildungskraft eines Menschen, der kein Geld hat, wirken mußte.
»Hunderttausend Franken Rente sind wirklich ein hübscher Kommentar zum Katechismus und helfen wunderbar, die Moral zur Tat zu machen,« sagte er seufzend, »es ist so – meine Tugendhaftigkeit kann nicht gut zu Fuß gehen. Für mich ist das Laster eine Dachstube, ein abgetragener Anzug, ein grauer Hut im Winter und Schulden beim Hausbesorger. Oh, ich möchte in all dem Luxus leben, ein Jahr, sechs Monate, das ist gleich! Und nachher sterben! Dann hätte ich tausend Existenzen gekannt, durchlebt und erschöpft!«
Emile hatte ihn sprechen gehört und sagte ihm: »Du hältst den Wagen eines Börsenagenten für das Glück! Mein Lieber, du hättest bald genug vom Reichtum, wenn du bemerktest, daß er dir die Möglichkeit nimmt, ein überlegener Mensch zu sein. Kann ein Künstler schwanken, ob er die Armut des Reichtums oder die Reichtümer der Armut wählen solle? Aber mach deinen Magen bereit!« unterbrach er sich und wies mit einer heroischen Gebärde auf den majestätischen, dreimal heiligen und beruhigenden Anblick des Speisesaals dieses gesegneten Kapitalisten. »Der Mann«, fuhr er fort, »hat doch nur für uns sein Geld zusammengescharrt! Er ist eine Art von Schwamm, den die Naturforscher in die Familie der Polypen einzureihen vergessen haben: man muß ihn mit Behutsamkeit auspressen, damit ihn nicht seine Erben aussaugen können. Schau, haben die Reliefs da an den Wänden nicht wirklich Stil? Und die Lüster, die Bilder – das heißt doch Verständnis für Luxus beweisen! Wenn man seinen Neidern und den Leuten, die immer in der Vergangenheit der andern schnüffeln, glauben dürfte, dann hätte dieser Mann während der Revolution einen Deutschen und noch einige andere Leute umgebracht, angeblich auch seinen besten Freund und dessen Mutter. Siehst du in diesem verehrungswürdigen Taillefer mit den grauen Haaren irgendeine Möglichkeit zu solchen Verbrechen? Er sieht doch wie ein guter Mensch aus! Schau, wie das viele Silber hier funkelt – jeder blitzende Strahl müßte doch für ihn ein Dolchstoß sein! Aber genug – ebenso könnte man an Mohammed glauben wie daran. Wenn die öffentliche Meinung recht hätte, wären alle die dreißig begabten und gefühlvollen Männer hier dazu zu haben, die Eingeweide einer Familie zu essen und ihr Blut zu trinken … Und wir zwei aufrichtigen jungen Menschen voll Begeisterungsfähigkeit wären die Mithelfer dieses Verbrechens. Ich hätte gute Lust, unseren Kapitalisten zu fragen, ob er ein anständiger Mensch ist.«
»Nicht jetzt,« rief Rafael, »erst wenn er totbetrunken sein wird – dann haben wir wenigstens das Essen gehabt!«
*
Die beiden Freunde setzten sich lachend zu Tisch. Erst zahlte jeder der Tischgenossen mit einem Blicke der Bewunderung seinen Tribut an den verschwenderischen Anblick der Tafel, die weiß war wie frisch gefallener Schnee und auf der sich, gekrönt von kleinen goldgelben Brötchen, symmetrisch die Gedecke erhoben. Alle Farben des Regenbogens leuchteten in den sternfunkelnden Reflexen der Kristallgläser, unendlich gespiegelt strahlte das Kerzenlicht: Silberkuppeln verbargen die Speisen und reizten die Neugier und den Appetit. Die Worte waren sehr spärlich geworden. Die Tischnachbarn sahen einander an. Der Madeira kreiste um den Tisch. Endlich erschien der erste Gang in all seiner Herrlichkeit: er hätte weiland Cambacères Ehre gemacht, und Brillat-Savarin hätte ihn gepriesen. Weißer und roter Bordeaux und Burgunder wurden mit königlicher Verschwendung angeboten. Dieser erste Abschnitt des Festes glich in allen Punkten der Exposition einer klassischen Tragödie; der zweite Akt wurde ein wenig geschwätzig.
Jeder der Gäste hatte voll Überlegung die Weinsorten nach seiner Laune gewechselt und genug getrunken; nun hoben stürmische Diskussionen an, sobald die Reste des großartigen ersten Ganges weggetragen worden waren. Bleiche Stirnen röteten sich, da und dort begann eine Nase purpurn zu leuchten, die Gesichter erglühten und die Augen blitzten. Während dieser Morgenröte der Trunkenheit durchbrachen die Reden noch nicht die Grenzen der Gesittung, doch Spöttereien und Witzworte kamen mählich aus jedem Munde. Dann erhob ganz sacht die Verleumdung ihren kleinen Schlangenkopf und redete mit flötender Stimme mit. Da und dort horchten einzelne in heimtückischer Aufmerksamkeit auf und hofften, weiter ihre Vernunft zu wahren. Der zweite Gang kam, als alle sich schon in Hitze geredet hatten. Jeder aß im Sprechen, sprach essend und trank, ohne auf das immer neue Zuströmen der Weine zu achten, weil sie köstlich und duftig waren – und weil das Beispiel ansteckend wirkte. Taillefer meinte, etwas zum Anspornen seiner Gäste tun zu müssen, und ließ nun die gefährlichen Weine von der Rhone, den hitzigen Tokaier und den alten betäubenden Roussilloner kommen.
Ausgelassen wie ausgeruhte, frisch eingespannte Pferde einer Postkutsche ließen die Männer nun, angepeitscht von den Flämmchen des ungeduldig erwarteten und nun im Überflusse strömenden Champagners, ihren Geist durch die Weiten der Erörterungen, denen niemand zuhörte, galoppieren, begannen Geschichten zu erzählen, die kein Publikum fanden, und versuchten es hundertmal immer wieder mit Fragen, die keine Antwort erhielten.
Die Orgie erhob ihre große Stimme, die aus hundert anschwellenden Lauten, wie ein Crescendo von Rossini, zusammengesetzt ist. Heimtückische Toaste, Prahlereien und Herausforderungen wurden laut. Nun verschmähten es alle schon, sich der Aufnahmefähigkeit ihres Geistes zu rühmen; vielmehr wetteiferten sie mit der Aufnahmefähigkeit von Tonnen, Fässern und Kufen. Jeder schien plötzlich zwei Stimmen zu haben. Es kam der Augenblick, in dem alle die Herren gleichzeitig redeten – und die Diener lachten. Immerhin hätte dieses Durcheinander von Worten und Paradoxen von recht zweifelhaftem Witze, von grotesk angetanen Wahrheiten, die in dem Geschrei gegeneinander stießen, von souveränen Urteilen und Dummheiten, die sich hier wie Kugeln und Geschosse in einer Schlacht kreuzten, einen Philosophen durch die Sonderbarkeit der Gedanken sicherlich interessiert und einen Politiker durch die Verworrenheit der Systeme in Erstaunen versetzt. Was da geschah, war zugleich ein Bild und ein Buch.
Philosophien, Religionen, Moralauffassungen, in ihrer Verschiedenheit die ganze Spannweite des Menschlichen umfassend, Regierungsformen – kurz, alle großen Dinge des menschlichen Geistes, fielen unter einer Sense, die lang war wie die Zeit; man hätte wohl Mühe gehabt, zu unterscheiden, ob die Weisheit sie im Rausche führte, oder der Rausch, der weise und hellseherisch geworden war. Von einer Art Sturm erfaßt, schienen alle diese Männer die Gesetze, gegen die alle Zivilisationen antreiben, wie das erregte Meer gegen die Klippen, erschüttern zu wollen – und taten damit ohne ihr Wissen dem Willen Gottes Genüge, der in der Natur das Gute wie das Böse gewähren läßt – und einzig das Geheimnis ihres immerwährenden Kampfes in sich bewahrt. In ihrer Wut und Lächerlichkeit wurde diese Diskussion wirklich zu einem Hexensabbat der Geister. Zwischen den trübseligen Scherzen, die diese Söhne der großen Revolution zur Geburt einer Zeitung machten, und den Gesprächen der fröhlichen Trinker bei der Geburt des Gargantua klaffte der tiefe Abgrund, der das XVI. Jahrhundert vom XIX. scheidet. Jenes bereitete lachend die Zerstörung vor – das unsere aber lacht inmitten von Ruinen.
»Wie heißt der junge Mann dort?« fragte der Notar, auf Rafael deutend.
»Ich glaube, jemand hat ihn Valentin gerufen.«
»Was plappern Sie da von einem gewöhnlichen Valentin?« rief Emile lachend, »Rafael von Valentin, wenn's Ihnen beliebt! Wir führen einen goldenen Adler mit silberner Krone, Krallen und Schnabel rot, auf schwarzem Grunde, darüber die schöne Devise: Non cecidit animus! Wir sind kein Findelkind, sondern ein Abkömmling des Kaisers Valens, des Ahnherrn der Valentinier und Gründers der Städte Valencia in Spanien und Valence in Frankreich, und sind rechtmäßiger Erbe des orientalischen Kaisertums: daß wir den Sultan Mahmud in Konstantinopel auf seinem Throne lassen, geschieht nur aus purer Gutmütigkeit und ein wenig auch aus Mangel an Geld oder Soldaten.«
Emile zeichnete mit seiner Gabel eine Krone über Rafaels Kopf in die Luft. Der Notar sammelte sich einen Augenblick, trank wieder und machte eine Gebärde, die auszudrücken schien, daß es ihm unmöglich sei, die Städte Valencia, Valence und Konstantinopel, Mahmud, den Kaiser Valens und die Familie der Valentinier in seine Klientel zu bekommen.
»Die Zerstörung der menschenwimmelnden Städte, wie Babylon, Tyrus, Karthago oder Venedig genannt waren, und die unter dem Fuße eines vorübergehenden Riesen zermalmt worden sind, muß doch ein Zeichen sein, das eine höhnische Macht den Menschen gibt?« sagte Claude Vignon, eine Art Sklave, der dazu gekauft wurde, für zehn Sous die Zeile den Bossuet zu spielen.
»Moses, Sulla, Ludwig XI., Richelieu, Robespierre und Napoleon sind vielleicht derselbe Mensch, der immer wieder wie ein Komet am Himmel erscheint«, führte ein anderer den Gedanken fort.
»Warum wollen wir denn die Ratschlüsse der Vorsehung erforschen?« fragte Canalis, der Balladenverfertiger.
»Laßt mich mit der Vorsehung in Ruhe!« rief der berufsmäßige Besserwisser, »ich weiß nichts auf der Welt, das so elastisch ist wie sie!«
»Bedenken Sie, mein Herr, Ludwig XIV. hat allein für den Bau der Wasserleitung der Maintenon dem Lande mehr Menschen gekostet als der Konvent damit, daß er die Steuerlasten gerecht verteilte, die Gesetze vereinheitlichte, Frankreich zum Nationalbewußtsein erweckte und eine gleichmäßige Verteilung der Erbschaften einführte«, sagte Massol, ein junger Mensch, der Republikaner geworden war, weil ihm ein kleines Wörtchen vor seinem Namen fehlte.
»Mein Herr,« entgegnete ihm Moreau, ein wohlhabender Gutsbesitzer, »Sie glauben, Blut sei dasselbe wie Wein! Vielleicht wollen Sie für heute doch jedem den Kopf auf seinen Schultern lassen?«
»Wem zunutze, Herr? Sind die Grundsätze der sozialen Ordnung nicht ein paar Opfer wert?«
»Bixiou! Horch! Der Herr Republikaner verlangt, daß der Kopf dieses Gutsbesitzers da zum Opfer gebracht werde!« sagte ein junger Mensch zu seinem Nachbar.
Der Republikaner fuhr, umgeben von Rülpsenden, mit seiner Theorie fort: »Menschen und Ereignisse sind nichts! In der Politik wie in der Philosophie gibt es nur Prinzipien und Ideen!«
»Wie furchtbar! Ihnen läge also nichts daran, Ihre Freunde wegen eines ›Wenn‹ zu töten …?«
»Herr, der Mensch, der Gewissensbisse hat, ist der richtige Verbrecher, denn er hat noch irgendeine Idee von Tugend. Männer wie Peter der Große oder der Herzog von Alba waren Systeme – und der Seeräuber Monbard war nur mehr ein organisatorisches Prinzip.«
»Kann denn die Gesellschaft nicht Ihre Systeme und Ihre organisatorischen Prinzipien entbehren?« sagte Canalis.
»Ganz Ihrer Meinung!« rief der Republikaner.
»Ihre blödsinnige Republik reizt mich zum Erbrechen! Wir können nicht einmal in Ruhe einen Kapaun zerlegen, ohne dabei auf das Agrargesetz zu stoßen.«
»Deine Prinzipien sind ausgezeichnet, mein kleiner getrüffelter Brutus. Aber du hast große Ähnlichkeit mit meinem Kammerdiener: der komische Bursche ist derart von der Manie der Reinlichkeit besessen, daß ich nackt gehen müßte, wenn ich ihn meine Kleidung nach seinem Willen bürsten ließe.«
Der Republikaner fuhr auf: »Ihr seid blöde Tiere! Ihr möchtet eine Nation mit Zahnstochern reinigen. Und wenn man euch folgte, wäre die Justiz viel gefährlicher als die Diebe.«
»Was Sie nicht sagen!« warf der Rechtsanwalt Desroches ein.
»Was die mich mit ihrer Politik langweilen!« rief nun der Notar Cardot. »Hört doch auf! Es gibt keine Wissenschaft und keine Tugend, die einen Tropfen Blut wert wäre. Wenn wir die Wahrheit liquidieren wollten, fänden wir sie vielleicht bankerott.«
»Es wäre uns billiger gekommen, uns über das Laster gut zu unterhalten, als uns über das Gute in den Haaren zu liegen. Ich für mein Teil gäbe alle politischen Reden der letzten vierzig Jahre für eine Forelle, eine Erzählung von Perrault oder eine Zeichnung von Charlet her.«
»Sie haben durchaus recht! Reichen Sie mir den Spargel herüber! Nach alledem zeugt die Freiheit also die Anarchie, die Anarchie führt zur Despotie, und die Despotie schafft wieder die Freiheit. Millionen Wesen sind hingegangen, ohne einem dieser Systeme zum Triumph verhelfen zu können. Ist das nicht der circulus vitiosus, in dem die moralische Welt sich immerdar dreht? Wenn der Mensch glaubt, etwas vervollkommnet zu haben, hat er die Dinge nur von ihrem Platze gerückt.«
Da schrie der Schwankdichter Cursy: »Also, meine Herren, ich bringe einen Toast auf Karl X., den Vater der Freiheit, aus!«
»Warum nicht?« fragte Emile, »wenn die Gesetze despotisch sind, sind die Sitten frei – und umgekehrt.«
»Trinken wir auf die Dummheit der Herrschenden, die uns die Herrschaft über die Dummen gibt!« rief der Bankier.
»Mein Lieber, Napoleon hat uns wenigstens den Ruhm hinterlassen!« rief ein Marineoffizier, der nie über Brest hinausgekommen war.
»Traurige Ware, der Ruhm! Kostet eine Menge und hält sich nicht. Er ist der Egoismus der großen Männer, wie das Glück der der Dummköpfe ist!«
»Mein Herr, Sie haben aber viel Glück …«
»Der Erfinder der Befestigungswerke war bestimmt ein Schwächling, die Gesellschaft profitiert nur von den jämmerlichen Leuten. Der Wilde und der Denker haben, jeder auf seine Art und am anderen Pole der moralischen Welt, einen Abscheu vor dem Eigentume.«
»Das ist hübsch!« rief Cardot dazwischen, »wenn es kein Eigentum gäbe, wie könnten wir Akten ausfertigen?«
»Nehmen Sie von den köstlichen grünen Erbsen …«
»... Und am andern Morgen fand man den Priester tot in seinem Bette …«
»Wer redet von Tod! Macht keine Scherze … ich habe einen Onkel, der …«
»Sie würden sich sicher dareinfinden, ihn zu verlieren!«
»Das ist keine Frage.«
»Hören Sie mich, meine Herren! Die Methode, wie man seinen Onkel umbringt! (Hört! Hört!). Erstens muß man einen dicken, fetten Onkel haben, der mindestens siebzig Jahre alt ist – das sind die besten Onkels (allgemeine Erregung). Gebt ihm unter irgendeinem Vorwand eine Gänseleberpastete zu essen.«
»Mein Lieber, mein Onkel ist ein großer magerer Kerl, geizig und nüchtern …«
»Diese Art Onkels sind Untiere, die mit dem Leben Mißbrauch treiben!«
Der Mann mit den Onkeln fuhr fort: »Teilen Sie ihm, während er gerade verdaut, den Bankerott seines Bankiers mit.«
»Wenn er das aber überlebt?«
»Dann lassen Sie ein Mädchen auf ihn los …«
»Er ist aber doch …«, sagte der andere mit verneinender Geste.
»Dann ist das kein Onkel. Ein Onkel hat dem Wesen nach lüstern zu sein!«
»Die Stimme der Malibran hat zwei Töne verloren.''
»Herr, das ist nicht wahr!«
»Herr, das ist wahr!«
»Wahr oder nicht wahr, das ist doch die Geschichte aller religiösen, patriotischen und literarischen Fehden. Der Mensch ist ein Hanswurst, der über Abgründe tanzt.«
»Wenn ich Ihnen glauben wollte, wäre ich ein Dummkopf.«
»Im Gegenteil, Sie sind einer, weil Sie mir nicht glauben wollen.«
»Die ganze Bildung ist ein hübscher Unsinn! Im Lexikon steht die Zahl der gedruckten Bücher mit mehr als einer Milliarde angegeben – und kein Mensch kann in seinem ganzen Leben davon mehr als hundertfünfzigtausend lesen. Erklären Sie mir also, was das Wort Bildung heißen soll. Für die einen besteht die Bildung darin, den Namen des Pferdes Alexanders des Großen oder ähnliche Namen zu wissen, aber keine Ahnung von den Männern zu haben, denen wir etwa das Holzflößen oder das Porzellan verdanken. Für die andern heißt gebildet sein: zu wissen, wie man ein Testament verbrennt und dann geehrt, geliebt und angesehen lebt, anstatt eine Uhr zu stehlen, als Rückfälliger mit erschwerenden Umständen verurteilt zu werden und gehaßt und entehrt auf dem Grèveplatz zu sterben.«
»Wird Nathan bleiben?«
»Seine Mitarbeiter sind geistreiche Leute.«
»Und Canalis?«
»Der ist ein großer Mann, darüber ist nicht zu reden.«
»Ihr seid betrunken!«
»Die unmittelbare Folge einer Verfassung ist die Verflachung der Intelligenzen. Künste, Wissenschaften, Denkmäler – alles wird von dem furchtbaren Egoismus, unserer zeitgemäßen Form der Lepra, aufgefressen. Wenn euere dreihundert Bürger zur Beratung zusammensitzen, denken sie höchstens noch daran, irgendwo Pappeln anzupflanzen. Die Despotie bringt auf ungesetzlichem Wege große Dinge hervor – die Freiheit gibt sich nicht einmal die Mühe, auf gesetzlichem Wege wenigstens ganz kleine fertigzubringen.«
Ein Absolutist unterbrach den Redenden: »Eure Volksbildung macht Hundertsousstücke aus Menschenfleisch. In einem Volke mit gleichmäßiger Bildung verschwinden die Persönlichkeiten.«
»Aber ist denn nicht der Sinn der menschlichen Gesellschaft, jedem zum Wohlstand zu verhelfen?« fragte der Saint-Simonist.
»Mein Lieber, wenn Sie fünfzigtausend Franken Rente hätten, dächten Sie kaum über das Volk nach. Wenn Sie die edle Leidenschaft der Menschlichkeit gepackt hat, gehen Sie doch nach Madagaskar! Dort finden Sie ein kleines, hübsches, ganz neues Volk: das können Sie saint-simonisieren, in Klassen einteilen und in Flaschen abziehen; bei uns kommt jeder ganz von selber in seine Zelle – wie ein Nagel in sein Loch. Portiere und andere Tröpfe sind eben Tiere und müssen nicht erst von einem Kollegium von Patres dazu ernannt werden.«
»Sind Sie Carlist?«
»Warum nicht? Ich liebe die Despotie – sie zeugt von einer gewissen Verachtung für die menschliche Rasse. Ich hasse die Könige nicht, sie sind so amüsant. Dreißig Millionen Meilen von der Sonne in einem Thronsaale zu sitzen, ist das vielleicht nichts?«
Der Gelehrte, der zur Aufklärung des unaufmerksamen Bildhauers eine Diskussion über die Anfänge der Gesellschaft und über autochthone Völker eingeleitet hatte, sagte nun: »Fassen wir also diesen Überblick über die Zivilisation zusammen. In den Anfängen der Völker war die Gewalt materiell, einfach und roh; später dann, als die Gemeinschaften größer wurden, haben die Herrschenden allmählich mehr oder weniger geschickt die primitive Gewalt zersetzt. Im frühen Altertume hatte die Theokratie die Macht: die Priester hatten Schwert und Weihrauchfaß in den Händen. Später gab es zwei priesterliche Gewalten – den Oberpriester und den König. Heute hat unsere Gesellschaft die letzte Form der Zivilisation erreicht, sie hat die Macht an die Industrie, den Gedanken, das Geld und das Wort verteilt. Die Macht, die solcherart ihre Einheit verloren hat, strebt nun unablässig der völligen Auflösung zu, die nur noch eine Schranke hat: den Eigennutz. Überdies stützen wir uns weder auf die Religion noch auf die materielle Gewalt, sondern nur noch auf den Verstand. Glauben Sie, daß das Buch das Schwert aufwiegt oder die Reden die Tat? Das ist das Problem!«
»Der Verstand hat alles umgebracht!« schrie der Carlist. »Die absolute Freiheit führt die Völker zum Selbstmorde – sie langweilen sich in ihrem Triumph zu Tode – wie ein englischer Millionär.«
»Sie sagen uns Neuigkeiten! Heutzutage werden die Mächte lächerlich gemacht, das bedeutet dasselbe wie das Leugnen Gottes. Es gibt keinen Glauben mehr. Das Jahrhundert ist wie ein alter Sultan in Ausschweifung zugrunde gegangen. Zum Schlusse hat noch euer Lord Byron in der letzten Verzweiflung eines Dichters die Leidenschaften des Verbrechers besungen.«
Bianchon, der schon volltrunken war, entgegnete ihm: »Wissen Sie, daß ein bißchen Phosphor mehr oder weniger ausmacht, ob einer ein Genie oder ein Schurke, ein Mann von Geist oder ein Idiot, ein tugendhafter Mensch oder ein Verbrecher ist?«
»Darf man so über die Tugend reden,« rief Gursy, »die Tugend, die der Gegenstand aller Theaterstücke, die Lösung aller Dramen, die Basis aller Gerichtsverhandlungen ist!«
»Du sei ruhig, du Vieh! Deine Tugend ist ein Achilles ohne Ferse!« rief Bixiou ihm zu.
»Willst du wetten, daß ich eine Flasche Champagner auf einen Zug austrinke?«
»Sicher dein einziger geistreicher Zug!« rief Bixiou.
»Sie sind besoffen wie Fuhrleute«, sagte ein junger Mann, der mit größtem Ernst seiner Weste zu trinken gab.
»Ja, mein Herr, die heutige Regierung besteht in der Kunst, die politische öffentliche Meinung zu beherrschen.«
»Die öffentliche Meinung! Die ist die allerärgste von allen öffentlichen Dirnen! Wenn man auf euch hörte, ihr Moralisten und Politiker, müßte man stets eure Gesetze über die Natur stellen und die öffentliche Meinung über das eigene Gewissen. Geht doch – alles ist wahr, alles ist falsch. Die Wohltat, daß uns die Gesellschaft die Daunenkissen gegeben hat, hat sie reichlich durch das Geschenk der Gicht wieder aufgehoben; wie sie die Prozeßordnung zur Mäßigung der Justiz eingeführt hat – hat sie uns auch den Schnupfen als eine Folge der dünnen Kaschmirkleider beschert!«
»Du Untier!« unterbrach Emile den Misanthropen. »Wie kannst du die Gesellschaft im Anblick der Weine, der köstlichen Speisen, mit dem Kinn am Teller, zu lästern wagen? Beiß das Reh da mit dem vergoldeten Geweih – aber beiß nicht deine eigene Mutter …«
»Ist es meine Schuld, daß der Katholizismus es schließlich zu einer Million Götter gebracht hat, daß die Republik immer mit einem Napoleon endet, daß zum Königtum die Ermordung Heinrichs IV. und die Hinrichtung Ludwigs XVI. gehört und daß aus dem Liberalismus ein Lafayette wird?«
»Haben Sie ihn während der Julirevolution umarmt?«
»Ich nicht.«
»Dann schweigen Sie, Sie Skeptiker!«
»Die Spektiker sind die gewissenhaftesten Leute.«
»Sie haben kein Gewissen.«
»Was sagen Sie? Sie haben mindestens zwei!«
»Mit dem Himmel Geschäfte machen! Herr, das ist eine Religion für Geschäftsleute. Die antiken Religionen waren lediglich eine glückliche Weiterentwicklung des leiblichen Vergnügens ins Metaphysische. Wir anderen aber haben dafür die Seele und die Jenseitshoffnung erfunden: das ist der Fortschritt.«
»Liebe Freunde, was könnt ihr von einem mit Politik übersättigten Jahrhundert erwarten? Denkt doch an die reizende Geschichte von dem Könige von Böhmen und seinen sieben Schlössern!« sagte Nathan.
»Was?« schrie der Besserwisser von einem Ende des Tisches zum anderen, »das, das ist ein Buch, reif fürs Irrenhaus!«
»Sie sind ein Dummkopf!«
»Sie sind ein Narr!«
»Ah, ah!«
»Oh, oh!«
»Sie werden sich schlagen.«
»Nein …«
»Auf morgen, mein Herr!«
»Nein, augenblicklich!« erwiderte Nathan.
»Vorwärts, also! Ihr seid zwei tapfere Burschen!«
»Sie sind auch einer!« schrie der Herausforderer. »Sie können ja nicht einmal mehr aufstehen …«
»Ich stehe vielleicht nicht gerade?« rief der kriegerische Nathan und bewegte sich her und hin wie ein schwankender Papierdrachen. Er richtete einen stumpfsinnigen Blick auf den Tisch, dann sank er, wie erschöpft von dieser Leistung, in seinen Sessel zurück, neigte den Kopf und verfiel in Schweigen.
»Emile, gib acht auf deinen Anzug! Dein Nachbar wird blaß!« rief Bixiou.
»Kant, mein Herr? Das ist auch so ein Luftballon, der zum Vergnügen der Dummköpfe steigen gelassen wird. Materialismus und Spiritualismus sind zwei hübsche Ballschläger, mit denen die Scharlatane im Talar den gleichen Federball emporwerfen. Gott soll, nach den Worten des heiligen Paulus, in allem sein … Dummköpfe! Ob man eine Tür öffnet oder schließt, ist das nicht dieselbe Bewegung? Wer war zuerst, das Huhn oder das Ei? Reichen Sie mir die Ente herüber … Da haben Sie die ganze Philosophie!«
»Idiot!« schrie ihm der Gelehrte zu, »deine Frage ist durch eine Tatsache entschieden!«
»Durch welche?«
»Die Lehrstühle der Professoren sind nicht für die Philosophie geschaffen worden – wohl aber die Philosophie für die Lehrstühle! Setz' die Brille auf und lies das Budget!«
»Diebe!«
»Dummköpfe!«
»Schufte!«
»Gimpel!«
»Nur in Paris gibt es einen so lebhaften und schlagfertigen Gedankenaustausch!« rief Bixiou mit einer Baßstimme.
»Vorwärts, Bixiou, machen Sie uns etwas vor, eine Karikatur!«
»Soll ich Ihnen das neunzehnte Jahrhundert darstellen?«
»Zuhören!«
»Ruhe, Ruhe!«
»Setzt Sordinen auf eure Schnauzen!«
»Wirst du ruhig sein, Chinese!«
»Gebt dem Kinde Wein, damit es still ist!«
»Also, Bixiou!«
Der Künstler knöpfte seinen schwarzen Rock bis zum Halse zu, zog seine gelben Handschuhe an, und äffte nun schielend dem Titelblatte der Revue des deux Mondes nach. Aber der Lärm übertäubte seine Stimme, und es war unmöglich, auch nur ein Wort seiner Verhöhnung zu verstehen. Wenn er auch nicht das Jahrhundert darstellte, stellte er doch wenigstens jene Revue dar – denn er verstand sich selber nicht.
Das Dessert war wie durch Zauberei aufgetragen worden. Auf dem Tische stand ein riesiger Aufsatz aus vergoldeter Bronze aus der Werkstätte von Thomire. Hohe Figuren, von einem Künstler nach den Gesetzen, die in Europa für die ideale Schönheit gelten, gestaltet, trugen und stützten Büschel von Erdbeeren, Ananas, frischen Datteln, gelben Trauben, goldigen Pfirsichen, von Orangen, die das Eilboot aus Setubal gebracht hatte, und Granatäpfeln – kurz, alle Überraschungen des Luxus, Wunder von kleinen Bäckereien, die leckersten Köstlichkeiten, die verführerischsten Näschereien.
Die Farben dieser Meisterwerke der Tafelkunst wurden durch den Glanz des Porzellans, die blitzenden Linien des Goldes und die Sèvresaufsätze, die Landschaften von Poussin nachahmten, erhöht. Mit einem ganzen deutschen Fürstentum wäre dieser übermütige Reichtum nicht zu bezahlen gewesen. Silber, Perlmutter, Gold und Kristall waren in immer neuen Formen verschwendet worden, doch die abgestumpften Blicke und das geschwätzige Fieber der Trunkenheit ließen die Feenpracht, die eines orientalischen Märchens würdig gewesen wäre, den hier Tafelnden kaum mehr zum Bewußtsein kommen. Die Dessertweine spendeten ihre Düfte und ihr Feuer, durchdringende Essenzen und Dämpfe voll Zauberkraft, die den Geist verblendeten, die Füße mit starken Banden fesselten und die Hände schwer machten. Bald waren die Fruchtpyramiden geplündert, die Stimmen wurden lauter, der Tumult wuchs. Nun war kein Wort mehr zu unterscheiden. Gläser zerschellten, wildes Lachen scholl wie Schüsse. Cursy ergriff ein Horn und blies eine Fanfare. Das war wie ein Signal des Teufels. Die ganze Gesellschaft delirierte, heulte, pfiff, sang, schrie, knurrte, brüllte.
Jeder hätte lächeln müssen, der alle die Leute da mit ihrer angeborenen Heiterkeit nun düster wie Gestalten Crébillons oder träumerisch, wie Seeleute auf der Fahrt werden, gesehen hätte. Die verschwiegensten Menschen schwatzten ihre Geheimnisse vor Leuten aus, die ihnen gar nicht zuhörten. Melancholiker lächelten wie Tänzerinnen, wenn sie ihre Pirouette vollenden. Claude Vignon wiegte sich wie ein Bär im Käfig. Intime Freunde prügelten einander. Die Ähnlichkeiten mit Tieren, die in den Gesichtern der Menschen sind – auf die von den Physiologen mit soviel Eifer hingewiesen wird – tauchten nun unbestimmt in allen Gebärden und leiblichen Gewohnheiten auf. Ein kühler, nüchterner Beobachter wie Bichat hätte hier ein ganzes Buch zu lesen gefunden.
Der Hausherr fühlte sich betrunken und wagte es nicht mehr, aufzustehen; mit einer erstarrten Grimasse drückte er den Gästen seine Anerkennung für ihre Extravaganzen aus – und bemühte sich im übrigen, ein gastfreies und würdiges Wesen zur Schau zu tragen. Sein breites Gesicht, rot und blau und fast schon violett geworden, war furchtbar anzusehen und ging in der allgemeinen Bewegung wie im Schlingern und Stampfen einer Brigg auf und nieder.
»Haben Sie sie wirklich ermordet?« fragte ihn Emile.
»Man sagt, daß dank der Julirevolution die Todesstrafe abgeschafft werden soll!« erwiderte ihm Taillefer; er hob die Brauen mit einem Ausdruck, der Klugheit und Dummheit in sich vereinte.
»Aber sehen Sie sie nicht manchmal im Traum?« drängte ihn Rafael.
»Es gibt doch Verjährung«, sagte der reiche Mörder.
Emile rief höhnend: »Und der Leichenbestattungsunternehmer wird auf seinen Grabstein schreiben: Die ihr vorübergeht, weiht seinem Andenken eine Träne! Ich gäbe einem Mathematiker, der mir in einer algebraischen Gleichung die Existenz der Hölle bewiese, mit Vergnügen hundert Sous.« Er warf eine Münze in die Luft: »Kopf oder Adler? Kopf bedeutet Gott!«
»Schauen Sie nicht hin!« rief Rafael und fing die Münze auf. »Wer weiß – der Zufall ist so spaßhaft!«
Emile fuhr traurig scherzend fort: »O weh, jetzt weiß ich nicht, soll ich mich an die Mathematik des Unglaubens oder an das Paternoster des Papstes halten. Ach was – trinken wir! Ich glaube an das Trinken, an das Orakel der heiligen Flasche, bei Pantagruel ist es ja auch das Um und Auf.«
Rafael entgegnete ihm: »Dem Paternoster verdanken wir die Künste, die Denkmäler, vielleicht auch die Wissenschaft – und eine Wohltat, die noch viel größer ist: unsere modernen Regierungen, in denen eine große fruchtbare Gesellschaft durch fünf intelligente Köpfe repräsentiert wird, die einander entgegenwirkenden Kräfte sich aufheben und alle Macht der Zivilisation überlassen, der gigantischen Königin, die die veraltete schreckliche Figur eines Königs ersetzt, dieses zweideutigen Schicksals, das der Mensch zwischen dem Himmel und sich selber aufgerichtet hat. Angesichts so vieler vollbrachter Werke ist der Atheismus wie ein Skelett, das nicht zu zeugen vermag. Was meinst du dazu?«
Emile erwiderte kühl: »Ich denke an die Ströme von Blut, die der Katholizismus vergossen hat. Aus dem Blute unserer Adern hat er eine neue Sintflut gemacht. Aber was liegt daran! Es muß doch jeder denkende Mensch dem Banner Christi folgen, denn nur er hat den Triumph des Geistes über die Materie geheiligt und nur er hat seherisch die Welt, die uns von Gott scheidet, enthüllt.«
Rafael sah ihn mit einem unbeschreiblichen Lächeln der Trunkenheit an: »Du glaubst? Aber gut! Wir wollen uns nicht bloßstellen, bringen wir einen Toast aus: Diis ignotis!« Und sie leerten ihre Kelche, aus denen sie Wissen, Kohlensäure, Düfte, Poesie und Ungläubigkeit getrunken hatten.
»Wenn sich die Herren in den Salon begeben wollen … der Kaffee wartet!« meldete der Kammerdiener.
*
Um diese Stunde waren fast alle Gäste schon tief in jenen seligen Vorhimmeln, darin die Lichter des Geistes erlöschen und der Körper, seines Tyrannen ledig, sich in den irren Freuden der Freiheit verliert. Die einen, die den Höhepunkt der Trunkenheit erreicht hatten, verharrten nun dumpf, mühevoll damit beschäftigt, einen Gedanken zu fassen, der ihnen ihre Existenz beweisen könnte. Die anderen, in der sanften Verblödung lähmender Verdauung, blieben ohne Bewegung. Unverzagte Redner sprachen noch vage Worte, deren Sinn ihnen selber schon schwand.
Ein paar Refrains klangen immer wieder wie das Geräusch eines Mechanismus, der sein künstliches seelenloses Leben zu Ende laufen lassen muß. Schweigen und Tumult waren absonderlich miteinander verbunden. Als aber die klangvolle Stimme des Dieners erscholl, der ihnen, da der Herr fehlte, neue Freuden verkündete, erhoben sich alle Gäste und führten, trugen und schoben einander.
Die ausschweifendsten Verlockungen des Mahles erblichen vor dem erregenden Schauspiele, das der Gastgeber nun dem gierigsten ihrer Sinne bot. Unter den strahlenden Kerzen eines goldenen Lüsters zeigte sich plötzlich rund um einen mit vergoldetem Silbergerät überladenen Tisch eine Gruppe von Frauen den Gästen, deren Augen wie ebenso viele Diamanten aufblitzten. Sie waren reich geschmückt – aber reicher noch war ihre Schönheit, vor der alle Wunder dieses Palastes verblichen. Die erregten Augen der Mädchen leuchteten lebhafter, als die Ströme von Licht die seidigen Reflexe der Tapeten, die Weiße des Marmors und die zarten Konturen der Bronzen aufglänzen ließen. Das Herz entbrannte beim Anblick der wilden Locken, ihrer Haltung und all der Verschiedenheit ihrer Reize und Typen. Sie schienen ein Strauß von Blumen, durchmengt mit Rubinen, Saphiren und Korallen: schwarzes Haar über weißen Nacken, leichte Schärpen, wehend wie Leuchtturmfeuer, stolze Turbane, Tuniken, züchtig und doch erregend.
Dieser Serail war für alle Augen voll Verführung, für jede Laune der Lust voll Versprechens. Eine Tänzerin, die in den wellenden lichten Falten des Kaschmirs hüllenlos zu sein schien, zeigte sich in hinreißender Stellung. Hier enthüllte durchscheinende Gaze, hier verbarg schimmernde Seide geheimnisvollste Vollkommenheiten. Schmale kleine Füße sprachen von Liebe, da die frischen roten Lippen schwiegen. Zarte schamhafte junge Mädchen, Schauspielerinnen der Jungfräulichkeit, deren schöne Haare fromme Unschuld atmeten, zeigten sich dem Blicke wie Erscheinungen, die ein Hauch verwehen konnte. Da wieder waren adlige Schönheiten mit stolzem Blicke, leidenschaftslos, schlank und schmal und voll Anmut – und neigten den Kopf, als ob sie noch immer königliche Protektionen zu vergeben hätten. Eine bleiche, keusche Engländerin, ätherisch wie aus den Wolken Ossians herabgestiegen, war wie ein Engel der Schwermut, wie Gewissensqual, die vor einem Verbrechen flüchtet. Die Pariserin, deren ganze Schönheit ihre unbeschreibliche Grazie ist, eitel auf ihre Toilette wie auf ihren Geist, durch die Waffe ihrer allmächtigen Schwäche wehrhaft, geschmeidig und hart, Sirene ohne Herz und ohne Leidenschaft, die aber kunstvoll alle Schätze der Leidenschaft und jeden Gefühlston nachzuahmen versteht, fehlte nicht in dieser gefährlichen Versammlung, in der noch Italienerinnen von stillem Aussehen, voll Gewissenhaftigkeit in der Lust, üppige Normanninnen von stolzen Formen und Frauen des Südens mit schwarzem Haar und schön geschnittenen Augen strahlten.
Sie alle drängten sich wortlos und schamhaft um den Tisch zusammen, wie ein Bienenschwarm, der im Innern seines Stockes summt. Diese Furchtsamkeit, die Abwehr und Koketterie zugleich war, konnte sowohl aus wohlberechneter Verführungskunst wie aus ungewollter Schamhaftigkeit stammen. Vielleicht hieß sie ein Gefühl, das eine Frau nie ganz aufgibt, sich in den Mantel von Tugend hüllen – um die Zuchtlosigkeit des Lasters noch reizvoller und lockender zu machen. Die zügellosen Männer waren im Augenblick von der majestätischen Gewalt, die Frauen eigen ist, unterjocht. Ein Murmeln der Bewunderung erscholl wie die sanfteste Musik. Die Liebesgier war nicht zugleich mit der Trunkenheit gewachsen: statt daß ein Orkan der Leidenschaften sie mitgerissen hätte, überließen sich alle die Zechgenossen einen Augenblick lang der Schwäche und den Köstlichkeiten wollüstiger Entzückung. Wie Dichtungen genossen die Künstler voll Glück alle feinen Unterschiede dieser erlesenen Schönheiten.
Ein Philosoph, den vielleicht die Kohlensäure, die aus dem Champagner stieg, erweckt haben mochte, schauderte im Gedanken an all das Unheil, das die Frauen hier, die dereinst der reinsten Huldigungen würdig gewesen waren, bringen konnten. Sicherlich hatte jede von ihnen ein gräßliches Drama zu erzählen. Fast alle bargen alte höllischste Qualen in sich, schleppten ohne Glauben Männer, gebrochene Schwüre und mit Elend gebüßte Freuden hinter sich her. Die Gäste näherten sich ihnen voll Höflichkeit, und Gespräche, verschieden wie die Charaktere, entspannen sich. Es bildeten sich Gruppen. Man hätte meinen können, in einem Salon der guten Gesellschaft zu sein, wo junge Mädchen und Frauen nach dem Essen den Gästen Kaffee, Zucker und Likör anbieten. Doch bald erklang Lachen, das Murmeln wuchs an, und Stimmen erhoben sich. Einen Augenblick lang schien die Orgie gebändigt gewesen zu sein, doch jetzt drohte sie wieder aufzuflammen. Dieses Abwechseln von Stille und Brausen hatte eine unbestimmte Ähnlichkeit mit einer Beethovenschen Symphonie.
Die beiden Freunde, die nun auf einem schwellenden Diwan saßen, erblickten ein großes wohlgestaltetes Mädchen, das sich ihnen näherte. Ihre Haltung war prächtig, ihr Gesicht unregelmäßig, aber feurig und hinreißend in seinen heftigen Gegensätzen. Ihr schwarzes, wollüstig gelocktes Haar schien von Liebeskämpfen zerwühlt und fiel flockig auf die schönen, breiten Schultern nieder. Die langen Ringellocken bedeckten halb den majestätischen Hals, über den zuweilen ein Lichtschein glitt und die edlen Konturen enthüllte. Von dem matten Weiß ihrer Haut hob sich schön die belebte Wärme der Farben ihres Gesichtes ab. Unter den langen Wimpern brachen kühne Blicke, Blitze der Liebe, hervor. Der rote Mund war halb offen, als ob er nach Küssen riefe. Ihre Gestalt war kräftig, doch voll leidenschaftlicher Biegsamkeit; ihr Busen und ihre Arme waren voll, wie an den schönen Gestalten des Caracci, dennoch wirkte sie gewandt und geschmeidig, ihre kräftige Gestalt verriet die Beweglichkeit einer Pantherin und die straffe Anmut ihrer Formen verhieß alle Wildheit der Lust. Sicherlich konnte dieses Mädchen lachen und Tollheiten treiben – dennoch erschrak man vor ihren Augen und ihrem Lächeln. Sie war wie eine der Prophetinnen, die der Dämon treibt: ihr Anblick erweckte eher Staunen als Gefallen, jeder Ausdruck ging voll Größe und wie ein Blitz über ihr bewegliches Gesicht. Vielleicht konnte sie abgestumpfte Männer entzücken – aber ein junger Mensch nahm sich vor ihr sicher in acht. Sie war eine gewaltige Statue, von der Höhe eines griechischen Tempels herabgestürzt, wundervoll in der Ferne, doch in der Nähe roh. Dennoch mußte ihre gewalttätige Schönheit die längst Kraftlosen aufrütteln können, ihre Stimme die Tauben selbst entzücken und ihre Blicke die Gebeine in den Gräbern noch beleben können. Emile verglich sie mit einer Tragödie von Shakespeare, in der die Freude heulen wird, die Liebe voll Wildheit ist und die Zauber der Anmut und die Feuer des Glückes auf blutige Rasereien des Zornes folgen. Sie war ein gefährliches Tier, das beißen und liebkosen, wie ein Dämon lachen und wie die Engel weinen konnte, das in einer einzigen Umschlingung alle Verführungen des Weibes geben konnte, nur die Seufzer der Schwermut und die bezaubernde Bescheidenheit der Jungfrau nicht. In einem Augenblicke konnte sie aufbrüllen, sich die Flanken zerfleischen, ihre Leidenschaft und ihren Geliebten zerschmettern und endlich, wie ein empörtes Volk es tut, sich selber zerstören. Sie trug ein Kleid von rotem Samt; achtlos zertrat sie die Blumen, die aus dem Haar ihrer Gefährtinnen gefallen waren – und mit verächtlicher Handbewegung streckte sie den beiden Freunden ein Silbertablett hin. Im stolzen Bewußtsein ihrer Schönheit und vielleicht auch ihrer Laster zeigte sie ihren weißen Arm, der sich leuchtend von dem roten Samt abhob. Wie die Königin der Wollust stand sie da, wie ein Bild der menschlichen Freude, der Freude, die durch drei Generationen aufgehäufte Schätze vergeudet, die über Leichen lacht, die Vorfahren verhöhnt, Perlen und Throne zerstört, Jünglinge zu Greisen – aber auch oft Greise zu Jünglingen macht: jener Freude, die nur machtmüden Riesen erlaubt ist, die jeden Gedanken zu Ende gedacht haben und für die der Krieg selbst nur mehr ein Spielzeug geworden ist.
»Wie heißt du?« fragte sie Rafael.
»Aquilina.«
»Ah, du kommst aus dem ›geretteten Venedig‹« rief Emile.
Sie erwiderte ihm: »Ja. Wie die Päpste andere Namen annehmen, wenn sie sich über die Menschen erheben, habe ich einen anderen Namen angenommen, als ich mich über alle anderen Frauen erhob.«
»Hast du wie deine Namenspatronin auch einen vornehmen, furchtbaren Verschwörer zum Geliebten, der für dich zu sterben wüßte?« fragte sie Emile lebhaft, erweckt, da ihn ein Schimmer des Dichterischen grüßte …
Sie antwortete: »Ich hatte einen – aber die Guillotine war meine Rivalin. Seitdem trage ich immer etwas Rotes, auf daß sich meine Freude niemals zu weit wage.«
»Wenn man sie die Geschichte der vier jungen Leute von La Rochelle erzählen läßt, hört sie nicht mehr damit auf. Beruhige dich, Aquilina. Alle Frauen haben einen Liebhaber zu beklagen – aber nicht jede hat das Glück wie du, ihn auf dem Schafott verloren zu haben. Mir wäre es viel lieber, ihn im Grabe als im Bett einer Nebenbuhlerin zu wissen!« Diese Worte sprach eine sanfte, melodische Stimme – das unschuldigste, hübscheste, reizendste kleine Geschöpf, das jemals der Zauberstab einer Fee aus einem Zauber-Ei erweckt hatte. Sie war mit leisen Schritten herangekommen und zeigte nun ihr zartes Gesicht, ihre feine Gestalt, blaue Augen voll entzückender Bescheidenheit und frische, reine Schläfen. Keine unschuldige Najade, die eben ihre Quelle verlassen hat, konnte scheuer und kindlicher sein, als dieses junge Mädchen es war; sie sah aus, als sei sie sechzehn Jahre, als wüßte sie nichts vom Bösen noch von der Liebe, als kenne sie die Stürme des Lebens nicht und käme eben aus der Kirche, wo sie zu den Engeln gebetet hätte, sie vor der Zeit in den Himmel zu rufen. Einzig in Paris kann man diesen Geschöpfen mit dem Unschuldsgesichte begegnen, die unter einer Stirn von der Weiße und Zartheit einer Margerite die tiefste Verderbtheit und die verfeinertste Lasterhaftigkeit bergen. Emile und Rafael ließen sich erst von den himmlischen Versprechen, die in holden Zügen in das Gesicht des Mädchens geschrieben schienen, täuschen; sie nahmen den Kaffee, den sie in die von Aquilina gereichten Tassen goß, und schickten sich an, Fragen an sie zu richten. Bald aber wurde sie für die beiden Dichter die Vollendung jenes düsteren Antlitzes des Menschenlebens, das, im Gegensatz zur rohen Leidenschaftlichkeit ihrer imposanten Gefährtin, das Bild kalter Verderbtheit, wollüstiger Grausamkeit und jenes Leichtsinns war, der Verbrechen begeht – und Stärke genug besitzt, darüber zu lachen. Sie war ein Dämon ohne Herz, der die reichen und zarten Seelen damit straft, daß er jene Empfindungen in ihnen erweckt, die ihm selber versagt sind, der immer eine Grimasse der Liebe zum Verkaufe bereit hat, immer Tränen beim Leichenbegängnis seines Opfers vergießt und am Abend danach dann voll Freude dessen Testament liest. Ein Dichter hätte die schöne Aquilina bewundern müssen; aber jeder Mensch hätte vor der rührenden Euphrasie fliehen müssen; die eine war die Seele des Lasters, die andere war das Laster ohne Seele.
Emile sagte zu dem schönen Wesen: »Ich möchte gern wissen, ob du zuweilen an die Zukunft denkst?«
Sie erwiderte lachend: »An die Zukunft? Was nennen Sie Zukunft? Warum soll ich an etwas denken, das noch gar nicht existiert? Ich schaue niemals vor mich noch hinter mich. Es ist doch schon genug, wenn ich mich mit einem ganzen Tag auf einmal beschäftigen muß. Übrigens kennen wir ja unsere Zukunft. Sie ist das Spital!«
»Wie kannst du das Spital vor dir sehen und doch nicht vermeiden, dahin zu kommen?« rief Rafael. »Was ist denn so Schreckliches an dem Spitale?« fragte Aquilina. »Wenn wir weder Mütter noch Ehefrauen sind, wenn das Alter uns schwarze Strümpfe anzieht und uns Falten über die Stirn legt, wenn alles Weibliche in uns verwelkt und die Freude in den Blicken unserer Freunde versiegt, was hätten wir dann noch anderes zu wünschen? Nichts mehr blendet euch dann an uns, und ihr seht nur noch den Dreck in uns, der auf zwei Füßen daherkommt, kalt und trocken und verfallen ist und ein Geräusch wie tote Blätter macht. Unsere schönsten Kleider werden zu Lumpen, und das Ambra, das unsere Boudoirs durchduftete, stinkt nach Leichen und nach Skeletten. Wenn wir dann einmal unten im Kot sind, erniedrigt ihr uns noch und erlaubt uns nicht einmal die Erinnerungen mehr. Ob man im Alter in einem reichen Hause sich um seine Hunde kümmert, oder im Spital um seine Lumpen – das ist doch ganz genau dasselbe. Ob man seine weißen Haare unter einem blau- und rotkarrierten Taschentuch oder unter Spitzen versteckt, ob man die Straßen mit einem Reisigbesen oder die Stufen der Tuilerien mit einer Seidenschleppe fegt, ob man an vergoldeten Kaminen sitzt und sich wärmt oder an der Glut eines roten irdenen Topfes, ob man sich eine Hinrichtung auf dem Grèveplatz ansieht oder in die Oper fährt – das ist dann der ganze Unterschied.«
Euphrasie sagte zu ihr: »Aquilina mia, niemals noch in all deinen Verzweiflungsausbrüchen hast du so recht gehabt wie jetzt. Kaschmir, Parfüm, Gold, Seide, der Luxus, alles, was glänzt und was gefällt, kleidet nur die Jugend. Nur die Zeit kann gegen unsere Tollheiten recht behalten – aber das Glück vergibt uns unsere Sünden. Ihr lacht über das, was ich sage?« schrie sie mit einem giftigen Grinsen die beiden Freunde an, »habe ich nicht recht? Ich will lieber am Vergnügen als an einer Krankheit sterben! Ich habe weder die Ewigkeitsmanie noch einen besonderen Respekt vor dem Menschengeschlecht, wenn ich sehe, was Gott daraus macht. Gebt mir Millionen, ich zehre sie auf – ich will nicht einen Heller für das nächste Jahr aufheben! Leben, um zu gefallen und um zu herrschen, sagt jeder meiner Herzschläge. Die Gesellschaft billigt meine Existenz, denn sie liefert mir unaufhörlich die Mittel zu meiner Verschwendung. Warum gibt mir der liebe Gott jeden Morgen die Summe, die ich jeden Abend wieder ausgebe? Warum baut ihr für uns Hospitäler? Er hat uns sicher nicht dazu die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen gelassen, damit wir das wählen, was uns wehtut oder langweilt – so wäre ich wirklich dumm, wenn ich mich nicht unterhalten wollte.«
»Und die anderen?« fragte Emile.
»Die anderen? Die sollen sich's eben einrichten. Mir ist es weit lieber, über ihren Jammer zu lachen, als über meinen zu weinen. Ich rate keinem Manne, mir auch nur den geringsten Kummer anzutun!«
»Was hast du leiden müssen, um so denken zu können?« fragte Rafael.
»Mich hat einer um einer Erbschaft willen verlassen!« sagte sie und nahm eine Stellung ein, die alles Verführerische an ihr zur Wirkung brachte. »Und ich habe doch Tag und Nacht gearbeitet, um meinen Liebhaber zu ernähren. Aber mich wird kein Lächeln und kein Versprechen mehr betrügen – ich will aus meinem Leben eine lange Lustfahrt machen.«
»Kommt denn das Glück nicht aus der Seele?« rief Rafael.
Aquilina erwiderte ihm: »Ist das nichts, sich bewundert und umworben zu sehen, über alle Frauen, auch die tugendhaftesten, zu triumphieren und sie durch seine Schönheit und seinen Reichtum in den Schatten zu drängen? Überdies – wir erleben an einem Tage mehr als solch eine gute Bürgersfrau in zehn Jahren – damit ist doch alles gesagt.«
»Muß man eine Frau ohne Tugend nicht hassen?« sagte Emile zu Rafael.
Euphrasie warf ihnen einen Vipernblick zu und sagte mit unnachahmlicher Ironie: »Die Tugend überlassen wir den Häßlichen und den Buckligen – was wären diese armen Weiber ohne sie?«
Emile rief: »Schweig, rede nicht von etwas, das du nicht kennst!«
Euphrasie entgegnete ihm: »Oh, ich kenne sie nicht! Sich für sein ganzes Leben einem verhaßten Menschen zu schenken, Kinder aufzuziehen, die einen verlassen, und ihnen ›Danke‹ zu sagen, wenn sie einen ins Herz treffen – das sind die Tugenden, die ihr den Frauen anbefehlt; als Entschädigung für ihre Entsagung kommt ihr dann und sucht sie zu verführen. Widerstehen sie, dann zerstört ihr ihren Ruf. Ein hübsches Leben! Dann schon lieber freibleiben, die lieben, die einem gefallen – und jung sterben!«
»Fürchtest du nicht, eines Tages für all das zu büßen?«
Sie entgegnete ihm: »Schön. Statt meine Freuden und meinen Kummer durcheinanderzumengen, soll mein Leben lieber in zwei Teile geteilt sein: eine Jugend, die sicher fröhlich ist – und irgendein Alter dann, in dem ich mein Teil leiden werde.«
»Sie hat nicht geliebt!« sagte Aquilina mit einem tiefen Klange in der Stimme. »Sie hat nie hundert Meilen durcheilt, um mit tausend Entzückungen im Herzen einen Blick zu erhalten – oder zurückgewiesen zu werden. Sie hat nie ihr Leben an eine Locke geheftet, nie versucht, ein paar Menschen zu erdolchen, um ihren Herrscher, ihren Herrn, ihren Gott zu retten. Für sie war die Liebe ein hübscher Offizier.«
»Ich weiß schon! Die Geschichte von La Rochelle!« antwortete ihr Euphrasie. »Ja, die Liebe ist wie der Wind – wir wissen nicht, woher sie kommt. Übrigens wenn du ein rechtes Vieh geliebt hättest, hättest du einen Abscheu gegen die geistreichen Leute.«
»Das Gesetz verbietet, Tiere zu lieben!« entgegnete Aquilina ironisch.
»Ich hätte dir mehr Nachsicht gegen das Militär zugetraut!« sagte Euphrasie lachend.
»Wie glücklich die sind, daß sie ihre Vernunft so leicht von sich tun können!« rief Rafael.
»Glücklich?« – Das sprach Aquilina mit einem Lächeln des Mitleids – und des Schreckens – und sah die beiden Freunde mit einem furchtbaren Blicke an: »Oh, ihr wißt nicht, was es heißt, mit dem Tod im Herzen zur Lust verdammt zu sein!«
In diesem Augenblick war ein Blick in diese Salons wie eine Vision des Pandämoniums von Milton. Die blauen Flammen des Punsches färbten die Gesichter derer, die noch zu trinken vermochten, mit einem höllischen Lichte. Rasende Tänze voll wilder Energie erweckten Lachen und Schreie, die wie Feuerwerke aufprasselten. Das Boudoir und ein kleiner Salon waren von Weintoten und -sterbenden übersät und sahen wie ein Schlachtfeld aus. Die Atmosphäre war überhitzt vom Weine, von der Wollust und von Worten. Trunkenheit, Liebe, Raserei und Weltvergessen standen in den Herzen und den Gesichtern, waren auf die Teppiche geschrieben und in der wüsten Unordnung ausgesprochen – und warfen über alle Blicke leichte Schleier, die in der Luft berauschende Dünste gewahren ließen. Wie in leuchtenden Streifen von Sonnenstrahlen erhob sich schimmernder Staub, in dem spielende Lichter und sonderbare Formen einander durchdrangen. Da und dort verschwammen nun verschlungene Gruppen mit den Marmorgestalten, den Meisterwerken, die die Räume schmückten. Obwohl die beiden Freunde noch eine Art trügerischer Klarheit der Sinne und der Gedanken bewahrt hatten, ein letztes Erzittern, ein Abbild des Lebens, vermochten sie doch nicht mehr zu unterscheiden, was in diesen bizarren Phantasien Wirklichkeit war, noch was die übernatürlichen Bilder, die unaufhörlich an ihren matten Augen vorbeizogen, an Wirklichem enthielten. Der dumpflastende Himmel aus unseren Träumen, die brennende Süße in den Antlitzen der Visionen, eine sonderbare Beweglichkeit unter der Last von Ketten, alle ungewöhnlichsten Dinge der Traumwelt überfielen sie mit solcher Lebendigkeit, daß sie die Spiele der Ausschweifung für die Launen eines Alps hielten, in dem die Bewegungen keine Geräusche erzeugen und die Schreie dem Ohr verloren gehen. In diesem Augenblick gelang es dem Leib-Kammerdiener noch, seinen Herrn ins Vorzimmer zu ziehen und ihm zuzuflüstern: »Gnädiger Herr, alle Nachbarn sind an den Fenstern und beklagen sich über den Lärm.«
»Wenn sie den Lärm scheuen, sollen sie Stroh vor ihre Türen tun!« schrie Taillefer.
*
Rafael lachte plötzlich so laut und unvermittelt auf, daß ihn sein Freund nach dem Grunde seiner jähen Freude fragte.
Er antwortete ihm: »Du würdest mich schwerlich verstehen – zuerst müßte ich dir gestehen, daß ihr mich auf dem Kai Voltaire in dem Augenblick aufgegriffen habt, da ich im Begriff war, mich in die Seine zu stürzen. Nun möchtest du sicher auch wissen, was für Gründe ich zum Selbstmord hatte. Ich muß also hinzufügen, daß durch einen fast märchenhaften Zufall mir die wunderbarsten Ruinen der stofflichen Welt vor meinen Augen zu einer symbolischen Übersetzung der ganzen menschlichen Weisheit wurden – und in diesem Augenblicke ist von den Trümmern der geistigen Schätze, die wir früher bei Tische durcheinanderwarfen, nichts mehr übriggeblieben; nur diese beiden Frauen sind da, die lebendigen und ursprünglichen Abbilder des Wahnes; und unsere tiefe Sorglosigkeit um Dinge und Menschen ist nun ein Übergang zu den starkfarbigen Bildern zweier einander so entgegengesetzter Systeme der Existenz geworden. Verstehst du jetzt, worum es sich handelt? Wenn du nicht betrunken wärst, würdest du das vielleicht für eine philosophische Abhandlung halten.«
»Wenn du nicht deine beiden Füße auf die entzückende Aquilina gelegt hättest, deren Schnarchen ein wenig Ähnlichkeit mit dem Grollen eines eben ausbrechenden Unwetters hat, würdest du über deine Besoffenheit und dein Geschwätz erröten«, erwiderte Emile, der sich damit unterhielt, die Locken der Euphrasie einzurollen und wieder aufzurollen, ohne sich freilich dieser seiner unschuldigen Beschäftigung sonderlich bewußt zu sein. »Deine zwei Systeme hätten in einem einzigen Satze Platz und lassen sich auf einen einzigen Gedanken zurückführen. Das einfache mechanische Leben führt zu einer sinnlosen Weisheit, da es unsere Intelligenz durch die Arbeit erstickt; aber das Leben in den Wüsten der Abstraktionen oder in den Abgründen der moralischen Welt führt zu einer Weisheit des Wahnsinns. Mit einem Worte: entweder die Gefühle töten, um lang zu leben – oder das Märtyrertum der Leidenschaften auf sich nehmen und jung zu sterben – das sind unsere Wege. Zu dieser Erkenntnis kommt freilich noch der Widerspruch der Veranlagung, die uns der wilde Spaßmacher, den wir als den Herrn der Kreatur anerkennen müssen, mitgegeben hat!«
»Idiot!« unterbrach ihn Rafael. »Wenn du so weiter tust, kannst du Bände daraus machen. Wenn ich die Absicht gehabt hatte, die beiden Ideen auf Formeln zu bringen, hätte ich gesagt, daß der Mensch sich durch die Übung der Vernunft verdirbt und sich in der Unwissenheit läutert. Aber das heißt, der Gesellschaft den Prozeß machen. Ob wir aber mit den Weisen leben – oder mit den Narren zugrunde gehen – das Resultat ist früher oder später ja doch dasselbe. Der Mann, der in der Abstraktion auf die Quintessenz aller Weisheit am größten war, hat diese beiden Systeme in zwei Worten ausgedrückt: Carymary – Carymara.«
»Du machst mir Zweifel an der Allmacht Gottes – denn du bist viel dümmer, als er mächtig ist!« erwiderte ihm Emile. »Unser teurer Rabelais hat diese Philosophie in ein noch viel kürzeres Wort, als ›Carymary – Carymara‹ es ist, zusammengefaßt: in das Wort ›Vielleicht‹, woraus Montaigne sein ›Was weiß ich?‹ genommen hat. Aber diese beiden letzten Worte des menschlichen Wissens sind auch nichts anderes als der Ausruf Pyrrhons, da er zwischen dem Bösen und dem Guten stand wie Buridans Esel zwischen zwei Heubündeln. Aber lassen wir diese ewige Streitfrage, die heute ja doch nur auf Ja oder Nein hinausläuft. Was für eine Erfahrung wolltest du damit machen, daß du dich in die Seine stürztest? Warst du auf die hydraulische Maschine der Notre-Dame-Brücke eifersüchtig?«
»Oh, wenn du mein Leben wüßtest!«
»Mein Lieber, für so banal hätte ich dich nicht gehalten; die Phrase ist ein bißchen zu abgebraucht! Du weißt doch ganz genau, daß ein jeder von uns sich einbildet, mehr zu leiden als die anderen …«
»Oh …« Rafael seufzte.
»Du bist ein Hanswurst mit deinem Oh! Was ist denn los? Zwingt dich eine körperliche oder seelische Krankheit jeden Morgen, die Pferde zusammenzutreiben, die dich am Abend vierteilen werden? Hast du in deiner Mansarde vielleicht deinen Hund roh und ungesalzen aufgegessen? Haben dir jemals deine Kinder ›Ich habe Hunger!‹ zugerufen? Hast du das Haar deiner Geliebten verkauft, um Geld zum Spiele zu haben? Hast du dir jemals, voll Angst, zu spät zu kommen, einen gefälschten Wechsel auf den Namen eines fingierten Onkels auszahlen lassen? Also los! Ich höre zu. Wenn du dich wegen einer Frau oder wegen eines Gläubigers oder aus Langeweile in die Seine hast stürzen wollen, verleugne ich dich! Gesteh! aber lüg nicht! Ich verlange kein Memoirenwerk von dir. Rede so kurz, als es deine Betrunkenheit zuläßt. Ich bin anspruchsvoll wie ein Leser – aber schläfrig wie eine Frau beim Abendgebet.«
»Armer Dummkopf!« redete Rafael nun. »Seit wann stammen die Schmerzen nicht einzig aus der Leidensfähigkeit der Seele? Wenn wir einmal eine Naturgeschichte des menschlichen Herzens haben werden, mit Namen, Arten, Unterarten, Familien, mit Schaltieren, Fossilien, Sauriern, mit mikroskopisch kleinen, mit – was weiß ich – mein lieber Freund, dann wird nachgewiesen sein, daß es ganz zarte, blumenhaft empfindliche Herzen gibt, die in den leichtesten Frösten, wie sie die mineralischen Herzen kaum empfinden, schon zugrunde gehen.«
»Gnade! Erspar mir die Vorrede!« sagte Emile halb lachend, halb mitleidig, und nahm Rafaels Hand in seine.
*