
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Fall Matapan.
In einer sternenhellen Novembernacht schritten zwei elegant gekleidete, junge Leute den Boulevard Haußmann entlang. Der eine war ein großer, kräftig gebauter Mann, mit starkem, braunem Schnurrbart, während der andere blondes Haupthaar und einen Vollbart von derselben Farbe trug.
»Wir sind bei deiner Wohnung angelangt,« sagte der erstere; »ich habe dich bis hierher begleitet, nun kannst du mich in meinen Klub bringen.«
»Nein, ich danke,« rief der andere, »wir haben heute abend genug geschwatzt und philosophiert; ich bin müde und werde mich jetzt zu Bett legen.«
»Na, ich nicht, das mag gut für dich sein, du bist ja auch verliebt.«
»Woher weißt du denn, daß ich verliebt bin?«
»Nun, das sieht man doch; seit drei Monaten bist du ja nicht mehr zu erkennen. Soll ich dir sagen, weshalb du heut abend in die Oper gegangen bist, wen du zu treffen hofftest?«
»Mein guter Courtaumer, du langweilst mich.«
»Nun gut, sprechen wir nicht mehr davon, reden wir von etwas anderem. Ich habe wirklich noch keine Lust zum Schlafen; wovon sprachen wir doch vorhin? Ach ja, ich sagte dir, ich möchte wohl wissen, was in den Häusern in Paris vorgeht. So zum Beispiel in deinem. Na, vorwärts, alter Freund, nenne nur einmal die Mieter dieses Hauses und beschreibe mir ihre Sitten. Mit dem Portier kannst du anfangen.«
»Na, meinetwegen; mein Portier ist alt, häßlich und hinterlistig, wie alle Pariser Portiers. Er liest nur republikanische Zeitungen und hält sich, glaube ich, für einen großen Freidenker. Seine Tochter spielt Piano und will zum Theater gehen; damit du alles weißt, sein Name ist Cyrill Marchefroid.«
»So, über den weiß ich Bescheid. Du scheinst mit ihm gerade keine angenehmen Beziehungen zu unterhalten?«
»Gar keine; ich spreche niemals mit ihm, und er grüßt mich nicht.«
»Aha, er haßt dich. Mein lieber Doutrelaise, gehen wir also in den ersten Stock über.«
»Aber, lieber Jacques, du traust mir wirklich viel Geduld zu.«
»Ach was, nicht ausweichen, also wer wohnt im ersten Stock?«
»Im ersten Stock wohnt der Eigentümer des Hauses, Herr Joachim Matapan, Besitzer von 12 Millionen, die er in fremden Ländern, ich glaube, mit Sklavenhandel verdient hat.«
»Den kenne ich, man hat mich eines Tages in den Champs-Elysées auf ihn aufmerksam gemacht, er fuhr in einer prächtigen Kutsche spazieren. Sieht übrigens aus wie ein alter Pirat. Ist er verheiratet?«
»Nein, er lebt allein mit seinem Kammerdiener und seinem Geldspinde, das, wie man behauptet, bis zum Rande mit Gold und Edelsteinen gefüllt ist. Er hat sich erst seit einem Monat im ersten Stock niedergelassen. Vor dem ersten Oktober hatte er die Wohnung im zweiten Stock inne, und Herr von Calprenède, der jetzt im zweiten Stock wohnt, wohnte damals im ersten.«
»Man erzählt im Klub, sein Sohn Julien soll ihm ein Stück Geld kosten. Der Junge hat den Teufel im Leibe, und wenn er so fortfährt, so wird seine Schwester, mangels Mitgift, schließlich sitzen bleiben. Allerdings kann sie das Geld entbehren, denn sie ist reizend, und ich glaube, es wird ihr nie an Bewerbern fehlen. Ich kenne wenigstens einen, der …«
»Jacques, ich bitte dich, laß mich mit deinen Späßen in Ruhe.«
»Ah! um so besser, du machst Geständnisse. Also ich schweige, und da dir die Leute im zweiten Stock so sehr am Herzen liegen, so erlaube ich dir, sogleich zum dritten überzugehen.«
»Im dritten wohnt Herr Bourleroy, früherer Drogenhändler, der sich von den Geschäften zurückgezogen hat, mit seiner Familie, die aus Frau, Sohn und Tochter besteht. Fräulein Bourleroy möchte gern einen Adeligen heiraten; wenn du Lust hast, mein Lieber, ich glaube, du würdest mit offenen Armen aufgenommen werden.«
»Ich danke dir, so weit bin ich noch nicht. In zehn Jahren vielleicht; aber jetzt habe ich meinen Abschied nur genommen, um mich in Paris zu amüsieren, und ich habe erst angefangen.«
»Nun, bei mir ist es das Gegenteil, ich höre auf,« sagte Doutrelaise schwermütig.
»Ja, das sieht man, du bist nur noch zum Heiraten gut, und ich rate dir, dies so schnell als möglich zu thun. Ich werde dir als Zeuge dienen; mehr kann ich nicht für dich thun.«
»Ach, du bist närrisch, es handelt sich ja gar nicht darum.«
»Gut, streiten wir nicht darüber. Geh' in deine Wohnung und tröste dich damit, daß du die Fenster deiner Holden anblickst …«
»Ach, geh' zum Teufel!« rief Doutrelaise, sich losmachend.
»Zum Teufel! na vielleicht … Ich geh' ja in den Klub … spielen. Sieht man dich morgen früh?«
»Ich weiß nicht … Adieu!«
Albert Doutrelaise schloß die Thür, doch er war nicht wenig überrascht, sich in einer tiefen Dunkelheit zu befinden. Gewöhnlich ließ der Portier, wenn er um 12 Uhr das Gas ausdrehte, im Flur eine angezündete Nachtlampe und ein Licht für jeden Mieter stehen. An diesem Abend hatte er diese Vorsorge nicht getroffen und Albert entschloß sich, seine Wohnung ohne Licht aufzusuchen.
Die Treppe war ihm bekannt, und er fürchtete nicht, unterwegs abzustürzen. Er klammerte sich an das Geländer und begann mit weiser Vorsicht den Aufstieg. Er hatte bereits die Sticheleien seines Freundes Jacques vergessen, aber er dachte an das junge Mädchen, das sein Freund genannt hatte, und gab daher nicht besonders acht, was in seiner Nähe vorging.
Albert stieg, ohne sich zu beeilen, geräuschlos hinauf, denn es lag ein Teppich auf der Treppe. Ohne Zwischenfall gelangte er in den ersten Stock, aber ein wenig höher stieß er an ein lebendes Hindernis, und in demselben Augenblick packte ihn eine Eisenfaust am Arm, deren Druck ihm einen Angstruf entlockte. Doutrelaise war durchaus kein Hasenfuß, aber trotzdem konnte er sich eines leisen Schauers nicht erwehren. Dennoch verlor er den Kopf nicht und gewann nach einigen Sekunden seine Fassung wieder.
»Wer ist da? und was wollen Sie von mir?« fragte er lebhaft.
Da man nicht antwortete, versetzte er dem Unbekannten einen Stoß, der seine Wirkung nicht verfehlte, denn der Fremde ließ ihn los. Nun fing er aber an, den Mann zu packen; doch vergebens bemühte er sich, ihn zu ergreifen, der andere wußte ihm mit größter Geschicklichkeit stets zu entwischen. Er konnte nichts weiter thun, als sich an einen Gegenstand anzuklammern, den der Fremde in der Hand hielt. Dieser Gegenstand mußte wohl eine Kette sein, und er riß so stark daran, daß ihm einer der Ringe in den Händen blieb.
In demselben Augenblick gewann er aber seine Ueberlegung wieder, und es erschien ihm klug, das Abenteuer nicht auf die Spitze zu treiben; daher stieg er schnell die Stufen hinauf, doch auf dem Treppenabsatz des zweiten Stockes blieb er einen Augenblick stehen, um zu lauschen und nun erkannte er, daß der Mann mit langsamem, gleichmäßigem Schritte nachkam.
»Haha!« sagte er sich, »ich bin doch ein rechter Narr, mich um diesen Nachtwandler zu bekümmern. Ich möchte wetten, es ist der Diener von Bourleroy, der sich betrunken hat.«
Mit diesen Worten stieg er weiter hinauf, und bald hörte er, wie sich ein Schlüssel im Schlosse drehte, eine Thür sich öffnete und leise wieder schloß.
»Jetzt weiß ich Bescheid,« murmelte er, »es ist Julien von Calprenède, der sternhagel betrunken nach Hause kommt. Das ist so seine Gewohnheit. Ein wahres Glück, daß ich nicht gerufen habe: ›Haltet den Dieb.‹ Der Portier Marchefroid hätte sich die Gelegenheit, einen kleinen Skandal zu machen, nicht entgehen lassen. Uebrigens ist es sehr unrecht von Julien, ein solches Leben zu führen; das nächstemal, wenn ich ihn sehe, werde ich ihm eine kleine Moralpredigt halten …, und ich kenne ein junges Mädchen, die mir sehr dankbar sein würde, wenn ich ihren Bruder wieder auf den rechten Weg zurückführte. Wo war sie nur heut abend? Der Graf wollte sie in die Oper führen, aber sie sind nicht erschienen. Jetzt schläft sie gewiß schon. Courtaumer hat recht, ich habe den Schlaf verloren, und werde schließlich auch noch den Verstand verlieren. Ich bin in das junge Mädchen eben wahnsinnig verliebt.«
Diesen Monolog führte Albert Doutrelaise bis in den vierten Stock, wo er eine für sein Vermögen zu teure, und für seinen aus Kammerdiener und Köchin bestehenden Haushalt zu große Wohnung inne hatte. Er hatte wohl oft daran gedacht, die Wohnung aufzugeben, aber es hielt ihn eine Nachbarschaft zurück, für die er gern alle Unannehmlichkeiten der Welt ertragen hätte. Herr von Calprenède wohnte in dem Hause und Herr von Calprenède hatte eine Tochter. Herr von Calprenède empfing Albert gern und Fräulein von Calprenède kam ihm höchst liebenswürdig entgegen, ja es war nicht unmöglich, daß diese freundschaftlichen Beziehungen zu einer Heirat führten.
Der Graf war reich gewesen, aber man erzählte sich, er sei es nicht mehr, während Doutrelaise ein Vermögen von 60 000 Frs. Rente besaß. Allerdings war er nur bürgerlicher Herkunft, aber wenn ihm auch der Name eines Edelmannes fehlte, so besaß er dafür doch die Manieren, und was noch mehr wert war, die Gefühle eines solchen. Fräulein von Calprenède schloß also keine Mesalliance, wenn sie sich mit ihm vermählte.
An diesem Abend nun nahm er sich vor, genau zu beobachten, was in der Wohnung des Grafen vorging. Daher wartete er, ob das erste Zimmer erleuchtet wurde und war nicht wenig überrascht, als die Wohnung im zweiten Stock dunkel blieb.
»Das ist doch sonderbar,« murmelte er, »vor drei Minuten hörte ich noch, wie die Thür geöffnet wurde. Wenn es wirklich der Schlingel von Julien war, so kann er unmöglich schon im Bett liegen. Nun, er war gewiß so betrunken, daß er auf den Teppich niedergefallen ist, oder vielleicht sucht er auch ein Licht.«
Noch immer sah Albert nach der Wohnung hinüber; da schien es ihm plötzlich, als husche ein Schatten an den Fenstern vorbei.
»Ich hatte recht,« sagte er sich, »er kann noch nicht einschlafen und irrt wie eine gequälte Seele durch sein Zimmer … Und doch könnte man behaupten, er sei es gar nicht. Julien ist nicht so groß … Ah! aus der Entfernung kann man schlecht beurteilen; ich sehe ihn ja gar nicht mehr, er hat sich jedenfalls ohne Licht niedergelegt. Es bleibt mir nichts weiter übrig, als es ebenso zu machen.«
Er wollte eben seinen Beobachtungsposten verlassen, da fuhr er plötzlich mit leiser Stimme fort:
»Aber nein, da ist er ja wieder in dem Arbeitskabinett … Er nähert sich dem Fenster, er bückt sich, man möchte darauf schwören, er kniet nieder … Ja, was soll denn das heißen, jetzt beugt er sich schon wieder; aber nein, jetzt habe ich von der Sache wirklich genug. Ich werde ihm wohl morgen im Klub oder sonstwo begegnen und ihn bitten, mir seine nächtlichen Spaziergänge zu erklären. Das wird jedenfalls einfacher und sicherer sein, als in dieser Bibliothek stehen zu bleiben, wo es durchaus nicht warm ist.«
Nach dieser weisen Schlußfolgerung ging Doutrelaise nach seinem Schlafzimmer, welches sich gerade gegenüber dem Boudoir des Fräulein Arlette befand. »Ach, zum Teufel mit Julien und seinem Schatten,« rief Albert. »Es wäre ja reiner Wahnsinn, dieser Treppengeschichte irgend welche Bedeutung beizulegen. Bei dieser Gelegenheit habe ich einen tüchtigen Schlag bekommen, und halte seit einer Viertelstunde ein ›Andenken‹ in der Hand, ohne es näher anzusehen. Betrachten wir doch einmal, was ich da habe.«
Er öffnete die Hand und näherte sich der Lampe.
»Ah! das ist doch stark, ich halte da, ohne es zu wissen, einen kostbaren Edelstein in der Hand … Einen prächtigen Opal mit kleinen Diamanten eingefaßt! Und da fragte ich mich noch, ob ich es mit einem Diebe zu thun hätte. Der Dieb bin ich ja.«
»Es ist doch wirklich nicht zu glauben,« fuhr Albert fort, den Gegenstand näher betrachtend. Aber warum zum Teufel führt Julien diesen Schmuck in der Nacht spazieren? Und wo hat er diese Edelsteine hergenommen? Bei seiner Schwester habe ich sie noch nie gesehen.«

Wieder versank Albert in tiefes Nachdenken; eifrig betrachtete er den Opal, aber je länger er ihn ansah, desto ernster wurde sein Gesicht.
»Es giebt nur eine Erklärung,« murmelte er; »Julien hat gespielt und wahrscheinlich eine größere Summe aus Ehrenwort verloren. Anstatt seinem Vater alles zu gestehen, hat er sich diesen Opal angeeignet, – um ihn zu versetzen. Hm, schön ist es ja nicht, was er da gethan hat, aber noch ist es Zeit, ihn von dem schlechten Wege abzubringen, morgen früh werde ich ihn aufsuchen und ihm die Summe leihen, die er braucht; hoffentlich wird er sich nicht weigern, das Geld von mir anzunehmen. Uebrigens habe ich ja auch einen guten Vorwand, die Sache zur Sprache zu bringen und brauche ihm zu dem Zwecke nur dies Fragment eines kostbaren Familienschmucks zu übergeben. Zuerst werde ich mich entschuldigen, daß ich ihn ein wenig rauh auf der Treppe behandelt habe … Bei der Gelegenheit frage ich ihn, weshalb er mich so schnell losgelassen hat, und warum er sich nicht besser verteidigte, als ich ihn angriff. Ich habe ihn nicht für so ruhig gehalten. Jedenfalls wollte er einen Kampf vermeiden, um einer Erklärung aus dem Wege zu gehen … Warum hat er den Schmuck nicht in die Tasche gesteckt? … Sonderbar … Nun, auch das wird sich morgen aufklären.«
Während dieser Worte schloß Doutrelaise den Opal in ein Kästchen und erhob sich, um die seltsamen Gedanken, welche ihn beherrschten, zu verscheuchen. Er ging einigemal im Zimmer auf und ab, bald trat er aber wieder ans Fenster und blickte hinüber, als sich plötzlich das Zimmer, in welchem Fräulein Arlette wohnte, erhellte.
»Woher kommt sie zu dieser Stunde?« murmelte er, als er einen Frauenkopf sich hinter den Gardinen abzeichnen sah. »Vielleicht war sie bei ihrem Vater … Aber nein, beim Grafen ist kein Licht … Aber was thut sie denn jetzt? Sie kniet nieder … Sie betet … Vielleicht für ihn.«
Albert hatte recht gesehen. Fräulein von Calprenède betete. Sie lag auf den Knieen mit gerungenen Händen, und es hatte fast den Anschein, als ob sie weinte. »Sollte ich recht geraten haben?« fragte sich Doutrelaise. »Ist es wirklich das Betragen ihres Bruders, das sie so traurig stimmt? Dieser unglückliche Mensch steht vielleicht eben im Begriff, seiner Familie Schande zu machen. Nun, noch ist es Zeit, und soweit es an mir liegt, will ich ihm redlich helfen.«
Am nächsten Morgen überreichte ihm sein Diener außer den Zeitungen zwei Briefe. Die Handschrift des ersten schien ihm bekannt und er murmelte, die Adresse betrachtend:
»Was hat mir denn Courtaumer zu schreiben? Wir haben uns um Mitternacht getrennt, und am frühen Morgen schickt er mir einen Brief? Das ist fast beunruhigend … Er ist sehr jähzornig, vielleicht hat er heute nacht einen Streit mit jemandem gehabt. Nun, wir werden sehen.«
Er öffnete den Brief und las folgende Worte:
»Lieber Freund! Ich bin vollständig abgebrannt. Mangels an Munition mußte ich heute nacht den Kampf einstellen. Wenn Du mir neue Patronen liefern kannst, so komm heut mittag zwischen 1-2 Uhr zu mir. Ich grüße Dich
Dein Freund
Jacques v. Courtaumer.«
»Ah! verteufelt!« brummte Doutrelaise, »er hat wieder verloren und wahrscheinlich eine hübsche Summe, da er mich braucht. Er hätte auch besser gethan, Marinelieutenant zu bleiben, als sich in Paris zu ruinieren. Ich will ihn ja nicht in Verlegenheit lassen, aber aufrichtig gesagt, er kommt ein wenig zu oft.«
Nach diesen Worten legte Albert den Brief seines Freundes beiseite und begann den zweiten zu öffnen.
»Was ist denn das für ein Gekritzel,« murmelte er, die unregelmäßige Schrift betrachtend. »Hoffentlich ist es nicht wieder eine Geldanleihe.«
»Ha!« rief er, erstaunt die Unterschrift betrachtend, »Julien v. Calprenède. Das ist ja ein wahres Ereignis … Der Fall muß ernst sein, lesen wir!«
»Verehrter Herr! Sie würden mich zu großem Danke verpflichten, wenn Sie mich heut um 11 Uhr im Speisesaal des Café de la Paix aufsuchen wollten. Ich möchte mir erlauben, Sie um einen großen Dienst zu bitten.«
»Wahrscheinlich Geld … Ich hatte richtig geraten … Auch heute nacht hatte ich mich nicht getäuscht … Er war es … Er muß sich in einer großen Verlegenheit befinden, daß er den Familienschmuck verpfänden wollte, der nicht einmal ihm gehörte. Aber ich werde ihn retten; und von ganzem Herzen. Aber jetzt darf ich keine Minute mehr versäumen, will ich nicht zu spät ins Café kommen … Eine seltsame Idee, mich in ein Restaurant zu bestellen, warum ist er nicht zu mir gekommen, das war doch viel einfacher.«
Während dieser Worte war Albert aus dem Bett gesprungen und hatte seine Toilette begonnen. Dann klingelte er seinem Kammerdiener und fragte ihn, wer den Brief Juliens gebracht hätte.
»Herr von Calprenède selbst,« erwiderte der Kammerdiener zur größten Verwunderung Alberts, der wohl wußte, daß Julien sonst nie vor Mittag das Bett verließ.
Die erhaltene Auskunft bestärkte ihn in der Annahme, daß die Lage des jungen Mannes eine sehr peinliche sein mußte, und daß es die höchste Zeit war, ihm aus der Verlegenheit zu helfen. Daher beendete er schnell seine Toilette, welche sonst gewöhnlich viel Zeit in Anspruch nahm. Um 10½ Uhr war er fertig und verließ seine Wohnung, nicht, ohne den Opal in die Tasche zu stecken, dessen Verschwinden den jungen Calprenède im hohen Grade beunruhigen mußte.
Inzwischen war er die Treppen hinuntergestiegen, da sah er sich plötzlich in der zweiten Etage Herrn Matapan gegenüber und war nicht wenig erstaunt, daß dieser an der Thür des Herrn von Calprenède klingelte. Er sah äußerst vergnügt aus und war höchst elegant gekleidet. Mit herablassender Leutseligkeit begrüßte er seinen Mieter vom vierten Stock und schüttelte ihm freundschaftlich die Hand.
»Sonderbar! Was hat er denn zu dieser Stunde bei Juliens Vater zu thun?« murmelte Doutrelaise, als er sich von ihm verabschiedet hatte. »Der Graf empfängt doch sonst morgens nicht, oder höchstens Agenten und Lieferanten?«
Nach einigen Sekunden hörte Albert, wie die Thür zur Wohnung des Herrn von Calprenède sich öffnete und ein Gespräch sich zwischen einem Diener und Herrn Matapan entspann, der sogleich eingelassen wurde.
»Das wird immer seltsamer,« sagte sich Albert, »das sah ja so aus, als wenn man ihn erwartete. Ich glaubte nicht, daß der Graf und er andere Beziehungen unterhielten, als die zwischen Mieter und Vermieter. Dieser exotische Millionär gehört doch nicht zur selben Gesellschaftsklasse wie Calprenèdes. Und er besucht sie vormittags, das ist mir unerklärlich. Aber vielleicht hat Julien die tolle Idee gehabt, sich von ihm Geld zu leihen … Nun, das werde ich ja sogleich erfahren.«
Als Albert an der Loge des Portiers vorüber kam, stand dieser gerade vor der Thür, und er konnte nicht umhin – ihn anzusprechen, um sich Aufklärung über die Ereignisse der vergangenen Nacht zu verschaffen.
»Herr Marchefroid,« sagte er in ziemlich scharfem Tone, »ich hätte mir beinahe gestern nacht auf der Treppe den Hals gebrochen. Die Nachtlampe war nicht angezündet und ich konnte mein Licht nicht finden.«
»Aber gnädiger Herr, ich habe doch alles, bevor ich mich zu Bett legte, hingestellt,« erwiderte der Portier.
»Einer Ihrer Mieter wird sie, als er nach Hause kam, ausgelöscht haben.«
»Da habe ich Ihnen wohl um 12½ Uhr geöffnet?«
»Ganz recht.«
»Dann hat niemand die Nachtlampe berühren können, denn ich habe sie um 12 Uhr angezündet und von diesem Augenblick hat kein Mensch vor Ihnen das Haus betreten.«
»Sie müssen sich täuschen, denn ich bin ganz sicher, zwischen der ersten und zweiten Etage mit einem Herrn zusammengestoßen zu sein. Ich konnte ihn in der Dunkelheit nicht erkennen und habe ihn nicht gesprochen, aber ich glaube, es war Herr v. Calprenède.«
»Der Graf? Der ist gestern abend nicht ausgegangen.«
»Nein, nicht der Graf – sein Sohn.«
»Ah! das ist etwas anderes, der ist die ganze Nacht gegangen und gekommen. Um zwei Uhr des Morgens war er noch nicht zu Hause. Um 2¼ Uhr hörte ich ihn klingeln. Um 2 Uhr 25 Minuten ließ er sich wieder die Hausthür öffnen, und um 6 Uhr ging das Spiel von neuem an. Wenn der gnädige Herr mir nicht glauben wollen, so können Sie ja Herrn von Calprenède selbst fragen,« schloß der Portier mit beleidigter Miene.
»Oh! Ich glaube Ihnen, Herr Marchefroid, aber außerdem hat Herr von Calprenède wohl das Recht, auszugehen und nach Hause zu kommen, wenn es ihm beliebt. Sorgen Sie in Zukunft nur dafür, daß ich nicht im Dunkeln die Treppe hinaufzusteigen brauche.«
Damit drehte er dem Portier den Rücken und schritt mit flüchtigem Gruße davon. Er ging langsam und benutzte die Zeit, um über die Antworten des Portiers nachzudenken. Sie setzten ihn einigermaßen in Erstaunen und er glaubte, daß Marchefroid ihm nicht die Wahrheit oder wenigstens nicht die volle Wahrheit sagte.
»Als ich klingelte,« sagte er sich, »hatte ich bereits zehn Minuten mit Jacques von Courtaumer vor der Thür gestanden und geplaudert. Wenn Julien nach Hause gekommen wäre, während wir auf dem Trottoir standen, hätte ich ihn gesehen … Und hätte er das Haus eine Viertelstunde vor mir betreten, so hätte ich ihn nicht auf der Treppe getroffen; er hätte dann ja zehnmal Zeit gehabt, in seine Wohnung zu gehen. Wie kommt es nur, daß ich daran noch nickt gedacht habe!«

Während er die Frage unterwegs von diesem neuen Gesichtspunkte betrachtete, bemerkte er auf der anderen Seite des Boulevard zwei weibliche Wesen. Die eine trug ein sehr einfaches Kleid, während ein dichter Schleier ihr Antlitz den Blicken des Beschauers entzog; aber dennoch bemerkte Albert den seinen Schnitt ihrer Züge und die Vornehmheit ihrer ganzen Erscheinung. Die andere schien ein Kammermädchen zu sein, und als sie sich umwandte, erkannte Doutrelaise die Zofe des Fräulein von Calprenède und Fräulein Arlette selbst.
Er war im höchsten Grade überrascht. Junge Damen von Welt pflegen gewöhnlich nicht mit ihren Zofen auszugehen, und er hatte keine Ahnung, was Fräulein von Calprenède schon so früh veranlassen konnte, ihre Wohnung zu verlassen.
Fräulein Arlette hatte sich nicht umgesehen und setzte ruhig ihren Weg fort, doch konnte man aus ihrem beschleunigten Gange entnehmen, daß die Zofe sie von der Nähe Alberts unterrichtet hatte.
Seine Neugierde sollte nicht allzulange auf die Probe gestellt werden. An der Ecke des Boulevard Malesherbes wandte sich Fräulein Arlette und ihre Zofe nach links, und Doutrelaise sah sie in der Kirche Saint-Augustin verschwinden.
Albert, der die Ursache ihres Kummers zu kennen glaubte, nahm sich fest vor, ihr sobald als möglich ein Ende zu machen. Brauchte er sich doch nur mit dem Bruder Arlettes auseinander zu setzen, und dieser erwartete ihn ja in dem Café de la Paix. Er eilte, und ging so schnell, daß er vor Julien von Calprenède anlangte.
Es war noch nicht elf Uhr und das Restaurant fast leer. Fast sämtliche Tische waren leer, er brauchte nur zu wählen und ließ sich daher ganz im Hintergrunde des Saales in einem Winkel nieder, wo man ungestört plaudern konnte, ohne befürchten zu müssen, von den an den Nebentischen Sitzenden gehört zu werden.
Er mochte wohl zwanzig Minuten dagesessen haben, als er Julien am Eingang des Cafés erscheinen sah.
Der Bruder des Fräuleins von Calprenède war ein großer Mensch mit braunen Haaren und unregelmäßigen Gesichtszügen. Seine Augen blickten unstät hin und her und störten den Eindruck seiner sonst sympathischen Erscheinung.
Als er Doutrelaise bemerkte, überflog ein mattes Lächeln sein Gesicht, und er eilte auf ihn zu. Albert reichte ihm beide Hände und sagte, ohne ihm Zeit zu lassen, auch nur ein Wort zu sprechen:
»Man hat mir Ihren Brief heut morgen übergeben, und ich danke Ihnen, daß Sie an mich gedacht haben. Ihre Bitte ist im voraus erfüllt, aber erst wollen wir frühstücken, ich sterbe vor Hunger.«
»Ich nicht,« murmelte Julien.
»Das glaube ich,« sagte Albert, »aber trotzdem wäre ich Ihnen böse, wenn Sie mir nicht Gesellschaft leisteten.«
»Ich habe nicht das Recht, Ihnen etwas abzuschlagen, mein lieber Doutrelaise, denn ich bin bereits Ihr Schuldner, da Sie die Güte hatten, hierher zu kommen.«
»O, ich bin entzückt, aber weshalb kamen Sie nicht einfach zu mir, statt mir zu schreiben?«
»Ich bin sehr früh ausgegangen und wollte Sie nicht wecken.«
»O, Sie hatten mich nicht geweckt, denn ich habe sehr wenig geschlafen, und ich möchte wetten. Sie noch weniger als ich.«
»Ach, ich schlafe überhaupt nicht mehr.«
»Die Partie hat wohl erst am frühen Morgen ein Ende genommen.«
»Wahrscheinlich!«
»Sie wissen es nicht genau, waren Sie denn nicht da?«
»Doch, aber ich bin nicht bis zu Ende geblieben.«
»Dann haben Sie gewonnen?«
»Weshalb?«
»Weil man nicht fortgeht, wenn man verliert; man will den Verlust wiedergewinnen und ruiniert sich oft vollends.«
»So ist es heute einem Ihrer Freunde, Herrn von Courtaumer ergangen.«
»Das konnte ich mir denken. Hat er viel verloren?«
»Ich glaube 25 000 Francs.«
»Teufel! Das ist eine hübsche Summe,« sagte Doutrelaise und fügte hinzu:
»Courtaumer hat kein Glück und sollte auf das Baccarat verzichten. Und wie ist es Ihnen ergangen?«
»Ich habe nicht gespielt.«
»Ah!« sagte Albert ganz überrascht. »Sie sind also vernünftig geworden?«
»Nicht so ganz, aber ich hatte kein Geld und war außerdem noch welches schuldig.«
»Nun, das ist trotzdem ein Beweis von Klugheit, daß Sie nicht noch weitere Schulden kontrahieren wollten.«
»Ich hätte es vielleicht doch gethan, hätten mich nicht triftige Gründe davon abgehalten.«
»Die will ich nicht wissen, mein lieber Julien, doch wiederhole ich Ihnen noch einmal, daß ich ganz zu Ihrer Verfügung stehe.«
»Ich danke Ihnen, aber bevor ich Ihr Anerbieten annehme, muß ich Ihnen erklären, um was es sich handelt.«
»Wozu? Sie brauchen mir nur die Summe zu nennen …«
»Sie ist glücklicherweise nicht allzu hoch, aber es handelt sich nicht allein um einen Gelddienst, sondern auch noch um etwas anderes.«
»Um so besser. Meine Person und meine Börse stehen Ihnen zu Diensten.«
»Nun, so hören Sie; es hat mich jemand beleidigt und ich will mich schlagen.«
»Ich werde mit Vergnügen Ihr Zeuge sein.«
»Ich erwartete nichts anderes von Ihnen, aber das ist nicht alles. Mein Gegner ist auch gleichzeitig mein Gläubiger. Ich schulde ihm eine Summe auf Ehrenwort und kann mich nicht schlagen, ehe ich ihn nicht bezahlt habe.«
»Das wäre in der That gegen alle Regeln, er würde das Duell verweigern und hätte nicht unrecht. Aber Sie können ihn noch heute bezahlen, wenn Sie wollen, ich habe alles Nötige bei mir.«
»Sie können sich nicht denken, welchen Dienst Sie mir erweisen!« rief Julien. »Mit Ihrer Hilfe kann ich diesen Tölpel jetzt züchtigen, wie er es verdient.«
»Um wen handelt es sich denn?«
»Es handelt sich um meine Schwester.«
»Um Ihre Schwester?« rief Doutrelaise. »Was hat Fräulein von Calprenède mit einem Duell zu thun?«
»Man hat von ihr in einer Weise gesprochen, die mir nicht gefällt,« erwiderte Julien.
»Dann haben Sie allerdings das Recht, eine Genugthuung zu verlangen, aber wer hat sich denn erlaubt? …«
»Wer? Ein Tölpel, den Sie wenigstens von Ansehen kennen, denn er wohnt in demselben Hause wie wir, Anatole Bourleroy.«
»Ah! das ist in der That stark und er verdient eine Züchtigung Aber Ihr Herr Vater hat ihm, so viel ich weiß, doch nie die Ehre erwiesen, ihn zu empfangen. Was hat er denn gesagt?«
»Er hat Reden gehalten, die uns alle beleidigen, meinen Vater, meine Schwester, und mich. Ich kam heute nacht erst sehr spät in den Klub. Vor dem Kamin im roten Saal saßen drei bis vier junge Leute und unterhielten sich. Sie wandten mir den Rücken und sahen mich nicht … Ich hörte sofort die Stimme Bourleroys heraus. Er erzählte den anderen, mein Vater wäre im letzten Monat umgezogen, weil er nicht mehr im stande gewesen, seine Miete zu bezahlen.«
»Wenn er weiter nichts gesagt hat,« sagte Doutrelaise die Achseln zuckend, »darüber brauchten Sie sich doch nicht aufzuregen, man weiß ja, daß es nicht wahr ist.«
»Ob es nun wahr ist oder nicht, das ist gleichgültig. Ich dulde es nicht, daß dieser Herr sich mit unseren Angelegenheiten befaßt. Aber er hat hinzugefügt, wir hätten ein einfaches Mittel, uns aus der Verlegenheit zu ziehen; wir brauchten nur meine Schwester einem Manne zu verheiraten, der ein großes Vermögen besitzt, und gleichzeitig bemerkte er, wir hätten diesen Mann schon gefunden.«
»Und er hat den Betreffenden genannt?« fragte Albert mit zitternder Stimme.
»Gewiß, es ist der Eigenthümer des Hauses.«
»Herr Matapan?«
»Er selbst. Was sagen Sie zu dieser Unverschämtheit? … Matapan ist 50 Jahre alt … Niemand weiß, woher er kommt, aber man weiß wohl, daß es kein Edelmann ist, obwohl er sich den Barontitel gegeben hat.«
Doutrelaise zitterte, auch er war ja kein Edelmann.
»Zu behaupten, Herr von Calprenède opfere seine Tochter den Millionen dieses alten Parvenüs, heißt uns alle beleidigen und das kann und will ich nicht dulden.«
»Und doch haben Sie es geduldet,« sagte Albert ernst.
»Sie wissen weshalb,« erwiderte Julien. »Bourleroy hat mir gestern im Ecarté 6000 Fr. abgewonnen. Ich hatte seit zwei Monaten viel verloren und um einige Tage Aufschub gebeten. Ich bin sein Schuldner und infolgedessen verurteilt zu schweigen. Ich war noch genügend Herr meiner selbst, um den Saal zu verlassen, er hat nicht geahnt, daß ich da war. Zornig kehrte ich nach Hause zurück und wollte meinem Vater alles sagen. Dann aber überlegte ich mir, daß die Sache mich allein anging, und kehrte in den Klub zurück. Ich hoffte, hier einen Freund zu finden, der mir die 6000 Fr. hätte leihen können. Ich gestehe Ihnen sogar, daß ich ganz zuerst an Sie gedacht habe.«
»Sie thaten recht, mein lieber Julien, ich werde Ihnen die Summe zustellen. Aber gestatten Sie mir. Ihnen einen Rat zu geben …«
»Was für einen Rat?« fragte Julien etwas scharf.
»Meine Ansicht ist, daß Herr Bourleroy eine Lektion empfangen muß, aber ich halte es für unangemessen, daß bei der Sache der Name des Fräuleins von Calprenède ausgesprochen wird.«
»Aber unter welchem Vorwande sonst?«
»Unter dem ersten besten. Ich nehme es auf mich, einen zu finden, und wenn es Ihnen recht ist, so will ich Ihnen die ganze Angelegenheit ordnen.«
»Sie vergessen ganz, mein Lieber, daß die Sache Sie nichts angeht.«
»Um Verzeihung. Ich habe die Ehre, von Ihrem Herrn Vater empfangen zu werden, ich hege für ihn und die Seinen die lebhafteste Sympathie …«
»Ich zweifle nicht daran, aber Sie sind nicht mit ihm verwandt. Unter welchem Vorwande wollen Sie eine Beleidigung rächen, die uns persönlich zugefügt worden ist?«
»Nun, ich bin doch Ihr Freund,« erwiderte Albert.
»Das genügt nicht. Meine Pflicht ist es, Bourleroy zu fordern, das heißt, wenn Sie geneigt sind, meinen Wunsch zu erfüllen.«
»Zweifeln Sie daran?« fragte Doutrelaise.
»Gewiß nicht. Sie haben es mir ja versprochen. Aber nicht hier, bitte, an den Nebentischen sitzen Leute, die uns kennen.«
»Wie Sie wollen,« sagte Albert. »Sprechen nur von etwas anderem.«
»Sehr gern, vielleicht von den Frauen.
»Nein, davon bitte nicht.«
»Ah! es ist ja wahr, ich vergaß, Sie sind verliebt.«
»Wie kommen Sie zu der Ansicht?« rief Doutrelaise.
»Alle Ihre Freunde behaupten es, und Sie erröten, wenn man davon spricht; es ist also wahr.«
»Es ist eine Einbildung Courtaumers,« entgegen Doutrelaise verlegen.
»Er erzählte mir heut morgen im Klub, er hätte Sie heut um Mitternacht nach Hause begleitet.«
»Ja, ich habe das Haus einen Augenblick nach Ihnen betreten.«
»Nach mir? Ich bin erst um 2 Uhr nach Hause gekommen.«
»Das ist sonderbar, ich glaubte Ihnen auf der Treppe begegnet zu sein.«
»Ach, gehen Sie, ich hätte Sie doch gesehen.«
»Nein, die Scene hat sich doch in der tiefsten Dunkelheit abgespielt.«
»Die Scene? Welche Scene?«
»Nun, eine ziemlich eigentümliche Scene. Zwischen der ersten und zweiten Etage stieß ich mit einem Manne zusammen, der vor mir hinaufstieg und mich am Arme packte. Ich riß mich los, stieß ihn zurück und versuchte, ihn dann meinerseits zu packen, gab aber das Abenteuer dann auf. Ich ließ ihn einfach stehen und ging in meine Wohnung.«
»Das ist in der That sonderbar,« entgegnete Julien. »Aber welchen Grund hatten Sie, anzunehmen, ich greife nachts die Leute an?«
»Weil der Betreffende die Thür Ihrer Wohnung mit einem Schlüssel öffnete und darin verschwand.«
»Sie wissen das ganz genau?«
»Ganz genau. Ich hörte wie der Schlüssel sich im Schlosse drehte und glaubte natürlich, Sie wären es.«
»Nun, was würden Sie sagen,« erwiderte Julien, »wenn ich Ihnen mitteilte, daß man nicht zum erstenmal heimlich in mein Zimmer eingeschlichen ist?«
»Ich würde sagen,« entgegnete Doutrelaise, »man habe Ihre Wohnung betreten, um Sie zu bestehlen.«
»Aber nein,« fuhr Arlettes Bruder fort, »man hat mir garnichts gestohlen, und ich weiß es nur daher, weil Gegenstände, die ich selbst an einen bestimmten Ort gestellt habe, sich anderswo befanden. Möbel waren vorgerückt, Stühle umgeworfen, als wäre jemand ohne Licht durch mein Zimmer gegangen.«
»Das ist ja wirklich sonderbar!«
»Um so sonderbarer, als es, seit wir umgezogen sind, vier- bis fünfmal passiert ist«
»Aber meiner Ansicht nach giebt es dafür eine einfache Erklärung. Der Kammerdiener Ihres Vaters bedient Sie ja wohl auch. Er ist durch das Zimmer gegangen, das Sie bewohnen …«
»Mein Vater hat keinen Kammerdiener mehr. Die Köchin schläft nicht in der Wohnung, und die Zofe meiner Schwester würde sich nicht erlauben, mein Zimmer zu betreten, wenn ich nicht da bin.«
»Nur mein Zimmer,« fuhr Julien fort, »hat der nächtliche Besucher betreten. Wenn die Leute nächtlicherweile bei mir eindringen, um mich zu bestehlen, so thun sie mir herzlich leid, denn ich trage stets mein ganzes Geld bei mir.«
»Wer beweist, daß diese Leute nicht weiter gegangen sind, als in Ihr Zimmer? denn in dem zweiten Kabinett habe ich die Person bemerkt, die Ihre Wohnung aufschloß und die ich für Sie gehalten habe.«
»Woher wissen Sie das alles?«
»Der Vorfall auf der Treppe hatte meine Neugier erweckt; von meinem Fenster kann man in die Ihren blicken, ich schaute hin und sah einen Schatten, der an den Fenstern vorbeiging; erst in Ihrem Kabinett und dann in dem Arbeitszimmer. Es war mir sogar, als kniee er nieder.«
»Und was geschah dann?«
»Das weiß ich nicht, denn ich war fest überzeugt. Sie seien es, und zog mich zurück.«
»Sonderbar,« sagte Julien nachdenklich. »Sie hätten vielleicht die Erklärung gefunden, nach der ich seit einem Monat suche.«
Albert betrachtete ihn aufmerksam; sein Argwohn hatte sich während der Unterredung in Gewißheit verwandelt und er dachte bei sich:
»Er hat das Collier genommen, um sich Geld zu verschaffen; mit dem Gelde wollte er Bourleroy bezahlen und ihn dann fordern; der Zweck entschuldigt fast das Mittel.«
Während Albert diese Betrachtungen anstellte, zündete sich Julien mit nachdenklicher Miene eine Cigarre an, dann sagte er plötzlich:
»Sie sind eigentlich ein recht glücklicher Mensch, daß Sie dem Spiel so wenig huldigen. Ich kann es nicht lassen, und doch hat es mir an Lehren nicht gefehlt.«
»Die letzte war etwas hart. Sie sind dadurch der Schuldner des Herrn Bourleroy geworden.«
»Ja, das ist bitter, und Sie glauben nicht, in welcher entsetzlichen Lage ich mich seit zwei Tagen befinde. Glücklicherweise wollen Sie mir helfen, und das ist wirklich ein Glück für mich, denn in solchen Fällen verliere ich den Kopf und könnte das Silbergeschirr meines Vaters nehmen, um es ins Leihamt zu tragen.«
»Oh, lieber Freund, Sie werden mich nie überzeugen, daß Sie im stande wären, eine schlechte Handlung zu begehen. Doch da Sie gerade vom Leihhaus sprechen, muß ich Ihnen noch einen Fund zeigen, den ich heute nacht gemacht habe. Ich glaube, man würde mir eine hübsche Summe darauf leihen,« sagte Doutrelaise, lächelnd in seine Tasche fassend. »Nun, was sagen Sie hierzu?« fragte er dann, den Opal aufs Tischtuch werfend und Julien scharf anblickend.
»Ein sehr schönes Kleinod,« sagte dieser äußerst ruhig. »Schade, daß der Opal Unglück bringt; der Stein ist prächtig.«

»Sie glauben an dies Vorurteil?« murmelte Doutrelaise, zugleich überrascht und entzückt, ihn so ruhig zu sehen.
»Nicht ganz, aber ich habe ein solches Pech, daß ich um keinen Preis der Welt dieses Kleinod tragen möchte.«
»Sie sehen nichts Besonderes an dem Opal?«
»Nichts als seinen Glanz … Ja doch. Die Kette, die die einzelnen Steine verbindet, zeigt einen ganz frischen Bruch.«
»Ja, ganz recht.«
»Aber wodurch ist das gekommen? … Ach ja, Sie wissen ja nichts, denn Sie haben ihn ja gefunden.«
»O, ich weiß es doch.«
»Dann wissen Sie auch, wem er gehört?«
»Ich glaubte es zu wissen, aber jetzt muß ich fast annehmen, daß ich mich getäuscht habe.«
»Lieber Freund, wollen Sie sich nicht etwas deutlicher erklären?«
»Sehr gern. Ich selbst habe die Kette, die diesen Opal hielt, zerbrochen.«
»Aber warum denn, mein Gott?«
»Ohne es zu wollen; ich zog daran, und der Stein blieb mir in den Händen.«
»Ich verstehe immer weniger.«
»Also sagen Sie mir ganz aufrichtig, kennen Sie diesen Opal nicht, erinnert er Sie an nichts?«
»Mein Lieber,« rief Calprenède lachend. »Sie scheinen mich für einen Juwelier zu halten …«
»Nein … Aber …«
»Nun, worauf zielen denn eigentlich alle Fragen hin? Sie fragen mich, als wären Sie Untersuchungsrichter und ich Angeklagter.«
»Sie haben recht, wenn Sie mich für lächerlich halten. Entschuldigen Sie, aber ich hatte eine seltsame Idee.«
»Welche? Bitte.«
»Ich bildete mir ein, dieses Collier gehöre Ihnen.«
»Ah! Sie kommen darauf zurück. Sie glauben also wirklich, ich handle mit Juwelen.«
»Nein, ich schwöre es Ihnen; aber Sie können ja diesen Schmuck geerbt haben.«
»Wenn diese Steine mir gehörten, so hätte ich sie schon lange zu Gelde gemacht.«
»Selbst wenn sie ein Erbteil Ihrer Mutter wären?«
»Doch, ich weiß genau, daß der Schmuck meiner Mutter keinen einzigen Opal enthielt. Uebrigens trägt auch niemand mehr diese Steine am Halse, und wenn sie jemals Mode gewesen sind, so war das in längst vergangener Zeit oder in ferneren Ländern, wie in Japan oder China.
Julien sprach diese Worte mit so natürlicher Stimme, daß Doutrelaises Argwohn fast ganz geschwunden war.
»Nun sprechen Sie sich aber doch aus,« fuhr Calprenède fort. »Wo haben Sie den Stein gefunden?«
»Der Ausdruck ›gefunden‹ ist eigentlich nicht ganz richtig,« sagte Albert lächelnd, »ich habe ihn mir eher erobert.«
»Wie das?«
»Dadurch, daß ich das Halsband zerbrach.«
»Aber wem zum Teufel haben Sie es denn entrissen?«
»Ich habe Ihnen doch mein Abenteuer von vergangener Nacht erzählt?«
»Allerdings.«
»Nun, bei der Gelegenheit erfaßte ich einen Gegenstand, zog daran aus allen Leibeskräften, und dieser Opal blieb in meinen Händen.«
»Das ist aber merkwürdig. Doch, wie kamen Sie auf den Gedanken, ich schleiche mit einem kostbaren Juwelenarmband auf den Treppen herum? Glaubten Sie vielleicht, ich hätte es gestohlen?«
»Nein, gewiß nicht,« versetzte Albert. »Ich dachte, dieses Collier gehörte Ihnen oder einem der Ihrigen, und Sie wollten es verpfänden, da Sie sich in Geldverlegenheit befanden.«
»Sie haben eine recht schlechte Meinung von mir,« sagte Calprenède mit scharfer Stimme, »und ich finde es sonderbar, daß Sie mir diese seltsamen Thatsachen unterschieben, die zur Nachtzeit in dem Hause, das wir beide bewohnen, sich ereignen.«
»Seltsame Thatsachen,« sagte plötzlich eine tiefe Stimme, »ich glaube, Sie verleumden mein Haus.«
Doutrelaise erhob lebhaft das Haupt und erkannte zu seiner größten Ueberraschung Herrn Matapan.
Calprenède sprang wie besessen von seinem Stuhl, stürzte nach seinem Hut und verlangte vom Kellner mit herrischem Ton den Ueberzieher.
Verdutzt betrachtete Doutrelaise abwechselnd Julien und seinen Wirt, der zu so ungelegener Zeit erschienen war.
»Wie, Julien, Sie gehen?« rief er lebhaft.
»Es scheint, mein Herr, ich verjage Sie,« rief Matapan spöttisch. »Merkwürdig, alle meine Mieter verschwinden, wenn ich erscheine.«
Calprenède hielt es nicht für nötig, auf diese Bemerkung eine Antwort zu geben, sondern entfloh, als wären ihm seine sämtlichen Gläubiger aus den Fersen.
Matapan hatte diese kleine Scene mit größter Seelenruhe mit angesehen, und aus seinem Lächeln konnte man schließen, daß sie ihm höchst albern vorkam.
Er war ein Mann von ungefähr 50 Jahren, von untersetzter, aber äußerst kräftiger Gestalt. Seine schwarzen Haare durchzog noch kein Silberfaden, und nur sein Bart begann etwas ins Graue zu schimmern. Seine Augen glänzten wie feurige Kohlen, und wenn er lachte, zeigte er scharfe blendendweiße Zähne.
»Ich wollte hier jemand erwarten,« fuhr Matapan fort. »Doch der Betreffende ist noch nicht da. Ist es Ihnen unangenehm, wenn ich inzwischen den Platz des Herrn von Calprenède einnehme?«
»Durchaus nicht,« erwiderte Albert.
»Ich werde Sie nicht allzu lange langweilen. Inzwischen rauchen Sie diese gute Cigarre,« fuhr Matapan fort. »Ich habe mir davon im letzten Jahre 10 000 Stück aus der Havanna kommen lassen.«
»Ich danke verbindlichst, Herr Matapan,« sagte Doutrelaise und nahm das kostbare Geschenk entgegen.
»Was zum Teufel hatte denn Ihr Freund? Er stürzte ja wie ein Wahnsinniger davon.«
»Er ist zuweilen launenhaft,« murmelte Doutrelaise.
»Jawohl, launenhaft wie ein störrisches Pferd. Ist er nicht auch gegen Sie grob geworden?«
»Oh! ich habe nicht darauf achtgegeben.«
»Und Sie haben recht daran gethan. Aber sagen Sie einmal, von welchen seltsamen Thatsachen sprach er denn, die zur Nachtzeit in meinem Hause vorgehen?«
Da Doutrelaise hierzu schwieg, so fuhr Matapan lachend fort: »Wenn der Vater dieses jungen Mannes wüßte, daß sich sein Herr Sohn alle Nächte herumtreibt, so würde er ihn vielleicht in sein Zimmer einschließen. Es fehlt dem Herrn von Calprenède an Energie. Ich habe ihm eben ein sehr vorteilhaftes Geschäft vorgeschlagen, konnte aber keine entscheidende Antwort von ihm bekommen, und werde seine Schwelle nicht so bald wieder betreten.«
Albert atmete auf.
»Doch, nun sagen Sie mir, lieber Freund,« fuhr der Wirt fort, »was für Gespenster giebt es in meinem Hause?«
»Gespenster?« wiederholte Doutrelaise lächelnd, »nein, mein werter Herr, das sind durchaus keine Gespenster. Das sind Menschen von Fleisch und Blut wie wir, denn als ich die Treppe hinausstieg, stieß ich gegen einen Herrn.«
»Das ist alles!« rief Matapan lachend. »Das ist allerdings unangenehm, aber Sie sind doch schließlich nicht von Glas und ich hoffe, der andere hat sich auch nicht Arm oder Bein gebrochen.«
»Er hat sich gar nichts gebrochen … aber er hat mir den Arm so stark gedrückt, daß ich beinahe aufgeschrieen hätte Trotzdem habe ich mich nicht gerührt, und den Mann gegen die Wand gestoßen.«
»Also ein stummer Kampf. Wie hat er denn geendet?«
»Ich setzte meinen Weg fort und er den seinen.«
»Das heißt. Sie stiegen hinauf und er hinunter.«
»Nein, er stieg vor mir hinauf. Ich eilte an ihm vorbei, er suchte nicht, mich einzuholen, blieb aber auch nicht stehen.«
»Wer konnte dieser Nachtwandler nur sein,« sagte Matapan nachdenklich. »Wahrscheinlich ein Diener, der ohne Erlaubnis ausgegangen ist und sich in der Kneipe verspätet hat.«
»Vielleicht der Ihre?«
»Nein.«
»Nun, der meine auch nicht. Sagen Sie mir doch, bitte in welchem Stockwerk stießen Sie mit dem Manne zusammen?«
»Zwischen den ersten und zweiten.«
»Im ersten wohne ich, im zweiten Herr v. Calprenède, der nur weibliche Dienstboten hat. Im dritten Stock wohnt Herr Bourleroy, der sich den Luxus eines Kammerdieners gestattet.«
»Ich bin sicher, es war kein Diener.«
»Nun, wenn es ein Herr war, so wissen Sie wohl auch, welche Wohnung er betreten hat.«
»Gewiß, die Wohnung im zweiten Stock.«
»Dann war es also der Graf von Calprenède oder sein Sohn.«
»Ich glaubte, es wäre der Sohn, aber er hat mir eben erzählt, er sei bis zwei Uhr im Klub gewesen.«
»War er vielleicht deshalb so ärgerlich?« fragte Herr Matapan.
»Nein, er war schlechter Laune, weil er im Spiel verloren hat.«
»Aha! Und das Bezahlen ist eine andere Sache, woher sollte er auch das Geld nehmen!«
»Das geht uns wohl nichts an,« erwiderte Doutrelaise mit scharfem Tone.
»Nun, das geht mich doch vielleicht ein wenig an,« murmelte Matapan, »aber es handelt sich jetzt nicht darum. Die seltsamen Thatsachen, von denen Sie soeben sprachen, beschränken sich also auf das nächtliche Abenteuer, das Sie mir erzählten. Aufrichtig gestanden, ich halte es für unnötig, eine Untersuchung zu eröffnen. Herr von Calprenède wollte Ihnen nicht zugeben, daß Sie in der Dunkelheit mit ihm zusammen gestoßen sind, aber nur er kann es sein, den Sie gegen die Wand gedrückt haben.«
Während dieser Unterhaltung war es Doutrelaise gelungen, den Opal, welcher auf dem Tisch liegen geblieben war, mit seiner Serviette zu bedecken, und er fuhr beruhigt fort:
»Ich glaube, Sie täuschen sich, es ist nicht Julien, mit dem ich diese Nacht einen kleinen Kampf bestand.«
»Nun, wer sollte denn sonst die Wohnung des Herrn von Calprenède betreten haben?«
»Das weiß ich nicht, und er ebensowenig, denn er fand mehrmals in den Zimmern, die er bewohnt, Spuren eines nächtlichen Besuches; vom Platze gerückte Möbel, umgestürzte Stühle u. s. w.«
»Ich sagte Ihnen ja, es giebt Gespenster in meinem Hause,« versetzte Matapan, »aber vielleicht sind Sie der Ansicht, man habe bei Herrn von Calprenède einbrechen wollen.«
»Nun, nach meiner Ansicht war der Mann von heute nacht niemand anderes als ein Dieb.«
»Was hätte er denn stehlen sollen?« fragte Matapan höhnisch. »Der Graf besitzt doch keine Schätze … Aber vielleicht hat man ihm das Schmuckstück gestohlen, das Sie seinem Sohn zeigten, als ich das Restaurant betrat.«
»Was für ein Schmuckstück?« fragte Doutrelaise errötend.
»Das Sie da unter Ihrer Serviette liegen haben.«
Albert fühlte, daß er sich eine Blöße gegeben und daß kein Ausweichen mehr möglich war, darum murmelte er, die Serviette entfernend: »Ich wollte es Ihnen nicht sagen, denn ich fürchtete. Sie zu beunruhigen. Aber der Mann, dem ich heute nacht auf der Treppe begegnet bin, war wahrscheinlich ein Dieb. Dieser Stein gehört zu einem Collier, das er in der Hand hielt; beim Kampfe entriß ich ihm denselben.«
»Gestatten Sie mir vielleicht den Stein?« fragte Matapan eifrig.
Er nahm ihn und seine Hände zitterten unwillkürlich, als er ihn zurücklegte.
»Sie glauben also,« fragte Matapan, »dieser Opal sei Herrn von Calprenède gestohlen worden?«
»Nein,« erwiderte Albert, »das nicht; auch sein Sohn glaubt das nicht.«
»Das ist gleich; es liegt mir daran, den Dieb zu entdecken. Wir sind alle in dieser Angelegenheit interessiert, denn der Spitzbube wohnt in meinem Hause, davon bin ich überzeugt. Ich bitte nicht, mir dieses Beweisstück anzuvertrauen, aber ich hoffe, daß ich auf Sie zählen darf. Nicht wahr?«
»Gewiß.«
»Dann glaube ich, werde ich bald den Eigentümer des Colliers auffinden. Aber es ist ein Uhr, der Herr, auf den ich warte kommt nicht; ich gehe nach Hause.«

Mit diesen Worten reichte er Doutrelaise die Hand und verließ mit schnellen Schritten das Restaurant.
Der Graf von Calprenède hatte einst ein großes Vermögen besessen, aber seit dem Tode seiner Gattin war das Glück und die Freude seines Hauses entschwunden. Herr von Calprenède besaß zwei Fehler, welche alle seine guten Eigenschaften in den Schatten stellten. Er litt an der Entdeckungssucht und glaubte stets, die Natur habe ihn als großen Spekulanten geschaffen. Ein Erfinder brauchte sich nur an ihn zu wenden, und er konnte sicher sein, daß der Graf ihm seine Börse und seinen Einfluß zu Verfügung stellte.
Merkwürdigerweise schlugen aber die sämtlichen Erfindungen fehl und verschlangen den größten Theil seines Vermögens.
Diese verschiedenartigen Mißerfolge entmutigten den Grafen jedoch nicht, und er war stets bereit, seiner fixen Idee neue Opfer zu bringen.
Julien liebte seinen Vater, aber er konnte sich nicht an das häusliche Leben gewöhnen, zu dem ihn sein Vater übrigens in keiner Weise zwang. Viel besser verstand er sich mit seiner Schwester, die keinen einzigen seiner Fehler besaß. Ihr allein vertraute er seine Sorgen an, sie tröstete ihn und nur von ihr nahm er Ratschläge an, die er allerdings häufig nicht befolgte. Er war stets bereit, sie zu verteidigen, wie sie stets bereit gewesen wäre, sich für ihn zu opfern und seine Verteidigung zu übernehmen. Auch heute war es so. Da Julien den ganzen Vormittag umherlief, um Geld aufzutreiben, war er nicht zum Frühstück erschienen. Kurz nach ein Uhr betrat der Graf den Speisesaal, und seine Miene verdüsterte sich, als er die Abwesenheit Juliens bemerkte. Arlette war bleich, und ihre von Thränen geröteten Augen verrieten nur zu deutlich ihren Gemütszustand.
»Du bist heut morgen ausgegangen?« fragte Herr von Calprenède, sie auf die Stirn küssend.
»Ja, lieber Vater, ich bin in die Kirche gegangen,« erwiderte sie zögernd.
»Wie ich sehe, ist Julien nicht hier,« bemerkte der Graf düster.
»Ich glaube, er ist nach dem Fechtsaal gegangen,« versetzte das junge Mädchen schüchtern.
»Das glaube ich nicht,« entgegnete Herr von Calprenède mit herbem Lächeln. Ich hörte ihn die ganze Nacht kommen und gehen, und ich glaube, er hat sich nicht zu Bett gelegt. Es ist mir übrigens lieb, daß er nicht hier ist, denn ich habe ernsthaft mit dir zu sprechen. Lassen Sie uns allein, Julie,« sagte er zu der Kammerzofe, die sogleich das Zimmer verließ. »Weißt du, was Herr Matapan bei mir wollte?« fragte Herr von Calprenède nach einer Pause.
»Nein, Papa,« erwiderte Arlette, »ich vermute, er wollte von Geschäften mit dir sprechen.«
»Nun, ein Geschäft hat er mir allerdings vorgeschlagen; er hat mich um deine Hand gebeten.«
»Dieser Antrag ist so seltsam, daß ich ihn mir nicht erklären kann,« murmelte Fräulein von Calprenède.
»Ich erkläre ihn mir sehr gut; er ist reich und glaubt, seine Millionen seien hinreichend, den sozialen Abstand, der uns trennt, zu überbrücken, doch ich habe ihm ins Gesicht gelacht und er hat mich mit Wut im Herzen verlassen.«
»Glücklicherweise haben Sie nichts von ihm zu fürchten.«
»Nein, wenigstens wird er es nicht wagen, mir offen den Krieg zu erklären. Außerdem werden die Beziehungen, die ich mit ihm unterhielt, bald ein Ende nehmen, denn ich habe beschlossen, die Wohnung zu kündigen.«
»Sie wollen das Haus verlassen?« fragte Arlette lebhaft.
»Gewiß. Thut es dir leid?«
»Nein, aber ich war an das Haus gewöhnt, und meine arme Mutter ist hier gestorben.«
»Ich habe oft bedauert,« fuhr der Graf fort, »daß ich das Haus nicht kaufte, als ich es noch konnte und er es mir verkaufen wollte. Ich hätte mir einen bitteren Schmerz erspart und einen Teil meines Vermögens gerettet. Ich könnte dir dann wenigstens etwas hinterlassen.«
»O, mich erschreckt die Armut nicht,« murmelte das junge Mädchen.
»Ja, ich weiß, du hast ein großes Herz und erträgst die Armut mit stolzem Mut. Aber ich hoffe noch, sie dir zu ersparen. Die Gegenwart ist allerdings traurig, doch ich hoffe auf die Zukunft, die uns mehr zurückgeben wird, als ich je verloren habe.«
»O Gott!« hauchte das junge Mädchen, »ich bitte ja täglich für Sie und meinen Bruder.«
»Bete lieber für Julien; ich zittere tagtäglich, er könne meinem Namen Schande machen.«
»O, lieber Vater, ich glaube, er würde nie eine unehrenhafte Handlung begehen.«
»Thäte er es, ich würde ihn töten! Aber lassen wir deinen Bruder und sprechen wir von dir, meine liebe Arlette. Ich konnte einen Parvenü nicht verhindern, sich um deine Hand zu bewerben, aber derselbe Gedanke kann einem anderen Herrn der nämlichen Gesellschaftsklasse kommen und dem möchte ich dich nicht wieder aussetzen. Nur ein Mittel giebt es, dich gegen solche Zudringlichkeiten sicher zu stellen; du mußt dich verheiraten, mein liebes Kind.«
»Mich verheiraten?« wiederholte das junge Mädchen bewegt.
»Ja, aber mit einem hübschen und intelligenten, jungen Manne. Ich verlange nicht, daß er reich ist, ich bin zufrieden, wenn deine Zukunft gesichert wird. Nun? was hältst du von meinem Plan?«
»O! lieber Vater, ich will Sie niemals verlassen,« sagte Arlette verlegen.
»Ach, das ist die übliche Antwort, die man in diesem Fall immer giebt,« rief der Graf lachend. »Aber damit werde ich mich nicht begnügen. Nun, mein liebes Kind, wenn ich dir meinen Kandidaten vorstellte, würdest du ihm dein Jawort geben, ja oder nein?«
»Aufrichtig gestanden, lieber Vater, kann ich mich nicht aussprechen, bevor ich ihn gesehen habe.«
»Nun, so höre mich an. Er ist dreißig Jahre, hat ein angenehmes Aeußere und besitzt elegante, vornehme Manieren. Nun, errätst du noch immer nicht, wen ich meine?«
»Durchaus nicht,« erwiderte Arlette schüchtern.
»Nun, ich will dir helfen. Du kennst doch unsern Nachbarn von da oben, Herrn Doutrelaise.«
»Er,« rief Fräulein von Calprenède errötend, »wollen Sie mich mit dem verheiraten?«
»Wer spricht denn davon?« fragte der Graf, die Stirn runzelnd, »das glaubst du doch wohl selbst nicht.«
»Nein, nein,« murmelte Arlette bleich und zitternd. »Verzeihen Sie … ich glaubte …«
»Du hast dir doch wohl nicht eingebildet, daß ich je daran gedacht habe, dich mit diesem Herrn zu verheiraten? Aber ich habe das Gespräch nicht ohne Absicht auf Herrn Doutrelaise gebracht. Herr Doutrelaise kennt meinen Kandidaten, er ist sogar eng mit ihm befreundet.«
»Ich weiß noch immer nicht!« stotterte das junge Mädchen.
»Nun, du erinnerst dich doch des Sommerabends, an dem wir in den Champs-Elysées im Konzert waren?«
»Ja gewiß, ganz genau,« erwiderte Arlette lebhaft.
»Dort trafen wir unsern Nachbarn aus dem vierten Stock. Er war sehr höflich, sprach uns an, und ich hielt es für gut, ihn an unserer Seite Platz nehmen zu lassen. Du wirst dich ferner erinnern, daß sich im Konzert zwischen dir und Herrn Doutrelaise eine sehr lebhafte Unterhaltung über Mozart und Gluck entspann. Ich war nicht aufgelegt, euch in die hohen Sphären der Kunst zu folgen und hätte mich sehr gelangweilt, wäre Herr Doutrelaise allein gewesen; das war aber glücklicherweise nicht der Fall, denn er stellte mir einen seiner Freunde vor, mit dem ich mich lebhaft unterhielt. Es war ein Herr Jacques von Courtaumer.«
»Ja,« erwiderte Fräulein von Calprenède, »jetzt weiß ich; ist er nicht mit Frau von Vervins verwandt?«
»Er ist ihr Neffe und ich habe ihn später bei ihr getroffen Herr von Courtaumer hat zwölf Jahre in der Marine gedient, im letzten Jahre seinen Abschied genommen und ist nach Paris gekommen, um sich zu amüsieren. Aber Frau von Vervins behauptet, er sei dieses Müßiggängerlebens müde und es bedarf zu seiner vollen Bekehrung nur eines jungen Mädchens, das ihm gefällt. Nun, Frau von Vervins ist der Meinung, daß du dieses junge Mädchen seiest.«
»Ich? Wie ist das möglich, er kennt mich ja kaum!«
»Das ist wahr, aber er hat mit der Marquise von dir gesprochen, und wir wissen, daß du ihm sehr gefällst. Wenn du nichts dagegen hast, mit ihm zusammenzutreffen, so wäre es ein leichtes, euch zusammenzubringen.«
»Ich werde Ihre Befehle erfüllen, lieber Vater, aber …«
»Du antwortest, als wärest du noch immer ein Kind,« fuhr der Graf nach kurzer Pause fort. »In erster Reihe muß ich dir sagen, daß ich dir vollständig freie Wahl lasse, den Gatten, den ich dir vorschlage, anzunehmen oder abzulehnen. Ich hätte dir vielleicht von meinem Plane noch nichts gesagt, hätte mich der unverschämte Antrag des Herr Matapan nicht daran erinnert, daß ich sterben und dich allein ohne Schutz und ohne Vermögen zurücklassen könnte. Was sollte nun aus dir werden, wenn ich nicht mehr sein würde? Ich habe dir bereits gesagt, daß die Lage meines Vermögens zwar nicht zum Verzweifeln, aber immerhin ernst ist. Ein großer Teil desselben ist in unglücklichen Spekulationen untergegangen. Der Rest steckt in einem Unternehmen, das, wenn es gut geht, alle meine Verluste wieder auswetzen wird, das aber in diesem Augenblick alle meine Mittel erfordert.«
»Ich schwöre Ihnen, lieber Vater, ich vermisse nichts.«
»Ich weiß, du hast dich mit frohem Mut in das Unvermeidliche gefügt. Nichtsdestoweniger ist unsere Sage recht peinlich. Hoffentlich nimmt sie bald ein Ende, und ich will dir nicht verhehlen, liebe Arlette, der Mann, den ich für dich ausgesucht, könnte zur glücklichen Entwickelung der Sache viel beitragen. Er ist ein ausgezeichneter Seemann und besitzt Kenntnisse, welche mir bei meiner Angelegenheit sehr zu statten kommen würden. Ich habe mit Kapitalien das Eigentumsrecht eines untergegangenen Schiffes gekauft, welches Tonnen Goldes trug. Es handelt sich nun, dieselben ans Land zu bergen, und dieses Rettungswerk will ich versuchen. Begreifst du nun, in welcher Weise mir der Beistand des Herrn von Courtaumer nützlich sein kann?«
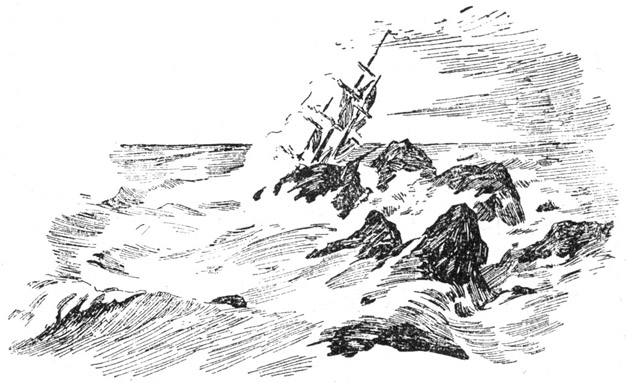
»Nicht so ganz,« murmelte Arlette leise.
»Wie«, fuhr Herr von Calprenède fort. »Du begreifst nicht, daß, wenn Herr von Courtaumer, der 12 Jahre Seemann gewesen, sich bei diesem Unternehmen beteiligt, der Erfolg schon so gut wie gesichert ist? Nun der Grund ist doch sonnenklar, und jetzt wirst du wohl einsehen, weshalb ich deine Heirat mit Herrn von Courtaumer so lebhaft wünsche.«
»Lieber Vater,« versetzte Arlette in ziemlich festem Tone, »ich glaube, Herr von Courtaumer könnte sich auch bei diesen, großen Unternehmen beteiligen, ohne mich zu heiraten. Ich begreife nicht einmal, welche Beziehungen zwischen meiner Heirat und …«
»Submarinen Arbeiten besteht? Allerdings! Meine beiden Projekte sind voneinander völlig unabhängig, und wenn ich dem jungen Mann einen Anteil an meinem Unternehmen biete, so stelle ich nicht zur Bedingung, daß er dich heiraten muß. Ich werde Herrn von Courtaumer nur auffordern, sich an meinem Plane zu beteiligen. Wenn er nun, wie ich hoffe, annimmt, so wird er gezwungen sein, Paris zu verlassen. Die Arbeiten werde lange dauern, umsomehr, da ich nur eine kleine Anzahl von Arbeitern beschäftigen will, denn es liegt mir daran, meine Entdeckung nicht bekannt werden zu lassen. Gelingt der Plan nicht, so war meine Hoffnung eben umsonst, denn du wirst dann viel zu arm sein, um an eine reiche Heirat denken zu können.«
Arlette atmete auf. Die Gefahr lag noch in weiter Ferne.
»Ich werde alles thun, was Sie wollen, lieber Vater,« versetzte sie; »aber ich glaube, Herr von Courtaumer denkt gar nicht an mich.«
»Nun, das werden wir ja sehen. Was gibt es denn?« wandte er sich an die Zofe, welche eben ins Zimmer getreten war.
»Herr Matapan läßt fragen, ob der gnädige Herr ihn empfangen wolle.«
»Ah! das ist doch zu stark,« sagte Herr von Calprenède. »Sie haben doch hoffentlich geantwortet, ich wäre nicht zu Hause?«
»Ich sagte, der Herr Graf säße bei Tisch; aber Herr Matapan meinte, er hätte dem Herrn Grafen eine sehr wichtige Mitteilung zu machen, und würde warten.«
»Es ist gut,« sagte Herr von Calprenède ungeduldig, »führen Sie den Herrn in mein Arbeitszimmer.«
»Ich glaubte, mich heute morgen klar genug ausgedrückt zu haben,« sagte der Graf, nach einigen Minuten in sein Kabinett tretend, zu Matapan, »was haben Sie mir noch zu sagen, mein Herr?«
»Nichts, was mit unserer vorigen Unterredung in Zusammenhang stände,« versetzte Matapan kühl.
»Und um was handelt es sich jetzt?«
»Um eine Auskunft.«
»Eine Auskunft? Worüber, wenn's beliebt?«
»Ueber eine Thatsache, die Sie als Mieter meines Hauses angeht.«
Herr von Calprenède zitterte, er dachte an seinen Sohn, und diese seltsame Vorrede beunruhigte ihn.
»Ich muß Ihnen mitteilen, daß ich gezwungen bin, mit einer Art von Verhör zu beginnen,« fuhr Matapan fort.
»Zuerst wünsche ich zu wissen, ob es wahr ist, daß Sie ihren Kammerdiener entlassen haben.«
»Was kümmert das Sie? rief der Graf zornig.
»Ich habe meine guten Gründe, Sie darnach zu fragen. Es ist heute nacht etwas passiert, das ich gern einem Ihrer Bedienten zur Last legen möchte.«
»Ich habe nur weibliche Dienstboten.«
»Das hat man mir mitgeteilt. Aber hat der Kammerdiener, den Sie entlassen, vielleicht einen Schlüssel mitgenommen?«
»Mein Gott, was bedeuten diese Fragen?«
»Nun, es hat sich heute nacht jemand heimlich bei Ihnen eingeschlichen. Ein Mensch hat die Thür Ihrer Wohnung geöffnet, folglich hatte er einen Schlüssel.«
»Aller Wahrscheinlichkeit nach.«
»Er besaß auch einen Schlüssel zu meiner Wohnung, denn als er die meine verließ, betrat er die Ihre.«
»Und Sie vermuten, daß es mein Kammerdiener war?«
»Ich vermute gar nichts; ich suche nur nach Aufklärung.«
»Suchen Sie dieselbe anderswo. Ich habe keine Lust, die Polizei Ihres Hauses zu spielen. Außerdem ist die Geschichte auch kaum glaublich.«
»Bitte sehr, sie ist wahr. Der Mann hat sicher Ihre Wohnung betreten, denn man hat gehört, wie er Ihre Thür öffnete und schloß.«
»Wer hat ihn gehört?«
»Herr Doutrelaise.«
»Was geht die Sache denn den an? Und was ist dabei so außerordentliches? Ich bin gestern abend nicht ausgegangen, und mein Sohn kommt gewöhnlich sehr spät nach Hause, also war er es jedenfalls.«
»Das will und kann ich nicht glauben.«
»Aus welchem Grunde?« fragte der Graf erregt.
»Weil ich Ihnen bereits bemerkte, daß der Mann, welcher Ihre Wohnung betreten, zuerst in meiner war.«
»Ah! Ich bin Ihnen wirklich sehr verbunden, daß Sie nicht frei heraussagen, es sei mein Sohn gewesen.«
»Ich klage ihn umsoweniger an, als ich bestohlen worden bin.«
»Also darauf zielte Ihre Frage hin und Sie glaubten, ich hätte dem Diebe Asyl gegeben?«
»Das behaupte ich durchaus nicht. Trotzdem ist dem aber so, denn Herr Doutrelaise behauptet es.«
»Das kümmert mich wenig. Sie glauben doch wohl nicht, daß ich Ihnen bei der Untersuchung einer Angelegenheit behilflich sein werde, der ich vollständig fremd gegenüber stehe?«
»Nein, mein Herr, ich werde allein handeln, wenn Sie mich dazu zwingen. Man hat mir heute nacht ein Collier gestohlen, welches mir sehr teuer war, denn es war ein Familienschmuck.«
»Der Dieb,« fuhr Matapan fort, »mußte wohl wissen, wo das Collier lag, denn er hat den Schrank geöffnet, in den ich es gestern verschloß, hat kein anderes Möbel angerührt und er ist gerade in das Zimmer gegangen, in dem ich gewöhnlich Wertgegenstände aufbewahre.«
»Und daraus schließen Sie, daß einer der Meinigen der Schuldige ist? Darauf, mein Herr, habe ich nichts zu antworten, und halte den Moment für gekommen, unsere Unterredung abzubrechen.«
Es trat eine Pause ein, doch Matapan machte keine Miene, das Zimmer zu verlassen, sondern fuhr fort:
»Sie geben mir also den Rat, klagbar zu werden? Haben Sie auch die Folgen eines solchen Schrittes wohl überlegt? Dieselben könnten sehr unangenehm werden, nicht für mich, aber für jemanden, der Ihnen nahe steht.«
»Erstens, mein Herr,« erwiderte lebhaft der Graf, »habe ich Ihnen keinerlei Rat gegeben. Wenden Sie sich an die Gerichte, oder thun Sie, was Sie wollen.«
»Mein Herr,« fuhr Matapan fort, ohne sich von der Stelle zu rühren, »ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, daß die Sache für Sie unangenehme Folgen haben könnte, wenn ich genötigt wäre, sie dem Gerichte anzuzeigen. Ich will mich jetzt deutlicher und genauer erklären, und zwar in Ihrem Interesse.«
»Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, daß man mir ein Collier von hohem Werte gestohlen hat, dasselbe ist heute nacht verschwunden. Der Beamte, dem ich die Sache anzeigen werde, wird mich nun fragen, was ich über den Charakter meiner Mieter weiß, er wird wissen wollen, ob ich jemand in Verdacht habe.«
»Wollen Sie vielleicht antworten. Sie beargwöhnten ein Mitglied meiner Familie?«
»Nein, aber der Beamte wird mich auffordern, mich näher auszulassen, und ich werde genötigt sein, ihn von allen mir bekannten Thatsachen in Kenntnis zu setzen. Ich werde ihm z. B. mitteilen müssen, daß der Mensch, der mir mein Collier gestohlen hat, Ihre Wohnung betreten hat.«
»Das müßten Sie auch beweisen.«
»Das kann ich, Herr Doutrelaise wird verhört werden, und sein Zeugnis ist entscheidend, jener hat gehört, daß ein Mann, dem er auf der Treppe begegnete, Ihre Wohnungsthür öffnete.«
»Das ist kein Beweis, und ich erkläre Ihnen noch einmal, diese ganze Geschichte erscheint mir unglaublich.«
»Der Beamte dürfte nicht dieser Meinung sein. Wenn er aber, was kaum glaublich ist, noch zweifeln sollte, so würde ihm Herr Doutrelaise einen der Steine des Colliers zeigen, einen Opal, den er dem Diebe auf den Stufen der Treppe heut nacht entrissen hat.«
»Ich habe diesen Stein vor einer Stunde im Restaurant gesehen, wo Herr Doutrelaise mit einem seiner Freunde frühstückte. Ich habe den Stein sofort erkannt, denn diese Fassung giebt es nur einmal. Der Freund, welchem Herr Doutrelaise das Schmuckstück zeigte, ging fort; und er nahm die Gelegenheit wahr, mir sein nächtliches Abenteuer zu erzählen, ich habe ihm nicht gesagt, daß der Stein mir gehört, sondern ihn nur gebeten, ihn nicht aus der Hand zu geben, was er mir auch versprach. Als ich Ihnen heute morgen meine Aufwartung machte, wußte ich von dem Diebstahl noch nichts. Ich konnte mit Ihnen also noch nicht davon sprechen, glaubte aber, nachdem ich alles erfahren. Ihnen nichts verschweigen zu dürfen.«
»Herr Matapan,« sagte der Graf, »ich sehe den Zweck ihres Besuches noch nicht recht ein. Sie wollen den Dieb entdecken, das begreife ich vollkommen und wünsche, daß Sie bald in den Besitz Ihres Schmuckes gelangen mögen.«
Sie erachten also die Folgen einer etwaigen Klage für nichts,« sagte Matapan. »Was würden Sie nun sagen, wenn eines Tages in Ihrer Wohnung eine Haussuchung gehalten würde? Da der Dieb Ihre Wohnung betreten hat, so wird man in derselben Nachforschungen halten. Man wird annehmen, daß er den Schmuck versteckt hat, und wenn man ihn unglücklicherweise findet …«
Man wird ihn nicht finden, wenn man Ihnen den Schmuck gestohlen hat; denn angenommen, dieser Kammerdiener hätte meine Wohnung betreten, so hätte er das Collier wohl kaum hier gelassen. Hat er es Ihnen genommen, so geschah das um ihn zu verkaufen, nicht aber, um ihn zu behalten.
»Ich bin ganz Ihrer Ansicht, Herr Graf!«
»Nun, so bleibt uns nur ein Verdacht übrig. Ich oder mein« Sohn könnte den Diebstahl begangen haben.«
»Sie, Herr Graf, sind über jeden Verdacht erhaben.
»Also käme mein Sohn in Frage?«
»Herr Graf,« erwiderte Matapan gelassen, »unsere Beamten erkundigen sich zuerst immer, welches Leben die irgend eines Verbrechens Verdächtigen führen. Um einem Untersuchungsrichter schuldig zu erscheinen, genügt es oft, daß man Spieler ist oder Schulden hat.«
»Und mein Sohn hat Schulden, mein Sohn spielt? fragte lebhaft der Graf.
»Nun, es ist stadtbekannt, daß seine Ausgaben seine Einnahmen weit übersteigen.«
»Das ist kein Grund, ihm eine ehrenrührige Handlung zur Last zu legen. Wenn man es wagen würde, ihn anzuklagen, würde er sich rechtfertigen. Reichen Sie also ruhig Ihre Klage ein.«
»Nun gut, Herr Graf, ich wünsche nur, daß Sie Ihre heutigen Worte nicht bereuen mögen. Gestatten Sie mir noch, hinzuzusetzen, daß ich mich nicht an die Gerichte gewendet haben würde, hätten Sie meinen Antrag von heute morgen besser ausgenommen.«
»Ah!« rief der Graf, bleich vor Zorn, »also darauf wollen Sie hinaus? Sie hofften, mich da mit einer Diebstahlsgeschichte, die Sie sich da ausgesonnen haben, einzuschüchtern, aber Sie kennen mich sehr schlecht, mein Herr. Lieber sehe ich meinen Sohn vor den Schranken des Gerichtshofes erscheinen, als daß meine Tochter Ihren Namen trägt.«
»Mein Name, oder ein anderer,« sagte Matapan kalt, »das kommt auf eins heraus. Sie wollten mich nicht zum Schwiegersohn, das war Ihr Recht, und diese Sache ist für mich erledigt. Ich verlangte nichts weiter, als diese unangenehme Affaire im Keime zu ersticken; statt mir aber für meinen Schritt Dank zu wissen, schlagen Sie einen Ton an, der mich jeder Rücksichtsnahme gegen Sie überhebt. Es bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als dem Gericht meine Klage einzureichen.«
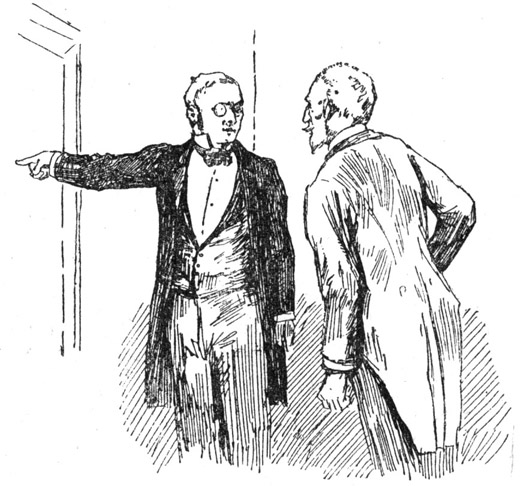
»Gehen Sie,« sagte der Graf und zeigte aus die Thür.
»Wenn die Sache übel abläuft,« sagte Matapan, während er das Zimmer verließ, »so habe Sie es sich allein zuzuschreiben, Herr Graf.«
»Ich werde Julien gegen die Verleumdungen dieses Menschen in Schutz nehmen,« murmelte Calprenède, als er sich allein sah, »aber wenn er sich nicht bessert, so muß er Paris verlassen.«
Im selben Augenblicke öffnete sich die Thür des Kabinetts und Arlette erschien.
»Wie, du warst da?« sagte der Greis, die Stirne runzelnd, »ich hatte dich doch gebeten, zu warten.«
»Ich war auch im Speisesaal,« sagte Arlette, »aber Ihre Unterredung mit Matapan dauerte sehr lange, und ich war unruhig …«
»Du hattest recht,« versetzte Calprenède, »es handelte sich um deinen Bruder.«
»Ah! mein Gott, hat er etwa Geld von diesem Menschen geliehen?«
»Schlimmer als das, er hat ihn bestohlen. Heute nacht ist bei Matapan eingebrochen und ein kostbares Opalcollier ist ihm gestohlen worden.«
»Julien ist heute früher als gewöhnlich nach Hause gekommen, schon um ein Uhr … Ich hörte ihn, er war in diesem Zimmer …«
»Das ist sonderbar, ich glaubte – ich hoffte, er hätte die Nacht seiner Gewohnheit gemäß außer dem Hause zugebracht,« murmelte der Graf nachdenklich.
»Sie hofften?«
»Ja, denn man hat auf der Treppe einen Menschen gesehen, der die Thür unserer Wohnung öffnete … Er hatte den Schlüssel … Und dieser Mensch hielt in der Hand das angeblich gestohlene Collier.«
»Ah! Und Sie glauben?«
»Ich glaube, bis man mir das Gegenteil beweist, überhaupt nicht an die Geschichte. Aber weißt du, wer sie Herrn Matapan erzählt hat? Herr Doutrelaise, unser Nachbar, den du so sehr lobst.«
»Er,« murmelte das Mädchen und senkte errötend das Haupt.
»Jawohl, er selbst. Er hat auch den Opal behalten, den er dem Diebe entrissen; derselbe soll als Beweisstück dienen, um den Schuldigen aufzufinden. Doutrelaise hat auch behauptet, daß der Dieb sich in unsere Wohnung geflüchtet hat. Und auf diese leichtfertige Behauptung stützt Matapan seine Anklage.«
»Dieser Verdacht ist unwürdig, und ich bin gewiß, daß Herr Doutrelaise ihn nicht teilt … Ich bin sicher, er würde, Julien sogar im Notfalle verteidigen.«
»Nun, Herr Matapan wird ihm Gelegenheit dazu geben, denn er ist von hier zum Polizeikommissär gegangen und wird ihm alles erzählen. Was sagst du dazu?«
»Nun, ich bin gewiß, man wird die Grundlosigkeit der Anklage sehr bald einsehen.«
»Das ist auch meine Ansicht und ich sehe ohne besondere Unruhe der Haussuchung entgegen.«
»Wie, eine Haussuchung?« wiederholte Fräulein von Calprenède erstaunt.
»Das heißt, die Polizeibeamten werden hierherkommen, unsere Schränke durchwühlen, um zu sehen, ob sie den Schmuck des Herrn Matapan nicht finden.«
»Und Sie werden das dulden?«
»Ich muß wohl; wenn ich mich widersetzte, so würde man Verdacht schöpfen,« sagte der Graf und spielte mit dem Schlüssel, der in einem kleinen Schränkchen steckte.
Unter dem leichten Drucke sprang das Thürchen plötzlich aus, und der Graf erblickte plötzlich in einem Fache Brillanten, die er gewiß nicht hineingelegt hatte. Er nahm sie in die Hand; es war das gestohlene Opalcollier. Ein Zweifel war nicht möglich, denn an der zerrissenen Kette fehlte ein Stein.
Arlette stieß einen Schrei aus und fiel ohnmächtig in die Arme ihres Vaters, der die unseligen Edelsteine entsetzt von sich warf.
»Er war es, er war es doch! O! – ich werde ihn töten,« sagte der unglückliche Vater mit gebrochener Stimme.