
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Hochtiere.
Affen im allgemeinen. Menschenaffen.
Wagler nennt die Affen » umgewandelte Menschen« und wiederholt damit die uralte und doch immer neue Ansicht aller Völker, die mit diesen fratzenhaften Wesen verkehrt haben und verkehren; das Gegenteil seines Ausspruches würde heutzutage gültigen Anschauungen entsprochen haben. Nicht die Affen sind umgewandelte Menschen, sondern diese vollkommener entwickelte Affen oder, falls ein solcher Ausdruck anstoßen sollte, höher stehende Handtiere.
Von den alten Völkern scheinen nur die Ägypter und Inder eine gewisse Zuneigung für die Affen gezeigt zu haben. Die alten Ägypter, auf deren Affenwürdigung ich zurückkommen werde, gruben ihre Bildnisse in den unvergänglichen Porphyr ein und schufen nach ihnen die Abbilder ihrer Götter; die alten Inder erbauten ihnen, wie ihre Nachkommen es heute noch tun, Häuser und Tempel. Salomo ließ sich zwar ebenfalls Affen aus Ophir kommen, und die Römer hielten solche zu ihrem Vergnügen, studierten, ihren Leib zergliedernd, an ihnen den inneren Bau des Menschen, freuten sich der drolligen Nachahmungssucht der Tiere, ließen sie wohl auch mit Raubtieren kämpfen, befreundeten sich aber nie recht mit ihnen und verkannten, ebensowenig wie Salomo, das »Tier« in ihnen. Die Araber gehen noch weiter; denn sie sehen in ihnen Söhne, Enkel, Urenkel und Nachkommen des Ungerechten, denen nichts heilig, nichts achtbar, nichts zu gut und nichts zu schlecht ist, die keine Freundschaft halten mit andern Geschöpfen des Herrn und verflucht sind seit dem Tage, an dem sie durch das Strafgericht des Gerechten aus Menschen zu Affen verwandelt wurden, von Allah Verdammte, die jetzt das Bild des Teufels und des Adamssohnes in wunderlicher Vereinigung zur Schau tragen.
Wir denken nicht viel anders als die Araber. Anstatt unserer nächsten Verwandten und vielleicht Vorgänger wollen auch wir kaum mehr in ihnen erkennen als Zerrbilder unserer selbst und schleudern das Urteil der Verdammnis auf sie. Daraus erklärt sich mindestens teilweise der mit gelindem Entsetzen gemischte Abscheu aller nicht naturwissenschaftlich Gebildeten oder Verbildeten vor den Folgerungen, zu denen Darwins Lehre Veranlassung gegeben hat. Der Mensch, leiblich ein veredelter Affe, geistig ein Halbgott, will nur das letztere sein und versucht mit kindischer Ängstlichkeit seine nächsten Verwandten von sich abzustoßen, als könne er durch sie irgendwie beeinträchtigt werden.
Es ist beachtenswert, daß wir bloß diejenigen Affen wirklich anmutig finden, die die wenigste Ähnlichkeit mit den Menschen zeigen, während uns alle diejenigen Arten, bei denen diese Ähnlichkeit schärfer hervortritt, geradezu abscheulich erscheinen. Unser Widerwille gegen die Affen begründet sich ebensowohl auf deren leibliche wie geistige Begabungen. Sie ähneln dem Menschen zu viel und zu wenig. In der Gestalt des Menschen zeigt sich das vollendete Ebenmaß, in der Affengestalt gibt sich oft widerliche Fratzenhaftigkeit kund. Ein einziger Blick auf das Knochengerüst des Menschen und das des Affen zeigt den in beider Anlage begründeten Unterschied, der jedoch keineswegs ein durchgreifender ist, vielmehr nur als ein bedingter, nicht aber unbedingter aufgefaßt werden darf. Jedenfalls ist es unrichtig, die Affen als mißgebildete Geschöpfe zu bezeichnen, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt und auch von mir selbst geschehen ist. Es gibt bildschöne, und es gibt sehr häßliche Affen; mit dem Menschen aber ist dies nicht im geringsten anders: in einem Eskimo, Buschmann oder Neuholländer sehen wir auch kein Vorbild Apollos. An und für sich sind die Affen sehr wohl ausgestattete Tiere; mit dem höchststehenden Menschen verglichen, erscheinen sie als Zerrbilder des vollendeteren Wesens. Doch hüte man sich vor aller Überschwenglichkeit; denn der Affenmensch spiegelt sich selbst in den Augen des salbadernden Menschenverherrlichers als Bruder des Menschenaffen.
Die Leibesgröße des Affen spielt in weiten Grenzen: der Gorilla kommt einem starken Manne, das Seidenäffchen einem Eichhorne gleich. Auch der Bau des Leibes ist sehr verschieden, wie die im allgemeinen richtigen Bezeichnungen »Menschen-, Hund- und Eichhornaffe« besser als lange Beschreibungen dartun. Einige sind massig, andere schlank, diese plump, jene zierlich gebaut; die einen haben stämmige, die andern schmächtige Gliedmaßen, die meisten lange, einige kurze, einzelne gar keine Schwänze. Ebenso verhält es sich mit der Behaarung: bei diesen deckt ein spärliches Haarkleid, bei jenen ein ziemlich dichter Pelz den Leib. Die Farben des Felles, im ganzen düster, können doch zuweilen lebhaft und ansprechend sein, während die der nackten Teile oft geradezu grell, für unsere Augen abstoßend erscheinen.
Die Übereinstimmung des inneren Leibesbaues der Affen ist größer als man, von ihrer äußeren Erscheinung folgernd, vermuten möchte. Das Gerippe enthält 12 bis 16 Brustwirbel, 4 bis 9 Lendenwirbel, 2 bis 5 Kreuzbein- und 3 bis 33 Schwanzwirbel; das Schlüsselbein ist stark; die Unterarmknochen sind getrennt und sehr beweglich, die Handwurzelknochen gestreckt, die der Finger aber teilweise verkümmert, während an den Füßen gerade der entgegensetzbare Daumen auffällt. Der Schädel ist sehr verschieden gestaltet, je nachdem der Schnauzenteil vor- oder zurücktritt und der Hirnkasten sich erweitert; die Augen liegen vorn, in stark umrandeten Knochenhöhlen, und die Jochbogen stehen nicht bedeutend vom Schädel ab. Das Gebiß enthält alle Zahnarten in ununterbrochenen Reihen, d. h. ohne Lücken zwischen den verschiedenen Zähnen: vier Schneidezähne, zwei oft außerordentlich und wie bei Raubtieren entwickelte Eckzähne, zwei oder drei Lück- und drei Mahlzähne in jedem Kiefer pflegen es zu bilden. Unter den Muskeln verdienen die der Hände unsere Beachtung, weil sie im Vergleiche zu denen der Menschenhand außerordentlich vereinfacht erscheinen. Der Kehlkopf befähigt nicht zu einer Sprache im menschlichen Sinne; die sackartigen Erweiterungen der Luftröhre dagegen begünstigen gellende, heulende Laute. Besonderer Erwähnung wert sind die Backentaschen, die einige Affensippen besitzen: Ausbuchtungen der Mundhöhlenwände, die durch eine hinter dem Mundwinkel gelegene Öffnung mit der Mundhöhle in Verbindung stehen und zur zeitweiligen Aufspeicherung der Nahrung dienen. Bei den Meerkatzen, Makaken und Pavianen erreichen sie die höchste Entwicklung und ziehen sich tiefer herab als der Unterkiefer; bei den Schlankaffen verringern sie sich bis auf ein sehr kleines Säckchen: den Menschenaffen wie denen der Neuen Welt fehlen sie gänzlich.
Man nennt die Affen oft auch Vierhänder und stellt ihnen die Zweihänder oder Menschen wegen des abweichenden Hand- und Fußbaues als grundverschiedene Tiere gegenüber. Beides ist falsch: die Affen sind keine Vierhänder, und die Zweihänder unterscheiden sich durch ihren Hand- und Fußbau wohl merklich, aber nicht grundsätzlich. Vergleicht man Menschen- und Affenhand und Menschen- und Affenfuß, so wird man zunächst erkennen müssen, daß die einen wie die andern nach denselben Grundgesetzen gebaut sind. Selbstverständlich weichen beide Glieder von den entsprechenden des Menschen ab, aber die Verschiedenheit der Entwicklung darf wohl auf die Verschiedenheit der Verwendung zurückgeführt werden.
Ungeachtet der großen Ähnlichkeit zwischen Mensch und Affe lassen sich Unterscheidungsmerkmale aufstellen; nur darf man denselben nicht ausnahmsweise ein größeres Gewicht beilegen, als man sonst bei Vergleichung verschiedener Säugetiere zu tun pflegt. Der hagere, behaarte Leib ohne Gesäß, die langen Arme, die dünnen Beine ohne Waden, die Gesäßschwielen bei einem großen Teile der Arten, der vielen zukommende lange Schwanz und vor allem der tierische Kopf mit dem rückliegenden und kleinen Schädel und den eingezogenen dünnen Lippen sind Kennzeichen der Affen, die als gegensätzliche von denen der Menschen aufgefaßt werden dürfen.
Oken beschreibt die Affen im Vergleiche zu dem Menschen mit folgenden Worten: »Die Affen sind dem Menschen ähnlich in allen Unsitten und Unarten. Sie sind boshaft, falsch, tückisch, diebisch und unanständig, sie lernen eine Menge Possen, sind aber ungehorsam und verderben oft den Spaß mitten im Spiele, indem sie dazwischen einen Streich machen wie ein tölpelhafter Hanswurst. Es gibt keine einzige Tugend, die man einem Affen zuschreiben könnte, und noch viel weniger irgendeinen Nutzen, den sie für den Menschen hätten. Wachestehen, Aufwarten, verschiedene Dinge holen, tun sie bloß so lange, bis sie die Narrheit anwandelt. Sie sind nur die schlechte Seite des Menschen, sowohl in leiblicher wie in sittlicher Hinsicht.«
Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Schilderung im wesentlichen nicht unrichtig ist. Wir wollen jedoch auch gegen die Affen gerecht sein und dürfen deshalb wirklich gute Seiten derselben nicht vergessen. Über ihre geistigen Eigenschaften in einem abzuurteilen, ist nicht gerade leicht, weil die ganze Sippschaft zu viele sich widersprechende Eigentümlichkeiten zeigt. Man muß freilich anerkennen, daß die Affen boshaft, listig, tückisch, zornig oder wütend, rachsüchtig, sinnlich in jeder Hinsicht, zänkisch, herrsch- und raufsüchtig, reizbar und grämlich, kurz leidenschaftlich sind, darf aber auch die Klugheit und Munterkeit, die Sanftheit und Milde, die Freundlichkeit und Zutraulichkeit gegen den Menschen, ihre Unterhaltungsgaben, ihre erheiternde Ernsthaftigkeit, ihre Geselligkeit, ihren Mut und ihr Einstehen für das Wohl der Gesamtheit, ihr kräftiges Verteidigen der Gesellschaft, der sie angehören, selbst gegen ihnen überlegene Feinde, und ihre oft sehr unschuldige Lust an Spielereien und Neckereien nicht vergessen. Und in einem Punkte sind sie alle groß: in ihrer Liebe gegen ihre Kinder, in dem Mitleiden gegen Schwache und Unmündige nicht allein ihrer Art und Familie, sondern selbst anderer Ordnungen, ja sogar anderer Klassen des Tierreichs. Der Affe in seiner sinnlichen Liebe ist ein Scheusal: er kann aber in seiner sittlichen Liebe manchem Menschen ein Vorbild sein!
Die geistige Ausbildung, die die Affen erreichen können, erhebt sie zwar nicht so hoch über die übrigen Säugetiere, mit Ausschluß des Menschen, stellt sie aber auch nicht so tief unter den Menschen, als von der einen Seite angenommen, von der andern behauptet worden ist. Die Hand, die der Affe besitzt, gewährt ihm vor andern Tieren so große Vorzüge, daß seine Leistungen teilweise größer erscheinen, als sie sind. Er ist gelehrig, und der Nachahmungstrieb, den viele seines Geschlechtes besitzen, erleichtert es ihm, irgendeine Kunst oder Fertigkeit zu erlernen. Deshalb eignet er sich nach kurzer Übung die verschiedenartigsten Kunststücke an, die einem Hunde z. B. nur mit großer Mühe gelingen. Allein man darf nie verkennen, daß er das ihn Gelehrte immer nur mit einem gewissen Widerstreben, niemals aber mit Freude und Bewußtsein ausführt. Es hält nicht schwer, einen Affen daran zu gewöhnen, mit Messer und Gabel zu essen, aus Gläsern zu trinken, Kleider anzuziehen, ihn zum Drehen des Bratspießes oder zum Wasserholen usw. abzurichten; allein er wird solches nie mit derselben Sorgfalt, ich möchte sagen Gewissenhaftigkeit, tun wie ein wohlerzogener Hund. Dafür haben wir den Hund aber auch Jahrtausende hindurch gepflegt, gelehrt, unterrichtet und ein ganz anderes Geschöpf aus ihm gebildet, als er war, während der Affe keine Gelegenheit hatte, mit dem Menschen in nähere Verbindung zu kommen. Was Affen leisten können, wird aus dem Nachfolgenden hervorgehen und damit der Beweis geliefert werden, daß man Recht hat, sie zu den klügsten aller Tiere zu zählen. Ein hoher Grad von Überlegung ist ihnen nicht abzusprechen. Sie besitzen ein vortreffliches Gedächtnis und wissen ihre Erfahrungen verständig zu benutzen, mit wirklicher Schlauheit und List ihre Vorteile immer wahrzunehmen, bekunden überraschendes Geschick in der Verstellung und lassen es sich oft nicht merken, welche heillose Absicht sie in ihrem Gehirne ausbrüten, wissen sich Gefahren gewandt zu entziehen und finden trefflich die Mittel auf, gegen sie sich zu wahren. Auch Gemüt muß ihnen zuerkannt werden. Sie sind der Liebe und Zuneigung fähig, besitzen Dankbarkeit und äußern ihr Wohlwollen gegen diejenigen, die ihnen Gutes taten. Ein Pavian, den ich besaß, bewahrte mir unter allen Umständen seine unverbrüchliche Zuneigung, obgleich er leicht mit jedermann Freundschaft schloß. Sein Herz schien jedoch bloß für die Liebe zu mir Raum zu haben; denn er biß seinen eben gewonnenen Freund, sobald ich mich ihm und diesem nahte. Eine ähnliche Engherzigkeit habe ich bei allen Arten der Ordnung, die ich beobachten konnte, wahrgenommen. Die Liebe, die alle Affen gegen ihresgleichen betätigen, spricht ebenfalls für ein tiefes Gemüt. Sehr viele Tiere verlassen die Kranken ihres Verbandes, einige töten, andere fressen sie sogar: die Affen versuchen selbst ihre Toten wegzuschleppen. Doch ist ihre Zuneigung oder Liebe im allgemeinen ebenso wetterwendisch, wie sie selbst es sind. Man braucht bloß das Affengesicht zu studieren, um sich hierüber klar zu werden. Seine Beweglichkeit ist unglaublich groß. In ebenso rascher wie unregelmäßiger Folge durchlaufen es alle nur denkbaren Ausdrücke: Freundlichkeit und Wut, Ehrlichkeit und Tücke, Lüsternheit, Genußsucht und andere Eigenschaften und Leidenschaften mehr. Und doch will es scheinen, als könne das Gesicht den Kreuz- und Quersprüngen des Affengeistes kaum folgen.
Hervorgehoben zu werden verdient, daß alle Affen, trotz ihres Verstandes, auf die albernste Weise überlistet und getäuscht werden. Ihre Leidenschaften tragen häufig einen vollständigen Sieg über ihre Klugheit davon. Sind jene rege geworden, so achten sie auf die plumpeste Falle nicht mehr und vergessen ihre Sicherheit gänzlich über der Absicht, ihrer Gier zu frönen. Die Malaien höhlen harte Kürbisse durch eine kleine Öffnung aus und füllen sie mit Stücken von Nahrung, namentlich mit Zucker oder mit Früchten, die die Affen gern fressen. Diese zwängen, um zu ihrer Lieblingsspeise zu gelangen, ihre Hände durch die Öffnung und erfassen eines der Stücke mit solcher Gier, daß sie sich lieber fangen als das einmal Erfaßte wieder loslassen. In solcher Weise beherrschen die Leidenschaften auch die klügsten Affen – just wie so manche Menschen. Ob man deshalb berechtigt ist, ihren Verstand zu unterschätzen, möchte zu bezweifeln sein.
Die Affen waren in früheren Schöpfungsabschnitten über einen größeren Teil der Erde verbreitet als gegenwärtig; denn sie hausten im südlichen Europa, in Frankreich und England. Gegenwärtig beschränkt sich ihr Vaterland auf die warmen Teile der Erde. Gleichmäßige Wärme scheint Lebensbedingung für sie zu sein. Einige Paviane steigen zwar ziemlich hoch im Gebirge empor und ertragen geringere Wärmegrade, als man vermuten möchte; fast alle übrigen Affen aber sind gegen Kälte höchst empfindlich. Jeder Erdteil besitzt seine eigenen Arten, Asien mit Afrika wenigstens eine gemeinschaftlich. In Europa kommt nur eine Art vor, und zwar in einem einzigen Trupp, der an den Felsenwänden Gibraltars unter dem Schutze der Besatzung dieser Festung lebt. Gibraltar ist übrigens nicht der nördlichste Ort, der Affen besitzt; denn ein japanischer Makake geht noch weiter nach Norden hinauf, etwa bis zum 37. Grade nördlicher Breite. Nach Süden zu reichen die Affen ungefähr bis zum 35. Grade südlicher Breite, doch nur in der Alten Welt, während sich der Verbreitungskreis der Neuweltsaffen bloß vom 28. Grade nördlicher Breite bis zum 29. Grade südlicher Breite erstreckt.
Der Verbreitungsgrad einer Art ist ziemlich beschränkt, obwohl es vorkommt, daß in entfernten Ländern eines und desselben Erdteils gewisse, sich sehr ähnliche Arten einander vertreten.
Die Mehrzahl der Affen gehört dem Walde an; nur ein kleiner Teil lebt aus felsigen Gebirgen. Ihre Ausrüstung weist sie auf das Klettern hin: Bäume bilden daher ihren Lieblingsaufenthalt. Alle Felsenaffen bewegen sich aus diesen ungeschickt, besteigen sie auch bloß im Notfalle.
Die Affen gehören unstreitig zu den lebendigsten und beweglichsten Säugetiere. Solange sie auf Nahrungserwerb ausgehen, sind sie nicht einen Augenblick lang ruhig. Schon die Mannigfaltigkeit ihrer Nahrung bedingt dies. Ihnen ist alles Genießbare recht. Früchte, Zwiebeln, Knollen, Wurzeln, Sämereien, Nüsse, Knospen, Blätter und saftige Pflanzenstengel bilden den Hauptteil ihrer Mahlzeiten; ein Kerbtier aber wird auch nicht verschmäht, und Eier, junge Vögelchen usw. sind Leckerbissen. Da gibt es nun immer etwas zu begucken, zu erhaschen oder abzupflücken, zu beriechen und zu kosten, um es entweder zu genießen oder auch wegzuwerfen. Solche Untersuchungen erfordern viel Bewegung; deshalb ist die ganze Bande niemals ruhig. Die Sorge um das liebe Futter scheint groß zu sein: sogar der gewaltige Elefant soll seine Prügel bekommen, wenn er so dreist ist, an der Affentafel – und das ist der ganze, große Wald – schmausen zu wollen. Von Eigentum haben die Schelme äußerst mangelhafte Begriffe: »Wir säen, aber die Affen ernten«, sagen die Araber Ost-Sudans. Felder und Gärten werden von allen Affen als höchst erquickliche Orte angesehen und nach Möglichkeit gebrandschatzt. Jeder einzelne Affe verwüstet, wenn er dies tun kann, zehnmal mehr, als er frißt. Gegen solche Spitzbuben hilft weder Schloß noch Riegel, weder Hag noch Mauer; sie öffnen Schlösser und steigen über Mauern hinweg, und was nicht gefressen werden kann, wird wenigstens mitgenommen, Gold und Edelsteine auch. Man muß eine Affenherde selbst gesehen haben, wenn sie auf Raub auszieht, um begreifen zu können, daß ein Landwirt sich halb tot über sie ärgern kann. Für den Unbeteiligten ist die Beobachtung der sich während des Raubzuges in ihrer ganzen Regsamkeit zeigenden Geschöpfe freilich ein höchst unterhaltendes Schauspiel. Alle Künste gelten. Es wird gelaufen, gesprungen, geklettert, gegaukelt, im Notfalle auch geschwommen. Die Künsteleien auf dem Gezweige übersteigen allen Glauben. Nur die Menschenaffen und Paviane sind schwerfällig, die übrigen vollendete Gaukler: sie scheinen fliegen zu können. Sätze von sechs bis acht Meter Sprungweite sind ihnen Spaß; von dem Wipfel eines Baumes springen sie zehn Meter tief hernieder auf das Ende eines Astes, beugen denselben durch den Stoß tief herab und geben sich, während der Ast zurückschnellt, noch einen mächtigen Schwung, strecken Schwanz oder Hinterbeine als Steuer lang aus, und durchfliegen wie ein Pfeil die Luft. Sofort nach glücklicher Ankunft geht es weiter, auch durch die fürchterlichsten Dornen, als wandele man auf getäfeltem Fußboden. Eine Schlingpflanze ist eine höchst bequeme Treppe für die Affen, ein Baumstamm ein gebahnter Weg. Sie klettern vor- und rückwärts, oben auf einem Aste hin oder unten an ihm weg; wenn man sie in einen Baumwipfel wirft, erfassen sie mit einer Hand ein Zweiglein und hängen an ihm geduldig, bis der Ast zur Ruhe kommt, steigen dann an ihm empor und so unbefangen weiter, als hätten sie sich stets aus ebenem Boden befunden. Bricht der Zweig, so fassen sie im Fallen einen zweiten, hält dieser auch nicht, so tut es doch ein dritter, und im Notfalle bringt sie ein Sturz auch nicht außer Fassung. Was sie mit der Vorderhand nicht ergreifen können, fassen sie mit der Hinterhand oder die neuweltlichen Arten mit dem Schwänze. Dieser wird von allen als Steuer angewandt, wenn weite Sprünge ausgeführt werden sollen, dient auch sonst noch zu den verschiedensten Zwecken, sei es selbst als eine Leiter für den nächsten. Bei den Neuweltsaffen wird er zur fünften – nein, zur ersten Hand. An ihm hängt sich der ganze Affe auf und wiegt und schaukelt sich nach Belieben; mit ihm holt er sich Nahrung aus Spalten und Ritzen; ihn benutzt er als Treppe für sich selbst; er dient anstatt der Hängematte, wenn sein Eigner Mittagsruhe halten will.
Die Leichtigkeit und Zierlichkeit ihrer Bewegungen zeigt sich übrigens nur beim Klettern. In dieser Beziehung leisten selbst die Menschenaffen Erkleckliches, obgleich sie, wenigstens die höher begabten, mehr nach Art eines Menschen als nach Art anderer Ordnungsverwandten klettern. Der Gang der Affen ist immer mehr oder weniger plump und schwerfällig. Meerkatzen, Makaken, Roll- und Krallenaffen gehen noch am besten, schon die Paviane aber humpeln in spaßhafter Weise dahin und bewegen ihren dicken Hintern dabei so ausdrucksvoll, daß es aussteht, als wollten sie einen deutschen Bauerntanz aufführen. Der Gang der Menschenaffen ist kaum noch Gang zu nennen. Während jene mit der ganzen Sohle auftreten, stützen diese sich auf die eingeschlagenen Knöchel der Finger ihrer Hände und werfen den Leib schwerfällig vorwärts, so daß die Füße zwischen die Hände zu stehen kommen. Dabei werden letztere seitlich aufgesetzt, und die Tiere stützen sich also auf die eingeschlagene Faust der Hände und auf die Außenseite oder äußere Kante der Füße, deren Mittelzehen oft ebenfalls unter die Sohle gekrümmt werden, wogegen die große, weit abstehende Zehe als wesentliche Stütze des Leibes dient. Nur die Gibbons scheinen nicht imstande zu sein, in solcher Weise zu laufen, gehen vielmehr auf dem Boden in der Regel aufrecht, strecken dabei alle Zehen aus, spreizen die Daumenzehe bis zu einem rechten Winkel vom Fuße ab, und halten sich mittels der ausgebreiteten Arme im Gleichgewichte, recken dieselben auch um so weiter aus, je schneller sie forttrippeln. Nach eigenen Erfahrungen vermag der Tschego mit geringerer Anstrengung zu voller Höhe sich aufzurichten und gehend länger aufgerichtet sich zu erhalten als jeder andere Affe, dessen Bewegungen ich beobachten konnte. Auch viele Hunds-, Neuwelts- und selbst Krallenaffen vermögen längere oder kürzere Strecken aufrecht gehend zurückzulegen; alle aber fallen, wenn sie das Gleichgewicht nicht länger erhalten können, auf die Vorderglieder nieder und gehen bei ernsterem Laufe, beispielsweise wenn sie verfolgt werden oder zum Kampfe schreiten wollen, stets auf allen Vieren.
Einige Sippen der Ordnung schwimmen vortrefflich, andere gehen im Wasser unter wie Blei. Zu ersteren gehören die Meerkatzen, von denen ich einige mit der größten Schnelligkeit und Sicherheit über den Blauen Nil schwimmen sah, zu den letzteren die Paviane und vielleicht auch die Brüllaffen; von jenen ertrank uns einer, als wir ihn baden wollten. Die Schwimmunkundigen scheuen das Wasser in hohem Grade: man hat eine fast verhungerte Familie von Brüllaffen auf einem Baume gefunden, dessen Fuß durch Überschwemmung unter Wasser gesetzt worden war, ohne daß die Affen es gewagt hätten, nach andern, kaum sechzig Schritte entfernten Bäumen sich zu retten. Ulloa, der über brasilianische Tiere schrieb, hat daher für die armen, schwimmunkundigen Tiere eine hübsche Brücke erfunden, die gewiß sehr gute Dienste leisten würde, wenn – die Affen sie benutzen wollten. Er erzählt, daß je ein Brüllaffe mit seinen Händen den Schwanz eines andern packe, und daß in dieser Weise die ganze Gesellschaft eine lange Kette aus lauter Affengliedern bilde, die vermittels des Schwanzes des Endgliedaffen am Wipfel eines Unterbaumes befestigt und hierauf durch vereinigte Kraft aller Glieder in Schwingungen gesetzt werde, bis das Vorderglied den Zweig eines Baumes des jenseitigen Ufers erfassen und sich dort festhalten könne. Auf der solchergestalt hergerichteten Brücke sollen nun zuerst die Jungen und Schwächeren auf das andere Ufer übersetzen, dann aber der Vorderaffe die ganze Kette, deren Endglied seine Klammer löst, zu sich hinüberziehen. Prinz von Wied, ein sehr gewissenhafter Beobachter, nennt diese Erzählung bei ihrem rechten Namen: »eine spaßhafte Fabel«.
Alle Affen sind außerordentlich starkgliedrig und heben Lasten, die verhältnismäßig für unsere schwachen Arme zu schwer sein würden: ein Pavian, den ich besaß, hing sich viele Minuten lang an einem Arme auf und hob seinen dicken Leib daran in die Höhe, so hoch es der Arm zuließ.
Das gesellige Leben der Affen ist ein für den Beobachter sehr anziehendes. Wenig Arten leben einsiedlerisch, die meisten schlagen sich in Banden zusammen. Von diesen erwählt sich jede einzelne ihren festen Wohnsitz, der größeren oder geringeren Umfang haben kann. Die Wahl fällt regelmäßig auf Gegenden, die in jeder Hinsicht günstig scheinen. Etwas zu knacken und zu beißen muß es geben, sonst wandert die Bande aus. Waldungen in der Nähe menschlicher Ansiedlungen sind Paradiese: der verbotene Baum in ihnen kümmert die Affen nicht, wenn nur die Apfel auf ihm gut sind. Mais- und Zuckerrohrfelder, Obst-, Melonen-, Bananen- und Pisanganpflanzungen gehen über alles andere; Dorfschaften, in denen jeder, der die unverschämten Spitzbuben züchtigt, den Aberglauben der Bewohner zu fürchten hat, sind auch nicht übel. Wenn sich die Bande erst über den Wohnort geeinigt hat, beginnt das wahre Affenleben mit all seiner Lust und Freude, seinem Kampf und Streit, seiner Not und Sorge. Das stärkste oder älteste, also befähigtste männliche Mitglied einer Herde schwingt sich zum Zugführer oder Leitaffen auf. Diese Würde wird ihm nicht durch das allgemeine Stimmrecht übertragen, sondern erst nach sehr hartnäckigem Kampfe und Streite mit andern Bewerbern, d. h. mit sämtlichen übrigen alten Männchen, zuerteilt. Die längsten Zähne und die stärksten Arme entscheiden. Wer sich nicht gutwillig unterordnen will, wird durch Bisse und Püffe gemaßregelt, bis er Vernunft annimmt. Dem Starken gebührt die Krone: in seinen Zähnen liegt seine Weisheit. Der Leitaffe verlangt und genießt unbedingten Gehorsam, und zwar in jeder Hinsicht. Ritterliche Artigkeit gegen das schwächere Geschlecht übt er nicht: im Sturme erringt er der Minne Sold. Das jus primae noctis gilt ihm heute noch. Er wird Stammvater eines Volkes, und sein Geschlecht mehrt sich, gleich dem Abrahams, Isaaks und Jakobs, »wie der Sand am Meere«. Kein weibliches Glied der Bande darf sich einer albernen Liebschaft mit irgendeinem Grünschnabel hingeben. Seine Augen sind scharf, und seine Zucht ist streng; er versteht in Liebessachen keinen Spaß. Auch die Äffinnen, die sich oder besser ihn vergessen sollten, werden gemaulschellt und zerzaust, daß ihnen der Umgang mit andern Helden der Bande gewiß verleidet wird; der betreffende Affenjüngling, der die Haremsgesetze des auf sein Recht stolzen Sultans verletzt, kommt noch schlimmer weg. Die Eifersucht macht diesen furchtbar. Es ist auch töricht von einer Affin, solche Eifersucht heraufzubeschwören; denn der Leitaffe ist Manns genug für sämtliche Äffinnen seiner Herde. Wird diese zu groß, dann sondert sich unter der Führung eines inzwischen stark genug gewordenen Mitbruders ein Teil vom Haupttrupp ab und beginnt nun für sich den Kampf und den Streit um die Oberherrschaft in der Leitung der Herde und in der Liebe. Kampf findet immer statt, wo mehrere nach gleichem Ziele streben; bei den Affen vergeht aber sicher kein Tag ohne Streit und Zank. Man braucht eine Herde nur kurze Zeit zu beobachten und wird gewiß bald den Streit in ihrer Mitte und seine wahre Ursache kennenlernen.
Im übrigen übt der Leitaffe sein Amt mit Würde aus. Schon die Achtung, die er genießt, verleiht ihm Sicherheit und Selbständigkeit, die seinen Untergebenen fehlt; auch wird ihm von diesen in jeder Weise geschmeichelt. So sieht man, daß selbst die Äffinnen sich bemühen, ihm die höchste Gunst, die ein Affe gewähren kann, zuteil werden zu lassen. Sie beeifern sich, sein Haarkleid stets von lästigen Schmarotzern möglichst rein zu halten, und er läßt sich diese Huldigung mit dem Anstände eines Paschas gefallen, dem eine Lieblingssklavin die Füße kraut. Nach neueren Beobachtungen soll das sogenannte Sichlausen der Affen dem Genuß ihrer Hautsekretion dienen. Von Ungeziefer sind die Affen ziemlich frei. Dafür sorgt auch er treulich für die Sicherheit seiner Bande und ist deshalb in beständiger Unruhe. Nach allen Seiten hin sendet er seine Blicke, keinem Wesen traut er, und so entdeckt er auch fast immer rechtzeitig eine etwaige Gefahr.
Die Affensprache darf ziemlich reichhaltig genannt werden; wenigstens verfügt jeder Affe über sehr wechselnde Laute für verschiedenartige Erregungen. Auch der Mensch erkennt bald die Bedeutung dieser Laute. Der Ausruf des Entsetzens, der stets die Mahnung zur Flucht in sich schließt, ist besonders bezeichnend. Er läßt sich allerdings sehr schwer beschreiben und noch weniger nachahmen; man kann eben nur sagen, daß er aus einer Reihe kurzer, abgestoßener, gleichsam zitternder und mißtöniger Laute besteht, deren Wert der Affe durch die Verzerrung des Gesichts noch besonders erläutert. Sobald dieser Warnungston laut wird, nimmt die Herde eiligst die Flucht. Die Mütter rufen ihre Kinder zusammen; diese hängen im Nu an ihr fest, und mit der süßen Bürde beladen, eilen sie so schnell als möglich nach dem nächsten Baume oder Felsen. Der alte Affe zieht voran und bezeichnet den Weg, der stets in der kühnsten Weise ausgeführt wird. Erst wenn er sich ruhig zeigt, sammelt sich die Herde und beginnt dann nach kurzer Zeit den Rückweg, um die unterbrochene Plünderung wieder aufzunehmen.
Jedoch nicht alle Affen flüchten vor Feinden; die stärkeren stellen sich vielmehr selbst furchtbaren Raubtieren und dem noch gefährlicheren Menschen kühn zur Wehr und lassen sich auf Kämpfe ein, deren Ausgang für den Angreifer mindestens zweifelhaft ist. Alle größeren Affen, namentlich Menschenaffen und Paviane, besitzen in ihren Zähnen so furchtbare Waffen, daß sie es mit einem Feinde Wohl aufnehmen können, zumal sie im Kampfe außerordentlich treu und fest zusammenhalten. Weibliche Affen lassen sich nur, wenn sie sich ihrer Haut wehren oder ihr Junges verteidigen müssen, in Streit ein, betätigen dann aber ebenso große Tapferkeit wie die Männchen. Die meisten Arten kämpfen mit Händen und Zähnen: sie kratzen und beißen; allein es wird von vielen Seiten einstimmig versichert, daß sie auch mit abgebrochenen Baumästen sich verteidigen, und es ist gewiß, daß sie Steine, Früchte, Holzstücke und dergleichen von oben herab auf ihre Gegner schleudern. Schon mit dem Pavian beginnt ohne Feuergewehr kein Eingeborener Kampf und Streit; dem Gorilla gegenüber wird er nicht einmal durch das Feuergewehr in allen Fällen zum überlegenen Gegner. Jedenfalls ist die beispiellose Wut der Affen, die deren Stärke noch bedeutend steigert, sehr zu fürchten, und die Gewandtheit, die sie alle besitzen, nimmt ihrem Feinde nur zu häufig die Gelegenheit, ihnen einen entscheidenden Schlag beizubringen.
In der Gefangenschaft halten fast alle Affenarten gute Freundschaft; doch bildet sich bald ein ähnliches Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis wie unter einer freilebenden Bande. Der Stärkste erringt auch hier die Oberherrschaft und knechtet und peinigt den Schwächeren so lange, bis dieser sich fügt. Zarte Rücksicht zu nehmen, ist nicht der Affen Art; Übermut macht sich jederzeit geltend, selbst inniggeliebten Pfleglingen gegenüber. Größere Arten, und zwar die Männchen ebensowohl wie die Weibchen, nehmen sich der kleineren, hilfloseren regelmäßig an; starke Äffinnen zeigen selbst Gelüste nach kleinen Menschenkindern oder allerlei jungen Tieren, die sich tragen lassen. So abscheulich der Affe sonst gegen Tiere ist, so liebenswürdig beträgt er sich gegen Tierjunge oder Kinder, am liebenswürdigsten natürlich gegen die eigenen, und daher ist die Affenliebe sprichwörtlich geworden.
Die Affen gebären ein Junges, wenige Arten zwei. Dies ist regelmäßig ein kleines, häßliches Geschöpf, ausgestattet mit doppelt so lang erscheinenden Gliedmaßen, wie seine Eltern sie besitzen, und einem Gesichte, das, seiner Falten und Runzeln halber, dem eines Greises ähnlicher sieht als dem eines Kindes. Dieser Wechselbalg ist aber der Liebling der Mutter, und sie hätschelt und Pflegt ihn in rührender oder – lächerlicher Weise; denn die Liebe streift, mindestens in unsern Augen, an das Lächerliche. Das Kind hängt sich bald nach seiner Geburt mit beiden Vorderhänden an dem Halse, mit beiden Hinterhänden aber an den Weichen der Mutter fest, in der geeignetsten Lage, die lausende Mutter nicht zu behelligen und ungestört zu saugen. Ältere Affenkinder springen bei Gefahr auch wohl auf Schulter und Rücken ihrer Eltern.
Anfangs ist der Affensäugling gefühl- und teilnahmlos, um so zärtlicher aber die Mutter. Sie hat ohne Unterlaß mit ihm zu tun; bald leckt sie ihn, bald laust sie ihn wieder, bald drückt sie ihn an sich, bald nimmt sie ihn in beide Hände, als wolle sie sich an seinem Anblicke weiden, bald legt sie ihn an die Brust, bald schaukelt sie ihn hin und her, als wolle sie ihn einwiegen. Nach einiger Zeit beginnt der junge Affe mehr oder weniger selbständig zu werden, verlangt namentlich ab und zu ein wenig Freiheit. Diese wird ihm gewährt. Die Alte läßt ihn aus ihren Armen, und er darf mit andern Affenkindern scherzen und spielen; sie aber wendet keinen Blick von ihm und hält ihn in beständiger Aufsicht, geht ihm übrigens willig auf allen Schritten nach und erlaubt ihm, was sie gewähren kann. Bei der geringsten Gefahr stürzt sie auf ihn zu, läßt einen eigentümlichen Ton hören und ladet ihn durch denselben ein, sich an ihre Brust zu flüchten. Etwaigen Ungehorsam bestraft sie mit Kniffen und Püffen, oft mit förmlichen Ohrfeigen. Doch kommt es selten dazu; denn das Affenkind ist so gehorsam, daß es manchem Menschenkinde zum Vorbilde dienen könnte, und gewöhnlich genügt ihm der erste Befehl seiner Mutter. In der Gefangenschaft teilt sie, wie ich mehrfach beobachtet habe, jeden Bissen treulich mit ihrem Sprößlinge und zeigt an seinem Geschicke einen solchen Anteil, daß man sich oft der Rührung nicht erwehren kann. Der Tod eines Kindes hat in vielen Fällen das Hinscheiden der gefangenen Mutter zur Folge. Stirbt eine Äffin, so nimmt das erste beste Mitglied der Bande die Waise an Kindesstatt an, und die Zärtlichkeit gegen ein Pflegekind der eigenen Art ist kaum geringer als die, die dem eigenen Kinde zuteil wird.
Im Freileben scheinen alle Affen wenigen Krankheiten ausgesetzt zu sein. Bei uns zu Lande leiden alle außerordentlich von dem rauhen Klima. Die Kälte drückt sie nieder, verstimmt sie und macht sie still und traurig. Gewöhnlich pflegt die Lungenschwindsucht ihr Leben zu beenden. Ein kranker Affe ist eine Erscheinung, die jedermann rühren muß. Der sonst so heitere Gesell sitzt traurig und elend da und schaut den mitfühlenden Menschen kläglich bittend, ja wahrhaft menschlich ins Gesicht. Je mehr er seinem Ende zugeht, um so milder wird er; das Tierische verliert sich, und die edlere Seite seines Geistes zeigt sich heller. Er erkennt jede Hilfe mit größtem Danke, sieht bald in dem Arzte seinen Wohltäter, nimmt ihm gereichte Arzneien willig ein, gestattet sogar wundärztliche Eingriffe, ohne sich zu wehren.

Menschenaffen beim Diner
Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Affen als Hausgenossen anraten darf. Die munteren Gesellen bereiten viel Vergnügen, verursachen aber noch weit mehr Ärger. Auf lose Streiche aller Art darf man gefaßt sein, und wenn man eben nicht die Geisteskräfte des Affen studieren will, bekommt man jene doch bald gründlich satt. Die größeren Arten werden auch mitunter gefährlich; denn sie beißen und kratzen fürchterlich. Als frei umhergehendes Haustier ist der Affe nicht zu dulden, weil sein ewig regsamer Geist beständig Beschäftigung verlangt. Wenn sein Herr ihm solche nicht gewährt, schafft er sie sich selbst und dann regelmäßig nicht eben zum Vorteile des Menschen. Einige Arten sind schon wegen ihrer Unanständigkeit nicht zu ertragen; sie beleidigen jedes sittliche Gefühl fortwährend in der abscheulichsten Weise. In Anbetracht der Untugenden, die der Affe zeigt, der Tollheiten, die er verübt, verschwindet der geringe Nutzen, den er gewährt. Ihn zu allerlei Kunststücken abzurichten, ist sehr leicht. In der Regel lernt der Schüler binnen ein bis zwei Stunden ein Kunststück; doch muß man ihn in Übung halten, weil er rasch wieder vergißt. Mit seiner Ernährung hat man keine Not: er frißt alles, was der Mensch genießt.
In ihrer Heimat schaden die Affen ungleich mehr als sie nützen. Man ißt das Fleisch einiger Arten und verwendet das Fell anderer zu Pelzwerk, Beuteln und dergleichen: allein dieser geringe Gewinn kommt nicht in Betracht gegen den außerordentlichen Schaden, den die Affen im Walde, Felde und Garten verursachen, und es ist wirklich unbegreiflich, daß heute noch die Inder in ihnen heilige Geschöpfe sehen und sie deshalb pflegen und hegen, als wären sie wirklich Halbgötter.
*
Über die Einteilung der Affen sind die Forscher sehr verschiedener Meinung. Während einzelne sich von den althergebrachten Anschauungen nicht trennen können und für den Menschen nicht allein eine besondere Ordnung, sogar ein eigenes Reich bilden wollen, vereinigen diesen andere mit den Affen in einer und derselben Ordnung. Huxley bemerkt ausdrücklich, die Vergleichung der Reihenfolge der Affen, welches System von Organen man auch studieren möge, führe stets zu demselben Ergebnis: daß die Unterschiede der Bildung, die den Menschen vom Gorilla und Schimpansen trennen, nicht so groß sind, wie diejenigen, die den Gorilla von den tiefer stehenden Affen sondern. Trotzdem kann es entschuldigt werden, wenn man das Menschengeschlecht in einer besonderen Ordnung des Tierreiches vereinigt und für die eigentlichen Affen eine anderweitige Ordnung aufstellt.
In der zweiten Familie der Hochtiere, die die Altweltsaffen (Catarrhini) umfaßt, mag man die Menschenaffen (Anthropomorpha) als besondere Unterfamilie von den übrigen trennen und hat dann für sie folgende Merkmale anzugeben. Der Leib ist menschenähnlich gebildet; die Vorderglieder aber sind länger, die Hinteren kürzer als bei den Menschen. Das Gesicht erscheint namentlich durch den Bau und die Stellung der Augen und Ohren menschenähnlicher als das aller übrigen Affen. Ein Schwanz fehlt gänzlich. Das Haarkleid besteht aus langen, jedoch ziemlich dünn stehenden, schlichten Grannenhaaren, die bloß das Gesicht und die Zehen frei lassen; Gesäßschwielen sind meist nicht vorhanden. Das Gebiß ähnelt dem des Menschen bis auf die Eckzähne, die bei alten Männchen tierische Größe erreichen. Alle hierher gehörigen Affen bewohnen die Alte Welt, und zwar Asien und Afrika, ersteres in größerer Anzahl als letzteres.
Vor mehr als zweitausend Jahren rüsteten die Karthager eine Flotte zu dem Zwecke aus, Ansiedlungen an der Westküste von Afrika zu gründen. Auf sechzig großen Schiffen zogen ungefähr dreißigtausend Männer und Frauen zu diesem Behufe von Karthago aus, versehen mit Nahrung und allen Gegenständen zur Ansässigmachung. Der Befehlshaber dieser Flotte war Hanno, der seine Reise in einem kleinen, aber wohlbekannten Werke (dem »Periplus Hannonis«) der damaligen Welt beschrieb. Im Verlaufe der Reise gründete die Mannschaft jener Schiffe sieben Ansiedlungen, und nur der Mangel an Nahrungsmitteln zwang sie, früher als man wollte, zurückzukehren. Doch hatten die kühnen Seefahrer die Sierra Leone bereits hinter sich, als dieses geschah. Jener Hanno nun hinterließ uns in seinem Berichte eine Mitteilung, die auch für uns von Wichtigkeit ist. Die betreffende Stelle lautet: »Am dritten Tage, als wir von dort gesegelt waren und die Feuerströme durchschifft hatten, kamen wir zu einem Busen, das Südhorn genannt. Im Hintergrunde war ein Eiland mit einem See und in diesem wieder eine Insel, auf der sich wilde Menschen befanden. Die Mehrzahl derselben waren Weiber mit haarigem Körper, und die Dolmetscher nannten sie Gorillas. Die Männchen konnten wir nicht erreichen, als wir sie verfolgten; sie entkamen leicht, da sie Abgründe durchkletterten und sich mit Felsstücken verteidigten. Wir erlangten drei Weibchen; jedoch konnten wir dieselben nicht fortbringen, weil sie bissen und kratzten. Deshalb mußten wir sie töten; wir zogen sie aber ab und schickten das abgestreifte Fell nach Karthago.« Die Häute wurden dort später, wie Plinius berichtet, im Tempel der Juno aufbewahrt.
Es unterliegt Wohl keinem Zweifel, daß Hanno unter den wilden behaarten Menschen nur einen Menschenaffen meinen kann, und wenn er auch vielleicht den Schimpansen vor Augen gehabt hat, sind wir doch berechtigt, den riesigsten aller Affen Gorilla zu nennen.

Gorilla ( Gorilla gina)
Der Gorilla, »Njina«, oder »Ingiine« der Eingeborenen (Gorilla gina), Vertreter einer besonderen Sippe oder doch Untersippe, ist zwar etwas kleiner, aber bei weitem breitschultriger als ein starker Mann. Laut Owen beträgt beim erwachsenen Männchen die Höhe von der Sohle bis zum Scheitel 1,65 Meter, die Breite von einer Schulter zur andern 95 Zentimeter, die Länge des Kopfes und Rumpfes zusammengenommen 1,08 Meter, die der Vorderglieder 1,08 Meter, der Hinterglieder bis zur Ferse 75 Zentimeter, bis zur Spitze der Mittelzehe aber 1,5 Meter. Die Länge und Stärke des Rumpfes und der Vorderglieder, die unverhältnismäßige Größe der Hände und Füße sowie die durch Bindehaut größtenteils vereinigten mittleren Finger und Zehen sind die bezeichnendsten Merkmale. Der Umriß des Kopfes bildet von dem stark hervortretenden Augenbrauenbeine an nach dem Scheitel zu anfänglich eine etwas eingesenkte, später sanft gewölbte Linie, steigt am Scheitel auf und fällt nach dem Nacken zu gerade ab. Der Brauenbogen wird durch die ausliegende dicke Haut und starke Behaarung noch weiter vorgerückt und läßt das kleine, braune Auge um so tiefer zurücktreten; die Nase ist flach gedrückt, in der Mitte der Länge nach eingebuchtet und an ihren Flügeln sehr verbreitert, tritt aber, der weiten, schief nach vorn und oben geöffneten Nasenlöcher halber, an ihrer Spitze merklich hervor; das breite Maul wird durch dicke Lippen geschlossen, die kürzer und minder beweglich sind als bei andern Menschenaffen und mehr mit denen des Menschen übereinstimmen; das Kinn würde seiner Kürze halber zurücktreten, wäre nicht der ganze Unterteil des Gesichts vorgeschoben; das ziemlich weit nach hinten, in gleicher Höhe mit den Augen gelegene Ohr ist verhältnismäßig kleiner als das des Schimpansen, jedoch vergleichsweise größer als das des Menschen, diesem ähnlicher als das irgendeines andern Affen, Leiste wie Gegenleiste, Ecke wie Gegenecke wohl entwickelt und selbst ein zwar kleines, aber entschieden hängendes Läppchen vorhanden. Der kurze Hals bildet hinten wegen der langen, mit mächtigen Muskeln überdeckten Wirbelfortsätze mit Hinterkopf und Rücken eine gerade Linie, trennt sich daher nur seitlich und vorn vom Rumpfe ab, so daß der Kopf unmittelbar auf letzterem zu sitzen scheint. Der Rumpf selbst fällt ebensowohl durch seine außerordentliche Stärke wie seine im Vergleiche zu dem des Menschen unverhältnismäßige Länge auf; der mächtige Brustkasten ist ungemein geräumig, die Schulterbreite fast unmäßig, der Rücken sanft gebogen, ohne daß die Schulterblätter hervortreten, der Bauch allseitig gewölbt. Die Glieder unterscheiden sich wesentlich von denen des Menschen durch die gleichmäßige Stärke ihrer einzelnen Teile, indem dem Oberarme die Anschwellung, dem Schienbeine die Wade gänzlich fehlt. Verhältnismäßig ist der Oberarm länger, der ganze Arm aber kürzer als bei andern Menschenaffen, unter Berücksichtigung der Rumpflänge vergleichsweise nicht viel länger als beim Menschen, obgleich dies, der in der Entwicklung zurückgebliebenen Beine halber, den Anschein hat. Der Unterarm geht ohne erhebliche Verschmächtigung in die ebenso kurze wie breite und dicke, wegen ihres langen Tellers ausgezeichnete Hand über, deren drei überaus dicke und kräftige, gleichsam geschwollene Mittelfinger bis zu dem dritten Gliede durch eine Bindehaut vereinigt sind, also höchstens zwei Glieder frei bewegen können, und Nägel tragen, die zwar denen der Menschenhand an Größe gleichkommen, im Verhältnis zu den Fingern aber klein erscheinen; der Daumen ist wie bei allen Menschenaffen beziehentlich schwach und kurz, kaum halb so lang als jeder andere Finger. Mit dem der Verwandten verglichen, erscheinen die Oberschenkel stark, der Unterschenkel dagegen ebenso kurz als schwach, der Fuß kurz und unförmlich breit, die an ihrer Spitze verbreiterte, sehr bewegliche Daumenzehe, die unter einem Winkel von sechzig Graden zu den andern steht, verhältnismäßig stark und lang, die übrigen Zehen, unter denen die dritte die längste, die letzte sehr verkürzt ist, und deren zweite bis vierte unter sich ebenfalls größtenteils durch Haut verbunden sind, jener gegenüber kurz und schwach. Das gewellte, entfernt an Wolle erinnernde Haar läßt das Vordergesicht, nach oben bis zu den Augenbrauen, seitlich bis zur Mitte der Jochbogen, nach unten hin bis zum Kinne, das Ohr, die Hand und den Fuß seitlich und, soweit Finger und Zehen nicht vereinigt sind, auch unten gänzlich frei, bekleidet dagegen ziemlich regelmäßig den übrigen Leib, Oberkopf, Nacken, Schultern, Oberarme sowie Ober- und Unterschenkel am dichtesten, Brust und Bauch am spärlichsten, ist bei alten Tieren aber auch auf Mittel- und Unterrücken gewöhnlich abgerieben und hat, mit Ausnahme des Unterarmes, seinen Strich von vorn und oben nach hinten und unten, am Unterarme dagegen von unten nach oben. Alle nackten Teile haben graulich schieferschwarze, die mit Haaren bekleideten Hautteile dunkellederbraune, die Haare dagegen verschiedene, schwer zu beschreibende Färbung. Ein düsteres Dunkelgrau, hervorgebracht durch wenige rötliche und viele graue Haare, herrscht vor; die Mischung beider Farben wird gleichmäßiger auf Oberkopf und Nacken, weshalb diese Teile deutlich graurot aussehen; auf dem Rücken kommt mehr das Grau, an den inneren Schenkelseiten das Braun zur Geltung. Einige wenige weiße Haare finden sich am Gesäße. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht, Alte und Junge anscheinend nicht wesentlich.
Die Zähne sind sehr kräftig, die Eck- oder Hundszähne kaum weniger als bei Raubtieren entwickelt; der hinterste untere Backenzahn zeigt drei kleine äußere und zwei innere Höcker, nebst einem hinteren Anhange. Das Gerippe entspricht hinsichtlich seiner Massigkeit der Größe des Tieres; der ungeheure Schädel fällt besonders auf durch die Länge und Schmalheit des seitlich sehr zusammengedrückten, hinten eckig vortretenden, innen kleinen, d. h. wenig geräumigen Hirnteiles, den mächtig entwickelten Scheitelkamm des Männchens, die weit vortretenden Brauen und Jochbogen und den riesigen Unterkiefer, das Arm- und Handgerüst durch seine gewaltige Stärke, der von dreizehn Rippenpaaren umschlossene Brustkasten durch seine Weite.
Bis jetzt ist es noch nicht möglich gewesen, den Verbreitungskreis des Gorilla genau abzugrenzen, insbesondere wissen wir nicht, wie weit derselbe in das Innere des Erdteiles sich erstreckt. Einstweilen haben wir die zwischen dem Gleicher und dem fünften Grade südlicher Breite gelegenen Länder der Westküste Afrikas als seine Heimat, die von den Flüssen Gabun, Muni und Fernandovaz durchschnittenen Urwaldungen als seine Aufenthaltsorte anzusehen.
Abgesehen von Hanno, berichtet zuerst Andreas Battell über die großen Menschenaffen Westafrikas. Gelegentlich der Beschreibung von Majumba und des an der Loangoküste mündenden Stromes, den er Banna nennt, sagt er: »Die Wälder sind derartig überfüllt mit Pavianen, Meerkatzen, Affen und Papageien, daß sich jedermann fürchtet, in denselben zu reisen. Namentlich gilt dies für zwei Ungeheuer, die in diesen Waldungen leben und im höchsten Grade gefährlich sind. Das größte dieser Scheusale wird von den Eingeborenen »Pongo«, das kleinere »Ensego« genannt. Der Pongo hat den Gliederbau eines Menschen, ähnelt aber eher einem Riesen als einem Manne; denn er ist sehr groß und besitzt zwar das Antlitz eines Menschen, aber hohlliegende Augen, die von langen Brauenhaaren überdeckt werden; Gesicht und Ohren sind haarlos, die Hände ebenfalls, der Leib dagegen ist, wenn auch nicht gerade dicht, mit Haaren bekleidet, die eine düstere Färbung haben. Vom Menschen unterscheidet er sich nur durch seine Beine, die keine Waden zeigen. Er geht stets auf seinen Füßen und hält, wenn er auf dem Boden läuft, seine Hände zusammengeklammert im Nacken. Er schläft auf Bäumen und baut sich Dächer gegen den Regen. Sein Futter besteht aus Früchten, die er in den Wäldern findet, auch wohl aus Nüssen; Fleisch ißt er niemals. Sprechen kann er nicht, und sein Verständnis ist nicht größer als das eines Viehes. Haben die Eingeborenen, die die Wälder durchreisen müssen, nachts ein Feuer angezündet, so erscheinen die Pongos am Morgen, sobald jene das Lager verlassen, und sitzen am Feuer, bis dasselbe ausgeht; denn sie Verstehen nicht, daß man, um es zu erhalten, Holz zulegen muß. Oft vereinigen sie sich zu Gesellschaften und töten manchen Neger im Walde, oft auch überfallen sie Elefanten, die werdend in ihre Nähe kommen, und schlagen dieselben so mit ihren mächtigen Fäusten, daß sie brüllend davonlaufen. Niemals kann man diese Pongos lebend erhalten, weil zehn Männer nicht imstande sind, sie festzuhalten; doch erlegt man viele ihrer Jungen mit vergifteten Pfeilen. Der junge Pongo klammert sich so fest an den Leib seiner Mutter, daß die Eingeborenen, wenn sie das Weibchen erlegen, auch das Junge erhalten, das die Mutter nicht verläßt. Stirbt eines dieser Ungeheuer, so bedecken es die übrigen mit einem großen Haufen von Zweigen und Holz; solche Haufen findet man viele in den Wäldern.«
Später erwähnt ein Schiffsführer, der längere Zeit an der Westküste Afrikas sich aufgehalten hat, derselben Affen, führt aber drei Arten von ihnen auf und bemerkt, daß der größte »Impungu« heiße. »Dieses wundervolle und fürchterliche Erzeugnis der Natur«, sagt er, »geht aufrecht wie ein Mann, ist erwachsen sieben bis neun Fuß hoch, verhältnismäßig dick und entsetzlich stark. Schwarzes Haar, das auf dem Kopfe sich verlängert, bedeckt seinen Leib. Sein Gesicht ähnelt dem des Menschen mehr als das des Schimpansen, ist aber ebenfalls schwarz. Wenn dieses Tier einen Neger sieht, verfolgt und fängt es denselben; zuweilen tötet es ihn auch, und manchmal packt es ihn bei der Hand und nimmt ihn mit sich fort. Einige, die so glücklich waren, dieser Gefangenschaft zu entrinnen, sagen, daß das Ungetüm, wenn es schlafen geht, sich nicht niederlegt, sondern gegen einen Baum anlehnt; dann wartet der Gefangene, bis es eingeschlafen ist, löst vorsichtig seine Hand von sich ab und stiehlt sich still hinweg, erregt aber doch zuweilen die Aufmerksamkeit des Gegners und wird zurückgeholt. Das Tier lebt von den Früchten und Wurzeln dieses Landes und macht sich vornehmlich die Arbeit der Eingeborenen zunutze. Fehlt es ihm an Wasser, so sucht es sich einen Baum mit saftiger Rinde auf, reißt diese mit der Hand ab, zerquetscht sie und saugt den Saft aus; ja es nimmt zuweilen einen solchen Baum bei seinen Wanderungen mit, wenn es weiß, daß sich auf dem Wege kein Wasser findet. Ich habe gehört, daß es imstande ist, einen Palmbaum abzubrechen, um zu dem Safte desselben zu gelangen. Niemals habe ich dieses Tier zu sehen bekommen; allein ein Junges von ihm wurde während der Zeit, als mein Sohn in Malemba war, von einem Lande des Innern dem Könige geschenkt, und die Leute, die es brachten, sagten, daß es seit der Zeit, in der sie es in Besitz hatten, ruhig und ernsthaft gewesen sei, seine Speisen widerstandslos genommen und verständig gegessen und getrunken habe. Man hatte ihm ein Joch um den Nacken gelegt und seine Hände gebunden wie die der Sklaven, die mit ihm kamen, und so führte man es widerstandslos fort. Als es aber in der Königsstadt angelangt war, und sich eine unschätzbare Menge von Leuten einfand, um es zu betrachten, wurde es traurig und mürrisch, wollte keine Nahrung mehr zu sich nehmen und starb nach vier oder fünf Tagen. Es war noch jung, aber doch über sechs Fuß hoch. Auch mein Sohn sah es nicht, wohl aber die Hand von ihm, die man etwas über dem Gelenke abgehauen und getrocknet hatte, und deren Finger noch in diesem Zustande so dick waren wie drei von den seinigen, stärker fast als sein Handgelenk, im Verhältnisse zu den menschlichen länger, während der Armteil auch in getrocknetem Zustande noch dicker war als die dickste Stelle seines Armes. Der obere Teil der Finger und aller übrigen Handteile war mit schwarzem Haar bedeckt, der untere Teil der Hand ähnelte der eines Negers. Man sah, daß es das stärkste aller Tiere des Waldes sei, und begriff, daß die übrigen sämtlich vor ihm sich fürchten.«
Erst im Jahre 1846 gelang es Wilson, einem amerikanischen Heidenprediger, den Schädel dieses Affen zu erhalten. Derselbe ließ keinen Zweifel zu, daß er einer noch unbeschriebenen Art angehöre. Nach einigen Anstrengungen wurde ein zweiter Schädel erworben; andere Teile des Gerippes konnten später erlangt werden. Die Eingeborenen, vollständig vertraut mit Wesen und Sitten dieses Tieres, gaben die eingehendsten Berichte über seine Größe, seine Wildheit, die Beschaffenheit der Waldungen, die es bewohnt, versprachen auch in kürzester Frist ein vollständiges Gerippe zu beschaffen. Wilson selbst hat einen Gorilla gesehen, nachdem er getötet worden war. Nach seiner Versicherung ist es unmöglich, einen richtigen Begriff weder von der Scheußlichkeit seines Aussehens, noch von seiner außerordentlichen Muskelkraft zu geben. Sein tiefschwarzes Gesicht offenbart nicht allein verzerrte (der englische Text sagt »übertriebene«) Züge, sondern die ganze Erscheinung ist nichts anderes als ein Ausdruck der rohesten Wildheit. Große Augäpfel, ein Schopf von langen Haaren, der in der Wut über den Vorderkopf fällt, ein riesenhaftes Maul, bewaffnet mit einer Reihe von gewaltigen Zähnen, abstehende Ohren; dies alles zusammen läßt den Affen als eines der fürchterlichsten Geschöpfe der Erde erscheinen. Es ist nicht überraschend, daß die Eingeborenen sogar bewaffnet mit ihm zusammenzutreffen fürchten. Sie sagen, daß er sehr wild sei und unabänderlich zum Angriffe übergehe, wenn er mit einem einzelnen Manne zusammenkomme; »ich selbst«, versichert Wilson, »habe einen Mann gesehen, dem eins dieser Ungeheuer die Wade fast gänzlich weggebissen hatte, und der wahrscheinlich in Stücke zerrissen worden wäre, hätte er nicht rechtzeitig die Hilfe seiner Gefährten erhalten. Es wird versichert, daß sie dem bewaffneten Manne das Gewehr aus der Hand reißen und den Lauf zwischen ihren Kiefern zusammendrücken; und wenn man die ungeheure Muskelkraft der Kinnladen in Erwähnung zieht, kann man nicht finden, daß dies unmöglich sei.«
Ungefähr in derselben Zeit stellte Savage unter den Negern eingehende Nachforschungen über die Lebensweise des Affen an und veröffentlichte die Ergebnisse derselben in der »Bostoner naturwissenschaftlichen Zeitung« vom Jahre 1847. Ihnen zufolge lebt der »Ingiine« im Innern von Unterguinea, während der Verbreitungskreis des Schimpansen mehr längs der Küste sich erstreckt. Der Gang des ersteren ist wackelnd oder watschelnd, die Bewegung des Leibes, der immer nach vorn überhängt, etwas rollend oder von einer Seite zur andern schwankend. Die Arme werden beim Gehen vorwärts geworfen und auf den Grund gestemmt. Man sagt, daß der Gorilla beim Gehen die Finger nicht beuge, sondern sie ausgestreckt als Stütze der Hand verwende. Wenn er sich aufrichtet und in dieser Stellung geht, hält er seinen mächtigen Körper dadurch im Gleichgewichte, daß er seine Arme nach oben beugt. Er lebt in Banden; dieselben sind jedoch nicht so zahlreich als die, die der Schimpanse bildet. In jeder solchen Bande befinden sich mehr Weibchen als Männchen; denn alle Nachrichten stimmen darin überein, daß nur ein altes Männchen sich bei solcher Gesellschaft befindet, und daß, wenn junge Männchen ihre volle Größe erreicht haben, zwischen ihnen und andern ein Kampf um die Oberherrschaft stattfindet und der stärkste, nachdem er den Nebenbuhler getötet oder doch vertrieben hat, zum Haupte der Gesellschaft sich aufwirft. Seine Wohnungen, falls man sie so nennen darf, ähneln denen, die der Schimpanse baut, und bestehen einfach aus wenigen Stecken und blätterigen Zweigen, die von Astgabeln und Asten der Bäume unterstützt werden, gewähren auch keinen Schutz gegen das Wetter und werden nur des Nachts benutzt. Gorillas sind außerordentlich wild und stets angriffslustig, flüchten auch niemals vor dem Menschen. Die Eingeborenen fürchten sie in hohem Grade und nehmen niemals den Kampf mit ihnen auf, es sei denn, um sich selbst zu verteidigen. Die wenigen Stücke, die erbeutet wurden, fanden ihren Tod durch Elefantenjäger und Handelsleute, die im Walde mit ihnen zusammentrafen. Angesichts eines Menschen soll der männliche Gorilla zuerst einen entsetzlichen Schrei ausstoßen, der auf weithin im Walde widerhallt und etwa wie ein langgezogenes und schrilles »Kheh, Kheh« klingt, dabei die ungeheuren Kiefern zu voller Weite öffnen und mit über das Kinn herabhängender Unterlippe und über die Brauen herabfallendem Haarschopfe das Bild unbeschreiblicher Wildheit sein. Weibchen und Junge verschwinden bei dem ersten Schrei des Männchens; dieses aber nähert sich, in rascher Folge seinen entsetzlichen Schrei ausstoßend, dem Jäger. Letzterer erwartet seine Ankunft mit dem Gewehre an der Wange, und verzögert, wenn er seines Schusses nicht ganz sicher ist, sein Feuer, bis das Tier den Gewehrlauf ergriffen und, wie es zu tun pflegt, in das Maul gebracht hat. Sollte das Gewehr versagen, so zerquetscht der Gorilla den dünnen Lauf zwischen seinen Zähnen, und das Zusammentreffen kann für den Jäger verhängnisvoll werden. Im übrigen ähneln die Sitten und Gewohnheit des Gorilla denen des Schimpansen; er baut ähnliche Nester auf die Bäume, lebt von denselben oder ähnlichen Früchten und macht seinen Aufenthaltsort von den Umständen abhängend.
Im Jahre 1852 gibt Ford übereinstimmende Nachrichten. »Der Gorilla«, sagt er, »erhebt sich zum Angriffe auf seine Füße, nähert sich jedoch seinem Gegner in gebeugter Haltung. Obgleich er niemals auf der Lauer liegt, stößt er doch, sobald er die Annäherung eines Menschen wahrnimmt, augenblicklich seinen bezeichnenden Schrei aus, bereitet sich zum Kampfe und geht zum Angriffe über. Der Schrei ist mehr ein Grunzen als ein Heulen, ähnelt dem des erregten Schimpansen, ist jedoch lauter und wird in weiter Entfernung vernommen. Zuerst nun begleitet er die Weibchen, von denen er regelmäßig umgeben wird, auf eine kurze Strecke bei ihrer Flucht, kehrt hierauf zurück, sträubt den Haarschopf, so daß er vorn überhängt, weitet seine Nüstern, zieht die Unterlippe herab, fletscht die Zähne und läßt nochmals jenen Schrei hören, wie es scheint, in der Absicht, seinen Gegner zu erschrecken. Streckt ihn jetzt nicht eine wohlgezielte Kugel zu Boden, so nimmt er einen Ansatz, schlägt seinen Gegner mit der Hand nieder oder packt ihn mit einem Griffe, der kein Entrinnen ermöglicht, wirft ihn auf den Boden und zerfetzt ihn mit den Zähnen. Das wilde Wesen dieses Geschöpfes konnte man deutlich sehen an einem kleinen Jungen, das hierher gebracht wurde. Man hielt es mehrere Monate und gab sich die größte Mühe, um es zu zähmen; es war jedoch so unverbesserlich, daß es mich noch eine Stunde vor seinem Tode biß.«
Der nächstfolgende Berichterstatter ist Du-Chaillu. Ich würde dessen Mitteilungen vorzugsweise benutzt haben, hätte die Darstellung nicht beim ersten Lesen ein unbesiegliches Mißtrauen in mir erweckt. Demungeachtet mag auch diese Schilderung hier eine Stelle finden; nur verwahre ich mich gegen die Annahme, als wolle ich sie in irgendeiner Weise bekräftigen. Ich bin vielmehr durchaus der Meinung Reade's, daß Du-Chaillu's Erzählung ein wunderbares Gemisch von Wahrheit und Erdichtung ist, und stimme dem Letztgenannten bei, wenn er sagt, daß jener vieles über den Gorilla geschrieben hat, das wahr, aber nicht neu ist, und weniges, das neu, aber nicht wahr ist. Man urteile selbst, was Wohl von einem Forscher zu halten ist, der sein erstes Zusammentreffen mit dem Gorilla schildert, wie folgt:
»Schnell vorwärts bewegte es sich im Gebüsche, und mit einem Male stand ein ungeheurer männlicher Gorilla vor mir. Durch das Dickicht war er auf allen Vieren gekrochen; als er uns aber sah, erhob er sich und sah uns kühn und mutig in die Augen. So stand er etwa zwölf Schritte vor uns – ein Anblick, den ich nie vergessen werde! Der König des afrikanischen Waldes kam mir wie eine gespenstische Erscheinung vor. Aufgerichtet war der ungeheure, fast sechs Fuß hohe Körper; frei zeigten sich die mächtige Brust, die großen, muskelkräftigen Arme, das wild blitzende, tiefgraue Auge und das Gesicht mit seinem wahrhaft höllischen Ausdruck. Er fürchtete sich nicht! Da stand er und schlug seine Brust mit den gewaltigen Fäusten, daß es schallte, wie wenn man eine große metallene Trommel schlägt. Das ist die Art des Trotzbietens, das ist das Kampfeszeichen des Gorilla! Und dazwischen stieß er einmal nach dem andern sein gräßliches Gebrüll aus – ein Gebrüll, so grauenerregend, daß man es den eigentümlichsten und fürchterlichsten Laut der afrikanischen Wälder nennen muß. Es beginnt mit scharfem Bellen, wie es ein großer Hund hören läßt, und geht dann in tiefes Dröhnen über, das genau dem Rollen fernen Donners am Himmel gleicht: habe ich doch mehr als einmal dieses Gebrüll für Donner gehalten, wenn ich den Gorilla nicht sah! Wir blieben bewegungslos im Verteidigungszustande. Die Augen des Unholdes blitzten grimmiger; der Kamm des kurzen Haares, der auf seiner Stirn steht, legte sich auf und nieder; er zeigte seine mächtigen Fänge und wiederholte das donnernde Brüllen. Jetzt glich er gänzlich einem höllischen Traumbilde, einem Wesen jener widerlichen Art, halb Mann, halb Tier, wie es die alten Maler erfanden, wenn sie die Hölle darstellen wollten. Wiederum kam er ein Paar Schritte näher, blieb nochmals stehen und stieß von neuem sein entsetzliches Geheul aus. Und noch einmal näherte er sich, noch einmal stand er und schlug brüllend und wütend seine Brust. So war er bis auf sechs Schritte herangekommen: da feuerte ich und tötete ihn. Mit einem Stöhnen, das etwas schrecklich Menschliches an sich hatte und doch durch und durch viehisch war, fiel er vorwärts auf sein Gesicht. Der Körper zuckte krampfhaft mehrere Minuten; dann wurde alles ruhig: der Tod hatte seine Arbeit getan.« Zu vorstehender Stelle gehört ein kurzer Nachsatz von Reade: »In einem Vortrag, den ich in einer Sitzung der Londoner tierkundlichen Gesellschaft las, und der in den Schriften der Gesellschaft veröffentlicht worden ist, habe ich die Gründe entwickelt, aus denen ich mit vollster Sicherheit schließen darf, daß Du-Chaillu niemals einen Gorilla erlegt hat.«
Doch auch das Unwahrscheinliche, richtiger vielleicht, die Lüge, mag hier Erwähnung finden, um so mehr, als die Berichtigung auf dem Fuße folgen wird.
»Mein langer Aufenthalt in Afrika«, erzählt Du-Chaillu, »erleichterte es mir, mit Eingeborenen zu verkehren, und als meine Neugierde, jenes Ungeheuer kennenzulernen, aufs höchste erregt worden war, beschloß ich, selbst auf dessen Jagd auszuziehen und es mit meinen Augen zu sehen. Ich war so glücklich, der erste zu sein, der nach eigener Bekanntschaft über den Gorilla sprechen darf, und während meine Erfahrungen und Beobachtungen zeigen, daß viele Erzählungen auf falschen und leeren Einbildungen unwissender Neger und leichtgläubiger Reisenden beruhen, kann ich anderseits bestätigen, daß keine Beschreibung die entsetzliche Erscheinung, die Wut des Angriffs und die wüste Bosheit eines Gorilla versinnbildlichen wird.
Es tut mir leid, daß ich der Zerstörer vieler anmutigen Träumereien sein muß. Aber der Gorilla lauert nicht auf den Bäumen über dem Wege, um einen unvorsichtig Vorübergehenden zu ergreifen und in seinen zangengleichen Händen zu erwürgen; er greift den Elefanten nicht an und schlägt ihn mit Stöcken zu Tode; er schleppt keine Weiber aus den Dörfern der Eingeborenen weg; er baut sich kein Nest aus Blättern und Zweigen auf den Waldbäumen und sitzt nicht unter deren Dach; er ist nicht einmal ein geselliges Tier, und alle Berichte von gemeinschaftlichen Angriffen haben nicht ein Körnchen von Wahrheit in sich.
Der Gorilla lebt in den einsamsten und dunkelsten Stellen des dichten afrikanischen Niederwaldes, tiefe bewaldete Täler und ebenso schroffe Höhen allen übrigen Aufenthaltsorten vorziehend. Gerade die Hochebenen, die mit unermeßlichen Halden bedeckt sind, scheinen seinen Lieblingswohnsitz zu bilden. In jenen Gegenden Afrikas findet sich überall Wasser, und ich habe beobachtet, daß der Gorilla just an solchen Stellen sich aufhält, wo es am feuchtesten ist. Er ist ein rastloses Vieh, das von Ort zu Ort wandert und schwerlich an einer und derselben Stelle zwei Tage lang bleibt. Dieses Umherschweifen ist zum Teil bedingt durch die Schwierigkeit, sein Lieblingsfutter zu finden. Obgleich der Gorilla vermöge seiner ungeheuren Eckzähne ohne Mühe jedes andere Tier des Waldes zu zerstückeln vermöchte, ist er doch ein echter Pflanzenfresser. Ich habe die Magen von allen untersucht, die zu töten ich so glücklich war, und niemals etwas anderes gefunden als Beeren, Pisangblätter und sonstige Pflanzenstoffe. Der Gorilla ist ein arger Fresser, der unzweifelhaft an einem Orte alles auffrißt und dann, in beständigem Kampfe mit dem Hunger, zum Wandern gezwungen wird. Sein großer Bauch, der sich, wenn er aufrecht dasteht, deutlich genug zeigt, beweist dies: und wahrlich, sein gewaltiger Leib und die mächtige Muskelentwicklung könnten bei weniger Nahrung nicht unterhalten werden.
Es ist nicht wahr, daß der Gorilla viel oder immer auf den Bäumen lebt; ich habe ihn fast stets auf der Erde gefunden. Allerdings steigt er oft genug an den Bäumen in die Höhe, um Beeren oder Nüsse zu pflücken; wenn er aber dort gegessen hat, kehrt er wieder nach unten zurück. Nach meinen Erfahrungen über die Nahrung kann man behaupten, daß er es gar nicht nötig hat, die Bäume zu erklettern. Ihm behagen Zuckerrohr, die weißen Rippen der Pisangblätter, mehrere Beeren, die nahe der Erde wachsen, das Mark einiger Bäume und eine Nuß mit sehr harter Schale. Diese letztere ist so fest, daß man sie nur mit einem starken Schlage vermittels eines Hammers öffnen kann. Wahrscheinlich ihrethalben besitzt er das ungeheure Gebiß, das stark genug ist, einen Gewehrlauf zusammenzubiegen.
Nur junge Gorillas schlafen auf Bäumen, um sich gegen Raubtiere zu schützen. Ich habe mehrere Male die frische Spur eines Gorillabettes gefunden und konnte deutlich sehen, daß das Männchen, mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt, in ihm gesessen hat; doch glaube ich, daß Weibchen und Junge zuweilen die Krone des Baumes ersteigen mögen, während die Männchen immer am Fuße der Bäume oder unter Umständen auf der Erde schlafen. Alle Affen, die viel auf Bäumen leben, haben an ihren vier Händen längere Finger als der Gorilla, dessen Hand mehr der menschlichen ähnelt. Infolge dieses verschiedenen Baues ist er weniger geeignet, Bäume zu erklettern. Zugleich muß ich bemerken, daß ich niemals einen Schirm oder ein Zelt gefunden habe und deswegen zu dem Schlüsse gekommen bin, er führe ein derartiges Gebäude überhaupt nicht auf.
Der Gorilla ist nicht gesellig. Von den Alten fand ich gewöhnlich ein Männchen und ein Weibchen zusammen, oft genug auch ein altes Männchen allein. In solchem Falle ist es immer ein alter, mürrischer, böswilliger Gesell, der nicht mit sich spaßen läßt. Junge Gorillas traf ich in Gesellschaft bis zu fünf Stück an. Sie liefen stets auf allen Vieren davon, schreiend vor Furcht. Es ist nicht leicht, sich ihnen zu nähern; denn sie hören außerordentlich scharf, und verlieren keine Zeit, um zu entkommen, während die Beschaffenheit des Bodens es dem Jäger sehr erschwert, ihnen zu folgen. Das alte Tier ist auch scheu: ich habe zuweilen den ganzen Tag gejagt, ohne auf mein Wild zu stoßen und mußte bemerken, daß es mir sorgfältig auswich. Wenn jedoch zuletzt das Glück den Jäger begünstigt und er zufällig oder durch ein gutes Jagdkunststück auf seine Beute kommt, geht diese ihm nicht aus dem Wege. Bei allen meinen Jagden habe ich nicht einen einzigen Gorilla gefunden, der mir den Rücken zugekehrt hätte. Überraschte ich ein Paar, so fand ich gewöhnlich das Männchen, an einen Felsen oder Baum gelehnt, im dunkelsten Dickicht des Waldes, wo die strahlende Sonne nur ein düsteres Zwielicht hervorrufen kann; das Weibchen weidete in der Regel nebenbei und dieses war es auch, das zuerst unter lautem und heftigem Schreien und Kreischen davonrannte. Dann erhob sich langsam das Männchen, das noch einen Augenblick mit wütendem Blicke dagesessen hatte, schaute mit glühenden Augen auf die Eindringlinge, schlug aus seine Brust, erhob sein gewaltiges Haupt und stieß das furchtbare Gebrüll aus. Ich glaube, daß ich dieses Gebrüll auf die Entfernung von drei Meilen gehört habe.
Es ist Grundsatz eines geschulten Gorillajägers, sein Feuer bis zum letzten Augenblicke zu bewahren. Die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn der Jäger feuert und fehlt, der Gorilla augenblicklich auf ihn stürzt. Und seinem Anpralle kann kein Mann widerstehen! Ein einziger Schlag der gewaltigen, mit mächtigen Nägeln bewehrten Hand, und das Eingeweide des armen Jägers liegt bloß, seine Brust ist zertrümmert, sein Schädel zerschmettert; es ist zu spät, neu zu laden, und die Flucht vergebens! Einzelne Neger, tollkühn aus Furcht, haben sich unter solchen Umständen in ein Ringen mit dem Gorilla eingelassen und mit ihrem ungeladenen Gewehre verteidigen wollen, aber nur Zeit zu einem einzigen, erfolglosen Streiche gehabt: im nächsten Augenblicke erschien der lange Arm mit verhängnisvoller Kraft und zerbrach Gewehr und Negerschädel mit einem Schlage. Ich kann mir kein Geschöpf denken, das so unabwendbare Angriffe auf den Menschen auszuführen versteht wie der Gorilla, und zwar aus dem Grunde, weil er sich Gesicht gegen Gesicht dem Manne gegenüberstellt und seine Arme als Waffen zum Angriffe gebraucht, gerade wie ein Preisfechter tun würde, nur daß jener längere Arme und weitaus größere Kraft hat, als sich der gewaltigste Faustkämpfer der Erde träumen läßt.
Da man sich in den dunklen und undurchdringlichen Dickichten, der vielen Ranken und Dornen halber, kaum bewegen kann, bleibt der Jäger klugerweise stehen und erwartet die Ankunft des wütenden Tieres. Der Gorilla nähert sich mit kurzen Schritten, hält häufig an-, stößt sein höllisches Gebrüll aus, schlägt ab und zu mit den Armen seine Brust, ruht auch wohl länger aus und setzt sich, blickt aber immer wütend auf seinen Gegner. Die sehr kurzen Hinterbeine genügen entschieden nicht, um den Körper aufrecht zu tragen: daher hält sich das Tier durch Schwingungen mit den Armen im Gleichgewicht; aber der dicke Bauch, das runde, stierartige Haupt, das rückwärts fast auf dem Nacken aufliegt, die großen, muskelkräftigen Arme und die weite Brust – alles dies läßt sein Schwanken unsäglich entsetzlich erscheinen und vermehrt noch das Furchtbare seiner Erscheinung. Zugleich blitzen die tiefliegenden grauen Augen in unheimlichem Glanze; die Wut verzerrt das Gesicht aus das abscheulichste; die dünnen, scharf geschnittenen Lippen, die zurückgezogen werden, lassen die gewaltigen Eckzähne und die furchtbaren Kinnladen, in denen ein Menschenglied zermalmt werden würde wie Zwieback, sichtbar werden. Der Jäger steht, mit ängstlicher Sorge seinen Feind bewachend, auf einer und derselben Stelle, das Gewehr in der Hand, oft fünf lange, bange Minuten, mit aufregendem Grauen den Augenblick erwartend, in dem er feuern muß. Die gewöhnliche Schußweite beträgt zehn Schritte. Ich meinesteils habe nie weiter auf ein Gorillamännchen geschossen als auf acht Ellen. Zuletzt kommt die Gelegenheit: so schnell wie möglich wird das Gewehr erhoben, – ein ängstlicher Augenblick, der die Brust zusammenschnürt, und dann – Finger an den Drücker! Wenn der Neger einem Flußpferde während der Jagd eine Kugel zusandte, geht er im Augenblick auf seine Beute los – wenn er nach einem Gorilla schoß, steht er still; denn falls er gefehlt hat, muß er kämpfen für sein Leben, Gesicht gegen Gesicht, hoffend, daß irgendein unerwartetes Glück ihn von dem tödlichen Streich errettet, und er davonkommt, wenn auch vielleicht gelähmt auf immer. Glücklicherweise stirbt der Gorilla ebenso leicht wie der Mensch: ein Schuß in die Brust bringt ihn sicher zu Fall. Er stürzt vorwärts auf sein Gesicht, die langen, gewaltigen Arme ausstreckend und mit dem letzten Atem ein Todesröcheln ausstoßend, halb Brüllen, halb Stöhnen, das, obgleich es dem Jäger seine Rettung verkündet, dennoch sein Ohr peinigt wegen der Ähnlichkeit mit dem Seufzer eines sterbenden Menschen. Die Neger greifen den Gorilla nur mit Flinten an, niemals mit andern Waffen, und da, wo sie kein Feuergewehr besitzen, durchzieht das Untier unbelästigt als alleiniger Herrscher den Wald. Einen Gorilla getötet zu haben, verschafft dem Jäger für sein Lebenlang die größte Achtung selbst der mutigsten Neger, die, wie ich hinzufügen muß, im allgemeinen durchaus nicht nach dieser Art des Ruhmes lüstern sind. Der Gorilla gebraucht keine künstlichen Waffen zur Verteidigung, sondern wehrt sich mit seinen Armen und im weiteren Kampfe mit seinen Zähnen. Ich habe oft Gorillaschädel untersucht, in denen die gewaltigen Reißzähne losgebrochen waren, und von den Negern erfahren, daß ein derartiger Verlust während der Kämpfe entstand, die zwei Gorillamännchen in Sachen der Liebe ausgefochten haben. Solch ein Streit muß ein in jeder Hinsicht gewaltiges, großartiges Schauspiel gewähren: ein Ringen zwischen zwei tüchtigen männlichen Gorillas würde alle Kampfspiele der Welt überbieten.
Der gewöhnliche Gang des Gorillas geschieht nicht auf den Hinterbeinen, sondern auf allen Vieren. Bei dieser Stellung wird das Haupt bedeutend erhöht, weil die Arme verhältnismäßig sehr lang sind. Wenn er schnell läuft, setzt er die Hinterbeine fast bis über den Leib vor, und immer bewegt er beide Glieder einer Seite zu gleicher Zeit, wodurch er eben einen so sonderbar wackelnden Gang erhält. Nicht zu bezweifeln steht, daß er auch in erhobener Stellung ziemlich schnell und viel länger als der Schimpanse oder andere Affen dahinwandeln kann. Wenn er aufrecht steht, biegt er seine Knie nach auswärts. Sonderbar ist seine Fährte. Die Hinterfüße hinterlassen keine Spur von ihren Zehen, nur der Fußballen und die große Zehe scheinen aufzutreten; die Finger der Hand sind undeutlich dem Boden aufgedrückt. Junge Gorillas klettern, verfolgt, nicht auf Bäume, sondern laufen auf dem Boden dahin.
Niemals habe ich gefunden, daß eine Gorillamutter an Verteidigung denkt, durch die Neger aber erfahren, daß dies zuweilen Wohl der Fall sein könne. Es ist ein hübscher Anblick, solch eine Mutter mit ihrem sie umspielenden Jungen! So begierig ich auch war, Gorillas zu erhalten, konnte ich es doch nicht über das Herz bringen, ein solches Verhältnis zu stören. Meine Neger waren weniger weichherzig und töteten ihren Erzfeind ohne Zeitverlust. Flüchtet die Mutter vor dem Jäger, so springt das Junge ihr sofort auf den Nacken und hängt sich zwischen ihren Brüsten an, mit den kleinen Gliedern ihren Leib umschlingend. Schon ein junger Gorilla ist außerordentlich stark. Einen, der nur zwei und ein halbes Jahr alt war, vermochten vier starke Männer nicht festzuhalten. Der Alte kann mit seinen Zähnen einen Gewehrlauf plattbeißen und mit seinen Armen Bäume umbrechen von zehn bis fünfzehn Zentimeter im Durchmesser (?). Das Fell des Tieres ist dick und fest wie eine Ochsenhaut, aber verhältnismäßig zarter als das anderer Affen.
Am 4. Mai lieferten einige Neger, die in meinem Auftrage jagten, einen jungen, lebenden Gorilla ein. Ich kann unmöglich die Aufregung beschreiben, die mich erfaßte, als man das kleine Scheusal in das Dorf brachte. Alle die Beschwerden und Entbehrungen, die ich in Afrika ausgehalten hatte, waren in einem Augenblicke vergessen. Der Affe war etwa zwei bis drei Jahre alt, zweieinhalb Fuß hoch, aber so wütend und halsstarrig, wie nur einer seiner erwachsenen Genossen hätte sein können. Meine Jäger, die ich am liebsten an das Herz gedrückt hätte, fingen ihn in dem Lande zwischen dem Rembo und dem Vorgebirge St. Katharina. Nach ihrem Berichte gingen sie zu fünf nahe einer Ortschaft an der Küste lautlos durch den Wald, hörten ein Geknurre, das sie sofort als den Ruf eines jungen Gorillas nach seiner Mutter erkannten, und beschlossen, ohne Zögern dem Schrei zu folgen. Mit den Gewehren in der Hand schlichen die Braven vorwärts, einem düsteren Dickicht des Waldes zu. Sie wußten, daß die Mutter in der Nähe sein würde, und erwarteten, daß auch das gefürchtete Männchen nicht weit sein möchte, beschlossen jedoch, alles aufs Spiel zu setzen, um womöglich das Junge lebend zu erhalten. Beim Näherkommen hatten sie einen selbst ihnen seltenen Anblick. Das Junge saß einige Schritte entfernt von seiner Mutter auf dem Boden und beschäftigte sich, Beeren zu pflücken. Die Alte schmauste von denselben Früchten. Meine Jäger machten sich augenblicklich zum Feuern fertig: und nicht zu spät; denn die Alte erblickte sie, als sie ihre Gewehre erhoben. Glücklicherweise töteten sie die besorgte Mutter mit dem ersten Schusse. Das Junge, erschreckt durch den Knall der Gewehre, rannte zu seiner Erzeugerin, hing sich an sie, umarmte ihren Leib und versteckte sein Gesicht. Die Jäger eilten herbei; das hierdurch aufmerksam gewordene Junge verließ aber sofort seine Mutter, lief zu einem schmalen Baume und kletterte an ihm mit großer Behendigkeit empor, setzte sich hier nieder und brüllte wütend auf seine Verfolger herunter. Doch die Leute ließen sich nicht verblüffen. Nicht ein einziger fürchtete sich, von dem kleinen wütenden Vieh gebissen zu werden. Man hieb den Baum um, deckte, als er fiel, schnell ein Kleid über den Kopf des seltenen Wildes und konnte es nun, so geblendet, leichter fesseln. Doch der kleine Gesell, seinem Alter nach nur ein unerwachsenes Kind, war bereits erstaunenswürdig kräftig und nichts weniger als gutartig, so daß die Leute nicht imstande waren, ihn zu führen, und sich genötigt sahen, seinen Hals in eine Holzgabel zu stecken, die vorn verschlossen wurde und als Zwangsmittel dienen mußte. So kam der Gorilla in das Dorf. Eine ungeheure Aufregung bemächtigte sich aller Gemüter. Als der Gefangene aus dem Boote gehoben wurde, in dem er einen Teil seines Weges zurückgelegt hatte, brüllte und bellte er und schaute aus seinen bösen Augen wild um sich, gleichsam versichernd, daß er sich gewiß rächen werde, sobald er könne. Ich sah, daß die Gabel seinen Nacken verwundet hatte, und ließ deshalb möglichst rasch einen Käfig für ihn anfertigen. Nach zwei Stunden hatten wir ein festes Bambushaus für ihn gebaut, durch dessen sichere Stäbe wir ihn nun beobachten konnten. Er war ein junges Männchen, erwachsen genug, um seinen Weg allein zu gehen, für sein Alter auch mit einer merkwürdigen Kraft ausgerüstet. Gesicht und Hände waren schwarz, die Augen jedoch noch nicht so tief eingesunken wie bei den alten, Brust und Bauch dünner, die Arme länger behaart. Das Haar der Brauen und des Armes, das rötlichbraun aussah, begann sich eben zu erheben; die Oberlippe war mit kurzen Haaren bedeckt, die untere mit einem kleinen Barte, die Augenlider waren fein und dünn, die Augenbrauen etwa zwei Zentimeter lang; eisgraues Haar, das in der Nähe der Arme dunkelte und am Steiße vollständig weiß erschien, bedeckte seinen Nacken.
Nachdem ich den kleinen Burschen glücklich in seinen Käfig gelockt hatte, nahte ich mich, um ihm einige ermunternde Worte zu sagen. Er stand in der fernsten Ecke; sowie ich mich aber näherte, bellte er und sprang wütend nach mir. Obgleich ich mich so schnell als ich konnte zurückzog, erreichte er doch meine Beinkleider, zerriß sie und kehrte augenblicklich wieder nach seinem Winkel zurück. Dies lehrte mich Vorsicht; doch gab ich die Hoffnung, ihn zu zähmen, nicht auf. Meine erste Sorge war natürlich, Futter für ihn zu schaffen. Ich ließ Waldbeeren holen und reichte ihm diese nebst Wasser; doch wollte er weder essen noch trinken, bevor ich mich ziemlich weit entfernt hatte. Am zweiten Tage war Joe, wie ich ihn genannt hatte, wilder als am ersten, fuhr auf jedermann zu, der nur einen Augenblick vor seinem Käfig stand, und schien bereit, uns alle in Stücke zu zerreißen. Ich brachte ihm einige Pisangblätter und bemerkte, daß er davon nur die weichen Teile fraß. Er schien eben nicht wählerisch zu sein, obschon er jetzt und während seines kurzen Lebens, mit Ausnahme der wilden Blätter und Früchte seiner heimischen Wälder, alles Futter verschmähte. Am dritten Tage war er noch mürrischer und wütender, bellte jeden an und zog sich entweder nach seinem fernen Winkel zurück oder schoß angreifend vor. Am vierten Tage glückte es ihm, zwei Bambusstäbe auseinanderzuschieben und zu entfliehen. Beim Eintreten in mein Haus wurde ich von ärgerlichem Brüllen begrüßt, das unter meiner Bettstelle hervorkam. Augenblicklich schloß ich die Fenster und rief meine Leute herbei, das Tor zu beaufsichtigen. Als Freund Joe dies sah, bekundete er grenzenlose Wut: seine Augen glänzten, der ganze Leib bebte vor Zorn, und rasend kam er unter dem Bette hervor. Wir schlossen das Tor und ließen ihm das Feld, indem wir vorzogen, lieber einen Plan zu seiner sicheren Gefangennahme zu entwerfen, als uns seinen Zähnen auszusetzen. Es war kein Vergnügen, ihn wieder zu fangen: er war schon so stark und wütend, daß ich selbst einen Faustkampf mit ihm scheute, aus Furcht, von ihm gebissen zu werden. Mitten im Raum stand der biedere Gesell und schaute grimmig auf seinen Feind, prüfte dabei aber mit einiger Überraschung die Einrichtungsgegenstände. Ich besorgte, daß das Ticken meiner Uhr sein Ohr erreichen würde und ihn zu einem Angriffe auf diesen unschätzbaren Gegenstand begeistern, oder daß er vieles von dem, was ich gesammelt hatte, zerstören möchte. Endlich, als er sich etwas beruhigt hatte, schleuderten wir ihm glücklich ein Netz über den Kopf. Der junge Unhold brüllte fürchterlich und wütete und tobte unter seinen Fesseln. Ich warf mich schließlich auf seinen Nacken, zwei Mann faßten seine Arme, zwei andere die Beine: und dennoch machte er uns viel zu schaffen. So schnell wie möglich trugen wir ihn nach seinem inzwischen ausgebesserten Käfig zurück und bewachten ihn dort sorgfältiger.
Niemals sah ich ein so wütendes Vieh wie diesen Affen. Er fuhr auf jeden los, der ihm nahte, biß in die Bambusstäbe, schaute mit bösen Augen um sich und zeigte bei jeder Gelegenheit, daß er ein durch und durch bösartiges und boshaftes Gemüt hatte.«
Im Verlaufe seiner Erzählung teilt Du-Chaillu mit, daß Joe weder durch Hunger noch durch »gesittete Nahrung« zu bändigen war, nach einiger Zeit, als er zum zweitenmal durchbrach, mit vieler Mühe wieder gefangen, trotz alles Widersträubens in Ketten gelegt wurde und zehn Tage darauf plötzlich starb, seinen Herrn zuletzt aber wohl kennengelernt hatte. Später will Du-Chaillu ein junges Gorillaweibchen erhalten haben, das mit außerordentlicher Zärtlichkeit an der Leiche seiner Mutter hing und das ganze Dorf durch seine Betrübnis in Aufregung versetzte. Das Tierchen war noch ein kleiner Säugling und starb, weil Milch nicht zu bekommen war, schon am dritten Tage nach seinem Fange.
Die Eingeborenen des Innern essen das Fleisch des Gorillas und anderer Affen sehr gern, obgleich es schwarz und hart ist; die Stämme nahe der See dagegen verschmähen es und fühlen sich beleidigt, wenn man es ihnen anbietet, weil sie sich einer gewissen Ähnlichkeit zwischen ihnen und den Affen bewußt sind. Auch im Innern weisen Negerfamilien Gorillafleisch zurück, weil sie wähnen, daß vor Zeiten eine ihrer weiblichen Ahnen einen Gorilla geboren habe.
Unter allen Berichterstattern macht Winwood Reade den Eindruck der größten Verläßlichkeit. »Als ich im Innern der Gorillagegenden reiste«, sagt er, »pflegte ich in jedem Dorfe, das mir zur Nachtherberge wurde, nachzufragen, ob sich hier ein Neger befinde, der einen Gorilla getötet habe. Wollte das Glück, daß dies der Fall war, so ließ ich ihn zu mir bringen und befragte ihn mit Hilfe eines Dolmetschers über die Sitten und Gewohnheiten der Affen. Diesen Plan verfolgte ich unter den Belingi am Muni, unter Schikeni am Gabun und unter den Kommi am Fernandovaz. Ebenso befragte ich auch die aus dem Innern stammenden Sklaven, die von ihren Herren als Jäger verwendet wurden. Alle Nachrichten, die ich empfing, habe ich verglichen und nur das behalten, das durch das gleichlautende Zeugnis aller Jäger dieser drei verschiedenen Gegenden Innerafrikas bestätigt wurde.

Gorilla ( Gorilla gina)
In Bapuku ist der Gorilla unter den Küstenstämmen nicht bekannt. Der nördlichste Punkt, wo ich von seinem Vorhandensein Kunde erhielt, war das Ufer eines kleinen Flusses bei St. Jones. Am Muni findet er sich weniger häufig als um den Gabun, und in den Waldungen am Fernandovaz wiederum häufiger als dort. Glaubwürdige Berichte bestätigen, daß er in Majumba, von dem Battell spricht, und nach Süden hin bis nach Loango vorkommt; ich bin jedoch geneigt zu glauben, daß er sich über ein weit größeres Gebiet verbreitet, als wir gegenwärtig annehmen. Der Schimpanse lebt nach Norden hin bis zur Sierra Leona, und ich nehme an, daß der Gorilla sich in demselben Gebiete wie jener findet. Der Schimpanse hält sich mehr an der Seeküste und in offeneren Gegenden auf als der Gorilla, und darin liegt die Erklärung, daß man jenen besser kennt als diesen. Die Fens erzählten mir, der »Nji« sei sehr häufig in dem weiten Lande gegen Nordosten, von dem sie ausgewandert wären, und man höre dort seinen Schrei in unmittelbarer Nähe der Stadt; und ebenso wurde mir in Ngumbi gesagt, daß der Gorillatanz – ein Tag der Neger, der die bezeichnendsten Bewegungen des Gorillas nachzuahmen versucht – in einem neunzig Tagereisen nach Osten hin gelegenen Lande seinen Ursprung habe.
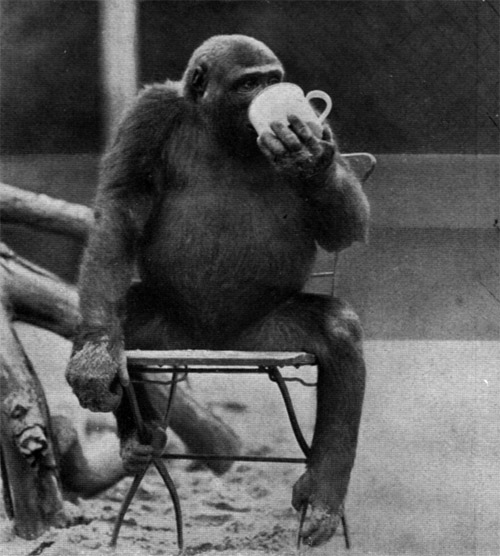
Gorilla ( Gorilla gina) trinkend
Während der Schimpanse in der Nachbarschaft kleiner Steppen haust, scheint der Gorilla das düstere Zwielicht der dichtesten Wälder zu lieben. Er läuft auf allen Vieren, und man sieht ihn zuweilen allein, zuweilen in Begleitung eines Weibchens und Jungen. Von den Bäumen bricht er sich Zweige und Blätter, die sich in einer ihm erreichbaren Höhe über dem Boden befinden. Zuweilen erklettert er auch einen Baum, um dessen Früchte zu genießen. Eine Grasart, die in kleinen Büscheln wächst, liebt er so, daß man sein Vorkommen da, wo dieses Gras vorhanden, fast mit Sicherheit annehmen kann. Morgens und abends besucht er die Pflanzungen der Dörfer, frißt Pisang und Zuckerrohr und läßt seinen kläglichen Schrei vernehmen. Nachts erwählt er sich einen hohlen Baum, um auf ihm zu schlafen. Wenn das Weibchen trächtig ist, baut das Männchen, meist in einer Höhe von fünf bis acht Metern über dem Boden, ein Nest, d. h. ein bloßes Lager aus trockenen Stecken und Zweigen, die es mit den Händen zusammenschleppt. Hier bringt das Weibchen sein Junges zur Welt und verläßt dann das Nest. Während der Brunftzeit kämpfen die Männchen um ihre Weibchen. Ein glaubwürdiger Zeuge sah zwei von ihnen im Kampfe; einer war viel größer als der andere, und der kleinere wurde getötet. Aus dieser Tatsache scheint mir hervorzugehen, daß die Gorillas in Vielehigkeit leben wie andere Tiere, die um die Weibchen kämpfen. Das gewöhnliche Geschrei des Gorillas ist kläglich, das Wutgeschrei dagegen ein scharfes, rauhes Bellen, ähnlich dem Gebrüll eines Tigers.
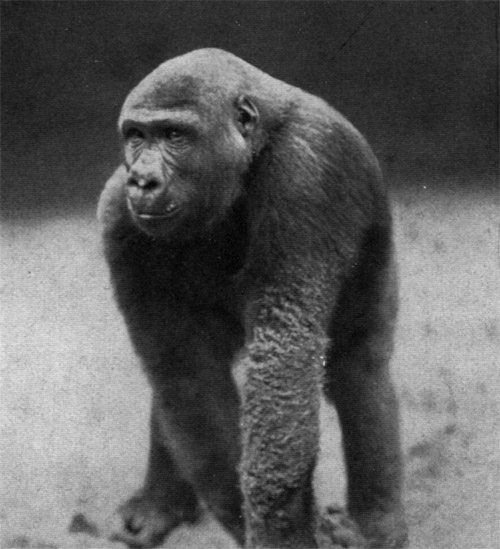
Gorilla ( Gorilla gina) stehend
Entsprechend der Neigung der Neger, alles zu übertreiben, hörte ich anfänglich die verschiedensten Geschichten bezüglich der Wildheit des Gorilla. Als ich aber die wirklichen Jäger befragte, fand ich sie, so weit ich zu urteilen vermochte, wie alle mutigen Leute bescheiden und eher schweigsam als geschwätzig. Ihre Mitteilungen über die Wildheit der Affen reichen kaum bis an die Erzählungen von Savage und Ford heran. Sie leugnen, daß der Gorilla, ohne gereizt zu sein, den Menschen stets angreife. Laßt ihn allein, sagen sie, und er läßt euch allein. Wenn er aber beim Fressen oder im Schlafe plötzlich überrascht wird, dreht er sich in einem Halbkreise herum, heftet seine Augen fest auf den Mann und stößt einen unwillig klagenden Schrei aus. Versagt das Gewehr des Jägers, oder wird der Affe nur verwundet, so läuft er zuweilen davon; manchmal aber stürzt er sich mit wütendem Blicke, herunterhängender Lippe und nach vorn überfallendem Haarschopfe auf den Gegner. Es scheint nicht, daß er sehr behend sei; denn die Jäger entkommen ihm häufig. Er greift stets auf allen Vieren an, packt den betreffenden Gegenstand, reißt ihn in seinen Mund und beißt ihn. Die Geschichte vom Zusammenbeißen des Gewehrlaufes wird allgemein erzählt, ist aber durchaus nicht wunderbar, weil die billigen Gewehre aus Birmingham von jedem starkkieferigen Tiere zusammengequetscht werden dürften. Von den verschiedensten Seiten her hörte ich erzählen, daß Leute durch den Gorilla getötet worden seien; immer aber fand ich, daß solche Erzählungen auf Überlieferungen sich gründeten. Daß ein Mann von einem Gorilla umgebracht werden kann, möchte ich keinen Augenblick bezweifeln, daß aber kein Mann seit Menschengedenken umgebracht worden ist, kann ich mit Bestimmtheit versichern. Der Jäger, der mich in den Waldungen von Ngumbi führte, wurde einst von einem Gorilla verwundet. Seine Hand war vollständig verkrüppelt und die Narben der Zahnwunden am Gelenke noch sichtbar Ihn forderte ich auf, mir genau die Art und Weise des Angriffes eines Gorillas zu zeigen. Ich stellte den Jäger vor, er den Gorilla. Er nahm eine gebückte Stellung an, und ich tat, als ob ich ihn schießen wollte. Nun kam er auf allen Vieren auf mich zu, ergriff meine Hand am Gelenke, zog sie zu seinem Munde, biß hinein und lief davon. So, sagte er, hat der Gorilla mit mir getan. Durch solche einfache Zeugen gelangt man unter den Negern am ersten zur Wahrheit. Der Leopard gilt allgemein als ein wilderes und gefährlicheres Tier als der Gorilla. Auch der Schimpanse greift, wenn er angefallen wird, einen Menschen an; dasselbe tut der Orang-Utan, dasselbe tun in der Tat alle Tiere vom Elefanten bis zu den Kerbtieren herunter. Ich kann also keinen Grund zu der Annahme finden, daß der Gorilla wilder und mehr geneigt zum Angriffe auf einen Menschen sei als andere Tiere, die, wie unser Affe, bedächtig und furchtsam sind, und die ihre ausgezeichnete Befähigung im Riechen und Hören sich zunutze machen, um vor dem Menschen zu entfliehen.
In meiner bescheidenen Eigenschaft, als ein bloßer Sammler von Tatsachen, wünsche ich nichts weiter als zu der Wahrheit zu gelangen. Meine Angaben unterscheiden sich von denen meiner Vorgänger, und ich muß frei zugestehen, daß für die eine wie für die andere Seite gleiche Berechtigung vorliegt. Alle Neger sind geneigt, eher zu übertreiben als zu unterschätzen. Ich habe eine größere Anzahl von Zeugen befragt als vielleicht Wilson, Savage und Ford zusammen und, nachdem die Frage einmal wichtig geworden war, doppelte Vorsicht bei meinen Untersuchungen angewendet; aber jene hatten ihrerseits großen Vorteil über mich, weil sie die Sprache der Eingeborenen kannten und keiner Dolmetscher bedurften, auch besser mit dem Wesen der Eingeborenen vertraut waren als ich. Den bezüglichen Wert unserer Mitteilungen vermag ich also nicht bestimmt abzuschätzen, schon weil ich nicht weiß, von welchem Stamme jene ihre Nachrichten erhalten haben. Das, was ich aus persönlicher Anschauung versichern kann, ist folgendes: Ich habe die Nester des Gorillas gesehen und beschrieben, bin jedoch nicht imstande, bestimmt zu sagen, ob sie als Betten oder nur als zeitweilige Lager benutzt werden. Ich habe ebenso wiederholt die Fährte des Gorillas gefunden und darf deshalb behaupten, daß der Affe gewöhnlich auf allen Vieren läuft. Niemals habe ich mehr Fährten gesehen als von zwei Gorillas zusammen. Auch habe ich einen jungen Gorilla und einen jungen Schimpanse in gefangenem Zustande beobachtet und darf versichern, daß beide gleich gelehrig sind. Endlich kann ich behaupten, daß der Gorilla wenigstens zuweilen vor dem Menschen flüchtet; denn ich war nahe genug, um zu hören, daß einer von mir weglief.
Von den vielen Erzählungen über den Gorilla, die mir mitgeteilt wurden, habe ich alle nicht genug beglaubigten weggelassen. Eine von diesen berichtet zum Beispiel, daß zuweilen eine Gorillafamilie einen Baum erklettere und sich an einer gewissen Frucht toll und voll fresse, während der alte Vater unten am Fuße des Baumes verbleibe. Kannst du, sagen die Eingeborenen, nahe genug herankommen, um ihn zu erlegen, so kannst du auch den Rest der Familie töten. Die zweite Geschichte ist die, die von allen großen Affen berichtet wird, daß sie Frauen mit sich nehmen. In einem Dorfe am rechten Ufer des Fernandovaz wurde mir erzählt, daß die Frauen, während sie zum Brunnen gingen, sehr häufig von Gorillas gejagt werden; ja, man brachte mir sogar eine Frau, die versicherte, selbst die Leidenschaft eines Gorillas erlitten zu haben und ihm kaum entkommen zu sein. In alledem kann ich nichts Wunderbares finden; denn wir wissen, daß die Affen höchst empfängliche Tiere sind. Demungeachtet wird man berechtigt sein, Zweifel zu hegen, wenn erzählt wird, daß eine Frau in die Wälder geschleppt und halbwild unter den Affen gelebt habe.«
Winwood Reade schließt seine Mitteilungen mit der Bemerkung, daß er nicht imstande gewesen sei, etwas zu erfahren, worin der Gorilla vom Schimpansen wesentlich sich unterscheide. Beide Tiere bauen Nester, beide gehen auf allen Vieren, beide greifen in ähnlicher Weise an, beide vereinigen sich, obschon sie durchaus nicht gesellig sind, zuweilen in größerer Anzahl usw. »Ein weißer Mann hat bis jetzt weder einen Gorilla noch einen Schimpansen erlegt. Die Vorsicht der Tiere, die Ungewißheit ihres Aufenthaltes, die Eifersucht der eingeborenen Jäger stempelt eine derartige Jagd zu einem sehr schwierigen Unternehmen.«

Schimpanse ( Simia troglodytes)
Der vorstehend mehrfach erwähnte Schimpanse, »Barris«, »Inschoko«, »Insiëgo«, »Soko«, »Nschniëgo«, »Baâm«, und wie er sonst noch bei den Eingeborenen heißen oder von Reisenden genannt worden sein mag (Simia, troglodytes), wird gegenwärtig ebenfalls als Vertreter einer gleichnamigen Sippe oder Untersippe betrachtet. Er ist beträchtlich kleiner, im Rumpfe verhältnismäßig viel kürzer als der Gorilla, trotzdem er dieselbe Anzahl von rippentragenden und Lendenwirbeln (dreizehn und vier) besitzt wie dieser, sein Kopf verhältnismäßig groß, die breite Schnauze wenig vorgezogen, der Vorderarm für Menschenaffen auffallend kurz, die Hand gestreckt und schmal, das Bein ebenfalls kurz, der Fuß der Hand entsprechend gebaut; auch zeigt der hinterste Backenzahn nur vier Höcker und einen hinteren Anhang. Sein Gesicht ist ziemlich breit und flach, die Stirn tritt namentlich bei alten merklich, jedoch weit weniger als beim Gorilla zurück und das Kinn in demselben Verhältnisse vor, so daß der Gesichtswinkel 55 Grad beträgt. Die Augenbrauenbogen stehen deutlich vor; die Nase ist klein und flach, der Mund übermäßig groß; die schmalen, weit vorstreckbaren Lippen sind im Leben vielfach gefaltet. Die Ohrmuschel ist viel größer, steht auch weiter vom Kopfe ab als bei dem Menschen, und zeigt fast denselben Bau wie beim Gorilla. Die Arme reichen bei aufrechtem Gange sehr weit am Beine herab und die Fingerspitzen der ausgestreckten Hand berühren fast die Knöchel. Um das Verhältnis der Glieder zum Leibe anzugeben, will ich die Maße eines jungen Schimpansen, den ich lebend untersuchen konnte, angeben. Es beträgt die Länge vom Scheitel bis zum Steiße 52 Zentimeter, die Armlänge von der Achselhöhle bis zur Fingerspitze 44 Zentimeter, die Beinlänge bis zur Zehenspitze 41 Zentimeter, die Länge des Oberarmes 19 Zentimeter, die Länge des Unterarmes 19 Zentimeter, die Länge der Hand 13 Zentimeter, die Länge des Oberschenkels 17 Zentimeter, des Unterschenkels 17 Zentimeter, des Fußes oben gemessen 12 Zentimeter, der Umfang des Schädels über dem Brauenbogen gemessen 38 Zentimeter, der Umfang des Halses 26 Zentimeter, der Umfang des Leibes unter den Armen 50 Zentimeter.
Ein ziemlich dichtes, aus mittellangen schlichten und glänzenden Haaren bestehendes Kleid, das sich bartartig an beiden Gesichtsseiten und schopfig auf dem Hinterkopfe verlängert, deckt gleichmäßig Stirn, Scheitel, Hinterkopf, Nacken und Rücken, wogegen die Unterseite weit spärlicher bekleidet und die Kinn- und Weichengegend nur sehr dünn behaart ist. In der Gegend des nackten Afters sieht das Haar weißlich aus. Die Färbung des unbehaarten Gesichtes ist ein grauliches Ledergelb, das zwischen den Augen in Braunschwarz übergeht, ohne daß jedoch letztere Färbung zur vorherrschenden würde. Hände und Füße sehen lederbraun, die Lippen blaßrot, die Ohren lebergelb aus. Die milden, sanften Augen haben licht-zimmetbraune Iris.
Inwiefern das Tier in höherem Alter von dem eben beschriebenen Jungen abweicht, vermag ich nicht zu sagen, weil ich noch niemals einen lebenden Schimpansen gesehen habe, der bereits über die Jahre der Kindheit hinaus gewesen wäre, und mich auf eine Beschreibung getrockneter Bälge nicht einlassen mag. Nur so viel will ich noch bemerken, daß der erwachsene Schimpanse nach Versicherung der Eingeborenen zuweilen bis 1,5 Meter hoch wird und sich durch weißen Kinnbart, der auch bei den Jungen bereits angedeutet ist, besonders auszeichnet. Die Knochen des Schimpansen sind, laut Hartmann, im ganzen schlanker und zierlicher als diejenigen des Gorillas. Dem Schädel des männlichen Schimpansen fehlt der riesige Knochenkamm des ebengenannten Verwandten gänzlich; ebensowenig bemerkt man an ihm die beim männlichen Gorilla sehr mächtigen, beim weiblichen deutlich erkennbaren Knochenwülste über den Augen.
Um zu beweisen, daß die Alten den Schimpansen gekannt haben, führt man das berühmte Mosaikbild an, das einstmals den Tempel der Fortuna in Präneste schmückte und unter vielen anderen Tieren der oberen Nilländer auch unseren Menschenaffen dargestellt haben soll. Erwähnt wird dieser von vielen Schriftstellern der letztvergangenen Jahrhunderte meist unter den Namen »Insiëgo« oder »Nschniëgo«, die er in Mittelafrika heute noch führt. Ein junger Schimpanse wurde in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts lebend nach Europa gebracht, von Tulpius und Tyson zergliedert und von Dapper beschrieben. Von dieser Zeit an gelangte das Tier wiederholt zu uns, und neuerlich trifft es sogar mit einer gewissen Regelmäßigkeit aus dem europäischen Tiermarkte ein: im Jahre 1870 wurden fünf Stück allein nach Deutschland gebracht.
Während man früher Ober- und Niederguinea für seine ausschließliche Heimat hielt, wissen wir gegenwärtig durch Heuglin und Schweinfurth, daß er sich bis tief in das Innere von Afrika verbreitet. »Auf dem dichtbelaubten Hochholz längs der Flüsse im Lande der Niamniam«, sagt Heuglin, »haust in Paaren und Familien der Mban (richtiger Boâm), ein Affe von der Größe eines Mannes und von wildem Wesen, der sich nicht scheut, den ihn verfolgenden Jäger anzugreifen. Derselbe baut sich große Nester auf den Kronen der Bäume und versieht sie mit einem dichten Schutzdache gegen den Regen. Er hat ein» olivenschwärzliche, nicht dichte Behaarung, nacktes, fleischfarbenes Gesicht und weißliches Gesäß.« Vorstehende Schilderung die durch Schweinfurths Angaben durchaus bestätigt wird, kann sich nur auf den Schimpansen beziehen, und diese Ansicht wird unterstützt durch die Berichte des Letztgenannten und Hartmanns über die wenigen Stücke dieses mittelafrikanischen Affen, die in schlecht zubereiteten Bälgen nach Europa gelangt sind. Schweinfurth erfuhr, daß ein Krainer Jäger, Klancznik, im Jahre 1863 außer einer Ladung Sklaven auch einen lebenden Schimpansen vom oberen Weißen Flusse mitbrachte. Der Affe starb, noch ehe er Chartum erreichte, wurde dort abgehäutet und der Hochschule für Ärzte in Kairo überlassen. Hier sah Schweinfurth den Balg; auf der Pariser Ausstellung konnte Hartmann einen zweiten untersuchen. Beide Forscher sprechen sich dahin aus. daß man das Tier als Schimpansen bestimmen müsse. »Im Dezember 1868« schaltet Schweinfurth hier ein, »fand ich in Chartum einen dritten, schlecht ausgestopften, aber sehr großen Balg des betreffenden Affen, der sich gegenwärtig im Berliner Museum befindet und nach Hartmanns Überzeugung von dem westafrikanischen Schimpansen sich nicht unterscheidet. Unter den von mir bereisten Ländern des tiefsten Innern von Afrika nenne ich als Heimat dieses Menschenaffen vor allen anderen das waldreiche Land des Königs Uando, weil das Tier hier besonders häufig auftreten muß. In einem Dorfe nahm ich zwölf vollständige Schädel desselben von einem einzigen der hier gebräuchlichen Merkpfähle, die mit Beutezeichen der Jagd behangen zu werden pflegen. In dem bevölkerten Monbuttulande dagegen, das weite, dem Bananenbau gewidmete Lichtungen in sich schließt, scheint das menschenscheue Tier nur ein ziemlich vereinzeltes Dasein zu führen. Auch mir wurde erzählt, daß er auf den von ihm bewohnten Bäumen sich Nester errichte.« In Ober- und Niederguinea bewohnt der Schimpanse die großen Wälder in den Flußtälern und an der Küste, scheint jedoch trockene Gegenden feuchten vorzuziehen. Auf der nördlichen Seite des Kongo soll er, laut Monteiro, sehr häufig sein.
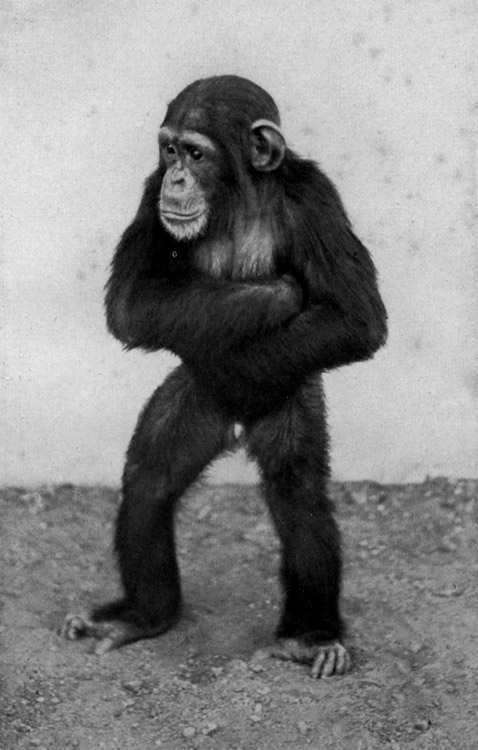
Schimpanse ( Simia troglodytes) stehend
»Man kann nicht sagen«, berichtet Savage, »daß die Schimpansen gesellig leben, da man selten mehr als ihrer fünf, höchstens ihrer zehn zusammen findet. Auf gute Gewähr mich stützend, darf ich behaupten, daß sie sich gelegentlich in größerer Anzahl versammeln, um zu spielen. Einer meiner Berichterstatter versichert, bei einer solchen Gelegenheit einmal nicht weniger als ihrer fünfzig gesehen zu haben, die sich durch Jubeln, Schreien und Trommeln auf alten Stämmen erfreuten. Sie meiden die Aufenthaltsorte der Menschen soviel als möglich. Ihre Wohnungen, mehr Nester als Hütten, errichten sie auf Bäumen, im allgemeinen nicht hoch über dem Boden. Größere oder kleinere Zweige werden niedergebogen, abgeknickt, gekreuzt und durch einen Ast oder einen Gabelzweig gestützt. Zuweilen findet man ein Nest nahe dem Ende eines dicken blattreichen Astes, acht bis zwölf Meter über der Erde: doch habe ich auch eins gesehen, das nicht niedriger als dreizehn Meter sein konnte. Einen festen Standort haben die Schimpansen nicht, wechseln ihren Platz vielmehr beim Aufsuchen der Nahrung oder aus sonstigen Gründen, je nach den Umständen. Wir sahen sie öfters auf hoch gelegenen Stellen, wohl nur deshalb, weil die dem Reisbau der Eingeborenen günstigeren Niederungen öfters gelichtet werden, und jenen dann passende Bäume zum Bau ihrer Nester mangeln. Selten sieht man mehr als ein oder zwei Nester auf einem und demselben Baume oder sogar in derselben Umgebung. Doch hat man einmal deren fünf gefunden.« Nester, wie solche Du-Chaillu bespricht und abbildet, wahrhaft künstliche Flechtereien nämlich, beschreibt kein einziger der übrigen Berichterstatter. In der Ruhe nimmt der freilebende Schimpanse gewöhnlich eine sitzende Stellung an. Man sieht ihn in der Regel stehen oder gehen; wird er dabei entdeckt, so fällt er unverzüglich auf alle Viere und entfernt sich fliehend von dem Beobachter. Sein Bau ist derart, daß er nicht ganz aufrecht stehen kann, sondern stets nach vorn neigt; wenn er steht, sieht man ihn die Hände über dem Hinterhaupte zusammenschlagen oder über der Lendengegend kreuzen, was notwendig zu sein scheint, um sich im Gleichgewichte zu erhalten. Die Zehen sind beim Erwachsenen stark gebogen und nach innen gewendet, können auch nicht vollständig ausgestreckt werden. Beim Versuche hierzu erhebt sich die Haut des Fußrückens in dicken Falten, woraus hervorgeht, daß völlige Streckung des Fußes ihm unnatürlich ist. Die ihm bequemste Stellung ist die auf allen Vieren, wobei der Leib auf den Knöcheln ruht. Infolge des Gebrauches sind letztere verbreitert und wie die Fußsohle mit schwieliger Haut bekleidet. Wie man schon aus dem Bau vermuten kann, ist der Schimpanse ein geschickter Kletterer. Bei seinen Spielen schwingt er sich auf weite Entfernungen von einem Baume zum anderen und springt mit erstaunenerregender Behendigkeit. Nicht selten steht man die »alten Leute«, wie einer meiner Berichterstatter sich ausdrückt, unter einem Baume sitzen, mit Aufzehren von Früchten und freundschaftlichem Geschwätz sich unterhaltend, während ihre Kinder um sie herumspringen und ausgelassen von Baum zu Baum klettern. Die Nahrung besteht wahrscheinlich aus denselben Pflanzen und Früchten, die der Gorilla verzehrt: Früchte, Nüsse, Blatt- und Blütenschößlinge, vielleicht auch Wurzeln bilden wohl die Hauptspeise. Nicht selten soll er Bananen und andere Fruchtbäume besuchen, die die Neger zwischen ihren Maisfeldern anpflanzen, oder sich in verlassenen Negerdörfern, in denen die Papaya in großer Menge wächst, einfinden und dort so lange verweilen, als es Nahrung gibt, nach Aufzehrung derselben aber wieder Wanderungen von größerer oder geringerer Ausdehnung unternehmen.
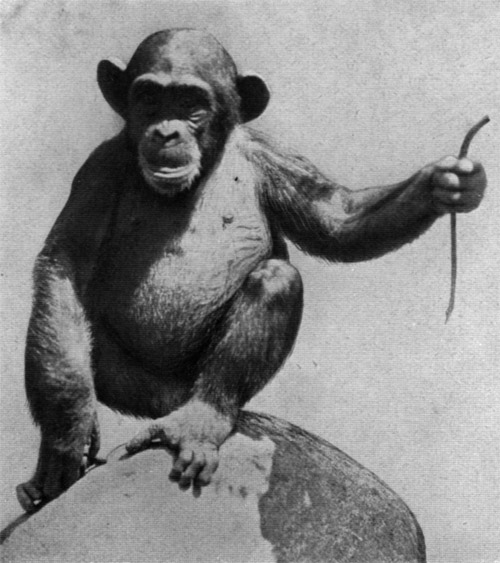
Schimpanse ( Simia troglodytes) hockend
Der Schimpanse bekundet scharfen Verstand und warme Liebe zu seinen Jungen. Ein Weibchen, das sich mit seinem Manne und zwei Jungen auf einem Baume befand und von dem Jäger aufgefunden wurde, stieg zuerst mit großer Schnelligkeit herunter und versuchte mit dem Männchen und einem Jungen ins Dickicht zu entfliehen. Bald darauf aber kehrte es zur Rettung des zurückgebliebenen Jungen zurück, stieg wieder auf den Baum, nahm das Kind in seine Arme und erhielt in demselben Augenblick die tödliche Kugel, die auf dem Wege zum Herzen der Mutter durch den Vorderarm des Jungen drang. In einem andern Falle blieb die Mutter, nachdem sie entdeckt war, mit ihrem Jungen auf dem Baume und folgte aufmerksam dem Vorgehen des Jägers. Als er zielte, bewegte sie ihre Hand, genau in der Weise, wie ein Mensch tun würde, um den Gegner zum Abstehen und Fortgehen zu bewegen. Verwundete suchen das Blut durch Aufdrücken der Hand oder, wenn dies nicht ausreicht, durch Auflegen von Blättern und Gras zu stillen, schreien auch laut, »nicht unähnlich einem Menschen, der plötzlich in große Not gerät.« Ferner wird erzählt, daß sich die Schimpansen in ihrer geschlechtlichen Liebe weit weniger abschreckend als andere Affen zeigen, sogar eine gewisse Sittsamkeit an den Tag legen sollen. Auch von ihnen geht überall, wo sie vorkommen, das Gerücht, daß die Männchen an weiblichen Menschen Gefallen finden, und diese Behauptung erscheint denjenigen, die das Gebaren großer männlicher Affen beim Anblicke von Frauen aus eigener Erfahrung kennengelernt haben, durchaus nicht unwahrscheinlich. Über Zeit und Umstände der Paarung, Schwangerschaft und Entwicklung der Jungen usw. sind mir keinerlei Angaben bekannt; ich weiß bloß aus Beobachtung an gefangenen Jungen, daß deren Wachstum weit langsamer vor sich geht, als man bisher angenommen zu haben scheint. Der Zahnwechsel beginnt nicht vor dem zurückgelegten vierten Lebensjahre, wahrscheinlich noch um ein Jahr später. Ein Schimpanse, den ich drei Jahre lang pflegte, war, als er in meinen Besitz kam, jedenfalls älter als zwei Jahre und wechselte erst kurz vor seinem Tode die unteren Schneidezähne: der Zahnwechsel würde also, die Richtigkeit meiner Annahme vorausgesetzt, erst im sechsten Lebensjahre stattgefunden haben. Wenn man, hierauf fußend, den Schimpansen bezüglich seines Wachstums und des zu erreichenden Alters dem Menschen annähernd gleichstellt, wird man sich schwerlich irren.
Unter den Eingeborenen Westafrikas geht eine Überlieferung, nach der die Schimpansen einmal Mitglieder ihres eigenen Stammes gewesen seien, wegen ihrer schlechten Gewohnheiten aber aus aller menschlichen Gesellschaft verstoßen und infolge hartnäckigen Beharrens bei ihren gemeinen Neigungen allmählich auf den gegenwärtigen Zustand herabgesunken wären. Dies hindert die Eingeborenen übrigens nicht, die Herren Vettern zu essen; ja deren Leiber gelten, mit Palmöl gekocht, sogar für ein äußerst schmackhaftes Gericht.
Wie es scheint, kämpft der Schimpanse mit dem Menschen einzig und allein, um sich zu verteidigen. Fürchtet er gefangen zu werden, so leistet er dadurch Widerstand, daß er seine Arme um den Gegner schlingt, ihn zu sich heranzieht und zu beißen versucht. Savage hat einen Mann gesehen, der so an den Füßen bedeutend verwundet worden war. »Die starke Entwicklung der Eckzähne beim erwachsenen Schimpansen möchte Neigung zu Fleischnahrung andeuten. Solche zeigt sich jedoch nur, wenn er gezähmt wurde. Anfänglich weist er Fleisch zurück, nach und nach aber verzehrt er es mit einer gewissen Vorliebe. Die Eckzähne, die sich frühzeitig entwickeln, spielen also nur eine Rolle bei der Verteidigung. Kommt ein Schimpanse mit dem Menschen in Zwiespalt, so ist beinahe das erste, was er tun will, beißen.«
»Leider«, erzählt Schweinfurth, »war es mir noch nicht vergönnt, im Lande der Niamniam eine Jagd auf Schimpansen veranstalten zu sehen. Eine solche bereitet nämlich viele Schwierigkeiten. Nach Aussage der Niamniam selbst gehören dazu mindestens zwanzig bis dreißig entschlossene Jäger, denen die heikle Aufgabe zufällt, in den achtzig und mehr Fuß hohen Bäumen mit dem Schimpansen um die Wette umherzuklettern und dabei die gewandten und kräftigen Tiere in Fangnetze zu locken, in denen sie, einmal verwickelt, mit Lanzenwürfen leicht abgetan werden können. In solchen Fällen sollen sie sich grimmig und verzweifelt wehren, in die Enge getrieben, den Jägern sogar die Speere zu entreißen vermögen, mit denen sie dann wütend um sich schlagen. Weit verderblicher aber noch soll den Angreifern der Biß ihrer gewaltigen Eckzähne und die erstaunliche Muskelstärke ihrer nervigen Arme werden.«
Unter allen Menschenaffen gelangt gegenwärtig der Schimpanse am häufigsten lebend zu uns, hält hier aber leider nur ausnahmsweise zwei bis drei Jahre aus, während er, wie man versichert, in Westafrika bis zwanzig Jahre in Gefangenschaft gelebt haben und groß und stark geworden sein soll. Bis jetzt hat man stets beobachtet, daß die Gefangenen sanft, klug und liebenswürdig waren. Grandpret sah auf einem Schiffe ein Weibchen, das man gelehrt hatte, den Backofen zu heizen. Es erfüllte sein Amt zur allgemeinen Zufriedenheit, gab acht, daß keine Kohlen herausfielen, wußte, wenn der Ofen den nötigen Grad von Hitze erlangt hatte, ging hin und berichtete dem Bäcker durch sehr ausdrucksvolle Gebärden davon. Derselbe Affe verrichtete die Arbeit eines Matrosen mit ebensoviel Geschick als Einsicht, wand das Ankertau auf, zog die Segel ein, band sie fest und arbeitete vollkommen zur Zufriedenheit der Matrosen, die ihn zuletzt als ihren Maat betrachteten. Brosse brachte ein Pärchen junger Schimpansen nach Europa, ein junges Männchen und ein Weibchen. Sie setzten sich an den Tisch wie ein Mensch, aßen von allem und bedienten sich dabei des Messers, der Gabel und der Löffel, teilten auch alle Getränke, namentlich Wein und Branntwein, mit den Menschen, riefen die Schiffsjungen, wenn sie etwas brauchten, und wurden böse, wenn diese es ihnen verweigerten, faßten die Knaben am Arme, bissen sie und warfen sie unter sich. Das Männchen wurde krank, und der Schiffsarzt ließ ihn deshalb zur Ader; so oft es sich unwohl fühlte, hielt es ihm stets den Arm hin. Buffon erzählt, daß sein Schimpanse traurig und ernsthaft aussah und sich abgemessen und verständig bewegte. Von den häßlichen Eigenschaften der Paviane zeigte er keine einzige, war aber auch nicht mutwillig wie die Meerkatzen, gehorchte aufs Wort oder auf ein Zeichen, bot den Leuten den Arm an und ging mit ihnen umher, setzte sich zu Tische, benutzte ein Vorstecktuch und wischte sich, wenn er getrunken hatte, damit die Lippen; schenkte sich selbst Wein ein und stieß mit den andern an, holte sich eine Tasse und Schale herbei, tat Zucker hinein, goß Tee darauf und ließ ihn kalt werden, bevor er ihn trank. Niemandem fügte er ein Leid zu, sondern näherte sich jedem bescheiden und freute sich ungemein, wenn ihm geschmeichelt wurde. Traills Schimpansen hielt man einen Spiegel vor: sogleich war seine Aufmerksamkeit gefesselt; auf die größte Beweglichkeit folgte die tiefste Ruhe. Neugierig untersuchte er das merkwürdige Ding und schien stumm vor Erstaunen, blickte sodann fragend seinen Freund an, hieraus wieder den Spiegel, ging hinter diesen, kam zurück, betrachtete nochmals sein Bild und suchte sich durch Betasten desselben zu überzeugen, ob er wirkliche Körperlichkeit oder bloßen Schein vor sich habe: ganz so wie es wilde Völker tun, wenn ihnen zum erstenmal ein Spiegel gereicht wird. Leutnant Sayers erzählt von einem jungen Männchen, das er wenige Tage nach der Gefangenschaft an der Westküste Afrikas erhielt, daß es sehr bald und in hohem Grade vertraut mit ihm wurde, noch innigere Freundschaft aber mit einem Negerknaben schloß und im höchsten Zorn zu kreischen anfing, wenn jener ihn nur für einen Augenblick verlassen wollte. Sehr eingenommen war der Affe für Kleidungsstücke, und das erste Beste, das ihm in den Weg kam, eignete er sich an, trug es sogleich auf den Platz und setzte sich unabänderlich mit selbstzufriedenem Gurgeln darauf, gab es auch gewiß nicht ohne harten Kampf und ohne die Zeichen der größten Unzufriedenheit wieder her. »Als ich diese Vorliebe bemerkte«, fährt der Erzähler fort, »versah ich ihn mit einem Stück Baumwollenzeug, von dem er sich dann zur allgemeinen Belustigung nicht wieder trennen mochte, und das er überallhin mitschleppte, so daß keine Verlockung stark genug war, ihn zum Aufgeben desselben auch nur für einen Augenblick zu bewegen. Die Lebensweise der Tiere in der Wildnis war mir völlig unbekannt; ich versuchte deshalb ihn nach meiner Art zu ernähren und hatte den besten Erfolg. Morgens um acht Uhr bekam mein Gefangener ein Stück Brot in Wasser oder in verdünnter Milch geweicht, gegen zwei Uhr ein paar Bananen oder Pisang, und ehe er sich niederlegte wieder eine Banane, eine Apfelsine oder ein Stück Ananas. Die Banane schien seine Lieblingsfrucht zu sein, für sie ließ er jedes andere Gericht im Stiche, und wenn er sie nicht bekam, war er höchst mürrisch. Als ich ihm einmal eine verweigerte, bekundete er die heftigste Wut, stieß einen schrillen Schrei aus und rannte mit dem Kopfe so heftig gegen die Wand, daß er auf den Rücken fiel, stieg dann auf eine Kiste, streckte die Arme verzweiflungsvoll aus und stürzte sich herunter. Alles dies ließ mich so sehr für sein Leben fürchten, daß ich den Widerstand aufgab. Nun erfreute er sich seines Sieges auf das lebhafteste, indem er minutenlang ein höchst bedeutungsvolles Gurgeln hören ließ: kurz, jedesmal, wenn man ihm seinen Willen nicht tun wollte, zeigte er sich wie ein verzogenes Kind. Aber so böse er auch werden mochte, nie bemerkte ich, daß er geneigt gewesen wäre, seinen Wärter oder mich zu beißen oder sich sonstwie an uns zu vergreifen.«
Ich kann diese Berichte nach eigener Erfahrung bestätigen und vervollständigen, da ich selbst mehrere Schimpansen jahrelang gepflegt und beobachtet habe. Einen solchen Affen kann man nicht wie ein Tier behandeln, sondern mit ihm nur wie mit einem Menschen verkehren. Ungeachtet aller Eigentümlichkeiten, die er bekundet, zeigt er in seinem Wesen und Gebaren so außerordentlich viel Menschliches, daß man das Tier beinahe vergißt. Sein Leib ist der eines Tieres, sein Verstand steht mit dem eines rohen Menschen fast auf einer und derselben Stufe. Es würde abgeschmackt sein, wollte man die Handlungen und Streiche eines so hochstehenden Geschöpfes einzig und allein auf Rechnung einer urteilslosen Nachahmung stellen, wie man es hin und wieder getan hat. Allerdings ahmt der Schimpanse nach; es geschieht dies aber in genau derselben Weise, in der ein Menschenkind Erwachsenen etwas nachtut, also mit Verständnis und Urteil. Er läßt sich belehren und lernt. Wäre seine Hand ebenso willig und gebrauchsfähig wie die Menschenhand, er würde noch ganz anderes nachahmen, noch ganz anderes lernen. Er tut eben so viel er zu tun vermag, führt das aus, was er ausführen kann; jede seiner Handlungen aber geschieht mit Bewußtsein, mit entschiedener Überlegung. Er versteht, was ihm gesagt wird, und wir verstehen auch ihn, weil er zu sprechen weiß, nicht mit Worten allerdings, aber mit so ausdrucksvoll betonten Lauten und Silben, daß wir uns über sein Begehren nicht täuschen. Er erkennt sich und seine Umgebung und ist sich seiner Stellung bewußt. Im Umgange mit dem Menschen ordnet er sich höherer Begabung und Fähigkeit unter, im Umgange mit Tieren bekundet er ein ähnliches Selbstbewußtsein wie der Mensch. Er hält sich für besser, für höher stehend als andere Tiere, namentlich als andere Affen. Sehr wohl unterscheidet er zwischen erwachsenen Menschen und Kindern: erstere achtet, letztere liebt er, vorausgesetzt, daß es sich nicht um Knaben handelt, die ihn necken oder sonstwie beunruhigen. Er hat witzige Einfälle und erlaubt sich Späße, nicht bloß Tieren, sondern auch Menschen gegenüber. Er zeigt Teilnahme für Gegenstände, die mit seinen natürlichen Bedürfnissen keinen Zusammenhang haben, für Tiere, die ihn sozusagen nichts angehen, mit denen er weder Freundschaft anknüpfen, noch in irgendein anderes Verhältnis treten kann. Er ist nicht bloß neugierig, sondern förmlich wißbegierig. Ein Gegenstand, der seine Aufmerksamkeit erregte, gewinnt an Wert für ihn, wenn er gelernt hat, ihn zu benutzen. Er versteht Schlüsse zu ziehen, von dem einen aus etwas anderes zu folgern, gewisse Erfahrungen zweckentsprechend aus ihm neue Verhältnisse zu übertragen. Er ist listig, sogar verschmitzt, eigenwillig, jedoch nicht störrisch; er verlangt, was ihm zukommt, ohne rechthaberisch zu sein, bekundet Launen und Stimmungen, ist heute lustig und aufgeräumt, morgen traurig und mürrisch. Er unterhält sich in dieser und langweilt sich in jener Gesellschaft, geht auf passende Scherze ein und weist unpassende von sich. Seine Gefühle drückt er aus wie der Mensch. In heiterer Stimmung lacht er freilich nicht, aber er schmunzelt doch wenigstens, d. h. verzieht sein Gesicht und nimmt den unverkennbaren Ausdruck der Heiterkeit an. Trübe Stimmungen dagegen verkündet er ganz in derselben Weise wie ein Mensch, nicht allein durch seine Mienen, sondern auch durch klägliche Laute, die jedermann verstehen muß, weil sie menschlichen mindestens in demselben Grade ähneln wie tierischen. Wohlwollen erwidert er durch die gleiche Gesinnung, Übelwollen womöglich in eben derselben Weise. Bei Kränkungen gebärdet er sich wie ein Verzweifelter, wirft sich mit dem Rücken auf den Boden, verzerrt sein Gesicht, schlägt mit Händen und Füßen um sich, kreischt und rauft sich sein Haar. Andere Affen bekunden ähnliche Geistesfähigkeiten: beim Schimpansen aber erscheint jede Äußerung des Geistes klarer, verständlicher, weil sie dem, was wir beim Menschen sehen, entschieden ähnlicher ist als die Verstandesäußerung jener Tiere.
Der Schimpanse, der, während ich diese Zeilen in die schnellläufige Feder des Eilschreibers fließen lasse, in meinem Zimmer umhergeht und sich nach Herzenslust unterhält, langte in der traurigsten Verfassung an. Er war ermüdet und ermattet von der Reise, krank und leiblich und geistig herabgekommen. In dieser Lage verlangte er die sorgsamste Pflege, eine solche, wie man sie einem kranken Kinde angedeihen läßt, und erhielt diese und eine treffliche Erziehung durch einen der ausgezeichnetsten Tierpfleger, meinen alten Freund Seidel, in der freundlichsten Weise. Kein Wunder, daß er an diesem Manne hängt wie ein Kind an seiner Mutter, daß er sich seinen Wünschen fügt und in überraschend kurzer Zeit zu dem folgsamsten Pfleglinge unter der Sonne geworden ist. Namentlich seitdem er seine Krankheit vollständig überwunden hat, zeigt er sich als ein ganz anderes Geschöpf als vorher. Er ist rege und tätig ohne Unterlaß, vom frühen Morgen bis zum späten Abend, sucht sich ununterbrochen mit irgend etwas zu beschäftigen, und sollte er auch nur mit seinen Händen klatschend auf seine Fußsohlen klopfen, ganz so wie Kinder es ebenfalls zu tun pflegen. So ungeschickt er zu sein scheint, wenn er geht, so gewandt und behend ist er wirklich, und zwar bei jeder Bewegung. In der Regel geht er in der sämtlichen Menschenaffen eigenen Weise auf allen Vieren und zwar mit schiefer Richtung seines Leibes, indem er sich mit den Händen auf die eingeschlagenen Knöchel stützt und entweder ein Hinterbein zwischen den Vorderarmen und eins außerhalb derselben setzt oder beide Hinterbeine zwischen die Vorderarme schiebt. Trägt er jedoch etwas, so richtet er sich fast zu voller Höhe auf, stützt sich nur mit einer Hand auf den Boden und bewegt sich dann eigentlich ebenso geschickt als sonst. Wirklich aufrecht, also nur auf beiden Beinen allein, ohne sich mit einem Arm zu stützen, geht er bloß dann, wenn er in besondere Erregung gerät, beispielsweise wenn er glaubt, daß sich sein Pfleger von ihm entfernen wolle, ohne ihn mitzunehmen. Bei dieser Bewegung hält er die im Armgelenk gebogenen Hände seitlich vom Kopfe ab nach oben, um das Gleichgewicht herzustellen. Der Gang auf allen Vieren sieht äußerst holperig aus, fördert aber verhältnismäßig rasch genug und jedenfalls mehr, als ein Mensch zu laufen imstande ist. Eigentliche Beweglichkeit und Behendigkeit entfaltet er aber doch nur im Klettern, und hierin unterscheidet er sich, wie wahrscheinlich alle übrigen Menschenaffen, wesentlich von seinen Ordnungsverwandten. Er klettert nach Art eines Menschen, nicht nach Art eines Tieres, und turnt in der ausgezeichnetsten Weise. Mit seinen Armen ergreift er einen Ast oder sonstigen Halt und schwingt sich nun mit überraschender Gewandtheit über ziemlich weite Entfernungen weg, macht auch verhältnismäßig große Sätze, immer aber so, daß er mit einer Hand oder mit beiden einen neuen Halt ergreifen kann. Die Füße spielen beim Klettern und Turnen den Händen gegenüber eine untergeordnete Rolle, obgleich sie selbstverständlich ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und die höchst beweglichen Zehen gebührend benutzt werden. Mit dem ihm gebotenen Turngeräte macht er sich vom Morgen bis zum Abend zu schaffen, und weiß ihnen fortwährend neue Seiten der Verwendung abzugewinnen. Er schaukelt sich minutenlang mit Behagen, klettert an seiner hängenden Leiter auf und ab, setzt diese in Bewegung, geht am Reck, mit den Händen festhängend, hin und her und führt andere Turnkünsteleien mit vollendeter Fertigkeit aus, ohne jemals im geringsten unterrichtet worden zu sein. So sicher er sich auf diesen ihm bekannten Turngeräten fühlt, so ängstlich gebärdet er sich, wenn er auf einen Gegenstand klettert, der ihm nicht fest genug zu sein scheint: ein wackeliger Stuhl z. B. erregt sein höchstes Bedenken. Den Händen fällt der größte Teil aller Arbeiten zu, die er verrichtet. Mit ihnen untersucht und betastet, mit ihnen packt er Gegenstände, während der Fuß nur aushilfsweise als Greifwerkzeug benutzt wird. Er gebraucht seine Hände im wesentlichen ganz so wie ein Mensch und unterscheidet sich von diesem hauptsächlich darin, daß er die einzelnen Finger der Hand unter sich weniger als der Mensch bewegt, d. h. gewöhnlich mit dem Daumen und der übrigen ganzen Hand zugreift; doch wendet er bei genaueren Untersuchungen sehr regelmäßig auch den Zeige- oder Mittelfinger an.
Winwood Reade erzählt, daß ihm auf die Frage, ob sich der Gorilla auf die Brust schlage und ein Geräusch wie das einer Trommel hervorbringe, erwidert worden sei, der Gorilla habe keine Trommel, Wohl aber der Schimpanse; daß man ihn dann, als er die Trommel zu sehen gewünscht, zu einem hohlen Baume geführt und ihm gezeigt habe, wie der Schimpanse diesem durch Stampfen mit den Beinen einen trommelnden Ton zu entlocken wisse. Der Bericht der Neger ist gewiß vollständig richtig; denn auch der zahme Schimpanse tut dasselbe, indem er bei heiterer Stimmung, gleichsam um seinen Übermut auszulassen, nicht bloß mit den Händen auf den Boden schlägt, wie andere Affen es ebenfalls tun, sondern auch mit den Beinen auf und nieder trampelt, besonders da, wo es tönt, und damit allerdings ein trommelndes Geräusch hervorbringt. Er zeigt sich wahrhaft entzückt, wenn sich ein Mensch herbeiläßt, in derselben Weise wie er zu klopfen, ja er fordert Bekannte geradezu auf, derartig mit ihm zu spielen.
Mein Schimpanse kennt seine Freunde genau und unterscheidet sie sehr wohl von Fremden, befreundet sich aber bald mit allen, die ihm liebreich entgegenkommen. Am behaglichsten befindet er sich im Kreise einer Familie, namentlich wenn er aus einem Zimmer ins andere gehen, Türen öffnen und schließen und sich sonstwie zu unterhalten vermag. Man vermeint es ihm anzusehen, wie gehoben er sich fühlt, wenn er sich einmal frei unter ihm wohlwollenden Menschen bewegen und mit ihnen am Tische sitzen darf. Merkt er, daß man auf seine Scherze eingeht, so beginnt er mit seinen Händen auf den Tisch zu klopfen, und freut sich höchlich, wenn seine Gastgeber ihm folgen. Außerdem beschäftigt er sich mit genauer Untersuchung aller denkbaren Gegenstände, öffnet die Ofentüre, um sich das Feuer zu betrachten, zieht Kisten heraus, kramt sie aus und spielt mit dem, was er hier findet, vorausgesetzt, daß es nicht verdächtig erscheint; denn er ist im hohen Grade ängstlich und kann vor einem Gummiballe sich entsetzen. Sehr genau merkt er, ob er beobachtet wird oder nicht. Im ersteren Falle tut er nur das, was ihm erlaubt wird, im letzteren läßt er sich mancherlei Übergriffe zuschulden kommen, gehorcht aber, wenn sein Pfleger ihm etwas verbietet, auf das bloße Wort hin, obschon nicht immer sogleich. Lob feuert ihn an, namentlich wenn es sich um Schwingen und Turnen handelt. Beschenkt oder freudig überrascht, beweist er sich dankbar, indem er, ohne gerade hierzu abgerichtet oder gelehrt worden zu sein, seinen Arm zärtlich um die Schulter des Wohltäters legt und ihm eine Hand oder echt menschlich auch einen Kuß gibt. Genau dasselbe tut er, wenn er des Abends aus seinem Käfig genommen und auf das Zimmer gebracht wird. Er kennt die Zeit und zeigt sich schon eine Stunde, bevor er in sein Zimmer gebracht wird, höchst unruhig. In dieser letzten Stunde darf sein Pfleger sich nicht entfernen, ohne daß er in ausdrucksvolles Klagen ausbricht oder auch wohl verzweifelnd sich gebärdet, indem er sich, wie beschrieben, auf den Boden wirft, mit Händen und Füßen strampelt und ein unerträgliches Kreischen ausstößt. Dabei beachtet er die Richtung, in der sein Pfleger sich bewegt, genau, und bricht nur dann in Klagen aus, wenn er meint, daß jener ihn verlassen wolle. Wird er getragen, so setzt er sich wie ein Kind auf den Arm seines Pflegers, schmiegt den Kopf an dessen Brust und scheint sich außerordentlich behaglich zu fühlen. Von nun an hat er anscheinend bloß den einen Gedanken, sobald als möglich auf sein Zimmer zu kommen, setzt sich hier auf das Sofa und betrachtet seinen Freund mit treuherzigem Blicke, gleichsam als wolle er in dessen Gesicht lesen, ob dieser ihm heute Abend wohl Gesellschaft leisten oder ihn allein lassen werde. Wenn er das erstere glaubt, fühlt er sich glücklich, wogegen er, wenn er das Gegenteil merkt, sehr unglücklich sich gebärdet, ein betrübtes Gesicht schneidet, die Lippen weit vorstößt, jammernd aufschreit, an dem Pfleger emporklettert und krampfhaft an ihm sich festhält. In solcher Stimmung hilft auch freundliches Zureden wenig, während dieses sonst die vollständigste Wirkung auf ihn äußert, ebenso wie er sich ergriffen zeigt, wenn er ausgescholten wurde. Man darf wohl sagen, daß er die an ihn gerichteten Worte vollständig versteht; denn er befolgt ohne Zögern die verschiedensten Befehle und beachtet alle ihm zukommenden Gebote; doch gehorcht er eigentlich nur seinem Pfleger, nicht aber Fremden, am wenigsten, wenn diese sich herausnehmen, in Gegenwart seines Freundes etwas von ihm zu verlangen.
Im hohen Grade anziehend benimmt er sich Kindern gegenüber. Er ist an und für sich durchaus nicht bösartig oder gar heimtückisch und behandelt eigentlich jedermann freundlich und zuvorkommend, Kinder aber mit besonderer Zärtlichkeit, und dies um so mehr, je kleiner sie sind. Mädchen bevorzugt er Knaben, aus dem einfachen Grunde, weil letztere es selten unterlassen können, ihn zu necken; und wenn er auch auf solche Scherze gern eingeht, scheint es ihn doch zu ärgern, von so kleinen Persönlichkeiten sich gefoppt zu sehen. Als er zum erstenmal meinem sechswöchentlichen Töchterchen gezeigt wurde, betrachtete er zunächst das Kind mit sichtlichem Erstaunen, als ob er sich über dessen Menschentum vergewissern müsse, berührte hieraus das Gesicht überaus zart mit einem Finger und reichte schließlich freundlich die Hand hin. Dieser Charakterzug, den ich bei allen von mir gepflegten Schimpansen beobachtet habe, verdient besonders deshalb hervorgehoben zu werden, weil er zu beweisen scheint, daß unser Menschenaffe auch im kleinsten Kinde immer noch den höher stehenden Menschen sieht und anerkennt. Gegen seinesgleichen benimmt er sich keineswegs ebenso freundlich. Ein junges Schimpansenweibchen, das ich früher pflegte, zeigte, als ich ihm ein junges Männchen seiner Art beigesellte, keine Teilnahme, kein Gefühl von Freude oder Freundschaft für dieses, behandelte das schwächere Männchen im Gegenteil mit entschiedener Roheit, versuchte es zu schlagen, zu kneipen, überhaupt zu mißhandeln, so daß beide getrennt werden mußten. Ein solches Betragen hat sich keiner der von mir gepflegten Schimpansen gegen Menschenkinder zuschulden kommen lassen.
Abweichend von anderen Affenarten ist er munter bis in die späte Nacht, mindestens so lange, als das Zimmer beleuchtet wird. Das Abendbrot schmeckt ihm am besten, und er kann deshalb nach seiner Ankunft im Zimmer kaum erwarten, daß die Wirtschafterin ihm den Tee bringt. Erscheint dieselbe nicht, so geht er zur Türe und klopft laut an diese an; kommt jene, so begrüßt er sie mit freudigem »Oh! Oh!«, bietet ihr auch wohl die Hand. Tee und Kaffee liebt er sehr, den ersteren stark versüßt und mit etwas Rum gewürzt, wie er überhaupt alles genießt, was auf den Tisch kommt, und sich auch an Getränken, namentlich an Bier, gütlich tut. Beim Essen stellt er sich auf das Sofa, stützt beide Hände auf den Tisch oder legt sich mit dem einen Arme auf, nimmt mit der einen Hand die Obertasse von der unteren, schlürft mit Behagen den flüssigen Inhalt und geht dann erst zu den eingebrockten Brotstückchen über. So weit er diese erlangen kann, zieht er sie mit den Lippen an sich; geht es auf die Neige, so bedient er sich, da ihm untersagt ist, mit den Händen zuzulangen, des Löffels mit Geschick. Während des Essens zeigt er sich aufmerksam auf alles, was vorgeht, und seine Augen sind ununterbrochen nach allen Seiten gerichtet. Wie andere junge Tiere seiner Art hat er zuweilen natürlich zu erklärende Gelüste, ißt z. B. eine größere Menge Salz, ein Stück Kreide, eine Hand voll Erde; niemals aber habe ich an ihm die abscheuliche Unart, den eigenen Kot zu verschlingen, bemerkt, wie solches an Affen, einschließlich seiner Art- und Sippschaftsgenossen, und ebenso zuweilen an Menschenkindern beobachtet worden ist. Der innige Umgang mit ernst und verständig erziehenden Menschen hat seine Sitten auch in dieser Hinsicht veredelt und vielleicht vorhanden gewesene häßliche Gelüste im Keime erstickt.
Nachdem er gespeist, will er sich in seiner Häuslichkeit noch ein wenig vergnügen, jedenfalls noch nicht zu Bette gehen. Er holt sich ein Stück Holz vom Ofen oder zieht die Hausschuhe seines Pflegers über die Hände und rutscht so im Zimmer umher, nimmt ein Hand- oder Taschentuch, hängt sich dasselbe um oder wischt und scheuert das Zimmer damit. Scheuern, Putzen, Wischen sind Lieblingsbeschäftigungen von ihm, und wenn er einmal ein Tuch gepackt hat, läßt er nur ungern es sich wieder nehmen. Anfangs sehr unreinlich, hat er sich bald daran gewöhnt, seinen Käfig, das Zimmer und das Bett nicht mehr zu beschmutzen; und wenn er einmal das Mißgeschick hat, in Schmutz zu treten, zeigt er sich sehr verdrießlich, gebärdet sich genau wie ein Mensch in gleichem Falle, betrachtet mit entschiedenem Ekel den Fuß, hält ihn so weit als möglich von sich, schüttelt ihn ab und nimmt dann eine Hand voll Heu, um sich damit zu reinigen. Ja, es ist bemerkt worden, daß er letzteres, nachdem es Dienste getan, zur Türe seines Käfigs hinauswarf.
Sobald das Licht ausgelöscht wird, legt er sich zu Bette, weil er sich im Dunkeln fürchtet. Er schläft ruhig die Nacht hindurch, streckt und reckt sich aber mitunter, namentlich wenn es ihm zu kalt oder zu warm wird. In schwülen Sommernächten ruht er langgestreckt auf dem Rücken, beide Hände gleichseitig unter den Kopf gesteckt; im Winter hingegen liegt er mehr zusammengekauert. Mit Tageshelle ermuntert er sich und ist von nun an wieder so rege wie tags vorher.
Mit anderen Tieren pflegt er wenig Umgang. Größere fürchtet, kleine mißachtet er. Ein Kaninchen, das ihm zum Spielen beigegeben wurde, mißhandelte er ebenso wie das erwähnte Weibchen, das zu ihm gesetzte Männchen der eigenen Art. Vögel lassen ihn gleichgültig, falls sie nicht in besonders naher Beziehung zu seinem Gebieter stehen, und dadurch seine Teilnahme erregen. In seinem Zimmer befindet sich ein Graupapagei, mit dem er sich stets zu schaffen macht. So furchtsam er selbst ist, so kann er es doch nicht unterlassen, diesen zu ängstigen. Leise schleicht er an das Bauer heran, hebt plötzlich seine Hand hoch und tut, als ob er seinen Gefährten erschrecken wolle. Dieser aber ist viel zu sehr an ihn gewöhnt, als daß er sich fürchten sollte, und hat für den Schimpansen ergötzlicherweise nur ein verbietendes »Pst! Pst!, das er seinem Herrn abgelauscht, zur Antwort. Vor Schlangen und anderen Kriechtieren sowie vor Lurchen hat er eine lächerliche Furcht und gebärdet sich ihnen gegenüber fast in derselben Weise wie nervenschwache Frauenzimmer oder verbildete Männer. Schon ihr Anblick verursacht ihm Entsetzen. Zeige ich ihm Krokodile, so ruft er halb ängstlich, halb ärgerlich »Oh! Oh!« und sucht sich schleunigst zu entfernen; lasse ich ihm Schlangen durch eine Glasscheibe betrachten, so stößt er denselben Ruf aus, versucht aber nur ausnahmsweise sich zu entfernen, weil er die Bedeutung des trennenden Glases genau kennt; nehme ich aber eine Schildkröte, Eidechse oder Schlange in die Hand, so eilt er im schnellsten Laufe davon, um sich zu sichern. Alles schlangenähnliche Getier ist ihm unheimlich.
Heute, während ich diese Zeilen überlese, weilt das vortreffliche Tier nicht mehr unter den Lebenden. Eine Lungenentzündung, die auf eine Halsdrüsengeschwulst folgte, hat seinem Dasein ein Ende gemacht. Ich habe mehrere Schimpansen krank und einige von ihnen sterben sehen: keiner von allen hat sich in seinen letzten Lebenstagen so menschlich benommen wie dieser eine. Das mehrfach erwähnte Männchen kam ebenfalls krank in Europa an, war, wie ein leidendes Kind in gleicher Lage, eigensinnig, klammerte sich ängstlich an dem ihm zuerteilten Wärter fest oder ruhte bewegungslos auf seinem Lager, den schmerzenden Kopf mit einer oder beiden Händen haltend, verweigerte Arzneien zu nehmen, zeigte sich auch sonst oft unfolgsam und unartig: vorstehend beschriebener Schimpanse, der gesittetste, den ich jemals kennengelernt habe, verleugnete auch während seiner Krankheit die ihm gewordene Erziehung nicht. Er genoß die sorgsamste Pflege mehrerer Ärzte, die dem Verlauf der Krankheit mit um so größerer Teilnahme folgten, je mehr sie den Leidenden schätzen lernten, und ich kann deshalb wohl nichts Besseres tun, als einen dieser Arzte, Dr. Martini, anstatt meiner reden zu lassen.
»In meiner Eigenschaft als Arzt machte ich die Bekanntschaft des Schimpansen Ende Dezember bei trübem Winterwetter. Ich zögerte nicht, der auch an mich ergangenen Bitte, dieses Tier zu behandeln, Folge zu leisten; denn die vergleichende Anatomie sprach in vorliegendem Falle dem Menschenarzt größeres Recht als dem Tierarzte für die Behandlung zu. Ich hatte den Schimpansen vordem oft beobachtet und die Ausgelassenheit seines Wesens, das lebhafte Mienenspiel, die rastlose Beweglichkeit und die unbegrenzte Liebe zu seinem Pfleger angestaunt. Um so mehr überraschte mich der Eindruck, den der kranke Affe auf mich machte. Bis auf den Kopf in sein Deckbett gehüllt, lag er ruhig und teilnahmlos gegen alles, was um ihn her vorging, auf seinem Lager, den Ausdruck schweren Leidens im Antlitze, von Hustenanfällen geplagt, in oberflächlicher, aber beschleunigter Atmung nach Luft haschend, nur zeitweise unter Schmerzensseufzern die Augen aufwärtsschlagend. Wie ein Kind scheute er vor mir, dem ihm unbekannten Manne zurück und machte an diesem Tage eine genauere Untersuchung unmöglich. Letztere gelang erst, nachdem ich während der folgenden Besuche durch Beileidsbezeigungen und freundliches Nähertreten sein Vertrauen mir erworben hatte. Außer bedeutender Schwellung der Lymphdrüsen zu beiden Seiten des Halses ließen sich Veränderungen des Gewebes in beiden Lungenspitzen und eine neuerdings hinzugetretene Entzündung des linken unteren Lungenlappens feststellen. Hierzu kam noch eine eiternde Geschwulst vor und unterhalb des Kehlkopfes, die nachweislich mit der Drüsenerkrankung im Zusammenhange stand und bereits Kehlkopf und Luftröhre zusammenpreßte, früher oder später also entweder zur Erstickung führen oder zum Durchbruche nach außen oder innen kommen oder, was wahrscheinlicher, ihren Inhalt in den Mittelfellraum senken und dadurch weitere Gefahren hervorrufen mußte. Das beklagenswerte Geschöpf schien sich dieser Geschwulst als Atmungshindernisses bewußt zu sein; wie bräunekranke Kinder in ihrem Lufthunger nach dem Sitze des Leidens fassen, so führte der Schimpanse meine untersuchende Hand, als erwarte er in dunkler Ahnung von dieser Hilfe, immer und immer wieder zur Halsgeschwulst zurück.
Nach vorgängiger Beratung mit einem Berufsgenossen wurde die Öffnung des Senkungsgeschwüres durch einen Schnitt in der Höhe des Kehlkopfes als dringend notwendig erkannt. Leicht gefunden war dieser Rat, schwierig die Art und Weise der Ausführung. Jede Bewegung des leidenden Tieres während der wundärztlichen Operation konnte dem Messer eine tödliche oder doch schwer verletzende Richtung geben. Betäubung durch Chloroform war infolge der schweren Erkrankung der Lunge untersagt; Chloralhydrat in einer Gabe von drei Gramm versuchsweise angewandt, bewirkte kaum einen Halbschlummer, nicht aber Bewußtlosigkeit. Nach dreistündigem erfolglosen Warten gingen wir endlich mit Gewalt ans Werk. Vier Männer sollten das Tier festhalten. Umsonst: mit Aufbietung all seiner Kräfte schleuderte der Schimpanse die Leute zur Seite und hörte nicht eher zu toben auf, bis wir die vermeintlichen Peiniger zur Türe hinausgewiesen hatten. Was durch Zwangsmittel nicht zu erreichen gewesen war, sollte jetzt zu unserem Erstaunen freiwillig gewährt werden. Wieder beruhigt durch gütliches Zureden und Liebkosungen, gestattete der Leidende ohne Widerstreben eine nochmalige Untersuchung der Halsgeschwulst und leitete auch diesmal bittenden Blickes meine Hand. Dies mußte uns ermutigen, die Operation ohne Hilfe betäubender Mittel und ohne jegliche Fessel zu wagen. Auf dem Schoße seines Pflegers sitzend, beugte der Affe den Kopf rückwärts und ließ sich willig in dieser Stellung festhalten. Die erforderlichen Schnitte waren rasch geführt; das Tier zuckte weder, noch gab es einen Laut des Schmerzes von sich. Eine Menge dünnflüssigen Eiters quoll hervor, und mit seiner Entleerung schwand die Geschwulst. Jetzt trat freiere Atmung ein, obwohl die bestehende Lungenentzündung immer noch eine Vermehrung der Atemzüge bedingte. Ein unverkennbarer Ausdruck der Freude und des Besserbefindens prägte sich in den Zügen des Kranken aus, und dankbar reichte er, unaufgefordert, uns beiden die Hand, beglückt umarmte er seinen Wärter.
Leider genügte die Beseitigung dieses einen Leidens nicht zur Rettung des Lebens. Die Halswunde heilte, aber die Lungenentzündung griff weiter um sich. So heldenmütig und verständig das kranke Tier sich während der wundärztlichen Behandlung gezeigt, so willig und folgsam nahm er die ihm gereichten Arzneien, so sanft und geduldig erschien er in seinen letzten Stunden. Er starb, wie ein Mensch, nicht wie ein Tier stirbt.«
Dies sind Beobachtungen, die ich verbürge, und die niemand bemäkeln soll. Möge man sich auch den Anschein eines »tiefernsten Denkens« zu geben suchen, um zu beweisen, daß das Tier keinen Verstand besitze: ein solcher Schimpanse wirft alle Ergebnisse jenes tiefernsten Denkens einfach über den Haufen. Nicht aller Mensch, aber sehr viel Mensch ist an ihm!
Der Tschego ( Anthropopithecus Tschego, Troglodytes Tschego) ist, wie das höchstens fünfjährige Weibchen des Dresdener Gartens vermuten läßt, merklich größer als der Schimpanse, vielleicht nur wenig kleiner als der Gorilla. Eine eingehende Schilderung des Betragens dieses Tschego würde kaum mehr als eine Wiederholung der vorstehend vom Schimpansen gegebenen Mitteilung sein. Begabungen und Eigenschaften, Sitten und Gewohnheiten, Wesen und Gebaren beider so nah verwandten Tiere schienen, soviel ich wahrnehmen konnte, in allen wesentlichen Zügen durchaus übereinzustimmen, etwaige Abweichungen nur die Folge der verschiedenen Erziehung zu sein.
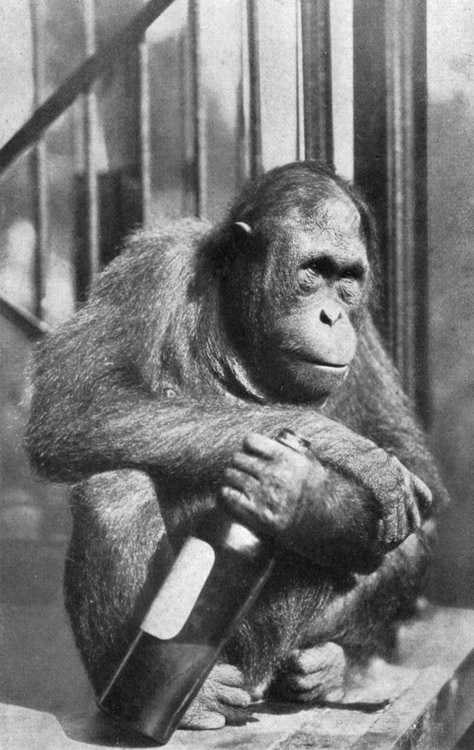
Orang-Utan ( Pithecus satyrus) hockend
Von dem afrikanischen Menschenaffen unterscheidet sich der asiatische, der gewöhnlich Orang-Utan (Waldmensch), fälschlich Orang-Utang, auf Borneo aber Meias oder Majas genannt wird (Pithecus satyrus), Vertreter der Sippe der Orangaffen, durch die bedeutend längeren Arme, die bis zu den Knöcheln der Füße herabreichen, und durch den kegel- oder pyramidenförmig zugespitzten Kopf mit weit vorstehender Schnauze, hat auch nur zwölf rippentragende Wirbel. So lange er jung ist, gleicht sein Schädel dem eines Menschenkindes in hohem Grade; mit dem zunehmenden Alter aber tritt das Tierische auch bei ihm derartig hervor, daß der Schädel nur noch entfernt an den des jungen Affen erinnert.
Der größte männliche Orang-Utan, den Wallace erlegte, war im Stehen 1,35 Meter hoch, klafterte aber mit ausgestreckten Armen 2,4 Meter: das Gesicht war 35 Zentimeter breit; der Umfang des Leibes betrug 1,15 Meter. Der Leib, an dem der Bauch stark hervortritt, ist an den Hüften breit, der Hals kurz und vorn faltig, weil das Tier einen großen Kehlsack besitzt, der aufgeblasen werden kann; die langen Gliedmaßen haben auch lange Hände und Finger. Die platten Nägel fehlen häufig den Daumen der Hinterhände. Die Lippen sind unschön, weil nicht allein gerunzelt, sondern auch stark aufgeschwollen und aufgetrieben; die Nase ist ganz flach gedrückt, und die Nasenscheidewand verlängert sich über die Nasenflügel hinaus; Augen und Ohren sind klein, aber denen des Menschen ähnlich gebildet. In dem furchtbaren Gebisse treten die Eckzähne stark hervor; der Unterkiefer ist länger als der Oberkiefer. Die Behaarung ist spärlich auf dem Rücken und sehr dünn auf der Brust, um so länger und reichlicher aber an den Seiten des Leibes, wo sie lang herabfällt. Im Gesichte entwickelt sie sich bartähnlich; aus den Oberlippen und am Kinn, am Schädel und auf den Unterarmen ist sie aufwärts, übrigens abwärts gerichtet. Gesicht und Handflächen sind nackt, Brust und Oberseiten der Finger fast gänzlich nackt. Gewöhnlich ist die Färbung der Haare ein dunkles Rostrot, seltener ein Braunrot, das auf dem Rücken und auf der Brust dunkler, am Bart aber Heller wird. Die nackten Teile sehen bläulich- oder schiefergrau aus. Alte Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch ihre bedeutende Größe, dichteres und längeres Haar, reichlicheren Bart und eigentümliche Schwielen oder Hautlappen an den Wangen, die sich halbmondförmig von den Augen an nach den Ohren hin und zum Oberkiefer herabziehen und das Gesicht auffallend verhäßlichen. Die jüngeren Tiere sind bartlos, sonst aber reicher behaart und dunkler gefärbt.
Einige Naturforscher nehmen mit den Eingeborenen mehrere Arten Orang-Utans an; andere halten die Unterschiede für solche, die durch das Alter der Tiere bedingt werden.
Der Orang-Utan ist seit alter Zeit bekannt. Schon Plinius gibt an, daß es auf den indischen Bergen Satyrn gäbe, »sehr bösartige Tiere mit einem Menschengesicht, die bald aufrecht, bald auf allen Vieren gingen und wegen ihrer Schnelligkeit nur gefangen werden könnten, wenn sie alt oder krank seien.« Seine Erzählung erbt sich fort von Jahrhundert zu Jahrhundert und empfängt von jedem neuen Bearbeiter Zusätze. Man vergißt fast, daß man noch von Tieren redet; aus den Affen werden beinahe wilde Menschen. Übertreibungen jeder Art verwirren die ersten Angaben und entstellen die Wahrheit. Bontius, ein Arzt, der um die Mitte des 17. Jahrhunderts auf Java lebte, spricht wieder einmal aus eigener Anschauung. Er sagt, daß er den Waldmenschen einigemal gesehen habe, und zwar ebensowohl Männer als Weiber. Sie gingen öfters aufrecht und gebärdeten sich ganz wie andere Menschen. Bewunderungswürdig wäre ein Weibchen gewesen. Es habe sich geschämt, wenn es unbekannte Menschen betrachtet hätten und nicht nur das Gesicht, sondern auch seine Blöße mit den Händen bedeckt; es habe geseufzt, Tränen vergossen und alle menschlichen Handlungen so ausgeübt, daß ihm nur die Sprache gefehlt habe, um wie ein Mensch zu sein. Die Javaner behaupten, daß die Affen wohl reden könnten, wenn sie nur wollten, es jedoch nicht täten, weil sie fürchteten, arbeiten zu müssen. Daß die Waldmenschen aus der Vermischung von Affen und indianischen Weibern entständen, sei ganz sicher. Schouten bereichert diese Erzählung durch einige Entführungsgeschichten, in denen Waldmenschen der angreifende, malaiische Mädchen aber der leidende Teil sind. Es versteht sich fast von selbst, daß die Orang-Utans nach allen diesen Erzählungen aufrecht auf den Hinterfüßen gehen, obwohl hinzugefügt wird, »daß sie auch auf allen vier Beinen laufen könnten.« Eigentlich sind die Reisebeschreiber an den Übertreibungen, die sie auftischen, unschuldig; denn sie geben bloß die Erzählungen der Eingeborenen wieder. Diese wußten sich natürlich die Teilnahme der Europäer für unsere Affen zunutze zu machen, weil sie ihnen solche verkaufen wollten und deshalb ihre Ware nach Kräften priesen – nicht mehr und nicht minder, als es Tierschausteller bei uns zu Lande heutigen Tages auch noch tun.
Dank den trefflichen Forschungen Wallaces sind wir über das Freileben des Orang-Utan genauer unterrichtet als über das jedes anderen Menschenaffen. Der genannte Reisende hatte die beste Gelegenheit, das Tier kennenzulernen und die Berichte der Eingeborenen mit seinen eigenen Beobachtungen zu vergleichen. Zur Ehre seiner Vorgänger, von denen mehrere, namentlich Owen, Kessel und Brooke bemüht waren, ihre Schilderungen von Fabeln und Irrtümern zu reinigen, muß ich sagen, daß unser Gewährsmann, obgleich er nur eigene Beobachtungen wiedergibt, die Angaben jener in allem wesentlichen bestätigt.
»Man weiß«, sagt er, »daß der Orang-Utan Sumatra und Borneo bewohnt, und hat guten Grund zu glauben, daß er auf diese beiden großen Inseln beschränkt ist. Jedoch scheint er auf der ersteren viel seltener zu sein als auf der letzteren. Hier hat er eine weite Verbreitung. Er bewohnt ausgedehnte Gegenden der Südwest-, Südost-, Nordost- und Nordwestküsten, hält sich aber ausschließlich in niedrig gelegenen und sumpfigen Wäldern auf. In Sadong findet man ihn bloß in flachen, wasserreichen, mit hohem Urwalde bedeckten Gegenden. Über die Sümpfe erheben sich viele vereinzelt stehende Berge, die zum Teil von Dajaks bewohnt werden und mit Fruchtbäumen bebaut worden sind. Sie bilden für den Meias einen Anziehungspunkt; denn er besucht sie ihrer Früchte halber, obwohl er sich des Nachts stets in den Sumpfwald zurückzieht. In allen Gegenden, wo der Boden sich etwas erhebt und trocken ist, wohnt der Orang-Utan nicht. So kommt er beispielsweise in den tieferen Tälern des Sadongebietes häufig vor, fehlt dagegen jenseits der Grenze, innerhalb der Ebbe und Flut bemerkbar sind. Der untere Teil des Saravaktales nun ist sumpfig, jedoch nicht überall mit hohem Walde bedeckt, sondern meist von der Ripapalme bestanden, und nahe der Stadt Saravak wird das Land trocken und hügelig und ist in Besitz genommen von kleinen Strecken Urwald mit Dschungeln. Eine große Fläche ununterbrochenen und gleichmäßig hohen Urwaldes ist für das Wohlbefinden unseres Affen Bedingung. Solche Wälder bilden für ihn ein offenes Land, in dem er sich nach jeder Richtung hin bewegen kann, mit derselben Leichtigkeit wie der Indianer durch die Steppe und der Araber durch die Wüste zieht. Er geht von einem Baumwipfel zum anderen, ohne jemals auf den Boden hinabzusteigen. Die hohen und trockenen Gegenden, die mehr durch Lichtungen und später auf diesen wachsendes, niederes Dschungel bedeckt sind, eignen sich wohl für Menschen, nicht aber für die eigentümliche Art der Bewegung unseres Tieres, das hier auch vielen Gefahren ausgesetzt sein würde. Wahrscheinlich finden sich außerdem in seinem Gebiete auch Früchte in größerer Mannigfaltigkeit, indem die kleinen inselartigen Berge als Gärten oder Anpflanzungen dienen, so daß inmitten der sumpfigen Ebene die Bäume des Hochlandes gedeihen können.
Es ist ein seltsamer und fesselnder Anblick, einen Meias gemächlich seinen Weg durch den Wald nehmen zu sehen. Er geht umsichtig einen der größeren Äste entlang in halb aufrechter Stellung, zu der ihn die bedeutende Länge seiner Arme und die verhältnismäßige Kürze seiner Beine nötigen, und zwar bewegt er sich wie seine Verwandten, indem er auf den Knöcheln, nicht wie wir auf den Sohlen geht. Stets scheint er solche Bäume zu wählen, deren Äste mit denen des nächststehenden verflochten sind, streckt, wenn er nahe ist, seine langen Arme aus, faßt die betreffenden Zweige mit beiden Händen, scheint ihre Stärke zu prüfen und schwingt sich dann bedächtig hinüber auf den nächsten Ast, auf dem er wie vorher weiter geht. Nie hüpft oder springt er, niemals scheint er auch nur zu eilen, und doch kommt er fast ebenso schnell fort, wie jemand unter ihm durch den Wald laufen kann.« – An einer anderen Stelle meint Wallace, daß er im Laufe einer Stunde bequem eine Entfernung von fünf bis sechs englischen Meilen zurücklegen könne. »Die langen mächtigen Arme sind für ihn von größtem Nutzen; sie befähigen ihn, mit Leichtigkeit die höchsten Bäume zu erklimmen, Früchte und junge Blätter von dünnen Zweigen, die sein Gewicht nicht aushalten würden, zu pflücken und Blätter und Äste zu sammeln, um sich ein Nest zu bauen.« Ein von unserem Forscher verwundeter Orang-Utan zeigte seinem Verfolger, in welcher Weise der Bau solches Nestes geschieht. »Sobald ich geschossen hatte«, erzählt Wallace, »kletterte der Meias höher im Wipfel des Baumes hinauf und hatte bald die höchsten Spitzen desselben erreicht. Hier begann er sofort ringsherum Zweige abzubrechen und sie kreuz und quer zu legen. Der Ort war trefflich gewählt. Außerordentlich schnell griff er mit seinem einzigen noch unverwundeten Arme nach jeder Richtung hin, brach mit der größten Leichtigkeit starke Äste ab und legte sie rückwärts quer übereinander, so daß er in wenigen Minuten eine geschlossene Masse von Laubwerk gebildet hatte, die ihn meinen Blicken gänzlich entzog. Ein ähnliches Nest benutzt der Meias auch fast jede Nacht zum Schlafen; doch wird dieses meist niedriger auf einem kleinen Baume angebracht, in der Regel nicht höher als acht bis fünfzehn Meter über dem Boden, wahrscheinlich weil es hier weniger den Winden ausgesetzt ist als oben. Der Meias soll sich in jeder Nacht ein neues machen; ich halte dies jedoch deshalb kaum für wahrscheinlich, weil man die Überreste häufiger finden würde, wenn das der Fall wäre. Die Dajaks sagen, daß sich der Affe, wenn es sehr naß ist, mit Pandanblättern oder sehr großen Farnen bedeckt. Das hat vielleicht zu dem Glauben verleitet, daß er sich eine Hütte in den Bäumen erbaue.
Der Orang-Utan verläßt sein Lager erst, wenn die Sonne ziemlich hoch steht und den Tau auf den Blättern getrocknet hat. Er frißt die mittlere Zeit des Tages hindurch, kehrt jedoch selten während zweier Tage zu demselben Baume zurück. Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, nährt er sich fast ausschließlich von Obst, gelegentlich auch von Blättern, Knospen und jungen Schößlingen. Unreife Früchte zieht er den reifen anscheinend vor, ißt auch sehr sauere oder stark bittere. Insbesondere scheint ihm die große rote fleischige Samendecke einer Frucht vortrefflich zu schmecken. Manchmal genießt er nur den kleinen Samen einer großen Frucht und verwüstet und zerstört dann weit mehr als er ißt, so daß man unter den Bäumen, auf denen er gespeist hat, stets eine Menge Reste liegen sieht. In hohem Grade liebt er die Durian und vernichtet eine Menge dieser köstlichen Früchte, kreuzt aber niemals Lichtungen, um sie zu holen.« Die Durian wächst, wie Wallace an einer anderen Stelle seines Werkes bemerkt, an einem großen und hohen Waldbaume, der in seinem Gesamtgepräge unserer Ulme ähnlich ist, aber eine glattere und mehr blätterige Rinde besitzt. »Die Frucht ist rund oder leicht eiförmig, hat die Größe einer Kokosnuß, grüne Färbung und ist mit kleinen, starken, scharfen Stacheln bedeckt, deren Ansätze sich gegenseitig berühren und infolgedessen sechseckig erscheinen. Sie bewaffnen die Frucht so vollständig, daß es bei abgebrochenem Stengel seine Schwierigkeit hat, eine Durian vom Boden aufzuheben. Die äußere Rinde ist so dick und zähe, daß die Frucht nie zerbricht, von welcher Höhe sie auch herabfallen möge. Von der Wurzel zur Spitze sieht man fünf sehr schwach gezeichnete Linien, über die die Stacheln sich ein wenig wölben; sie zeigen die Nähte an, in denen die Frucht mit einem starken Messer und einer kräftigen Hand geteilt werden kann. Die fünf Zellen sind innen atlasartig weiß, und jede wird von einer Masse rosafarbenen Breies angefüllt, in dem zwei oder drei Samen von der Größe einer Kastaniennuß liegen. Dieser Brei, das Eßbare, ist ebenso unbeschreiblich in seiner Zusammensetzung wie in seinem Wohlgeschmacke: ein würziger, butteriger, stark nach Mandeln schmeckender Eierrahm gibt die beste Vorstellung davon. Dazwischen aber machen sich Düfte bemerklich, die an Rahm, Käse, Zwiebelbrühe, Jereswein und anderes Unvergleichbare erinnern. Auch hat der Brei eine würzige, klebrige Weichheit, die sonst keinem Dinge zukommt und ihn noch schmackhafter macht. Die Durian ist weder sauer noch süß noch saftig, und doch vermißt man den Mangel einer dieser Eigenschaften nicht. Denn sie erscheint vollkommen so, wie sie ist; sie verursacht keine Übelkeit, bringt überhaupt keine schlechten Wirkungen hervor, und je mehr man von ihr ißt, desto weniger fühlt man sich geneigt, aufzuhören. Durianessen ist in der Tat eine neue Art von Empfindung, die eine Reise nach dem Osten lohnt.« Es scheint wunderbar, wie der Meias imstande ist, diese Frucht zu öffnen. Wahrscheinlich beißt er zuerst einige Stacheln ab, macht dann ein kleineres Loch und sprengt die Schale mit seinen mächtigen Fingern.
»Äußerst selten steigt der Orang-Utan auf die Erde herab, wahrscheinlich nur dann, wenn er, vom Hunger getrieben, saftige Schößlinge am Ufer sucht oder wenn er bei sehr trockenem Wetter nach Wasser geht, von dem er für gewöhnlich genug in den Höhlungen der Blätter findet. Nur einmal sah ich zwei halb erwachsene Orangs auf der Erde in einem trockenen Loche am Fuße der Siénunjonhügel. Sie spielten zusammen, standen aufrecht und faßten sich gegenseitig an den Armen an. Niemals geht dieser Affe aufrecht, es sei denn, daß er sich mit den Händen an höheren Zweigen festhalte, oder aber, daß er angegriffen werde. Abbildungen, die ihn darstellen, wie er mit einem Stocke geht, sind gänzlich aus der Luft gegriffen.
Vor dem Menschen scheint sich der Meias nicht sehr zu fürchten. Diejenigen, die ich beobachtete, glotzten häufig einige Minuten lang auf mich herab und entfernten sich dann nur langsam bis zu einem benachbarten Baume. Wenn ich einen gesehen hatte, mußte ich oft eine halbe Meile und weiter gehen, um mein Gewehr zu holen; trotzdem fand ich ihn nach meiner Rückkehr fast stets auf demselben Baume oder innerhalb eines Umkreises von ein paar hundert Fuß. Niemals sah ich zwei ganz erwachsene Tiere zusammen, wohl aber Männchen wie auch Weibchen, zuweilen begleitet von halb erwachsenen Jungen.
Die Dajaks sagen, daß der Meias niemals von Tieren im Walde angefallen wird, mit zwei seltenen Ausnahmen. Alle Dajakshäuptlinge, die ihr ganzes Leben an Orten zugebracht haben, wo das Tier häufig vorkommt, versicherten: Kein Tier ist stark genug, um den Meias zu verletzen, und das einzige Geschöpf, mit dem er überhaupt kämpft, ist das Krokodil. Wenn er kein Obst im Dschungel findet, geht er an die Flußufer, um hier junge Schößlinge und Früchte, die dicht am Wasser wachsen, zu fressen. Dann versucht es das Krokodil, ihn zu packen; der Meias aber springt auf dasselbe, schlägt es mit Händen und Füßen, zerfleischt und tötet es. Der Mann fügte hinzu, daß er einmal solchem Kampfe zugeschaut habe, und versicherte, daß der Meias stets Sieger bleibe. Ein anderer Häuptling sagte mir folgendes: Der Meias hat keine Feinde; denn kein Tier wagt es, ihn anzugreifen, bis auf das Krokodil und die Tigerschlange. Er tötet aber das Krokodil stets durch seine gewaltige Kraft, indem er sich auf dasselbe stellt, seine Kiefern aufreißt und ihm die Kehle aufschlitzt. Greift eine Tigerschlange den Meias an, so packt er sie mit seinen Händen, beißt sie und tötet sie bald. Der Meias ist sehr stark: kein Tier im Dschungel ist so kräftig wie er.
Ausnahmsweise geschieht es wohl auch, daß ein Orang-Utan mit Menschen kämpft. Eines Tages kamen einige Dajaks zu mir, um mir zu erzählen, daß ein Meias am gestrigen Tage einen ihrer Genossen beinahe getötet habe. Einige Meilen den Fluß hinab steht das Haus eines Dajak, und die Bewohner sahen einen großen Orang-Utan, der sich an den Schößlingen einer Palme am Ufer gütlich tat. Aufgeschreckt zog er sich in das Dschungel zurück, und eine Anzahl mit Speeren und Beilen bewaffneter Männer liefen hin, um ihm den Weg abzuschneiden. Der vorderste Mann versuchte seinen Speer durch den Körper des Tieres zu rennen; der Meias aber ergriff seinen Gegner mit den Händen, packte in demselben Augenblicke den Arm mit dem Maule und wühlte sich mit den Zähnen in die Muskeln über dem Ellenbogen ein, sie entsetzlich zerreißend und zerfetzend. Wären die anderen nicht zur Stelle gewesen, er würde den Mann noch weit ernstlicher verletzt, wenn nicht getötet haben. Die Gefährten aber machten das mutige Tier bald mit ihren Speeren und Beilen nieder. Der Verwundete blieb lange Zeit krank und erlangte den Gebrauch seines Armes niemals vollständig wieder.« Von der Wahrheit dieser Erzählung konnte sich Wallace selbst überzeugen, weil er am nächsten Tage den Kampfplatz besuchte und dem getöteten Orang-Utan den Kopf abschnitt, um diesen seinen Sammlungen einzuverleiben.
Gelegentlich einer seiner Jagden erlangte unser Forscher auch einen jungen Orang-Utan. Von Dajaks herbeigerufen, sah er einen großen Meias sehr hoch auf einem Baume sitzen und erlegte ihn mit drei Schüssen. Während die Leute ihn zurüsteten, um ihn nach Hause zu tragen, bemerkte man noch ein Junges, das mit seinem Kopfe im Sumpfe lag. »Dieses kleine Geschöpf«, berichtet Wallace, »war nur einen Fuß lang und hatte augenscheinlich am Halse der Mutter gehangen, als sie vom Baume herabfiel. Glücklicherweise schien es nicht verwundet zu sein, und nachdem der Mund vom Schlamme gesäubert worden war, fing es an zu schreien und schien kräftig und lebhaft. Als ich es nach Hause trug, geriet es mit seinen Händen in meinen Bart und faßte so fest hinein, daß ich große Mühe hatte, frei zu kommen: denn die Finger sind gewöhnlich am letzten Gelenke hakenartig nach innen gebogen. Es hatte noch keinen einzigen Zahn; doch kamen einige Tage darauf die beiden unteren Vorderzähne zum Vorscheine. Unglücklicherweise konnte ich keine Milch schaffen, da weder Malaien noch Chinesen noch Dajaks dieses Nahrungsmittel verwenden, und vergeblich bemühte ich mich um ein weibliches Tier, das mein Kleines säugen könnte. Ich sah mich daher genötigt, ihm Reiswasser aus der Saugflasche zu geben. Dies aber war doch eine zu magere Kost, und das kleine Geschöpf gedieh auch nicht gut dabei, obgleich ich gelegentlich Zucker und Kokosnußmilch hinzufügte, um die Atzung nahrhafter zu machen. Wenn ich meinen Finger in seinen Mund steckte, saugte es mit großer Kraft, zog seine Backen mit aller Macht ein und strengte sich vergeblich an, etwas Milch herauszuziehen, und erst nachdem es das eine Zeitlang getrieben hatte, stand es mißmutig davon ab und fing ganz wie ein Kind unter ähnlichen Umständen zu schreien an. Liebkoste und wartete man es, so war es ruhig und zufrieden; sowie man es aber ablegte, schrie es stets, namentlich in den ersten paar Nächten, die es unter großer Unruhe verbrachte. Ich machte einen kleinen Kasten als Wiege zurecht und reichte ihm eine weiche Matte, die täglich gewechselt und gereinigt wurde, fand es jedoch sehr bald nötig, auch den kleinen Meias zu waschen. Diese Behandlung gefiel ihm, nachdem er sie einige Male durchgemacht hatte, in so hohem Grade, daß er zu schreien begann, sobald er schmutzig war, und nicht eher aufhörte, als bis ich ihn herausnahm und nach dem Brunnen trug. Obwohl er beim ersten kalten Wasserstrahl etwas strampelte und sehr komische Grimassen schnitt, beruhigte er sich dann doch sofort, wenn das Wasser über seinen Kopf lief. Das Abwaschen und Trockenreiben liebte er außerordentlich, und vollkommen glücklich schien er zu sein, wenn ich sein Haar bürstete. Dann lag er ganz still und streckte Arme und Beine von sich, während ich das lange Haar auf Rücken und Armen strählte. In den ersten Paar Tagen klammerte er sich mit allen Vieren verzweifelt an alles, was er packen konnte, und ich mußte meinen Bart sorgfältigst vor ihm in acht nehmen, da seine Finger das Haar hartnäckiger als irgend etwas festhielten, und ich mich ohne Hilfe unmöglich von ihm befreien konnte. Wenn er aber ruhig war, wirtschaftete er mit den Händen in der Luft umher und versuchte irgend etwas zu ergreifen. Gelang es ihm, einen Stock oder einen Lappen mit zwei Händen oder mit diesen und einem Fuße zu fassen, so schien er ganz glücklich zu sein. In Ermangelung eines anderen ergriff er oft seine eigenen Füße, und nach einiger Zeit kreuzte er fast beständig seine Arme und packte mit jeder Hand das lange Haar unter der entgegengesetzten Schulter. Bald aber ließ seine Kraft nach, und ich mußte auf Mittel sinnen, ihn zu üben und seine Glieder zu stärken. Zu diesem Zwecke verfertigte ich ihm eine kurze Leiter mit drei oder vier Sprossen und hing ihn eine Viertelstunde lang an dieselbe. Zuerst schien ihm dies zu gefallen; er konnte jedoch nicht mit Händen und Füßen in eine bequeme Lage kommen und ließ, nachdem er jene verschiedene Male geändert hatte, eine Hand nach der anderen los, bis er zuletzt auf den Boden herabfiel. Manchmal, wenn er nur an zwei Händen hing, ließ er eine los und kreuzte sie nach der gegenüberliegenden Schulter, um hier sein eigenes Haar zu Packen, und da ihm dieses meist angenehmer als der Stock zu sein schien, ließ er auch die andere los, fiel herab, kreuzte beide Arme und lag zufrieden auf dem Rücken. Da ich sah, daß er Haar so gern hatte, bemühte ich mich, ihm eine künstliche Mutter herzustellen, indem ich ein Stück Büffelhaut in einen Bündel zusammenschnürte und niedrig über dem Boden aufhing. Zuerst schien ihm dasselbe ausgezeichnet zu gefallen, weil er mit seinen Beinen nach Belieben umherzappeln konnte und immer etwas Haar zum Festhalten fand. Meine Hoffnung, die kleine Waise glücklich gemacht zu haben, schien erfüllt. Bald aber erinnerte er sich seiner verlorenen Mutter und versuchte zu saugen. Dazwischen zog er sich so viel als möglich in die Höhe und suchte nun überall nach der Saugwarze, bekam aber nur den Mund voll Haare und Wolle, wurde verdrießlich, schrie heftig und ließ nach zwei oder drei vergeblichen Versuchen gänzlich von seinem Vorhaben ab. Eines Tages war ihm etwas Wolle in die Kehle gekommen, und ich fürchtete schon, daß er ersticken würde; nach vielem Keuchen aber erholte er sich doch wieder. Somit mußte ich die nachgemachte Mutter zerreißen und den letzten Versuch, das kleine Geschöpf zu beschäftigen, aufgeben. Nach der ersten Woche fand ich, daß ich ihn besser mit einem Löffel füttern und ihm mehr abwechselnde und nahrhaftere Kost reichen könnte. Gut eingeweichter Zwieback mit etwas Ei und Zucker gemischt, manchmal süße Kartoffeln wurden gern gegessen, und ich bereitete mir ein nie fehlschlagendes Vergnügen dadurch, daß ich die drolligen Grimassen beobachtete, durch die er seine Billigung oder sein Mißfallen über das, was ich ihm gegeben hatte, ausdrückte. Das arme kleine Geschöpf beleckte die Lippen, zog die Backen ein und verdrehte die Augen mit dem Ausdrucke der höchsten Befriedigung, wenn er seinen Mund mit dem, was er besonders liebte, voll hatte, während er andererseits den Bissen eine kurze Zeit mit der Zunge im Munde herumdrehte, als ob er einen Wohlgeschmack daran suchen wolle, und wenn er ihn nicht süß oder schmackhaft genug fand, regelmäßig alles wieder ausspie. Gab man ihm dasselbe Essen fernerhin, so begann er zu schreien und schlug heftig um sich, genau wie ein kleines Kind im Zorne zu tun pflegt.
Als ich meinen jungen Meias ungefähr drei Wochen besaß, bekam ich glücklicherweise einen jungen Makaken, der klein aber sehr lebhaft war und allein fressen konnte. Ich setzte ihn zu dem Meias, und sie wurden sogleich die besten Freunde. Keiner fürchtete sich im geringsten vor dem anderen. Der kleine Makak setzte sich ohne die mindeste Rücksicht auf den Leib, ja selbst auf das Gesicht des Meias, und während ich diesen fütterte, pflegte jener dabei zu sitzen und alles aufzunaschen, was danebenfiel, gelegentlich auch mit seinen Händen den Löffel aufzufangen. War ich mit der Atzung fertig geworden, so leckte er das, was an den Lippen des Meias saß, begierig ab und riß diesem schließlich das Maul auf, um zu sehen, ob noch etwas darin sei. Den Leib seines Gefährten betrachtete er wie ein bequemes Kissen, indem er sich oft darauf niederlegte, und der hilflose Meias ertrug allen Übermut seines Gefährten mit der beispiellosesten Geduld: denn er schien zu froh zu sein, überhaupt etwas Warmes in seiner Nähe oder einen Gegenstand zur Verfügung zu haben, Um den er zärtlich seine Arme schlingen konnte. Nur wenn sein Gefährte weggehen wollte, hielt er ihn solange als er konnte, an der beweglichen Haut des Nackens oder Kopfes oder auch wohl am Schwanze fest, und der Makak vermochte nur nach vielen kräftigen Sprüngen sich loszumachen. Merkwürdig war das verschiedene Gebaren dieser zwei Tiere, die im Alter nicht weit auseinander sein konnten. Der Meias benahm sich ganz wie ein kleines Kind, lag hilflos auf dem Rücken, rollte sich langsam hin und her, streckte alle Viere in die Luft, in der Hoffnung, irgend etwas zu erhaschen, war aber noch kaum imstande, seine Finger nach einem bestimmten Gegenstande hinzubringen, öffnete, wenn er unzufrieden war, seinen fast zahnlosen Mund und drückte seine Wünsche durch ein sehr kindliches Schreien aus; der junge Makak dagegen war in beständiger Bewegung, lief und sprang umher, wann und wo es ihm Vergnügen machte, untersuchte alles, ergriff mit der größten Sicherheit die kleinsten Dinge, er hielt sich mühelos auf dem Rande des Kastens im Gleichgewichte, kletterte an einem Pfahle hinauf und setzte sich in den Besitz von allem Eßbaren, das ihm in den Weg kam. Man konnte keinen größeren Gegensatz sich denken: der Meias erschien neben dem Makaken noch mehr denn als ein kleines Kind.
Nachdem ich meinen Gefangenen ungefähr einen Monat besessen hatte, zeigte sich, daß er wohl allein laufen lernen würde. Wenn man ihn auf die Erde legte, stieß er sich mit den Beinen weiter oder überstürzte sich und kam so schwerfällig vorwärts. Wenn er im Kasten lag, pflegte er sich am Rande gerade aufzurichten, und es gelang ihm auch ein- oder zweimal bei dieser Gelegenheit, sich herauszuhelfen. War er schmutzig oder hungrig, oder fühlte er sich sonst vernachlässigt, so begann er heftig zu schreien, bis man ihn wartete. Wenn niemand im Hause war, oder wenn man auf sein Schreien nicht kam, wurde er nach einiger Zeit von selbst ruhig. So wie er aber dann einen Tritt hörte, fing er wieder um so ärger an.
Nach fünf Wochen kamen seine beiden oberen Vorderzähne zum Vorschein. In der letzten Zeit war er nicht im geringsten gewachsen, sondern an Größe und Gewicht derselbe geblieben wie anfangs. Das kam zweifellos von dem Mangel an Milch oder anderer ebenso nahrhafter Kost her. Reiswasser, Reis und Zwieback waren doch nur dürftige Ersatzmittel, und die ausgepreßte Milch der Kokosnuß, die ich ihm manchmal gab, vertrug sich nicht mit seinem Magen. Dieser Nahrung hatte ich auch eine Erkrankung an Durchfall zuzuschreiben, unter der das arme, kleine Geschöpf sehr litt; doch gelang es mir, ihn durch eine geringe Gabe Rizinusöl wieder herzustellen. Eine oder zwei Wochen später wurde er wieder krank und diesmal ernstlicher. Die Erscheinungen waren genau die des Wechselfiebers, auch von Anschwellungen der Füße und des Kopfes begleitet. Er verlor alle Eßlust und starb, nachdem er in einer Woche bis zu einem Jammerbilde abgezehrt war. Der Verlust meines kleinen Lieblings, den ich fast drei Monate besessen und großzuziehen gehofft hatte, tat mir außerordentlich leid. Monatelang hatte er mir durch sein drolliges Gebaren und seine unnachahmlichen Grimassen das größte Vergnügen bereitet.«
Zur Vervollständigung des von Wallace so trefflich gezeichneten Lebensbildes eines jungen Orang-Utan will ich noch einige ältere Berichte folgen lassen. Die ersten genauen Beobachtungen verdanken wir dem Holländer Vosmaern, der ein Weibchen längere Zeit zahm hielt. Das Tier war gutmütig und bewies sich niemals boshaft oder falsch. Man konnte ihm ohne Bedenken die Hand in das Maul stecken. Sein äußeres Ansehen hatte etwas Trauriges, Schwermütiges. Es liebte die menschliche Gesellschaft ohne Unterschied des Geschlechtes, zog aber diejenigen Leute vor, die sich am meisten mit ihm beschäftigten. Man hatte es an eine Kette gelegt, worüber es zuweilen in Verzweiflung geriet; es warf sich dann auf den Boden, schrie erbärmlich und zerriß alle Decken, die man ihm gegeben hatte. Als es einmal freigelassen wurde, kletterte es behend in dem Sparrwerke des Daches umher und zeigte sich hier so hurtig, daß vier Personen eine Stunde lang zu tun hatten, um es wieder einzufangen. Bei diesem Ausfluge erwischte es eine Flasche mit Malagawein, entkorkte sie und brachte den Wein schleunigst in Sicherheit, stellte dann aber die Flasche wieder an ihren Ort. Es fraß alles, was man ihm gab, zog aber Obst und gewürzhafte Pflanzen anderen Speisen vor. Gesottenes und gebratenes Fleisch oder Fische genoß es ebenfalls sehr gern. Nach Kerbtieren jagte es nicht, und ein ihm dargebotener Sperling verursachte ihm viel Furcht; doch biß es ihn endlich tot, zog ihm einige Federn aus, kostete das Fleisch und warf den Vogel wieder weg. Rohe Eier soff es mit Wohlbehagen aus. Der größte Leckerbissen schienen ihm Erdbeeren zu sein. Sein gewöhnliches Getränk bestand in Wasser; es trank aber auch sehr gern alle Arten von Wein und besonders Malaga. Nach dem Trinken wischte es die Lippen mit der Hand ab, bediente sich sogar eines Zahnstochers in derselben Weise wie ein Mensch. Diebstahl übte es meisterhaft; es zog den Leuten, ohne das sie es merkten, Leckereien aus den Taschen heraus. Vor dem Schlafengehen machte es stets große Anstalten. Es legte sich das Heu zum Lager zurecht, schüttelte es gut auf, legte sich noch ein besonderes Bündel unter den Kopf und deckte sich dann zu. Allein schlief es nicht gern, weil es die Einsamkeit überhaupt nicht liebte. Bei Tage schlummerte es zuweilen, aber niemals lange. Man hatte ihm eine Kleidung gegeben, die es sich bald um den Leib, und bald um den Kopf legte, und zwar ebensowohl, wenn es kühl war, als während der größten Hitze. Als man ihm einmal das Schloß seiner Kette mit dem Schlüssel öffnete, sah es mit großer Aufmerksamkeit zu und nahm sodann ein Stückchen Holz, steckte es ins Schlüsselloch und drehte es nach allen Seiten um. Einst gab man ihm eine junge Katze. Es hielt dieselbe fest und beroch sie sorgfältig. Die Katze kratzte es in den Arm, da warf es dieselbe weg, besah sich die Wunde und wollte fortan nichts wieder mit Miez zu tun haben. Es konnte die verwickeltsten Knoten an einem Stricke sehr geschickt mit den Fingern oder, wenn sie zu fest waren, mit den Zähnen auslösen und schien daran eine solche Freude zu haben, daß es auch den Leuten, die nahe zu ihm hintraten, regelmäßig die Schuhe aufband. In seinen Händen besaß es eine außerordentliche Stärke und konnte damit die größten Lasten aufheben. Die Hinterhände benutzte es ebenso geschickt wie die vorderen. So legte es sich zum Beispiel, wenn es etwas mit den Vorderhänden nicht erreichen konnte, auf den Rücken und zog den Gegenstand mit den Hinterfüßen heran. Es schrie nie, außer wenn es allein war. Anfangs glich dieses Geschrei dem Heulen eines Hundes. Die Auszehrung machte seinem jungen Leben bald ein Ende.
Ein anderer zahmer Meias, von dem uns Jeffries erzählt, hielt seinen Stall sehr reinlich, scheuerte den Boden desselben öfters mit einem Lappen und Wasser und entfernte alle Überreste von Speisen und dergleichen. Er wusch sich auch Gesicht und Hände wie ein Mensch. Ein anderer Orang-Utan zeichnete sich durch große Zärtlichkeit gegen alle aus, die freundlich mit ihm sprachen, und küßte seinen Herrn und seinen Wärter echt menschlich. Gegen Unbekannte war er sehr schüchtern, gegen Bekannte ganz zutraulich.
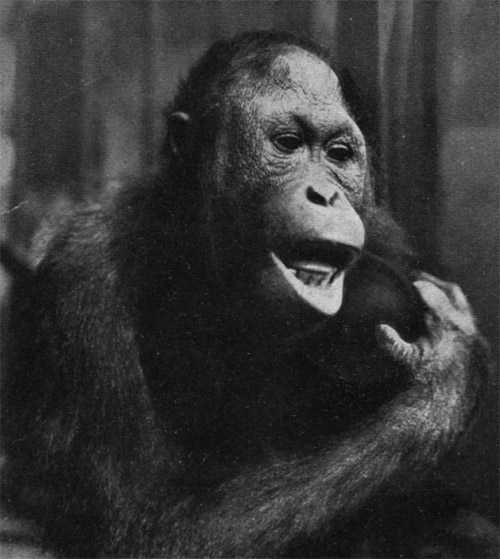
Orang-Utan ( Pithecus satyrus) Brustbild
Der Orang-Utan, den Cuvier in Paris beobachtete, war etwa zehn bis elf Monate alt, als er nach Frankreich kam, und lebte dort noch fast ein halbes Jahr. Seine Bewegungen waren langsam und auf dem Boden schwerfällig. Er setzte beide Hände geschlossen vor sich nieder, erhob sich aus seine langen Arme, schob den Leib vorwärts, setzte die Hinterfüße zwischen die Arme vor die Hände und schob den Hinterleib nach, stemmte sich dann wieder auf die Fäuste usw. Wenn er sich auf eine Hand stützen konnte, ging er auch aus den Hinterfüßen, trat aber immer mit dem äußeren Rande des Fußes auf. Beim Sitzen ruhte er in der Stellung der Morgenländer mit eingeschlagenen Beinen. Das Klettern wurde ihm sehr leicht; er umfaßte dabei den Stamm mit den Händen, nicht mit den Armen und Schenkeln. Wenn sich die Zweige zweier Bäume berührten, kam er leicht von einem Baume zum anderen. In Paris ließ man ihn an schönen Tagen oft in einem Garten frei; dann kletterte er rasch auf die Bäume und setzte sich auf die Äste. Wenn ihm jemand nachstieg, schüttelte er die Äste aus allen Kräften, als wenn er seinen Nachfolger abschrecken wollte; zog man sich zurück, so endeten diese Vorsichtsmaßregeln; erneuerte man den Versuch, so begannen sie sogleich wieder. Auf dem Schiffe hatte er sich oft im Takelwerke lustig gemacht; das Schwanken des Fahrzeugs hatte ihm jedoch viel Angst bereitet, und er war nie gegangen, ohne sich an Seilen und dergleichen zu halten. Beim Schlafen bedeckte er sich gern mit jedem Zeuge, das er finden konnte, und die Matrosen durften sicher darauf zählen, daß sie ein ihnen fehlendes Kleidungsstück bei ihm finden würden. Die Essenszeit kannte er genau, kam regelmäßig zur rechten Zeit zu seinem Wärter hin und nahm, was dieser ihm gab. Fremdenbesuche wurden ihm oft lästig, und nicht selten versteckte er sich solange unter seinen Decken, bis die Leute wieder fort waren. Bei Bekannten tat er dies nie. Nur von seinem Wärter nahm er Futter an. Als sich einst ein Fremder an den gewöhnlichen Platz seines Pflegers setzte, kam er zwar herbei, verweigerte aber, als er den Fremden bemerkte, alle Nahrung, sprang auf den Boden, schrie und schlug sich, wie in Verzweiflung, vor den Kopf. Seine Speise nahm er mit den Fingern und nur selten gleich mit den Lippen auf und beroch alles, was er nicht kannte, vorher sorgfältig. Sein Hunger war unverwüstlich: er konnte, wie die Kinder, zu jeder Zeit essen.
Zuweilen biß und schlug er zu seiner Verteidigung um sich, aber nur gegen Kinder und mehr aus Ungeduld als aus Zorn. Er war überhaupt sanft und liebte die Gesellschaft, ließ sich gern schmeicheln und gab Küsse im eigentlichen Sinne. Wenn er etwas sehnsüchtig verlangte, ließ er einen starken Kehllaut hören. Denselben vernahm man gleichfalls, wenn er im Zorne war; doch wälzte er sich dann oft am Boden und schmollte, falls man ihm nicht willfahrte. Zwei junge Katzen hatte er besonders liebgewonnen und hielt die eine oft unter dem Arme oder setzte sie sich auf den Kopf, obschon sie sich mit ihren Krallen an seiner Haut festhielt. Einigemal betrachtete er ihre Pfoten und suchte die Krallen mit seinen Fingern auszureißen. Da ihm dies nicht gelang, duldete er lieber die Schmerzen, als daß er das Spiel mit seinen Lieblingen aufgegeben hätte.
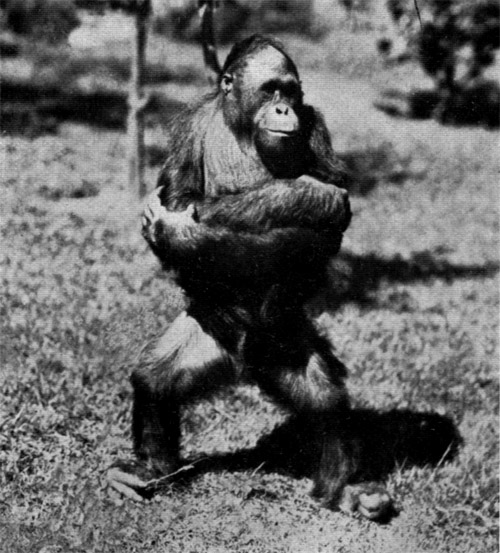
Orang-Utan ( Pithecus satyrus) stehend
Eine fernere Mitteilung rührt von einem guten Beobachter her, der den Orang-Utan drei Monate mit sich auf dem Schiffe hatte. Das Tier hauste, solange sich das Schiff in den asiatischen Gewässern befand, auf dem Verdecke, seinem beständigen Aufenthalte, und suchte sich nur des Nachts eine geschützte Stelle zum Schlafen aus. Während des Tages war der Orang-Utan außerordentlich aufgeräumt, spielte mit anderen kleinen Affen, die sich an Bord befanden, und lustwandelte im Takelwerke umher. Das Turnen und Klettern schien ihm ein besonderes Vergnügen zu machen; denn er führte es mehrmals des Tages an verschiedenen Tauen aus. Seine Gewandtheit und die bei diesen Bewegungen sichtbar werdende Muskelkraft war erstaunenswert. Kapitän Smitt, der Beobachter, hatte einige hundert Kokosnüsse mitgenommen, von denen der Affe täglich zwei erhielt. Die äußerst zähe, zwei Zoll dicke Hülle der Nuß, die selbst mit einem Beile nur schwer zu durchhauen ist, wußte er mit seinem gewaltigen Gebiß sehr geschickt zu zertrümmern. Er setzte an dem spitzigen Ende der Nuß, wo die Frucht kleine Erhöhungen oder Buckel hat, mit seinen furchtbaren Zähnen ein, packte die Nuß dann mit dem rechten Hinterfuße und riß so regelmäßig die zähe Schale auseinander. Dann durchbohrte er mit den Fingern einige der natürlichen Öffnungen der Nuß, trank die Milch aus, zerschlug hierauf die Nuß an einem harten Gegenstande und fraß den Kern.
Nachdem das Schiff die Sundastraße verlassen hatte, verlor gedachter Waldmensch mit der abnehmenden Wärme mehr und mehr seine Heiterkeit. Er hörte auf zu turnen und zu spielen, kam nur noch selten auf das Verdeck, schleppte die wollene Decke seines Bettes hinter sich her und hüllte sich, sobald er stille saß, vollständig in dieselbe ein. In der gemäßigten südlichen Zone hielt er sich größtenteils in der Kajüte auf und saß dort oft stundenlang mit der Decke über dem Kopfe regungslos auf einer Stelle. Sein Bett bereitete er sich ebenfalls mit der größten Umständlichkeit. Er schlief nie, ohne vorher seine Matratze zwei- bis dreimal mit dem Rücken der Hände ausgeklopft und geglättet zu haben. Dann streckte er sich auf den Rücken, zog die Decke um sich, so daß nur die Nase mit den dicken Lippen frei blieb, und lag in dieser Stellung die ganze Nacht oder zwölf Stunden, ohne sich zu rühren. In seiner Heimat geschah sein Aufstehen und Niederlegen so regelmäßig wie der Gang einer Uhr. Punkt sechs Uhr morgens oder mit Sonnenaufgang erhob er sich, und sowie der letzte Strahl der Sonne hinter dem Gesichtskreise entschwunden war, also Punkt sechs Uhr abends, legte er sich wieder nieder. Je weiter das Schiff nach Westen segelte und demgemäß in der Zeit abwich, um so früher ging er zu Bette und um so früher stand er auf, weil er eben auch nur seine zwölf Stunden schlief. Diese Veränderung des Schlafengehens stand übrigens nicht genau mit der Zeitrechnung des Schiffes im Verhältnis; allein eine gewisse Regelmäßigkeit war nicht zu verkennen. Am Vorgebirge der guten Hoffnung ging er bereits um zwei Uhr des Mittags zu Bette und stand um halb drei Uhr des Morgens auf. Diese beiden Zeiten behielt er später bei, obwohl das Schiff im Verlaufe seiner Reise die Zeit noch um zwei Stunden veränderte.
Außer den Kokosnüssen liebte er Salz, Fleisch, Mehl, Sago usw. und wandte alle mögliche List an, um während der Mahlzeit eine gewisse Fleischmenge sich zu sichern. Was er einmal gefaßt hatte, gab er nie wieder her, selbst wenn er geschlagen wurde. Drei bis vier Pfund Fleisch aß er mit Leichtigkeit auf einmal. Das Mehl holte er sich täglich aus der Küche und wußte dabei immer eine augenblickliche Abwesenheit des Kochs zu benutzen, um die Mehltonne zu öffnen, seine Hand tüchtig voll zu nehmen und sie nachher auf dem Kopfe abzuwischen, so daß er stets gepudert zurückkam. Dienstags und Freitags, sobald acht Glas geschlagen wurde, stattete er den Matrosen unwandelbar seinen Besuch ab, weil die Leute an diesen Tagen Sago mit Zucker und Zimt erhielten. Ebenso regelmäßig stellte er sich um zwei Uhr in der Kajüte ein, um am Mahle teilzunehmen. Beim Essen war er sehr ruhig und, gegen die Gewohnheit der Affen, reinlich: doch konnte er nie dazu gebracht werden, einen Löffel richtig zu gebrauchen. Er setzte den Teller einfach an den Mund und trank die Suppe aus, ohne einen Tropfen zu verschütten. Geistige Getränke liebte er sehr und erhielt deshalb mittags stets sein Glas Wein. Er leerte dieses in ganz eigentümlicher Weise. Aus seiner Unterlippe konnte er durch Vorstrecken einen drei Zoll langen und fast ebenso breiten Löffel bilden, geräumig genug, um ein Glas Wasser aufzunehmen. In diesen Löffel schüttete er das betreffende Getränk, und niemals trank er, ohne ihn zuvor herzustellen. Nachdem er das ihm gereichte Glas sorgfältig berochen hatte, bildete er seinen Löffel, goß das Getränk hinein und schlürfte es sehr bedächtig und langsam zwischen den Zähnen hinunter, als ob er sich einen recht dauernden Genuß davon verschaffen wollte. Nicht selten währte dieses Schlürfen mehrere Minuten lang, und erst dann hielt er sein Glas von neuem hin, um es sich wieder füllen zu lassen. Er zerbrach niemals ein Gefäß, sondern setzte es stets behutsam nieder, und unterschied sich hierdurch sehr zu seinem Vorteile von den übrigen Affen, die, wie bekannt, Geschirre gewöhnlich zerschlagen.
Nur ein einziges Mal sah sein Besitzer, daß er sich an der Schiffswand ausrichtete und so einige Schritte weit ging. Dabei hielt er sich jedoch wie ein Kind, das gehen lernt, immer mit beiden Händen fest. Während der Reise kletterte er selten umher und dann stets langsam und bedächtig; gewöhnlich tat er es nur dann, wenn ein anderer, kleinerer Affe, sein Liebling, wegen einer Unart bestraft werden sollte. Dieser flüchtete sich dann regelmäßig an die Brust seines großen Freundes und klammerte sich dort fest, und Bobi, so hieß der Orang-Utan, spazierte mit seinem kleinen Schützlinge in das Takelwerk hinaus, bis die Gefahr verschwunden schien.
Man vernahm nur zwei Stimmlaute von ihm: einen schwachen, pfeifenden Kehllaut, der Gemütsaufregung kennzeichnete, und ein schreckliches Gebrüll, das dem einer geängsteten Kuh etwa ähnelte und Furcht ausdrückte. Diese wurde einmal durch eine Herde von Pottfischen hervorgerufen, die nahe am Schiffe vorüberschwamm und ein zweites Mal durch den Anblick verschiedener Wasserschlangen, die sein Gebieter mit aus Java gebracht hatte. Der Ausdruck seiner Gesichtszüge blieb sich immer gleich.
Leider machte ein unangenehmer Zufall dem Leben des schönen Tieres ein Ende, noch ehe es Deutschland erreichte. Bobi hatte von seiner Lagerstätte aus den Kellner des Schiffes beobachtet, während dieser Rumflaschen umpackte, und dabei bemerkt, daß der Mann einige Flaschen bis auf weiteres liegen ließ. Es war zu der Zeit, als es sich schon um zwei Uhr nachmittags zu Bette legte. In der Nacht vernahm sein Herr ein Geräusch in der Kajüte, als wenn jemand mit Flaschen klappere, und sah beim Schimmer der auf dem Tische brennenden Nachtlampe wirklich eine Gestalt an dem Weinlager beschäftigt. Zu seinem Erstaunen entdeckte er in dieser seinen Orang-Utan. Bobi hatte eine bereits fast ganz geleerte Rumflasche vor dem Munde. Vor ihm lagen sämtliche leere Flaschen behutsam in Stroh gewickelt, die endlich gefundene volle hatte er auf geschickte Weise entkorkt und seinem Verlangen nach geistigen Getränken völlig Genüge leisten können. Etwa zehn Minuten nach diesem Vorgange wurde Bobi plötzlich lebendig. Er sprang auf Stühle und Tische, machte die lächerlichsten Bewegungen und gebürdete sich mit steigender Lebhaftigkeit, wie ein betrunkener und zuletzt wie ein wahnsinniger Mensch. Es war unmöglich, ihn zu bändigen. Sein Zustand hielt ungefähr eine Viertelstunde an, dann fiel er zu Boden; es trat ihm Schaum vor den Mund, und er lag steif und regungslos. Nach einigen Stunden kam er wieder zu sich, fiel aber in ein heftiges Nervenfieber, das seinem Leben ein Ziel setzen sollte. Während seiner Krankheit nahm er nur Wein mit Wasser und die ihm gereichten Arzneien zu sich, nichts weiter. Nachdem ihm einmal an den Puls gefühlt worden war, streckte er seinem Herrn jedesmal, wenn dieser an sein Lager trat, die Hand entgegen. Dabei hatte sein Blick etwas so Rührendes und Menschliches, daß seinem Pfleger öfters die Tränen in die Augen traten. Mehr und mehr nahmen seine Kräfte ab, und am vierzehnten Tage verschied er nach einem heftigen Fieberanfalle.
Ich habe mehrere lebende Orang-Utans beobachtet, keinen einzigen aber kennengelernt, der mit einem Schimpansen gleichen Alters hätte verglichen werden können. Allen fehlte die letzteren so auszeichnende neckische Munterkeit und die Lust zu scherzen: sie waren im Gegenteil ernsthaft bis zum äußersten, mehrere auch still und deshalb langweilig. Jede ihrer Bewegungen war langsam und gemessen, der Ausdruck ihrer braunen, gutmütigen Augen unendlich traurig. So stellten sie fast in jeder Hinsicht ein Gegenstück des Schimpansen dar.
*
Bei keiner Sippe der Affen zeigt sich die Entwicklung der Vorderglieder in gleichem Grade wie bei den Gibbons oder Langarmaffen ( Hylobates). Sie tragen ihren Namen mit vollstem Rechte; denn die über alles gewohnte Maß verlängerten Arme erreichen, wenn sich ihr Träger aufrecht stellt, den Boden. Dieses eine Merkmal würde genügen, um die Langarmaffen von allen übrigen Mitgliedern ihrer Ordnung zu unterscheiden.
Die Gibbons bilden eine kleine Gruppe der Affen; sie sind sämtlich Asiaten und gehören ausschließlich Ostindien und seinen Inseln an. Die Arten erreichen eine ziemlich bedeutende Größe, wenn auch keine einzige über einen Meter hoch wird. Ihr Körper erscheint trotz der starken und gewölbten Brust sehr schlank, weil die Weichengegend, wie bei dem Windhunde, verschmächtigt ist; die Hinterglieder sind bedeutend kürzer als die vorderen, und ihre langen Hände bei einigen Arten noch durch die teilweise miteinander verwachsenen Zeige- und Mittelfinger ausgezeichnet. Der Kopf ist klein und eiförmig, das Gesicht menschenähnlich: die Gesäßschwielen sind klein, und der Schwanz ist äußerlich noch nicht sichtbar. Ein reicher und oft seidenweicher Pelz umhüllt ihren Leib; Schwarz, Braun, Braungrau und Strohgelb sind seine Hauptfarben.
Der Siamang ( Hylobates syndactylus) wegen der am Grunde verwachsene Zeige- und Mittelzehe auch wohl als Vertreter einer besonderen Untersippe betrachtet, ist der größte aller Langarmaffen, und auch dadurch ausgezeichnet, daß seine Arme verhältnismäßig weniger lang als die der anderen Arten erscheinen. »Seine Gestalt nackt gedacht«, sagt Duvaucel, »würde eine häßliche sein, besonders deshalb, weil die niedrige Stirn bis auf die Augenbrauenbogen verkümmert ist, die Augen tief in ihren Höhlen liegen, die Nase breit und platt erscheint, die seitlichen Nasenlöcher aber sehr groß sind und das Maul sich fast bis auf den Grund der Kinnladen öffnet. Gedenkt man sonst noch des großen nackten Kehlsackes, der schmierig und schlaff wie ein Kropf am Vorderhalse herabhängt und beim Schreien sich ausdehnt, der gekrümmten, einwärts gekehrten Gliedmaßen, die stets gebogen getragen werden, der unter vorstehenden Höckern eingesenkten Wangen und des verkümmerten Kinnes, so wird man sich sagen müssen, daß unser Affe nicht zu den schönsten seiner Ordnung gehört. Ein dichter, aus langen, weichen und glänzenden Haaren gebildeter Pelz von tiefschwarzer Farbe deckt den Leib; nur die Augenbrauen sind rotbraun. Auf dem Hodensacke stehen lange Haare, die, nach unten gekehrt, einen nicht selten bis zu den Knien herabreichenden Pinsel bilden. Die Haare richten sich am Vorderarme rückwärts, am Oberarme vorwärts, so daß am Ellenbogen ein Busch entsteht.« Nach Versicherung von Raffles kommen auch Weißlinge vor. Ausgewachsene Männchen erreichen ein Meter an Höhe, klaftern aber beinahe das Doppelte.
Der Siamang ist in den Waldungen von Sumatra gemein und wurde von tüchtigen Forschern in der Freiheit wie in Gefangenschaft beobachtet.
Mehr das allgemeine Gepräge der Sippe zeigt der Hulock ( H. Hulock), ein Langarmaffe von etwa 0,90 Meter Höhe, ohne Kehlkopf und mit freien Zehen. Sein Pelz ist bis auf eine weiße Stirnbinde kohlschwarz, der des Jungen schwarzbraun, an den Gliedmaßen längs der Mittellinie des Leibes und auf dem Rücken aschgrau. Die Gesäßschwielen sind deutlich. Der Hulock bewohnt Hinterindien und Bengalen, besonders häufig die Uferwaldungen am Burramputr in Assan.
Der Lar ( H. Lar) wird ungefähr ebensogroß wie der Hulock, hat schwarzgraue Färbung, lohfarbenes, rings von weißen Haaren umgebenes Gesäß und oberseits weißgraue, unterseits schwarze Hände und Füße. Das Vaterland ist Malakka und Siam.
Der Unko ( H. Rafflesii) ähnelt dem Hulock in der Größe, unterscheidet sich aber durch die Färbung sowie anatomisch dadurch, daß er vierzehn Rippenpaare besitzt. Gesicht und Pelz sind schwarz, auf dem Rücken und an den Weichen braunrötlich, Augenbrauen, Backen und Kinnbacken bei dem Männchen weiß, bei dem bedeutend kleineren Weibchen schwarzgrau. Die Insel Sumatra ist das Vaterland des Unko; doch scheint er hier verhältnismäßig selten vorzukommen.
Der Wauwau ( H. agilis) endlich, der demselben Vaterlande entstammt, hat ein nacktes, blauschwarzes, beim Weibchen ins Bräunliche spielendes Gesicht und langen, reichen Pelz, dessen Färbung am Kopfe, auf dem Bauche und den Innenseiten der Arme und Schenkel dunkelbraun ist, über den Schultern und nach dem Halse zu unmerklich heller wird und auf den Weichen ins Blaßbraune übergeht, während die Aftergegend bis zu den Kniekehlen weiß und rötelfarbig gemischt erscheint. Hände und Füße sind dunkelbraun. Das Weibchen ist lichter, der Backenbart minder lang als bei dem Männchen, obschon immer noch groß genug, so daß der Kopf breiter als hoch erscheint. Die Jungen sind einfarbig gelblichweiß.
Ihre ganze Ausrüstung weist die Langarmaffen zum Klettern an. Sie besitzen jede Begabung, die zu einer raschen, anhaltenden und gewandten Kletter- oder Sprungbewegung erforderlich ist. Die volle Brust gibt großen Lungen Raum, die nicht ermüden, nicht ihren Dienst versagen, wenn das Blut durch die rasche Bewegung in Wallung gerät; die starken Hinterglieder verleihen die nötige Schnellkraft zu weiten Sprüngen, die langen Vorderglieder unerläßliche Sicherheit zum Ergreifen eines Astes, der zu neuem Stützpunkte werden soll, mit kürzeren Armen aber leicht verfehlt werden könnte. Wie lang im Verhältnis diese Arme sind, wird am deutlichsten klar, wenn man vergleicht. Ein Mensch klaftert, wie bekannt, ebensoweit, als er lang ist: der Gibbon aber klaftert fast das Doppelte seiner Leibeslänge; ein aufrechtstehender Mann berührt mit seinem schlaff herabhängenden Arme kaum sein Knie, der Gibbon hingegen seinen Knöchel. Daß solche Arme als Gehwerkzeuge fast unbrauchbar sind, ist erklärlich: sie eignen sich bloß zum Klettern. Deshalb ist der Gang der Langarmaffen ein trauriges Schwanken auf den Hinterfüßen, ein schwerfälliges Dahinschieben des Leibes, der nur durch die ausgestreckten Arme im Gleichgewichte erhalten werden kann, das Klettern und Zweigtanzen der Tiere aber ein lustiges, köstliches Bewegen, scheinbar ohne Grenzen, ohne Bewußtsein des Gesetzes der Schwere. Die Gibbons sind auf der Erde langsam, tölpisch, ungeschickt, kurz fremd, im Gezweige jedoch das gerade Gegenteil von alldem, ja wahre Vögel in Affengestalt. Wenn der Gorilla der Herkules unter den Affen ist, sind sie der leichte Merkur: trägt doch einer von ihnen, Hylobates Lar, seinen Namen zur Erinnerung an eine Geliebte des letzteren, an die schöne, aber schwatzhafte Najade Lara, die durch ihre rastlose Zunge Jovis Zorn, durch ihre Schönheit aber zu ihrem Glücke noch Merkurs Liebe erweckte und hierdurch dem Hades entrann.
Am schwerfälligsten bewegt sich, seiner Gestalt entsprechend, der Siamang, da er nicht bloß langsam geht, sondern auch etwas unsicher klettert und nur im Springen seine Behendigkeit bekundet. Aber auch die übrigen vermögen auf dem Boden nur schwer fortzukommen. »Im Zimmer oder auf ebener Erde«, sagt Harlan vom Hulock, »gehen sie aufrecht und halten das Gleichgewicht ziemlich gut, indem sie ihre Hände bis über den Kopf erheben, ihre Arme an dem Handgelenke und im Ellenbogen leise biegen und dann rechts und links wankend ziemlich schnell dahinlaufen. Treibt man sie zu größerer Eile an, so lassen sie ihre Hände auf den Boden reichen und helfen sich durch Unterstützung schneller fort. Sie hüpfen mehr als sie laufen, halten den Leib jedoch immer ziemlich aufrecht.« Von den übrigen wird gesagt, daß es aussehe, als ob der Leib nicht allein zu lang, sondern auch viel zu schwer sei für die kurzen und dünnen Schenkel, sich deshalb vorn überneige, und daß ihre beiden Arme beim Gehen gleichsam als Stelzen benutzt werden müßten. »So kommen sie ruckweise vorwärts, vergleichbar einem auf Krücken humpelnden Greise, der eine stärkere Anstrengung fürchtet.« Ganz das Gegenteil findet statt, wenn sie sich kletternd bewegen. Alle Berichterstatter sind einstimmig in ihrer Bewunderung über die Fertigkeit und Geschicklichkeit, die die Langarmaffen im Gezweige bekunden.
Mit unglaublicher Raschheit und Sicherheit erklettert der Wauwau, laut Duvaucel, einen Bambusrohrstengel, einen Baumwipfel oder einen Zweig, schwingt sich auf ihm einigemal auf und nieder oder hin und her und schnellt sich nun, durch den zurückprallenden Ast unterstützt, mit solcher Leichtigkeit über Zwischenräume von zwölf bis dreizehn Metern hinüber, drei-, viermal nacheinander, daß es aussieht, als flöge er wie ein Pfeil oder ein schief abwärts stoßender Vogel. Man vermeint es ihm anzusehen, daß das Bewußtsein seiner unerreichbaren Fertigkeit ihm großes Vergnügen gewährt. Er springt ohne Not über Zwischenräume, die er durch kleine Umwege leicht vermeiden könnte, ändert im Sprunge die Richtung und hängt sich an den ersten besten Zweig, schaukelt und wiegt sich an ihm, ersteigt ihn rasch, federt ihn auf und nieder und wirft sich wieder hinaus in die Luft, mit unfehlbarer Sicherheit einem neuen Ziel zustrebend. Es scheint, als ob er Zauberkräfte besäße und ohne Flügel gleichwohl fliegen könne; er lebt mehr in der Luft als in dem Gezweige. Was bedarf solch begabtes Wesen noch der Erde? Sie bleibt ihm fremd, wie er ihr; sie bietet ihm höchstens die Labung des Trunkes, sonst stößt sie ihn zurück in sein luftiges Reich. Hier findet er seine Heimat; hier genießt er Ruhe, Frieden, Sicherheit; hier wird es ihm möglich, jedem Feinde zu trotzen oder zu entrinnen; hier darf er leben, erglühen in der Lust seiner Bewegung.
Diese Lust zeigte sich recht deutlich an einem weiblichen Wauwau, den man lebend nach London brachte. Man wollte an ihm die Bewegungsfähigkeit seiner Sippschaft prüfen und richtete ihm deshalb einen großen Raum besonders her. Hier und da, in verschiedenen Entfernungen, setzte man Bäume ein für das Kind der Höhe, um seinen wundervollen Bewegungen Spielraum zu gewähren. Die größte Weite von einem Aste zum anderen betrug nur sechs Meter – wenig für einen Affen, der in der Freiheit das Doppelte überspringen kann, viel, sehr viel für ein Tier, das seiner Freiheit beraubt, in ein ihm fremdes und feindseliges Klima gebracht und seiner ursprünglichen Nahrung entwöhnt worden war, das eben erst eine lange, entkräftende Seereise überstanden hatte. Doch trotz all dieser mißlichen Umstände gab der Gibbon derartige Beweise seiner Bewegungsfähigkeit zum besten, daß, wie mein Gewährsmann sagt, »alle Zuschauer vor Erstaunen und Bewunderung geradezu außer sich waren«.
Es war ihm eine Kleinigkeit, sich von einem Aste auf den anderen zu schwingen, ohne die geringste Vorbereitung dazu bemerklich werden zu lassen, und er erreichte das erstrebte Ziel mit unwandelbarer Sicherheit. Er konnte seine Luftsprünge lange Zeit ununterbrochen fortsetzen, ohne dazu einen neuen ersichtlichen Ansatz zu nehmen; den zum Sprunge nötigen Abstoß gab er sich während der augenblicklichen Berührung der Äste, die er sich zum Auffußen erwählt hatte. Ebenso sicher wie seine Bewegungen waren bei ihm Auge und Hand. Die Zuschauer belustigten sich, ihm während seiner Sprünge Früchte zuzuwerfen: er fing sie auf, während er die Luft durchschnitt, ohne es der Mühe wert zu achten, deshalb seinen Flug zu unterbrechen. Er hatte sich stets und vollkommen in seiner Gewalt. Mitten im schnellsten Sprunge konnte er die begonnene Richtung ändern; während des kräftigsten Dahinschießens erfaßte er einen Zweig mit einer seiner Vorderhände, zog mit einem Rucke die Hinterfüße zu gleicher Höhe empor, packte mit ihnen den Ast und saß nun einen Augenblick später so ruhig da, als wäre er nie in Bewegung gewesen.
Es läßt sich denken, daß der Gibbon in der Freiheit noch ganz andere Proben seiner Beweglichkeit bieten kann, und die Erzählungen der Beobachter dürfen deshalb wohl auch allen Glauben verdienen, obgleich sie uns übertrieben zu sein scheinen. Die Berichterstatter vergleichen die Bewegungen der freilebenden Langarmaffen mit dem Fluge der Schwalben!
Die Beobachtung der Tiere im Freileben hat übrigens ihre Schwierigkeiten, weil fast alle Arten den Menschen meiden und nur selten an die Blößen in den Waldungen herankommen. »Meist leben sie«, sagt Duvaucel vom Siamang, »in zahlreichen Herden, die von einem Anführer geleitet werden, nach Versicherung der Malaien von einem Unverwundbaren ihres Geschlechtes. Überrascht man sie auf dem Boden, so kann man sie auch gefangennehmen; denn entweder hat der Schreck sie stutzig gemacht oder sie fühlen selbst ihre Schwäche und erkennen die Unmöglichkeit zu entfliehen. Die Herde mag so zahlreich sein, als sie will, stets verläßt sie den verwundeten Gefährten, es sei denn, daß es sich um einen ganz jungen handelt. In solchem Falle ergreift die Mutter ihr Kind, versucht zu fliehen, fällt vielleicht mit ihm nieder, stößt dann ein heftiges Schmerzensgeschrei aus und stellt sich dem Feinde mit aufgeblasenem Kehlsacke und ausgebreiteten Armen drohend entgegen. Die Mutterliebe zeigt sich aber nicht bloß in Gefahren, sondern auch sonst bei jeder Gelegenheit. Es war ein überraschendes Schauspiel, wenn es manchmal bei äußerster Vorsicht gelang, zu sehen, wie die Mütter ihre Kleinen an den Fluß trugen, sie ungeachtet ihres Geschreies abwuschen, darauf wieder abwischten und trockneten und überhaupt eine Mühe auf ihre Reinigung verwendeten, die man manchen Menschenkindern wünschen möchte. Die Malaien erzählten Diard, und dieser fand es späterhin bestätigt, daß die noch nicht bewegungsfähigen Jungen immer von demjenigen Teile ihrer Eltern getragen und geleitet werden, der ihrem Geschlechte entspricht, und zwar die männlichen Kleinen vom Vater, die weiblichen von der Mutter. Ebenso berichten sie, daß die Siamangs öfter den Tigern zur Beute würden, und zwar durch dieselbe Veranlassung, wie kleine Vögel oder Eichhörnchen Beute der Schlangen, nämlich durch Bezauberung, was, wenn die Geschichte überhaupt wahr ist, nichts anderes sagen will, als daß die Todesangst gedachte Affen vollständig sinnlos gemacht hat.
Über die Hulocks liegen ebenfalls ziemlich ausführliche Berichte vor. Diese Affen halten sich, laut Harlan, vorzüglich auf niedrigen Bergen auf, da sie Kälte nicht ertragen können. Ihre Nahrung besteht aus Früchten, die in den Bambuswäldern dieser Gegend vorkommen, namentlich aus Früchten und Samen des heiligen Propulbaumes. Sie verzehren aber auch gewisse Gräser, zarte Baumzweige u. dgl., kauen dieselben aus und verschlucken den Saft, während sie die ausgekaute Masse wegwerfen. Nach Owen, der fast zwei Jahre lang im Wohngebiete der Hulocks lebte, vereinigen sich diese in ihren Wäldern zu Gesellschaften von hundert bis hundertundfünfzig Stück. Gewöhnlich bemerkt man sie in den Wipfeln der höchsten Olung- und Makkoibäume, auf deren Früchte sie sehr erpicht sind; manchmal aber kommen sie auf Fußpfaden aus dem dichten Walde heraus in die offenen Lichtungen. Eines Tages begegnete Owen plötzlich einer Gesellschaft von ihnen, die sich fröhlich belustigten, bei seiner Annäherung aber sogleich Lärm schlugen und in das Dickicht der Bambus entflohen; ein andermal hingegen sah er sich, während er auf einer neu angelegten Straße einsam einherschritt, unvermutet von einer großen Gesellschaft unserer Affen umgeben, die zwar überrascht, noch mehr jedoch erzürnt schienen über das Eindringen eines fremdartig gekleideten Menschen in das Bereich ihrer Herrschaft. Die Bäume ringsum waren voll von ihnen, und sie drohten von oben hernieder mit Grimassen und wildem Geschrei, als Owen vorüberging. Ja, einige von ihnen stiegen hinter ihm von den Bäumen herab und folgten ihm auf der Straße, so daß sie bei ihm die Meinung erweckten, sie wollten einen Anfall machen. Auf der ebenen Straße gelang es freilich bald, den Verfolgern zu entkommen. Bei seiner Rückkehr in die Behausung fragte unser Berichterstatter seinen Dolmetscher, ob es gewöhnlich sei, daß man von diesen Affen feindlich angegriffen werde, und erfuhr, daß vor wenigen Tagen eine Gesellschaft von Nagas, auf einem vielbogigen Pfade durch die Bambusgebüsche hintereinander gehend, von Hulocks angegriffen wurde, ja, wahrscheinlich getötet worden wäre, hätten nicht die übrigen ihrem Vordermanne Hilfe leisten können. »In der Tat«, bemerkt Owen, »kann ich versichern, daß sie kräftige Kämpfer sind, da auch ein gezähmtes Weibchen des Wauwau einmal plötzlich seinen Wärter ergriff, auf ihn sprang, mit allen vier Händen kratzte und ihn in die Brust biß, wobei es noch ein Glück für den Mann war, daß es seine Eckzähne verloren hatte.« Ich muß bemerken, daß ich letztere Geschichte nicht glauben kann; denn alle übrigen Berichte widersprechen der Mitteilung Owens geradezu; namentlich wird hervorgehoben, daß Langarmaffen bei Annäherung des Menschen so eilig als möglich fliehen, aus diesem Grunde auch nur äußerst selten einmal gesehen werden. Sie sind, wie mir Haßkarl mitteilt, ebenso vorsichtig als neugierig, und erscheinen deshalb nicht selten am Rande eines freien, zum Feldbau entholzten Platzes, namentlich da, wo sie noch nicht durch Jäger scheu gemacht worden sind, verschwinden aber im Augenblicke, sobald sie bemerken, daß man sie beobachtet oder sich ihnen nähert, und werden dann so leicht nicht mehr gesehen.
Um so öfter hört man sie. Bei Sonnenauf- und -untergang pflegen sie ihre lautschallenden Stimmen zu einem so furchtbaren Geschrei zu vereinigen, daß man taub werden möchte, wenn man naht, und daß man wahrhaftig erschrickt, wenn man die sonderbare Musik nicht gewohnt ist. Sie sind die Brüllaffen der alten Welt, die Wecker der malaischen Bergbewohner und zugleich der Ärger der Städter, denen sie den Aufenthalt in ihren Landhäusern verbittern. Man soll ihr Geschrei auf eine englische Meile weit hören können. Von gefangenen Langarmaffen hat man es auch oft vernommen, und zwar von denen, die Kehlsäcke besitzen ebensogut, wie von denen, denen diese Stimmverstärkungstrommeln fehlen. Ein guter Beobachter, Bennet, besaß einen lebenden Siamang und bemerkte, daß dieser, wenn er irgendwie erregt war, jedesmal die Lippen trichtermäßig vorstreckte, dann Luft in die Kehlsäcke blies und nun lospolterte, fast wie ein Truthahn. Er schrie ebensowohl bei freudiger als bei zorniger Aufregung. Auch das Unkoweibchen in London schrie zuweilen laut, und zwar in höchst eigentümlicher, tonverständiger Weise. Man konnte das Geschrei sehr gut in Noten wiedergeben. Es begann mit dem Grundtone E und stieg dann in halben Tönen eine volle Oktave hinauf, die chromatische Tonleiter durchlaufend. Der Grundton blieb stets hörbar und diente als Vorschlag für jede folgende Note. Im Aufsteigen der Tonleiter folgten sich die einzelnen Töne immer langsamer, im Absteigen aber schneller und zuletzt außerordentlich rasch. Den Schluß bildete jedesmal ein gellender Schrei, der mit aller Kraft ausgestoßen wurde. Die Regelmäßigkeit, Schnelligkeit und Sicherheit, mit der das Tier die Tonleiter herschrie, erregte allgemeine Bewunderung. Es schien, als ob die Äffin selbst davon im höchsten Grade aufgeregt werde; denn jede Muskel spannte sich an, und der ganze Körper geriet in zitternde Bewegung. Ein Hulock, den ich vor geraumer Zeit lebend im Londoner Tiergarten sah, ließ ebenfalls sehr gern seine Stimme erschallen, und zwar zu jeder Tageszeit, sobald er von dem Wärter angesprochen oder von sonst jemand durch Nachahmung seiner Laute hierzu angereizt wurde. Ich darf behaupten, daß ich niemals die Stimme eines Säugetieres, den Menschen ausgenommen, gehört habe, die volltönender und wohllautender mir in das Ohr geklungen hätte, als die des gedachten Langarmaffen. Zuerst war ich erstaunt, später entzückt von diesen aus tiefster Brust hervorkommenden, mit vollster Kraft ausgestoßenen und durchaus nicht unangenehmen Tönen, die sich vielleicht durch die Silben hu, hu, hu einigermaßen wiedergeben lassen. Andere Arten sollen einen viel weniger angenehmen Ruf ausstoßen. So beginnt der Wauwau, wie mir Haßkarl mitteilt, mit einigen vereinzelt ausgestoßenen Lauten: ua, ua; hierauf folgt schneller: ua, ua, ua; dann: ua, uua, ua, ua, und zuletzt wird der Ruf immer kläglicher und rascher, das u kürzer, so daß es fast wie w klingt, das a länger, und nunmehr fällt die ganze Gesellschaft mit gleichen Lauten in den Vortrag des Sängers ein.
Über die geistigen Fähigkeiten des Langarmaffen sind die Meinungen der Beobachter geteilt. Duvaucel stellt dem Siamang ein sehr schlechtes Zeugnis aus. »Seine Langsamkeit, sein Mangel an Anstand und seine Dummheit«, drückt er sich aus, »bleiben dieselben. Zwar wird er, unter Menschen gebracht, bald so sanft wie er wild war, und so vertraulich wie er vorher scheu war, bleibt aber immer furchtsamer, als die andern Arten, deren Anhänglichkeit er niemals erlangt, und seine Unterwürfigkeit ist mehr Folge seiner unbeschreiblichen Gleichgültigkeit als des gewonnenen Zutrauens. Er bleibt derselbe bei guter und schlechter Behandlung; Dankbarkeit oder Haß scheinen fremdartige Gefühle für ihn zu sein. Seine Sinne sind stumpf. Besieht er etwas, so geschieht dies ohne Empfindung, berührt er etwas, so tut er es ohne Willen. So ist er ein Wesen ohne alle Fähigkeiten, und wollte man das Tierreich nach der Entwicklung seines Verstandes ordnen, so würde er eine der niedrigsten Stufen einnehmen müssen. Meistens sitzt er zusammengekauert, von seinen eigenen langen Armen umschlungen, den Kopf zwischen den Schenkeln verborgen, und ruht und schläft. Nur von Zeit zu Zeit unterbricht er diese Ruhe und sein langes Schweigen durch ein unangenehmes Geschrei, das weder Empfindung noch Bedürfnisse ausdrückt, also ganz ohne Bedeutung ist. Selbst der Hunger scheint ihn aus seiner natürlichen Schlaftrunkenheit nicht zu erwecken. In der Gefangenschaft nimmt er seine Nahrung mit Gleichgültigkeit hin, führt sie ohne Begierde zum Munde, und läßt sie sich auch ohne Unwillen entreißen. Seine Weise zu trinken, stimmt ganz überein mit seinen übrigen Sitten. Er taucht seine Finger ins Wasser und saugt dann die Tropfen von ihnen ab.« Auch diese Schilderung halte ich nicht für richtig, weil die übrigen Beobachter, wenn auch nicht das gerade Gegenteil sagen, so doch weit günstiger über unsern Affen berichten. Benett brachte einen Siamang mit sich fast bis nach Europa herüber, und dieser gewann in sehr kurzer Zeit die Zuneigung aller seiner menschlichen Reisegefährten. Er war sehr freundlich gegen die Matrosen und wurde bald zahm, war auch keineswegs langsam, sondern zeigte große Beweglichkeit und Gewandtheit, stieg gern im Takelwerke umher und gefiel sich in allerlei harmlosen Scherzen. Mit einem kleinen Papuamädchen schloß er zärtliche Freundschaft und saß oft, die Arme um ihren Nacken geschlungen, neben ihr, Schiffsbrot mit ihr kauend. Wie es schien, hätte er mit den übrigen Affen, die sich an Bord befanden, auch gern Kameradschaft gehalten; doch diese zogen sich scheu vor ihm zurück und erwiesen sich ihm gegenüber als sehr ungesellig: dafür rächte er sich aber. Sobald er nur immer konnte, fing er einen seiner mitgefangenen Affen und trieb mit dessen Schwanze wahren Unfug. Er zog den armen Gesellen an den ihm selbst fehlenden Anhängsel oft auf dem ganzen Schiffe hin und her oder trug ihn nach einer Rahe empor und ließ ihn von dort herunterfallen, kurz machte mit ihm, was er wollte, ohne daß das so gepeinigte Tier jemals imstande gewesen wäre, sich von ihm zu befreien. Er war sehr neugierig, besah sich alles und stieg auch oft an dem Maste in die Höhe, um sich umzuschauen. Ein vorüberziehendes Schiff fesselte ihn immer so lange auf seinem erhabenen Sitze, bis es aus dem Gesichtskreise entschwunden war. Seine Gefühle wechselten sehr rasch. Er konnte leicht erzürnt werden und gebärdete sich dann wie ein unartiges Kind, wälzte sich, mit Verrenkung der Glieder und Verzerrung des Gesichts, auf dem Verdecke herum, stieß alles von sich, was ihm in den Weg kam, und schrie ohne Unterlaß »ra! ra! ra!« – denn mit diesen Lauten drückte er stets seinen Ärger aus. Er war lächerlich empfindlich und fühlte sich durch die geringste Handlung gegen seinen Willen sogleich im Tiefinnersten verletzt: seine Brust hob sich, sein Gesicht nahm einen ernsten Ausdruck an, und jene Laute folgten bei großer Erregung rasch aufeinander, wie es schien, um den Beleidiger einzuschüchtern. Zum Bedauern der Mannschaft starb er, noch ehe er England erreichte.
Auch Wallace stellt den Siamang in günstigerem Lichte dar. »Ich kaufte«, sagt er, »einen kleinen Langarmaffen dieser Art, den Eingeborene gefangen und so fest gebunden hatten, daß er dadurch verletzt worden war. Zuerst zeigte er sich ziemlich wild und wollte beißen: als wir ihn aber losgebunden, ihm zwei Stangen unter dem Vorbau unseres Hauses zum Turnen gegeben und ihn vermittels eines kurzen Taues mit lose über den Stangen liegendem Ringe befestigt hatten, so daß er sich leicht bewegen konnte, beruhigte er sich bald, wurde zufrieden und sprang mit großer Behendigkeit umher. Zuerst bekundete er gegen mich eine Abneigung, die ich dadurch zu beseitigen suchte, daß ich ihn immer selbst fütterte. Eines Tages aber biß er mich beim Füttern so stark, daß ich die Geduld verlor und ihm einen tüchtigen Schlag versetzte. Dies mußte ich bereuen, da er von nun an mich noch weniger leiden konnte. Meinem malaiischen Knaben erlaubte er, mit ihm zu spielen, und gewährte uns dadurch und durch seine eigene Beschäftigung, durch die Leichtigkeit und Gewandtheit, mit der er sich hin und her schwang, eine stete Quelle der Unterhaltung. Als ich nach Singapore zurückkam, zog er die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Er aß fast alle Arten Früchte und Reis, und ich hatte gehofft, ihn mit nach England bringen zu können: allein er starb gerade, ehe ich abreiste.« Dies lautet ganz anders als der Bericht von Duvaucel und steht auch mit dem, was wir von anderen Langarmaffen wissen, vollkommen im Einklange. Ein Hulock, den Harlan fünf Monate lebendig besaß, wurde in weniger als einem Monate so zahm, daß er sich an der Hand seines Gebieters festhielt, und mit ihm umherging, wobei er sich mit der anderen Hand aus den Boden stützte. »Auf meinen Ruf«, erzählt Harlan, »kam er herbei, setzte sich auf einen Stuhl zu mir, um mit mir das Frühstück einzunehmen, und langte sich ein Ei oder einen Hühnerflügel vom Teller, ohne das Gedeck zu verunreinigen. Er trank auch Kaffee, Schokolade, Milch, Tee usw., und obgleich er gewöhnlich beim Trinken nur die Hand in die Flüssigkeit tauchte, so nahm er doch darauf, wenn er durstig war, das Gefäß in beide Hände und trank nach menschlicher Weise daraus. Die liebsten Speisen waren ihm gekochter Reis, eingeweichtes Milchbrot, Bananen, Orangen, Zucker u. dgl. Die Bananen liebte er sehr, fraß aber auch gerne Kerbtiere, suchte im Hause nach Spinnen und fing Fliegen, die in seine Nähe kamen, geschickt mit der rechten Hand. Wie die Inder, die des Glaubens halber Fleischwaren verweigern, so schien auch dieser Gibbon gegen die letzteren Widerwillen zu haben, verzehrte jedoch einmal einen gebratenen Fisch und ein wenig Hühnerfleisch.
Mein Gefangener war ein außerordentlich friedfertiges Geschöpf und gab seine Neigung zu mir und seine Anhänglichkeit an mich in jeder Weise zu erkennen. Wenn ich ihn früh besuchte, begrüßte er mich mit fröhlichem, lautschallendem Wau! Wau! Wau! das er wohl fünf bis zehn Minuten lang wiederholte und nur unterbrach, um Atem zu holen. Erschöpft legte er sich nieder, ließ sich kämmen und bürsten und bekundete deutlich, wie angenehm ihm das war, indem er sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite legte, bald diesen, bald jenen Arm hinhielt, und wenn ich mich stellte, als ob ich fortgehen wollte, mich am Arme oder Rocke festhielt und mich wieder an sich zog. Rief ich ihn aus einiger Entfernung, und erkannte er mich an meiner Stimme, so begann er sogleich sein gewöhnliches Geschrei, bisweilen in klagender Weise, sobald er mich sah aber sogleich in gewöhnlicher Stärke und Heiterkeit. Obwohl männlichen Geschlechts, zeigte er doch keine Spur von jener Geilheit der Paviane. Leider ging er bald zugrunde, und zwar infolge eines Schlages in die Lendengegend, den er unversehens von einem meiner Diener in Kalkutta erlitten hatte. Ein junges Weibchen derselben Art, das ich ebenfalls pflegte, starb auf dem Wege nach Kalkutta an einem Lungenleiden. Während der Krankheit litt es augenscheinlich große Schmerzen. Ein warmes Bad schien ihm Erleichterung zu verschaffen und tat ihm so wohl, daß es, herausgenommen, sich von selbst wieder in das Wasser legte. Sein Benehmen war ungemein sanft, etwas schüchtern, Fremden gegenüber sogar scheu. An mich aber hatte es sich bereits nach einigen Tagen derart gewöhnt, daß es schnell zu mir zurückgelaufen kam, wenn ich es an einen freien Platz gesetzt hatte, in meine Arme sprang und mich umhalste. Niemals zeigte es sich boshaft, niemals biß es, ja selbst gereizt verteidigte es sich nicht, sondern verkroch sich lieber in einen Winkel.«
Auch das vorhin erwähnte Weibchen des Unko war sehr liebenswürdig in seinem Betragen und höchst freundlich gegen alle, denen es seine Zuneigung einmal geschenkt hatte. Es unterschied mit richtigem Gefühle zwischen Frauen und Männern. Zu ersteren kam es freiwillig herab, reichte ihnen die Hand und ließ sich streicheln; gegen letztere bewies es sich mißtrauisch, wohl infolge früherer Mißhandlungen, die es von einzelnen Männern erlitten haben mochte. Vorher beobachtete es aber jedermann prüfend, oft längere Zeit, und faßte dann auch zu Männern Vertrauen, wenn diese ihm dessen würdig zu sein schienen.
Man sieht übrigens die Gibbons selten in der Gefangenschaft, auch in ihrem Vaterlande. Sie können den Verlust ihrer Freiheit nicht ertragen; sie sehnen sich immer zurück nach ihren Wäldern, nach ihren Spielen, und werden immer stiller und trauriger, bis sie endlich erliegen.
In der zweiten Unterfamilie vereinigen wir die Hundsaffen ( Cynopithecini). Sie kennzeichnet das stärkere Vortreten der Schnauze, das sich namentlich bei den tieferstehenden Sippen bemerklich macht, die geringere Länge der Arme, das regelmäßige Vorhandensein eines Schwanzes und der Gesäßschwielen und das häufige Vorkommen von Backentaschen. Übrigens sind sie sehr verschieden gebaut: denn von der gestreckten Gestalt der Schlankaffen bis zu der massigen der Hundskopfaffen oder Paviane finden sich fast alle Zwischenstufen vertreten. Sie verbreiten sich über die heißen Länder der alten Welt, insbesondere über Indien vom Himalaja an, Hinterindien, Cochinchina, den malaiischen Archipel, Südarabien und ganz Afrika, mit Ausnahme der östlichen Teile der Sahara, gehören zu den lebendigsten und beweglichsten Mitgliedern ihrer Ordnung, sind klug, großenteils aber boshaft und unanständig, fast überall, wo sie auftreten, mehr oder weniger schädlich, indem sie in der unverschämtesten Weise Pflanzungen und Gärten plündern, werden hier und da auch ihrer bösartigen Gelüste halber gefürchtet und haben sich bei einzelnen Völkerschaften die größte Verachtung erworben, während sie bei anderen teilweise wenigstens im Geruche der Heiligkeit stehen, mindestens als Heilige und Halbgötter betrachtet werden.
Wie genau sich das eigentliche Gepräge eines Erdteils oder Landes in seiner Tierwelt widerspiegelt, können wir unter tausend anderen Fällen auch bei Betrachtung verschiedener Affengruppen bemerken. Die Schlankaffen ( Semnopithecus) und die Stummelaffen ( Colobus) ähneln sich außerordentlich und unterscheiden sich gleichwohl wieder wesentlich, gleichsam als müßten sie beweisen, daß die Heimat der einen Asien, die der anderen Afrika ist. Hier wie dort spricht sich der gleiche Grundzug der Ausbildung des Tieres aus; aber dennoch behauptet jeder Erdteil sein eigentümliches Gepräge.
Die Schlankaffen sind, wie ihr Name andeutet, schlanke und leichtgebaute Affen mit langen, feinen Gliedmaßen und sehr langem Schwanze, kleinem hohen Kopfe, nacktem Gesichte und verkürzter Schnauze ohne Backentaschen. Ihre Gesäßschwielen sind noch sehr klein. Ihr Zahnbau ähnelt dem der Makaken und Paviane (die wir später kennenlernen werden), weil sich am hintersten unteren Backenzahne noch ein besonderer Höcker findet; ihr Knochenbau erinnert wegen seiner schlanken Formen an das Gerippe der Gibbons. Die Hände haben lange Finger; aber der Daumen der Vorderhände ist bereits verkürzt oder verkümmert und zum Greifen unbrauchbar geworden. Die Behaarung ist wundervoll fein, ihre Färbung stets ansprechend, bei einer Art höchst eigentümlich; die Haare verlängern sich am Kopfe oft bedeutend. Höchst merkwürdig ist der Bau des Magens, weil er wegen seiner Einschnürungen und hierdurch entstandenen Abteilungen entfernt an den Magen der Wiederkäuer und näher an den der Känguruhs erinnert. Nach Duveroys und Owens Untersuchungen wird er durch zwei Einschnürungen in drei Teile geteilt, deren mittlerer wiederum Unterabteilungen in doppelter Reihe zeigt. Der Magen erhält hierdurch die größte Ähnlichkeit mit einem Grimmdarme, zumal er wie ein solcher mit deutlich hervortretenden Muskelbändern versehen ist. Ein Kehlsack von verschiedener Größe ist bei sämtlichen Arten vorhanden.
Das Festland Südasiens, Ceylon und die Eilande des indischen Inselmeeres bilden die Heimat der Schlankaffen. Hier leben sie in mehr oder minder zahlreichen Trupps in den Waldungen, am liebsten in der Nähe von Flußufern, nicht minder gern aber auch in der Nachbarschaft der Dörfer und Pflanzungen, und führen, weil sie fast überall geschont werden, ein ungemein behagliches Leben. Um mit kurzen Worten ein allgemeines Bild ihres Freilebens zu geben, will ich der Einzelschilderung hervorragender Arten einige Bemerkungen vorausschicken und mich dabei auf die Mitteilungen von Tennent und Wallace stützen.
Wenn man den Schlankaffen in ihren heimischen Waldungen begegnet, sieht man sie in der Regel in Gesellschaft von zwanzig oder dreißig ihrer Art, in den meisten Fällen eifrig beschäftigt, sich Ähren und Knospen zu suchen. Äußerst selten bemerkt man sie auf dem Boden, es sei denn, daß sie herabgefallene Früchte ihrer Lieblingsbäume dort aufsuchen wollten. Vor den Eingeborenen fürchten sie sich nicht im geringsten, legen vielmehr die größte Sorglosigkeit an den Tag; der fremdartig gekleidete Europäer dagegen wird mehrere Minuten lang angestarrt und hierauf sobald wie möglich verlassen. In ähnlicher Weise erregt die Gegenwart eines Hundes ihre Neugier; anstatt aber dessen Bewegungen zu beobachten, pflegen sie stets durch Geschrei usw. sich hervorzutun und zu verraten. In Furcht gesetzt, verbergen sie sich oft im Gezweige der Bäume, und wissen dies in einer Art und Weise zu bewerkstelligen, daß sich eine Gesellschaft, die sich vielleicht auf einer Palmyrapalme gütlich tat, in der kürzesten Zeit unsichtbar macht. Trauen sie dem Frieden nicht, so flüchten sie, und zwar mit einer Schnelligkeit, Gewandtheit und Sprungfertigkeit, die innerhalb ihrer Familie kaum erreicht, geschweige denn überboten wird. Sie springen ungeheuer weit von den Ästen eines Baumes auf die etwas tieferen eines anderen, regelmäßig so, daß der Zweig, auf dem sie fußten, durch ihr Aufspringen tief hinabgebogen wird und sie beim Zurückschnellen wieder in die Höhe schleudert; sie sind aber auch imstande, im Sprunge noch die Richtung zu ändern, um nötigenfalls einen anderen passenderen Zweig zu ergreifen und sich weiter fortzuhelfen. Es ist, wie Wallace bemerkt, sehr unterhaltend, zu sehen, wie dem Führer, der einen kühnen Sprung wagte, die anderen mit größerer oder geringerer Hast folgen; und nicht selten kommt es dann vor, daß einer oder zwei der letzten gar nicht zum Sprunge sich entschließen können, bis die anderen außer Sicht sind. Dann werfen sie sich förmlich verzweifelt und aus Furcht, allein gelassen zu werden, in die Luft, durchbrechen die schwachen Zweige und stürzen oft zu Boden. Da, wo sie ungestört ihr Wesen treiben dürfen, werden sie zudringlich, erscheinen unmittelbar auf oder vor den Häusern und richten mancherlei Schaden an; ja es kommt sogar vor, daß sie Kindern gefährlich werden. So wurde, wie Tennent erzählt, das Kind eines europäischen Geistlichen, das die leichtsinnige Amme vor das Haus gesetzt hatte, von Schlankaffen überfallen und derartig gequält und gebissen, daß es den erlittenen Mißhandlungen erlag. Die Nahrung besteht aus den verschiedensten Pflanzenteilen, Früchten aller Art, soweit sie solche öffnen können, Knospen, Blättern und Blüten.
Die Singalesen haben die Meinung, daß die Überbleibsel eines Affen niemals im Walde gefunden würden. »Wer eine weiße Krähe, das Nest eines Reisvogels, eine gerade Kokosnußpalme oder einen toten Affen gesehen hat«, sagen sie, »ist sicher, ewig zu leben.« Dieser Volksglaube stammt unzweifelhaft von Indien her, weil dort einer der hervorragendsten Schlankaffen göttliche Ehre genießt, und man allgemein der Überzeugung ist, daß jemand, der auf dem Grabe eines solchen Affen oder auch nur auf seinem Todesplatze ruhen oder rasten wollte, sterben müßte, ja daß selbst noch die vergrabenen Knochen Unheil stiften könnten. Aus diesem Grunde läuft jeder, der ein Haus bauen will, zu den Zauberern seines Volkes und versichert sich durch ihre »Kunst«, daß auf dem für das Haus gewählten Platze niemals ein derartiges Unglück geschehen sei.
Unter den Schlankaffen verdient zunächst berücksichtigt zu werden der Hulman oder Huneman, wie die Hindus ihn nennen, der Mandi der Malabaren oder der Marbur der Mahratten – der heilige Affe der Inder ( Semnopithecus entellus), der abgöttisch verehrt wird. Er ist der gemeinste und in den meisten Gegenden Niederindiens vorkommende Affe und verbreitet sich immer mehr, weil man ihn nicht allein schützt und hätschelt, sondern in gewissen Gegenden auch einführt. Die Gesamtlänge des ausgewachsenen Männchens beträgt nach Elliot 1,57 Meter, wovon freilich 97 Zentimeter aus den verhältnismäßig ungemein langen, gequasteten Schwanz kommen, das Gewicht 11 Kilogramm. Die Färbung des Pelzes ist gelblichweiß, die der nackten Teile dunkelviolett. Gesicht, Hände und Füße, so weit sie behaart sind, und ein steifer Haarkamm, der über die Augen verläuft, sind schwarz; der kurze Bart dagegen ist gelblich.
Der Hulman nimmt einen der ersten Plätze unter den dreißig Millionen Gottheiten der Hindu ein und erfreut sich dieser Ehre schon seit undenklichen Zeiten. Der Riese Ravan, so berichtet die altindische Sage, raubte Sita, die Gemahlin des Schri-Rama, und brachte sie nach seiner Wohnung auf der Insel Ceylon; der Affe aber befreite die Dame aus ihrer Gefangenschaft und führte sie zu ihrem Gemahle zurück. Seitdem gilt er als Held. Viel wird berichtet von der Stärke seines Geistes und von seiner Schnelligkeit. Eine der geschätztesten Früchte, die Mango, verdankt man ihm ebenfalls, er stahl sie aus dem Garten des Riesen. Zur Strafe für seinen Diebstahl wurde er zum Feuertode verurteilt, löschte aber das Feuer aus und verbrannte sich dabei Gesicht und Hände, die seitdem schwarz blieben. Dies sind die Gründe, die die Brahmanen bestimmten, ihn zu vergöttern.
Schon seit vielen Jahren hat man diesen Affen in seinem Vaterlande beobachtet: allein gerade deshalb sind wir am spätesten mit ihm bekannt geworden. Viele Reisende verwechselten den Hulman mit einem den Himalaja bewohnenden Verwandten und riefen dadurch Verwirrung hervor. Zudem war man der Meinung, daß ein so gemeines Tier auch oft nach Europa gebracht worden sein müsse, und verschmähte es daher, unseren Hulman auszustopfen und den Balg noch Europa zu senden. Hierzu kommt noch, daß es Schwierigkeiten oder vielmehr Gefahren hat, das heilige Tier zu töten; denn bloß die Mahratten erweisen ihm keine Achtung, während fast alle übrigen Indier ihn hegen und pflegen, schützen und verteidigen, wo sie nur können. Ein Europäer, der es wagt, das unverletzliche Tier anzugreifen, setzt sein Leben aufs Spiel, wenn er der einzige Weiße unter der leicht erregbaren Menge ist. Der Affe gilt eben als Gott.
Heutzutage noch ist die Achtung gegen das heilige Tier dieselbe wie früher. Die Indier lassen sich von dem unverschämten Gesellen ruhig ihre Gärten plündern und ihre Häuser ausstehlen, ohne irgend etwas gegen ihn zu tun, und betrachten jeden mit scheelen Augen, der es wagt, den Gott zu beleidigen. Duvaucel berichtet, daß es im Anfange ihm unmöglich war, einen dieser Affen zu töten, weil die Einwohner ihn stets daran verhinderten. So oft sie den Naturforscher mit seinem Gewehre sahen, jagten sie immer die Affen weg, und ein frommer Brahmane ließ es sich nicht verdrießen, einen ganzen Monat lang im Garten des Europäers Wacht zu halten, um die lieben Tiere augenblicklich zu verscheuchen, wenn der Fremde Miene machte, auf sie zu jagen. Forbes versichert, daß in Duboy ebensoviel Affen als Menschen anzutreffen sind. Die Affen bewohnen das oberste Stockwerk der Häuser und werden dem Fremden unerträglich. Wenn ein Einwohner der Stadt an seinem Nachbar sich rächen will, streut er Reis und anderes Getreide auf das Dach des Feindes, und zwar kurz vor Anfang der Regenzeit, vor der jeder Hausbesitzer die Bedachung in Ordnung bringen lassen muß. Wenn nun die Affen das ausgestreute Futter wahrnehmen, fressen sie nicht nur das Erreichbare, sondern reißen auch die Ziegel ab, um zu denjenigen Körnern zu gelangen, die in die Spalten gefallen sind. Um diese Zeit ist aber wegen übergroßer Beschäftigung kein Dachdecker zu erhalten, und so kommt es, daß das Innere des Hauses den Regengüssen offen steht und dadurch verdorben wird.
Man trägt übrigens nicht nur für die gesunden, sondern auch für die kranken Affen Sorge. Tavernier fand in Amadabad ein Krankenhaus, worin Affen, Ochsen, Kühe usw. verpflegt wurden. Alle Söller werden zeitweilig für die Affen mit Reis, Hirse, Datteln, Früchten und Zuckerrohr bestreut. Die Affen sind so dreist, daß sie nicht nur die Gärten plündern, sondern um die Essenszeit auch in das Innere der Häuser dringen und den Leuten die Speise aus der Hand nehmen. Der Missionar John versichert, daß er bloß durch angestrengte Wachsamkeit seine Kleider und andere Sachen vor diesen Dieben habe schützen können. Einmal rief ein Fakir vor dem Zelte Hügels die Affen zusammen, gab ihnen aber nichts zu fressen. Da fielen drei der ältesten ihn so boshaft an, daß er sie kaum mit dem Stocke abwehren konnte. Die Bevölkerung stand jedoch nicht auf seiner, sondern auf der Affen Seite und schimpfte ihn tüchtig aus, weil er die heiligen Tiere erst getäuscht habe und noch prügele.
Abgesehen von ihrer Unverschämtheit sind diese Affen schmucke und anziehende Geschöpfe. John sagt ausdrücklich, daß er niemals schönere Affen gesehen habe als die Hulmans. Ihr freundschaftlicher Umgang untereinander und ihre ungeheueren Sprünge fesseln jeden Beobachter. Mit ganz unglaublicher Behendigkeit steigen sie von der Erde auf die Gipfel der Bäume, stürzen von da sich wieder auf die Erde herab, brechen, wie zum Scherze, starke Zweige herunter, springen auf Wipfel weit entfernter Bäume und gelangen in weniger als einer Minute von einem Ende des Gartens bis zum anderen, ohne die Erde zu berühren. Sie sind oft in wenig Minuten in unglaublicher Menge versammelt, plötzlich verschwunden und ein paar Minuten später alle wieder da. In der Jugend haben sie einen ziemlich runden Kopf und sind sehr klug; sie wissen Wohl zu unterscheiden, was ihnen schädlich oder nützlich ist, lassen sich auch sehr leicht zähmen, zeigen aber einen unwiderstehlichen Trieb zum Stehlen. Mit zunehmendem Alter verändern sich die geistigen Eigenschaften, wie sich ihr Kopf verändert. Dieser wird platter, der Affe also tierischer, und damit tritt Stumpfheit an die Stelle der Klugheit; der Hang zur Einsamkeit verscheucht die Zutraulichkeit, plumpe Kraft verdrängt die Geschicklichkeit, so daß die alten Affen mit den jungen kaum noch etwas gemein haben.
Das tägliche Treiben und gesellige Leben der Hulmans ist das aller Hundsaffen. Sie bilden im Walde, ihrem eigentlichen Wohngebiete, zahlreiche Banden, denen ein aus hartnäckigen Kämpfen siegreich hervorgegangenes Männchen vorsteht, und streifen unter dessen Führung plündernd, raubend und mehr verwüstend als verbrauchend in ihm und in den benachbarten Feldern und Gärten umher, Gebrandschatzten zur Geisel, frommen Narren und unbeteiligten Forschern zur Augenweide. Ihre Vermehrung in günstigen, d. h. unter dem Schutze der Dummgläubigkeit stehenden Gegenden ist eine besorgniserregende; dagegen sterben sie erwiesenermaßen in höher gelegenen Gegenden Oberindiens, woselbst sie eingeführt wurden und werden, bald wieder aus; denn auch diese Heiligen können reine Luft nicht vertragen. Blyth berichtet, daß hier und da alle halb erwachsenen oder besiegten Männchen einer Bande von dem sein Haremsrecht wahrenden Affensultan ausgetrieben und gezwungen werden, sich eigene Vereine zu bilden, erfuhr auch von den Eingeborenen, daß des Streitens und Kämpfens unter verschiedenen Männchen kein Ende wäre; Hutton beobachtete Ähnliches von dem auf dem Himalaja lebenden Verwandten des Hulman. Beide unternehmen, wie es scheint, zuweilen größere Streifzüge oder Wanderungen, jener bei Eintritt kalter Witterung in seinen Höhen, dieser, um nach Art bettelnder Mönche von der blindgläubigen Bevölkerung Zoll zu erheben. Wie die glaubenseifrige, aber denkunfähige Bauernfrau dem faulen, nichtsnutzigen Strolche und Tagediebe, der in einer Mönchskutte bettelnd vor ihr erscheint, das letzte Ei oder Huhn überliefert, um ihrer Seele Notdurft zu befriedigen, sieht auch der Hindu der Ankunft der Affenheiligen im Glauben entgegen. Sobald sie an den geweihten Orten eingetroffen sind, beginnt für die frommen Brahmanen eine Zeit der größten Sorge und Geschäftigkeit; sie haben nun ihre Heiligen zu pflegen und zu beschützen. Der eigentümlichste Baum Indiens, die prachtvolle heilige Feige, soll der Lieblingsaufenthalt der Hulmans sein. Man erzählt, daß unter demselben Baume auch giftige Schlangen wohnen, mit denen die Affen in beständiger Feindschaft leben. Alle Affen haben gegen die Schlangen einen unüberwindlichen Abscheu und fürchten sich vor keinem Tiere in gleich hohem Grade, als eben vor ihnen.
Auch der Hulman zeigt große Anhänglichkeit an seine Jungen. Duvaucel erzählt, daß er ein Weibchen dieses Affen erlegt habe, dann aber Zeuge eines wirklich rührenden Zuges geworden sei. Das arme Tier, das ein Junges mit sich trug, wurde in der Nähe des Herzens verwundet. Es raffte alle seine Kräfte zusammen, nahm sein Junges, hing es an einen Ast und fiel hierauf tot herunter. »Dieser Zug«, setzt unser Gewährsmann hinzu, »hat mehr Eindruck auf mich gemacht, als alle Reden der Brahmanen, und diesmal ist das Vergnügen, ein so schönes Tier erlegt zu haben, nicht Meister geworden über die Empfindung der Reue, ein Wesen getötet zu haben, das noch im Tode das achtungswürdigste Gefühl betätigte.«
Unsere Gruppe hat noch andere merkwürdige Mitglieder. Ein sehr schöner Affe ist der Budeng der Javanesen ( Semnopithecus maurus). Er ist im Alter glänzend schwarz, im Gesichte und an den Händen wie Samt, auf dem Rücken wie Seide. Der Unterleib, der spärlicher behaart ist als der Oberleib, zeigt einen bräunlichen Anflug. Der Kopf wird von einer eigentümlichen Haarmütze bedeckt, die über die Stirn hereinfällt und zu beiden Seiten der Wangen vortritt. Neugeborene Junge sehen goldgelb aus, und nur die Haarspitzen des Unterrückens, der Oberseite des Schwanzes und der Schwanzquaste sind dunkler. Bald aber verbreitet sich das Schwarz weiter, und von nun an geht das Kleid mehr und mehr in das des alten Tieres über. Die Gesamtlänge dieses schönen Affen beträgt 1,5 Meter, wovon mehr als die Hälfte auf den Schwanz kommt.
Als ich den Budeng im Tiergarten von Amsterdam zum ersten Male lebend sah, erkannte ich ihn nicht. Ich konnte, trotz aller Berichtigungen, die ich den Mißgestalten in Büchern und Museen hatte angedeihen lassen, unmöglich ein so schönes Tier vermuten, als ich jetzt vor mir sah. Dieser Affe erregte die allgemeine Aufmerksamkeit aller Beschauer, obwohl er nicht das Geringste tat, um die Blicke der Leute auf sich zu ziehen. Ich möchte sein stilles Wesen nicht so verdammen, wie Horsfield es getan hat; denn ich glaube nicht, daß man ihn eigentlich » mürrisch« nennen kann. Er ist still und ruhig, aber nicht übellaunisch und ungemütlich. Das Paar, das in Amsterdam lebte, hielt stets treu zusammen. Gewöhnlich saßen beide dicht aneinander gedrängt in sehr zusammengekauerter Stellung, die Hände über der Brust gekreuzt, auf einer hohen Querstange ihres Käfigs und ließen die langen, schönen Schwänze schlaff herabhängen. Ihr ernsthaftes Aussehen wurde vermehrt durch die eigentümliche Haarmütze, die ihnen weit in das Gesicht hereinfällt. Wenn man ihnen Nahrung vorhielt, kamen sie langsam und vorsichtig herunter, um sie wegzunehmen, blieben dabei aber ruhig und bedächtig, wie immer. Der Gesichtsausdruck deutete entschieden auf große Klugheit hin; doch fehlte das Leben in den Augen.
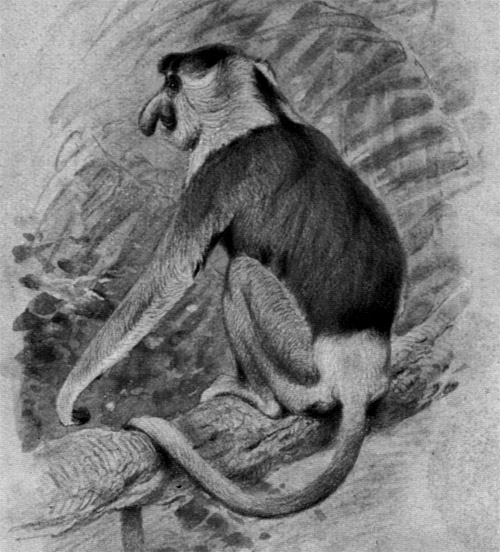
Nasenaffe oder Kahau ( Semnopithecus nasicus)
Von den eigentlichen Schlankaffen trennt man gegenwärtig eine Art, die sich im hohen Grade auszeichnet, und zwar durch ihre Nase: den Kahau oder Nasenaffen ( Semnopithecus nasicus). Im allgemeinen hat dieses absonderliche Geschöpf noch ganz den Bau der Schlankaffen; die vorspringende verzerrte Menschennase aber, die wie ein Rüssel beweglich ist und vorgeschoben oder zurückgezogen werden kann, verleiht ihm etwas im hohen Grade Eigentümliches. Der Leib ist schlank, der Schwanz sehr lang, die Gliedmaßen sind fast von gleicher Länge, die Vorder- und Hinterhände fünfzehig, die Backentaschen fehlen, aber die Gesäßschwielen sind vorhanden. Die Nase hängt hakenförmig über die Oberlippe herab, ist in der Mitte ziemlich breit, an ihrem äußeren Ende zugespitzt und längs ihres Rückens mit einer leichten Furche versehen: die Nasenlöcher sind sehr groß und können noch bedeutend ausgedehnt werden. Bei jungen Tieren ist das hier so merkwürdig gebildete Sinnwerkzeug noch klein und stumpf, und erst bei alten erreicht es seine bedeutende Größe. Die Behaarung ist reichlich und weich. An dem Scheitel, dem Hinterkopfe und in der Schultergegend sind sie lebhaft braunrot, auf dem Rücken und der oberen Hälfte der Seiten fahlgelb, dunkelbraun gewellt, an der Brust und dem Oberteile des Bauches lichtrötlichgelb gefärbt; in der Kreuzgegend findet sich ein scharf abgegrenzter Fleck von graulichweißer Farbe, dessen Spitze nach der Schwanzwurzel zu gerichtet ist; die Gliedmaßen sehen in der oberen Hälfte gelblichrot, in der unteren, ebenso wie der Schwanz, aschgrau, die nackten Innenflächen der Hände und die Gesäßschwielen graulichschwarz aus. So zeigt auch dieser Affe eine sehr lebhafte Gesamtfärbung und beweist dadurch seine enge Verwandtschaft mit den übrigen Schlankaffen. Erwachsene Männchen des Kahau erreichen eine Höhe von etwa 55 Zentimeter; ihr Leib ist 70 Zentimeter und der Schwanz etwas darüber lang. Die Weibchen bleiben kleiner.
Der Kahau lebt gesellig auf Borneo. Wallace, der Gelegenheit hatte, unsern Affen in seinen heimischen Wäldern zu beobachten, erwähnt seiner nur nebenbei: »An den Ufern des Flusses Simunjon hielten sich sehr viele Affen auf, unter andern der merkwürdige Nasenaffe, der so groß ist wie ein dreijähriges Kind, einen sehr langen Schwanz und eine fleischige Nase, länger als die des dicknasigsten Menschen, hat.« »Die Nasenaffen«, schreibt mir Haßkarl, »die in den Jahren 1841 und 1842 im Pflanzengarten zu Buitenzorg auf Java anlangten und dort gepflegt wurden, starben sehr bald, hatten aber freilich auch nicht genügenden Raum zu ausgiebiger Bewegung.«
*
Auch die afrikanischen Vertreter der schlanken Asiaten, die Stummelaffen ( Colobus), sind sehr auffallende, durch eigentümliche Färbung, sonderbare, aber schöne Mähnen und andere Haarwucherungen ausgezeichnete Tiere. Wie Indien lebendiger und reicher ist als das trockene Afrika, so sind auch die Schlankaffen heller und lebhafter gefärbt als die Stummelaffen, obwohl ich nicht behaupten will, daß diese weniger schön oder minder angenehm für unser Auge wären als jene. Im ganzen sind die Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Gruppen nur sehr geringfügig. Die Stummelaffen zeichnen sich hauptsächlich dadurch vor den Schlankaffen aus, daß sie an den Vorderhänden immer bloß vier Finger und keinen Daumen besitzen, während, wie wir sahen, dieses Glied bei den Schlankaffen nur hier und da verkümmert. Der Leib der Stummelaffen ist noch immer schlank und zierlich, die Schnauze kurz, der Schwanz sehr lang, die unter sich fast gleichlangen Gliedmaßen sind schmächtig, Gesäßschwielen vorhanden, Backentaschen aber fehlen; die Hinterhände haben regelmäßig fünf Finger.
Unter diesen Tieren dürfen wir ohne Zweifel den Guereza ( Colobus Guereza) obenanstellen. Meiner Ansicht nach ist er der schönste aller Affen. Seine Färbung ist, obgleich sie keineswegs lebhaft genannt werden kann, doch eine außerordentlich angenehme, und seine Behaarung eine so eigentümliche und zugleich so zierliche, wie kaum noch bei einem andern Tiere. Das Verdienst der Entdeckung des wunderschönen Geschöpfes gebührt unserem ausgezeichneten Landsmanne Rüppell, der es während seiner Reise in Abessinien in der Provinz Godjam auffand und den im Lande gebräuchlichen Namen zum wissenschaftlichen machte.
Rüppell sah den Guereza lebend und konnte so aus eigener Anschauung über ihn berichten. Später haben auch andere Naturforscher ihn beobachtet. Ich selbst fand in den Händen eines Hassanïe am unteren weißen Nil ein Fell desselben, das der Mann als Tabaksbeutel benutzte, und erfuhr von dem Eigner, daß der Affe weiter südlich keineswegs zu den Seltenheiten gehöre. Heuglin, der Erforscher Afrikas, beobachtete ihn öfters in Abessinien und auf dem weißen Flusse und erhielt sichere Nachrichten über sein Vorkommen in ganz anderen Gegenden Mittelafrikas, woraus hervorgeht, daß der Verbreitungskreis des Tieres viel größer sein muß, als wir gewöhnlich angenommen haben.
Der Guereza ist ein wirklich herrliches Tier. Von dem schön sammetschwarzen Leibe heben sich Stirnbinde, Schläfegegend, die Halsseiten, Kinn, Kehle und ein Gürtel oder eine Mähne, sowie eine Einfassung um die nackten Gesäßschwielen und die Schwanzspitze, welche Teile weiß gefärbt sind, prachtvoll ab. Jedes weiße Haar ist aber auch vielfach braun geringelt, und hierdurch entsteht das silbergraue Aussehen der Behaarung. Die Mähne, wie ich den Seitengürtel vielleicht nennen kann, hängt wie ein reicher Beduinenmantel zu beiden Seiten des Körpers herab und ziert ihn unbeschreiblich. Ihre Haare sind von größter Weichheit und Feinheit und dabei von bedeutender Länge. Der schwarze Pelz des unteren Körpers schimmert hier und da zwischen dem kostbaren Behange hindurch; das Dunkelschwarz sticht lebendig ab von dem blendenden Weiß, und die dunklen Hände und das dunkle Gesicht stehen hiermit so vollkommen im Einklange, daß unser Affe wohl den Preis der Schönheit verdienen dürfte. So viel Willkür, wenn ich mich so ausdrücken dürfte, in der Bekleidung sich ausspricht, so zierlich und anmutig ist dieselbe. Die Leibeslänge beträgt 65 Zentimeter, die Schwanzlänge ohne Quaste 70 Zentimeter.
Der Guereza findet sich, wie mir Schimper mitteilte, vom 13. Grade nördlicher Breite an überall in Abessinien, am häufigsten in einem Höhengürtel von 2000 bis 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Hier lebt er in kleinen Gesellschaften von zehn bis fünfzehn Stück auf hochstämmigen Bäumen, gern in der Nähe klarer fließender Gebirgswässer und häufig auch unmittelbar neben den in Habesch immer einsam im Schatten geheiligter Bäume stehenden Kirchen. Eine Wacholderart ( Juniperus procera), die, im Gegensatze zu der bei uns wachsenden, so riesenhafte Verhältnisse zeigt, daß selbst unsere Tannen und Fichten neben ihr zu Zwergen herabsinken, scheint ihm ganz besonders zuzusagen: jedenfalls ihrer auch unseren Gaumen behagenden Beeren halber. Er ist, wie mein Berichterstatter mit besonderem Ausdrucke sagte, »ein im allerhöchsten Grade behendes Tier«, das sich mit geradezu wunderbarer Kühnheit und Sicherheit bewegt. Wo der Guereza keine Nachstellungen erleidet, ist er, laut Heuglin, nicht scheu und bellt und kreischt mit katzenartig gebogenem Rücken den, der ihn aus seiner Ruhe stört, gemütlich an. Verfolgt zeigt er sich in seiner ganzen Schönheit. Mit ebenso großer Anmut als Leichtigkeit, mit ebensoviel Kühnheit als Berechnung springt der so wundersam geschmückte Geselle von Zweig zu Zweig oder aus Höhen von fünfzehn Metern in die Tiefe hinab, und der weiße Mantel fliegt dabei um ihn herum, wie der Burnus eines auf einem arabischen Pferde dahinjagenden Beduinen um Roß und Reiter weht. Übrigens kommt er nur dann auf den Boden herab, wenn die Verfolger ihm sehr nahe auf den Leib rücken; als vollendetes Baumtier findet er in seiner luftigen Höhe alles, was er bedarf. Seine Nahrung ist die gewöhnliche der Baumaffen: Knospen, Blätter, Blüten, Beeren, Früchte, Kerbtiere usw. Im Gegensatze zu andern Affen wird er von allen Eingeborenen als ein durchaus harmloses Geschöpf betrachtet, hauptsächlich wohl deshalb, weil er die Pflanzungen verschont oder wenigstens in ihnen niemals größere Verwüstungen anrichtet.
Heuglin besaß ein lebendes Junges, war aber nicht imstande, dasselbe zu erhalten, trotzdem er ihm die beste Pflege zuteil werden ließ. Auch in den Hütten der Landeseingeborenen sieht man gezähmte Guerezas nicht; es scheint also schwierig zu sein, ihnen die rechte Pflege angedeihen zu lassen.
Afrika beherbergt nicht nur die größten, die klügsten und die häßlichsten Affen der alten Welt, sondern auch die schönsten, nettesten und gemütlichsten. Zu diesen gehört unzweifelhaft die zahlreiche Gruppe, die uns unter dem Namen »Meerkatzen« bekannt ist. Wir sehen dieses oder jenes Mitglied der betreffenden Sippe häufig genug in jedem Tiergarten oder in jeder Tierschaubude und finden es auch öfters als lustigen Gesellschafter irgendeines Tierfreundes.
Die Meerkatzen erhielten ihren Namen schon im sechzehnten Jahrhundert, jedenfalls, weil sie zuerst von dem Westen Afrikas, nämlich von Guinea zu uns kamen und entfernt an die Gestalt einer Katze erinnern. Bewohner der Wendekreisländer des genannten Erdteils, beschränken sie sich, mit Ausnahme einer einzigen Art, die auf Madagaskar vorkommt, auf das afrikanische Festland. Wo sich Urwälder finden, zeigen sich auch diese Affen in großer Anzahl. Manche Arten erhalten wir ebensowohl aus dem Osten wie auch aus dem Westen und aus der Mitte des Erdteils; die meisten aber kommen aus Westafrika, ziemlich viele auch aus Abessinien und den oberen Nilländern.
Sie zeichnen sich durch leichte und zierliche Formen, schlanke Gliedmaßen, feine, kurze Hände mit langen Daumen, auch durch einen langen Schwanz ohne Endquaste aus und besitzen weite Backentaschen und große Gesäßschwielen. Ihre Farben sind meistens ziemlich lebhaft, bei einzelnen Arten oft recht angenehm bunt. Man kennt ungefähr zwanzig Arten. Feuchte oder wenigstens von Flüssen durchschnittene Waldungen werden von ihnen trockenen Berggegenden stets vorgezogen; in der Nähe von Feldern siedeln sie sich außerordentlich gern an. Recht deutlich bemerkt man bei ihnen die eigentümliche Erscheinung, daß sich Affen und Papageien nicht bloß in Gestalt, Lebensart und Wesen, sondern auch hinsichtlich der Verbreitung entsprechen. Man darf mit Sicherheit darauf rechnen, daß man in Afrika da, wo man Papageien findet, auch unseren Meerkatzen begegnen wird, oder umgekehrt.
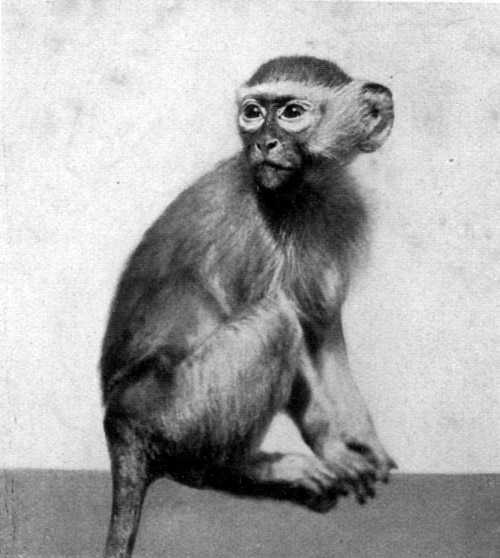
Graugrüne Meerkatze oder Grünaffe ( Cercopithecus sabaeus)
Die Meerkatzen gehören zu den geselligsten, beweglichsten, lustigsten und, wie bemerkt, gemütlichsten aller Affen. Man findet sie fast stets in ziemlichen Banden; Familien kommen kaum vor. Es ist eine wahre Lust, wenn man einer Herde dieser Tiere im Walde begegnet. Da kann man ein Leben, ein Schreien und Kämpfen, ein sich Erzürnen und Versöhnen, ein Klettern und Laufen, Rauben und Plündern, Gesichterschneiden und Gliederverrenken bemerken! Sie bilden einen eigenen Staat und erkennen keinen Herrn über sich an, als den Stärkeren ihresgleichen; sie beachten kein Recht, als das, das durch spitze Zähne und kräftige Hände von dem alten Affenstammvater geübt wird; sie halten keine Gefahr für möglich, aus der es nicht auch einen Ausweg gebe; sie machen sich jede Lage behaglich, fürchten niemals Mangel und Not und Verbringen so ihr Leben in beständiger Regsamkeit und Fröhlichkeit. Ein grenzenloser Leichtsinn und ein höchst spaßhafter Ernst im Vereine ist ihnen eigen; mit beiden beginnen und vollbringen sie alle ihre Geschäfte. Kein Ziel ist zu weit gesteckt, kein Wipfel zu hoch, kein Schatz sicher genug, kein Eigentum achtbar. So darf es uns nicht wundernehmen, daß die Eingeborenen Ostsudans nur mit grenzenloser Verachtung und mit Zorn von ihnen sprechen; ebensowenig aber wird man es dem unbeteiligten Beobachter verdenken, wenn er sie als höchst ergötzliche Wesen betrachtet.
Man kann eine Meerkatzenbande im Urwalde nicht übersehen. Wenn man auch den wechselvollen Ausruf des Leitaffen nicht vernimmt, hört man wenigstens bald das Geräusch, das die lausende und springende Gesellschaft auf den Bäumen verursacht, und wenn man dieses nicht hört, sieht man die Tiere laufen, spielen, ruhig dasitzen, sich sonnen, gewisser Schmarotzer halber sich Liebesdienste erzeigen: niemals fällt es ihnen ein, vor irgend jemand sich zu verbergen. Auf dem Boden trifft man sie bloß da, wo es etwas zu fressen gibt; sonst leben sie in den Wipfeln der Bäume und nehmen ihren Weg von einem Aste zum andern.
Äußerst anziehend für den Beobachter ist es, wenn er eine auf Raub ausziehende Gesellschaft belauschen kann. Mich hat die Dreistigkeit, die sie dabei zeigen, ebenso ergötzt, wie sie den Eingeborenen empörte. Unter Führung des alten, oft geprüften und wohlerfahrenen Stammvaters zieht die Bande der Tiere dem Getreidefelde zu; die Äffinnen mit kleinen Kindern tragen diese in der oben beschriebenen Weise am Bauche, die Kleinen haben aber noch zum Überflusse auch mit ihrem Schwänzchen ein Häkchen um den Schwanz der Mutter geschlagen. Anfangs nähert sich die Rotte mit großer Vorsicht, am liebsten, indem sie ihren Weg noch von einem Baumwipfel zum andern verfolgt. Der alte Herr geht stets voran; die übrige Herde richtet sich nach ihm Schritt für Schritt und betritt nicht nur dieselben Bäume, sondern sogar dieselben Äste wie er. Nicht selten steigt der vorsichtige Führer aus einem Baume bis in die höchste Spitze hinauf und hält von dort aus sorgfältige Umschau; wenn das Ergebnis derselben ein günstiges ist, wird es durch beruhigende Gurgeltöne seinen Untertanen angezeigt, wenn nicht, die übliche Warnung gegeben. Von einem dem Felde nahen Baume steigt die Bande ab, und nun geht es mit tüchtigen Sprüngen dem Paradiese zu. Hier beginnt jetzt eine wirklich beispiellose Tätigkeit. Man deckt sich zunächst auf alle Fälle. Rasch werden einige Maiskolben und Durrahähren abgerissen, die Körner enthülst und mit ihnen die weiten Backentaschen so voll gepfropft, als nur immer möglich; erst, wenn diese Vorratskammern gefüllt sind, gestattet sich die Herde etwas mehr Lässigkeit, zeigt sich aber auch zugleich immer wählerischer, immer heikler in der Auswahl der Nahrung. Jetzt werden alle Ähren und Kolben, nachdem sie abgebrochen worden sind, erst sorgsam berochen, und wenn sie, was sehr häufig geschieht, diese Probe nicht aushalten, sofort ungefressen weggeworfen. Man darf darauf rechnen, daß von zehn Kolben erst einer wirklich gefressen wird; in der Regel nehmen die Schlecker bloß ein paar Körner aus jeder Ähre und werfen das übrige weg. Dies ist es eben, das ihnen den grenzenlosen Haß der Eingeborenen zugezogen hat.
Wenn sich die Affenherde im Fruchtfelde völlig sicher fühlt, erlauben die Mütter ihren Kindern, sie zu verlassen und mit ihresgleichen zu spielen. Die strenge Aufsicht, unter der alle Kleinen von ihren Erzieherinnen gehalten werden, endet deshalb jedoch nicht, und jede Affenmutter beobachtet mit wachsamen Blicken ihren Liebling: keine aber bekümmert sich um die Sicherheit der Gesamtheit, sondern verläßt sich, wie alle übrigen Mitglieder der Bande, ganz auf die Umsicht des Herdenführers. Dieser erhebt sich selbst während der schmackhaftesten Mahlzeit von Zeit zu Zeit auf die Hinterfüße, stellt sich aufrecht wie ein Mensch und blickt in die Runde. Nach jeder Umschau hört man beruhigende Gurgeltöne, wenn er nämlich nichts Unsicheres bemerkt hat: im entgegengesetzten Falle stößt er einen unnachahmlichen, zitternden oder meckernden Ton zur Warnung aus. Hierauf sammelt sich augenblicklich die Schar seiner Untergebenen, jede Mutter ruft ihr Kind zu sich heran, und im Nu sind alle zur Flucht bereit; jeder aber sucht in der Eile noch so viel Futter aufzuraffen, als er fortbringen zu können glaubt. Ich habe es mehrmals gesehen, daß Affen fünf große Maiskolben mit sich nahmen. Davon umklammerten sie zwei mit dem rechten Vorderarme, die übrigen faßten sie mit der Hand und mit den Füßen, und zwar so, daß sie beim Gehen mit den Kolben den Boden berührten. Bei wirklicher Gefahr wird nach und nach mit sauren Mienen alle Last abgeworfen, der letzte Kolben aber nur, wenn der Verfolger ihnen sehr nahe auf den Leib geht, und die Tiere wirklich Hände und Füße zum Klettern notwendig haben. Immer wendet sich die Flucht dem ersten besten Baume zu. Ich habe beobachtet, daß die Meerkatzen auch auf ganz einzeln stehende Bäume kletterten, von denen sie wieder absteigen und weiterfliehen mußten, wenn ich sie dort aufstörte: sowie sie aber einmal den Wald erreicht haben und wirklich flüchten wollen, sind sie geborgen; denn ihre Gewandtheit im Klettern ist fast ebenso groß wie die der Langarmaffen. Es scheint kein Hindernis für sie zu geben: die furchtbarsten Dornen, die dichtesten Hecken, weit voneinander stehende Bäume – nichts hält sie auf. Jeder Sprung wird mit einer Sicherheit ausgeführt, die uns in größtes Erstaunen setzen muß, weil kein bei uns heimisches Klettertier es dem Affen auch nur annähernd nachtun kann. Wie die Schlankaffen sind auch sie imstande, mit Hilfe des steuernden Schwanzes noch im Sprunge die von ihnen anfangs beabsichtigte Richtung in eine andere umzuwandeln; sie fassen, wenn sie einen Ast verfehlten, einen zweiten, werfen sich vom Wipfel des Baumes auf die Spitze eines tiefstehenden Astes und lassen sich Weiterschnellen, setzen mit einem Sprunge von dem Wipfel auf die Erde, fliegen gleichsam, über Gräben hinweg, einem andern Baume zu, laufen pfeilschnell an dem Stamm empor und flüchten weiter. Auch hierbei geht der Leitaffe stets voran und führt die Herde durch sein sehr ausdrucksvolles Gegurgel bald rascher, bald langsamer. Man gewahrt bei flüchtenden Affen niemals Angst oder Mutlosigkeit, muß vielmehr ihre unter allen Umständen sich gleichbleibende Geistesgegenwart bewundern. Ohne zu übertreiben kann man sagen, daß es für sie, wenn sie wollen, eigentlich keine Gefahr gibt. Nur der tückische Mensch mit seinen weittragenden Waffen kann sie in seine Gewalt bringen; den Raubsäugetieren entgehen sie leicht, und die Raubvögel wissen sie schon abzuwehren, falls es sein muß.
Wenn es dem Leitaffen gut dünkt, hält er in seinem eiligen Laufe an, steigt rasch auf die Höhe eines Baumes hinauf, vergewissert sich der neu erlangten Sicherheit und ruft hierauf mit beruhigenden Tönen seine Schar wieder zusammen. Diese hat jetzt zunächst ein wichtiges Geschäft zu besorgen. Während der rasenden Flucht hat keiner darauf achten können, Fell und Glieder von Kletten und Dornen freizuhalten; letztere hängen vielmehr überall im Pelze oder stecken oft tief in der Haut. Nun gilt es vor allen Dingen, sich gegenseitig von den unangenehmen Anhängseln zu befreien. Eine höchst sorgfältige Reinigung beginnt. Der eine Affe legt sich der Länge lang auf einen Ast, der andere setzt sich neben ihn und durchsucht ihm das Fell auf das gewissenhafteste und gründlichste. Jede Klette wird ausgelöst, jeder Dorn herausgezogen, ein etwa vorkommender Schmarotzer aber auch nicht ausgelassen, vielmehr mit Leidenschaft gejagt und mit Begierde gefressen. Übrigens gelingt ihnen die Reinigung nicht immer vollständig; denn manche Dornen sind so tief eingedrungen, daß sie dieselben bei aller Anstrengung nicht aus ihren Gliedern herausziehen können. Dies darf ich verbürgen, weil ich selbst eine Meerkatze geschossen habe, in deren Hand noch ein Mimosendorn steckte, der von unten eingedrungen war und die ganze Hand durchbohrt hatte. Daß solches möglich ist, hat mich nicht verwundert, weil ich mir selbst einmal einen Mimosendorn eingetreten habe, der die Ledersohle, meine große Fußzehe und das Oberleder des Stiefels durchdrang, ich mir also wohl denken kann, daß ein von oben herunter auf einen Ast springender Affe kräftig genug auffällt, um eine ähnliche Erfahrung von der Schärfe und Härte jener Dornen machen zu können.
Erst nachdem die Reinigung im großen und ganzen beendet ist, tritt die Affenherde wieder den Rückzug an, d. h. sie geht ohne weiteres von neuem nach dem Felde zurück, um dort ihre Spitzbübereien fortzusetzen. So kommt es, daß der Einwohner des Landes sie eigentlich niemals aus seinen Feldern los wird, sondern stets unter einer Plage zu leiden hat, die noch ärger als die der Heuschrecken ist. Da die Leute keine Feuergewehre besitzen, wissen sie sich nur durch oftmaliges Verjagen der Affen zu schützen; denn alle andern Kunstmittel zur Vertreibung fruchten bei diesen losen Geistern gar nichts – nicht einmal die sonst unfehlbaren Kraftsprüche ihrer Heiligen oder Zauberer; und eben deshalb sehen die braunen Leute Innerafrikas alle Affen als entschiedene Gottesleugner und Glaubensverächter an. Ein weiser Schech Ostsudans sagte mir: »Glaube mir, Herr, den deutlichsten Beweis von der Gottlosigkeit der Affen kannst Du darin erblicken, daß sie sich niemals vor dem Worte des Gesandten Gottes beugen. Alle Tiere des Herrn achten und ehren den Propheten – Allahs Frieden sei über ihm! – die Affen verachten ihn. Derjenige, der ein Amulet schreibt und in seine Felder aufhängt, auf daß die Nilpferde, Elefanten und Affen seine Früchte nicht auffressen und seinen Wohlstand schädigen, muß immer erfahren, daß nur der Elefant dieses Warnungszeichen achtet. Das macht, weil er ein gerechtes Tier, der Affe aber ein durch Allahs Zorn aus dem Menschen in ein Scheusal verwandeltes Geschöpf ist, ein Sohn, Enkel und Urenkel des Ungerechten, wie das Nilpferd die abschreckende Hülle des scheußlichen Zauberers.«
In Ostsudan jagt man die Meerkatzen nicht, Wohl aber fängt man sie, und zwar gewöhnlich in Netzen, unter denen man leckere Speisen aufstellt. Die Affen, die den Köder wegnehmen wollen, werden von den Netzen bedeckt und verwickeln sich dergestalt in diese, daß sie nicht imstande sind, sich frei zu machen, so wütend sie sich auch gebärden. Wir Europäer erlegten die Tiere mit dem Feuergewehre ohne alle Schwierigkeit, weil sie erst dann fliehen, wenn einige aus ihrer Mitte ihr Leben gelassen haben.
Bei der Affenjagd ging es mir wie so vielen andern vor mir: sie wurde mir einmal gründlich verleidet. Ich schoß nach einer Meerkatze, die mir gerade das Gesicht zudrehte; sie war getroffen und stürzte von dem Baume herab, blieb ruhig sitzen und wischte sich, ohne einen Laut von sich zu geben, das aus den vielen Wunden ihres Antlitzes hervorrieselnde Blut mit der einen Hand so menschlich, so erhaben ruhig ab, daß ich, aufs äußerste erregt, hinzueilte und, weil beide Läufe meines Gewehres abgeschossen waren, dem Tiere mein Jagdmesser mehrere Male durch die Brust stieß, um es von seinen Leiden zu befreien. Aber ich habe von diesem Tage an nie wieder auf kleine Affen geschossen und rate jedem davon ab, der nicht seiner wissenschaftlichen Arbeiten wegen auf die Affenjagd gehen muß. Mir war es immer, als habe ich einen Menschen gemordet, und das Bild des sterbenden Assen hat mich förmlich verfolgt.
Nur einmal haben mir die Meerkatzen eine Jagdfreude gemacht. Ich beobachtete, daß allabendlich Schlangenhalsvögel, Ibisse und Reiher auf einer einzelnen Mimose am Stromufer des Asrakh zum Schlafen bäumten, und beschloß, dort anzustehen. Zufällig nächtigte eine Affenherde auf demselben Baume. Bedenken ausdrückende Töne wurden laut, als ich im nahen Maisfelde mich unter einem flugs zusammengestellten Schirme verborgen hatte: die Gesellschaft oben im Wipfel ahnte offenbar nichts Gutes. Nach länger währendem Gegurgel und Gezeter schien man übereingekommen zu sein, die belagerte Stelle zu verlassen. Vorsichtig stieg der Leitaffe vom Wipfel hernieder nach den unteren Asten. Er untersuchte und Prüfte. Sein Vorsatz schien nicht verändert zu werden: denn nach einigem Besinnen stieg er langsam noch weiter am Stamme herab, unzweifelhaft in der Absicht, dem nahen Walde zu fliehen. Andere folgten; nur die säugenden Mütter waren noch oben im Wipfel. In diesem Augenblicke bäumte ein Schlangenhalsvögel auf, ein Feuerstrahl aus meinem Gewehre blitzte durch die Dämmerung. Unbeschreiblicher Wirrwarr im Wipfel war die erste Wirkung des Schusses. Der Leitaffe kehrte sofort wieder um, alle übrigen flüchteten mit ihm nach den höchsten und dichtesten Ästen. Jeder suchte ein sicheres Versteck. Welch Gezeter, Schreien, Gurgeln, Hin- und Herspringen folgte nun! Jeder neue Schuß vermehrte das Entsetzliche der Lage. Das ganze Volk fühlte sich in höchsten Ängsten. Wohl mochten hundert Pläne zur Flucht das ewig rege und erfindungstüchtige Affengehirn beschäftigen – kein einziger schien ausführbar. Das fürchterliche Feuergewehr verursachte schließlich ein geradezu unsinniges Handeln. Einzelne Affen sprangen von den Ästen auf den Boden herab und kletterten dann wieder angsterfüllt am Stamme desselben Baumes empor, der ihnen eine Viertelminute vorher zu unsicher erschienen war. Endlich regte sich nichts mehr da oben. Jeder Affe saß ergebungsvoll auf dem Baume, so dicht an den Stamm gedrückt als möglich. Mein Anstand währte sehr lange, weil die wiederholt aufgeschreckten Vögel immer und immer wieder zu dem geliebten Schlafplatze zurückkehrten; nach den letzten Schüssen vernahm ich aber nur noch ein ängstliches Stöhnen der fast dem Entsetzen erliegenden Affenbande. Erst als ich schon längst nach meinem Schiffe zurückgekehrt war, hörte ich wieder Gurgeltöne, mit denen der Stammvater zu beruhigen versuchte.
Von Raubtieren haben die freilebenden Meerkatzen nicht viel zu leiden. Den Raubsäugetieren gegenüber sind sie viel zu behend; höchstens der Leopard dürfte dann und wann ein noch unvorsichtiges Äffchen sich erlisten. Den Raubvögeln widerstehen sie durch vereinigte Kraft. Einer der kühnsten Stößer ihrer Heimat ist unstreitig der gehäubte Habichtsadler ( Speziaëtos occipitalis). Er nimmt die bissigen Erdeichhörnchen ohne weiteres vom Boden weg und kümmert sich nicht im geringsten um ihre scharfen Zähne und um ihr Fauchen; an die Affen aber wagt er sich nur selten und wohl niemals ein zweites Mal. Davon habe ich mich selbst überzeugen können. Als ich eines Tages in den Urwäldern jagte, hörte ich plötzlich das Rauschen eines jener Räuber über mir und einen Augenblick später ein fürchterliches Affengeschrei: der Vogel hatte sich auf einen noch sehr jungen, aber doch schon selbständigen Affen geworfen und wollte diesen aufheben und an einen entlegenen Ort tragen, um ihn dort ruhig zu verspeisen. Allein der Raub gelang ihm nicht. Der von dem Vogel erfaßte Affe klammerte sich mit Händen und Füßen so fest an den Zweig, daß ihn jener nicht wegziehen konnte, und schrie dabei Zeter. Augenblicklich entstand ein wahrer Aufruhr unter der Herde, und im Nu war der Adler von vielleicht zehn starken Affen umringt. Diese fuhren unter entsetzlichem Gesichterschneiden und gellendem Schreien auf ihn los und hatten ihn sofort auch von allen Seiten gepackt. Jetzt dachte der Gaudieb schwerlich noch daran, die Beute zu nehmen, sondern gewiß bloß an sein eigenes Fortkommen. Doch dieses wurde ihm nicht so leicht. Die Affen hielten ihn fest und hätten ihn wahrscheinlich erwürgt, wenn er sich nicht mit großer Mühe frei gemacht und schleunigst die Flucht ergriffen hätte. Von seinen Schwanz- und Rückenfedern aber flogen verschiedene in der Luft umher und bewiesen, daß er seine Freiheit nicht ohne Verlust erkauft hatte.
Vor derartigen Raubtieren fürchten sich die Meerkatzen also ebensowenig wie vor dem Menschen. Um so größeres Entsetzen bereiten ihnen Kriechtiere und Lurchen, namentlich Schlangen. Ich habe zu erwähnen vergessen, daß unsere Affen Vogelnester jederzeit unbarmherzig ausnehmen und nicht bloß die Eier, sondern auch die jungen Vögel leidenschaftlich gern fressen. Wenn sie aber das Nest eines Höhlenbrüters ausplündern wollen, verfahren sie stets mit der größten Sorgfalt, eben aus dieser Furcht vor den Schlangen, die oft in solchen Nestern ihrer Ruhe Pflegen. Mehr als einmal habe ich gesehen, daß, wenn sie eine Baumhöhlung entdeckt hatten, sie stets sorgfältig untersuchten, ob nicht etwa eine Schlange darin wäre. Zuerst wurde hineingeschaut, so weit dies möglich war, hierauf nahmen sie das Ohr zur Hilfe, und wenn auch dieses ihnen nichts Ungewöhnliches mitteilte, streckten sie zögernd den einen Arm in die Höhle. Niemals tauchte ein Affe mit einem einzigen kühnen Griffe in die Tiefe, sondern stets in Absätzen, immer ein Stückchen tiefer, und immer horchte und schaute er dazwischen wieder in das Loch hinein, ob sich darin das gefürchtete Kriechtier verrate.
Die Fortpflanzungszeit der freilebenden Meerkatzen scheint an keine bestimmte Jahreszeit gebunden zu sein. Man steht bei jeder Herde Säuglinge, Kinder und Halberwachsene, der mütterlichen Zucht nicht mehr bedürftige. In den Gärten und Tierschaubuden Europas Pflanzen sich die meisten Arten bei guter Pflege ebenfalls fort, wenn auch seltener als Makaken und Paviane.
Während meines langjährigen Aufenthaltes in Afrika habe ich stets viele Affen und darunter auch regelmäßig Meerkatzen in der Gefangenschaft gehalten und berichte nach eigener Erfahrung über das geistige Wesen der Tiere, das man fast nur an Gefangenen beobachten kann. Ich darf versichern, daß jedes dieser merkwürdigen Tiere sein eigenes Wesen hatte und mir beständig Gelegenheit zu ebenso anziehenden als unterhaltenden Beobachtungen gab. Der eine Affe war zänkisch und bissig, der andere friedfertig und zahm, der dritte mürrisch, der vierte immer heiter, dieser ruhig und einfach, jener Pfiffig, schlau und ununterbrochen auf dumme, boshafte Streiche bedacht: alle aber kamen darin überein. daß sie größeren Tieren gern einen Schabernack antaten, kleinere dagegen beschützten, hegten und Pflegten. Sich selbst wußten sie jede Lage erträglich zu machen. Dabei lieferten sie täglich Beweise eines scharfen Verstandes, wahrhaft berechnender Schlauheit und wirklich vernünftiger Überlegung, zugleich aber auch der größten Gemütlichkeit und zärtlichsten Liebe und Aufopferung andern Tieren gegenüber, und ich habe wegen aller dieser Eigenschaften einzelne herzlich liebgewonnen.
Als ich auf dem Blauen Flusse reiste, brachten mir die Einwohner eines Uferdorfes einmal fünf frisch gefangene Meerkatzen zum Verkaufe. Ich kaufte sie in der Hoffnung, eine lustige Reisegesellschaft an ihnen zu bekommen, und band sie der Reihe nach am Schiffsbord fest. Meine Hoffnung schien jedoch nicht in Erfüllung gehen zu sollen; denn die Tiere saßen traurig und stumm nebeneinander, bedeckten sich das Gesicht mit beiden Händen wie tiefbetrübte Menschenkinder, fraßen nicht und ließen von Zeit zu Zeit traurige Gurgeltöne vernehmen, die offenbar Klagen über das ihnen gewordene Geschick ausdrücken sollten. Es ist auch möglich, daß sie sich über die geeigneten Mittel berieten, aus der Gefangenschaft wieder loszukommen; wenigstens schien mir ein Vorfall, der sich in der Nacht begab, Ergebnis ihrer Gurgelei zu sein. Am andern Morgen nämlich saß bloß noch ein einziger Affe an seinem Platze, die übrigen waren entflohen. Kein einziger der Stricke, mit denen ich sie gefesselt hatte, war zerbissen oder zerrissen; die schlauen Tiere hatten vielmehr die Knoten sorgfältig gelöst, an ihren Gefährten aber, der etwas weiter von ihnen saß, nicht gedacht und so ihn in der Gefangenschaft sitzen lassen.
Dieser übriggebliebene war ein Männchen und erhielt den Namen Koko. Er trug sein Geschick mit Würde und Fassung. Die erste Untersuchung hatte ihn belehrt, daß seine Fesseln für ihn unlösbar seien, und ich meinesteils sah darauf, ihm diese Überzeugung noch mehr einzuprägen. Als Weltweiser schien sich Koko nun gelassen in das Unvermeidliche zu fügen und fraß schon gegen Mittag des folgenden Tages Durrahkörner und anderes Futter, das wir ihm vorwarfen. Gegen uns war er heftig und biß jeden, der sich ihm nahte; doch schien sein Herz nach einem Gefährten sich zu sehnen. Er sah sich unter den andern Tieren um und wählte sich unbedingt den sonderbarsten Kauz, den er sich hätte aussuchen können: einen Nashornvogel nämlich, den wir aus seinem heimatlichen Walde mitgebracht hatten. Wahrscheinlich hatte ihn die Gutmütigkeit des Vogels bestochen. Die Verbindung beider wurde bald eine sehr innige. Koko behandelte seinen Pflegling mit unverschämter Anmaßung; dieser aber ließ alles sich gefallen. Er war frei und konnte hingehen, wohin er wollte; gleichwohl näherte er sich oft aus freien Stücken dem Affen und ließ nun über sich ergehen, was diesem gerade in den Sinn kam. Daß der Vogel Federn anstatt der Haare hatte, kümmerte Koko sehr wenig; sie wurden ebenso gut nach Läusen durchsucht wie das Fell der Säugetiere, und der Vogel schien wirklich bald so daran sich zu gewöhnen, daß er später gleich von selbst die Federn sträubte, wenn der Affe sein Lieblingswerk begann. Daß ihn dieser während des Reinigens hin und her zog, ihn beim Schnabel, an einem Beine, an dem Halse, an den Flügeln und an dem Schwanze herumriß, brachte das gutmütige Geschöpf ebensowenig auf. Er hielt sich zuletzt regelmäßig in der Nähe des Affen auf, fraß das vor diesem liegende Brot weg, Putzte sich und schien seinen Freund fast herausfordern zu wollen, mit ihm sich zu beschäftigen. Die beiden Tiere lebten mehrere Monate in engster Gemeinschaft zusammen. Erst der Tod des letzteren löste das schöne Verhältnis. Koko war wieder allein und langweilte sich. Zwar versuchte er, mit gelegentlich vorüberschleichenden Katzen sich abzugeben, bekam aber von diesen gewöhnlich Ohrfeigen anstatt Freundschaftsbezeigungen und wurde einmal auch mit einem bissigen Kater in einen ernsthaften Kampf verwickelt, der unter entsetzlichem Fauchen, Miauen, Gurgeln und Schreien ausgefochten wurde, aber unentschieden blieb, obschon er mit dem Rückzüge des jedenfalls unversehens gepackten Mäusejägers endete.
Ein junger, mutterloser Affe gewährte Kokos Herzen endlich die nötige Beschäftigung. Gleich, als er das kleine Tierchen erblickte, war er außer sich vor Freude und streckte verlangend die Hände nach ihm aus; wir ließen den Kleinen los und sahen, daß er selbst sofort zu Koko hinlief. Dieser erstickte den angenommenen Pflegesohn fast mit Freundschaftsbezeigungen, drückte ihn an sich, gurgelte vergnügt und begann sodann vor allen Dingen die allersorgfältigste Reinigung seines vernachlässigten Felles. Jedes Stäubchen, jeder Stachel, jeder Splitter, die in jenen kletten-, distel- und dornenreichen Ländern immer im Felle der Säugetiere hängen bleiben, wurden herausgelesen und weggekratzt. Dann folgte wieder neue Umarmung und andere Beweise der größten Zärtlichkeit. Wenn einer von uns Koko das Pflegekind entreißen wollte, wurde er wütend, und wenn wir den Kleinen ihm wirklich abgenommen hatten, traurig und unruhig. Er benahm sich ganz, als ob er ein Weibchen, ja als ob er die Mutter des kleinen Waisenkindes wäre. Dieses hing mit großer Hingabe an seinem Wohltäter und gehorchte ihm auf das Wort.
Leider starb dieses Äffchen trotz aller ihm erwiesenen Sorgfalt schon nach wenigen Wochen. Koko war außer sich vor Schmerz. Ich habe oft tiefe Trauer bei Tieren beobachtet, niemals aber in dem Grade, wie unser Affe jetzt sie zeigte. Zuerst nahm er seinen toten Liebling in die Arme, hätschelte und liebkoste ihn, ließ die zärtlichsten Töne hören, setzte ihn dann an seinem bevorzugten Platze auf den Boden, sah ihn immer wieder zusammenbrechen, immer unbeweglich bleiben, und brach nun von neuem in wahrhaft herzbrechende Klagen aus. Die Gurgeltöne gewannen einen Ausdruck, den ich vorher nie vernommen hatte; sie wurden ergreifend weich, ton- und klangreich, und dann wieder unendlich schmerzlich, schneidend und verzweiflungsvoll. Immer und immer wiederholte er seine Bemühungen, immer wieder sah er keinen Erfolg und begann dann wieder zu klagen und zu jammern. Sein Schmerz hatte ihn veredelt und vergeistigt; er rührte uns und bewegte uns zu dem tiefsten Mitleide. Ich ließ endlich das Äffchen wegnehmen, weil schon einige Stunden nach dessen Tode die Fäulnis begann, und die kleine Leiche über eine hohe Mauer werfen. Koko hatte aufmerksam zugesehen, gebärdete sich wie toll, zerriß in wenig Minuten seinen Strick, sprang über die Mauer hinweg, holte sich den Leichnam und kehrte mit ihm in den Armen auf seinen alten Platz zurück. Wir banden ihn wieder fest, nahmen ihm den Toten nochmals und warfen ihn weiter weg; Koko befreite sich zum zweiten Male und tat wie vorher. Endlich vergruben wir das Tier. Eine halbe Stunde später war Koko verschwunden. Am andern Tage erfuhren wir, daß in dem Walde eines nahen Dorfes, der sonst nie Affen beherbergte, ein menschengewöhnter Affe zu sehen gewesen sei.
Ungefähr einen Monat später erhielt ich eine Meerkatzenmutter mit ihrem Kinde und konnte nun mit Muße das Verhältnis zwischen beiden belauschen. Auch dieses Kleine starb, obwohl ihm nichts mangelte. Von diesem Augenblicke an hörte die Alte auf zu fressen und verendete nach wenigen Tagen.
Ich erfuhr aber auch genug Beweise von dem Mutwillen derselben Affenart. Sie waren zuweilen sehr ergötzlich, zuweilen aber auch recht ärgerlich. Ein Freund von mir besaß eines dieser Äffchen, das im höchsten Grade zärtlich an ihm hing, aber doch nicht an Reinlichkeit zu gewöhnen war. Während es mit seinem Herrn spielte, beschmutzte es diesen oft in der schändlichsten Weise, und weder Schläge noch andere Zuchtmittel, die man in solchen Fällen bei Tieren anwendet, schienen das geringste zu fruchten. Dieser Affe war sehr diebisch und nahm alle glänzenden Gegenstände, die er erwischen und forttragen konnte, augenblicklich an sich. Der Genannte wohnte in dem Geschäftshause der ostindischen Gesellschaft. Im Untergeschosse befanden sich die Schreiber- und die Kassenstube. Beide waren gegen menschliche Diebe durch starke Eisengitter vor den Fenstern wohl geschützt, nicht aber gegen solche Spitzbuben, wie jener Affe war. Eines Tages bemerkte mein Freund beide Backentaschen seines Lieblings vollgepfropft, lockte ihn deshalb an sich heran, untersuchte die Vorratskammern und fand in der einen drei und in der anderen zwei Guineen, die sich der Affe aus der Kasse heraufgeholt hatte. Das Geld wurde natürlich dem Eigentümer zurückgegeben, derselbe aber zugleich ersucht, in Zukunft auch die Glasfenster verschlossen zu halten, um dem kleinen Diebe das Stehlen unmöglich zu machen.
Eine Meerkatze brachte ich mit in meine Heimat. Sie gewann sich sehr bald die Zuneigung meiner Eltern und anderer Leute, ließ sich aber doch viel lose Streiche zuschulden kommen. Die Hühner meiner Mutter brachte sie geradezu in Verzweiflung, weil es ihr den größten Spaß zu machen schien, diese Tiere zu jagen und zu ängstigen. Im Hause selbst ging sie durch Küche und Keller, in alle Kammern und auf den Boden, und was ihr recht schien, wurde entweder zerbissen oder gefressen oder mitgenommen. Niemand war so geschickt, ein Hühnernest aufzufinden, wie sie: die Hühner mochten es anfangen wie sie wollten: Hassan, so hieß der Affe, kam gewiß hinter ihre Schliche, nahm die Eier weg und trank sie aus. Einige Male bewies er jedoch gerade bei dieser Räuberei wahren Menschenverstand. Meine Mutter schalt ihn aus und züchtigte ihn, als er wieder mit dottergelbem Maule erschien. Am andern Tage brachte er ihr zierlich ein ganzes Hühnerei legte es vor sie hin, gurgelte beifällig und ging seiner Wege. Unter allen irdischen Genüssen schien ihn Milch und noch mehr Rahm am meisten zu entzücken. Es dauerte gar nicht lange, so wußte er in der Speisekammer prächtig Bescheid und genau, wo diese leckeren Dinge aufbewahrt wurden, ermangelte auch nicht, jede Gelegenheit zu benutzen, um seine Naschhaftigkeit zu befriedigen. Auch hierbei wurde er erwischt und ausgescholten; deshalb verfuhr er in Zukunft listiger. Er nahm sich nämlich das Milchtöpfchen mit auf den Baum und trank es dort in aller Ruhe aus. Anfangs warf er die ausgeleerten Töpfe achtlos weg und zerbrach sie dabei natürlich fast immer; dafür wurde er bestraft, und zu dem innigen Vergnügen meiner Mutter brachte er ihr nun regelmäßig die leeren, aber unzerbrochenen Töpfchen wieder!
Sehr spaßhaft war es, wenn dieser Affe auf den Ofen kletterte, oder wenn er ein ziemlich langes Ofenrohr bestieg und wahrhaft verzweifelt von einem Beine auf das andere sprang, weil ihm die Wärme des Rohres zu arg wurde. Er führte dergestalt die allerdrolligsten Tänze aus; so gescheit war er aber nicht, daß er den heißen Boden verlassen hätte, bevor er wirklich gebrannt worden war. Er blieb sehr gleichgültig gegen alle unsere Haustiere, hielt aber mit einem weiblichen Pavian, den ich ebenfalls mitgebracht hatte, innige Freundschaft und ließ sich von diesem hätscheln und pflegen, als ob er ein kleiner unverständiger Affe gewesen wäre. Des Nachts schlief er stets in des Pavians Armen, und beide hielten sich so fest umschlungen, daß es aussah, als wären sie nur ein Wesen. Pavian und Meerkatze unterhielten sich lange mit verschiedenen kurzen Gurgeltönen und verstanden sich ganz entschieden vortrefflich. Seiner Pflegerin bewies er trotz seines Alters denselben kindlichen Gehorsam wie jenes obenerwähnte junge Äffchen seinem Wohltäter. Er folgte ihr überall hin, wohin diese von uns geführt wurde, und kam sogleich in das Zimmer, in das wir seine mütterliche Freundin brachten. Nur in deren Gesellschaft unternahm er längere Ausflüge, aber wenn er allein seinem Treiben nachging, entfernte er sich niemals weit und blieb mit ihr in beständiger Unterhaltung. Selbst entschiedene Gewalttätigkeiten ließ er sich von ihr gefallen, ohne zu grollen. Er teilte jeden guten Bissen mit seiner Pflegemutter; diese aber erkannte solche Herzensgüte selten und niemals dankbar an. So oft Hassan auch einmal etwas für sich behalten wollte, änderte sich das Verhältnis zwischen beiden. Denn wie ein Raubtier fiel dann der große Pavian über den armen Burschen her, brach ihm das Maul auf, holte mit den Fingern das Futter aus Hassans Backentaschen heraus, fraß es auf und kniff und puffte den armen Wehrlosen wohl auch noch tüchtig dabei.
Gegen uns war er liebenswürdig, gab aber niemals seine Selbständigkeit auf. Er kam auf den Ruf – wenn er wollte, sonst antwortete er wohl, rührte sich aber nicht. Wenn wir ihn gefangen hatten und gewaltsam festhielten, verstellte er sich nicht selten mit größter Meisterschaft und gebürdete sich zuweilen, als müsse er im nächsten Augenblick abscheiden; sowie er aber frei wurde, rächte er sich für die erlittene Gefangenschaft durch Beißen und entfloh hierauf mit vielsagendem Gegurgel.
Der zweite kalte Winter, den er in Deutschland verlebte, endete leider sein frisches, fröhliches Leben, und das ganze Haus trauerte um ihn, als ob ein Kind gestorben wäre. Jedermann hatte seine unzähligen Unarten vergessen und gedachte nur noch seines heiteren Wesens und seiner Gemütlichkeit.
Der Grünaffe, Abulandj oder Nißnaß der Araber ( Cercopithecus Sabaeus), erreicht Durchschnittsgröße, d. h. eine Länge von einem Meter, wovon die Hälfte auf den Schwanz gerechnet werden muß, und eine Schulterhöhe von 40 Zentimeter. Die Haare der Oberseite sind graulichgrün, schwarz geringelt und gespitzt, die der Arme, Beine und des Schwanzes einförmig aschgrau, die des kurzen Backenbartes weißlich, an der Wurzel schwarz geringelt, die der Unten- und Innenseite der Beine weißlich; Nase, Maul und Augenbrauen sehen schwarz aus; das Gesicht hat hellbraune Färbung.
Andere Meerkatzen zeichnen sich durch besondere Schönheit aus. Eine der bekanntesten, die Diana ( Cercopithecus Diana), ein ziemlich kleines, schlankes Tier, ist an ihrem langen Backen- und Stutzbart leicht kenntlich. Ihre Hauptfarbe ist schiefergrau, der Rücken und das Kreuz sind purpurbraun, die unteren Teile weiß, die Schenkel hinten gelblich. Dem Weibchen mangelt der Bart. Die Gesamtlänge beträgt etwa ein Meter, wovon über die Hälfte auf den Schwanz kommt.
Mit der Diana hat der Nonnenaffe ( Cercopithecus mona) Ähnlichkeit; doch fehlt ihm der Stutzbart. Beide Affen stammen aus Westafrika.

Affenfelsen (Paviane und Makaken)
Nicht alle Meerkatzen sind so liebenswürdig wie die eben beschriebenen Arten; einige scheinen sogar recht mürrisch und widerwärtig zu sein. Nach meinen Erfahrungen ist der Husarenaffe ( Cercopithecus ruber) die langweiligste und unliebenswürdigste Meerkatze, und ihr Geist entspricht so durchaus nicht dem schön gefärbten Leibe. In der Größe übertrifft dieser Affe den vorher beschriebenen fast um die Hälfte, mindestens um ein Drittel. Sein Verbreitungskreis erstreckt sich vom Westen Afrikas bis Habesch; das Tier scheint jedoch überall spärlicher aufzutreten als der Abulandj oder Grünaffe. In seinem Wesen scheint er das gerade Gegenteil des Abulandj zu sein. Sein Gesichtsausdruck ist der eines Staatshämorrhoidariers, ewig mürrisch und unfreundlich nämlich und sein Handeln straft diesen Ausdruck in keiner Weise Lügen.
*
Der Mohrenaffe oder gemeine Mangabe ( Cercopithecus fuliginosus) erreicht eine ziemlich beträchtliche Größe; seine Länge beträgt bis 1,25 Meter, wovon auf den Schwanz 60 Zentimeter kommen, die Schulterhöhe 40 Zentimeter. Die Färbung der oberen Seite ist ein düsteres Schwarz, das unten und an den Innenseiten der Gliedmaßen ins Schiefergraue übergeht. Gesicht und Hände sind schwarz, die oberen Augenlider fast rein weiß.
*
Mit dem Namen Makak oder Makako bezeichnet man an der Küste von Guinea alle Affen überhaupt, im wissenschaftlichen Sinne aber eine nicht besonders zahlreiche Gruppe, deren Mitglieder teils im südöstlichen Asien, teils in Afrika leben. Im allgemeinen kennzeichnen sich die Makaken durch folgende Merkmale: Der Bau ist untersetzt; die mäßig langen Gliedmaßen sind kräftig; die Schnauze tritt ungefähr ebenso weit wie bei den Meerkatzen vor; der Gesichtswinkel beträgt vierzig bis fünfzig Grade; der Kinnladenteil ist dick, die Nase besonders vorstehend; die Nasenlöcher sind kurz und engständig; der kurze Daumen und die beträchtlich längere Daumenzehe tragen glatte, die übrigen Finger und Zehen hohlziegelförmige Nägel. An den nackten Hinterbacken machen sich die großen Schwielen schon sehr bemerklich. Der Schwanz spielt in verschiedener Lange und Stärke, erreicht bei einzelnen beinahe Leibeslänge und verkümmert bei andern fast gänzlich. Als fernere Eigentümlichkeit dieser Tiere mag noch erwähnt sein, daß das Kopfhaar bei einigen in der Mitte gescheitelt ist, bei andern perückenartig von dem sonst fast kahlen Scheitel herabfällt, und daß der einzelnen fehlende Backenbart bei andern eine geradezu beispiellose Wucherung zeigt.
In der Vorzeit waren die Makaken über einen großen Teil Europas verbreitet, und auch gegenwärtig noch gehen sie am weitesten nach Norden hinauf. Die stummelschwänzigen Arten bewohnen Nordafrika, China und Japan, die langschwänzigen das Festland und die Inseln Ostindiens. Sie vertreten gleichsam die Meerkatzen, ähneln aber ebenso den Pavianen in vieler Hinsicht und sind somit als Verbindungsglieder zwischen beiden anzusehen. Diese Mittelstellung spricht sich auch in ihrer Lebensweise aus, d. h. sie leben bald wie Meerkatzen in Wäldern, bald wie die Paviane auf Felsen. Beider Unverschämtheit scheint in ihrem Wesen vereinigt zu sein; in der Jugend sind sie gemütlich lustig wie die Meerkatzen, im Alter boshaft und frech wie die Paviane. Sie eignen sich vortrefflich für die Gefangenschaft, halten am längsten in ihr aus und pflanzen sich am leichtesten in ihr fort.
Wohl die bekannteste Art der Gruppe ist der Makak oder Javaneraffe ( Macacus cynomolgus). Er erreicht eine Länge von 1,15 Meter, wovon der Schwanz 58 Zentimeter wegnimmt, und eine Schulterhöhe von etwa 45 Zentimeter. Der Backenbart ist sehr kurz, das Kopfhaar beim Männchen flach niedergedrückt, beim Weibchen kammartig in der Mitte aufgekrempelt; der übrige Pelz hat auf der Oberseite olivenbräunlichgrüne mit Schwarz untermischte, auf der dünner behaarten Unterseite weißlichgraue, die Innenseite der Gliedmaßen graue, Hände, Füße und Schwanz schwärzliche Färbung; das Gesicht sieht bleigrau, zwischen den Augen weißlich aus; die Ohren sind schwärzlich; die Iris ist braun.
Der Verbreitungskreis des gemeinen Makaken erstreckt sich über ganz Ostasien; namentlich die großen Sundainseln beherbergen ihn in Menge. Aus den Berichten der Reisenden geht hervor, daß er überall, wo er vorkommt, zu den häufigsten Arten seiner Ordnung zählt. Wie mir Schiffer erzählten, bieten die Eingeborenen ihnen in jedem Hafen des Festlandes und der Inseln gezähmte Javaneraffen zum Kaufe an und verlangen für dieselben in der Regel so niedrige Preise, daß sich jeder Matrose entschließt, einen oder mehrere zu erwerben.
Die ausführlichsten, mir bekannten Bemerkungen über den Monjet verdanken wir Junghuhn. »Der Monjet ißt gern die Früchte von Feigen- wie von vielen andern Bäumen und kommt daher in den Urwäldern bis zu einer Höhe von 1600 Meter ebenso häufig vor wie in den Rhizophorawaldungen des Seestrandes, wo man ihn oft genug umherspazieren sieht, um die Krabben und Muscheln aufzulesen und zu verzehren, die die Flut auf dem Gestade zurückließ. Er ist ein guter Gesellschafter, liebt die Einsamkeit nicht, sondern hält sich stets in kleinen Trupps von zehn bis fünfzig Stück zusammen. Oft kann man sich an den Kapriolen dieses fröhlichen, auch in der Wildnis durchaus nicht scheuen Affen belustigen, wenn man die Weibchen mit ihren Jungen, die sich fest an die Brust der Mutter angeklammert haben, dort in den Bäumen umherspringen sieht, oder wenn man andere erblickt, die, unbekümmert um den zuschauenden Reisenden, sich auf den weit über den Spiegel eines Baches herüberhängenden Zweigen schaukeln. Große männliche Stücke zeichnen sich durch dreistes Betragen besonders aus. Wie Kavaliere stolzieren sie zwischen den andern Affen umher, die einen hohen Grad von Achtung vor ihnen zu erkennen geben. Freilich ist ihre Art, sich in Achtung zu setzen, etwas handgreiflich. Wird ihnen das Gedränge um sie herum zu groß, so packen sie einige ihrer Kameraden mit den Händen, andere mit den Zähnen, weshalb die übrigen unter Angstgeschrei und mit Bestürzung zur Seite fliehen. Sich selbst jedoch weichen diese Despoten sehr sorgfältig aus.« Durch Martens erfahren wir, daß die Europäer in Java oft Affen und Papageien halten, und daß der Affe, den man am häufigsten zu sehen bekommt, eben unser Makake ist. »Auch im wilden Zustande ist er einer der gemeinsten im Indischen Archipel. Man hält ihn oft in Pferdeställen, wie bei uns Böcke und Kaninchen, wohl aus ähnlichen Gründen. Die Javaner sagen, die Pferde langweilen sich dann nicht so sehr und gedeihen dadurch besser.«
In unsern Tiergärten und Tierschaubuden bildet der Makak einen wesentlichen Teil der Bewohnerschaft, und hier wie dort erwirbt er sich Freunde. Wie in seiner Gestalt, ähnelt er auch in seinem Wesen den Meerkatzen. Ich habe im Verlaufe der Zeit sicherlich gegen hundert dieser Affen gepflegt und vielleicht die zehnfache Anzahl gesehen und beobachtet, fühle mich aber außerstande, etwas Wesentliches anzugeben, wodurch der Makak von den Meerkatzen sich unterscheidet. Seine Bewegungen sind entschieden plumper als die der letztgenannten Affen, immer aber noch behend genug. In Gebaren, Eigenheiten und Charakter dagegen stimmen beide Gruppen vollständig überein. Auch ist er ein ununterbrochen munterer, gutmütiger Affe, verträgt sich ausgezeichnet mit seinesgleichen und den ihm verwandten Arten, weiß ebenso mit größeren Affen trefflich auszukommen und sich sogar in die Laune der Paviane zu fügen oder ihren Grobheiten zu begegnen, wenn er in die Lage kommt, mit ihnen sich abgeben zu müssen. Daß er seinerseits Hilflose nach Kräften bemuttert, kleinere aber ebenso schlecht behandelt, als er von größeren sich behandeln läßt, eine zuweilen widerwärtige Selbstsucht, und zuweilen wiederum eine hingebende Aufopferung an den Tag legt, unterscheidet ihn nicht von den Meerkatzen, da diese ja ebenfalls genau in derselben Weise verfahren. Überhaupt bekundet er dieselbe Wetterwendigkeit des Wesens wie die eben genannten Affen. Eben noch äußerst gemütlich und gutmütig, ist er im nächsten Augenblicke einer Kleinigkeit halber höchst entrüstet, erzürnt und boshaft; eben noch überfließend vor lauter Zärtlichkeit gegen einen Mitaffen oder seinen Wärter, maulschelliert er in der nächsten Minute jenen und versucht diesen zu beißen. Doch muß ich zu seinem Ruhme sagen, daß auch er für gute Behandlung in hohem Grade empfänglich sich zeigt. Es verursacht deshalb seine Zähmung kaum nennenswerte Mühe. Derjenige, der ihn einige Male fütterte oder ihm einen Leckerbissen zusteckte, erringt bald seine vollste Freundschaft und zuletzt eine wirklich dauernde Anhänglichkeit. Denn wenn auch kleine Zerwürfnisse zwischen ihm und dem Pfleger an der Tagesordnung sind, stellt sich das alte Verhältnis doch sofort wieder her, sobald irgendeine andere Einwirkung von außen sich geltend macht und unsern Affen in einige Verlegenheit setzt. Neugierig in vollem Maße, der Langenweile entschieden abhold, und für jede Änderung der Lage äußerst empfänglich, läßt der Makak leichter als die in dieser Hinsicht gleichgearteten Paviane durch Erregung seiner Aufmerksamkeit nach Belieben sich leiten und lenken und selbst im höchsten Zorne sofort versöhnen, so daß seine Behandlung auch in dieser Hinsicht zu einer sehr leichten wird.
Im Freileben wird sich der Makak wahrscheinlich von eben denselben oder ähnlichen Pflanzenstoffen ernähren wie seine Verwandten; in der Gefangenschaft nimmt er mit dem einfachsten Futter vorlieb, wie er sich beim Fressen überhaupt als ein höchst anspruchsloser Gesell zeigt, obgleich seine Ansprüche vielleicht nichts weniger als bescheiden sind. Ein Stück Brot, im rechten Augenblicke ihm dargebracht, erscheint als ein ausgezeichneter Leckerbissen, während es, wenn er sich gesättigt hat, achtlos fortgeworfen wird; eine Handvoll Körner, vor ihn auf den Boden gestreut, erregt ihn zum eifrigsten Aufsuchen derselben und zum schleunigsten Anfüllen der Backentaschen, selbst wenn er den Futternapf eben verlassen hat; ein Zweig mit grünen Blättern, Knospen oder Blüten, vom ersten besten Baume gebrochen, wird mit Behagen entblättert und Blatt und Blüte, Knospe und Zweigspitze anscheinend mit demselben Vergnügen verzehrt. Milch trinkt der Makak, so lange er jung ist, leidenschaftlich gern; Milchbrot genießt er noch im Alter mit Vorliebe. An Fleischkost läßt er sich gewöhnen, überhaupt bald dahin bringen, die Gerichte der menschlichen Tafel zu teilen. Auch geistigen Getränken ist er keineswegs abhold, und einmal an dieselben gewöhnt, zieht er sie allen andern vor. Je reicher man ihm seine Tafel beschickt, um so wählerischer zeigt er sich. Trotzdem kann man ihn kaum verwöhnen, weil er im Notfalle sich wiederum mit dem einfachsten Futter begnügt und dasselbe scheinbar mit demselben Behagen verspeist wie die beste Leckerei.
Gefangene Makaken pflanzen sich ziemlich regelmäßig im Käfige fort, paaren sich zuweilen auch mit Verwandten und erzeugen dann lebenskräftige Blendlinge. Ich selbst habe von den Makaken, die ich pflegte, wiederholt Junge erhalten. Einmal wurde einer in einem Käfig geboren, in dem sich außer der betreffenden Mutter noch ein anderer Makak und das Weibchen eines Mantelpavians befanden. Letztere hatte geraume Zeit vorher ebenfalls geboren, das Junge aber bald eingebüßt. Wenige Minuten nach der Geburt des Makaken bemerkten die Wärter das Junge in den Armen des gedachten Hamadryasweibchens und schlossen daraus, daß dieses ein nachgeborenes Junge zur Welt gebracht habe. Aus diesem Grunde ließen sie auch der anscheinenden Mutter das Junge. Erst in den Nachmittagsstunden fiel ihnen auf, daß sich die Pflegemutter wenig mütterlich betrage, das Junge oft auf das Stroh lege und sich zeitweilig kaum um dasselbe kümmere. Nunmehr erst sahen sie, daß der alte Makak, die wirkliche Mutter, sehr abgefallen war, fingen dieselbe, untersuchten sie, und fanden ihre Brüste strotzend von Milch. Jetzt erhielt die Alte ihr Kind; letzteres saugte auch, war aber doch schon zu lange ohne Pflege und Nahrung gewesen; denn am andern Morgen fand man es tot.
Wie innig Makaken an ihren Kindern hängen, mag aus einer andern Beobachtung von mir hervorgehen. Gelegentlich der Wintereinrichtungen sollten einige Affen aus ihrem Käfig entfernt werden, und es wurde deshalb Jagd auf sie gemacht. Unter der Gesellschaft jenes Käfigs befand sich auch das Junge eines Makakenweibchens, das von der Mutter bereits seit Monaten getrennt worden war. Letztere bewohnte einen andern Käfig, von dem aus sie jenen übersehen konnte, und war von ihrem Kinde getrennt worden, weil sie eine bessere Pflege erhalten sollte. Als die Jagd auf die Affen begann, folgte die Alte mit ängstlichen Blicken jeder Bewegung des Wärters und schrie laut auf, sooft dieser ihrem Kinde sich näherte. Das fiel auf, und sie erhielt infolge ihrer Teilnahme das Kind zurück. Augenblicklich ergriff sie es, nahm es in die Arme und liebkoste es auf das zärtlichste. Sie hatte also das Junge niemals aus den Augen verloren, und dieses, wie es schien, auch die Mutter im Gedächtnis behalten.
In unsern Affentheatern spielt der Makak eine bestimmte, nicht allzu eng begrenzte Rolle, gewöhnlich als Aufwärter, Diener usw., seltener als Reiter. Einzelne bringen es zu einer bemerkenswerten Künstlerschaft. Ihre Abrichtung erfordert größere Mühe als die Abrichtung der Paviane.
Minder häufig als der Makak gelangt uns der Hutaffe ( Macacus sinicus) zu Gesichte. In der Größe steht dieser Affe seinen Verwandten um etwas nach. Seine Leibeslänge beträgt selten mehr als 45 Zentimeter, seine Schwanzlänge ebenso viel. Der Leib ist ziemlich schmächtig, die zusammengedrückte Schnauze weiter vorgezogen als bei jenem, das Kopfhaar vom Scheitel aus strahlig ausgebreitet, die Stirn fast nackt, der Pelz ziemlich kurz, die Färbung der Oberseite ein fahles Grünlichgrau, das durch den Gesamteindruck der grauen, schwarz- und gelbgeringelten Haare hervorgerufen wird, die der Unterseite weißlich; Hände und Ohren sind schwärzlich gefärbt.
Der Hutaffe bewohnt die dichteren Waldungen Malabars, ohne von irgendeinem Feinde behelligt zu werden. Die Eingeborenen betrachten ihn als ein heiliges Wesen und erlauben ihm nicht bloß, in ihren Gärten nach Lust und Willkür zu schalten, sondern errichten ihm noch besonders Tempel und bauen Fruchtgärten für ihn an, um dem sauberen Heiligen ihre Ehrfurcht zu beweisen. In seinem Wesen ist der Hutaffe ein echter Makak, d. h. wetterwendisch wie irgendein anderer seiner Ordnung. Seine Launen wechseln in jedem Augenblick, und daher kommt es, daß man eigentlich niemals recht weiß, wie man mit ihm daran ist. Sein Mutwillen, die Munterkeit seines Wesens, seine Nachahmungssucht und seine Gelehrigkeit machen ihn jedoch zu einem gern gesehenen Gesellschafter und lassen seine Unarten und sein garstiges Gesicht vergessen.
Im allgemeinen darf man sagen, daß er sich in seinen Sitten, Gewohnheiten, in der Art und Weise seiner Bewegung, seines Gebarens, überhaupt des gesamten Auftretens wenig oder nicht von dem gemeinen Makaken unterscheidet. Entsprechend seinem absonderlichen Gesicht, dem der auf die Stirn hereinfallende Haarschopf einen ganz eigentümlichen Ausdruck verleiht, schneidet er vielleicht noch mehr als jener Grimassen und Fratzen; dies aber ist auch alles, was ich zum Unterschied anzugeben wüßte. Auf Ceylon steht er bei jedermann in großer Gunst und ist der allgemeine Liebling und das Schoßtier der Eingeborenen wie der Europäer. Die Schlangenbeschwörer lehren ihn den Tanz und ähnliche Künste, kleiden ihn in auffallende Tracht, ziehen mit ihm von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und lassen durch ihn sich ernähren, so gut und schlecht es eben gehen will. Fast alle Affen, die ich kenne, lieben den Tabaksrauch mit einer gewissen Leidenschaft. Einige geraten in förmliches Entzücken, wenn man ihnen solchen zubläst, andere öffnen das Maul so weit als möglich, wenn man sie anraucht, und blasen dann den eingezogenen Rauch mit wirklichem Behagen von sich. Der Hutaffe macht also durchaus keine Ausnahme von der Regel.
Außer dem Hulman ehrt der Inder noch einen andern Affen, den Bunder ( Macacus rhesus), in einer Art und Weise, die das Maß der zur Heiligenverehrung erforderlichen kindlichen Einfalt noch erheblich übersteigt.

Rhesusaffen oder Bunder ( Macacus rhesus) auf einem Felsen
»In der Nähe von Bindrabun, zu Deutsch Affenwald«, erzählt Kapitän Johnson, »gibt es mehr als hundert wohlbestellte Gärten, in denen alle Arten von Früchten gezogen werden, einzig und allein zum besten der Bunder, deren Unterhaltung den Reichen des Landes als großes Glaubenswerk erscheint. Als ich durch eine der Straßen in Bindrabun ging, folgte ein alter Affe mir von Baum zu Baum, kam plötzlich herunter, nahm mir meinen Turban weg und entfernte sich damit in kurzer Zeit, ohne wieder gesehen zu werden. Ich wohnte einst einen Monat in dieser Stadt, und zwar in einem großen Hause an den Ufern des Flusses, das einem reichen Eingeborenen gehörte. Das Haus hatte keine Türen; die Affen kamen daher oft in das Innere des Zimmers, in dem ich mich aufhielt, und nahmen Brot und andere Dinge vor unsern Augen von dem Tische weg. Wenn wir in einer Ecke des Raumes schliefen, brandschatzten sie uns auch in anderer Hinsicht. Ich habe oft mich schlafend gestellt, um sie in ihrem Treiben zu beobachten, und dabei mich weidlich gefreut über ihre Pfiffigkeit und Geschwindigkeit. Sätze von vier bis fünf Meter von einem Hause zum andern, mit einem, ja zwei Jungen unter ihrem Bauche und noch dazu beladen mit Brot, Zucker und andern Gegenständen, schienen für sie nur Spaß zu sein.
Es ist fast unmöglich, sich einen Garten oder eine Pflanzung anzulegen: die geduldeten Halbgötter vernichten oder brandschatzen ihn wenigstens in der allernachdrücklichsten Weise. Falls man Wachen ausstellt, um sie zu verscheuchen, kommt man nicht zum Ziel: denn wenn man die zudringlichen Gäste auf der einen Seite weggejagt hat, erscheinen sie auf der andern wieder. Brennende Feuer, Schreckensbilder und dergleichen stören sie nicht im geringsten, und die ihnen wirklich angetane Gewalt gefährdet das eigene Leben.

Rhesusaffen oder Bunder ( Macacus rhesus) auf einem Baum
Ein dort wohnender Engländer wurde durch Bunder zwei Jahr lang in dieser Weise bestohlen und geärgert und wußte sich gar nicht mehr vor ihnen zu retten, bis er endlich auf ein wirklich sinnreiches Mittel verfiel. Er jagte eine Bande Affen auf einen Baum, fällte denselben mit Hilfe seiner Diener, fing eine Menge von den Jungen und nahm sie mit sich nach Hause. Hier hatte er bereits eine Salbe zurechtgemacht, in der Zucker, Honig und Brechweinstein die Hauptbestandteile waren. Mit dieser Salbe wurden die jungen Affen eingerieben und dann freigelassen. Die ängstlichen Eltern hatten sorgend nach ihrer Nachkommenschaft gespäht und waren froh, als sie die lieben Kinder erblickten. Aber o Jammer, wie kamen sie zurück! Unsauber, beschmutzt, beschmiert, kaum mehr kenntlich. Natürlich, daß sofort eine gründliche Reinigung vorgenommen wurde. Die Beschwerde der Säuberung schien sich zu lohnen; denn zuckersüß war die Schmiere, die den Körper bedeckte. Beifälliges Grunzen ließ sich vernehmen; doch nicht lange Zeit: der Brechweinstein zeigte seine tückische Wirkung, und ein Fratzenschneiden begann, wie niemals früher, als sich die Affen anschickten, mit heißem Flehen den »heiligen Ulrich« anzurufen. Nach dieser bitteren Erfahrung kamen sie nie wieder in die Nähe des Verräters und ließen sein Hab und Gut fortan unbehelligt.«
Der Bunder erreicht eine Länge von 50 bis 65 Zentimeter; sein Schwanz mißt etwa 20 Zentimeter. Er ist von kräftigem, untersetztem Bau, am Oberleibe reichhaltig, am Unterleibe spärlich behaart. Seine sehr schlaffe Haut bildet an dem Halse, der Brust und dem Bauche wammenartige Falten. Die Färbung des Pelzes ist oben grünlich oder fahlgrau, an den Schenkeln und dem Gesäß mit hellgelblichem oder rötlichem Anflug, an der Unterseite weiß, die des Schwanzes oben grünlich, unten graulich. Gesicht, Ohren und Hände sind licht kupferfarben, die Gesäßschwielen lebhaft rot gefärbt. Das Weibchen trägt seinen Schwanz gewöhnlich hängend, das Männchen bogig ab- und einwärts gekrümmt. Unser Affe verbreitet sich über einen großen Teil des festländischen Indiens. In namhafter Anzahl bevölkert er die Waldungen am Ufer des Ganges, kommt jedoch auch im Himalaja vor, wenigstens in den tiefen warmen Tälern dieses Gebirges. »Ich sah diese Affen«, berichtet Hutton »wiederholt im Februar, obgleich der Schnee nahe bei Simla zehn bis fünfzehn Zentimeter hoch lag, zur Nachtzeit auf den Bäumen schlafen, augenscheinlich ohne alle Rücksicht auf die Kälte. Der Winter scheint sie wenig zu behelligen. Zuweilen bemerkte ich sie springend und spielend unter den Nadelbäumen, deren Äste mit Schneelasten bedeckt waren: ich sah sie noch bis zu 3000 Meter über dem Meere, selbst im Herbste, als in jeder Nacht harte Fröste fielen. Doch wird aus verschiedenen Örtlichkeiten, in denen der Bunder vorkommt, gemeldet, daß er sich beim Herannahen des Winters in die Ebene zurückzieht. Er liebt das Wasser in hohem Grade, schwimmt vorzüglich und besinnt sich, verfolgt, keinen Augenblick, sich ins Wasser zu stürzen, tauchend eine Strecke unter demselben wegzuschwimmen, und dann an irgendeiner andern Stelle zu landen.«
Unter den Makaken ist der Bunder dasselbe, was der Husarenaffe unter den Meerkatzen: ein im höchsten Grade erregter, wütender, jähzorniger und mürrischer Geselle, ein Affe, der sich selten und eigentlich nur in der Jugend an seinen Wärter anschließt und mit seinen Mitaffen in ebenso entschiedener Feindschaft lebt, als mit den Menschen. In Wut gebracht, zerbricht und zerreißt er alles, was man in die Nähe seines Käfigs bringt, geht auch furchtlos auf den Menschen los und bedient sich seiner mächtigen Zähne mit großer Fertigkeit und dem entschiedensten Nachdruck. Immer schlecht gelaunt, ärgert er sich über alles, was um ihn her vorgeht, und schon ein scheeler Blick bringt ihn außer sich. Dann verzerrt sich sein sonst nicht gerade häßliches Gesicht zur abscheulichsten Fratze, die Augen funkeln, und er nimmt eine lauernde Stellung an wie ein Raubtier, das im Begriff steht, sich auf seine Beute zu stürzen. Andere Affen, die mit ihm in einem und demselben Käfig leben, tyrannisiert er in der abscheulichsten Weise; denn er ist ebenso neidisch und selbstsüchtig als heftig und wird zornig, wenn er einen andern Affen fressen sieht. In seiner gemütlichsten Stimmung nimmt er die unter Affen übliche Huldigung mit einer gewissen Würde entgegen, gestattet, daß ihm der Pelz durchsucht und gereinigt wird, läßt sich vielleicht herab, einem andern gleiche Liebesdienste zu erweisen; doch hält eine so sanfte Stimmung selten längere Zeit an, schlägt vielmehr meist urplötzlich in das Gegenteil um, und der eben noch geduldete oder sogar bediente Mitaffe hat dann die volle Leidenschaftlichkeit des Heiligen zu erfahren. Demungeachtet läßt sich auch der Bunder zähmen und zu den verschiedensten Kunstfertigkeiten abrichten. Bei Affenführern und im Affentheater ist er sehr beliebt, weil sein mäßig langer, biegsamer Schwanz in der Kleidung mühelos sich unterbringen läßt, er auch leicht lernt und »gern arbeitet«. Ich habe gerade unter diesen Affen »große Künstler« kennengelernt. Bei geeigneter Pflege Pflanzt sich der Bunder in der Gefangenschaft fort, und zwar geschieht dies ziemlich regelmäßig.
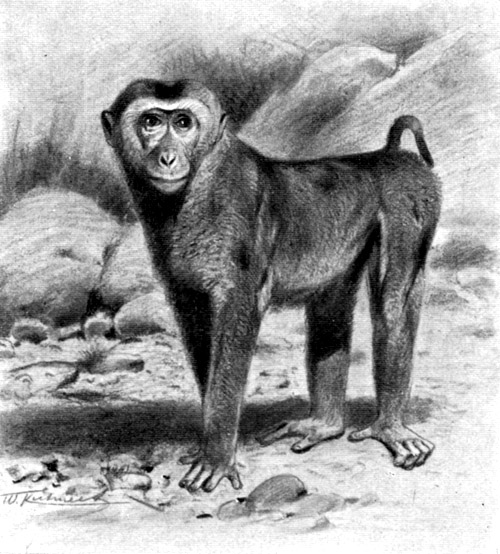
Schweinsaffe ( Macacus nemestrinus)
Von den bisher genannten Makaken unterscheidet sich der Schweinsaffe oder Lapunder ( Macacus nemestrinus) vornehmlich durch seinen kurzen, dünnen Schwanz und die hohen Beine. Seinen Namen erhielt er eben wegen seines Schwanzes, der mit dem eines Schweines insofern Ähnlichkeit hat, als ihn der Affe in einer ganz eigentümlichen gekrümmten Weise trägt. Auf dem Scheitel gehen die Haare strahlenförmig auseinander. Die Höhe dieses Affen beträgt bis 55 Zentimeter, die Länge des Körpers 60 Zentimeter, und die des Schwanzes 15 Zentimeter. Der Schweinsaffe lebt in den ausgedehnten Wäldern von Sumatra, Borneo (?) und der malaiischen Halbinsel, wahrscheinlich weniger auf Bäumen als nach Art der Paviane auf dem Erdboden oder auf Felsen. Sein Wesen ist entschieden gutmütig, und man darf wohl sagen, daß dieser Affe zu den liebenswürdigsten seines Geschlechts zählt. Auch er pflanzt sich leicht in der Gefangenschaft fort und paart sich zuweilen erfolgreich mit Verwandten.

Bartaffe oder Wanderu ( Macacus Silenus)
Zu den abweichenden Arten der Gruppe zählt einer der schönsten aller Affen, der Bartaffe oder Wanderu ( Macacus silenus). Ihn kennzeichnet der gedrungene Bau, ein reicher Vollbart, der das ganze Gesicht umschließt, und der mittellange, am Ende gequastete Schwanz. Der sehr reiche lange Pelz ist glänzend schwarz, unterseits lichtbräunlichgrau, der mähnenartig verlängerte Vollbart dagegen weiß. Erwachsen erreicht er eine Länge von 1 Meter und darüber, wovon der Schwanz 25 bis 36 Zentimeter wegnimmt.
Die Bartaffen werden von den Malabaren geschätzt. Die Fürsten dieses Volkes achten sie sehr hoch wegen ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer Klugheit. Sie lassen Junge aufziehen und zu allerlei Spielen abrichten, wobei dieselben sich zum Verwundern gut benehmen. »Der weißbärtige Affe«, sagt Heydt, »stellt einen alten Indier mit seinem Barte nicht übel vor. Er hält sich die meiste Zeit in den Wäldern auf und verursacht wenig Schaden.«
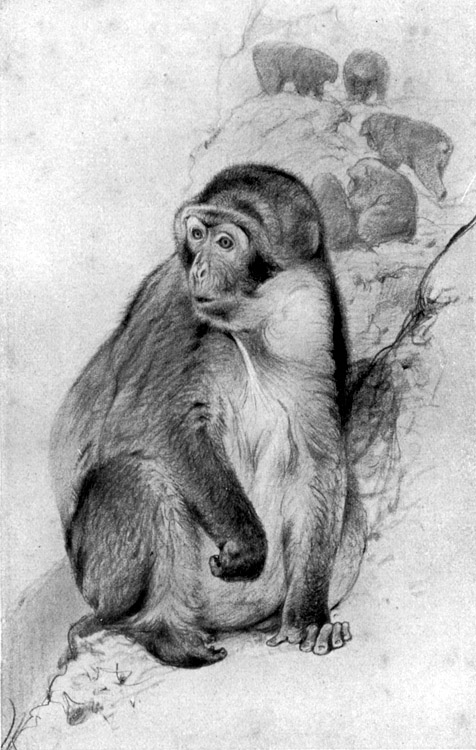
Magot ( Inuus ecaudatus)
In gewisser Hinsicht der wichtigste aller Makaken ist der Magot ( Inuus ecaudatus). Sein hervorstechendstes Merkmal ist seine Schwanzlosigkeit. Ihn kennzeichnet außerdem der schmächtige Leibesbau und die Schlankheit seiner hohen Glieder, ein ziemlich reicher, auf der Unterseite des Leibes spärlicherer Pelz und der dichte Backenbart. Das runzlige Gesicht, Ohren, Hände und Füße sehen fleischfarbig, die Schwielen blaßrot aus; der Pelz ist rötlich olivenfarbig. Die Unterseite und die Innenseite der Gliedmaßen hat lichtere, mehr graugelbliche oder weißliche Färbung. Bei etwa 75 Zentimeter Leibeslänge erreicht der Magot eine Schulterhöhe von 45 bis 50 Zentimeter.
Die Heimat des Magot ist das nordwestliche Afrika, Marokko, Algier und Tunis. Soviel wir wissen, lebt er in seinem Vaterlande in großen Gesellschaften unter Leitung alter, erfahrener Männchen. Er ist sehr klug, listig und verschlagen, gewandt, behend und kräftig und weiß sich im Notfall mit seinem vortrefflichen Gebiß ausgezeichnet zu verteidigen. Bei jeder leidenschaftlichen Erregung verzerrt er das Gesicht in einem Grade, wie kein anderer Affe, bewegt dabei die Lippen schnell nach allen Richtungen hin und klappert auch wohl mit den Zähnen. Nur wenn er sich fürchtet, stößt er ein heftiges, kurzes Geschrei aus. Wenn er zornig ist, bewegt er seine in Falten gelegte Stirn heftig auf und ab, streckt die Schnauze vor und zwängt die Lippen so zusammen, daß der Mund eine kleine zirkelrunde Öffnung bildet. In der Freiheit lebt er in Gebirgsgegenden, aus felsigen Wänden, ist aber auch auf Bäumen zu Hause. Man sagt, daß er, wie die Paviane, viele Kerbtiere und Würmer fresse, deshalb beständig die Steine umwälze und sie gelegentlich die Berge herabrolle. An steilen Gehängen soll er hierdurch nicht selten gefährlich werden. Skorpione sind, wie behauptet wird, seine Lieblingsnahrung; er weiß ihren giftigen Stachel geschickt auszurupfen und verspeist sie dann mit großer Gier. Aber auch mit kleinen Kerbtieren und Würmern begnügt er sich, und je kleiner seine Beute sein mag, um so eifriger zeigt er sich in der Jagd, um so begieriger verzehrt er den gemachten Fang. Das erhaschte Kerbtier wird sorgfältig aufgenommen, vor die Augen gehalten, mit einer beifälligen Fratze begrüßt und nun sofort gefressen.
Der Magot ist der einzige Affe, der noch heutigen Tages wild in Europa gefunden wird. Leider konnte ich während meines Aufenthalts in Südspanien (1856) über die Affenherde, die die Felsen von Gibraltar bewohnt, nichts Genaues und Ausführliches erfahren. Man erzählte mir, daß jene Gesellschaft noch immer ziemlich zahlreich sei, aber nicht eben häufig gesehen werde. Von der Festung aus beobachtete man die Tiere oft mit Fernrohren, wenn sie, ihrer Nahrung nachgehend, die Steine umwälzen und den Berg herabrollen. In die Gärten kämen sie selten. Auch die Spanier wissen nichts darüber anzugeben, ob die Tiere von allem Anfang an Europäer waren, oder solches erst durch ihre Verpflanzung aus Afrika herüber wurden.
*
Die Gruppe der Paviane ( Cynocephalus) ist zwar eine der merkwürdigsten, nicht aber auch eine der anziehendsten und angenehmsten. Wir finden in ihr vielmehr die häßlichsten, rüdesten, flegelhaftesten und deshalb widerwärtigsten Mitglieder der ganzen Ordnung; wir sehen in ihnen den Affen gleichsam auf der tiefsten Stufe, die er einnehmen kann. Jede edlere Form ist hier verwischt und jede edlere Geistesfähigkeit in der Unbändigkeit der scheußlichsten Leidenschaften untergegangen.
Wir nennen die Paviane mit Aristoteles »Hundsköpfe«, weil ihr Kopfbau dem eines groben, rohen Hundes ähnelt. In Wahrheit ist die Ähnlichkeit zwischen beiden Tierköpfen nur eine oberflächliche und zugleich unbefriedigende; denn der Hundekopf des Pavian ist ebensogut eine Verzerrung seines Vorbildes wie der Kopf des Gorilla eine solche des Menschenhauptes ist. Allein den andern Affen gegenüber ist eben das Schnauzenartige des Paviangesichts ein hervorstechendes Merkmal: und deshalb können wir auch dem alten Aristoteles seine Ehre lassen.
Die Hundsköpfe sind neben den Menschenaffen die größten Glieder ihrer Ordnung. Ihr Körperbau ist gedrungen, ihre Muskelkraft ungeheuer. Der schwere Kopf verlängert sich in eine starke und lange, vorn abgestutzte, oft wulstige oder gefurchte Schnauze mit vorstehender Nase; das Gebiß erscheint raubtierähnlich wegen seiner fürchterlichen Reißzähne, die auf ihrer hintern Seite scharfe Kanten haben; die Lippen sind sehr beweglich, die Ohren klein, die Augen hoch überwölbt und in ihrem Ausdruck das treueste Spiegelbild des ganzen Affen selbst – listig und tückisch ohnegleichen. Alle Gliedmaßen sind kurz und stark, die Hände fünfzehig; der Schwanz ist bald kurz, bald lang, bald glatthaarig, bald gequastet; die Gesäßschwielen erreichen wahrhaft abschreckende Größe und haben gewöhnlich lebhafte Färbung. Die lange und lockere Behaarung verlängert sich bei einigen Arten am Kopfe, Hals und an den Schultern zu einer reichen Mähne, und hat gewöhnlich unbestimmte Erd- oder Felsenfarben, wie Grau, Graugrünlichgelb, Bräunlichgrün usw.
Der Verbreitungskreis der Hundsköpfe erstreckt sich über Afrika und die hart an diesen Erdteil grenzenden Länder Asiens, namentlich das glückliche Arabien, Jemen, Hadramaut und Indien. Afrika muß unbedingt als derjenige Erdteil angesehen werden, der ihnen die wahre Heimat bietet. Verschiedene Gegenden besitzen ihre eigentümlichen Arten. Die Paviane sind echte Felsenaffen und bewohnen Hochgebirge oder wenigstens höhere Gebirgsgegenden. In Wäldern trifft man sie nicht: sie meiden die Bäume und ersteigen sie nur selten, etwa im Falle der Not. Im Gebirge gehen sie bis zu drei- und viertausend Meter über die Meereshöhe, ja selbst bis zur Schneegrenze hinauf; doch scheinen sie niedere Gegenden zwischen ein- bis zweitausend Meter den Hochgebirgen vorzuziehen. Auch die meisten Reisenden, die uns über jene Gegenden berichten, stimmen darin überein, daß die Paviane Gebirgstiere sind.
Diesem Aufenthaltsorte der Paviane entspricht ihre Nahrung. Sie besteht hauptsächlich aus Zwiebeln, Knollengewächsen, Gräsern, Kraut, Pflanzenfrüchten, die auf der Erde oder wenigstens nur in geringer Höhe über derselben wachsen oder von den Bäumen abgefallen sind, Kerbtiere, Spinnen, Schnecken, Vogeleiern usw. Eine Pflanze Afrikas, die diese Affen besonders lieben, hat gerade deshalb ihren Namen »Babuina« nach einer Art unserer Sippe erhalten. In den Anpflanzungen, zumal in den Weinbergen, richten sie den allergrößten Schaden an; ja man behauptet, daß sie ihre Raubzüge förmlich geordnet und überlegt unternähmen. Sie sollen oft noch eine gute Menge Früchte wegnehmen und auf die höchsten Gipfel der Berge schleppen, um dort für ungünstige Zeiten Vorräte anzusammeln. Daß sie Schildwachen aufstellen, ist sicher; ebenso, daß alle Hundsköpfe als eine wahre Landplage betrachtet werden müssen, weil sie den Landleuten ihrer Heimat außerordentlichen Schaden zufügen.
Mehr als alle übrigen Affen zeigen die Paviane durch ihre Haltung, daß sie echte Erdtiere sind. Ihre ganze Gestaltung bindet sie an den Boden und erlaubt ihnen bloß ein leichtes Ersteigen von Felswänden, nicht aber auch ein schnelles Erklettern von Bäumen. Man sieht sie stets auf allen Vieren gehen und nur dann auf zwei Beine sich stellen, wenn sie Umschau halten wollen. Sie ähneln in ihrem Gange plumpen Hunden mehr als Affen, und nehmen selten die bezeichnende Stellung der letzteren an. Auch wenn sie sich aufrichten, stützen sie ihren Leib gern auf eine ihrer Hände. Solange sie sich ruhig verhalten und Zeit haben, sind ihre Schritte langsam und schwerfällig; sobald sie sich verfolgt sehen, fallen sie in einen merkwürdigen Galopp, der die allersonderbarsten Bewegungen mit sich bringt. Ihr Gang zeichnet sich durch eine gewisse leichtfertige Unverschämtheit aus; man muß ihn aber gesehen haben, wenn man ihn sich vorstellen will. Das ist ein Wackeln der ganzen Gestalt, namentlich des Hinterteils, wie man es kaum bei einem andern Tiere sieht; und dabei tragen die Tiere den Schwanz so herausfordernd gebogen und schauen so unverschämt aus ihren kleinen, glänzenden Augen heraus, daß schon ihre Erscheinung ihrer Anmaßung Ausdruck gibt. Ihre geistigen Eigenschaften widersprechen ihrer äußeren Erscheinung nicht im geringsten.
Der Geist der Paviane ist gleichsam der Affengeist in seiner Vollendung, aber mehr im schlechten als im guten Sinn. Einige vortreffliche Eigenschaften können wir ihnen nicht absprechen. Sie haben eine außerordentliche Liebe zueinander und gegen ihre Kinder; sie lieben auch den Menschen, der sie pflegt und auferzogen hat, werden ihm selbst nützlich auf mancherlei Weise. Aber all diese guten Seiten können nicht in Betracht kommen ihren Unsitten und Leidenschaften gegenüber. List und Tücke sind Gemeingut aller Hundsköpfe, und namentlich zeichnet eine furchtbare Wut sie aus. Ihr Zorn gleicht einem ausbrechenden Strohfeuer, so rasch lodert er auf; aber er hält aus und ist nicht so leicht wieder zu verbannen. Ein einziges Wort, spottendes Gelächter, ja ein schiefer Blick kann einen Pavian rasend machen, und in der Wut vergißt er alles, selbst den, den er früher liebkoste. Deshalb bleiben diese Tiere unter allen Umständen gefährlich, und ihr roher Sinn bricht durch, auch wenn sie ihn lange Zeit gar nicht zeigten. Ihren Feinden gegenüber machen sie sich wahrhaft furchtbar.
Die Paviane leben sehr unbehelligt in ihrer Heimat; denn die Raubtiere und der Mensch fürchten sie und gehen ihnen aus dem Wege, wo nur immer möglich. Sie fliehen zwar vor dem Menschen, lassen sich aber doch, wenn es nottut, mit ihm wie mit Raubtieren in Kampf ein, und dieser wird, weil sie regelmäßig gemeinschaftlich angreifen, oft äußerst gefährlich. Der Leopard scheint der Hauptfeind zu sein; doch stellt er mehr den Jungen nach als den Alten, weil er alle Ursache hat, sich zu bedenken, ob seine Fangzähne und Klauen dem Gebiß und den Händen der Paviane gewachsen sind. Eine Herde greift er nicht an. Dies tut selbst der Löwe nicht, wie mir und andern Reisenden von den Eingeborenen versichert worden ist. Die Jagdhunde der Kapbewohner lassen jede andere Fährte, sowie sie von der eines Affen Witterung bekommen. Der Kampf zwischen beiden Tieren soll, wie Augenzeugen versichern, ein furchtbarer sein; die Pflanzer am Kap fürchten für ihre Hunde weit mehr, wenn diese einen Pavian verfolgen, als wenn sie sich zum Kampfe mit dem Leopard rüsten. Auch die Menschen können eben nicht mehr tun, als diese Affen dann und wann aus ihren Pflanzungen zu vertreiben. Eine wirkliche Jagd würde, wenn sie nicht gefährlich sein sollte, bedeutende Mannschaften erfordern und auch dann schwerlich zu einem Ausrottungskriege werden können. Nur Kriechtiere und Lurche sind es, die die Paviane in wirkliche Furcht und Schrecken versetzen. Die kleinste Schlange bringt unter einer Herde ein namenloses Entsetzen hervor. Kein Pavian hebt einen Stein aus oder durchsucht einen Busch, ohne sich vorher zu vergewissern, daß unter und in ihm keine Schlange verborgen ist. Skorpione fürchten die klugen Tiere nicht, wissen dieselben vielmehr mit großer Gewandtheit zu fangen und sie ihrer Giftstachel zu berauben, ohne sich zu verletzen. Dann verspeisen sie den Skorpion mit demselben Vergnügen wie andere Spinnen oder ein Kerbtier.
In ihrer sinnlichen Liebe sind die Paviane wahrhaft scheußlich. Die Männchen sind nicht bloß lüstern auf die Weibchen ihrer Art, sondern auf alle größeren Säugetiere weiblichen Geschlechts überhaupt. Daß sie Männer und Frauen sofort unterscheiden, habe ich hundertfach beobachtet, und ebenso, daß sie den Frauen durch ihre Zudringlichkeit und Unverschämtheit im höchsten Grade lästig werden können, Die Männchen sind beständig brünstig, die Weibchen nur zu gewissen Zeiten, alle dreißig bis fünfunddreißig Tage etwa. Die Brunst zeigt sich auch äußerlich in häßlicher Weise: die Geschlechtsteile schwellen bedeutend an und erhalten eine glühendrote Farbe; man meint, daß das Gesäß in bedenklicher Weise erkrankt sei. Nach meinen Beobachtungen währt die Brunstzeit der Paviane, soweit äußerlich ersichtlich, vierzehn bis zwanzig Tage. Sie beginnt mit einem merklichen Anschwellen der Geschlechtsteile, das sich im Verlaufe der Zeit fast über das ganze Gesäß erstreckt und die Schwielen blasig auftreibt. Diese röten sich gleichzeitig, als ob sie entzündet wären, und das ganze Gesäß erhält dadurch ein wahrhaft abschreckendes Aussehen. Nach etwa acht Tagen verkleinern sich die Blasen, schrumpfen mehr und mehr zusammen und verschwinden gegen Ende der angegebenen Zeit vollständig.
Der Nutzen der Paviane ist gering. Ihrer Gelehrsamkeit wegen werden sie zu allerlei Kunststücken abgerichtet. Am Kap sollen sie noch zum Aufsuchen des Wassers in der Wüste dienen. Man hält sie deshalb häufig gezähmt und nimmt sie mit in jene wasserarmen Striche, in denen selbst die Buschmänner das wichtigste Element nur tropfenweise zu gewinnen wissen. Wenn der Wasservorrat zu Ende geht, bekommt der Pavian etwas Salziges zu fressen. Nach einigen Stunden nimmt man ihn dann an eine Leine und läßt ihn laufen. Das vom Durst gequälte Tier wendet sich bald rechts, bald links, bald vor-, bald rückwärts, schnüffelt in der Luft, reißt Pflanzen aus, um sie zu prüfen, und zeigt endlich durch Graben das verborgene oder durch ein entschiedenes Vorwärtseilen das zutage getretene Wasser an.

Schopfpavian ( Cynocephalus niger)
Der erste Gegenstand unserer Betrachtung mag ein Affe sein, der von vielen Naturforschern unter die Paviane, von andern dagegen unter die Makaken gezählt wird. Der Mohren- oder Schopfpavian ( Cynocephalus niger) unterscheidet sich von andern Hundsköpfen durch seinen Stummelschwanz und die Bildung der Schnauze, die breit, flach, kurz und besonders noch dadurch ausgezeichnet ist, daß die Nase nicht wie bei den Pavianen die Oberlippe überragt, sondern ziemlich weit hinten auf der Oberschnauze endigt. In der Größe steht der Schopfpavian hinter allen Verwandten zurück. Seine Leibeslänge beträgt 65 Zentimeter, die Länge des Schwanzstummels kaum 3 Zentimeter.
Unter den mantellosen Pavianen ist mir der Babuin (Papio cynocephalus) am besten bekannt geworden, wenn auch nur in seinem Gefangenleben. Der glatte, gleichmäßige, nirgends verlängerte Pelz ist oben olivengrünlichgelb, jedes Haar abwechselnd schwärzlich und gelb geringelt, unterseits lichter, auf den Backen weißlichgelb. Gesicht und Ohren haben schwärzlich bleigraue, die oberen Augenlider weißliche, die Hände braungraue, die Augen hellbraune Färbung. Erwachsene Männchen erreichen bei 65 bis 70 Zentimeter Schulterhöhe eine Gesamtlänge von 1,50 Meter, wovon der verhältnismäßig dünne Schwanz allerdings ein Drittel wegnimmt. Der Babuin lebt so ziemlich in der Heimat des Hamadryas, dringt aber weiter in das Innere Afrikas vor als dieser. Abessinien, Kordosan und andere mittelafrikanische Länder beherbergen ihn, und wo er vorkommt, ist er häufig.
Hartmann hat mir über das Freileben unseres Affen nur folgende Mitteilung geben können: »Aus dem Djebel-Guli lebt der Babuin in ziemlicher Anzahl; er findet daselbst Knollen von Liliengewächsen, Früchte von wilden Feigen, Tamarinden, Beeren des Cissus- und in benachbarten Ebenen auch solche des Khetamstrauches usw., und lebt äußerst gemütlich in den Tag hinein, falls nicht einmal ein Leopard in seine Berge kommt, ihn aufstört und, wenn es möglich ist, einen oder den andern auffrißt. Die Eingeborenen bekümmern sich im ganzen wenig um ihn, obschon sie gelegentlich ein Junges fangen und aufziehen. In einer Hinsicht aber scheinen diese Paviane den Fungis doch lästig zu werden, wenn jene nämlich Wasser holen wollen. Die Paviane steigen von den Bergen, aus denen einige dünne Wasserfäden abwärts rieseln, zur Ebene herab und trinken hier aus den kleinen Quellteichen und Regenwasserpfützen. Nun versichern die Fungis allen Ernstes, daß ihre jungen Mädchen beim Wasserholen nicht selten von alten Babuinen angegriffen werden. Deshalb gehen, sobald man noch halbe Kinder auf die Wasserplätze sendet, stets einige mit Lanzen und Schleudereisen bewaffnete junge Männer zu deren Schutze mit.
Uns haben die reihenweise einer hinter dem andern über die steilen Granitplatten des schroffen Djebel-Guli ziehenden und unter den Bäumen des Gebirges spielenden Paviane stets das größte Vergnügen bereitet. Bei jedem Trupp sahen wir einige in ihrer Art riesenhafte alte Herren. Unsere Absicht, Jagd auf sie zu machen, konnten wir übrigens nicht ausführen, weil sie sich bei versuchter Näherung regelmäßig rechtzeitig zurückzogen.
In seinen Bewegungen und seiner Stellung gleicht der Babuin ganz den andern Pavianen; sein geistiges Wesen zeichnet ihn jedoch zu seinem Vorteile aus. Er ist ein sehr kluges Tier und gewöhnt sich, jung eingebracht, außerordentlich leicht an den Menschen, läßt sich zu allen möglichen Kunststücken ohne Mühe abrichten und hängt seinem Herrn, trotz schlechter Behandlung, mit großer Treue an. Das Weibchen ist sanfter und liebenswürdiger als das Männchen, das oft seine Tücken und Unarten auch seinem Herrn gegenüber zeigt, während das Weibchen mit diesem auf dem traulichsten Fuße lebt.
Der erste Babuin, den ich besaß, erhielt den Namen Perro. Er war ein hübscher, munterer Affe und hatte sich schon nach drei Tagen vollkommen an mich gewöhnt. Ich wies ihm das Amt eines Türhüters an, indem ich ihn über unserer Hoftür befestigte. Hier hatte er sich bald einen Lieblingsplatz ausgesucht und bewachte von dort aus die Tür auf das allersorgfältigste. Nur uns und ihm Bekannte durften eintreten, Unbekannten verwehrte er hartnäckig den Eingang und gebärdete sich dabei so toll, daß er stets gehalten werden mußte, bis der Betreffende eingetreten war, weil er sonst wie ein wütender Hund auf denselben losgefahren sein würde. Bei jeder Erregung zeigte er sich als Pavian vom Wirbel bis zur Sohle, mit allen Gewohnheiten und Sitten, Arten und Unarten seiner Sippschaft, deren Glieder in ihrem Gebaren überhaupt die größte Übereinstimmung bekunden. Im Zorne erhob er den Schwanz und stellte sich auf beide Füße und eine Hand; die andere benutzte er, um damit heftig auf den Boden zu schlagen, ganz wie ein wütender Mensch auf den Tisch schlägt, nur daß er nicht die Faust ballte wie dieser. Seine Augen glänzten und blitzten, er ließ ein gellendes Geschrei hören und rannte wütend auf seinen Gegner los. Nicht selten verstellte er sich mit vollendeter Hinterlist, nahm eine sehr freundliche Miene an, schmatzte mehrmals rasch hintereinander, was immer als Freundschaftsbeteuerung anzunehmen war, und langte sehnend mit den Händen nach dem, dem er etwas versetzen wollte. Gewährte ihm dieser seine Bitte, so fuhr er blitzschnell nach der Hand, riß seinen Feind an sich heran und kratzte und biß ihn. Er lebte mit allen Tieren in Freundschaft, mit Ausnahme der Strauße, die wir besaßen. Diese trugen jedoch die Schuld des feindlichen Verhältnisses, das zwischen beiden bestand. Perro saß, wenn seine Wächterdienste unnötig waren, gewöhnlich ruhig auf seiner Mauer und hielt sich gegen die sengenden Sonnenstrahlen eine Strohmatte als Schirm über den Kopf. Dabei vernachlässigte er es, auf seinen langen Schwanz besondere Rücksicht zu nehmen und ließ diesen an der Mauer herabhängen. Die Strauße nun haben die Unart, nach allem möglichen, was nicht niet- und nagelfest ist, zu schnappen. Und so geschah es denn sehr oft, daß einer oder der andere dieser Vögel schaukelnd herankam, mit seinem dummen Kamelkopfe sich dem Schwänze näherte und, ohne daß Perro es ahnte, Plötzlich demselben einen tüchtigen Biß versetzte. Die Strohmatte wegwerfen, laut schreien, den Strauß mit beiden Händen am Kopfe fassen und tüchtig abschütteln, war dann gewöhnlich eins. Es kam oft vor, daß der Affe nachher eine ganze Viertelstunde lang seine Gemütserschütterung nicht bemeistern konnte. Nun war es freilich kein Wunder, daß er dem Strauße, wo er ihn nur immer erreichen konnte, einen Hieb oder Kniff versetzte.
Während unserer Rückreise nach Ägypten wurde Perro, der mit allem Schiffsvolke gute Freundschaft hielt, am Bord der Barke angebunden. Er fürchtete das Wasser in hohem Grade, war aber doch gescheit genug, sich, wenn er durstete, demselben so zu nähern, daß er keine Gefahr zu besorgen brauchte. Zuerst probierte er seinen festen Strick, dann ließ er sich an diesem bis nah über den Wasserspiegel hinab, streckte seine Füße in den Strom, näßte sie an und leckte sie ab, auf diese Weise seinen Durst stillend.
Gegen junge Tiere zeigte er warme Zuneigung. Als wir in Alexandrien einzogen, hatten wir ihn auf den Wagen gebunden, der unsere Kisten trug; sein Strick war aber so lang, daß er ihm die nötige Freiheit gewährte. Beim Eintreten in die Stadt erblickte Perro neben der Straße das Lager einer Hündin, die vor kurzer Zeit geworfen hatte und vier allerliebste Junge ruhig säugte. Vom Wagen abspringen und der Alten ein säugendes Junges wegreißen, war die Tat weniger Augenblicke; nicht so schnell gelang es ihm, seinen Sitz wieder zu erreichen. Die Hundemutter, aufs äußerste erzürnt über die Frechheit des Affen, fuhr wütend auf diesen los, und Perro mußte seine ganze Kraft zusammennehmen, um dem andringenden Hunde zu widerstehen. Sein Kampf war nicht leicht; denn der Wagen bewegte sich stetig weiter, und ihm blieb keine Zeit übrig, hinaufzuklettern, weil ihn sonst die Hündin gepackt haben würde. So klammerte er nun den jungen Hund zwischen den oberen Arm und die Brust, zog mit demselben Arme den Strick an sich, weil dieser ihn würgte, lief auf den Hinterbeinen und verteidigte sich mit der größten Tapferkeit gegen seine Angreiferin. Sein mutiger Kampf gewann ihm die Bewunderung der Araber in so hohem Grade, daß keiner derselben ihm sein geraubtes Pflegekind abnahm; sie jagten schließlich lieber die Hündin weg. Unbehelligt brachte er den jungen Hund mit sich in unsere Behausung, hätschelte, pflegte und wartete ihm sorgfältig, sprang mit dem armen Tiere, das gar keinen Gefallen an solchen Tänzerkünsten zu haben schien, auf Mauern und Balken, ließ es dort in der gefährlichsten Lage los und erlaubte sich andere Übergriffe, die wohl an einem jungen Affen, nicht aber an einem Hunde gerechtfertigt sein mochten. Seine Freundschaft zu dem Kleinen war groß; dies hinderte ihn jedoch nicht, alles Futter, das wir dem jungen Hunde brachten, selbst an dessen Stelle zu fressen und das arme hungrige Pflegekind auch noch sorgfältig mit dem Arme wegzuhalten, während er, der räuberische Vormund, das unschuldige Mündel beeinträchtigte. Ich ließ ihm noch an demselben Abend das Junge abnehmen und es zu seiner rechtmäßigen Mutter zurückbringen. Der Verlust ärgerte ihn dergestalt, daß er mehrere Tage sehr mürrisch war und verschiedene lose Streiche verübte. Während meines zweiten Aufenthaltes in Ostsudan hatte ich viele Paviane derselben Art zu gleicher Zeit in meinem Gehöfte. Sie gehörten teils mir, teils einem meiner Freunde an. Jeder Pavian kannte seinen Herrn genau und ebensogut den ihm verliehenen Namen. Es war eine Kleinigkeit, einem frischgekauften Affen beides kennen zu lehren. Wir brachten das Tier in das Innere unserer Wohnung und sorgten durch aufgestellte Wachen dafür, daß es den Raum nicht verlassen konnte. Dann nahm einer von uns die Peitsche und bedrohte den betreffenden Affen, der andere gebärdete sich in ausdrucksvoller Weise als Schutzherr des Verfolgten. Nur selten wurde es wirklich nötig, einen Pavian zu schlagen; er begriff schon die Drohung und den ihm in Aussicht gestellten Schutz und erwies sich stets dankbar für die ihm in so schwerer Bedrängnis gewordene Hilfe. Ebenso leicht wurde es, einem Hundskopfaffen begreiflich zu machen, daß er mit dem oder jenem Namen getauft worden sei. Wir riefen den Namen und prügelten alle diejenigen, die falsch antworteten. Hierin bestand das ganze Kunststück. Es war keineswegs nötig, harte Züchtigungen zu verhängen. Die Drohung, zu schlagen, bewirkte oft mehr als die Schläge selbst und versetzte jeden Pavian stets in die größte Aufregung.
Alle unsere Paviane teilten mit den Eingeborenen die Leidenschaft für die Merisa, eine Art Bier, das die Sudanesen aus den Körnern der Durrah oder des Dohhen zu bereiten wissen. Sie berauschten sich oft in diesem Getränk. Rotwein tranken die Affen auch, Branntwein dagegen verschmähten sie stets. Einmal gossen wir ihnen ein Gläschen davon mit Gewalt in das Maul. Die Folge zeigte sich bald, zumal unsere Tiere vorher schon hinreichend oft die Merisa gekostet hatten. Sie wurden vollständig betrunken und schnitten die allerfürchterlichsten Gesichter, wurden übermütig, leidenschaftlich, tierisch, kurz, gaben mir ein abschreckendes Zerrbild eines rohen, betrunkenen Menschen. Am andern Morgen stellte sich der Katzenjammer mit allen seinen Schrecken ein. Die von dieser unheimlichen Plage befallenen Paviane machten jetzt Gesichter, die wahrhaft erbarmungswürdig aussahen. Man merkte es ihnen an, daß ein heftiger Kopfschmerz sie peinige; sie hielten sich auch wohl wie Menschen unter solchen Umständen mit beiden Händen das beschwerte Haupt und ließen von Zeit zu Zeit die verständlichsten Klagen hören. Wie der Katzenjammer ihnen mitspielte, zeigten sie dadurch, daß sie nicht nur das ihnen gebrachte Futter, sondern auch die ihnen dargebrachte Merisa verschmähten und sich von Wein, den sie sonst sehr liebten, mit Abscheu wegwandten. Dagegen erquickten sie kleine saftige Zitronen außerordentlich; sie gebärdeten sich auch hierin wieder vollkommen menschlich, und würden unzweifelhaft dem Heringe die gebührende Ehre angetan haben, hätten wir ihnen denselben nur reichen können.
Mit den andern Tieren, die ich lebendig hielt, vertrugen sie sich sehr gut. Eine zahme Löwin, von der ich weiter unten berichten werde, ängstigte zwar die Meerkatzen auf das höchste, nicht aber die mutigen Hundsköpfe. Sie flohen Wohl auch, wenn sich das gefürchtete Tier nahte, hielten ihm aber tapfer stand, sowie die Löwin einen Versuch machte, einen Pavian wirklich anzugreifen. Dasselbe habe ich später stets beobachtet. Meine zahmen Paviane flohen z. B. vor Jagdhunden, die ich auf sie hetzte, trieben dieselben jedoch augenblicklich in die Flucht, wenn einer der Hunde es wirklich gewagt hatte, sie am Felle zu packen. Der flüchtende Affe sprang dann unter furchtbarem Gebrülle blitzschnell herum, hing sich mit unglaublicher Gewandtheit an dem Hund an und maulschellierte, biß und kratzte ihn derartig, daß der Gegner in höchster Verblüffung und gewöhnlich heulend das Weite suchen mußte. Um so lächerlicher war ihre jedes Maß übersteigende Furcht vor Kriechtieren und Lurchen aller Art. Eine unschuldige Eidechse, ein harmloser Frosch brachten sie geradezu in Verzweiflung! Sie rasten förmlich, suchten die Höhe zu gewinnen und klammerten sich krampfhaft an Balken und Mauern fest, so weit es ihr Strick zuließ. Gleichwohl war ihre Neugierde so groß, daß sie nie umhin konnten, sich die ihnen entsetzlichen Tiere in der Nähe zu betrachten. Ich brachte ihnen unter andern mehrmals giftige Schlangen in Blechschachteln mit. Sie wußten aus Erfahrung, was für gefährliche Wesen diese Schachteln beherbergten, konnten aber doch nicht widerstehen, die geschlossenen Gefängnisse der Schlangen aufzumachen und weideten sich dann gleichsam an ihrem eigenen Entsetzen. In dieser Furcht vor Kriechtieren sind meiner Erfahrung nach alle Affen gleich.
Einer dieser Paviane verendete auf sehr traurige Weise. Mein Diener wollte ihn im Nil baden und warf ihn vom Bord unseres Schiffes aus in den Strom. Der Affe war an einem langen Stricke befestigt, dessen Ende August in der Hand behielt. Unglücklicherweise aber entfiel ihm dieser, der Affe versank, ohne auch nur einen Versuch im Schwimmen zu machen und ertrank.
Ein anderes Mitglied der Gesellschaft brachte ich mit mir nach Deutschland und in meine Heimat. Es zeichnete sich durch auffallenden Verstand aus, verübte aber auch viele lose und tolle Streiche. Atile, so hieß mein Pavian, machte sich ein Vergnügen daraus, unsern Hund auf jede Weise zu ärgern. Wenn er draußen im Hofe seinen Mittagsschlummer hielt und sich in der bequemsten Weise auf den grünen Rasen hingestreckt hatte, erschien die neckische Äffin leise neben ihm, sah mit Befriedigung, daß er fest schlafe, ergriff ihn sacht am Schwanz und erweckte ihn durch einen plötzlichen Riß an diesem geachteten Anhängsel aus seinen Träumen. Wütend fuhr der Hund auf und stürzte sich bellend und knurrend auf die Äffin. Diese nahm die herausfordernde Stellung an, schlug mit der Hand wiederholt auf den Boden und erwartete getrost ihren erbitterten Feind. Der erreichte sie zu seinem grenzenlosen Ärger niemals. Sowie er nämlich nach ihr biß, sprang sie mit einem Satze über den Hund hinweg und hatte ihn im nächsten Augenblicke wieder beim Schwanze. Daß der Hund durch solche Beleidigung zuletzt geradezu rasend wurde und wirklich vor Wut schäumte, fand ich erklärlich. Es half ihm aber nichts: schließlich räumte er stets mit eingezogenem Schwänze das Feld.
Atile liebte Pflegekinder aller Art. Hassan, die bereits erwähnte Meerkatze, war ihr Liebling und genoß ihre Zuneigung in sehr hohem Grade – solange es sich nicht um das Fressen handelte. Daß der gutmütige Hassan sozusagen jeden Bissen mit ihr teilte, schien sie ganz selbstverständlich und keines Dankes würdig zu finden. Sie verlangte von ihm sklavische Unterwürfigkeit; sie brach ihm, wie schon bemerkt, augenblicklich das Maul auf und leerte die gefüllten Vorratskammern Hassans ohne Umstände aus, wenn dieser den kühnen Gedanken gehabt hatte, auch für sich etwas in Sicherheit zu bringen, übrigens genügte ihrem großen Herzen ein Pflegekind noch nicht; ihre Liebe verlangte umfassendere Beschäftigung. Sie stahl junge Hunde und Katzen, wo sie immer konnte, und trug sie oft lange mit sich umher. Eine junge Katze, die sie gekratzt hatte, wußte sie unschädlich zu machen, indem sie mit großer Verwunderung die Klauen des Tieres untersuchte und die ihr bedenklich erscheinenden Nägel dann ohne weiteres abbiß. Die menschliche Gesellschaft liebte sie sehr, zog aber Männer ganz entschieden Frauen vor und neckte und ärgerte letztere in jeder Weise. Auf Männer wurde sie bloß dann böse, wenn diese ihr etwas zuleide getan hatten, oder wenn sie glaubte, daß ich sie auf die Leute hetzen wolle. In diesem Punkte war sie ganz wie ein abgerichteter Hund. Man durfte ihr bloß ein Wort sagen oder jemand zeigen: sie fuhr dann sicher wütend auf den Betreffenden los und biß ihn oft empfindlich. Empfangene Beleidigungen vergaß sie wochenlang nicht und rächte sich, sobald sich ihr Gelegenheit bot.
Ihr Scharfsinn war außerordentlich groß. Sie stahl meisterhaft, machte Türen auf und zu und besaß eine bedeutende Fertigkeit, Knoten zu lösen, wenn sie glaubte, dadurch etwas zu erreichen. Schachteln und Kisten öffnete sie ebenfalls und plünderte sie dann immer rein aus. Wir pflegten sie manchmal zu erschrecken, indem wir ein Häufchen Pulver vor sie auf den Boden schütteten und dieses dann mit Feuerschwamm anzündeten. Sie schrie gewöhnlich laut auf, wenn das Pulver aufblitzte, und machte einen Satz, so weit ihr Strick es zuließ. Doch ließ sie sich derartige Schrecken nur einigemal gutwillig gefallen. Später war sie pfiffig genug, den brennenden Schwamm mit ihren Händen zu ersticken und so die Entzündung des Pulvers zu verhüten! Dann fraß sie dasselbe regelmäßig auf, wahrscheinlich des salpeterigen Geschmackes wegen.
Während des Winters bewohnte sie gewöhnlich den warmen Ziegenstall, trieb aber hier häufig Unfug, indem sie Türen aushob und so die Ziegen und Schweine befreite, Bretter abdeckte und andere unerlaubte Streiche ausführte. Das eingemischte Kleienfutter, das die Ziegen erhielten, fraß sie leidenschaftlich gern und fing deshalb oft Streit mit den rechtmäßigen Eigentümern an. Hierbei benahm sie sich äußerst geschickt: sie faßte nämlich mit der einen Hand den Eimer oder Kübel, mit der andern packte sie die Ziege an den Hörnern oder an dem um dieselbe gewundenen Stricke und hielt sie, während sie selber trank, so weit als möglich von sich ab. Wenn eine Ziege sie stieß, schrie sie laut auf und hing dann gewöhnlich im nächsten Augenblicke an dem Halse ihrer Gegnerin, um sie zu bestrafen. Sie verzehrte alles Genießbare, namentlich gern Kartoffeln, die auch ihre Hauptspeise bildeten. Gewürzhafte Sämereien, zumal Kümmel, waren eine Leckerei für sie. Den Tabak und noch mehr den Tabakrauch liebte sie, wie alle Affen, in hohem Grade, und sperrte, wenn ich ihr denselben in das Gesicht blies, das Maul weit auf, um davon soviel als möglich einzuschlürfen.
Ihre Zuneigung zu mir überstieg alle Grenzen. Ich konnte tun, was ich immer wollte: ihre Liebe gegen mich blieb sich gleich. Wie es schien, betrachtete sie mich in allen Fällen als vollkommen unschuldig an allen Übeln, die ihr widerfuhren. Wenn ich sie züchtigen mußte, wurde sie niemals auf mich wütend, sondern stets auf diejenigen, die zufällig anwesend waren, wahrscheinlich, weil sie glaubte, daß diese die Schuld an ihrer Bestrafung trügen. Mich zog sie unter allen Umständen ihren sämtlichen Bekannten vor: sie wurde, wenn ich mich nahte, augenblicklich eine Gegnerin von denen, die sie eben noch geliebkost hatte.
Freundliche Worte schmeichelten ihr, Gelächter empörte sie, zumal wenn sie merkte, daß es ihr galt. Sie antwortete jedesmal, wenn wir sie riefen, und kam auch zu mir heran, wenn ich es wünschte. Ich konnte weite Spaziergänge mit ihr machen, ohne sie an die Leine zu nehmen. Sie folgte mir wie ein Hund, wenn auch nur in weiten Bogen, die sie nach eigenem Ermessen ausführte, und Hassan lief wiederum ihr treulich noch.
Als Hassan starb, war sie sehr unglücklich und stieß von Zeit zu Zeit ein bellendes Geschrei aus, auch in der Nacht, die sie sonst regelmäßig verschlafen hatte. Wir mußten fürchten, daß sie den Verlust ihres Gefährten nicht überleben würde und verkauften sie deshalb an den Besitzer einer Tierschaubude, bei dem sie andere Gesellschaft fand.

Paviane (Atbara-Pavian und Hamadryas)
Der Babuin wird im Sudan oft gefangen, auf dem Nile herunter nach Ägypten und von dort nach Europa gebracht, muß jedoch auch von anderer Seite hierher gelangen, weil man ihn ziemlich häufig in Gefangenschaft sieht. In Ägypten dient er Gauklern ziemlich zu denselben Zwecken wie der Hamadryas, den wir demnächst kennenlernen werden. In Europa ist er ein ständiger Bewohner der Affenhäuser in den Tiergärten.
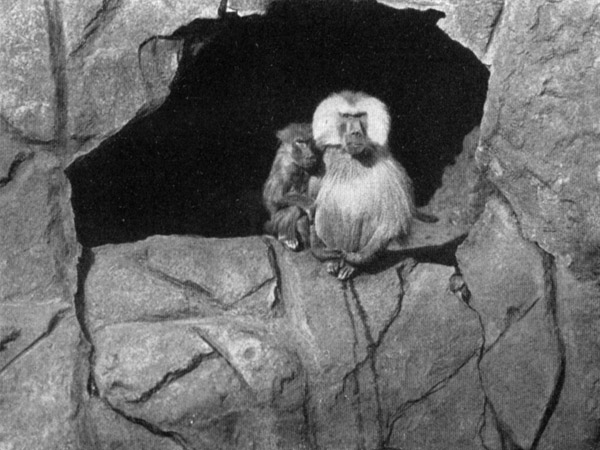
Hamadryas ( Cynocephalus hamadryas)
Der bereits mehrfach erwähnte Pavian, der ebensowohl seiner Gestalt wie seines ausgezeichneten Verstandes und vielleicht auch seiner unliebenswürdigen Eigenschaften halber in der Urgeschichte der Menschheit eine große Rolle spielt, ist der Hamadryas oder Mantelpavian ( Cynocephalus Hamadryas). Wie er zu der Ehre gekommen ist, den Namen einer altgriechischen Baumnymphe zu tragen, weiß ich nicht; in seiner Gestalt und in seinem Wesen liegt wahrhaftig nichts Weibliches. Die alten Völker waren es nicht, die ihm jenen Namen verliehen. Herodot, Plutarch und Plinius bezeichnen ihn mit Cynocephalus, Strabo nennt ihn Cebus, Juvenal Cercopithecus, Agatharchides Sphinx. Bei den heutigen Abessiniern heißt er Hebe, bei den Arabern Robah und in Ägypten endlich Khird. Unter all diesen Namen ist nicht ein einziger, der an irgendwelche Nymphe erinnert; man müßte denn » Sphinx« als solchen betrachten wollen.
Bei den alten Ägyptern genoß der Hamadryas große Verehrung. Eine Folge davon läßt sich noch jetzt nachweisen; denn alle Bewohner der Steppenländer des inneren Afrika und auch ein großer Teil der Abessinier tragen ihre Haare genau in derselben Weise gekämmt und gescheitelt wie der Hamadryas, und er ist somit unverkennbar zum Vorbilde für jene Leute geworden, mögen diese auch mehr die Bildsäulen als das lebende Tier im Auge gehabt haben. Heutigen Tages genießt der Hamadryas in jenen Ländern keine Verehrung mehr. Seine Schädlichkeit ist zu groß, als daß er sich die Freundschaft der Menschen erwerben sollte. Gegenwärtig findet sich das Tier in Ägypten nirgends mehr wild.
Alvarez, der gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts in Abessinien war, berichtet, daß er die Mantelpaviane in ungeheuren Herden gesehen habe, und gibt eine sehr richtige Beschreibung von ihrem Wesen und Treiben. »Sie lassen«, sagt er, »keinen Stein liegen; wenn ihrer zwei oder drei einen nicht umwenden können, so stellen sich so viele daran, als Platz haben, drehen ihn dennoch um und suchen ihre Lieblingsnahrung hervor. Auch Ameisen fressen sie gern und legen, um diese zu fangen, ihre Hände umgekehrt auf die Haufen, und sobald eine Hand mit Ameisen bedeckt ist, bringen sie dieselbe rasch zum Munde. Wenn man sie nicht abwehrt, verheeren sie die Felder und Gärten. Ohne Kundschafter gehen sie zwar nicht in die Pflanzungen; aber wenn diese ihnen das Zeichen zur Sicherheit gegeben, dringt die ganze Bande in den Garten oder das umhegte Feld und läßt nichts übrig. Anfangs sind sie ganz still und ruhig, und wenn ein unkluges Junges einen Laut hören läßt, bekommt es eine Ohrfeige; sobald sie jedoch die Furcht verlieren, zeigen sie durch gellendes Geschrei ihre Freude über ihre glücklichen Überfälle. Sie würden sich in entsetzlicher Weise vermehren, wenn nicht der Leopard so viele ihrer Jungen zerrisse und fräße, obgleich die Alten diese mutig zu verteidigen suchen.« Ich meinesteils traf den Mantelpavian auf meiner ersten Reise nach Afrika im Freileben nirgends an, um so häufiger aber auf meinem leider nur zu kurzen Ausfluge nach Abessinien im Frühjahr 1862, und kann also aus eigener Erfahrung über ihn reden.
Der Hamadryas bewohnt das ganze Küstengebirge Abessiniens und Südnubiens, nach Norden hin, soweit die Regen herabreichen, in ziemlicher Anzahl. Je pflanzenreicher die Gebirge, um so angenehmer scheinen sie ihnen zu sein. Wasser in der Nähe ist unerläßliche Bedingung für das Wohlbefinden einer Herde. Von den höheren Bergen herab wandern die Gesellschaften zuweilen auf die niederen Hügelreihen der Samchara oder des Wüstenstreifens an der Meeresküste herab; die Hauptmasse bleibt aber immer im Hochgebirge. Hier bewohnt jede Herde ein Gebiet von vielleicht anderthalb oder zwei Meilen im Durchmesser. Man begegnet kleineren Gesellschaften viel seltener als größeren. Ich sah ein einzigesmal eine Schar von fünfzehn bis zwanzig Stück, sonst aber immer Herden, die der geringsten Schätzung nach ihrer hundertundfünfzig zählen mochten. Darunter befinden sich dann etwa zehn bis fünfzehn vollkommen erwachsene Männchen – wahrhafte Ungeheuer von bedeutender Größe und einem Gebiß, das das des Leoparden an Stärke und Länge der Zähne bei weitem übertrifft, – und etwa doppelt so viele erwachsene Weibchen. Der Rest besteht aus Jungen und Halberwachsenen. Die alten Männchen zeichnen sich durch ihre gewaltige Größe und den langen Mantel aus – bei einem von mir erlegten mittelalten Männchen messen die Mantelhaare 27 Zentimeter; – die Weibchen sind kürzer behaart und dunkler, d. h. olivenbraun von Farbe; die Jungen ähneln der Mutter. Jedes einzelne Haar ist abwechselnd grünlich braun und gelblich geringelt, wodurch eine sehr schwer zu beschreibende, dürr gewordenem Grase am meisten ähnelnde Gesamtfärbung des Pelzes entsteht. Die Kopfseiten und Hinterbeine sind immer lichter, meist aschgrau. Das Gesäß ist brennend rot, das nackte Gesicht schmutzig fleischfarben. Je älter die Männchen werden, um so mehr lichtet sich die Farbe ihres Mantels. Die Länge des ausgewachsenen Männchens beträgt 0,9 bis 1 Meter, wovon 20 bis 25 Zentimeter auf den Schwanz kommen, die Höhe am Widerrist 50 Zentimeter.
In den Frühstunden oder bei Regen findet man die ganze Bande an ihren Schlafplätzen, größeren und kleineren Höhlungen an unersteiglichen Felswänden und auf überdachten Felsgesimsen, möglichst nahe zusammengedrückt, die Jüngeren und Schwächeren dicht an den Leib ihrer Mütter und bezüglich auch ihrer Väter geschmiegt. Bei gutem Wetter verläßt die Herde jene Wände in den Vormittagsstunden und wandert nun langsam und gemächlich längs der Felswände dahin, hier und da eine Pflanze ausziehend, deren Wurzel hauptsächlich als Nahrungsmittel zu dienen scheint, und jeden nicht allzu großen Stein umwendend, um zu besonderen Leckerbissen, den unter den Steinen verborgenen Kerbtieren, Schnecken und Würmern zu gelangen. Sobald das Frühmahl eingenommen, steigen alle nach der Höhe des Bergkammes empor. Die Männchen setzen sich ernst und würdig auf große Steine, an deren einer Seite die körperlangen gequasteten Schwänze herabhängen, den Rücken immer dem Winde zugekehrt; die Weibchen beaufsichtigen ihre ohne Unterlaß spielenden und sich balgenden Jungen und treiben sich unter diesen umher. In den späten Nachmittagsstunden zieht die Gesellschaft zum nächsten Wasser, um dort zu trinken; dann geht sie nochmals auf Nahrung aus und wendet sich schließlich nach irgendeinem geeigneten Schlafplatze. Ist ein solcher besonders günstig, so darf man mit Sicherheit darauf rechnen, die Paviane gegen Abend da einziehen zu sehen, selbstverständlich solange man sie nicht durch wiederholte Verfolgungen gestört hat. Durrahfelder in der Nähe des Wohnplatzes gehören zu den ganz besonderen Annehmlichkeiten desselben und müssen sorgfältig gehütet werden, wenn man auf eine Ernte rechnen will; sonst erscheinen die frechen Räuber tagtäglich, verwüsten weit mehr als sie verzehren, und richten schließlich das ganze Feld vollständig zugrunde.
Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daß sie mehr oder weniger ausgedehnte Wanderungen unternehmen, in der Absicht, ein von ihnen ausgeplündertes Gebiet mit einem noch Nahrung versprechenden zu vertauschen; wenigstens versicherten mir die dortigen Eingeborenen, daß man sie keineswegs das ganze Jahr über an einer und derselben Stelle bemerke, sie vielmehr kämen und gingen, wie es ihnen eben beliebe. Wie alle Affen werden die Mantelpaviane durch ihr Fortpflanzungsgeschäft wenig in Anspruch genommen, mindestens nicht aufgehalten. Ich glaube nicht einmal, daß die meisten Geburten in eine bestimmte Jahreszeit fallen, schließe vielmehr aus Beobachtungen an Gefangenen, daß ihre Fortpflanzung und beziehentlich die Geburt ihrer Jungen in jedem Monate des Jahres erfolgen kann.
Von den vielen Weibchen, die ich gepflegt habe, gebar eines zu meiner Überraschung anfangs Oktober ein vollkommen ausgetragenes Junges. Der letzte Blutfluß hatte 4½ Monate früher stattgefunden: als Trächtigkeitsdauer ist dieser Zeitraum jedoch wohl kaum anzunehmen. Das Junge kam mit geschlossenen Augen zur Welt, hatte vollkommen ausgebildete Nägel und sehr feines Haar, von oben schwärzlicher, seitlich graulicher Färbung, während die Unter- und Innenseite nackt oder wenigstens fast nackt war, so daß man die einzelnen Haare kaum bemerken konnte. Die Hautfarbe dieser Stellen war hochziegelrot. Die Gesamtlänge des Tierchens betrug 38 Zentimeter, die Schwanzlänge allein 17 Zentimeter, die Fußlänge 5,5 Zentimeter, die Handlänge 4,5 Zentimeter.
Das Junge wurde in den Vormittagsstunden an einem sehr kalten Morgen geboren. Die Mutter zeigte sich außerordentlich zärtlich gegen ihren Sprossen, aber auch im höchsten Grade besorgt um ihn. Sie hielt das an ihre Brust gedrückte Kind mit beiden Armen fest und leckte es fortwährend an allen Teilen des Leibes. Näherte sich jemand, so schrie sie entsetzt auf, den gewöhnlichen Ausdruck der Angst »eck, eck, eck« ausstoßend, drehte sich auch gewöhnlich ab und kehrte dem Beobachter den Rücken zu. Die Nabelschnur, die anfangs noch ziemlich weit herabhing, hatte sie bereits zwei Stunden nach der Geburt, und zwar hart am Nabel abgebissen, ohne daß deshalb eine Blutung erfolgt wäre. Das Junge schien sehr schwach zu sein, regte sich wenig und gab nur leise, mehr tönende als schreiende Laute von sich. Bereits in den Nachmittagsstunden schien die Mutter zu merken, daß ihr Kind sterben werde; denn sie hatte es auf dem Boden des Käfigs abgelegt, ging auf und ab, oft an dem Kleinen vorüber und betrachtete es dabei mit anscheinend gleichgültigem Blicke; doch duldete sie nicht, daß jemand von uns es aufnahm, ergriff es vielmehr sofort, wenn einer Miene machte, es zu berühren, und legte es wieder an ihre Brust. Gegen Abend war das Junge bereits regungslos; am nächsten Morgen lag es verendet auf dem Boden des Käfigs. In der nächsten Zeit zeigte nun das Weibchen ein durchaus verändertes Wesen, litt entschieden, bekundete wenig Freßlust, saß viel auf einer und derselben Stelle, versteckte sich halb im Stroh, zitterte, als ob Frost es schüttelte, legte sich oft nieder und sah überhaupt höchst kläglich aus. Um andere Affen bekümmerte es sich nicht mehr. Es läßt sich kaum daran zweifeln, daß diese Krankheit hauptsächlich eine Folge der Gemütsbewegung über den Verlust des Jungen war. Es steht dies wenigstens vollständig im Einklange mit den Beobachtungen, die ich an andern Affen gemacht habe.
Wenn die Mantelpaviane stillsitzen, schweigt die ganze Gesellschaft, so lange sich nichts Ausfälliges zeigt. Ein etwa herankommender Menschenzug oder eine Viehherde entlockt einem oder dem andern ganz sonderbare Laute, die am besten mit dem Gebell mancher Hunde verglichen werden können und wahrscheinlich nichts anderes bezwecken, als die Aufmerksamkeit der Gesamtheit zu erregen. Bei gefahrdrohender Annäherung eines Menschen oder eines Raubtiers aber werden die allerverschiedensten Töne laut. Die ganze Gesellschaft brüllt, brummt, bellt, schreit, grunzt und quiekt durcheinander. Alle kampffähigen Männchen rücken auf der Felskante vor und schauen aufmerksam in das Tal hinab, um die Gefahr abzuschätzen: die Jungen suchen Schutz bei den Älteren; die Kleinen hängen sich an die Brust der Mütter und klettern auch wohl auf deren Rücken, und nunmehr setzt sich der ganze Zug in Bewegung und eilt auf allen Vieren laufend und hüpfend dahin.
Vor den Eingeborenen fürchtet sich der Hamadryas so gut wie nicht. Er zieht, unbekümmert um die braunen Leute, dicht vor ihnen hin und trinkt aus demselben Bache mit ihnen. Ein Weißer erregt jedoch schon mancherlei Bedenken, obwohl man nicht gerade behaupten kann, daß die Affen vor ihm scheu entfliehen. Mehr noch als andere Familienverwandte zeigen unsere Paviane jene bedächtige Ruhe, die niemals um einen Ausweg verlegen ist, die Gefahr mag noch so nah sein. Anders verhält sich die Sache, wenn die Herde Hunde oder gar Leoparden gewahrt. Dann erheben die alten Männchen ein furchtbares Gebrüll und Gebrumm, schlagen erzürnt mit der einen Hand auf den Felsen, fletschen die Zähne und schauen funkelnden Auges auf jene Störenfriede hinab, augenscheinlich bereit, gemeinsam über sie herzufallen.
Die erste Gesellschaft, der ich begegnete, ruhte eben von ihrer Frühwanderung aus. Sie saß auf der Kante eines nach beiden Seiten hin ziemlich steil abfallenden Grates. Ich hatte schon von weitem die hohen Gestalten der Männchen gesehen, dieselben aber für auf dem Kamme liegende Felsblöcke gehalten; denn mit solchen haben die Affen, so lange sie ruhig sind, die größte Ähnlichkeit. Erst ein wiederholtes einlautiges Bellen, ungefähr dem hoch ausgestoßenen Laute » Kuck« vergleichbar, belehrte mich. Aller Köpfe richteten sich nach uns hernieder; nur die Jungen spielten noch unbesorgt weiter, und einige Weibchen gaben ihr Lieblingsgeschäft nicht auf, sondern durchsuchten noch eifrig den Pelz eines alten Herrn nach Ungeziefer. Wahrscheinlich würde die ganze Gesellschaft in beobachtender Haltung geblieben sein, hätten wir nicht zwei muntere und tatenlustige Hunde mit uns geführt, schöne, schlanke Windspiele, gewohnt, die Hyäne von den Wohnungen abzutreiben, erprobt selbst im Kampfe gegen den Wolf jener Länder. Sie antworteten mit Gebell auf besagte Laute, und sofort entstand ein allgemeiner Aufstand unter der Herde. Es mochte den Affen daran zu liegen scheinen, einen noch sichereren Aufenthaltsort zu suchen. Sie zogen deshalb bis auf die letzten Posten längs des Kammes dahin und verschwanden unsern Blicken. Doch sahen wir zu unserer Überraschung bei der nächsten Biegung des Tals die ganze Herde, diesmal an einer senkrecht erscheinenden, sehr hohen Felswand, wo sie in langer Reihe, in einer mir heute noch unbegreiflichen Weise gleichsam an den Felsen klebten. Die Jagdlust wurde allzu mächtig. Leider war die Wand so hoch, daß an ein sicheres Schießen nicht zu denken war. Wir gedachten also die Gesellschaft wenigstens aufzustören. Der Knall des ersten Schusses brachte eine unbeschreibliche Wirkung hervor. Ein rasendes Brüllen, Heulen, Brummen, Bellen und Kreischen antwortete; dann setzte sich die ganze Kette in Bewegung und wogte an der Felswand dahin mit einer Sicherheit, als ob die Gesellschaft auf ebenem Boden sich fortbewege, obgleich wir nicht absehen konnten, wie es nur möglich war, festen Fuß zu fassen. Ein schmales Gesims schien von den Affen als höchst bequemer Weg betrachtet zu werden. Wir feuerten etwa sechs Schüsse ab; aber es war uns unmöglich, sicher zu zielen, auch schon weil der Anblick so viel Überraschendes hatte, daß uns alle Ruhe verlorenging. Immerhin aber waren unsere Kugeln noch gut genug gerichtet, um die Aufregung der Affen bis zum Entsetzen zu steigern, überaus komisch sah es aus, wie die ganze Herde nach einem Schusse urplötzlich sich an einem Felsen anklammerte, als fürchte sie, durch die bloße Erschütterung zur Tiefe herabgestürzt zu werden. Wie es schien, entkamen alle unversehrt unsern Geschossen. Allein der Schreck mochte ihnen doch wohl einen Streich gespielt haben; denn es wollte uns dünken, als hätten sie die ihnen sonst eigene Berechnung diesmal ganz außer acht gelassen. Beim Umbiegen um die nächste Wendung des Tals trafen wir die Gesellschaft nicht mehr in der Höhe, sondern in der Tiefe an, eben im Begriffe, das Tal zu überschreiten, um auf den gegenüberliegenden Höhen Schutz zu suchen. Ein guter Teil der Herde war bereits am jenseitigen Ufer angekommen, die Hauptmasse jedoch noch zurück. Unsere Hunde stutzten einen Augenblick, als sie das wogende Gewimmel erblickten; dann stürzten sie sich mit jauchzendem Bellen unter die Bande. Jetzt zeigte sich uns ein Schauspiel, wie man es nur selten zu schauen bekommt. Sobald die Hunde herbeieilten, warfen sich von allen Felsen die alten Männchen herab in das Tal, jenen entgegen, bildeten sofort einen Kreis um die Rüden, brüllten furchtbar, rissen die zähnestarrenden Mäuler weit auf, schlugen mit den Händen grimmig auf den Boden und sahen ihre Gegner mit so boshaften, wütend funkelnden Blicken an, daß die sonst so mutigen, kampflustigen Tiere entsetzt zurückprallten und ängstlich bei uns Schutz suchen wollten. Selbstverständlich hetzten wir sie von neuem zum Kampfe, und es gelang uns, ihren Eifer wieder anzufachen. Das Schauspiel hatte sich jedoch inzwischen verändert: die sich siegreich wähnenden Affen waren unterdes auf die erkorene Seite gezogen. Als die Hunde von frischem anstürmten, befanden sich nur wenige in der Tiefe des Tals, unter ihnen ein etwa halbjähriges Junges. Es kreischte laut auf, als es die Hunde erblickte, flüchtete eilends auf einen Felsblock und wurde hier kunstgerecht von unsern vortrefflichen Tieren gestellt. Wir schmeichelten uns schon, diesen Affen erbeuten zu können: allein es kam anders. Stolz und würdevoll, ohne sich im geringsten zu beeilen und ohne auf uns zu achten, erschien vom andern User herüber eines der stärksten Männchen, ging furchtlos den Hunden entgegen, blitzte ihnen stechende Blicke zu, die sie vollkommen in Achtung hielten, stieg langsam auf den Felsblock zu dem Jungen, schmeichelte diesem und trat mit ihm den Rückweg an, dicht an den Hunden vorüber, die so verblüfft waren, daß sie ihn mit seinem Schützlinge ruhig ziehen ließen. Diese mutige Tat des Stammvaters der Herde erfüllte uns ebenfalls mit Ehrfurcht, und keiner von uns dachte daran, ihn in seinem Wege zu stören, obgleich er sich uns nah genug zur Zielscheibe bot. Als ich mit dem Herzog von Koburg-Gotha durch das Tal von Mensa zog, machte uns einer der Abessinier auf einige Mantelpaviane aufmerksam, die auf ziemlich hohen Bäumen saßen. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil die Paviane, wie ich oben sagte, gewöhnlich nur im Notfall Bäume ersteigen.
Mir ist, seitdem ich die Tiere selbst in ihrer Freiheit sah, durchaus nicht mehr unwahrscheinlich, daß sie auf einen nicht mit dem Feuergewehr bewaffneten Menschen im Augenblicke der höchsten Gefahr mutig losgehen und ihn gemeinsam angreifen, wie die Araber und Abessinier oder übereinstimmend gute Beobachter, namentlich Rüppell und Schimper, erzählen. Wir selbst haben zwar keine Erfahrungen gesammelt, die jene Beobachtungen bestätigen könnten, wohl aber gesehen, daß die Hamadryaden selbst vor den Bewaffneten nur höchst langsam und mit sehr vielsagendem Zähnefletschen und Brüllen sich zurückziehen. Schimper versicherte mir, daß der Hamadryas ohne Umstände Menschen nicht nur angreife, sondern auch bewältige und töte; alte Männchen sollen sich sogar ungereizt, und zwar wiederholt über holzsammelnde Mädchen hergemacht und sie umgebracht haben, wenn sie sich widersetzten. Auch Rüppell gibt an, daß der scheußliche Affe unter die gefährlichsten Gegner des Menschen gerechnet werden muß.
In Ägypten und namentlich in Kairo sieht man oft Mantelpaviane im Besitze von Gauklern und Volksbelustigern. Wahrscheinlich werden noch heute genau dieselben Spiele dem Volke zur Schau gegeben, die schon Alpinus sah, wie ja auch heutigen Tages noch mit der Brillenschlange in derselben Weise gegaukelt wird, in der Moses vor Pharao gaukelte. Zumal an Festtagen findet man auf jedem größerem Platze der Hauptstadt einen Affenführer und Schlangenbeschwörer. Die Vorstellungen stehen unter der Mittelmäßigkeit oder vielmehr, sie sind pöbelhaft gemein. Der Schausteller hat die Gelehrigkeit des Pavians benutzt, um seine eigene Unsauberkeit im scheußlichsten Zerrbilde wiederzugeben, und die Naturanlage der Affen kommt seinem Herrn nur zu gut zustatten. Übrigens benutzten die ägyptischen Gaukler gewöhnlich Weibchen; denn die Männchen werden mit der Zeit zu bösartig und gefährlich. Sogar in Ägypten dürfen sie nicht ohne Beißkorb ausgeführt werden. Dieser hindert sie jedoch immer noch nicht, Unfug zu stiften. Ich ritt einst durch die Straßen Kairos und stieß dabei mit dem Fuße an einen auf der Straße sitzenden Hamadryas; mein Reitesel lief im schnellsten Galopp: Gleichwohl hatte der Pavian im nächsten Augenblicke mich am Beine gepackt und riß mir mit wenigen Griffen die Gamasche, den Strumpf und Schuh vom Fuße, mir zugleich als Zeichen seiner Gewandtheit und Freundlichkeit noch ein paar ziemlich tiefe Wunden hinterlassend.
Ich habe später vielfach Gelegenheit gehabt, gefangene Hamadryaden zu beobachten, und mehrere von ihnen, junge wie alte, auch längere Zeit selbst gepflegt. In der Jugend sind alle liebenswürdig, zutunlich, ihren Pflegern im höchsten Grade anhänglich, gegen andere Menschen freundlich, gegen andere Affen friedfertig! sie gleichen den in Gebärden und Wesen artigen Babuinen und erwerben sich eine allgemeine Zuneigung. Dies aber ändert sich, sobald sie halbwegs mannbar werden, und mit zunehmendem Alter treten die unliebenswürdigen Eigenschaften immer schärfer hervor. Niemals habe ich einen alten Mantelpavian gesehen, der nicht die verkörperte Wut und Bosheit gewesen wäre, und nur einen einzigen habe ich kennengelernt, der mit seinem Wärter auf wenigstens erträglichem Fuße stand. Die Peitsche vermag viel, aber nicht alles, und die Tücke dieses Affen bleibt unter allen Umständen zu fürchten. Einen Mantelpavian von einem Käfig in den andern zu bringen, ist ein schwieriges Unternehmen, weil er, gereizt, auch auf seinen Pfleger mit blinder Wut sich zustürzt und bei seiner Stärke ein keineswegs zu unterschätzender Gegner ist. Nur durch Erregung seiner Leidenschaft gelingt es, ihn in die gestellte Falle zu locken, und wenn er wirklich einmal wütend gemacht wurde, fällt er auch der plumpsten Vorkehrung zum Opfer. Falls ihn seine Neugier nicht lockt, treibt ihn seine Wut, seine Rachsucht dahin, wohin man ihn haben will. Im Zorne vergißt er alles, sich selbst sogar. Ein einziger Blick macht ihn wütend, Gelächter rasend, Strafe geradezu toll und unsinnig. Andere Affen lassen sich, wenn sie erkrankt oder verwundet sind, behandeln und verbinden; beim Mantelpavian ist dies gänzlich unausführbar. Ein Gefangener, den ich Pflegte, litt an einem unbedeutenden Ausschlag, der namentlich auf einem seiner Beine hervortrat; es war aber unmöglich, ihm zu helfen, weil es nach einem mißglückten Versuch niemand mehr wagen wollte, ihn mit dem Sacknetze einzufangen und festzuhalten. Der Ausschlag mochte ihm zuweilen ein heftiges Jucken bereiten; denn er zuckte oft mit dem einen Bein, und begann sodann heftig sich zu kratzen. Dies verursachte ihm endlich Schmerzen, und darüber wurde er allgemach so wütend, daß er das Bein mit beiden Händen Packte und wütend in dasselbe biß, als habe er es mit einem tödlich gehaßten Gegner zu tun. Diese Leidenschaftlichkeit zeigte sich auch im Umgange mit dem zarteren Geschlecht. Im Freileben hat der weibliche Hamadryas wenigstens Raum, um den stürmischen Liebesanträgen des Männchens auszuweichen; im Käfig dagegen muß es trotz seiner Willfährigkeit oft sehr viel leiden. Denn so heiß und glühend das Verlangen des Tieres ist: seine unsinnige Leidenschaft findet in der Erreichung des Erstrebten kein volles Genügen. Ohne Knüffe und Bisse geht es bei einer Paarung dieser Affen nie ab, und sehr oft entwindet sich das Weibchen nur blutend den stürmischen Umarmungen seines Gatten oder Überwältigers.
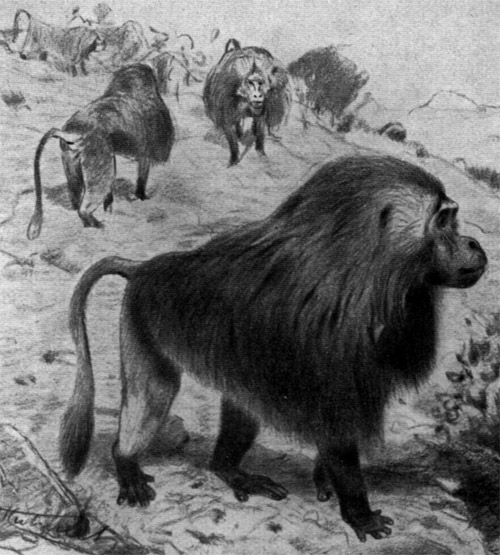
Dschelada ( Cynocephalus Gelada)
In unmittelbarer Nähe des Hamadryas wohnt ein zweiter Mantelpavian, der Dschelada der Abessinier ( Cynocephalus Gelada). Er ist der Riese seiner Familie und noch bedeutend größer als der Hamadryas; vom Hamadryas unterscheidet er sich auf den ersten Blick. Der sehr reiche Pelz, der sich auf Hinterhals, Nacken und Rücken mantelartig verlängert, ist schwarzbraun, insbesondere im Gesicht, Kinn und Kehle, der Mantel und die lange Schwanzquaste gelblichbraun, das Haar auf Kehle, Vorderhals, Brust, Bauchmitte und den Vorderarmen braunschwarz, das Gesicht schwarz. Die beiden nackten Stellen auf dem Vorderhalse und der Brust sind dreieckig, und da sie mit den Spitzen gegeneinander stehen, zusammen einer Sanduhr ähnlich: grau und weiß gesprenkelte Haare fassen sie ein. Im Gegensatz zum Hamadryas hat der Dschelada nur sehr kleine, vollständig von einander getrennte schwarzgraue Schwielen. Er bewohnt die höheren Berggipfel in Simién, dem eigentlichen Hochlande von Abessinien. Schimper sagte mir, daß man ihn gewöhnlich in einem Höhengürtel findet, der zwischen 3000 bis 4000 Meter über dem Meere liegt. Seine gewöhnliche Nahrung besteht aus verschiedenen Zwiebeln, die er ausgräbt, Orchideen, Liliaceen, aus Gräsern, Kräutern, Früchten aller Art, und selbstverständlich aus Kerbtieren, Würmern, Schnecken und dergleichen. Die Felder besucht er ebenfalls.

Mandril ( Mormon Maimon)
Mit demselben Rechte, mit dem wir den Guereza den schönsten aller Affen nennen können, dürfen wir den Mandril ( Mormon Maimon) als den häßlichsten bezeichnen. Alt ist er ein wahrhaft scheußliches Vieh in jeder Beziehung, und sein geistiges Wesen gleicht seinen leiblichen Eigenschaften vollständig. Der Leib ist sehr kräftig, beinahe etwas plump, der Kopf abscheulich, das Gebiß wahrhaft furchtbar, die Behaarung eigentümlich rauh und struppig, die Färbung der nackten Teile im höchsten Grade grell und abstoßend. Jedes einzelne Haar ist schwarz und olivengrün geringelt, wodurch der Pelz der oberen Seite eine dunkelbraune, olivengrün überflogene Färbung erhält; an der Brust sehen die Haare gelblich, am Bauche weißlich, an den Seiten hellbräunlich aus; der Kinnbart ist lebhaft zitronengelb; hinter dem Ohre befindet sich ein graulich weißer Flecken. Hände und Ohren sind schwarz, die Nase und ihre Umgebung zinnoberrot, die Wangenwülste kornblumenblau, die Furchen in ihnen schwarz, Hodensack und After hochrot, die Schwielen rot und blau. Alte Männchen erreichen eine Länge von 1 Meter und darüber bei etwa 60 Zentimeter Schulterhöhe, der Schwanzstummel dagegen mißt kaum mehr als 3 Zentimeter. Der verwandte Dril ( Mormon leucophaeus) ist etwas kleiner, sein Pelz oben olivenbraun, unten und an der Innenseite weißlich, der Backenbart fahlweißlich, das Gesicht schwarz; Hände und Füße sehen kupferbräunlich, die Schwielen und der Hodensack lebhaft rot aus. Die Länge des Erwachsenen beträgt etwa 85 bis 90 Zentimeter, die Schulterhöhe 55 bis 60, die Länge des Schwanzes 8 bis 9 Zentimeter.
Es ist auffallend genug, daß wir über das Freileben dieser beiden seit so vielen Jahren als Gefangene bekannten Affen nichts Sicheres wissen. Beide Arten stammen von der Küste von Guinea und werden namentlich von der Goldküste zu uns gebracht. Beide sollen truppweise in gebirgigen Wäldern, teils auf Felsen, teils auf Bäumen leben, ihren Aufenthalt aber nicht selten verlassen, um die naheliegenden Ansiedelungen zu besuchen und dort nach Herzenslust zu plündern. Man sagt auch, daß Rotten dieser Tiere in die Dörfer einfallen und in Abwesenheit der Männer Frauen und Kinder der Neger mißhandeln. Die Eingeborenen sollen den Mandril mehr fürchten als den Löwen, sich niemals in einen Kampf mit ihm einlassen, ja nicht einmal die Waldungen betreten, in denen der Affe sich aufhält, es sei denn, daß die Männer in großer Anzahl und mit guten Waffen versehen einen förmlichen Kreuzzug gegen ihre Feinde ausführen. Wieviel an diesen Gerüchten, die von einer Naturgeschichte in die andere übergehen, Wahres ist, läßt sich nicht entscheiden; als unwahrscheinlich haben wir meiner Ansicht nach sie nicht anzusehen. Auffallend ist nur, daß die Neger so viele von den gefürchteten Tieren einfangen und an die Schiffer vertauschen.
In früheren Zeiten gelangten Mandril und Dril viel öfter auf unseren Tiermarkt als gegenwärtig, obgleich sie auch jetzt noch keineswegs zu den Seltenheiten gehören. Insbesondere gilt dies von dem Mandril, der stets häufiger als der Dril zu uns gebracht wird. Den Alten waren beide unbekannt. »Dieses thier«, sagt der alte Geßner, »ist mit grossem Wunder gen Augsburg gebracht un gezeiget worden. An seinen füssen hat es finger als der Mensch, und so man ihm deütet, so keert er den arß dar. Apffel, Biren und allerley andere frücht isset dieß thier, auch brot: trinkt insonderheit gern weyn. So es hungrig ist, so ersteygt es die bäum, schütt die frücht abhär. Ist von natur fröudig vorauß gegen den weyberen, gegen welchen es sein fröudigkeit vil erzeiget. Das weyblein deß geschlächts gebirt alle zeyt zwey zumal ein par, nämlich ein männlein und ein weyblein.«
Ein junger Mandril ist ein allerliebstes Geschöpf, unter einer reichhaltigen Gesellschaft unserer Herren Vettern im Affenhause der ausgeprägteste Komiker, zu lustigen und tollen Streichen jeder Art aufgelegt, mit unverwüstlicher guter Laune begabt und ungeachtet seiner durch nichts zu erschütternden Unverschämtheit in keiner Weise widerwärtig. Die Eigentümlichkeit, die Geßner mit der Derbheit unserer Vorfahren kennzeichnet, zeigt allerdings auch schon der junge Mandril; sein Hinterteil dient ihm gleichsam zum Dolmetsch seiner Gefühle; doch geschehen hierauf bezügliche Bewegungen noch mit einer so ausgeprägten Harmlosigkeit, daß man über der Komik das Unanständige vergißt. Dies aber ändert sich nur zu bald, weit früher als bei anderen Pavianen, und schon nach wenig Jahren zeigt sich der Mandril in seiner ganzen Scheußlichkeit. Der Zorn anderer Affen ist, wie ein englischer Schriftsteller sich ausdrückt, »ein leises Fächeln des Windes, verglichen mit der Wut des Mandril, die einem jener entsetzlichen, alles vor sich niederwerfenden Stürme der Wendekreisländer gleicht«, und ebenso groß wie sein Jähzorn ist seine Unanständigkeit. Zur Schilderung der letzteren fehlen die Worte. »Sein Geschrei, sein Blick und seine Stimme«, sagt Cuvier, »kündigen eine vollkommen viehische Unverschämtheit an. Die schmutzigsten Gelüste befriedigt er in der schamlosesten Weise. Es scheint, als ob die Natur in ihm ein Bild des Lasters mit all seiner Häßlichkeit habe aufstellen wollen.« Alles Widerwärtige, das uns der Hamadryas und andere Paviane zeigen, erscheint dem Gebaren des Mandrils gegenüber als anständig. Seine Leidenschaftlichkeit kennt keine Grenzen. Erzürnt, gerät er in eine entsetzliche Aufregung, vergißt alles und stürzt sich gleichsam kopflos auf seinen Feind zu. Ein wahrhaft dämonischer Glanz strahlt aus den Augen des Scheusals, der mit dämonischer Kraft und Böswilligkeit begabt zu sein scheint. Jetzt hat er nur den einen Gedanken: den Gegner zu zerreißen, und jedes Hindernis aus dem Wege zu räumen. Weder die Peitsche noch die blanke Waffe wird von ihm im geringsten beachtet. Sein Angriff bekundet nicht mehr Kühnheit, sondern geradezu Verrücktheit. Kein Tier haben die Wärter mehr zu fürchten als einen wütenden Mandril. Doch gibt es Ausnahmen. Schon Jardine berichtet von einem Mandril, der erwachsen und sehr zahm war, gegen seinen Wärter sich folgsam zeigte, aber, wie alle übrigen, durch Fremde leicht in Wut gebracht werden konnte. »Dieser Mandril«, sagt unser Gewährsmann, »lernte unter anderem Branntwein trinken und Tabak rauchen. Ersteres tat er sehr gern, zu dem letzteren aber mußte er erst durch das Versprechen gebracht werden, Branntwein und Wasser zu erhalten. In seinem Käfige stand ein kleiner Armstuhl, auf den er sich, wenn es ihm befohlen wurde, würdig setzte und fernere Befehle erwartete. Alle seine Bewegungen wurden langsam und bedächtig gemacht. Hatte der Wärter die Tabakspfeife angezündet und sie ihm gereicht, so betrachtete er sie genau und befühlte sie auch wohl, bevor er sie ins Maul steckte, um sich dann zu überzeugen, daß sie auch wirklich brenne. Er steckte sie dann ins Maul, faßte bis an den Kopf, und hielt sie einige Minuten daran, ohne daß man Rauch sah. Denn während dieser Zeit füllte er seine Backentaschen und sein geräumiges Maul; dann aber blies er den Rauch in Massen aus dem Munde, der Nase und zuweilen selbst aus den Ohren. Gewöhnlich schloß er dieses Kunststück mit einem Trunk Branntwein und Wasser, der ihm in einem Becher gereicht wurde. Diesen nahm er ohne Umstände sogleich in die Hand.« Einer der berühmtesten Mandrils lebte in England unter sehr günstigen Verhältnissen. Er war wohlbekannt unter dem Namen » Hans im Glücke« und ziert noch heute nach seinem Tode das britische Museum. Das Tier hatte mehrmals die Ehre, infolge besonderer Einladungen ein Gast der königlichen Familie zu sein: kurz, es genoß, wie mein englischer Gewährsmann sagt, ein so glückliches Leben, als es nur immer einem Pavian zuteil werden kann.
Einen anderen, ebenfalls hochberühmten Mandril, habe ich erst in den letzten Tagen besucht. Ich meine den großen Künstler vom Affentheater des Herrn Broekmann. Gedachter Mandril befindet sich seit sechzehn Jahren im Besitze seines Herrn und ist gezähmt und abgerichtet, wie nur ein Affe es sein kann. Gegen Fremde zeigt er sich selbstverständlich ebenfalls erregbar und jähzornig; mit seinem Herrn aber steht er auf dem vertrautesten Fuße, und selbst wenn er, um seinem Jähzorne geeigneten Ausdruck zu verleihen, nach Pavianart die Stäbe seines Käfigs schüttelt, als wolle er sie zerbrechen, darf Broekmann ohne Bedenken ihn am Halsbande packen und aus seinem Käfige herausnehmen, auch sofort zur »Arbeit« verwenden.
Broekmann verkehrt mit seinem Mandril wie ein Freund mit dem anderen. Beide haben sich ineinander eingelebt; der eine versteht den anderen, und das erzogene Tier beugt sich vor seinem Erzieher. Von Strafe oder auch nur einer Androhung dazu ist bei diesem Mandril keine Rede mehr: ein Blick genügt, ein gutes Wort besänftigt, ein ernstes bringt den Affen zur Besinnung zurück, wenn sich wirklich einmal der alte Adam regt. Der Mandril »arbeitet« gern und im vollsten Bewußtsein seiner Würde; er weiß genau, ob er eine Leistung zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit seines Gebieters ausgeführt hat, und strebt danach, ersteres, so viel in seinen Kräften steht, zu tun. Willig kommt er aus seinem Käfige, ruhig setzt er sich auf seinen Ankleidestuhl, und behilflich nimmt er alle Stellungen an, die beim Ankleiden erforderlich werden. Mit entschiedenem Selbstbewußtsein tritt er als Schauspieler auf, und wie ein solcher ist er empfänglich für Lob und Tadel. Für ein gut geartetes Tier will alles dies wenig besagen, für einen Mandril ist es das Außerordentlichste, was die Erziehung leisten kann.