
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wenn man die reiche Abteilung unserer Klasse, die fast alle Naturforscher übereinstimmend begrenzen und mit den vorstehend angegebenen Namen bezeichnen, aufmerksam betrachtet, will sich die Ansicht aufdrängen, daß die verschiedenartigen Gestalten, die wir in der einen Ordnung vereinigen, gar nicht zusammengehören. Es gibt in dieser große und kleine, kräftig gebaute und schlanke, lang- und kurzschnäbelige, hochbeinige und niedriggestellte, stumpf- und spitzflügelige, dicht- und dünnbefiederte, bunt- und einfarbige Vögel, und es wird, diesen Gegensätzen entsprechend, eine Verschiedenartigkeit der Lebensweise, der Sitten und Gewohnheiten, des Nahrungserwerbes und der Nahrung selbst, des Fortpflanzungsgeschäftes und der Entwicklung, kurz aller Lebensäußerungen bemerklich wie in keiner andern gleichwertigen Abteilung der ganzen Klasse. Einige Naturforscher haben deshalb die oben ausgesprochene Ansicht betätigt und anstatt einer Ordnung deren zwei aufgestellt; im allgemeinen aber hält man an der Auffassung früherer Vogelkundiger noch fest und sieht die Stelzvögel als eine Gesamtheit an, die man nicht zersplittern darf.
Aus vorstehenden Worten geht zur Genüge hervor, daß eine allgemein gültige Kennzeichnung der Stelzvögel nicht gegeben werden kann. Ein langer, schwacher Hals und lange, dünne Beine, die auch über dem Fersen- oder Hakengelenk nackt und deren Füße drei- oder vierzehig sind, dürfen als Merkmale der Mehrzahl gelten, und ebenso kann man noch sagen, daß die Flugwerkzeuge nicht verkümmert, die Federn wie gewöhnlich gebildet sind. Der Schnabel ist so verschieden gestaltet, daß eine Beschreibung desselben an dieser Stelle nicht tunlich erscheinen kann; Flügel und Schwanz ändern ebenfalls vielfach ab, und auch das Kleingefieder zeigt durchaus keine Übereinstimmung.
Die Stelzvögel sind Weltbürger im eigentlichen Sinne des Wortes und leben allerorten, nicht bloß am Wasser und demgemäß mehr in der Tiefe, sondern hoch oben im Gebirge noch, dicht unter der Schneegrenze, am Fuße der Gletscher, nicht allein im oder am Sumpfe, welchen unterscheidenden Namen er auch haben möge, sondern ebenso in der sonnendurchglühten Wüste. Soweit das Meer nach Norden hinauf offen ist, ebensoweit dehnt sich ihr Wohn- oder Verbreitungskreis aus. Sie sind es, die im Verein mit den an das Wasser gebundenen Schwimmvögeln das Meer beleben, die das Gewimmel am Strande desselben hervorrufen; sie auch bilden diejenige Bewohnerschaft der Sümpfe und Flußufer, die unser Auge am ersten zu fesseln weiß.
Alle Stelzvögel, die in einem gemäßigten Gürtel brüten, ziehen oder wandern; selbst diejenigen Arten, die in gewissen Gegenden höchstens streichen, gehen in andern regelmäßig auf die Reise. Viele durchfliegen beträchtliche Strecken; andere lassen sich schon im gemäßigten Süden durch nahrungversprechende Örtlichkeiten zurückhalten. Diejenigen, die sich am Meer aufhalten, wandern die Küsten entlang und besuchen, weiter und weiter reisend, Länder, die gänzlich außerhalb ihres Verbreitungskreises zu liegen scheinen, siedeln sich hier möglicherweise auch bleibend an, brüten und bürgern sich ein. So findet man gewisse Strandläufer fast auf der ganzen Erde, mindestens in allen Gürteln derselben. Auch diejenigen, deren Heimat die Äquatorländer sind, werden von dem Drange, zu wandern, beeinflußt und streichen mindestens, aber in so regelmäßiger Weise, daß man ihr Wegziehen und Wiederkommen vielleicht auch ein Ziehen nennen kann.
*
Obenan stehen die Trappen ( Otididae), große oder mittelgroße, schwerleibige Vögel mit mittellangem, dickem Halse, ziemlich großem Kopfe, kräftigem, an der Wurzel niedergedrücktem, übrigens kegelförmigem, vor der Spitze des Oberkiefers etwas gewölbtem, ungefähr kopflangem Schnabel, mittelhohen, sehr starken Läufen und dreizehigen Füßen, wohl entwickelten, großen, sanft muldenförmigen Flügeln, aus zwanzig breiten Federn bestehendem Schwanze, wie endlich einem derben, geschlossenen, glatt anliegenden Gefieder, das sich am Kopf und Hals oft verlängert, mindestens durch lebhafte Färbung auszeichnet. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen stets durch bedeutendere Größe, gewöhnlich auch durch ein schöneres Kleid; die Jungen ähneln, nachdem sie das Daunenkleid angelegt haben, zunächst dem Weibchen. Eigentümlich ist ein großer, häutiger, unter der Zunge geöffneter Sack, der vorn, unmittelbar unter der Halshaut, vor der Luftröhre liegt und sich nur beim alten Männchen findet, während der Paarungszeit mit Luft gefüllt wird, sich sonst aber so zusammenzieht, daß selbst sorgfältig arbeitende Zergliederer ihn nicht aufzufinden vermochten.
Mit Ausnahme Amerikas leben in allen Erdteilen Trappen; besonders reich an ihnen sind Afrika und Asien. Eigentlich der Steppe angehörend, bewohnen sie bei uns zulande die großen, offenen Felder ebener Gegenden, treten aber nicht entfernt in derselben Menge auf wie in der Steppe. Eigentliche Waldungen meiden sie ängstlich; dünnbuschige Gegenden hingegen scheuen sie durchaus nicht. Gewöhnlich leben sie in kleinen Trupps oder mehreren Familien, die sich gesellten; nach der Brutzeit aber vereinigen sie sich oft zu Herden, die Hunderte zählen und, wie es scheint, wochenlang zusammenleben. Alle südländischen Arten dürfen als Standvögel angesehen werden, während diejenigen, die in dem gemäßigten Gürtel leben, entweder regelmäßige Wanderungen antreten oder doch unregelmäßig in einem weiten Gebiete hin und her streifen.
So plump und schwerfällig sie zu sein scheinen, so leicht bewegen sie sich. Ihr gewöhnlicher Gang ist ein gemessener Schritt, der jedoch zu ziemlicher Eilfertigkeit gesteigert werden kann; der Flug erscheint ungeschickter als er wirklich ist, denn die Trappen erheben sich nach einem kurzen Anlauf leicht wieder vom Boden, fördern sich bald in eine genügende Höhe und fliegen, wenn auch nicht gerade sehr schnell, so doch mit großer Ausdauer meilenweit in einem Zuge fort, übersetzen sogar das Meer oder unternehmen Reisen in fernliegende Länder. Die Stimme ist sehr verschieden. Einige Arten gehören zu den schweigsamsten aller Vögel und lassen nur ausnahmsweise sonderbare Laute vernehmen, die man am liebsten Geräusch nennen möchte, weil ihnen aller Klang und Ton fehlt; andere hingegen besitzen eine helle, weithin schallende Stimme und geben sie oft zum besten. Die Sinne dürfen als hochentwickelt bezeichnet werden. Alle Arten sind kluge Vögel, die vorsichtig jeden ihnen bedenklich erscheinenden Gegenstand beobachten und sich selten täuschen lassen. Neben dieser Vorsicht spricht sich in ihrem Wesen Erregbarkeit und Heftigkeit aus. Sie fliehen den Feind, den sie fürchten müssen, stellen sich aber, gezwungen, selbst dem Menschen kühn gegenüber oder bedrohen ihn, nachdem sie vertraut mit ihm wurden; sie leben mit ihresgleichen in ziemlichem Frieden, kämpfen aber erbittert, wenn Liebe oder Eifersucht ins Spiel kommen; sie nehmen auch einen Kampf mit andern Vögeln, die an Größe und Stärke ihnen gleichen, ohne Bedenken auf. Alte Hähne werden wirklich bösartig. An veränderte Verhältnisse gewöhnen sie sich schwer; doch fügen sie sich schließlich, scheinbar ohne Widerstreben, obwohl sie keine Gelegenheit vorübergehen lassen, ihr Mütchen an einer ihnen unangenehmen Persönlichkeit oder einem ihnen verhaßten Tier zu kühlen.
Ihre Lebensweise erinnert in vieler Hinsicht an die der Scharrvögel, aber ebenso auch an das Treiben der Regenpfeifer und Verwandten. Ungestört verweilen sie fast den ganzen Tag auf dem Boden, indem sie in den Morgenstunden äsen, schreien oder miteinander kämpfen, mittags, behaglich hingestreckt, sich sanden, gegen Abend von neuem nach Nahrung suchen und schließlich einen möglichst gesicherten Platz zur Nachtruhe erwählen. Sie erscheinen, wenigstens in gewissen Gegenden, zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Plätzen und fliegen tagtäglich nach andern zurück, oder aber durchlaufen, vielleicht mit derselben Regelmäßigkeit, gewisse Strecken. Ihre Nahrung wird zum großen Teil dem Pflanzenreich entnommen; die Küchlein hingegen äsen fast nur Kerbtiere und verkümmern sicherlich, wenn diese ihnen fehlen. Erst wenn sie ihr volles Gefieder erlangt haben und etwa halb ausgewachsen sind, gehen sie zur Pflanzennahrung über. Sie genießen Körner ebenso gern wie Blätter, Knospen und Knollenfrüchte, lieben es aber, die Blätter selbst zu Pflücken, lassen beispielsweise klar geschnittenen Kohl unberücksichtigt, wogegen sie dasselbe Futter, wenn ihnen davon ein ganzer Kopf gereicht wird, leidenschaftlich gern fressen. An Brot lassen sie sich leicht gewöhnen, und später sehen sie in ihm einen Leckerbissen.
Die Fortpflanzung fällt mit dem Spätfrühling der betreffenden Heimat zusammen. Alle größeren Vereinigungen, die während der Winterzeit gebildet wurden, haben sich jetzt gelöst und alle Männchen Weibchen gefunden. Die meisten Beobachtungen sprechen dafür, daß sie in Einehigkeit leben. Die Hähne zeigen sich, wenn die Paarungszeit herannaht, im höchsten Grade erregt, schreiten pomphaft mit dick aufgeblasenem Halse, gewölbten Flügeln und ausgebreitetem Schwanze einher, kämpfen wacker mit jedem Nebenbuhler, lassen, wenn sie schreilustig sind, ihre Stimme fast ununterbrochen vernehmen und machen dabei fortwährend der Henne nach ihrer Weise den Hof. Letztere scharrt sich nach erfolgter Begattung eine seichte Mulde im aufschießenden Getreide oder zwischen hohem Steppengrase aus, bekleidet sie dürftig und belegt sie dann mit ihren wenigen Eiern. Das Weibchen brütet allein und führt auch anfänglich die zierlich beflaumten, aber etwas täppischen Jungen ohne Hilfe des Gemahls; dieser stellt sich jedoch später wieder bei der Familie ein und dient ihr fortan als treuer Wächter. Das Wachstum der Jungen geht langsamer vonstatten als bei vielen andern Vögeln.
Trappen werden in allen Ländern mit einer gewissen Leidenschaft gejagt, weil ihre große Vorsicht die menschliche Überlegenheit herausfordert. Man wendet die verschiedensten Mittel an, um sich der achtsamen Geschöpfe zu bemächtigen, jagt aber trotzdem durchaus nicht immer mit Glück. Der Fang ist, wenigstens zu gewissen Zeiten, verhältnismäßig leicht; es hält aber schwer, Trappen einzugewöhnen. Alt gefangene verschmähen regelmäßig das Futter und trotzen und hungern sich zu Tode; jung erbeutete verlangen sorgfältige Pflege, wenn sie gedeihen und groß werden sollen. In Ungarn und in Rußland werden jetzt alljährlich viele Trappen aufgezogen, auch erhalten wir lebende aus Afrika, Asien und Australien.
*
Die Großtrappe ( Otis tarda) ist der größte europäische Landvogel. Seine Länge beträgt einen Meter und darüber, die Breite 2,2 bis 2,4 Meter, die Fittichlänge bis siebzig, die Schwanzlänge achtundzwanzig Zentimeter, das Gewicht fünfzehn bis sechzehn Kilogramm. Kopf, Oberbrust und ein Teil des Oberflügels sind hell aschgrau, die Federn des Rückens auf rostgelbem Grunde schwarz in die Quere gebändert, die des Nackens rostfarbig, die der Unterseite schmutzig- oder gelblichweiß, die Schwingen dunkelgraubraun, an der schmalen Außenfahne und am Ende schwarzbraun, ihre Schäfte gelblichweiß, die Unterarmfedern schwarz, weiß an der Wurzel, die letzten fast reinweiß, die Steuerfedern schön rostrot, weiß an der Spitze und vor ihr durch ein schwarzes Band geziert, die äußeren fast ganz weiß. Der Bart besteht aus etwa dreißig langen, zarten, schmalen, zerschlissenen, grauweißen Federn. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel schwärzlich, der Fuß graulich hornfarben. Das Weibchen unterscheidet sich durch merklich geringere Größe, aber auch durch sein minder lebhaftes Gefieder und das Fehlen des Bartes. Seine Länge beträgt höchstens siebzig, seine Breite einhundertachtzig Zentimeter.

Großtrappen ( Otis tarda)
Von Südschweden und dem mittleren Rußland an findet man Trappen in ganz Europa und Mittelasien, aber nur einzeln und wohl bloß während des Winters in Nordwestafrika. In Großbritannien ist die Trappe, obschon sie zuweilen noch als Besuchsvogel erscheint, bereits ausgerottet, in Frankreich sehr selten geworden, in Spanien nur in einigen Gegenden zu finden; in Ungarn, der Moldau und Walachei, in Rumelien und Thessalien, der südrussischen Steppe und in ganz Mittelasien dagegen tritt sie außerordentlich häufig auf; auch in Kleinasien, dem nördlichen Syrien, Palästina und ebenso in Marokko kommt sie vor. Gelegentlich ihrer Streifereien, die man eher ein Streichen als einen Zug nennen kann, berührt sie nicht nur die südlichen Länder, sondern auch solche, in denen man sie sonst nicht bemerkt, z. B. Holland und die Schweiz. In unserm Vaterlande bewohnt sie ständig noch alle geeigneten Stellen der norddeutschen Ebene und ebenso weite, waldlose Ackerflächen Mittel- und Süddeutschlands, insbesondere die Mark, Pommern, Posen, Schlesien, Anhalt, Sachsen, Braunschweig, Hannover, Thüringen, die unteren und oberen Rheinlande und Bayern, immer aber nur einzelne Gebiete, die ihren Lebensanforderungen entsprechen. Hier trifft man zuweilen noch Flüge an, die über hundert Stück zählen; aber sie kommen gar nicht in Vergleich mit den Scharen, die die ungarische Pußta und die russische Steppe beleben. Sie bevorzugt unter allen Umständen Gegenden, in denen Getreidebau getrieben wird; Radde fand sie gerade in denjenigen Teilen, die das Hochsteppengepräge Mittelasiens am deutlichsten zeigen, viel seltener als in der Udinskischen und Bargusinschen Steppe und im Selengatal, obgleich hier die Gegend hügelig oder bergig ist; aber freilich wird dort wie hier viel Getreide gebaut. In Griechenland ist sie in allen Ebenen Standvogel; in Spanien belebt sie die weiten, fruchtbaren Flächen beider Kastilien, der Mancha, Estremaduras und Niederandalusiens; auf den Inseln des Mittelmeers kommt sie immer nur einzeln vor. Bei uns zulande ist sie Standvogel, der zwar ein weites Gebiet bewohnt, dasselbe jedoch in der Regel nicht verläßt, in Rußland und Mittelasien dagegen Wander- oder doch Strichvogel. Waldige Gegenden meidet die Großtrappe stets, weil sie in jedem Busch einen Hinterhalt sieht. Ebensowenig naht sie sich bei uns zulande bewohnten Gebäuden. Jede Veränderung auf dem gewohnten Weideplatze, jedes Loch, das gegraben wird, fällt dem mißtrauischen Vogel auf und erscheint ihm höchst bedenklich, Regenwetter und Nässe im Getreide, die ihm sehr zuwider sind, veranlassen ihn, zuweilen auf Feldwegen und breiten Rainen zwischen Ackerstücken oder auf anstoßenden Brachäckern sich sehen zu lassen; aber sobald er Gefahr ahnt, schleicht er wieder zu den ihn deckenden Halmen zurück. Im Winter wählt er sich am liebsten solche Felder, die ihm Nahrung versprechen, insbesondere also die mit Winterraps oder mit Wintergetreide bestellten, und während dieser Jahreszeit ist er womöglich noch vorsichtiger als im Sommer, der ihm in dem hochaufgeschossenen Getreide gute Deckung gewährt. Nachtruhe hält er stets auf den entlegensten Feldern, meist auf Brach- oder Stoppeläckern, begibt sich auch erst in der Dämmerung nach solchen Plätzen und scheint hier abwechselnd Wachen auszustellen, die für die Sicherheit der übrigen zu sorgen haben. »Sowie der Morgen graut«, sagt Naumann, »werden sie schon wieder wach, erheben sich von ihrem Lager, strecken sich behaglich, schlagen wohl auch ihre Flügel einige Male, gehen langsam hin und her und fliegen nun zusammen, die ältesten und schwersten zuletzt, auf und stets vom Nachtlager entfernten Futterplätzen zu.«
Der Gang der Großtrappe ist langsam und gemessen, verleiht daher dem Vogel eine gewisse Würde; doch kann sie, wenn es not tut, so eilig dahinrennen, daß sie ein Hund nur mit Mühe einholt. Vor dem Auffliegen nimmt sie einen kurzen, aus zwei bis drei Sprüngen bestehenden Anlauf und erhebt sich nun, zwar nicht gerade schnell, aber doch nicht ohne sonderliche Anstrengung in die Luft, schwingt sich mit langsamen Flügelschlägen weiter und streicht, wenn sie erst eine gewisse Höhe erreicht hat, so rasch dahin, daß derjenige Jäger, der sie mit der Büchse erlegen will, seines Auges und seiner Waffe sehr sicher sein muß. Im Fluge streckt sie Hals und Beine gerade von sich, der schwere Rumpf senkt sich aber hinten etwas hernieder, und dies macht sie von weitem kenntlich. Wenn sich eine Gesellschaft von Großtrappen gleichzeitig erhebt, hält jedes Glied derselben einen gewissen Abstand von den übrigen ein, gleichsam als fürchte es, diese durch seine Flügelschläge zu beirren.
Der Stimmlaut, den man zu allen Zeiten von der Großtrappe vernimmt, läßt sich schwer durch Buchstaben ausdrücken; er ist ein sonderbares und leises Schnarren, das nur dann deutlich wird, wenn man sich in unmittelbarer Nähe des Vogels befindet. Von gefangenen habe ich nur diesen einen Laut oder richtiger dieses eine Geräusch vernommen; denn von einem Laut oder Ton ist, streng genommen, nicht zu reden. Wenn ich versuchen soll, diese Stimme auszudrücken, muß ich die Silbe »Psäärr« zu ihrer Bezeichnung wählen; es ist mir jedoch unmöglich, auch die Betonung derselben zu versinnlichen. Während der Paarungszeit vernahm Naumann, aber auch selten, einen tiefen und dumpfen Laut, den er eine Art Brausen nennt und dem »Huh, huh, huh« des zahmen Taubers ähnlich findet.
Daß unter den Sinneswerkzeugen der Großtrappe das Auge am meisten entwickelt ist, lehrt dessen Beobachtung. Ihrem Scharfblick entgeht so leicht nichts. »Schon in weiter Ferne«, sagt Naumann, »beobachtet sie die vermeintlichen Gefahren, besonders die ihr verdächtige einzelne Person, und wenn diese glaubt, sie sei von der Trappe, die sie zu beschleichen gedenkt, noch fern genug, als daß sie schon von ihr bemerkt worden sein könnte, so irrt sie gewöhnlich, namentlich wenn sie hofft, einen zwischen ihr und der Trappe gelegenen Hügel oder Graben zu erreichen, um durch jenen gedeckt oder in diesem verborgen sich ihr schußmäßig zu nähern; denn in demselben Augenblick, in dem sie sich ihrem Blick entzogen zu haben glaubt, ergreift jene auch schon die Flucht.« Fest steht ferner, daß sie auch sehr scharf hören.
Die Großtrappe nährt sich, wenn sie erwachsen, vorzugsweise von grünen Pflanzenteilen, Körnern und Sämereien, in frühester Jugend beinahe ausschließlich von Kerbtieren. Sie frißt von allen unsern Feldfrüchten, vielleicht mit Ausnahme der Kartoffeln, die sie gewöhnlich liegen läßt, am liebsten, wie es scheint, Kraut und Kohl; aber sie weidet auch oft, im Notfall sogar die Spitzen des gewöhnlichen Grases ab. Im Winter nährt sie sich hauptsächlich von Raps und Getreide; im Sommer fängt sie neben der Pflanzennahrung stets einige Kerbtiere, ohne jedoch eigentlich auf sie zu jagen, stellt auch Feldmäusen eifrig nach, dürfte überhaupt jedes kleinere Tier verspeisen, das ihr in den Wurf kommt. Alle Nahrung nimmt sie mit dem Schnabel auf, und höchstens im Winter läßt sie sich herbei, verdecktes Futter durch Scharren mit den Füßen bloßzulegen. Kleine Quarzkörner werden zur Beförderung der Verdauung regelmäßig mit verschluckt. Ihren Durst stillt sie mit den Tautropfen, die morgens am Grase hängen.
Schon im Februar bemerkt man, laut Naumann, im Betragen der freilebenden Trappen eine wesentliche Veränderung. »Der regelmäßige Besuch der bekannten Weideplätze, ihr bestimmter Zug nach und von denselben und ihr gemütliches Beisammensein hört jetzt auf. Eine gewisse Unruhe hat sich ihrer bemächtigt und treibt sie zu einem ungeregelten Umherschweifen von diesen zu jenen Weideplätzen zu allen Tageszeiten an. Die Hähne fangen an, sich um die Hennen zu streiten, sich zu verfolgen, diese sich zu zerstreuen. Die Vereine werden loser, ohne sich noch ganz aufzulösen. Bei solchem Umhertreiben streichen sie dann nicht selten, sich vergessend, oft durch Gegenden, über Bäume und Dörfer, ja über die lebhaftesten Orte so niedrig hinweg, wie es sonst nie geschieht. Mit stolzem Anstand, aufgeblasen wie ein Puterhahn, den fächerförmig ausgebreiteten Schwanz aufgerichtet, schreiten die Hähne neben den Hennen einher, fliegen selten weit weg und nehmen nach dem Niederlassen jene Stellung sogleich wieder ein.« Der oft erwähnte, viel geleugnete Kehlsack kommt jetzt zu seiner Bedeutung und wird so weit aufgeblasen, daß der Hals des Trappenhahnes mehr als noch einmal so dick erscheint wie sonst. Anfänglich schreitet der liebebegeisterte Vogel nur mit etwas gesenkten Flügeln und schief erhobenem, dachförmig getragenem Schwanze umher; bald aber bemächtigt sich seiner die volle Glut der Empfindung. Er bläst nunmehr den Hals vollends auf, drückt den Kopf so weit zurück, daß er auf dem Nacken aufliegt, breitet und senkt die Flügel, wendet und dreht aber gleichzeitig alle Federn derselben nach oben und vorn, so daß die letzten Schulterfedern den Kopf von hinten, die Bartfedern ihn von vorn fast verbergen, legt das Spiel so weit zurück, daß man streng genommen nur noch die gebauschten Unterdeckfedern sieht, senkt endlich den Vorderteil des Körpers tief nach unten und erscheint nunmehr als wundersamer Federballen. Jede andere männliche Großtrappe wird ihr jetzt zu einem Gegenstand des Hasses und der Verachtung. Mit sonderbaren Sprüngen eilen die wackern Kämpen gegeneinander los; Schnabel und Läufe werden kräftig gebraucht, um den Sieg zu erringen; selbst fliegend noch verfolgen sich die Erzürnten, schwenken sich in einer Weise, die man ihnen nie zutrauen würde, und stoßen mit dem Schnabel aufeinander. Allmählich tritt Ruhe ein. Die starken Hähne haben sich die Hennen erkämpft, und nur die schwächeren versuchen noch im kindischen Spiel den ernsten Kampf älterer nachzuahmen. Fortan sieht man Männchen und Weibchen stets beisammen; wo das eine hinfliegt, folgt auch das andere hin.
Die Niststelle wird stets vorsichtig ausgewählt, von älteren Paaren noch sorgfältiger als von jüngeren. Wenn das Getreide bereits so hoch aufgeschossen ist, daß es das brütende Weibchen verbirgt, scharrt dieses eine seichte Vertiefung in den Boden, kleidet sie auch wohl mit einigen dürren Stoppeln, Stengeln und Halmen aus und legt in sie seine zwei, ausnahmsweise auch drei, nicht eben großen, durchschnittlich achtundsiebzig Millimeter langen, sechsundfünfzig Millimeter dicken, kurzeiförmigen, starkschaligen, grobgekörnten, glanzlosen, auf bleich olivengrünem oder malt graugrünem Grunde dunkler gefleckten und gewässerten Eier. Es nähert sich dem Neste stets mit äußerster Behutsamkeit, indem es sich förmlich heranschleicht, läßt sich so wenig wie möglich sehen und legt, sobald es jemand bemerkt, den während des Brütens aufrecht getragenen Hals der Länge nach platt auf den Boden hin. Naht sich ein Feind, so schleicht es ungesehen im Getreide fort; kommt ihm eine Gefahr plötzlich über den Hals, so erhebt es sich fliegend, stürzt sich aber bald wieder in das Getreide herab und läuft dann weiter. Werden die Eier von einem Menschen mit bloßen Händen berührt, so kehrt es nie wieder zu ihnen zurück, und ebenso verläßt es das Nest, wenn die nächste Umgebung desselben arg zertreten wurde. Nach etwa dreißigtägiger Bebrütung entschlüpfen die wolligen, bräunlichen, schwarzgefleckten Jungen dem Ei, werden durch die Wärme der Mutter getrocknet und dann von dieser weggeführt. Die Alte liebt sie mit hingebender Zärtlichkeit, gibt sich bei Gefahr, das ihr sonst eigene Wesen vergessend, rücksichtslos dem Feinde preis, flattert angstvoll nahe vor dem Ruhestörer dahin, übt die unter den Hühnern gebräuchliche Kunst der Verstellung und kehrt erst, wenn es ihr glückte, den Nahenden irrezuführen, zu den Kindern zurück, die sich, falls es irgend möglich war, an einer geeigneten Örtlichkeit auf den Boden drückten und in der Gleichfarbigkeit desselben mit ihrem Kleide einen vortrefflichen Schutz fanden. Die erste Kindheit verbringen die Trappen fast nur im Getreide; erst später und auch dann bloß, wenn die Alte in der Ferne keinen Menschen bemerkt, führt sie ihre Jungen auch wohl einmal auf freies Brachfeld, immer aber nur so weit, daß sie rasch wieder den Zufluchtsort erreichen kann. Kleine Käfer, Heuschrecken und Larven, die von der Mutter teilweise ausgescharrt oder gefangen und den Küchlein vorgelegt werden, bilden ihre erste Nahrung. Sie sind anfänglich sehr unbeholfen, gehen schlecht und wankend und lernen erst spät selbst Futter aufzunehmen, beginnen aber, wenn sie so weit gekommen, auch Grünes mitzufressen. Etwa einen Monat nach dem Ausschlüpfen sind sie fähig geworden, ein Stück weit zu flattern; vierzehn Tage später fliegen sie bereits ziemlich gut, und nunmehr durchstreifen sie mit den Eltern weitere Strecken.
Um Trappen zu zähmen, muh man sie jung einfangen, denn alte ertragen den Verlust ihrer Freiheit schwer. Besonders geübte Züchter kaufen Hirten gefundene Eier ab und lassen diese von Hühnern oder Putern ausbrüten. Zerstückelte Heuschrecken, Mehlwürmer, Bröckchen von dem Fleisch zarter Küchlein bilden die Nahrung der soeben aus dem Ei gekommenen Trappen, etwas derbere Fleischkost das Futter älterer, bis schließlich Grünzeug und Körner gereicht werden können. Die Ernährung selbst verursacht also kaum Schwierigkeiten; diese aber beruhen darin, daß die Trappenküchlein höchst empfindlich gegen die Nässe sind und demzufolge stets sehr warm und trocken gehalten werden müssen. Haben sie sich erst an ein passendes Ersatzfutter gewöhnt, so halten sie sich, ohne eigentlich sorgfältige Abwartung zu verlangen, jahrelang, und zwar um so besser, je größer der für sie bestimmte Raum ist und je mehr man sie sich selbst überläßt. Ein Stalleben vertragen sie nach meinen Erfahrungen nicht, müssen vielmehr Sommer und Winter im Freien bleiben. Eine Trappe, mit der man sich viel beschäftigt, lernt ihren Pfleger kennen und von andern Menschen unterscheiden, folgt seinem Rufe, kommt an das Gitter heran, kann es aber nicht leiden, wenn man ihr Gehege betritt, stellt sich dann kühn dem Menschen entgegen, erhebt ihren Schwanz, lüftet die Flügel etwas, stößt das obenerwähnte »Psäär« aus und sucht durch wohlgezielte Schnabelhiebe zu schrecken. Mit andern Vögeln, Auerhähnen zum Beispiel, hält sie gute Freundschaft, läßt sich jedoch nichts gefallen und weist Angriffe ernstlich zurück. Zur Fortpflanzung hat man, soviel mir bekannt, gefangene Trappen noch nicht schreiten sehen; es läßt sich jedoch annehmen, daß man früher oder später auch sie züchten wird.
Die Trappe, die man zur hohen Jagd zählt, wird überall eifrig gejagt, weiß jedoch fast alle Jagdarten zu vereiteln. Ihr grenzenloses Mißtrauen läßt sich selten täuschen; sie unterscheidet den Jäger von andern Menschen auch dann noch, wenn er in Weiberkleidern einhergeht, und flieht ebenso ängstlich vor dem Reiter wie vor dem Fußgänger. Man erfand daher den Trappenwagen, das heißt, man setzte einen gewöhnlichen Bauernwagen rundum mit Strohgarben aus, verbarg sich dazwischen, ließ durch einen in seiner gewöhnlichen Tracht gekleideten Ackerknecht den Wagen auf die weidenden Trappenherden zufahren, in entsprechender Nähe einen Augenblick halten und feuerte nun so rasch wie möglich auf die stärksten Hähne. Dennoch gelang es keineswegs immer, das scheue Wild zu hintergehen. In der russischen Steppe hetzt man die Trappen nicht selten mit Windhunden, in Asien beizt man sie mit Edelfalken oder gezähmten Steinadlern.
Im Süden unseres Erdteils tritt zu der Großtrappe ein kleiner, niedlicher Verwandter, die Zwergtrappe ( Otis tetrax). Abgesehen von der geringen Größe und der verschiedenen Färbung unterscheidet sie sich auch noch durch die seitlich etwas verlängerten Oberhals- und Hinterkopffedern von der Großtrappe. Beim Männchen ist der Hals schwarz, durch ein von den Ohren nach der Gurgel herablaufendes weißes Ringband und ein breites, über den Kropf sich hinziehendes weißes Querband gezeichnet, das Gesicht dunkelgrau, der Oberkopf hellgelblich, braun gefleckt, der Mantel auf hellrötlichgelbem Grunde schwarz in die Quere gefleckt und gewellt, der Flügelrand, die Ober- und Unterschwanzdeckfedern und das Gefieder der Unterseite weiß. Die Schwanzfedern sind weiß, gegen die Spitze hin durch zwei Binden geziert. Das Auge ist hell- oder braungelb, der Schnabel horngrau, an der Spitze schwarz, der Fuß strohgelb. Die Länge beträgt etwa fünfzig, die Breite fünfundneunzig, die Fittichlänge sechsundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter.
Bis zum Jahre 1870 durften wir die Zwergtrappe nicht zu den deutschen Brutvögeln zählen. Sie erschien höchstens gelegentlich ihrer Frühjahrs- und zumal der Herbstwanderungen in unserm Vaterlande, vielleicht häufiger, als wir annahmen, verweilte jedoch immer nur kurze Zeit im Lande und wanderte entweder dem Südwesten oder dem Osten Europas zu. Seit dem genannten Jahre hat sie sich auf dem waldentblößten, kahlen, hügeligen, aber fruchtbaren Thüringer Landstrich, der zwischen den Städten Weißensee, Kölleda, Erfurt, Langensalza und Greußen liegt, angesiedelt und neuerdings auch in Schlesien hier und da festgesetzt. Daß sie nicht sofort ausgerottet wurde, verdanken wir vor allem dem Pfarrer Thienemann, der damals das in jener Gegend gelegene Dorf Gangloffsömmern bewohnte und kein Mittel unversucht ließ, ihr Schonung zu erwirken. In den letztvergangenen sieben Jahren hat sich die Anzahl der in Thüringen wie in Schlesien brütenden Vögel allmählich vermehrt; demungeachtet gehört unsere Trappe in Deutschland noch immer zu den großen Seltenheiten. Auch sie ist Steppenvogel; ihr eigentliches Wohngebiet beginnt daher erst da, wo die Steppe oder ihr ähnliche Landstriche ihr passende Aufenthaltsorte gewähren. Besonders häufig scheint sie auf Sardinien zu leben; aber auch in Spanien kennt man sie allenthalben als einen, obschon nicht zahlreich vorkommenden, so doch nirgends fehlenden Vogel. In den russischen und sibirischen Steppen, die man als Brennpunkt ihres Verbreitungsgebietes anzusehen hat, tritt sie zuweilen, besonders während der Zugzeit, massenhaft auf. Ähnlich scheint es in Spanien zu sein; denn auch von hier aus tritt die Zwergtrappe in jedem Herbst ihre Reise an und erscheint in jedem Frühling wieder. Gelegentlich dieser Wanderungen besucht sie die Atlasländer, überwintert wohl auch schon hier. Ägypten berührt sie sehr selten; soviel ich mich erinnere, ist mir nur ein einziges Stück von ihr, und zwar in der Nähe von Alexandria, in die Hände gefallen.
Die Zwergtrappe bindet sich nicht so streng wie ihr großer Verwandter an die Ebene, sondern nimmt auch in hügeligen Gegenden ihren Stand. In Spanien wählt sie vorzugsweise Weinberge zu ihrem Aufenthalt, gleichviel ob dieselben in der Ebene oder an einem Gehänge liegen; nächstdem siedelt sie sich in dem wüstenhaften »Campo«, und zwar in Gemeinschaft mit dem Dickfuß an. In Ungarn bewohnt sie die Pußta, in Südrußland und ganz Sibirien und Turkestan die Steppe. In Thüringen fallen ihre Wohnplätze, laut Thienemann, mit denjenigen der Großtrappe zusammen; aber auch hier zieht sie Örtlichkeiten, die der Steppe ähneln, allen andern vor. Wald meidet sie so ängstlich, daß sie sich weder in der Nähe eines Gehölzes festsetzt, noch über dasselbe wegfliegt, es sei denn, daß sie etwa eine Ecke abschneide. Ausgedehnte Klee- und Esparsettefelder sind hier ihr Lieblingsaufenthalt; dorthin begibt sie sich, nachdem sie im Frühjahr aus dem warmen Süden zurückgekehrt ist. Sobald die Wintersaaten ihre Frühjahrstriebe sprossen lassen und die Sommersaaten dicht werden, verfügt sie sich abwechselnd auch nach solchen Feldern, namentlich dann, wenn das junge Getreide im Juni die Höhe erreicht hat, die genügt, sie dem Blick des Menschen oder der Raubvögel zu entziehen; jedoch sucht sie, namentlich am Morgen, auch da, wo sie ein Saatfeld zum Sommeraufenthalt erwählte, Klee- und Esparsettefelder gern auf, um ein paar Stunden in ihnen zu verbringen, und kehrt erst später in das bergende Dickicht der wogenden Ähren zurück. Mit Beginn der Ernte, die sie sehr belästigt, wandert sie von Acker zu Acker. Ist der letzte Halm gefallen, so zieht sie sich meist in Kartoffel- und Rübenfelder zurück und sucht dabei erklärlicherweise, ebenso wie die ausgedehntesten Kleefelder, die größten Breiten auf. »Wollte ich«, schreibt mir Thienemann, »die Zwergtrappen in dieser Zeit aufsuchen, um sie etwa einem Freunde zu zeigen, so fuhr ich in die Gegend ihres Aufenthaltes, wählte die größten Rüben- oder Kartoffelfelder aus, steuerte auf ihre Mitte zu und durfte sicher sein, eine oder die andere Familie bald anzutreffen. Im Spätherbst schlagen sich die einzelnen Familien in Herden von zwölf bis zwanzig und mehr Stück zusammen, streichen in der Gegend umher und halten sich meist auf Futteräckern oder Kleefeldern auf.
Nach Thienemanns Erfahrungen ist die Nahrung im ganzen der unserer Großtrappe gleich. Pflanzenstoffe bilden den Hauptteil der Äsung, auf sie folgen Kerbtiere, die von den Blättern und Blüten ihrer Wohnpflanzen abgelesen werden. Kleeblätter lieben sie sehr, doch fressen sie auch junge Saat und im Herbst, zeitweise fast ausschließlich, die Blätter des Löwenzahns, die ihnen wahrscheinlich ihrer Bitterkeit halber ebenso zusagen wie den gehörnten Wiederkäuern in unsern Ställen. Zur besseren Verdauung verschlingen auch sie Kieselsteinchen von geringer Größe. Sie gehen täglich mehrere Male auf Äsung; namentlich kann man sicher sein, sie frühmorgens, bald nach Aufgang der Sonne, in voller Tätigkeit zu treffen. Zu ihren Wohngebieten wählen sie gern große Kleefelder mit freier Aussicht, in deren Mitte sie sich niederlassen und nach längerer Umschau fleißig Blätter abrupfen und Kerbtiere suchen. Im Herbst verschlucken sie hier und da wohl auch ein Samenkorn, dies aber immer nur selten. Im übrigen ähnelt ihre Lebensweise völlig derjenigen ihrer größeren Verwandten.
*
Als die nächsten Verwandten der Trappen sieht man wohl mit Recht die Regenpfeifer an, kräftige, kurzhalsige, großköpfige Vögel von geringer Größe, mit meist kurzem, selten mehr als die Hälfte der Kopflänge erreichendem, an der Wurzel weichem, an der kolbenförmigen Spitze hartem Schnabel, mittelhohen, schlanken, im Fersengelenke etwas verdickten Beinen und meist dreizehigen Füßen, ziemlich großen, schmalen, spitzigen Flügeln, in denen die erste oder zweite Schwinge die übrigen an Länge überragen, und deren Oberarmschwingen zu einem sogenannten Afterflügel sich verlängern, kurzem oder mäßig langem, am Ende seicht abgerundetem, aus zwölf Federn bestehendem Schwanze und dichtem und weichem, glatt anliegendem, weniger nach dem Alter als nach der Jahreszeit verschiedenem Gefieder.
Alle Erdteile beherbergen Mitglieder dieser Familie. Einzelne von diesen verbreiten sich über weite Länderstrecken, jede scheint aber ein gewisses Gebiet und bezüglich eine bestimmte Örtlichkeit mehr oder weniger zu bevorzugen, mindestens zur Brutzeit eine solche zu erwählen. Beliebte Aufenthaltsorte sind die Küste des Meeres oder die Ufer und sandigen Stellen der Flüsse, Seen und größeren Teiche, nicht minder auch die Sümpfe oder richtiger die Moore und endlich Gebirgshöhen, die von dem schmelzenden Schnee zwar bewässert werden, aber doch weder Sümpfe noch Moore sind. Auf ihren Wanderungen folgen die einen den Gewässern, streichen also ebensowohl längs der Meeresküste dahin oder in Stromniederungen fort; andere dagegen kümmern sich wenig um das ihnen befreundete Wasser. Während der Brutzeit leben alle Arten paarweise, aber unmittelbar nebeneinander; gelegentlich des Zuges scharen sie sich zu Gesellschaften, die zuweilen zu Schwärmen anwachsen können; unter allen Umständen aber hält sich jede Art soviel wie möglich zusammen und vereinigt sich, streng genommen, nur scheinbar mit andern, indem sie die gleiche Örtlichkeit zeitweilig besucht.
An einem der ersten Abende, die ich in einem teilweise verfallenen Hause einer der Vorstädte Kairos verlebte, sah ich zu meiner nicht geringen Überraschung von den platten Dächern der Häuser große Vögel herniederfliegen, dem Buschwerk im Garten sich zuwenden und hier verschwinden. Ich dachte zunächst an Eulen; aber der Flug war doch ein ganz anderer, und ein lauter Ruf, den einer dieser Vögel ausstieß, überführte mich sehr bald meines Irrtums. Je weiter die Nacht vorrückte, um so reger wurde das Treiben unten in dem vom Vollmond beleuchteten Garten. Wie Gespenster huschte es aus dem Dickicht der Orangen hervor, und ebenso plötzlich, wie gekommen, waren die Gestalten wieder verschwunden. Ein wohlgezielter Schuß verschaffte mir Aufklärung. Ich eilte in den Garten hinab und fand, daß ich einen mir als Balg bekannten echten deutschen Vogel erlegt hatte, den Triel oder Dickfuß nämlich, das Verbindungsglied zwischen Trappe und Regenpfeifer, die Nachttrappe, wie man vielleicht sagen könnte. Später gab es Gelegenheit genug, den sonderbaren Gesellen zu beobachten; denn ich begegnete ihm oder einem seiner Verwandten, die sich in der Lebensweise nicht im geringsten unterscheiden, in allen Teilen Südeuropas und in allen Ländern Nordostafrikas, die ich durchforschte.

Triel ( Oedicnemus crepitans)
Unser Triel ( Oedicnemus crepitans), Vertreter einer gleichnamigen Sippe und Unterfamilie, ist etwa fünfundvierzig Zentimeter lang und achtzig Zentimeter breit; die Fittichlänge beträgt fünfundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Das Gefieder der ganzen Oberseite sieht lerchenfarben aus; die Federn sind rostgrau und in der Mitte schwarzbraun gestreift, die Stirne, eine Stelle vor dem Auge, ein Streifen über und unter ihm weiß, ebenso ein Streifen auf dem Oberflügel, die Federn der Unterseite gelblichweiß, die Schwungfedern schwarz, die Steuerfedern schwarz an der Spitze und seitlich weiß. Das Auge ist goldgelb, der Schnabel gelb, an der Spitze schwarz, der Fuß strohgelb, das Augenlid ebenfalls gelb. Bei jungen Vögeln spielt die Hauptfarbe mehr ins Rostfarbene.
Als eigentliche Heimat des Triel haben wir die Länder Südeuropas, Nordafrikas und Mittelasiens anzusehen, in denen es wirkliche Wüsten oder doch steppenartige Strecken gibt. Alle Mittelmeerländer, Syrien, Persien, Arabien, Indien usw. beherbergen ihn in Menge. In Ungarn, Österreich und Deutschland fehlt er jedoch auch nicht, findet sich selbst noch in Holland, Großbritannien, Dänemark, Südschweden und muß, wenigstens bei uns zulande, hier und da als regelmäßige Erscheinung gelten, da er alle Jahre auf einer und derselben Stelle gefunden wird. Die nördlichen Teile seines Verbreitungsgebietes verläßt er im Spätherbst, fliegt bis zum Süden Europas oder in eine ähnliche Breite hinab und kehrt im Frühjahr zurück; schon um das Mittelmeer herum aber wandert er nicht mehr, sondern treibt sich als Stand- oder doch als Strichvogel jahraus jahrein in demselben Gebiet umher. Letzteres kann sehr verschiedenartig, muß aber immer wüstenhaft sein. Wenn er sich bei uns zulande ansiedeln soll, darf der Sand ihm mindestens nicht fehlen, gleichviel, ob er ausgedehnte Brachfelder oder spärlich bestandene Kieferwälder oder mit Buschwerk überdeckte Inseln in Strömen und Flüssen bewohnt. Immer aber muß sein Aufenthaltsort ihm weite Umschau oder doch sichere Deckung gewähren.
Der Triel ist ein Freund der Einsamkeit, der sich kaum um seinesgleichen bekümmert, am wenigsten aber mit andern Geschöpfen abgeben mag. Vertrauen kennt er nicht; jedes Tier erscheint ihm, wenn nicht bedenklich, so doch beachtenswert. Er beobachtet also jederzeit alles, was um ihn her vorgeht, und täuscht sich selten. Ihm ist es sehr wohl bewußt, daß jene platten Dächer ägyptischer Städte ebenso sicher, vielleicht noch sicherer sind als die dürren Lehden bei uns zulande, die ein schützendes Kieferdickicht umgeben, oder die sandigen, spärlich mit Weidicht bestandenen Inseln der Donau unterhalb Wiens. Übertags bemerkt man ihn selten, meist nur zufällig; denn er hat den Menschen, der sich seinem Standort naht, viel eher gesehen, als dieser ihn. Befindet er sich auf einer weiten, ebenen Fläche ohne schützendes Dickicht, so duckt er sich platt auf den Boden nieder und macht sich dadurch, dank seines erdfarbenen Gefieders, beinahe unsichtbar. Hat er ein Dickicht zur Deckung, so eilt er schnellen Laufes auf dieses zu, bleibt aber keineswegs hier unter einem Busche sitzen, sondern durchmißt den Versteckplatz mit fast ungeminderter Eile und tritt dann auf der Seite, die dem Beobachter entgegengesetzt liegt, wieder auf das freie Feld heraus. In der Wüste drückt er sich zuerst auch nieder; sowie er aber gewahrt, daß der Verfolger sich ihm naht, erhebt er sich, läuft in einer wohlberechneten, für das Schrotgewehr stets zu großen Entfernung seines Weges dahin, sieht sich von Zeit zu Zeit überlegend um, läuft weiter und gewinnt so in der Regel bald genug den nötigen Vorsprung, ohne seine Flügel zu Hilfe zu nehmen. Durch einen Reiter läßt er sich ebensowenig täuschen wie durch den Fußgänger; denn er weiß sehr wohl, daß ihm nur das Pferd ohne Reiter ungefährlich ist. Sein Gang ist, solange er sich nicht beeilt, steif und trippelnd, kann aber zum schnellsten Rennen gesteigert werden; der Flug ist sanft und weich, auch ziemlich gewandt, wird aber selten weit ausgedehnt. Wenn die Nacht hereinbricht, wird er lebendig, rennt und fliegt unruhig hin und her, läßt seine Stimme erschallen, erhebt sich spielend leicht in verhältnismäßig bedeutende Höhen und entfaltet Künste des Fluges, die man bei ihm nie vermuten würde. Raschen Laufes huscht er über den Boden dahin, einer Schattengestalt vergleichbar, im Strahle des Mondes auf Augenblicke sich verkörpernd, aus nicht beleuchteten Stellen wiederum zum Gespenste sich wandelnd. Zunächst geht es der Tränke zu, und wenig kümmert es ihn, ob das erfrischende Wasser weit entfernt oder in der Nähe gelegen ist. Bei Mondschein sieht man ihn von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in Bewegung, und wahrscheinlich wird es in dunklen Nächten kaum anders sein. Die Stimme, die man weit vernimmt und durch die Silben »Kräiith« ungefähr wiedergeben kann, klingt hell durch die stille Nacht, insbesondere während der Zugzeit, wenn der Vogel hoch oben seines Weges dahinfliegt.
Würmer, Kerbtiere in allen Lebenszuständen, Schnecken und andere Weichtiere, Frösche, Eidechsen und Mäuse sind das Wild, dem der Triel nachstellt; Eier und junge Nestvögel werden wahrscheinlich auch nicht vor ihm gesichert sein. Den Feldmäusen lauert er, laut Naumann, wie eine Katze auf und fängt sie im Laufen sehr geschickt, indem er ihnen zuvörderst einen tüchtigen Schnabelhieb versetzt, sie hierauf packt, wiederholt gegen den Erdboden stößt, bis alle Knochen zerbrochen sind, und endlich, förmlich zerquetscht, hinunterschlingt. Auch die Kerbtiere tötet er, bevor er sie verschluckt. Zur Beförderung der Verdauung nimmt er grobe Sandkörner auf.
Im Frühjahr kommt es ebensowohl der Weibchen als der Standorte wegen zwischen zwei Paaren zuweilen zu Raufereien; dabei fahren beide Kämpfer mit dem Schnabel heftig gegeneinander los und verfolgen sich laufend oder fliegend. Hat der eine den andern vertrieben, so kehrt er zum Weibchen zurück, läuft, laut Naumann, in engen Kreisen mit tief zu Boden herabgebeugtem Kopf, hängenden Flügeln und fächerartig aufgerichtetem Schwanz um dieses herum und stößt ein sanftes »Dick, dick, dick« aus. Zu Ende des April findet man das Nest, eine kleine Vertiefung im Sande, und in ihm ohne jegliche Unterlage die drei bis vier Eier, die Hühnereiern an Größe ungefähr gleichkommen, durchschnittlich dreiundfünfzig Millimeter Längs-, achtunddreißig Millimeter Querdurchmesser haben, ihnen auch in der Gestalt ähneln und auf bleich lehmgelbem Grunde schieferblaue Unterflecke und dunkelgelbe bis schwarzbraune Oberflecke und Schnörkel zeigen, unter sich aber hinsichtlich der Zeichnung sehr abweichen. Das Paar erzielt, ungestört, im Laufe des Sommers nur eine Brut; das Weibchen zeitigt die Eier innerhalb sechzehn Tagen, und das Männchen hält währenddem treue Wacht. Sobald die Jungen völlig abgetrocknet sind, folgen sie der Alten und kehren nie wieder ins Nest zurück. Anfänglich legen beide Eltern ihnen gefangene Beute vor; später gewöhnen sie dieselben an selbständiges Jagen. Die Küchlein drücken sich bei Gefahr sofort auf den Boden nieder, wo ihnen jede Unebenheit einen Versteckplatz gewährt. Ein Raubtier versuchen die Eltern abzulenken; dem geübten Jäger verraten sie durch ihr ängstliches Umherlaufen den Versteckplatz.
Einen alten Triel so zu täuschen, daß man schußgerecht ihm ankommt, ist schwer. In Indien oder in der Sahara bedient man sich der Baizfalken zur Mithilfe. Eine Erfolg versprechende Fangart ist nicht bekannt; deshalb sieht man den teilnahmswerten Gesellen selten einmal im Gesellschaftsbauer eines Tiergartens oder im Käfig eines Händlers und Liebhabers.
*
Die Regenpfeifer im engeren Sinne ( Charadriinae), die eine anderweitige Unterfamilie und den Kern der ganzen Familie bilden, entsprechen der eingangs gegebenen Kennzeichnung, ändern jedoch, wie aus Nachstehendem hervorgehen wird, unter sich nicht unerheblich ab.
Der Kiebitz ( Vanellus cristatus) vertritt eine gleichnamige Sippe ( Vanellus), deren Kennzeichen in den vierzehigen Füßen, den stumpfen Flügeln und der Federholle auf dem Kopf zu suchen sind. Oberkopf, Vorderhals, Oberbrust und die Hälfte des Schwanzes sind glänzend dunkelschwarz, die Federn des Mantels dunkelgrün, blau oder purpurn schillernd, Halsseiten, Unterbrust, Bauch und die Wurzelhälfte der Schwanzfedern weiß, einige Ober- und die Unterschwanzfedern dunkel rostgelb; die Haube besteht aus langen, schmalen Federn, die eine doppelte Spitze bilden. Das Weibchen unterscheidet sich durch kürzeren Federbusch und weiß und schwarz gefleckten Vorderhals. Ihm ähneln die Jungen, nur mit dem Unterschiede, daß deren Kleid schmutzigere Farben und breite, rostgelbe Federränder auf dem Oberkörper zeigt. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß schmutzig dunkelrot. Die Länge beträgt vierunddreißig, die Breite siebzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge zehn Zentimeter.
Vom einundsechzigsten nördlichen Breitengrad an bis Nordindien und Nordafrika hat man den Kiebitz in allen bekannten Ländern der Alten Welt beobachtet. Er ist in China an geeigneten Orten ebenso gemein wie in Großbritannien und wandert von seiner Heimat aus allwinterlich südlich bis in die zwischen Nordindien und Marokko gelegenen Länder, verfliegt sich auch wohl bis auf die Färinseln und Island, selbst bis Grönland. In Griechenland wie in Spanien, in Kleinasien wie in Nordafrika, in Südchina wie in Indien erscheint er in namhafter Menge vom Ende des Oktober an, bezieht Flußtäler, sumpfige Niederungen oder die Küste des Meeres und wandert Anfang März wieder nach dem Norden zurück. Unter den europäischen Ländern beherbergt Holland unzweifelhaft die meisten Kiebitze; sie sind hier Charaktervögel des Landes, die ebenso zur Landschaft gehören wie die Wassergräben, die schwarzweißen Kühe, die Windmühlen und die von hohen Bäumen beschatteten Landhäuser. Doch ist der Vogel auch in Deutschland keineswegs selten, mit Ausnahme höherer Gebirge vielmehr überall vorhanden.
Der Kiebitz gehört zu den ersten Boten des Frühlings; denn er stellt sich ungefähr um dieselbe Zeit bei uns ein, wie der muntere Star oder die Feldlerche, trifft sogar bereits dann in der Heimat ein, wenn der Winter noch die Herrschaft festhält und er ein kümmerliches Leben zu führen gezwungen wird. Mehr als von andern Vögeln hat man von ihm beobachtet, daß dem großen Wanderheere einzelne vorausziehen, die gewissermaßen bestimmt zu sein scheinen, den Hauptzug anzusagen und Herberge zu machen. Sie werden oft bitter getäuscht, wenn das Wetter sich ändert. Spät im Frühjahr fallender Schnee deckt ihnen die Nahrung zu; sie scheinen auf Besserung zu hoffen, können sich nicht zum Rückzuge entschließen, irren von einer Quelle zur andern, streifen im Lande umher, verkümmern mehr und mehr, harren und hoffen und verderben. Während der Zugzeit vernimmt man zuweilen selbst in der Nacht ihre bezeichnende Stimme, und tagsüber gewahrt man, namentlich in Flußtälern, zahlreiche Haufen, die meistens ohne Ordnung, aber doch geschart, ihre Wanderung ausführen.
Sobald eine Kiebitzschar sich in der Heimat festgesetzt hat, verteilt sie sich einigermaßen auf den betreffenden Standorten und beginnt nunmehr ihr Sommerleben. Der Kiebitz liebt die Nähe des Menschen nicht, meidet deshalb, mit Ausnahme der Marschländer, die Wohnung desselben soviel wie möglich. Hauptbedingung des Brutplatzes ist die Nähe von Wasser. Es kommt zwar auch, jedoch selten, vor, daß Kiebitze hochgelegene Bergebenen zum Nisten wählen; wenn es aber geschieht, darf man mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen, daß die sonst benutzten Nistplätze im Laufe des Sommers werden überschwemmt werden. Auf diesen Nistplätzen nun sieht oder hört man den Kiebitz zu jeder Tageszeit. Ganz abgesehen von seiner Wachsamkeit, die in jedem andern Geschöpf, vielleicht mit Ausnahme der Rinder und Schafe, ein gefährliches Wesen erkennen will, gefällt sich der Vogel in einer fast ununterbrochenen Beweglichkeit, und da er lieber fliegt als läuft, zur Kundgabe seiner Liebesgefühle oder auch seines Ärgers und mancher Spiele, deren Grund man nicht recht begreift, hauptsächlich seine Schwingen benutzt, kann es nicht fehlen, daß man ihn wahrnimmt. Am lebhaftesten gebärdet er sich, solange seine Eier im Neste liegen oder seine Jungen noch unfähig sind, herannahender Gefahr fliegend zu entrinnen. Um diese Zeit wird jeder Mensch, der in die Nähe ihres Brutortes kommt, unter lautem »Kiwit« umschwärmt, und zwar mit einer Kühnheit, die wahrhaft in Erstaunen setzt; denn der um seine Brut besorgte Vogel stößt oft so dicht an dem Kopf des Menschen vorbei, daß dieser den durch schnelle Bewegung erzeugten Luftzug deutlich verspüren kann. Der Flug ist vortrefflich und durch die mannigfaltigsten Wendungen gleichsam verschnörkelt. Nur wenn der Kiebitz über dem Wasser dahinstreicht, fliegt er mit langsamen Schwingenschlägen seines Weges fort; sowie er in höheren Luftschichten sich bewegt, beginnt er zu gaukeln, gleichsam als wolle er jedes Gefühl durch eine besondere Bewegung ausdrücken. Wenn sich ihm oder seinen Jungen wirklich Gefahr naht, führt er die kühnsten Schwenkungen aus, stürzt sich fast bis auf den Boden herab, steigt aber sofort steil wieder in die Höhe, wirft sich bald auf diese, bald auf jene Seite, überschlägt sich förmlich, senkt sich auf den Boden herab, trippelt ein wenig umher, erhebt sich von neuem und beginnt das alte Spiel wieder. Kein Vogel unseres Vaterlandes fliegt wie er, keiner versteht es, in derselben Weise alle nur denkbaren Bewegungen mit den Fittichen auszuführen. Eigentümliches Sausen und Wuchteln, das bei den schnellen Flügelschlägen entsteht, zeichnet diesen Flug noch außerdem so aus, daß man in der Luft dahinziehende Kiebitze auch in finsterer Nacht von jedem andern Vogel unterscheiden kann. Der Gang ist zierlich und behend; der Lauf kann zu großer Eile gesteigert werden. Im Fliegen wie im Gehen spielt der sonderbare Geselle dabei fortwährend mit seiner Holle, die er bald wagrecht niederlegt, bald hoch aufrichtet. Von seiner Stimme macht er sehr oft Gebrauch, und obgleich dieselbe nicht wechselvoll genannt werden kann, weiß er doch die wenigen Töne, aus denen sie besteht, vielfach vertönend zu verbinden. Der Lockton ist das bereits erwähnte »Kiwit«, das bald mehr, bald weniger gedehnt, überhaupt verschieden betont wird und dann auch Verschiedenes ausdrückt; der Angstruf klingt wie »Chräit«, der Paarungsruf besteht aus einer eng verbundenen Reihe von Lauten, die man durch die Silben »Chäh querkhoit kiwitkiwitkiwit kiuiht« ungefähr ausdrücken kann. Daß dieser Ruf im Flug ausgestoßen und von den mannigfaltigsten Gaukeleien begleitet wird, braucht kaum erwähnt zu werden. Ruf und Gaukelflug sind, wie Naumann sagt, unzertrennlich und bilden zusammen ein Ganzes; sie drücken unverkennbar die hohe Freude, das ganze Liebesglück des Vogels aus.
Ebenso eigenartig, wie sich der Kiebitz im Fluge zeigt, ebenso absonderlich ist sein Gebaren, wenn er aus seiner Weide nach Nahrung umherläuft. Liebe hat ihn im Zimmer eingehend beobachtet, alles, was er ihm abgesehen, dann auch im Freien bestätigt gefunden, und ihm so manches abgelauscht, was bis dahin noch unbekannt oder doch nicht veröffentlicht war. »Geht der Kiebitz«, so schreibt er mir, »nach Nahrung aus, so läuft er mit ruhig gehaltenem Körper schnellen Schrittes etwa einen Meter weit geradeaus, hält dann mit einem Rucke ganz still, indem er auf einem Ständer steht und den andern nach hinten gestreckt auf die Zehenspitzen stützt, und unterzieht, ohne den Kopf zu bewegen, den kleinen Fleck Lands um sich her der sorgfältigsten Prüfung, was nur dadurch möglich wird, daß die prächtig braunen Augen groß genug sind und etwas hervortreten. Nachdem er die Stelle abgeäugt hat, rennt er wieder mit größter Gewandtheit über Stellen und Grasstubben weg einen Meter weit vor und bleibt wiederum in der angegebenen Stellung stehen, und so fort. Wie viele andere Vögel wippt auch er mit dem Schwanz; aber dieses Wippen ist langsam und gravitätisch und teilt sich mit Ausnahme des Kopfes dem ganzen Körper mit, so daß dieser in schaukelnde Bewegung gerät. Fast heftig wird das Wippen und Schaukeln, wenn der Vogel ein Bad nimmt. Sehr sonderbar ist eine andere Bewegung der Kiebitze, die man aber nur dann sieht, wenn sie sich aus der Luft auf einer Wiese oder einem Felde niedergelassen haben, oder wenn ihnen in der Ferne etwas auffällt, oder endlich, wenn sie beisammen stehen und sich stumm unterhalten. Wie die Waldsänger oder Steinschmätzer sich schnell bücken, so schnellen die Kiebitze im Steigen den Kopf bei sonst wagrechter Haltung desselben auf einen Augenblick senkrecht in die Höhe. Diese vollständig gewohnheitsmäßige Bewegung gehört zu denen, die ich sichernde nenne; denn sie durchspähen so die weitere Umgebung nach etwaigen Gefahren. Wieder eine andere Bewegung, die ich zu den spielenden zähle, weil man sie nur sieht, wenn sie sorglos beisammen stehen und durch Zeichen und auch durch leicht krächzendes Gemurmel eine Art Unterhaltung pflegen, ist die, daß sie den Kopf seitlich niederstrecken, als ob sie etwas von dem Boden aufheben wollten. Bei starker Erregung wiederholen sie diese Bewegung öfters und führen sie schneller aus. Namentlich kann man dies beobachten bei Gelegenheit der Hochzeitsspiele. Das Männchen umschwenkt dann das am Boden stehende Weibchen zuerst mit den wunderbarsten Flugkünsten und stürzt sich endlich, wenn sich letzteres in eine kleine Bodenmulde geduckt hat, in der Nähe desselben aus die Erde, geht aber keineswegs immer sogleich zu ihm hin, sondern liebäugelt zuvor auf eine wunderliche Weise, trippelt bald rechts, bald links vor, immer mit kurzen Pausen, ehe es ganz still steht, und macht dabei jene eben beschriebene Bewegung, die tiefen Verbeugungen auf das Haar gleicht. Jetzt wird das Weibchen rege, hebt sich ein wenig in den Fersen, schaukelt sich hin und wieder unter leichtem Schwanzwippen und läßt dabei ein halblautes, recht unangenehm klingendes, krächzendes Geschwätz hören, mit dem es das Männchen zu ermuntern scheint. Dieses kommt nun näher heran und gibt seinen warmen Gefühlen dadurch Ausdruck, daß es einige Schritte zu dem Weibchen vorläuft, stehenbleibt, dann Binsenhalme, ein Stengelchen oder sonst dergleichen mit dem Schnabel faßt und über den Rücken hinter sich wirft, das Spiel auch öfters wiederholt. Ein ähnliches Liebeswerben habe ich bei keinem andern Vogel beobachtet.«
Je mehr man den Kiebitz beobachtet, um so fester wird man überzeugt, daß er ein sehr kluger Vogel ist. Die Wachsamkeit, die den Jäger ärgert, gereicht ihm zum höchsten Ruhm. Er weiß genau, welchen Menschen er trauen darf und welche er meiden muß. Mit Hirten und Bauern tritt er in ein gewisses Freundschaftsverhältnis; dem Jäger weicht er so ängstlich aus, daß man meinen möchte, er kenne das Gewehr. Eine böse Erfahrung vergißt er nie, und derjenige Ort, an dem einen seiner Art ein Unglück traf, bleibt den übrigen jahrelang im Gedächtnis. Allen Raubtieren gegenüber legt er den tiefsten Haß an den Tag, betätigt zugleich aber hohen Mut, ja förmliche Tollkühnheit. Wütend stößt er auf den schnüffelnden Hund herab, oft so dicht an dem Kopf desselben vorüber, daß der geärgerte Vierfüßler sich veranlaßt sieht, nach ihm zu schnappen. Reineke wird ebenso eifrig angegriffen, aber nicht immer besiegt und vertrieben, ergreift vielmehr nicht selten einen der kühnsten Angreifer und mordet ihn dann vor den Augen der Genossen, die voll Entsetzen in alle Winde zerstieben und fern vom Walplatz den verunglückten Gefährten beklagen. Kühn greift der Kiebitz Raubvögel, Möwen, Reiher und Störche an, von denen er weiß, daß sie nicht imstande sind, es ihm im Fluge gleichzutun; aber vorsichtig weicht er denjenigen gefiederten Räubern aus, die ihn im Fluge überbieten. Es ist ein höchst anziehendes Schauspiel, Kiebitze zu beobachten, die einen Bussard, einen Weih, einen nach den Eiern lüsternen Raben oder einen Adler anfallen; man glaubt ihnen die Siegesgewißheit und dem Räuber den Arger anzumerken. Einer unterstützt dabei den andern, und der Mut steigert sich, je mehr Angreifer durch den Lärm herbeigezogen werden. Der fliegende Räuber wird dadurch so belästigt, daß er es vorzieht, von aller Jagd abzustehen, um nur die Kläffer loszuwerden. Das Strandgeflügel lernt sehr bald auf ihn achten und entzieht sich, dank seiner Vorsicht, vielen Gefahren. Deshalb nennen die Griechen ihn bezeichnend »gute Mutter«.
Regenwürmer scheinen seine Hauptnahrung zu bilden; nächstdem werden Kerbtierlarven aller Art, Wasser- und kleine Landschnecken usw. aufgenommen. Zur Tränke geht er, wenn er in der Nähe des Wassers lebt, mehrmals im Laufe des Tages; Bäder im Wasser sind ihm Bedürfnis.
Das Nest findet man am häufigsten auf weiten Rasenflächen, feuchten Äckern, selten in unmittelbarer Nähe des Wassers und niemals im eigentlichen Sumpfe. Es besteht aus einer seichten Vertiefung, die zuweilen durch einige dünne Grashälmchen und zarte Wurzeln zierlich ausgekleidet wird. Die Zeit des Legens fällt in günstigen Jahren in die letzten Tage des März, gewöhnlich aber in die ersten Tage des April. Die vier verhältnismäßig großen, durchschnittlich sechsundvierzig Millimeter langen, zweiunddreißig Millimeter dicken Eier sind birnenförmig, am stumpfen Ende stark, am entgegengesetzten spitz zugerundet, feinkörnig, glattschalig und auf matt olivengrünlichem oder bräunlichem Grunde mit dunkleren, oft schwarzen Punkten, Klecksen und Strichelchen sehr verschiedenartig gezeichnet, liegen im Neste stets so, daß ihre Spitzen sich im Mittelpunkt berühren, und werden vom Weibchen immer wieder so geordnet. Letzteres brütet allein, zeitigt die Eier innerhalb sechzehn Tagen und führt die Jungen dann solchen Stellen zu, auf denen sie sich verstecken können. Beide Eltern gebaren sich, solange sie Eier und Junge haben, kühner als je, gebrauchen auch allerlei Listen, um den Feind zu täuschen. weidenden Schafen, die sich dem Nest nähern, springt das Weibchen mit gesträubtem Gefieder und ausgebreiteten Flügeln entgegen, schreit, gebärdet sich wütend und erschreckt die dummen Wiederkäuer gewöhnlich so, daß sie das Weite suchen. Auf Menschen stoßen beide mit wahrem Heldenmut herab; aber das Männchen versucht auch, indem es seinen Paarungsruf hören läßt und in der Luft umhergaukelt, durch diese Künste den Gegner irrezuführen. Die schlimmsten Feinde sind die nächtlich raubenden Vierfüßler, vor allen der Fuchs, der sich so leicht nicht betören läßt; Weihen, Krähen und andere Eierdiebe hingegen werden oft vertrieben. Sind die Jungen flugbar geworden, so gilt es nur noch, Habicht und Edelfalken auszuweichen. Ihnen gegenüber benimmt sich der kluge, gewandte Vogel sehr ungeschickt, schreit jämmerlich, sucht sich in das nächste Gewässer zu stürzen und durch Untertauchen sein Leben zu retten, ist aber im seichten Wasser jedesmal verloren.
In Deutschland wird dem Kiebitz nicht besonders nachgestellt, weil sein Fleisch mit Recht für unschmackhaft gilt; die Südeuropäer teilen diese Ansicht nicht und verfolgen die Wintergäste ebenso eifrig, als ob sie Schnepfen wären. Hier und da stellt man übrigens doch einen Kiebitzherd, und wenn man es geschickt anzufangen weiß, erlangt man auf solchem reiche Beute.
Gefangene Kiebitze sind unterhaltend, und namentlich diejenigen, die jung erlangt wurden, lernen es sehr bald, sich in die veränderten Verhältnisse zu fügen, werden zahm und zutraulich gegen den Pfleger, nehmen diesem das Futter aus der Hand, folgen ihm auch wohl eine Strecke weit nach, befreunden sich sogar mit Hunden und Katzen und maßen sich über andere Strandvögel die Oberherrschaft an. Wenn man ihnen anfänglich zerstückelte Regenwürmer vorwirft, gewöhnen sie sich auch leicht an ein Ersatzfutter, Milchsemmel nämlich, und halten bei dieser Nahrung jahrelang aus, falls man die Vorsicht braucht, sie mit Einbruch kühler Witterung in einem geschützten Räume unterzubringen.
*
Der Reisende, der den Nil herauf- oder hinabschwimmt, lernt schon in den ersten Tagen nach seinem Eintritt in das Land der Pharaonen einen Vogel kennen, den er nicht übersehen bzw. nicht überhören kann. Derselbe, unser Sporenkiebitz ( Hoplopterus spinosus), kennzeichnet sich durch echten Kiebitzschnabel, schlanke Beine, dreizehige Füße, einen scharfen, am Flügelbug sitzenden Sporn, verhältnismäßig spitze Flügel, sowie endlich eine stumpfe Holle am Hinterkopf. Das Kleid, das sich weder nach dem Geschlecht noch nach dem Alter unterscheidet, ist auf dem Mantel graubraun, auf dem Kopf, dem Unterkörper schwarz, an den Kopf-, Hals- und Bauchseiten, dem Hinterhals und in der Bürzelgegend weiß; die Handschwingen und die Steuerfedern sind in ihrer Endhälfte schwarz, die Spitzen der großen Flügeldeckfedern und der beiden äußersten Steuerfedern weiß. Die Länge beträgt etwa dreißig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge neun Zentimeter.
Unter allen ägyptischen Stelzvögeln ist dieser Kiebitz der gemeinste. Man bemerkt ihn überall, wo ein süßes Gewässer ihm den Aufenthalt möglich macht; denn vom Wasser entfernt er sich selten oder niemals weit. Aber er ist genügsam in seinen Ansprüchen und findet schon auf einem Felde, das zuweilen unter Wasser gesetzt wird, einen ihm in jeder Hinsicht zusagenden Aufenthaltsort. Die Küste des Meeres scheint er zu meiden; an den Strandseen hingegen, die brackiges und zum Teil salziges Wasser enthalten, kommt er vor.
In seinem Betragen hat der Sporenkiebitz viel Ähnlichkeit mit dem Kiebitz, scheint jedoch minder gesellig zu sein und hält sich mehr paarweise zusammen. Aber ein Paar lebt dicht bei dem andern und vereinigt sich gern auf kurze Zeit mit seinesgleichen. Wenige Vögel gibt es, die den Forscher durch ihre Allgegenwart so belästigen wie der Sporenkiebitz. Anfangs freut man sich allerdings über ihr munteres, lebendiges Wesen, über den raschen Lauf, über den leichten, schönen, strandläuferartigen Flug und die laute, wenn auch nicht gerade wohltönende, so doch nicht unangenehme Stimme, ihren Mut und ihre Kampflust; bald aber lernt man sie gründlich hassen. Sie verstehen es meisterhaft, dem Jäger und dem Naturforscher seine Jagd zu verleiden; denn sie sind nicht bloß für das kleine Strandgeflügel, sondern für alle Vögel überhaupt Wächter und Warner. Ihnen entgeht nichts. Der Jäger, der an einem der Seen eine Viertelstunde lang durch Sumpf und See gewatet ist und endlich auf dem Bauch herankriecht, um einen scheuen Flamingo oder Pelikan zu überlisten, muß zu seinem größten Ärger vernehmen, daß er von einem Paar dieser allgegenwärtigen Vögel aufgespürt wurde und Gefahr läuft, die Beute, der er sich schon ganz sicher dünkte, zu verlieren. In weiten Kreisen umfliegen die Störenfriede mit lautem »Siksak, siksäh« den Schützen, stoßen frech auf ihn herab, regen die ganze fliegende Bevölkerung des Sees auf und scheuchen alle klügeren Vögel in die Flucht. Erzürnt springt man auf, und oft genug schießt man voller Ingrimm einen der zudringlichen Gesellen aus der Luft herab. So geht es bei Tage, nicht anders bei Nacht; denn die Sage der Araber, daß der von Allah gestrafte Siksak niemals schlafe und umsonst die Ruhe suche, fußt auf Beobachtung des Vogels. Wie dem Jäger, ergeht es auch jedem andern Geschöpf, das geeignet ist, das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Seevögel zu stören. Jeder Milan, der lungernd vorüberschwärmt, jede Nebelkrähe, jeder Wüstenrabe, der naht, jeder Rohrweih und insbesondere jedes vierfüßige Raubtier wird angegriffen und oft in die Flucht geschlagen.
Die Nahrung des Sporenkiebitzes ist ungefähr dieselbe, die der deutsche Verwandte zusammensucht; man findet Kerbtiere verschiedener Art, Würmer, Muscheln und Sand in dem Magen der Getöteten. Das Fleisch nimmt von letzterem einen höchst unangenehmen Geschmack an, und der Siksak gilt deshalb bei Arabern wie bei Europäern als ungenießbar.
In Nordägypten beginnt die Fortpflanzung dieses Vogels um Mitte März; die meisten Nester findet man aber Mitte April, viele noch im Mai. In Ägypten erwählt das Pärchen zu seinem Nistort regelmäßig ein feuchtes Feldstück; am oberen Nil brütet es unter anderm Strandgeflügel auch auf Sandbänken. Ich habe ausdrücklich angemerkt, daß man drei bis sechs Eier in einem Nest finde; es erscheint mir jedoch wahrscheinlich, daß eine solche Anzahl von zwei Weibchen, die zufällig in ein und dasselbe Nest gelegt haben, herrührt, und daß eine Anzahl von vier die Regel sein wird. Die Eier sind bedeutend kleiner als die unseres Kiebitzes, etwa fünfunddreißig Millimeter lang und fünfundzwanzig Millimeter dick, denselben aber ähnlich gestaltet und auch ähnlich gezeichnet. Die Grundfarbe ist ein schwer zu beschreibendes Gemisch aus Grün, Grau und Gelb; die Zeichnung besteht aus dunklen Unter- und schwarzbraunen Oberflecken, die nur die Spitze freilassen, am stumpfen Ende aber ineinander verschwimmen. Bei Annäherung eines Menschen verläßt das brütende Weibchen die Eier, und beide Eltern gebärden sich ganz nach Art unseres Kiebitzes. In einigen Nestern fand ich feuchte Erde zwischen die Eier geschichtet oder letztere damit bedeckt, wage aber nicht zu entscheiden, ob der Vogel damit bezweckt, die Eier vor den kräftigen Sonnenstrahlen zu schützen oder aber, sie zu verbergen. Die Jungen sind anfänglich mit graubunten Daunen bedeckt, bekommen schon nach wenigen Tagen ein Jugendkleid, das dem der Alten vollständig ähnlich ist, anfangs aber noch mit Flaum überkleidet ist. Sie verlassen bald nach dem Auskriechen das Nest, haben im wesentlichen das Betragen aller kleinen Sumpfvögel, einen erstaunlich schnellen Lauf und wissen sich bei Gefahr geschickt zu verbergen.
Während meines Aufenthaltes in Afrika habe ich oft Sporenkiebitze gefangen und kurze Zeit unterhalten. Sie nahmen ebenso wie unser Kiebitz mit einfachem Futter vorlieb und schienen sich sehr bald an den Verlust ihrer Freiheit zu gewöhnen.
*
Die Regenpfeifer im engsten Sinne ( Charadrius) kennzeichnen sich durch mäßig langen, verschieden dicken, an der Wurzel weichen, an der Spitze kolbigen Schnabel, ziemlich hohe, gewöhnlich dreizehige, bis gegen das Fersengelenk hinab befiederte Füße, spitze Flügel, mäßig langen, zugerundeten Schwanz und buntes, je nach der Jahreszeit meist verschiedenes Gefieder.
Als Verbindungsglied der Kiebitze und Regenpfeifer gilt der Kiebitzregenpfeifer ( Charadrius squatarola). Stirnrand, Zügel, Kinn, Kehle, Vorderhals, Brust und Bauch sind schwarz, der Vorderkopf und ein breiter, von der Stirn beginnender, das Schwarz begrenzender Streifen, Steiß und Unterschwanzdecken weiß, die ganze Oberseite schwarzweiß gefleckt, die Handschwingen schwarz, die Armschwingen schwarzbraun, die Schwanzfedern weiß und mit schwarzen Querbinden geziert, die Bürzel- und Oberschwanzdecken gleich gefärbt und ähnlich gebändert. Im Winterkleide ist die Oberseite auf braunschwarzem Grund durch verschieden große, rundliche, gelblichweiße Flecke, die Unterseite, mit Ausnahme der weißen Brustmitte, auf schmutzigweißem Grund mit dunklen, verschieden breiten Schaftstrichen gezeichnet. Beide Geschlechter tragen fast dasselbe Kleid; das des Weibchens zeigt jedoch im Sommer mehr Weiß auf der Unterseite. Die Länge beträgt dreißig, die Breite sechsundsechzig, die Fittichlänge zwanzig, die Schwanzlänge neun Zentimeter.
Wie der zu beschreibende Gold- bewohnt auch der Kibitzregenpfeifer die Tundra, jedoch nur deren nördlichste Teile und, dem Anscheine nach, bloß das Küstengebiet des Meeres, vielleicht mit Ausnahme Islands, Spitzbergens und Nowaja Semljas, woselbst er noch nicht beobachtet wurde. Von hier aus durchwandert er allwinterlich fast die ganze Erde; nur in den südlichsten Ländern Amerikas und auf Neuseeland hat man ihn noch nicht gefunden. Deutschland durchreist er im September, Oktober und November oder, heimwärts wandernd, in den Monaten März bis Juni; den Winter verbringt er zum Teil schon im Mittelmeerbecken, zum Teil in allen übrigen Ländern seines Gebietes, den kurzen Sommer, vom Juni bis zum Beginn des September, in seiner Heimat; gegen Ende Juni beginnt er zu brüten; um die Mitte August, spätestens zu Anfang September, sind seine Jungen flügge, wenige Tage später reisefähig. Dies ist, mit kurzen Worten gezeichnet, der Jahreslauf dieses Vogels.
In seinem Auftreten ähnelt der Kiebitzregenpfeifer seinem bekannteren Verwandten fast in jeder Beziehung. Haltung, Gang und Flug beider Arten stimmen so miteinander überein, daß nur ein sehr erfahrener Beobachter beide zu unterscheiden vermag; auch beider Sitten und Gewohnheiten, selbst die Stimmlaute sind bis auf geringfügige Abweichungen dieselben.

Goldregenpfeifer mit Jungen ( Charadrius pluvialis)
Der Goldregenpfeifer ( Charadrius pluvialis) ist merklich kleiner als der Kiebitzregenpfeifer, von diesem leicht an seinem dreizehigen Fuß zu unterscheiden, dem Verwandten aber so ähnlich gefärbt und gezeichnet, daß man ihn beschreibt, wenn man angibt, daß aus der Oberseite Goldgrüngelb vorherrscht, weil alle Federn hier so gefärbte Ränder zeigen. Diese goldgrüne Färbung spricht sich auch im Winterkleide noch deutlich genug aus, um eine Verwechslung mit jenem zu verhüten. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarzgrau. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite achtundfünfzig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter.
Auch der Goldregenpfeifer ist Charaktervogel der Tundra. Wenn man durch jene Moore wandert, die sich über den ganzen Norden der Erde erstrecken, hört man von allen Seiten her den schwermütigen, fast kläglichen Ruf dieses Vogels erschallen, sieht ihn Paar bei Paar, in kleinen Trupps, in Familien, und in zahlreichen Flügen, je nach der Zeit des Sommers, begegnet ihm überall, wohin man sich auch wenden mag; denn ein Paar wohnt dicht neben dem andern, und der Jäger, der hier ihn sich zur Beute ausersieht, kann vom frühen Morgen bis zum späten Abend ununterbrochen seiner Jagd obliegen. Gegen den siebenundfünfzigsten nördlichen Breitengrad beginnt er seltener zu werden, und schon in Deutschland brütet er nur sehr vereinzelt. Aber er besucht unser Vaterland alljährlich zweimal gelegentlich seiner Reise nach dem Süden, die er mit Ende des September beginnt und im März beendet. Ist der Winter gelinde, so verweilt er auch in den dazwischen liegenden Monaten als Gast im mittleren Deutschland; das große Heer aber geht weiter südlich, von Lappland und Finnland aus bis in die Mittelmeerländer und Nordwestafrika, von Nordasien aus bis Indien und China, und Von dem hohen Norden Amerikas aus nach dem Süden der Vereinigten Staaten, selbst bis nach Brasilien. Die Reise wird gewöhnlich in Gesellschaft angetreten und hauptsächlich während der Nacht ausgeführt. Die ziehenden Regenpfeifer fliegen dabei sehr hoch, zuweilen regellos, meist aber in einem geordneten Keile nach Art unseres Kranichs. Bei Tage ruht solche Wanderschar auf einer geeigneten Örtlichkeit, gewöhnlich auf Feldern, aus, um Futter zu suchen, und wenn das Wetter gelind ist, verbringt sie hier auch wohl den ganzen Winter.
In seinem Wesen unterscheidet sich der Goldregenpfeifer wenig von andern seiner Sippe und seiner Familie. Er ist ein munterer, flüchtiger Vogel, der vortrefflich läuft, d.+h. entweder zierlich einherschreitet oder überaus schnell dahinrennt und nur nach langem Laufe ein wenig stillsteht, rasch und gewandt fliegt, beim Durchmessen weiterer Entfernungen nach Art einer flüchtigen Taube dahineilt, in der Nähe des Nestes aber sich in allerlei schönen Schwenkungen und Flugkünsten gefällt, dessen wohlklingendes, helltönendes Pfeifen, den Silben »Tlüi« etwa vergleichbar, trotz seiner schwermütig erscheinenden Betonung angenehm ins Ohr fällt, der aber auch in der Zeit der Liebe zu einem gesangartigen Triller »Talüdltalüdltalüdltalüdl« sich begeistert. Würmer und Kerbtierlarven bilden die Hauptnahrung; im Sommer frißt er fast ausschließlich Stechmücken in allen Lebenszuständen, gelegentlich des Zuges Käfer, Schnecken, Regenwürmer und dergleichen, verschluckt auch, um die Verdauung zu befördern, kleine Quarzkörnchen. Wasser ist ihm unentbehrlich, ebensowohl des Trinkens wie des Badens halber, und wahrscheinlich läßt er keinen Tag vorübergehen, ohne sein Gefieder zu waschen und dadurch zu reinigen.
Der Goldregenpfeifer nistet einzeln in unserm Vaterlande, so z.+B. auf den Heiden des Münsterlandes, nach Naumann auch in der Lüneburger Heide und in Westjütland; seine eigentlichen Brutplätze sind jedoch in der Tundra zu suchen. Hier sieht man die artigen Liebesspiele des Männchens allüberall, und hier findet man, ohne sich anzustrengen, leicht Nester mit Eiern oder Jungen in hinreichender Menge. Das Männchen schwenkt sich selbstgefällig in der Luft, schwebend und dabei singend, stürzt sich zum Weibchen herab, umgeht dieses nickend, ab und zu einen Flügel breitend, und das Weibchen erwidert die Werbung, so gut es vermag. Eine kleine napfförmige, seichte Vertiefung, die von letzterem ausgescharrt und höchstens mit einigen dürren Hälmchen belegt wird, dient zum Neste. Das Gelege besteht aus der üblichen Anzahl verhältnismäßig sehr großer, etwa sechsundvierzig Millimeter langer, fünfunddreißig Millimeter dicker, kreiselförmiger Eier, die sich durch ihre glatte, glanzlose, feinkörnige Schale, ihre trüb oder bleich olivengelbe Grundfarbe und die reiche, in verschiedener Weise verteilte, zuweilen kranzförmig um das Ei laufende, aus Dunkelschwarzbraun oder Braunrot gemischte Zeichnung kenntlich machen, aber vielfach abändern. Je nach der nördlichen oder südlichen Lage des Wohnplatzes ist das Gelege früher oder später vollständig. Die Jungen werden noch am ersten Tage ihres Lebens dem Neste entführt und bringen die ihrer Familie eigentümliche Kunst des Versteckens sozusagen mit auf die Welt. Beide Eltern setzen, wenn sie Junge haben, jede Rücksicht aus den Augen und bewerfen wahrhaft rührende Zärtlichkeit gegen die Jungen. Werden die ersten Eier geraubt, so entschließt sich das Paar zu einer zweiten Brut; in der Regel aber brütet es nur einmal im Jahre.
Der Mornell oder Alpenregenpfeifer ( Charadrius morinellus) trägt ein Kleid, das der Bodenfärbung einer Gebirgshalde vortrefflich entspricht. Das Gefieder des Oberkörpers ist schwärzlich, wegen der rostroten Federränder lichter gezeichnet, der graue Kopf durch einen schmalen schwarzen und einen weißen Gürtel von der Brust getrennt, diese rostrot, die Unterbrust in der Mitte schwarz, der Bauch weiß; über das Auge verläuft ein breiter lichter, im Nacken zusammenlaufender Streifen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß grünlichgelb. Das Weibchen ist minder schön, dem Männchen aber ähnlich. Die Länge beträgt dreiundzwanzig, die Breite sechsundvierzig, die Fittichlänge fünfzehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Gelegentlich einer Renntierjagd auf den Hochrücken der Fjelds des Dovregebirges und unmittelbar unter der Grenze des schmelzenden Schnees lernte ich den Mornell zuerst als Brutvogel kennen; später fand ich, daß er überall im Norden, aber nur an ähnlichen Orten, gegen das Nordkap hin allerdings auf niedrigeren Bergrücken, immer aber im Alpengebiete, beziehentlich in der Hochtundra, gefunden wird. Sein Brutgebiet reicht von Finnmarken bis ins Taimirland und von Spitzbergen oder Nowaja Semlja bis Mitteldeutschland und Mittelsibirien, sein Wandergebiet bis Kleinasien, Persien und Algerien. In unserm Vaterlande bewohnt er wohl nur den Kamm des Riesengebirges, in Großbritannien das schottische Hochland. Gelegentlich seiner Winterreisen besucht er Deutschland, Frankreich, Ungarn und Norditalien regelmäßig, zieht aber selten weiter als bis in die Mittelmeerländer oder die diesen entsprechenden Gegenden Mittelasiens. Er verläßt bereits im August seine Heimat und kommt selten früher als im April dahin zurück, beginnt aber freilich sofort nach seiner Ankunft das Brutgeschäft. Seine Wanderung tritt er in kleineren oder größeren Gesellschaften an, und während der Reife bewegt er sich ebensowohl bei Tage wie bei der Nacht.
Ich zähle den Mornell zu den anziehendsten Mitgliedern seiner Familie; es mag aber sein, daß diejenigen, die ich beobachten konnte, mich besonders fesselten, weil sie gerade brüteten. Auf seinem Brutplatze zeigt er wenig Scheu vor dem Menschen, gewiß aber nur, weil er diesen in seiner sicheren Höhe so selten zu sehen bekommt. Seine Haltung ist ungemein zierlich, der Gang anmutig und behend, dabei leicht und rasch, der Flug äußerst gewandt, wenn Eile not tut, pfeilschnell, durch wundervolle Schwenkungen ausgezeichnet, seine Stimme ein sanfter, flötenartiger, höchst angenehmer Ton, der durch die Silben »Dürr« oder »Dürü« ungefähr ausgedrückt werden mag, sein Wesen friedlich und gesellig. Nur derjenige, der das Pärchen umringt sieht von den drei oder vier kleinen Küchlein, kann die ganze Lieblichkeit und Anmut dieses Vogels würdigen. Auf jenen Höhen findet man im Mai und Juni das einfache Nest, eine flach ausgescharrte, mit einigem trockenen Gewurzel und Erdflechten ausgekleidete Grube, in der vier, oft aber nur drei Eier von birnförmiger Gestalt, vierzig Millimeter Längs- und achtundzwanzig Millimeter Querdurchmesser, feiner und glatter, glanzloser Schale, hell gelbbräunlicher oder grünlicher Färbung und dunkler, unregelmäßiger Fleckenzeichnung liegen. Die Mutter sitzt auf dem Neste so fest, daß sie sich fast ertreten läßt, weiß aber auch, wie sehr sie auf ihr Bodengewand vertrauen darf. Wenn erst die Küchlein ausgeschlüpft sind, gewährt die Familie ein reizendes Bild. Ich habe es nur einmal über mich vermocht, ein Pärchen nebst seinen Jungen zu töten, andern aber kein Leid antun können; denn das Gefühl überwog den Sammeleifer. Angesichts des Menschen verstellt sich die Mutter, die Junge führt, meisterhaft, während der Vater seine Besorgnis durch lautes Schreien und ängstliches Umherfliegen zu erkennen gibt. Die Mutter läuft, hinkt, flattert, taumelt dicht vor dem Störenfriede einher, so nahe, daß die mich begleitenden Lappen sich wirklich täuschen ließen, sie eifrig verfolgten und die kleinen niedlichen Küchlein, die sich geduckt hatten, vollständig übersahen. Unmittelbar vor mir lagen sie alle drei, den Hals lang auf den Boden gestreckt; jedes einzelne teilweise hinter einem Steinchen verborgen, die kleinen, hellen Äuglein geöffnet, ohne Bewegung, ohne durch ein Zeichen das Leben zu verraten. Ich stand dicht vor ihnen, sie rührten sich nicht. Die Alte führte meine Lappen weiter und weiter, täuschte sie um so mehr, je länger die Verfolgung währte; plötzlich aber schwang sie sich auf und kehrte pfeilschnell zu dem Orte zurück, wo die Jungen verborgen waren, sah mich dort stehen, rief, gewahrte keines von den Kindern und begann das alte Spiel von neuem. Ich sammelte die Küchlein, die sich willig ergreifen ließen, nahm sie in meine Hände und zeigte sie der Mutter. Da ließ diese augenblicklich ab von ihrer Verstellung, kam dicht an mich heran, so nahe, daß ich sie wirklich hätte greifen können, blähte das Gefieder, zitterte mit den Flügeln und erschöpfte sich in allen ihr zu Gebote stehenden Gebärden. Von meinen Händen aus liefen die kleinen Dingerchen auf den Boden herab; ein unbeschreiblicher Ruf von der Mutter, und sie waren bei ihr. Nun setzte sich die Alte vor mir nieder, huderte die Kleinen, die ihr behend unter die Federn geschlüpft waren, wie eine Henne, und verweilte mehrere Minuten auf derselben Stelle. Ich wußte, daß ich meinem Vater und andern Vogelkundigen die größte Freude bereitet haben würde, hätte ich ihnen Junge im Dunenkleide mit heimgebracht; aber ich vermochte es nicht, Jäger zu sein. Leider denken gewisse Eiersammler anders; ihnen haben wir die hauptsächlichste Schuld zuzuschreiben, daß der liebliche Vogel auf unsern norddeutschen Alpen, auf den Höhen des Riesengebirges, fast ausgerottet worden ist.
Während des Zuges teilt der Mornell alle Gefahren, die dem Goldregenpfeifer drohen, und wird wegen seiner harmlosen Zutraulichkeit wohl noch öfter erlegt als jener. Sein Wildbret ist freilich das zarteste und wohlschmeckendste von allem Federwild; es übertrifft selbst das der Schnepfenarten.
Auf flachen Kies- und Sandufern der Flüsse und ebenso an der Küste des Meeres, immer aber an freien Gewässern, nicht an Sümpfen, treiben sich auch in Deutschland mehrere Arten der Familie umher, die sich kennzeichnen durch verhältnismäßig geringe Größe, schwachen Schnabel, lange, spitzige Flügel und ein sehr übereinstimmendes Gefieder, das auf der Oberseite sandfarben, auf der Unterseite weiß aussieht und durch ein Halsband geschmückt wird, weshalb man die bezüglichen Arten unter dem Namen Bandregenpfeifer zusammengestellt hat.
Die bekannteste Art dieser Gruppe ist unser Flußregenpfeifer, auch Strandpfeifer genannt ( Charadrius fluviatilis), ein Vogel, der unsere Lerche an Größe kaum übertrifft. Wangen, Scheitel und Oberkörper sind erdgrau, die Unterteile bis auf die Halszeichnung weiß, auf der Stirne steht ein schmales, schwarzes Band, an das sich ein breites, weißes reiht, das wiederum nach hinten zu durch ein schwarzes begrenzt wird; die Zügel sind schwärzlich, der Kropf und ein von ihm aus nach hinten sich ziehendes Band tiefschwarz, die Schwingen dunkelbraun, die äußeren beiden Schwanzfederpaare weiß, die übrigen braun. Das Auge ist dunkelbraun, ein ziemlich breiter Ring um dasselbe königsgelb, der Schnabel schwarz, eine schmale Stelle an der Wurzel gelblich orangefarben, der Fuß rötlichgrau. Beim Weibchen sind die Farben blasser; den Jungen fehlt das schwarze Stirnband. Man hat den Flußregenpfeifer in ganz Europa, fast ganz Afrika und ebenso beinahe in ganz Asien gefunden. Die südlichen Gegenden berührt er wohl nur während seines Zuges, der ihn im August oder September von uns wegführt und ihn im März oder September uns wiederbringt; noch im äußersten Süden Europas aber gehört er unter die Brutvögel. Im Norden hält er sich fast ausnahmslos an den Ufern von Binnengewässern, fern vom Meere, auf; in der Winterherberge bevorzugt er ähnliche Orte, kommt jedoch gelegentlich auch einmal am Seestrande vor. Er reist in großen Gesellschaften und hält sich in der Fremde stets in ziemlichen Schwärmen zusammen.
Ihm ähnlich, aber merklich größer ist der Halsband- oder Sandregenpfeifer ( Charadrius hiaticula). Bei ihm sind ein schmaler Saum an der Wurzel des Oberschnabels, der Vorderscheitel und ein mit beiden zusammenhängender breiter Zügel- und Ohrstreifen sowie ein sehr breites Kropfquerband schwarz, ein schmales, vom Schwarz eingeschlossenes Stirnquerband, Schläfengegend, Kinn, Kehle und ein von hier ausgehendes, nach hinten sich verschmälerndes Halsringband sowie alle übrigen Unterteile weiß, der Scheitel und die ganze Oberseite erd- oder hellolivenbraun, die Schwingen und die Schwanzfedern braunschwarz. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel an der Wurzel orangegelb, an der Spitze schwarz, der Fuß rötlich orangefarben. Die Länge beträgt neunzehn, die Breite neununddreißig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Der Halsbandregenpfeifer bewohnt den Norden der Alten Welt, brütet in ganz Europa und verbreitet sich bis zur Südspitze Afrikas und über ganz Asien bis Australien, nimmt seinen Sommerstand aber regelmäßig am Seestrande und aus andern sandigen Strecken in der Nähe der See.
Der Seeregenpfeifer ( Charadrius cantianus) endlich, der in der Größe zwischen Fluß- und Halsbandregenpfeifer ungefähr mitteninne steht, unterscheidet sich von beiden durch den Mangel des dunklen Kropfquerbandes. Das Verbreitungsgebiet umfaßt, mit Ausnahme des hohen Nordens, der indischen Inseln, Australiens und Amerikas, die ganze Erde; das Brutgebiet beschränkt sich auf die Küsten der Meere.

Flußuferläufer ( Tringoides hypoleucus) und Halsbandregenpfeifer ( Charadrius hiaticula)
Raummangel verbietet mir, die Lebensweise jedes dieser Regenpfeifer besonders zu schildern; ich muß mich daher auf ein flüchtiges Lebensbild des Flußregenpfeifers beschränken. Er ist, wie alle Glieder seiner Familie, halber Nachtvogel, also besonders im Zwielicht rege, in Mondscheinnächten lebendig, jedoch auch übertags tätig, kann ungemein schnell laufen und vortrefflich fliegen, tut letzteres in den Mittagsstunden aber nur sehr selten, während er des Abends und Morgens seine Bewegungslust in jeder Weise zu erkennen gibt. Der Lockton läßt sich durch die Silbe »Dia« oder »Deä« ungefähr wiedergeben, der Warnungsruf klingt wie ein kurz ausgesprochenes »Diü«, die Liebeswerbung ist ein förmlicher, mit einem Triller endigender Gesang, wie »Düh, dü, düll, düll, lüllül, lüll«. Mit andern seiner Art lebt er, kleine Raufereien im Anfange der Brutzeit etwa abgerechnet, im besten Einvernehmen, hängt mit unerschütterlicher Liebe an seinem Gatten oder an seiner Brut, begrüßt jenen nach kürzester Abwesenheit durch Töne, Gebärden und Stellungen, zeigt sich da, wo er geschont wird, äußerst zutraulich, da, wo er Verfolgungen erfahren mußte, scheu und vorsichtig und gewöhnt sich, selbst alt gefangen, bald an den Verlust seiner Freiheit, wird auch in der Regel sehr zahm. Seine Nahrung besteht aus verschiedenen Kerbtieren und deren Larven, auch wohl Muscheln und kleinen Weichtieren; er wendet Steine um und jagt selbst im Wasser, trinkt oft und viel und badet sich ein- oder zweimal täglich, wie denn Wasser überhaupt wahres Lebensbedürfnis für ihn ist.
Das Nest, eine einfache Vertiefung, die das Weibchen ausgekratzt und zugerundet hat, steht regelmäßig auf kiesigen Strecken der Flußufer, die voraussichtlich einer Überschwemmung nicht ausgesetzt werden, manchmal einige hundert Schritte vom Wasser entfernt, und enthält um Mitte Mai vier niedliche Eier von neunundzwanzig Millimeter Längen- und zweiundzwanzig Millimeter Querdurchmesser, deren Färbung dem Kiesel ringsum täuschend ähnelt, da ihre zarte, glanzlose Schale auf bleichrostgelbem Grunde mit aschgrauem Unter- und schwarzbraunen, gröberen und feineren Oberflecken und Punkten, zuweilen kranzartig, gezeichnet ist. Beide Eltern brüten sehr wenig; denn die Sonnenstrahlen vermitteln übertags gleichmäßige Entwicklung des Keimes, und nur bei Regenwetter oder des Nachts sitzen die Alten viel auf den Eiern. Nach fünfzehn bis siebzehn Tagen schlüpfen die Jungen aus und verlassen, sobald sie abgetrocknet sind, das Nest mit den Eltern, die nun alle Zärtlichkeit, deren sie fähig sind, an den Tag legen. Anfänglich tragen sie die Atzung den Jungen im Schnabel zu; schon nach ein paar Tagen aber sind diese hinlänglich unterrichtet, um sich selbst zu ernähren. Das Versteckenspielen verstehen sie vom ersten Tage ihres Lebens an. In der dritten Woche ihres Daseins können sie, laut Naumann, die Fürsorge der Eltern bereits entbehren; doch halten sie sich zu diesen, bis sie völlig erwachsen sind, bleiben selbst während des Zuges noch in Gesellschaft ihrer Erzeuger.
Gefangene Regenpfeifer zählen zu den anmutigsten Stubenvögeln, verlangen jedoch sorgfältige Pflege, wenn sie ausdauern sollen. Anfänglich scheu und wild, gewöhnen sie sich doch bald an Pfleger und Käfig und bekunden zuletzt warme Hingebung an ihren Gebieter.
*
»Wenn das Krokodil mit gähnendem Rachen auf dem Lande liegt«, erzählt Plinius, Herodots Mitteilungen benutzend, »fliegt der Vogel Trochilus herbei, schlüpft ihm ins Maul und reinigt dasselbe. Das tut dem Krokodile wohl, und es schont daher den Vogel; ja es öffnet den Rachen weiter, damit er sich nicht drückt, wenn er heraus will. Dieser Vogel ist klein, nicht größer als eine Drossel, hält sich in der Nähe des Wassers aus und warnt das Krokodil vor dem Ichneumon, indem er herbeifliegt und es teils durch seine Stimme, teils durch Picken an der Schnauze aufweckt.« Diese Angabe, die man am liebsten ins Gebiet der Fabel verweisen möchte, ist tatsächlich begründet; denn der Freundschaftsbund zwischen dem Krokodile und seinem Wächter, wie die Araber den Vogel nennen, besteht heute noch.
Der Krokodilwächter ( Hyas aegyptia) ist der Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Hyas). Seine Gestalt ist gedrungen, der Kopf mittelgroß, verhältnismäßig kleiner als bei den Regenpfeifern, der Schnabel von mehr als halber Kopflänge und ziemlich kräftig, der Flügel so lang, daß er das Ende des Schwanzes erreicht; die Federn des Hinterkopfes verlängern sich etwa über die andern, so daß sie eine kurze Holle bilden. Oberkopf, ein breiter Zügelstreifen, der sich im Genicke vereinigt, Nacken, ein breites Brustband und die verlängerten schmalen Rückenfedern sind schwarz, ein Augenbrauenstreifen, Kehle und Gurgel sowie die ganze übrige Unterseite aber weiß, seitlich und an der Brust blaß rotbraun, in der Steißgegend in Bräunlich-Isabellfarben übergehend, die Schwingen in ihrer Mitte und an der Spitze schwarz, an der Wurzel und vor der Spitze aber weiß, so daß zwei breite Bänder entstehen, die den geöffneten Flügeln zum größten Schmucke werden, die Steuerfedern blaugrau, an der Spitze weiß, vor ihr durch ein schwarzes Band gezeichnet. Das Auge ist lichtbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß lebhaft bleigrau. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Der Krokodilwächter, dessen Bild auf den altägyptischen Denkmälern oft dargestellt wurde, da es in dem hieroglyphischen Alphabet das U ausdrückt, ist häufig im ganzen Nilgebiete. Von Kairo an stromaufwärts vermißt man ihn an keiner geeigneten Stelle des Nilufers. Sein Verbreitungskreis reicht so weit nach Süden, als ich selbst gekommen bin; ich habe ihn aber immer nur am Nile selbst gesehen und darf also diesen Strom für den Nordosten Afrikas als seine eigentliche Heimat bezeichnen. Er gehört weder zu den Zug- noch zu den Strichvögeln. Wenn möglich, wählt er eine Sandbank zu seinem Standorte und hält an diesem fest, solange ihn der Hochstand des Wassers nicht zum Verlassen desselben zwingt.
Schwerlich dürfte es einen Nilreisenden geben, dem der schmucke, lebendige, gewandte und schreilustige Vogel nicht aufgefallen wäre. Er macht sich bemerklich, wenn er mit der seiner Familie eigenen Eilfertigkeit dahinrennt, und noch bemerklicher, wenn er über dem Wasser wegfliegt und dabei seine volle Schönheit, die weiß und schwarz gebänderten Schwingen, entfaltet. Sein Lauf ist sehr gewandt, geschieht aber nicht ruckweise; der Flug fördert, den spitzigen Schwingen entsprechend, sehr rasch, scheint auch durchaus nicht zu ermüden, wird aber selten weit ausgedehnt. Der Krokodilwächter fliegt höchstens von einer Sandbank zur andern und dabei stets sehr niedrig über dem Wasser dahin, niemals nach Art unserer Regenpfeifer oder Strandläufer, die sobald wie möglich eine gewisse, ihnen sicher dünkende Höhe zu erreichen suchen. Während des Fluges vernimmt man regelmäßig seine laute, pfeifende Stimme, die aus einer Reihe von Tönen besteht und ungefähr wie »Tschip-tschip-hoit« klingt. Aber auch im Sitzen oder Umherlaufen läßt sich der Vogel oft vernehmen; denn er ist ebenso redselig, wie sein Verwandter schweigsam.
Seinen aus dem Arabischen übersetzten Namen trägt er mit vollstem Rechte, leistet jedoch nicht bloß dem Krokodile, sondern allen übrigen Geschöpfen, die auf ihn achten wollen, Wächterdienste. Jedes Schiff, jeder nahende Mensch, jedes Säugetier, jeder größere Vogel erregt seine Aufmerksamkeit, und er beeilt sich, durch lebhaftes Geschrei dies kundzugeben. Mit dem Krokodile lebt er wirklich in Freundschaft, aber nicht etwa, weil das gefräßige Kriechtier wohlwollende Gefühle für ihn hegt, sondern weil seine Gewandtheit ihn vor böswilligen Gelüsten sichern. Ohne Besorgnis läuft er auf dem Rücken der Panzerechse auf und nieder, als ob dieser ein Stück grünen Rasens wäre, unbekümmert liest er Kerbtiere und Egel ab, die das Krokodil schröpfen wollen, wagt sich sogar daran, seinem gewaltigen Freunde die Zähne zu putzen, d.+h. buchstäblich Brocken, die zwischen denselben hängen blieben, oder Tiere, die sich an den Kinnladen und dem Zahnfleische festsetzten, wegzunehmen: ich habe das gesehen, und zwar zu wiederholten Malen. In der Achtsamkeit beruht auch der Dienst, den er dem Reptil leistet. Das Geschrei, das er beim Anblicke eines ihm fremdartig oder gefährlich dünkenden Wesens oder Gegenstandes ausstößt, erweckt das schlafende Krokodil und läßt diesem geraten erscheinen, sich in die sicheren Fluten zurückzuziehen.
Es ist möglich, daß unser Vogel dann und wann ein Samenkorn mit verzehrt; seine gewöhnliche Nahrung aber entnimmt er dem Tierreiche. Er frißt Kerbtiere aller Art, namentlich Sandkäfer, Fliegen, Wasserspinnen, Gewürm, kleine Muscheln, Fische und, wie aus der angegebenen Beobachtung hervorgeht, auch Brocken vom Fleische größerer Wirbeltiere.
Die List des Krokodilwächters zeigt sich deutlich gelegentlich seines Fortpflanzungsgeschäftes. Nur einmal ist es mir gelungen, das Nest des häufigen Vogels aufzufinden, obgleich ich zu allen Jahreszeiten und insbesondere, wenn die Zergliederung der erlegten Stücke mich lehrte, daß die Brutzeit eingetreten war, nach Nestern und Eiern gesucht habe. Ein Zufall ließ mich entdecken, wie es der schlaue Gesell anfängt, seine Eier vor dem Auge eines Feindes zu verbergen. Durch das Fernrohr beobachtete ich längere Zeit ein Pärchen, von dem der eine Gatte auf dem Sande saß, während der andere in seiner gewöhnlichen Weise hin- und herlief. Ich vermutete, daß der sitzende mit Brüten beschäftigt sein möge, nahm mir die Stelle fest ins Auge und ging langsam auf dieselbe zu. Zu nicht geringem Erstaunen bemerkte ich, daß der Vogel, als ich etwa bis auf hundert Schritte herangekommen war, mit einer gewissen Vorsicht aufstand, eilfertig scharrte, sodann zum andern rannte und mit diesem scheinbar gleichgültig sich entfernte. Bei der betreffenden Stelle angekommen, konnte ich zunächst nichts unterscheiden, und mehr zufällig als infolge meines Suchens entdeckte ich endlich eine Unebenheit im Sande, grub nach und hatte zwei Eier in den Händen, die vollständig mit Sand überdeckt gewesen waren und, wenn die Mutter mehr Zeit gehabt hätte, gewiß so überdeckt worden wären, daß man auch die Mulde nicht wahrgenommen haben würde. Die Eier dieser Vögel gehören zu den schönsten, die Stelzvögel überhaupt legen. In Gestalt und Korn ähneln sie den Eiern des Wüstenläufers, in der Größe denen der Brachschwalbe. Ihr Längendurchmesser beträgt etwa neunundzwanzig, ihr Querdurchmesser dreiundzwanzig Millimeter; ihre Färbung ist ein rötliches Sandgelb, die Zeichnung ein helleres und tieferes Rotgrau, die Oberzeichnung ein lebhaftes Kastanienbraun, die mit dem Grau Flecke, Punkte, Striche und Wurmlinien bildet und die Oberfläche ziemlich gleichmäßig bedeckt.
*
Unter dem kleinen Strandgewimmel, das die Küste des Meeres belebt, bemerkt man hier und da auch einen schön gezeichneten, äußerst lebendigen Vogel, der sich von den übrigen nicht bloß durch seine Gestalt, sondern in mancher Hinsicht auch durch sein Betragen auszeichnet. Man hat diesen Vogel, den Steinwälzer, so ziemlich auf der ganzen Erde gefunden, überall vorzugsweise am Meere und nur während der Zugzeit, jedoch immer sehr einzeln, an Binnengewässern.
Der Steinwälzer ( Strepsilas interpres) darf als Vertreter einer besonderen Unterfamilie ( Strepsilinae) betrachtet werden. Der Leib ist kräftig, der Kopf verhältnismäßig groß und hochstirnig, der Schnabel kürzer als der Kopf, kegelförmig, ein wenig und sanft aufwärts gebogen, das Bein verhältnismäßig niedrig, aber kräftig, der Fuß vierzehig, der Flügel lang und spitzig, der zwölffederige Schwanz kaum mittellang, sanft abgerundet, das Gefieder ziemlich reich, jedoch knapp anliegend, durch lebhafte Färbung ausgezeichnet. Beim alten Vogel im Sommerkleide sind Stirne, Wangen, ein breites Halsband im Nacken, Unterrücken, Kehle und Unterdeckfedern der Flügel sowie ein Streifen über dem Flügel rein weiß, ein Streifen, der auf der Stirne beginnt, neben dem Auge vorüber- und am Halse herabläuft, der Vorderhals, die Seiten des Halses und der Brust schwarz, die Federn des Mantels schwarz und rot gefleckt; die des Scheitels weiß und schwarz in die Länge gestreift, die Flügeldeckfedern kastanienbraunrot, schwarz gefleckt? der Bürzel zeigt eine breite braune Binde? die Schwingen sind schwärzlich, die Steuerfedern an der Wurzel und an der Spitze weiß, gegen das Ende hin von einer breiten schwarzen Binde durchzogen. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß orangegelb. Die Länge beträgt vierundzwanzig, die Breite achtundvierzig, die Fittichlänge fünfzehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.
Man darf annehmen, daß der Steinwälzer hauptsächlich den Meeresküsten entlang zieht und deshalb so selten das Innere des Landes besucht. In Skandinavien, aus Island und in Grönland erscheinen die ersten Steinwälzer von den letzten Tagen des April an bis Mitte des Mai und Herlassen diese Gegend schon zu Ende des August wieder. Zur selben Zeit gewahrt man die ersten bereits an der Küste des Mittelmeeres, und zwar an der nördlichen ebenso gut wie an der südlichen. In der Sommerherberge lebt der Vogel paarweise und nur um die Zugzeit in kleineren Gesellschaften; in der Winterherberge vereinigt er sich zwar hauptsächlich mit den kleinen Strandläufern, bildet aber doch auch selbständige Flüge, die bis zu bedeutender Anzahl anwachsen können. Letztere entfernen sich nur dann von der eigentlichen Küste des Meeres, wenn in deren Nähe ein Salzwassersee liegt.
Schönheit des Gefieders, Lebhaftigkeit, Munterkeit und leichte Bewegung zeichnen den Steinwälzer aus. Eigentlich ruhig sieht man ihn selten; höchstens in den Mittagsstunden verträumt er ein paar Minuten, still auf einer und derselben Stelle sitzend. Während der Zeit des übrigen Tages ist er in steter Bewegung, vom Morgen bis nach Sonnenuntergang, oft auch noch des Nachts. Er geht trippelnd, wenn er Nahrung sucht, ziemlich langsam, vermag aber rennend ungemein rasch weite Strecken zu durchmessen, obgleich er die Gewohnheit hat, ein Stück schußweise fortzulaufen, dann auf irgendeiner kleinen Erhöhung eine Zeitlang stillzuhalten und von neuem wegzuschießen. Im Fluge bekundet er die Meisterschaft seiner Verwandten, versteht pfeilschnell dahinzufliegen, gewandt zu schwenken und zu wenden und bewegt sich dicht über der Erde fort ebenso sicher wie in höheren Luftschichten. Seine Stimme mag als ein gellendes, schneidendes Pfeifen bezeichnet werden; denn sie besteht nur aus einem Laute, welchen man durch die Silbe »Kie« etwa wiedergeben kann. Dieser eine Laut wird bald länger gedehnt, bald schnell nacheinander hervorgestoßen, so daß er sehr verschieden in das Ohr des Beobachters fällt. Am Meeresstrande gehört der Steinwälzer überall zu den vorsichtigsten Vögeln. Er läßt gern andere, größere Strandvögel für seine Sicherheit wachen, übernimmt aber, wenn er sich unter den kleineren Strandläufern umhertreibt, auch seinerseits das Amt des Warners und Wächters und weiß sich sehr bald Beachtung zu verschaffen. Verfolgung macht ihn überaus scheu.
Solange er in Tätigkeit ist, geht er seiner Nahrung nach. Diese besteht aus allerlei kleinem Meergetiere, vorzugsweise also aus Würmern und zarten Muscheltieren, die er aus dem Sande bohrt oder durch Umdrehen der Steine erbeutet: daher sein Name. Kerbtiere, die sich über der Flutgrenze aufhalten, werden von ihm selbstverständlich auch mitgenommen; sein eigentliches Weidegebiet aber ist der Küstenstreifen, der von der Ebbe trocken gelegt wird und also nur ausnahmsweise Kerfe beherbergt.
Zur Niststelle wählt er sich am liebsten kleine, flache Sandinseln oder kiesige Stellen am Gestade. Aus den Beobachtungen Schillings scheint hervorzugehen, daß er solche Inseln, die mit kurzem Heidekraute und einzelnen verkrüppelten Wacholderbüschen bestanden sind, andern vorzieht; Holland beobachtete, daß er Plätze erwählt, auf denen höhere Gras- oder Binsenbüschel stehen, unter denen dann das Nest angelegt wird. Während der Brutzeit scheint er sich hier und da tiefer in das Innere des Landes zu begeben, so zum Beispiel auf Island. Das Nest ist eine mit wenigen Hälmchen dürftig ausgelegte Vertiefung. Die vier Eier ähneln entfernt denen des Kiebitzes, sind aber kleiner, etwa vierzig Millimeter lang, dreißig Millimeter dick, glattschalig und auf graubraunem, gelblicholiven- oder seegrünem Grunde mit dunkelbraunen, ölgrauen und schwärzlich olivenfarbigen Flecken und Punkten, auch wohl mit Schnörkeln gezeichnet, am dicken Ende dichter als an, der Spitze. Beide Eltern legen ihre warme Liebe für die Brut durch Schreien, ängstliches Umherfliegen und lebhafte Gebärden an den Tag. Die Jungen betragen sich nach Art der Regenpfeifer.
*
Wer irgendeine Küste der Nordsee besucht, wird gewiß die Bekanntschaft eines Strandvogels machen, der hier fast allerorten häufig vorkommt und sich durch sein Betragen so auszeichnet, daß man ihn nicht übersehen kann. Die Küstenbewohner sind mit ihm ebenso vertraut geworden, wie wir mit einem unserer Raben oder mit dem Sperlinge: darauf hin deutet schon sein Namenreichtum. Der Austernfischer ( Haematopus ostralegus) fällt auf durch seine Gestalt und gilt daher mit Recht als Vertreter einer besonderen Unterfamilie ( Haematopodinae). Ihn kennzeichnen gedrungener Leib und großer Kopf, der einen langen, geraden, sehr zusammengedrückten, vorn keilförmigen, harten Schnabel trägt, der mittelhohe, kräftige Fuß, dessen drei Zehen sich ebensowohl durch ihre Kürze wie ihre Breite und eine große Spannhaut zwischen der äußeren und mittleren auszeichnen, die mittellangen, aber spitzigen Flügel, in denen die erste Schwungfeder die längste ist, und der aus zwölf Federn gebildete ziemlich kurze, gerade abgeschnittene Schwanz. Das Gefieder ist auf der Oberseite, dem Vorderhalse und Kröpfe schwarz, etwas schillernd, auf dem Unterrücken und Bürzel, unter dem Auge, auf der Brust und dem Bauche weiß; die Handschwingen und Steuerfedern sind an der Wurzel weiß, übrigens schwarz. Das Auge ist lebhaft blutrot, am Rande orangefarbig, ein nackter Ring um dasselbe mennigrot; der Schnabel zeigt dieselbe Färbung, hat aber eine lichtere Spitze; die Füße sehen dunkelrot aus. Die Länge beträgt zweiundvierzig, die Breite zweiundzwanzig, die Schwanzlänge elf Zentimeter. Das Weibchen ist etwas kleiner und das Schwarze an der Vorderbrust bei ihm auf einen geringen Raum beschränkt. Im Winterkleide zeigt die Gurgel einen weißen halbmondförmigen Fleck.

Brütender Austernfischer ( Haemetopus ostralegus)
Vom Nordkap oder vom Finnischen Meerbusen an bis zum Kap Tarifa hat man den Austerfischer an allen europäischen Küsten beobachtet, besonders häufig da, wo die Küste felsig ist. Ebenso findet er sich auf den Inseln der Nordsee und allen Küsten des Eismeeres und auffallenderweise auch an großen Strömen Nordasiens, so, nach unfern Beobachtungen, am ganzen unteren Ob. Nach Südeuropa kommt er während des Winters, aber keineswegs häufig; denn seine Wanderungen sind in mehrfacher Hinsicht eigentümlich. So verläßt er den Strand der Ostsee regelmäßig, während er auf Island bloß vom Nordrande zur Südküste zieht. Die Erklärung hierfür ist nicht schwer zu geben; unser Vogel verweilt da, wo der Golfstrom die Küste bespült, jahraus, jahrein, und verläßt sie da, wo die See im Winter zufriert, er also zum Wandern gezwungen wird. Gelegentlich seiner Reisen zieht er soviel wie möglich der Küste nach, überfliegt ohne Bedenken einen Meeresteil, höchst ungern aber einen Streifen des Festlandes, gehört deshalb bei uns im Binnenlande überall zu den seltenen Vögeln. Diejenigen Austerfischer, die die Nord- und Ostsee verlassen, finden schon an den französischen Küsten geeignete Herbergen, während diejenigen, die im Chinesischen Meere leben, ihre Reise bis nach Südindien ausdehnen.
So plump und schwerfällig unser Vogel aussieht, so bewegungsfähig zeigt er sich. Er läuft, in ähnlicher Weise wie der Steinwälzer, absatzweise, gewöhnlich schreitend oder trippelnd, nötigenfalls aber auch ungemein rasch dahinrennend, kann sich, dank seiner breitsohligen Füße, auf dem weichsten Schlicke erhalten, schwimmt, und keineswegs bloß gezwungen, vorzüglich und fliegt sehr kräftig und schnell meist geradeaus, aber oft auch in kühnen Bogen und Schwenkungen dahin, mehr schwebend als die meisten übrigen Strandvögel. Seine Stimme, ein pfeifendes »Hyip«, wird bei jeder Gelegenheit ausgestoßen, zuweilen mit einem langen »Kwihrrrr« eingeleitet, manchmal auch kurz zusammengezogen, so daß sie wie »Kwik, kwik, kewik, kewik« klingt. Am Paarungsorte trillert er wundervoll, wohltönend, abwechselnd und anhaltend.
Sein Betragen erklärt die Beachtung, die ihm überall gezollt wird. Es gibt keinen Vogel am ganzen Strande, der in gleichem Grade wie er rege, unruhig, mutig, neck- und kampflustig und dabei doch stets wohlgelaunt wäre. Wenn er sich satt gefressen und ein wenig ausgeruht hat, neckt und jagt er sich wenigstens mit seinesgleichen umher; denn lange still sitzen, ruhig aus einer Stelle verweilen, vermag er nicht. Aufmerksamer als alle andern Küstenvögel, finden die Austernfischer fortwährend Beschäftigung, auch wenn sie vollständig gesättigt sind. Jeder kleine Strandvogel, der naht oder wegfliegt, wird beobachtet, jeder größere mit lautem Rufe begrüßt, keine Ente, keine Gans übersehen. Nun nahen der Küste aber auch andere Vögel, die jene als Feinde, mindestens als Störenfriede der Gesamtheit kennengelernt haben. Sobald einer von diesen, also ein Rabe oder eine Krähe, eine Raub- oder große Seemöwe, von weitem sich zeigt, gibt ein Austerfischer das Zeichen zum Angriff, die übrigen erheben sich, eilen auf den Feind zu, schreien laut, um seine Ankunft auch andern Vögeln zu verraten, und stoßen nun mit größter Wut auf den Eindringling herab. In diesem Gebaren gleichen sie ganz den Kiebitzen; ihre Waffe ist aber vorzüglicher und der Erfolg um so sicherer. Daß das übrige Strandgeflügel bald lernt, ihre verschiedenen Stimmlaute zu deuten, den gewöhnlichen Lockton z.B. vom Warnungsruf zu unterscheiden, versteht sich von selbst. Da, wo es Austerfischer gibt, sind sie es, die vor allen übrigen das große Wort führen und das Leben des vereinigten Strandgewimmels gewissermaßen ordnen und regeln. Dem Menschen weichen die listigen Geschöpfe überall mit der nötigen Vorsicht aus. Sie kennen den Hirten, den Fischer, wissen, daß diese beiden ihnen selten oder niemals beschwerlich fallen, und lassen sie deshalb ohne Bedenken nahe herankommen; aber sie betrachten jeden andern Menschen mit mißtrauischen Blicken und gestatten dem Jäger wohl einmal, nicht aber fernerhin, ihnen so nahe auf den Leib zu rücken, daß er einen erfolgreichen Schuß abgeben kann.
Welcher Handlung der Austernfischer seinen gewöhnlichen Namen verdankt, ist schwer zu sagen, denn er fischt gewiß niemals Austern. Allerdings nimmt er gern kleinere Weichtiere auf, frißt auch wohl eine größere Muschel aus, die tot an den Strand geschleudert wurde, ist aber nicht imstande, eine solche zu öffnen. Seine Nahrung besteht vorzugsweise aus Gewürm, und wahrscheinlich bildet der Uferwurm den größten Teil seiner Speise. Daß er dabei einen kleinen Krebs, ein Fischchen und ein anderes Seetier nicht verschmäht, bedarf der Erwähnung nicht, ebensowenig, daß er in der Nähe des an der Küste weidenden Viehes Kerbtiere erjagt. Muscheln und Steinchen wendet er vielleicht noch häufiger um als der Steinwälzer.
Diejenigen Austernfischer, die als Strandvögel betrachtet werden können, beginnen um die Mitte des April, die, die wandern, etwas später mit dem Nestbau. Die Vereine lösen sich, und die Pärchen verteilen sich auf dem Brutplatze. Jetzt vernimmt man hier das Getriller der Männchen fortwährend, kann auch Zeuge ernster Kämpfe zweier Nebenbuhler um ein Weibchen werden. Dagegen leben die Austerfischer auch auf dem Brutplatze mit allen harmlosen Vögeln, die denselben mit ihnen teilen, im tiefsten Frieden. Kurze, grasige Flächen in der Nähe der See scheinen ihre liebsten Nistplätze zu sein; wo diese fehlen, legen sie das Nest zwischen den von Hochfluten ausgeworfenen Tang am Strande an. Das Nest ist eine seichte, selbstgekratzte Vertiefung; das Gelege besteht aus drei, oft auch nur aus zwei sehr großen, bis sechzig Millimeter langen, vierzig Millimeter dicken, spitzen oder rein eiförmigen, festschaligen, glanzlosen, auf schwach bräunlich rostgelbem Grunde mit hell violetten oder dunkel graubraunen und grauschwarzen Flecken, Klecksen und Punkten, Strichen, Schnörkeln usw. gezeichneten Eiern, die übrigens vielfach abändern. Das Weibchen brütet sehr eifrig, in den Mittagsstunden aber nie, weshalb es auch von dem Männchen nicht abgelöst wird; doch übernimmt dieses die Sorge für die Nachkommenschaft, wenn die Mutter durch irgendeinen Zufall zugrunde geht. Nach etwa dreiwöchiger Bebrütung entschlüpfen die Jungen und werden nun von den Alten weggeführt. Bei Gefahr verbergen sie sich gewöhnlich, wissen sich aber auch im Wasser zu bewegen; denn sie schwimmen und tauchen vortrefflich, können sogar auf dem Grunde und unter Wasser ein Stück weglaufen. Beide Alten sind, wenn sie Junge führen, vorsichtiger und kühner als je.
Am leichtesten kann man die Austernfischer berücken, wenn man zur Zeit ihres Mittagsschläfchens auf sie ausgeht; ihre Sinne sind aber so fein, daß man ihnen auch dann vorsichtig nahen muß, weil sie die Tritte eines gehenden Menschen hören oder doch verspüren. Erschwert wird die Jagd noch ganz besonders dadurch, daß sie ein überaus zähes Leben besitzen und einen sehr starken Schuß vertragen. Übrigens jagt wohl nur der Naturforscher oder der Sonntagsschütze ernsthaft auf Austernfischer, weil deren Wildbret von der Nahrung einen so widerwärtigen Geschmack annimmt, daß es gänzlich ungenießbar wird. Dagegen gelten deren Eier mit Recht als höchst schmackhafte Speise. Liebhaber fangen sich einen oder den andern, um den anziehenden Gesellen in der Gefangenschaft beobachten zu können. Laufschlingen, die dort, wo sich viele dieser Vögel umhertreiben, gestellt werden, führen regelmäßig zum Ziele, und die Eingewöhnung der gefangenen Vögel verursacht keine Mühe. Wenn man ihnen anfänglich einige Krabben, zerkleinertes Fischfleisch, zerhackte Muscheln und dergleichen vorwirft, kann man sie bald ans einfachste Stubenfutter, aufgeweichtes Milchbrot nämlich, gewöhnen. Die Alten verlieren bald ihre Scheu vor dem Menschen. Sie vertragen sich auch mit allen übrigen Vögeln, die man mit ihnen zusammenbringt, und leisten diesen nach wie vor ihre Wächterdienste.
Die dritte Familie, über alle Erdteile und Gürtel verbreitete Arten umfassend, ist die der Schnepfenvögel ( Scolopacidae). Die Merkmale der ersten hierher gehörigen Unterfamilie, der eigentlichen Schnepfen ( Scolopacinae), sind kräftiger, verhältnismäßig kurzer Leib, von beiden Seiten zusammengedrückter, hochstirniger Kopf, kleiner, abgeplatteter Scheitel und große, auffallend weit nach oben und hinten stehende Augen, langer, gerader, schwacher, schmaler, nach vorn sich verschmächtigender, sehr weicher und biegsamer, tastfähiger Schnabel, dessen Unterkieferspitze von der des oberen teilweise umschlossen wird, niederer, schwacher, weicher, über der Ferse wenig oder nicht nackter Fuß, unter dessen drei Vorderzehen die mittlere durch ihre Länge auffällt, verhältnismäßig kurzer, aber breiter Flügel und der durch die wechselnde Anzahl der Steuerfedern, die zwischen zwölf und sechsundzwanzig schwankt, bemerkenswerte, kurze, breite, zugespitzte oder abgerundete Schwanz. Das Kleingefieder liegt, trotz seiner Weiche und Dichte, glatt oder doch geschlossen an; seine Färbung ähnelt, ungeachtet der sehr verschiedenartigen Zeichnung, unter allen Umständen der Bodenfärbung des bezüglichen Aufenthaltes.
Unsere Waldschnepfe ( Scolopax rusticola), vertritt die gleichnamige erste Sippe der Familie. Das Gefieder ist auf dem Vorderkopf grau, auf Ober-, Hinterkopf und Nacken mit vier braunen und ebenso vielen rostgelben Querstreifen gezeichnet, übrigens oben rostfarben, rostgrau, rostgelb, graubraun und schwarz gefleckt, an der Kehle weißlich, auf dem übrigen Unterkörper graugelblich und braun gewellt; die Schwingen sind auf braunem, die Steuerfedern auf schwarzem Grunde mit rostfarbenen Flecken gezeichnet. Das sehr große Auge ist braun, der Schnabel wie der Fuß horngrau. Die Länge beträgt zweiunddreißig, die Breite achtundfünfzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge neun Zentimeter.
Mit Ausnahme einiger nordischen Inseln hat man die Waldschnepfe in allen Ländern Europas und ebenso in ganz Nord- und Mittelasien angetroffen. Gelegentlich ihres Zuges besucht sie von Europa aus Nordwestafrika, von Nordasien aus Indien, und zwar nicht bloß die nördlichen Hochgebirge, sondern auch das südliche Tiefland bis Kalkutta und Madras hinab. Gewöhnlich nimmt man an, daß ihre eigentliche Heimat, d.+h. also ihr Brutgürtel, zwischen dem fünfundvierzigsten und siebenundsechzigsten Grad nördlicher Breite gelegen sei; wir wissen aber jetzt durch Graf von der Mühle, daß einzelne Waldschnepfen in den griechischen Gebirgen, und durch Mountaineer, daß nicht wenige im Himalaja, hier freilich dicht unter der Schneegrenze, nisten. In Deutschland brüten verhältnismäßig wenige Schnepfen, die meisten noch in den Mittelgebirgen oder im Norden unseres Vaterlandes; im Norden trifft man sie während des Sommers in allen größeren Waldungen an. Milde Winter veranlassen sie zuweilen, den Brutplatz jahraus, jahrein zu behaupten; die Mehrzahl aber tritt in jedem Herbst eine Reise an und nimmt erst in den südeuropäischen Gebirgen Herberge. In Griechenland treffen, nach von der Mühles Beobachtungen, einzelne bereits um die Mitte des September ein, beziehen zunächst die Hochgebirge, werden aber später durch die sich hier fühlbar machende Kälte in die Ebene herabgedrückt. Drei Engländer, die zwischen Patras und Pyrgos im Peloponnes jagten, erbeuteten innerhalb drei Tagen eintausend Schnepfen. Vom Februar an beginnen sie bereits ihren Rückzug. Ungefähr dasselbe gilt für andere südeuropäische Länder.
Je nach der im Norden stattfindenden Witterung trifft die Schnepfe bei uns zulande früher oder später im Jahre ein. Ein alter Jägerspruch trifft so ziemlich das Rechte:
»Reminiscere – nach Schnepfen suchen geh',
Okuli – da kommen sie,
Lätare – das ist das Wahre,
Judika – sind sie auch noch da,
Palmarum – trallarum,
Quasimodogeniti – halt, Jäger halt, jetzt brüten sie.«
Von Mitte März an kann man auf durchziehende Schnepfen rechnen. Aber Bestimmteres kann nicht gesagt werden, weil gerade dieser Vogel dem Jäger, der ihn auf das genaueste beobachtet, in jedem Jahr neue Rätsel aufgibt. »Ich habe den Schnepfenstrich«, sagt Schauer, »siebzehn Jahre lang in Polen und Galizien fast täglich besucht, in den fünf Jahren jeden Tag ohne Ausnahme vom ersten bis zum letzten April; habe genau Register geführt und Tag und Stunde, Wärme- und Luftmesser, Anfang und Ende des Strichs, die Anzahl der Schnepfen, die geschossen, gesehen, gehört wurden, die Witterung des Tages während des Striches, Wind, Wolkenzug usw., alles genau beobachtet, und wenn man mir jetzt sagt: Sie gehen bei diesem Wetter auf den Schnepfenstrich, es werden keine ziehen, so antworte ich: Davon will ich mich überzeugen. Die alten Jäger sind der Meinung, daß der Schnepfenstrich von der augenblicklichen Witterung abhinge; dem aber ist nicht so: meine genauen und ununterbrochenen Beobachtungen haben mich das Gegenteil gelehrt, aber auch zu der Überzeugung geführt, daß die Waldschnepfe durch ein Vorgefühl für die bevorstehende Witterung geleitet wird. Ihr Zug selbst ist höchst verschieden. Vorgestern zogen alle sehr niedrig und langsam, gestern niedrig und rasch, heute sehr hoch und ohne zu balzen, morgen kommen sie so spät, daß man kaum schießen kann, und übermorgen sind sie gleich nach Sonnenuntergang da.« Dem kann man noch hinzufügen, daß auch die Straße, die sie während des Zuges benutzen, eine vielfach verschiedene ist; denn während man in einem Jahre an einer Örtlichkeit, die allen Anforderungen zu entsprechen scheint, sehr viele Waldschnepfen antrifft, sieht man in andern Jahren hier kaum eine, obgleich die Umstände das Gegenteil erwarten lassen. Wenn nach einem strengen Winter rechtzeitig Tauwetter eintritt und die Luft fortan gelinde bleibt, geht der Frühlingszug am regelmäßigsten vonstatten. Ebenso hat man festzuhalten, daß die Schnepfen, wie andere Vögel auch, ungern mit dem Winde ziehen, am liebsten also bei mäßigem Gegenwinde reisen. Sehr dunkle oder stürmische Nächte hindern die Wanderung, und ebenso fesselt die Voraussicht von schlechtem Wetter, beispielsweise von einem späten Schneefall, an einen und denselben Ort. In größeren, zusammenhängenden Waldungen findet man sie eher als in kleinen Gehölzen, höchst wahrscheinlich deshalb, weil ihnen die großen Wälder mehr Schutz geben als die kleineren, die sie später gern besuchen. In waldarmen Gegenden fallen sie nicht selten selbst in buschreichen Gärten oder auch einzelnen Hecken ein.
Die Schnepfe scheint keine Baumart zu bevorzugen; denn man findet sie in den Nadelwaldungen ebenso häufig wie im Laubwalde. Hauptbedingung für ihr Leben ist feuchter, weicher Waldboden, der ihr gestattet, in ihm mit dem Schnabel zu bohren. Die unermeßlichen Wälder des Nordens, die meist nur aus Fichten bestehen, entsprechen ihren Anforderungen in jeder Hinsicht, wogegen dürftige Kieferwaldungen sandiger Gegenden ihr in keiner Weise zusagen.
Ihr tägliches oder häusliches Leben läßt sich nicht eben leicht beobachten, weil sie höchst furchtsam, mißtrauisch und scheu ist. Übertags zeigt sie sich niemals im Freien, und wenn sie wirklich einmal gezwungen wurde, sich hier niederzulassen, drückt sie sich platt auf den Boden nieder, und ihr Gefieder geht dann, ebenso wie das eines Rebhuhnes, in der Färbung desselben auf. Wenn es sehr ruhig im Walde ist, kann es geschehen, daß sie auch bei Tage auf dem Boden umherläuft; immer aber wählt sie dann solche Stellen aus, die sie möglichst verbergen und vor dem ihr wahrscheinlich lästigen, grellen Licht schützen. Erst mit der Dämmerung wird sie munter und beginnt umherzulaufen. Bei ruhiger Haltung zieht sie den Hals ein, trägt den Leib wagerecht und den Schnabel mit der Spitze gegen den Boden gesenkt. Der Gang ist geduckt, schleichend, trippelnd, wenig schnell und nicht anhaltend, der Flug dagegen in jeder Beziehung vortrefflich. Sie kann sich durch das dichteste Gezweig hindurchwinden, ohne irgendwo anzustoßen, überhaupt die Eile des Fluges gänzlich nach den Umständen einrichten, bald beschleunigen und bald mäßigen, schwenkt sich gewandt in jeder Richtung, steigt oder fällt nach Belieben, erhebt sich aber, bei Tage wenigstens, niemals in höhere Lustschichten und fliegt, solange sie es vermeiden kann, nicht über freie Stellen. Wenn sie erschreckt wurde, vernimmt man beim Aufstehen ein dumpfes Fuchteln, an dem sie der Weidmann jederzeit erkennt, auch wenn er sie nicht zu sehen bekam. Wurde sie während des Tages gejagt und in Angst gesetzt, so pflegt sie sich abends beim Weiterziehen fast senkrecht emporzuheben und dann so eilig wie möglich weiterzuziehen. Ganz anders fliegt sie, wenn sie streicht, d.+h. einem Weibchen zu Gefallen Flugkünste übt. Sie bläht dabei ihr Gefieder auf, so daß sie viel größer erscheint, als sie wirklich ist, kommt höchst langsam einhergeflogen, bewegt ihre Flügel nur mit matten Schlägen und ähnelt einer Eule mehr als irgendeinem Sumpf- oder Stelzvogel. Treffen zwei Schnepfenmännchen aufeinander, so beginnen sie einen sonderbaren Zweikampf in der Luft, indem sie sich weidlich umhertummeln und mit den Schnäbeln nacheinander stechen. Zuweilen packen sie sich wirklich und hindern sich gegenseitig im Fluge; ja es kommt vor, daß drei zusammen einen förmlichen Knäuel bilden und beim Herabwirbeln im dichten Gezweig sich verwickeln. Dieses Streichen, der Balz vergleichbar, beginnt schon während des Zuges, währt anfänglich nur kurze Zeit, dauert später und an den Brutplätzen länger, pflegt aber mit Eintritt der Dunkelheit zu enden.
Die Waldschnepfe weiß genau, welch vortrefflichen Schutz ihr das boden- oder rindenfarbene Kleid gewährt, und versteht es meisterhaft, beim Niederdrücken stets eine Stelle auszuwählen, die sie verbirgt. Eine Schnepfe, die, ohne sich zu regen, zwischen dürrem Laub, Holzgebröckel, neben einem Stück zu Boden gefallener Borke oder einer hervorragenden Wurzel liegt, wird selbst von dem schärfsten Auge des geübtesten und erfahrensten Jägers übersehen und günstigstenfalls nur an den großen Augen erkannt. In dieser Lage verweilt sie so lange, als es ihr rätlich erscheint, und namentlich, wenn sie verfolgt worden war, läßt sie den Jäger oft bis auf wenige Schritte herankommen, bevor sie plötzlich aufsteht. Sodann fliegt sie nie anders, als auf der entgegengesetzten Seite des Gesträuches heraus und immer so, daß sie durch Gebüsch und Bäume vor dem Schützen gedeckt wird. Beim Einfallen beschreibt sie oft einen weiten Bogen, streicht aber, wenn sie schon das Dickicht erreicht hat, noch weit in demselben fort, schlägt auch wohl einen Haken und täuscht so nicht selten vollständig. Nach Art ihrer Familie bekümmert sie sich übrigens möglichst wenig um andere Geschöpfe, solange die Liebe nicht ins Spiel kommt, nicht einmal sehr um ihresgleichen, geht ihren eigenen Weg und macht sich mit anderm Geflügel so wenig wie möglich zu schaffen. Jedem nur einigermaßen bedenklich erscheinenden Tier mißtraut sie, und fast scheint es, als ob sie auch in dem harmlosesten und unschuldigsten ein gefährliches Wesen sähe. Sie läßt sich aber zähmen und wird, wenn sie jung aufgezogen wurde, sehr zutraulich, beweist dem Wärter ihre Zuneigung durch sonderbare Stellungen und Gebärden, wie sie solche während der Paarung anzunehmen pflegt, hört auf seinen Ruf, kommt herbei und stößt, gleichsam zur Begrüßung, wohl auch einen ihrer wenigen Stimmlaute aus. Diese Laute entbehren jedes Wohlklanges, klingen heiser und gedämpft wie »Katch« oder »Dack« und »Ähtch«, werden jedoch während der Zeit der Liebe oder im Schreck einigermaßen verändert, im ersteren Falle in ein kurz abgebrochenes Pfeifen, das wie »Pßiep« klingt und oft das Vorspiel zu einem dumpfen, scheinbar tief aus der Brust kommenden »Jurrk« ist, in letzterem Falle ein quiekendes »Schähtsch« vertönt. Es ist wahrscheinlich, daß das Pfeifen und das sogenannte Murksen nur vom Männchen, ein sanftes Piepen aber vom Weibchen hervorgebracht wird.
Mit Beginn der Abenddämmerung fliegt die Waldschnepfe auf breite Waldwege, Wiesen und sumpfige Stellen im Walde oder in der Nähe desselben nach Nahrung aus. Ein sorgfältig versteckter Beobachter, von dessen Vorhandensein sie keine Ahnung hat, sieht hier, wie sie den langen Schnabel unter das alte, abgefallene Laub schiebt und dasselbe haufenweise umwendet, um die darunter versteckten Larven, Käfer und Würmer bloßzulegen, oder wie sie mit jenem in den feuchten, lockeren Boden bohrt, indem sie ein Loch dicht neben dem andern einsticht, soweit es der weiche, biegsame Schnabel gestattet. In ähnlicher Weise durchstöbert sie frischen Rinderdünger, der sehr bald von Kerbtierlarven bevölkert wird. Gewöhnlich hält sie sich nicht lange an einer und derselben Stelle auf, sondern fliegt von einer zur andern. Larven der verschiedensten Kerbtiere und diese selbst, kleine Nacktschnecken, insbesondere aber Regenwürmer, bilden ihre Nahrung. In der Gefangenschaft gewöhnt sie sich, wenn man ihr anfänglich reichlich Regenwürmer vorlegt, nach und nach an Milchsemmel und Ameiseneier, lernt auch bald das Bohren in weichem Rasen, selbst wenn sie so jung dem Neste entnommen wurde, daß sie keine Gelegenheit hatte, diese Art des Nahrungserwerbes erfahrungsmäßig kennenzulernen.
In einsamen, stillen Wäldern wählt sich die Waldschnepfe zu ihrem Nistplatz Stellen, auf denen dichtes Unterholz mit freien Blößen abwechselt. Nachdem sich das Pärchen geeinigt, das Männchen mit seinen Nachbarn wochenlang herumgestritten hat, sucht das Weibchen ein geeignetes Plätzchen hinter einem kleinen Busch, alten Stock, zwischen Wurzeln, Moos und Gräsern und benutzt hier eine vorgefundene Vertiefung des Bodens zur Neststelle oder scharrt selbst eine solche, kleidet sie mit wenig trockenem Geniste, Moos und andern Stoffen dürftig und kunstlos aus und legt hier ihre vier ziemlich großen, etwa zweiundvierzig Millimeter langen, zweiunddreißig Millimeter dicken, kurzbauchigen, glattschaligen, glanzlosen, aus bleich rostgelbem Grunde mit rotgrauen Unter- und dunkelrötlichen oder gelbbraunen Oberflecken bald dichter, bald sparsamer gezeichneten, übrigens in Größe und Färbung vielfach veränderlichen Eier. Es brütet mit größtem Eifer siebzehn bis achtzehn Tage lang, läßt einen Menschen, der nach dem Nest sucht oder zufällig in die Nähe kommt, bis auf wenige Schritte nahen, bevor es aufsteht, sich, wie Hintz beobachtete, sogar berühren, fliegt gewöhnlich nicht weit weg und kehrt baldmöglichst zum Nest zurück, brütet auch fort, wenn ein Ei geraubt wurde. Das Männchen scheint sich wenig um die Gattin zu bekümmern, stellt sich aber bei derselben ein, nachdem die Jungen entschlüpft und aus dem Nest gelaufen sind. Beide Eltern zeigen sich sehr besorgt um die Familie, fliegen bei Annäherung eines Feindes ängstlich auf und, sich verstellend, schwankend und wankend, dahin, stoßen ein ängstliches »Dack, dack« aus, beschreiben nur enge Kreise im Fluge und werfen sich wieder in der Nähe auf den Boden herab. Währenddem verbergen sich die Jungen zwischen Moos und Gras so vortrefflich, daß man sie ohne Hund selten auffindet. Mehrere Jäger, und unter ihnen sehr sorgfältige Beobachter, haben gesehen, daß alte Waldschnepfen ihre Jungen bei großer Gefahr wegschafften, indem sie dieselben mit den Krallen packten oder mit Hals und Schnabel gegen die Brust drückten, um sie festzuhalten, sich erhoben und die Küchlein so in Sicherheit brachten. In der dritten Woche ihres Lebens beginnen letztere zu flattern, und noch ehe sie ordentlich fliegen lernen, machen sie sich selbständig.
Wild- und Hauskatzen, Marder, Habicht und Sperber, Edelfalken, Häher und Elstern gefährden die Waldschnepfe und deren Brut. Der Weidmann jagt sie bloß während ihres Zuges, der Südländer auch in der Winterherberge, trotzdem ihr Wildbret dann oft hart und zähe ist. Die oben gegebene Mitteilung über die Schlächterei, die drei Engländer anrichteten, beweist am besten, wie rücksichtslos den eingewanderten Schnepfen in der Winterherberge nachgestellt wird. Der Anstand auf streichende Waldschnepfen gehört zu den köstlichsten Vergnügungen eines jagdkundigen Mannes, und das Schnepfentreiben hat ebenfalls seine großen Reize.
*
Wegen des verhältnismäßig langen Schnabels, der mittellangen, über der Ferse nackten Füße, deren lange, dünne Zehen ganz getrennt sind, der sehr stark ausgeschnittenen Flügel und des kurzen Schwanzes vereinigt man die Sumpfschnepfen ( Gallinago) in einer besonderen Sippe.
Unter den in Deutschland brütenden Arten dieser Gruppe steht die Mittelschnepfe oder gemeine Sumpfschnepfe ( Gallinago media) an Größe obenan. Ihre Länge beträgt durchschnittlich achtundzwanzig, die Breite fünfundfünfzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Der Oberkopf ist bräunlichschwarz, in der Mitte und über dem Auge durch je einen schmalen rostgelblichen Streifen gezeichnet, die übrige Oberseite braunschwarz, licht rostbraun quergefleckt und durch schmale, unterbrochene, zackige und bogige Binden von gleicher Färbung ansprechend gezeichnet, der Bürzel braunschwarz, die Kehle weißlich, der Kopf rostgraugelblich, der übrige Unterkörper graulichweiß, jeder dieser Teile mit dunkelbraunen, roströtlich gesäumten, nach unten sich verbreiternden Pfeilflecken bedeckt; die Handschwingen sind schwarzbraun, gleich den dunkelgrauen, innen gemarmelten Armschwingen vor der dunkleren Spitze breit schmutzigweiß gesäumt, wodurch auf dem Flügel fünf lichte Querbinden entstehen, die an der Wurzel dunklen Schwanzfedern in der Endhälfte rostrot, schwarz quergebändert und breit weiß gesäumt.

Gemeine Sumpf- oder Mittelschnepfe ( Gallinago media)
Die Mittelschnepfe ist Brutvogel der altweltlichen Tundra, in Deutschland daher nur in wenigen Sümpfen und Brüchen anzutreffen. Ich fand ihr Nest im Spreewalde; andere beobachteten sie während der Brutzeit in Holstein, Oldenburg, Hannover, Westfalen, Mecklenburg, Pommern und Anhalt. In Skandinavien tritt sie noch selten auf, in der russischen und sibirischen Tundra ist sie häufig und die allein vorkommende Art ihres Geschlechtes. Von der Tundra aus durchwandert sie alljährlich ganz Europa und Mittelasien, um in Afrika und Südwestasien ihre Winterherberge zu suchen. In Afrika zieht sie bis zur Südspitze des Erdteils, in Asien wahrscheinlich nicht minder weit. Da ihr Brutgebiet erst spät schneefrei wird und bald wiederum dem Winter anheimfällt, unternimmt sie ihre Reisen im Frühling spät, selten vor Anfang Mai, und im Herbst frühzeitig, meist schon im August, spätestens im September. Unterwegs, beispielsweise am oberen und mittleren Ob, verweilt sie oft wochenlang an einer und derselben Stelle, balzt, kämpft wie am Brutorte, schreitet aber nicht zum Nestbau, sondern verschwindet plötzlich, eilt in die Tundra, beginnt hier sofort ihr Brutgeschäft und zieht wieder südwärts, sobald letzteres beendet ist. Vererbter Gewohnheit folgend, erscheint und brütet sie auch in Deutschland kaum früher als in der Tundra, ebenso wie sie dort kaum länger verweilt als hier.
Von der verwandten Bekassine unterscheidet sich die Mittelschnepfe in vielfacher Hinsicht. Sie nimmt ihren Sommerstand nicht im eigentlichen Sumpfe, sondern ausschließlich auf ziemlich trockenem Boden, in der Tundra zwischen dem Zwergbirkengebüsch auf moosigem Grund oder im Riedgrase, wird daher bei uns zulande immer nur auf ganz bestimmten Stellen der Sümpfe oder Moore, häufiger vielleicht auf hochgrasigen Wiesen, angetroffen; sie ist auch keineswegs gesellig wie jene, vereinigt sich jedoch unterwegs notgedrungen auf geeigneten Aufenthaltsplätzen oft mit andern ihrer Art und kommt am Brutplatz ebenso mit ihresgleichen zusammen, um zu kämpfen. In der weiten Tundra behauptet jedes Paar seinen ausgedehnten Stand, und wenn es erst fest brütet, begegnet man immer nur ihm, niemals Gesellschaften. Selbst die flugbaren Jungen verweilen bloß kurze Zeit bei den Eltern und gehen baldmöglichst ihre eigenen Wege. Achtet man da, wo zeitweilig viele Mittelschnepfen sich aufhalten, auf die von ihnen erwählten Stellen, so bemerkt man, wenigstens im Frühling, hier vielfach verschlungene, aber ziemlich breite, deutlich ausgetretene Pfädchen zwischen den Halmen und Blättern des deckenden Grases, die unzweifelhaft von den Schnepfen herrühren, achtsamen sibirischen Jägern auch als bestimmtes Merkmal ihres Vorhandenseins gelten. Von solchen Pfädchen erhebt sich die vom Menschen oder von einem Raubtiere bedrohte Mittelschnepfe erst im äußersten Notfall; denn sie liegt ungemein fest und steht tagsüber nur auf, wenn sie dazu gezwungen wird, fällt auch stets nach kurzem, geradem, meist niedrig über den Boden dahinführendem Fluge wiederum ein. Die bekannten Zickzacklinien der fliegenden Bekassine beschreibt sie nie, und wenn sie wirklich einmal in höhere Luftschichten aufsteigt, führt sie höchstens zwei oder drei weite Kreise aus und fällt dann wieder auf den Boden herab. Beim Aufstehen vernimmt man ein eigentümliches Geräusch, das Naumann treffend als »wuchtelndes Getöse« bezeichnet, nur äußerst selten aber einen schwachen, wie »Bäd, bäd, bäd« klingenden Stimmlaut und niemals ein dem bekannten Meckern der Bekassine entsprechendes Getön. Scheu ist sie nicht, im Gegenteil meist so vertrauensvoll, daß sie erst durch wiederholte Verfolgung zu einiger Vorsicht sich bequemt. Vor dem Hunde steht sie bis zum Auffliegen mit eingezogenem Hals und gerade vorgestrecktem Schnabel, unbeweglich wie eine Bildsäule, nicht aber in geduckter Haltung wie ihre Verwandten.
Nachttier wie alle Schnepfen überhaupt, verläßt sie tagsüber den erwählten Ruheplatz nur, wenn sie dazu genötigt wird. Mit Eintritt der Dämmerung wird sie rege, läuft, nach Art eines Strandläufers, mit ausgestrecktem Hals umher, fliegt dann und wann eine kurze Strecke weit dicht über dem Boden dahin und bohrt auf allen geeigneten Stellen, um zu ihrer Nahrung zu gelangen, die aus allerlei Kerbtier-, in der Tundra hauptsächlich Mückenlarven, Schnecken und Würmern besteht, regelmäßig mit kleinen Kieskörnern, zufällig auch mit halb vermoderten Pflanzenteilen vermischt und rasch verdaut wird.
Wie ich von sibirischen Jägern erfuhr, balzt die Mittelschnepfe während ihrer Liebeszeit nur auf dem Boden. Da, wo sie häufig ist, versammeln sich mit Eintritt der abendlichen Dämmerung acht bis zehn Männchen auf bestimmten Plätzen, die durch das gänzlich niedergetretene Gras kenntlich sind, um zeitweilig bis zum frühen Morgen zu spielen und eigentümlich leise Laute zum besten zu geben. Mit aufgeblähtem Gefieder, gesenkten Fittichen und etwas gehobenem und gebreitetem Schwänze laufen sie, sich brüstend, vor den Weibchen einher, rufen mit gleichsam flüsternden Lauten »Bip, bip, bipbib, bibiperere, biperere«, dann und wann auch lauter, ungefähr nach Art eines Rotschenkels, und lassen dazwischen ein sonderbares Schnappen hören, das wahrscheinlich durch heftiges Zusammenklappen des Schnabels entsteht. Bis dahin strecken sie Kopf und Schnabel nach oben, breiten und schließen den Schwanz wie einen Fächer, und bekunden durch ihr ganzes Auftreten, daß sie sich in einem Zustand der Verzückung befinden. Stößt ein Männchen auf das andere, so beginnt zwischen beiden ein Kampf, der mehr mit den Flügeln als mit dem Schnabel ausgefochten wird, aber niemals lange währt. In klaren, hellen Nächten balzen sie am eifrigsten, in regnerischen minder anhaltend; in den Stunden um Mitternacht gehen sie dem Futter nach. Während der Höhezeit der Balz sind sie noch weniger scheu, als sonst, gestatten Annäherung des Beobachters, ohne ihr Spiel zu unterbrechen, und kehren, vertrieben, binnen kurzer Zeit zum Balzplatze zurück. Erst wenn alle Weibchen brütend aus den Eiern sitzen, enden diese Liebesspiele.
Wie in der Tundra schreitet das Weibchen auch bei uns zulande erst spät im Jahre, frühestens zu Ende Mai oder im Anfang Juni, zum Bau des Nestes. Letzteres unterscheidet sich nicht von dem der Heerschnepfe, und auch die vier Eier ähneln denen der letzterwähnten Art bis zum Verwechseln, sind jedoch ein wenig größer, durchschnittlich vierundvierzig Millimeter lang und zweiunddreißig Millimeter dick. Das Weibchen brütet etwa achtzehn Tage mit voller Hingebung, sitzt ungemein fest, versucht sich durch Niederducken zu verbergen und fliegt erst davon, wenn der Störenfried bis in seine unmittelbare Nähe gelangte. Das Jugendleben der Küchlein verläuft in ähnlicher Weise wie bei der Heerschnepfe; die Jungen scheinen jedoch noch früher als die der letzteren selbständig zu werden und ihre Eltern zu verlassen.
Die Heerschnepfe oder Bekassine ( Gallinago scolopacina) ist der Mittelschnepfe sehr ähnlich, oberseits auf braunschwarzem Grunde durch einen breiten, rostgelben Streifen, der längs der Kopfmitte verläuft, und vier lange, rostgelbe Streifen, die sich über den Rücken und die Schultern ziehen, gezeichnet, auf der Unterseite dagegen weiß, auf dem Vorderhals grau, hier, auf der Oberbrust und an den Seiten braun gefleckt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß dunkel hornfarben. Die Länge beträgt neunundzwanzig, die Breite fünfundvierzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Heerschnepfe oder Bekassine ( Gallinago scolopacina)
Der Norden Europas und Asiens ist auch die Heimat der Heerschnepfe; sie geht jedoch nicht so hoch hinauf wie die Mittelschnepfe und brütet überall, wo es große Sümpfe gibt. In Norddeutschland, Holland, Dänemark, Skandinavien, Livland, Finnland und Südsibirien ist sie an geeigneten Örtlichkeiten außerordentlich gemein. Während ihres Zuges besucht sie alle größeren und kleineren Sümpfe, Brüche und Moore, die zwischen ihrer Sommer- und ihrer Winterherberge liegen. Letztere nimmt vielleicht noch einen größeren Raum ein als ihre Heimat selbst; denn die Bekassine kommt von Südchina an bis zum Senegal in allen zwischen dem fünfundvierzigsten und zehnten Grade nördlicher Breite liegenden Ländern als Wandervogel vor. Mit Beginn des Oktober erscheint sie in Ägypten oder in Indien in unermeßlicher Anzahl, siedelt sich in allen Brüchen, Sümpfen und überschwemmten Reisfeldern an, setzt sich sogar an Strömen mit sandigen Ufern fest und läuft hier wie ein Strandläufer ungedeckt umher, wandert den Strömen nach, soweit sie es in südlicher Richtung tun kann, und besucht möglicherweise die Quellen des Nils ebenso regelmäßig wie die Mündungen des Ganges. Auch sie gehört, trotz ihres massenhaften Auftretens an einem und demselben Ort, zu den ungeselligen Vögeln. Eine kann dicht neben der andern liegen, wird sich aber schwerlich um ihren Nachbar bekümmern, und jede einzelne bewegt sich, mit Ausnahme der Brutzeit, stets nach eigenem Belieben. Ihre Reise legt sie ebenfalls in der Nacht zurück; aber auch während des Wanderfluges zieht jede unabhängig von der andern ihres Weges fort. Unser Vaterland durchreist sie, sobald sich einigermaßen mildes Frühlingswetter einstellt, also unter Umständen bereits von Mitte Februar an bis zur Mitte des April, im Herbst vom August an bis zum September und Oktober. In milden Wintern verweilen viele schon bei uns zulande-, man trifft sie sogar in schneereichen Wintern hier und da, wenn auch einzeln, an sogenannten warmen Quellen an. Trockene Gegenden durcheilt sie so schnell wie möglich. Man begegnet ihr nur in feuchten Niederungen, Sümpfen, Morästen, aus schlammigen Wiesen, kurz, auf Örtlichkeiten, die dem eigentlichen Sumpfe mehr oder weniger ähneln; ein Vorkommen an kahlen Flußufern, wie ich es in Nubien beobachtet habe, gehört zu den seltensten Ausnahmen. Wesentliche Bedingung des Aufenthaltsortes ist, daß der Boden Gräser, Seggen, Ried- und andere Sumpfpflanzen trägt und ihren Bohrarbeiten kein Hindernis bietet. Auf solchen Stellen treibt sie, mit Ausnahme der Brutzeit, ihr Wesen so still, daß man von ihrem Vorhandensein nichts wahrnimmt. Auch sie ist vorzugsweise in der Dämmerung tätig, aber doch viel mehr Tagvogel als Wald- und Mittelschnepfe. Wahrscheinlich schläft sie nur in den Mittagsstunden und benutzt die übrige Tageszeit, wenn sie sich ungestört weiß, zur Aufsuchung ihrer Nahrung.
Ihr Gang ist verhältnismäßig gut, zwar nicht so rasch wie der eines Strand- und Wasserläufers, aber doch viel schneller als der einer Waldschnepfe; ihr Flug geschieht überaus schnell und zeichnet sich dadurch aus, daß er anfänglich kurz nach dem Erheben mehrere Zickzacklinien beschreibt, aus die das gerade Fortstürmen folgt. Fast jede Bekassine erhebt sich jählings in die Luft, streicht mit raschen Flügelschlägen weit weg, beschreibt einen großen Bogen, kehrt bis ziemlich zu derselben Stelle, von der sie sich erhob, zurück, zieht plötzlich die Flügel ein und stürzt in schräger Richtung mit größter Schnelligkeit wieder in den Sumpf hernieder. Daß sie trefflich zu schwimmen versteht, und diese Kunst auch ohne Not ausübt, habe ich oft beobachtet. Bei Gefahr, insbesondere wenn sie von einem Raubvogel verfolgt wird, nimmt sie zum Untertauchen ihre Zuflucht. Der gewöhnliche Ruf, den sie beim Auffliegen hören läßt, ist ein heiseres »Kähtsch«, das unter Umständen mehrmals wiederholt wird. Zur Zugzeit vernimmt man ein heiseres »Grek, geckgäh« und ebenso zuweilen ein hohes »Zip«. In ihrem Wesen unterscheidet sie sich in vieler Hinsicht von Wald- und Mittelschnepfe. Sie ist ebenso scheu und furchtsam wie jene, aber weit beweglicher und bewegungslustiger als beide Arten, gefällt sich oft in einem Umherfliegen, das man als unnütz bezeichnen möchte, und zeigt sich nur, wenn sie sehr feist geworden, einigermaßen träge. Ihrem Gatten hängt sie mit warmer Zärtlichkeit an, und die Brut liebt sie ungemein; im übrigen bekümmert sie sich, streng genommen, um kein anderes Tier, das ihr nicht gefährlich wird.
Kerbtiere, Würmer, kleine Nacktschnecken und dünnschalige Muscheltiere bilden ihre Nahrung. Auch sie sucht diese erst in der Dämmerung und Nacht auf, streicht wenigstens erst zu dieser Zeit von einer Stelle zur andern umher und fällt gelegentlich auch auf Örtlichkeiten ein, auf denen sie sich tagsüber nicht sehen läßt. Bei reichlichem Futter wird sie außerordentlich fett.
In entsprechenden Sümpfen brütet ein Pärchen der Sumpfschnepfe nahe bei den andern. Schon lange vor dem Legen beginnen die in jeder Hinsicht ausgezeichneten Liebesspiele. »Es schwingt sich das Männchen«, schildert Naumann sehr richtig, »von seinem Sitze aus dem grünen Sumpfe meistens blitzschnell, erst in schiefer Richtung aufsteigend, dann in einer großen Schneckenlinie himmelan, bei heiterem Wetter so hoch in die Lüfte, daß es nur ein gutes Auge noch für einen Vogel erkennt. In solcher Höhe treibt es sich nun flatternd im Kreise herum und schießt aus diesem mit ganz ausgebreiteten, still gehaltenen Flügeln, senkrecht, in einem Bogen, herab und hinauf, und mit einem so besonderen Kraftaufwand, daß in diesem Bogenschusse die Spitzen der großen Schwingen in eine bebende oder schnurrende Bewegung gesetzt werden und dadurch einen zitternden, wiehernden, summenden, knurrenden oder brummenden Ton geben, der dem Meckern einer Ziege höchst ähnlich ist und dem Vogel zu dem Namen Himmelsziege, Haberbock und ähnlichen verholfen hat. Durch einen so kräftigen Bogenschuß ist es nun wieder in die vorige Höhe gekommen, wo es wiederum flatternd einige Male herumkreist, um Kräfte zu einem neuen, senkrechten Bogensturze und dem mit ihm verbundenen Summen, Brummen, Meckern, oder wie man es sonst noch nennen möchte, zu sammeln, der sofort erfolgt. Und so wird das Kreisen in einem wagrechten Strich und auf einem kleinen Raum mit den damit abwechselnden senkrechten Bogenstürzen und Meckern oft viertel-, ja halbestundenlang fortgesetzt, wobei noch zu bemerken ist, daß dieses Getön an und für sich wenig über zwei Sekunden anhält und anfänglich in Zwischenräumen von sechs bis acht, später aber, wenn die Kräfte anfangen zu erlahmen, von zwanzig bis fünfundzwanzig Sekunden wiederholt wird. Wenn es mit Silben deutlich gemacht werden soll, kann man es mit ›Dududududududu‹, so schnell wie nur möglich gesprochen, am besten versinnbildlichen. Da das Männchen diese wunderlichen Gaukeleien nicht allein in der Abend- oder Morgendämmerung, sondern auch nicht selten am Tage und stets bei ganz heiterem Himmel und stillem Wetter ausübt, so hält es mit natürlich scharfem Auge durchaus nicht schwer, die wirbelnd schnurrende Bewegung der Schwungfederspitzen bei jenem heftigen Hinauf- und Herabdrängen des Vogels durch die Luft deutlich genug wahrzunehmen und sich zu überzeugen, daß diese Töne allein hierdurch hervorgebracht werden und nicht aus der Kehle des Vogels kommen.« Neuerdings hat man sich dahin geeinigt, daß man nicht die Schwingen, sondern die Schwanzfedern als Erzeuger des meckernden Lautes ansieht. Die Liebesbegeisterung beeinflußt übrigens das Männchen so, daß es sein sonstiges Wesen gänzlich verleugnet, sich z.+B. zuweilen auf starke Baumspitzen frei hinstellt und mit zitterndem Fluge auf- und abfliegt; auch bekümmert es sich jetzt um andere seiner Art, wenn auch freilich nicht in freundlicher Absicht. Jedes Männchen spielt allerdings für sich und beschreibt seinen eigenen Kreis in der Luft; aber es geschieht doch gar nicht selten, daß die Eifersucht zwei zusammenbringt und ein ziemlich ernster Kampf ausgefochten wird. Auf das Umhertummeln in der Luft folgt der zweite Akt des Liebesspieles. »Wenn das Männchen mit jener gewiß sehr anstrengenden, sonderbaren Bewegung lange genug sich abgeplagt hat«, fährt Naumann fort, »ertönt aus dichtem, nassem Verstecke am Boden, an weniger unsicheren Orten wohl auch von einem erhabenen Steine oder Hügelchen, der zärtlich verlangende Liebesruf der Auserwählten zum Geliebten hinaus, und kaum hat dieser die ersehnte Einladung vernommen, als er auch sogleich seine Gaukelei beendet, seine Flügel dicht an den Leib zieht und wie ein fallender Stein, auch mit ebensolchem Sausen, fast senkrecht aus der Höhe zu seinem Weibchen herabstürzt. Den dritten und letzten Akt, der nun folgt, verbergen dem Späher die dichten Umgebungen.« Jener Ausdruck der Liebe ist ein hoher, reiner, pfeifender Laut, den man durch die Silben »Tikküp« oder »Dië« ungefähr wiedergeben kann. An derjenigen Stelle, von der sich das Männchen gewöhnlich zu seinem Liebesspiele aufschwingt und zu der es wieder zurückkehrt, steht, rings von Sumpf und Wasser umgeben, auf einer Erhöhung, zwischen Schilfgräsern ziemlich verborgen, das Nest, eigentlich nur eine Eindrückung des Grases selbst, das höchstens mit trockenen Blättchen und Hälmchen belegt, durch das weiter wachsende Gras später aber fast vollständig überdeckt wird. Von Mitte April an bis zu Ende des Mai findet man in ihm regelmäßig vier, durchschnittlich achtunddreißig Millimeter lange, achtundzwanzig Millimeter dicke, feinkörnige, glattschalige, glanzlose Eier, die auf schmutzig oder grünlich olivengelbem, auch schwach graugrünem Grunde mit grauen Schalenflecken und vielen groben Oberflecken und Punkten von grünlicher oder rötlicher und schwarzbrauner Färbung gezeichnet sind. Sie werden vom Weibchen allein innerhalb fünfzehn bis siebzehn Tagen ausgebrütet, die Jungen aber von beiden Eltern geführt, weshalb auch der Vater, sobald seine Kinder das Licht der Welt erblickt haben, seine Gaukeleien einstellt. Ihr buntscheckiges Dunenkleid macht schon nach acht bis zehn Tagen dem Jugendkleide Platz; nach ein paar Wochen beginnen sie bereits zu flattern, einige Tage später sind sie selbständig geworden.
Die Heerschnepfe ist, dank ihres Aufenthaltes und ihrer bedeutenden Flugfertigkeit, weniger Gefahren ausgesetzt als die Waldschnepfe; Edelfalken und Habichte fangen aber doch manche, und der Fuchs sucht sie auch im Sumpfe auf. Die Brut mag wohl am meisten vom Rohrweih zu leiden haben. Plötzliches Anschwellen der Gewässer vernichtet manchmal Hunderte ihrer Nester zu gleicher Zeit. Der Europäer verfolgt sie ihres schmackhaften Wildbretes, das dem der Mittelschnepfe an Wohlgeschmack zwar bei weitem nachsteht, das der Waldschnepfe jedoch entschieden übertrifft, allenthalben, wenn auch nicht überall mit besonderem Eifer, weil das Umherwaten im Sumpfe nicht jedermanns Sache und die zur Jagd unbedingt erforderliche Fertigkeit im Flugschießen nicht jedermann eigen ist. Unter den Ungarn und unter den Europäern Ägyptens oder Indiens aber hat diese Jagd, nach meinem Dafürhalten eine der angenehmsten, die es gibt, begeisterte Anhänger, belohnt sich in den gedachten Ländern aber auch so wie nirgend anderswo.
Auch Bekassinen lassen sich in der Gefangenschaft halten; ihre Eingewöhnung verlangt aber einen sehr geschickten Pfleger, der sich keine Mühe verdrießen läßt. Die Gefangenen werden zutraulich, zeigen sich aber bei Tage träge und schläferig und nur des Nachts munter, können also nicht zu den empfehlenswerten Stubenvögeln gezählt werden.
Die Moorschnepfe ( Gallinago minima) ist die kleinste Schnepfenart; ihre Länge beträgt sechzehn, die Breite neununddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge vier Zentimeter. Zügel, ein Streifen unter den Wangen und Kopf sind braun, zwei Streifen über und unter dem Auge rostgelblich, die Mantelfedern schwarzblau, mit grünem und purpurnem Schiller und vier rostgelben Hauptstreifen, die der Gurgel, des Kropfes und der Seiten grau, bräunlich gewellt und gefleckt, übrigens weiß, die Schwung- und Steuerfedern mattschwarz, letztere rostgelb eingefaßt. Das Frühlingskleid zeigt auf den Flügeln eine mehr rostrote Färbung als das Herbstkleid; das Jugendkleid ist nicht so strahlend wie das der alten Vögel.
An denselben Orten, die während des Frühlings- und Herbstzuges die Heerschnepfe beherbergen, findet man auch ihre kleinere Verwandte, niemals jedoch in derselben Anzahl. Einzelne Pärchen brüten hier und da in Deutschland; ihre eigentliche Heimat aber ist Rußland und Westsibirien; in Ostsibirien fand Radde sie nur selten. In Skandinavien trifft man sie hier und da als Brutvogel an; in Livland und Litauen ist sie gemein. Ihre Wanderung erstreckt sich nicht so weit nach Süden wie die der Bekassine; jedoch kommt sie gleichzeitig mit letzterer in Indien an, verteilt sich über die ganze Halbinsel und verläßt diese im Frühjahre mit ihrer Verwandten wieder. Dasselbe gilt für Nordafrika. In Spanien und Griechenland überwintern viele, und zwar auf Ackerland. Im Anfang des März verlassen die Wintergäste den Süden und reisen nun, wie die übrigen Arten des Nachts, der eigentlichen Heimat zu.
Die Halbschnepfe ähnelt in ihrer Stellung den verwandten Arten, läuft auch ungefähr wie diese auf dem Boden umher, fliegt aber viel weniger gut, d. h. unsicherer, obgleich sie noch immer schnell genug dahineilt und die verschiedensten Schwenkungen ausführen kann. Bei heftigem Winde wagt sie kaum aufzustehen, weil sie dann wie ein Spielball fortgeschleudert wird. Ihre Stimme, die man am häufigsten noch gegen Abend vernimmt, ist ein feiner, scharfer, wie »Kiz« oder, wenn dumpf betont, wie »Ähtsch« klingender Laut; der Balzruf läßt sich wiedergeben durch die Silben »Tettettettettet«, die zuweilen vier bis sechs Sekunden ununterbrochen ausgestoßen werden. Übrigens ist auch sie höchst ungesellig. Ihre Nahrung ist im wesentlichen dieselbe wie bei den andern Sumpfschnepfen; doch hat man in ihrem Magen öfter als bei den verwandten Arten auch feine Sämereien gefunden.
Wahrscheinlich brütet die Halbschnepfe nicht so selten in Deutschland, wie gewöhnlich angenommen wird. Skandinavien, Litauen, Livland und Estland, Mittelrußland und Südsibirien sind ihre eigentlichen Brutländer. Das Nest ist eine mit wenig Grashälmchen belegte Grube auf einem Hügelchen. Die vier Eier sind kleiner und glattschaliger als die Eier der Bekassine, ihnen aber sonst sehr ähnlich. Das brütende Weibchen sitzt so fest, daß Wolley eines mit der Hand berühren konnte, bevor es aufflog.
Dieselben Feinde, die der Bekassine nachstellen, gefährden auch die Halbschnepfe. Ihre Jagd bietet kaum erhebliche Schwierigkeiten, weil sie sehr fest liegt und dann auch nur verhältnismäßig langsam dahinfliegt. Im Spätherbst, wenn sie sehr feist geworden, zeigt sie sich zuweilen so träge, daß man sie vor dem Vorstehhunde mit der Hand wegnehmen oder mit dem Netz überdecken kann. Das Wildbret ist vorzüglicher als das der Bekassine.
*
Die Strandläufer ( Triginae) sind durchgehends kleine, verhältnismäßig schlanke Vögel mit kopflangem oder noch etwas längerem, geradem oder bogenförmigem, an der Spitze kaum merklich verbreitetem Schnabel, schlanken, vierzehigen, weit über der Ferse nackten Füßen, mittellangen, spitzigen Schwingen und zugerundetem oder ausgeschnittenem Schwanze, deren Gefieder sich infolge der doppelten Mauser alljährlich zweimal wesentlich verändert.
Der Roststrandläufer oder Kanutsvogel ( Tringa canutus), Vertreter der Sippe der Strandläufer ( Tringa), ist der größte unter seiner europäischen Verwandtschaft. Seine Länge beträgt fünfundzwanzig, die Breite fünfundfünfzig, die Fittichlänge siebzehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Im Sommerkleide sind die Federn tief braunrot, unterseits bis auf die weißlichen des Bauches einfarbig, oberseits durch pfeilartige schwarze Mittelflecke und breite gelblichweiße Ränder gefleckt, die Rücken- und längsten Schulterfedern schwarz, weiß umrandet, die Unterrücken- und Bürzelfedern auf weißem, bräunlich gemischtem Grund schwarz quergebändert, die weißgeschafteten Handschwingen schwärzlich, die Armschwingen grau, die hintersten weiß gesäumt, die Schwanzfedern grau, schmal weißlich gesäumt. Im Winterkleide ist das Gefieder oberseits aschgrau, licht graufahl gesäumt, unterseits graulich weiß, seitlich trüber, am Kropfe durch schmale Schaftstriche gezeichnet. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß graulich schwarz. Der etwa kopflange Schnabel ist gerade.
Der Seestrandläufer ( Tringa maritima) ist merklich kleiner als der Roststrandläufer; seine Länge beträgt etwa einundzwanzig, die Breite zweiundvierzig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Im Hochzeitskleide sind Oberkopf und Nacken schwarz, weiß und ockerfarben längs gestreift, Kopfseiten und Hals schmutzigweiß, bräunlichschwarz gestreift, Oberseite und Rücken glänzend schwarz, durch die rostfarbenen, weiß gesäumten Ränder der Federn gezeichnet, Brust und Seiten auf weißem Grunde schwärzlichgrau gefleckt, die übrigen Unterteile weiß, die weißschaftigen Schwingen schwärzlich, mit lichten Säumen geziert. Das Auge ist braun, der Schnabel rötlich-, der Fuß safrangelb. Dem Winterkleide fehlt alles Rostgelb, und Schnabel und Füße haben minder lebhafte Färbung. Der mehr als kopflange Schnabel ist sanft gebogen.
Wie alle Sippschaftsgenossen brütet auch der Roststrandläufer nur im hohen Norden, durchwandert im Herbst und Winter aber Europa, fast ganz Asien, einen großen Teil von Amerika, ebenso auch Afrika, ist sogar auf Neuseeland gefunden worden. Auf diesen Wanderungen verläßt er die Seeküste nur ausnahmsweise, um nahegelegene Binnengewässer zu besuchen, gehört daher im Inneren des Landes stets zu den seltenen Erscheinungen. Am Seestrande schart er sich zu sehr zahlreichen Gesellschaften, die gemeinschaftlich leben und handeln. Viele solcher Flüge überwintern schon im Norden, andere ziehen gemächlich südwärts, verweilen unterwegs, wo sie reichliche Nahrung finden, ohne ein bestimmtes Reiseziel zu erstreben, und wenden sich wiederum der Heimat zu, wenn die Brutzeit herannaht. An unsern Küsten wie dann und wann im Binnenlande erscheint er bereits im August und September und zieht im Mai wiederum seiner nordischen Heimat zu.
Der Seestrandläufer entstammt derselben Heimat, durchwandert ebenfalls beide Erdhälften, ist noch weiter südlich beobachtet worden, erscheint aber seltener an unsern Küsten als sein Verwandter, und besucht die Binnengewässer unseres Vaterlandes nicht. Auch er überwintert bereits im Norden, häufiger an den Küsten Großbritanniens, Hollands, Frankreichs, erscheint und verschwindet ungefähr zu derselben Zeit, führt überhaupt fast dieselbe Lebensweise wie jener.
Beide Arten sind trotz ihres gedrungenen Baues sehr bewegliche, behende, gewandte, fast ununterbrochen tätige, rastlose, unruhige und vorsichtige, wenn auch nicht immer scheue Vögel, laufen und fliegen vortrefflich, schwimmen auch recht gut, haben eine laute, hohe, pfeifende, aber angenehme Stimme, lieben Geselligkeit, leben jedoch mehr mit ihresgleichen als mit verwandten Arten zusammen.
Ihre Nahrung, die aus dem verschiedensten Kleingetier, insbesondere Würmern, kleinen zartschaligen Muscheln, Kerbtieren und deren Larven und dergleichen besteht, lesen sie nur von der Oberfläche des Kieses oder Schlammes der Küste wie der Ufer ab, laufen deshalb mit äußerster Geschäftigkeit auf und nieder und halten sich, während sie jagen, etwas entfernt voneinander.
Über das Brutgeschäft des Roststrandläufers fehlt noch jegliche Kunde; der Seestrandläufer dagegen nistet schon auf den Shetlandsinseln und weiter nach Norden hin, überall in der Nähe der Küste. Er erwählt zur Niststelle gewöhnlich einen erhöhten steinigen, mit kurzem Grase oder Moose bestandenen Platz und legt Ende Mai seine vier mäßig großen, etwa dreißig Millimeter langen, vierundzwanzig Millimeter dicken, birnförmigen, nach Färbung und Zeichnung abändernden, auf grünlich- oder ölbräunlich grauem Grunde mit zahlreichen, großen, umberbraunen Flecken gezeichneten Eier in eine seichte, kaum ausgekleidete Grube oder Mulde. Das brütende Weibchen sitzt sehr fest und nimmt bei Gefahr zur Verstellung seine Zuflucht, um den Feind abzulenken. Die Jungen wachsen rasch heran und sind oft schon Ende Juni flügge.
Die Jagd beider Strandläuferarten ist mühelos, der Fang auf besonders eingerichteten Herden auch nicht schwierig; das Wildbret lohnt jedoch, da es tranig zu schmecken Pflegt, die Jagd nicht. Gefangene Rost- und Seestrandläufer benehmen sich wie andere Arten der Gruppe.
Die Länge des Sichlerstrandläufers oder Zwergbrachvogels ( Tringa subarquata) beträgt neunzehn bis zwanzig, die Breite fünfunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Im Frühlingskleide ist fast der ganze Unterkörper rostrot, heller oder dunkler, reiner oder mehr braun, der Oberkopf auf schwärzlichem Grunde rostgrau gewellt, weil die Federkanten diese Färbung zeigen, der Hinterhals rostgrau oder rostrot, schwarz in die Länge gestrichelt, der übrige Oberkörper, mit Ausnahme des weißgefleckten Steißes, aus tiefschwarzem Grunde hell rostfarben gefleckt und licht aschgrau oder rostgelb gekantet; die Schwanzfedern sind aschgrau, nach der Mitte zu dunkler, ihre Schäfte und Kanten weiß. Der Augenstern ist braun, der gebogene Schnabel schwarz, der Fuß schwarzbraun. Die Geschlechter unterscheiden sich nicht.
Der nächste Verwandte der vorstehend beschriebenen Art ist der Alpenstrandläufer ( Tringa alpina). Seine Länge beträgt fünfzehn bis achtzehn, die Breite dreißig bis dreiunddreißig, die Fittichlänge zehn bis elf, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Oberkopf, Mantel, Schultern und Bürzel sind im Hochzeitskleide rostrotbraun, alle Federn in der Mitte schwarz, Kopf- und Halsseiten, Hinterhals, Kehle, Kopf, Oberbrust und Unterschwanzdecken auf weißem Grunde durch dunkle Schaftstriche längsgestreift, Unterbrust und Bauch einfarbig schwarz, die Handschwingen schwarzbraun, die hinteren außen schmal, die Armschwingen breit weiß gesäumt, letztere auch an der Spitze weiß gerandet, die Schwanzfedern braun. Das Auge hat braunen Stern, der gebogene Schnabel und die Füße sind schwarz. Im Winterkleide sind alle Oberteile graulichbraun, die Unterteile aber reinweiß.
Der Sichlerstrandläufer wird im ganzen Norden der Erde gefunden, wandert aber, den Küsten wie Flüssen und andern Binnengewässern folgend, weit nach Süden hinab und kommt allwinterlich regelmäßig und sehr häufig in ganz Nordafrika, längs der Küsten des Roten, Indischen, Atlantischen und Stillen Meeres vor, soll sogar am Vorgebirge der Guten Hoffnung erlegt worden sein. Ich fand ihn in seinem schönsten Kleide noch tief im Innern Afrikas am Weißen wie am Blauen Nil; andere Beobachter trafen ihn in Westafrika an. Er erscheint, vom Süden herkommend, Mitte April und kehrt einzeln bereits Ende Juli, regelmäßig aber erst vom August an wieder zurück; der Durchzug währt jedoch bis Anfang Oktober.
Der Alpenstrandläufer ist zwar ebenfalls im Norden heimisch, brütet aber schon in Deutschland und durchstreift allwinterlich, mit Ausnahme von Australien und Polynesien, die ganze Erde.
Auftreten, Wesen und Betragen beider Strandläufer ähneln sich sehr. Auch sie sind vorzugsweise Seevögel, halten sich aber doch auch gern auf flachen, schlammigen Ufern stehender Gewässer auf und steigen, ihnen folgend, hoch im Gebirge empor. Mit Ausnahme der Mittagsstunden, die sie teilweise schlafend verbringen, sieht man sie den ganzen Tag in Bewegung. Trippelnd oder rennend laufen sie längs des Ufers dahin, jeden Augenblick fast ein kleines Tier aufnehmend, dabei anhaltend und dann weitereilend. Gestört, erheben sie sich mit schnellem, gewandtem Fluge in die Höhe, schießen eine Strecke weit eilig dahin und kehren, einen großen Bogen beschreibend, in die Nähe des Ortes zurück, von dem sie aufflogen. Wenn sie sich in Gesellschaft anderer Strandläufer befinden, tun sie diesen alles nach, laufen und fliegen mit ihnen, führen selbst die verschiedenen Schwenkungen, die das leitende Mitglied des Trupps einhält, im Fluge aus. Eine Uferschnepfe oder ein großer Wasserläufer wird gewöhnlich der Ehre gewürdigt, gemischten Zügen dieser Strandläufer vorzustehen und scheint sich seinerseits auch ganz gut unter dem kleinen Volk zu gefallen. Aus meinen Beobachtungen glaube ich schließen zu dürfen, daß ein derartiges Verhältnis wochenlang besteht, vielleicht erst auf dem Rückzuge gelockert wird. Diese Verbindung erschwert zuweilen die Beobachtung der sonst höchst zutraulichen Vögel. Man bemerkt sehr bald, daß eine der vorsichtigen Uferschnepfen ihre Ängstlichkeit auf das kleine Gesindel überträgt und dieses zuletzt so scheu macht, daß man Mühe hat, sich ihm zu nähern. Besteht ein solcher Verein nur aus Strandläufern selbst, so übernimmt nicht selten der Zwergbrachvogel die Führung, und dann ist er ebenfalls viel scheuer als sonst. Am leichtesten kann man beide beobachten, wenn man sich stellt, als ob man gar nicht auf sie achte, sondern seines Weges weitergehen wolle; dann ist man imstande, bis auf wenige Schritte an den Trupp heranzukommen und dessen Treiben mit Muße zu belauschen. Alle Mitglieder des Häufchens scheinen nur von einem Geiste beseelt zu sein; sie halten sich stets geschlossen zusammen, rennen immer in derselben Richtung, scheinbar auch gleichzeitig, fressen dabei beständig, erheben sich auf das warnende, etwas schwirrende Pfeifen des wachhaltenden Männchens, stürmen im dichtgeschlossenen Fluge nahe über dem Wasser fort, kehren, nachdem sie wenige hundert Schritte durchmessen haben, wieder zurück und treiben es hier wie vorher. Von beiden Strandläufern bleiben viele sehr lange, einzelne während des ganzen Sommers in der Winterherberge zurück, ohne daß man einen zwingenden Grund dafür anzugeben wüßte.
Am Brutplatz vereinzeln sich die zurückkehrenden Schwärme in Paare, die jedoch immerhin noch in einer gewissen Verbindung miteinander bleiben, und schreiten unmittelbar nach ihrer Ankunft zur Fortpflanzung. Die Männchen lassen jetzt ihre pfeifende oder schwirrende, auf weithin hörbare Stimme öfter als je vernehmen, erheben sich auch wohl in die Luft und tragen, über dem Neste fast nach Pieperart auf und nieder fliegend, eine Art von Gesang vor, tun dies auch selbst im Sitzen. Die Brutgebiete des Zwergbrachvogels liegen im höchsten Norden, die des Alpenstrandläufers erstrecken sich von hier bis Deutschland; das Brutgeschäft des ersteren ist noch nicht, das des letzteren recht gut bekannt. Jenen sahen wir selbst in der Tundra der Samojedenhalbinsel, offenbar am Brutplatz, fanden jedoch das Nest nicht; diesen dagegen beobachteten Naumann und andere vielfach in Schleswig-Holstein, Oldenburg, Hannover, Westfalen, Dänemark usw. Das Nest steht meist auf sandigen oder feuchten, spärlich mit Gras, Binsen, Heidekraut bewachsenen Stellen, in der Regel nicht weit vom Meer, und ist eine kleine, mit wenigen Hälmchen ausgelegte Vertiefung; die vier Eier, die man von Ende April bis Mitte Juni findet, sind durchschnittlich fünfunddreißig Millimeter lang, vierundzwanzig Millimeter dick, kreiselförmig, dünnschalig, glänzend und auf schmutzig ölfarbenem Grunde mit vielen großen und kleinen Flecken und Punkten von dunkelölbrauner Färbung getüpfelt. Nur das Weibchen brütet und zeitigt die Eier binnen sechzehn bis siebzehn Tagen, wird aber währenddem vom Männchen bewacht, wie dieses auch an der Führung der Jungen Anteil nimmt. Letztere verlassen das Nest, sobald sie abgetrocknet sind, wachsen unter treuer Führung ihrer Eltern rasch heran, erhalten schon in der ersten Woche ihres Lebens Federn, lernen in der dritten Woche bereits fliegen und gesellen sich bald darauf zu ihresgleichen, um nunmehr, ohne die Alten, ihre Wanderung anzutreten.
Außer ihren natürlichen Feinden, insbesondere den kleinen Falken, stellt der Mensch beiden Strandläufern ihres höchst schmackhaften Wildbrets halber eifrig nach und erlegt oder fängt sie auf den sogenannten Schnepfenherden zu Hunderten und Tausenden. Gefangene und entsprechend gepflegte Sichler- und Alpenstrandläufer sind allerliebst, gewöhnen sich leicht an ein geeignetes Ersatzfutter und werden bald zahm und zutraulich, halten aber selten längere Zeit aus, weil sie übermäßig fressen und an Verfettung sterben.
Der Zwergstrandläufer oder Raßler ( Tringa minuta) ist mit seinen Verwandten der kleinste aller Schnepfenvögel. Seine Länge beträgt vierzehn, die Breite dreißig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge vier Zentimeter. Im Frühlingskleide sind die Federn des Oberkopfes schwarz, rostfarben gerandet, die des Hinterhalses grau, dunkler gewölkt, die des Mantels dunkelschwarz, breit hochrostfarben gesäumt, die der Kehle weiß, der Seiten des Halses und der Oberbrust hell rostfarben, fein braun gefleckt; über das Auge zieht sich ein weißlicher, zwischen ihm und dem Schnabel steht ein tiefbrauner Streifen. Das Auge ist braun, der gerade Schnabel schwarz, der Fuß grünlichschwarz. Im Herbstkleide sind die Oberteile dunkel aschgrau, mit deutlich braunschwarzen Schaftstrichen gezeichnet, die Gurgel, die Seiten des Kopfes, die Unterbrust rostgrau, die übrigen Unterteile weiß.
Die meisten Forscher trennen von dieser Art den im Norden Amerikas heimischen, wiederholt auch in Europa vorgekommenen Pygmäenstrandläufer ( Tringa minutilla), der zwar sehr ähnlich, am Hals und Kropf aber stärker gefleckt und noch kleiner ist, auch kürzere Flügel hat als jener.
Bestimmt verschieden und schon an seinem gebogenen Schnabel und den niedrigen Fußwurzeln kenntlich ist das Sandläuferchen ( Tringa temminckii). Seine Länge beträgt fünfzehn, die Breite neunundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Das Gefieder ist im Hochzeitskleide oberseits auf bräunlichgrauem Grunde schwarz und rostfarben gefleckt, unterseits, bis auf die dunkler gestrichelten Kropfseiten, weiß, im Winterkleide oberseits fast einfarbig bräunlich aschgrau, unterseits auf dem Kropfe bräunlichgrau, dunkler längsgestrichelt, übrigens weiß. Das Auge ist braun, der Schnabel an der Wurzel gelblich, übrigens schwarz, der Fuß schmutzig grüngelb.
Auch der Zwergstrandläufer gehört dem hohen Norden an, zieht aber so weit, daß man ihn fast an allen Meeresküsten, erweislich an denen Europas, Asiens, Afrikas und Australiens sowie an Flüssen und stehenden Gewässern im Innern dieser Erdteile gefunden hat. In Ägypten überwintert er in großer Anzahl. Das Sandläuferchen teilt mit ihm dieselbe Heimat, wandert im Winter jedoch nicht so weit, sondern nimmt schon in Südeuropa, Nordafrika, China und Indien Herberge. Beide folgen auf ihrem Zuge der Küste des Meeres und den Ufern der Ströme und Flüsse, wandern gewöhnlich in Gesellschaften mit Verwandten, zuweilen aber auch in starken Flügen, die nur von einer der beiden Arten gebildet werden, regelmäßig des Nachts und treiben sich tagsüber an einer geeigneten Stelle, Nahrung suchend, umher. Schlammiger Boden scheint ihnen mehr zuzusagen als sandiger, obwohl sie sich auch auf solchem finden. Sie sind äußerst niedliche, höchst bewegliche, behende, regsame Vögel, die vortrefflich laufen und gewandt und schnell fliegen, bei Tage aber selten größere Strecken durchmessen, vielmehr gewöhnlich in einem geringen Umkreise sich umhertreiben und, verjagt, nach derselben Stelle zurückkehren. Unter ihresgleichen leben sie in tiefstem Frieden, gegen andere Tiere zeigen sie wenig Scheu, dem Menschen gegenüber eine gewisse Zutraulichkeit. Die Stimme klingt sanft und angenehm wie »Dürr« oder »Dürrrüi«, manchmal auch »Dirrrit«. Im übrigen ähneln beide den bereits geschilderten Verwandten.
Beide Strandläufer nisten in den Tundren Europas und Asiens; Nester und Eier ähneln denen anderer Strandläufer, sind aber kleiner, die des Zwergstrandläufers neunundzwanzig, die des Sandläuferchens achtundzwanzig Millimeter lang, jene zwanzig, diese neunzehn Millimeter dick, die einen wie die andern glattschalig, feinkörnig und glänzend, auf trüb gelblichgrauem bis ölgrünem Grunde mit aschgrauen, wolkenartigen Unterflecken und Rändern, dunkelbraunen Flecken und schwarzbraunen Punkten, namentlich am stumpfen Ende, gezeichnet.
*
Der merkwürdigste aller Strandläufer ist der Kampfläufer ( Machetes pugnax), der einzige Vertreter seiner Sippe. Das Gefieder ist durch einen Kampfkragen, den die Männchen im Frühjahre tragen, besonders ausgeschmückt. Letztere zeichnen sich auch dadurch aus, daß sie ein Drittel größer sind als die Weibchen, im Hochzeitskleide eine ins unendliche abändernde Färbung und Zeichnung haben und im Gesichte eigentümliche Warzen erhalten, die im Herbste mit den Kragen verschwinden. Eine allgemein gültige Beschreibung kann nicht gegeben werden. Der Oberflügel ist dunkel braungrau, der schwarzgraue Schwanz auf den sechs mittleren Federn schwarz gefleckt, der Bauch weiß, das übrige Gefieder aber höchst verschieden gefärbt und gezeichnet. Letzteres gilt insbesondere für die aus harten, festen, etwa fünf Zentimeter langen Federn bestehende Krause, die den größten Teil des Halses umgibt. Sie ist auf schwarzblauem, schwarzem, schwarzgrünem, dunkel rostbraunem, rotbraunem, rostfarbenem, weißem und andersfarbigem Grunde heller oder dunkler gefleckt, gebändert, getuscht oder sonstwie gezeichnet, so verschiedenartig, daß man kaum zwei männliche Kampfläufer findet, die einander ähneln. Aus Erfahrung weiß man, daß bei einem und demselben Vogel im nächsten Jahre die gleiche Färbung und Zeichnung wieder zum Vorschein kommt. Die Brustfedern haben entweder die Zeichnung der Krause oder sind anders gefärbt. Dasselbe gilt für den Rücken. Das Auge ist braun, der Schnabel grünlich oder grünlichgelb, mehr oder weniger ebenfalls mit der Färbung des Gefieders wechselnd, der Fuß in der Regel rötlichgelb. Die Länge beträgt neunundzwanzig bis zweiunddreißig, die Breite etwa vierundsechzig, die Fittichlänge neunzehn, der Schwanz acht Zentimeter. Das Gefieder des Weibchens ändert nicht ab. Seine Färbung ist aus der Oberseite ein mehr oder weniger ins Rötliche spielendes Grau, das durch dunkle Flecke gezeichnet wird; das Gesicht und die Stirne sind gewöhnlich hellgrau, die Federn des Oberkopfes grau, braunschwarz in die Länge gefleckt, die des Hinterhalses grau, die des Rückens und der Schultern in der Mitte braunschwarz, am Rande rostfarben, die der Kehle und Gurgel grau und die des Bauches mehr oder weniger weiß. Die Länge beträgt höchstens sechsundzwanzig, die Breite siebenundfünfzig Zentimeter.
Der Norden der Alten Welt ist die Heimat des Kampfläufers; einzelne haben sich jedoch auch nach Nordamerika verirrt. Gelegentlich ihres Zuges besuchen diese Vögel nicht nur alle Länder Europas und Asiens, sondern auch ganz Afrika; denn man hat sie im Kaplande wie am Senegal oder am oberen Nil erlegt. Größere Sumpfflächen, wie sie der Kiebitz liebt, beherbergen in der Regel auch den Kampfläufer; jedoch verbreitet sich derselbe nicht so weit wie jener. Süddeutschland besucht er nur auf dem Zuge; Norddeutschland bewohnt er stellenweise regelmäßig. In der Nähe des Meeres sieht man ihn oft, eigentlichen Seevogel aber kann man ihn nicht nennen. Er folgt den Flüssen vom Meere an bis tief ins Land, hält sich allerdings meist in ihrer Nähe auf, streicht aber doch ziemlich weit von ihrem Ufer weg und wird deshalb oft inmitten der Felder oder selbst in der Steppe gefunden.
Bei uns zulande erscheint der Kampfläufer flugweise Anfang Mai, selten schon in den letzten Tagen des April, bezieht seine Sommerplätze und beginnt bereits im Juli und August wieder umherzustreifen, bezüglich sich auf die Wanderschaft zu begeben. Auch er reist des Nachts und immer in Gesellschaften, die dann in der Regel Kettenzüge in Keilform bilden. Die Männchen ziehen getrennt von den Weibchen und Jungen, wie sich auch beide Geschlechter abgesondert in der Winterherberge aufhalten. Zahlreiche Scharen, die ich am Mensaleh-See und in den Flußniederungen im Sudan antraf, bestanden regelmäßig aus Weibchen; Männchen kamen mir nur einzeln und immer selten zu Gesicht. Erstere verlassen uns zuerst und kehren am spätesten zurück; es finden sich aber unzweifelhaft dieselben Vögel auch wieder auf denselben Plätzen ein.
Vor und nach der Brutzeit unterscheiden sich Männchen und Weibchen in ihrem Betragen nicht. Ihr Gang ist anmutig, nicht trippelnd, sondern mehr schrittweise, die Haltung dabei eine stolze, der Flug sehr schnell, viel schwebend, durch leichte und rasche Schwenkungen ausgezeichnet. Bis gegen die Brutzeit hin vertragen sich die Kampfläufer sehr gut, zeigen sich gesellig, halten treu zusammen, mischen sich auch wohl zuweilen, immer aber nur für kurze Zeit, unter ähnliches Geflügel und treiben sich munter in einem bestimmten Gebiete umher, zu regelmäßigen Tageszeiten bald an dieser, bald an jener Stelle desselben sich beschäftigend. Nach Art ihrer Verwandten sind sie munter und rege, noch ehe der Tag angebrochen und bis tief in die Nacht hinein, bei Mondschein auch während desselben, schlafen und ruhen also höchstens in den Mittagsstunden. Morgens und abends beschäftigen sie sich eifrig mit Aufsuchung der Nahrung, die in dem verschiedensten Wassergetiere, aber auch in Landkerfen und Würmern und ebenso in mancherlei Sämereien besteht. In Indien fressen sie, solange sie sich in der Winterherberge aufhalten, fast ausschließlich Reis; in Ägypten wird es nicht anders sein, da ich sie dort ebenfalls oft in Reisfeldern gefunden habe. Solange sie Nahrung suchen, pflegen sie sehr ruhig und still dem wichtigen Geschäfte nachzugehen; man vernimmt dann höchstens beim Auffliegen ihre sehr schwache Stimme, die wie ein heiseres »Kak, kak« klingt. Mit Einbruch der Nacht werden sie rege und schwärmen nun scheinbar zu ihrem Vergnügen oft längere Zeit umher.
Dieses Betragen ändert sich gänzlich, sobald die Paarungszeit eintritt. Jetzt betätigen sie ihren Namen. Die Männchen kämpfen, und zwar fortwährend, ohne wirklich erklärliche Ursache, möglicherweise garnicht um die Weibchen, wohl aber um eine Fliege, einen Käser, einen Wurm, um einen Sitzplatz, um alles und nichts; sie kämpfen, gleichviel ob Weibchen in der Nähe sind oder ob sie keine solche sehen, ob sie sich ihrer vollen Freiheit erfreuen oder in der Gefangenschaft befinden, ob sie erst vor wenigen Stunden ihre Freiheit verloren oder schon jahrelang im Käfig gelebt haben; sie kämpfen zu jeder Tageszeit, kurz, unter allen Umständen. Im Freien versammeln sie sich auf besonderen Plätzen, die da, wo sie häufig vorkommen, fünf- bis sechshundert Schritte voneinander entfernt liegen, alljährlich wieder aufgesucht und benutzt werden und sich wohl infolge der beständigen Kämpfezeit, nicht aber an und für sich von dem umliegenden Boden unterscheiden. Eine etwas erhöhte, immer feuchte, mit kurzem Rasen bedeckte Stelle von anderthalb bis zwei Meter Durchmesser wird zum Kampfplatze ausgewählt und nun täglich von einer gewissen Anzahl Männchen mehrmals besucht. Hier erwartet jedes den Gegner, und mit ihm kämpft es. Bevor die Federn des Kragens sich nicht ausgebildet haben, erscheint kein Kampfläufer auf dem Walplatze; sowie er aber sein volles Hochzeitskleid angelegt hat, findet er sich ein und hält nun mit einer bewunderungswürdigen Zähigkeit an ihm fest.
Zuweilen findet sich ein Weibchen auf dem Kampfplatze ein, nimmt ähnliche Stellungen an wie die kämpfenden Männchen und läuft unter diesen herum, mischt sich aber sonst nicht in den Streit und fliegt bald wieder davon. Dann kann es geschehen, daß ein Männchen es begleitet und ihm eine Zeitlang Gesellschaft leistet. Bald aber kehrt es wieder zum Kampfplatz zurück, ohne sich um jenes zu kümmern. Niemals kommt es vor, daß zwei Männchen einander fliegend verfolgen. Der Streit wird auf einem Platze ausgefochten und außerhalb desselben herrscht Frieden.
Wenn die Legezeit herannaht, sieht man ein Männchen in Gesellschaft zweier Weibchen oder umgekehrt, ein Weibchen in Gesellschaft mehrerer Männchen, auch fern vom Kampfplatze in der Nähe der Stelle, die später das Nest aufnehmen soll. Letzteres steht selten fern vom Wasser, oft auf einer erhöhten Stelle im Sumpfe, und ist eine mit wenigen dürren Hälmchen und Grasstoppeln ausgelegte Vertiefung. Vier, seltener drei Eier, von bedeutender Größe, etwa vierzig Millimeter Längs-, zweiunddreißig Millimeter Querdurchmesser, die auf olivenbräunlichem oder grünlichem Grunde rötlichbraun oder schwärzlich, am dickeren Ende gewöhnlich stärker als am schwächeren gefleckt sind, bilden das Gelege. Das Weibchen brütet allein, siebzehn bis neunzehn Tage lang, liebt die Brut sehr und gebärdet sich am Neste ganz nach Art anderer Schnepfenvögel, wie denn auch die Jungen in derselben Weise leben wie ihre Verwandten. Das Männchen bekümmert sich nicht um seine Nachkommenschaft, es kämpft mit andern, solange es brünstige Weibchen gibt, beendet die Kampfspiele in den letzten Tagen des Juni und treibt sich nun bis gegen die Zugzeit hin nach Belieben im Lande umher.
Kein Schnepfenvogel läßt sich leichter fangen, keiner leichter an die Gefangenschaft gewöhnen als der Kampfläufer. Wenn man auf dem Kampfplatze Schlingen stellt, bekommt man die Männchen gewiß in seine Gewalt; auch auf dem Wasserschnepfenherde fängt man sie, oft in erheblicher Anzahl. Im Käfig zeigen sie sich augenblicklich eingewöhnt, gehen ohne weiteres an das Futter und halten sich recht gut. In einem größeren Gesellschaftsbauer nehmen sie sich allerliebst aus und gewähren jedermann beständige Unterhaltung, mindestens solange die Brutzeit währt; denn auch hier enden ihre Kämpfe nie: jede ihnen zugeworfene Semmelkrume erregt die ganze Gesellschaft. Nach der Paarungszeit tritt Frieden ein, und die wackeren Recken leben fortan sanft, gemütlich und ruhig untereinander, obwohl einer und der andere sich noch zu drohenden Stellungen verleiten läßt.
*
»Zwei norwegische Meilen von dem Gehöfte Melbo auf den Lofoten liegt die Pfarrkirche Bö und dicht neben ihr das Pfarrhaus. In ihm lebt ein liebenswürdiger Mann, bekannt als Pfarrer, bekannter noch als Maler. Den suchen Sie auf, und wenn Sie es nicht seinetwillen tun wollen, so müssen Sie es tun der Wassertreter halber, die Sie dort in unmittelbarer Nähe finden werden. Dreihundert Schritte östlich von diesem Pfarrhause liegen fünf kleine mit Gras umstandene Süßwasserteiche; auf ihnen werden Sie die Vögel finden, nach denen Sie mich gefragt haben.«
So sagte mir der Forstmeister Barth, ein vogelkundiger Norman, bei dem ich mir Rats erholte, bevor ich mich den Ländern zuwandte, in denen vier Monate im Jahre die Sonne nicht untergeht. Ich begab mich auf die Reise, benutzte jede Gelegenheit, um mit der Vogelwelt bekannt zu werden, suchte jeden riedumstandenen Süßwassersee ab und spähte vergeblich nach den ersehnten Vögeln. Endlich kam ich nach Bö, fand bei dem Pfarrer freundliche Aufnahme und ließ mir die köstlichen Bilder zeigen, die der einsame Mann da oben zu seiner eigenen Genugtuung malt; dann aber fragte ich, zu nicht geringer Überraschung des Wirtes, nach den bewußten kleinen Seen. Wir brachen auf, erreichten sie nach wenigen hundert Schritten, und – auf dem ersten derselben schwamm ein Pärchen des Wassertreters umher, auf dem zweiten ein zweites, auf einem der übrigen noch ein drittes. Später habe ich freilich noch viele andere gefunden; denn in Lappland gehören sie nicht zu den Seltenheiten, und in der Tundra der Samojedenhalbinsel sind sie überaus häufig: so aber, wie an jenem Tage, haben sie mich doch nie wieder entzückt und hingerissen.
Der Wassertreter, von den Isländern Odinshenne genannt ( Phalaropus hyperboreus), vertritt eine gleichnamige Sippe und Unterfamilie ( Phalaropodinae). Das Gefieder ist auf dem Oberkörper schwarzgrau, auf dem Unterrücken und den Schultern schwarz und rostgelblich gerändert, an den Seiten des Hinterhalses rostrot, auf der Kehle und den Unterteilen weiß, an dem Kropfe und an den Seiten grau; die weißschaftigen Schwingen sind schwärzlich, an der Wurzel weiß, die Flügeldeckfedern am Ende weiß gesäumt, die Schwanzfedern braun. Beim Weibchen ist die Färbung lebhafter. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau, dessen innere Schwimmhäute und Säume gelblich, die äußeren aber grau. Die Länge beträgt beim Männchen achtzehn, die Breite dreiunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge fünf Zentimeter; das Weibchen ist merklich größer.
Die Odinshenne bewohnt im Sommer die Hebriden, Färinseln, Island, Lappland und von hier an die Tundra aller drei nördlichen Erdteile, wandert im Winter selten weit, wird aber doch ziemlich regelmäßig in Schottland und Norwegen, seltener an den Küsten von Dänemark, Deutschland, Holland, Frankreich und Spanien, selbst Italien gesehen, nimmt ebenso im Schwarzen, Japanischen, Chinesischen und Indischen Meere Herberge und zieht in Amerika bis zur Breite von Guatemala hinab. Die See verläßt dieser Vogel selten während seines Zuges, kommt aber doch auch auf Binnengewässern vor, überwintert beispielsweise alljährlich in Persien.
Die Wassertreter sind echte Kinder des Meeres, halten sich nur während der Brutzeit in der Nähe der Küste und auf kleinen Süßwasserseen des Festlandes selbst auf und verbringen die übrige Zeit im Meere. Die Odinshenne trifft zwischen dem zwanzigsten und fünfundzwanzigsten Mai auf Island, in den letzten Tagen desselben Monats in Grönland ein und wird sich wohl auch in Finnmarken zur nämlichen Zeit einstellen. Vorher sieht man sie entweder in Scharen inmitten des Meeres oder in kleineren Flügen in der Nähe der Küste auf den Fjorden. Hierauf zerteilen sich die Schwärme in Paare, und jedes von diesen sucht seinen Nistteich auf. Als Holboell im Frühling des Jahres 1835 achtzehn Tage hindurch während der Hinreise nach Grönland vom Eise eingeschlossen war, sah er stets Wassertreter zwischen den Eisstücken umherschwimmen; später bemerkte er sie inmitten der heftigsten Brandung. Auf der See verbringen sie den Winter, und das Meer bietet ihnen so reichliche Nahrung, daß sie von Fett strotzen, ja kaum abgebalgt werden können. Man sieht sie beständig von den Wellen etwas aufnehmen und verschlucken, hat aber die Tierchen, die hier jetzt ihre Nahrung bilden, noch nicht zu bestimmen vermocht.
Ich bin mir vollkommen bewußt, daß die Ordnung der Stelzvögel sehr viele liebenswürdige und anmutige Mitglieder zählt, nehme aber doch keinen Anstand, die Wassertreter, insbesondere die Odinshenne, als die anmutigsten von allen zu erklären. Diese Vögel sind überaus lieblich, anziehend in ihrem Wesen und Betragen, gewandt in jeder Bewegung, begabt wie nur irgendein anderes Mitglied ihrer Zunft, auf dem festen Lande wie im Riede, auf dem Wasser wie in der Luft zu Hause. Ihr Gang ähnelt dem der Strandläufer. Sie stehen mit etwas eingezogenem Halse ruhig am Ufer, laufen, wenn sie in Bewegung gekommen, trippelnd dahin, vermögen jedoch ihren Lauf zum Nennen zu beschleunigen und wissen sich mit größtem Geschicke im Riede zu bewegen, auch trefflich zu verbergen. Ihr rascher, unsteter Flug beschreibt viele Bogen, wie es scheint, mehr um der Laune als um einem Bedürfnisse zu genügen; sie erinnern fliegend jedoch weniger an Strandläufer als vielmehr an die Moorschnepfe und unterscheiden sich von dieser nur dadurch, daß sie den Hals sehr einziehen und infolgedessen vorne wie abgestutzt aussehen. Ihr kleiner Kopf und der feine Schnabel fallen ebenfalls so auf, daß man sie kaum verwechseln kann. Im Schwimmen betätigen sie Leichtigkeit, Zierlichkeit und Anmut, die unwiderstehlich hinreißen. Sie liegen leichter als jeder andere mir bekannte Schwimmvogel auf dem Wasser, so daß sie dessen Oberfläche kaum zu berühren scheinen, tragen dabei das Gefieder knapp, bewegen sich kräftig, unter kurzen Stößen und mit beiden Beinen abwechselnd rudernd, nickend wie ein Rohrhühnchen, und durchmessen in kurzer Zeit verhältnismäßig bedeutende Strecken. Zu tauchen vermögen sie nicht; ihr Gefieder ist zu reich, als daß es ihrer Kraft möglich wäre, den leichten Leib unter die Oberfläche zu zwingen; selbst verwundete versuchen nicht, in der Tiefe sich zu verbergen, sondern schwimmen so eilig wie möglich dem Riede zu, um sich hier den Blicken zu entziehen. Vom Wasser erheben sie sich ohne weiteres in die Luft, und ebenso fallen sie aus der Höhe unmittelbar auf dessen Spiegel herab. Schwimmend verrichten sie alle Geschäfte, nehmen von der Oberfläche des Wassers Nahrung auf, jagen sich spielend hier umher und begatten sich sogar in dieser Stellung. Dabei gilt es ihnen vollkommen gleich, ob das Wasser ruhig wie ein Spiegel oder bewegt, ob es kalt oder warm ist. Faber sah sie auf den Teichen der heißen Quellen, in deren Wasser man kaum die Hand halten kann, mit demselben Gleichmute wie zwischen Eisschollen umherschwimmen. Ihr Lockton ähnelt dem kleinerer Strandläufer, läßt sich aber schwer mit Buchstaben ausdrücken, weil die schneidenden Töne ungewöhnlich hoch liegen. Ihre Sinne sind scharf. Harmlos und vertrauend, wie wenig andere Strandvögel, erlauben sie dem Menschen eine Annäherung bis auf zehn Schritte, und wenn derselbe sie nicht behelligt, lassen sie sich minutenlang beobachten, ohne sich dem Auge zu entziehen; aber jeder Versuch einer Verfolgung macht sie vorsichtig und ein einziger Fehlschuß sehr scheu. Um andere Geschöpfe scheinen sie sich, während der Brutzeit wenigstens, nicht zu bekümmern, leben vielmehr nur sich selbst; die Liebe erregt jedoch auch sie und ruft unter den Männchen der gleichen Art, die sich sonst vortrefflich vertrugen, lebhaften Streit und Kampf hervor. Ihre Streitereien werden auf dem Wasser begonnen und in der Luft zum Austrage gebracht. Das Männchen, das sich innerhalb des Gebietes eines seßhaften Pärchens sehen läßt, ruft augenblicklich die Eifersucht des rechtmäßigen Besitzers hervor. Beide schwimmen aufeinander los, erheben sich vom Wasser und balgen sich nun im wirbelnden Fluge so lange, bis der Eindringling in die Flucht geschlagen wurde. Um so größere Zärtlichkeit erweisen sich die Gatten des Pärchens. Der eine hält sich beständig zu dem andern und verläßt ihn nur selten. Auf größeren Seen mag es vorkommen, daß mehrere Paare zusammen nisten, da, wo es kleinere Süßwasserseen oder richtiger Teiche gibt, behauptet jedes Paar einen derselben und duldet auf ihm keine Mitbewohnerschaft. Gleichwohl statten sich verschiedene Pärchen von Zeit zu Zeit Besuche ab, schwärmen fliegend ein Weilchen über dem See oder Teiche, lassen sich vielleicht auch auf Augenblicke nieder, schwimmen ein wenig umher, verweilen jedoch nicht lange und verschwinden ebenso rasch wieder, wie sie gekommen waren.
In Lappland fand ich brütende Odinshennen immer nur auf Teichen in unmittelbarer Nähe des Meeres, in der Tundra der Samojedenhalbinsel dagegen auch über hundert Kilometer von dieser entfernt, die meisten aber in der Nähe des Ob oder der Tschutschja. Das Nest steht nicht auf Inseln oder trockenen Stellen in den Teichen, sondern regelmäßig am Rande derselben, und ist eine einfache, aber hübsch gerundete Mulde im Grase, ohne eigentliche Auskleidung, welche jedoch durch das beim Runden niedergedrückte Gras selbst ersetzt wird. Ich fand drei und vier Eier in den von mir untersuchten Nestern; letzteres ist die gewöhnliche Anzahl. Die Eier sind verhältnismäßig klein, etwa dreißig Millimeter lang, zwanzig Millimeter dick und auf ölfarbenem oder dunkelgraugrünem Grunde mit vielen kleineren und größeren schwarzbraunen Flecken gezeichnet. Faber sagt, daß Männchen und Weibchen abwechselnd brüten, fügt aber hinzu, daß diese Vögel die einzigen sind, deren Männchen zwei Brutflecke haben, während man letztere beim Weibchen nicht bemerkt, und Holboell meint deshalb, daß das Männchen allein die Eier zeitige, das Weibchen aber überhaupt nicht brüte. Am Nest zeigt sich der brütende Vogel sehr besorgt, fliegt beständig herbei, beschreibt einen weiten Bogen, um sofort wieder zurückzukehren, und treibt es in dieser Weise fort, solange man sich in der Nähe des Nestes aufhält. Dann und wann setzt er sich auch wohl auf den Wasserspiegel; daß er sich aber, um den Störenfried abzulenken, lahm stellen sollte, habe ich nicht bemerkt. Zu solchen Künsten greift er jedoch, wenn er Junge führt. Mitte Juli fand ich im nördlichen Lappland Junge im Daunenkleide, die unter Führung der Alten rasch im Ried oder Gras dahinliefen, sich meisterhaft zu verstecken wußten, aber doch aufgefunden und erhascht wurden. Die Alten zeigten sich unendlich besorgt, flatterten ängstlich um mich her und versuchten, mich durch Verstellungskünste von den Jungen abzuhalten. Diese ähneln in ihrem Betragen andern Strandvögeln, unterscheiden sich aber von ihnen dadurch, daß sie fertig schwimmen können. Die Färbung ihres Daunenkleides ist eine verhältnismäßig dunkle, der des Riedgrases ähnlich.
In dem Magen der von mir erlegten Odinshennen fand ich verschiedene Kerbtierlarven, die ich nicht bestimmen konnte, und gelegentlich meiner Beobachtungen der Vögel sah ich, daß sie ihre Nahrung ebensowohl vom Wasser wegnahmen als am Uferrande oder im Ried aufsammelten. Daß die Jungen nur mit solcher Nahrung sich begnügen müssen, wie sie das Ried ihnen bietet, braucht nicht erwähnt zu werden. Nach Malmgreen verzehrt der Wassertreter auf Spitzbergen während des Sommers hauptsächlich eine kleine Alge, die in den Sümpfen zahlreich vorkommt.
Anfang August führen die Alten ihre inzwischen flügge gewordenen Jungen hinaus zu den Inseln in den Fjorden und sammeln sich hier zu unschätzbaren Scharen, die jetzt ihr Winterleben beginnen. Anfang September haben sie ihr Winterkleid bereits angelegt und sich auch schon so gemästet, daß sie für den Sammler unbrauchbar geworden sind. Ende September Verlassen sie die Küste gänzlich und schwärmen nun auf das hohe Meer hinaus.
*
Die Wasserläufer ( Totaninae), die eine anderweitige Unterfamilie bilden, sind durchschnittlich schlanker, kleinköpfiger, langschnäbeliger und hochbeiniger als die Strandläufer. Der Schnabel ist kopflang oder etwas länger, von der Wurzel bis gegen die Mitte hin weich, an der Spitze hornig. Das Kleingefieder liegt knapp an, trägt keine Prachtfarben und wird zweimal im Jahre gewechselt. Männchen und Weibchen unterscheiden sich wenig durch die Große, wenig oder nicht durch die Färbung.
Wie die vorher genannten Vögel, gehören auch die Wasserläufer vorzugsweise dem Norden an; alle Arten aber wandern regelmäßig und besuchen dabei die entlegensten Länder. Die Ufer fließender und stehender Gewässer, Sümpfe und Brüche, weniger die Seeküste, bilden ihre Aufenthaltsorte. In der Winterherberge vereinigen sie sich mit vielen andern und manchmal ganz fremdartigen Vögeln, schlagen sich aber selten zu so starken Flügen zusammen wie die Strandläufer. Ihr Wesen ist ansprechend, der Gang zierlich, behend, schrittweise, der Flug außerordentlich leicht und schnell; die Stimme besteht aus angenehmen, hohen, flötenden, weit vernehmbaren Tönen, die sich so ähneln, daß eine Art der andern nicht selten folgt. Das Rest steht meist auf dem Boden, jedoch auch auf Bäumen; das Gelege zählt ebenfalls vier, verhältnismäßig große, birn- oder kreiselförmige, auf ölgrünem Grunde mit braungrauen Flecken gezeichnete Eier, die vom Weibchen gezeitigt werden. Die Jungen laufen den Alten vom ersten Tage ihres Lebens an nach, verbergen sich nach Art ihrer Verwandten bei Gefahr äußerst geschickt auf dem Boden oder im Grase, lernen bald flattern und machen sich, sowie sie ihre Flugfertigkeit erlangt haben, selbständig.
Sämtliche Wasserläufer gehören zu den vorsichtigen und scheuen Vögeln; die großen Arten übernehmen deshalb überall, wo sie mit andern Strandvögeln zusammenleben, die Führerschaft. Ihre Jagd gelingt keineswegs immer; auch der Fang verursacht Schwierigkeiten. Im Käfig gewöhnen sie sich bald ein, nehmen mit einfachem Ersatzfutter vorlieb und halten bei einigermaßen entsprechender Pflege jahrelang in der Gefangenschaft aus.
Beim Flußuferläufer, Sandpfeifer, Steinpicker, Steinbeißer usw. ( Tringoides hypoleuca), ist das Gefieder des Oberkörpers ölbräunlich, grünlich oder purpurschillernd, durch schwarze Schaft- und Querflecke gezeichnet, das der Kopfseiten bräunlich, dunkler geschaftet und längsgefleckt, das des Unterkörpers weiß; die Handschwingen sind braunschwarz, an der Spitze fein weißgrau gesäumt, von der dritten an auf dem Rande der Innenfahne durch ein weißes Fleckchen, das sich nach dem Körper zu vergrößert, geziert, die Unterarmschwingen in der Wurzelhälfte und an der Spitze weiß, sonst ebenfalls matt braunschwarz, die mittleren Steuerfedern braungrau, schwarz geschaftet, rostgelb gekantet und gefleckt, die übrigen mehr oder weniger weiß, schmal schwarz in die Quere gebändert. Das Auge ist braun, der Schnabel grauschwarz, an der Wurzel heller, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt einundzwanzig, die Breite vierunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Er vertritt die Sippe der Strand-Pfeifer ( Tringoides).
Der Flußuferläufer bewohnt oder besucht, mit Ausnahme des höchsten Nordens der Vereinigten Staaten, Mittel- und Südamerikas sowie Polynesiens, die ganze Erde, nistet auch fast überall, wo er vorkommt. Im nördlichen Deutschland erscheint er Mitte April, zuweilen auch erst im Mai, brütet und beginnt schon im Juli sein Umherschweifen, bis Mitte September die Wanderung angetreten wird. Gelegentlich dieser Reisen, die des Nachts ausgeführt und bei Tage unterbrochen werden, bemerkt man ihn in kleinen Gesellschaften von sechs bis acht, vielleicht auch zwanzig Stück. Diese Trupps scheinen während der Wanderung zusammenzubleiben; sie brechen abends auf, fliegen bei einigermaßen günstiger Witterung bis zum Morgen, lassen sich dann an einem geeigneten Orte, gewöhnlich an einem Fluß- oder Bachufer, nieder, suchen hier tagsüber Nahrung, schlafen in der Mittagszeit ein wenig, verweilen, wenn es ihnen besonders gut gefällt, sogar mehrere Tage an einer und derselben Stelle und setzen die Wanderung wieder fort.
Man sieht den Uferpfeifer regelmäßig auf Sandbänken, am häufigsten da, wo das Ufer mit Gesträuch und Schilf bewachsen ist. Er steht wagerecht, läuft behend und mehr trippelnd als schreitend umher und wippt nach Bachstelzenart beständig mit dem Schwanze. Sein Flug ist leicht, schnell und gewandt, insofern ungewöhnlich, als der Vogel beim Wegfliegen selten zu höheren Luftschichten emporsteigt, vielmehr unmittelbar über dem Wasser in gerader Linie hin fortstreicht, so daß man meint, er müsse sich die Schwingen netzen. Nur wenn er eine Stelle gänzlich verlassen will, schwingt er sich ebenfalls hoch in die Luft und jagt dann eilig dahin. Die weißen Flecke in den Schwungfedern zeigen sich bei ausgebreiteten Schwingen als breite, zierende Binden. Im Notfall wirft sich der geängstigte Flußuferläufer ins Wasser, schwimmt, wenn er es kann, rasch auf demselben dahin oder taucht, wenn es sein muß, in die Tiefe, rudert mit den Flügeln sehr schnell ein Stück weg und erscheint an einer ganz andern Stelle wieder. Sein Wesen treibt er, wie Naumann sagt, gern im stillen, halb und halb im verborgenen, obwohl er sich eigentlich niemals verkriecht und noch weniger im Grase versteckt. Selbst die erhabensten Plätzchen, die er betritt, liegen fast immer so, daß er wenigstens vom nächsten Ufer aus nicht schon aus der Ferne gesehen werden kann. Mit andern Strandvögeln macht er sich wenig zu schaffen; nicht einmal die Paare hängen treuinnig aneinander, sobald die Brutzeit vorüber ist. Die Stimme, ein zartes, helles, hohes und weitschallendes Pfeifen, ähnelt der des Eisvogels und klingt ungefähr wie »Hididi« oder »Jiht« und »Jhdihdihd«, wird aber während der Paarungszeit in einen Triller zusammengeschmolzen, der sanft beginnt, anschwillt und wieder abfallend endet, sich unendlich oft wiederholt und wenigstens nicht unangenehm ins Ohr fällt.
Unmittelbar nach seiner Ankunft im Frühjahr wählt sich jedes Pärchen seinen Stand und duldet in der Nähe kein zweites. Das Männchen zeigt sich sehr erregt, streicht in sonderbaren Zickzackflügen hin und her, trillert, singt und umgeht das Weibchen mit zierlichen Schritten. Dieses wählt an einer den Hochfluten voraussichtlich nicht ausgesetzten Uferstelle, näher oder entfernter vom Wasser, ein geeignetes Plätzchen im Gebüsch oder baut unter dem Gezweig, am liebsten im Weidicht, ein einfaches Nest aus Reisern, Schilf, Stoppeln und dürren Blättern so versteckt, daß man es trotz der verräterischen Unruhe der Alten gewöhnlich erst nach langem Suchen auffindet. Die vier Eier, die das Gelege bilden, sind bald kürzer, bald gestreckter, durchschnittlich fünfunddreißig Millimeter lang, sechsundzwanzig Millimeter dick, birnenförmig, feinschalig, glänzend, auf bleichrostgelbem Grunde mit grauen Unter-, rotbraunen Mittel- und schwarzbraunen Oberflecken gezeichnet und bepunktet. Jede Störung am Nest ist den Alten ungemein verhaßt; sie merken es auch, wenn ihnen ein Ei genommen wird, und verlassen dann das Gelege sofort. Beide Geschlechter brüten. Die Jungen entschlüpfen nach etwa zweiwöchentlicher Bebrütung, werden noch kurze Zeit von der Mutter erwärmt und nun den Weidehagen zugeführt. Hier wissen sie sich so vortrefflich zu Verstecken, daß man sie ohne gute Hunde selten auffindet, obgleich die Alten den Suchenden unter ängstlichem Geschrei umflattern. Nach acht Tagen brechen die Flügel- und Schwanzfedern hervor; nach vier Wochen sind sie flügge und der Pflege der Eltern entwachsen.
Kerbtierlarven, Gewürm und Kerbtiere im Fliegenzustande, namentlich Netz- und Zweiflügler, bilden die Nahrung. Sie wird entweder vom Strande aufgelesen oder im Fluge weggeschnappt, auch von den Blättern weggenommen. Fliegen, Mücken, Schnaken, Hafte und Wasserspinnen beschleicht der Flußuferpfeifer, indem er mit eingezogenem Kopf und Hals leise und vorsichtig auf sie zugeht, plötzlich den Schnabel vorschnellt und selten sein Ziel verfehlt.
In der Gefangenschaft gewöhnt er sich bald an das vorgesetzte Stubenfutter, hat sich nach wenigen Tagen eingewöhnt, wird sehr zahm, hält sich auf einem kleinen Räume in der Nähe seines Freßgeschirrs, beschmutzt den Käfig wenig und gewährt seinem Besitzer viel Vergnügen.
Unter den echten Wasserläufern ( Totanus) ist wohl der bekannteste von allen der Sumpfwasserläufer oder Rotschenkel ( Totanus calidris). Seine Länge beträgt siebenundzwanzig, die Breite neunundvierzig, die Fittichlänge sechzehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Die Oberteile sind graulichbraun, Kopf und Hals durch kleine längliche, Rücken und Mantel durch große runde, schwarze Flecke gezeichnet, Unterrücken und Bürzel weiß, die Federn des letzteren schwarz gebändert, Seitenhals und Kropf graugelblich, wie die Seiten mit schwarzen, braun eingefaßten Flecken besetzt, übrige Unterteile weiß, die Handschwingen, deren erste weiß geschaftet ist, braun, innen im Wurzelteil, die letzten, je weiter nach hinten, je mehr, auch am Ende weiß, die Armschwingen, bis auf die letzte, innen gebändert, übrigens fast ganz weiß, wodurch ein breiter Spiegel gebildet wird, die Schulterfedern dunkelbraun, zackig rostrot quergefleckt, die Schwanzfedern weiß, mit dunkelbraunen, grau abschattierten Querbinden geziert. Das Auge ist graubraun, der gerade Schnabel an der Wurzel blaßrot, an der Spitze schwarz, der Fuß zinnoberrot. Im Winterkleide ist die Oberseite tiefgrau, schwarz geschaftet und die Unterseite stärker gefleckt. Das Brutgebiet des Sumpfwasserläufers umfaßt ganz Europa, vielleicht mit Ausnahme Islands und der Färöerinseln, Klein-, Nord- und Mittelasien, das Wandergebiet erstreckt sich bis zum Vorgebirge der Guten Hoffnung und Indien, einschließlich seiner nachbarlichen Inseln.
Bei uns zulande, mindestens in Norddeutschland, brütet der Sumpfwasserläufer an allen geeigneten Orten, ist hier auch nicht selten, nirgends aber so häufig wie in Skandinavien, Rußland, Südsibirien und Turkestan. Er meidet Gebirge und Wälder, siedelt sich in der freien Ebene aber überall an, wo es größere oder viele stehende Gewässer, Brüche und Sümpfe gibt, und nimmt ebenso gut an der Seeküste oder an Strom- oder Flußufern wie auf nassen Wiesen oder Viehweiden seinen Sommerstand. An der See überwintert er nicht selten; Brutplätze des Binnenlandes dagegen verläßt er sofort nach beendeter Brut, um fortan zunächst in der Umgegend auf und nieder zu streichen. Im August beginnt, im Oktober beendet er seinen Wegzug, im März, zuweilen schon in den ersten Tagen, regelmäßiger in der Mitte des Monats, kehrt er zurück. Auch er reist des Nachts, aber nur im Frühling einigermaßen eilfertig, im Herbst dagegen langsam, gemächlich, den Flüssen oder der Küste folgend und auf nahrungsreichen Örtlichkeiten oft tagelang verweilend.
Obwohl ebenfalls behend und gewandt, steht er doch andern Wasserläufern in beiden Beziehungen ebenso wie hinsichtlich der Anmut und Gefälligkeit merklich nach. Jedoch schreitet auch er rasch und zierlich einher, schwimmt, selbst ungezwungen, nicht selten, fliegt leicht und schnell und gefällt sich, zumal während der Paarungszeit, allerlei Schwenkungen auszuführen, zu kreisen und schwebend streckenweit durch die Luft zu gleiten. Seine Lockstimme ist ein wohlklingender Doppellaut, der durch »Djaü« oder »Djüü« ungefähr ausgedrückt werden mag, sein Warnungsruf dem vorigen ähnlich, aber längergezogen, der Ausdruck seiner Zärtlichkeit das allen Wasserläufern eigene »Dück, dück«, der Schreckensschrei ein unangenehmes Kreischen, der Paarungsruf, der immer nur im Fluge ausgestoßen wird, ein förmlicher, jubelnder Gesang, den Silben »Dlidl, dlidl, dlidl« etwa vergleichbar. Seinesgleichen gegenüber wenig gesellig, kommt er doch bei Gefahr und Not schreiend herbeigeflogen, als wolle er helfen, raten, warnen, und ebenso wirft er sich zum Führer anderer Strandvögel auf. Auch er ist scheu, aber weit weniger klug und vorsichtig als seine Verwandten. Wohl unterscheidet er den Jäger von dem Hirten, den Mann vom Kinde, läßt sich jedoch leicht berücken und setzt am Brutplatz sein Leben gewöhnlich dreist aufs Spiel.
Seine Nahrung sucht er am Rande der Gewässer oder im Sumpf auf, watet daher, soweit seine Beine gestatten, ins Wasser, taucht auch oft mit dem Vorderteil des Leibes unter, um zu tiefer versteckter Beute zu gelangen; ebenso aber betreibt er Kerbtierjagd auf Feldern und trockenen Wiesen.
Sofort nach seiner Ankunft schreitet er, da er meist wohl schon gepaart eintrifft, zur Fortpflanzung. Das Nest, eine mit wenigen Halmen ausgekleidete Vertiefung, steht meist nicht weit vom Wasser entfernt, womöglich mitten im Sumpf, zwischen Binsicht, Seggen und Gras, und enthält gewöhnlich schon Mitte April das volle Gelege. Die Eier sind verhältnismäßig groß, durchschnittlich achtundvierzig Millimeter lang, dreißig Millimeter dick, kreiselförmig, glattschalig, feinkörnig, glanzlos und auf bleich bräunlich- bis trüb ockergelbem Grunde mit vielen, mehr oder minder dichtstehenden, sehr verschieden großen Tüpfeln, Flecken und Punkten von graulicher, dunkelgrau- und purpurbrauner Färbung gezeichnet. Das Weibchen brütet allein, zeitigt die Eier binnen vierzehn bis fünfzehn Tagen und führt dann die Jungen auf nahrungversprechende Plätze, legt ihnen anfänglich erbeutete Atzung vor, hudert, leitet, unterrichtet sie, gibt sich, angesichts eines Feindes, diesem rücksichtslos preis, greift, in der Hoffnung, sie zu retten, zu den üblichen Verstellungskünsten und bekundet seine Besorgnis durch ängstliches Geschrei, wogegen das Männchen zwar auch lebhaft schreit, seine Sicherheit aber weit seltener als jenes aus dem Auge verliert. Etwa vier Wochen nach dem Ausschlüpfen sind die Jungen flügge, bald darauf auch selbständig; und nunmehr lockert sich das innige Verhältnis zwischen ihnen und den Eltern rasch.
Von den in Frage kommenden Raubtieren und Raubvögeln haben auch die Sumpfwasserläufer viel, von den eierraubenden Menschen nicht minder zu leiden; außerdem stellen ihnen Jäger und Fänger nach, obwohl ihr Wildbret nicht gerade vorzüglich ist. Gefangene werden ebenso bald zahm und benehmen sich im wesentlichen ebenso wie die Verwandten.
Die beiden kleinsten Arten der Sippe, die Europa bewohnen, sind der Bach- und der Waldwasserläufer. Ersterer, der auch punktierter oder Tüpfelwasserläufer, Wasserschnepfe und Dluit heißt ( Totanus ochropus), ist der größere von beiden. Seine Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite achtundvierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge vier Zentimeter. Das Gefieder des Kopfes und Mantels ist auf dunkelbraunem, ins Ölfarbene schillerndem Grunde mit kleinen, weißen Seitenflecken gezeichnet, die sich auf dem Kopf zu Streifen ordnen, das des Halses, der Kehle und des Kropfes auf weißem, im Nacken bräunlichem Grunde gleichmäßig längsgestreift, das des Flügelrandes einfarbig dunkelbraun, das des Bürzels, des Kinns und der übrigen Unterseite reinweiß; die Schwingen sind braunschwarz, die Schwanzfedern in der Wurzelhälfte weiß, in der Spitzenhälfte mit drei bis vier, nach außen hin bis zu Punktflecken abnehmenden Querbinden geziert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel grünlich hornfarben, an der Spitze dunkler, der Fuß grünlich bleigrau. Im Herbstkleide sind die weißen Flecke sehr klein und die Kropfseiten dunkel.
Der Wald- oder Bruchwasserläufer ( Totanus glareola) ist merklich kleiner als der Verwandte; seine Länge beträgt zweiundzwanzig, die Breite dreiundvierzig, die Fittichlänge dreizehn, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Die Oberteile sind grünlich schwarzbraun, alle Federn des Kopfes und Hinterhalses schwach weißlich gestreift, die des Rückens licht fahlgrau umrandet und grau und weiß geflockt, Hals und Kropf mit schmalen, dunklen Längsstreifen auf weißlichem Grunde gezeichnet, Bürzel, Unterbrust und Bauch reinweiß, die Schwingen schwarzbraun. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß grünlichgelb. Im Herbstkleide ist die Oberseite lichter braun, rostgelblichweiß gefleckt, die Unterseite am Hals und Kropf gestreift und gewellt.
Mittel- und Nordeuropa sowie Mittel- und Nordasien bilden das Brutgebiet, fast ganz Europa, Asien und Afrika den Verbreitungskreis beider Wasserläufer. In Europa sind sie überall beobachtet worden. In unserm Vaterlande erscheinen sie im April und Mai, fangen Ende Juli an zu streichen und begeben sich im August und September wiederum auf die Reise nach der Winterherberge, die schon im Süden Europas beginnt, aber bis Indien und zum Vorgebirge der Guten Hoffnung sich ausdehnt. Einzelne Bachwasserläufer überwintern sogar in Deutschland. Beide Arten führen eine versteckte oder doch heimliche Lebensweise; während der Bachwasserläufer aber, seinem Namen entsprechend, die Ufer kleiner, umbuschter Gewässer bevorzugt, siedelt sich der Waldwasserläufer mit Vorliebe im einsamen, stillen, düstern Walde an, gleichviel ob der Bestand aus Nadel- oder Laubholz gebildet wird. In Skandinavien und Sibirien habe ich ihn nur ausnahmsweise anderswo gefunden und oft mit Vergnügen beobachtet, wie er auf Wipfel- und andern Zweigen hoher Bäume fußte. Mangel an geeigneten Örtlichkeiten und andere Verhältnisse bedingen übrigens nicht allzu selten Abänderungen in der Wahl der Aufenthaltsorte.
Beide Wasserläufer sind höchst anmutige Vögel, zierlich und gewandt in jeder Hinsicht, beweglich, scharfsinnig und vorsichtig, jedoch nicht eigentlich scheu, es sei denn, daß sie üble Erfahrungen gemacht haben sollten. Sie halten sich im Sitzen wagerecht, wiegen sich oft wie der Flußuferläufer, gehen leicht und gut, fliegen ausgezeichnet, schwenken mit vollster Sicherheit durch das Geäst der Bäume oder Gebüsche und entfalten während ihrer Fortpflanzungszeit fast alle in ihrer Familie üblichen Flugkünste. Ihre Stimme ist ungemein hoch und laut, aber so rein und wohlklingend, daß einzelne Töne denen der besten Sänger fast gleichkommen. Der Lockton des Bachuferläufers ist ein silberglockenreines, mehrmals und rasch nacheinander wiederholtes »Dlüidlui«, der des Waldwasserläufers ein pfeifendes »Giffgiff«, der Ausdruck der Zärtlichkeit bei jenem ein kurzes, hohes »Dick, dick«, bei diesem ein ähnlich betontes »Gik, gik«, der Paarungsruf bei jenem der vertönte, oft wiederholte Lockruf, bei diesem ein förmlicher Gesang, in dem man bald Laute wie »Titirle«, bald solche wie »Tilidl« herauszuhören vermeint. Im übrigen betätigen beide die Eigenschaften ihrer Sippschaftsgenossen.
Der Bachwasserläufer legt sein Nest ebensowohl auf dem Boden wie auf Bäumen in alten Nestern, beispielsweise Eichhorn-, Tauben-, Häher- und Drosselnestern, sogar in Baumhöhlen bis zehn Meter über dem Grunde, hier aber immer in unmittelbarer Nähe des Wassers, an. Für den Waldwasserläufer, der nach meinen Erfahrungen noch mehr Baumvogel ist als jener, dürfte dasselbe gelten; doch liegen, meines Wissens, bestimmte Beobachtungen über sein Nisten auf Bäumen noch nicht vor. Die kreiselförmigen Eier des ersteren, deren Längsdurchmesser etwa sechsunddreißig und deren Querdurchmesser sechsundzwanzig Millimeter beträgt, sind aus licht ölgrünem, bald mehr ins Gelbliche, bald mehr ins Grünliche spielenden Grunde mit kleinen Flecken, Schmitzen und Punkten von bräunlich aschgrauer bis dunkel grünbrauner Färbung gezeichnet; die des Waldwasserläufers, die bei fünfunddreißig Millimeter Längsdurchmesser vierundzwanzig Millimeter Querdurchmesser haben, ähneln ihnen sehr, sind aber gröber gefleckt. Nach etwa fünfzehntägiger Bebrütung entschlüpfen die Jungen, verlassen, sobald sie trocken geworden, das Nest, springen, wenn sie auf Bäumen gezeitigt wurden, wie Hintz erfuhr, ohne Schaden von der Höhe herab ins Gras und wachsen nun unter treuer, aufopfernder Führung ihrer Eltern rasch heran, werden auch ebensobald wie andere ihrer Art selbständig.
Die Feinde anderer Strandvögel gefährden auch unsere beiden Wasserläufer. In Gefangenschaft halten sie sich ebenso gut und benehmen sich ebenso wie ihre Verwandten.
*
Die Uferschnepfen ( Limosinaa) bilden eine anderweitige Unterfamilie. In Gestalt und Wesen stehen die Uferschnepfen den Wasserläufern am nächsten; jedoch läßt sich nicht verkennen, daß sie auch mit den Brachvögeln Ähnlichkeit zeigen, sowie sie anderseits wiederum an die Schnepfen erinnern.
Die Pfuhlschnepfe ( Limosa rufa) ist auf Scheitel und Nacken hell rostrot, braun in die Länge gestreift, auf Rücken und Schultern schwarz mit rostfarbenen Flecken und Rändern, auf den Deckfedern der Flügel graulich und weiß gesäumt, auf dem Bürzel weiß, braun gefleckt; Augenbrauen, Kehle, Halsseiten und untere Teile sind lebhaft dunkel rostrot, die Brustseiten und unteren Schwanzdeckfedern schwarz in die Länge gefleckt, die Schwingen schwarz, weiß marmoriert, die Steuerfedern grau und weiß in die Quere gebändert. Das Auge ist braun, der Schnabel rötlich, an der Spitze schwarzgrau, der Fuß schwarz. Beim Weibchen sind die Farben minder lebhaft. Die Länge beträgt einundvierzig, die Breite achtundsechzig, die Fittichlänge zwanzig, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Bestimmt verschieden von der Pfuhlschnepfe ist die Uferschnepfe oder Limose ( Limosa aegocephala). Ihre Länge beträgt fünfundvierzig bis achtundvierzig, die Breite gegen achtzig, die Fittichlänge dreiundzwanzig, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Das Kleingefieder ist vorherrschend rostrot, auf dem Kopf und Oberrücken durch breite Schaft-, auf dem Mantel durch Pfeilflecke gezeichnet, auf der Unterseite vom Kropf an schwarz quergebändert, das kleine Flügeldeckgefieder grau, der Unterrücken bräunlichschwarz, der Bürzel weiß; die Schwingen sind schwärzlich, von der vierten an im Wurzelteile weiß, die Schwanzfedern an der Wurzel weiß, übrigens schwarz. Das Auge ist braun, der Schnabel an der Wurzel orangefarben, sonst hornschwarz, der Fuß schwarz. Das nicht gefleckte Winterkleid ist grau, unterseits licht fahlgrau.
Alle Limosen führen eine so übereinstimmende Lebensweise, daß ich mich bei Schilderung derselben auf die Pfuhlschnepfen beschränken darf.
Nordeuropa und Nordasien sind die Länder, in denen diese brütet; von hier aus besucht sie aber während ihres Zuges den größten Teil von Südasien, ganz Südeuropa und Nordafrika bis nach Südnubien und den Gambia hin, erscheint also auch an den deutschen und insbesondere an den holländischen Küsten in Menge. »Myriaden«, sagt Naumann, »streichen an der Westküste Schleswigs und Jütlands in wolkenähnlichen Zügen von den Watten auf die Wiesen und Viehweiden und auf jene zurück, wie ihnen Ebbe und Flut gebieten; wo sich eine solche Schar lagert, bedeckt sie buchstäblich den Strand in einer langen Strecke oder überzieht, wo sie ruhig auf den Watten ihrer Nahrung nachgeht und weniger dicht beisammen ist, eine fast nicht zu übersehende Fläche. Unglaublich ist ein solches Gewimmel, und das Aufsteigen einer Schar in der Ferne oft einem aufsteigenden Rauch ähnlich.« Die Hauptmasse scheint den Seeküsten entlang zu wandern; wenigstens trifft man Pfuhlschnepfen im Innern Deutschlands stets nur in geringer Anzahl. Dagegen sieht man sie häufig im Süden Europas und besonders an den Strandseen Unterägyptens, wie denn überhaupt die Mittelmeerländer für diejenigen, die aus Nordwesteuropa wegziehen, wohl die eigentliche Winterherberge bilden. Der wirkliche Zug beginnt Ende August und währt den September hindurch; die Rückkehr erfolgt vom April an bis tief in den Mai hinein. Während des Zuges entfernen sie sich ungern vom Meer, treiben sich auf den von der Ebbe bloßgelegten Watten und Sandbänken umher, schwärmen mit zurückkehrender Flut nach dem Festlande zurück, senden, wenn die Ebbe wieder eintritt, Kundschaft aus, erheben sich, nachdem ihnen diese die erwünschte Nachricht gebracht, unter entsetzlichem Lärm, eilen dem Wasser zu und folgen nun den zurückkehrenden Wogen. Auch diejenigen, die im Innern des Landes sich aufhalten, lieben es, vom Wasser weg auf das Trockene zu fliegen und wieder dahin zurückzukehren. Sie verbringen dann die Mittagszeit, in der sie auch schlafen, am Lande und suchen das Wasser gegen Abend auf, an ihm während der ganzen Nacht oder doch in der Abend- und Morgendämmerung sich beschäftigend.

Schwarzschwänzige Uferschnepfe ( Limosa aegocephala)
Die Limosen schreiten mit abgesetzten Schritten am Wasserrande einher, waten oft bis an den Leib ins Wasser, schwimmen auch und wissen sich im Notfalle trefflich durch Untertauchen zu helfen. Schilling beobachtete, daß eine Pfuhlschnepfe, die er angeschossen hatte, vor seinen Augen ins Meer tauchte und nicht wieder zum Vorschein kam; mir ist Ähnliches am Mensolehsee wiederholt begegnet. Der Flug ähnelt dem der kleineren Wasserläufer hinsichtlich der Leichtigkeit und Gewandtheit, steht ihm auch kaum an Schnelligkeit nach; wenigstens bemerkt man, daß Limosen und Wasserläufer lange Zeit miteinander fortfliegen können, ohne daß der eine dem andern vorauskommt. Vor dem Niedersetzen pflegen die Limosen zu flattern und ihre Flügel vor dem Zusammenlegen mit den Spitzen senkrecht in die Höhe zu strecken. Wenn mehrere von einem Ort zum andern fliegen, halten sie selten eine bestimmte Ordnung ein, bilden vielmehr wirre Schwärme, wogegen sie, wenn sie ziehen, die übliche Keilordnung annehmen. Die Stimme unterscheidet sich von der der kleinen Wasserläufer durch die Tiefe des Tones und den geringen Wohlklang. Der Lockton klingt wie »Kjäu« oder »Kei, kei«, auch wohl »Jäckjäckjäck«; der Paarungsruf, wohllautender, mehr flötenartig, wie »Tabie, tabie«. Keiner der Laute kann sich an Vollklang mit dem der Wasserläufer im engeren Sinne messen.
Das Betragen der Limosen läßt auf scharfe Sinne schließen. Zuweilen trifft man einzelne an, die sich gar nicht scheu zeigen; die Mehrzahl aber weicht dem Jäger sorgfältig aus und unterscheidet ihn sicher von andern ungefährlichen Menschen. Eine Gesellschaft ist immer scheu, sie mag sich aufhalten, wo sie will; die einzelnen werden es ebenfalls, wenn sie Verfolgungen erfahren, und nicht bloß dann, sondern auch da, wo sie sich zum Führer ihrer kleinen Verwandtschaft aufwerfen. Am Mensaleh sah ich selten eine Uferschnepfe ohne die übliche Begleitung der verschiedensten Strandläufer und Regenpfeifer, die jeder Bewegung des großen Führers folgten und sich ihm überhaupt in jeder Hinsicht unterordneten.
Würmer und Kerbtierlarven oder ausgebildete Kerfe, kleine Muscheln, junge Krebse und Fischchen bilden die Nahrung der Limosen; große Beute vermögen sie nicht zu verschlingen. Ob ihr Schnabel wirklich, wie man angenommen, so feinfühlend ist, daß sie ohne Hilfe des Gesichts ihre Nahrung entdecken, steht dahin. Der knochenzellige Tastapparat ist bei ihnen nicht entwickelt.
Über die Fortpflanzung der Pfuhlschnepfe sind die Berichte noch immer äußerst dürftig und unsicher; von der Uferschnepfe dagegen wissen wir, daß sie in Jütland, Holland, Polen, meist gesellig, brütet und auf einer etwas erhöhten Stelle in tiefen und großen Sümpfen und Morästen oder nassen, moorigen Wiesen ihr Nest anlegt, eine einfache, mit Gewürzel und Grashalmen ausgelegte Grube, die Ende April vier große, durchschnittlich fünfundfünfzig Millimeter lange, achtunddreißig Millimeter dicke, bauchige, auf graugelblichem, bräunlichem, dunkel ölgrünem oder rostbraunem, immer trübem Grunde mit großen und kleinen Flecken, Stricheln und Punkten von aschgrauer, erdbrauner, dunkelbrauner Färbung gezeichnete Eier enthält. Beide Eltern brüten abwechselnd und hingebend, umfliegen unter lautem, kläglichem Geschrei jeden Störenfried, der sich dem Nest naht, führen auch die kleinen Jungen gemeinschaftlich.
In der Gefangenschaft benehmen sich die Limosen wie andere Wasserläufer, gehen leicht ans Futter, gewöhnen bald ein, lernen ihren Wärter kennen und halten sich jahrelang vortrefflich.
*
Der Leib der Säbler ( Recurvirostra), einer Sippe mittelgroßer Strandvögel, die zur Unterfamilie der Stelzenläufer ( Recurvirostrinae) gehören, ist kräftig gebaut, der Kopf groß, der Schnabel lang, schwach, schmal, abgeplattet und deshalb bedeutend breiter als hoch, an der Spitze ungemein verdünnt und entweder einfach aufwärts gekrümmt oder unmittelbar vor ihr wiederum abwärts gebogen, durchaus hart und glatt, an den Kanten schneidend scharf, im Innern bis auf zwei gleichlaufende Leistchen in jeder Hälfte, deren untere in die oberen passen, und zwischen denen die Zunge liegt, äußerst flach, das Bein sehr lang, aber verhältnismäßig stark, hoch über die Ferse nackt, der Fuß vierzehig, zwischen den Vorderzehen mit halben Schwimmhäuten ausgerüstet, die Hinterzehe bei gewissen Arten verkümmert, bei andern ausgebildet, der Flügel mittellang und spitzig, der Schwanz zwölffederig, kurz und einfach zugerundet, das Kleingefieder oben geschlossen, unten dicht und Pelzig wie bei echten Schwimmvögeln.
Der Säbelschnäbler ( Recurvirostra avosetta) ist einfach, aber sehr ansprechend gezeichnet. Oberkopf, Nacken und Hinterhals, die Schultern und der größte Teil der Flügel sind schwarz, zwei große Felder auf den Flügeln, gebildet durch die kürzeren Schulterfedern, die hinteren Armschwingen, die Deckfedern der Handschwingen und das übrige Gefieder weiß. Das Auge ist rötlichbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß aschblau. Bei den Jungen spielt das Schwarz ins Bräunliche, und wird der Flügel durch rostgraue Federkanten gezeichnet. Die Länge beträgt dreiundvierzig, die Breite vierundsiebzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.

Säbelschnäbler ( Recurvirostra avocetta)
Man hat den Säbelschnäbler von Mitteleuropa an fast überall in der Alten Welt gefunden. Er bewohnt die Küsten der Nord- und Ostsee sowie die Salzseen Ungarns und Mittelasiens und durchwandert von hier aus Südeuropa und Afrika bis zum Vorgebirge der Guten Hoffnung, von dort aus Südchina und Indien. Wo er vorkommt, tritt er meist in namhafter Anzahl auf. In unsern Gegenden erscheint er im April; seinen Rückzug beginnt er im September.
Er ist ein echter Seevogel; denn er verläßt die Küste des Meeres selten und, falls es wirklich einmal freiwillig geschieht, nur dann, wenn er einen salzigen oder doch brackigen See aufsuchen will. Im Binnenlande gehört er zu den Seltenheiten. Seichte Meeresküsten oder Seeufer, deren Boden schlammig ist, bilden seine Aufenthaltsorte; daher kommt es, daß ihn in einzelnen Gegenden jedermann kennt, während er wenige Kilometer davon als fremdartig erscheint. Im Meere wechselt er, laut Naumann, seinen Aufenthalt mit der Ebbe und Flut. Wenn erstere die Watten trocken gelegt hat, sieht man ihn oft mehrere Kilometer weit von der eigentlichen Küste, während er, vor der Flut zurückweichend, nur am Strand sich aufhält. Er gehört zu denjenigen Seevögeln, die jedermann auffallen müssen, weil sie eine wahre Zierde des Strandes bilden. Bei ruhigem Gehen oder im Stehen hält er den Leib meist wagerecht und den dünnen Hals S-förmig eingezogen. Sein Gang ist leicht und verhältnismäßig behend, obgleich er selten weitere Strecken in einem Zuge durchläuft, sein Flug zwar nicht so schnell wie der der Strandläufer, aber immer doch rasch genug und so eigentümlich, daß man den Vogel in jeder Entfernung erkennen kann, da die hohen, herabgebogenen Flügel, die mit weit ausholenden Schlägen bewegt werden, der eingezogene Hals und die langen, geradeaus gestreckten Beine bezeichnend sind. Den sehr ausgebildeten Schwimmhäuten entsprechend bewegt er sich auch in größerer Tiefe der Gewässer, schwimmt leicht und gewandt und tut dies oft ohne besondere Veranlassung. Die pfeifende Stimme klingt etwas schwermütig, keineswegs aber unangenehm, der Lockton ungefähr wie »Qui« oder »Dütt«, der Paarungsruf klagend, oft und rasch wiederholt »Kliu«, so daß er zu einem förmlichen Jodeln wird.
Gewöhnlich sieht man den Säbelschnäbler im Wasser, stehend oder langsam umhergehend, mit beständig nickender und seitlicher Bewegung des Kopfes Nahrung suchend, nicht selten auch gründelnd, wobei er nach Entenart mehr oder weniger auf dem Kopf steht. Der sonderbare Schnabel wird anders gebraucht als von den übrigen Sumpfvögeln, wie Naumann sagt, »säbelnd, indem ihn der Vogel ziemlich rasch nacheinander seitwärts rechts und links hin- und herbewegt und dabei die im Wasser schwimmende Nahrung, die durch die Leisten an der inneren Schnabelfläche festgehalten wurde, aufnimmt. Der Schustervogel durchsäbelt auf diese Weise, langsam fortschreitend, die kleinen Pfützen, die sich während der Ebbe auf den schlammigen Watten erhalten und von kleinen lebenden Wesen buchstäblich wimmeln, und wenn er mit dem Ausfischen einer solchen fertig ist, geht er an eine andere. Oft beschäftigt er sich mit einer einzigen eine Stunde lang und darüber. Gewöhnlich steckt er, wenn er anfängt, den Schnabel geradezu ins Wasser oder in den dünnflüssigen Schlamm und schnattert damit einige Augenblicke wie eine Ente, säbelt aber hieraus gleich los. Letztere Bewegung dient übrigens, wie man an gefangenen Verkehrtschnäblern beobachten kann, nur dazu, um den Schlamm aufzuwühlen und Beute frei zu machen, nicht aber, um sie in den Rachen zu spielen. Einige wenige sah ich auch im Sumpf so über die kurzen, nassen Gräser säbelnd hinfahren, oder im Wasser schwimmende Geschöpfe fangen.« Ich habe dieses Säbeln oft und genau beobachtet, glaube aber, daß die Verkehrtschnäbler in schlammigen Seen doch noch öfter gründeln, also nach Entenart den Schlamm durchschnattern, als säbeln.
Der Säbelschnabler ist, weil er stets in Gesellschaft lebt, auch überall scheu und flieht den Menschen unter allen Umständen. Wenn man sich der Stelle nähert, wo hundert dieser Vögel eifrig beschäftigt sind, ihre Nahrung aufzunehmen, bemerkt man, daß auf den ersten Warnungsruf hin alle unruhig werden und nun entweder watend oder schwimmend dem tieferen Wasser zustreben, oder fliegend sich erheben und erst wieder zur Ruhe kommen, wenn sie sich außer Schußweite wissen. Gegen andere Vögel zeigen sie keine Zuneigung. Ein einzelner wird niemals von dem kleinen Strandgewimmel zum Führer erkoren, und wenn sich einer unter andern Vögeln niederläßt, benimmt er sich durchaus unabhängig von der Gesellschaft; nur mit dem Stelzenläufer findet, wie schon bemerkt, ein einigermaßen freundschaftliches Verhältnis statt. Die Ursache dieser Zurückhaltung sucht Naumann, und gewiß mit Recht, weniger in dem mangelnden Geselligkeitstriebe als in der eigentümlichen Nahrungsweise.
Bald nach ihrer Ankunft trennen sich die Schwärme in Paare und verteilen sich auf den Niststellen, am liebsten auf Flächen, die mit kurzgrasigem Rasen bedeckt sind und von Austerfischern, Wasser- und Strandläufern, Meerschwalben, Silbermöwen usw. ebenfalls zum Nisten benutzt werden, seltener auf Feldern mit jungem oder aufgegangenem Getreide, immer aber auf Strecken unweit der Seeküste. Das Nest ist eine unbedeutende, mit einigen trockenen Hälmchen oder Gewurzel ausgelegte Vertiefung; das Gelege besteht in der Regel aus vier, manchmal aus drei, zuweilen nur aus zwei Eiern von ungefähr achtundvierzig Millimeter Längen-, siebenunddreißig Millimeter Querdurchmesser, birn- oder kreiselförmiger Gestalt, zarter, glanzloser Schale, licht rost- oder olivengelblicher Grundfärbung und einer aus mehr oder weniger zahlreichen schwarzgrauen und violetten Flecken und Punkten bestehenden Zeichnung. Beide Geschlechter brüten abwechselnd etwa siebzehn bis achtzehn Tage lang, zeigen sich ungemein besorgt um die Brut, umfliegen mit kläglichem Schreien den Menschen, der sich dem Neste nähert, und führen die Jungen, sobald sie völlig abgetrocknet sind, einer Bodenfläche zu, die ihnen Versteckplätze bietet, später an große Pfützen und endlich, wenn sie zu flattern beginnen, an die offene See.
Gefangene beanspruchen sorgsame Pflege und reich mit Kerbtierlarven oder Ameisenpuppen versetztes Futter, dauern unter solchen Umständen aber jahrelang im Käfig aus.
*
Die letzte Unterfamilie bilden die Brachvögel ( Numeniinae), schlank gebaute Vögel mit sehr langem, seicht gebogenem, an der Wurzel hohem, nach vorn allmählich verschwächtem, mit Ausnahme der hornigen Spitze weichem Schnabel, vierzehigen, schlanken und hohen, bis weit über die Ferse hinauf nackten, breitsohligen Füßen, deren Zehen durch eine deutliche Spannhaut verbunden werden, und mittellangem, abgerundetem Schwanze.
Der Brachvogel oder die Doppelschnepfe ( Numenius arquatus) ist die größte unserer einheimischen Arten. Seine Länge beträgt siebzig bis fünfundsiebzig, die Breite durchschnittlich einhundertfünfundzwanzig, die Fittichlänge zweiunddreißig, die Schwanzlänge zwölf, die Schnabellänge achtzehn bis zwanzig Zentimeter. Das Gefieder der Oberseite ist braun, licht rostgelb gerandet, das des Unterrückens weiß, braun in die Länge gefleckt, das des Unterkörpers rostgelblich, braun geschaftet und längsgefleckt; die Schwingen sind schwarz, weiß gekantet und weiß gefleckt, die Steuerfedern auf weißem Grunde schwarzbraun gebändert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Die Jungen unterscheiden sich von den Alten durch kurzen Schnabel und die blasseren Fleckchen im Gefieder der Unterseite.
Der Regenbrachvogel, Regen- und Blaubeerschnepfe ( Numenius phaeopus), ist um ein Viertel kleiner als der Brachvogel. Das Gefieder ist im allgemeinen dem des vorher beschriebenen Verwandten ähnlich, jedoch düsterer gefärbt; die Kopffedern sind dunkelbraun, ungefleckt, in der Mitte durch einen hellen Längsstreifen geteilt, die Weichen weiß, mit schwarzbraunen Pfeilflecken und Querstreifen gezeichnet, die Schwanzfedern grauweißlich, an der Wurzel aschgrau, mit sieben bis acht dunklen, am Rande verwaschenen Bändern geziert. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau.
Es gibt kein Land in Europa, in dem der Brachvogel noch nicht beobachtet worden wäre; denn im Norden brütet er, und den Süden berührt er während seines Zuges. Außerdem findet er sich im größten Teile Asiens unter denselben Bedingungen. Auf seinen Wanderungen durchreist er Afrika ebenso regelmäßig, wie er Indien besucht, im September eintreffend und bis zum März verweilend. Im Nordwesten Afrikas gehört er auch nicht zu den Seltenheiten. Bei uns zulande trifft er im April ein und wandert bis zu Anfang Mai durch, kehrt aber schon Ende Juli zurück, treibt sich ziellos umher und bricht endlich im September nach der Winterherberge auf, vorausgesetzt, daß das Wetter ungünstig ist; denn unter Umständen überwintert er auch in nördlichen Gegenden, seltener in Deutschland, häufiger in Großbritannien oder auf den Färinseln. Der Regenbrachvogel bewohnt während der Brutzeit nur die hochnordischen Tundren, wandert aber ebenso weit wie der Verwandte und ist daher wie dieser als Weltbürger zu bezeichnen.

Großer Brachvogel ( Numenius arquatus)
Hinsichtlich der Lebensweise ähneln sich die verschiedenen Arten so, daß es genügen kann, wenn ich mich auf die Lebensschilderung des Brachvogels beschränke. Unter allen Schnepfenvögeln zeigt er sich am wenigsten wählerisch hinsichtlich seines Aufenthaltes. Ihm ist jede Gegend recht, die Seeküste wie verschiedene Binnengewässer, die Ebene wie das Hügelland. Vom Wasser aus fliegt er auf das dürrste Land, von diesem auf Feld oder Wiese, von hier aus wieder zum Wasser zurück, just wie es ihm gefällt. Zeitweilig teilt er mit der Sumpfschnepfe, zeitweilig mit dem Dickfuße dasselbe Gebiet. Man begegnet ihm überall, aber nirgends eigentlich regelmäßig. Während seiner Wanderung, die er ebensowohl bei Tage wie bei Nacht ausführt, folgt er allerdings den allgemeinen Heerstraßen, verläßt aber Ströme und Flüsse auf Meilen weit, überfliegt auch ohne Bedenken mittelhohe Gebirge. Wie bei uns treibt er es auch in der Winterherberge. Er gehört zu den regelmäßigen Erscheinungen an den Seen; aber er fängt auch mit dem Ibis in der Steppe Heuschrecken oder sucht sich an den felsigen Ufern des Nils in Nubien sein Futter.
Ich habe den Brachvogel auf seinen Brutplätzen in Lappland und Sibirien, am Weißen oder Blauen Nil, in Ägypten, Griechenland, Spanien und Deutschland beobachtet, unter den verschiedenartigsten Verhältnissen mit ihm verkehrt und ihn unter allen Umständen als denselben kennengelernt. Scheu und vorsichtig, mißtrauisch und furchtsam zeigt er sich stets. Geselliger als viele andere Schnepfenvögel, bildet er gern kleine Vereine, und seine Wachsamkeit versammelt stets eine Menge minder kluger Strandvögel um ihn; er aber gibt sich mit dem Gesindel nur so weit ab, als es ihm gerade gut dünkt. Dem Locktone seiner Art folgt er, beantwortet ihn wenigstens, um andere Stimmen bekümmert er sich nicht; die übrige Tierwelt läßt ihn entweder gleichgültig oder flößt ihm Mißtrauen und Furcht ein. Den Menschen meidet er unter allen Umständen, selbst am Brutplatze, obgleich er sich hier ungleich weniger scheu zeigt als irgendwo anders; an den südlichen Seen wird er geradezu unerträglich, weil er für den Jäger ein noch schädlicherer Warner ist als jeder Kiebitz und die Flucht nicht erst dann ergreift, wenn die Gefahr ihm schon nahe, sondern unter allen Umständen, sowie sich ihm etwas Verdächtiges auch nur von weitem zeigt. Dabei unterscheidet er sehr richtig zwischen gefährlichen und ungefährlichen Leuten, läßt einen Hirten oder Bauern nahen, flieht aber jeden ihm einigermaßen auffallenden Menschen. Meinen schwarzen Dienern gelang es viel öfter als mir, Brachvögel zu erlegen, obgleich ich mir die größte Mühe gab, die schlauen Geschöpfe zu überlisten.
Haltung, Gang, Flug und Stimme zeichnen den Brachvogel von sämtlichen Schnepfenvögeln zu seinem Vorteile aus. Er geht mit großen Schritten, aber leicht und zierlich, wie Naumann sagt, »anständig«; verdoppelt, wenn er schnell weiter will, sie nicht der Anzahl, sondern der Weite nach, watet oft bis an den Leib im Wasser umher und schwimmt, ungezwungen, recht gut. Sein Flug ist zwar nicht besonders schnell, aber anhaltend, regelmäßig, gewandt und der verschiedensten Wendungen fähig. Vor dem Niedersetzen pflegt er eine Zeitlang zu schweben; wenn er sich aus bedeutenden Höhen herabsenken will, zieht er die Flügel an und stürzt wie ein fallender Stein sausend hernieder, hält sich aber durch einige Flügelschläge und Ausbreiten der Schwingen noch rechtzeitig auf und betritt erst nach einigen Schwenkungen den Boden. Seine Stimme besteht in abgerundeten, vollen, klangreichen Tönen, die man durch die Silbe »Taü, taü« und »Tlaüid, tlaüid« ausdrücken kann. Der Unterhaltungslaut klingt wie »Twi, twi«; der Angstruf ist ein kreischendes »Kräh« oder »Krüh«. Während der Paarungszeit gibt auch er einen kurzen Gesang zum besten; derselbe besteht jedoch auch nur aus dem gewöhnlichen Lockrufe, der in eigentümlicher, kaum beschreiblicher Weise verschmolzen wird.
Einzelne Gegenden Norddeutschlands werden vom Brachvogel bereits zum Nisten benutzt; eigentlich aber brütet er in nördlicheren Ländern und hier, wie bemerkt, hauptsächlich in der Tundra. Die Brutvögel treffen auch in Lappland ungefähr um dieselbe Zeit ein wie bei uns und schreiten bald nach ihrer Ankunft zur Fortpflanzung. Das Männchen läßt seinen Paarungsruf jetzt zu jeder Tageszeit, am häufigsten aber in den stillen Mitternachtsstunden, erschallen, und das Weibchen sucht inzwischen nach einem passenden Hügelchen im Moos, das das Nest tragen soll. Letzteres ist nichts anderes als eine Vertiefung im Moos oder Riedgras, die mir erschien, als ob sie eingedrückt und gerundet, nicht aber durch Ausscharren entstanden sei. In einigen dieser Nester fand ich eine dürftige Unterlage von herbeigetragenen Pflanzenstoffen; in andern war das Moos selbst hierzu benutzt worden. Die vier Eier sind größer als die einer Ente, etwa sechsundsechzig Millimeter lang, sechsundvierzig Millimeter dick, birnen- oder kreiselförmig, nicht gerade glattschalig, glanzlos und auf schmutzigölgrünem, mehr oder weniger ins Gelbe und Bräunliche spielendem Grunde mit dunkelgrauen Unterflecken und Punkten, grünlich schwarzbraunen Oberflecken, Stricheln und Schnörkeln gezeichnet. Beide Geschlechter scheinen abwechselnd zu brüten, bekunden mindestens warme Liebe zur Brut und setzen sich, angesichts des Feindes, wirklichen Gefahren aus. Die Jungen werden baldmöglichst den Stellen zugeführt, die mit höherem Grase bestanden sind.
Kerbtiere der verschiedensten Art in allen Lebenszuständen, Würmer, Muscheln, Krebstiere, auch Fischchen oder Lurche und endlich mancherlei Pflanzenstoffe, insbesondere Beeren, bilden die Nahrung der erwachsenen Bracher; die Jungen fressen nur Kerfe und im hohen Norden ausschließlich Mücken und deren Larven. In der Gefangenschaft hält er sich gut, gewöhnt sich bald an das übliche Ersatzfutter, seinen Pfleger und andere Tiere, mit denen man ihn zusammensperrt, und wird sehr zahm.
Die Jagd ist nicht leicht und der Zufall der beste Gehilfe des Jägers. Der Fang verspricht am Nest sicheren Erfolg und gelingt auch oft am Wasserschnepfenherde. Das Wildbret wird geschätzt, steht aber dem der wirklichen Schnepfen weit nach und verdient seinen Ruhm nur im Spätsommer, nicht im Herbst oder Frühling. Diejenigen Brachvögel, die man im Winter in Afrika erlegt, eignen sich höchstens zur Suppe.
Die Ibisse ( Ibidae) sind mittelgroße, ansprechend gebaute, über die ganze Erde verbreitete Reihervögel mit ziemlich weichem, nur an der Spitze hartem Schnabel von zweifach verschiedener Gestalt, dessen gemeinsames Merkmal in einer vom Nasenloch bis zur Spitze verlaufenden Furche liegt, mäßig hohen Füßen, deren Vorderzehen durch eine kurze Spannhaut verbunden werden, ziemlich spitzen Flügeln, gerade abgestutztem Schwanz und reichem Gefieder. Sie zerfallen in zwei wohlumgrenzte Unterfamilien. Die erste von ihnen bilden die Ibisse im engeren Sinne ( Ibidinae).
In dem Nilstrom erkannte das sinnige Volk der Pharaonen den Bringer und Erhalter alles Lebens; daher mußte auch der mit den schwellenden Fluten in Ägyptenland erscheinende Ibis zu hoher Achtung und Ehre gelangen. Also heiligte man den Vogel und sorgte dafür, daß sein vergänglicher Leib der Verwesung enthoben und für Jahrtausende aufbewahrt werde. In einer der Pyramiden von Sakhara findet man die von Urnen umschlossenen oder auch in Kammern schichtenweise aufgestapelten Mumien des Vogels zu Tausenden.

Ibis ( Ibis aethiopica)
Der Ibis oder heilige Ibis ( Ibis aethiopica) wird als Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Ibis) angesehen, als deren Kennzeichen der kräftige Schnabel, der im Alter nackte Kopf und Hals und die am Ende zerschlissenen Schulterfedern gelten. Das Gefieder ist weiß, unter den Flügeln gelblich; die Schwingenspitzen und die Schulterfedern sind bläulichschwarz. Das Auge ist karminrot, der Schnabel schwarz, der Fuß schwarzbraun. Die nackte, schwarze Haut des Halses fühlt sich samtig an und färbt merklich ab. Beim jungen Vogel sind Kopf und Hals mit dunkelbraunen und schwärzlichen, weißgeränderten Federn bekleidet, die Kehle und die untere Hälfte des Halses weiß wie das übrige Gefieder, mit Ausnahme der ebenfalls schwarz geränderten und schwarz zugespitzten Schwingen. Nach der ersten Mauser erhalten die Jungen die zerschlissenen Schulterfedern; Kopf und Hals bleiben aber noch befiedert; die Kahlheit dieser Stellen zeigt sich erst im dritten Lebensjahre. Bei alten Vögeln beträgt die Länge fünfundsiebzig, die Breite einhundertdreißig, die Fittichlänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter.
Auffallenderweise besucht der Ibis gegenwärtig Ägypten nicht mehr, wenigstens nicht mehr regelmäßig, und wohl nur in Ausnahmefällen schreitet er hier zur Brut. Als Bote und Verkündiger des steigenden Nils tritt er erst im südlichen Nubien auf. Unterhalb der Stadt Muchereff (achtzehn Grade nördlicher Breite) habe ich nie einen beobachtet; schon bei Khartum aber brüten einige Paare, und weiter südlich gehört er zu den gewöhnlichen Erscheinungen. Im Sudan trifft er mit Beginn der Regenzeit, also Mitte oder Ende Juli, ein, brütet und verschwindet mit seinen Jungen nach drei oder vier Monaten wieder, scheint aber nicht weit zu ziehen, vielleicht nur zu streichen. Sofort nach seiner Ankunft im Lande bezieht er seine stets äußerst sorgfältig gewählten Brutplätze. Von ihnen aus unternimmt er längere oder kürzere Ausflüge, um Nahrung zu suchen. Man sieht ihn paar- oder gesellschaftsweise in der Steppe umherlaufen und hier Heuschrecken fangen, bemerkt ihn an den Ufern der Ströme oder Regenteiche und sehr häufig auch, meist in Gesellschaft des kleinen Kuhreihers, unter Viehherden, unbekümmert um deren Hirten, wie überhaupt um die Eingeborenen, gegen die er nicht die geringste Furcht zeigt. Seine Haltung ist würdevoll, der Gang gemessen, nur schreitend, nie rennend, der Flug sehr leicht und schön, die Stimme der Alten ein schwaches »Krah« oder »Gah«.
Auf einer Reise in die Urwälder des Blauen Flusses, die ich auf diesem selbst zurücklegte, traf ich am 16. und 17. September eine solche Menge der heiligen Vögel an, daß wir in der kurzen Zeit von zwei Tagen über zwanzig Stück erbeuten konnten. Flug auf Flug kam von dem gegenüberliegenden Walde herübergezogen, um in der Steppe Heuschrecken, die gegenwärtig die ausschließliche Nahrung ausmachten, zu fangen. Nachdem ich aus einem der vorüberziehenden Flüge erst einen Ibis herabgeschossen hatte, wurde es mir nicht schwer, andere zu erbeuten. Auf Anraten meines braunen Dieners brachte ich den getöteten mit Hilfe einiger Stäbchen in eine aufrechte Lage und machte ihn dadurch zum Lockvogel für die übrigen. Jeder Zug, der später vorüberkam, hielt an, um den scheinbar lebenden Gefährten zu betrachten, und wurde mit Schüssen begrüßt, deren Erfolg bei der geringen Entfernung ausgezeichnet war.
Erst später wurde uns der Grund dieser Zusammenhäufungen klar. Der gegenüberliegende Wald war teilweise überschwemmt und von den klugen Vögeln deshalb zum Nistplatz erwählt worden. Zu den Nestern zu gelangen, war unmöglich. Ich bot zwei Mark unseres Geldes für jedes Ei; keiner der Sudanesen konnte das Geld verdienen. Der Boden des Waldes war grundlos, das Wasser aber so seicht, daß ein Kahn ebenfalls nicht gebraucht werden konnte. Früher hatte ich eine andere Nistansiedlung besucht, die unter ähnlichen Umständen angelegt, aber doch zugänglich war. Sie befand sich auf einer kleinen, mit hohen Mimosen bestandenen Insel des Weißen Nils, die beim Steigen des Stromes unter Wasser gesetzt, aber so hoch überschwemmt wurde, daß man vom Boot aus die Bäume besteigen konnte. Hier beobachtete ich, daß der heilige Ibis eine Mimosenart, die die Araber der dichten, ungemein dornigen, ja fast undurchdringlichen Äste halber »Harâsi«, d.+h. die sich Schützende, nennen, jeder andern bevorzugt. Aus den Zweigen der Harâsi bestand auch das flache Nest des Vogels; nur das Innere der Mulde war mit seinen Reisern und einzelnen Grashalmen ausgelegt, das Ganze aber kunstlos zusammengeschichtet, kaum besser ausgeführt als das der Ringeltaube. Ein Nest stand neben dem andern; aber stets waren die dornigsten Äste zur Aufnahme desselben erwählt worden. Das Gelege zählt drei bis vier weiße, ziemlich rauhkörnige Eier, die Enteneiern an Größe ungefähr gleichkommen.
Ich halte es für glaublich, daß der Ibis wirklich kleine Schlangen verzehrt, bin jedoch der Meinung, daß er sich mit größeren und gefährlichen nicht einläßt. Während der Regenzeit besteht seine Nahrung, wenn nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise aus Kerbtieren. In dem Magen der erlegten fanden wir entweder Heuschrecken oder Käfer verschiedener Art, insbesondere Dungkäfer; an den gefangenen beobachteten wir, daß sie vorgeworfene kleine Lurche nicht verschmähten, Kerfe aber vorzogen. Hartmann gibt an, daß der Ibis auch kleine Süßwasserweichtiere frißt. So ungefüge der Schnabel zu sein scheint, so geschickt weiß der Vogel ihn zu gebrauchen. Er nimmt mit seiner Spitze die kleinsten Kerbtiere von der Erde auf und streift, indem er förmlich schnattert, von den Gräsern die daransitzenden Kerfe mit größter Gewandtheit ab. »Nichts sieht possierlicher aus«, sagt Hartmann, »als wenn ein Ibis Heuschrecken fängt. Der Stelzvogel fährt mit dem Sichelschnabel auf die ruhig dasitzenden Geradflügler ein; springen diese aber, die Gefahr noch rechtzeitig merkend, davon, so hüpft auch Freund Ibis hinterher, stellt sich dabei jedoch des hochsparrigen Grases wegen nicht selten ziemlich ungeschickt an; dennoch läßt er nicht ab, und hat er endlich eine oder die andere erwischt, so zermalmt und schluckt er sie sofort hinunter.«
Junge Ibisse, die wir auffütterten, wurden zunächst mit rohen Fleischstücken gestopft, fraßen dieses Futter auch sehr gern. Sie bekundeten ihren Hunger durch ein sonderbares Geschrei, das man ebensowohl durch »Zick, zick, zick«, wie durch »Tirrr, tirrr, tirrr« wiedergeben kann, zitterten dabei mit dem Kopf und Hals und schlugen auch wohl heftig mit den Flügeln, gleichsam in der Absicht, ihrem Geschrei größeren Nachdruck zu geben. Bereits nach wenigen Tagen nahmen sie das ihnen vorgehaltene Futter aus der Hand, und im Verlauf der ersten Woche fraßen sie bereits alles Genießbare. Das Brot, das wir ihnen reichten, trugen sie regelmäßig nach dem Wasser, aus dem sie überhaupt am liebsten Nahrung nahmen und das sie beständig nach Art der Enten durchschnatterten. Ebenso durchsuchten sie auch die feinsten Ritzen und alle Löcher, faßten die dort verborgenen Tiere geschickt mit der Schnabelspitze, warfen sie in die Luft und fingen sie sicher wieder auf. Heuschrecken waren auch ihre Lieblingsspeise.
Vom ersten Tage ihrer Gefangennahme an betrugen sich diese Jungen still, ernst und verständig; im Verlauf der Zeit wurden sie, ohne daß wir uns viel mit ihnen beschäftigten, zahm und zutraulich, kamen auf den Ruf herbei und folgten uns schließlich durch alle Zimmer des Hauses. Wenn man ihnen die Hand entgegenstreckte, eilten sie sofort herbei, um sie zu untersuchen; dabei pflegten sie sich dann wieder zitternd zu bewegen. Ihr Gang war langsam und gemessen; doch führten sie, ehe sie noch recht fliegen konnten, zuweilen hohe und geschickte Sprünge aus, in der Absicht, ihre Bewegung zu beschleunigen. Auf den Fersen saßen sie stundenlang. Da sie anfangs jeden Abend in einen Kasten gesperrt wurden, gingen sie später beim Anbruch der Nacht lieber selbst hinein, als daß sie sich treiben ließen, obgleich ihnen das beschwerlich fiel. Am Morgen kamen sie mit freudigem Geschrei hervor und durchmaßen den ganzen Hofraum. Im Oktober hatten sie fliegen gelernt und erhoben sich jetzt erst bis auf die niedrige Hofmauer, später bis auf das Dach; schließlich entfernten sie sich auf zwei- oder dreihundert Schritte von unserm Gehöft, kehrten aber stets nach kurzer Zeit wieder zurück und verließen von nun an den Hof nicht mehr, sondern besuchten höchstens den benachbarten Garten. Wenn es gegen Mittag heiß wurde, verfügten sie sich in die schattigen Zimmer, setzten sich auf die Fersen nieder und hockten oft mit ernstem Gesicht in einem Kreise, als ob sie Beratung halten wollten. Zuweilen stellten sich auch zwei von ihnen einander gegenüber, sträubten alle Kopffedern, schrien unter beständigem Kopfnicken und Schütteln, oft auch Flügelschlägen, jetzt wie »Kek, kek, kek«, und schienen sich gegenseitig zu begrüßen. Vor unserer Mittagsmahlzeit besuchten sie regelmäßig die Küche und baten und bettelten den Koch solange an, bis er ihnen etwas zuwarf. Der Glückliche, der es erhaschte, wurde von den andern verfolgt, bis er seine Beute in Sicherheit gebracht, d. h. sie hinabgeschlungen hatte. Sobald sie Teller in unser Eßzimmer bringen sahen, versammelte sich die ganze Gesellschaft daselbst; während wir aßen, saßen sie wartend nebenan; wenn wir aber den Blick nach ihnen wandten, hüpften sie bald auf die Kiste, bald auf den einzigen Stuhl, den wir besaßen, und nahmen uns die Brotstücke aus den Händen oder von dem Teller weg. Eine höchst sonderbare Gewohnheit von ihnen war, sich gern auf weiche Gegenstände zu legen. Kam eines der aus Lederriemen geflochtenen, federnden Bettgestelle, wie sie im Sudan üblich sind, auf den Hof, so lagen die Ibisse gewiß in kurzer Zeit darauf, und zwar platt auf dem Bauch, die Ständer nach hinten ausgestreckt. Sie schienen sich dabei äußerst behaglich zu fühlen und standen nicht auf, wenn sich jemand von uns näherte. Auf einem weichen Kissen sahen wir einmal ihrer drei nebeneinander liegen.
Mit allen übrigen Vögeln, die aus dem Hofe lebten, hielten sie gute Freundschaft, wurden wenigstens ihrerseits niemals zu Angreifern; unter sich zankten sie sich nie, waren vielmehr stets zusammen, entfernten sich selten weit voneinander und schliefen nachts einer dicht neben dem andern. Als wir eines Tages einen flügellahm geschossenen älteren Vogel ihrer Art in den Hof brachten, eilten sie freudig auf denselben zu, nahmen ihn förmlich in ihre Gesellschaft auf und wußten ihm bald alle Furcht zu benehmen, so daß er nach kurzer Zeit ebenso zutraulich war wie sie. Große Hitze schien ihnen sehr unangenehm zu sein; sie saßen dann in irgendeinem schattigen Winkel oder im Zimmer und sperrten tief atmend die Schnäbel auf. Im Wasser beschäftigten sie sich, wie schon bemerkt, gern und viel, badeten sich übrigens seltener, als man glauben möchte; wenn es jedoch geschah, näßten sie sich das Gefieder so vollständig ein, daß sie kaum mehr fliegen konnten.
Ibisse, die ich später beobachtete, lebten ebenfalls in ziemlichem Frieden mit allen Vögeln, die dasselbe Gehege mit ihnen teilten, maßten sich aber doch gegen schwächere eine gewisse Oberherrschaft an und schienen ein Vergnügen daran zu finden, diejenigen, die es sich gefallen ließen, zu necken. Namentlich mit den Flamingos machten sie sich fortwährend zu schaffen, und zwar in der sonderbarsten Weise. Sie schlichen, wenn jene zusammenstanden oder, den Kopf in die Federn verborgen, schliefen, leise heran und knabberten mit der Schnabelspitze an den Schwimmhäuten der Opfer ihres Übermutes herum, gewiß nicht in der Absicht zu beißen, sondern nur aus reiner Necklust. Der Flamingo mochte dann einen ihm lästigen Kitzel verspüren, entfernte sich, sah sich furchtsam nach dem Ibis um und versuchte wiederum einzunicken; dann aber war jener flugs wieder zur Stelle und begann das alte Spiel von neuem. Am lästigsten wurde er, wenn er mit den Flamingos das Winterzimmer teilte und die Armen ihm nicht entrinnen konnten. Brachvögel, Uferschnepfen und Austernfischer räumen den Ibissen willig das Feld und warten gar nicht erst, bis diese durch Schnabelhiebe sie hierzu nötigen.
Zur Zeit der alten Ägypter haben sich die heiligen Vögel höchst wahrscheinlich im Zustande einer Halbgefangenschaft fortgepflanzt; heutzutage tun sie dies bei guter Pflege nicht allzu selten in unsern Tiergärten.
Im Sudan stellt man dem Ibis nicht nach, obgleich sein schmackhaftes Fleisch die Jagd wohl belohnen würde. Ein zufällig gefangener Ibis wird übrigens von den Eingeborenen gern gegessen und von den freien Negern außerdem noch seiner zerschlissenen Federn beraubt, weil diese den Kriegern jener Stämme zu einem beliebten Kopfschmuck dienen.
*
Die Löffelreiher ( Plataleinae), die die zweite, über beide Erdhälften verbreitete Arten umfassende Unterfamilie bilden, sind größere und kräftigere Vögel als die Ibisse. Ihr Schnabel ist lang, ziemlich gerade, niedrig, nach vorn ungemein abgeplattet und spatelförmig verbreitert, das abgerundete Ende des Oberschnabels in einen unbedeutenden Nagel herabgehoben, die Innenseite der Kiefer mit Längsriefen versehen, der Fuß kräftig, ziemlich lang, seine drei Vorderzehen am Grunde durch verhältnismäßig breite Spannhäute verbunden, die Krallen stumpf und klein, der Flügel groß und breit, der zwölffederige Schwanz kurz und etwas zugerundet. Das Kleingefieder, das sich durch seine Dichtigkeit und Derbheit auszeichnet, verlängert sich zuweilen am Hinterhalse zu einem Schopfe und läßt die Gurgel, in der Regel auch einen Teil des Oberkopfes, unbekleidet. Die Färbung pflegt eine sehr gleichmäßige zu sein und unterscheidet sich weder nach dem Geschlecht noch nach der Jahreszeit, wohl aber einigermaßen nach dem Alter.
In Holland, den Donautiefländern, Südeuropa, ganz Mittelasien, selbst Mittelindien noch, sowie auf den Kanaren und Azoren lebt und brütet der Löffler, die Löffel- oder Spatelgans ( Platalea leucorodia), der uns die Lebensweise seiner Sippschaft kennen lehren mag. Er ist, mit Ausnahme eines gelblichen Gürtels um den Kropf, rein weiß, das Auge karminrot, der Schnabel schwarz, an der Spitze gelb, der Fuß schwarz, der Augenring gelblichgrün, die Kehle grünlichgelb. Das Weibchen unterscheidet sich durch etwas geringere Größe, der junge Vogel durch den Mangel des Federbusches und des gelben Brustgürtels. Die Länge beträgt achtzig, die Breite einhundertvierzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter.
In Indien oder Südasien überhaupt und in Ägypten gehört der Löffler wahrscheinlich unter die Standvögel; in nördlicheren Ländern erscheint er mit den Störchen, also im März und April, und verläßt das Land im August und September wieder. Er wandert bei Tage, meist in einer langen Querreihe, scheint aber nicht besonders zu eilen, sondern sich während der Reise allerorts aufzuhalten, wo er Nahrung findet. In Griechenland trifft er mit den übrigen Reihern nach der Tag- und Nachtgleiche ein, hält sich kurze Zeit in den Sümpfen auf und reist dann weiter, benutzt aber im Herbst einen andern Weg als im Frühling. Im Brutlande wie in der Fremde zieht er Strandseen und Sümpfe dem Meere entschieden vor, ist also keineswegs ein Seevogel, wie man oft angenommen hat, sondern ähnelt auch hinsichtlich seines Aufenthaltes den Ibissen. Da, wo das Meer seicht und schlammig ist, fehlt er freilich nicht; die Meeresküste ähnelt hier aber, streng genommen, einem großen Sumpf. Uferstellen und Brüche, die mit höheren Pflanzen bestanden sind, vermeidet er unter allen Umständen; sein eigentliches Weidegebiet sind die schlammigen Uferränder der Gewässer. Hier schreitet er, meist watend, mit gemessenen Schritten dahin, solange er Nahrung sucht, mit tief herabgebeugtem Oberkörper, den Schnabel beständig seitlich hin und her schwingend und so, in ähnlicher Weise wie der Säbelschnäbler, Wasser und Schlamm durchsuchend. Selten sieht man ihn mit gerade ausgestrecktem Halse stehen; wenn er nicht arbeitet, biegt er denselben vielmehr so tief herab, daß der Kopf fast auf den Schultern ruht und der Hals vorn weit hervortritt; nur beim Sichern streckt er den Kopf gerade empor. Der Gang ist ernst und gemessen, jedoch zierlicher als der des Storches, der Flug sehr leicht und schön, oft schwebend und kreisend. Von dem fliegenden Reiher unterscheidet sich der Löffler dadurch, daß er den Hals stets gerade auszustrecken pflegt, vom fliegenden Storch dadurch, daß er öfter und schneller mit den Flügeln schlägt. Die Stimme, ein einfacher, quakender Laut, den man schwer durch Silben wiedergeben kann, wird selten und bloß auf geringe Entfernung hin vernommen. Unter den Sinnen steht das Auge obenan; das Gehör ist gut; das Gefühl scheint aber ebenfalls wohl entwickelt, der Schnabel in ziemlich hohem Grade tastfähig zu sein.
In seinem Wesen und Gebaren zeigt der Löffler mit Störchen und Reihern keine Verwandtschaft. Er gehört zu den vorsichtigen und klugen Vögeln, die sich in die Verhältnisse zu fügen wissen und jedes Ereignis bald nach seinem Wert abzuschätzen lernen, zeigt sich da verhältnismäßig zutraulich, wo er nichts zu fürchten hat, äußerst scheu hingegen an allen Orten, wo dem Sumpfgeflügel überhaupt nachgestellt wird. Unter sich leben diese Vögel im hohen Grade gesellig und friedlich. Mit wahrem Vergnügen habe ich gesehen, wie sich zwei Löffler gegenseitig Liebesdienste erwiesen, indem der eine dem andern das Gefieder des Halses mit dem Schnabel putzte und ordnete, selbstverständlich nur diejenigen Stellen, die mit dem eigenen Schnabel nicht bearbeitet werden können. Unter dem andern Geflügel, das mit ihm dieselben Aufenthaltsorte teilt, bewegt sich der Löffler mit einer liebenswürdigen Harmlosigkeit und gutmütigen Friedfertigkeit, hält mit allen Freundschaft und scheint froh zu sein, wenn ihn andere nicht behelligen; sein unschuldiges Gemüt läßt nicht einmal einen Gedanken an Neckereien aufkommen.
Wie die Mehrzahl der Reihervögel überhaupt, gehört auch der Löffler zu den Tagvögeln; in mondhellen Nächten läßt er sich aber doch gern verleiten, noch ein wenig auf Nahrung auszugehen; ich sah ihn am Mensaleh-See zu meiner nicht geringen Verwunderung noch in der elften Nachtstunde eifrig Nahrung suchen. Gewöhnlich eilt er schon vor Sonnenuntergang den Schlafplätzen zu und verläßt sie bis zum Morgen nicht wieder. Sehr gern hält er auf den Bäumen, die ihm Nachtruhe gewähren, auch ein kurzes Mittagsschläfchen, während er, solange er am Boden oder im Wasser umherläuft, sich beständig mit seinem Nahrungserwerb zu beschäftigen scheint.
Fische bilden wohl seine hauptsächlichste Nahrung. Er ist imstande, solche von zehn bis fünfzehn Zentimeter Länge zu verschlingen, packt sie sehr geschickt mit dem Schnabel, dreht sie, bis sie in die rechte Lage kommen, und schluckt sie, den Kopf nach vorn, hinab. Nebenbei werden unzweifelhaft alle übrigen kleineren Wassertiere, Krebse, Muscheln und Schnecken samt den Gehäusen, Wasserlurche usw. und ebenso wohl auch Kerbtiere in allen Lebenszuständen verzehrt.
Wo Löffler häufig vorkommen, bilden sie Siedelungen und legen auf einem und demselben Baume so viele Nester an, wie sie eben können. In Gegenden, in denen es weit und breit keine Bäume gibt, sollen sie auch im Rohre nisten. Die Nester selbst sind breit, locker und schlecht aus dürren Reisern und Rohrstengeln zusammengefügt, inwendig mit trockenen Schilfblättern, Binsen und Rispen ausgekleidet. Das Gelege zählt zwei bis drei, seltener vier verhältnismäßig große, etwa siebzig Millimeter lange, fünfundvierzig Millimeter dicke, starkschalige, grobkörnige, glanzlose, auf weißem Grunde mit vielen rötlichgrauen und gelben Flecken gezeichnete Eier, die übrigens mannigfach abändern. Wahrscheinlich brüten beide Eltern abwechselnd; beide füttern mindestens die Jungen groß. Letztere werden nach dem Ausfliegen den Sümpfen zugeführt, verweilen nicht bloß auf dem Zuge, sondern auch in der Winterherberge in Gesellschaft der Alten, kehren mit diesen zurück und schlagen sich erst dann in abgesonderte Trupps zusammen, da sie nicht vor dem dritten Jahre fortpflanzungsfähig werden.
In früheren Zeiten wurde auch der Löffler gebeizt; gegenwärtig jagt man ihn hier und da seines genießbaren, wenn auch nicht gerade wohlschmeckenden Fleisches halber. Rechtzeitig ausgehobene Nestvögel gewöhnen sich leicht an die Gefangenschaft, auch an allerlei Nahrung, pflanzliche ebenso wie tierische, lernen ihren Herrn kennen, begrüßen ihn mit freudigem Schnabelgeklapper, wenn sie ihn sehen, können zum Aus- und Einfliegen gebracht und wegen ihres sanften, friedfertigen Wesens unter allem Hofgeflügel gehalten werden.
*
Nach Reichenows und Gadows eingehenden Untersuchungen gebührt den Flamingos ( Phoenicopteridae), die eine besondere Familie bilden, hier ihre Stelle. Der Leib der Flamingos ist schlank, der Hals sehr lang, der Kopf groß, der Schnabel etwas länger als der Kopf, höher als breit, aber dick, von der Mitte an unter einem stumpfen Winkel herabgebogen, sein Oberkiefer viel kleiner, schmäler als der untere und, was besonders beachtenswert, merkwürdig platt, sein Rand aber, wie der des unteren, mit Zähnen besetzt. Die Beine sind ungemein lang und dünn, seitlich zusammengedrückt, weit über die Ferse hinauf nackt, ihre drei Vorderzehen ziemlich kurz und durch vollkommene, obwohl seicht ausgeschnittene Schwimmhäute verbunden; die hocheingelenkte, bei einer Art verkümmerte Hinterzehe ist kurz und schwach. Der Flügel ist mittellang, der aus zwölf Federn gebildete Schwanz kurz, das Kleingefieder dicht und derb, durch große Weiche und besondere Farbenschönheit ausgezeichnet.
Der Flamingo ( Phoenicopterus roseus) ist weiß, äußerst zart und schön rosenrot überhaucht, sein Oberflügel karminrot; die Schwingen sind schwarz. Das Auge ist gelb, der Augenring karminrot, der Schnabel an der Wurzel rosenrot, an der Spitze schwarz, der Fuß karminrot. Die Länge beträgt einhundertzwanzig bis einhundertdreißig, die Breite einhundertsechzig bis einhundertsiebzig, die Fittichlänge neununddreißig, die Schwanzlänge vierzehn Zentimeter. Das Weibchen ist bedeutend kleiner. Bei den Jungen ist das ganze Gefieder weiß, am Halse grau, auf dem Oberflügel gesprenkelt. Erst mit dem dritten Jahre geht dieses Kleid in das des alten Vogels über.
Die Länder um das Mittelländische und Schwarze Meer sind die Heimat des Flamingos. Von hier aus verbreitet er sich südlich über den Norden des Roten Meeres und anderseits bis gegen die Inseln des Grünen Vorgebirges hin. Ebenso tritt er in Mittelasien an den großen Seen ziemlich regelmäßig und an den Meeresküsten Südasiens auf. Auffallend ist seine Beschränkung auf gewisse Örtlichkeiten. Vom Mittelmeer aus hat er sich schon einige Male nach Deutschland verflogen. Im März 1795 wurde ein Flamingo am Neuburger See erlegt, 1728 einer am Altrhein bei Alzey geschossen; im Juni 1811 erschienen siebenundzwanzig Stück bei Kehl, von denen sechs Stück erlegt wurden; am 25. Juni desselben Jahres sah man eine Anzahl dieser Vögel über Bamberg fliegen; vom 14. bis 16. Juli beobachtete man ihrer zwei auf einer Rheinaue bei Schierstein. Alle diese Irrlinge waren junge Vögel, die verschlagen worden sein mußten. Streng genommen bildet das südliche Europa die nördliche Grenze seines Verbreitungskreises und Nordafrika und Mittelasien das eigentliche Wohngebiet. Strandseen mit salzigem oder brackigem Wasser sind die Aufenthaltsorte, die der Flamingo allen übrigen vorzieht. Nach wirklich süßen Gewässern verirrt er sich nur, hält sich hier auch immer bloß kurze Zeit auf und verschwindet wieder. Dagegen sieht man ihn häufig im Meere selbst, erklärlicherweise nur auf flachen Stellen, die ihm gestatten, sich in gewohnter Weise zu bewegen. Er zählt zu den Strichvögeln, scheint aber so regelmäßig zu streichen, daß man bei ihm vielleicht auch von Ziehen reden kann.

Flamingos ( Phoenicopterus roseus)
Wer, wie ich, Tausende von Flamingos vereinigt gesehen hat, stimmt in die Begeisterung der übrigen Beobachter ein, denen das Glück wurde, ein so großartiges Schauspiel zu genießen. »Wenn man des Morgens von Cagliari aus gegen die Seen sieht«, schildert der alte Cetti, »scheint sie ein Damm von roten Ziegeln zu umgeben, oder man glaubt eine große Menge von roten Blättern auf ihnen schwimmen zu sehen. Es sind aber die Flamingos, die daselbst in ihren Reihen stehen und mit ihren rosenroten Flügeln diese Täuschung bewirken. Mit schöneren Farben schmückte sich nie die Göttin des Morgens, glänzender waren nicht die Rosengärten des Pästus als der Schmuck, den der Flamingo auf seinen Flügeln trägt. Es ist ein lebhaft brennendes Rosenrot, ein Rot erst aufgeblühter Rosen. Die Griechen benannten den Vogel von dieser Farbe der Flügeldeckfedern, die Römer behielten die Benennung bei, und die Franzosen hatten auch nichts anders im Sinne als die brennendroten Flügel, wenn sie unsern Vogel ›Flamant‹ nennen.« Mir wird der erste Eindruck, den die Flamingos auf mich übten, unvergeßlich bleiben. Ich schaute über den weiten Mensalehsee hinweg und auf Tausende und andere Tausende von Vögeln, buchstäblich auf Hunderttaufende. Das Auge aber blieb haften auf einer langen Feuerlinie von wunderbarer, unbeschreiblicher Pracht. Das Sonnenlicht spielte mit den blendendweiß und rosenrot gefiederten Tieren, die sie bildete, und herrliche Farben wurden lebendig. Durch irgend etwas aufgeschreckt, erhob sich die Masse; aus dem wirren Durcheinander, aus den lebendigen Rosen ordnete sich ein langer, mächtiger Zug in die Keilform der Kraniche, und nunmehr zog die Feuerlinie an dem blauen Himmel dahin. Es war ein Anblick zum Entzücken! Nach und nach ließen sie sich wieder herab, und von neuem stellten sie sich in altgewohnter Weise auf, so daß man wiederum meinen mußte, einen zahlreichen Truppenkörper vor sich zu haben. Das Fernrohr belehrt, daß die Flamingos nicht eine Linie im strengsten Sinne des Wortes bilden, sondern nur auf weithin nebeneinander stehen; aus größerer Entfernung gesehen, erscheinen sie aber stets wie ein wohlgeordnetes Heer. Die Singalesen nennen ihre Flamingos »englische Soldatenvögel«, die Südamerikaner geradezu »Soldaten«; ja Humboldt erzählt uns, daß die Einwohner Angosturas eines Tages kurz nach Gründung der Stadt in die größte Bestürzung gerieten, als sich einmal gegen Süden Reiher und »Soldatenvögel« erblicken ließen. Sie glaubten sich von einem Überfall der Indianer bedroht, und obgleich einige Leute, die mit dieser Täuschung bekannt waren, die Sache aufklärten, beruhigte sich das Volk nicht ganz, bis die Vögel in die Luft flogen und der Mündung des Orinoko zustrebten.
Einzelne Flamingos sieht man selten, vor Anfang der Paarungszeit wohl nie. Immer sind es Massen, die gesellschaftlich auf einer und derselben Stelle ihrer Jagd obliegen und innerhalb des eigentlichen Heimatgebietes stets Massen von Hunderten oder von Tausenden. Derartige Gesellschaften vermeiden fast ängstlich, Stellen zu nahen, die ihnen gefährlich werden könnten. Sie fischen im freien Wasser, das ihnen nach allen Seiten hin Umschau gestattet, oder hüten sich namentlich vor Schilfdickichten. Einem Boote, das auf sie lossteuert, entweichen sie stets aus weiter Ferne; überhaupt schreckt sie alles Fremdartige auf, und es ist deshalb nicht gerade leicht, ihr Freileben zu beobachten. Man sieht sie tagtäglich, ohne über ihr Treiben vollständig klar werden zu können, und nur mit Hilfe eines guten Fernrohres wird es möglich, sie zu beobachten. Gewöhnlich stehen sie bis über das Fersengelenk im Wasser; seltener treten sie auf die Düne oder auf Sandinseln heraus, am wenigsten auf solche, die irgendwie bewachsen sind. Im Wasser und auf dem Lande nehmen sie die sonderbarsten Stellungen an. Der lange Hals wird eigentümlich verschlungen, wie mein Bruder trefflich sich ausdrückt, verknotet vor die Brust gelegt, der Kopf dann auf den Rücken gebogen und unter den Schulterfedern der Flügel verborgen. Das eine Bein trägt dabei regelmäßig die Last des Leibes, während das andere entweder schief nach hinten weggestreckt oder zusammengeknickt an den Bauch angezogen wird. In dieser Stellung pflegt der Flamingo zu schlafen; sie ist ihm eigentümlich. Bei einer andern Stellung, die stets von dem vollen Wachsein Kunde gibt, wird der Hals nach Art der Reiher S-förmig zusammengebogen, so daß der Kopf dicht über dem Nacken zu stehen kommt. Nur wenn der Flamingo erschreckt oder sonstwie erregt wurde, erhebt er seinen Kopf so hoch, wie der lange Hals dies gestattet, und nimmt dann auf Augenblicke diejenige Stellung an, die bei unsern Ausstopfern ganz besonders beliebt zu sein scheint. Ebenso sonderbar wie im Zustand der Ruhe trägt er sich, wenn er mit Aufnahme seiner Nahrung sich beschäftigt. Er gründelt nach Art der Zahnschnäbler, aber in durchaus verschiedener Weise. Fischend watet er in dem Wasser dahin und biegt seinen langen Hals so tief herab, daß der Kopf mit den Füßen auf dieselbe Ebene zu stehen kommt, mit andern Worten, daß der Schnabel, und zwar der Oberschnabel, in den Schlamm eingedrückt werden kann. In dieser Weise untersucht er den Grund des Gewässers, bewegt sich dabei mit kleinen Schritten vor- und rückwärts und öffnet und schließt abwechselnd seinen Schnabel unter entsprechender Bewegung der Zunge. Vermöge des feinen Gefühls derselben wird alles, was in den Siebschnabel gelangt, geprüft und das zur Ernährung Dienende von dem Unbrauchbaren ausgeschieden oder richtiger abgeseiht. Durch das Trippeln mit den Füßen bringt er die kleinen Wassertiere, von denen er sich ernährt, in Aufruhr und Bewegung.
Der Gang ähnelt der Gehbewegung hochbeiniger Watvögel, ohne ihr jedoch zu gleichen. Jeder Storch, jeder Kranich, jeder Reiher geht anders als ein Flamingo, der Unterschied in der Bewegung des einen und der andern läßt sich aber schwer mit Worten ausdrücken; man kann höchstens sagen, daß die Schritte des Flamingos langsamer, unregelmäßiger, schwankender sind als die der eigentlichen Watvögel, was wohl in der Länge der Beine seinen hauptsächlichsten Grund haben mag. Vor dem Auffliegen nämlich bewegt er sich gar nicht selten halb fliegend, halb laufend auf der Oberfläche des Wasser dahin, zwar nicht mit der Fertigkeit, die der Sturmvogel an den Tag legt, aber doch ebenso gewandt, wie ein Wasserhuhn oder ein Entvogel dasselbe auszuführen vermag. Im tieferen Wasser schwimmt er, wie es scheint, ohne alle Anstrengung. Der Flug, der durch jenes Dahinlaufen über das Wasser eingeleitet zu werden pflegt, erscheint leicht, nachdem der Vogel sich einmal erhoben hat. Die ziemlich raschen Flügelschläge bringen ein ähnliches Geräusch hervor, wie wir es von Enten und Gänsen zu hören gewohnt sind; einige Berichterstatter vergleichen das Getön, das eine plötzlich aufgescheuchte Flamingogesellschaft verursacht, mit fernem Donner. Auch der Ungeübteste oder der Neuling, wenn ich so sagen darf, würde den fliegenden Flamingo nie zu verkennen imstande sein. Gegen anderer Langhälse Art streckt dieser Vogel nämlich im Fliegen außer den langen Beinen auch den langen Hals gerade von sich und erscheint deshalb auffallend lang und schmächtig. An diese Gestalt sind nun die schmalen Flügel genau in der Mitte eingesetzt, und so nimmt der fliegende Flamingo die Gestalt eines Kreuzes an. Eine größere Anzahl pflegt sich, wie das ziehende Kranichsheer, zu längerem Fluge entweder in eine Reihe oder in einen Keil zu ordnen, dessen Schenkel im Verlaufe des Fluges fortwährend sich ändern, weil immer einer der Vögel nach dem andern den Vordermann ablöst. Aus größeren Höhen steigen die Flamingos in weit ausgeschweiften Schraubenlinien hernieder, kurz vor dem Niederlassen schweben sie wie vor dem Auffliegen noch ein Stück über das Wasser dahin, bis sie imstande sind, ihre Bewegung, soviel wie zum ruhigen Stehenbleiben erforderlich ist, zu verlangsamen.
Der Flamingo lebt von kleinen Wassertierchen, insbesondere von einschaligen Muscheln, die er durch Gründeln gewinnt, Würmern verschiedener Art, Krebsen, kleinen Fischchen und gewissen Pflanzenstoffen. Gefangene können mit gekochtem Reis, eingequelltem Weizen, Gerstenschrot, eingeweichtem Brot und Teichlinsen längere Zeit erhalten werden, bedürfen jedoch, um sich wohl zu befinden, einen Zusatz von tierischen Stoffen. Bei derartig gemischter Nahrung halten sie viele Jahre in der Gefangenschaft aus. Es verdient bemerkt zu werden, daß ihr Gefieder den zarten Rosenhauch verliert, wenn man ihnen längere Zeit ausschließlich Pflanzennahrung reicht, wogegen sie ihre volle Schönheit zurückerhalten, wenn man die Futtermischung der von ihnen selbst während des Freilebens gesuchten Nahrung möglichst entsprechend wählt.
Der Flamingo legt sich sein Nest inmitten des Wassers selbst auf seichten Stellen, nach Versicherung der Araber hingegen auf flachen, mit sehr niederem Gestrüpp bewachsenen Inseln an. Im ersteren Fall ist das Nest ein kegeliger Haufen von Schlamm, der mit den Füßen zusammengescharrt, wahrscheinlich durch Wasserpflanzen und dergleichen gedichtet und so hoch aufgerichtet wird, daß die Mulde bis zu einem halben Meter über dem Wasserspiegel liegt, im letzteren Falle nur eine seichte, im Boden selbst ausgescharrte Mulde, in der man, wie mir die Araber erzählten, eine dürftige Lage aus Schilf und Rohrblättern findet. Die Anzahl der Eier beträgt gewöhnlich zwei; es mag jedoch vorkommen, daß auch einmal ihrer drei in einem Nest liegen. Sie sind sehr gestreckt, meist ungleichhälsig, haben eine weiche, kreidige und ebene Schale und sehen kalkweiß aus. Der Vogel brütet unzweifelhaft, indem er sich mit zusammengeknickten Beinen auf das Nest setzt; es kann jedoch geschehen, daß er zuweilen eines seiner Beine nach hinten ausstreckt und über den Rand des Nestes hinabhängen läßt. Die Zeit der Bebrütung soll dreißig bis zweiunddreißig Tage währen, und das Weibchen sein Männchen durch lautes Schreien zum Wechseln einladen. Die Jungen sollen bald nach dem Ausschlüpfen ins Wasser geführt werden, hier vom ersten Tage ihres Lebens an umherschwimmen und bald auch sehr fertig laufen können, aber erst nach mehreren Monaten flugfähig sein.
Die Jagd des Flamingos erfordert äußerste Vorsicht. Bei Tage läßt ein Heer der ängstlichen Geschöpfe den Jäger nicht einmal auf Büchsenschußweite an sich herankommen; beim Nahrungsuchen halten stets mehrere der älteren Wache und warnen die Gesamtheit beim Herannahen einer Gefahr. Nachts hingegen lassen sie sich leichter berücken. Salvadori versichert, daß es dann nicht schwer sei, sie mit Schroten zu schießen, und die Araber erzählen mir, daß man sie noch einfacher erbeuten könne. Man spannt nachts zwischen zwei Barken gewöhnliche Fischnetze aus und segelt mit ihnen unter eine Flamingoherde; die erschreckten Tiere fliegen auf, verwickeln sich in den Netzen und werden von einigen Bootsleuten ausgelöst. Auf diese Weise erlangt man zuweilen fünfzig und noch mehr aus einer Gesellschaft. Auf den Märkten der nordägyptischen Städte findet man den schönen Vogel oft zu Dutzenden, weil er als Wildbret sehr beliebt ist. Die alten Schriftsteller erzählen, daß die Römer das Fleisch, insbesondere aber Zunge und Hirn außerordentlich hochschätzten und von dem letzteren ganze Schüsseln voll auftragen ließen. Ich habe Fleisch und Zungen selbst versucht und beides wohlschmeckend, die Zunge aber wirklich köstlich gefunden.
*
Die Störche ( Ciconidae) sind verhältnismäßig plump gebaute, dickschnäbelige, hochbeinige, aber kurzzehige Sumpfvögel. Ihr Schnabel ist lang, gerade, gestreckt kegel- und keilförmig, zuweilen etwas nach oben gebogen, bei andern in der Mitte klaffend, gegen die Spitze hin seitlich zusammengedrückt, das Bein sehr lang, stark, weit über die Fersengelenke hinauf unbefiedert, der kurzzehige Fuß zwischen den Vorderzehen mit kleinen Spannhäuten ausgerüstet und mit dicken, kuppigen Krallen bewehrt, der Flügel groß, lang und breit, der kurze Schwanz abgerundet. Beide Geschlechter unterscheiden sich durch die Größe, die Jungen durch mattere Farben von den Alten.
Störche leben in allen Erdteilen, doch darf man im allgemeinen sagen, daß sie waldige, ebene, wasserreiche Gegenden den höheren und trockeneren vorziehen und demgemäß Gebirgen oder Steppen und Wüsten fehlen. Die nordischen Arten gehören zu den Zugvögeln und durchwandern meist ungeheuere Strecken? die im Süden lebenden streichen. Sie sind nur bei Tage tätig, tragen sich aufrecht, den Hals fast ganz oder nur sanft S-förmig gebogen, gehen schreitend mit gewissem Anstand, waten gerne im Wasser umher, entschließen sich aber nur ausnahmsweise zum Schwimmen, fliegen sehr schön, leicht und meist hoch, nicht selten schwebend, oft in prachtvollen Schraubenlinien kreisend, strecken dabei Hals und Beine gerade von sich und nehmen so im Fluge eine sie von weitem kennzeichnende Gestalt an.
Langer, kegelförmiger, gerader, an den scharfen Schneiden stark eingezogener, mit plattem Hornüberzuge bekleideter Schnabel, hohe, weit über der Ferse nackte Füße, mit kurzen, unten breiten Zehen, deren äußere und mittlere bis zum ersten Gelenke durch eine Spannhaut verbunden sind, lange, mäßig breite, ziemlich stumpfe Flügel, unter deren Schwingen die dritte, vierte, fünfte gleich lang und die längsten sind, aus zwölf kurzen Federn bestehender, abgerundeter Schwanz und reiches, wenigfarbiges, oft aber glänzendes Gefieder kennzeichnet die Klapperstörche ( Ciconia).
Unter ihnen verdient selbstverständlich der Hausstorch, Adebar oder Klapperstorch ( Ciconia alba), an erster Stelle genannt zu werden. Sein Gefieder ist mit Ausnahme der schwarzen Schwingen und längsten Deckfedern schmutzigweiß, das Auge braun, der Schnabel lack-, der Fuß blutrot, der kahle Fleck um das Auge grauschwarz. Die Länge beträgt einhundertundzehn, die Breite zweihundertvierundzwanzig, die Fittichlänge achtundsechzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter. Das Weibchen ist kleiner.
Mit Ausnahme der hochnordischen Länder fehlt der Storch keinem Teile Europas, obgleich er freilich nicht überall als Brutvogel gefunden wird. So besucht er unter andern auch England, woselbst er früher häufig gewesen sein soll, gegenwärtig nur noch selten, und ebenso hat er sich aus Griechenland mehr oder weniger zurückgezogen, weil die Bewohner der Morea ihn, den heiligen Vogel der Türkei, gänzlich verscheucht haben. Auch in Spanien gehört der Storch in manchen für ihn durchaus geeigneten Teilen des Landes zu den Seltenheiten. Außerdem tritt er in Südrußland und rings um das Kaspische wie um das Schwarze Meer, in Syrien, Palästina, Persien, den Oxusländern und in Japan sowie andererseits in den Atlasländern und auf den Kanaren auf, soll, laut Layard, »ohne Zweifel« auch in Südafrika nisten. Auf seinem Winterzuge durchstreift er ganz Afrika und Indien. In Mittel- und Norddeutschland erscheint er zwischen dem letzten Februar und ersten April, einige Vorläufer und Nachzügler ausgenommen. Einzelne kommen bereits um die Mitte des Februar und andere noch in der zweiten Hälfte des April an. Im Innern Afrikas trifft er wenige Tage nach seiner Abreise ein; ich sah ihn bereits am 1. September im südlichen Nubien und noch am 31. März bei Khartum. Er bevorzugt ebene, flache und tiefe Gegenden, die reich an Wasser und insbesondere an Sümpfen und Morästen sind, verlangt aber Gelände, in denen der Mensch zur Herrschaft gekommen ist. Zwar siedeln sich viele Hausstörche auch fern von den menschlichen Wohnungen in Wäldern an und gründen hier auf starken Bäumen ihren großen Horst; die Mehrzahl aber nistet im Gehöfte der Bauern oder wenigstens auf Dächern.
Wenn man besonderes Glück hat, kann man die Ankunft des beliebten Dachgastes beobachten und sehen, daß sich das Paar, das im vorigen Jahre im Gehöfte nistete, plötzlich aus ungemessener Höhe in Schraubenlinien herabläßt aus den Dachfirst, und nun vom ersten Augenblicke an so heimisch tut, als wäre es nie verreist gewesen. Sofort nach der Ankunft beginnt das gewöhnliche Treiben. Er fliegt vom Nest, das wirklich zu seinem Hause wird, weg, auf Feld und Wiesen, nach Sümpfen und Morästen hinaus, um seiner Jagd obzuliegen, kehrt in den Mittagsstunden gewöhnlich wieder zurück, unternimmt nachmittags einen zweiten Ausflug, kommt vor Sonnenuntergang nach Hause, klappert und schickt sich schließlich zum Schlafen an. So treibt er es, bis die Fortpflanzungszeit eintritt und nunmehr die Sorge um die Brut eine gewisse Abweichung von der gewohnten Lebensweise bedingt.
Das Betragen erscheint uns würdevoll. Sein Gang ist langsam und gemessen, seine Haltung aufgerichtet, sein Flug, der durch wenige Sprünge eingeleitet wird, verhältnismäßig langsam, aber doch leicht und schön, namentlich durch prachtvolle Schraubenlinien ausgezeichnet. Im Stehen pflegt er den Hals etwas einzuziehen und den Schnabel mit der Spitze nach unten zu richten; niemals aber nimmt er eine so häßliche Stellung an wie die meisten Reiher, und selbst in der tiefsten Ruhe sieht er anständig aus. Selten steigert er seinen Gang bis zum Rennen; diese Bewegung scheint ihn auch bald zu ermüden, während er, in seiner gewöhnlichen Weise dahinwandelnd, stundenlang in Tätigkeit sein kann. Der Flug ermüdet ihn nicht; er bewegt die Flügel selten und auch nicht oft nacheinander, weiß aber den Wind oder jeden Luftzug so geschickt zu benutzen, daß er schwebend nach Belieben steigt und fällt, und versteht sein Steuer so trefflich zu handhaben, daß er jede Wendung auszuführen vermag. Sein Verstand ist ungewöhnlich ausgebildet. »Er weiß sich«, sagt Naumann, »in die Zeit und in die Leute zu schicken, übertrifft darin fast alle übrigen Vögel, und ist keinen Augenblick darüber in Zweifel, wie die Menschen an diesem oder jenem Ort gegen ihn gesinnt sind. Er merkt gar bald, wo er geduldet und gern gesehen ist, und der wenige Tage früher in einer fremden Gegend angekommene, schüchterne und vorsichtige, dem Menschen ausweichende, allem mißtrauende Storch hat nach der Einladung, die ein zur Grundlage seines zukünftigen Nestes aus ein hohes Dach oder auf einen Baumkopf gelegtes Wagenrad ist, sofort alle Furcht verloren, und nachdem er Besitz von jenem genommen, ist er nach wenigen Tagen schon so zutunlich geworden, daß er sich furchtlos aus der Nähe begaffen läßt. Bald lernt er seinen Gastfreund kennen und von andern Menschen, oder die ihm wohlwollenden überhaupt von mißgünstigen und gefährlichen Personen unterscheiden. Er weiß, ob man ihn liebt und gern sieht, oder ob man ihn nur mit Gleichgültigkeit betrachtet; denn er beobachtet aufmerksam.« Fern vom Nest zeigt sich der Storch ebenso scheu wie alle seine Verwandten. Er kennt die Bauern, Hirten und Kinder sehr gut als ungefährliche Menschen, meidet aber doch jede Annäherung und erschwert dem Jäger, der ihn erlegen will, schußgerecht anzukommen. Noch viel vorsichtiger und scheuer zeigt er sich auf dem Zuge oder überhaupt, wenn er mit andern seiner Art sich vereinigt.
Gewöhnlich betrachtet man den Storch als einen harmlosen und gutmütigen Vogel; diese Eigenschaften besitzt er jedoch durchaus nicht. »Seine Art, sich zu ernähren«, sagt Naumann, »macht ihm das Morden zur Gewohnheit, und diese kann sogar zuzeiten auf seinesgleichen übergehen. Man hat Beispiele, daß Störche von anderswo herkamen, das Nest stürmten, über die Jungen herfielen und, trotz der verzweifelten Gegenwehr ihrer Eltern, sie endlich doch ermordeten, dies auch bei mehreren in der Gegend so machten.« Der gezähmte Storch geht, gereizt, seinem Widersacher unter Umständen zu Leibe; der angeschossene wehrt sich tapfer, versetzt bis zum letzten Hauche Schnabelstöße und kann, da diese häufig nach den Augen gerichtet sind, Menschen oder Jagdhunden leicht gefährlich werden. Wenn Eifersucht ins Spiel kommt, kämpft er auf Leben und Tod, und kleinen Tieren gegenüber bleibt er immer gefährlich.
Der einzige Stimmlaut, den der Storch hervorbringen kann, ist ein heiseres, unbeschreibliches Zischen. Man vernimmt dies selten, am öftesten noch von gezähmten, die besondere Freude an den Tag legen wollen. Gewöhnlich drückt er seine Gefühle durch Klappern mit dem Schnabel aus, und er versteht dieses sonderbare Werkzeug wirklich kunstgerecht zu handhaben, klappert bald länger, bald kürzer, bald schneller, bald langsamer, bald stärker, bald schwächer, klappert aus Freude oder aus Kummer, wenn er hungrig ist, und nachdem er sich gesättigt hat, macht seinem Weibchen klappernd seine Liebeserklärung und liebkost klappernd seine Jungen. Diese lernen die merkwürdige, aber keineswegs arme Sprache ihrer Eltern, noch ehe sie flugbar werden, und drücken, sobald sie klappern können, ihre Gefühle ebenfalls dadurch aus, während man früher von ihnen Laute vernahm, die zwar ebensowenig klangvoll sind wie die ihrer Eltern, aber doch als Laute bezeichnet und ein Gewinsel oder Gezwitscher genannt werden dürfen.
Tiere der verschiedensten Art bilden die Nahrung des Storches. Er ist ein Räuber in der vollsten Bedeutung des Wortes. Es scheint, daß Lurche, Kerbtiere und Regenwürmer von ihm bevorzugt werden, wohl aber nur, weil sie sich am leichtesten fangen lassen. Bei seinen gewöhnlichen Jagdgängen trifft er am häufigsten Frösche, Mäuse und Kerbtiere an, und sie werden zuerst mitgenommen; aber er tötet auch Eidechsen, Blindschleichen, Nattern, selbst Giftschlangen, ist nach Fischen ebenso begierig wie nach Fröschen, stellt ihnen gelegentlich im trüben Wasser eifrig nach und verschluckt solche bis zur Länge einer Manneshand. Große Nattern bearbeitet er, laut Lenz, bevor er sie faßt, oft lange mit Schnabelhieben, bis sie ganz ohnmächtig sind, und schluckt sie dann, wie er sie gerade packt, hinab, entweder den Schwanz oder den Kopf vorweg, gleichviel ob sie schon tot sind oder sich noch fest um seinen Schnabel ringeln, so daß er genötigt ist, sie durch eine heftige Bewegung wieder herauszuschleudern, oder sie mit einem Fuße herauszukratzen, worauf er sie von neuem zu verschlingen sucht. Bei großer Gier schluckt er kleinere Schlangen oft, ohne sie vorher im geringsten zu bearbeiten: sie toben noch lange im Halse herum, huschen auch leicht, wenn er sich rasch bückt, um eine neue Beute zu greifen, wieder heraus, so daß, wenn er auf freiem Boden mehrere Schlangen vor sich hat, recht lustige Jagden entstehen. Auch die giftigen Kreuzottern sind ihm eine Lieblingsspeise; er haut sie aber, sooft es ans Schlucken geht, so oft und so derb auf den Kopf, daß ihnen Hören und Sehen vergeht. Verfährt er einmal zu rasch und unvorsichtig und wird von einer Otter gebissen, so leidet er einige Tage sehr, erholt sich dann aber gänzlich. Die Eier aller Bodenbrüter nimmt er aus; junge Vögel, auch Rebhühner, tötet er ohne Gnade, schleppt seinen Jungen sogar volle Vogelnester zu; den Mäusen lauert er auf Feld und Wiesen vor ihren Löchern auf; die Maulwürfe spießt er im Aufstoßen, junge Hasen nimmt er der Mutter trotz mutiger Verteidigung weg. Auf blumigen Wiesen treibt er eifrig Kerbtierfang und ergreift nicht allein die sitzenden und kriechenden, sondern bemüht sich auch, die umherschwirrenden noch im Fluge wegzuschnappen. Kröten ekeln ihn an; er haßt sie so, daß er sie tötet, rührt sie aber niemals an. Naumann fand an einem Teiche zahllose Kreuzkröten, entweder tot oder mit aufgerissenem Bauch und zerfetzten Eingeweiden, in den letzten Zuckungen liegen; Opfer zweier Störche, die an demselben Teiche regelmäßig fischten.
Da der Storch, wie aus Vorstehendem zu ersehen, der Jagd schadet, auch durch Wegfangen von Bienen sich Übergriffe erlauben soll, zählen ihn Jäger und Imker zu den schädlichen Vögeln und wollen ihn ausgerottet wissen. Einzelne Naturforscher stellen sich auf jene Seite, rechnen ihm alle Frösche nach, die er vertilgt, und wollen glauben machen, daß er Flur und Feld veröde. Daß solche Behauptungen arge Übertreibungen sind, bedarf kaum des Beweises. Selbst, wenn man seine Schädlichkeit in jagdlicher Beziehung im vollen Umfange zugesteht, wird man sich besinnen müssen, bevor man ihm das Verdammungsurteil spricht. Hasen, Rebhühner, Singvögel, Frösche und Fische rottet er nicht aus, schmälert ihren Bestand nicht einmal in nennenswerter Weise, und dem Land- und Forstwirte schadet er auch nicht; dies aber kommt doch wohl in erster Reihe in Betracht. Beide haben daher recht, ihn zu den überwiegend nützlichen Vögeln zu zählen und, in Anerkennung der guten Dienste, die er leistet, seine nicht in Abrede zu stellenden Übergriffe ihm nachzusehen. Aufmerksame Landwirte haben beobachtet, daß in Jahren, in denen die Störche selten waren, die Mäuse bedenklich überhand nahmen und gleichzeitig weit mehr Ungeziefer anderer Art, insbesondere die Kreuzotter, viel häufiger gefunden wurde als sonst. Daß wenigstens ersteres begründet sein dürfte, erscheint jedem wahrscheinlich, der aus den vom Storche ausgespienen Gewöllen die von diesem vertilgte, tatsächlich jeder Berechnung spottende Unzahl von Mäusen abzuschätzen versucht. Was man aber auch gegen ihn vorbringen mag; so viel steht doch wohl fest, daß Frösche, Schnecken und Regenwürmer den Hauptteil seiner Nahrung ausmachen. Alle genannten Tiere sind aber noch in Überzahl vorhanden, und wenn die doch auch nicht unbedingt nützlichen Frösche da, wo Störche leben, tatsächlich abnehmen sollten, trifft den Menschen sicherlich schwerere Schuld als den Storch. Unsere Fluren verlieren mehr und mehr die großen, auf weithin ins Auge fallenden und gerade deshalb das Gelände belebenden Vögel; lasse man daher den reizlosen, Wasser- und froschreichen Ebenen wenigstens ihren Storch.
Die Anhänglichkeit des Vogels an den Menschen bekundet sich vorzugsweise während der Paarungszeit. »Man muß erstaunen«, sagt Naumann, »daß Störche, die in einer fremden Gegend groß wurden, bei allem angeborenen Mißtrauen sogleich erkennen, daß man sie gern sieht. Vor wenigen Jahren zeigte sich ein Storchpaar in meiner Gegend und musterte die breiten Köpfe der alten, hohen Pappeln zwischen zwei Nachbardörfern. Man erriet ihre Absicht und befestigte ein altes Wagenrad auf der Firste eines hohen Strohdaches. Die Störche nahmen sogleich die Einladung an, waren in wenigen Tagen mit dem Bau des Nestes auf jener Grundlage fertig, völlig heimisch und kommen seitdem alle Jahre wieder.« Man kennt Horste, die seit hundert Jahren jeden Sommer bewohnt waren. Wie viele Jahre nacheinander ein und dasselbe Paar das Nest benutzt, weiß man nicht, nimmt aber, und gewiß mit Recht, an, daß die Lebensdauer der Vögel eine sehr lange und demgemäß Wechsel der Nesteigentümer selten ist. In der Regel erscheint der Storch ein paar Tage früher als die Störchin, gewöhnlich benimmt er sich aber so, daß man an seiner Eigenschaft als Besitzer gar nicht zweifeln kann. Kommt, wie es zuweilen geschieht, nur einer der Störche zurück, so währt es oft lange Zeit, bevor er sich einen Gatten gefreit, und in der Regel entstehen dann heftige Kämpfe um das Nest, indem sich wahrscheinlich junge Paare einfinden, die gemeinschaftlich über den früheren Inhaber herfallen, ihn zu vertreiben suchen und auch oft genug vertreiben oder sogar umbringen. Unter solchen Umständen wird der Mensch zuweilen genötigt, einzugreifen, um den Frieden zu erhalten. Aus allen Beobachtungen darf man folgern, daß die Ehe eines Storchpaares für die Lebenszeit geschlossen wurde und beide Gatten sich in Treue zugetan sind. Über jeden Zweifel erhaben ist diese Treue zwar nicht; denn man kennt Fälle, daß eine Störchin fremden Störchen Gehör gab, will sogar beobachtet haben, daß ein unbeweibter Storch plötzlich über den neben seinem Neste Wache haltenden Gatten herfiel und ihn mit einem wohlgezielten Schnabelstoße tötete, nichtsdestoweniger aber von der brütenden Störchin ohne weiteres angenommen wurde; man spricht auch von Auftritten, die leider gerechtfertigte Eifersucht der männlichen Störche unverkennbar bekundeten. Solchen Ausnahmen kann man andere Züge entgegenstellen, die für die Treue des Storchpaares sprechen. Ein Storch blieb drei Jahre lang zurück und suchte an Quellen und Bächen Nahrung, oder während der grimmigsten Kälte unter Stalldächern Schutz. Jedes Jahr kam sein Gatte zurück, und sie brüteten wie gewöhnlich. Der zuerst zurückbleibende war das Weibchen. Vom vierten Herbst an blieb nun aber auch das Männchen in Gesellschaft seines Weibchens während des Winters in der Heimat und dies drei Jahre hintereinander. Beide wurden endlich von bösen Menschen getötet, und es ergab sich, daß das Weibchen durch eine früher erhaltene Wunde reiseunfähig war. Genau dasselbe habe ich in Afrika erfahren. Hier sah ich zwei Störche, die in der Winterherberge zurückgeblieben waren, ließ beide erlegen und fand denselben Grund für ihr Verweilen.
Bleibt das Paar ungestört, so beginnt es bald nach Ankunft mit der Ausbesserung des Horstes, indem es neue Prügel und Reiser herbeiträgt und über den alten mehr oder weniger verrotteten aufschichtet, auch eine neue Nestmulde herstellt. Demzufolge nimmt der Horst von Jahr zu Jahr an Höhe und Schwere zu, und dies kann so weit gehen, daß die Unterlage ihn nicht mehr zu tragen vermag, und der Mensch wiederum helfen muß. Der Bau selbst gehört keineswegs zu den ausgezeichneten. Daumenstarke Reiser und Stäbe, Äste, Dornen, Erdklumpen und Rasenstücke bilden die Grundlage, feineres Reisig, Rohrhalme und Schilfblätter eine zweite Schicht, dürre Grasbüschelchen, Mist, Strohstoppeln, Lumpen, Papierstücke, Federn die eigentliche Nestmulde. Alle Baustoffe werden von beiden Gatten im Schnabel herbeigetragen; das Weibchen ist aber, wie gewöhnlich, der Baumeister. Beide arbeiten so eifrig, daß ein neues Nest innerhalb acht Tagen vollendet, die Ausbesserung aber schon in zwei bis drei Tagen geschehen ist. Sowie der Bau beginnt, regt sich das Mißtrauen im Herzen der Besitzer, und einer von den Gatten pflegt regelmäßig Wache beim Neste zu halten, während der andere ausfliegt, um Niststoffe zu sammeln. Dabei wird selbstverständlich auf die mannigfaltigste Weise, man möchte sagen, in allen Ton- und Taktarten, geklappert, überhaupt die Freude über den glücklich gegründeten, bezüglich wieder aufgeputzten Herd deutlich kund getan. Um die Mitte oder zu Ende des April legt die Störchin das erste Ei, und wenn sie zu den älteren gehört, im Verlaufe von wenigen Tagen die drei oder vier andern hinterher. Die Gestalt der letzteren, deren Längsdurchmesser sieben und deren Querdurchmesser fünf Zentimeter beträgt, ist rein eiförmig, die Schale fein, glatt, die Farbe weiß, zuweilen etwas ins Grünliche oder Gelbliche spielend. Die Brutzeit währt achtundzwanzig bis einunddreißig Tage. Beide Geschlechter brüten abwechselnd; dem Weibchen fällt jedoch der Hauptteil an dieser Beschäftigung zu. Dafür sorgt der Storch wiederum für die Sicherheit seiner Gattin. Sind die Jungen ausgeschlüpft, so verdoppelt sich die Sorge der Eltern um die Brut und mit der Sorge auch die Wachsamkeit; denn niemals entfernen sich beide zu gleicher Zeit von den Jungen. Anfänglich erhalten diese hauptsächlich Gewürm der verschiedensten Art und Kerbtiere, Regenwürmer, Egel, Larven, Käfer, Heuschrecken und dergleichen, später kräftigere Kost. Sie werden nicht geatzt, sondern müssen vom ersten Tage ihres Lebens an sich bequemen, das ihnen vorgewürgte Futter selbst aufzulesen. Hierzu leiten die Alten sie an, indem sie die Kleinen am Schnabel packen und diesen abwärts ziehen. Die nötige Wassermenge schleppen die Alten mit der Nahrung im Kehlsacke herbei und speien es mit dieser vor. Bei großer Hitze sollen sie die Jungen auch überspritzen, ebenso wie sie sich zwischen diese und die Sonne stellen, um ihnen Schatten zu verschaffen, oder, im Gegenteile, bei kalter und regnerischer Witterung sie mit dem eigenen Leibe decken. Das Familienleben gewährt jederzeit ein unterhaltendes, nicht immer aber ein angenehmes Schauspiel. Nicht bloß das Dach wird abscheulich beschmutzt, sondern auch eine Masse von Nahrungsstoffen herabgeschleudert, so daß sie unten verfaulen und Gestank verbreiten. Gar nicht selten geschieht es auch zum Entsetzen der Hausfrau, daß der alte Storch mit einigen frisch gefangenen, noch halb lebenden Blindschleichen, Nattern und anderem Ekel oder Furcht einflößenden Ungeziefer ankommt und seine Jungen damit atzen will, einige von den Schlangen aber verliert und diese nun über das Dach in den Hof herabrollen läßt. Doch ist das Vergnügen an der Familie größer als aller Arger, den sie verursacht. Die Jungen sitzen in den ersten Tagen ihres Lebens auf den Fersen, stellen sich später im Neste auf, werden auch von erfahrenen Eltern gegen das Herabfallen durch Anbringung neuer Stäbe und Reiser noch besonders geschützt, lernen bald die Gegend kennen und beweisen, daß ihr Auge von Anfang an vortrefflich ist; denn sie erspähen den mit Futter beladenen Alten, der herbeikommt, schon aus weiter Ferne und begrüßen ihn zuerst durch Gebärden, später durch Schnabelgeklapper, so ungeschickt dasselbe anfänglich auch sein mag. Ihr Wachstum währt mindestens zwei volle Monate. Gegen das Ende dieser Zeit hin beginnen sie ihre Schwingen zu proben, stellen sich auf den Nestrand, schlagen mit den Flügeln und unternehmen endlich das Wagestück, vom Nest aus bis auf den First des Daches zu fliegen. Vermögen sie ihren Fittichen zu vertrauen, so unternehmen sie mit den Alten Spazierflüge, kehren aber anfänglich noch jeden Abend zum Neste zurück, um hier die Nacht zu verbringen. Doch verliert sich diese Anhänglichkeit an die Wiege immer mehr; denn die Zeit naht nunmehr heran, in der alt und jung zur Wanderung ausbricht.
Vor dem Wegzuge versammeln sich alle Storchfamilien einer Gegend auf bestimmten Plätzen, gewöhnlich weichen, sumpfigen Wiesen. Die Anzahl der Zusammenkommenden mehrt sich von Tag zu Tag, und die Versammlungen währen immer länger. Um Jakobi, also zu Ende Juli, pflegen letztere vollzählig zu sein, und bald darauf bricht das ganze Heer zur Reise auf, hebt sich, nachdem es vorher noch lebhaft geklappert, in die Höhe, kreist noch einige Zeitlang über der geliebten Heimat und zieht nun in südwestlicher Richtung rasch seines Weges dahin, wahrscheinlich unterwegs noch andere aufnehmend und sich so mehr und mehr verstärkend. Naumann spricht von Storchflügen, deren Anzahl sich auf zwei- bis fünftausend belaufen mochte, und ich kann ihm nur beistimmen, da diejenigen Scharen, die ich noch im Innern Afrikas während ihres Zuges sah, zuweilen so zahlreich waren, daß sie weite Flächen längs des Stromufers oder in der Steppe buchstäblich bedeckten und, wenn sie aufflogen, den Gesichtskreis erfüllten.
Der Storch gewöhnt sich, namentlich wenn er jung aus dem Nest genommen wurde, leicht an die Gefangenschaft und an einen bestimmten Pfleger, wird so zahm, daß man ihm freies Aus- und Einfliegen gestatten darf, begrüßt seine Bekannten durch Schnabelgeklapper und Ausbreiten der Flugwerkzeuge, erkennt ihm angetane oder zugedachte Wohltaten und Freundlichkeiten dankbar an, befreundet sich ebenso mit größeren Haustieren, läßt sich, schwächeren gegenüber, freilich auch Ausschreitungen zuschulden kommen und kann Kindern gefährlich werden. Hält man ihn paarweise, und gewährt man ihm eine gewisse Freiheit, so schreitet er auch wohl zur Fortpflanzung.
Man hat erfahren, daß der Hausmarder zuweilen junge Störche überfällt und umbringt, kennt aber kein Raubtier, das alten gefährlich sein könnte, die größeren Katzenarten und Krokodile, die in der Winterherberge einen und den andern wegnahmen, vielleicht ausgenommen. Gleichwohl vermehren sich die Störche anscheinend nicht; es müssen also viele von ihnen zugrunde gehen.
*
Die zweite Art der Familie, die Deutschland bewohnt, ist der Schwarzstorch oder Waldstorch ( Ciconia nigra). Seine durchschnittliche Länge beträgt einhundertundfünf, die Breite einhundertachtundneunzig, die Fittichlänge fünfundfünfzig, die Schwanzlänge vierundzwanzig Zentimeter. Das Gefieder des Kopfes, Halses und der ganzen Oberseite ist braunschwarz, prachtvoll kupfer- oder goldgrün und purpurfarben schimmernd, das der Unterseite von der Oberbrust an weiß; die Schwingen und Schwanzfedern sind fast glanzlos. Das Auge ist rötlichbraun, der Schnabel blutrot, der Fuß hoch karminrot. Im Jugendkleide ist das Gefieder bräunlich schwarzgrün, schmutzig weißgrau gesäumt und fast glanzlos, das Auge braun, der Schnabel rötlich, der Fuß graulich olivengrün.
Der Waldstorch bewohnt Mittel- und Süd-, seltener Nordeuropa, viele Länder Asiens und im Winter Afrika. In unserm Vaterlande Heute ist er in den meisten von Brehm genannten Gegenden unseres Vaterlandes ausgerottet. Gegenwärtig kommt er bei uns wohl nur noch in den weiten ostpreußischen Waldungen vor. Herausgeber. brütet er in geeigneten ruhigen Waldungen der Norddeutschen Ebene allerorten, häufig in Ost- und Westpreußen und Pommern, nicht selten in der Mark, in Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig und Hannover, einzeln in Schleswig-Holstein, Anhalt, Sachsen, seltener in Westfalen, Hessen und Thüringen, sehr einzeln auch im südlichen Deutschland; in dem österreichisch-ungarischen Kaiserstaate tritt er besonders häufig in Mittelungarn und Galizien auf; in Skandinavien kommt er einzeln bis zum sechzigsten Grade, in Rußland und Polen hier und da, in Dänemark geeigneten Ortes überall als Brutvogel vor. Bei uns zulande erscheint er gegen Ende März oder im April, bezieht seine alten Nistorte und begibt sich vom August an wieder auf die Reise.
Vom Hausstorch unterscheidet er sich vor allem andern dadurch, daß er seinen Aufenthalt stets in Waldungen, niemals aber in Ortschaften nimmt. Auch er bevorzugt die Ebene dem Gebirge und wasserreiche Gegenden trockenen, kommt jedoch hier wie dort vor, falls er nur über alte, sperrige oder wipfeldürre Bäume eines stillen, wenig von Menschen besuchten Waldes verfügen kann. Auf solchen Bäumen brütet er und auf ihnen hält er Nachtruhe.
Wesen und Betragen, Eigenschaften, Sitten und Gewohnheiten, alle Bewegungen, die Art und Weise, Gefühle auszudrücken, kurz das ganze Gebaren des Schwarzstorches ähnelt dem des menschenliebenden Verwandten so, daß es angängig erscheinen darf, von einer ausführlichen Schilderung abzusehen. Er ist vielleicht ein wenig gewandter und zierlicher, demgemäß auch anmutiger, und bei weitem vorsichtiger und scheuer als der Hausstorch, übrigens aber in seinem Tun und Treiben ihm vollständig gleich. Ebenso räuberisch wie der letztere, verschont auch er nichts Lebendes, was ihm zur Nahrung dienen kann, stellt jedoch weit eifriger und erfolgreicher als jener allen Süßwasserfischen nach und wird besonders deshalb hier und da entschieden schädlich.
*
Gelegentlich meiner Reise auf dem Blauen Nil kamen wir eines Nachmittags zu einer mit Sumpfvögeln der verschiedensten Art bedeckten Sandinsel im Strome. Unter ihnen bemerkten wir auch zwei Stelzvögel, die wir bis dahin noch nicht gesehen hatten und nicht kannten. Sie unterschieden sich von allen übrigen durch ihre prachtvoll schneeweißen, in der Mitte bandartig schwarz gezeichneten Schwingen. Am folgenden Tage fanden wir sie wieder auf und erkannten nunmehr in ihnen Riesenstörche ( Mycteria), wenn auch nicht die stärksten, so doch die höchsten aller Reihervögel.
Der Sattelstorch ( Mycteria senegalensis) ist ein gewaltiger und prachtvoller Vogel. Die Federn des Kopfes und Halses, des Oberflügels, der Schultern und des Schwanzes sind schwarz, metallisch glänzend, die übrigen, einschließlich der Schwingen, blendend weiß. Die Länge des Männchens beträgt einhundertsechsundvierzig, die Breite zweihundertvierzig, die Fittichlänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter. Das Weibchen ist merklich kleiner.
Man muß einen Sattelstorch im Freien, lebend, sich bewegend, fliegend, über dem dunkeln Walde seine Kreise ziehend gesehen haben, um den Eindruck, den der gewaltige Vogel hervorruft, verstehen, um seine volle Schönheit würdigen zu können. Im Gehen hält sich dieser Riese sehr stolz und aufrecht, erscheint aber wegen der langen Beine noch größer, als er wirklich ist. Im Fluge nimmt er sich prachtvoll aus; denn die weißen Schwingen stechen von den schwarzen Deckfedern der Flügel herrlich ab. Leider ist der Sattelstorch unter allen Umständen so scheu und dabei in den von mir bereisten Gebieten so selten, daß ich nicht viel über das Freileben zu sagen weiß. Er lebt paarweise am Weißen und Blauen Nil vom vierzehnten Grade nördlicher Breite an nach Süden hin, findet sich auch im Westen und Süden des Erdteils, bewohnt das Ufer der Ströme, die Sandinseln und die nahe am Ufer gelegenen Seen, Regenteiche und Sümpfe und entfernt sich nur während der Regenzeit zuweilen von der Flußniederung; doch sah man ihn ausnahmsweise auch in seichten Meerbusen. Unter andere Sumpfvögel mischt er sich nicht selten; das Paar bleibt aber stets beisammen.
Jede Bewegung des Sattelstorches, jede Stellung ist zierlich und anmutig, der Schönheit des Gefieders vollkommen entsprechend. Er schreitet mit gemessenen Schritten unhörbar dahin und trägt dabei den Hals sanft gebogen und den Schnabel so nach abwärts gekehrt, daß die untere Lade fast auf den Federn des Halses ruht. Zuweilen steht er hoch aufgerichtet auf einem Bein; oft ruht er auf den eingeknickten Fersen; manchmal legt er sich auch mit doppelt zusammengebogenen Füßen platt auf den Boden. Lustige oder tanzartige Sprünge, wie sie Kraniche ausführen, beobachtet man nicht; doch rennt er gelegentlich einmal mit ausgebreiteten Flügeln im schnellen Laufe dahin. Den ungeheuren Schnabel weiß er mit überraschendem Geschick zu handhaben; er ist imstande, den kleinsten Gegenstand mit der Spitze aufzunehmen, ihn wiederholt hin und her zu drehen und dann, nachdem er ihn vorher aufgeworfen, zu verschlingen, ebenso beim Federputzen einen kleinen Schmarotzer zu fangen und umzubringen. Außerdem benutzt er den Schnabel wie der Storch, um seine Gefühle auszudrücken.
Hinsichtlich der Nahrung wird sich der Sattelstorch wohl wenig von seinen deutschen Verwandten unterscheiden. In dem Magen der von uns getöteten fanden wir Fische, Lurche und Käfer; andere Beobachter lernten den Vogel als Vertilger der Heuschrecken kennen; Rüppels Jäger erlegten einen am Aas, und auch Heuglin erbeutete einen, der sich mit Geiern und Kropfstörchen um die Überreste eines gefallenen Kamels balgte. Fliegende Heuschrecken und andere Kerfe fängt er ebenso geschickt aus der Luft weg, wie er sie vom Boden aufliest. Den Bissen, einen großen, nachdem er ihn vorher kauend gequetscht hat, wirft er vor dem Verschlingen in die Höhe, fängt ihn geschickt auf und läßt ihn in den Schnabel gleiten. Er bedarf etwa ein Kilogramm Fleisch oder das Gleichwertige an Fischen, um sich zu sättigen.
Über die Fortpflanzung wissen wir wenig. Im allgemeinen mag sie dem Brutgeschäft des Storches ähneln. Beide Gatten eines Paares sind sehr zärtlich gegeneinander, begrüßen sich, nach kurzer Trennung, durch Geklapper, schnäbeln sich auch gegenseitig und führen zu ihrer Unterhaltung besondere Tänze auf. Einen Horst, in dem ein Sattelstorch, offenbar brütend, mit eingeknickten Fußwurzeln saß, sah Heuglin mitten in einem unzugänglichen Sumpfwalde auf dem Wipfel einer schirmförmigen Akazie stehen; derselbe war sehr umfangreich, aus dürren Asten und Reisern zusammengefügt und oben platt. Eier, die in Ostafrika eingesammelt wurden, ähneln in Gestalt und Färbung denen des Storches, sind aber bedeutend größer; denn ihr Längsdurchmesser beträgt achtundsiebzig, ihr Querdurchmesser dreiundfünfzig Millimeter.
Gefangene Sattelstörche gelangen neuerdings nicht allzu selten in unsere Tiergärten. Sie halten sich bei Fleisch- und Fischnahrung sehr gut, werden bald ebenso zahm wie irgendein anderer Storch, lernen ihren Pfleger kennen und von andern Leuten unterscheiden, begrüßen ihn durch Schnabelgeklapper, sobald sie seiner ansichtig werden, folgen auch seinem Ruf und gestatten, daß er sie berührt. Um andere Tiere bekümmern sie sich nicht, lassen sich aber auch nichts gefallen und erwerben sich daher bald volle Hochachtung aller Mitbewohner ihrer Gehege. Jede ihrer Bewegungen und Handlungen fesselt; denn ihr Betragen ist ebenso anziehend wie ihre Gestalt.
*
Die häßlichsten aller Störche ( Leptoptilus) werden Kropfstörche genannt, weil ihre Speiseröhre sich am Unterhals zu einem weiten Sack ausdehnt, der zwar wenig Ähnlichkeit mit dem eigentlichen Kropfe hat, aber doch in derselben Weise gebraucht wird. Übrigens kennzeichnen sie sich durch kräftigen, fast ungeschlachten Leib, dicken, nackten Hals, nackten oder höchstens mit wenigen flaumartigen Federn bekleideten, grindigen Kopf, einen ungeheuren, an der Wurzel sehr dicken, vierseitigen, vorn keilförmig zugespitzten, leichten Schnabel, dessen äußere Bekleidung durch ihre Unebenheit und Rauhigkeit auffällt, hohe Beine, gewaltige, abgerundete Flügel und mittellangen Schwanz, dessen untere Deckfedern außerordentlich entwickelt, von der Wurzel an fein zerschlissen sind und prächtige Schmuckfedern abgeben.
Während meines Aufenthaltes in Afrika bin ich mit der dort lebenden Art, dem Marabu ( Leptoptilus crumenifer), »Abu Sëin« oder Vater des Schlauches der Araber, bekannt geworden. Sein Kopf ist rötlich fleischfarben, nur spärlich mit kurzen, haarigen Federn bekleidet, die Haut in der Regel grindig, der Hals nackt. Das Gefieder ist auf dem Mantel dunkelgrün, metallisch glänzend, auf der ganzen Unterseite und im Nacken weiß; die Schwingen und Steuerfedern sind schwarz und glanzlos, die großen Deckfedern der Flügel auf der Außenfahne weiß gerandet. Der Schnabel ist schmutzigweißgelb, der Fuß schwarz, in der Regel aber mit Kot weiß übertüncht. Die Länge beträgt einhundertsechzig, die Breite dreihundert, die Fittichlänge dreiundsiebzig, die Schwanzlänge vierundzwanzig Zentimeter.

Marabu ( Leptoptilus crumeniferus)
In den von mir durchreisten Ländern begegnet man dem Marabu zuerst ungefähr unter dem fünfzehnten Grade nördlicher Breite, von hier aus aber nicht selten längs der beiden Hauptströme des Landes und regelmäßig in der Nähe aller größeren Ortschaften, in denen Markt gehalten und wenigstens an gewissen Tagen in der Woche Vieh geschlachtet wird. In den nördlichen Teilen seines Verbreitungsgebietes erscheint er nach der Brutzeit im Mai und zieht im September und Oktober wieder weg, den weiter unten im Süden gelegenen Waldungen zu, um daselbst zu brüten. Schon im Dezember scheint er das Fortpflanzungsgeschäft beendigt zu haben; wenigstens bemerkten wir um die Mitte dieses Monats an einer größeren Lache eine ganz ungewöhnliche Anzahl der gefräßigen Vögel. Das Nest habe ich nie gefunden, auch von den Eingeborenen nichts Sicheres darüber erfahren können. Der einzige Reisende, der es gesehen hat, Livingstone, berichtet auch nur, daß es auf dem Seitenaste eines Affenbrotbaumes erbaut gewesen sei, aus einem Haufen von dürren Asten bestanden und Junge enthalten habe, die beim Ab- und Zufliegen der Alten ein unangenehmes »Tschuk tschuk« vernehmen ließen.
Im Sudan habe ich den Marabu sehr oft, bei Khartum tagtäglich beobachtet. Ganz abgesehen von seiner Größe fällt er auch durch seinen sonderbaren Anstand aus. In den Tiergärten erwirbt er sich regelmäßig einen Spitznamen: man nennt ihn den »Geheimen Rat«; er erinnert, wie Vierthaler sagt, aber auch wirklich an einen durch vieljährige Dienste krumm gebückten, in schwarzblauen Frack und enge, weiße Beinkleider eingezwängten Hofmann mit feuerroter Perücke, der sich scheu und ängstlich fortwährend nach dem strengen Gebieter umschaut, der gnädigsten Befehle harrend; er erinnert, füge ich hinzu, an einen ungeschickten Menschen, der zum ersten Male in einen Frack gesteckt wird und dieses Kleidungsstück nicht mit dem nötigen Anstande trägt. Das Benehmen des Marabu steht mit seiner Gestalt und Haltung, die unwillkürlich zum Lachen herausfordern, im Einklang. In jeder seiner Bewegungen spricht sich unverwüstliche Ruhe aus. Sein Gang, ja jeder Schritt, jeder Blick scheint berechnet, genau abgemessen zu sein. Wenn er sich verfolgt wähnt, schaut er sich ernsthaft um, mißt die Entfernung zwischen sich und seinem Feinde und regelt nach ihr seine Schritte. Geht der Jäger langsam, so tut er es ebenfalls, beschleunigt jener seine Schritte, so schreitet auch er weiter aus, bleibt jener stehen, so tut er es auch. Bei meiner Ankunft in Khartum lebte er mit den Metzgern, die in einem vor der Stadt liegenden Schlachthause ihr Handwerk trieben, im besten Einvernehmen, fand sich ohne Furcht vor dem Hause oder in ihm selbst ein, erbettelte sich die Abfälle oder belästigte die Leute so lange, bis sie ihm etwas zuwarfen. Der Flug ist wahrhaft prachtvoll, majestätisch, dem der Geier ähnlicher als dem unseres Storches; der Hals wird dabei ausgestreckt, aber, vielleicht des schweren Schnabels wegen, etwas nach unten gesenkt, die Flügelspitzen, wie bei einzelnen Geiern und Adlern, etwas in die Höhe gehoben, der Flügel überhaupt selten bewegt.
Wahrscheinlich gibt es keinen Vogel, der an Gefräßigkeit dem Marabu gleichkäme. Seine natürliche Nahrung besteht in allen denkbaren Wirbeltieren, von der Größe einer Ratte oder eines jungen Krokodils an bis zur kleinsten Maus herab; er frißt jedoch auch Muscheln, Spinnentiere, Kerfe und mit Vorliebe Aas. Wir zogen aus seinem Kropf ganze Rinderohren und ganze Rinderbeine samt den Hufen hervor, auch Knochen von einer Größe, daß sie ein anderer Vogel gar nicht hätte verschlingen können, beobachteten, daß er blutgetränkte Erde oder blutbefleckte Fetzen hinunterschlang, bemerkten wiederholt, daß flügellahm Geschossene im Laufen gleich noch einen guten Bissen aufnahmen. Einmal sah ich zehn bis zwölf Marabus im Weißen Fluß Fische fangen. Sie besitzen darin viel Geschicklichkeit, schließen einen Kreis und treiben sich Fische gegenseitig zu. Einer von ihnen hatte das Glück, einen großen Fisch zu erhaschen, der alsbald hinabgewürgt, einstweilen aber noch im Kropfsack aufbewahrt wurde. Der Fisch zappelte in dem Kropf herum und dehnte ihn fußlang aus. Sofort stürzten sich alle Marabus auf den glücklichen Fänger los und schnappten so ernstlich nach dessen Kropf, daß er sich genötigt sah, die Flucht zu ergreifen, um den Fangversuchen ein Ziel zu setzen. Mit Geiern und Hunden liegt der Marabu stets im Streit. Er fällt mit den Geiern regelmäßig auf das Aas und weiß seinen Platz zu behaupten. Ein Ohrengeier, der die Speise zerreißen, namentlich die Höhlen aufbrechen muß, steht seinen Mann; aber den Marabu vertreibt er nicht; denn dieser weiß sich zu verteidigen und teilt mit seinem Keilschnabel nach rechts und links so kräftige Hiebe aus, daß er sich unter allen Umständen seinen Anteil sichert.
Die Jagd bleibt stets schwierig, weil die außerordentliche Scheu der Vögel dem Jäger sein Handwerk verleidet. Nicht einmal auf den Schlafplätzen kann man mit Sicherheit darauf rechnen, diese klugen Vögel zu überlisten. Einige, die wir beunruhigt hatten, flogen während der ganzen Nacht über den Schlafbäumen hin und her, ohne sich wieder zu setzen, und diejenigen, die bei den Schlachthäusern einmal geängstigt wurden, konnten uns Jäger zur Verzweiflung bringen. Leichter noch gelingt der Fang, wenn auch bloß den Eingeborenen, an die die Marabus gewöhnt sind. Man bindet ein Schafbein an einen dünnen, aber festen, langen Faden und wirft es unter die übrigen Abfälle. Der Marabu schlingt es hinab und wird wie an einer Angel gefangen, noch ehe er Zeit hat, den eingewürgten Knochen wieder von sich zu geben.
Auf diese Weise gelangten mehrere Kropfstörche in meinen Besitz, und ich habe die gefangenen, trotz ihrer ungeheuren Gefräßigkeit, stets gern gehalten, weil sie bald ungemein zahm und zutraulich wurden. Wenn wir Vögel abbalgten, standen sie ernsthaft zuschauend nebenan und lauerten auf jeden Bissen, der ihnen zugeworfen wurde, fingen denselben höchst geschickt, beinahe unfehlbar aus der Luft und zeigten sich gegen den Pfleger sehr dankbar. Der erste, den ich besaß, kam mir entgegen, nickte mit dem Kopf, klapperte wie ein Storch laut mit dem Schnabel, um mir seine Freude auszudrücken, und umtanzte mich unter den lustigsten Gebärden. Seine Anhänglichkeit verlor sich übrigens zum Teil, nachdem er einen Gefährten erhalten hatte, und als ich ihn nach einer zweimonatlichen Reise wiedersah, kannte er mich nicht mehr. In unsern Tiergärten fehlt der Marabu nicht, weil er mehr als jeder andere Vogel seiner Größe als Schaustück gilt. Man darf ihn unter allerlei Geflügel halten, ohne für dasselbe besorgt sein zu müssen; denn er erwirbt sich nämlich schon in den ersten Tagen eine so unbedingte Oberherrschaft auf dem Futterplatze, daß groß und klein sich vorsichtig vor ihm zurückzieht und ihn seinen Hunger zuerst stillen läßt. Hat er jedoch einmal gefressen, dann ist er das gutmütigste Vieh unter der Sonne und fängt, ungereizt, mit keinem andern Geschöpf Händel an. Aber man darf den kräftigen Vogel auch mit andern, gefährlicheren Tieren zusammenbringen, ohne für ihn fürchten zu müssen. Ein zahmer Marabu, der auf unserm Hof in Khartum umherlief, hatte sich in kürzester Zeit die Achtung aller übrigen Tiere zu erringen gewußt und überzeugte sogar unsere junge, necklustige Löwin, die aus reinem Übermut einen Angriff auf ihn versuchte, daß mit ihm nicht zu spaßen. Unmittelbar nach geschehenem Angriff drehte er sich gegen die Löwin, schritt mutig aus sie zu und versetzte ihr mit dem gewaltigen Keilschnabel so fühlbare Hiebe, daß Bachida für gut fand, eiligst den Rückzug anzutreten, und schließlich, verfolgt von dem kühnen Vogel, an einer Wand emporkletterte, um sich nur zu retten.
Der Leib der Reiher ( Ardeidae) ist auffallend schwach, seitlich ungemein zusammengedrückt, der Hals sehr lang und dünn, der Kopf klein, schmal und flach, der Schnabel in der Regel länger als der Kopf, mindestens ebenso lang, ziemlich stark, gerade, seitlich sehr zusammengedrückt, auf Firste und Kiel schmal, an den etwas eingezogenen Mundkanten schneidend scharf, nächst der Spitze gezähnelt, mit Ausnahme der Nasengegend mit glatter, harter Hornmasse bekleidet, das Kleingefieder sehr reich, weich und locker, am Scheitel, auf dem Rücken und an der Oberbrust oft verlängert, teilweise auch zerschlissen, seine Färbung eine sehr verschiedenartige und nicht selten ansprechende, obgleich eigentliche Prachtfarben nicht vorkommen. Die Geschlechter unterscheiden sich äußerlich höchstens durch die etwas verschiedene Größe; die Jungen tragen ein von dem der Alten abweichendes, minder schönes Gefieder.
Die Reiher bewohnen alle Erdteile, alle Gürtel der Höhe und mit Ausnahme der hochnordischen alle Länder. Schon innerhalb des gemäßigten Gürtels treten sie zahlreich auf, in den Wendekreisländern bilden sie den Hauptbestandteil der Bevölkerung der Sümpfe und Gewässer. Einige Arten scheinen das Meer zu bevorzugen, andere halten sich an Flüssen, wieder andere in Sümpfen auf; einige lieben freiere Gegenden, andere Walddickichte oder Wälder überhaupt.
Das Wesen der Reiher ist nicht bestechend. Sie verstehen es, die wunderbarsten Stellungen anzunehmen; keine einzige von diesen aber kann anmutig genannt werden; sie sind ziemlich bewegungsfähig; jede ihrer Bewegungen aber hat, mit der anderer Reihervögel verglichen, etwas Schwerfälliges. Ihr Gang ist gemächlich, langsam und bedächtig, ihr Flug keineswegs ungeschickt, aber einförmig und schlaff. Ihre Stimme ist ein unangenehmes Gekreisch oder ein lautes, weithin schallendes Gebrüll, das manchem Menschen unheimlich dünkt, die Stimme der Jungen ein widerwärtiges Gebelfer. Unter den Sinnen steht unzweifelhaft das Gesicht obenan. Ihre Beute besteht vorzugsweise in Fischen; die kleineren Arten sind der Hauptsache nach Kerbtierfresser; aber weder diese noch die größten verschmähen irgendein anderes Tier, das sie erreichen können. Sie verzehren kleine Säugetiere, junge und unbehilfliche Vögel, Lurche verschiedener Art, vielleicht mit Ausnahme der Kröten, und ebenso Weichtiere und Würmer, vielleicht auch Krebse. Lautlos und höchst bedächtig, beutegierig das Wasser durchspähend, schleichen sie, den langen Hals so tief eingezogen, daß der Kopf aus den Schultern, die untere Schnabellade auf dem vorgebogenen Halse ruht, watend dahin; blitzschnell streckt sich der Hals plötzlich zu seiner ganzen Länge aus, und wie eine geschleuderte Lanze fährt der Schnabel auf die meist unrettbar verlorene Beute.
Alle Reiher nisten gern in Gesellschaft von ihresgleichen, verwandter und nicht verwandter Vogelarten. Ihre Nester, große, roh zusammengefügte Bauten, stehen entweder auf oder im Röhricht auf zusammengeknickten Stengeln. Das Gelege enthält drei bis sechs ungefleckte, weißgrünliche oder blaugrünliche Eier. Nur das Weibchen brütet, wird aber inzwischen vom Männchen mit Nahrung versorgt. Die Jungen verweilen bis zum Flüggewerden oder doch fast bis zu dieser Zeit im Nest, werden nach dem Ausflattern noch eine Zeitlang geatzt, hierauf aber ihrem Schicksal überlassen.
Gut besetzte Reiheransiedlungen gewähren ein großartiges Schauspiel. »Es ist«, so ungefähr schildert Baldamus, »Anfang Juni; die Rohre haben eine Höhe von reichlich zwei Meter erreicht und überdecken den trüben Wasserspiegel des weißen Morastes. Soweit das Auge reicht, schweift es über die Ebene, ohne einen Ruheplatz zu finden. Aber auf dem endlosen Grün und Blau stechen wundervolle, gelbe, graue, weiße und schwarze Gestalten prachtvoll ab: Silber-, Purpur-, Schopf- und Nachtreiher, Löffler, Ibisse, Scharben, Seeschwalben, Möwen, Gänse und Pelikane. Auf den Bruchweiden und Pappeln, die sich hier und da erheben, nisten die ersteren. Eine ihrer Ansiedlungen hat höchstens einen Umfang von einigen tausend Schritten, und die Nester sind nur auf hundert bis hundertfünfzig Weiden zerstreut; aber viele dieser Bäume tragen zehn bis zwanzig Nester. Auf stärkeren Asten der größeren Weiden stehen die Nester des Fischreihers, daneben, oft auf deren Rand ruhend, die des Nachtreihers; schwächere und höhere Zweige tragen jene des Seidenreihers und der Zwergscharbe, während tiefer unten auf den schlanken Seitenzweigen die kleinen, durchsichtigen Nester des Rallenreihers schwanken. Auf dem in Rede stehenden Horstplatze ist, wie gewöhnlich, der Nachtreiher am zahlreichsten vertreten, auf ihn folgt der Seidenreiher, der Fischreiher und endlich der Rallenreiher. Mit Ausnahme der Zwergscharbe sind alle so wenig scheu, daß wochenlang fortgesetztes Schießen sie nicht vom Platze vertrieben hat. Sie fliegen zwar nach einem Schuß ab, bäumen aber bald wieder auf, ja sie bleiben oft genug auf demselben Baum sitzen, der eben bestiegen wird. Hält man sich eine kurze Zeit in dem Kahn unter den Bäumen, so beginnt bald das bunteste Treiben, und es folgen sich so überraschende und wechselvolle Auftritte, daß man nicht müde wird, dem nie gehabten Schauspiel zuzusehen. Zuerst klettern die Nachtreiher unter lebhaftem Geschrei und unter sonderbaren Grimassen von den oberen Zweigen auf ihre Nester herab, haben dies und jenes daran zurechtzuzupfen, die Eier anders zu schieben, sich nach allen Seiten hin umzudrehen und den großen, roten Rachen gegen einen allzu nahe kommenden Nachbar unter heiserem Gekrächze weit aufzusperren; dann kommen die kleinen Silberreiher im leisen Fluge, dieser ein trockenes Reis zum Neste tragend, jener behend von Zweig zu Zweig nach seinem Horst steigend, dazwischen in leichtem, eulenartigem Fluge die herrlichen gelben Gestalten der Schopfreiher; zuletzt nahen sich etwas vorsichtiger die Fischreiher. Das ist ein Lärm, ein Schreien, Ächzen, Knarren und Knurren durcheinander, ein Gewimmel von schneeweißen, gelben, grauen und schwarzen Irrwischen auf dem lichtblauen Grunde, daß Ohr und Auge verwirren und ermatten. Endlich wird es ruhiger; der Lärm nimmt ab. Die große Mehrzahl der Vögel sitzt brütend auf oder wachend neben dem Nest, nur einzelne fliegen, Neststoffe herbeitragend, ab und zu. Da fällt es plötzlich einem sich langweilenden Nachtreiher ein, irgendein Reis von dem Nest seines Nachbars für das seinige passend zu finden, und das Geschrei, das eben etwas verstummt war, beginnt von neuem. Wieder ein Piano; denn eigentliche Pausen gibt es da nicht. Woher nun jetzt das schreckliche Fortissimo? Sich da, ein Milan, der fünfzig Schritte davon seinen Horst hat, nimmt mit aller Ruhe in jeden seiner Fänge einen jungen Fischreiher. Der Alte geht murrend und drohend vom Horst, läßt den Räuber aber ruhig mit seinen Kindern davonziehen, während nur ein Versuch, seine gefährliche Waffe und seine Kraft anzuwenden, dieser und ähnlicher Schmarotzer Tod werden müßte. Einige Nachtreiher begleiten schreiend den unberufenen Friedensstörer; aber plötzlich ruft sie ein neues, stärkeres Geschrei zurück. Eine Elster hier, eine Nebelkrähe dort, hat sich die Entfernung zunutze gemacht, um einige Eier fortzutragen. Die Nachbarn der Beraubten erheben sich unter entsetzlichem Geschrei, während andere desselben Diebsgesindels über die eben verlassenen Nester herfallen und blitzschnell mit ihrer Beute davoneilen. Noch tönt das verworrene Angst- und Rachegeschrei; da rauscht es in der Luft und gebietet lautlose Stille. Der gewaltige König der Lüfte, ein mächtiger Aar, zog vorbei, hinüber nach jenem unzugänglichen Rohrdickicht, wo das laute Geschnatter der Gänse und Enten ebenso plötzlich verstummt. Drüben am Wiesenrande fällt ein Schuß, und die ganze Siedlung, bis auf die Nachtreiher, erhebt sich und mischt sich mit den Tausenden, die dort, aus dem seichten Wasser aufgeschreckt, flüchtig umherkreisen und sich endlich wieder niederlassen.«
In Deutschland verfolgt man die Reiher in allen Orten eifrig, da sie in unsern Gewässern mehr schaden als jeder andere tierische Fischjäger. Da, wo sich ein Reiherstand befindet, ist es üblich, alljährlich ein sogenanntes Reiherschießen anzustellen, bei dem so viele Reiher getötet werden, als man töten kann. Die Jagd ist übrigens auch nur in der Nähe dieser Reiherstände ergiebig, da die Scheu und Vorsicht der alten Reiher Nachstellungen gewöhnlich zu vereiteln weiß.
Der Fischreiher oder Reigel ( Ardea cinerea) ist auf der Stirn und dem Oberkopf weiß, auf dem Halse grauweiß, auf dem Rücken aschgrau, durch die verlängerten Federn bandartig weiß gezeichnet, auf den Seiten des Unterkörpers schwarz; ein Streifen, der vom Auge beginnt und nach dem Hinterhalse läuft, drei lange Schopffedern, eine dreifache Fleckenreihe am Vorderhalse und die großen Schwingen sind schwarz, die Oberarmschwingen und Steuerfedern grau. Das Auge ist goldgelb, die nackte Stelle im Gesicht grüngelb, der Schnabel strohgelb, der Fuß bräunlichschwarz. Die Länge beträgt einhundert bis einhundertsechs, die Breite einhundertsiebzig bis einhundertachtzig, die Fittichlänge durchschnittlich siebenundvierzig, die Schwanzlänge neunzehn Zentimeter. Der junge Vogel sieht grauer aus als der alte und trägt auch keinen Federbusch.
Nach Norden hin reicht der Verbreitungskreis des Fischreihers bis zum vierundsechzigsten Grade; nach Süden hin kommt er fast in allen Ländern der Alten Welt vor, und zwar nicht bloß als Zug-, sondern auch als Brutvogel. Ich habe ihn noch tief im Innern Afrikas angetroffen; andere Forscher fanden ihn im Westen und Süden Afrikas. In Indien ist er gemein, und von hier aus streift er gewiß bis auf eine oder die andere Insel von Ozeanien hinüber. Im Norden ist er Zug-, im Süden wenigstens Strichvogel. Von Deutschland aus wandert er im September und Oktober weg und reist gemächlich den großen Strömen entlang, erscheint im Oktober überall in Südeuropa und fliegt endlich nach Afrika hinüber. Im März und April kehrt er zurück. Auf der Wanderschaft schließt sich einer dem andern an, und so bilden sich zuweilen Gesellschaften, die bis fünfzig Stück zählen. Sie reisen stets bei Tage, aber in hoher Luft langsam dahinfliegend und in der Regel eine schräge Linie bildend. Heftiger Wind macht ihre Wanderung unmöglich; Mondschein bewegt sie zuweilen, des Nachts zu reisen.
Derselben Untersippe gehört der Purpurreiher ( Ardea purpurea) an. Oberkopf und Schopffedern, ein vom Schnabel zum Hinterkopf sowie ein auf jeder Halsseite verlaufender Streifen sind schwarz, Kopf- und Halsseiten, die flatternden Schulterfedern und die Schenkel zimtrotbraun, Kinn und Kehle weiß, die flatternden Vorderhalsfedern rostfahlweiß, schwarz geschaftet, Hinterhals und Nacken aschgrau, die übrigen Oberteile dunkelgraubraun, grünlich schimmernd, die Flügeldeckfedern heller, Brust-, Bauch- und Schenkelseiten dunkelpurpurbraunrot, die übrigen Unterteile schwarz, die Schwingen schwarz, die Schwanzfedern graubraun. Beim jungen Vogel ist das Gefieder vorherrschend rostrot, unterseits fahlweiß gesäumt. Die Länge beträgt durchschnittlich neunzig, die Breite einhundertdreißig, die Fittichlänge sechsunddreißig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Das Verbreitungsgebiet dieses in Deutschland seltenen Reihers umfaßt Mittel-, Süd-, Ost- und Westeuropa, den größten Teil Mittel- und Südasiens und Afrika. In Holland, Ungarn, Galizien sowie den Ländern ums Mittelländische, Schwarze und Kaspische Meer ist er Brutvogel.
Alle Reiher ähneln in ihrem Tun und Treiben dem Fischreiher so, daß ich mich auf dessen Lebensschilderung beschränken darf. Gewässer aller Art, vom Meer an bis zum Gebirgsbach, bilden seinen Aufenthaltsort und sein Jagdgebiet; denn die einzige Bedingung, die er an das Gewässer zu stellen hat, ist Seichtigkeit. Er besucht die kleinsten Feldteiche, Wassergräben und Lachen, ebenso, wenigstens in der Winterherberge, seichte Meerbusen und Küstengewässer, bevorzugt jedoch Gewässer, in deren Nähe es Waldungen oder wenigstens hohe Bäume gibt; auf letzteren pflegt er der Ruhe. An Scheu und Furchtsamkeit übertrifft er alle andern Arten, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ihm am eifrigsten nachgestellt wird. Jeder Donnerschlag entsetzt ihn, jeder Mensch, den er von ferne sieht, flößt ihm Bedenken ein. Die Stimme ist ein kreischendes »Kräik«, der Warnungslaut ein kurzes »Ka«.
Die Nahrung besteht aus Fischen bis zu zwanzig Zentimeter Länge, Fröschen, Schlangen, insbesondere Nattern, jungen Sumpf- und Wasservögeln, Mäusen, Kerbtieren, die im Wasser leben, Muscheln und Regenwürmern. »Angelangt am Teiche«, schildert Naumann, »gehen die Reiher gewöhnlich sogleich ins seichte Wasser und beginnen ihre Fischerei. Den Hals niedergebogen, den Schnabel gesenkt, den spähenden Blick auf das Wasser geheftet, schleichen sie in abgemessenen, sehr langsamen Schritten und so behutsam und leisen Trittes, daß man nicht das geringste Plumpen oder Plätschern hört, im Wasser und in einer solchen Entfernung vom Uferrande entlang, daß ihnen das Wasser kaum bis an die Fersen reicht. So umkreisen sie, schleichend und suchend, nach und nach den ganzen Teich, werfen alle Augenblicke den zusammengelegten Hals wie eine Schnellfeder vor, so daß bald nur der Schnabel allein, bald auch noch der ganze Kopf dazu unter die Wasserfläche und wieder zurückfährt, fangen fast immer einen Fisch, verschlucken ihn sogleich oder bringen ihn zuvor im Schnabel in eine verschluckbare Lage, den Kopf nach vorn, und verschlingen ihn dann. Wenn der erzielte Fisch zu tief im Wasser gestanden hat, fährt der Reiher mit dem ganzen Halse hinunter, wobei er, um das Gleichgewicht zu behalten, jedesmal die Flügel etwas öffnet und mit deren Vorderteilen das Wasser so stark berührt, daß es plumpt. Frösche, Froschlarven und Wasserkerfe sucht er ebenfalls schleichend auf. Die ersteren verursachen ihm, wenn sie etwas groß find, viele Mühe; er sticht sie mit dem Schnabel, wirft sie weg, fängt sie wieder auf, gibt ihnen Kniffe usw., bis sie halb tot mit dem Kopfe vorn hinabgeschlungen werden.«
Der Fischreiher brütet auch in Deutschland gern in Gesellschaft und bildet hier und da Ansiedlungen oder Reiherstände, Solche finden sich bei uns gegenwärtig z.+B. noch aus einigen einsamen Inseln in den großen masurischen Seen. Herausgeber die fünfzehn bis hundert und mehr Nester zählen und ungeachtet aller Verfolgungen jährlich wieder bezogen werden, selbst wenn die Brutvögel vom nächsten Wasser aus zehn Kilometer und weiter fliegen müssen, um sie zu erreichen. In der Nähe der Seeküsten gesellt sich die Scharbe regelmäßig zu den Reihern, wahrscheinlich weil es ihr bequem ist, deren Horst zu benutzen. Bäume und Boden werden vom Kote der Vögel weiß übertüncht, alles Laub verdorben; faulende Fische verpesten die Luft; kurz, es gibt hier, wie Naumann sagt, »der Unfläterei und des Gestankes viel«. Im April erscheinen die alten Reiher an den Nestern, bessern sie, soweit wie nötig, aus und beginnen hierauf zu legen. Der Horst ist etwa einen Meter breit, flach und kunstlos aus dürren Stöcken, Reisern, Rohrstengeln, Schilfblättern, Stroh zusammengebaut, die seichte Mulde mit Borsten, Haaren, Wolle, Federn nachlässig ausgelegt. Die drei bis vier, durchschnittlich sechzig Millimeter langen, dreiundvierzig Millimeter dicken stark- und glattschaligen Eier sehen grün aus. Nach dreiwöchentlicher Bebrütung entschlüpfen die Jungen, unbehilfliche und häßliche Geschöpfe, die von einem beständigen Heißhunger geplagt zu sein scheinen, unglaublich viel fressen, einen großen Teil ihrer Nahrung vor lauter Gier über den Rand des Nestes herabwerfen, länger als vier Wochen im Horste verweilen, aus das warnende »Ka« ihrer Eltern sich drücken, sonst oft aufrecht stehen und endlich, nachdem sie völlig flügge geworden sind, sich entfernen. Die Eltern unterrichten sie noch einige Tage und überlassen sie dann ihrem Schicksal; alt und jung zerstreut sich, und der Reiherstand verödet.
Edelfalken und große Eulen, auch wohl einzelne Adler, greifen die Alten an, schwächere Falken, Raben und Krähen plündern die Nester. »Auffallend«, sagt Baldamus, »ist die wirklich lächerliche Furcht dieser mit so gefährlicher Waffe ausgerüsteten Reiher vor allen Raubvögeln, und selbst vor Krähen und Elstern. Die Räuber scheinen das auch zu wissen; denn sie plündern jene Ansiedelungen mit einer großartigen Unverschämtheit, holen die Eier und Jungen mitten aus dem dichtesten Schwarme heraus, ohne daß sie mehr als gräßliches Schreien, furchtsames Zurückweichen, einen weit aufgesperrten Rachen und höchstens einen matten Flügelschlag zu erwarten haben. Wohl aber habe ich gesehen, daß ein ziemlich erwachsener junger Reiher mit gesträubtem Gefieder und aufgeblasener Kehle nach einer Elster stieß, die ein auf den Rand seines Nestes gestütztes Nachtreihernest plünderte. Auch gegen den Menschen setzen sich solche junge Reiher fauchend und stechend zur Wehr, aber nur dann, wenn sie, auf den äußersten Rand ihres Nestes gedrängt, zur Verzweiflung getrieben sind.«
Die Reiherbeize, die früher in ganz Europa üblich war, ist gegenwärtig nur noch bei den Asiaten, beispielsweise in Indien, und ebenso bei einigen Stämmen der Araber in Nordafrika im Schwange. Sowie der Reiher den Falken auf sich zukommen sah, spie er zunächst die eben gefangene Nahrung aus, um sich zu erleichtern, und stieg nun so eilig wie möglich hoch zum Himmel empor, wurde aber freilich vom Falken sehr bald überholt und nunmehr von oben angegriffen. Dabei hatte sich dieser sehr in acht zu nehmen, weil der Reiher stets den spitzigen Schnabel zur Abwehr bereit hielt. Konnte der Falke Man vergleiche hierzu auch die Schilderung der Falkenbeize. Herausgeber sein Opfer packen, so stürzten beide wirbelnd zum Boden herab. Hatte er es mit einem erfahrenen Reiher zu tun, so währte die Jagd länger; schließlich aber kam der Reiher doch auch hernieder, weil er vor Ermüdung nicht länger fliegen konnte. Die wunderbaren Schwenkungen, das Steigen und Herabstürzen, die Angriffe und die Abwehr beider Vögel gewährte ein prachtvolles Schauspiel. Hielt der Jäger den Reiher in der Hand, so begnügte er sich in der Regel, ihm die Schmuckfedern auszuziehen, oder nahm ihn mit nach Hause, um junge Falken an ihm zu üben. Nicht selten legte man dem Reiher einen Metallring mit Namen des Fängers und der Tagesangabe des Fanges um die Ständer und ließ ihn hierauf wieder fliegen. So soll derselbe Reiher wiederholt gebeizt worden sein und man erfahren haben, daß der Vogel ein Alter von fünfzig und mehr Jahren erreicht.
Gefangene lassen sich mit Fischen, Fröschen und Mäusen leicht aufziehen, dürfen aber nicht mit anderm Hausgeflügel zusammen gehalten werden, da sie Küchlein und junge Enten ohne weiteres wegnehmen und verzehren.
*
Schlanker Leib und Gliederbau, insbesondere der lange Hals und der verhältnismäßig schwache Schnabel, endlich auch die langen, weitstrahligen Rückenfedern und das blendendweiße Gefieder kennzeichnet die Sippe der Schmuckreiher ( Egretta), die am würdigsten durch den Edel- oder Silberreiher ( Egretta alba) vertreten wird. Das Gefieder dieses Prachtvogels ist rein und blendendweiß, das Auge gelb, der Schnabel dunkelgelb, die nackte Wangenhaut grünlichgelb, der Fuß dunkelgrau. Die Länge beträgt einhundertvier, die Breite einhundertneunzig, die Fittichlänge fünfundfünfzig, die Schwanzlänge zwanzig Zentimeter. Den jungen Vögeln fehlen die Schmuckfedern. Der Edelreiher bewohnt Südeuropa, zumal Südosteuropa, Mittel- und Südosten, Afrika und Australien. In Deutschland zählt er zu den seltenen Erscheinungen, hat aber erwiesenermaßen hier gebrütet; in den Donautiefländern ist er bereits sehr zusammengeschmolzen, in Griechenland, Italien, Spanien auch nicht häufig; in namhafter Anzahl dagegen tritt er noch in den Ländern um das Kaspische Meer und in Nordafrika auf.

Edel- oder Silberreiher ( Egretta alba)
Der Seidenreiher ( Egretta garzetta) ähnelt dem Edelreiher in Ansehen und Wesen, ist aber bedeutend kleiner; seine Länge beträgt nur zweiundsechzig, die Breite einhundertundzehn, die Fittichlänge zweiunddreißig, die Schwanzlänge elf Zentimeter. Das Gefieder ist ebenfalls reinweiß. Hinsichtlich seiner Verbreitung stimmt der Seidenreiher mit seinem edleren Verwandten überein, tritt aber überall häufiger auf als dieser.
Der Edelreiher bevölkert, wie der Fischreiher, Gewässer verschiedener Art, am liebsten jedoch ausgedehnte Sümpfe und in ihnen stets diejenigen Stellen, die möglichst ruhig und von dem menschlichen Treiben abgelegen sind; denn er gehört überall zu den vorsichtigen und da, wo er Verfolgungen erfährt, zu den scheuesten Vögeln. Er ist, wie Naumann treffend bemerkt, ein durch Zierlichkeit und hohe Einfachheit seines Gefieders ausgezeichneter, die andern weißen Reiher durch seine ansehnliche Größe überstrahlender, herrlicher Vogel. Vom Fischreiher unterscheidet er sich im Stehen, Gehen und Fliegen. Auch er nimmt höchst sonderbare Stellungen an, verbirgt z.+B. Kopf und Hals und eines seiner Beine derart im Gefieder, daß man von diesen Gliedern nicht das geringste bemerkt, sondern nur einen umgestürzten Kegel zu sehen vermeint, der auf einer dünnen Stütze ruht; aber so sonderbar auch diese Stellung sein mag, anmutiger als die des Fischreihers erscheint sie immer noch. Der Gang ist, meines Erachtens nach, wenn auch nicht leichter, so doch würdevoller als der des Fischreihers, der Flug entschieden schöner, schon weil der Vogel fliegend viel schlanker und jede Bewegung kräftiger, rascher erscheint als bei jenem.
Der Edelreiher brütet in Ungarn regelmäßig in den ungeheueren Rohrwaldungen der Sümpfe, ohne jedoch Bäume zu meiden. Baldamus, der zur Brutzeit die Donautiefländer besuchte, entdeckte seine Horste in dem Rohrwalde des Weißen Morastes. »Ich stieg«, so erzählt er, »auf eine der mitten im Moraste liegenden Fischerhütten, feuerte nach der bezeichneten Gegend einen Schuß ab, und siehe, es erhoben sich aus dem urwäldlichen Rohrdickichte eine Anzahl von zwölf bis dreizehn Edelreihern, um sich alsbald an demselben Ort wieder niederzulassen. Die Richtung wurde nun bezeichnet und die nötige Zubereitung zum Eindringen getroffen. Zwei ziemlich große Schinakel wurden mit je drei Mann besetzt, Nahrungsmittel für zwei Tage eingepackt, und, nachdem die beiden walachischen Führer vom Leben Abschied genommen, setzten wir uns andern Tages früh vier Uhr in Bewegung. Obwohl von der Mühseligkeit des Unternehmens im voraus überzeugt, hatten doch sowohl die beiden braven Jäger wie wir selbst keine Vorstellung von der Gefahr, aus diesem einförmigen und schrecklichen Durcheinander von altem und neuem, mehr als zwei bis drei Meter hohem Rohre, von über und unter dem bis anderthalb Meter tiefen Wasser befindlichen Storzeln und bodenlosem Schlamm jemals wieder herauszukommen, und gestehen muß ich, daß dieser Tag der beschwerdenreichste meines Lebens ist, daß wir ohne die ausdauerndsten und allseitigsten Anstrengungen schwerlich zum Ziele und wieder ans Land gekommen sein würden. Wir fanden am dreiundzwanzigsten Juni, nachdem wir an einigen Purpurreihernestern vorübergekommen, fünf Horste der Edelreiher mit je drei und vier Eiern. Die Horste ruhen auf Rohrstengeln und Storzeln, die aus ziemlichem Umkreise zusammengezogen und umgeknickt wurden, sind aus einem starken Haufen von gleichen Stoffen erbaut, innen mit Rohrblättern ausgelegt und sowohl infolge der Menge der umgeknickten Rohrstengel, wie infolge der Masse der aufgehängten Neststoffe so fest, daß ich mehrere derselben besteigen konnte. Die Anzahl der Eier scheint zwischen drei und vier zu schwanken; fünf fanden sich nirgends. Das Hauptkennzeichen derselben ist das Korn; denn die Größe gibt ebensowenig wie die Gestalt ein untrügliches Merkmal zu ihrer Bestimmung, obgleich sie die der Purpurreiher um vieles, die der Fischreiher noch bedeutend an Größe übertreffen. Das Korn ist ein anderes, die Eier sind fühlbar glätter, als die der genannten beiden Arten, die Erhöhungen weniger scharf und spitzig, die Poren weiter voneinander entfernt und größer, die Färbung hat einen mehr bläulichen Ton, die Gestalt eine gestrecktere Eiform. Der Edelreiher scheint in der Regel gegen Mitte des April und um eine Woche später als der Purpurreiher in seiner Sommerherberge einzutreffen; gewiß ist, daß er seine Brutgeschäfte wenigstens um so viel später beginnt.«
Naumann meint, daß der Edelreiher leichter erlegt werden könne als der Fischreiher, ich muß das Gegenteil behaupten; denn ich habe ersteren stets sehr scheu gefunden. Der Vogel hatte auch alle Ursache, dies zu sein. Man stellt ihm in seiner Heimat eifrig nach, insbesondere der prachtvollen Rückenfedern wegen, aus denen die berühmten Reiherbüsche zusammengesetzt werden. In den Augen der Ungarn und Walachen gilt es als ein Kunststück, einen der vorsichtigen Vögel überlistet zu haben. Neuerdings sieht man den prächtigen Vogel in allen Tiergärten.
*
Wenn man zur Winterzeit an einem der ägyptischen Seen sich aufhält, stößt man hier und da auf dicke Bäume, die mit einer zahlreichen Gesellschaft von Reihern besetzt sind. Diese erwählen sich gern die Sykomore vor oder in den Dörfern zum Ruheplatze aus. Hier sitzen sie während des ganzen Tages, den Hals tief zusammengezogen, mit geschlossenen Augen, ohne Bewegung, und erst, wenn der Abend sich naht, beginnt einer und der andere sich zu regen. Dieser öffnet die Augen zur Hälfte, dreht den Kopf ein wenig seitwärts und blinzelt zur Sonne empor, gleichsam, um nachzusehen, wie hoch diese noch am Himmel steht, der andere nestelt sich im Gefieder herum, der dritte trippelt von dem rechten auf das linke Bein, der vierte streckt den Flügel: kurz, es kommt Leben in die Gesellschaft. Mittlerweile senkt sich die Sonne herab, und die Dämmerung bricht ein. Jetzt ermuntern sich die Schläfer, hüpfen geschickt von einem Ast zum andern, mehr und mehr dem Wipfel zu, und plötzlich erhebt sich aus einen quakenden Lockruf hin die ganze Schar und fliegt nun dem ersten besten Sumpfe zu, um hier ihr Tag- oder richtiger Nachtwerk zu beginnen. Eine Gesellschaft scheint sich der andern anzuschließen, und so kann es geschehen, daß man, wenigstens zur eigentlichen Zugzeit, Tausende dahinfliegen sieht, ohne es sich erklären zu können, woher diese alle gekommen. Ein solches Schauspiel genießt man übrigens nicht bloß in Ägypten, sondern auch im Innern Afrikas: denn bis zu den Wäldern im Blauen und Weißen Nile hinaus reisen die nächtlichen Gesellen, deren wahre Heimat der Südosten Europas ist.
Der Nachtreiher ( Nycticorax nycticorax) unterscheidet sich durch seine gedrungene Gestalt, den kurzen, dicken, hinten sehr breiten, aus dem Firste gebogenen Schnabel und das reichliche, mit Ausnahme von drei fadenförmigen Schmuckfedern am Hinterkopfe, nirgends verlängerte Gefieder von den andern Reihern, gilt daher als Urbild einer besonderen Sippe ( Nycticorax). Beim alten Vogel sind Oberkopf, Nacken, Oberrücken und Schultern grünlichschwarz, die übrigen Oberteile und die Halsseiten aschgrau, die Unterteile blaß strohgelb, die drei langen Schmuckfedern weiß, selten teilweise schwarz. Die Länge beträgt sechzig, die Breite einhundertacht, die Fittichlänge dreißig, die Schwanzlänge elf Zentimeter.
Auch der Nachtreiher ist weit verbreitet. Er bewohnt Holland noch immer ziemlich zahlreich, Deutschland einzeln und nicht regelmäßig, die Donautiefländer und geeignete Gegenden ums Schwarze und Kaspische Meer massenhaft, kommt in Italien, Südfrankreich und Spanien vor, wandert allwinterlich durch ganz Afrika, tritt ebenso in Palästina, im östlichen Mittelasien, China, Indien und auf den Sundainseln als Brutvogel auf, fehlt endlich auch dem größten Teile Nord-, Mittel- und Südamerikas nicht und ist einzig und allein in Australien noch nicht gefunden worden. Im Norden erscheint er Ende April oder Anfang Mai; seinen Rückzug tritt er im September oder Oktober wieder an.
Die Gegend, in der es dem Nachtreiher gefallen soll, muß reich an Bäumen sein; denn auf diesen schläft er, und sie bedarf er zum Brüten. Sümpfe, in deren Nähe es keine Waldungen oder Bäume gibt, beherbergen ihn nicht oder doch nur unregelmäßig und stets bloß auf kurze Zeit, wasserreiche Niederungen aber, denen es wenigstens an einer geschützten Baumgruppe nicht fehlt, oft in unglaublicher Menge. Es ist nicht gerade nötig, daß ein solcher Schlafplatz nahe am Sumpfe liegt; denn es ficht den Vogel wenig an, wenn er allnächtlich eine große Strecke durchfliegen muß, um von dem Ruheorte aus sein Jagdgebiet zu erreichen und wiederum nach jenem zurückzukehren.
Mit Ausnahme der Brutzeit verbringt er den ganzen Tag schlafend oder ruhend, und erst mit Einbruch der wirklichen Dämmerung tritt er seine Streifereien und Jagdzüge an. Seine Bewegungen unterscheiden ihn in mancher Hinsicht von andern Reihern. Der Gang zeichnet sich durch die kurzen Schritte, der Flug durch verhältnismäßig schnelle, aber vollkommen geräuschlose, oft wiederholte Flügelschläge und nur kurzes Gleiten aus. Gewöhnlich sieht man das nächtliche Heer in einer bedeutenden Höhe, stets in regellos geordneten Haufen dahinziehen, da, wo er häufig ist, oft auf weithin den Nachthimmel erfüllend. In der Nähe der Sümpfe angekommen, senkt sich die Gesellschaft mehr und mehr herab, und vor dem Niedersetzen bemerkt man auch wohl ein kurzes Schweben. In der Regel zeigt sich der Nachtreiher jeder schnellen Bewegung abhold; denn unfähig ist er einer solchen durchaus nicht. Eine Fertigkeit besitzt er in hohem Grade: er kann vortrefflich klettern und bewegt sich demgemäß im Gezweige der Bäume fast mit großer Gewandtheit. Die Stimme ist ein rauher, auf weithin vernehmbarer Laut, der allerdings an das Krächzen der Raben erinnert und zu dem Namen Nachtrabe Veranlassung gegeben hat. Sie mit Buchstaben auszudrücken ist schwer, da man ebenso gut ein »Koa« wie »Koau« oder »Koei« zu hören glaubt. Sein Wesen unterscheidet sich von dem anderer Reiher ungefähr ebenso wie das einer Eule von dem eines Falken. Eigentlich scheu kann man ihn nicht nennen, obwohl er immer eine gewisse Vorsicht bekundet. Aber man trifft gewöhnlich auch nur bei Tage mit ihm zusammen und hat dann eben einen schlafenden oder doch schläferigen Vogel vor sich. Dieser läßt in der Regel den Jäger bis unter den Baum kommen, auf dem er ruht, und entschließt sich, zumal an Orten, wo er durch die Gutmütigkeit des Menschen verwöhnt wurde, auch dann nicht immer zum Auffliegen. Derselbe Vogel zeigt sich, wenn die Nacht hereinbricht, munter und regsam, wenn auch nicht gerade sehr lebendig, und dabei unter allen Umständen vorsichtig, weicht furchtsam jedem Menschen aus, der sich ihm nähert, und wird, wenn er sich verfolgt sieht, ungemein scheu. Seine Fischerei betreibt er ungefähr in derselben Weise wie der Tagreiher, jedenfalls vollkommen lautlos. In einer Hinsicht unterscheidet er sich von vielen seiner Verwandten: er ist entschieden geselliger als sie. Allerdings trifft man in Nordostafrika zuweilen auch einzelne Nachtreiher an, in der Regel jedoch stets Gesellschaften, und zwar solche, die Hunderte von Stück zählen, größere, als sie irgendein anderer Reiher eingeht; und wenn man die Vögel des Nachts beobachtet, muß man sehr bald bemerken, wie ihr beständiges Schreien und Krächzen zur Folge hat, daß immer neue Zuzügler sich dem Schwarme anschließen.
Das Brutgeschäft fällt in die Monate Mai bis Juli. Um diese Zeit bezieht der Vogel entweder mit Verwandten gewisse Reiherstände oder bildet selbst Siedlungen. In Holland muß er sehr häufig brüten, weil man von dort aus alljährlich lebende Junge erhalten kann; in Deutschland nistet er selten, wahrscheinlich aber doch häufiger, als wir wähnen. So fand Wicke im Jahre 1863 eine von ihm geschilderte Siedlung in der Nähe von Göttingen. Auf den ungarischen Reiherständen ist er stets zahlreich vertreten. Seine Nester werden in der Regel in der Mitte der Wipfel auf Gabelästen angelegt oder auch auf den Rand von Fischreihernestern gestützt. Höhere Bäume zieht er den niederen vor, ohne jedoch besonders wählerisch zu sein. Der Horst ist verhältnismäßig nachlässig gebaut, außer von trockenem Gezweige nach Art eines Krähennestes zusammengeschichtet, innen mit trockenen Schilf- oder Riedblättern sparsam ausgelegt. Vor Anfang Mai findet man auch in Südungarn selten Eier in den Nestern, zu Ende des Monats hingegen sind fast alle mit vier bis fünf Stück belegt. Die grünen Eier, deren Längsdurchmesser etwa fünfundfünfzig und deren Querdurchmesser vierzig Millimeter beträgt, sind sehr länglich und auffallend dünnschalig. Wahrscheinlich brütet nur das Weibchen; wenigstens scheint dies bei Tage zu geschehen. Die Männchen sitzen, nach den Beobachtungen von Baldamus, ungestört in der Nähe des brütenden Weibchens, haben aber auch noch gewisse Sammelplätze, zu denen sie sich begeben, wenn sie behelligt werden; denn es tritt nur auf Augenblicke vollkommene Ruhe ein. Beachtenswert ist, daß der Nachtreiher während der Brutzeit sich auch bei Tage mit Fischfang beschäftigt. Freilich treibt ihn der niemals zu stillende Hunger seiner Jungen zu ungleich größerer Tätigkeit an als sonst, und wohl oder übel sieht er sich genötigt, seine gewohnte Lebensweise zu verändern. »Von allen Seiten, hoch und niedrig«, schildert Landbeck, »zieht der Nachtreiher, den Kropf mit Fischen, Fröschen und Kerbtierlarven angefüllt, zu seinen Nestern. Ein im tiefsten Basse ausgestoßenes ›Quak‹ oder ›Gewäk‹ kündigt seine Ankunft schon in bedeutender Entfernung an, und ein katzenartiges ›Quäht, quäht‹ oder ›Queaohaaeh, queoeah‹ der Jungen ist die Antwort beim Füttern. Haben sich die Alten entfernt, dann beginnt die Musik der Jungen aufs neue, und aus allen Nestern tönt ein ununterbrochenes ›Zikzikzik, zäkzäkzäk, zgäzgäzgä‹ und ›Gättgättgättgätt‹. Zur Abwechslung klettern die jungen Reiher auf den Ästen hinaus auf die Wipfel der Nestbäume, wo sie eine freiere Aussicht genießen und ihre Eltern schon in der Ferne kommen sehen, sich aber auch sehr oft täuschen.« Der Boden unter den Bäumen ist mit zerbrochenen Eierschalen, faulenden Fischen, toten Vögeln, zertrümmerten Nestern und anderm Unrat übersät; ein durchdringender Gestank verbreitet sich ringsum. Junge Nachtreiher, die aus ihren Nestern gestoßen wurden, laufen unten umher, die Fische aufsammelnd, die von den gefräßigen Nestjungen oben in den Bäumen herabgeworfen werden, falls sich nicht die Alten bequemen, sie auch unten zu füttern. Schon in bedeutender Entfernung vernimmt man ein sonderbares Prasseln und Plumpen, herrührend von dem dichten Kotregen und dem Herabfallen von Fischen oder Herabstürzen der Jungen. Niemand kann unten umhergehen, ohne grün und blau bemalt zu werden. In der Nähe ist der Lärm fürchterlich, der Gestank fast unerträglich und der Anblick von Dutzenden verwesender junger Reiher, die mit Tausenden von Fleischfliegen und Maden bedeckt und dadurch tausendfältig wieder belebt sind, äußerst ekelhaft.
In früheren Jahrhunderten scheint man an der Jagd auf Nachtreiher absonderliches Vergnügen gefunden zu haben, weil man diesen Vogel zur hohen Jagd rechnete und als Wildbret in Ehren hielt. Gegenwärtig erlegen ihn Raubschützen wegen seiner drei weißen Genickfedern, »Bismarckfedern« genannt, die von Federschmückern gesucht und zu Federbüschen verarbeitet werden. Gefangene sieht man in den meisten Tiergärten. Zu den anziehenden Vögeln gehören sie nicht, da sie auch in der Gefangenschaft den ganzen Tag verschlafen.
*
Geringe Größe, schlanker Schnabel, niedrige Läufe, die bis zu den Fußgelenken befiedert sind, verhältnismäßig lange Flügel, kurzer, schwacher Schwanz und nicht besonders reiches, nach Alter und Geschlecht verschieden gefärbtes Gefieder kennzeichnen die Sippe der Zwergreiher ( Ardetta), die in Deutschland oder Europa überhaupt durch die Zwergrohrdommel ( Ardetta minuta) vertreten wird. Ihre Länge beträgt vierzig, die Breite siebenundfünfzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Das Gefieder ist auf Oberkopf, Nacken, Rücken und Schultern schwarzgrünlich schillernd, auf dem Oberflügel und dem Unterkörper rostgelb, an den Seiten der Brust schwarz gefleckt; die Schwingen und Steuerfedern find ebenfalls schwarz. Der Augenstern ist gelb, der Schnabel auf der Firste braun, übrigens blaßgelb; der Fuß grüngelb. Beim Weibchen sind die dunkleren Teile braunschwarz, die helleren blaßgelb; bei den Jungen Oberkopf und Nacken rostrotbraun, dunkler in die Länge gefleckt, die Unterteile rostgelb und braun längsgefleckt, Bauch- und Hinterschwanzdeckfedern weiß.
Vom mittleren Schweden und den Orkneyinseln an nach Süden hin kommt die Zwergrohrdommel in ganz Europa als Brut- oder Zugvogel vor. In Holland, Osterreich, Ungarn, der Türkei und Griechenland ist sie gemein, in Deutschland, Südfrankreich und Spanien wenigstens nicht selten. Sie erscheint im Norden Ende April und verschwindet bereits im September wieder, hält sich während ihres Zuges längere Zeit in Griechenland auf und überwintert im Norden Afrikas, hier nach und nach bis in die Gleicherländer, selbst bis zum Süden Afrikas vorrückend. Zu ihrem Sommerstande wählt sie rohrreiche oder doch mit Büschen und hohen Sumpfpflanzen bestandene Brüche und Gewässer überhaupt, und demgemäß findet sie in Holland und Ungarn oder in Griechenland ungleich günstigere Wohnorte als bei uns zulande. Aufenthaltsort und Lebensweise verbergen sie den Blicken, und nur der laute Ruf des Männchens während der Paarungszeit verrät sie den Kundigen. Nicht selten bewohnt sie kleine, dicht mit Röhricht oder Gebüsch bewachsene Teiche in unmittelbarer Nähe der Dörfer, ohne daß man davon eine Ahnung hat.
Tagsüber sitzt sie so versteckt und regungslos im Röhricht oder auf einem Baumzweige, daß der Unkundige, auch wenn er sie sieht, gewöhnlich getäuscht wird. Sie versteht es meisterhaft, stets solche Stellen auszusuchen, deren Umgebung der Färbung ihres Kleides entspricht, und treibt dabei geflissentlich Versteckenspielen, indem sie täuschende, oft höchst sonderbare Stellungen annimmt. Wenn sie ruhig auf dem Boden steht, zieht sie den Hals tief herab und erscheint dann sehr niedrig. Im Gehen legt sie den Kopf etwas vor und schreitet nun, unter beständigem Schwanzwippen, fast nach Art einer Ralle, zierlich und hurtig ihres Weges fort. Ihr Flug ist verhältnismäßig schnell, auch sehr gewandt, beim Auffliegen flatternd, beim Niederlassen entweder schwebend oder herabstürzend. Außerordentliche Geschicklichkeit bekundet sie im Klettern. Bei Gefahr steigt sie augenblicklich an den Rohrhalmen in die Höhe und bewegt sich hier mit einer Fertigkeit, die wahrhaft in Erstaunen setzt. In ihrem Rohrwalde fühlt sie sich vollkommen sicher und läßt sich kaum mit Gewalt daraus vertreiben. Sie schläft sehr leise und bemerkt den Ruhestörer viel eher als dieser sie, läuft also, wenn ihr Gefahr droht, auf dem Grunde weg oder, von einem Rohrstengel zum andern kletternd, weiter. Steinwürfe, Schlagen mit Stangen auf das Rohr und anderer Lärm von außen bringen sie, laut Naumann, nie zum Auffliegen. Nur abends kommt sie freiwillig hervor und fliegt dann, wo sie sich sicher glaubt, niedrig auch über freies Wasser hinweg, andern Rohrbüschen zu oder läßt sich an kahlen Ufern nieder. »Obwohl sie sich«, schildert Naumann, »überall lebhafter und gemütlicher zeigt als die meisten andern Reiher, so würde man sich doch täuschen, wenn man ihrem schlauen Blicke Vertrauen schenken wollte; denn sie ist ebenso heimtückisch und mutig wie jene. Kommt ihr, ohne daß sie ausweichen kann, ein Geschöpf zu nahe, so erhält es unversehens durch kräftiges und ungemein rasches Vorschnellen des Halses die heftigsten Schnabelstöße, die gewöhnlich nach den Augen, beim Menschen auch nach den Händen oder andern entblößten Teilen gerichtet sind und leicht gefährlich werden können. So schnell der Hals dabei wie aus einer Scheide fährt, ebenso schnell zieht er sich wieder in die vorige Lage zurück; beides ist das Werk eines Augenblicks.« In großer Bedrängnis verteidigt sie sich bis zum letzten Atemzuge. Mit andern Vögeln verkehrt sie nicht, duldet nicht einmal gern andere ihrer Art in einem und demselben Teiche. Der Paarungslaut des Männchens ist ein tiefer, gedämpfter Baßton, der durch die Silbe »Pumm« oder »Pumb« wiedergegeben werden kann und an einen lauten und tiefen Unkenruf erinnert. Dieser Laut wird zwei- bis dreimal nacheinander wiederholt; dann folgt eine längere Pause, und das Brüllen beginnt wieder; aber niemals läßt der Vogel einen Laut vernehmen, wenn er Menschen in der Nähe weiß. In der Angst stoßen beide Geschlechter ein quakendes »Gäth, gäth« aus.
Kleine Fische und Lurche bilden wohl ihre Hauptnahrung; außerdem fängt sie Würmer und Kerbtiere in allen Lebenszuständen. Junge Rohrsänger oder andere ungeschickte Nestvögel, die ihr im Sumpfe aufstoßen, werden wahrscheinlich ebenfalls von ihr gemordet. Sie jagt nur des Nachts, am liebsten in der Abend- und Morgendämmerung.
Das große, lockere und unkünstliche, aber doch dauerhafte Nest, das aus trockenem Rohr, Schilfblättern und Wasserbinsen erbaut und mit Binsen und Gras ausgekleidet wird, steht gewöhnlich auf alten Rohrstoppeln über dem Wasser, seltener auf dem Erdboden, und nur ausnahmsweise auf dem Wasser selbst. Zu Anfang des Juni, in ungünstigen Jahren noch vierzehn Tage später, findet man in ihm drei bis vier, zuweilen auch fünf oder sechs kleine, zweiunddreißig Millimeter lange, fünfundzwanzig Millimeter dicke, schwachschalige, aber glatte, glanzlose Eier von weißer, ins Bläulichgrüne spielender Färbung, aus den nach ungefähr sechzehntägiger Bebrütung die in rostgelbe Daunen gekleideten Jungen schlüpfen. Ungestört verweilen sie bis zum Flüggewerden im Neste; geschreckt, flüchten sie sich an Rohrstengeln in die Höhe und zwischen diesen weiter. »Nähert man sich dem Neste«, berichtet Naumann, »so wird das Weibchen, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, sogleich sichtbar, kommt nahe herbei, an den Rohrstengeln und andern Pflanzen auf- und absteigend, schreit kläglich ›Gäth, gäth‹, wippt dazu mit dem Schwänze wie eine Ralle oder wie ein Rohrhuhn und zeigt die größte Angst. Das Männchen hält sich entfernter und beobachtet den Ruhestörer mehr aus dem Verborgenen.«
Gefangene gehen ohne Umstände an das vorgesetzte Fischfutter, gewähren ihrem Pfleger viel Vergnügen, halten sich auch, wenn man ihnen einen größeren Raum zur Verfügung stellt, recht gut. Sie werden einigermaßen zahm, zutraulich jedoch nie und behalten ihr tückisches Wesen stets bei.
*
Die Rohrdommel ( Botaurus stellaris) vertritt eine gleichnamige Sippe ( Botaurus). Ihre Merkmale sind: gedrungener Leib, langer, aber dicker Hals, schmaler, hoher Schnabel, fast bis auf die Ferse herab gefiederter, großzehiger Fuß, breiter Flügel und dichtes, am Hals verlängertes Gefieder ohne alle Schmuckfedern. Der Oberkopf ist schwarz, der Hinterhals grauschwarz und gelb gemischt, das übrige Gefieder auf rostgelbem Grunde mit schwarzbraunen und rostbraunen Längs- und Querflecken, Bändern und Strichen der verschiedensten Art, die am Vorderhalse drei Längsstreifen bilden, gezeichnet. Die Schwingen sind auf schieferfarbenem Grunde rostfarbig gebändert, die Schwanzfedern auf rötlich rostgelbem Grunde braunschwarz bespritzt. Die Länge beträgt zweiundsiebzig, die Breite einhundertsechsundzwanzig, die Fittichlänge vierzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter.
Die Rohrdommel ist heute selten in Deutschland, häufiger in Holland, gemein in den Tiefländern der Donau und Wolga, verbreitet sich nach Osten hin über ganz Mittelsibirien, nach Westen hin über Süd- und Mitteleuropa und besucht auf dem Zuge Nordafrika. An allen Orten, wo sie vorkommt, lebt sie vorzugsweise in Seen, Teichen oder Brüchen, die teilweise mit hohem Rohre bestanden sind, unter Umständen aber auch im dichten Weidengebüsche nasser, von Gräben durchzogener Wiesen, so im Spreewalde. Im Norden Deutschlands erscheint sie Ende März oder Anfang April; ihren Rückzug tritt sie im September oder Oktober an; bei milder Witterung verweilt sie jedoch auch länger im Norden, da, wo es offenes Wasser gibt, sie sich also ernähren kann, zuweilen das ganze Jahr über.
In der Fertigkeit, die sonderbarsten Stellungen anzunehmen, übertrifft sie noch ihre kleine Verwandte. Wenn sie ruhig und unbefangen steht, richtet sie den Leib vorn etwas auf und zieht den langen Hals so weit ein, daß der Kopf auf dem Nacken ruht; im Fortschreiten hebt sie den Hals mehr empor; in der Wut bläht sie das Gefieder, sträubt die Hinterhauptsfedern, sperrt den Schnabel etwas auf und wappnet sich zum Angriffe. Wenn sie täuschen will, setzt sie sich auf die Fußwurzeln und streckt Rumpf und Hals, Kopf und Schnabel in einer geraden Linie schief nach oben, so daß sie eher einem alten, zugespitzten Pfahle oder abgestorbenen Schilfbüschel als einem Vogel gleicht. Ihr Gang ist langsam, bedächtig und träge, der Flug sanft, geräuschlos, langsam und scheinbar ungeschickt. Um die Höhe zu gewinnen, beschreibt sie einige Kreise, aber nicht schwebend, sondern stets flatternd, ebenso senkt sie sich auch beim Niederkommen bis dicht über das Rohr herab, zieht plötzlich die Flügel ein und fällt senkrecht zwischen den Stengeln nieder. Übrigens fliegt sie nur des Nachts in höhere Luftschichten, bei Tage hingegen stets dicht über dem Rohre dahin. Wenn sie des Nachts fliegt, vernimmt man auch ihre gewöhnliche Lockstimme, ein lautes, rabenartiges Krächzen, das man durch die Silben »Krah« oder »Krauh« ungefähr wiedergeben kann; denn das berüchtigte Brüllen läßt sie nur während der Paarungszeit hören. Sie lebt nur für sich und scheint jedes andere Geschöpf zu hassen; diejenigen Tiere, die sie verschlingen kann, bringt sie um, diejenigen, die hierzu zu groß sind, greift sie wütend an, wenn sie ihr zu nahe kommen. Solange wie irgend möglich zieht sie sich vor jedem größeren Gegner zurück; in die Enge getrieben, geht sie demselben tollkühn zu Leibe und richtet ihre Schnabelstöße mit so viel Geschick, Böswilligkeit und Schnelligkeit nach den Augen ihres Widersachers, daß sich selbst der kluge Mensch sehr in acht zu nehmen hat, wenn er von ihr nicht gefährlich verletzt werden soll. Die Gefangenschaft ändert ihr Wesen nicht; auch die jung aufgezogenen Rohrdommeln bekunden gelegentlich alle diese widerwärtigen Eigenschaften.
Fische, insbesondere Schlammbeißer, Schleien und Karauschen, Frösche, Unken und andere Wasserlurche verschiedener Art, aber auch Schlangen, Eidechsen, junge Vögel und kleine Säugetiere bis zur Größe von Wasserratten bilden ihre Nahrung. Zuweilen frißt sie fast nur Egel, und zwar hauptsächlich Pferdeegel, unbekümmert um deren scharfen Saugapparat und ohne sie vorher zu töten. Sie jagt bloß des Nachts, aber von Sonnenuntergang bis zu Sonnenaufgang, bedarf viel zu ihrer Sättigung, bringt aber doch kaum merklichen Schaden, da ihre kurzen Beine Jagd in tieferem Wasser nicht gestatten.
Der absonderliche Paarungsruf der männlichen Rohrdommel, ein Gebrüll, das dem der Ochsen ähnelt und in stillen Nächten zwei bis drei Kilometer weit vernommen werden kann, ist aus einem Vorschlage und einem Haupttone zusammengesetzt und klingt, nach der Naumannschen Übersetzung, wie »Üprumb«. Dabei vernimmt man, wenn man sehr nahe ist, noch das Geräusch, das klingt, als ob jemand mit einem Rohrstengel auf das Wasser schlüge. Ehe der Vogel ordentlich in Zug kommt, klingt sein Lied ungefähr so: »Uü ü prumb«, sodann »Ü prumb, ü prumb, ü prumb«. Zuweilen, aber selten, schließt sich dem »Prumb« noch ein »Buh« an. Zum Anfange der Begattungszeit brüllt das Männchen am fleißigsten, beginnt damit in der Dämmerung, ist am lebendigsten vor Mitternacht, setzt es bis zu Ende der Morgendämmerung fort und läßt sich zwischen sieben und neun Uhr noch einmal vernehmen. Graf Wodzicki hat durch eine Beobachtung die uralte Angabe über die Art und Weise des Hervorbringens eines so ungewöhnlich starken Lautes bestätigt. »Der Künstler«, sagt er, »stand auf beiden Füßen, den Leib wagerecht gehalten, den Schnabel im Wasser, und das Brummen ging los; das Wasser spritzte immer auf. Nach einigen Noten hörte ich das Naumannsche ›Ue‹, und das Männchen erhob den Kopf, schleuderte ihn hinter, steckte den Schnabel sodann schnell ins Wasser, und da erschallte das Brummen, so daß ich erschrak. Dies machte mir klar, daß diejenigen Töne, die nur im Anfange so laut tönen, hervorgebracht werden, wenn der Vogel das Wasser tief in den Hals genommen hat und mit viel größerer Kraft herausschleudert als sonst. Die Musik ging weiter, er schlug aber den Kopf nicht mehr zurück, und ich hörte auch die lauten Noten nicht mehr. Es scheint also, daß dieser Laut die höchste Steigerung des Balzens ist, und daß er ihn, sobald seine Leidenschaft befriedigt ist, nicht mehr wiederholt.« Die Rohrdommel steht beim Balzen nicht im dichtesten Rohre, sondern vielmehr auf einem kleinen, freien Plätzchen; denn das Weibchen muß ihren Künstler ansehen können. Das Geplätscher, als schlüge jemand mit einem Rohrstengel auf das Wasser, verursacht das Männchen mit dem Schnabel, indem es, wenn es laut wird, zwei- bis dreimal das Wasser schlägt und dann endlich den Schnabel hineinsteckt. Das letzte dumpfe ›Buh‹, das man vernimmt, wird durch das Ausstoßen des noch im Schnabel befindlichen Wassers beim Herausziehen des ersteren hervorgebracht. Ein Männchen, das Wodzicki im Brummen störte, flog auf und spritzte einen soeben eingeschlürften, sehr beträchtlichen Wasserstrahl weit von sich.
Unweit der Stelle, von der man das Brüllen am häufigsten vernimmt, selbstverständlich an einem möglichst verborgenen und schwer zugänglichen Orte, in der Regel auf altem umgeknickten Rohre über dem Wasser, zuweilen auf Erdhügelchen oder kleinen Schilfinselchen, ausnahmsweise als schwimmender Bau auch auf dem Wasserspiegel selbst, steht das Nest; bald ein sehr großer, hoher, liederlich zusammengeschichteter Klumpen, bald ein kleiner und etwas besserer, aus dürrem Rohre, Blättern, Seggen, Schilf, Wasserbinsen und dergleichen bestehender, innen mit alten Rohrrispen und dürrem Grase ausgelegter Horst. Von Ende Mai an findet man das vollzählige Gelege, drei bis fünf Stück eiförmige, starkschalige, glanzlose Eier von zweiundfünfzig Millimeter Längen-, neununddreißig Millimeter Querdurchmesser und blaßgrünlichblauer Färbung. Das Weibchen brütet allein, wird aber währenddem mit Futter versorgt und von Zeit zu Zeit mit Gebrüll unterhalten. Vor dem sich nahenden Menschen entflieht es erst, wenn derselbe sich bis auf wenige Schritte genaht hat; einen Hund läßt es noch näher herankommen. Nach einundzwanzig bis dreiundzwanzig Tagen entschlüpfen die Jungen, werden von der Mutter noch einige Tage gewärmt und in Gemeinschaft mit dem Vater geatzt. Ungestört verweilen sie bis zum Flüggesein im Neste, gestört, entsteigen sie demselben, noch ehe sie fliegen lernen, und klettern im Rohre auf und ab. Wenn sie ihre Jagd betreiben können, vereinzeln sie sich und streifen bis zum Zuge im Lande umher.
*
Als die edelsten Mitglieder der letzten Unterordnung der Sumpfhühner haben wir die Kraniche ( Gruidae) anzusehen. Ihre Merkmale sind: verhältnismäßig langer, fast walzenförmiger, aber kräftiger, seitlich nicht zusammengedrückter Leib, langer, schmächtiger Hals, kleiner, schön gestalteter Kopf, mittelmäßig starker, gerader, seitlich etwas zusammengedrückter, stumpfrückiger, spitziger Schnabel, der dem Kopf an Länge gleichkommt oder ihn etwas übertrifft, an seiner Wurzelhälfte weich, an der Spitze jedoch hart ist, sehr lange, starke, weit über die Ferse nackte Beine und vierzehige Füße, deren kleine, kurze Hinterzehe sich so hoch einlenkt, daß sie beim Gehen den Boden nicht berührt, deren äußere und mittlere Vorderzehe durch eine dicke, bis zum ersten Gelenke reichende Spannhaut verbunden werden, und deren Krallen kurz, flach gebogen und stumpfkantig sind, große, lange, breite Flügel, in denen die dritte Schwinge die längste, und deren letzte Oberarmfedern sich über alle übrigen verlängern, auch wohl sichelförmig biegen, überhaupt durch eigentümliche Gestaltung auszeichnen, aus zwölf Federn gebildeter, ziemlich kurzer oder zugerundeter Schwanz und dicht anschließendes, derbes, jedoch reiches Kleingefieder, das oft einen Teil des Kopfes und des Halses freiläßt oder hier sich zu schönen Schmuckfedern umgestaltet, bei einzelnen auch am Vorderhalse sich verlängert und verschmächtigt. Die Geschlechter unterscheiden sich nicht merklich durch die Färbung, wohl aber durch die Größe; die Jungen legen nach der ersten Mauser ein den Alten ähnliches Kleid an, erhalten jedoch die Schmuckfedern in ihrer Vollendung erst später.
Die Kraniche sind Weltbürger, hauptsächlich aber im gemäßigten Gürtel heimisch. Jeder Erdteil beherbergt besondere Arten, Asien die meisten. Ausgedehnte Sümpfe und Moräste bilden ihre Wohnsitze; solche, die an bebautes Land grenzen, scheinen bevorzugt zu werden, da sie ebenso gut im Sumpfe wie auf den Feldern Nahrung suchen. Sie gehen mit abgemessenen Schritten, jedoch zierlich einher, gefallen sich in anmutigen tanzartigen Sprüngen, bewahren stets eine gewisse Würde, waten ziemlich tief ins Wasser, sind auch imstande zu schwimmen, fliegen leicht, schön, oft schwebend und große Kreise beschreibend, mit gerade ausgestrecktem Halse und Beinen, meist in hoher Luft dahin, haben eine laute, durchdringende Stimme, sind heiter, necklustig, kampfesmutig und selbst mordsüchtig, zeigen sich gegen ihresgleichen äußerst gesellig und nehmen auch gern Familienverwandte, jedoch nur solche im engeren Sinne, unter sich auf, bekümmern sich sonst aber wenig oder nicht um andere Tiere oder maßen sich, wenn sie es tun, die Oberherrschaft über diese an. Auf ihrem Zuge, der sie bis in die Wendekreisländer bringt, reisen sie fast ununterbrochen, bei Nacht ebensowohl wie bei Tage, legen deshalb auch ihre Wanderungen in überraschend kurzer Zeit zurück.
Der Kranich ( Grus cinerea), für uns das Urbild der Familie und der Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Grus), ist aschgrau, in der Kehlgegend und aus dem Vorderscheitel schwarz, an den Halsseiten weißlich; die Schwungfedern sind schwarz. Das Auge ist braunrot, der Schnabel an der Wurzel rötlich, an der Spitze schwarzgrün, der Fuß schwärzlich. Die Länge beträgt einhundertvierzig, die Breite zweihundertvierzig, die Fittichlänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge einundzwanzig Zentimeter. Ein breiter Gürtel der Alten Welt, vom Osten Mittelsibiriens an bis nach Skandinavien und von der niedrigen Tundra an bis zur Breite Mitteleuropas, ist die Heimat des Kranichs; von hier aus wandert er durch China bis Siam und Indien oder bis Mittel- und Westafrika.
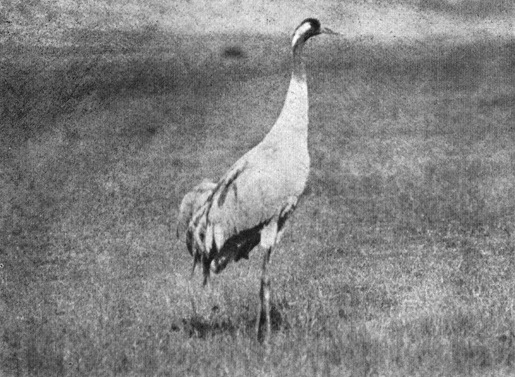
Junger Graukranich ( Grus cinerea)
Ihm gesellt sich in Ostasien der prachtvolle Schneekranich ( Grus leucogeranos), der einige Male auch in Europa erlegt wurde. Er ist bis auf die schwarzen Steuerfedern blendend weiß, der nackte Kopf blutrot, das Auge hellgelb, der Schnabel blaßrot, der Fuß hellkarminrot. Seine Länge beträgt etwa einhundertzwanzig Zentimeter, die Breite das Doppelte.

Antigonekraniche ( Grus antigonae)
Ebenso zählt man den Antigonekranich ( Grus antigone) aus Daurien unter den europäischen Vögeln auf, weil er in den südrussischen Steppen erlegt wurde. Er unterscheidet sich von unserm Kranich durch die große Ausdehnung des nackten Kopffeldes und den gerundeten Schwanz. Sein Gefieder ist mit Ausnahme der dunkel schieferfarbenen Schwingen und Schwanzfedern fast gleichmäßig bräunlich aschgrau, das Auge orangerot, der Schnabel grün an der Wurzel, bräunlich schwarz an der Spitze, der Fuß blaß rosenrot. Die Länge beträgt einhundertsechsunddreißig, die Breite zweihundertvierzig, die Fittichlänge sechsundsechzig, die Schwanzlänge dreiundzwanzig Zentimeter.

Vogelleben am Weißen Nil, besonders Kraniche
Öfter als die beiden vorhergenannten Arten besucht der in den mittelasiatischen Steppen heimische, bis Südindien, Mittel- und Südafrika wandernde, ungemein zierliche Jungfernkranich ( Grus virgo) unsern heimatlichen Erdteil. Er unterscheidet sich von seinen beschriebenen Verwandten durch den kurzen, runden Schnabel, den ganz befiederten, hinten mit zwei langen Federzöpfen gezierten Kopf, das verlängerte Gefieder des Unterhalses und die nicht zerschlissenen und aufgekrempten, sondern nur verlängerten, aber die andern weit überragenden Oberflügeldeckfedern. Das Gefieder, das sich durch Zartheit auszeichnet, ist licht bleigrau, der Vorderhals und sein herabwallender Schmuck ist schwarz, die zopfartige Kopfzierde rein weiß; die Schwingen sind grauschwarz. Das Auge ist hochkarminrot, der Schnabel an der Wurzel schmutziggrün, gegen die Spitze hin hornfarben, an ihr blaßrot, der Fuß schwarz. Dem jungen Vogel fehlen die Schmuckfedern am Kopf und Unterhalse. Die Länge beträgt fünfundachtzig, die Breite einhundertsechsundsechzig, die Fittichlänge fünfundvierzig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter.
Unser deutscher Kranich, auf dessen Lebensschilderung ich mich beschränken muß, erscheint im Sudan scharenweise im Oktober und bezieht hier größere Sandbänke in den Strömen, die über den Wasserspiegel hervorragen. In Indien trifft er ebenfalls zu derselben Zeit in namhafter Anzahl ein und bewohnt dann ähnliche Örtlichkeiten. Durch Deutschland sieht man ihn Anfang Oktober und Ende März, regelmäßig in zahlreichen Gesellschaften, die in hoher Luft fliegen, die Keilordnung streng einhalten und nur zuweilen kreisend in wirre Flüge sich auflösen, vielleicht auch hier und da auf den Boden herabsenken, um zu äsen, nirgends aber längere Zeit aufhalten, seines Weges dahinziehen. Diese Züge halten eine gewisse Richtung, vor allem die bekannten Heerstraßen der Vögel, alljährlich ein und lassen sich nur durch ungewöhnliche Erscheinungen ablenken. Vor dem Herbstzuge gesellen sie sich, wie die Störche, auf bestimmten Örtlichkeiten, von denen sie sich eines Tages unter großem Geschreie erheben, und fliegen nun rastlos, Tag und Nacht reisend, ihrer Winterherberge zu. Hier angelangt, senken sie sich tief herab und suchen nun nach einer ihren Anforderungen entsprechenden und von andern Wanderscharen noch nicht besetzten Insel. Solange ihr Aufenthalt in der Fremde währt, halten sie sich stets in zahlreichen Massen zusammen und nehmen auch verwandte Arten, in Afrika die Jungfernkraniche, in Indien die Antigone-, in Südchina und Siam außer letzteren auch die Weißnacken- und Schneekraniche, unter sich auf. Mit ihnen fliegen sie gemeinsam jeden Morgen auf die Felder hinaus, um hier Nahrung zu suchen, kehren in den Vormittagsstunden zurück und verweilen nun Tag und Nacht auf den Inseln, zeitweilig mit verschiedenen Spielen sich vergnügend und beständig im Gefieder putzend und ordnend, da die jetzt stattfindende Mauser derartige Sorgfalt nötig macht. Scharenweise brechen sie auch auf, und vereinigt noch kommen sie an in der Heimat; hier aber lösen sich die Heereshaufen bald in kleinere Trupps und diese in Paare auf, und jedes Paar bezieht nun eine zur Fortpflanzung geeignete Örtlichkeit, die sich von der Winterherberge wesentlich unterscheidet. In Indien oder im Sudan ist der Kranich Strandvogel, im Norden Europas oder Asiens wird er zum vollendeten Sumpfvogel. Er bezieht hier die großen Brüche oder Sümpfe der Ebene, bezüglich der Tundra, und wählt in den Morästen diejenigen Stellen aus, die mit niedrigem Seggengrase oder Riede bewachsen sind, ihm aber unter allen Umständen weite Aussicht gestatten. Sie werden zu seinem Brutgebiete, und von ihnen fliegt er hinaus auf die Felder, die ihm auch während des Sommers zollen müssen. Brüche, Sümpfe oder Moräste, in denen viel Buschwerk oder hohes Röhricht wächst, liebt er nicht, es sei denn, daß ihre Ausdehnung die Annäherung eines Menschen erschwert und ihm die nötige Sicherheit verbürgt.
Jede Bewegung des Kranichs ist schön. Mit leichten, zierlichen, aber doch abgemessenen Schritten, gewöhnlich ruhig und würdevoll, nur im Falle der Not eilend und rennend, geht er seines Weges dahin; ohne Mühe erhebt er sich nach einem oder nach zwei Sprüngen vom Boden, mit wenigen, weit ausholenden Schlägen der kräftigen Flügel gewinnt er die nötige Höhe, und nunmehr fliegt er, Hals und Beine gerade von sich gestreckt, stetig und ohne Eile zu verraten, aber doch schnell und fördernd dahin, mit Entschiedenheit einem bestimmten Ziele zustrebend. Aber derselbe Vogel ergötzt sich auch, wenn ihn die Laune anwandelt, durch lustige Sprünge, übermütige Gebärden, sonderbare Stellungen, Verneigungen des Halses, Breiten der Flügel und förmliches Tanzen oder dreht sich fliegend in prachtvollem Reigen längere Zeit über einer und derselben Stelle umher. Wie im Übermute nimmt er Steinchen und Holzstückchen von der Erde auf, schleudert sie in die Lust, sucht sie wieder aufzufangen, bückt sich rasch nacheinander, lüftet die Flügel, tanzt, springt, rennt eilig hin und her, bleibt aber immer anmutig, immer schön. Er ist nicht scheu, aber im allerhöchsten Grade vorsichtig und läßt sich deshalb sehr schwer überlisten. Der einzelne denkt stets an seine Sicherheit; eine Herde stellt regelmäßig Wachen aus. Die beunruhigte Schar sendet Späher und Kundschafter, bevor sie den Ort wieder besucht, auf dem sie gestört wurde. Mit wahrem Vergnügen habe ich in Afrika beobachtet, wie vorsichtig die Kraniche zu Werke gehen, sobald sie auch dort die Tücke des Menschen kennengelernt haben; wie sie zunächst einen Kundschafter aussenden, dann mehrere, wie diese sorgsam spähen und lauschen, ob etwas Verdächtiges sich noch zeige, wie sie sich erst nach den eingehendsten Untersuchungen beruhigen, zurückfliegen, die Gesamtheit benachrichtigen, dort noch immer nicht Glauben finden, durch Gehilfen unterstützt werden, nochmals auf Kundschaft ausziehen und nun endlich die Herde nach sich ziehen. Und doch lernt man den Kranich während seines Freilebens nie vollständig kennen, muß ihn vielmehr zum Gesellschafter erworben haben, wenn man über ihn urteilen will. So vorsichtig er dem Menschen ausweicht, solange er frei ist, so innig schließt er sich ihm an, wenn er in dessen Gesellschaft kam. Er sieht in seinem Gebieter nicht bloß den Brotherrn, sondern auch den Freund und bemüht sich, dies kundzugeben. Leichter als jeder andere Vogel gewöhnt er sich an das Gehöft, an das Haus seines Pflegers, lernt hier jedes Zimmer, jeden Raum kennen, die Zeit abschätzen, die Verhältnisse würdigen, in denen andere Leute oder Tiere zum Gastfreunde stehen, bekundet bewunderungswertes Verständnis für Ordnung, duldet auf dem Geflügelhofe keinen Streit, hütet, ohne dazu aufgefordert zu werden, gleich dem verständigsten Hunde, das Vieh, straft durch scheltendes Geschrei oder empfindliche Schnabelhiebe und belohnt durch freundliches Gebaren, Verneigungen und Tanzen, befreundet sich mit wohlwollenden Menschen und drängt sich in deren Gesellschaft, läßt sich aber nichts gefallen und trägt ungebührliche Beleidigungen monate-, ja jahrelang nach. Es liegen über seinen Verstand so viele Beobachtungen vor, daß ich kein Ende finden könnte, wollte ich sie hier anführen.
Mit andern Mitgliedern der Familie, auch wohl mit verwandten Vögeln, lebt der Kranich in gutem Einvernehmen; in ein Freundschaftsverhältnis tritt er aber nur mit ebenbürtigen Geschöpfen. Geselligkeit scheint ihm Bedürfnis zu sein; aber er wählt sich seine Gesellschaft. Dem Gatten gegenüber beweist er unwandelbare Treue; gegen seine Kinder bekundet er die wärmste Zärtlichkeit; gegen seine Art-, Sippschafts- und Familienverwandten legt er eine gewisse Hochachtung an den Tag. Demungeachtet kommt es vor, daß sich Kraniche in Sachen der Minne, während des Zuges oder gelegentlich anderer Zusammenkünfte erzürnen und wütend bekämpfen. Man hat beobachtet, daß mehrere über einen herfielen und ihm durch Schnabelhiebe so zusetzten, daß er zur Weiterreise unfähig ward. Wir haben außerdem in Tiergärten mehr als einmal erfahren, daß verschiedenartige Kraniche sich mit bitterem Hasse befehdeten, und daß einer den andern tötete. Doch gehören solche Vorkommnisse zu den Ausnahmen; denn eigentlich sind die Kraniche wohl necklustig und mutig, nicht aber boshaft, tückisch und hinterlistig.
Unser Kranich frißt Getreide und Saat, Grasspitzen und Feldpflanzen, sehr gern Erbsen, nimmt auch einzelne Früchte auf oder erbeutet Würmer und Kerbtiere, insbesondere Käfer, Heuschrecken, Grillen und Libellen, fängt auch ab und zu einen Taufrosch oder einen andern Wasserlurch. In der Gefangenschaft gewöhnt sich der Kranich an die verschiedensten Nahrungsstoffe, läßt sich aber mit dem einfachsten Körnerfutter jahrelang erhalten. Er zieht Erbsen und Bohnen dem Getreide vor, sieht im Brot einen Leckerbissen, nimmt aber auch gern gekochte Kartoffeln oder klein geschnittene Rüben, Kohl, Obst und dergleichen zu sich, verschmäht ein Stückchen frisches Fleisch keineswegs, läßt auch keine Gelegenheit vorübergehen, Mäuse und Kerbtiere zu fangen.

Fliegende Kronenkraniche ( Balearica pavonina)
Sofort nach seiner Ankunft in der Heimat nimmt das Kranichpaar Besitz von dem Sumpfe, in dem es zu brüten gedenkt, und duldet innerhalb eines gewissen Umkreises kein zweites Paar, obwohl es jeden vorüberreisenden Zug mit lautem Rufen begrüßt. Erst wenn die Sümpfe grüner werden und das Laub der Gebüsche ausschlägt, beginnt es mit dem Nestbau, trägt auf einer kleinen Insel oder Seggenkufe, einem niedergetretenen Busche oder einem andern erhabenen Orte dürre Reiser zusammen und schichtet auf ihnen bald mehr, bald weniger trockene Halme und Rohrblätter, Schilf, Binsen und Gras zusammen, ohne sich dabei sonderliche Mühe zu geben. Auf die seichtvertiefte Mitte dieses Baues legt das Weibchen seine zwei großen und gestreckten, etwa vierundneunzig Millimeter langen, einundsechzig Millimeter dicken, starkschaligen, grobkörnigen und fast glanzlosen Eier, deren Grundfarbe bald graugrün, bald bräunlich, bald hellgrün ist, und deren Zeichnung aus grauen und rotgrauen Unterflecken, rotbraunen und dunkelbraunen Oberflecken, Tüpfeln und Schnörkeln besteht, aber vielfach abändert. Beide Geschlechter brüten abwechselnd und verteidigen gemeinschaftlich die Brut gegen einen nahenden Feind, falls derjenige, der gerade nicht brütet, aber die Wache hält, allein nicht fertig werden sollte. An gefangenen Kranichen, die brüten, kann man beobachten, daß der Wächter mit Wut auf jedes Tier stürzt, das sich dem Neste nähert und, da er an den Anblick des Menschen gewöhnt ist, diesen ebenfalls rücksichtslos angreift; die freilebenden hingegen fliehen letzteren, ihren schlimmsten Feind, auch während sie brüten, ängstlich. Ihr Nest verraten sie nie, betätigen im Gegenteil bewunderungswürdige Geschicklichkeit, während der Brutzeit sich zu verbergen oder doch im Brüten dem Auge des Beobachters zu entziehen. Wie lange die Brutzeit dauert, weiß ich nicht; wohl aber sind wir über das Jugendleben der ausgeschlüpften Kraniche einigermaßen unterrichtet. An gefangenen Geschwistern hat man beobachtet, daß sie sich zuweilen wie Tauben schnäbeln, und deshalb angenommen, daß die Jungen anfänglich wohl von den Alten geatzt werden mögen; sehr junge Kraniche aber, die ich erhielt, pickten ohne weiteres das ihnen vorgehaltene Futter aus der Hand und benahmen sich so geschickt und selbständig, daß ich sie unbedingt für entschiedene Nestflüchter halten muß. Trotz ihrer dicken Beine laufen sie sehr gut und wissen sich in dem dichten Riede oder Binsichte vortrefflich zu verbergen. Die Alten verraten sich nicht, beschäftigen sich nur, wenn sie sich ganz unbeachtet glauben, mit ihnen und führen sie, falls sie Gefahr befürchten, oft weit weg, beispielsweise auf Felder hinaus, um sie hier im Getreide zu verstecken. Aber sie behalten sie fortwährend im Auge und sehen auch dann noch nach ihnen, wenn sie gefangen und in einem der Brutstelle nicht sehr entlegenen Gehöfte untergebracht wurden. Unangenehm werden die niedlichen Tiere durch das ununterbrochene wiederholte Ausstoßen der einzelnen Silbe »Piep«; diese Untugend legen sie auch erst ab, wenn sie vollkommen erwachsen sind.
Alte Kraniche werden nur von einem früher vorbereiteten, den Vögeln also nicht mehr auffallenden Verstecke aus mit einiger Sicherheit erlegt, übrigens bloß durch Zufall erbeutet, vorausgesetzt, daß nicht besondere Umstände, beispielsweise drückende Hungersnot, sie das ihnen sonst eigene Wesen vergessen lassen. Wie vorsichtig sie sind, habe ich am besten in der Winterherberge erfahren, in der doch alle Vögel leichter als sonst erlegt werden können. Nur wenn wir uns nachts auf jene Sandinsel begaben, dort ruhig niederlegten, das Boot wieder wegfahren ließen und so den Vögeln glauben machten, daß die Störung eine zufällige gewesen sei, durften wir auf ein günstiges Jagdergebnis rechnen. Sonst brachte bloß die weittragende Büchse einen oder den andern in unsere Gewalt und dies auch bloß dann, wenn wir uns von einem der Ufer aus im Walde bis auf Schußweite anschleichen konnten. Eine Störung, und noch mehr der Verlust eines Gefährten, macht die übrigen dem Jäger geradezu unnahbar. Das Fleisch haben wir gern gegessen, gewöhnlich aber zur Bereitung einer vortrefflichen Suppe benutzt. In früheren Zeiten schätzte man es höher; Kranichwildbret durfte bei großen Gastmählern auf den Tafeln der reichen Jagdherren nicht fehlen. In Asien beizt man die dortigen Arten mit Falken und verfolgt sie auch in anderer Weise eifrig, um ihre Federn zu verwenden.
*
Der Pfauenkranich ( Balearica pavonina), Vertreter der Sippe der Kronenkraniche ( Balearica), ist schwarz, seine Krone goldgelb und schwarz gemischt; die Flügeldeckfedern sind rein weiß, die Oberarmschwingen rostbraun, die letzten goldgelb. Das Auge ist weiß, die Wange oben lichtfleischfarben, unten hochrot, der Schnabel schwarz, an der Spitze weißlich, der Fuß schwarzgrau. Im Leben liegt ein bläulicher Duft über dem Gefieder, weshalb dieses graulich erscheint. Die Länge beträgt neunundneunzig, die Breite einhundertachtundachtzig, die Fittichlänge einundfünfzig, die Schwanzlänge zweiundzwanzig Zentimeter. Die Heimat des Vogels ist Mittelafrika, ungefähr vom sechzehnten Grade nördlicher Breite an nach Süden. Hier bewohnt er nach meinen Beobachtungen paar- oder gesellschaftsweise die mit Gebüsch bedeckten flachen Ufer der Ströme oder die dünner bestandenen Waldungen, kommt aber täglich auf die Strominseln, um hier zu trinken und zu tanzen. Während der Regenzeit begegnet man ihm paarweise, sonst in Gesellschaften, die zuweilen mehr als hundert Stück zählen. Diese Schwärme gesellen sich auch wohl zu den im Sudan überwinternden Scharen des grauen und Jungfernkranichs.
In seinem Wesen erinnert der Pfauenkranich nur entfernt an seine Namensvettern. Sein Gang ist aufrecht; der Rücken wird dabei wenig gekrümmt, die Krone aufgerichtet. In der Regel geht er langsam; geängstigt aber kann er, wie mich flügellahm Geschossene belehrten, so schnell laufen, daß ein Mensch sich sehr anstrengen muß, wenn er ihn einholen will. Vor dem Aufstehen rennt er mit geöffneten Flügeln ein Stück auf dem Boden dahin und erhebt sich erst dann in die Luft. Sein Flug ist langsam; die Flügel werden in gemessenen Schlägen bewegt; der Hals wird weit vorgestreckt, die Krone nach hinten zurückgelegt. Aber gerade der fliegende Pfauenkranich zeigt sich in seiner vollen Pracht, weil die beiden Hauptfarben, schwarz und weiß, jetzt zur Geltung kommen. Verwechseln kann ihn derjenige, der ihn einmal sah, mit keinem andern Sumpfvogel. Auch der laufende Pfauenkranich ist eine anziehende Erscheinung, namentlich wenn er sich auf einer grünen Fläche oder zwischen grünem Gebüsche bewegt. Höchst eigentümlich sind die tanzartigen Bewegungen, die er bei jeder Erregung zum besten gibt. Pfauenkraniche, die auf einer Sandfläche stehen, beginnen zu tanzen, sooft eine ungewöhnliche Erscheinung sie beschäftigt, sooft einer zu dem großen Haufen stößt usw. Der Tänzer springt in die Höhe, nicht selten meterhoch vom Boden auf, breitet dabei die Flügel ein wenig und setzt die Füße tanzend nieder, nicht immer beide gleichzeitig, sondern zuweilen einen um den andern. Ob beide Geschlechter tanzen, weiß ich nicht, glaube jedoch annehmen zu dürfen, daß nur das Männchen in dieser Weise sich belustigt. Die Stimme ist ein lauter Ruf, der durch den arabischen Namen des Vogels »Rharnuk«, ein Klangbild des Geschreies, ziemlich richtig wiedergegeben wird; man vernimmt sie im Walde auf eine Entfernung von zwei Kilometer. Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus Sämereien, während der Reife des Getreides nur aus Durrah oder Kafferhirse, sonst aus verschiedenen Körnern, insbesondere aus den Samen einiger Grasarten; nebenbei nimmt der Vogel Baumknospen, Grasspitzen, Früchte und Kerbtiere, ausnahmsweise vielleicht auch Muscheln und kleine Fischchen zu sich, ohne jedoch Entbehrung zu bekunden, wenn diese Nahrung ihm fehlt.
Das tägliche Leben des Pfauenkranichs ist ein sehr geregeltes. Von dem Schlafplatze aus zieht er mit Sonnenaufgang in die Steppe hinaus, verweilt hier, Futter suchend, ungefähr zwei Stunden, erscheint sodann auf den Sandbänken im Strome, trinkt, putzt sich das Gefieder und vergnügt sich in der angegebenen Weise. Zuweilen wird in den Nachmittagsstunden ein kurzer Ausflug gemacht; in der Regel jedoch genügt die Morgenmahlzeit für den ganzen Tag. Gegen Abend teilen sich die Herden in kleinere Trupps, und diese fliegen nun gemeinschaftlichen Schlafplätzen zu. Am Blauen Nil belehrten mich die Pfauenkraniche, daß sie nur im Walde übernachten. Einige vorüberziehende zeigten mir die Richtung des Weges, und nachdem ich einige Minuten weit gegangen war, vernahm ich auch die Trompetentöne der schreienden Schlafgesellschaft. Es ging sehr laut zu auf dem Versammlungsorte; aber die Töne klangen so schwach zu mir herüber, daß ich bald einsah, derselbe müsse noch in weiter Ferne sein. In der Tat hatte ich noch eine gute Viertelstunde zu gehen, bevor ich den Schlafplatz erreichte. Zu meiner nicht geringen Überraschung fand ich dreißig bis vierzig Pfauenkraniche auf den Bäumen eines kleinen, rings von der Steppe umgebenen Wäldchens sitzen, keinen einzigen auf der Erde. Diese Wahrnehmung, die ich später wiederholt machte, bestimmte mich zu glauben, daß die Pfauenkraniche auch auf Bäumen und nicht auf dem Boden nisten. Über die Fortpflanzung selbst habe ich eigene Beobachtungen leider nicht sammeln können.
Schon seit längerer Zeit wird der schöne und ausfallende Vogel von den Westafrikanern gezähmt und demgemäß auch oft nach Europa gebracht. Mit Hühnern oder Stelzvögeln vertragen sich die Gefangenen vortrefflich; ihren Gebieter bewillkommnen sie bei Gelegenheit durch ihre lustigen Tänze. In den Tiergärten ziehen sie die Besucher lebhaft an, weil sie in der Regel auch zu tanzen beginnen, wenn sie Musik vernehmen.
Feldstörche ( Arvicolidae) nennt Burmeister einige große Sumpfvögel mit kurzem oder mäßig langem, nicht sehr kräftigem Schnabel, dessen Spitze von einer Hornkuppe überkleidet ist, während die Wurzel nur einen häutigen Überzug besitzt. Die erste Sippe umfaßt die Schlangenstörche ( Dicholophus), höchst eigentümlich gestaltete Vögel, die in vieler Hinsicht an den Kranichgeier erinnern. Der Schnabel ist etwas kürzer als der Kopf, schlank, gestreckt, an seinem Wurzelteil gerade, gegen die Spitze hin gebogen und hakig, einem gestreckten Raubvogelschnabel nicht unähnlich, der Fuß sehr hoch, weit über die Ferse hinauf unbefiedert, besonders ausgezeichnet noch durch die dicken, stark gekrümmten und zugespitzten Krallen, also ebenfalls an den Fang eines Raubvogels erinnernd, das Gefieder der Stirn vom Schnabelgrunde an zu einem aufrechtstehenden Schopfe verlängert, das des Bauches und Steißes weich und daunig, das die Nasengrube und den Mundrand umgebende borstig; ein Zügelfleck bleibt unbefiedert.
Das Gefieder der Seriema ( Dicholophus cristatus) ist grau, jede Feder mit feineren, helleren und dunkleren Querzickzackwellenlinien gezeichnet, die auf der Vorderbrust die Schaftgegend frei- und daher einen Schaftstreifen hervortreten lassen; die des Unterbauches haben keine Zeichnung; die verlängerten des Kopfes und Halses sind schwarzbraun, die Schwingen braun. Die Länge beträgt zweiundachtzig, die Fittichlänge siebenunddreißig, die Schwanzlänge einunddreißig Zentimeter.
Die Seriema ist über einen großen Teil Südamerikas verbreitet und lebt in den großen, offenen Triften des inneren Brasilien, wo sanfte, mit Gras bewachsene Höhen oder Ebenen mit einzelnen Gesträuchen abwechseln. Man beobachtet sie paar- oder nach der Brutzeit familienweise zu drei oder vier zusammen, bekommt sie aber nur da zu sehen, wo sie sich nicht im Grase verstecken kann. Ihre Färbung kommt, laut Burmeister, in den dürren Steppen ihr sehr zustatten. Sie duckt sich, wenn sie Geräusch hört, hebt nur dann und wann den Kopf ein wenig und läuft hierauf rasch zwischen den Halmen fort, ohne sich zu zeigen. »Obgleich ich den Vogel täglich in den Campos gehört habe und namentlich auf meinem Lager in früher Morgendämmerung, habe ich ihn doch nie zu Gesicht bekommen. Dicht neben mir hörte ich oftmals einen Ton, und wenn ich heranritt, war alles still, kein Halm, viel weniger ein Vogel regte sich.« Der Prinz von Wied sagt, daß der Lauf dem eines Truthahnes ähnele; Burmeister fügt dem hinzu, daß er schneller dahinrenne, als ein Pferd zu traben vermöge, und nur im Galopp eingeholt werden könne. In der Ruhe ist der Hals eingezogen, der Vorderteil des Leibes erhoben und der Schwanz geneigt. Während des Tages sieht man die Seriema selten ruhig; sie steht, geht oder läuft beständig umher. Burmeister sagt, daß sie die Nacht in den Kronen mäßig hoher Bäume verbringe. In der Freiheit wie in der Gefangenschaft vernimmt man oft die laute, weithinschallende Stimme. Sie klingt, nach Burmeisters Meinung, wie das Gebelfer und Gekläff eines jungen Hundes, nach Homeyers Angabe raubvogelstimmig und ungemein kreischend. Auch der schreiende Vogel sitzt am liebsten etwas erhöht, schreit wenigstens, solange er auf dem Boden umherläuft, minder laut und anhaltend. Zuweilen schreit der Vogel eine halbe Stunde lang.
Die Nahrung besteht vorzüglich in den Kerbtieren des Campo; doch vertilgt die Seriema auch viele Schlangen, Eidechsen und dergleichen. In den Augen der Brasilianer ist sie deshalb ein allgemein geachtetes Tier, und das Gesetz verbietet, sie zu töten. Der Prinz fand ihren Magen gänzlich mit Heuschrecken vollgepfropft; Burmeister gibt auch noch saftige Beeren als Futter an. Gefangene fressen Fleischstücke, Brot, Kerbtiere und dergleichen, bekunden übrigens wirkliche Raubgelüste, sooft sie können. »Sperlinge, junge Ratten und Mäuse«, sagt Homeyer, »die sich dem Futterkasten nähern, werden oft, indem sich der Vogel im schnellsten Laufe auf sie stürzt, mit unendlicher Geschicklichkeit gefangen und, nachdem sie erst im Wasser vollkommen eingeweicht und mundgerecht gemacht worden sind, mit Haut und Haaren verschluckt. Das Einweichen geschieht vorzugsweise bei größeren Arten, wie Ratten und Sperlingen, seltener bei kleineren, den Mäusen zum Beispiel.« In der Paarzeit streiten sich die männlichen Seriemas heftig um die Weibchen. »Kommt die Seriema in Streit«, sagt Homeyer, »so macht sie tolle Sprünge, sträubt das Halsgefieder, bläht sich raubvogelartig auf und breitet den Schwanz während eines Sprunges in der Luft fächerförmig aus, nebenbei auch vielleicht, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, den einen oder den andern Flügel. So wird bald springend, bald laufend der Gegner unter den drolligsten Gebärden angegriffen und verfolgt. Der Schnabel ist als die eigentliche Waffe zu betrachten, indem die Seriema mit ihm einen glücklichen Griff tut und dem Gegner viele Federn ausrupft, während der oft vorgeschnellte Fuß nie krallt, sondern nur Stöße und Fußtritte gibt. Übrigens sind diese Zwistigkeiten zwischen den Seriemas oder ihnen und andern Vögeln überhaupt nie von langer Dauer, nehmen auch nie einen bösartigen Charakter an.«
Das Nest wird auf einem niederen oder mäßig hohen Baume angelegt. Eins, das der Prinz fand, konnte mit der Hand erreicht werden. Es bestand aus dürren Reisern, die unordentlich quer über die Zweige gelegt waren, und einer Schicht von Letten oder Kuhmist, die die Mulde bildete. In ihr findet man zwei weiße, spärlich rostrot getüpfelte Eier, die Pfaueneiern in der Größe ungefähr gleichkommen, und später die in dichte, rostgelbe, grauschwarzbraun gewellte Daunen gekleideten Jungen, die einige Zeit im Nest zubringen, dann aber von den Alten ausgetrieben werden sollen. Ihrer leichten Zähmbarkeit halber hebt man sie, wenn sie halbwüchsig sind, aus, um sie im Gehöft aufzuziehen. Sie gewöhnen sich, laut Burmeister, schon nach zweitägiger Pflege so an den Menschen, daß sie auf seinen Ruf herbeieilen, um ihre Nahrung von ihm zu empfangen. Nachdem sie erwachsen, spielen die Jungen den Meister des übrigen Geflügels auf dem Hühnerhofe, leben jedoch mit diesem ziemlich in Frieden. Nachts schlafen sie stets auf erhabenen Standpunkten, am liebsten auf den aus Reisern geflochtenen Dächern der Sonnenschauer. Man gewährt ihnen vollkommene Freiheit; sie laufen weit umher, kehren aber immer wieder zu dem Gehöft zurück und benehmen sich schließlich ganz wie Haustiere.
*
Unsere Wasserralle gilt als Urbild einer an Arten zahlreichen, über die ganze Erde verbreiteten gleichnamigen Familie ( Rallidae) zierlicher Sumpfvögel, die sich kennzeichnen durch hohen, seitlich stark zusammengedrückten Leib, mittellangen Hals, kleinen Kopf, verschieden gestalteten, seitlich zusammengedrückten, selten mehr als kopflangen Schnabel, hohe, langzehige Füße mit stets entwickelter Hinterzehe, ziemlich kurze, abgerundete Flügel, die die zusammengelegte Schwanzspitze nicht erreichen, langen, zugerundeten Schwanz und reiches, jedoch glattanliegendes Gefieder.

Wasserralle ( Rallus aquaticus)
Die Wasserralle oder Tauschnarre ( Rallus aquaticus) ist die Vertreterin einer gleichnamigen Sippe ( Rallus). Der Oberkörper des alten Männchens erscheint auf gelbem Grunde schwarz gefleckt, weil alle Federn ölbraune Ränder zeigen; die Kopfseiten und der Unterkörper sind aschblaugrau, in den Weichen schwarz und weiß gebändert, Bauch und Steiß rostgraugelb, die Schwingen matt braunschwarz, olivenbraun gerändert, die Steuerfedern schwarz, ölbraun gesäumt. Das Auge ist schmutzighellrot, der Schnabel auf der Firste braungrau, am Kieferrande wie der Unterschnabel mennigrot, der Fuß bräunlichgrün. Die Länge beträgt neunundzwanzig, die Breite neununddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Das Weibchen ist kleiner, dem Männchen aber ähnlich gefärbt und gezeichnet. Die ausgefiederten Jungen sind auf der Unterseite rostgelblichgrau, durch schwarzgraue und schwarzbraune Spitzenflecke geziert.
Nord- und Mitteleuropa sowie Mittelasien, nach Osten bis zum Amur hin, sind das Heimatsgebiet der Wasserralle; Südeuropa und Nordafrika, ebenso auch Indien, besucht sie auf ihrer Wanderung, gehört aber schon in Ägypten zu den seltenen Wintervögeln. Ihr Zug fällt in den Oktober und März; doch begegnet man ihr mitten im Winter, um dieselbe Zeit, in der sie in Südeuropa häufig ist, einzeln auch noch in Deutschland. Auffallend ist, daß sie, trotz ihres sehr schlechten Fluges, regelmäßig auch auf einzelnen Inseln des Nordens, beispielsweise auf den Färöerinseln und auf Island, erscheint, bzw. von hier aus gar nicht wegwandert, sondern, oft recht kümmerlich, während des Winters ihr Leben an den heißen Quellen zu fristen sucht. Ihre Wanderung legt sie jedenfalls größtenteils zu Fuß zurück, dem Lauf der Flüsse folgend. Die Aufenthaltsorte der Ralle sind, wie Naumann sagt, »unfreundliche Sümpfe, die der Mensch nur ungern betritt, die nassen Wildnisse, wo Wasser und Morast unter dichten Pflanzen versteckt und diese mit Gebüsch vermischt sind, oft in der Nähe von Waldungen gelegene oder selbst von diesen umschlossene schilf- und binsenreiche Gewässer, Erlenbrüche und solche Weidengebüsche, die mit vielem Schilf und hohen Gräsern abwechseln, viel Morast und Wasser haben oder von Schilf- oder Wassergräben durchschnitten werden«. Aus dem Zuge wählt sie sich allerlei passende Örtlichkeiten, die sie verbergen, läßt sich in Waldungen nieder, verkriecht sich in Hecken, Ställen usw.
Sie ist mehr Nacht- als Tagvogel und in der Dämmerung am muntersten. Den Tag verlebt sie im stillen, teilweise wohl schlafend. In ihrem Betragen ähnelt sie den kleinen Sumpf- oder Rohrhühnern sehr, trägt sich auch, den Rumpf meist wagerecht, den Hals eingezogen, den Schwanz hängend, so wie diese. Erblickt sie etwas Auffallendes, so reckt sie den Hals etwas empor, legt die Flügelspitze über den Bürzel und wippt wiederholt mit dem Schwanz. Beim Umherschleichen biegt sie Hals und Kopf herab, so daß sich die ganze Gestalt erniedrigt; die Schritte werden größer, folgen schneller, und wenn sie in vollen Lauf gerät, ist sie in wenigen Augenblicken dem Beobachter entschwunden und hat sich auf weithin entfernt. Sie schwimmt mit Leichtigkeit und Anmut, auch ohne Zwang, geht deshalb den tieferen Stellen des Sumpfes, auf denen ihre Beine den Grund nicht mehr erreichen, nicht aus dem Wege, vermeidet aber stets, über etwas große, freie Flächen zu schwimmen. Wird sie dabei überrascht, so flieht sie schnell, halb fliegend, halb laufend, über die Wasserfläche hin, dem nächsten Dickicht zu. Heftig verfolgt und in höchster Not sucht sie sich auf tieferem Wasser auch wohl durch Untertauchen zu retten. Ihr Flug ist schlecht, anstrengend, erfordert starke Schwingenschläge, geschieht niedrig und nie weit in einem Zuge. Sie streckt dabei die Flügel weit von sich und bewegt sie in kurzen, zappelnden Schlägen, so daß es aussieht, als ob eine Fledermaus dahinflöge. Während des Sommers nimmt sie übrigens nur, wenn ihr Gefahr droht, zu den Flügeln ihre Zuflucht; dann aber kann es geschehen, daß sie sich mitten im freien Felde oder sogar auf Bäumen niederläßt. Die gewöhnliche Lockstimme, die man abends am häufigsten vernimmt, ist ein scharfer Pfiff, der, wie mein Vater sagt, klingt, als ob jemand eine Rute schnell durch die Luft schwinge, also durch die Silbe »Wuitt« ausgedrückt werden kann. Im Fluge, namentlich während der Wanderung, vernimmt man ein hohes, schneidendes, aber angenehm klingendes »Kriek« oder »Kriep«. Mit ihresgleichen verkehrt sie wenig, scheint vielmehr zu den ungeselligsten Vögeln zu gehören; denn sie vereinigt sich auch nicht einmal auf dem Zuge mit andern ihrer Art.
Gefangene Rallen gewöhnen sich bald an den Verlust ihrer Freiheit und an den Käfig. Anfänglich suchen sie sich freilich beständig unter Hausgerät zu verstecken; nach kurzer Zeit aber werden sie zutraulich und zuletzt so zahm, daß sie ihrem Pfleger Futter aus der Hand nehmen, sich sogar streicheln lassen. Ein Arzt in Saalfeld hatte eine Ralle so gezähmt, daß sie ihm im Hause nachlief wie ein Hund, auf seine Gebärden achtete und im Winter mit ihm das Bett teilte, d. h. wirklich unter die Bettdecke kroch, um sich hier zu wärmen. Das muntere Wesen, die mannigfaltigen Stellungen und solche Zutraulichkeit gewinnen ihr jeden Liebhaber zum Freunde.
In der Freiheit nährt sich die Ralle hauptsächlich von Kerbtieren, deren Larven, Würmern und Weichtieren, später auch von Samen, insbesondere Gras- und Schilfsämereien. Wahrscheinlich verschmäht sie ein Vogelei ebensowenig wie ihre nächsten Verwandten.
Das Nest, ein loses Geflecht aus trockenen Schilfblättern, Binsen und Grashalmen von tiefnapfförmiger Gestalt, steht im dichten Grase oder Schilf sehr verborgen und wird selten entdeckt, obgleich die Alten seinen Standort durch ihre Abendmusik anzeigen. Gewöhnlich findet man es am Rande eines Wassergrabens, bald unter Weidengesträuch, bald auch in weniger dichten Schilfgräsern, sehr selten in etwas kurzem Grase. Das Gelege zählt sechs bis zehn, zuweilen noch mehr, schön gestaltete, fest- und glattschalige, feinkörnige Eier, die etwa fünfunddreißig Millimeter lang, fünfundzwanzig Millimeter dick, auf blaßgelbem oder grünlichem Grunde ziemlich spärlich mit violetten und aschgrauen Unter- und rötlichen oder zimtbraunen Oberflecken gezeichnet sind. Die Jungen tragen ein schwarzes Daunenkleid, verlassen sofort nach dem Ausschlüpfen das Nest und laufen wie Mäuse durch das Pflanzengestrüpp, schwimmen im Notfall auch recht gut. Ihre Mutter hält sie durch den sanften Lockton zusammen, bis sie erwachsen sind.
*
An schönen Maiabenden vernimmt man von Wiesen und Feldern her einen sonderbar schnarrenden Laut, der klingt, als ob man mit einem Hölzchen über die Zähne eines Kammes streicht. Dieser Laut ertönt mit wenig Unterbrechungen bis tief in die Nacht hinein und vom frühesten Morgen an bis nach Aufgang der Sonne, selten von einer Stelle, vielmehr bald von hierher, bald von dorther, obschon innerhalb eines gewissen Gebietes. Der Vogel, der das Knarren hervorbringt, ist der Wiesenknarrer, auch Schnärz und Wachtelkönig genannt ( Crex pratensis), Vertreter der Feldrallen ( Crex). Die Färbung desselben ist oberseits auf schwarzbraunem Grunde ölgrau gefleckt, weil die einzelnen Federn breite Säume tragen, unserseits an Kehle und Vorderhals aschgrau, seitlich braungrau, mit braunroten Querflecken, auf den Flügeln braunrot, durch kleine, gelblichweiße Flecke geziert. Das Auge ist lichtbraun, der Schnabel rötlichbraungrau, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt neunundzwanzig, die Breite siebenundvierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge zwei Zentimeter. Beim Weibchen ist die Färbung minder lebhaft.
Der Wiesenknarrer verbreitet sich über Nordeuropa und einen großen Teil Mittelasiens. Südeuropa berührt er regelmäßig auf dem Zuge, scheint jedoch daselbst nur ausnahmsweise zu brüten. Das Volk glaubt, daß er die Wachteln beherrsche oder führe; auch die griechischen Jäger versichern mit Bestimmtheit, daß jedem Wachtelfluge ein Wachtelkönig vorstehe. Wie der Vogel zu dieser Ehre gekommen ist, bleibt fraglich, da er in seinem Wesen nichts mit den Wachteln gemein hat, ja nicht einmal genau zu derselben Zeit wie diese wandert. Er erscheint bei uns im Mai und beginnt seine Rückwanderung Ende August, nachdem er die Mauser vollendet hat, kommt jedoch einzeln noch Mitte Oktober vor. Seinen Weg legt er des Nachts zurück; wahrscheinlich durchmißt er den größeren Teil desselben laufend.
Hinsichtlich seines Aufenthaltes richtet sich der Wiesenknarrer nach den Umständen. Er bewohnt fruchtbare Gegenden, insbesondere Ebenen, ohne jedoch das Hügelland zu meiden, bezieht am liebsten Wiesen, die von Getreidefeldern umgeben werden oder in deren Nähe liegen, liebt aber ebensowenig sehr feuchte wie sehr trockene Lagen und scheint oft lange suchen zu müssen, ehe er die rechte Örtlichkeit findet. Nach der Mahd begibt er sich in das Getreide und bei der Ernte von diesem in das Gebüsch, tut dies jedoch nicht eher, als bis die Sense ihn dazu zwingt.
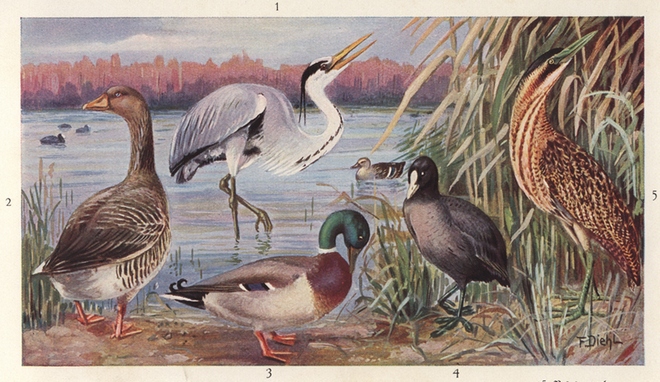
Wasservögel:
Auch er ist mehr Nacht- als Tagvogel, schweigt wenigstens in den heißen Stunden gänzlich und läßt sich, mit Ausnahme der Mitternachtsstunden, die ganze Nacht hindurch hören. Aber er versteckt sich bei Tage wie bei Nacht. »Um recht versteckt sein zu können«, sagt mein Vater, »macht er sich im tieferen Grase besondere Gänge, in denen er mit der größten Leichtigkeit und ohne daß sich nur ein Grashalm rührt, hin und her läuft. Daraus läßt sich auch erklären, daß man ihn bald da und kurz darauf bald dort schreien hört, sein Hin- und Herlaufen auch nicht an den Bewegungen des Grases bemerken kann. Schmale Gräben, die durch die Wiesen gezogen sind, benutzt er auch zu solchen Gängen. In ihnen ist er, da sie oben durch überhängendes Gras völlig geschlossen sind, vor den Nachstellungen der Raubvögel und vieler Raubtiere gesichert. Beim Laufen, das mit ungeheurer Geschwindigkeit vonstatten geht, drückt er den Kopf nieder, zieht den Hals ein, hält den Leib wagerecht und nickt bei jedem Schritt mit dem Kopf. Wegen seines ungewöhnlich schmalen Körpers ist es ihm auch da, wo er keine Gänge hat, möglich, im dichten Grase und Getreide schnell umherzulaufen, da er sich überall leicht durchdrängen kann. Er fliegt schnell, geradeaus, mit schlaff herunterhängenden Beinen, niedrig über dem Boden weg und nur kurze Strecken durchmessend, ist aber sehr schwer zum Auffliegen zu bringen.« Vor dem Hunde hält er oft so lange aus, daß es ersterem nicht selten gelingt, ihn beim Auffliegen wegzuschnappen, und wenn er sich wirklich erhebt, flattert er mehr, als er fliegt, wie ein junger Vogel, der seine Flugwerkzeuge zum ersten Male versucht, stürzt auch sobald wie möglich auf den Boden herab. So schmuck und nett er aussieht, so unfreundlich ist sein Wesen andern seiner Art oder schwächeren Tieren gegenüber. Auch er gehört zu den Raubvögeln und ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Nestplünderer. Schon Naumann beobachtete an gefangenen Wachtelkönigen Bissigkeit und Herrschsucht, erfuhr auch, daß sie kleine Sänger oder finkenartige Vögel hackten oder selbst totbissen und dann das Gehirn verzehrten, fand selbst getötete Mäuse, die sie beim Futternapf ergriffen hatten; Wodzicki hatte Gelegenheit, diese Raubsucht in ausgedehnterem Maße kennenzulernen. In einem Gesellschaftsbauer lebten viele kleine Vögel in Eintracht, bis ein Wiesenknarrer zu ihnen gesetzt wurde. Von dieser Zeit an fand man täglich getötete und teilweise verzehrte Vögel, und zwar nicht nur von den kleineren Singvögeln, sondern zuweilen auch solche bis zur Größe einer Drossel. Abgesehen von solchen Übergriffen, empfiehlt sich der Wiesenknarrer sehr für die Gefangenschaft. Er ist einer der drolligsten und unterhaltendsten Vögel, die man halten kann.
Sofort nach seiner Ankunft denkt der Wiesenknarrer an die Fortpflanzung, und deshalb eben läßt er sein »Errp, errp, errp« oder »Knerrp, knerrp« fast ununterbrochen vernehmen. Durch ein zärtliches »Kjü, kjo, kjä« kost er mit seinem Weibchen, das die Liebeswerbung in ähnlicher Weise erwidert. Überschreitet ein anderes Männchen die Grenzen seines Gebietes, so wird es sofort unter häßlichem Geschrei angegriffen und wieder zurückgescheucht. Mit dem Bau des Nestes beginnt das Pärchen, wenn das Gras eine bedeutende Höhe erreicht hat, in manchen Jahren also nicht vor Ende Juni. Es erwählt einen trockenen Ort inmitten seines Gebiets und kleidet hier eine ausgescharrte Vertiefung kunstlos mit trockenen Grashalmen, Grasblättern, Moos und feinen Wurzeln aus. Die Anzahl der Eier schwankt in den meisten Fällen zwischen sieben und neun, kann jedoch bis auf zwölf steigen. Sie sind verhältnismäßig groß, siebenunddreißig Millimeter lang, sechsundzwanzig Millimeter dick, schön eigestaltig, festschalig, aber feinkörnig, glatt, glänzend und auf gelblichem oder grünlichweißem Grunde mit feinen lehm- und bleichroten, rotbraunen und aschblauen Flecken spärlicher oder dichter überstreut. Das Weibchen brütet drei Wochen so eifrig, daß es sich unter Umständen mit der Hand vom Nest wegnehmen läßt, nicht einmal vor der behenden Sense die Flucht ergreift und oft ein Opfer seiner Treue wird. Die schwarzwolligen Jungen laufen bald davon, werden von der Mutter zusammengehalten, antworten piepend auf deren Ruf, versammeln sich oft unter ihren Flügeln, stieben bei Überraschung auseinander, huschen wie Mäuse über den Boden dahin und haben sich im Nu so geschickt verkrochen, daß es recht schwer hält, sie aufzufinden. Wenn sie etwas herangewachsen sind, suchen sie auch rennend zu entkommen und zeigen dann im Laufen ebensoviel Geschicklichkeit wie vorher im Verstecken.
In Deutschland erlegt man den Wiesenknarrer zufällig mit; in Spanien und Griechenland wird er häufiger geschossen und regelmäßig aus den Markt gebracht, weil man sein Fleisch zu dem schmackhaftesten Wildbret zählt.
*
Von den Feldrallen unterscheiden sich die Sumpfhühnchen ( Ortygometra) hauptsächlich durch den niedrigeren, schlankeren Schnabel und die langzehigeren Füße. Unter den drei europäischen Arten ist das Tüpfelsumpfhühnchen ( Ortygometra porzana) das größte. Seine Länge beträgt einundzwanzig, die Breite vierzig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Stirn, Kehle, Kropf und Oberbrust sind schieferblaugrau, letztere Teile weiß getüpfelt, die Federn des Oberkopfes und Nackens olivenbraun und weißgefleckt, Mantel und Schultern dunkelolivenbraun, durch breite, schwarze Schaftflecke und sehr viele weiße Tüpfel, Flecke und Strichelchen gezeichnet, Unterrücken und Bürzel schwarz, ölbraun gefleckt und spärlich weiß bespritzt, die Weichenfedern mit breiten, olivenbraunen, schwarzschattierten und schmäleren, wellenförmig zackigen Querbinden geziert, Brust- und Bauchmitte weiß, Steiß- und Unterschwanzdeckfedern dunkelrostgelb, die Schwingen und Schwanzfedern dunkelolivenbraun, die Unterflügeldeckfedern schwarz und weiß gebändert. Das Auge ist dunkelrotbraun, der Schnabel an der Wurzel orangerot, übrigens bis gegen die schmutziggelbliche Spitze zitrongelb, der Fuß gelblichgrün. Das etwas kleinere Weibchen ist matter gefärbt als das Männchen; das Herbstkleid unterscheidet sich vom Frühlingskleide dadurch, daß Olivenbraun vorherrscht und die weißen Tüpfel minder schön sind; das Jugendkleid ist durch stärkere weiße Tüpfelung ausgezeichnet, das Nestkleid schwarz.
Ganz Europa, Mittel- und Nordasien bilden das Brutgebiet, Südeuropa, Nord- und Mittelafrika sowie Südasien die Winterherberge unseres Sumpfhühnchens. In den wasserreichen Ebenen Norddeutschlands ist es in allen Sümpfen und auf allen nassen Wiesen häufig; im Hügellande tritt es seltener, im Gebirge nur an sehr wenigen geeigneten Stellen auf. Es erscheint nicht vor der Mitte, meist erst in den letzten Tagen des April am Brutplatze und beginnt schon gegen Ende August wieder südwärts zu wandern, reist ebenfalls des Nachts, soviel wie möglich zu Fuß, und wird bei dieser Gelegenheit auch in Gegenden bemerkt, denen es während des Sommers gänzlich fehlt. Seinen Sommerstand nimmt es am liebsten auf nassen, mit vielen Gräben durchzogenen und mit Seggengras bestandenen Wiesen, kaum minder gern im eigentlichen Sumpf oder Bruch, niemals aber an freien Wasserflächen.
Im Schutze der bergenden Gräser führt es sein verstecktes Leben. Tagsüber regt es sich wenig; gegen Abend ermuntert es sich, und während der ganzen Nacht ist es in voller Tätigkeit. Ist man imstande, es zu belauschen, so sieht man, daß es sich im wesentlichen ganz nach Art des Wiesenknarrers bewegt, wie dieser im Stehen sich hält, wie dieser geht, läuft, watet und fliegt, bei Gefahr mit dem Schwanz wippt usw. Nur in einer Beziehung scheint es den Verwandten bei weitem zu übertreffen: es schwimmt und taucht ausgezeichnet, ebenso gern wie anhaltend, das Schwänzchen gestelzt, bei jedem Ruderstoße mit dem Kopf nickend, erscheint daher gerade in dieser Beziehung höchst anmutig. Sein Lockton ist ein zwar helltönender, aber mehr quietschender als pfeifender Laut, der Ausdruck der Zärtlichkeit, der beiden Geschlechtern eigen zu sein scheint, ein kurzes »Uit«, dem Geräusch, das ein fallender Tropfen in einem gefüllten Gefäß hervorbringt, vergleichbar, der Angstruf ein quakendes Geschrei. Im Vertrauen auf seine unvergleichliche Fertigkeit, sich zu verbergen, ist es durchaus nicht scheu, läßt den nahenden Hund oder Menschen im Gegenteil oft so dicht an sich herankommen, daß dieser wie jener es ergreifen kann, wird auch durch Verfolgungen kaum gewitzigt, beweist aber durch leichte Zähmbarkeit und innige Anhänglichkeit dem Pfleger gegenüber, daß es lernt. Um andere harmlose Vögel bekümmert es sich dem Anschein nach nicht, dürfte jedoch angesichts eines Nestes kleiner Sumpfvögel die Raubgelüste seiner Familie schwerlich verleugnen; denn seine Nahrung ist im wesentlichen genau dieselbe, die der Wiesenknarrer genießt.
Das Nest, ein loses, grobes Geflecht aus Schilf- und Seggenblättern oder Binsen, Grashalmen und andern feineren Stoffen, die die innere Auskleidung bilden, steht regelmäßig an wenig zugänglichen, oft rings vom Wasser umgebenen, in keiner Weise dem Blick auffallenden Stellen des Brutgebiets, aus und zwischen Seggenblättern oder Halmen, und wird im Laufe der Zeit durch beständiges Nieder- und Gegeneinanderbeugen der umstehenden Halme vom Weibchen absichtlich noch besser verborgen, so daß selbst das scharfe Auge des Weih den unter der grünen Kuppellaube brütenden Vogel nicht zu sehen vermag. Ende Mai oder in den ersten Tagen des Juni pflegt das aus neun bis zwölf Eiern bestehende Gelege vollzählig zu sein. Die Eier, deren Längsdurchmesser etwa dreiunddreißig und deren Querdurchmesser vierundzwanzig Millimeter beträgt, sind länglich eiförmig, glattschalig, feinkörnig, glänzend und auf lichtrostgelbem Grunde mit vielen feinen, dunkleren Pünktchen, violettgrauen Schalen- und, zumal am stumpfen Ende, scharf umrandeten, großen, rotbraunen Oberflecken gezeichnet. Das Männchen scheint am Brutgeschäft wenig Anteil zu nehmen, sich auch um die Jungen nicht zu kümmern und alle Sorgen der Mutter zu überlassen. Nach dreiwöchiger, hingebender Bebrütung zeitigt diese die Küchlein, die im schwarzwolligen Daunenkleide dem Ei entschlüpfen und unmittelbar nach dem Abtrocknen mit ihr davonlaufen, vom ersten Tage ihres Lebens an gleich den Eltern sich benehmen, gewandt wie Mäuse durch das Gras huschen, ohne Bedenken ins Wasser gehen, schwimmen und tauchen, bei Gefahr aber so geschickt sich bergen und drücken, daß nur die unfehlbare Nase eines Raubsäugetiers sie aufzufinden vermag. Noch ehe sie ausgefiedert sind, vereinzeln sie sich, verlassen die Mutter und beginnen aus eigene Gefahr den Weg durch das Dasein zu wandeln.
Viele Feinde stellen dem wehrlosen Vogel, noch mehr den Eiern nach, so daß seine bedeutende Vermehrung eben ausreicht, die Verluste zu decken.
*
Noch niedlicher und anmutiger als das Tüpfelsumpfhühnchen sind seine beiden unter sich im wesentlichen übereinstimmenden Verwandten, das Bruchhühnchen und das Zwergsumpfhühnchen. Ersteres ( Ortygometra parva) wird auch Meerhühnchen und Sumpfschnärz genannt. Seine Länge beträgt etwa zwanzig, die Breite zweiunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Oberkopf, Nacken, Mantel und Flügel sind auf olivenbraunem Grunde mit mehr oder minder deutlich hervortretenden tiefschwarzen Schaftflecken und einzelnen rundlichen weißen Fleckchen gezeichnet, Gesicht und ganze Unterseite aschgraublau, die Weichen- und Unterschwanzdeckfedern aber dunkel aschgrau, durch breite weiße Querbinden gezeichnet, die Schwingen schwärzlichbraun, olivenbraun gekantet, die Schwanzfedern schwarz, ölbraun gesäumt. Das Auge ist brennendrot, der Schnabel an der Wurzel hochrot, in der Mitte grün, an der Spitze gelb, der Fuß lebhaft grün. Beim Weibchen ist die Oberseite, mit Ausnahme der schwarzen, weißgefleckten Rückenmitte, olivenbraungrau, die Kehle weiß, die Brust rostgelblichgrau. Die Jungen sind auf der hellbraunen Oberseite mit weißen Längsflecken, auf den braunen Bauchseiten mit weißen Querbändern gezeichnet, Vorderhals und Oberbrust aber graulichweiß.
*
Das der eben beschriebenen Art sehr ähnliche Zwergsumpfhühnchen oder Zwergrohrhühnchen ( Ortygometra pygmaea) unterscheidet sich vom Bruchhühnchen, abgesehen von seiner geringen Größe, durch den grünen Schnabel und den blaßroten Fuß. Die Länge beträgt etwa neunzehn, die Breite dreißig, die Fittichlänge über acht, die Schwanzlänge fünf Zentimeter.
Zurzeit läßt sich weder das Brutgebiet noch der gesamte Verbreitungskreis beider in Sein und Wesen, Sitten und Gewohnheiten so nahe verwandten Sumpfhühnchen mit einiger Sicherheit umgrenzen. Beide leben so versteckt, daß sie wahrscheinlich weiter verbreitet sind und innerhalb der uns bekannten Grenzen viel häufiger auftreten, als wir glauben. Das Bruchhühnchen bewohnt von Südskandinavien an südlich ganz Europa, ebenso Mittelasien. In Deutschland ist es unzweifelhaft häufiger, als wir annehmen, in Schlesien wie in den Rheinlanden, in Schleswig-Holstein wie in Bayern heimisch, mit einem Worte überall beobachtet worden, wo ein Vogelkundiger geeignete Brutorte genau durchforschte. Das Zwergsumpfhühnchen scheint in Deutschland seltener aufzutreten, ist jedoch ebenfalls im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen, an den Grenzen wie im Herzen unseres Vaterlandes beobachtet worden. Beide Arten erscheinen, einzeln und des Nachts wandernd, bei uns zulande erst im Mai, gewöhnlich nicht vor Mitte des Monats, beziehen ruhige, wasserreiche Brüche oder ungestörte, mit Schilf umsäumte und Seggengras umgebene, an Wasserrosen reiche Seen, auch wohl tote Flußarme, Sümpfe und Sumpfwiesen, leben still und versteckt, zeigen sich bei Tage seltener als in den Abend- und Nachtstunden, lassen sich auch schwer auftreiben, treten bereits im August, spätestens im September, ihre Winterreise an, und entziehen sich so der Beobachtung mehr als jede andere Art ihrer Familie.
Alle Beobachter, die so glücklich waren, die eine oder andere Art im Freien zu belauschen, sind des Lobes voll. Wie beide das Tüpfelsumpfhühnchen an Schönheit übertreffen, überbieten sie es auch an Anmut des Auftretens, so ähnlich alle Bewegungen, alle Sitten und Gewohnheiten dem Gebaren jenes sind. Sie laufen, schwimmen und tauchen ebenso hurtig und behend, stiegen ebenso schlecht, matt, niedrig und kurz, flatternd und mit herabhängenden Beinen, wissen sich ebenso gewandt zu verbergen wie das Tüpfelhühnchen, zeigen sich aber doch öfter als dieses frei, zuweilen in förmlich herausfordernder Weise. Namentlich gilt dies vom Bruchhühnchen, das in Naumann und Kutter treffliche Beobachter gefunden hat. »Zuweilen«, sagt der Altmeister, »kommt das harmlose Geschöpf, wenn es Menschen nahe am oder auf dem Wasser laut verkehren hört, aus seinem Versteck hervor, stellt sich, gewöhnlich auf der Wasserseite, auf schwimmende Seerosenblätter oder ein anderes schwimmendes Inselchen keck ins Freie und begrüßt jene mit gellender Stimme.« Auch Kutter hebt die geringe Scheu oder auffallende Zuversicht derselben Art bei Schilderung seiner Beobachtungen eines von ihm belauschten Pärchens hervor. »Bald«, sagt er, »lief das Weibchen in geduckter Stellung pfeilschnell auf den Seerosenblättern und der den Wasserspiegel überziehenden dünnen Pflanzendecke dahin, hier und da ein Wasserkerbtier erhaschend, bald schwamm es mit zierlichem Kopfnicken hurtig zwischen den Blättern einher. Auch das Männchen sah ich häufig, und beide kamen bei ihren Jagden und Spielen so in meine unmittelbare Nähe, daß sie mich gewahren mußten; aber stören ließen sie sich nicht. Nur eine plötzliche Bewegung meinerseits war geeignet, sie sofort zu erschrecken; blitzschnell tauchten sie in das schützende Element und waren dann für längere Zeit unsichtbar.« Die Stimme beider Arten ist hoch und hellgellend, mehr quiekend als pfeifend, die der einen Art der der anderen so ähnlich, daß sich kaum Unterschiede angeben lassen; den Lockton bezeichnet Naumann als ein hellpfeifendes »Kiihk«, den herausfordernden Laut, angesichts herannahender Menschen, als ein kurzes, oft wiederholtes, rasch auseinander folgendes, dem Lockrufe des Mittelspechtes gleichendes »Kik, kik, kik.«
Allerlei im oder am Wasser lebende Kerbtiere oder deren Larven, Lauf- und Rohrkäfer, Hafte, Fliegen, Mücken, Schnaken und Spinnwanzen, kleine Heuschrecken z.+B., auch Spinnen und Schnecken bilden die Nahrung beider Sumpfhühnchen. Zarte Pflanzenteile scheinen sie zufällig mit zu verschlucken, Sämereien nur im Notfalle zu genießen. Gefangene, die ich pflegte, in jeder Beziehung reizende Geschöpfe, gewöhnen sich bald an ein reichlich mit Ameisenpuppen und Mehlwürmern gewürztes Mischfutter.
Gegen Ende Mai oder Anfang Juni schreiten beide Arten zur Fortpflanzung. Zum Standorte ihres Nestes wählen sie einen dichten Erlen-, Weiden- oder Seggenbusch im Wasser selbst oder doch in unmittelbarer Nähe desselben, am liebsten einen rings umflossenen, knicken einige Seggenstengel übereinander oder benutzen einen passenden Strauchzweig und errichten auf dieser unsicheren Unterlage ihren aus zerschlissenen trockenen Schilfblättern bestehenden, sorgfältig verflochtenen, napfförmigen Bau. Das Gelege zählt beim Bruchhühnchen acht bis zehn, beim Zwergsumpfhühnchen sieben bis acht glattschalige und feinkörnige, aber glanzlose Eier, die bei ersterem einen Längsdurchmesser von zweiunddreißig, bei letzterem einen solchen von sechsundzwanzig, bei jenem einen Querdurchmesser von zweiundzwanzig, bei diesem von zwanzig Millimeter haben, bei jenem auf schwachem und trübem, braun- oder lehmgelbem Grunde mit vielen gelbgrauen und gelblichbraunen Punkten bestreut, bei diesem aus graugelblichem Grunde mit aschgrauen Schalen- und rotbraunen Oberflecken gezeichnet sind. Die Weibchen brüten sehr eifrig und führen die Jungen, sobald diese abgetrocknet, vom Neste aus in den Sumpf oder Bruch, unter Umständen weit vom Neste weg. Das schwarzwollige Daunenkleid der Küchlein geht binnen drei Wochen in das Jugendkleid über, und damit ist für das kleine Volk der Zeitpunkt gekommen, ihre Mutter zu verlassen.
Dieselben Feinde, die das Tüpfelsumpfhuhn bedrohen, gefährden auch dessen zwerghafte Verwandten; die Eier namentlich werden von Wasserratten oft zerstört, auch die Jungen oder brütenden und führenden Weibchen, die, jenen zuliebe, bei Gefahr sich preisgeben, von laufendem oder fliegendem Raubzeuge weggefangen.
Die Wasserhühner ( Fulicidae), eine über alle Teile der Erde verbreitete Familie, stehen den Rallen so nahe, daß sie von einzelnen Forschern als solche betrachtet werden. Sie kennzeichnen kräftiger Leib, mittellanger Hals, großer Kopf, kurzer, meist kräftiger, hoher, dicker, auf der Firste gebogener Schnabel mit nackter Stirnschwiele, kräftige, mittelhohe Füße, sehr kurze Flügel, sehr kurzer Schwanz und reiches, weiches, wasserdichtes, weitstrahliges, mehr oder weniger einfarbiges Gefieder. Alle Arten dieser Familie bewohnen schilfreiche Seen, größere Sümpfe und Brüche, Teiche und pflanzenbedeckte Flußufer, immer aber süße Gewässer, treiben sich viel im Schilfe und noch mehr auf dem pflanzenbedeckten Wasserspiegel umher, sind im Laufen weniger geschickt als die Rallen, übertreffen diese aber durch ihre bedeutende Schwimm- und Tauchfertigkeit und ähneln ihnen hinsichtlich ihres schwerfälligen, wankenden und ermüdenden Fluges.
Obenan stellen wir die Sultanshühner ( Porphyrio), deren in Europa lebendes Mitglied von den alten Römern und Griechen in der Nähe der Tempel unterhalten und gleichsam unter den Schutz der Götter gestellt wurde. Das Purpurhuhn ( Porphyrio veterum) ist im Gesicht und am Vorderhals schön türkisblau, auf Hinterhaupt, Nacken, Unterleib und Schenkeln dunkelindigoblau, auf der Unterbrust, dem Rücken, den Deckfedern der Flügel und den Schwingen ebenso, aber lebhafter gefärbt, in der Steißgegend weiß. Das Auge ist blaßrot, ein schmaler Ring um dasselbe gelb, der Schnabel nebst der Stirnplatte lebhaft rot, der Fuß rotgelb. Junge Vögel sind oben graublau und unten weiß gescheckt. Die Länge beträgt siebenundvierzig, die Breite dreiundachtzig, die Fittichlänge vierundzwanzig, die Schwanzlänge zehn Zentimeter. Das Purpurhuhn lebt in sumpfigen und wasserreichen Gegenden Italiens, Spaniens, Portugals, Südrußlands, Nordwestafrikas und Palästinas, verfliegt sich nicht selten nach Norditalien und Südfrankreich, ist auch schon wiederholt in Großbritannien und einmal, im Jahre 1788, bei Melchingen im Sigmaringischen erlegt worden.
Alle Sultanshühner bewohnen vorzugsweise Sümpfe, in deren Nähe Getreidefelder liegen, oft auch die Reisfelder selbst, die ja beständig überschwemmt gehalten werden und deshalb wahre Sümpfe sind. In ihrem Betragen erinnern sie am meisten an unser Teichhühnchen, tragen sich aber stolzer und schreiten würdevoller dahin. Ihr Gang ist abgemessen, jedoch zierlich. Ein Bein wird bedachtsam vor das andere gesetzt, beim Aufheben der Fuß zusammengelegt, beim Niedersetzen aber wieder so ausgebreitet, daß die Zehen eine verhältnismäßig bedeutende Fläche einnehmen, jeder Schritt außerdem mit einem Wippen des Schwanzes begleitet, übrigens ist das Sultanshuhn ebenso wie das Teichhühnchen fähig, halb flatternd, halb laufend über eine schwankende Decke von schwimmenden Pflanzen wegzurennen. Das Schwimmen versteht es sehr gut, geht nicht bloß gezwungen, sondern, wie das Teichhühnchen, oft und gern ins Wasser, liegt leicht auf den Wellen und rudert mit anmutigem Neigen des Hauptes dahin. Im Fluge zeichnet es sich bloß durch seine Schönheit, nicht aber durch die Leichtigkeit der Bewegung vor den Verwandten aus. Es erhebt sich ungern in die Luft, flattert unbehilflich eine Strecke fort und fällt dann rasch wieder auf den Boden herab, am liebsten in hohes Schilf, Ried oder Getreide, um hier sich zu verbergen. Seine langen, roten Beine, die es, wenn es fliegt, herabhängen läßt, zieren es übrigens sehr und kennzeichnen es von weitem. Die Stimme erinnert an das Gackern oder Glucksen der Hühner, aber auch an die unseres Teichhühnchens, nur daß sie stärker und tiefer klingt. Eigentlich scheu kann man die Purpurhühner nicht nennen; vorsichtig aber sind sie doch, und Verfolgung macht sie bald ungemein ängstlich.
Zeitweilig fressen die Sultanshühner nur Pflanzenstoffe, und zwar frisch aufsprossendes Getreide oder Grashalme überhaupt, Blätter und verschiedene Sämereien, vorzugsweise Reis; während der Brutzeit aber schleichen sie beständig im Sumpfe umher, suchen Nester auf, plündern diese, begnügen sich keineswegs mit den Bruten schwächerer Vögel, sondern rauben selbst die Gelege stärkerer, werden dadurch also sehr schädlich. In allen Sümpfen, die Purpurhühner beherbergen, findet man beim Nachsuchen Massen von zerbrochenen Eierschalen, und an gefangenen Sultanshühnern beobachtet man sehr häufig Raubgelüste der verschiedensten Art. Wie die Raubvögel lauern sie aus Sperlinge, die von ihrem Futternapfe naschen wollen, und wie eine Katze vor den Löchern der Mäuse. Ein einziger Hieb des kräftigen Schnabels genügt, dem Opfer den Garaus zu machen? dann wird es mit einem Beine gepackt, festgehalten, zerrissen und die Bissen mit dem Fuße zum Munde gebracht. Fische verzehren sie mit Begierde.
Vor der Brutzeit halten sich die Purpurhühner am liebsten in Reisfeldern auf, während der Nistzeit selbst siedeln sie sich, wo sie können, im Röhrichte oder Schilfe an. Das Nest steht ziemlich verborgen, in der Regel auf dem Wasserspiegel selbst, ist von dürren Gras- und Reisstengeln, Schilf und Rohrblättern errichtet, etwas, liederlich zusammengebaut, dem unseres Wasserhuhnes entfernt ähnlich, und enthält im Mai drei bis fünf Eier. Letztere sind etwas größer als Birkhühnereier, durchschnittlich fünfundfünfzig Millimeter lang, achtunddreißig Millimeter dick, haben eine schöne längliche Eigestalt, glatte, aber wenig glänzende Schale und tragen auf dunkelsilbergrauem, fleischfarbigem oder rotgrauem Grunde violettgrauliche Unter- und rotbraune, sehr einzeln stehende Oberflecke. Die Jungen entschlüpfen in einem schwarzblauen Daunenkleide, lernen bald schwimmen und untertauchen, werden von beiden Eltern geführt, mit warmer Zärtlichkeit überwacht und bei Gefahr gewarnt. An Sultanshühnern, die ich pflegte, beobachtete ich, daß beide Geschlechter bauen, abwechselnd brüten und gemeinschaftlich die Jungen führen. Doch hütet das Männchen nur so lange das Nest, als das Weibchen bedarf, um sich zu sättigen, hält dafür aber, während dieses brütet, treue Wacht und greift jeden gefiederten Ankömmling, am heftigsten seinesgleichen an. Nach achtundzwanzigtägiger Bebrütung entschlüpfen die Jungen, bedürfen jedoch noch mehrtägiger Pflege im Neste, bevor sie dasselbe verlassen können, und werden bis dahin von der Mutter gehudert und sorgfältig mit den Stoffen geatzt, die das Männchen für sie und die Gattin herbeibringt. Später nimmt auch der Vater an der Atzung teil, faßt, wie er es der Mutter abgesehen, ein Bröcklein Nahrung so behutsam mit der Schnabelspitze, daß es an dieser nur zu kleben scheint, beugt sich nach unten und hält den Jungen so lange die Bissen vor, bis diese sich entschließen, letzteren vom Schnabel abzupicken. Erst am achten Tage ihres Lebens verlassen die Küchlein das Nest, beginnen, holperig trippelnd, umherzulaufen, lernen nach und nach gehen, endlich laufen, lassen sich nun entweder von der Mutter allein oder teils von dieser, teils vom Vater führen, entschließen sich aber erst sehr spät, selbst Futterstoffe aufzunehmen.
Alle Sultanshühner lassen sich leicht zähmen, gewöhnen sich bald an allerlei Futter, an die Hausgenossen, loben friedlich mit den Hühnern, vorausgesetzt, daß diese erwachsen sind, treiben sich, wenn man ihnen größere Freiheit gibt, in Hof und Garten oder auf der Straße umher, kommen in die Zimmer, betteln bei Tische und werden dann wirklich zu einer wahren Zierde des Gehöftes, dauern auch lange Jahre aus und schreiten bei geeigneter Pflege leicht zur Fortpflanzung.
*
Der kegelförmige, seitlich zusammengedrückte Schnabel mit Stirnschwiele und scharfer, sein gezähnelter Schneide, die großen Füße mit langen, an der Sohle breiten und belappten Zehen, die stumpfen breiten Flügel, der kurze Schwanz und das reiche, dichte Gefieder kennzeichnen das Teichhuhn oder Rotbläßchen ( Gallinula chloropus), das Urbild einer gleichnamigen Sippe ( Gallinula), ein trotz seines einfachen Kleides höchst zierliches Geschöpf. Das Gefieder ist auf Mantel und Unterrücken dunkelölbraun, übrigens dunkelschiefergrau, in den Weichen weißgefleckt und am Steiße rein weiß. Das Auge hat um den Stern einen gelben, sodann einen schwarzgrauen und außerhalb einen roten Ring; der Schnabel ist an der Wurzel lackrot, an der Spitze gelb, der Fuß gelbgrün. Die Länge beträgt einunddreißig, die Breite sechzig, die Fittichlänge zwanzig, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Grünfüßiges Teichhuhn ( Gallinula chloropus)
Das Teichhühnchen, ein in allen Erdteilen heimischer, obwohl in ständigen Abarten auftretender Vogel, ist in Europa, mit Ausnahme des hohen Nordens, überall gemein, in Deutschland Zugvogel, der zu Ende März erscheint und erst im Oktober wegzieht, wahrscheinlich in Paaren und wohl größtenteils zu Fuß wandert, zuweilen auch bei uns zulande überwintert. Im Frühjahr kommen gewöhnlich beide Gatten in einer Nacht auf ihrem Brutteiche an, ausnahmsweise beide bald nacheinander. Wenn das Paar von einem Teiche Besitz genommen hat, beachtet es den Ruf der in der Luft dahinziehenden Artgenossen nicht mehr; ist aber nur erst der eine Gatte da, so antwortet er dem oben fliegenden und ladet ihn durch ähnliche Töne ein, zu ihm herabzukommen.
Kleine Teiche, die am Rande mit Schilf oder Ried bewachsen, wenigstens durch Rohr und Gebüsch bedeckt und teilweise mit schwimmenden Wasserpflanzen überwuchert sind, bilden die bevorzugten Aufenthaltsorte des Teichhuhnes. Jedes Pärchen liebt es, einen Teich für sich allein zu besitzen, und nur auf größeren Wasserflächen siedeln sich mehrere Pärchen an, von denen dann jedes sein Gebiet streng festhält. Liegen mehrere Teiche nebeneinander, so besuchen sich die rauflustigen Männchen gegenseitig, um einen Strauß auszufechten, werden aber stets wieder zurückgeschlagen, da sich jedesmal beide Gatten vereinigen, um den frechen Eindringling zu züchtigen.
»Erscheint«, sagt Liebe, »der Schwan als Sinnbild stolzer Majestät, so ist das Teichhühnchen das anmutiger Beweglichkeit. Begabt wie kaum ein anderer Vogel, taucht das rotstirnige Hühnchen mit derselben Geschicklichkeit, mit der es im Rohre und Schilfe umherflattert. Übertags schwimmt es, leicht und zierlich, fast wie eine Möwe, mit dem kurzen Schwanze aufwärts wippend, zwischen den Blättern der Teichrosen und Froschkräuter dahin, bald rechts, bald links ein kleines unbekanntes Etwas erhaschend, taucht dazwischen einmal hinab und holt einen Büschel Horn- und Tausendblatt vom Grunde herauf, um dann die Oberfläche nach Erbsenmuscheln und Wasserkerfen abzusuchen; während des Abends und der Nacht steigt es gern im Rohre empor und weiß dies, indem es mit den langen Zehen drei oder vier Stengel zugleich erfaßt, so geschickt zu bewerkstelligen, daß man das verursachte Geräusch kaum zu vernehmen imstande ist. Zur Paarungszeit versteigt es sich gern in die Köpfe der Weiden, die den Weiher umgeben, und treibt sich hier stundenlang umher. Erschreckt läuft es flatternd über die schwimmenden Blätter der Wasserpflanzen hinweg oder taucht unter und ist scheinbar vom Teiche verschwunden.« Bei Gefahr rudert es mit Hilfe seiner Flügel eilig zwischen dem Grunde und der Oberfläche fort, kommt zum Atemholen einen Augenblick empor, streckt aber bloß den Schnabel hervor und rudert weiter. Der Flug ist matt, schwerfällig flatternd, nicht schnell, geht fast geradeaus, gewöhnlich tief auf dem Wasser hin; denn erst, wenn es eine gewisse Höhe erreicht hat, fliegt es leichter; Hals und Beine werden dabei gerade ausgestreckt. Auf einen seiner feinsten Kunstgriffe machte mich Liebe aufmerksam. »Nimmt man«, so erzählte er mir, »den Zeitpunkt wahr, wenn Teichhühnchen im freien Wasser in der Nähe eines hohen Teichdammes sich aufhalten, beschleicht man sie, klettert man an dem Damm behutsam hinauf und springt man zuletzt plötzlich auf dessen Bekrönung, so tauchen die erschrockenen Teichhühnchen sofort unter und lassen sich nicht wieder blicken. Sucht man jetzt die Oberfläche des Wassers sorgfältig mit dem Auge ab, so sieht man, und zwar oft in einer Entfernung von nur wenigen Schritten, das Blatt einer Teichlilie oder Seerose ein wenig gehoben und darunter das schwarze Auge des Teichhühnchens, das, ohne sich zu regen, den Blattstiel umfaßt hält und unter dem Schutze des Blattes eben nur einen Teil des Kopfes über den Wasserspiegel erhebt. Wiederholt man den Versuch öfter, dann kann man auch die leise Bewegung des Blattes sehen, an dessen Stiele das Hühnchen emporklettert, und den Augenblick abwarten, in dem es die Blatteile vorsichtig emporhebt.« Ich habe Liebes Anleitung befolgt und dasselbe gesehen wie er. Die Stimmlaute unseres Hühnchens sind laut und kräftig. Der Lockruf klingt wie »Terr, terr«, der Warnungsruf wie »Kerr, tett, tett«, oder, wenn er den Jungen gilt, leise wie »Gurr, gurr«. Außerdem vernimmt man ein scharfes Krächzen oder ein starkes »Kürg«, das Furcht auszudrücken scheint, und aus dem Zuge ein helltönendes, weitschallendes »Keck, keck«.
Das Teichhühnchen ist schon am frühen Morgen wach und rege und geht erst spät zur Ruhe. Aus Teichen, die dem menschlichen Verkehre fern liegen, verbirgt es sich tagüber im Schilfe und kommt nur morgens und abends auf das offene Wasser heraus, fliegt auch bei Ankunft eines Menschen, so schnell es kann, seinem Versteckplatze zu; da hingegen, wo es sich an den Menschen gewöhnt hat und weih, daß dieser es schützt, wird es ungemein kirr. Das Pärchen, das den Teich neben Naumanns Garten bewohnte, war so zahm wie Hausgeflügel, unterschied jedoch fremde Leute augenblicklich von seinen Bekannten. Einer oder andere der Gatten wurde gefangen und wieder freigelassen, hatte aber doch die verdrießliche Störung nach einigen Tagen verziehen. Mit andern Tieren verkehrte es nicht gern; fremde Hunde floh es ängstlich; aber auch Gänse und Enten waren ihm unangenehm. Enten werden oft fortgejagt und Gänse wenigstens angegriffen; kommen letztere aber öfters und in Mehrzahl, so müssen die Teichhühnchen, wie Naumann sagt, »mit verbissener Wut Frieden halten; aber ein solcher Zwang ist ihnen dann sehr unangenehm«.
Im Frühjahre hat jedes Pärchen längere Kämpfe mit andern zu bestehen, die sich erst einen Standort suchen müssen. Naht ein fremdes Teichhuhn, so fährt das Männchen mit aufgesträubten Flügeln, niedergedrücktem Kopfe, halb schwimmend, halb auf dem Wasser laufend, gegen den Eindringling los, hackt und kratzt mit Schnabel und Füßen, schlägt auch mit den Flügeln und ruft, wenn jener nicht weichen will, die Gattin zu Hilfe, bis der Gegner vertrieben ist. Solche Kämpfe werden auch dann noch ausgefochten, wenn bereits der Bau des Nestes in Angriff genommen wurde. Letzteres steht gewöhnlich in einem Schilfbusche auf den niedergeknickten Blättern desselben oder zwischen mehreren Büschen auf der Oberfläche des Wassers selbst, seltener auf einem trockeneren Hügelchen im Schilfe. Holzstückchen, Bretter, Entenhäuschen und dergleichen werden gern benutzt, vorausgesetzt, daß sie im Wasser schwimmen. Beide Gatten bauen gemeinschaftlich, zuweilen sorgfältig, gewöhnlich aber liederlich. Schilfblätter, trockene wie frische, werden übereinander geschichtet und oben korbartig ineinander geflochten. Die Mulde ist tief napfförmig. Sobald der Bau vollendet ist, beginnt das Weibchen zu legen. Die sieben bis elf Eier sind verhältnismäßig groß, etwa siebenundvierzig Millimeter lang, neunundzwanzig Millimeter dick, festschalig, feinkörnig, glatt, glanzlos und auf blaßrostgelbem Grunde mit vielen violettgrauen und aschblauen Punkten, zimmet- und rotbraunen Pünktchen, Fleckchen und Klexen bestreut. Beide Geschlechter brüten zwanzig bis einundzwanzig Tage lang, das Männchen aber nur so lange, als das Weibchen nach Nahrung sucht. Mein Vater erhielt ein Nest mit elf gepickten Eiern, in denen man die Jungen schon piepen hörte, ließ aus Mitleid das Nest wieder an den Ort setzen, wo es gestanden hatte, und das alte Weibchen nahm die Eier, obgleich sie drei Stunden lang ihm entzogen worden waren, doch sofort wieder an und brütete sie wirklich aus. Die ausgekrochenen Jungen bleiben ungefähr vierundzwanzig Stunden im Neste, werden dann auf das Wasser geführt. »Eine Familie dieser Vögel«, sagt mein Vater, »gewährt eine angenehme Unterhaltung. Die Jungen schwimmen neben und hinter den Alten her und geben genau Achtung, wenn diese ein Kerbtier oder einen Wurm für sie aufgefunden haben. Sie eilen dann herbei, um die Speise möglichst schnell in Empfang zu nehmen. Nach wenigen Tagen lernen sie ihre Nahrung selbst suchen und werden von den Eltern bloß noch geführt, gewarnt und geschützt. Auf den ersten Warnungsruf hin verbergen sie sich augenblicklich. Nach ein paar Wochen sind sie imstande, sich selbst zu ernähren. Dann beginnen die Alten Anstalt zur zweiten Brut zu machen.« Ist auch diese glücklich entschlüpft, so wird das Schauspiel noch anziehender. »Wenn die Jungen der zweiten Brut auf dem Wasserspiegel erscheinen«, schildert Naumann, »kommen die nun mehr als halbwüchsigen der ersten Brut herbei und helfen den Alten, dieselben zu führen. Groß und klein, alt und jung ist sozusagen ein Herz und eine Seele. Ein unvergleichlich anmutiges Bild gibt eine solche Doppelfamilie, wenn sie sich furchtlos auf einem kleinen Wasserspiegel ausgebreitet hat und in voller Tätigkeit ist. Jedes der ausgewachsenen Jungen ist eifrig bemüht, einem seiner kleinen Geschwister Nahrungsmittel darzureichen, weshalb diese Kleinen bald einem von jenen, bald einem der Eltern nachschwimmen und mit verlangendem Piepen ihre Eßlust andeuten, gleich zufrieden, wer sie zuerst stillt. Auch bei vorkommenden Gefahren warnen die großen die kleinen Jungen.«
Obgleich das Teichhühnchen seine Nahrung mehr dem Tier- als dem Pflanzenreiche entnimmt und hauptsächlich Käfer, Libellen, Eintagsfliegen, Wasserwanzen und andere Kerbtiere, Wasserschnecken und dergleichen verzehrt, läßt es sich doch leicht in Gefangenschaft halten und an einfaches Ersatzfutter gewöhnen. Es ergibt sich bald in sein Schicksal, befreundet sich mit seinem Pfleger und wird fast ebenso zahm wie ein Purpurhuhn. Wir haben mehrere gehalten, die unter Hühnern unseres Gehöftes umherliefen, zuweilen in die Zimmer kamen, aus den Ruf hörten, kurz, ganz wie Hausgeflügel sich betrugen. Eines blieb während des ganzen Winters in unserem Gehöfte, besuchte von hier aus die benachbarten Teiche, erwarb sich endlich eine Gefährtin und siedelte sich mit dieser in dem ihm am meisten zusagenden Teiche an, um zu brüten.
*
Allbekannter Vertreter der durch die mit Lappen bekleideten langen Zehen besonders ausgezeichneten Sippe der Wasserhühner ( Fulica) ist das Wasserhuhn, auch Bläßhuhn genannt ( Fulica atra). Die vorherrschende Färbung seines Gefieders ist ein ziemlich gleichmäßiges Schieferschwarz, das an Kopf und Hals dunkler, auf Brust und Bauch lichter als der Rücken erscheint. Der Augenstern ist hellrot, der Schnabel einschließlich der Stirnplatte blendendweiß, der Fuß bleifarben, an der Ferse rotgelblichgrün. In Europa und Mittelasien kommt das Wasserhuhn überall vor; außerdem hat man es in ganz Afrika, Südasien und Australien in der Winterherberge angetroffen.
In Deutschland fehlt das Wasserhuhn keinem geeigneten Gewässer. Es meidet Ströme und Flüsse, ebenso das Meer und siedelt sich am liebsten an Seen und Teichen an, deren Ränder mit Schilf und hohem Rohre bewachsen sind. Bei uns zulande erscheint es im Frühjahre nach der Schnee- und Eisschmelze, also bald früher, bald später, verweilt während des ganzen Sommers an einem und demselben Orte, beginnt im Herbste zu streichen, sammelt sich auf größeren Gewässern, im Gegensatze zu seinen Verwandten, zu starken Scharen an, wandert im Oktober und November nach Süden hinab und überwintert da, wo es offene Gewässer findet, unter Umständen auch in Deutschland.
Entsprechend seinen Schwimmfüßen treibt sich das Wasserhuhn mehr auf dem Wasser als auf dem Lande umher. Letzteres betritt es nicht selten, namentlich in den Mittagsstunden, um hier sich auszuruhen und das Gefieder zu putzen. Es läuft noch ziemlich gut auf ebenem Boden dahin, obgleich die ungefügen Füße dazu nicht besonders sich eignen, schwimmt aber doch viel öfter und länger. Seine Füße sind vortreffliche Ruder; denn was den Schwimmlappen an Breite abgeht, wird durch die Länge vollständig ersetzt. Im Tauchen wetteifert es mit vielen Schwimmvögeln, steigt in bedeutende Tiefen hinab und rudert mit Hilfe seiner Flügel auf weite Strecken hin unter dem Wasser fort. Der Flug ist etwas besser als der des Teichhuhnes, aber immer noch schlecht genug; deshalb entschließt es sich selten zum Fliegen und nimmt, ehe es sich erhebt, einen langen Anlauf, indem es flatternd auf dem Wasser dahinrennt und mit den Füßen so heftig aufschlägt, daß man das Plätschern, das es verursacht, auf weithin vernehmen kann. Seine Stimme ist ein durchdringendes »Köw« oder »Küw«, das im Eifer verdoppelt und verdreifacht wird und dann dem Bellen eines Hündchens nicht unähnlich klingt; außerdem hört man ein kurzes, hartes »Pitz« und zuweilen ein dumpfes Knappen.
In seinem Wesen unterscheidet es sich von dem verwandten Teichhuhne in mancher Hinsicht. Es ist ebensowenig scheu wie dieses, jedoch vorsichtig und prüft erst lange, bevor es zutraulich wird, lernt seine Leute kennen und unterscheiden, siedelt sich deshalb auch nicht selten in unmittelbarer Nähe von Wohnungen, namentlich von Mühlen, an, meidet aber im allgemeinen die Nachbarschaft von Menschen mehr als jenes. Während der Brutzeit hält jedes Pärchen ein bestimmtes Gebiet fest und duldet innerhalb desselben keine Mitbewohnerschaft; sofort nach Beendigung des Brutgeschäftes aber schlagen sich die Familien und Vereine zusammen, und diese wachsen nach und nach zu unzählbaren Scharen an, die in der Winterherberge zuweilen buchstäblich unabsehbare Strecken der nahrungsreichen Seen bedecken.
Wasserkerfe, deren Larven, Würmer, kleine Schaltiere und allerhand Pflanzenstoffe, die sie im Wasser finden, bilden die Nahrung des Wasserhuhnes. Ob es ebenso wie die Verwandten der Brut kleiner Vögel nachstellt, ist zurzeit noch nicht erwiesen, jedoch nicht unwahrscheinlich. Seine Nahrung sucht es schwimmend und tauchend, indem es sie von der Oberfläche abliest oder vom Grunde hervorholt.
Da, wo das Wasserhuhn auf kleineren Teichen sich angesiedelt hat, beginnt es sofort nach seiner Ankunft mit dem Nestbaue; auf größeren Gewässern, wo mehrere Pärchen leben, hat es erst mancherlei Kämpfe auszufechten, bevor es sich ein bestimmtes Gebiet sichert. Wo viele zusammenwohnen, nimmt, wie Naumann sagt, das Jagen, Herumflattern, Plätschern und Schreien kein Ende. Die Nachbarn überschreiten sehr oft die Grenzen, und der Inhaber eines Gebietes eilt dann augenblicklich mit Wut herbei, um den Eindringling zu verjagen. In gebückter Stellung, mit dem Schnabel knappend und ins Wasser schlagend, schwimmen die Kämpfer aufeinander los, erheben sich plötzlich und wenden nun jede Waffe an, die sie besitzen, den Schnabel zum Hacken, die Flügel zum Schlagen, die Füße zum Prügeln, bis einer den Rückzug antritt. Das Nest steht regelmäßig auf der Wasserseite im oder am Schilfe, oft auf umgeknickten Rohrhalmen und dergleichen, ebensooft aber auch schwimmend auf dem Wasserspiegel selbst. Seine Grundlage bilden alte Rohrstoppeln und Halme, die obere Lage dieselben etwas besser gewählten Stoffe, Wasserbinsen, dünne Halme, Grasstöckchen und Rispen, die zuweilen sorgsam verarbeitet werden. Um Mitte Mai findet man die sieben bis fünfzehn großen, durchschnittlich dreiundfünfzig Millimeter langen, sechsunddreißig Millimeter dicken, festen und feinschaligen, glanzlosen, auf bleichlehmgelbem oder blaßgelbbraunem Grunde äußerst zart mit dunkel aschgrauen, dunkel- und schwarzbraunen Pünktchen und Flecken gezeichneten Eier vollzählig im Neste; zwanzig oder einundzwanzig Tage später schlüpfen die zierlichen, mit Ausnahme des brennendroten Kopfes schwarzdaunigen Jungen aus den Eiern, werden nach dem Abtrocknen sofort auf das Wasser geführt, von beiden Eltern geatzt, zuweilen gehudert, bei Gefahr gewarnt, gegen schwächere Feinde auch mutvoll verteidigt, überhaupt höchst sorgfältig behandelt. Anfangs halten sie sich viel im Rohre und ebenso auf gesicherten Stellen des Festlandes aus; des Nachts kehren sie gewöhnlich in das Nest zurück; später entfernen sie sich mehr und mehr von den Alten, und ehe sie noch flügge sind, haben sie sich bereits selbständig gemacht.
Obgleich das Fleisch des Wasserhuhnes noch schlechter schmeckt als das der Verwandten, wird dieses hier und da doch eifrig gejagt. Für die Gefangenschaft eignet sich das Wasserhuhn bloß dann, wenn man ihm ein größeres Wasserbecken oder einen Teich anweisen kann. Auf solchem ist es sehr unterhaltend, weil es sich beständig etwas zu schaffen macht und seine fortwährende Regsamkeit, Kampflust, sein Mut größeren Vögeln gegenüber jedermann anzieht. Wenn man es gewähren läßt, entschließt es sich auch zur Fortpflanzung, und man hat dann das Vergnügen, das Jugendleben der niedlichen Küchlein mit aller Bequemlichkeit beobachten zu können.