
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Eigentümliche Beweglichkeit der Gesichtsknochen, die außerordentliche Erweiterung des Maules ermöglicht, ist das bedeutsamste Merkmal der Schlangen. Die äußerliche Gestalt des Leibes teilen mit ihnen, wie wir gesehen haben, noch mehrere andere Kriechtiere, und erst wenn man von diesen absieht, darf man auf den langgestreckten, wurmförmigen, in eine feste, sogenannte Schuppenhaut eingehüllten Leib, von dem Kopf und Schwanz wenig sich absetzen, Gewicht legen. Nach Ansicht neuerer Forscher stellen die Schlangen nur einen eigentümlich entwickelten Seitenzweig der Echsen dar und weichen durch keinerlei tiefeingreifende Merkmale von letzteren ab.
Der Kopf der Schlangen ist nie sehr groß, in der Regel jedoch breiter als der übrige Leib und deutlich erkennbar, obwohl nur bei wenigen Arten scharf vom Halse, bezüglich vom Leibe geschieden, dreieckig oder eiförmig gestaltet, gewöhnlich von oben nach unten zusammengedrückt, also abgeplattet, das Maul so weit gespalten, daß der Rachen bis über die hintere Grenze des Kopfes selbst hinauszugehen scheint, der Gehörgang äußerlich nicht unterscheidbar, das Auge etwa in der Mitte der Schnauzenspalte, auf der Seite und nach dem Kieferrande, die Nase stets vorn, oft ganz an der Spitze der Schnauze gelegen, die Beschuppung von der des Leibes mehr oder weniger verschieden. Ein eigentlicher Hals ist nicht vorhanden; der Leib beginnt vielmehr fast unmittelbar hinter dem Kopfe und geht ebenso, äußerlich unwahrnehmbar, in den mehr oder weniger verlängerten und demgemäß spitz- oder stumpfkegeligen Schwanz über; beider Länge übertrifft den Querdurchmesser um das Dreißig- bis Hundertfache. Kopf, Leib und Schwanz werden von einer festen Haut bekleidet, der man, wie Karl Vogt sagt, »gewissermaßen mit Unrecht den Namen einer Schuppenhaut gegeben hat, während doch in der Tat diese Haut ein zusammenhängendes Ganzes bildet und deutlich aus einer Lederhaut und einer darüber liegenden Oberhaut besteht. Die Lederhaut ist nicht gleichförmig dick und eben, sondern an einzelnen Stellen verdickt, und der Rand dieser Stellen frei umgeschlagen, so daß Falten gebildet werden, die das Ansehen von dachziegelförmig übereinander liegenden Schuppen haben. Indem nun die Oberhaut ebenfalls diesen Verdoppelungen der Lederhaut folgt und sich an den freiliegenden Stellen verdickt, während sie da dünner wird, wo sie in den Falten eingeht, treten die Schuppen deutlicher hervor. Man unterscheidet der Gestalt nach Schuppen, die länger als breit sind, oft auf ihrer Mitte einen Kiel tragen und vorzugsweise auf der Rückenfläche des Tieres entwickelt scheinen, sowie Schilder von meist sechs- oder viereckiger Gestalt, gewöhnlich länger als breit, die vorzugsweise auf der Bauchseite und an dem Kopfe sich ausbilden.«
Hinsichtlich der Färbung und Zeichnung der Haut läßt sich Allgemeines nicht angeben, da beide ungemein große Mannigfaltigkeit zeigen. Es gibt einfarbige und buntgefleckte, geringelte, gegitterte, gestreifte, gebänderte, mit Punkten gezeichnete, gewölkte Schlangen; einzelne Arten sehen unscheinbar aus, andere prangen in den prachtvollsten Farben. Immer aber stehen Zeichnung und Färbung mehr oder weniger im Einklange mit der Örtlichkeit, auf der eine Schlange ihren Aufenthalt nimmt. Unter denen, die die Wüste bewohnen, herrscht das Sandgelb ebenfalls vor; diejenigen, die auf Bäumen leben, haben meist grüne Färbung; die, die sich auf pflanzenbedecktem Boden bewegen, tragen ein buntes, die Süßwasserschlangen ein düsteres Kleid, dem Dunkel schlammiger Gewässer vergleichbar, wogegen das der Seeschlangen in weit lebhafteren Farben, Grün, Gelb, Blau, prangt, also im Einklange steht mit den bewegten vielfarbigen Wogen des Indischen Weltmeeres. Als sonderbare Ausnahme verdient der Umstand Beachtung, daß die Schuppen wühlender, halbunterirdischer Schlangen teils lebhafte Färbung, teils wenigstens schönen Metallschimmer, gleich poliertem Stahl besitzen. Färbung und Zeichnung können zwar nicht oder doch nur in geringem Maße willkürlich verändert, durch Erregung erhöht, bei Erschlaffung geschwächt werden, sind jedoch nur bis zu einem gewissen Grade beständig, d. h. bloß das allgemeine Gepräge derselben läßt sich bei allen Stücken einer und derselben Art auffinden; denn, streng genommen, ändern Färbung und Zeichnung vielfach ab, bei einzelnen Arten mehr, bei andern weniger. Unsere Kreuzotter z. B. trägt fast ein Dutzend Namen, weil frühere Forscher glaubten, die einzelnen Abänderungen als besondere Arten ansehen und benennen zu müssen.
Die Einfachheit und Gleichmäßigkeit der äußeren Gestalt wird bedingt durch den Bau des Knochengerüstes. Dasselbe besteht nämlich bloß aus dem Schädel, der Wirbelsäule und den Rippen; denn die verkümmerten Stummel, die bei einzelnen Familien vorhanden sind und an die hinteren Glieder anderer Kriechtiere erinnern, können mit Gliedmaßen doch eben nur verglichen werden. Der wichtigste Teil des Knochengerüstes und zugleich derjenige, der die eigentümlichste Gestalt und Einrichtung zeigt, ist der Schädel. Er setzt sich aus dem Hinterhauptsbein, den Scheitel-, Stirn-, Schläfen-, Joch-, Nasen- und Tränenbeinen, dem Keilbeine, einem Zwischenkiefer-, einem Oberkiefer- und zwei Gaumenbeinen sowie dem mit ihm verbundenen, ebenfalls aus mehreren Teilen bestehenden Unterkieferbeine zusammen. Mehr noch als die geringe Größe des hirntragenden Teiles fällt die freie Beweglichkeit des Kiefergerüstes auf. »Der Zwischenkiefer«, sagt Karl Vogt, »hängt fest mit dem Nasenbeine zusammen; dagegen sind Oberkiefer-, Flügel- und Gaumenbeine durchaus beweglich und können sowohl nach den Seiten als auch nach vorn und hinten geschoben werden. Eine ebenso große Beweglichkeit ist in den Unterkiefern hergestellt. Das lange, schuppenförmige Zitzenbein hängt nur durch Bänder und Muskeln mit dem Schädel zusammen und trägt an seinem Ende das ebenfalls lange, stabförmige, meist schief nach hinten gerichtete Quadratbein, an dem der Unterkiefer eingelenkt ist. Dieser selbst besteht aus zwei völlig getrennten, stabförmigen, nur wenig gebogenen Hälften, die vorn entweder gar nicht oder nur durch lockere Sehnenfasern miteinander verbunden sind, und deren Trennung äußerlich gewöhnlich auch durch sogenannte Kinnfurchen an der Unterfläche des Kopfes ausgedrückt ist.« Jeder Unterkieferast also wird gebildet durch drei stabförmige Knochen, die durch lose Gelenke verbunden sind und nach allen Seiten hin bewegt oder weggedrückt werden können. An den Schädel schließt sich der Leib unmittelbar an, da eine Sonderung der Hals-, Brust-, Lenden-, Kreuz- und Schwanzwirbel bei den Schlangen nicht durchzuführen ist. Schon der zweite Wirbel hinter dem Schädel trägt wie die übrigen ein Paar falsche Rippen, die sich von denen des Rumpfteiles nur durch ihre etwas geringere Größe unterscheiden. Von ihm an nach hinten zu haben alle Wirbel mehr oder weniger denselben Bau. Sie sind durch wirkliche Kugelgelenke miteinander verbunden, derart, daß der Gelenkknopf des vorhergehenden in einer runden Pfanne des nachfolgenden spielt, und tragen Rippen, die ebenso durch Kugelgelenke mit den Wirbelkörpern zusammenhängen. Die Rippen erlangen insofern eine besondere und überaus wichtige Bedeutung, als sie den Schlangen die fehlenden Glieder ersetzen. Sie enden in einer Muskelschicht, die mit den großen Bauchschildern zusammenhängt, und drücken, wie ich weiter unten ausführen werde, letztere, wenn sie von vorn nach rückwärts bewegt werden, mit den hinteren vorspringenden Rändern gegen die Fläche, auf der die Bewegung erfolgen soll, stellen somit also eine Unzahl von Hebeln dar, von denen jeder einzelne, wenn auch nicht einem Beine entspricht, so doch die Tätigkeit eines solchen übernimmt. Jedenfalls ist es nicht unrichtig zu sagen, daß die Schlangen auf ihren Rippen gehen. Bei einzelnen Arten können die Halsrippen auch seitlich ausgebreitet werden. Im Schwanzteile verkümmern die Rippen mehr und mehr, bis sie endlich gänzlich verschwinden. Je nach Art und Größe schwankt der Wirbel in weiten Grenzen: ausnahmsweise nur scheint sie weniger als hundert zu betragen, kann aber bei einzelnen Arten bis gegen vierhundert ansteigen.
Nicht minder beachtenswert als die Knochen des Gerippes sind die Zähne, die je nach den verschiedenen Familien wichtige Unterschiede zeigen und zur Aufstellung von Unterordnungen benutzt worden sind. Zähne stehen nicht allein auf dem Ober- und Unterkiefer, sondern auch auf dem Zwischenkiefer, den Gaumen- und Flügelbeinen. Sie sind stets dem sie tragenden Knochen angewachsen und werden durch neue, hinter oder neben ihnen sich entwickelnde und mit ihnen in eine Schleimhautfalte eingeschlossene ersetzt, wenn dies nötig sein sollte. Alle sind nach hinten gekrümmte, spitzige Hakenzähne, die nur zum Beißen und zum Festhalten der Beute, niemals aber zum Zerreißen oder zum Kauen dienen können. Eine Folge der eigentümlichen Bildung des Knochengerüstes ist die Menge der Muskeln. Man kann ebensoviele Zwischenrippenmuskeln zählen als Rippen; außerdem verlaufen längs des Rückens Muskeln, die an vielen Rippen und Wirbeln zahlreiche Befestigungspunkte finden und deshalb nicht bloß gewaltige Kraft äußern, sondern auch in der verschiedenartigsten Richtung wirken können. Wie bei allen Kriechtieren überhaupt sind sie sehr blaß von Farbe.
Im hohen Grade bedeutsam für das Leben der Schlangen sind die Drüsen, die bei den giftigen Arten der Ordnung besonders sich entwickeln. Die Giftdrüse, hinter und unter den Augen über dem Oberkiefer sich befindend, ist sehr groß, länglich, hat ein blätteriges Gewebe, im Innern eine ansehnliche Höhle und unterscheidet sich außerdem von allen übrigen durch den langen Ausführungsgang, der an der äußeren Fläche des Oberkiefers bis nach vorn verläuft und hier vor und über dem Giftzahne in eine diesen umgebende häutige Scheide so sich öffnet, daß ihre Absonderung in den Zahn einfließen kann. Ein sehr starker Muskel umhüllt sie und dient mit dem Kaumuskel dazu, sie zusammenzudrücken.
Das Rückenmark überwiegt das Gehirn an Masse sehr bedeutend. Letzteres ist ungemein klein, das Rückenmark hingegen, entsprechend der Länge der Wirbelsäule, deren innere Röhre es ausfüllt, sehr groß oder massig. Hieraus läßt sich von vornherein die außerordentliche Reizbarkeit der Muskeln, die Stumpfheit der Sinne und die Schwäche der übrigen Geistesfähigkeiten erklären. Unter den Sinnen steht unzweifelhaft das Gefühl obenan, insbesondere soweit es sich als Tastsinn bekundet. Die seit alten Zeiten verschriene Zunge, in der Unkundige noch heutigentags das Angriffswerkzeug der Schlangen sehen, dient wahrscheinlich gar nicht zum Schmecken, sondern ausschließlich zum Tasten, wird aber gerade deshalb für das Tier von ungewöhnlicher Bedeutung. Sie ist sehr lang, dünn, vorn in zwei langspitzige Hälften gespalten und mit einer hornigen Masse überzogen, liegt in einer muskeligen Scheide verborgen, die unter der Luftröhre verläuft und kurz vor deren Mündung, nahe der Spitze der Unterkinnlade, sich öffnet, kann in diese Scheide ganz zurückgezogen, aber auch weit hervorgestoßen werden und zeichnet sich aus durch außerordentliche Beweglichkeit. Ein Ausschnitt im Oberkiefer, der auch bei ganz geschlossenem Munde noch eine Öffnung bildet, erleichtert ihr wechselseitiges Aus- und Einziehen, da sie durch ihn immer freien Ausgang findet. Das Gesichtswerkzeug der Schlangen dürfte hinsichtlich seiner Schärfe der in ausgezeichnetem Grade tastfähigen Zunge sich anreihen, obgleich das Auge unzweifelhaft minder vollkommen ist als bei den übrigen Kriechtieren. Eine besondere Eigentümlichkeit desselben liegt in seiner scheinbaren Unbeweglichkeit, die ihm ein gläsernes Ansehen und einen unheimlichen Ausdruck verleiht. An Stelle der fehlenden Augenlider findet sich ein durchsichtiges Häutchen, das »in ähnlicher Weise wie ein Uhrglas in einen Falz der runden Augenhöhle eingeheftet ist und eine Kapsel bildet, die durch einen weiten Gang des Tränenkanals nach innen mit der Nasenhöhle in Verbindung steht«. Dieses durchsichtige Häutchen, von einzelnen mit Unrecht der Hornhaut verglichen oder als solche angesehen, ist ein Teil der Oberhaut und wird bei der allgemeinen Häutung teilweise mit entfernt, weshalb denn auch seine Durchsichtigkeit durch die Häutung vermehrt und während der Zeit einer Häutung bis zur andern allmählich vermindert wird. Wohl zu beachten ist, daß ein Teil der Augenkapsel bei derartigem Wechsel bestehen bleibt, die Kapsel selbst also gleichsam als geschlossenes, durchsichtiges Lid anzusehen ist, unter dem das Auge frei sich bewegen kann. Der Stern ist bald rund, bald länglich und dann quer oder senkrecht gestellt: ersteres bei den Tag-, letzteres bei den Nachtschlangen. Die Regenbogenhaut glänzt meist in lebhaften Farben, bei einzelnen golden, bei andern silbern, bei manchen hochrot, bei einigen grünlich. Das Geruchswerkzeug, äußerlich an den Nasenlöchern erkennbar, die jederseits zwischen Auge und Spitze der Oberkinnladen entweder seitlich oder oben auf der Schnauze sich öffnen und bei gewissen Arten geschlossen werden können, scheint weit hinter Tastsinn und Gesicht zurückzustehen. Von dem Gehörwerkzeuge nimmt man erst dann etwas wahr, wenn man die Schuppen an den Kopfseiten entfernt, da die kurzen Gehörgänge gänzlich unter der Haut verborgen liegen. Eine eigentliche Trommelhöhle fehlt und ebenso das Trommelfell, die Schnecke aber ist vorhanden und im wesentlichen der der Vögel ähnlich.
Die Anlage des Leibes bedingt die den Schlangen eigentümlichen Bewegungen und, wie selbstverständlich, bis zu einem gewissen Grade die Lebensweise, da die Begabungen der Tiere mittelbar mindestens aus der Leibesanlage hervorgehen. Die Bewegungen sind vielseitiger, als der Unkundige gewöhnlich annimmt. Allerdings verdienen die Schlangen den Namen Kriechtiere mehr als die meisten übrigen Klassenverwandten; sie kriechen aber keineswegs allein auf ebenem Boden fort, sondern auch bergauf und bergab, an Bäumen empor und durch das Gezweige, auf der Oberfläche des Wassers und unter derselben hin: sie kriechen, klettern, schwimmen und tauchen also, und sie tun alles annähernd mit derselben Behendigkeit und Gewandtheit. Ihre zahlreichen, nur an den Wirbeln eingelenkten, nach unten freien Rippen kommen beim Kriechen zur Geltung: jede einzelne Rippe wird, wie bemerkt, zu einem Fuße, zu einer Stütze und zu einem Hebel, der den Leib nicht bloß trägt, sondern auch fortbewegt. Die kriechende Bewegung geschieht jedoch anders, als Unkundige anzunehmen und unerfahrene Maler abzubilden pflegen, nämlich nicht in senkrechten Bogenwindungen, sondern in seitlichen Wellenlinien. Alle Wirbel lassen sich sehr leicht in seitlicher Richtung biegen, die Rippen ebenso leicht von vorn nach hinten ziehen. Will nun die Schlange sich vorwärts bewegen, so spannt sie abwechselnd diese, abwechselnd jene Rippenmuskeln an, krümmt dadurch den Leib in eine wagerecht liegende Wellenlinie, zieht die Rippen so weit vor, daß sie fast oder ganz senkrecht stehen, und bringt sie bei der nächsten Krümmung in eine schiefe Richtung von vorn nach hinten, bewegt sie also wirklich in ähnlicher Weise wie andere Tiere ihre Füße. Die scharfen Ränder der nach unten gerichteten Schilder oder Schuppen vermitteln den Widerstand am Boden, da sie wohl eine Bewegung nach vorn ermöglichen, nicht aber auch ein Ausgleiten nach hinten zulassen. Solange das Tier auf freiem Boden sich fortschlängelt, geschieht seine Bewegung mit großer Leichtigkeit: der ganze Leib ist dann in Tätigkeit. Ein beträchtlicher Teil der Hunderte von Rippenpaaren arbeitet stemmend, während die übrigen gleichzeitig vorwärts gezogen und in demselben Augenblicke wirksam werden, in dem die andern aufhören, es zu sein. Jede einzelne Welle, die die Linie des Leibes beschreibt, wird sehr schnell ausgeglichen, und die Förderung kann demgemäß eine ziemlich rasche sein; aber gerade infolge der unzähligen Wellen, die der Leib beim Vorwärtskriechen beschreiben muß, wird die Schnelligkeit der Bewegung auch wiederum verlangsamt. Kriecht die Schlange durch enge Löcher, die ihrem Leib seitliche Bewegungen nicht gestatten, so fördert sie sich ausschließlich durch gangartiges Aufstelzen ihrer Rippen und Anstemmen ihrer Schuppen. Das Klettern ist eben auch nichts anderes als ein Kriechen an senkrechten Flächen. Ein Baumstamm, der der Schlange gestattet, ihn zu umwinden, verursacht ihr, falls seine Rinde nicht sehr glatt ist, durchaus keine Schwierigkeit: sie gleitet an ihm in schraubenförmigen Windungen, selbstverständlich unter fortwährend schlängelnder Bewegung, sehr rasch empor, da sie sich gegen das Herabrutschen durch die scharfen Hinterränder der Bauchschilder genügend sichern kann. Auf den Ästen selbst schlängelt sie sich beinahe mit derselben Sicherheit und Eilfertigkeit fort als auf ebenem Boden, insbesondere dann, wenn das Gezweige dicht ist. Genau dieselbe Bewegung führt sie auch beim Schwimmen aus; hierbei ist es jedoch unzweifelhaft der Schwanz, der das wichtigste Bewegungswerkzeug abgibt. Alle Arten der Ordnung sind fähig zu schwimmen; aber diejenigen, die für gewöhnlich nicht das Wasser aufsuchen oder in ihm leben, scheinen durch die Bewegung in ihm sehr bald ermüdet zu werden. Bei den eigentlichen Seeschlangen, deren Schwanz seitlich abgeplattet und durch Hautsäume noch verbreitert ist, gleicht die Schwimmbewegung mehr der eines Aales als anderer Ordnungsverwandten.
Nur sehr wenige Schlangen sind imstande, das vordere Drittteil ihres Leibes aufzurichten; Abbildungen, die das Gegenteil vorstellen wollen, dürfen also ohne Bedenken als falsch bezeichnet werden. Die meisten Schlangen erheben ihren Kopf nicht mehr als dreißig Zentimeter über den Boden. Wenige, beispielsweise die Brillenschlange, machen hiervon eine Ausnahme; viele sind nicht einmal imstande, wenn man sie am Schwanze packt und frei hängen läßt, so sich zu krümmen, daß sie mit dem Kopfe die Hand oder den Arm erreichen.
Die Atmung der zu vollem Leben erwachten und tätigen Schlangen geschieht unter deutlicher Bewegung der abwechselnd sich hebenden und senkenden Rippen ununterbrochen, ist jedoch im allgemeinen wenig lebhaft und steigert sich nur bei zunehmendem Zorne mehr und mehr. Heiseres, langanhaltendes und nur auf Augenblicke unterbrochenes Zischen, das die fehlende Stimme vertritt, gibt solcher Stimmung entsprechenden Ausdruck. Eine in Afrika lebende Schlange soll, nach Livingstones Angabe, ihr Zischen so oft unterbrechen, daß es wie das Meckern einer Ziege klingt.
Mit Ausnahme des Gefühls sind alle Sinne der Schlangen stumpf und schwach, und das Gefühl selbst ist eben auch nur als Tastsinn entwickelt. Nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen kann die Schlange ohne Zunge nicht gedeihen, nicht leben. Tatsache ist, daß jede Schlange, wenn sie nicht gerade ruht, unaufhörlich züngelt und dabei nach allen Richtungen hin arbeitet, um die Gegenstände, die sich vor ihr befinden, zu erforschen, daß sie niemals trinkt oder ins Wasser steigt, bevor sie die Oberfläche desselben mit der Zunge berührt hat, daß sie nicht allein die bereits getötete Beute vor dem Verschlingen, sondern, falls das Opfertier ihr dazu Zeit läßt, sogar vor dem Erwürgen oder Vergiften in gleicher Weise untersucht und, wenn sie fürchtet, daß der ins Auge gefaßte Gegenstand ihrer Jagdbegier entrinnen könnte, vor dem Angriffe wenigstens durch häufiges Züngeln die Absicht bekundet, die übliche Untersuchung an ihm vorzunehmen. Je munterer eine Schlange ist, je mehr und je schneller züngelt sie. Die Kreuzotter bewegt, wenn sie wütend ist, ihre Zunge so schnell, daß manche das dadurch entstehende Flimmern für eine elektrische Erscheinung gehalten haben. Das oft wiederholte Einziehen der Zunge geschieht unzweifelhaft, um sie wieder schleimig zu machen und dadurch die Empfindlichkeit zu erhöhen.
Im Vergleiche zur Tastfähigkeit der Zunge zeigt sich das Empfindungsvermögen der Schlangen schwach. Aus Erfahrung wissen wir, daß ihnen, trotz der dicken Bekleidung, selbst eine leise Berührung zum Bewußtsein gelangt, und ebenso, daß sie mit andern Kriechtieren die Vorliebe für die Wärme teilen, da ja auch diejenigen, die nur des Nachts tätig sind, bei Tage ihren Schlupfwinkel verlassen, um sich das Hochgefühl der Besonnung zu verschaffen; trotz alledem irrt man schwerlich, wenn man annimmt, daß im allgemeinen starke Reize erforderlich sind, um das Gefühl zu erregen. Viel eher als von Empfindungsvermögen darf man von Empfindungslosigkeit reden. Auch die Schlangen bekunden die Zählebigkeit anderer Kriechtiere, ertragen Martern, die höher entwickelten Wesen unbedingt tödlich werden, und überraschen bei Verwundungen, ja sogar Teilungen selbst den, der die gegenseitige Unabhängigkeit ihrer Nervenmittelpunkte kennt. Bohle brachte Vipern und Nattern unter die Luftpumpe und leerte den Raum unter der Glocke, so weit dies möglich war: der Schlangenleib dehnte sich zu einer Blase aus, die Kinnladen wurden auseinander gezerrt; aber beide ließen noch stundenlang Lebenszeichen erkennen. Das ausgeschnittene Herz einer Schlange schlägt längere Zeit fort, der abgehauene Kopf der Viper züngelt, beißt und vergiftet noch, eine geschundene, das heißt ihrer Schuppenhaut beraubte Schlange, lebt noch tagelang. Das Empfindungsvermögen eines derartig veranlagten Tieres kann nicht bedeutend sein. Dieser Abschnitt ist typisch für Brehms vermenschlichende Tierpsychologie. Weil die Schlangen den Schmerz, den solche Martern ihnen zweifellos bereiten, nicht in menschlichen Schmerzausdrucksformen darstellen können, deshalb müssen sie empfindungslos sein. Herausgeber.
Nicht viel anders verhält es sich mit den übrigen Sinnen. Sehr richtig ist der Ausspruch Lincks, daß die Empfänglichkeit der Zunge nicht hinreicht, um das Auge vollständig zu ersetzen, obgleich diese Zunge der Schlange, gleich dem Stabe des Blinden, nicht bloß zur Unterstützung, sondern zum Ersatze des Sehvermögens dient; unrichtig dagegen die Behauptung, daß die Schlange des Auges nicht, der Zunge nur schwer entbehren kann, sich ohne diese kümmerlich durchs Leben hilft und ohne jenes zu Tode kümmert; denn das Auge erlangt bei ihr doch niemals die Bedeutung, wie bei den übrigen Kriechtieren, mit Ausnahme einiger wenigen. Dursy folgerte aus der seitlichen Stellung der Augen, daß ein jedes von ihnen, um das ihm zugewiesene Gesichtsfeld beherrschen zu können, unabhängig von dem andern sich bewegen müsse, und fand die Richtigkeit seines Schlusses durch die Beobachtung bestätigt. Nach dieser sind die Schlangen imstande, ihre Augen ebensowohl gleichzeitig nach einer Richtung zu wenden als auch den Stern des einen nach dieser, den Stern des andern nach jener Seite zu kehren, ebenso wie sie das eine Auge bewegen, das andere ruhen lassen können. Nach dieser Wahrnehmung sollte man annehmen dürfen, daß die Schlangen zu den scharfsichtigsten Tieren zählen müssen; in Wahrheit ist dies jedoch nicht der Fall: mit der Schönheit und Beweglichkeit des Auges steht seine Fähigkeit nicht im Einklange. Alle Beobachtungen sprechen dafür, daß das Gesicht schwach und unbedeutend, daß die Meinung, zu der sein Glanz veranlaßt, eine falsche ist. »Nach meiner Ansicht«, sagt Lenz, »sehen die Schlangen schlecht, obgleich das Gesicht nächst dem Gefühl der Zunge derjenige Sinn ist, dem sie folgen. Ob es ausländische Arten gibt, die gut sehen, weiß ich nicht, was aber unsere einheimischen betrifft, so scheint ihnen ihr Auge keinen rechten Begriff von den Gegenständen zu geben, obgleich sie dieselben wohl bemerken; sie scheinen vorzüglich nur auf deren Bewegungen zu achten. So z. B. laufen sie wie unbesonnen auf einen sich still verhaltenden Menschen los und fliehen erst, wenn er sich bewegt. Steckt man sie mit einem Feinde in eine große Kiste, so nähern sie sich ihm oft ohne weiteres und kriechen, wenn es geht, auf ihm herum; rührt er sich aber und versetzt ihnen vielleicht gar einige Hiebe oder Bisse, so nehmen sie, wenn sie nicht gerade zur Gegenwehr geneigt sind, Reißaus, kehren aber doch, wenn er sich ruhig verhält, oft bald zu ihm zurück und fliehen dann wieder, wenn es nochmals Hiebe gibt. Wütende Schlangen, giftige und giftlose, beißen sogar nach einem Schatten und sehr oft an dem Gegenstande, wonach sie zielen, wenn er nicht groß ist, vorbei; doch kann man einwenden, in solchen Fällen mache die Wut sie blind. Bevor die Häutung stattfindet, ist das Auge gleichsam mit einem weißlichen Schleier überzogen, der von dem sich später ablösenden Oberhäutchen herrührt; sie sehen in dieser Zeit noch schlechter.« Es liegen keine Beobachtungen vor, die diesen Angaben des schlangenkundigen Lenz widersprechen, und was bezüglich unserer einheimischen Arten richtig ist, gilt auch für die übrigen. Von dem sogenannten geistigen Ausdrucke des Schlangenauges hat man, meiner Ansicht nach, mehr Rühmens oder doch Wesens gemacht, als die Sache verdient. »Sprechend, wie selten ein Tierauge«, meint Linck, »spiegelt es nicht nur den Charakter, sondern selbst die Stimmung des Augenblicks wieder. Ruhig und mild, doch nicht glanzlos erscheint es an den friedfertigen Gliedern der Ordnung, unheimlich an denen, die zu verwunden, doch nicht zu töten gerüstet sind; drohend in der Wut, d. h. furchtbar glüht das Auge der Otter, die den Tod auf der Spitze ihres Zahnes trägt. Etwas Fremdartiges aber gibt die glasige Haut, die sich darüber herwölbt, sowie die Starrheit des Augapfels, der sich nur schwer und in sichtbar gewaltsamen Rucken bewegt, auch den Blicken der frömmsten Schlange.« Letzteres ist vollkommen richtig, ersteres von dem Beobachter dem Schlangenauge beigelegt. Abgesehen von dem Glasigen, hat dieses nichts Auffallendes, das Drohende und Unheimliche aber seinen Grund weniger in der Bildung des Auges selbst als vielmehr in der Lage unter den es überwölbenden Schuppen, die bei den nächtlich lebenden Giftschlangen besonders entwickelt sind und denselben Eindruck hervorbringen, wie z. B. der vorgezogene Brauenknochen eines Raubvogels.
Soweit wir zu urteilen vermögen, folgt auf den Gesichtssinn hinsichtlich seiner Schärfe der des Gehörs, obgleich dessen Werkzeug uns in höherem Grade verkümmert erscheint als das des Geruchs. Versuche, die Lenz und andere anstellten, ergaben nur, daß sich Schlangen an verschiedene Töne wenig oder nicht kehrten, wenn dieselben nicht die Luft oder den Boden stark erschüttern. Noch schwieriger ist es, über den Geruch der Schlangen ins klare zu kommen. Die Bildung der Geruchswerkzeuge scheint so ungünstig als möglich zu sein, und die Beobachtung widerspricht einer dahingehenden Annahme nicht. Leichter als über alle andern Sinnestätigkeiten, mit Ausnahme des Tastsinnes, vermögen wir über den Geschmackssinn zu urteilen, weil wir dreist behaupten dürfen, daß derselbe durchaus verkümmert ist.
›Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben‹, dieser Ausspruch ist in doppelter Hinsicht unrichtig, am unrichtigsten aber, soweit er sich auf den Verstand der Schlangen bezieht; denn dieser ist so überaus gering, daß sich außer dem bereits im allgemeinen Mitgeteilten kaum noch etwas Besonderes hierüber sagen läßt. Wahrscheinlich tut man den Schlangen nicht unrecht, wenn man annimmt, daß sie unter den tiefstehenden Kriechtieren die am tiefsten stehenden sind. Bei ihrer Jagd legen sie eine gewisse List an den Tag, und Feinden gegenüber benehmen sie sich ebenfalls zuweilen scheinbar verständig, gegen ihren Pfleger einigermaßen zutunlich; unter keinen Umständen aber zeigen sie ein höheres Maß von Verstand als andere Kriechtiere: sie sind nicht bloß stumpfsinnig, sondern, wie bemerkt, auch stumpfgeistig.
Alle Erdteile beherbergen Schlangen, aber keineswegs in annähernd gleicher Anzahl. Auch sie unterliegen den allgemeinen Verbreitungsgesetzen der Kriechtiere und nehmen um so rascher an Arten und Einzelwesen ab, je höher die Breite ist; allein nicht alle gleichen Breitengrade weisen auch eine verhältnismäßig gleich zahlreiche Menge von ihnen auf.
Abgesehen von reichlicher Nahrung, verlangen die Schlangen passende Versteck- und Zufluchtsorte, meiden daher Gegenden, die letztere ihnen nicht gewähren. Mit Befremden bemerkte Schweinfurth, daß es im Bongolande keine oder doch sehr wenige Schlangen gibt, und erhielt auf Befragen eine Erklärung, der er beistimmen mußte. Es fehle, sagte man, in jenem steinigen Gelände an der schwarzen Erde, die in der Zeit der Dürre tief sich spaltet und den Schlangen die zu ihrer Ruhe und noch mehr bei Steppenbränden unerläßlichen Schlupfwinkel bietet. Ähnliches kann man auch bei uns zulande wahrnehmen. So ist die Kreuzotter in der Umgegend Berlins stellenweise ungemein häufig und fehlt an anderen Orten gänzlich, weil sie dort Schlupfwinkel, hier aber keine findet. Im allgemeinen gilt auch für die Schlangen, daß sie um so häufiger auftreten, je wechselreicher eine Gegend ist. Gänzliches Fehlen derselben gehört zu den Ausnahmen; denn sie hausen in der Wüste ebensowohl wie im Walde, im Gebirge ebensogut wie in der Tiefebene. Wärme und Feuchtigkeit sagen ihnen mehr zu als Hitze und Trockenheit; doch können auch sie in letzterer Hinsicht Unglaubliches ertragen. Ungeachtet ihrer Fußlosigkeit wissen sie sich einzurichten, die einen auf ebenem Boden, die andern an steilen Gehängen, diese im Sumpfe, jene im Wasser der Seen, Flüsse, selbst des Meeres, einzelne sogar unter der Erde, nicht wenige im Gezweige der Bäume. An dem einmal gewählten Aufenthaltsorte scheinen sie beharrlich festzuhalten, also, mit andern Worten, nur ein sehr kleines Gebiet zu durchstreifen. In beschränktem Grade wandern auch sie; denn sie übersetzen Flüsse und andere Gewässer, um sich am jenseitigen Ufer oder auf Inseln anzusiedeln, kommen aus dem Walde, aus der Steppe in Dörfer und Städte herein usw.; im allgemeinen aber lieben sie das Umherstreifen nicht, sondern wählen sich einen Standort, womöglich einen solchen, der ein passendes Versteck enthält, und lauern in der Nähe desselben auf Beute. Nicht ganz unwahrscheinlich ist, daß sie freiwillig überhaupt nur während der Paarungszeit und gegen den Winter hin Streifzüge antreten. Zum Auswandern gezwungen werden sie, wenn ein Platz, den sie bewohnen, derartig sich verändert, daß ihnen der Schlupfwinkel und die Nahrung, oder die Möglichkeit, behaglich sich zu sonnen, entzogen wird. Entwässern der Moore vertreibt z. B. die Kreuzottern. Herausgeber. In der Regel findet man sie auch fern von menschlichen Behausungen, dies aber nur deshalb, weil sie der Mensch in der Nähe der Ortschaften verfolgt und vertreibt; denn sie selbst fürchten die Nähe ihres Erzfeindes keineswegs, drängen sich ihm vielmehr oft in höchst unerwünschter Weise auf. Auch bei uns begegnet man nicht selten Schlangen in solchen Gärten, die inmitten von Städten liegen, ohne daß man eigentlich begreift, wie sie dahin gelangten; in südlichen Ländern empfängt man häufig ihre unerwünschten Besuche in den Häusern, und namentlich die Nachtschlangen, also gerade die gefährlichsten, werden hier manchmal höchst unangenehm. Mehr als einmal ist es mir begegnet, in den Behausungen, die ich während meines Aufenthaltes in Afrika bewohnte, auf Schlangen zu stoßen, sie sogar auf meiner Lagerstätte, unter den Teppichen zu finden. Ähnliches erfuhren alle Reisenden, die Gleicherländer besuchten. »Das einzige, das in den Dinkabehausungen den Fremdling beunruhigt«, sagt Schweinfurth, »ist das Getümmel von Schlangen, die hoch über dem geängstigten Haupte des Schlafenden im Stroh des Daches rasseln.« In Indien sind derartige Besuche an der Tagesordnung, und nicht wenige von den zwanzigtausend Menschen, die innerhalb der britischen Besitzungen alljährlich ihr Leben durch Schlangen verlieren, werden von diesen im Innern ihrer Häuser gebissen.
In allen Gegenden, die einen kalten oder heißen trockenen Winter haben, sind die Schlangen genötigt, sich gegen die Einwirkungen der Kälte oder bezüglich der Trockenheit zu schützen. Sämtliche Arten, die den nördlichen Teil unsers gemäßigten Gürtels bewohnen, ziehen sich mit Beginn des Winters in tiefe Schlupfhöhlen zurück und verbringen in ihnen die ungünstige Jahreszeit in einem Zustande der Erstarrung. Dasselbe findet, wie bereits angegeben, in den Ländern unter den Wendekreisen statt, beschränkt sich hier aber vielleicht auf diejenigen Arten, die wenn nicht im Wasser, so doch in feuchten Gegenden leben und durch die Dürre belästigt werden. Einzelne Arten scheinen sich während des Winterschlafes zu gesellen, möglicherweise nur deshalb, weil entsprechende Schlupfwinkel schwer zu finden sind und somit Zusammendrängen mehrerer, über ein gewisses Gebiet zerstreuter Schlangen nötig wird. So behauptet man in Nordamerika allgemein, daß die Klapperschlange während des Winters hier und da dutzendweise ein und dasselbe Winterbett beziehe, und hat ähnliches ebenso von unserer Kreuzotter und der Viper beobachtet. Bei warmem, stillem Wetter bemerkt man in Mitteldeutschland schon im März wieder Schlangen im Freien, die ihre Winterherberge verlassen haben, um sich zu sonnen, abends aber wahrscheinlich wieder nach demselben Schlupfwinkel zurückkehren. An Jagd und Fortpflanzung denken sie dann jedoch noch nicht; denn ihr eigentliches Sommerleben beginnt erst Anfang April. Wenn sie im Herbst zur Ruhe gehen, sind sie fett; wenn sie im Frühling wieder zum Vorschein kommen, ist etwa die Hälfte ihres Fettes verbraucht. Weitaus die meisten giftlosen Schlangen sind Tag-, fast alle Giftschlangen dagegen Nachttiere. Die ersteren ziehen sich mit Beginn der Dunkelheit nach ihrem Schlupfwinkel zurück, verbringen hier in träger Ruhe die Nacht und erscheinen erst geraume Zeit nach Sonnenaufgang wieder; die Giftschlangen zeigen sich übertags zwar oft genug, jedoch nur im Zustande schläfriger Ruhe: denn ihre Tätigkeit beginnt erst nach Eintritt der Abenddämmerung. Wer an solchen Orten, wo Giftschlangen häufig sind, nachts ein Feuer anzündet, wird bald wahrnehmen, daß das Otterngezücht zu den Nachttieren gehört. Durch den Schein des Feuers angezogen, kriecht es von allen Seiten herbei, und der Fänger, der übertags vergeblich sich bemühte, an derselben Stelle eine einzige Kreuzotter, Sand- oder Hornviper zu fangen, wird nachts reiche Beute gewinnen können. Wenn wir in den afrikanischen Steppen übernachten mußten, sind wir durch die Hornviper oft ungemein belästigt worden, und mehr als einmal haben wir mit einer Zange in der Hand stundenlang gewacht, um das herankriechende Gewürm sofort zu packen und ins Feuer zu schleudern.
Alle Schlangen, über deren Lebensweise wir unterrichtet sind, nähren sich von andern Tieren, und zwar hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich von solchen, die sie selbst gefangen und getötet haben. Die Art und Weise, wie sie ihr tägliches Brot gewinnen, ist sehr verschieden. Wohl die meisten von ihnen lauern auf eine in der Nähe ihres Lagerplatzes vorübergehende Beute, überfallen dieselbe plötzlich und bringen ihr den tödlichen Biß bei oder ergreifen und verschlingen sie, entweder sofort, oder nachdem sie das Opfertier erst erwürgt haben. Die giftige Schlange kann mit der giftlosen Schlange an Schnelligkeit und Gewandtheit nicht wetteifern. Jene bedarf nicht des Aufwandes an Kraft wie diese. Ihre Waffen sind so furchtbarer Art, daß gleichsam nur die Berührung ihres Opfers und tatsächlich ein kaum mehr als millimetertiefes Einhauen ihrer Giftzähne genügt, dasselbe in ihre Gewalt zu bringen, während die giftlose Schlange zwar ebenfalls lauert wie sie, jedenfalls aber viel öfter und regelmäßiger verfolgend jagt als irgendeine Giftschlange und, wenn sie eine beabsichtigte Beute glücklich erreicht, auch außerdem sich anstrengen muß, um dieselbe festzuhalten. Dafür kommen ihr aber ihre Begabung, ihr gestreckter Bau, ihre im Verhältnis zu dem einer Giftschlange stets beträchtliche Leibeslänge und die hiermit im Einklang stehende Beweglichkeit und Gelenkigkeit zugute.
Wenn man verschiedene Schlangen in entsprechender Weise pflegt, ihnen vor allem die nötige Wärme gewährt, benehmen sie sich im Käfige wahrscheinlich im wesentlichen nicht viel anders als in der Freiheit. Unnützes Umherstreifen behagt ihnen nicht, weit mehr ruhiges Verharren auf einer und derselben Stelle. Einige liegen stundenlang mehr oder minder unbeweglich in oder auf dem Sande, zwischen Steinen, die ihnen passende Schlupfwinkel darbieten, auch wohl im Wasser; andere ruhen verknäuelt, mehr hängend als liegend, auf dem für sie bestimmten Geäst, und alle scheinen sich, solange sie nicht gestört werden, in der behaglichsten Stimmung zu befinden, im übrigen aber um die ganze Außenwelt nicht im geringsten sich zu kümmern. Da naht der nahrungspendende Wärter und schüttet seine Gabe von oben hinab in die Käfige der gefangenen Schlangen, je nach Art und Bedürfnis derselben, in diesen Käfig eine Ladung Frösche, in jenen eine gewisse Anzahl von Fischen, in die mit Riesenschlangen und großen Giftschlangen besetzten je ein lebendes Kaninchen, eine Taube oder sonst ein warmblütiges Wirbeltier. Die Giftschlangen kümmern sich auch jetzt noch manchmal stundenlang kaum um die gebotenen Opfer, blasen sich höchstens, augenscheinlich erzürnt über den ihre Ruhe störenden Eindringling, in der vielen von ihnen eigentümlichen Weise auf, züngeln vielleicht auch einige Male, erheben drohend den Kopf und lassen es zunächst dabei bewenden. Riesenschlangen und Nattern dagegen verlieren, wenn sie einigermaßen hungrig sind, keinen Augenblick, sondern beginnen sofort die Verfolgung der in ihren Bereich gelangenden Beute: die einen, indem sie sich mit Anstrengung aller Kräfte so eilig als möglich auf jene stürzen, die andern, indem sie bedächtig, langsam, regelrecht das Opfer zu beschleichen suchen. Noch bevor der in den Käfig geworfene Frosch in Erfahrung gebracht hat, in welcher Gesellschaft er sich befindet, ist er von einer behenden Natter bereits an einem Hinterbeine gepackt worden und arbeitet mit den übrigen Gliedern vergeblich, sich loszuringen, wandert vielmehr langsam und sicher weiter und weiter in den Schlund der Natter. Nicht viel besser ergeht es dem Kaninchen, der Taube, dem Huhne, das einer Riesenschlange vorgesetzt wurde, nur daß dieses vorher in später zu schildernder Weise erwürgt wird. Im Laufe der Nacht findet gewöhnlich auch das einer Giftschlange gebotene Tier sein Ende; sehr häufig aber bemerkt man, daß die Schlange ihr Opfer trotzdem nicht weiter berührte.
Beachtenswert ist, daß alle Schlangen sehr genau wissen, wie sie mit ihrer Beute umzugehen haben. Frösche und Fische werden ohne weiteres, d. h. bei lebendigem Leibe, verschlungen, Eidechsen dagegen ebenso wie Säugetiere und Vögel erst erwürgt. Und nicht eher als bis die Schlange von ihrem Tode sich überzeugt hat, löst sie ihre Schlingen, um solche Beute nunmehr nach gewohnter Art zu verzehren. Alle Beute wird ganz verschlungen; keine Schlange ist imstande zu zerstückeln, einen mundrechten Bissen von einem größeren Tiere abzutrennen.
Je nach Art und Größe der Schlangen ist die Beute, der sie nachstellen, eine höchst verschiedene. Die Riesen der Ordnung sollen wirklich Tiere bis zur Größe eines Rehes verschlingen können; die übrigen begnügen sich mit kleineren Geschöpfen, namentlich Nagetieren, kleinen Vögeln, Kriechtieren aller Art (vielleicht mit Ausnahme der Schildkröten) und Fischen, während die niedere Tierwelt bloß von den Wurm- und Zwergschlangen und vielleicht den Jungen verschiedener Arten, die im Alter Wirbeltieren nachjagen, bedroht wird. Unsere Beobachtungen über die Nahrung sind zur Zeit noch sehr dürftig und mangelhaft; soviel aber dürfen wir behaupten, daß jede Schlangenart mehr oder weniger eine bestimmte Tierart bevorzugt. »Alle Wassernattern«, schreibt mir Effeldt, auf Grund seiner langjährigen Beobachtungen, »als da sind Ringel-, Würfel-, Viper- und amerikanische Natter, fressen nur Fische und Frösche, und zwar von Fröschen ausschließlich den braunen Grasfrosch, schaudern aber zurück, wenn man ihnen den grünen Wasserfrosch gibt, und lassen denselben, obwohl sie anbeißen, selbst bei großem Hunger sofort wieder fahren. Die glatte Natter frißt nur graue Eidechsen, die gelbgrüne, wie die Eidechsennatter nur Smaragdeidechsen, die trügerische Natter graue, Zaun- und Mauereidechsen; die Äskulapschlange, die vierstreifige und die Hufeisennatter, die gebänderte und algerische Natter nehmen warmblütige Tiere, wie Mäuse und Vögel, zu sich; die Leopardennatter verzehrt nur Mäuse. Letzteren stellen alle Giftschlangen, die ich beobachtete, nach, beispielsweise die Kreuzotter, Sand- und Hornviper, Aspisschlange und andere; eine Ausnahme aber macht die Wasserviper, deren gewöhnliche Nahrung zwar Fische sind, die jedoch auch Frösche und selbst Schlangen, giftige nicht ausgenommen, frißt, und auch wiederum warmblütige Tiere, wie Mäuse und Vögel, nicht verschmäht.« Daß einzelne Schlangen Vogeleier fressen, weiß schon Plinius. Außer Wirbeltieren fressen sie wirbellose, einzelne vielleicht selbst Weich- und Krustentiere; man hat gesehen, daß sie anscheinend mit wahrem Behagen Ameisenpuppen fraßen, auch in dem Magen einzelne Grillen gefunden.
Der Glaube an das Wunderbare und Unnatürliche hat eine sonderbare, noch heute in manchen Köpfen spukende Meinung erzeugt. Bis in die neueste Zeit haben sich sogar Naturforscher nicht gescheut, die Worte ›Zauberkraft der Schlangen‹ auszusprechen, und sie in Verbindung zu bringen mit der Art und Weise, wie die Schlangen Beute gewinnen. Man hat nämlich beobachtet, daß manche Tiere, Mäuse und Vögel z. B., sich ohne Furcht Schlangen näherten, die sie später abfingen und verschlangen, und hat ebenso gesehen, daß Vögel mit höchster Besorgnis Schlangen umflatterten, die ihre Brut oder sie selbst bedrohten, schließlich sich versahen und ebenfalls ergriffen wurden. Da nun, so scheint man gefolgert zu haben, der Naturtrieb, der das Tier ohne weiteres über alle ihm drohenden Gefahren belehrte, in beiden Fällen sich nicht bewährte, die arme Maus, den beklagenswerten Vogel also schmählich im Stiche ließ, konnte nur noch Annahme einer andern, übernatürlichen Kraft etwaige Zweifel lösen. Wollte man den unzähligen Berichten, die über die Zauberkraft der Schlangen uns von verschiedenen Reisenden gegeben worden sind, unbedingten Glauben schenken, so müßte man sich allerdings ebenfalls zu der von ihnen ausgesprochenen Ansicht bekennen. Man gelangt jedoch zur unbedingten Verwerfung der letzteren, sowie man sich darüber klar geworden ist, daß wohl die Beobachtungen an und für sich richtig sein mögen, die Schlußfolgerungen aber falsch sind. Nach meinen, unzählige Male wiederholten Wahrnehmungen verhält sich die Sache einfach so, daß die nach Ansicht jener Reisenden verzauberten Tiere die Schlange, die sie bedroht, nicht als das furchtbare Raubtier erkennen, das sie ist. Weder das Säugetier, sei es nun ein unkluges Kaninchen oder eine alte erfahrene Ratte, noch irgendein Vogel, und wäre es selbst der mißtrauische, durch vielfache Schicksale gewitzigte Sperling, wissen, was eine Schlange ist. Falls sie ihr überhaupt Beachtung schenken, nähern sie sich ihr plump neugierig, betrachten oder beschnüffeln sie, lassen es sich gefallen, daß die Schlange sie bezüngelt, und prallen nur dann ein wenig zurück, wenn die Zunge sie an irgendeiner empfindlichen Stelle kitzelt. Alte, kräftige Ratten, die man zu großen Schlangen setzt, bekunden vor diesen nicht nur nicht Furcht, sondern betätigen die ihnen eigene Dreistigkeit manchmal in gänzlich unerwarteter Weise. Eine von ihnen, die ich gefangenen Klapperschlangen als Opfertier anbot, kümmerte sich nicht im geringsten um das bedrohliche Rascheln und Zischen der Schlange, sondern fraß, als sie Hunger bekam, ein Loch in den Leib des Giftwurmes, an dem dieser elendiglich zu Grunde ging. Daß nun vollends an den Gifthauch irgendeiner Schlange nicht gedacht werden kann, bedarf keiner längeren Auseinandersetzung. Viele Schlangen, insbesondere die Giftschlangen, riechen allerdings nicht gerade nach Ambra und Weihrauch, verbreiten, namentlich wenn sie gefressen haben und verdauen, im Gegenteil sehr unangenehme Düfte; daß aber solche ein Säugetier betäuben könnten, muß als gänzlich unmöglich erachtet werden. Anders, aber ebenso leicht, erklärt sich das von obengedachten Reisenden beobachtete ängstliche Gebaren verschiedener Vögel am Neste angesichts einer diesem sich nähernden Schlange. In solchen Fällen nehmen, wie jedem Beobachter bekannt, schwächere Vögel gern zu Verstellungskünsten ihre Zuflucht, um die Aufmerksamkeit des erkannten Feindes von ihrer Brut ab- und sich zuzulenken: sie schreien kläglich, nähern sich scheinbar sinnbetört dem Feinde, flattern und hinken auf dem Boden dahin, als ob ihnen Flügel und Beine gelähmt wären, lassen sich wie tot von der Höhe der Zweige hinab ins Gras fallen usw., täuschen auch dadurch regelmäßig jeden nicht besonders gewitzten Feind, den weisen Menschen nicht ausgeschlossen. Solche Fälle mögen es gewesen sein, die jenen Beobachtern vorgelegen haben.
Da die Schlangen alle Nahrung unzerstückelt und zuweilen in Bissen verschlingen, die doppelt so dick sind als ihr Kopf, erfordert das Hinabwürgen bedeutenden Kraftaufwand und geht nur langsam vor sich. Mit seltenen Ausnahmen packen sie die Beute stets vorn am Kopfe, halten sie mit den Zähnen fest, schieben die eine Kopfseite vor, haken die Zähne wiederum ein, schieben die der andern Kopfseite nach, und greifen so abwechselnd bald mit dieser, bald mit jener Zahnreihe weiter, bis sie den Bissen in den Rachen gefördert haben. Infolge des bedeutenden Drucks sondern die Speicheldrüsen sehr reichlich ab und erleichtern den Durchgang desselben durch die Maulöffnung, die allmählich bis auf das äußerste ausgedehnt wird. Während des Verschlingens sehr großer Beutestücke erscheint der Kopf unförmlich auseinandergezerrt und jeder einzelne Knochen des Kiefergerüstes verrenkt; sobald jedoch der Bissen durchgegangen ist, nimmt er seine vorige Gestalt rasch wieder an. Es kommt vor, daß Schlangen Tiere packen und zu verschlingen suchen, die selbst für ihr unglaublich dehnbares Kiefergerüst zu groß sind; dann liegen sie stundenlang mit der Beute im Rachen auf einer und derselben Stelle, die Luftröhre soweit vorgestoßen, daß die Atmung nicht unterbrochen wird, und mühen sich vergeblich, die Masse zu bewältigen, falls es ihnen nicht glückt, die Zähne aus ihr herauszuziehen und sie durch Schütteln mit dem Kopfe wieder herauszuwerfen; die Angabe aber, daß die Schlange des einmal gepackten und verschlungenen Beutestückes nicht wieder sich entledigen könne und unter Umständen an einem zu großen Bissen ersticken müsse, ist gänzlich falsch. Giftschlangen packen ihr Opfer erst, nachdem es verendet ist, und dann mit einer gewissen Vorsicht, um nicht zu sagen Zartheit. Sie gebrauchen beim Verschlingen ihre Giftzähne nicht, sondern legen dieselben soweit zurück als möglich und bringen dafür die Unterkinnlade hauptsächlich in Wirksamkeit. Die Verdauung geht langsamer vor sich, ist aber sehr kräftig. Zuerst wird derjenige Teil der Beute, der im untern Magen liegt, zerfetzt, und so geschieht es, daß ein Stück bereits aufgelöst und in den Darmschlauch übergegangen ist, ehe noch der andere Teil von der Verdauung angegriffen wurde. Werden mehrere Tiere verschluckt, so liegen diese, falls sie nicht sehr klein sind, nicht neben-, sondern stets hintereinander, und ist der Magen voll, so müssen die übrigen in der Speiseröhre verharren, bis sie nachrücken können. Die unverdaulichen Teile oder Speisereste, insbesondere Federn und Haare, werden durch den After entleert, ausnahmsweise und wohl nur von nicht kräftigen oder ungesunden Schlangen als Gewölle ausgespien, wie solches mit wenig verdauten Beutestücken geschehen kann, wenn die betreffende Schlange erschreckt oder überhaupt belästigt wird. Der Nahrungsverbrauch ist von der Witterung abhängig und steigert sich mit der Wärme; eigentlich gefräßig aber kann man die Schlangen nicht nennen. Sie verschlingen zwar viel auf einmal, können jedoch auch dann auf Wochen, ja selbst monatelang ohne jegliche Nahrung ausdauern.
Alle Schlangen trinken, die einen saugend, mit vollen Zügen, unter deutlich sichtbaren Bewegungen der Kinnladen, die andern, indem sie mit der Zunge Wasser- oder Tautropfen aufnehmen, bezüglich ihre Zunge mit denselben anfeuchten. Ich muß diese Angabe besonders betonen, da ich sehe, daß Effeldt, dessen Beobachtungsgabe und Erfahrung ich vollste Anerkennung zolle, neuerdings an Lenz berichtet hat, auch diejenigen Schlangen, die beim Trinken den Kopf in das Wasser stecken, sollten immer nur leckend, nie mit eingezogener Zunge trinken. An von mir gepflegten Klapperschlangen habe ich das Gegenteil wahrgenommen: sie tranken, wenn sie sehr durstig waren, unter förmlich kauenden Bewegungen ihrer Kinnladen, also schlürfend, nicht lappend. Wenn Schlangen nach längeren Reisen in engen Versandkisten in einen wohl eingerichteten Käfig gebracht werden, hungrig und durstig denselben nach allen Richtungen untersuchen und endlich das Wassergefäß entdecken, vergewissern sie sich durch Tasten mit der Zunge des ihnen winkenden erquicklichen Trunkes, tauchen die Schnauze bis zu und über die Augen ein und trinken dann unter Umständen so viel, daß sie, wie Effeldt sehr richtig bemerkt, ›zuweilen förmlich aufschwellen‹. Manche Arten verkümmern sichtlich und gehen schließlich zugrunde, wenn sie des Wassers entbehren müssen; andere hingegen scheinen ihr Bedürfnis an wenigen Tropfen tage-, ja wochenlang befriedigen zu können.
Wichtiger noch als für das Leben des Vogels die Mauser, ist für das Leben der Schlangen die Häutung, eines der ersten Geschäfte, das das eben dem Ei entschlüpfte Junge vornimmt, und eines, das von dem erwachsenen Tiere im Laufe des Jahres mehrmals wiederholt wird. Die Häutung beginnt mit Ablösen der feinen, wasserhellen Oberhaut an den Lippen, wodurch eine große Öffnung entsteht. Es bilden sich nun zwei Klappen, die eine am Oberkopfe, die andere an der Unterkinnlade, die sich zurückschlagen und nach und nach weiter umgestülpt werden, so daß schließlich der innere Teil nach außen gekehrt wird. Im Freien benutzen die Schlangen Moos, Heide- und andere Pflanzen, oder überhaupt Rauhigkeiten, um sich ihres Hemdes zu entledigen, und können die Häutung in sehr kurzer Zeit vollenden; im Käfig bemühen sie sich oft lange vergeblich, um denselben Zweck zu erreichen, lösen auch nur selten die ganze Haut unzerrissen ab. Nach den Beobachtungen unsres Lenz geschieht bei den einheimischen Schlangen die erste Häutung Ende April und Anfang Mai, die zweite Ende Mai und Anfang Juni, die dritte Ende Juni und Anfang Juli, die vierte Ende Juli und Anfang August, die fünfte endlich Ende August bis Anfang September.
Wenige Tage nach der ersten Frühjahrshäutung beginnt die Fortpflanzung. Sie erregt auch die Schlangen in einem gewissen Grade, keineswegs aber in einem so hohen, als man gefabelt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, daß einzelne Arten während der Paarungszeit zu größeren Gesellschaften sich vereinigen und längere Zeit zusammen verweilen: von einigen Giftschlangen wenigstens hat man beobachtet, daß sie gerade während der Begattung zu einem förmlichen Knäuel sich verschlingen und in dieser sonderbaren Vereinigung stundenlang verharren. Die Alten, die solche Verknäuelungen mehrerer Schlangen gesehen zu haben scheinen, erklärten sich die Ursache in abergläubischer Weise, nannten den Knäuel ein Schlangenei und schrieben ihm die wunderbarsten Kräfte zu. In der Regel findet man Männchen und Weibchen der sich paarenden Schlangen innig umschlungen auf den beliebtesten Lagerstellen ruhend, im Sonnenscheine stundenlang auf einer und derselben Stelle liegend, ohne sich zu regen. Die Vereinigung beider Geschlechter ist aus dem Grunde eine sehr innige, als die walzenförmigen Ruten des Männchens, die bei der Paarung umgestülpt werden, an der inneren Seite mit harten Stacheln besetzt sind und daher fest in den Geschlechtsteilen des Weibchens haften. Wie lange die Paarung dauert, weiß man noch nicht; wohl aber darf man annehmen, daß sie mehrere Stunden beansprucht: Effeldt fand ein Dutzend verknäuelte Kreuzottern, die er am Abend aufgespürt hatte, noch am folgenden Tage in derselben Lage vor. Nach etwa vier Monaten sind die Eier, sechs bis vierzig an der Zahl, legereif und werden nun von der Mutter in feuchtwarmen Orten abgelegt, falls die Art nicht zu denjenigen gehört, die soweit entwickelte Eier zur Welt bringen, daß die Jungen sofort nach dem Ablegen des Eies oder schon im Mutterleibe die Eihülle sprengen. Hierbei leistet die Mutter keine Hilfe, wie sie sich überhaupt um die ausgeschlüpften Jungen wenig oder nicht bekümmert. Letztere wachsen außerordentlich langsam, möglicherweise aber bis ans Ende ihres Lebens fort, in höheren Jahren selbstverständlich ungleich langsamer als in jüngeren.
Die Bedeutung der Schlangen der übrigen Tierwelt gegenüber ist so gering, daß man wohl behaupten darf, das ›Gleichgewicht der Natur‹ werde auch ohne jene nicht verändert werden. Allerdings nützen einige von ihnen durch Wegfangen von Mäusen und andern schädlichen Nagetieren; der Vorteil jedoch, den sie dem Menschen hierdurch bringen, wird, wie ich bereits gesagt habe, mehr als aufgewogen durch den Schaden, den sie, mindestens die giftigen Arten unter ihnen, verursachen: der Haß, unter dem die ganze Ordnung zu leiden hat, darf deshalb gewiß nicht als unberechtigt bezeichnet werden. Es gereicht dem Menschen zur Ehre, wenn er die ungiftigen Schlangen nicht der giftigen halber verdammt, verfolgt und tötet; zur Unterscheidung dieser und jener gehört aber eine so genaue Kenntnis des ganzen Gezüchtes, daß man schwerlich wohltut, dem Laien Schonung desselben anzuraten. Bei uns zulande hält es allerdings nicht schwer, die einzige Giftschlange, die wir haben, von den giftlosen Arten zu unterscheiden: schon im südlichen Europa hingegen kommt eine Natter vor, die dieser Kreuzotter so ähnlich sieht, daß selbst der schlangenkundige Dumeril sich täuschen und anstatt gedachter Natter eine Kreuzotter aufnehmen konnte, deren Biß ihn in Lebensgefahr brachte. Und in allen übrigen Erdteilen werden Schlangen gefunden, von denen man, ungeachtet unserer vorgeschrittenen Kenntnis, noch heutigentags nicht weiß, ob sie giftig oder ungiftig sind. Wer also Schonung der Schlangen predigen will, muß sich wenigstens streng auf Deutschland beschränken, damit er nicht etwa Unheil anrichte.
Die Schlangen haben von jeher in den Sagen wie im Glauben der Völker eine bedeutende Rolle gespielt. Nicht bloß die jüdisch-christliche, sondern die Sage eines jeden Volkes überhaupt gedenkt ihrer, bald mit Furcht und Abscheu, bald mit Liebe und Verehrung. Schlangen galten als Sinnbilder der Geschwindigkeit, der Schlauheit, der ärztlichen Kunst, selbst als solche der Zeit; Schlangen wurden, wie es heutigentags noch unter den rohen Völkern geschieht, bereits im grauen Altertume angebetet, von den Indiern als Sinnbild der Weisheit, von andern Völkern als solches der Falschheit, Tücke und Verführung, von andern wiederum, wie z. B. von den Juden, als Götzen, wie denn ja auch Moses eine Schlange aufrichtete, um durch dieselbe das ›Volk Gottes‹ von einer Plage zu befreien. Solche Anschauungen haben sich bis in spätere Jahrhunderte erhalten und leben heutigentags noch unter verschiedenen Völkern Europas, Asiens und Afrikas. Daß Schlangen Glück und Segen bringen, ist ziemlich allgemein verbreiteter Aberglaube; daß ihre Tötung Unheil nach sich zieht, die feste Überzeugung der Indier und Malaien. Nach Krapf sehen die Galla die Schlange als Mutter des Menschengeschlechtes an und zollen ihr hohe Verehrung. Als Heuglin eine afrikanische Riesenschlange in der Nähe eines Gehöfts der Dinkaneger erlegte, waren diese sehr ungehalten und sprachen klagend dahin sich aus, daß der gewaltsame Tod ihres Ahnherrn, der schon so lange in Frieden bei ihnen gewohnt habe, ihnen Unheil bringen werde. Schlangen sind, wie Schweinfurth bestätigend und ergänzend bemerkt, die einzigen Tiere, denen von den Dinka- sowohl wie von den Schilluknegern des Weißen Flusses eine Art göttlicher Verehrung gezollt wird. Die Dinka nennen sie ihre Brüder und betrachten Tötung derselben als ein Verbrechen. Wer versucht sein sollte, die rohen Völker zu belächeln, mag zuerst der Sardinier gedenken; denn die Ansichten dieser sind von denen jener nicht wesentlich verschieden. »In den Versammlungen der Frauen«, sagt Cetti, »werden von unsern Schlangen Wunderdinge erzählt. Sie sollen ehedem Wahrsagerinnen und der Zukunft kundig gewesen sein. Ich glaube gern, daß solche Märchen von unsern gebildeten Frauen nur zum Scherze erzählt werden; viele unserer Landleute aber sehen in den Schlangen einen ihrer vollsten Zuneigung und Hochachtung würdigen Gegenstand. Wenn eine in die Hütte des Bauern oder Hirten kommt, zeigt sie bevorstehendes Glück an; und wenn jemand sich einfallen lassen sollte, ihr übel zu begegnen, würde man dies für ebenso töricht halten, als wenn er das seinem Hause nahende Glück von sich abweisen wollte. Daher lassen alle Frauen auf dem Lande es sich angelegen sein, die Schlange zu behalten, und tragen ihnen täglich mit besonderer Sorgfalt Futter vor die Höhle, die letztere sich zum Wohnsitze erwählte. Ich kenne eine Frau, die solchen Dienst zwei Jahre lang ausgeübt hat.« Die russischen und – die thüringer oder süddeutschen Bauern denken nicht anders als die Sarden: auch in ihren Augen gilt die in das Gehöft kommende Schlange als Botschaft des freundlich sich nahenden Glückes.
Kein Wunder, daß derartige Anschauungen schon in frühester Zeit dahin führen mußten, in den Schlangen ganz andere Tiere zu erblicken, als sie wirklich sind. Alle denkbaren Eigenschaften wurden ihnen angedichtet, gute und böse, und so mußten sie bald die Stelle eines Gottes, bald die eines Teufels vertreten. Und nicht bloß Eigenschaften, die sie nicht besitzen, schrieb man ihnen zu, sondern ebenso Flügel, Beine und andere Glieder, kronenartigen Kopfputz und dergleichen, weil sich mit ihnen die Einbildungskraft mehr beschäftigt hat als wirkliche Beobachtung. Ich unterlasse eine Aufzählung der von Plinius und andern römischen wie auch von griechischen Schriftstellern aufgeführten Heil-, Zauber- und sonstigen Mittel, die man aus dem Leibe und einzelnen Leibesteilen verschiedener Schlangen zu gewinnen wähnte, und beschränke mich darauf, anzugeben, daß wir den Römern und Griechen jene aus Vipern bereiteten Arzneien verdanken, die das Mittelalter noch lange überdauert haben. Noch in den letzten Jahrhunderten sind Hunderttausende von verschiedenen zum Otterngeschlechte gehörigen Schlangen in Europa, vorzüglich in Italien und Frankreich für die Apotheke gesammelt worden; ja, es ging, weil man mit den europäischen noch nicht ausreichte, soweit, daß man ägyptische Giftschlangen in Unzahl aufkaufte.
Zur Beruhigung aller derer, die sich vor den Schlangen fürchten, und zur Freude aller Gegner des gefährlichen oder doch furchterregenden Gezüchtes ist das Heer seiner Feinde sehr zahlreich. Bei uns zulande stellen Katzen, Füchse, Marder, Iltisse, Wiesel, Igel, Wild- und Hausschweine, in südlicheren Gegenden die Schleichkatzen und namentlich die Mangusten den Schlangen eifrig nach, und ebenso verfolgen sie nachdrücklichst Schlangen- und Schreiadler, Bussarde, Raben, Elstern und Häher, Störche und andere Sumpfvögel sowie die betreffenden Vertreter dieser Vögel in heißen Ländern. Als der ausgezeichnetste aller Schlangenvertilger gilt der Kranichgeier oder Sekretär; doch leisten auch andere Ordnungsverwandte: Edel-, Zahn-, Sing- und Schlangenhabicht, Sperberadler, Gaukler, Geierfalk, Königs- und Rabengeier Erkleckliches, ganz abgesehen noch von manchen Leichtschnäblern, Scharr- und Stelzvögeln, deren Wirksamkeit wir bereits kennengelernt haben. Sie alle verdienen die Beachtung und den Schutz der Verständigen; denn der größte Teil von ihnen vernichtet nicht allein die Schlangen, sondern ersetzt auch ihre Leistungen vollständig.
Zähmung oder wenigstens Gefangenhaltung der Schlangen ist uralt. Schon die alten Ägypter sollen solche, und unter ihnen auch die furchtbare Uräusschlange in ihren Wohnungen gepflegt haben. Daß Gaukler dieselbe Schlange genau ebenso benutzten, wie noch heutigentags geschieht, manchmal auch tödlich gebissen wurden, wie es gegenwärtig ebenfalls vorkommt, erfahren wir durch Aelian, daß Frauen zuweilen kalte Schlangen um ihren Hals legten, durch Martial. Kaiser Tiberius besaß, wie Suetonius mitteilt, eine Schlange, die er sehr lieb hatte und aus der Hand zu füttern pflegte; Kaiser Heliogabal ließ, nach Angabe des Aelius Lampridius, zuweilen viele Schlangen sammeln und an Tagen, die das Volk zu den öffentlichen Spielen versammelten, vor Sonnenaufgang ausschütten, um sich an dem Entsetzen der geängstigten Menschen, von denen viele durch Bisse oder im Gedränge umkamen, zu weiden. An den Höfen der indischen Fürsten waren, wenn wir den alten Schriftstellern vollen Glauben schenken wollen, gefangene Schlangen etwas durchaus Gewöhnliches.
Die meisten Schlangen gewöhnen sich leicht an die Gefangenschaft und dauern in ihr Jahre aus. Zu ihrer Behaglichkeit ist Wärme, und zwar feuchte Wärme unbedingtes Erfordernis, namentlich darf ihrem Käfige ein Wasserbehälter zum Baden nicht fehlen. Um sie ans Futter zu gewöhnen, muß man ihnen zuerst lebende Tiere reichen, haben sie sich einmal herbeigelassen, diese zu ergreifen und zu verschlingen, so kann man dann auch zu toten und später selbst zu Fleischstücken übergehen.
Verschiedenartige, in einen Käfig zusammengesperrte Schlangen vertragen sich oder schlagen sich, je nachdem; eine frißt auch wohl andere auf, wie es in der Freiheit ebenfalls geschieht. Man kann gegen hundert Nattern verschiedener Arten einander gesellen, auch wohl noch einige kleinere Vipern der Bewohnerschaft eines Käfigs beimischen und nichts anderes als vollste gegenseitige Gleichgültigkeit beobachten, aber auch das Gegenteil erleben, wenn man eine einzige Natter hinzufügt, über deren Lieblingsnahrung man nicht unterrichtet ist. Mehr als einmal habe ich erfahren müssen, daß eine friedfertig und harmlos aussehende Natter sofort über ihre Verwandten herfiel und solche verschlang, die ihr an Größe wenig nachgaben. Giftschlangen beißen oft ihresgleichen blutig oder töten andersartige ihres Gezüchtes, ebensowohl um sie zu verschlingen, als aus reiner Bosheit oder vielleicht aus Ärger über die ihnen durch jene erwachsende Beunruhigung und Störung. Größere Arten aller drei landlebenden Familien der giftzahnigen Unterordnung darf man niemals mit andern Schlangen, gleichviel ob mit giftigen oder ungiftigen, zusammenbringen, falls man nicht auf Verluste gefaßt sein will; selbst kleine Vipern, die sich in der Regel nicht im geringsten um andere Schlangen kümmern, beißen und töten zuweilen Nattern, mit denen sie monatelang in gegenseitiger Nichtbeachtung gelebt hatten. Dagegen kann man auch wiederum ein dem Anscheine nach sehr inniges Zusammenleben gleichartiger Schlangen beobachten. Riesenschlangen, Nattern und andere kletternde Arten der Ordnung ruhen gern gemeinschaftlich im Gezweige und verknäueln sich dabei nicht selten zu einem für das Auge unentwirrbaren Ballen.
Zu ihrem Pfleger treten gefangene Schlangen nach und nach in ein gewisses Freundschaftsverhältnis, nehmen ihnen vorgehaltene Nahrung aus dessen Händen oder aus einer Zange, lassen sich berühren, aufnehmen, umhertragen, selbst bis zu einem gewissen Grade abrichten usw.; von wirklicher Anhänglichkeit an ihren Gebieter bemerkt man aber nichts, bei starker oder, dank ihrer Giftzähne, mindestens wehrhaften Arten eher noch das Gegenteil. Unter meiner Aufsicht gepflegte Riesenschlangen bekundeten unverkennbare Abneigung gerade gegen ihren Wärter, und auch große Giftschlangen sah ich in Zorn geraten, wenn ihr Pfleger ihnen sich nahte. Die Erregung begründete sich in beiden Fällen einzig und allein auf die durch den Wärter notgedrungen herbeigeführten Störungen der in behaglicher Faulheit sich gefallenden Tiere. Mit den reizbaren, jähzornigen Giftschlangen läßt sich nur ausnahmsweise ein einigermaßen erträgliches Verhältnis anbahnen; aber sie beißen mitunter auch dann noch, wenn sie schon monatelang als gezähmt angesehen worden waren. Der Umgang mit ihnen bleibt unter allen Umständen gefährlich und erfordert so große Vorsicht, daß man, meiner Erfahrung gemäß, niemand anraten darf, mit ihnen sich abzugeben.
*
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Alten unter ihren Drachen unsere heutigen Riesenschlangen verstanden. Die auffallende Größe dieser Tiere, ihre bedeutende Stärke und die allgemeine Furcht vor den Schlangen insgemein lassen die Übertreibungen, deren jene sich schuldig machten, sehr begreiflich und der noch heute in vielen Köpfen spukende Wunderglaube neben der beliebten Faselei gewisser Reisenden und sogenannter Naturbeschreiber auch sehr verzeihlich erscheinen. Von einem Menschen, der sich den vermeintlichen Ungeheuern gegenüber schwach fühlte, darf es uns nicht wundernehmen, daß seine Furcht mehr als doppelt sah und seine Einbildungskraft gedachte Ungeheuer mit Gliedern begabte, die nicht vorhanden sind. Die sogenannten Aftersporen der Riesenschlangen, die wir gegenwärtig als verkümmerte Fußstummel deuten, wurden von den Alten übersehen, dafür aber den in ihren Augen scheußlichen Geschöpfen eigentümliche Füße und wunderbare Flügel angedichtet. Im Verlaufe der Zeit begabte die Phantasie die Drachen noch reichlicher: der Teufelsspuk kam mit ins Spiel, und aus den unverständlichen Märchensagen der Morgenländer erwuchsen nach und nach Gestalten, für die der Vernünftige vergeblich Urbilder suchte, weil die Kunde von den Riesenschlangen wenigstens fast verloren gegangen war. Um so inniger klammerte sich der Abergläubige an die abgeschmackte Schilderung von dem »großen Drachen oder der alten Schlange, die da heißet Teufel oder Satanas und ausgeworfen ward auf die Erde, um die ganze Welt zu verführen«, und mit dem Begriffe Drache verband sich nach und nach der des Teufels, bis zuletzt die Benennung Drache zu einem Schmeichelnamen von jenem selbst wurde. In dieser Bedeutung wird das Wort noch heutigentags von dem Volke gebraucht, beispielsweise von den in anderer Hinsicht sehr gebildeten Thüringer Bauern.
Wenn man sich der Übertreibungen erinnern will, die sich einzelne Reisende noch heutigentags zuschulden kommen lassen, wird man sich mit solchen und ähnlichen Phantasien wahrscheinlich aussöhnen. Noch gegenwärtig spricht man von fünfzig Fuß langen Riesenschlangen; noch gegenwärtig scheut man sich nicht zu erzählen, daß solche Ungeheuer wohl auch über Pferde, Rinder und andere Tiere herfallen, sie erwürgen und verschlingen. Es mag sein, daß die Riesenschlangen vormals eine bedeutendere Größe erlangten als gegenwärtig, wo ihnen der besser ausgerüstete Mensch entgegentritt und mit seinen furchtbaren Waffen das Leben kürzt; solche Schlangen aber, wie sie die Alten uns beschrieben, hat es nie gegeben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie außerordentlich schwer es hält, die Länge der Schlangen richtig zu schätzen. Selbst derjenige, der hierin wohl geübt ist und seine Schätzungen später durch Anlegung des Maßstabes erprobt hat, irrt in unbegreiflicher Weise. Schon bei kleinen Schlangen von Meterlänge, und selbst wenn man diese ruhig vor sich liegen sieht, auch volle Zeit hat, ihr Bild genau sich einzuprägen, ist man nur zu leicht geneigt, ein reichliches Dritteil zuzusetzen; bei Schlangen aber, die drei Meter lang sind, verdoppeln und verdreifachen sich die Schwierigkeiten und damit die Fehler der Schätzung, und wenn solches Tier vollends sich bewegt, ist letztere einfach unmöglich. Worin dies eigentlich liegt, vermag ich nicht zu sagen, sondern nur als tatsächlich zu versichern, daß ausnahmslos jeder überschätzt, der überhaupt zu schätzen versucht, und daß jeder immer wieder in dieselben Fehler verfällt, auch wenn er denselben wiederholt erkannt hat. Über die Täuschung vergewissert man sich erst, nachdem man den Maßstab angelegt hat. Kein Wunder also, daß die rege Einbildungskraft der Eingeborenen südlicher Gegenden sich noch viel weniger als die unserige Schranken auferlegt und die wirkliche Größe auf das Doppelte und Dreifache schätzt. Derselbe Indier oder Südamerikaner, der mit dem Anscheine vollster Zuverlässigkeit von einer fünfzig Fuß langen Riesenschlange erzählt, die er selbst gesehen, bezüglich erlegt haben will, wird dem ruhig messenden Forscher, der ein Tier von sechs Meter erlegte, erklären, daß letzteres an Größe alles von ihm Gesehene gleicher Art bei weitem übertreffe.
Die Kennzeichen der Stummelfüßler ( Pteropoda), zu denen die Riesenschlangen gehören, sind folgende: Der Kopf ist gegen den Rumpf mehr oder weniger deutlich abgesetzt, dreieckig oder verlängert eiförmig, von oben nach unten abgeplattet, vorn meist zugespitzt, der Rachen mehr oder weniger weit gespalten, der Leib kräftig und muskelig, seitlich zusammengedrückt, längs der Mittellinie des Rückens oft vertieft, zu beiden Seiten, den hier verlaufenden starken Muskeln entsprechend, erhöht: der Schwanz verhältnismäßig kurz, der Stummelfuß auch äußerlich jederseits durch eine hornige, stumpfe Klaue in der Nähe des Afters angedeutet. Den Kopf bekleiden bald Tafeln, bald Schuppen, den Leib kleine, sechseckige Schuppen, den Bauch schmale, meist einfache, aber breite Schilder, die am Schwanzteile gewöhnlich in doppelter Reihe nebeneinander stehen. Beide Kieferbogen, bei einer Gruppe selbst die Gaumenbeine, tragen derbe Zähne, die in der Regel der Größe nach so geordnet sind, daß der zweite oder dritte in der Reihe der größte ist und die übrigen von ihm ab nach hinten zu an Größe abnehmen. Das verhältnismäßig große Auge zeigt einen länglichen Stern. Die Nasenlöcher öffnen sich nach oben.
Mit Ausnahme der zu unserer Familie zählenden Sandschlangen, von denen ich in der allgemeinen Schilderung gänzlich absehen werde, beschränken sich die Stummelfüßler auf die zwischen den Wendekreisen liegenden Gebiete, gehen wenigstens nicht weit über dieselben hinaus. Gegenwärtig bewohnen sie alle heißen und wasserreichen Länder der Alten und Neuen Welt, und zwar vorzugsweise die großen Waldungen, am liebsten und häufigsten solche, die von Flüssen durchschnitten werden oder überhaupt reich an Wasser sind; einzelne Arten von ihnen kommen jedoch auch in trockenen Gegenden vor. Mehrere sind echte Wassertiere, die nur, um sich zu sonnen und um zu schlafen, die Flüsse, Seen und Sümpfe verlassen, ihre Jagd aber hauptsächlich in den Gewässern oder doch am Rande derselben betreiben; andere scheinen das Wasser zu meiden und bis zu einem gewissen Grade zu scheuen. Der Bau ihres Auges läßt sie als Nachttier erkennen, Beobachtung gefangener hierüber keinen Zweifel aufkommen. Allerdings sieht man die Riesenschlangen in ihren heimischen Wäldern bei Tage sich bewegen und zu dieser Zeit gelegentlich auch Beute gewinnen; ihre eigentliche Regsamkeit aber beginnt mit Eintritt der Dämmerung und endet mit anbrechendem Morgen. An den Gefangenen bemerkt man bald genug, daß sie vollkommene Nachttiere sind. So träge und ruheliebend sie sich übertags zeigen, so munter und lebhaft sind sie des Nachts. Jetzt erst beginnen sie sich zu bewegen, jetzt also würden sie im Freien ihr Gebiet durchstreifen, jetzt auf Raub ausgehen. Übertags sieht man sie, in den verschiedensten Stellungen zusammengerollt, der Ruhe pflegen oder der Sonnenwärme sich hingeben. Einzelne wählen hierzu Felsblöcke, trockene Stellen oder über das Wasser emporragende Äste, andere erklettern Bäume, wickeln sich im Gezweige derselben fest, verknäueln sich oder lassen den vorderen Teil ihres Leibes tief herabhängen; andere suchen eine freie Stelle im Dickichte, auf Felsgesimsen, an den Gehängen auf und legen sich hier, mehr oder weniger langgestreckt oder in den sogenannten Teller zusammengerollt, ruhig hin. Alle bewegen sich so wenig als möglich, eigentlich nur wenn sie Gefahr fürchten und einer solchen zu entgehen suchen, oder aber, wenn sie lange vergeblich gejagt haben und nunmehr eine Beute sich ihnen darbietet. Dann löst sich plötzlich die Verknotung, und das gewaltige Tier stürzt sich mit Aufbietung seiner vollen Kraft auf das ersehene Opfer, packt es mit dem immerhin kräftigen Gebisse, umwindet es, und erstickt es unfehlbar. Ich habe den Hergang so oft beobachtet, daß ich aus eigener Anschauung schildern kann, wie die Schlange hierbei verfährt.
Sobald eine Riesenschlange auch übertags oder in der Dämmerung eine ihr unbesorgt sich nähernde Beute gewahrt, erhebt sie den Kopf über den stumpfen Kegel, den sie bisher bildete, indem sie, zusammengerollt, der Ruhe sich hingab. Der im Lichte zu einem schmalen Spalte zusammengezogene Stern ihres Auges erweitert sich, die Zunge gerät in Bewegung, erscheint und verschwindet abwechselnd, dreht und wendet sich nach dieser und jener Seite, und auch die Schwanzspitze drückt jetzt, wie bei lauernden Katzen, die sich regende Raublust aus. Nach sorgfältiger Beobachtung des Opfers, die eine längere oder kürzere Zeit beanspruchen kann, entrollt sich die Schlange und beginnt nun die Verfolgung. Langsam schiebt sich der Vorderleib über die Ringe hinweg, die die ruhende Schlange neben- und übereinander gelegt hatte; langsam und stetig folgt mehr und mehr von dem wurmförmigen Leibe. Alle Muskeln arbeiten, alle Rippen stemmen sich gegen den Boden, um die schwere Masse vorwärts zu treiben; tastend prüft die ewig bewegliche Zunge Weg und Steg, während die Augen ununterbrochen an der Beute haften; und näher und näher gelangt das Raubtier an diese. Das Opfer ahnt nichts von der ihm drohenden Gefahr; denn es erkennt in der ihm unaufhaltsam aus den Leib rückenden Schlange den furchtbaren Feind nicht, dem es wenige Augenblicke später rettungslos verfallen sein wird. Verdutzt über die ihm fremde und wahrscheinlich höchst auffallende Gestalt, bleibt es sitzen und führt höchstens einige Schritte, einige Sprünge aus, als wolle es der Schlange freie Bahn geben, beruhigt sich wieder und läßt es nicht bloß geschehen, daß der mehr und mehr in Erregung geratende Räuber unmittelbar vor ihm den Hals in Windungen legt, um die zum Vorstoße erforderliche Länge zu gewinnen, sondern bleibt gar nicht selten selbst dann noch sitzen, wenn jener so weit herangekommen ist, daß dessen Zungenspitzen seinen Leib berühren. Kaninchen beschnuppern unter solchen Umständen, wie ich wiederholt gesehen habe, auch ihrerseits neugierig die Schlange, just als wollten sie die Bezüngelung derselben erwidern. Urplötzlich schnellt der Schlangenkopf vor, gleichzeitig, nicht früher, öffnet sich der Rachen, und ehe das Opfer noch weiß, was ihm droht, ist es gepackt und zwischen ein oder zwei Ringe des Schlangenleibes gepreßt. Dies geht so blitzschnell vor sich, daß auch der Zuschauer von dem Wie kaum die rechte Vorstellung gewinnt. Die Schlange packt das Tier und rollt in demselben Augenblicke das vordere Ende ihres Leibes ein, indem sie den Kopf mit der Beute nach vorwärts wendet und mit ihm und ihr ebenso viele Kreise beschreibt, als sie Schlingen um das Beutetier legen will. Aber die Sekunde, bei deren Beginn der Vorstoß erfolgte, ist noch nicht verstrichen, wenn das gepackte Opfer bereits in der tödlichen Umstrickung sich befindet. Selten nur vernimmt man einen Aufschrei desselben, und wenn dies der Fall, wahrscheinlich nur infolge des furchtbaren Druckes, der die in den Lungen enthaltene Luft durch den Kehlkopf preßt. Wie unwiderstehlich dieser Druck ist, sieht man an dem Gesichtsausdrucke des eingeringelten Tieres. Aus den Höhlen treten diesem die Augen, schmerzvoll verzieht sich die Lippe, krampfhaft zucken die zufällig nicht mit eingeschnürten Hinterbeine. Schon nach wenigen Augenblicken aber schwindet die Besinnung, und je nach der Lebenszähigkeit des Tieres wird früher oder später der Herzschlag schwächer, bis er schließlich gänzlich endet und der Tod eintritt. Vergeblich würde es sein, die Schlange jetzt aufwickeln zu wollen. Ihre Muskelkraft spottet der Stärke mehr als eines Mannes. »Ich habe versucht«, bemerkt Hutton, »eine zwei Meter lange Riesenschlange, die ein Rebhuhn umschlungen hatte, aufzurollen, aber auch nicht einen Schatten von Erfolg erzielt, obgleich ich alle meine Kräfte anstrengte.« Die Schlange aber berechnet genau, wieviel Kraft sie anwenden muß, um eine Beute zu erwürgen, läßt diese auch niemals früher aus ihrer Umschlingung, als bis sie von dem Tode vollkommen sich überzeugt hat. Kleine Riesenschlangen umwinden auch kleine Opfer in der geschilderten Weise, große klemmen solche oft nur zwischen zwei Biegungen des Vorderleibes und erwürgen sie, indem sie sich auf dieselbe legen, also ihr eigenes Gewicht wirken lassen, wogegen sie größere Beutetiere stets umringeln. Daß sie zwischen verschiedener Beute genau unterscheiden, geht schlagend aus einer Mitteilung Huttons hervor. Dieser Forscher, mit dessen Beobachtungen die meinigen durchaus übereinstimmen, opferte einer von ihm gefangenen Tigerschlange einmal auch einen großen und starken Waran. Die Echse versuchte zu entfliehen und sprang hierbei auf den Rücken ihres Feindes. Obwohl offenbar unangenehm berührt durch die scharfen Nägel des Waran, blieb die Schlange doch ruhig liegen, heftete aber ihre Augen fest auf den Klassengenossen. Nach geraumer Zeit verließ der Waran diese, als ob er eingesehen habe, daß der Platz übel gewählt sei, und suchte an einer andern Stelle des Käfigs Zuflucht. Die Schlange löste ihre Schlingen und bereitete sich zum Vorstoße vor; der Waran reckte ihr sein Gesicht zu, so daß in Hutton schon die Hoffnung aufkeimte, ein Kampf werde entbrennen. Da aber stieß die Schlange vor und ringelte sich mit so außerordentlicher Schnelligkeit und Unwiderstehlichkeit um den Waran, daß der Hals desselben zweimal geknickt und die Schwanzwurzel gegen die Nasenspitze gedrückt wurde. Erstaunt, sie eine volle Stunde später noch zusammengerollt zu sehen, nahm unser Gewährsmann ein Stöckchen und versuchte, sie zu bewegen, die Beute fahren zu lassen, erkannte aber bald die Ursache der Untätigkeit des Raubtieres. Denn noch lebte der Waran, noch bewegte er die Füße, und so zähe erwies sich sein Leben, daß die Riesenschlange nicht vor vierthalb Stunden sich entringeln konnte. Ein Säugetier hat spätestens in zehn, in der Regel schon in fünf Minuten ausgeatmet und wird dann auch bald verzehrt: ein Waran beansprucht eine zwanzigmal längere Kraftanstrengung und ermüdet dennoch den Räuber nicht im geringsten.
Nachdem die Schlange sich von dem Tode ihres Opfers überzeugt hat, wickelt sie sich bedächtig los und prüft nun züngelnd die Beute, in der Regel ohne sie gänzlich frei zu geben. Niemals habe ich gesehen, daß sie vor dem Verschlingen mit ihr gespielt hätte, wie schon von den Alten behauptet und von neueren Schriftstellern wiederholt worden ist. Ihr Bezüngeln schien mir immer nur zu bezwecken, die rechte Stelle zum Angriffe beim Verschlingen herauszufinden. Diese Stelle ist der Kopf, weil der große Bissen, der unzerstückelt verschlungen werden muß, nur dann den geringsten Widerstand entgegensetzt, wenn die Schlange ihn zuerst in den Rachen schiebt. Nach längerem Bezüngeln faßt sie das erwürgte Tier von neuem beim Kopfe, sperrt dabei den Rachen so weit als möglich auf und beginnt nun die mühsame Arbeit des Verschlingens. Abwechselnd schiebt sie eine Kieferhälfte um die andere vor, drückt die rückwärts gekehrten Zähne jedesmal in den Bissen ein, um ihn so fest zu halten, und schiebt ihn so nach und nach weiter und weiter vorwärts. Zusehends weitet sich dabei der untere Kieferbogen zunächst hinten, sodann mehr und mehr auch vorn aus, indem die bewegenden Bänder immer weiter sich ausdehnen. Von der früheren Zierlichkeit des Kopfes bemerkt man nichts mehr; nur der obere Teil desselben behält annähernd seine Gestalt, die untere Kinnlade und die Kehlhaut erweitern sich, wie bei den Pelikanen zu einem Sacke, und gleichen zuletzt einem weiten Schlauche mit festem Ringe an seinem oberen Ende. Die Luftröhre tritt um so weiter vor, je mehr der Unterkiefer sich ausdehnt. Alle Drüsen sondern reichlich Speichel ab und nässen Haare oder Federn des Opfers, so weit dasselbe bereits in den hinteren Teil des Maules eingetreten ist. Bei größeren Tieren verursachen die Schulterblätter, bei Vögeln die Flügel noch besondere Beschwerde. Sobald aber erst sie überwunden sind, rückt der übrige Leib überraschend schnell weiter vor, bis zuletzt auch Beine und Schwanz verschwinden. Nunmehr nimmt auch der Kopf seine frühere Gestalt wieder an. Die auseinander gezerrten Gelenke fügen sich zusammen, und nachdem die Schlange einige Male gleichsam gähnend den Rachen aufgesperrt und bewegt hat, ist alles wieder in Ordnung. Mittlerweile schiebt sich der Bissen, wie man von außen deutlich sehen kann, weiter und weiter im Schlunde hinab, bis er in den Magen gelangt ist. Noch ehe er hier angekommen, kann die Schlange, falls sie einigermaßen hungrig war, ein zweites Opfer ergriffen haben, und wenn sie nach längerem Fasten über so viel Beute verfügen kann, als sie will, mag es auch wohl geschehen, daß sie sechs bis acht Tiere von Kaninchen- oder Taubengröße nacheinander verzehrt. Bindet man, wie dies in einzelnen Tiergärten und Schaubuden üblich ist, an das ihr vorgehaltene lebende Opfer noch zwei oder drei getötete gleicher Größe, so verschlingt sie die ganze Reihe in einem; reicht man ihr die lebenden Tiere nacheinander, so erwürgt und verzehrt sie eines nach dem andern. Nach jedesmaliger Bewältigung des Bissens züngelt sie behaglich und leckt sich förmlich das Maul.
Ungeachtet der außerordentlichen Schlingfähigkeit einer Riesenschlange, hat die Dehnbarkeit der Kinnladen doch ihre Grenzen. Die Schauergeschichten, die erzählt und geglaubt werden, sind unwahr: keine einzige Riesenschlange ist imstande, einen erwachsenen Menschen, ein Rind, ein Pferd, einen großen Hirsch zu verschlingen; schon das Hinabwürgen eines Tieres von der Größe eines Rehes verursacht auch den Riesen dieser Familie fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Im höchsten Grade abgeschmackt ist die Angabe, daß die Riesenschlange größere Tiere nur bewältige, indem sie warte, bis der Teil des Leibes, den sie nicht hinabwürgen kann, in Fäulnis übergegangen, ebenso die hierauf bezügliche Bemerkung, daß der Geifer der Schlange eine faulige Zersetzung des tierischen Leibes rasch herbeiführe. Bei Gefangenen, die man nach und nach daran gewöhnt hat, auch tote Tiere zu fressen, kann es allerdings vorkommen, daß dieselben, wenn sie nicht hungrig sind, ihre Beute längere Zeit liegen lassen und dann erst verschlingen, wenn die Verwesung derselben bereits begonnen hat. Derartige Beobachtungen können jedoch unmöglich als für das Freileben des Tieres maßgebend erachtet werden. Dagegen ist es vollständig begründet, daß die Riesenschlangen, sowie alle übrigen Ordnungsverwandten, nach einer reichlichen Mahlzeit in einen Zustand bemerkenswerter Trägheit versinken, der so lange anhält, bis die Verdauung größtenteils beendet ist. In älteren Reisebeschreibungen wird gefabelt, daß freilebende Riesenschlangen während ihrer Verdauung auch dann noch ruhig aus einer und derselben Stelle verbleiben, wenn Menschen in ihre Nähe kommen, ja sogar gestatten, daß letztere, die sie für einen umgefallenen Baumstamm halten, sich auf sie setzen und sich erst dann langsam fortbewegen. Derartige Erzählungen widerlegen sich selbst, und es ist mir unbegreiflich, daß man ihnen Glauben schenken konnte. Eine Riesenschlange mag so viel gefressen haben, als sie wolle, so träge wird sie nie, daß sie sich die Annäherung eines Menschen ruhig gefallen ließe, ohne wenigstens einen Versuch zur Abwehr oder Flucht zu machen. Auf sie treten mag man können, auf sie sich niederlassen kann man gewiß nicht. Wie außerordentlich kräftig die Verdauung wirkt, kann man an Gefangenen beobachten. Spätestens nach vier Tagen ist das größte Säugetier, das man zu verfüttern pflegt, bis auf einige Reste der Haare, die mit dem Kote ausgeschieden werden, vollkommen zersetzt, und von diesem Augenblicke an bekundet die Schlange wieder Freßlust. Doch schadet es ihr nichts, wenn sie wochen- und selbst monatelang hungern muß.
Über die Paarung freilebender Riesenschlangen sind, soviel mir bekannt, noch keine eingehenden Beobachtungen gewonnen worden. Hinsichtlich der Fortpflanzung weiß man, daß die einen zu den lebendig gebärenden Kriechtieren gehören, die anderen Eier legen, aus denen nach geraumer Zeit die Jungen schlüpfen, und zwar unter reger, bei keinem anderen Kriechtiere sonst beobachteter Beteiligung der Mutter. An Gefangenen hat man wiederholt erfahren, daß die Mutter die von ihr gelegten Eier mit ihrem Leibe bedeckte und gewissermaßen ausbrütete. Ob sich die Fürsorge der Mutter auch nach dem Ausschlüpfen solcherart bebrüteten Jungen betätigt, oder ob sie dieselben dann ihrem Schicksale überlassen, vermag ich nicht zu sagen. Diejenigen Arten, die lebendig gebären, scheinen sich ebensowenig als andere Kriechtiere um ihre Sprossen zu kümmern, sobald sie glücklich in die Welt gesetzt worden sind. Die fast meterlangen und daumendicken Jungen beginnen nach dem Ausschlüpfen die Lebensweise ihrer Eltern, verbleiben aber anfänglich noch in einem gewissen Verbande, d. h. halten sich in kleinen Trupps noch längere Zeit an einer und derselben Stelle zusammen, diese auf dem Boden, jene im Gezweige der Bäume Herberge nehmend. Ihr Wachstum schreitet anfänglich sehr rasch vor, verlangsamt sich jedoch später immer mehr und scheint zuletzt nicht mehr merklich zuzunehmen.
Vor dem Menschen flüchten auch die Riesenschlangen in der Regel, jedoch nicht ausnahmslos. In Brasilien ist fast jedermann überzeugt, daß sie dem Herrn der Erde die schuldige Hochachtung regelmäßig betätigen, das heißt bei seinem Erscheinen eilfertig sich zurückziehen; unter Umständen kommt jedoch auch das Gegenteil vor. Denn sie sind sich ihrer Stärke wohl bewußt und reizbarer als viele andere Schlangen. Wenn eine Riesenschlange wirklich einen Menschen umschlingen sollte, in der Absicht, ihn zu fressen, würde derselbe, wie schon Hutton richtig hervorhebt, wohl in allen Fällen verloren sein. Denn die Kraft des sich zusammenringelnden Tieres ist so groß, daß sie Abwehr kaum ermöglicht. Was aber das Verschlingen anlangt, so erscheint mir dasselbe noch viel unwahrscheinlicher als ein Angriff in so ernstlicher Absicht. Denn die Ausdehnungsfähigkeit der Kiefer hat, wie ich schon oben bemerkte, ihre Grenzen, und keine einzige Erzählung von den vielen, die berichten, daß die Riesenschlangen auch den Menschen als Jagdwild ansehen, ist so verbürgt, daß sie glaubhaft erscheinen könnte. Jedenfalls ist soviel gewiß, daß kein südamerikanischer Jäger sie fürchtet. Man stellt ihnen eifrig nach, weil man Fleisch, Fett und Fell aus mancherlei Weise benutzt. Ersteres wird allerdings nur von den Indianern gegessen; dem Fette aber schreibt man ziemlich allgemein heilkräftige Wirkungen zu, und die Haut bereitet man zu allerlei Zierat. Die Jagd selbst geschieht gegenwärtig fast nur mit dem Feuergewehre. Ein nach dem Kopfe gerichteter Schrotschuß genügt vollkommen, um eine Riesenschlange zu töten; denn im Verhältnisse zu ihrer Größe und Stärke besitzt sie eine ungleich geringere Lebenszähigkeit als andere Arten ihrer Ordnung.
Fast ebensooft, als man Riesenschlangen erlegt, bemächtigt man sich ihrer lebendig, und zwar ohne besondere Mühe, indem man sie entweder verfolgt und laufend einholt, oder indem man Schlingen vor ihre Schlupfwinkel legt, die so eingerichtet sind, daß sie wohl den schlanken Kopf, nicht aber den Leib durchlassen und um so fester sich zusammenschnüren, je heftiger die Anstrengungen des nach Befreiung strebenden Tieres werden. Daß letzteres sich erwürgen könnte, braucht man nicht zu befürchten, da, wie oben bemerkt wurde, alle Schlangen außerordentlich lange Zeit aushalten können, ohne zu atmen. Von großartigen Veranstaltungen zum Fange, wie die Alten uns erzählen, weiß man heutigen Tages nichts.
In Südasien wie in Amerika hält man Riesenschlangen sehr häufig in Gefangenschaft und gewährt ihnen mehr oder weniger Freiheit im Hause und Gehöfte, weil man sie als geschickte Rattenfänger benutzt. Lenz erfuhr von einigen seiner Schüler, deren Väter als Kaufleute in Brasilien wohnten, hierüber das Folgende: »Beim Kautschuksammeln fangen die Neger gelegentlich auch eine Boa und bringen dieselbe dann mit nach Hause. Hier steckt man sie in eine Kiste, die tagsüber verschlossen wird, und gewährt ihr des Nachts die erforderliche Freiheit, die sie zu ihrer Jagd auf Ratten und Mäuse nötig hat. Sobald der Speicher geschlossen wird, begibt sich ein Neger in denselben, öffnet den Kasten der Schlange, holt diese heraus und läßt sie, nachdem er oft erst längere Zeit mit ihr gespielt, in dem Raume frei, reinigt sodann die Kiste, füllt das in ihr befindliche Wassergefäß von neuem, geht weg und schließt die Tür des Speichers hinter sich zu. Hat eine Schlange den letzteren gereinigt, so schaffen die Neger, die mit besonderer Vorliebe diese Kriechtiere pflegen, tote Mäuse und Ratten herbei, und wenn auch diese fehlen, reicht man der Schlange geschnittenes rohes Fleisch, nachdem man sie an solche Kost gewöhnt hat. Morgens, vor der Öffnung des Speichers, begibt sich der Neger zuerst in das Innere, fängt die Schlange wieder ein und bringt sie von neuem in der Kiste unter.« Solche bereits an die Gefangenschaft gewöhnte Riesenschlangen eignen sich weit besser als frischgefangene zur Versendung nach Europa, und sie sind es auch, die bei einigermaßen genügender Pflege viele Jahre lang in Käfigen ausdauern. In Europa wie in Nordamerika finden sie in den Tierführern jederzeit willige Abnehmer, weil eine Tierbude ohne Riesenschlange ihr hauptsächlichstes Zugmittel entbehrt. Grauenerfüllt sieht der biedere Landmann, angstvoll die wißbegierige Städterin, wie der Wärter, nachdem er einen seiner unübertrefflichen Vorträge über die gesamte Tierwelt gehalten und das unvermeidliche Trinkgeld glücklich eingeheimst, einer langen Kiste zugeht und aus derselben die in wollene Decken gehüllte Boa hervorholt, sie sich über die Achsel legt, um den Hals schlingt, überhaupt in einer Weise mit dem Scheusale umgeht, daß einzelnen Beschauern die Haare zu Berge steigen. Zum Glück für die Wärter einer Tierschaubude, die ohne Riesenschlange auf den besten Teil ihrer Einnahme verzichten müßten, ist der Umgang mit dem »Drachen« nicht so gefährlich, als die Menge wähnt. Die Anstalten zur Unterbringung der Schlangen sind in allen Tierbuden trotz der ihnen niemals fehlenden Wärmflaschen so ungenügend, und die Behandlung läßt außerdem so viel zu wünschen übrig, daß die Riesenschlangen binnen kurzer Zeit geschwächt werden und sich zuletzt in einem Zustande beständiger Abmattung befinden, daher auch alles über sich ergehen und sich, ohne Widerstand zu leisten, förmlich mißhandeln lassen. Nicht so verhält es sich, wenn man eine Riesenschlange, wie es in wohleingerichteten Tiergärten geschieht, durch sorgfältige Pflege und Abwartung bei Kräften erhält. Hier laufen die Wärter zuweilen wirklich Gefahr, weil gerade sie von den starken Tieren gehaßt und dann und wann nicht allein bedroht, sondern förmlich angegriffen werden. Dies beobachtet man gelegentlich in allen Tiergärten, und dasselbe habe auch ich von den unter meiner Obhut gepflegten Riesenschlangen erfahren müssen. Dem geübten Wärter wird solcher Angriff übrigens nie gefährlich. Er versieht sich, wenn er den Käfig einer bissigen Riesenschlange betreten muß, einfach mit einer großen, dicken Decke und hält diese der Schlange vor, wenn sie sich anschickt, nach ihm zu beißen, oder fängt sie in einen weitmündigen Kescher ein und läßt sie in dem Sacke toben, bis er seine Sache verrichtet hat. Eine meiner Riesenschlangen legte ihrem Wärter sogar einmal zwei Schlingen um die Beine und schnürte diese so fest zusammen, daß der Mann sich nicht zu regen vermochte und nur durch Hilfe seiner Kameraden aus der immerhin unbehaglichen Lage befreit werden konnte. Nach diesen Erfahrungen scheint es mir glaublich, daß ein von Lenz mitgeteilter Unglücksfall sich wirklich zugetragen hat, nämlich, daß ein junges Mädchen, das als indische Göttin mit einer um den Leib geringelten Riesenschlange vor den Zuschauern zu erscheinen hatte, von der Boa erdrückt und erwürgt wurde, weil deren Raublust durch einen freigekommenen Affen rege geworden war.
So unbehaglich die Gefangenschaft einer Riesenschlange werden kann, so gedeihlich erweist sich an ihr volle Freiheit selbst in unserm kalten Klima. Hierüber danken wir Lenz eine in hohem Grade bemerkenswerte Mitteilung. In den ersten Jahren unsres Jahrhunderts kam eine wandernde Tierbude in die hessische Stadt Schlitz. Eine in ihr befindliche mittelgroße Riesenschlange war krank, der Besitzer der Tierbude aber gerade abwesend, als der Wärter eines Abends die Schlange seiner Meinung nach tot vorfand und aus Furcht, daß ihm das Unheil zur Last gelegt werden würde, sie, nachdem er einige Stäbe des Käfigs auseinander gedrängt hatte, heimlich in das Flüßchen Schlitz warf, vorgebend, daß sie weggelaufen sei. Der Tierbesitzer ließ am nächsten Morgen die ganze Umgegend nach der vermißten Schlange durchsuchen, fand aber keine Spur mehr von ihr und zog endlich, nachdem er noch längere Zeit in dem Städtchen verweilt und seine Nachspürungen fortgesetzt hatte, seines Weges weiter. Die Schlange war jedoch nicht verschwunden, sondern hatte sich inzwischen behaglich eingerichtet. Wahrscheinlich war es eine der wasserliebenden Arten gewesen; denn sie hatte sich im Flusse selbst eingenistet, zeigte sich in warmen Nächten zuweilen in ihm schwimmend und hinterließ Spuren von nächtlichen Spaziergängen. Alle Versuche, die Ausländerin wieder zu fangen, waren vergeblich, und so trat endlich die kalte Jahreszeit ein. Der Flüchtling war wiederum verschwunden und galt nochmals für tot. Im nächsten Frühjahre aber erschien er, sobald das Wetter recht warm geworden war, bei Fulda im Flusse, zeigte sich hier namentlich öfters bei den Badeplätzen der Soldaten. Alle Nachstellungen fruchteten auch dort nicht. Mit dem nächsten Winter verlor sich jede Spur. Die merkwürdige Tatsache, die Lenz durch den gräflichen Hofgärtner Wimmer in Schlitz mitgeteilt und durch andere Leute seines Alters bestätigt wurde, läßt keinen Zweifel zu.
*
Man pflegt die Gruppe der Stummelfüßler in drei Unterfamilien einzuteilen, die von einzelnen Forschern auch wohl zu selbständigen Familien erhoben worden sind. Weil auch in Europa vertreten, wollen wir die Sandschlangen ( Erycinae) als die erste Unterfamilie der Gesamtheit hinstellen. Sie unterscheiden sich von den übrigen Stummelfüßlern hauptsächlich durch ihren sehr kurzen, nicht einrollbaren, überhaupt viel weniger beweglichen Schwanz, ihre Färbung und ihre Lebensweise. Ihr Leib ist mäßig lang und rund, der Kopf etwas verlängert, an der Schnauze breit gerundet, das Auge klein, der Stern senkrecht gestellt, die Mundspalte weit. Die Bekleidung besteht aus kleinen, kurzen Schuppen; die unteren Schwanzplatten bilden nur eine einzige Reihe. Zähne finden sich in beiden Kiefern und am Gaumen, aber nicht im Zwischenkiefer. Als bezeichnend für die Gruppe mag ferner gelten, daß keines der Lippenschilder grubig vertieft ist.
Während die übrigen Stummelfüßler, also die eigentlichen Riesenschlangen, wasserreiche, mit einer üppigen Pflanzenwelt bedeckte Gegenden allen übrigen vorziehen und auf trockenen Örtlichkeilen gewissermaßen nur ausnahmsweise vorkommen, leben die Sandschlangen, ihrem Namen entsprechend, gerade auf dem dürrsten und womöglich sandigen Boden, in Steppen und Wüsten, und betreiben hier ihre Jagd mehr unter als über der Oberfläche der Erde.
Die Sandschlange ( Eryx jaculus) vertritt die gleichnamige artenreichste Sippe (Eryx) und lehrt uns die Lebensweise der gesamten Gruppe vollständig kennen. Sie erreicht eine Gesamtlänge von siebzig, höchstens achtzig Zentimeter und läßt sich an dem kurzen, stumpf zugerundeten Schwanze, dem kleinen, vom Rumpfe nicht abgesetzten, auf der Oberseite mit kleinen unregelmäßigen, hinterwärts sogar schuppenförmigen Schildern bekleideten Kopfe und den beiden sporenartigen Anhängseln an jeder Seite der Afterspalte, eben den Stummeln der Füße, leicht erkennen und von anderen Schlangen unterscheiden. Die seitlich gelegenen Nasenlöcher sind sehr eng, die Augen klein, die Schuppen leicht gekielt, die, die das Kinn bekleiden, durch eine in der Mitte liegende Falte getrennt. Die Grundfärbung der Oberseite ist ein mehr oder minder lebhaftes Gelblichgrau, das bei einzelnen Stücken ins Rost-, bei anderen ins Strohfarbene spielen kann. Der Kopf, mit Ausnahme einer jederseits schräg vom Hinterrande des Auges zum Mundwinkel sich ziehenden schwärzlichen Binde, einfarbig, höchstens auf dem Hinterhaupte durch zwei breite, in der Mitte zusammenstoßende schwärzliche oder dunkelbraune Bänder gezeichnet, die Oberseite des Rumpfes und Schwanzes mit ebenso gefärbten, in vier Längsreihen angeordneten, mehr oder weniger viereckigen Flecken geziert, die in der verschiedensten Weise miteinander verschmelzen und mannigfache Zeichnungen darstellen. Die Unterseite ist stets bedeutend heller und entweder einfarbig oder schwärzlich gefleckt. Mancherlei Spielarten sind bei dieser Schlange beobachtet worden.
Das Verbreitungsgebiet der Sandschlange, des einzigen Vertreters der Stummelfüßler in Europa, beschränkt sich hier auf die griechische Halbinsel, dehnt sich dagegen nach Osten hin bis zum Altaigebirge und nach Süden über einen beträchtlichen Teil Nordafrikas aus. In Rußland findet sie sich in den kaspischen Steppen, in besonderer Häufigkeit am Aralsee. Nach meinen und anderer Beobachtungen findet man sie stets auf Stellen, die mit weichem Rollsande bedeckt sind; denn nicht auf der Oberfläche, sondern unter derselben betreibt sie ihre Jagd, die wahrscheinlich hauptsächlich den gleich ihr lebenden Echsen gelten mag. Gefangene, die ich zuweilen in größerer Anzahl erhielt, kommen tagsüber nur dann einmal zum Vorscheine, wenn sie lange gehungert haben und vielleicht an den Bewegungen über ihnen Beute wahrnehmen oder vermuten. Solche überfallen sie dann und würgen sie nach Art ihrer größeren Verwandten, bis das Leben entflohen, worauf sie in üblicher Weise zum Verschlingen übergehen. Von den Arabern wird gerade diese Schlange und eine ihrer nächsten Verwandten sehr häufig gefangen, aber meist durch Abschneiden der Zunge verstümmelt. Solche Gefangenen leben zwar noch geraume Zeit, gehen aber nie ans Fressen und infolgedessen früher oder später mit Sicherheit ein, wogegen die unbeschädigten jahrelang in Käfigen ausdauern. Besonderes Vergnügen bereiten sie freilich auch dem eifrigsten Beobachter nicht, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht zum Vorschein kommen, und, aus dem Sande herausgeholt, sofort wiederum unter denselben sich einwühlen. Läßt man sie ungestört, so bekommt man sie zuweilen monatelang nicht zu Gesicht und wundert sich, wenn der Käfig wiederum mit frischem Sand versehen wird, förmlich darüber, daß sie noch vorhanden sind. Dagegen pflegen freilich alle gleich ihnen den Sand bewohnenden Echsenarten verschwunden zu sein.
*
n der zweiten Unterfamilie vereinigt man die Boaschlangen ( Boaeinae), zu denen ein großer Teil der eigentlichen Riesenschlangen zählt. Ihre Gestalt ist sehr gestreckt, der wohlgestaltete Kopf seitlich deutlich vom Leibe abgesetzt, der Hals verhältnismäßig dünn, der Leib seitlich zusammengedrückt und in der Mitte etwas vertieft, der Schwanz in verschiedenem Grade einrollbar, der Kopf häufig mit Schuppen, anstatt der Schilder, die Unterseite des Schwanzes mit breiten, in einer Reihe angeordneten Schildern bekleidet. Zähne finden sich im Ober- und Unterkiefer, auf dem Gaumen und Flügelbeinen, nicht aber im Zwischenkiefer.
Das wenigstens dem Namen nach bekannteste Mitglied der Familie ist die Abgott- oder Königsschlange ( Boa constrictor), Vertreter der Sippe der Schlinger ( Boa). Ihr deutlich vom Halse abgesetzter, Platter, vorn abgestumpfter Kopf, der nur am Mundrande mit gleichmäßig angeordneten Schildern bedeckt ist, und die seitlich zwischen zwei Schildern gelegenen Nasenlöcher gelten als die Merkmale der Sippe.
Die Abgottschlange gehört zu den schönsten aller Schlangen überhaupt. Ihre Zeichnung ist sehr hübsch und ansprechend, obgleich nur wenige und einfache Farben miteinander abwechseln. Ein angenehmes Rötlichgrau ist die Grundfärbung: über den Rücken verläuft ein breiter, zackiger Längsstreifen, in dem eigestaltige, an beiden Seiten ausgerandete, graugelbliche Flecke stehen; den Kopf zeichnen drei dunkle Längsstreifen. Bei jungen Abgottschlangen sind die Farben lebhafter, und die eiförmigen Flecke werden durch hellere Linien verbunden. Die Länge ausgewachsener Tiere soll sechs Meter erreichen, ja sogar noch übersteigen.
Im Lichte unserer heutigen Kenntnis erscheinen uns die Erzählungen früherer Reisenden über die Abgottschlange höchst ergötzlich. Gerade ihr dichtete man die verschiedensten Ungeheuerlichkeiten an. Noch zu Zeiten Lacépèdes glaubte man an alle Übertreibungen und Windbeuteleien, die unkundige Reisende, namentlich Missionäre, aufgetischt hatten. »Wenn man auch von den Erzählungen über die Abgottschlange, insbesondere ihrer Gefühllosigkeit und Erstarrung, manches abrechnet, so scheint doch ausgemacht zu sein, daß in verschiedenen Gegenden, namentlich auf der Landenge von Panama, Reisende in den dichten Kräutern der Wälder halb versteckte Abgottschlangen antrafen, über die sie zur Zeit ihrer Verdauung hingingen, oder auf die sie sich, wenn man den Erzählungen glauben darf, sogar niedersetzten, weil sie die Tiere für einen umgefallenen, mit Kräutern bedeckten Baumstamm hielten und dies, ohne daß die Schlange sich rührte. Nur wenn sie nahe neben ihr Feuer anzündeten, gab die Wärme ihr so viel Leben wieder, daß sie anfing, sich zu bewegen, und die Reisenden mit Schrecken ihre Gegenwart bemerkten und davonflohen.« Lacépède begründet diesen Satz auf eine Erzählung des Paters Simon. Zur Entschuldigung des genannten Paters muß gesagt werden, daß ähnliche Erzählungen noch in neueren Werken Aufnahme finden konnten.
Lacépède meint, daß der Name der Abgottschlange unserem Königsschlinger aus dem Grunde zukomme, weil die alten Mexikaner sie verehrt hätten. Ich lasse natürlich dahingestellt sein, ob es wirklich die Abgottschlange, oder eine ihr nahe verwandte, in Mexiko vorkommende Art der Familie war, die die Mexikaner verehrten, wage ebenso nicht zu entscheiden, ob diese Verehrung tatsächlich stattfand oder nicht, halte jedoch auch die Annahme für berechtigt, daß der Name Abgottschlange infolge der götzendienerischen Gebräuche entstand, die die Neger in Süd- und Mittelamerika den Schlangen erweisen sollen. Unter den jetzt lebenden Indianern haben, meines Wissens, alle Schlangen eine ähnliche Bedeutung verloren, falls überhaupt jemals gehabt; unter den Negern dagegen spielen sie, wie bereits bemerkt wurde und noch ausführlicher berichtet werden wird, eine bedeutende Rolle.
Der Verbreitungskreis der Königsschlange scheint minder ausgedehnt zu sein, als man gewöhnlich angenommen hat, da man häufig verschiedenartige Riesenschlangen miteinander verwechselte. Dumeril und Bibron glauben, daß sich das Vaterland auf die nördlichen und östlichen Länder Südamerikas, also auf Guayana, Brasilien und Argentinien beschränkt. Nach Prinz von Wied ist sie an der Ostküste Brasiliens nirgends selten und wird südlich bis Rio de Janeiro und Cabo Frio gefunden; nach Schomburgk verbreitet sie sich über ganz Britisch-Guayana. Beide Forscher stimmen darin überein, daß sie sich nur in trockenen, erhitzten Gegenden, Wäldern und Gebüschen aufhält. Sie bewohnt Erdhöhlen und Klüfte der Felsen, Gewurzel und andere Schlupfwinkel, nicht selten in kleinen Gesellschaften von vier, fünf und mehr Stücken, besteigt auch zuweilen die Bäume, um von dort aus auf Raub zu lauern. In das Wasser geht sie nie, während verwandte Arten gerade hier ihren Aufenthalt nehmen.

Abgottschlange ( Boa constrictor)
Könnte man das nächtliche Treiben der Abgottschlange belauschen, so würde man unzweifelhaft ein ganz anderes Bild von ihrem Sein und Wesen gewinnen, als wir gewonnen zu haben meinen. Allerdings läßt sie auch bei Tage eine ihr sich bietende Beute nicht vorübergehen; ihre eigentliche Raubzeit aber beginnt gewiß erst mit Einbruch der Dämmerung. Dies beweist ihr Gebaren im Freien und in der Gefangenschaft deutlich genug. Alle Reisenden, die die Waldungen Südamerikas durchstreiften und mit Abgottschlangen zusammenkamen, stimmen darin überein, daß diese unbeweglich oder doch träge auf einer und derselben Stelle verharrten und erst dann die Flucht ergriffen, wenn sich ihr Gegner bis auf wenige Schritte ihnen genaht hatte, daß sie sogar mit einem Knüppel sich erschlagen ließen. Schomburgk traf bei einem seiner Ausflüge mit einer großen Abgottschlange zusammen, die ihn und seinen indianischen Begleiter gewiß schon seit einiger Zeit gesehen hatte, aber doch nicht entflohen war, sondern unbeweglich in einer und derselben Stellung verharrte. »Wäre mir«, sagt der Reisende, »der Gegenstand früher in die Augen gefallen, ich würde ihn für das Ende eines emporragenden Astes gehalten haben. Ungeachtet der Vorstellungen und Furcht meines Begleiters sowie des Widerwillens unseres Hundes, war mein Entschluß schnell gefaßt, wenigstens den Versuch zu machen, das Tier zu töten. Ein tüchtiger Prügel als Angriffswaffe war bald gefunden. Noch steckte die Schlange den Kopf unbeweglich über das Gehege empor: vorsichtig näherte ich mich demselben, um mit meiner Waffe ihn erreichen und einen betäubenden Hieb ausführen zu können; in dem Augenblick aber, wo ich dies tun wollte, war das Tier unter der grünen Decke verschwunden, und die eigentümlich raschen Bewegungen der Farnwedel zeigten mir, daß es die Flucht ergriff. Das dichte Gehege verwehrte mir den Eintritt, die Bewegung verriet mir aber die Richtung, die die fliehende Schlange nahm. Sie näherte sich bald wieder dem Saume, dem ich daher entlang eilte, um in gleicher Linie zu bleiben. Plötzlich hörte die windende Bewegung der Farnkräuter auf, und der Kopf durchbrach das grüne Laubdach, wahrscheinlich um sich nach dem Verfolger umzusehen. Ein glücklicher Schlag traf den Kopf so heftig, daß sie betäubt zurücksank; ehe aber die Lebensgeister zurückkehrten, waren dem kräftigen Hiebe noch mehrere andere gefolgt. Wie ein Raubvogel auf die Taube schoß ich jetzt auf meine Beute zu, kniete auf sie nieder und drückte ihr, mit beiden Händen den Hals umfassend, den Schlund zu. Als der Indianer die eigentliche Gefahr vorüber sah, eilte er auf meinen Ruf herbei, löste mir einen der Hosenträger ab, machte eine Schlinge, legte ihr dieselbe oberhalb meiner Hand um den Hals und zog sie so fest als möglich zu. Das dichte Gehege hinderte das kräftige Tier in seinen krampfhaften Windungen und machte es uns daher leichter, seiner Herr zu werden.«
Der Prinz von Wied sagt, daß man in Brasilien die Abgottschlange gewöhnlich mit einem Prügel totschlägt oder mit der Flinte erlegt, da sie ein Schrotschuß sogleich zu Boden streckt. Gute und wahrhafte Jäger in Brasilien lachen, wenn man sie fragt, ob diese Schlange auch dem Menschen gefährlich sei; denn nur der rohe Haufe des Volkes erzählt abenteuerliche Geschichten von diesen Tieren, die jedoch von allen Kennern und gründlichen Beobachtern stets widerlegt werden.
Die Nahrung besteht in kleinen Säugetieren und Vögeln verschiedener Art, namentlich in Agutis, Pakkas, Ratten, Mäusen und vielleicht auch in andern Kriechtieren oder Lurchen, beispielsweise in kleineren Schlangen und Fröschen. Daß die Abgottschlange auch Eier nicht verschont, beweisen die Gefangenen, die nach solchen begierig zu sein scheinen. Alte Stücke sollen sich an Tiere bis zur Größe eines Hundes oder Rehes wagen. Ein brasilianischer Jäger erzählte dem Prinzen, daß er einst im Walde seinen Hund schreien gehört, und als er hinzugekommen sei, denselben von einer großen Abgottschlange im Schenkel gebissen, umschlungen und schon dergestalt gedrückt gefunden, daß derselbe aus dem Halse geblutet habe. Der Hund war durch einen Schuß schnell befreit, konnte sich aber erst nach langer Zeit wieder erholen. Geschichten, wie sie Gardner mitteilt, daß amerikanische Riesenschlangen Pferde oder Menschen verschlingen sollen, gehören in den Bereich der Fabel. Freilebende Schlangen fressen zweifelsohne nur selbsterlegte Beute, nicht aber Aas; die Gefangenen hingegen können nach und nach dahin gebracht werden, auch solches zu verzehren.
Über die Fortpflanzung freilebender Abgottschlangen kenne ich keinen eingehenden Bericht. An Gefangenen hat man beobachtet, daß sie lebendig gebärend sind. Prinz Waldemar von Preußen erlegte eine als Abgottschlange angesehene trächtige Boa, deren zwölf Eier soweit ausgetragen waren, daß die Jungen bereits eine Länge von dreißig bis fünfzig Zentimeter erlangt hatten, und Westerman hatte die Freude, gefangene Königsschlinger mit Erfolg zur Fortpflanzung schreiten zu sehen: die in Rede stehende Schlange brachte mehrere lebende Junge und gleichzeitig mehrere Eier zur Welt.
In Südostamerika werden die getöteten Boaschlangen verschiedentlich benutzt. Das Fleisch soll von den Negern gegessen werden; im Fett sieht man ein bewährtes Heilmittel gegen verschiedene Krankheiten; die Haut pflegt man zu gerben, um Stiefel, Satteldecken und dergleichen daraus zu bereiten; auch winden sie sich die Neger als Schutzmittel gegen mancherlei Krankheiten um den Unterleib.
Die nach Europa kommenden lebenden Abgottschlangen werden gewöhnlich in Schlingen gefangen, die man vor dem Schlupfwinkel aufstellt. An der Glätte des Eingangs, wo der dicke, schwere Körper stets seine Spuren hinterläßt, erkennt man, ob ein Erdloch bewohnt ist oder nicht, und bringt alsdann vor dem Eingang dieses Loches die Schlingen an. Das gefangene Tier soll sich gewaltig anstrengen und winden, wird sich aber wohl nur selten erwürgen, da es wohl leicht an Verwundungen zugrunde geht, gegen Druck und Stoß aber ziemlich unempfindlich zu sein scheint. Jene Abgottschlange, die Schomburgk erlegt hatte, wurde von ihm, seinen über die Zählebigkeit der Schlangen früher gemachten Erfahrungen gemäß, vorsichtig geschnürt und an den Pfosten der Hütte befestigt, und der Erfolg lehrte, daß jene Vorsicht vollständig gerechtfertigt war. »Ein helles, unmäßiges Gelächter und ein lautes, sonderbares Zischen«, erzählt unser Forscher, »weckte mich am Morgen aus dem Schlafe. Eilend sprang ich aus der Hängematte und trat vor die Tür. Die Schlange hatte sich wirklich wieder erholt und strebte nun, unter fürchterlicher Kraftanstrengung, sich von ihrer Fessel zu befreien. Ein Kreis von Indianern, die ihren Zorn und ihre Wut durch Necken betätigten, hatte sich um sie versammelt. Mit geöffnetem Rachen stieß sie ihre unheimlichen, dem Zischen der Gänse ähnlichen Töne aus, wobei die Augen sich vor Wut aus ihren Höhlungen zu drängen schienen. Die Zunge war in ununterbrochener Bewegung. Trat man ihr während des Zischens näher, so drang einem ein bisamartiger Geruch entgegen. Um ihrer Anstrengung so schnell wie möglich ein Ende zu machen, schoß ich sie durch den Kopf.«
Als Mäuse- und Rattenfängerin leistet, wie wir gesehen haben, die Abgottschlange in den Speichern der brasilianischen Kaufleute und Pflanzer gute Dienste, wird daher auch fast als Haustier angesehen und unter Umständen mit so großem Vertrauen beehrt, daß man selbst nachts einen und denselben Raum mit ihr teilt. Ihre Genügsamkeit oder ihre Fähigkeit, ohne Schaden monatelang fasten zu können, erhöht ihren Wert noch besonders, erleichtert auch ihre Versendung. Diese geschieht in höchst einfacher Weise. Die Schlange wird in eine große Kiste gepackt, letztere vernagelt, mit einigen Luftlöchern versehen, und jene nun ihrem Schicksal überlassen. Infolge dieser schnöden Behandlung und des wahrscheinlich sich regenden Hungers kommt sie gewöhnlich ziemlich unwirsch am Orte ihrer Bestimmung an, zeigt sich bissig und angriffslustig und trotzt auch wohl geraume Zeit, bevor sie sich zum Fressen entschließt; die Bosheit mindert sich aber bald, und wenn sie erst frißt und sich ein wenig an ihren Pfleger gewöhnt hat, läßt sie sich leicht behandeln. Zu ihrem Wohlbefinden sind ein geräumiger, warmer Käfig mit Stämmen und Ästen zum Klettern und ein in den Boden eingefügter größerer Wassernapf zum Baden unerläßliche Bedingung. Die in den Tierschaubuden gebräuchlichen Kisten entsprechen den Anforderungen des Tieres also in keiner Weise, und die wollenen Decken, in die man es wickelt, weil man glaubt, es dadurch zu erwärmen, haben eher ihr Bedenkliches, als daß sie Nutzen brächten. Mehr als einmal nämlich hat man beobachtet, daß gefangene Riesenschlangen, möglicherweise vom Hunger getrieben, ihr Deckbett verschlangen. Eine Abgottschlange, die in Berlin gehalten wurde, behielt die hinabgewürgte Wolldecke fünf Wochen und einen Tag im Magen, trank währenddessen sehr viel und gab Beweise des Unwohlseins zu erkennen, bis sie endlich nachts zwischen elf und zwölf Uhr die Wollmasse auszuspeien begann, und mit Hilfe des Wärters auch des unverdaulichen Bissens glücklich sich entledigte. Ähnliches ist fast gleichzeitig im Londoner Tiergarten und später im Pflanzengarten zu Paris geschehen. Die Decke, die die hier lebende, über drei Meter lange Abgottschlange hinabwürgte, war zwei Meter lang und einen Meter sechzig Zentimeter breit und blieb vom zweiundzwanzigsten August bis zum zwanzigsten September im Magen liegen. Endlich öffnete die Schlange den Rachen und trieb ein Ende der Decke hervor; der Wärter faßte dieses Ende, ohne zu ziehen; die Boaschlange wickelte den Schwanz um einen in ihrem Käfig befindlichen Baum und zog sich selbst zurück, so daß die ganze Decke unversehrt wieder hervorkam; doch hatte dieselbe die Form einer fast zwei Meter langen Walze, die an ihrer dicksten Stelle zwölf Zentimeter breit war. Die Schlange blieb nach dem Ereignis zehn Tage matt, befand sich aber später wieder ganz wohl.
*
Dieselben Länder, die die Heimat der Abgottschlange sind, beherbergen die berühmte Anakonda, ein durch die Lebensweise von der Verwandten sehr verschiedenes Mitglied der Familie, das die Sippe der Masse Wasserschlinger ( Eunectes) vertritt. Sie unterscheidet sich von der Königsschlange und ihren Verwandten durch die zwischen drei Schildern senkrecht gestellten, verschließbaren Nasenlöcher und die Bekleidung des Kopfes, die aus unregelmäßigen Schildern besteht. Die Anakonda ( Eunectes murinus) hat, nach der Angabe des Prinzen von Wied, der sie ausführlich beschreibt, eine sehr beständige und bezeichnende Färbung. Die oberen Teile sind dunkel olivenschwarz, die Kopfseiten olivengrau, die unteren Kieferränder mehr gelblich; vom Auge, dessen Regenbogenhaut dunkel und unscheinbar ist, verläuft nach dem Hinterkopf ein breiter, schmutzig gelbroter, oben dunkelschwarz eingefaßter Streifen und unter diesem, ebenfalls vom Auge über den Mundwinkel schief hinab und dann wieder etwas aufwärts, ein schwarzbrauner, der lebhaft gegen den vorigen absticht; die unteren Teile des Tieres bis zur halben Seitenhöhe sind auf blaßgelbem Grund mit schwärzlichen Flecken bestreut, die an einigen Stellen zwei unterbrochene Längslinien bilden; zur Seite dieser Flecken stehen ringförmige, schwarze, innen gelbe Augenflecke in zwei Reihen, und vom Kopf bis zum Ende des Schwanzes verlaufen auf der Oberseite zwei Reihen von runden oder rundlichen, zum Teil gepaarten, zum Teil wechselständigen, schwarzbraunen Flecken, die auf dem Halse und über dem After regelmäßig neben-, übrigens aber dicht aneinander stehen, sich auch wohl vereinigen.
Unter den Riesenschlangen der Neuen Welt ist die Anakonda die riesigste. Auch die glaubwürdigen Reisenden sprechen von Stücken, deren Länge gegen zehn Meter betragen soll, wobei jedoch wohl zu bemerken, daß sie selbst nur solche von fünf bis sieben Meter Länge erlegten. Eine Schlange dieser Art, die Bates untersuchte, war über sechs Meier lang und hatte in der Leibesmitte einen Umfang von sechzig Zentimeter. Schomburgk erzählt, daß er mehrere von fünf Meter Länge erlegt habe, und auch die Angaben des Prinzen stimmen hiermit überein. Ob nun wirklich einzelne uralte Stücke getötet worden sind, die über zehn Meter lang waren, wie die drei genannten Naturforscher von glaubwürdigen Zeugen erzählen hörten, bleibt fraglich und für mich zweifelhaft, weil ich auf derartige Schätzungen unkundiger Leute, auch wenn ich von ihrer Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe überzeugt bin, durchaus kein Gewicht zu legen vermag; immerhin aber steht soviel fest, daß die Anakonda eine gewaltige, achtunggebietende Schlange ist.
»Alle Nachrichten und Namen«, sagt der Prinz, die auf einen Aufenthalt in oder an dem Wasser deuten, beziehen sich auf diese Art; denn sie lebt meistens im Wasser und kann sehr lange in der Tiefe desselben aushalten, kommt aber oft an die Ufer auf alte Baumstämme, Felsenstücke oder auf den erhitzten Sand, um sich daselbst zu sonnen oder ihren Raub zu verzehren. Sie läßt sich im Fluß von dem Strom treiben, fischt daselbst oder legt sich auf einem Felsenstück auf die Lauer, um den Wasserschweinen, Agutis, Pakkas und ähnlichen Tieren nachzustellen. Im Fluß Belmonte hatten meine Jäger die vier Füße eines Säugetiers hervorblicken sehen, die sie für ein totes Schwein hielten; als sie aber näher hinzukamen, entdeckten sie eine riesenhafte Schlange, die ein großes Wasserschwein in mehreren Windungen umschlungen und getötet hatte. Sie brannten augenblicklich zwei Flintenschüsse nach dem Untier ab, und der Botokude schoß ihm einen Pfeil in den Leib. Nunmehr erst verließ es seinen Raub und schoß, der Verwundung ungeachtet, schnell davon, als ob ihm nichts widerfahren wäre. Meine Leute fischten das noch frische, eben erst erstickte Wasserschwein auf und kehrten zurück, um mir Nachricht von dem Vorfall zu geben. Da es mir äußerst wichtig war, die merkwürdige Schlange zu erhalten, sandte ich die Jäger sogleich wieder aus, um sie zu suchen; alle angewandte Mühe war jedoch fruchtlos. Die Schrote hatten im Wasser ihre Kraft verloren, und den Pfeil fand man zerbrochen am Ufer, wo ihn die Schlange abgestreift hatte.«
Die Anakonda nährt sich zwar von verschiedenartigen Wirbeltieren, besonders aber von Fischen, deren Überreste man in dem Magen findet. Sie lebt viel auf dem Grunde der Gewässer, liegt ruhend in deren Tiefen und zeigt höchstens den Kopf über der Oberfläche, von hier aus die Ufer beobachtend, oder treibt mit der Strömung schwimmend den Fluß hinab, jeglicher Art von Beute gewärtig. Den Anwohnern macht sie sich durch ihre Räubereien sehr verhaßt: Schomburgk erlegte eine, die eben eine der großen, zahmen Bisamenten ergriffen und bereits erdrückt hatte, und erfuhr gelegentlich seines Besuches in einer Pflanzung, daß sie sich zuweilen auch an vierfüßigen Haustieren, beispielsweise Schweinen, vergreift. Andere Forscher bestätigen seine Angaben.
Gerade von der Anakonda wird behauptet, daß sie zuweilen einen Menschen angreift. Schomburgk erzählt wörtlich folgendes: »In Morokko (einer Mission in Guayana) war noch alles von dem Angriff einer Riesenschlange auf zwei Bewohner der Mission bestürzt. Ein Indianer aus dieser war vor wenigen Tagen mit seiner Frau nach Federwild den Fluß aufwärts gefahren. Eine aufgescheuchte Ente hatte der Schuß erreicht und war auf das Ufer niedergefallen. Als der Jäger seiner Beute zueilt, wird er plötzlich von einer großen Anakonda ergriffen. In Ermangelung jeder Verteidigungswaffe (das Gewehr hatte er zurückgelassen) ruft er seiner Frau zu, ihm ein großes Messer zu bringen. Kaum ist die Frau an seiner Seite, so wird auch sie von dem Untier ergriffen und umschlungen, was dem Indianer glücklicherweise so viel Raum läßt, daß er den einen Arm frei bekommt und der Schlange mehrere Wunden beibringen kann. Durch diese geschwächt, läßt sie endlich vom Angriffe ab und ergreift die Flucht. Es war dies der einzige Fall, der zu meiner Kenntnis kam, daß die Anakonda Menschen angegriffen.« Höchstwahrscheinlich hatte die Schlange es auf die Ente, nicht aber auf den Indianer abgesehen und in blinder Raubgier an diesem sich vergriffen. Jedoch mögen wirklich Fälle vorkommen, die auch auf das Gegenteil hindeuten. »Zu Ega«, berichtet Bates, »hätte eine große Anakonda einst beinahe einen Knaben von zehn Jahren, den Sohn eines meiner Nachbarn, gefressen. Vater und Sohn wollten wilde Früchte sammeln und landeten an einer sandigen Uferstelle. Der Knabe blieb als Hüter des Bootes zurück; der Mann drang in den Wald ein. Während jener nun im Wasser unter dem Schatten der Bäume spielte, umringelte ihn eine große Anakonda, die ungesehen so weit herangekommen, daß es für ihn unmöglich wurde, zu flüchten. Sein Geschrei rief glücklicherweise rechtzeitig den Vater herbei, der die Anakonda sofort am Kopfe ergriff, ihr die Kinnladen aufbrach und den Knaben befreite.« Auch Humboldt erwähnt ausdrücklich, daß die großen Wasserschlangen den Indianern beim Baden gefährlich werden. Demungeachtet können diese Ausnahmen die vom Prinzen aufgestellte Regel, daß die Anakonda dem Menschen unschädlich ist und von niemand gefürchtet, sie auch sehr leicht getötet wird, nicht umstoßen.
Nach reichlich genossener Mahlzeit wird die Anakonda, wie die Schlangen überhaupt, träge, so bewegungslos aber, als man gefabelt hat, niemals. Allem, was man von der Nahrung und Unbeweglichkeit bei der Verdauung gesagt, liegt, wie der Prinz hervorhebt, »etwas Wahrheit zugrunde, alles ist aber immer sehr übertrieben.« Schomburgk bemerkt, daß der Geruch, der während der Verdauung von ihr ausströmt, pestartig sei und meist zum Führer nach dem Lager der verdauenden Schlange werde. Von was dieser Pestgeruch herrührt, ob von den sich zersetzenden Beutestücken oder von gewissen Drüsen, die namentlich in der Nähe des Afters liegen sollen, bleibt, laut Waterton, noch fraglich.
Humboldt ist der erste Naturforscher, der erwähnt, daß die Anakonda, wenn die Gewässer austrocknen, die ihren Aufenthalt gebildet haben, sich in den Schlamm vergräbt und in einen Zustand der Erstarrung fällt. »Häufig finden die Indianer«, sagt er, »ungeheure Riesenschlangen in solchem Zustande, und man sucht sie, so erzählt man, zu reizen oder mit Wasser zu begießen, um sie zu erwecken.« Ein solcher Winterschlaf findet übrigens nur in gewissen Teilen Südamerikas statt, nicht aber da, wo weder Kälte noch unerträgliche Hitze die mittlere Jahreswärme stören. Hier kann man, nach Versicherung des Prinzen von Wied, keine bedeutende Abwechslung in der Lebensart der Anakonda erwarten, und alles, was man von ihrem Winterschlafe gesagt hat, gilt für die Wälder von Brasilien nicht; denn in den ewig wasserreichen Waldtälern bleibt sie Winter und Sommer beweglich und lebendig. So viel ist indessen den Bewohnern bekannt, daß sie sich in der heißen Zeit oder den Monaten Dezember, Januar und Februar mehr bewegt, mehr zeigt und mehr um sich geht als im übrigen Teile des Jahres, da schon der Geschlechtstrieb sich regt.
Während der Paarung soll man nach Angabe desselben Forschers, die von Schomburgk durchaus bestätigt wird, oft ein sonderbares Brummen der Anakonda vernehmen, über die Begattung selbst, das heißt über die Zeit und die Art und Weise, in der sie geschieht, ist mir keine Mitteilung der Reisenden bekannt. Schomburgk sagt, daß die Jungen noch im Bauche der Mutter aus den Eiern schlüpfen, und die Anzahl der letzteren oft gegen hundert betragen soll. Auch Schlegel fand im Leibe einer ihm aus Surinam zugesandten Anakonda zwar nicht gegen hundert, aber doch einige zwanzig Eier, in denen die Keimlinge fast gänzlich entwickelt waren und bereits eine Länge von dreißig bis fünfundvierzig Zentimeter erlangt hatten. Es scheint jedoch, daß die Jungen auch als Frühgeburten zur Welt kommen können, da eine Anakonda der Dinterschen Tierbude am sechsundzwanzigsten Mai sechsunddreißig Eier legte, die zwischen wollenen Decken in einer Wärme von sechsunddreißig Grad erhalten und bis zum achtzehnten Juni, an welchem Tage das erste, etwa fingerdicke Junge frisch und munter herauskam, wirklich gezeitigt wurden. Im Freien scheinen sich die Jungen nach dem Auskriechen sofort ins Wasser zu begeben, aber noch längere Zeit gesellig zusammenzuhalten und auf den benachbarten Uferbäumen gemeinschaftlich zu lagern. Auch für diese Angabe ist Schomburgk Gewährsmann. »Eine große Anzahl Riesenschlangen«, erzählt er, »schien die Ufer des Flusses zu ihrem Wochenbette erwählt zu haben; denn auf den Bäumen, die über den Fluß herüberhingen, hatte sich eine Menge von etwa zwei Meter langer und entsprechend junger Brut gelagert. Wenn die Axt an den Stamm des über den Fluß gebeugten Baumes gelegt ward und ihn zu erschüttern begann, fielen jedesmal mehrere herab.«
Wenn man ältere Reisebeschreibungen liest, wundert man sich nicht mehr, daß noch heutigestags fürchterliche Geschichten von Kämpfen zwischen Menschen und Anakondas oder andern Riesenschlangen geglaubt werden. Kein Wunder, daß auch Schomburgk anfänglich sich scheute, eine von seinen Indianern entdeckte Anakonda anzugreifen. »Das Ungeheuer«, erzählt er, »lag auf einem dicken Zweige eines über den Fluß ragenden Baumes gleich einem Ankertaue zusammengerollt und sonnte sich. Ich hatte zwar schon in der Tat große Anakondas gesehen: ein solcher Riese aber war mir noch nicht begegnet. Lange Zeit kämpfte ich mit mir und war unentschieden, ob ich angreifen oder ruhig vorüberfahren sollte. Alle die schreckenvollen Bilder, die man mir von der ungeheuren Kraft dieser Schlangen entworfen, und vor denen ich schon als Kind gezittert hatte, tauchten jetzt in meiner Seele auf, und die Vorstellung der Indianer, daß, wenn wir sie nicht auf den ersten Schuß tödlich verwundeten, sie uns ohne Zweifel angreifen und das kleine Corial durch ihre Windungen umwerfen würde, wie dies schon öfters der Fall gewesen, verbunden mit dem sichtbaren Entsetzen Stöckles (des deutschen Dieners), der mich bei meinen und seinen Eltern beschwor, uns nicht leichtsinnig solchen Gefahren auszusetzen, bewogen mich, den Angriff aufzugeben und ruhig vorüberzufahren. Kaum aber hatten wir die Stelle im Rücken, als ich mich meiner Bedenklichkeiten schämte und die Ruderer zur Umkehr nötigte. Ich lud die beiden Läufe meiner Flinte mit dem gröbsten Schrote und einigen Posten; ebenso tat der beherzteste der Indianer. Langsam kehrten wir nach dem Baume zurück: noch lag die Schlange ruhig auf der alten Stelle. Auf ein gegebenes Zeichen schossen wir beide ab; glücklich getroffen stürzte das riesengroße Tier herab und wurde nach einigen krampfhaften Zuckungen von der Strömung fortgetrieben. Unter Jubeln flog das Corial der Schlange nach, und bald war sie erreicht und in den Kahn gezogen. Obgleich sich jeder überzeugte, daß sie längst verendet sei, so hielten sich doch Stöckle und Lorenz in ihrer Nähe keineswegs sicher; die beiden Helden warfen sich jammernd und heulend auf den Boden nieder, als sie das fünf Meter lange und starke Tier vor sich liegen und dann und wann noch den Schwanz sich bewegen sahen. Die Leichtigkeit, mit der wir sie bewältigten, verdankten wir der Wirksamkeit der Posten, von denen ihr die eine das Rückgrat, die andere den Kopf zerschmettert hatte. Eine solche Verwundung, besonders in den Kopf, macht, wie ich später noch oft wahrzunehmen Gelegenheit hatte, selbst die riesigste Schlange augenblicklich regungs- und bewegungslos. »Gewöhnlich«, sagt auch der Prinz von Wied, »wird die Anakonda mit Schrot geschossen, allein die Botokuden töten sie auch wohl mit dem Pfeile, wenn sie nahe genug hinzukommen können, da sie auf dem Lande langsam ist. Sobald man sie einholt, schlägt oder schießt man sie auf den Kopf. Ein durch den Leib des Tieres geschossener Pfeil würde dasselbe nicht leicht töten, da sein Leben zu zäh ist; es entkommt mit dem Pfeile im Leibe und heilt sich gewöhnlich wieder aus. Die Bewohner von Belmonte hatten derartige Schlangen erlegt, den Kopf fast gänzlich abgehauen, alle Eingeweide aus dem Leibe, sowie das viele darin befindliche Fett abgelöst, und dennoch bewegte sich der Körper noch lange Zeit, selbst nachdem die Haut schon abgezogen.
Die Anakonda wird ohne Gnade getötet, wo man sie findet. Ihre große, dicke Haut gerbt man und bereitet Pferdedecken, Stiefel und Mantelsäcke daraus. Das weiße Fett, das man bei ihr zu gewissen Zeiten des Jahres in Menge findet, wird stark benutzt, und die Botokuden essen das Fleisch, wenn ihnen der Zufall ein solches Tier in die Hände führt.«
Außer dem Menschen dürften erwachsene Anakondas kaum Feinde haben; ich wenigstens halte die Berichte von entsetzlichen Kämpfen zwischen Alligatoren und Wasserschlangen für nichts andres als eitel Faselei. Den Jungen dagegen stellen unzweifelhaft alle Schlangenfeinde Südamerikas mit demselben Eifer nach wie andern kleineren Mitgliedern der Ordnung auch.
In unsern Tiergärten sieht man lebende Anakondas ebenso oft als Abgottschlangen. Ihre Behandlung ist dieselbe, und was von dem Gefangenleben der einen gesagt werden kann, gilt auch für die andere.
*
Die Pythonschlangen ( Pythoninae), die altweltlichen Riesen der Ordnung, die die dritte Unterfamilie der Stummelfüßler bilden, unterscheiden sich von den Boaschlangen hauptsächlich dadurch, daß bei ihnen auch die Zwischenkiefer durch Zähne bewehrt sind, die unteren Schwanzschilder zwei Reihen bilden, einzelne Lippenschilder Gruben haben und die Nasenlöcher, die sich bald seitlich, bald nach oben öffnen, von ungleichen Schildern begrenzt werden, sowie endlich, daß der Kopf bis zur Stirn mit gleichartigen Schildern bekleidet ist.

Tigerschlange ( Python molurus)
Den größten Teil Indiens bewohnt die Peddapoda der Bengalen, unsere Tigerschlange ( Python molurus), Vertreter der Felsenschlangen ( Python), die sich dadurch kennzeichnen, daß nur die vordere Hälfte des Oberkopfes mit regelmäßigen Schildern, die hintere dagegen mit Schuppen bedeckt ist, das Schnauzenschild und einige obere und untere Lippenschilder Gruben haben und die Nasenlöcher zwischen zwei ungleich großen Schildern liegen. An Länge erreicht die Tigerschlange nachweislich sieben bis acht Meter; größere Stücke dürften, falls überhaupt vorhanden, überaus selten vorkommen. Der Kopf ist graulichfleischfarben, auf Scheitel und Stirn hellolivenbraun, der Rücken hellbraun, auf der Mitte graugelb angeflogen, die Unterseite weißlich; der Rücken trägt eine Reihe großer, unregelmäßig vierseitiger, brauner Flecken, die dunkler gerandet und am Rande entweder gezähnelt oder gradlinig sind und teilweise eine hochgelbe Mitte zeigen; längs der Seite verlaufen, den mittleren entsprechend, kleinere Längsflecken.

Tigerschlangen ( Phyton molurus)
Das Verbreitungsgebiet der Tigerschlange reicht vom Süden der Indischen Halbinsel bis zum Fuße des Himalaja und von der Küste des Arabischen Meeres bis Südchina.
Die Gitter- oder Netzschlange, Ularsawa, zu deutsch »Reisfelderschlange«, der Malaien ( Python reticulatus), dürfte die Tigerschlange an Länge nicht übertreffen. Ihre Grundfärbung ist licht gelblich- bis nuß- oder olivenbraun; die Zeichnung wird hervorgerufen durch eine schmale, schwarze Längslinie, die auf dem Stirnschilde beginnt und in gerader Richtung bis zum Genick verläuft, und eine zweite, die am hinteren Augenrande ihren Ursprung nimmt, sich schief über die Oberlippe herab, und sodann in ziemlich gerader Richtung längs der Halsmitte weiter zieht, bald aber, wie jene auch, in eine Reihe unregelmäßig gestalteter, bald rundlicher, bald verschoben viereckiger Hohlflecken übergeht, die die Rückenmitte einnehmen und scharf hervortreten. Jederseits eines solchen Fleckens steht ein kleinerer, ebenfalls unregelmäßig gestalteter, weißlicher, schwarz umrandeter Augen- oder Netzflecken und vermehrt die Gitterung der ganzen Zeichnung. Die gelbliche Unterseite ist seitlich mit unregelmäßigen schwarzen, die Schwanzunterseite mit gemarmelten braunen Flecken gezeichnet. Die Gitterschlange bewohnt außer der Malaiischen Halbinsel alle Eilande des Indischen Inselmeeres und ist auch auf solche verschleppt worden, auf denen sie früher nicht einheimisch war, so durch die Chinesen nach Amboina.

Gitterschlange ( Phyton reticulatus)
Unter den Indiern laufen noch heutigentags Erzählungen über diese Schlange um, die an die Märchen der Alten erinnern oder den Aufschneidereien der Südamerikaner gleichkommen. Aus den noch immer dürftigen Berichten der Naturforscher und Reisenden, die sich bemühten, wirklich Tatsächliches zu geben, geht zur Genüge hervor, daß die südasiatischen Drachen in keiner Weise gefährlicher sind als ihre neuweltlichen Verwandten, daß sie diesen auch ganz ähnlich leben, mit entschiedener Vorliebe in sumpfigen Gegenden, auf überschwemmten Reisfeldern, überhaupt in der Nähe vom Wasser sich aufhalten, trockene Gegenden jedoch ebensowenig meiden und hier wie dort ihre Jagd auf kleinere Wirbeltiere der beiden ersten Klassen betreiben. Sehr große Stücke sollen sich zuweilen selbst an junge Muntjake und Schweinshirsche wagen, und daher mögen wohl die Erzählungen rühren, die glauben machen wollen, daß unsere Schlangen Tiere bis zu Hirschgröße hinabwürgen. Zur Hirschfamilie zählen die genannten Wiederkäuer allerdings, in der Größe aber kommen sie bekanntlich noch nicht einmal unserm Rehe gleich, und zudem ist bei ihrer Erwähnung immer noch zu bedenken, daß in Südasien auch die kleinen Moschustierchen leben, die nicht bloß von den Eingeborenen, sondern ebenso von den dortigen Europäern gemeiniglich als Hirsche bezeichnet werden. Daß man in Indien noch heutigentags von den Angriffen auf Menschen zu fabeln weiß, daß berühmte Maler schauerliche Kämpfe zwischen Schlangen und Laskaren nach »verbürgten Tatsachen« dargestellt haben und ihre Abbildung sogar von gläubigen »Forschern« in ihre Werke aufgenommen worden sind, trotzdem ein Blick auf das Bild sie von der Unwahrheit desselben belehren mußte: dies alles wird denjenigen, der gewohnt ist, das Glaubliche von dem Unglaublichen zu sondern, nicht beirren können.
Am ersten Januar 1841 beobachtete man, wie Valenciennes und Dumeril ausführlich berichten, zum erstenmal die Begattung zweier im Pflanzengarten zu Paris lebender Tigerschlangen. Bis Ende Januar paarten sich die Tiere wiederholt. Vom zweiten Februar an fraß das Weibchen, das an gedachtem Tage ein Kaninchen und vier Kilogramm rohes Rindfleisch verschlungen hatte, nicht mehr, nahm aber gleichwohl an Körperumfang merklich zu. Am sechsten Mai legte es im Zeitraume von viereinhalb Stunden fünfzehn Eier, eines nach dem anderen, vereinigte sie zu einem Haufen und rollte sich derartig über sie zusammen, daß die einzelnen Ringe seines Leibes ein flaches Gewölbe bildeten, dessen höchste Stelle der Kopf einnahm. In dieser Lage verblieb die Schlange fast zwei Monate, vom fünften Mai bis zum dritten Juli, an welchem Tage die Jungen ausschlüpften. Während dieser Zeit wurde wiederholt die Wärme gemessen, die sich zwischen den Falten entwickelt hatte, und man fand, daß dieselbe zuweilen um acht bis zehn Grad Réaumur die der Umgebung übertraf. Der Raum, in dem sich die über den Eiern liegende Schlange befand, war ein großer Kasten, der von unten her durch Wärmflaschen geheizt und bis auf zwanzig oder fünfundzwanzig Grad gebracht werden konnte. Diese Wärme wurde während der ganzen Zeit sorgfältig erhalten und mag wesentlich zu dem günstigen Ergebnisse beigetragen haben. Aus den fünfzehn Eiern schlüpften an gedachtem Tage acht junge Schlangen von ungefähr einem halben Meter Länge; sie wuchsen jedoch, ohne Nahrung zu nehmen, während der ersten sechzehn Tage bis zu achtzig Zentimeter Länge heran, häuteten sich zum erstenmal zwischen dem dreizehnten und achtzehnten Juli, bis zum Dezember desselben Jahres überhaupt fünfmal und begannen nach der ersten Häutung zu fressen. Anfänglich reichte man ihnen Sperlinge, die sie nach Art ihrer Eltern erwürgten; später erhielten sie rohes Fleisch und kleine Kaninchen. Da ihnen so viel Nahrung gewährt wurde, als sie fressen wollten, gediehen sie vortrefflich und hatten bereits im Dezember ihres Geburtsjahres eine Länge von 1,5 bis 1,55, ja selbst zwei Meter erlangt. Nach Verlauf von zwanzig Monaten, am fünften März 1843, betrug die Länge der meisten von ihnen mehr als zwei Meter oder viermal soviel, als sie bei der Geburt gezeigt hatten; eine von ihnen war bereits bis auf 2,34 Meter herangewachsen. Letztere hatte in den ersten sechs Monaten ihres Lebens 13,17, im zweiten Jahr zweiundzwanzig Kilogramm an Nahrung zu sich genommen. Aus dieser Feststellung folgert Günther, daß eine Tiger- oder Netzschlange von reichlich drei Meter Länge ungefähr vier Jahre alt sein muß, und durch Beobachtungen, die im Garten zu Regents-Park gewonnen wurden, erfahren wir, daß in den nächsten zehn Jahren des Lebens die Länge bis auf sieben Meter ansteigen kann.
Beide Pythonarten werden oft gefangen und schon in Südasien, hier jedoch nicht von allen Völkerschaften, mit Vorliebe gepflegt. Laut Martens wird eine oder die andere Riesenschlange von den Chinesen in ihren Dschunken gern gesehen und als ein Pfand des Glückes betrachtet, wenn sie etwas frißt, als Unglück, wenn sie die Dschunke verläßt. Auf den Fahrzeugen wie in den Häusern, in denen man sie pflegt, liegt sie mit Eifer dem Rattenfange ob. Der alte Valentyn erzählt, wie geschickt sie hierbei zu Werke geht, indem sie die Ratten, ohne sich zu rühren, über ihren Leib weglaufen läßt, dann aber, sobald sie in Fangweite kommen, plötzlich zuschnappt und das dreiste Wild in der üblichen Weise erwürgt und verzehrt. In Anerkennung ihrer Nützlichkeit läßt man sie in Nebengebäuden der Wohnungen, insbesondere in Speichern, gern gewähren.
Bei der auf Südafrika beschränkten Natal- oder Felsenschlange ( Python natalensis) sind die beiden vordersten Schnauzen- oder Zwischennasenschilder länger als die darauf folgenden Schnauzenschilder, die beiden vorderen Stirnschilder noch weniger als letztere entwickelt, die übrigen klein und unregelmäßig gestaltet, und ist der Rüsselschild mit zwei Gruben ausgestattet, während die beiden Oberlippenschilder jederseits eine Grube zeigen. Ein schönes Gelbbraun bildet die Grundfärbung des vorderen Dritteils, ein dunkleres Olivenbraun des Restes der Oberseite, ein ansprechendes Rötlichweiß das der Unterseite: ein olivenbrauner, mit der Spitze nach vorn gerichteter Flecken nimmt den größten Teil des Oberkopfes ein; eine Reihe kettenartig verschlungener, länglich viereckiger, mehr oder weniger rechtwinkeliger oder verschobener, am Rande oft verwaschener, überhaupt ungleichartiger und auch ungleichmäßig angeordneter Flecken von olivenbrauner Färbung zieht sich über die ganze Oberseite und setzt sich als dunkler Streifen zwischen zwei gelben Längsbändern auch über die Schwanzspitze fort.
Bei der über ganz West- und Mittelafrika verbreiteten Assala, Tenne oder Hieroglyphenschlange ( Python sebae) dagegen sind die Zwischennasenschilder kürzer als die Schnauzenschilder, die beiden Vorderstirnschilderpaare klein oder auf eines verkümmert, drei Paar Scheitelschilder vorhanden, die Gruben in den Rüssel- und den Oberlippenschildern endlich ebenso wie bei der Natalschlange verteilt. Den Oberkopf nimmt ein dunkelbrauner oder schwärzlicher Pfeilflecken so weit ein, daß seitlich nur ein schmaler weißgelblicher Streifen übrig bleibt; der Leib zeigt auf graugelblichem Grunde bräunliche Flecken von vielfach wechselnder Gestalt, deren Inneres meist lichter als der Rand ist, sowie Querbänder, die wie die Flecken jederseits von einer dunklen, nach unten hin an ein lichtgelbes Feld stoßenden Längsbinde ausgehen. Die Unterseite sieht graugelb aus.
Falls der alte Bosmann wirklich richtig beobachtet hat, gebührt der Name » Abgottschlange« dieser Art der Familie; denn sie ist es, die in manchen Ländern der Guineaküste unter der Pflege von Priestern in Tempeln verehrt wird.
Wenn wir annehmen, daß die mittelafrikanischen Schlangen gleichartig sind oder doch annähernd dieselbe Lebensweise führen und das hierauf in Erfahrung Gebrachte zusammenstellen, wird eine Schilderung der Sitten dieser Tiere ungefähr folgendermaßen lauten müssen: Die Felsenschlange, Assala, Tenne oder wie man sie sonst nennen will, scheint nirgends besonders häufig, aber auch nicht gerade selten, hier und da sogar eine nicht ungewöhnliche Erscheinung und nur aus den bewohnten Gegenden verdrängt worden zu sein. Alte Stücke von sechs Meter und darüber gehören zu den größten Seltenheiten; schon solche von fünf Meter kommen dem beobachtenden und sammelnden Forscher nur ausnahmsweise zu Gesicht. Barth erwähnt, daß von seinen Leuten am Tschadsee eine Felsenschlange von fast sechs Meter Länge erlegt wurde, und Russegger spricht von einer außerordentlich großen, die man während seiner Reise im Sennâr tötete; ich selbst habe nur zwei gemessen, eine von 2,5 und eine von 3,15 Meter Länge. Letztere galt in den Augen der Sudanesen als wahres Ungeheuer. Schweinfurth spricht von einer von ihm erlegten Assala, die fast fünf, und von einer von ihm gesehenen, die sechs Meter lang war. Hiernach wird man also wohl beurteilen können, wie es sich mit den zehn bis sechzehn Metern Länge, die gewisse Berichterstatter unsern Tieren zusprechen, verhält.
Möglicherweise kommt die Schlange häufiger vor, als man glaubt; denn man findet sie ebenfalls nur zufällig auf, wenn sie einmal den Graswald oder das Buschdickicht, ihre beliebtesten, ja fast ausschließlichen Aufenthaltsorte, verlassen, sich in das Freie herausgewagt hat und hier in der Sonne liegen geblieben ist. Wäre es möglich, des Nachts in ihr Wohngebiet einzudringen und Beobachtungen anzustellen, so würde man sie wahrscheinlich weit öfter bemerken, da ja auch sie erst nach Sonnenuntergang ihre Tätigkeit beginnt, insbesondere auf Raub ausgeht. Alle Assalas, mit denen wir zusammentrafen oder von denen wir reden hörten, waren augenscheinlich in ihrer Tagesruhe gestört worden und suchten sich so eilig als möglich aus dem Staube zu machen, sobald sie merkten, daß wir sie entdeckt hatten. Oft genug mag es vorkommen, daß man nahe an einer ruhenden Schlange dieser Art vorübergeht oder -reitet, ohne sie zu bemerken, weil sie keine Veranlassung findet, sich zu bewegen, während man sie mit Hilfe von jagdgeübten Pferden oder feinspürenden Hunden, denen sie sich durch ihre Ausdünstung verrät, unzweifelhaft wahrnehmen würde. Eine sehr erklärliche Folge dieses seltenen Zusammentreffens ist die in ganz Afrika herrschende Unkenntnis von der Lebensweise der Schlange.
Savage erfuhr während seines fünfjährigen Aufenthaltes in der Nähe des Palmenvorgebirges in Westafrika teils durch Hörensagen, teils durch eigene Wahrnehmung, daß Riesenschlangen von ungefähr fünf Meter Länge zweimal kleinere Hunde packten und umringelten, und einmal eine kleinere Antilope ergriffen. Die Hunde konnten aus den furchtbaren Umschlingungen nur dadurch gerettet werden, daß man auf die Schlange schlug oder stach. Der eine von ihnen bewahrte für lange Zeit treues Gedächtnis an den erlittenen Angriff und fürchtete sich vor jedermann und vor jedem Dinge. Einer dieser Überfälle geschah während des Tages, einer, wie üblich, des Nachts. In lebendiger und anziehender Weise schildert Schweinfurth ein ähnliches Vorkommnis. »Zwischen tiefen Erdrissen, die zur Regenzeit zwei sich miteinander verbindende Bäche darstellten, und deren einer meinen Begleiter mitsamt seinem Esel barg, hatte ich im hohen Grase einen kleinen Buschbock krank geschossen. Ich sah ihn in der Richtung meines Ausgangspunktes durch das Gras eilen und erwartete eben sein Zusammenbrechen. Da hörte ich ihn plötzlich ein kurzes, meckerndes Geschrei ausstoßen, und in demselben Augenblicke, als sei er in eine Versenkung gefallen, war er meinen Blicken entzogen. Nun drang ich durch das hohe Gras zu der Stelle vor, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte, konnte aber nichts ausfindig machen. Meine Bewegungen waren durch zwei Gewehre, die ich trug, sehr erschwert; aber da ich das Tier bestimmt auf dem scharf abgegrenzten Striche wußte, der sich zwischen den beiden Erdrissen befand, so scheute ich nicht die Mühe einer fortgesetzten Nachsuchung. Endlich sah ich es dicht vor mir liegen, auf das lebhafteste mit den Läufen schnellend, aber fest gebannt an dem Boden durch einen Gegenstand, den ich nicht erkannte. Es schien mir, als hätte ein Nubier sein schmutziges Umschlagetuch auf die Beute geworfen. Ich trat einen Schritt näher und gewahrte ganz deutlich den dicken Leib einer Riesenschlange, die in dreifachen Windungen den Körper des Bocks umschlungen hielt. Der Kopf lag lang vorgeschoben, an dem einen Hinterlauf angeschmiegt.« Natürlich überfällt die Assala bloß ausnahmsweise so große und schwere Tiere. In der Regel begnügt sie sich mit viel kleinerem Wilde, insbesondere mit Hasen, Erdeichhörnchen, Springmäusen und andern auf dem Boden lebenden Nagern. Sie und verschiedene Erdvögel dürften am meisten ihren Nachstellungen ausgesetzt sein. In dem Magen einer von mir untersuchten Assala fand ich ein Perlhuhn, und hiermit steht auch eine Angabe Draysons im Einklange.
Über die Fortpflanzung wußten die Sudaner, soviel ich mich erinnere, mir nicht das geringste mitzuteilen. Wir haben jedoch an Gefangenen erfahren, daß sie hierin von den asiatischen Verwandten sich nicht unterscheiden.
Zur Jagd der Assala bedienen sich die Sudaner, die sehr wohl wissen, daß sie ungefährlich ist, eines einfachen Knüppels, da ein einziger, kräftiger Schlag auf den Kopf des Tieres hinreicht, es zu fällen. Wir erfuhren, daß es ebenso leicht durch einen Schuß mit mittelstarken Schroten erlegt wird. Angeschossene Riesenschlangen, namentlich solche, die schmerzhaft verwundet wurden, scheinen sich, wie aus der bereits teilweise gegebenen Schilderung Schweinfurths hervorgehen dürfte, verteidigen zu wollen. Als unser Reisender den oben erwähnten Buschbock in der Gewalt der Riesenschlange gesehen hatte, wich er so weit zurück, als ihm erforderlich schien, um den besten Schuß abgeben zu können, feuerte und sah, wie in demselben Augenblicke der Python kerzengerade und meterhoch vor seinen Blicken stand. »Dann«, sagt Schweinfurth wörtlich, »schnellte er zurück und schoß mit unglaublicher Schnelligkeit hoch auf mich los. Aber nur die vordere Hälfte schien beweglich, der Rest des Schlangenleibes lag gelähmt am Boden; denn die Wirbelsäule war gebrochen. Als ich dies gewahr geworden, griff ich zu meiner Schrotflinte, feuerte, lud und feuerte wieder, so lange, bis das Untier keine Bewegung mehr verriet. Es war ein Zielen so ungefähr wie auf einen Nachtschatten; denn ich vermochte den Bewegungen der Schlange nicht zu folgen.« In andern Fällen überzeugte sich auch Schweinfurth, daß gerade die Riesenschlange durch einen gewöhnlichen Schrotschuß zu töten ist, sobald nur die Wirbelsäule zerschmettert wird.
Im Ostsudan erfuhr ich, daß man eine erlegte Assala zunächst für die Küche verwendet, daher ihr Fleisch, mit Salz und rotem Pfeffer gewürzt, möglichst weich zu kochen sucht und es dann mit ebenso großem Behagen wie das Krokodilfleisch verzehrt. Da mir von dem Wohlgeschmacke desselben mancherlei erzählt worden war, ließ ich für uns ebenfalls ein Stück Fleisch in der angegebenen Weise zubereiten. Das Gericht hatte eine vielversprechende, schneeweiße Färbung und in der Tat einen zusagenden, an den des Hühnerfleisches erinnernden Geschmack, war aber so hart und zähe, daß wir es kaum zerkauen konnten. Noch wichtiger als das Fleisch scheint den Sudanern die bunte Haut zu sein; sie wird von ihnen und ebenso von den freien Negern des Blauen und Weißen Nils zu allerlei Zierat, und zwar in höchst geschmackvoller Weise, insbesondere zum Ausputz von Messerscheiden, Amulettrollen, Brief- oder Geldtaschen und dergleichen verwendet. Das Fett der Assala steht bei einzelnen Völkerschaften, beispielsweise bei den Namaquas, in dem Rufe, eine überaus wohltätige Heilkraft zu besitzen, wird aus diesem Grunde noch sorgfältiger bewahrt als das Fleisch und von Kranken in bestem Glauben, daher in vielen Fällen mit Erfolg, eingenommen. Im Sudan herrscht, laut Schweinfurth, eine ähnliche Ansicht, nur daß man die Heilkraft des Fettes auf Ohrenkrankheiten beschränken zu müssen glaubt.
In Tiergärten und Schaubuden sieht man die afrikanische Riesenschlange nicht viel seltener als ihre amerikanischen Verwandten. Sie scheint sich ebenso leicht wie letztere an den Pfleger zu gewöhnen, hält auch bei geeigneter Behandlung trefflich aus.
*
Linné vereinigte alle ihm bekannten Schlangen in drei Familien, die er mit den Namen Grubenottern, Riesenschlangen und Nattern bezeichnete. Mit dem letzteren Namen umfassen wir gegenwärtig noch immer die artenreichste Schlangengruppe. Alle Nattern ( Colubridae) kennzeichnen sich durch schlanken, allerwärts in gleichem Grade biegsamen Leib, von dem sich der kleine, längliche, wohlgestaltete Kopf deutlich absetzt, und dessen Schwanz in eine lange Spitze ausläuft, sowie durch ihre aus glatten oder gekielten Schindelschuppen und auf der Unterseite aus Schildern bestehende Bedeckung, endlich auch dadurch, daß die Schilder am Kinn durch eine Furche getrennt werden und am Schwanzteile in zwei Reihen sich ordnen. Zahlreiche Zähne bewaffnen beide Kiefer und den Gaumen; unter ihnen treten aber weder vorn, noch in der Mitte des Kiefers einzelne durch ihre Größe hervor. So kann man sagen, daß die Nattern diejenigen giftlosen Schlangen sind, die die regelmäßigste Gestalt und Bildung der einzelnen Teile zeigen oder durch kein hervorstechendes Merkmal besonders sich hervortun. Wohl aber zeichnen sie sich vor vielen anderen Schlangen aus durch ihre Beweglichkeit, Munterkeit und verhältnismäßige Klugheit, so daß man sie in gewisser Hinsicht vielleicht als die höchststehenden Schlangen bezeichnen darf.
Die Nattern verbreiten sich über die ganze Erde, da sie, wenn auch spärlich, noch bis gegen den Polarkreis hin und auch in Australien, wie auf den Eilanden des Stillen Meeres, mindestens in einigen Arten gefunden werden. Ihr Aufenthalt ist sehr verschieden. Viele Arten lieben feuchte Gegenden und Gewässer; andere hingegen suchen mehr trockene Örtlichkeiten auf. Alle bis jetzt bekannten sind, wie schon der Bau ihres Auges vermuten läßt, vorwiegend Tagetiere, die mit Einbruch der Nacht nach ihrem Schlupfwinkel sich zurückziehen und in ihm bis zu den Vormittagsstunden des nächsten Tages verweilen. Sie sind schnelle und bewegungsfähige Tiere, schlängeln sich verhältnismäßig rasch auf dem Boden fort, schwimmen, zum Teil mit überraschender Fertigkeit, klettern auch mehr oder weniger gut, einzelne von ihnen vorzüglich.
Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Wirbeltieren aller Klassen, insbesondere aus Kriechtieren und Lurchen; einzelne stellen jedoch auch kleinen Säugetieren, andere kleinen Vögeln und mehrere entsprechend großen Fischen eifrig nach. Wirft man unter die gemischte Nattergesellschaft eines Schlangenkäfigs verschiedenartige Nährtiere, wie sie den Gewohnheiten und Wünschen der bunten Genossenschaft entsprechen, so kann man in aller Bequemlichkeit beobachten, wie die eine Natterart diese, die andere jene Beute ins Auge faßt, verfolgt, ihrer sich bemächtigt und sie verzehrt. Keine einzige mir bekannte Natter lauert auf ein zufällig an ihr vorüberkommendes Opfer, sondern jede jagt auf das von ihr gesehene Tier, schleicht an dasselbe heran oder verfolgt es in eiligem Laufe, bis sie es gepackt hat. Dabei wird bemerklich, daß diejenigen Arten, die Frösche oder Fische fressen, dieselben ohne weitere Vorbereitungen, die Frösche oft mit den Hinterbeinen, die Fische stets mit dem Kopfe voran, verschlingen und hinabwürgen, wogegen diejenigen, die Eidechsen, Vögeln oder Säugetieren nachstreben, ihr Wild immer zunächst erdrosseln und dann erst verzehren. Schlangen, die nächsten Verwandten nicht ausgeschlossen, werden von den Nattern ebenso behandelt wie die Fische und so rasch verschlungen, daß man sie retten kann, wenn man rechtzeitig eingreift, sie am Schwanze packt und wieder aus Schlund und Magen ihrer Feindin zieht: eine von der nordamerikanischen Schwarznatter bereits bis auf die Schwanzspitze hinabgewürgte Kettennatter, die ich in dieser Weise dem Lichte der Welt zurückgab, lebte noch mehrere Jahre nach ihrer Errettung aus dem Schlunde ihrer gefährlichen Verwandten. Die größten Arten der Familie erweisen sich als ebenso tüchtige wie unternehmende Räuber.
In kälteren Gegenden ziehen sich die Nattern im Spätherbste zu ihrer Winterherberge zurück, verfallen hier in einen Zustand der Erstarrung und erscheinen erst nach Eintritt des wirklichen Frühlings wieder, häuten sich und beginnen sodann ihr Fortpflanzungsgeschäft, das einzelne Arten von ihnen in merkwürdiger Weise erregen und zu Angriffen auf größere Tiere geneigt machen soll. Mehrere Wochen später legt das Weibchen seine zehn bis dreißig Eier an feuchtwarmen Orten ab, deren Zeitigung der Sonnenwärme überlassend, oder trägt dieselben so weit aus, daß die Jungen unmittelbar vor oder nach dem Legen die Hülle sprengen, also lebendig geboren werden. Die Jungen ernähren sich anfänglich von kleinen, wirbellosen Tieren verschiedener Klassen, beginnen aber bald die Lebensweise ihrer Eltern.
Die Nattern bringen den Menschen keinen Nutzen, eher noch Schaden: diejenigen also, die sie geschont wissen wollen, dürfen nicht vergessen, daß zu solcher Schonung eine genaue Kenntnis der Schützlinge unbedingt erforderlich ist. In der Gefangenschaft halten die meisten Arten mehrere Jahre aus, da sie ohne Besinnen ans Futter gehen und sich nach und nach an ihren Pfleger gewöhnen, ja wirklich bis zu einem gewissen Grade zähmen lassen.
Die urbildliche Sippe dieser Gruppe umfaßt die Jachschlangen ( Coronella), wohlgestaltete, hübsche Nattern mit kräftigem, rundem, in der Mitte nicht zusammengedrücktem Leibe, mäßig langem, ziemlich plattem, rundschnauzigem, deutlich vom Halse abgesetztem Kopfe, mäßig langem Schwanze, mittelgroßen, rundsternigen Augen, zwischen zwei Schildern mündenden Nasengängen, zwei Paar Stirn-, einem Zügel- und zwei oder drei Schläfenschildern, kleinen, glatten, in siebzehn bis dreiundzwanzig Reihen stehenden Schuppen, zweireihigen Unterschwanzschildern und von vorn nach hinten gleichmäßig zunehmenden Zähnen, deren hinterster gefurcht sein kann.
In ganz Europa vom nördlichen Norwegen an bis zum Süden hinab lebt an geeigneten Orten, hier und da sehr häufig, die Schling- oder glatte Natter, auch Jachschlange genannt ( Coronella austriaca), eine der zierlichsten, beweglichsten und lebhaftesten Schlangen unseres Vaterlandes, deren Länge sechzig Zentimeter, höchstens einen Meter beträgt. Die Grundfärbung der Oberseite ist gewöhnlich braun; die Zeichnung besteht aus einem großen, dunkleren Flecken im Nacken, der sich oft nach hinten zu in breite Streifen verlängert, und in zwei Reihen dunkelbrauner, zuweilen paarweise verbundener Flecken, die längs des Rückens verlaufen; ein anderer dunkelbrauner Streifen zieht sich durch das Auge und an den Halsseiten hinab; der Unterleib sieht entweder stahlblau oder rotgelblich und weißlich aus, ist auch oft dunkler gefleckt. Wie bei den meisten Schlangen ändern Färbung und Zeichnung vielfach ab. Man findet Spielarten von Grau bis zu Rotbraun in allen dazwischenliegenden Schattierungen.
In Deutschland trifft man die Jachschlange nicht selten auf dem Harze und dem Thüringer Walde, von hier aus südlich aber auf allen Mittelgebirgen an. In den Alpen und im Kaukasus steigt sie bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe empor.
Zu ihrem Aufenthalte wählt sie trockenen Boden, sonnige, steinige Abhänge, Berghalden, dichte bebuschte Gehänge, kommt jedoch ausnahmsweise auch im Tieflande auf moorigem Boden vor. Nach den Beobachtungen von Lenz verkriecht sie sich weit öfter als die Kreuzotter oder Ringelnatter unter glatten Steinen, versteckt sich auch so unter Moos, daß nur das Köpfchen darüber hervorsteht. Sie ist weit beweglicher, flinker und lebhafter als die Ringelnatter, was sich besonders dann zeigt, wenn man sie an der Schwanzspitze oder auf einem Stocke, um den sie sich gewunden hatte, emporhebt. In ersterem Falle vermag sie, sofern sie gesund ist und nicht mit Speise überladen ist, den Kopf rasch bis zur Hand hinaufzuschwingen, in letzterem ringelt sie sich, nach brieflicher Mitteilung Sterkis, in lebhafter Bewegung um den Stock und sucht Boden oder festes Land zu gewinnen, bleibt auch, wenn ihr solches nicht gelingt, unbedingt am Stocke haften und fällt nicht herab, wie die plumpere Ringelnatter in solchen Fällen unter allen Umständen tut. Trotz dieser Fertigkeit hat man sie, soviel mir bekannt, niemals klettern sehen. Ebensowenig geht sie freiwillig in das Wasser, schwimmt jedoch, wenn man sie in dasselbe wirft, rasch und gewandt, freilich immer so eilig wie möglich wiederum dem Ufer zu.
Über das Wesen der Schlingnatter sprechen sich die verschiedenen Beobachter nicht übereinstimmend aus. Mehrere von ihnen bezeichnen sie als ein sanftes, gutmütiges Tier, während die übrigen das gerade Gegenteil behaupten, dadurch also den Sippschaftsnamen zu Ehren bringen. »Sie ist«, sagt Lenz, »ein jähzorniges, boshaftes Tierchen, das nicht nur, wenn es frisch gefangen wird, wütend um sich beißt, sondern auch in der Stube gewöhnlich noch mehrere Wochen, ja mitunter monatelang, sehr bissig bleibt. Wenn man ihr den Handschuh, einen Rockzipfel usw. vorhält, beißt sie sich regelmäßig so fest ein, daß sie zuweilen acht Minuten lang und länger hängen bleibt. Ihre Zähnchen sind allerdings so klein und ragen aus dem weichen Zahnfleische so wenig vor, daß man sie bei lebenden Stücken kaum sieht; sie sind aber so spitz, daß sie doch gleich einhäkeln. Die Schlange wird zwar leicht so grimmig, daß sie sich selbst, ihresgleichen, andere Schlangen usw. beißt, versucht jedoch ihre Zähne an Steinen oder Eisen, das man ihr vorhält, nicht gern. Wenn sie gereizt ist, stellt sie sich fast wie eine Kreuzotter, ringelt sich zusammen, zieht den Hals ein, breitet den Hinterkopf und sperrt beim Bisse oft den Rachen auf, so weit sie kann.« Mehrere Jachschlangen liegen sehr häufig miteinander in Fehde und beißen sich dabei oft recht heftig. Fassen sie sich zufällig bei solchen Händeln gleichzeitig am Kopfe, so verwickeln sie sich, laut Dursy, auch mitunter durch gegenseitiges Eingreifen der nach rückwärts gekrümmten Zähne, und der Kampf wird dann oft ein langwieriger, indem sie nach entgegengesetzten Richtungen rückwärts ziehen und die schwächere der stärkeren folgen muß. Man kann derartige Kämpfe hervorrufen, wenn man sie plötzlich mit Wasser bespritzt. Dann eilen sie zornig nach allen Richtungen und packen einander in blinder Wut. Dieses boshafte Wesen hat sie in üblen Ruf gebracht, und sie wird, weil man sie für giftig hält, sehr gefürchtet, ist auch wirklich in dem Augenblicke, in dem sie so voll Groll um sich schnappt, leicht mit einem Kreuzotterweibchen zu verwechseln. »Mir selbst ist es begegnet«, bemerkt bereits Schinz, »daß ich eine solche Schlange für eine Viper ansah, bis ich sie genauer untersucht hatte. Wenn man freilich den Kopf in der Nähe sieht, ist die Täuschung für den Kenner bald gefunden; die großen Schilder auf dem Kopfe, der dünnere, glänzendere Körper, der an der Sonne verschiedene Farben zeigt, unterscheiden sie sehr leicht; ein Irrtum ist aber doch zu gefährlich, und deshalb muß man genau nachsehen.«
Wahrscheinlich lassen sich die verschiedenen Angaben leicht ausgleichen. Die Schlingnatter hat gute und schlechte Launen. »Zuweilen«, fährt Lenz fort, »zumal wenn das Wetter naßkalt ist, läßt sie sich geduldig und ohne Gegenwehr fangen; meist aber sucht sie schnell zu entwischen und ist wirklich recht flink, obschon man sie auf ebenem Boden leicht einholen kann, jedenfalls weit gewandter als die Kreuzotter und Ringelnatter. Wenn man sie an der Schwanzspitze hält, hebt sie sich sehr leicht mit dem Kopfe bis zur Hand empor.«
Nicht selten teilt sie mit andern Schlangen, beispielsweise mit Ringelnattern und Kreuzottern, denselben Aufenthalt, verträgt sich auch in der Gefangenschaft längere Zeit mit ihnen, jedoch nur so lange, als es ihr eben behagt, und sie nicht hungrig ist. Eidechsen zieht sie jeder andern Art von Beute vor, wird aber kleinen Schlangen nicht selten ebenfalls gefährlich, und verzehrt, nach Erbers Beobachtungen, sogar junge Vipern, trotz ihrer Giftzähne. Wyder scheint der erste gewesen zu sein, der seine Beobachtungen über die Art und Weise, wie sie sich der Beute bemächtigt, veröffentlicht hat; späteren Forschern aber verdanken wir ausführlichere Schilderungen, die beste, meiner Ansicht nach, Dursy. Läßt man, so ungefähr drückt er sich aus, einige lebende Eidechsen in den Behälter, in dem sich Schlingnattern befinden, so erkennen dieselben sogleich die ihnen drohende Gefahr und suchen in rasendem Laufen nach allen Richtungen zu entkommen. Die ganze Gesellschaft gerät in die größte Aufregung, und in der ersten Überraschung suchen die Nattern sich eiligst aus dem Staube zu machen. Dabei beißen sie oft so wütend um sich, daß sie untereinander selbst in Händel geraten, ja mitunter gar ihren eigenen Leib erfassen. »Auf diese geräuschvolle Einleitung folgt eine peinliche Pause. Hastig züngelnd und mit erhobenem Kopfe überlegen die Schlangen ihren Angriffsplan, und mit halb geöffnetem Munde sammeln die vor Schreck fest gebannten Eidechsen ihre Kräfte zur verzweifelten Gegenwehr. Plötzlich fährt eine der Schlangen auf ihr Opfer los, streckt den vorher nach hinten und seitwärts gebogenen Hals, und rasch dahingleitend, erfaßt sie mit weit geöffnetem Rachen die fliehende Eidechse. In rasendem Wirbel sich drehend, umschlingt sie mit engen Windungen den Leib der auf den Rücken geworfenen Echse, so daß nur noch deren Kopf und Schweif den dichten Knäuel überragt.
»Nun folgt die schwere Arbeit des Verschlingens. Die Eidechse soll in ihrer ganzen Länge und Dicke hinabgewürgt werden, und zwar mit dem Kopfe voran: das kostet viel Zeit und Mühe. Unsere Natter hat daher auch keine große Eile damit, umzüngelt einstweilen ihr Opfer und wedelt mit dem Schwanze nach Katzenart. Jetzt aber richtet sie sich hoch auf, beschreibt mit dem Halse einen senkrechten Bogen und erfaßt mit weit geöffnetem Rachen den Kopf ihres Opfers. Allmählich lösen sich die Schlingen; es verschwindet der Kopf der Eidechse; langsam folgt ihr Leib; traurig winkt noch zum Abschied ihr Schwanz, und erst nach Verlauf einer halben Stunde oder später ist sie durch den weit ausgedehnten Schlund in den Magen der Natter eingefahren.
»Nicht immer wickelt sich dieses Geschäft so glatt ab; denn auch die bis zum Halse eingeschraubte Eidechse lebt noch und hält sich mit geöffnetem Rachen zur verzweifelten Gegenwehr bereit. Faßt die Natter nicht richtig an, so erwischt die Eidechse den oberen oder unteren Kiefer der Natter, und mit krampfhaft sich schließendem Munde, mit Hilfe der ebenfalls hakenförmig umgebogenen Zähne ist sie imstande, stundenlang den gepackten Teil ihrer Feindin zu behaupten. Umsonst sucht sich die Schlange zu befreien. Beide Tiere haben sich mit krampfhaft geschlossenen Kiefern wie Doggen ineinander verbissen; wütend wickelt die Schlange von ihrem Opfer sich los, zieht sich zurück, doch vergebens. Endlich läßt die Eidechse los, macht sich natürlich sogleich aus dem Staube, und die mitunter blutende Schlange hat das Nachsehen.«
Falls ich diese lebendige Schilderung noch ergänzen soll, habe ich hinzuzufügen, daß die Schlingnatter regelmäßig drei Ringe um ihr Opfer zieht und dieselben so eng schlingt, daß sie, ohne die Haut zu verletzen, einschneiden bis auf die Knochen, und jede Regung des umfaßten Leibes, ja jeden Herzschlag fast unmöglich machen. Bei Blindschleichen, der nächst den Eidechsen am meisten beliebten Beute, legt sie die Ringe weiter auseinander, immer aber so, daß der Kopf des Opfers nach oben gerichtet ist. Eine von Günther zahm gehaltene Natter fraß nur Eidechsen, nie eine Maus oder einen Frosch, obwohl sie nach ihnen wie nach jedem andern Tier biß. Schlegel fand in den Magen von ihm untersuchter Nattern auch Mäuse, und Erber beobachtete sie, während sie solche fraßen; trotzdem darf man annehmen, daß sie, solange sie Eidechsen und Blindschleichen haben, nur von diesen sich ernähren. Dementsprechend muß man Lenz vollständig recht geben, wenn er auch diese Natter als schädlich bezeichnet, da es ja außer allem Zweifel steht, daß die Eidechsen und Blindschleichen, die sie vernichtet, uns nützen.
Wyder bemerkte zuerst, daß die Schlingnatter zu den lebendig gebärenden Schlangen gehört, d. h. ihre Eier so weit austrägt, daß die Jungen sofort nach dem Legen die Schale sprengen und ausschlüpfen. Lenz fand Mitte Mai bei großen Stücken die Eier fünfzehn Millimeter lang und sechs Millimeter dick, schon in der letzten Hälfte des Juni aber über fünfundzwanzig Millimeter lang und etwa zwölf Millimeter breit, dann in ihnen auch weiße, dünn zusammengewundene Junge von sechs Zentimeter Länge mit dicken Köpfen und großen, schwarzen Augen. Ende August oder anfangs September werden die Eier gelegt, und dann kriechen sofort die fünfzehn Zentimeter langen, schreibfederdicken Jungen aus, drei bis dreizehn an der Zahl, suchen sich bei gutem Wetter noch etwas Nahrung zu verschaffen, und verbergen sich später in einem passenden Schlupfwinkel, um sich hier den Unbilden des Winters zu entziehen. »Niedlichere Geschöpfe, als solch ein Natterchen«, ruft Linck aus, »kann es kaum geben! Die Flecken des Rückens ziehen sich in glänzend zierlichen Reihen bis zur nadelfeinen Schwanzspitze, die Farbenzierden des etwas breiten Schädels treten klar und ausfallend hervor, und mit Lust blickt das Auge auf den steten Wechsel von Arabesken, die der Leib des unendlich gelenken Tierchens im Durchgleiten durch den Finger oder durch niederes Pflanzengestrüpp flicht.«
In der Gefangenschaft wird die Schlingnatter in der Regel schon nach wenigen Tagen so zahm, daß sie ihren Pfleger nicht mehr beißt, wenn sie derselbe in die Hand nimmt oder sich in den Busen steckt, um sie zu wärmen; doch gibt es, wie bemerkt, einzelne, die lange trotzen, bevor sie sich entschließen, mit ihrem Pfleger ein freundschaftliches Verhältnis einzugehen. Anfänglich beißen alle, und wenn auch der Druck, den die Kinnladen ausüben können, äußerst schwach ist, dringen die scharfen Zähnchen doch leicht durch die Haut und so tief ein, daß Blut fließt. Diese Bissigkeit verschwindet früher oder später gewiß, und deshalb empfiehlt sich die ebenso schöne wie zierliche und anmutige Jachschlange umsomehr, als sie auch recht gut in Käfigen aushält, falls man auf ihre Lebenserfordernisse die gebührende Rücksicht nimmt.
*
Der mäßig lange, oben zugerundete Leib, von dessen Gesamtlänge der Schwanz ein Fünfteil oder etwas weniger einnimmt, das mäßig große, rundsternige Auge und das seitlich je zwischen zwei Schildern gelegene Nasenloch, die regelmäßige Beschilderung des Kopfes und die entweder ganz glatten, oder nur schwach gekielten, in neunzehn bis siebenundzwanzig Reihen angeordneten Bauchschilder sowie endlich die gleichmäßigen Zähne kennzeichnen die Sippe der Kletternattern ( Coluber), die in Europa durch mehrere Arten vertreten wird.
Asklepios, der Gott der Heilkunde, trägt bekanntlich zum Zeichen seiner Wirksamkeit einen Stab in der Hand, um den sich eine Schlange windet. Welche Art der Ordnung die alten Griechen und Römer gemeint, läßt sich gegenwärtig nicht entscheiden; ziemlich allgemein aber nimmt man an, daß besagte Schlange ein Vertreter dieser Abteilung gewesen und erst durch die Römer weiter verbreitet worden sei. Als unter den Konsuln Fabius und Brutus eine Pest in Rom wütete, wurde sie, wie oben mitgeteilt, von Epidaurus aus herbeigeholt und sodann auf einer Insel der Tiber verehrt, um der Seuche zu steuern, und heutigestags noch soll man ihr Bild in den Gärten eines dem »heiligen« Bartholomäus geweihten Klosters sehen können. Von Rom aus, so nimmt man an, wurde die Schlange allgemach weiter verbreitet, insbesondere in den Bädern von Ems und Schlangenbad angesiedelt. Gewiß ist das eine, daß die Natter, die wir gegenwärtig Äskulapschlange nennen, noch gegenwärtig in solchen Ländern, in denen sie anderweitig nicht vorkommt, in der Nähe von Bädern gefunden wird. So begegnet man ihr in Deutschland bei Schlangenbad und Ems, in Österreich bei Baden, im unteren Tessin und in Wallis, wo sie nach Ansicht Fatios ursprünglich ebenfalls nicht heimisch gewesen sein soll, fast ausschließlich zwischen den Trümmern der Römerbäder. In Deutschland hat man sie allerdings auch in Thüringen und im Harz entdeckt, und Giebel tritt deshalb der Ansicht, daß sie durch die Römer nach Norden verschleppt worden wäre, entgegen; es läßt sich aber doch wohl denken, daß die Schlange im Laufe der Zeit von den Bädern aus freiwillig sich weiter verbreitet hat, oder durch Schlangenliebhaber verschleppt worden und später entkommen ist. Jedenfalls wurde neuerdings der Beweis geliefert, daß sie ohne besondere Schwierigkeiten sich einbürgern läßt. Graf Görtz ließ, wie er Lenz mitteilte, in den Jahren 1853 und 1854 nach und nach vierzig dieser Nattern aus Schlangenbad kommen und gab sie in der Nähe seines Landgutes Richthof, unweit Schlitz, im Großherzogtum Hessen, frei. Sie fanden hier alles, was ihnen das Leben angenehm machen kann, sonnige, warme Lage, alte Bäume mit rissiger Rinde, Gebüsch, fruchtbares Gartenland, felsige, steile Abhänge, durchlöchertes altes Gemäuer, unterirdische Klüfte usw., und vermehrten sich, da sie hier ausdrücklich geschützt wurden, zwar nicht übermäßig, aber doch stetig. Daß auch von hier aus ein Auswandern stattgefunden hat, wurde wiederholt bemerkt; denn man fand einzelne in der Entfernung einer Wegstunde, andere sogar jenseits der Fulda, die sie, weil es in der Nähe an Brücken fehlt, überschwommen haben mußten. Somit scheint mir die zuerst von Heyden ausgesprochene und von vielen anderen Forschern geteilte Ansicht, daß die Römer sie in Deutschland eingebürgert, noch keineswegs widerlegt. Die eigentliche Heimat unserer Schlange ist das südliche Europa, von Spanien an bis zum Westufer des Kaspischen Meeres. Sie kommt im südlichen Frankreich an mehreren Stellen vor, findet sich in der Schweiz außer an den angegebenen Orten in Wallis und im östlichen Waadtlande, bewohnt, einzelne Gegenden wie die lombardische Ebene ausgenommen, ganz Italien, das römische Gebiet, Kalabrien und die beiden großen Inseln Sizilien und Sardinien sogar sehr häufig, verbreitet sich über Südtirol und steigt bis zu eintausendfünfzig Meter über das Meer empor, tritt außerdem in Kärnten und Oberösterreich, seltener in Österreichisch-Schlesien auf, zählt in Galizien wie im südlichen Ungarn und Kroatien unter die häufigeren Schlangen, beschränkt sich hier jedoch nur auf das Waldgebirge, fehlt ebensowenig auf der Balkanhalbinsel und findet sich endlich in mehreren südlichen Gouvernements Rußlands.
Die Äskulapschlange, gelbliche oder Schwalbacher Natter ( Coluber longissimus), ist an dem kleinen, wenig vom Halse abgesetzten, an der Schnauze gerundeten Kopf, dem kräftigen Rumpfe und langen, schlanken Schwänze, sowie an der Bekleidung, die am Kopfe und den Seiten gekielte Schuppen zeigt, leicht erkenntlich. Die Oberseite des Leibes und Kopfes ist gewöhnlich bräunlich graugelb, die Unterseite weißlich; am Hinterkopfe steht jederseits ein gelber Flecken, und auf dem Rücken und an den Seiten gewahrt man kleine, weißliche Tüpfel, die bei einzelnen, unklaren Stücken sehr rein und deutlich sind. Die Färbung ändert übrigens vielfach ab: es gibt sehr lichte und fast schwarze Äskulapschlangen. Die Länge beträgt 1,5 Meter; eine so bedeutende Größe erreichen jedoch nur die in Südeuropa lebenden Schlangen dieser Art.
Alle Beobachter, die die Äskulapschlange im Freien sahen oder in der Gefangenschaft hielten, vereinigten sich zu ihrem Lobe. »Ihre Leibesgestalt und ihre Bewegungen«, meint Linck, »haben etwas ungemein Anmutiges, Gelecktes, Hofmäßiges. Da ist nichts Rauhes, Ruppiges auf der ganzen Hautfläche, nichts Eckiges, Plötzliches in dem Wechsel der Formen zu schauen: alles ist glatt, abgeschliffen, vermittelt.« Das Wesen der Schlange entspricht der äußeren Gestalt: sie ist anziehend in jeder Hinsicht.
In Südeuropa hält sich die Äskulapschlange mit Vorliebe auf felsigen oder doch steinigen, dürftig mit Buschwerk bestandenen Geländen auf. Bei Schlangenbad lebt sie gern an altem Gemäuer, insbesondere an dem verfallener Burgen. In der erwähnten Ansiedlung des Grafen Görtz klettert sie ebenfalls viel in einer durchlöcherten Mauer herum, besteigt ebenso den warmen Dachboden eines niedrigen, baufälligen, von Efeuwein bewachsenen Backhauses und kommt dann und wann auf einen absichtlich für sie aufgeworfenen Haufen der sich zersetzenden Pflanzenteile, in dem auch ihre Brut aufwächst. In manchen Mauerlöchern, mehr noch aber in einer uralten, wahrscheinlich bis zum Boden herab hohlen Eiche, haust sie friedlich mit Hornissen und schlüpft ungefähr drei Meter über der Bodenfläche durch ein Astloch in das Innere, das regelmäßig auch von den Hornissen als Zugang zu ihrem in der Höhlung des Baumes befindlichen Neste benutzt wird. In das Wasser geht sie nicht freiwillig, schwimmt aber, wenn sie gewaltsam in dasselbe gebracht wurde, sehr rasch und geschickt dem Ufer zu. Ihre Bewegungen auf ebenem Boden sind nicht besonders rasch oder sonstwie ausgezeichnet: die Schnelligkeit ihres Laufes steht vielleicht hinter der anderer Nattern sogar zurück; um so vortrefflicher aber versteht sie zu klettern. In dieser Hinsicht übertrifft sie alle übrigen deutschen Schlangen und kommt hierin beinahe den eigentlichen Baumschlangen gleich, die den größten Teil ihres Lebens im Gezweige verbringen. Gewöhnlich sucht sich die Äskulapschlange übrigens an dünnen Baumstämmen, die sie umschlingen kann, emporzuwinden, bis sie die Aste erreicht hat und nun zwischen und auf ihnen weiter ziehen kann. In einem dichten Walde geht sie von Baum zu Baum über und setzt in dieser Weise ihren Weg auf große Strecken hin fort. An einer Wand klettert sie mit fast unbegreiflicher Fertigkeit empor, da ihr jeder, auch der geringste Vorsprung zu einer genügenden Stütze wird, und sie mit wirklicher Kunstfertigkeit jede Unebenheit des Gesteins zu benutzen weiß.
Die Nahrung scheint vorzugsweise in Mäusen zu bestehen; nebenbei stellt sie aber auch Eidechsen nach, und wenn es sich gerade trifft, verschmäht sie keineswegs, einen Vogel wegzunehmen oder ein Nest auszuplündern. Dessenungeachtet mögen ihre Freunde, die sie wegen ihrer Mäusejagd zu den nützlichsten Arten der Ordnung rechnen, recht behalten.
»Unter allen deutschen Schlangen«, sagt Linck, »erzielt die Schwalbacher Natter die spärlichste Nachkommenschaft. Ihre Begattung geht in der üblichen Weise, doch erst spät, vor sich, da sie gegen Frost noch weit empfindlicher ist als irgendeine ihrer heimischen Sippen und ihre Winterherberge selten vor Anfang Juni, also nach Umständen ein bis zwei Monate später als die anderen, verläßt. Sie ist neben ihrer Base, der Ringelnatter, die einzige deutsche Schlange, deren Eier erst eine Nachreife von mehreren Wochen zu überstehen haben, bevor das Junge zum Auskriechen fertig ist. Gewöhnlich legt sie nur etwa fünf Eier, und zwar in Mulm, auch wohl in tiefes, trockenes Moos, und überläßt sie sodann ihrem Schicksale. Die Eier sind länglich, doch weniger stark gebaucht als Taubeneier und gleichen etwa vergrößerten Ameisenpuppen.«
Keine einzige deutsche Schlange wird so oft gefangen als die Äskulapnatter. In Schlangenbad bildet ihre Jagd einen Erwerbszweig ärmerer Leute. Man sucht sie nach ihrem Erwachen aus dem Winterschlafe auf, zähmt sie und belustigt dann mit ihr die Badegäste, verkauft auch ein und das andere Stück an Liebhaber. Nach Beendigung der Badezeit läßt man die Gefangenen wieder frei, da sie im Käfige nur selten Futter zu sich nehmen, wie man in Schlangenbad wenigstens allgemein glaubt. Hiermit stimmen denn auch Lenz und Linck überein. Daß beide Beobachter unrecht haben, obgleich sie nur das Ergebnis ihrer eigenen Erfahrungen mitteilen, geht aus einem Berichte von Erber hervor, der das freiwillige Hungern der Gefangenen als bemerkenswert bezeichnet, da er an zwei Äskulapschlangen, die er längere Zeit im Käfig hielt, beobachtete, daß sie zusammen im Laufe eines Sommers hundertacht Mäuse und zwei Eidechsen verzehrten. Auch eine, die vierzehn Monate lang keine Nahrung zu sich nahm, sich während dieser Zeit aber regelmäßig häutete und trotz dieser Hungerkur nicht sichtlich abmagerte, hatte sich schließlich noch zum Fressen bequemt, lag aber bald darauf tot im Zwinger: »das erste Tier dieser Art, das mir zugrunde ging.« Effeldt ließ die von ihm gefangen gehaltenen Äskulapschlangen, von denen er bisweilen gleichzeitig Dutzende pflegte, versuchsweise monatelang hungern und bot ihnen dann Vogeleier, Eidechsen, Blindschleichen, Kröten, Frösche und andere Lurche, auch Kerbtiere und Würmer verschiedener Art an. Allein keine einzige von ihnen vergriff sich an solchen Tieren. Dagegen gewöhnte der Genannte, der eine außerordentliche Erfahrung und ein bewunderungswürdiges Geschick in der Pflege von Schlangen besaß, sie bald dahin, Mäuse und Vögel zu fressen, und fand, daß sie auffallend viele Nahrung bedürfen. »Wird«, so schreibt er Lenz, »eine lebende Maus oder ein Vogel in den Käfig gesetzt, so gucken alsbald, es mag Tag oder Nacht sein, die Schlangenköpfchen aus den Höhlen hervor; es beginnt eine heftige Jagd, und die glücklichste Jägerin greift die Beute mit den Zähnen, gleichviel an welchem Körperteile, und wickelt sie blitzschnell ein, indem sie ihren Leib in sechs dicht aneinander schließenden Ringen um sie schlingt, so daß sie dem Auge des Zuschauers entschwindet. Ist das umschlungene Tier besonders lebenskräftig und sträubt es sich in ihren Umschlingungen, so kommt es häufig vor, daß die Schlange mit rasender Schnelligkeit im Käfige sich hin- und herrollt, bis die Beute durch Ersticken sicher getötet scheint. Auch nunmehr wird sie von der freßgierigen Natter nicht losgelassen. Diese lüftet nur die Ringe, sucht den Kopf, packt ihn mit den Zähnen und beginnt hierauf das Verschlingen in gewöhnlicher Weise. Es ereignet sich auch nicht gerade selten, daß zwei Äskulapschlangen gleichzeitig dasselbe Jagdwild umfassen, umwickeln und sich im Kampfe um den zu hoffenden Fraß mit solcher Schnelligkeit herumwälzen, daß der Zuschauer gar nicht deutlich sieht, aus was für Teilen das Walzwerk besteht.« Effeldt brachte die von ihm gepflegten Äskulapschlangen dahin, auch tote Säugetiere und Vögelchen, ja zuletzt sogar geschnittenes rohes Pferdefleisch zu fressen.
Im Anfange der Gefangenschaft ist die Äskulapschlange sehr boshaft und beißt mit Wut nach der Hand des Fängers oder nach Mäusen, die in ihren Käfig gebracht werden. »Sie macht dann«, sagt Lenz, »den Kopf äußerst breit, so daß sie ein ganz anderes Aussehen bekommt und der Kopf einem Dreiecke gleicht, zieht den Hals ein und schnellt ihn hierauf äußerst rasch zum Bisse los. Selbst wenn ihre Augen bei bevorstehender Häutung verdüstert sind, zielt sie gut, weit besser als die Kreuzotter. Ehe sie beißt, züngelt sie wie jene schnell; beim Bisse selbst aber ist die Zunge eingezogen. Wenn zwei gerade recht böse sind, beißen sie auch mitunter eine die andere; übrigens vertragen sie sich gegenseitig und mit anderen Kriechtieren in der Gefangenschaft sehr gut. Die Bosheit hält manchmal lange an, bricht auch wieder hervor, wenn die scheinbar gezähmte Natter in ihrer Behaglichkeit gestört oder nach einem längeren Ausfluge wieder in den Käfig zurückgebracht wird; nach einigen Wochen aber wird die Gefangene, wenn man sich viel mit ihr abgibt, so zahm und gutmütig, daß sie sich mit ihrem Pfleger wirklich befreundet, ihn aus freien Stücken und, selbst geneckt, nie mehr zu beißen sucht. Die eine, die Lenz pflegte, hatte sich so an ihn gewöhnt, daß es ihr gar nicht mehr einfiel, nach ihm zu beißen. »Nur wenn ich sie«, erzählt er, »wie dies öfters geschah, mit in ein Wäldchen von Kirschbäumen nahm, wo sie bald an einem Stamme hinauf, dann von Ast zu Ast und dann auch von Baum zu Baum ging, biß sie, wenn ich ihr nachgeklettert war und sie losmachen wollte. Sie fühlte sich dort oben wieder einmal frei, wollte ihre Freiheit behaupten und schlang sich immer wieder fest, wenn ich den Versuch machte, sie loszuwinden. Es blieb mir also nichts übrig, als daß ich jedesmal eine Säge mit hinaufnahm und den ganzen Ast absägte, an dem sie hing; auch ließ sie, wenn ich herunter war, nicht los, und so mußte ich ihn denn jedesmal unter Wasser stecken, worauf sie ablassen mußte, eiligst auf das trockene Ufer schwamm und dort von mir mit Leichtigkeit wieder eingefangen wurde.«
*
Die Sippe der Zornschlangen ( Zamenis) hat folgende Merkmale: Der Leib ist gestreckt, der flache Kopf deutlich von dem Halse geschieden, das rundsternige Auge mäßig groß, das Nasenloch seitlich je zwischen zwei Platten gelegen, die übrige Beschilderung des Kopfes dadurch ausgezeichnet, daß die einzelnen Schilder sich oft in zwei oder mehrere teilen und das Auge zuweilen von abgetrennten Stücken der Oberlippenschilder umgeben wird. Die Schuppen sind entweder glatt oder leicht gekielt, die Bauchschilder gewölbt und seitlich ebenfalls undeutlich gekielt, die Unterschwanzdeckenschilder in zwei Reihen geordnet. Zahlreiche Zähne finden sich in beiden Kiefern und auf dem Gaumen. Unter ersteren ist der letzte gewöhnlich der größte und von den übrigen durch einen kleinen Zwischenraum getrennt.
Die in Europa am häufigsten vorkommende Zornschlange ist die Zorn-, Pfeil- oder gelbgrüne Natter ( Zamenis gemonensis). Sie variiert so sehr, daß man verschiedene Abarten von ihr unterschieden hat. Die Zornnatter scheint höchstens 1,3 Meter zu erreichen, bleibt aber gewöhnlich auch hinter diesen Maßen zurück. Kopf und Nacken sind auf graugelbem, Rücken und Schwanz auf grünlichem Grunde unregelmäßig, die Unterteile auf gelbem Grunde regelmäßiger schwarz in die Quere gebändert; die Fleckenzeichnung geht am Hinterteile des Leibes in Streifen über, die gleichlaufend sich bis zur Schwanzspitze fortziehen. Bei anderen Stücken herrscht auf der Oberseite anstatt Grün ein schönes Grüngelb vor, und die Unterseite sieht dann kanariengelb aus. Bei wieder anderen ist die Oberseite olivenbraun und ungefleckt, bei einer gewissen Spielart fast vollständig schwarz, der Bauch in der Mitte strohgelb, die Unterseite des Schwanzes wie die Seite stahlblau.
Die Zornnatter verbreitet sich von Ungarn an westlich über alle Mittelmeerländer, dringt aber nur in Frankreich über die Alpen vor. Sie ist häufig in Kroatien, Krain, Südkärnten und Südtirol, im südlichen Teile der Schweiz dagegen selten. In Dalmatien findet man sie, laut Erber, häufiger als jede andere Schlange; in der Levante hat man sie ebenfalls beobachtet. Ihren Aufenthalt wählt die Pfeilnatter auf sonnigen, aber nicht dürren Örtlichkeiten bebauter Gegenden, in Gebüschen oder längs der Zäune, auf Straßen, in altem Gemäuer und in Steinhaufen der Ebene wie des Hügellandes.
Die Nahrung besteht, laut Erber, aus Eidechsen und Mäusen, wahrscheinlich aber auch aus anderen Schlangen, da man in der Gefangenschaft beobachtete, daß sie solchen gefährlich wird. Jedenfalls scheint sie Kriechtiere den Mäusen vorzuziehen. Erber und Metaxa lernten sie als Schlangenräuberin kennen. Metaxa hielt eine gelbgrüne Natter mit anderen in einem und demselben Käfige zusammen, mußte aber zu seinem Leidwesen wahrnehmen, daß erstere zwei ihrer Gefährten verzehrte, unter diesen ein Mitglied ihrer eigenen Art. Sie wurde betroffen, als sie das zweite Opfer schon halb verschlungen hatte, selbstverständlich gestört und veranlaßt, die Beute wieder von sich zu speien. Letztere kam lebend und unversehrt wieder hervor; aber auch die erstgefressene Schlange, die man nach Tötung ihrer Räuberin aus deren Magen hervorzog, war erst halb tot. Erber erlebte zu seinem Kummer, daß ihm eine unserer Nattern die seltenere Katzenschlange auffraß, beobachtete aber, daß die mutige Pfeilnatter sich nicht einmal vor giftigen Arten ihrer Ordnung fürchtete, namentlich die Sandviper ohne Bedenken angreift und verzehrt. Nach Effeldts Wahrnehmungen bilden Smaragdeidechsen ihre Lieblingsnahrung.
Von der Trägheit anderer Schlangen besitzt die Pfeilnatter nach Erhards Versicherung, die mit anderen Angaben im Einklange steht, durchaus nichts, ist im Gegenteil beständig lebhaft, verfolgt mit halbaufgerichtetem Leibe laufend und springend ihre Beute, weshalb der Name Pfeilnatter sehr gut gewählt erscheint, besteigt Bäume und schwimmt über Gewässer, nach Versicherung der griechischen Fischer sogar ohne Bedenken über einen Meeresarm. Den Menschen scheut sie durchaus nicht, sondern greift ihn immer zuerst an, und zwar unter heftigem Zischen und Geifern.
Unter den ungiftigen Schlangen Europas gilt sie mit Recht als die bissigste und lebhafteste. Eine Folge des bissigen Wesens der Pfeilnatter ist, daß man sie nicht leicht lebend erhält. Erber bezeichnet sie außerdem als listig und vorsichtig und gibt diese Eigenschaft als einen der Gründe an, weshalb sie nur selten gefangen werden soll, bemerkt auch, daß sie in Gefangenschaft immer scheu bleibt und selbst den Pfleger, an den sie sich gewöhnt zu haben scheint, zwingt, sich ihr mit Vorsicht zu nähern, weil er vor ihren Bissen niemals sicher sei. Zum Fressen bequemt sie sich übrigens bald, läßt auch nach und nach, zum Teil wenigstens, ihr ungestümes Wesen, wird aber eigentlich niemals wirklich zahm und zeigt sich so wärmebedürftig, daß sie bei uns zulande den Winter nur dann überlebt, wenn sie in gut eingerichteten Käfigen alle überhaupt mögliche Pflege genießen kann.
*
Kielrückennattern ( Tropidonotus) nennt man diejenigen Arten, deren Rückenschuppen scharfe Kiele zeigen. Der Kopf dieser Schlangen ist deutlich von dem dünnen Halse abgesetzt, flach gedrückt, durch sein weit gespaltenes Maul, das mäßig oder sehr große rundsternige Auge, die seitlich zwischen zwei Schildern gelegenen Nasenlöcher und die regelmäßige Beschilderung ausgezeichnet; der Leib rundlich, der Schwanz ziemlich lang, ersterer oben mit mittelgroßen und gekielten Schindelschuppen, unten mit weniger als zweihundert Bauchschildern bekleidet. Zahlreiche Zähne stehen in den Kiefern und an dem Gaumen; die vordersten sind stets die kürzesten, die hintersten verlängert, niemals aber gefurcht.
Die allbekannte Ringelnatter ( Tropidonotus natrix), »die Schlange der Schlangen für unser Volk, der Gegenstand seiner alten Sagen und neuen Wundermären, seiner Furcht, seines Hasses, seines Vernichtungseifers«, ist die verbreitetste aller deutschen Nattern. An Länge kann sie bis 1,6 Meter erreichen, bleibt jedoch mindestens bei uns zulande gewöhnlich hinter diesem Maße erheblich zurück, und die Männchen sind außerdem stets kleiner als die Weibchen. Zwei weiße oder gelbe Mondflecke, erstere beim Weibchen, letztere beim Männchen, jederseits hinter den Schläfen, die Krone der Sage und des Märchens, kennzeichnen sie so sicher, daß sie niemals mit andern Schlangen unseres Vaterlandes verwechselt werden kann; außerdem ist sie auf graublauem Grunde mit zwei längs des Rückgrats verlaufenden Reihen dunkler Flecke gezeichnet, weiter unten seitlich weiß gefleckt und auf der Bauchseite schwarz. Die Färbung des Rückens fällt bald mehr ins Blaue, bald ins Grünliche, bald ins Graublaue, sieht zuweilen auch fast schwarz aus und läßt dann die dunklen Flecke beinahe gänzlich verschwinden; im übrigen aber unterscheiden sich die beiden Geschlechter und Alte und Junge sehr wenig voneinander.
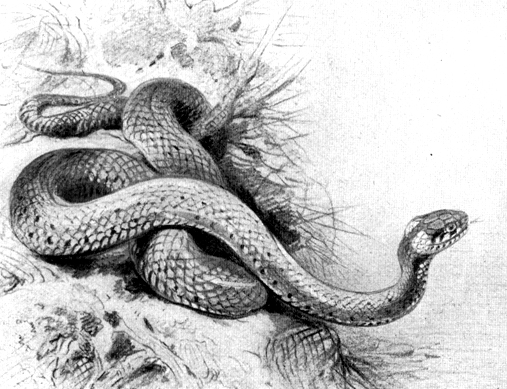
Ringelnatter ( Tropidonotus natrix)
Das Verbreitungsgebiet der Ringelnatter erstreckt sich, mit Ausnahme des äußersten Nordens und der Inseln Irland und Sardinien, über ganz Europa, einen sehr beträchtlichen Teil von Vorderasien und den Nordwesten Afrikas. Sie kommt in ganz Deutschland vor, in sumpfigen und wasserreichen Gegenden besonders häufig, auf trockenem Gelände seltener, ohne jedoch irgendwo zu fehlen, findet sich ebenso häufig in der Schweiz und in den Alpen überhaupt, steigt hier bis zu eintausendsechshundertfünfzig Meter unbedingter Höhe empor, fehlt jenseits der Alpen keinem Teile von Italien, gehört in ganz Frankreich und ebenso auf der Iberischen Halbinsel zu den gewöhnlichsten Schlangen, tritt in den Donautiefländern und auf der Balkanhalbinsel noch weit häufiger auf als bei uns, obwohl meist nur in der streifigen Abart, reicht nach Norden hin bis ins mittlere Schweden, in Rußland bis Finnland, überschreitet den Kaukasus wie den Ural, lebt daher in der Kirgisensteppe ebenso gut wie in Transkaukasien und erreicht erst in Persien und am Nordabhange des Atlas ihre südlichen Grenzen.
Umbuschte Ufer der Sümpfe und Brüche, langsam fließende Bäche und Flüsse, feuchte Wälder, das Binsicht oder Ried und der Sumpf selbst bilden den bevorzugten Aufenthalt der Ringelnatter, denn hier findet sie ihre liebste Nahrung. Doch begegnet man ihr auch auf höheren Bergen, weit von jedem Wasser, und zwar, laut Lenz, keineswegs bloß zufällig, sondern jederzeit im Jahre, so daß man also mit Recht annehmen muß, sie verlasse solchen Aufenthalt nicht. Nicht selten nähert sie sich den menschlichen Wohnungen und schlägt hier in Gehöften unter Mist- und Mullhaufen, die sie sich selbst durchlöchert, oder in den von den Ratten, Mäusen und Maulwürfen gegrabenen Löchern, auch wohl in Kellern und Ställen ihren Wohnsitz auf. Als besonderen Lieblingsaufenthalt von ihr lernte Struck die Ställe der Enten und Hühner kennen und sah namentlich in denen der ersterwähnten Vögel zuweilen alte und junge Nattern zu Dutzenden. Die hier befindliche feuchte, warme Streu behagt ihnen vortrefflich. Sie leben mit den Enten, die selbst kleine Nattern ihres Gestankes halber nicht gern antasten, in bestem Einvernehmen, legen auch ihre Eier gern unter verlassene Nester der Vögel, und zwar der Enten ebensowohl wie der Hühner. Dagegen konnte der genannte Beobachter nirgends in Erfahrung bringen, daß die Ringelnatter ebenso in Kuh- und Schafställen sich einnistet, und dies erklärt sich schon aus dem Grunde, daß die Schlangen durch die Hufe der Haussäugetiere zu sehr gefährdet sein dürften. Minder oft als in Federviehställen, aber immerhin nicht selten, begegnet man Ringelnattern im Innern menschlicher Wohnungen. Lenz erzählt, daß er als Kind in einem Hause gewohnt habe, dessen Untergeschoß über ein Jahr lang von einem Paare großer Ringelnattern bewohnt gewesen sei, denen sich dann und wann auch eine Schar junger zugesellt habe. »Es war verboten, die Ansiedlung zu stören, aber auch schwer, Dienstleute zu bekommen, die in solcher Gesellschaft aushalten wollten. Wir Kinder bewunderten die Tiere vorzugsweise, wenn sie über die Glasscherben eines großen Sammelkastens mit klirrendem Geräusche hinkrochen. Unangenehmer war die Ansiedlung einer großen Ringelnatter unter den Dielen der Wohnstube eines mir nahe verwandten Geistlichen. Ward irgend etwas stark auf die Dielen getreten, so erhob sich aus ihnen alsbald der bewußte Natterngestank. Die Dielen wurden nicht aufgerissen, weil das Haus unter der Verwaltung der Gemeinde stand. Zuletzt zog die Schlange freiwillig aus.« In den russischen Bauernhäusern kriecht die Ringelnatter, laut Fischer, sehr häufig umher, weil sie von den Landleuten gerne gesehen oder doch wenigstens geduldet und durch den Aberglauben, daß der Tod eines solchen Tieres sich räche, beschützt wird. Der Russe glaubt nämlich an ein Natternreich, das einen Natternkönig besitzt. Er trägt eine mit Edelsteinen geschmückte, im Sonnenscheine herrlich glänzende Krone, und ihm sind alle Nattern untertänig. Widerfährt einem seiner Untertanen Böses, so rächt er dies, indem er über den Frevler Krankheit und Mißgeburten, Brand und andere Schäden verhängt. Daß die Ringelnatter mit so gesinnten Bewohnern eines Hauses in ein freundschaftliches Verhältnis tritt, erscheint glaublich.
Die Ringelnatter zählt zu den Kriechtieren, die ihren Winterschlaf soviel wie möglich verkürzen. Im Herbst sieht man sie bei gutem und warmem Wetter noch im November sich sonnen; im Frühjahr kommt sie Ende März oder anfangs April wieder zum Vorschein und erquickt sich nun erst einige Wochen an der strahlenden Wärme, bevor sie ihr Sommerleben oder selbst ihre Jagd beginnt.
Wer die uns anerzogene Schlangenfurcht von sich abgestreift und die Ringelnatter kennengelernt hat, wird sie ohne Beschränkung als ein anmutiges und anziehendes Geschöpf bezeichnen. Sie gehört zu den bewegungsfähigsten und bewegungslustigsten Arten der Familie, reckt sich zwar ebenfalls gern im Sonnenscheine und verweilt stundenlang mit Behagen in dieser Lage, streift aber doch viel und gern umher, jedenfalls weit mehr als die tückisch lauernde, träge Giftschlange, die selbst des Nachts sich in einem möglichst kleinen Umkreise bewegt. An bebuschten Ufern ruhiger Gewässer kann man ihre Lebhaftigkeit und Beweglichkeit leicht beobachten. Vom Ufer aus, an dessen Rande sie sich eben sonnte, gleitet sie geräuschlos ins Wasser, um entweder schwimmend sich zu erlustigen oder ein Bad zu nehmen. Gewöhnlich hält sie sich so nahe der Oberfläche, daß das Köpfchen über dieselbe emporragt, und treibt sich nun mit schlängelnden Seitenbewegungen, beständig züngelnd, vorwärts; manchmal aber schwimmt sie auch zwischen der Oberfläche und dem Grunde des Wassers dahin, Luftblasen aufwerfend und in der Nähe festerer Gegenstände mit der Zunge tastend. Erschreckt und in Furcht gesetzt, flüchtet sie regelmäßig in die Tiefe des Wassers und schwimmt hier entweder auf dem Grunde desselben oder doch dicht über ihm eine gute Strecke fort, bis sie glaubt, sich genügend gesichert zu haben, steigt dann wieder zur Oberfläche auf oder läßt sich auf dem Grunde nieder und verharrt hier längere Zeit; denn sie kann stundenlang unter Wasser verweilen. Wenn sie weitere Strecken schwimmend durchmessen, beispielsweise einen breiten Fluß oder einen See durchschwimmen will, füllt sie ihre weite Lunge soviel als möglich mit Luft an und erleichtert sich dadurch bedeutend, während sie beim Niedertauchen jederzeit die Lunge erst entleert. Sie schwimmt zwar nicht besonders rasch, mindestens nicht so schnell, daß man nicht neben ihr hergehen könnte, aber sehr ausdauernd, und ist imstande, viel weitere Wasserreisen zu unternehmen, als man gewöhnlich annimmt. Unter günstigen Umständen kann man sie im Schwimmen auch weithin verfolgen. So gewahrte Struck einst eine dem Ufer entlang schwimmende Natter und ging achtzehnhundert Schritte neben ihr her, bis sie plötzlich untertauchte und verschwand. Daß sie wirklich über weite Wasserflächen setzt, ist zur Genüge festgestellt worden. Schinz sah sie bei stillem Wetter inmitten des Züricher Sees munter umherschwimmen; englische Forscher trafen sie wiederholt im Meere zwischen Wales und Anglesea an; der dänische Schiffer Irminger fand eine sogar auf offenem Meere in einer Entfernung von dreiundzwanzig Kilometer von der nächsten Küste, der Insel Rügen. Da sie an Bord zu kommen strebte, ließ er ein Boot herab, fing sie, und sandte sie an Eschricht nach Kopenhagen, der sie bestimmte. In Mecklenburg gilt es als allgemein bekannt, und Struck sah es mehrmals mit eigenen Augen, daß im See fischende Ringelnattern zuweilen auf dem Rücken schwimmender Enten sich lagerten, ohne Zweifel, um so Wärme, weiche Unterlage und Ruhe zugleich zu genießen. Die Enten lassen sich solche Reiter gern gefallen. Im Volke ist aus dieser Beobachtung die Meinung entstanden, daß Enten mit Nattern sich paaren, und keiner der treuen Anhänger dieses Aberglaubens würde sich beikommen lassen, jemals ein Entenei zu essen. Der Lauf der Ringelnatter, beziehentlich ihr Kriechen auf dem Boden, geht ziemlich rasch vor sich; doch kann man sie, auch ohne sich bedeutend anzustrengen, in der Ebene jederzeit einholen, während sie sich an Gehängen hernieder zuweilen mit so großer Schnelligkeit in die Tiefe stürzt, daß man sie recht gut mit einem Pfeile vergleichen darf. Auch im Klettern ist sie durchaus nicht ungeschickt, und manchmal besteigt sie ziemlich hohe Bäume. »Ich habe«, sagt Lenz, »wenn ich sie auf einem Baume bemerkte, mir das Vergnügen gemacht, sie recht hoch hinaufzutreiben. Kann sie nicht mehr weiter, so schlängelt sie sich schnell an den Ästen herab oder geht, wenn es möglich ist, auf den nächststehenden Baum über und steigt durch dessen Zweige herunter; sind aber die untersten Aste fern vom Boden, so sucht sie nicht am Stamme hinabzugleiten, sondern plumpt herab und entwischt.«
Man nennt die Ringelnatter ein gutmütiges Tier, weil sie dem Menschen gegenüber nur äußerst selten von ihrem Gebisse Gebrauch macht und mit anderen Schlangen oder Kriechtieren überhaupt oder auch mit Lurchen in der Freiheit und Gefangenschaft sich gut verträgt, mit Lurchen mindestens, solange sie nicht hungrig ist. Gegen Raubsäugetiere und Raubvögel stellt sie sich allerdings zischend zur Wehr, versucht auch wohl zu beißen; wenn es aber angeht, entflieht sie vor solchen ihr gefährlich dünkenden Geschöpfen jedesmal, namentlich vor denjenigen, die sie verfolgen und verzehren. Lenz versichert jedoch ausdrücklich, mitunter sehr unerwartet von Ringelnattern gebissen worden zu sein. So kam es einmal vor, daß sich eine gutmütig fangen ließ und erst etwa sechs Minuten nachher, obgleich sie bis dahin ruhig in der Hand gelegen hatte, plötzlich mit einem kurzen Zischen zubiß und der Hand eine zentimeterlange und millimetertiefe, blutende Wunde beibrachte, die wie mit einem scharfen Messer geschnitten war und natürlich ohne üble Zufälle sehr schnell heilte. Zu ihrer Verteidigung gegen den Menschen bedient sie sich nur ihres überaus stinkenden Unrats; großen Tieren, Raubvögeln und Raben gegenüber zeigt sie sich boshafter, zischt bei deren Annäherung sehr stark und beißt nach ihnen hin, erreicht aber nur selten ihren Feind. »Nie habe ich gesehen«, sagt Lenz, »daß sie solchen Feinden wirklich einen kräftigen Biß beigebracht hätte, obgleich sie imstande ist, einige Tage hintereinander, wenn sie mit dem Feinde eingesperrt wurde, unaufhörlich zusammengeringelt und aufgeblasen dazuliegen und jedesmal bei seiner Annäherung zu beißen. Wird sie von dem Feinde, sei er ein Vogel oder ein Säugetier, wirklich gepackt, so wehrt sie sich nicht, sondern zischt nur stark, sucht sich loszumachen oder umwindet den Feind und läßt Mist und Stinksaft zur Verteidigung los.« Erzählungen, die das Gegenteil der Beobachtungen unseres Lenz zu beweisen scheinen, habe ich übrigens auch vernommen; so berichtete mir ein sonst glaubwürdiger Forstmann, daß eine sehr große Ringelnatter sich um den Hals seines Hundes geschlungen und diesen fast erdrosselt habe: eine Angabe, die mit einer Mitteilung Tschudis sehr wohl übereinstimmt. Gewicht aber kann ich solchen Angaben unmöglich beilegen, und die Regel vermögen sie nicht umzustoßen.
Die bevorzugte Beute der Ringelnatter besteht in Fröschen, und zwar stellt sie hauptsächlich dem gemeinen Taufrosche ( Rana temporaria) eifrig nach. Den Beobachtungen unseres Lenz zufolge, scheint sie den Laubfrosch jedem anderen vorzuziehen, wenigstens hat man frischgefangene, die andere Frösche verschmähten, durch vorgehaltene Laubfrösche öfter zum Fressen gebracht. Zu solcher Leckerei gelangt sie im Freileben aber nur während der Paarungszeit der Laubfrösche, die diese auf den Boden hinabführt, und für gewöhnlich mögen wohl Tau- oder Grasfrösche dasjenige Wild bilden, das sie mit Leichtigkeit und regelmäßig erbeutet. Effeldts Beobachtung, daß die Wassernattern vor dem grünen Wasserfrosch zurückschaudern, bei großem Hunger zwar anbeißen, ihn aber nicht fressen, gilt wenigstens für die Ringelnatter nur bedingungsweise: sie habe ich mehr als einmal Wasserfrösche verschlingen sehen. Wenn sie Frösche nicht zur Genüge hat, vergreift sie sich auch an Landeidechsen und ebenso an Kröten; erstere findet man jedoch selten in ihrem Magen, wahrscheinlich weil sie zu schnell sind, und letztere verzehrt sie wohl nur bei sehr großem Hunger. Dagegen scheint sie Wassermolche recht gern zu fressen und weiß sich aller drei bei uns vorkommenden Arten auf dem Lande wie im Wasser zu bemächtigen. Auch am Feuersalamander vergreift sie sich, wie Sterki mir mitteilt, dann und wann einmal; doch scheint ihr solche Kost wenig zu behagen, weil sie den Salamander manchmal wieder ausspeit und ihm zunächst das Leben schenkt. Nächst den Lurchen jagt sie, wie alle ihre Verwandten, mit besonderer Vorliebe auf kleine Fische, kann deshalb hier und da wirklich Schaden anrichten. Lenz fand in dem Magen der bei der Untersuchung getöteten Ringelnattern, daß sie vorzugsweise Schmerlen, Gründlinge und Schleien gefressen hatten, und beobachtete, daß ihm frischgefangene oft diese Fischarten vor die Füße spieen.
Lebhaft und richtig schildert Linck die Jagd einer Ringelnatter auf ein Stück ihres Lieblingswildes, einen feisten Grasfrosch. »Dieser merkt beizeiten die Absicht der nahenden Natter, in der ihn Natur und je zuweilen die Erinnerung an eine glücklich überstandene ähnliche Gefahr den grimmigen Feind erkennen ließ, und macht sich sofort auf die Beine, wobei er, wie jedes gejagte Wild, um so hastiger ausgreift, je mehr der Abstand zwischen ihm und dem Feinde im Rücken sich verringert. Die Angst raubt ihm die Besinnung, so daß er selten und nur in kleinen Absätzen hüpft (obgleich ihm aus den gewaltigen Sätzen, die er sonst wohl zu vollführen imstande ist, noch am ersten Rettung erblühen könnte), vielmehr nur mit verdoppelter Eile und wiederholtem Purzeln durch Laufen zu entkommen sucht. Höchst seltsam klingt dabei das verzweiflungsvolle Wehegeschrei des Geängsteten, das mit den Lauten, die wir sonst von den Fröschen zu hören bekommen, gar keine Ähnlichkeit hat und dem Nichtkundigen von jedem andern Geschöpfe eher als von einem Frosche herzurühren scheint: fast wie ein wimmerndes, gezogenes Schafsblöken, aber gedehnter, und wahrhaft mitleiderregend dringt es in die Ohren.« Eine derartige Verfolgung, bei der die Schlange gegen alles andere blind zu sein scheint, währt selten lange Zeit; das Wild wird vielmehr in der Regel schon nach Verlauf einer Minute ergriffen, gepackt und dann verschlungen.
Die Art und Weise, wie die Ringelnatter ihren Raub verschlingt, widert den Beschauer aus dem Grunde besonders an, weil sie sich nicht damit aufhält, ihr Opfer erst zu töten, sondern dasselbe noch lebend im Innern ihres Magens begräbt. Gewöhnlich sucht sie allerdings den Frosch beim Kopfe zu packen; wenn ihr dies aber nicht gelingt, greift sie zu, wie es eben gehen will, faßt beispielsweise beide Hinterbeine und zieht sie langsam in den Schlund hinab, wobei der Frosch selbstverständlich gewaltig zappelt und jämmerlich quakst, solange er das Maul noch öffnen kann. Es verursacht der Schlange nicht geringe Mühe, das bewegliche Wild zu fesseln; demungeachtet gelingt es letzterem äußerst selten, sich von seiner unerbittlichen Feindin zu befreien; denn die Schlange folgt ihm, falls sie sich unbeobachtet sieht, sofort nach und bemächtigt sich seiner von neuem. Kleine Frösche werden weit leichter verschluckt als größere, bei denen die Arbeit oft mehrere Stunden dauert und die Ringelnatter sehr zu ermatten scheint, während sie von jenen bei regem Hunger oft ein halbes Dutzend nacheinander ergreift und hinabwürgt. Bei großem Hunger frißt sie kurz nacheinander hundert Kaulquappen oder fünfzig Fröschchen, die ihre Verwandlung eben beendet haben. Erschreckt und in Angst gesetzt, speit sie, wie andere Schlangen auch, die aufgenommene Nahrung regelmäßig wieder aus, wobei sie, wenn das aufgenommene Tier sehr groß ist, den Rachen entsetzlich aufsperren muß. Kleine Wirbeltiere der beiden ersten Klassen nimmt sie wohl nur in seltenen Ausnahmsfällen zu sich; an Gefangenen wenigstens hat man beobachtet, daß sie Mäuse oder Vögel und deren Eier regelmäßig verschmähen. Den Dotter geöffneter Eier dagegen lecken sie, wie Struck und andere beobachtet haben, anscheinend mit Behagen auf.
Lange Zeit war man der Meinung, daß die Ringelnatter nicht trinke. Lenz hat niemals Wasser in dem Magen der von ihm untersuchten Nattern gefunden, obgleich er sie bei heißem Wetter lange ohne Wasser ließ, sie in dieses legte und bald darauf schlachtete. Trotzdem darf das Gegenteil nicht bezweifelt werden: ein Freund unsers eben genannten Forschers beobachtete, daß eine seiner Gefangenen, nachdem sie im Hochsommer vierzehn Tage lang gedurstet, ein mit Wasser gefülltes Näpfchen rein austrank, und auch andere Schlangenfreunde haben dasselbe erfahren. Dursy wundert sich über jeden Beobachter, der das Trinken der Ringelnattern nicht gesehen hat und deshalb das Gegenteil behauptet. An heißen Tagen kann man wahrnehmen, daß sie die auf den Boden herabgefallenen Tropfen begierig aufsaugen, und ebenso glückt es sehr häufig, sie in ähnlicher Weise wie die Jachschlange aus einer mit Wasser gefüllten Schüssel trinken zu sehen. Von mir gepflegte und mit andern Schlangen in einem und demselben Käfige gehaltene Ringelnattern tranken ebenso regelmäßig wie ihre Verwandten. Außer Wasser nehmen wenigstens einzelne auch Milch zu sich, mindestens dann, wenn sie nichts anderes haben können, und wenn sie sich einmal an solche Flüssigkeit gewöhnt haben, mag es geschehen, daß sie solche vielleicht sogar gern trinken. Auf diese Wahrnehmung dürfte die allbekannte Sage sich begründen, daß die Ringelnatter am Euter der Kühe und anderer milchenden Haustiere sauge, um sich einen für ihr Leben erforderlichen Genuß zu verschaffen. Wenn nun auch nach manchen Beobachtungen festgestellt zu sein scheint, daß unsere Schlange Milch nicht gänzlich verschmäht, so darf doch anderseits von einem Melken der Kühe oder Ziegen nicht die Rede sein. Zu einem so kräftigen Saugen wie das Melken es erfordern würde, ist keine einzige Schlange befähigt. Schon Dumeril spricht, in Würdigung der Einrichtung des Mauls und der Zähne, den Schlangen und der Ringelnatter insbesondere eine solche Fähigkeit unbedingt ab, und jeder Forscher, der den Bau und das Wesen der Schlange kennt, muß ihm hierin beistimmen.
Wie alle Schlangen ist die Ringelnatter imstande, monatelang ohne Nahrung auszuhalten. Hierüber hat seinerzeit Herklotz eine Beobachtung veröffentlicht, die wohl verdient, auch in weiteren Kreisen bekannt zu werden. »Im Jahre 1864 am neunzehnten Juni fing ich auf einem Jagdausfluge in die Sümpfe des Neusiedler Sees eine Ringelnatter und beherbergte dieselbe seit jener Zeit in einem hierzu hergerichteten Glasbehälter. Obgleich ich ihr entsprechende Nahrung bot, verschmähte sie doch hartnäckig Futter und Wasser. Dieses Verhalten währte fort bis Mitte September, in welchem Monate sie ein einziges Mal Wasser trank, Futter aber noch verschmähte. Die Häutung erfolgte vollständig. Ich wurde begierig, zu erfahren, wie lange wohl das Tier werde hungern können, und verweigerte deshalb von jetzt an Futter und Wasser. Der Käfig stand in meinem Zimmer; ich bewohnte dasselbe allein, und es ist außer allem Zweifel, daß niemand die Schlange fütterte. Der Winter kam heran, die Schlange aber, obwohl sie versuchte, unter den Steinen und der moosbedeckten Erde sich ein Lager zu bereiten, fiel nicht in Winterschlaf, weil die Wärme nicht unter acht bis zehn Grad Réaumur sank. Sie war zwar den Winter über nicht sehr lebhaft und lag zuweilen sogar längere Zeit dem Anscheine nach leblos da; es verriet mir aber doch die pfeilschnelle Bewegung der Zunge, wenn ich den Käfig öffnete, daß sie noch lebe und nicht schlafe. Nur ein einziges Mal glaubte ich, sie sei gestorben, und gab Auftrag, den Leichnam aus dem Käfige zu entfernen; sie belebte sich jedoch in der warmen Hand meines Sohnes wieder, fing an, Schlingen zu bilden, nahm ein wenig ihr gereichtes Wasser, und setzte hierauf ihre unfreiwillige Hungerkur bis zum sechsundzwanzigsten April fort. An diesem Tage war sie wieder ganz ermattet, und ich fürchtete ernstlich für ihr Leben. Da ich sie nun des ihr von mir bereiteten Schicksals halber nicht opfern wollte, brachte ich ihr zwei Wassersalamander in ihren Käfig. Sie bemerkte augenblicklich den Fraß, rollte sich auf und machte mehrere Umgänge in ihrem Gefängnisse, blieb auf einmal liegen, hob das Köpfchen und strich sich mit demselben bald auf der rechten, bald auf der linken Seite an einem Steine, wobei sie wechselweise bald die eine, bald die andere Seite des Rachens und endlich denselben ganz öffnete und dehnte. Mit außerordentlicher Schnelligkeit stürzte sie sich hierauf auf einen Wassersalamander, verschlang denselben mit vorzüglicher Freßlust, und bald war auch der zweite in ihrem Rachen verschwunden. Seit jener Zeit hat sie nun öfter gefressen, ist ganz gesund und häutete sich vollständig am elften Mai. Trotzdem sie seit der Zeit ihrer Gefangenschaft abgemagert ist, so verrät doch kein einziges Zeichen irgendeinen krankhaften Zustand, und ihr ganzes Verhalten entspricht dem anderer Stücke, die ich ebenfalls in der Gefangenschaft hielt, ohne sie jedoch eine Hungerkur durchmachen zu lassen. Selten dürfte es sein, daß ein Tier ohne Nahrung und ohne Winterschlaf dreihundertelf Tage zubrachte, und deshalb glaubte ich diesen Fall mitteilen zu sollen.«
Obgleich die Ringelnatter in guten Jahren, wie schon bemerkt, gegen Ende März oder Anfang April zum Vorschein kommt und bald darauf zum erstenmal sich häutet, also gewissermaßen ihr Hochzeitskleid anlegt, schreitet sie doch selten vor Ende Mai oder Anfang Juni zur Paarung. Um diese Zeit sieht man, gewöhnlich in den Morgenstunden, Männchen und Weibchen mehrfach umschlungen in innigster Vereinigung liegen, wo immer möglich auf einer den Strahlen der Morgensonne ausgesetzten Stelle. Ihre Brunst beschäftigt sie so vollständig, daß man sich ihnen bis auf wenige Schritte nähern kann, bevor sie unter lautem Zischen, in der oben angegebenen Weise sich gegenseitig zerrend und hindernd, zu entfliehen suchen. Auf die Austragung der Eier im Mutterleibe scheint die Witterung nicht ohne Einfluß zu sein, da man frischgelegte Eier zu verschiedenen Jahreszeiten findet, die ersten Ende Juli, die letzten im August und September. Bei gefangengehaltenen Ringelnattern kann sich das Legen so verschieben, daß die Jungen bereits im Mutterleibe sich ausbilden und unmittelbar oder bald, nachdem sie zur Welt gekommen, auskriechen. Jüngere Weibchen legen deren fünfzehn bis zwanzig, ältere fünfundzwanzig bis sechsunddreißig. In Gestalt und Größe ähneln die Eier denen der Haustaube, unterscheiden sich aber, wie alle Kriechtiereier, durch ihre weiche, biegsame, also wenig kalkhaltige Schale und im Innern durch die geringe Menge von Eiweiß, das nur eine dünne Schicht um den Dotter bildet. An der Luft trocknen sie allmählich ein und verkümmern; im Wasser gehen sie ebenfalls zugrunde, und das eine oder das andere beeinträchtigt die Vermehrung dieser Schlangenart, die eine außerordentliche sein müßte, wenn alle Keime zur Entwicklung kämen. Gewöhnlich wählt die Alte mit vielem Geschick die günstigsten Stellen: Haufen von Mist, Laub, Sägespänen, lockere Erde, Mulm, feuchtes Moos und dergleichen, die der Wärme ausgesetzt sind und doch eine mäßige Feuchtigkeit längere Zeit bewahren. Sie sucht hier eine Vertiefung, bringt den After über dieselbe, biegt den Schwanz in die Höhe und läßt nun die Eier in die Mulde herabfallen. Ein Ei folgt beim Legen unmittelbar auf das andere und hängt mit dem vorigen durch eine gallertartige Masse zusammen, so daß das ganze Gelege perlschnurartig verbunden ist. Diese Eier sind es, die vom Volke als Hahneneier bezeichnet werden und in den Augen der Abergläubischen wunderbare Kräfte besitzen sollen. Drei Wochen nach dem Legen ist ihre Nachreife vollendet; das nunmehr vollständig entwickelte Junge bohrt ein Loch durch die Schale und beginnt hierauf das Leben der Eltern, falls nicht frühzeitig eintretende Kälte es zwingt, schon jetzt Schutz gegen die Witterung zu suchen, d. h. in die zur Winterherberge dienenden Löcher zu kriechen. Beim Ausschlüpfen haben die jungen Ringelnattern eine Länge von etwa fünfzehn Zentimeter; ihre Zähnchen sind aber bereits vorhanden, sie selbst also zu einer selbständigen Lebensweise genügend ausgerüstet. Verwehrt ihnen die Witterung, zu jagen und Nahrung zu erbeuten, so schützt sie das vom Ei mitgebrachte Fett und ihre angeborene Zählebigkeit bis zum nächsten Frühjahre vor dem Verhungern. Die Mutter bekümmert sich nach dem Legen nicht mehr um die Brut.
In Gefangenschaft hält sich die Ringelnatter leicht, weil sie ohne weiteres an das Fressen geht. Auch eine frischgefangene läßt den ihr angebotenen lebenden Frosch nicht unbeachtet vor sich hin- und herlaufen, sondern macht, falls sie Hunger hat, Jagd auf ihn, fängt, packt und verzehrt ihn, befindet sich dabei, wenn man auch für Wasser zum Trinken und Baden sorgt und ihren Raum gebührend herrichtet, sehr wohl im Käfige. Anfänglich bedient sie sich ihres Verteidigungsmittels in lästiger Weise, indem sie ihre Stinkdrüsen öfter entleert als lieb; nach und nach aber gewöhnt sie sich solche Unart ab und kann im Laufe der Zeit wirklich zahm werden. Sterki schreibt mir, daß er einzelne gepflegt habe, die sich so wenig nach ihrer Freiheit sehnten, daß er sie ins Freie tragen und stundenlang im Grase sich selbst überlassen konnte, ohne daß sie zu entfliehen versuchten, und ich selbst habe als Student einzelne besessen, die mir, wenn ich ihnen Nahrung vorhielt, durch das ganze Zimmer nachfolgten. Da die Ringelnatter nur in äußerst seltenen Fällen beißt, darf man sie unbesorgt auch tierfreundlichen Kindern zum Spielzeuge geben.
Die Würfelnatter ( Tropidonotus tessellatus) steht hinsichtlich ihrer Größe und Gestalt der Ringelnatter nahe, unterscheidet sich aber, laut Strauch, nicht bloß durch die Anzahl der Oberlippen- und Voraugenschilder, sondern auch durch die Form ihres Kopfes und die Zeichnung von ihr. Die Anzahl der Oberlippenschilder beträgt durchschnittlich acht, in seltenen Fällen sieben oder neun; die Anzahl der Voraugenschilder schwankt zwischen zwei und drei. Der Kopf ist schmaler und gestreckter, an den Seiten weniger steil abfallend als bei der Ringelnatter, so daß die Augen wie auch die Nasenlöcher eine schräge Lage einnehmen und nicht wie bei jener, einfach nach außen, sondern zugleich auch etwas nach oben gerichtet sind. Ein helleres oder dunkleres Olivengrau, oft mit einem Stiche ins Gelblichgraue, bildet die Grundfärbung. Der Kopf erscheint einfarbig, nur die gelblichen Oberlippenschilder sind fast ausnahmslos bald breiter, bald schmäler schwarz gerandet. Fünf Längsreihen schwarzer, meist viereckiger, selten rundlicher Flecke zeichnen den Rumpf und wechseln so miteinander ab, daß sie sich schachbrettartig anordnen. Die Flecke können hinsichtlich ihrer Form und beziehentlich ihrer Größe vielfach abändern, selbst bis auf geringe schwarze Striche am Ende der Schuppen gänzlich verschwinden und ebenso, anstatt gleichmäßig schwarz zu erscheinen, von hellen, olivengrauen, den Schuppenkielen entsprechenden Linien durchsetzt erscheinen. An manchen Stücken finden sich gleich hinter dem Kopfe zwei schräge, unter spitzigem, nach vorn gerichtetem Winkel zusammenstoßende, schmale, schwarze, mehr oder weniger deutliche Binden, bei anderen, zumal westeuropäischen, an den Seiten noch gelbliche Punkte, die die Ränder einzelner Schuppen einnehmen und manchmal Querreihen bilden. Die Unterseite, die auf gelblichem Grunde schwarz gefleckt ist, zeigt ebenfalls mitunter eine schachbrettartige Anordnung, die aber meist unregelmäßig zu sein pflegt.
Die Vipernatter ( Tropidonotus viperinus) unterscheidet sich von der vorhergehenden wie von der Ringelnatter durch ihren kurzen, gedrungenen Leib und den dünnen, auffallend rasch abfallenden Schwanz. Ihre Länge beträgt sechzig Zentimeter, selten darüber. Die Färbung der Oberseite ist ein mehr oder weniger ins Gelbliche spielendes Dunkelgrau, von dem sich die Zeichnung lebhaft abhebt. Letztere beginnt mit zwei dunklen, verschoben viereckigen Flecken am Kopfe, setzt sich als Zickzackband über den ganzen Rücken fort, bei manchen Stücken auf der Rückenmitte, bei allen auf der Schwanzspitze in einzelne Flecken sich auflösend und hier rasch sich verjüngend; zu beiden Seiten dieser Zeichnung, die der Vipernatter eine täuschende Ähnlichkeit mit der Kreuzotter und Viper verleiht, verlaufen in annähernd gleichem Abstande runde Augenflecke von dunkler Färbung, die einen weißen oder gelblichweißen Hof einschließen, zuweilen auch sich miteinander verschmelzen und dann der Zahl 8 ähnlich werden. Die Unterseite ist gelblich, nach der Bauchmitte zu dunkelgelb, weiter nach unten abwechselnd rotgelb gefleckt und schwarz gewürfelt, der Unterkiefer weiß.
Über das Wohngebiet der Würfelnatter sind erst in neuerer Zeit genügende Beobachtungen gesammelt worden. Sie zählt ebenfalls zu den weitverbreiteten Schlangen und begleitet, wie Strauch sagt, die Ringelnatter in einem großen Teile ihres Verbreitungsgebietes, ist aber mehr auf die südlichen Länder beschränkt und dringt nordwärts nicht über Mitteleuropa hinaus, kommt hier sogar nur stellenweise und im ganzen nicht häufig vor. Die Vipernatter teilt mit ihr im Südwesten Europas denselben Aufenthalt, zählt in Italien, Südfrankreich und Spanien zu den häufigen Schlangen und scheint auch im Norden Afrikas weit verbreitet zu sein.
Eine Schilderung der Lebensweise beider Schlangen stößt noch immer auf Schwierigkeiten, einesteils, weil eingehende Beobachtungen mangeln und dann, weil man beide vielfach miteinander verwechselt hat. An der Lahn findet man die Würfelnatter, laut Vogelsberger, im Frühjahre oft paarweise unter Steinen, im Sommer viel im Wasser und auch hier noch unter Steinen gelagert, im Spätherbste und Vorfrühling dagegen mehr im Gebirge, wohin sie sich zurückzieht, und wo man sie an sonnigen Tagen auf moosigen Plätzen liegen sehen kann; an der Nahe hat sie Geisenheyner hier und da, besonders häufig aber in Kreuznach selbst, gesehen. Hier breitet sich dem Kurgarten gegenüber der Fluß aus, und es treten dann bei niedrigem Wasserstande kleine Inseln hervor, während am linken Ufer noch Tümpel stehenden Wassers übrig bleiben. Dieser Teil des Flusses bietet die beste Gelegenheit, unsere Schlange zu beobachten. In ihnen sieht man sie meist auf den Steinen unter der Oberfläche des Wassers liegen, und von hier aus tritt sie Streifzüge nach dem nahen Gebirge an. Wie häufig sie sein muß, geht daraus hervor, daß Geisenheyner an einem Morgen fünf Stück mit zerschlagenen Köpfen finden konnte. In Dalmatien lebt sie, nach Erbers Beobachtungen, hauptsächlich am Ufer des Meeres, weil sie auch in salzigem Wasser ihrer Fischjagd obliegt. Nach Vogelsberger werden die Eier am feuchten Ufer abgelegt; Geisenheyner erhielt ihrer sieben von der Größe der Ringelnattereier, die aber nicht, wie bei dieser, perlschnurartig aneinander gereiht, sondern zu einem Klumpen zusammengebacken und im Miste gefunden worden waren.
Über die Vipernatter berichtet zuerst Metaxa. Die Schlange heißt in der Umgegend von Rom »Kuhsauger«, weil man sie dort ebenso verleumdet wie bei uns die Ringelnatter. Sie führt ungefähr dieselbe Lebensweise und hat dieselben Sitten und Gewohnheiten wie diese, ist wenig bissig und läßt sich leicht bis zu einem gewissen Grade zähmen, obwohl sie sich im Anfange etwas ungebärdig benimmt. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Haus- und Feldmäusen, Fröschen und Kröten.
Diese dürftigen Angaben werden durch die gedachten Beobachtungen meines Bruders wesentlich ergänzt. »Beide Nattern«, sagt er, »und noch zwei Verwandte, möglicherweise Spielarten derselben, leben in der Nähe des Schlosses Eskorial an großen Teichen und bewohnen hier die zerklüfteten Steine oder die Mauerritzen der künstlich erbauten Inseln und Dämme. An einem der größeren Gewässer haben sich mehrere Hunderte von ihnen angesiedelt; auf einem einzigen meiner Rundgänge um die ungefähr zehn Meter im Geviert haltende Insel, die ich zum Anstande auf Enten zu benutzen pflege, konnte ich einige sechzig Stück zählen, die sich vor mir in ihre Wohnungen flüchteten oder ins Wasser stürzten. Beide Arten stellen nur nebenbei den Fröschen, hauptsächlich aber den Fischen nach, und richten unter letzteren erhebliche Niederlagen an. Um die Fische zu fangen, durchziehen sie den Teich in allen Richtungen, zwischen dreißig Zentimeter und einem Meter unter der Oberfläche sich hinschlängelnd und von Zeit zu Zeit ihr Köpfchen über das Wasser erhebend, machen also wirklich Jagd auf ihr Wild und verfolgen es längere Zeit. Eine andere, von mir oft beobachtete Art ihres Fischfanges ist die, daß sie sich entweder platt auf die Steine unter Wasser legen oder sich schräg in letzterem aufstellen, wobei der Kopf zehn Zentimeter und darüber unterhalb des Wasserspiegels steht und der Schwanz zuweilen den Grund berührt, der Leib aber in Windungen gehalten wird. Aus dieser Stellung schießen sie pfeilschnell vor, wenn Fischchen vorüberziehen, und erhaschen so fast regelmäßig die einmal ins Auge gefaßte Beute. Gewöhnlich packen sie den Fisch am Bauche, heben ihn über den Wasserspiegel empor und schwimmen nun dem Lande oder der Insel zu, in der Absicht, das Opfer hier zu verzehren. Von meinem Anstande aus habe ich oft mehrere zu gleicher Zeit auf mich zuschwimmen sehen; alle aber hatten das Fischchen quer am silberglänzenden Bauche gepackt und hielten es außer dem Bereiche des Wassers. Als ich das erstemal eine Schlange mit ihrer Beute herankommen sah, wußte ich wirklich nicht, was für ein Tier sich mir näherte; denn ich sah nur einen breiten, glänzenden Gegenstand rasch im Wasser sich fortbewegen, und erst das Jagdfernrohr gab mir Aufschluß. Gar nicht selten sah ich in Engpässen und belebten Schwimmstraßen der Fische sechs bis acht Schlangen, Würfel- und Vipernattern friedlich nebeneinander, im Wasser stehen, um die Fische zu erwarten, während andere ruhig auf den am Ufer unterhalb des Wasserspiegels befindlichen Steinen lagerten. Daß die beiden Arten im Notfalle auch Frösche fangen, unterliegt keinem Zweifel: erst gestern griff ich eine, die vor meinen Augen einen Frosch gepackt und verschlungen hatte; jedenfalls aber bilden Fische, hier wenigstens, die Hauptnahrung der Viper- und Würfelnattern, und die eine wie die andere muß demgemäß unter die unbedingt schädlichen Tiere gezählt werden.« Nebenbei fressen auch diese Schlangen, wenigstens die Vipernatter, Kerbtiere.
Nach Erbers Beobachtungen bekundet die Würfelnatter eine so ausgeprägte Neugier, daß sie infolgedessen trotz ihrer außerordentlichen Gewandtheit leicht gefangen werden kann. Selbst im Käfige noch sucht sie jede Störung zu erforschen, und kriecht ohne Furcht auf die ihr vorgehaltene Hand. Ältere Stücke, die Geisenheyner gefangen hielt, zischten sehr stark, wenn sie in die Behälter gesetzt wurden, und begannen sodann unter beständigem Zischen eine Reihe von verzweifelten Versuchen, um sich zu befreien, gaben dieselben stets bald wieder auf, aber nur, um sie gegen Abend von neuem aufzunehmen. Wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann, gewöhnen auch sie sich bald an die Gefangenschaft, und wenn man ihnen ihr Lieblingsfutter, Fische, in genügender Menge bietet, scheinen sie sich zuletzt mit dem Verluste ihrer Freiheit gänzlich auszusöhnen. Ich habe viele von ihnen gepflegt und über ein Jahr lang gehalten, kann also der Angabe anderer Beobachter, daß Würfel- und Vipernattern hinfällig seien, in keiner Weise beistimmen.
*
Mit dem Namen Nachtbaumschlangen ( Dipsadidae) bezeichnen wir eine besondere Familie der Ordnung, Schlangen von mittlerer Größe, d. h. bis etwa zwei Meter Länge, mit mäßig langem, seitlich sehr zusammengedrücktem Leibe, kurzem, hinten meist stark verbreitertem, also fast dreieckigem, kurz- und rundschnauzigem, deutlich vom Halse abgesetztem Kopfe, weit vorstehenden, großen, glotzenden Augen, deren Stern senkrecht geschlitzt ist, seitlich gelegenen Nasenlöchern, weit gespaltenem Maule und im hohen Grade ausdehnbarem Unterkiefer, sehr dünnem Halse und bis auf Fadenstärke sich verdünnendem, hartspitzigem Schwänze, regelmäßigen Kopfschildern und durchschnittlich kleinen, längs des Rückgrates jedoch zuweilen merklich vergrößerten Schuppen sowie endlich kräftig entwickelten Zähnen, unter denen die hintersten gefurcht, die vorderen aber zu Fangzähnen entwickelt zu sein pflegen.
Der Verbreitungskreis der Nachtbaumschlangen erstreckt sich über beide Erdhälften. Sie treten fast ebenso zahlreich im indischen wie im südamerikanischen, spärlicher im äthiopischen und nur vereinzelt im australischen und nördlich altweltlichen Gebiete auf, gehören also ebenfalls größtenteils den Gleicherländern an. Alle bekannten Arten leben auf Bäumen und kommen nur ausnahmsweise zum Boden herab. Kriechtiere, namentlich Eidechsen und Baumfrösche, scheinen ihre bevorzugte Nahrung zu bilden; einige jagen ausschließlich auf Vögel, andere ebenso auf Säugetiere: einzelne mögen auch Kerbtieren nachstellen. Daß sie Nester plündern, konnte durch Günther, der das wohlerhaltene Ei eines Papageies aus dem Magen einer Nachtbaumschlange nahm, unwiderleglich bewiesen werden. Nach Wucherers Erfahrungen verdienen alle brasilianischen Nachtbaumschlangen ihren Namen. Während des Tages ziehen sie sich in dunkle, sie verbergende Stellen zurück; des Nachts sieht man sie im Freien, nicht selten auch in unmittelbarer Nähe oder selbst auf den Strohdächern der Häuser.
Die europäische Art der Familie ist von Fleischmann zum Vertreter der Trugnattern ( Tarbophis) erhoben worden. Die Katzenschlange ( Tarbophis vivax), an dem langen Zügelschilde und dem schlitzförmigen, senkrechten Augensterne unter allen europäischen Schlangen leicht kenntlich, ist auf schmutzig bräunlichgelbem, grau erscheinendem Grunde mit äußerst kleinen schwarzen Pünktchen, auf den Kopfschildern mit kastanienbraunen Flecken, im Nacken mit einem großen, schwarz- oder rotbraunen und auf dem Rücken mit ähnlich gefärbten, in Reihen stehenden Flecken gezeichnet; eine dunkle Binde verläuft vom Auge zum Mundwinkel, eine Reihe kleiner Flecke längs jeder Seite des Leibes; die unteren Teile sehen weißgelb aus. Die Länge beträgt gegen einen Meter.
Soviel bis jetzt bekannt, erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der Katzenschlange von Istrien bis zur Halbinsel Apscheron und vom Nordrande Afrikas bis zum fünfundzwanzigsten Grade nördlicher Breite. Man hat sie erhalten aus Istrien, Dalmatien, Albanien, der Türkei und Griechenland, ebenso aber auch aus Ägypten, Palästina, Kleinasien, den Gebirgsländern am Schwarzen Meere und von hier aus bis zum Kaspischen Meere. Felswände, mit Gestein bedeckte Gehänge, sonnige Halden und alte Gemäuer bilden ihren Aufenthalt; sie scheut aber, nach Fleischmann, ebensowohl bedeutende Hitze als empfindliche Kälte, erscheint daher in den heißen Monaten nur in den Morgen- und Abendstunden außerhalb ihres Schlupfwinkels. Ihre Bewegungen sind lebhafter als die der Vipern, jedoch langsamer und träger als die der Nattern. Fleischmann sagt, daß sie außer Eidechsen auch kleinen Säugetieren nachstellt; Erber erfuhr, daß sie sich ausschließlich an erstere hält; Dumeril fand in dem Magen einer von ihm untersuchten Katzenschlange einen halb verdauten Geko.
Wegen ihrer Bissigkeit wird sie von den Landeseingeborenen oft mit der Viper verwechselt, für sehr giftig gehalten und so eifrig verfolgt, daß sie gegenwärtig in Dalmatien schon ziemlich selten geworden ist. In der Gefangenschaft gewöhnt sie sich bald an ihren Pfleger, geht ohne zu trotzen ans Futter und hält deshalb bei geeigneter Pflege mehrere Jahre aus. In ihrem Betragen hat sie, wie Effeldt mir mitteilte, viele Ähnlichkeit mit der Schlingnatter. Sie klettert außerordentlich fertig und hält sich an den Zweigen, wenn sie sich einmal umschlungen hat, so fest, daß man sie kaum losmachen kann, mag man sie auch reizen und erzürnen. Ihre Beute tötet auch sie durch Umschlingung. Erber beobachtete, daß seine Gefangenen in Winterschlaf fielen, eine Tatsache, die deshalb erwähnt zu werden verdient, weil Cantraine noch im Dezember eine dieser Schlangen zwischen den Trümmern eines verfallenen Schlosses in Dalmatien umherlaufen sah.
Dumeril, der der Erforschung der Schlangen sein ganzes Leben gewidmet, ergriff auf einem Spaziergange eine Kreuzotter, in der Meinung, die Vipernatter vor sich zu sehen, wurde gebissen und schwebte mehrere Tage in Lebensgefahr. Diese Tatsache kann nicht oft genug wiederholt werden, weil sie schlagend beweist, daß die äußerlich wahrnehmbaren Unterschiede zwischen den giftlosen und den giftigen Schlangen höchst geringfügig sein können und in vielen Fällen tatsächlich sind. Es ist unmöglich, durch äußerliche Betrachtung jede Giftschlange unbedingt als solche zu erkennen. Dies gilt allerdings nicht für alle Arten oder Familien, aber gerade die Kreuzotter, die das geübte Forscherauge eines Dumeril täuschte, zählt zu letzteren.
In einzelnen Naturgeschichten werden Kennzeichen der Giftschlangen in geradezu leichtfertiger Weise aufgestellt. Wahr ist es, daß die nächtlich lebenden Arten gewöhnlich einen kurzen, in der Mitte stark verdickten, im Durchschnitt dreieckigen Leib, einen kurzen, dickkegelförmigen Schwanz, einen dünnen Hals und einen hinten sehr breiten, dreieckigen Kopf haben; wahr, daß sie sich in der Bildung ihrer Schuppen gewöhnlich von den giftlosen unterscheiden; vollkommen richtig, daß ihnen das große Nachtauge mit dem senkrecht geschlitzten Sterne, das durch die vortretenden Brauenschilder geschützt zu sein pflegt, einen boshaften, tückischen Ausdruck verleiht: alle diese Merkmale aber gelten eben nur für sie, nicht jedoch auch für die giftigen Tagschlangen, nicht für die »Giftnattern«, die man den hervorragendsten Mitgliedern der Gruppe zuliebe eher Brillen- oder Schildschlangen nennen sollte, nicht für die Seeschlangen; denn die meisten Mitglieder dieser beiden Gruppen sehen so unschuldig und harmlos aus wie irgendeine andere Schlange. Und eine zahlreiche Sippschaft der erstgenannten Familie, von deren Giftigkeit man sich jetzt doch überzeugen mußte, hat äußerlich so viel Bestechendes und scheint so gutmütig zu sein, daß die bewährtesten Forscher für sie in die Schranken traten und alte Erzählungen, die uns diese Schlangen als Spielzeug erscheinen lassen, unterstützen halfen. Einzig und allein die Untersuchung des Gebisses gibt in allen Fällen untrüglichen Aufschluß über die Giftigkeit oder Ungiftigkeit einer Schlange.
Wenn man weiß, welche erschreckende Anzahl von Menschen alljährlich durch Giftschlangen ihr Leben verlieren, wie viele selbst bei uns zulande durch sie mindestens zu jahrelangem Siechtum verurteilt werden, begreift man das Entsetzen, das jeden Nichtkundigen beim Anblicke einer Schlange erfaßt, versteht man auch die Erzählungen, Sagen und Dichtungen älterer und neuerer Völker, in denen von Schlangen die Rede ist. Sie, beziehentlich die giftigen unter ihnen, vermögen zwar nicht, ein Land unbewohnbar zu machen, gefährden und bedrängen den Bewohner einer von ihnen in ungewöhnlicher Anzahl heimgesuchten Gegend aber doch in einem Grade, von dem wir in dem an Giftschlangen armen Norden keine Vorstellung haben. Fayrer, ein englischer Arzt, hat sich jahrelang mit Untersuchung der Wirkungen des Schlangengiftes beschäftigt und während seines Aufenthaltes in Indien die Anzahl der von Giftschlangen alljährlich gebissenen, beziehentlich der an der Vergiftung gestorbenen Menschen zu erforschen gesucht. Das mit Hilfe der Regierung gewonnene Ergebnis ist entsetzlich. Es waren nur acht Präsidentschaften, an deren Behörden Fayrer um Auskunft sich wendete, und die Antworten liefen nicht aus allen Teilen ein oder waren nicht danach angetan, ein klares Bild der Sachlage zu geben: immerhin aber muß die durch diese Nachforschungen gewonnene Erkenntnis als schaudererregend betrachtet werden. Am genauesten, jedoch noch bei weitem nicht vollständig, waren die Nachrichten aus der Präsidentschaft Bengalen. Hier starben in dem einzigen Jahre 1869 nicht weniger als sechstausendzweihundertneunzehn Menschen an Schlangenbissen. Am meisten wurden ältere Frauen, am wenigsten Mädchen gebissen. Als die gefährlichste Schlange erscheint die Brillenschlange, der erwiesenermaßen neunhundertneunundfünfzig Morde zur Last fallen. Die Gesamtsumme aller derart bekanntgewordenen Schlangenbisse eines Jahres betrug nicht weniger als elftausendvierhundertsechzehn; sie aber entspricht nach Fayrers bestimmter Ansicht bei weitem noch nicht der Tatsächlichkeit. Viele Schlangenbisse kamen überhaupt nicht zur Anzeige: die eingeborenen Regierungsbeamten bekümmern sich um solche tagtäglichen Vorkommnisse nur in Ausnahmefällen, und die Eingeborenen fügen sich mit einer so ausgesprochenen Ergebung in das Unvermeidliche, daß sie es nicht der Mühe wert halten, viel davon zu sprechen. So glaubt Fayrer annehmen zu müssen, daß in dem einen Jahre mindestens zwanzigtausend Menschen durch Schlangen ihr Leben verloren haben. Wenn nun auch die Bevölkerung eine sehr zahlreiche ist und in den oben angegebenen Provinzen auf annähernd einhundertzwanzig Millionen geschätzt wird, so verliert diese Tatsache doch nicht im geringsten an Bedeutung und beweist die schon zu Zeiten der Römer ausgesprochene Behauptung, daß die Giftschlangen in Indien zu den furchtbarsten Plagen zählen, daß ihnen gegenüber, wie ich hinzufügen will, Tiger, Panther und Wölfe zu harm- oder doch bedeutungslosen Wesen herabsinken. Wollte oder könnte man in anderen, von vielen Giftschlangen heimgesuchten Ländern ähnliche Nachforschungen anstellen, man würde, wenn auch nicht zu gleichen, so doch annähernden Ergebnissen gelangen. Daß z. B. in Brasilien die Verhältnisse ähnliche sind, versichern alle Reisenden, neuerdings insbesondere Tschudi. »Aus dem von mir über Giftschlangen Mitgeteilten«, sagte er, »darf nicht die Folgerung gezogen werden, daß man bei jedem Spaziergange Gefahr läuft, von einer solchen verwundet zu werden, und daß ein Ausflug in die Urwälder ein steter Kampf mit ihnen sei. Die lebhafte Phantasie einiger Reisenden hat den Pinsel in viel zu grelle Farben eingetaucht; aber es ist doch immerhin ganz richtig, daß in Brasilien Schlangen sehr häufig vorkommen und alljährlich durch ganz Brasilien ihnen Hunderte von Menschen zum Opfer fallen. Einer meiner Bekannten hat in Rio de Janeiro in seinem Gartenhause im Verlaufe von ein Paar Jahren neun verschiedene Arten in mehr als dreißig Stücken gefangen und in Weingeist aufbewahrt. Ein jeder Grundbesitzer in Brasilien weiß, daß sein Garten oder Park eine Anzahl solcher Kriechtiere beherbergt. Andere Forscher nehmen die Giftschlangengefahr weniger tragisch. So ist der berühmte deutsch-brasilianische Naturforscher Fritz Müller in der Regel barfuß durch den Urwald gegangen, allerdings dabei auch gelegentlich auf eine Giftschlange gestoßen. Er hat sie aber noch stets rechtzeitig bemerkt. Herausgeber.
Bei aller Verschiedenheit in der äußeren Gestalt und im Bau, wie in der Lebensweise, besitzen die Giftschlangen in ihren Giftwerkzeugen ein Merkmal, das sie mit Sicherheit und für den einigermaßen Geübten auch mit einer gewissen Leichtigkeit von den giftlosen Schlangen unterscheiden läßt. Sie bilden daher eine durchaus natürliche Unterordnung ( Toxicophidia), zu deren Kennzeichnung man nichts weiter anzuführen braucht, als daß sie im Oberkiefer neben massigen, durchbohrte Zähne haben.
Bei Taggiftschlangen ist der Zahn inniger mit dem Oberkiefer befestigt als bei den nächtlich lebenden Giftschlangen; bei diesen wie bei jenen aber wird derselbe nicht durch Einwurzelung, sondern nur durch Bänder mit dem Kiefer zusammengehalten. In der Regel ist nur ein Zahn aus jeder Seite ausgebildet; da aber in jedem Kiefer stets mehrere (einer bis sechs) in der Entwicklung begriffene Ersatzzähne vorhanden sind, kann es geschehen, daß auch zwei von ihnen, in jeder Grube einer, sich ausgebildet haben und gleichzeitig in Wirksamkeit treten. Unter Ersatzzähnen, die lose aus dem Knochen stehen, ist der dem Giftzahne nächste auch stets der am meisten entwickelte. Die Giftzähne zeichnen sich vor den übrigen stets durch bedeutendere Größe und ausgesprochen pfriemenförmige Gestalt aus und sind, laut Strauch, nach einem und demselben Grundplan gebildet. Außer einer an den Wurzeln befindlichen Höhlung, die zur Ernährung des Zahnes bestimmt ist und allen Schlangen ohne Ausnahme zukommt, besitzt jeder Giftzahn noch eine der Länge nach verlaufende Röhre, die immer an der vorderen, gewölbten Seite des Zahnes liegt und mit zwei Öffnungen nach außen mündet. Die eine dieser Öffnungen, die stets einen mehr oder weniger rundlichen Durchschnitt zeigt, befindet sich nahe der Zahnwurzel und vermittelt, indem sie sich beim Öffnen des Rachens und der dadurch bedingten Lageveränderung des Zahnes über den Ausführungsgang der Giftdrüse erhebt, den Eintritt des Giftes in den Zahn; die untere Öffnung dagegen, die an der Spitze des Zahnes liegt und zum Austritte des Giftes dient, ist mehr spaltförmig. Bei der Mehrzahl der Giftschlangen nun sind diese beiden Öffnungen der Giftzähne durch einen feinen, oft schwer wahrnehmbaren Spalt miteinander verbunden, und die Giftröhre ist folglich vorn nicht gänzlich geschlossen; bei der Minderzahl dagegen erscheint letztere vollkommen abgeschlossen, und es findet sich an Stelle der Spalte höchstens eine feine Linie. Hiernach unterscheidet man gefurchte und glatte Giftzähne, solche, deren Röhre vorne eine Spalte zeigt, und solche, deren Kanal rings abgeschlossen ist. Die Spalte an den gefurchten Giftzähnen hat jedoch schwerlich irgendeine physiologische Bedeutung, da sie stets so eng ist, daß das Schlangengift unmöglich durch sie nach außen treten kann, und es muß daher ihre Anwesenheit einen anderen Grund haben. Dieser ist dann auch nicht schwer zu finden, indem sich nachweisen läßt, daß die Furche als nichts anderes als ein Überbleibsel aus einer früheren Keimlingszeit aufgefaßt werden muß.
Je nach der Größe des Tieres haben die Gifthaken verschiedene Länge; dieselbe steht jedoch nicht im genauen Verhältnisse zu jener des Tieres selbst: so besitzen namentlich alle Taggiftschlangen verhältnismäßig kleine, alle Nachtgiftschlangen verhältnismäßig große Zähne. Bei unsrer Kreuzotter erreichen die Gifthaken eine Länge von drei bis vier, höchstens fünf Millimeter, bei der Lanzenschlange werden sie fünfundzwanzig Millimeter lang. Sie sind glasartig hart und spröde, aber außerordentlich spitzig, und durchdringen deshalb mit der Leichtigkeit einer scharfen Nadel weiche Gegenstände, sogar weiches Leder, während sie von harten oft abgleiten oder selbst zerspringen, wenn der Schlag, den die Schlange ausführte, heftig war. Ist einer von ihnen verlorengegangen, so tritt der nächstfolgende Ersatzzahn an seine Stelle; ein solcher Wechsel scheint jedoch ohne äußerliche Ursache mit einer gewissen Regelmäßigkeit stattzufinden, alljährlich einmal, vielleicht öfter. Ihre Entwicklung und Ausbildung gehen ungemein rasch vor sich; Lenz fand, daß junge Kreuzottern, die er, seiner Berechnung nach, vier oder höchstens sechs Tage vor der Geburt dem Leibe hochträchtiger Weibchen entnahm, noch keine Giftzähne hatten, während solche, die seiner Mutmaßung nach in den nächsten Tagen geboren werden mußten, schon ganz ausgebildete Gifthaken besaßen. Nicht minder rasch als die Neubildung geht der Ersatz verlorengegangener oder gewaltsam ausgerissener Gifthaken vor sich. Werden solche einfach ausgebrochen, so tritt oft schon nach drei Tagen, spätestens aber nach sechs Wochen ein Ersatzzahn an ihre Stelle, und nur wenn man, wie Schlangenbeschwörer zu tun pflegen, auch die Schleimhautfalte, in der die Gifthaken eingebettet liegen, ausschneidet oder einen Teil der Kinnlade verletzt, also alle Zahnkeime zerstört, ersetzen sich jene nicht wieder.
Jede Drüse sondert eine verhältnismäßig geringe Menge Gift ab: die einer fast zwei Meter langen, gesunden Klapperschlange höchstens vier bis sechs Tropfen; aber ein kleiner Bruchteil eines solchen Tropfens genügt freilich auch, um das Blut eines großen Säugetieres binnen wenigen Minuten zu verändern. Die Giftdrüse strotzt von Gift, wenn die Schlange längere Zeit nicht gebissen hat, und das Gift selbst ist dann wirksamer. Der Ersatz der verbrauchten Absonderung geht jedoch sehr rasch vor sich, und auch das frischerzeugte ist im höchsten Grade wirksam.
Das Gift selbst, dem Speichel vergleichbar oder als solcher zu bezeichnen, ist eine wasserhelle, dünne, durchsichtige, gelblich oder grünlich gefärbte Flüssigkeit, die im Wasser zu Boden fällt, sich jedoch auch unter leichter Trübung mit demselben vermischt, Lackmuspapier rötet und sich sonach als Säure verhält. Hinsichtlich der Wirkung des Giftes scheint soviel festzustehen, daß sie um so heftiger ist, je größer die Schlange und je heißer die Witterung ist. Früher hat man angenommen, daß das Gift ohne Nachteil verschluckt werden könnte, während man durch neuerliche Versuche gefunden hat, daß dasselbe, selbst bei bedeutender Verdünnung mit Wasser, in den Magen gebracht, noch auffallende Wirkungen äußert, beim Verschlucken Schmerzen hervorruft und die Gehirntätigkeit stört, überhaupt von den Schleimhäuten aufgesogen wird und immerhin gefährliche Zufälle hervorrufen kann. Demungeachtet bleibt der alte Erfahrungssatz immer noch wahr: daß das Schlangengift, nur wenn es unmittelbar ins Blut übergeführt wird, das Leben ernstlich gefährdet. Je rascher und vollkommener der Blutumlauf, um so verheerender zeigt sich die Wirkung des Giftes: warmblütige Tiere sterben nach einem Schlangenbisse viel schneller und sicherer als Kriechtiere, Lurche oder Fische; wirbellose Tiere scheinen weniger zu leiden. Zwei Giftschlangen einer und derselben Art können sich gegenseitig Bisse beibringen, ohne daß ersichtliche Folgen eintreten. Anders verhält sich die Sache, wenn eine größere Giftschlange eine kleinere, ja vielleicht irgend eine die andere, artlich verschiedene, beißt; denn in einem solchen Falle äußern sich die Wirkungen des Giftes an den betreffenden Opfern ebenso gut wie an andern Tieren: sie sterben unter Zeichen der Vergiftung. Einzelne Säugetiere und Vögel scheinen der Wirkung des Schlangengiftes in einer für uns unbegreiflichen Weise zu trotzen, so namentlich Iltis und Igel; es fragt sich jedoch sehr, ob die Folgerungen, die wir von den umfassenden, in jeder Hinsicht ausgezeichneten Versuchen unseres schlangenkundigen Lenz herleiten, als wirklich berechtigte angesehen werden dürfen. Im allgemeinen zeigt sich die Wirkung der von Schlangen herrührenden Vergiftung bei allen Tieren mehr oder weniger in derselben Weise, obschon die auf den Biß folgenden Zufälle verschiedener Art sein können oder doch zu sein scheinen. Beim Menschen kennen wir darüber hinaus auch die Gefühle und Empfindungen der Vergifteten genau. Man vergleiche hierzu auch die entsprechende Schilderung bei der Kreuzotter, deren Bisse im allgemeinen milder zu verlaufen pflegen. Herausgeber. Unmittelbar nach dem Bisse, der zwei nebeneinander stehende kleine Stichwunden, wenn nur ein Gifthaken traf, auch bloß eine solche, hinterläßt und oft nicht einmal blutet, fühlt das Opfer gewöhnlich einen heftigen, mit nichts zu vergleichenden Schmerz, der wie ein elektrischer Schlag durch den Körper geht; in vielen Fällen aber findet auch das Gegenteil insofern statt, als der Gebissene glaubt, eben nur von einem Dorn geritzt worden zu sein, den Schmerz also durchaus nicht für erheblich achtet. Unmittelbar darauf folgende Ermüdung des ganzen Körpers, überaus rasches Sinken aller Kräfte, Schwindelanfälle und wiederholte Ohnmachten sind die ersten untrüglichen Zeichen von der beginnenden Veränderung des Blutes; sehr häufig stellt sich Erbrechen, oft auch Blutbrechen ein, fast ebenso oft Durchfall, zuweilen Blutungen aus Mund, Nase und Ohren. Die Entkräftung bekundet sich ferner in kaum zu bewältigender Schläfrigkeit und ersichtlicher Abnahme der Gehirntätigkeit; namentlich wird die Wirksamkeit der Sinne im höchsten Grade beeinträchtigt, so daß z. B. vollständige Blindheit oder Taubheit eintreten kann. Mit zunehmender Schwäche nimmt das Gefühl des Schmerzes ab, und wenn das Ende des Vergifteten herannaht, scheint derselbe keine Schmerzen mehr zu fühlen, sondern in dumpfer Bewußtlosigkeit allmählich zu verenden. Der Tod kann schon zwanzig Minuten nach dem Bisse, wenn aber das Gift in eine Hohlader gelangt, fast plötzlich eintreten. Wendet sich der Verlauf der Krankheit, sei es infolge der angewandten Mittel, oder weil die Menge des in die Wunde gebrachten Giftes zu gering war, so folgt diesen ersten allgemeinen Erscheinungen längeres Siechtum, bevor vollständige Heilung eintritt; leider nur zu häufig aber geschieht es, daß ein mit dem Leben davongekommener Mensch mehrere Wochen, Monate, ja selbst Jahre an den Folgen eines Schlangenbisses zu leiden hat, daß ihm mit dem einzigen Tröpflein der fürchterlichen Flüssigkeit im buchstäblichen Sinne des Wortes sein ganzes Leben vergiftet wird.
Unzählig sind die Heilmittel, die man von altersher gegen den Schlangenbiß angewendet hat und noch heutigestags anwendet. Das wirksamste von allen scheint Alkohol zu sein, in reichlicher Gabe genossen oder eingegeben, gleichviel in welcher Form, ob als Rum, Arrak, Kognak, Branntwein oder starker und schwerer Wein. Dies ist kein neu entdecktes, vielmehr ein schon seit den ältesten Zeiten bekanntes und von Nichtärzten viel früher als von Ärzten in den verschiedensten Teilen der Erde angewendetes Mittel. Schon Marcus Porcius Cato Censorius rät, einem von einer Schlange gebissenen Menschen oder Haustiere zerriebenen Schwarzkümmel in Wein einzugeben; Celsus empfiehlt mit Pfeffer und Knoblauchsaft gewürzten Wein. Die Dalmatiner, die von einer Viper gebissen werden, trinken Wein bis zur Berauschung und werden gesund. Die Nordamerikaner achten einen Klapperschlangenbiß verhältnismäßig wenig, wenn sie Branntwein in genügender Menge zur Verfügung haben, trinken davon soviel sie mögen, schlafen ihren Rausch aus und verspüren weiter keine nachteiligen Folgen des Schlangengiftes. Die Einwohner Indiens kennen, so viele sie deren auch anwenden, kein anderes wirksames Mittel, als einen Aufguß von Branntwein auf wilden Hanf oder Tabak. In der Neuzeit wenden auch Ärzte Alkohol in irgendeiner Form mit dem besten Erfolge an. Daß der Alkohol nicht als Gegengift wirkt, beziehentlich das Schlangengift nicht zerstört, ist durch Versuche nachgewiesen; er erhöht aber die Nerventätigkeit, die infolge des Schlangenbisses gelähmt wird, mehr und schneller als jedes andere Erregungsmittel und leistet dadurch vortreffliche Dienste, verdient auch ganz besonders aus dem Grunde zuerst angewendet zu werden, weil er als Branntwein auf jedem Dorfe sofort zu haben ist. Bei Behandlung eines durch Schlangenbiß Vergifteten ist alle Gefühlsschwärmerei vom Übel und einzig und allein kräftiges Handeln am Platze. Fayrer gibt nach seinen zahllosen Versuchen in kurzem folgende Anleitung zur Behandlung und Herstellung eines von einer Giftschlange gebissenen Menschen: Man nehme sogleich nach dem Bisse irgendein Band, wickle dasselbe oberhalb der gebissenen Stelle um das verwundete Glied und schnüre es, nötigenfalls mit Hilfe eines Knebels, so fest zu, als man vermag. Man lege in einem gewissen Abstande ein zweites, drittes und viertes derartiges Band oberhalb des ersteren um das Glied und verfahre mit ihm wie vorher. Sodann führe man einen raschen Schnitt über die Wunde und lasse sie bluten, auch durch einen Willfährigen aussaugen oder nehme eine brennende Kohle, glühendes Eisen oder, wenn man ihn besitzt, Höllenstein oder ein sonstiges Ätzmittel, um sie auszubrennen. Hat eine als gefährlich bekannte Schlange einen Finger oder eine Zehe verwundet, so hacke oder schneide man das vergiftete Glied ab; läßt sich das Glied nicht abnehmen, so schneide man wenigstens die Wunde aus, so tief, als man darf, ohne Schaden zu tun. Den Leidenden lasse man in Ruhe und quäle ihn nicht durch allerlei Übungen, wie man sie wohl anzuwenden pflegt. Treten die ersten Zeichen der Vergiftung ein, so reiche man ihm Lucienwasser, Salmiakgeist oder, besser als dieses, erwärmten Weingeist, Branntwein, Glühwein usw. in Wasser, am zweckmäßigsten nicht allzuviel mit einem Male, sondern kleinere Gaben möglichst rasch hintereinander. Tritt Entkräftung ein, so lege man Senfpflaster oder heiße Tücher auf den Leib; ebenso mögen kalte Sturzbäder angebracht sein. Will der Leidende Gegenmittel nehmen, an die er glaubt, so gebe man sie ihm; wichtiger aber ist, ihm Mut einzusprechen, soviel als immer nur möglich.
*
In der ersten Familie vereinigen wir die Giftnattern ( Elapidae), gestreckt gebaute, kleinköpfige, rundleibige und kurz-, aber spitzschwänzige Schlangen, deren Leib rundlich oder durch Erhebung der Rückenfirste stumpf dreieckig erscheint. Die Nasenlöcher öffnen sich seitlich an dem abgerundeten Schnauzenende; die Zügelschilder fehlen; der Kopf wird in regelmäßiger Weise mit großen Schildern bekleidet; die übrige Beschuppung des Leibes ändert vielfach ab. Das kleine Auge hat einen runden, nur bei wenigen Arten länglich eiförmigen und senkrecht gestellten Stern. Die Giftzähne zeigen in der Regel eine Furche, die der im Innern verlaufenden Giftröhre entspricht.
Die Familie verbreitet sich über beide Erdhälften, entwickelt sich auf der östlichen zu größerer Mannigfaltigkeit, umfaßt sämtliche in Australien vorkommende Giftschlangen, wird jedoch in Europa glücklicherweise nicht vertreten. Sie begreift beinahe die Hälfte aller bekannten und darunter mehrere der allergefährlichsten Giftschlangen in sich. Fast alle zu ihr zählenden Arten leben auf dem Boden; einzelne sind jedoch auch fähig, Bäume zu besteigen, scheinen dies aber nur ausnahmsweise zu tun. Die größeren stellen kleinen Wirbeltieren, die kleineren Kerfen und Schnecken nach. Eine der gefährlichsten Schlangen Neuhollands, die berüchtigte Schwarzotter ( Pseudechis porphyreus), Urbild der Trugottern ( Pseudechis), mag als australischer Vertreter der Familie an erster Stelle genannt werden. Die Merkmale der Sippe beruhen in dem sehr gestreckten, walzigen und verhältnismäßig lang- und spitzschwänzigen Leibe, dem kleinen, vom Halse wenig abgesetzten, mit großen Schildern bekleideten Kopfe, den glatten, verschoben viereckigen, in siebzehn Reihen geordneten Schuppen und den zuerst doppel-, sodann ein- und schließlich wiederum zweireihig stehenden Schwanzschildern. Die Länge der Schwarzotter schwankt nach Bennett von 1,6 bis 2,5 Meter. Die Färbung der Oberseite ist ein prachtvolles, glänzendes Schwarz, die des Bauches ein ebenso schönes Blaßrot, die der Seiten ein lebhaftes Karminrot, das jedoch nur die Ränder der Schuppen einnimmt, und durch deren lichte Mitte besonders gehoben wird, ebenso wie der schwarze Hinterrand der Bauchschilder deren Färbung wesentlich verschönert. Die Giftzähne sind verhältnismäßig schwach.
Nach übereinstimmender Ansicht aller Forscher, Beobachter und Jäger gibt es keinen Erdteil, ja kein Land, das verhältnismäßig so viele Giftschlangen erzeugt als gerade Neuholland. Mindestens zwei Dritteile aller Schlangen, die bis jetzt in den verschiedenen Teilen dieses Festlandes gesammelt wurden, sind giftig, und mehrere von ihnen gehören zu den gefährlichsten Arten der ganzen Ordnung. »Man mag sich befinden, wo man will«, versichert der ›alte Buschmann‹, »im tiefen Walde oder im dichten Heidegestrüppe, in den offenen Heiden und Brüchen, an den Ufern der Flüsse, Teiche oder Wasserlöcher: man darf sicher sein, daß man seiner ingrimmig gehaßten Feindin, der Schwarzotter, begegnet. Sie dringt bis in das Zelt oder die Hütte des Jägers; sie ringelt sich unter seinem Bettlaken zusammen; nirgendwo ist man vor ihr sicher, und wundern muß man sich, daß nicht weit mehr Menschen durch sie ihr Leben verlieren, als in der Tat der Fall.« Nach den Behauptungen desselben Beobachters, die ungeachtet mancher Unklarheit Glauben verdienen, halten alle Schlangen Australiens Winterschlaf: sie verschwinden gegen Ende März und kommen im September wieder zum Vorschein. Bald nach dem Erwachen im Frühjahre paaren sie sich und beginnen hierauf ihr Sommerleben, das insofern etwas Eigentümliches hat, als sie gezwungen werden, mit der zunehmenden Hitze, die die meisten Gewässer austrocknet, ihrer Beute nachzuwandern und so gewissermaßen von einem Sumpfe, Teiche oder Regenstrome zum andern zu ziehen. Die Schwarzotter, deren Weibchen wegen ihrer Färbung als »Braunschlange« oder »Braunotter« unterschieden wird, scheint die verbreiterte und häufigste von allen zu sein, mindestens öfter als die übrigen gesehen zu werden, was wahrscheinlich in ihrem Tagleben seinen Grund hat. Ihre Bewegungen sind schneller als die anderer Giftschlangen, da sie, falls die Beobachtungen richtig sind, nicht ganz selten das feste Land verläßt und entweder klettert oder sich in das Wasser begibt. »Im Sommer«, sagt gedachter Gewährsmann, »halten sich fast alle Schlangen Australiens in der Nähe des Wassers auf, und wenn ich auf Enten anstand, habe ich sehr oft hier gesehen, daß sie zum Trinken kamen. Einst schoß ich ein paar Enten, von denen die eine auf der entgegengesetzten Seite des Gewässers niederfiel. Da ich keinen Hund bei mir hatte, entkleidete ich mich und schwamm auf meine Beute zu. Im Schwimmen erblickte ich einen Gegenstand, den ich zuerst für einen Stock hielt; beim Näherkommen aber erkannte ich, daß es eine große Schwarzotter war, die vollständig bewegungslos ihrer vollen Länge nach ausgestreckt auf dem Wasser ruhte. Obgleich ich nur wenige Schritte an ihr vorüberschwamm, rührte sie sich doch nicht im geringsten; mir aber wurde durch diese Entdeckung klar, warum die Enten zuweilen ohne scheinbare Veranlassung so unruhig werden.« Diese Bemerkung hat übrigens keine Beziehung zur Nahrung der Schwarzotter, da letztere, so viel bekannt, nur kleinen Säugetieren, Vögeln, Kriechtieren und Lurchen nachstellt.
Die Giftschlangen Australiens verursachen vielen Schaden und manchen Unglücksfall, werden deshalb auch allgemein gefürchtet und verfolgt. Viele von den Rindern und Schafen, die man im Sommer sterbend oder verendet auf den Ebenen liegen sieht, mögen an Schlangenbissen zugrunde gegangen sein, obgleich sie, wenigstens die Schafe, diese gefährlichen Geschöpfe töten, indem sie mit allen vier Füßen auf sie springen und sie zerstampfen. Die Schwarzen fürchten alle Schlangen ungemein, trotzdem sie selten gebissen werden, aus dem einfachen Grunde, weil sie nur mit äußerster Vorsicht ihres Weges dahingehen, und ihre Adleraugen alles entdecken, was vor ihnen sich regt oder nicht regt. Durch lange Gewohnheit in hohem Grade vorsichtig geworden, durchschreiten sie niemals eine Vertiefung, treten sie niemals in ein Loch, das sie nicht genau übersehen können.
In der Regel nimmt die Schwarzotter eiligst die Flucht, wenn sie einen Menschen zu Gesicht bekommt oder hört; aber in die Enge getrieben und gereizt, ja nur längere Zeit verfolgt, geht sie ihrem Angreifer kühn zu Leibe, hat sich deshalb bei den Ansiedlern auch den Namen »Sprungschlange« erworben. Der »alte Buschmann« versichert übrigens, daß er nur ein einziges Mal eine Schwarzotter springen sah, und zwar in der Absicht, einen Hund zu beißen. Sie lag in halbaufgerichteter Stellung und warf sich mit Blitzesschnelle ihrer ganzen Länge nach vor. Manche Hunde sind ungemein geschickt, Giftschlangen zu fassen und zu töten, ohne sich selbst zu gefährden; fast alle aber büßen früher oder später ihren Eifer mit dem Leben: sie werden zu kühn und versehen sich doch einmal.
Die schwarzen Ureinwohner Neuhollands behaupten, daß der Biß unserer Schlange dem Menschen selten tödlich wird, und in der Tat erinnert sich Bennett einzelner Fälle, daß Leute, die von ihr gebissen wurden, ohne Anwendung irgendwelcher Heilmittel wieder genasen. Trotzdem steht soviel fest, daß der Biß stets die bedenklichsten Folgen hat. »Ein Ansiedler am Clarencefluß«, so berichtet genannter Forscher, »der erfahren hatte, daß eine Schwarzotter sich in seinem Hause befand, machte sich, mit einem Stocke bewaffnet, auf, um sie zu töten, verfuhr jedoch ungeschickt und wurde in den Fuß gebissen. Die Folgen des Bisses zeigten sich zunächst in einer auffallenden Abspannung und Schläfrigkeit des Verwundeten. Man wandte Salmiakgeist innerlich und äußerlich an, machte Einschnitte an der Wunden Stelle, legte einen festen Verband an und ließ den Kranken umhergehen, trotzdem er das größte Verlangen zum Schlafen kundgab, überhaupt sich benahm, als ob er mit Opium vergiftet worden wäre. Stundenlang hielt derselbe Zustand an, bis der Mann nach und nach sich erholte.« Die Schwarzen behandeln einen Gebissenen ganz in ähnlicher Weise. Nachdem sie die Wunde ausgesaugt haben, zwingen sie den Leidenden umherzulaufen, um ihn, wie sie sagen, vom Schlafen abzuhalten und den Wirkungen des Giftes dadurch zu begegnen. Nebenbei widmen sie übrigens auch der Wunde besondere Aufmerksamkeit, indem sie dieselbe entweder ausbrennen oder Einschnitte machen und stundenlang Blutung unterhalten.
Unter den natürlichen Feinden nimmt der Riesenfischer die erste Stelle ein, wenigstens in den Augen der Jäger und Eingeborenen; auch eine große Echse soll den Schwarzottern mit Erfolg nachstellen und viele vernichten. Viel erfolgreicher als alle diese Feinde wirkt das Feuer, das alljährlich auf Weideplätzen angezündet wird, um das verdorrte Gras wegzuräumen und in fruchtbare Asche zu verwandeln: ihm fallen alljährlich Tausende von giftigen Schlangen und anderem Ungeziefer zum Opfer.
*
» Cobra de Capello« nannten die Portugiesen eine Schlange, die sie auf Ceylon fanden, und übertrugen diesen Namen später auf Verwandte derselben, denen sie in Afrika begegneten. Der Name bedeutet » Hutschlange« und ist bezeichnend; die Portugiesen hätten jedoch nicht nötig gehabt, einen neuen Namen zu bilden, da die eine wie die andere Schlange schon seit uralten Zeiten bekannt und benannt waren, insbesondere die in Nord- und Ostafrika lebende Art schon in der altägyptischen Geschichte hohen Ruhm erlangt hatte. Die Eigentümlichkeit der Hutschlangen besteht darin, daß sie bei senkrechter Erhebung des vorderen Teiles ihres Leibes den Hals scheibenförmig ausbreiten können, indem sie die vorderen acht Rippen seitlich richten. Bei dieser Stellung halten sie den Kopf unabänderlich wagerecht, und es sieht dann allerdings aus, als ob sie einen großen, runden Hut tragen; jedoch gewinnt man diesen Eindruck nur, wenn man sie von hinten betrachtet, während die Rippenscheibe, von vorne gesehen, zur Begleichung mit einem Schilde gleichsam herausfordert, und der Name »Schildotter« deshalb als noch schärfer bezeichnend erachtet werden muß denn jener.
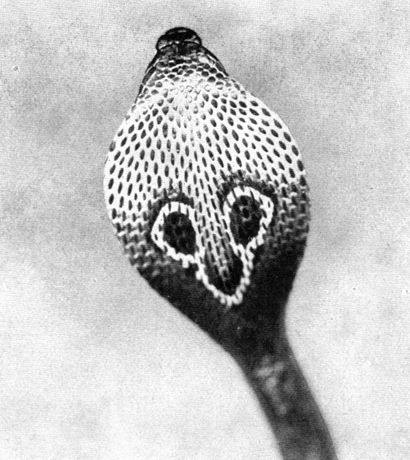
Indische Brillenschlange ( Naja tripudians), Kopf
Der Leib der Hutschlangen oder Schildottern ( Naja) ist langgestreckt und rundlich, in der Mitte etwas verdickt, unten platt, der einer bedeutenden Verbreiterung fähige Hals in der Ruhe wenig vom Kopfe abgesetzt, dieser selbst klein, länglich eiförmig, ziemlich flach, im ganzen dem der Nattern sehr ähnlich, der Schwanz langkegelig und zugespitzt, das Auge mäßig groß und rundsternig, das Nasenloch weit, seitlich je zwischen zwei Schildern gelegen. Die Bedeckung des Kopfes besteht aus großen, regelmäßigen Schildern. Die übrige Bekleidung bildet in schiefe Reihen geordnete kleine Schuppen auf dem Halse und ebenso gestellte rautenförmige auf der Oberseite des übrigen Leibes, während die Unterseite große, einreihige, erst am Schwanzende in Paare sich teilende Schilder zeigt. Die Mundöffnung ist verhältnismäßig weit; das Gebiß zeigt hinter den mittellangen, gefurchten Gifthaken zwei bis drei glatte, derbe Zähne.

Indische Brillenschlange ( Naja tripudians)
Wer ein einziges Mal eine Schildotter gesehen hat, wenn sie, durch den Anblick eines Gegners, insbesondere eines Menschen, erschreckt und gereizt, sich erhoben, das vordere Dritteil ihres Leibes emporreckt, den Schild gebreitet hat und nun langsamer oder schneller in dieser majestätischen Haltung, zum Angriff oder mindestens zur Abwehr gerüstet, auf den Gegenstand ihres Zornes zuschlängelt, vorn unbeweglich wie eine Bildsäule sich haltend, hinten jede einzelne Muskel anstrengend, und wer da weiß, daß ihr Biß ebenso tödlich wirkt wie der der Lanzen- oder Klapperschlange, begreift, daß sie von jeher die Aufmerksamkeit des Menschen erregen mußte, versteht, warum man ihr göttliche Ehre erzeigte und sie benutzte, mit dem Wesen und den Eigentümlichkeiten der Schlange nicht vertraute Menschen zu täuschen.
Die Cobra de Capello, schlechtweg Cobra genannt, die Brillenschlange ( Naja tripudians), ist ein Tier von 1,4 bis 1,8 Meter Länge und lohgelber, in gewissem Lichte ins Aschblaue schimmernder Färbung. Im Nacken herrscht Lichtgelb oder Weiß derartig vor, daß die dunklere Färbung nur als Tüpfelung sich darstellt, und gerade von dieser Stelle hebt sich eine Zeichnung deutlich ab, die mit einer Brille Ähnlichkeit hat. Diese Brille wird von zwei schwarzen Linien umrandet und ist gewöhnlich bedeutend lichter als der umgebende Teil, während diejenigen Stellen, die den Gläsern entsprechen, entweder ganz schwarz aussehen oder einen lichten Augenfleck dunkel umranden. Die Bauchschilder sind schmutzigweiß, einzelne schwarz gefleckt.
Die Brillenschlange verbreitet sich über ganz Südasien und ebenso über alle benachbarten Inseln. Wie die meisten übrigen Schlangen scheint sie sich nicht an eine bestimmte Örtlichkeit zu binden, im Gegenteile überall sich anzusiedeln, wo sie ein passendes Versteck und genügende Nahrung findet. Lieblingswohnungen von ihr sind die verlassenen Nesthügel der weißen Ameise oder Termite, altes Gemäuer, Stein- und Holzhaufen, durchlöcherte Lehmwände und ähnliches Gerümpel, das Löcher oder verdeckte Zwischenräume und damit für sie Schlupfwinkel bietet. Tennent hebt hervor, daß sie auf Ceylon neben der sogenannten Rattenschlange, einer Natter ( Coryphodon Blumenbachii), die einzige ihres Geschlechtes ist, die die Nachbarschaft menschlicher Wohnungen nicht meidet. Sie wird hier angezogen durch die Abzugsgräben und vielleicht durch die Beute, die sie an Ratten, Mäusen und kleinen Küchlein zu gewinnen gedenkt; in nicht wenigen Fällen treibt sie auch Wassernot, höher gelegene Teile des im Überschwemmungsbereiche der Flüsse gelegenen Landes und damit die daselbst errichteten Hütten aufzusuchen. Solange sie ungestört bleibt, pflegt sie vor dem Eingange ihrer Höhlen faul und träge zu liegen, bei Ankunft eines Menschen aber regelmäßig so eilig als möglich sich zurückzuziehen und nur, wenn sie in die Enge getrieben wird, ihrem Angreifer zu Leibe zu gehen. Ungereizt, beispielsweise wenn sie zur Jagd auszieht, schlängelt sie mit kaum erhobenem Kopfe und nicht verbreitertem Halse über den Boden dahin; gereizt, oder auch nur geängstigt, nimmt sie sofort die ihrem Geschlecht eigene Angriffsstellung an. Obwohl eine Tagschlange, meidet sie doch die Hitze der Mittagszeit oder die stechenden Sonnenstrahlen überhaupt und tritt erst in den späteren Nachmittagsstunden ihre Jagdzüge an, ist in den Abendstunden am muntersten und treibt sich oft noch in später Nacht umher, wird daher von einzelnen Berichterstattern geradezu als Nachttier angesehen.
Ihre Bewegungen werden von allen Beobachtern als langsam bezeichnet; doch ist sie geschickter als man glaubt: denn sie versteht nicht allein zu schwimmen, sondern auch in einem gewissen Grade zu klettern. Eine Cobra, die in einen Wallgraben gefallen war und an den steilen Wänden desselben nicht wieder emporkommen konnte, schwamm, Kopf und Hut über das Wasser gehoben, mehrere Stunden lang mit Leichtigkeit und Gemächlichkeit; andere begaben sich sogar freiwillig in die See. Als der »Wellington«, ein Regierungsschiff, zur Beaufsichtigung der Fischerei in der Bai von Kudremele, ungefähr eine Viertelmeile vom Lande vor Anker lag, entdeckte man etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang eine Brillenschlange, die in gerader Linie auf das Schiff zuschwamm und bis etwa zwölf Meter sich näherte, von den Matrosen aber durch entgegengeschleuderte Holzstücke und andere Wurfgegenstände gezwungen wurde, nach dem Lande zurückzukehren.
Die Nahrung der Cobra besteht ebenfalls nur in kleinen Tieren, wie es scheint vorzugsweise in Kriechtieren und Lurchen; wenigstens gibt Tennent Echsen, Frösche und Kröten, Fayrer außerdem noch Fische und Kerbtiere als ihre Beute an. Daß sie jungen Hühnern, Mäusen und Ratten gefährlich werden muß, geht aus den bereits von mir gegebenen Mitteilungen des erstgenannten Forschers zur Genüge hervor, daß sie auch Vogelnester plündert, insbesondere in Hühner- und Taubenställen den Eiern des Hausgeflügels nachgeht, bemerkt Fayrer. Um andere Schlangen bekümmert sie sich wenig. Sie trinkt viel, kann aber auch lange, nach Beobachtungen an Gefangenen, wochen- und selbst monatelang, ohne Schaden Durst erleiden.
Fayrer ist der einzige mir bekannte Schriftsteller, der über die Fortpflanzung berichtet und kurz mitteilt, daß die Cobra bis achtzehn länglich eiförmige, weichschalige, weiße, denen der Haustaube an Größe gleichkommende Eier legt. Genau dasselbe, was die Alten von der verwandten Uräusschlange oder Aspis angeben, erzählen auch die Inder von der Brillenschlange: daß Männchen und Weibchen eine gewisse Anhänglichkeit aneinander zeigen, daß man da, wo man eine Cobra gefangen habe, regelmäßig bald darauf die zweite bemerke usw., kurz, daß sozusagen ein Eheleben, mindestens entschiedenes Zusammenhalten, beider Geschlechter stattfinde. Tennent bemerkt, daß er zweimal Gelegenheit gehabt habe, Beobachtungen zu machen, die die Erzählung zu bewahrheiten scheinen. Eine ausgewachsene Cobra wurde im Bade des Regierungshauses zu Colombo getötet und »ihr Genosse« am nächsten Tage an derselben Stelle gefunden, ebenso zu derjenigen, die in den Wallgraben gefallen war, an demselben Morgen »ein Gefährte« in einem benachbarten Graben entdeckt. Ob dies gerade während der Paarzeit stattfand, sich also auf diese Weise erklärt, darüber sagt Tennent freilich nichts, und so wissen wir nicht, wieviel wir auf Rechnung des Zufalls zu setzen haben. Von den Jungen behaupten die Singalesen, daß sie nicht vor dem dreizehnten Tage, an dem die erste Häutung vor sich gehen soll, giftig seien.
Die Brillenschlange bildet wie vorzeiten so noch heutigentags einen Gegenstand ehrfurchtsvoller, ja fast göttlicher Verehrung und spielt in den Glaubenssagen der Hindu eine bedeutsame Rolle. Eine der anmutigsten Erdichtungen dieser Art ist folgende: Als Buddha eines Tages auf Erden wandelte und in der Mittagssonne schlief, erschien eine Cobra, breitete ihr Schild und beschattete dadurch das göttliche Antlitz. Der darob erfreute Gott versprach ihr außerordentliche Gnade, vergaß sein Versprechen jedoch wieder, und die Schlange sah sich genötigt, ihn zu erinnern, da die Milane gerade damals entsetzliche Verheerungen unter ihrem Geschlechte anrichteten. Zum Schutze gegen diese Raubvögel verlieh Buddha der Cobra die Brille, vor der jene sich fürchten. Eine andere Sage berichtet von einem kostbaren Steine, »Nege-Menik-Kya« genannt, der zuweilen im Magen der Cobra gefunden, von ihr aber sorgsam geheim gehalten wird, weil sein unbeschreiblicher Glanz wie ein strahlendes Licht jedermann anziehen und das Tier gefährden würde.
Während sich Dellon zu Kuranur aufhielt, in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts etwa, wurde ein Geheimschreiber des Fürsten von einer Brillenschlange gebissen. Man brachte ihn und in einem wohlverwahrten Gefäße auch die Schlange zur Stadt. Der Fürst war über den Unfall sehr betrübt und ließ die Brahminen herbeikommen, die der Schlange in rührender Weise vorstellten, daß das Leben des verwundeten Schreibers für den Staat von großer Wichtigkeit sei. Zu solchen Vorstellungen gesellten sich auch die nötigen Drohungen: man erklärte der Schlange, daß sie mit dem Kranken auf demselben Scheiterhaufen verbrannt werden würde, wenn ihr Biß den Tod zur Folge haben sollte; das göttliche Tier aber ließ sich nicht erweichen, und der Schreiber starb. Tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte sich des Fürsten; zur rechten Zeit jedoch kam ihm der Gedanke, daß der Tote vielleicht durch eine heimliche Sünde sich den Zorn der Götter zugezogen habe, und die Schlange nur einen göttlichen Befehl ausgerichtet haben könnte. Deshalb wurde sie in ihrem Gefäße vor das Haus getragen, hier in Freiheit gesetzt und durch tiefe Bücklinge gebührend um Verzeihung gebeten. Wenn ein Einwohner von Malabar eine Giftschlange in seinem Hause findet, bittet er sie freundlichst, hinauszugehen; hilft das nichts, so hält er ihr Speisen vor, um sie hinauszulocken, und geht sie dann noch nicht, so holt er die frommen Diener irgendeiner seiner Gottheiten herbei, die, selbstverständlich gegen entsprechende Entschädigung, der Schlange rührende Vorstellungen machen. Nach Fayrers Erkundigungen haben sich die Anschauungen der Hindu, wenn auch nicht aller Kasten, bis zum heutigen Tage nicht geändert. Viele Hindus töten unter keiner Bedingung eine Brillenschlange. Findet einer solche in seinem Hause, so besänftigt und beruhigt er sie, soviel in seinen Kräften steht, füttert und beschützt sie, als ob ihre Schädigung dem Hause Unglück bringen müsse. Sollte die Furcht vor dem gefährlichen und böswilligen Gaste die abergläubische Vergötterungslust überwiegen, die Schlange vielleicht gar einen Hausbewohner getötet haben, so läßt er sie fangen, behandelt sie aber auch jetzt noch achtungs- und rücksichtsvoll, bringt sie in eine entlegene unbewohnte Gegend und läßt sie dort frei, damit sie ihren Weg im Frieden wandle.
Solchem Volke gegenüber haben Gaukler erklärlicherweise leichtes Spiel. Die blinde Menge hält die Kunststücke der letzteren für offenbare Zauberei. Allerdings läßt sich nicht leugnen, daß die Gaukler mit den gefährlichen Tieren in einer Weise verkehren, die wohl geeignet ist, auch dem ungläubigen Europäer hohe Achtung vor ihrer Fertigkeit abzunötigen; ihre ganze Kunst aber begründet sich einzig und allein auf genaue Kenntnis des Wesens und der Eigentümlichkeiten der Schlange. Verschiedene Schriftsteller haben behauptet, daß der Cobra ebenso wie der Aspis, ihrer ägyptischen Schwester, vor dem Gebrauche verständigerweise erst die Giftzähne ausgebrochen würden, und ihr Biß deshalb nicht schaden könne; schon Davy aber bestreitet diese Annahme auf das entschiedenste, und neuere Beobachter geben ihm vollständig recht. Wohl mag es vorkommen, daß Gaukler den Schlangen die Zähne ausbrechen: in der Regel jedoch ist die Cobra im Besitze ihrer tödlichen Waffen, kann sie also gebrauchen; denn auch die Abrichtung, die sie überstanden hat, hindert sie schwerlich daran. Eine solche Abrichtung findet allerdings statt; dieselbe hat aber gewiß nicht den Erfolg, das Tier vom Beißen abzuhalten, und nur die Gewandtheit und Achtsamkeit des Gauklers sichert diesen vor der Gefahr, die er, wenn auch nicht in allen Fällen, in frevelhafter Weise herausfordert. Manch einer dieser Leute verliert durch die Brillenschlange sein Leben. »Der Schlangenbeschwörer«, erzählt Davy, »reizt die Cobra de Capello durch Schläge oder schnelle, drohende Bewegungen der Hand und beruhigt sie wieder durch seine Stimme, durch langsame, kreisende Handbewegungen und sanftes Streicheln. Wird sie böse, so vermeidet er geschickt ihren Angriff und spielt nur mit ihr, wenn sie beruhigt ist. Dann bringt er das Maul des Tieres an seine Stirne, dann fährt er mit ihr über das Gesicht. Das Volk glaubt, der Mann besitze wirklich einen Zauber, infolgedessen er die Schlange ohne Gefahr behandeln könne; der Aufgeklärte dagegen lacht darüber und verdächtigt den Gaukler als Betrüger, der der Cobra die Giftzähne ausgerissen hat: er aber irrt sich, und das Volk hat recht. Ich habe solche Schlangen untersucht, und ihre Zähne unversehrt gefunden. Die Gaukler besitzen wirklich einen Zauber, – einen übernatürlichen allerdings nicht, aber den des Vertrauens und des Mutes. Sie kennen die Sitten und Neigungen dieser Schlange, wissen, wie ungern sie ihre tödliche Waffe gebraucht, und daß sie nur nach vielen vorhergegangenen Reizungen beißt. Wer die Zuversicht und Hurtigkeit dieser Menschen besitzt, kann ihr Spiel auch nachahmen, und ich habe es mehr als einmal getan. Die Gaukler können ihr Spiel mit jeder Hutschlange treiben, sie sei frisch gefangen oder lange eingesperrt gewesen; aber sie wagen es mit keiner andern Giftschlange.« Die Wahrheit der Davyschen Annahme erhielt, laut Tennent, auf Ceylon traurige Bestätigung durch den Tod eines dieser Beschwörer, der infolge seiner Schaustellungen ungewöhnliche Dreistigkeit in Behandlung der Schlangen sich angeeignet hatte, von einer aber in die Brust gebissen wurde und noch am selben Tage verendete.
Eine sehr lebendige Schilderung der Beschwörung hat Rondot gegeben. »Gegen sechs Uhr abends kommt ein indischer Gaukler an Bord. Er ist armselig gekleidet, trägt aber zur Auszeichnung einen mit drei Pfauenfedern geschmückten Turban. In seinen Säcken führt er Halsbänder, Amulette und dergleichen, in einem flachen Körbchen eine Cobra de Capello mit sich. Er richtet sich auf dem Vorderdecke ein; wir lassen uns auf den Bänken des Hinterdeckes nieder; die Matrosen bilden einen Kreis ringsum.
Das Körbchen wird niedergesetzt und sein Deckel weggenommen. Die Schlange liegt zusammengeringelt auf dem Boden. Der Gaukler hockt sich in einiger Entfernung vor ihr nieder und beginnt auf einer Art von Klarinette eine getragene, klägliche, eintönige Weise zu spielen. Die Schlange erhebt sich ein wenig, streckt sich und steigt empor. Es sieht aus, als ob sie sich auf ihren Schwanz, der noch zusammengeringelt ist, gesetzt hat. Sie verläßt den Korb nicht. Nach einem Weilchen zeigt sie sich unruhig, sucht die Örtlichkeit, auf der sie sich befindet, zu erkunden, wird beweglich, entfaltet und breitet ihr Schild, erzürnt sich, schnauft mehr als sie zischt, züngelt lebhaft und wirft sich mehrmals mit Kraft gegen den Gaukler, als ob sie diesen beißen wollte, springt dabei auch wiederholt auf und führt ungeschickte Sätze aus. Je mehr sie ihr Schild bewegt, um so mehr breitet sie es aus. Der Gaukler hat die Augen fortwährend auf sie gerichtet und sieht sie mit einer sonderbaren Starrheit an. Nach Verlauf von zehn bis zwölf Minuten etwa zeigt sich die Schlange weniger erregt, beruhigt sich allmählich und wiegt sich endlich, als ob sie für die nach und nach sich abschwächende Musik des Meisters empfänglich wäre, züngelt jedoch dabei noch immer mit außerordentlicher Lebhaftigkeit. Mehr und mehr scheint ihr Zustand in den der Schlaftrunkenheit oder Traumseligkeit überzugehen. Ihre Augen, die anfänglich den Beschwörer vernichten zu wollen schienen, starren unbeweglich, gewissermaßen bezaubert nach ihm. Der Hindu macht sich diesen Augenblick der Verblüffung der Schlange zunutze, nähert sich ihr langsam, ohne mit seinem Spielen aufzuhören, und drückt zuerst seine Nase, dann seine Zunge auf ihren Kopf. Das währt nicht länger als einen Augenblick; aber in demselben Augenblicke erholt sich die Schlange und wirft sich mit rasender Wut nach dem Gaukler, der mit genauer Not aus ihrem Bereiche sich zurückzieht.
Als der Mann sein Spiel geendet hat, erscheint einer der Offiziere des Schiffes und wünscht auch zu sehen, wie der Hindu seine Lippen auf den beschuppten Kopf des Tieres drückt. Der arme Teufel beginnt seine eintönige Weise von neuem und heftet seinen starren Blick wiederum auf die Cobra. Seine Bemühungen sind vergeblich. Die Schlange befindet sich in einem Zustande der äußersten Erregung; nichts wirkt auf sie ein. Sie will das Körbchen verlassen, und dieses muß bedeckt werden.
Wir bezweifeln, daß die Cobra noch im Besitze ihrer Gifthaken und die von dem Hindu ausgedrückte Furcht vor ihr wirklich begründet ist. Deshalb verlangen wir, daß der Mann zwei Hühner beißen lassen soll, und versprechen ihm einen spanischen Piaster dafür. Er nimmt ein schwarzes Huhn und hält es der Schlange vor. Sie erhebt sich zur Hälfte, betrachtet das Huhn einen Augenblick, beißt und läßt es los. Das Huhn wird freigegeben und flüchtet erschreckt. Sechs Minuten später (die Uhr in der Hand) erbricht es sich, streckt die Beine von sich und stirbt. Ein zweites Huhn wird der Schlange vorgehalten: sie beißt es zweimal, und es stirbt nach acht Minuten.«
Graf Karl von Görtz beschreibt in seiner Reise um die Welt das Gaukelspiel etwas anders. Die Brillenschlangen, mit denen die Beschwörer in Madras vor ihm spielten, lagen ebenfalls in flachen Körben zusammengerollt; der Hauptmann des Trupps aber nahm eine nach der andern beim Kopfe, legte sie frei auf den Boden und begann nun erst die ohrzerreißenden Töne aus einer wunderlichen Klarinette, an deren Ende ein kleiner Kürbis angebracht war, hervorzulocken. Die Tiere richteten sich mit Kopf und Hals empor, sahen ihm starr ins Gesicht und breiteten ihren Hals weit aus, ohne sich weiter zu rühren. Nunmehr hielt ihnen der Mann die Faust vor den Kopf, sie zuckten mit diesem nach ihr zu, als wollten sie beißen, öffneten aber das Maul nicht. Mit Nasenspitze und Zunge führte er dasselbe aus wie mit jener. Durch einen festen Blick suchte er nicht zu bezaubern, griff vielmehr oft nachlässig an den Tieren vorüber und schlang sie zuletzt gar an seinen Hals. Von einer tanzenden Bewegung der Schlange war nichts zu sehen; in ihrem Benehmen sprach sich einerseits alle Bosheit und Wut ihrer Art, anderseits aber auch Furcht vor dem Beschwörer deutlich aus, und es war leicht zu erraten, daß die Zähmung in der Weise vor sich geht, daß man sie in harte oder heiß gemachte Gegenstände beißen ließ. »Die Giftzähne waren ausgerissen, wie ich mich selbst überzeugte und wie die Leute auch willig zugestanden.«
Die Brillenschlange ist aus dem Grunde der Liebling aller dieser Leute, weil ihre Stellung sie auffallender erscheinen läßt als jede andere Giftschlange, und die Häufigkeit ihres Vorkommens einen Schlangenbeschwörer niemals in Verlegenheit setzt. Denjenigen, die zu regelmäßigen Schaustellungen benutzt werden, hat man fast immer die Gifthaken ausgezogen und außerdem noch die Falte, in der letztere liegen, und von der aus sie ersetzt werden, ausgeschnitten. Demungeachtet muß man zugestehen, daß die Schlangenbeschwörer auch sehr wohl mit solchen Giftschlangen umzugehen wissen, die noch in vollem Besitze ihrer dämonischen Kraft sich befinden. Die Gewandtheit, die sie bekunden, indem sie eine in dichtem Grase dahineilende Giftschlange mit der bloßen Hand vom Boden aufnehmen, ohne jetzt schon verletzt zu werden, und die Sicherheit, mit der sie dieselbe später behandeln, ist in hohem Grade bewunderungswürdig. Die Schlangenbeschwörer kennen die Gefahr wohl, der sie sich aussetzen, und wissen so gut als irgend jemand, daß kein einziges Mittel als Gegengift angesehen werden darf, obwohl sie dies vorgeben und solche Mittel verkaufen. Außer den giftigen Schlangen stellen sie stets auch ungiftige aus, niemals aber, ohne die Pfeife erklingen zu lassen.
Mit dem Fange und der Ablichtung der Brillenschlange beschäftigen sich außer den Gauklern auch die Brahminen. Kämpfer erzählt, wie man verfahren muß, um Schlangen die Lust zum Beißen zu vertreiben. »Ein Brahmine hatte zweiundzwanzig Schlangen in ebenso vielen irdenen Gesäßen, die groß genug waren, ihnen die nötige Bewegung zu gestatten, und durch einen Deckel geschlossen werden konnten. Wenn die Witterung nicht zu heiß war, ließ er eine Schlange nach der anderen aus ihrem Gefängnisse und übte sie längere oder kürzere Zeit, je nach den Fortschritten, die sie schon in ihrer Kunst gemacht hatten. Sobald die Schlange aus dem Gefäße gekrochen war und entrinnen wollte, drehte der Meister ihr den Kopf vermittels einiger Schläge eines Rütchens nach sich zu und hielt ihr in dem Augenblicke, in dem sie nach ihm beißen wollte, das Gefäß vor, mit ihm wie mit einem Schilde die Bisse auffangend. Bald sah sie ein, daß ihre Wut nichts ausrichtete, und zog sich zurück. Eine Viertel- oder selbst eine halbe Stunde lang währte dieser Kampf zwischen Mensch und Schlange, und die ganze Zeit über folgte letztere beständig mit ausgebreitetem Schilde und zum Bisse freigelegten Giftzähnen allen Bewegungen des ihr vorgehaltenen Gefäßes. So wurde sie allmählich daran gewöhnt, sich, sobald man ihr das Gefäß vorhielt, aufzurichten. Späterhin hielt der Meister ihr statt des letzteren die Hand vor; die Schlange aber wagte nicht vorzuschnellen, weil sie glaubte, daß sie eben wiederum in Ton beißen würde. Der Gaukler begleitete die Bewegungen mit seinem Gesänge, um die Täuschung zu vermehren. Trotz aller Geschicklichkeit und Vorsicht hätte er jedoch verletzt werden können; deshalb ließ er die Schlange vorher in ein Stück Tuch beißen und ihres Giftes sich entledigen.«
Ich will es unentschieden lassen, wieviel Wahrheit in dieser Mitteilung enthalten ist, darf jedoch nicht verschweigen, daß es mir scheint, als ob die Erzählung nur auf Hörensagen, nicht aber auf eigener Beobachtung beruhe. Es mag sein, und Davys Bericht scheint dafür zu sprechen, daß Schildottern leichter als andere Giftschlangen Lehre annehmen; für sehr zweifelhaft aber halte ich es, daß eine Ablichtung von Nutzen sein könnte. Man erzählt in Indien wundersame Geschichten. »Haben Sie«, schreibt Skinner an Tennent, »jemals von zahmen Brillenschlangen gehört, die man gefangen und ans Haus gewöhnt hat, denen man gestattet, aus- und einzugehen nach eigenem Belieben und in Gesellschaft mit den übrigen Bewohnern des Hauses? Ein wohlhabender Mann, der in der Gegend von Negombo wohnt und beständig bedeutende Geldsummen in seinem Hause hat, hält die Cobra an Stelle der Hunde als Beschützer seiner Schätze. Aber das ist keineswegs ein vereinzelter Fall dieser Art. Ich hörte erst vor einigen Tagen von einem solchen, und zwar von einem unbedingt glaubwürdigen Manne. Die Schlangen treiben sich im ganzen Hause umher, ein Schrecken für die Diebe, versuchen aber niemals die rechtmäßigen Bewohner des Hauses zu verletzen.« Darf man derartigen Mitteilungen Glauben schenken? Ich bezweifle es, trotzdem sie uralte Behauptungen zu bestätigen scheinen; ich mißtraue ihnen um so mehr, als mir der Ursprung derselben sehr erklärlich scheint. Ein wohlhabender und gebildeter Mann, der das rohe Volk richtig zu beurteilen weiß, läßt ein derartiges Märchen aussprengen, um sich vor unerwünschten Besuchen zu sichern, hält vielleicht auch wirklich einige Brillenschlangen, die gelegentlich gezeigt werden, um seiner Erfindung den Stempel der Wahrhaftigkeit aufzudrücken. Das wird das Körnlein Wahrheit sein, das in der ganzen Erzählung zu finden ist.
Über die Bißwirkung der Cobra de Capello sind von Russell, Johnson, Breton, Fayrer und andern vielfache Versuche angestellt worden, die die Gefährlichkeit dieser Schlange zur Genüge dartun. Tauben starben drei bis vier, Hühner vier bis sechs, Hunde zwanzig Minuten bis mehrere Stunden nach erhaltenem Bisse; Menschen quälten sich mehrere Stunden lang, bevor sie erlagen. Johnson fand, daß in allen Fällen das Gift mehr und mehr von seiner tötenden Kraft verlor, Wenn man eine und dieselbe Brillenschlange kurz nacheinander verschiedene Tiere beißen ließ, und glaubt, als Ergebnis seiner Versuche aufstellen zu dürfen, daß das Gift durch Erhaltung in den Drüsen stets an Kraft und im Verhältnisse zur Wärme der Witterung an Flüssigkeit zunimmt, ebenso, daß die Schlangen die Fähigkeit zu töten, zu verschiedenen Zeiten in verschiedenem Grade besitzen. Auch Breton fand, daß mehrere aufeinanderfolgende Bisse an Kraft verlieren. Er ließ eine sogenannte Wasserschlange von einer Cobra de Capello in den Schwanz beißen. Anderthalb Stunden darauf vermochte jene die gebissene Stelle nicht mehr zu gebrauchen, wurde nach und nach matt und starb, ohne daß sich ein anderer Zufall, als ein immerwährendes Nachluftschnappen gezeigt hätte, nach Verlauf von zwei Stunden und fünfzehn Minuten. Ein Kaninchen, das unmittelbar darauf von derselben Schlange in den Schenkel gebissen worden war, bekundete Lähmung und Schwäche, bekam leichte Krämpfe und starb nach elf Minuten. Eine hierauf gebissene Taube verendete nach siebenundzwanzig Minuten, eine zweite erst nach einer Stunde und elf Minuten, eine dritte nach drei Stunden zweiundvierzig Minuten: eine vierte ließ kein Anzeichen der Vergiftung mehr erkennen, und auch eine fünfte litt nichts infolge des Bisses. Von derselben Cobra wurden andere Giftschlangen verwundet, ohne daß sich irgendein Erfolg der Giftwirkung zeigte.
Fayrer hat drei Jahre hintereinander die umfassendsten Versuche angestellt, um zu erfahren, welche Wirkungen das Gift der indischen Schlangen und insbesondere das der Brillenschlange äußert. Zu diesen Versuchen wurden vorzugsweise Hunde und Hühner, außerdem Pferde, Rinder, Ziegen, Schweine, Katzen, Schleichkatzen, Mungos, Kaninchen, Ratten, Milane, Reiher, Eidechsen, giftlose und giftige Schlangen, Frösche, Kröten, Fische und Schnecken verwendet und alle Beobachtungen sorgfältig niedergeschrieben. Aus allen Mitteilungen geht soviel hervor, daß das Gift der Brillenschlange auf sämtliche Tiere wirkt, mit denen Versuche angestellt wurden, und daß die Wirkung eine überaus heftige, meist auch äußerst rasche ist, daß endlich Gegenmittel der verschiedensten Art entweder gar keinen oder doch nur höchst geringen Erfolg haben, und daß Bisse, die ein größeres Blutgefäß treffen, als unbedingt tödlich angesehen werden müssen.
Die Indier wissen von einer ziemlichen Anzahl kleinerer Raubsäugetiere, die Mungos voran, und von verschiedenen Raubvögeln zu erzählen, die dem giftigen Gewürm eifrig nachstellen sollen. Als beachtenswert möge noch erwähnt sein, daß man Vermehrung der Schlangen überall da beobachtet hat oder doch beobachtet haben will, wo man Pfauen und anderen Wildhühnern eifrig nachstellte und sie demzufolge sehr verminderte. Hieraus würde also hervorgehen, daß diese großen und stolzen Hühner mit den Brillenschlangen ebenso verfahren wie unsere Haushühner mit der Kreuzotter. Auch von den Hirschen Ceylons behauptet man, daß sie viele Schlangen vertilgen, indem sie plötzlich mit allen vier Läufen zugleich auf sie springen und sie durch Stampfen töten.
Die erschreckende Anzahl von Unglücksfällen hat neuerdings die englischen Behörden bewogen, zu ernsteren Mitteln zur Vernichtung der Giftschlangen und vor allem der Brillenschlange zu schreiten. Glücklicherweise denken nicht alle Hindus so, wie weiter oben angegeben; viele der niederen Kasten befassen sich im Gegenteile so gut als ausschließlich mit dem Fange oder der Tötung von Giftschlangen, die einen, um mit ihnen zu gaukeln, die andern, um durch Fang oder Tötung kärglichen Lohn zu gewinnen. Im Jahre 1858 wurde von der Regierung eine Belohnung von vier Annas oder achtundvierzig Pfennigen unseres Geldes für jede getötete und der Behörde vorgelegte Giftschlange ausgesetzt und in einem einzigen Kreise nicht weniger als eintausendneunhunderteinundsechzig Rupien oder doppelt soviel Mark unseres Geldes ausgegeben. Als man die Belohnung auf zwei Annas herabsetzte, nahm die Anzahl der eingelieferten Schlangen jählings ab, so daß man 1859 in demselben Kreise nur hundertvierundzwanzig, 1860 sogar nur siebenundzwanzig, 1861 aber nur eine einzige Rupie auszugeben hatte; denn niemand wollte für die geringe Summe von zwei Annas sein Leben auf das Spiel setzen. Im Jahre 1862 erhöhte man die Belohnung wiederum auf vier Annas, und sofort zogen auch wieder Leute zum Schlangenfangen aus, so daß schon am ersten Tage siebenundvierzig, am zweiten siebzig, später hundertundachtzehn Giftschlangen täglich eingeliefert wurden. Am zwanzigsten Oktober berichtete der Beamte, daß vom neunundzwanzigsten Mai bis zum vierzehnten Oktober 1862 nicht weniger als achtzehntausendvierhundertdreiundzwanzig Schlangen oder hundertzehn täglich, getötet worden waren, und verlangte eine neue Summe von zehntausend Rupien, um fernerhin die Belohnung leisten zu können, schlug aber gleichzeitig vor, letztere wiederum auf zwei Annas herabzusetzen. Vom fünfzehnten Oktober bis zum siebenten Dezember stieg die Ausbeute so bedeutend, daß sechsundzwanzigtausendneunundzwanzig oder täglich durchschnittlich mehr als vierhundertdreiundsechzig Schlangen zur Ablieferung kamen. Als der Statthalter sein Erstaunen ausdrückte, daß gerade im kalten Winter so viele Schlangen gefangen würden, erklärte man ihm dies einfach und richtig durch den Zuwachs an Schlangenfängern und die von letzteren allmählich gewonnene Erfahrung.
Ein ähnliches Schauspiel, wie es die indischen Schlangenbeschwörer bieten, kann man an jedem Festtage auf öffentlichen Plätzen Kairos sehen. Dumpfe, jedoch schallende Töne, hervorgebracht auf einer großen Muschel, lenken die Aufmerksamkeit einem Manne zu, der sich eben anschickt, eine jener unter den Söhnen und Töchtern der »siegreichen Hauptstadt und Mutter der Welt« im höchsten Grade beliebten Schaustellungen zu geben. Bald hat sich ein Kreis rings um den »Haui« gebildet, und die Vorstellung nimmt ihren Anfang. Ein zerlumpter Junge vertritt die Rolle des Hanswurstes und ergeht sich in plumpen, rohen und gemeinen Scherzen, die bei den meisten Zuschauern nicht bloß volles Verständnis, sondern auch Widerhall finden; ein Mantelpavian zeigt seine Gelehrigkeit, und die Gehilfin des Schaustellers macht sich auf, den kargen Lohn in Gestalt wenig geltender Kupfermünzen einzuheimsen. Denn das Wunderbarste steht noch bevor: die offenbare Zauberei des von gar manchen mit Scheu betrachteten Mannes soll sich erst allmänniglich kundtun.
Geschäftig laufen und springen Schausteller, Hanswurst und Affe durch- und übereinander, zerrend an diesem Gegenstande, herbeischleppend einen anderen. Endlich ergreift der Haui einen der Ledersäcke, in denen er seine sämtlichen Gerätschaften aufbewahrt, wirft ihn mitten in den Kreis, öffnet die Schleife, die ihn bis dahin zusammenhielt, nimmt anstatt der Muschel die »Sumara«, ein von musikfeindlichen Dämonen erfundenes Werkzeug, und beginnt seine eintönige Weise zu spielen. In dem Sacke regt und bewegt es sich, näher und näher zur Öffnung kriecht es heran, und schließlich wird der kleine eiförmige Kopf einer Schlange sichtbar. Dem Kopfe folgt Hals und Vorderleib, und sowie dieser frei, erhebt sich das Tier genau in derselben Weise wie die Brillenschlange, schlängelt sich vollends aus dem Sacke heraus und bewegt sich nun in einem ihr von dem Gaukler gewissermaßen vorgeschriebenen Umkreise langsam auf und nieder, das kleine Köpfchen stolz auf dem gebreiteten Halse wiegend, mit blitzenden Augen jede Bewegung des Mannes verfolgend. Allgemeines Entsetzen ergreift die Versammlung: denn jedermann weiß, daß diese Schlange die mit Recht gefürchtete »Haie« ist; aber kaum ein einziger hält es für möglich, daß der Gaukler ohne Gefahr ihres Zornes spotten darf, weil er so klug gewesen, ihr die Giftzähne auszubrechen. Der Haui dreht und windet sie, wie bei uns Tierschaubudenbesitzer zu tun pflegen, um ihre Zahmheit zu zeigen, faßt sie am Halse, spuckt sie an oder bespritzt sie mit Wasser und drückt, unmerklich für den Beschauer, plötzlich an einer Stelle des Nackens. In demselben Augenblicke streckt sich die Schlange ihrer ganzen Länge nach, – und wahr und verständlich wird die alte Geschichte: »Aaron warf seinen Stab vor Pharao und vor seinen Knechten, und er ward zur Schlange. Da forderte Pharao die Weisen und Zauberer. Und die ägyptischen Zauberer taten auch also mit ihrem Beschwören. Ein jeglicher warf seinen Stab von sich, da wurden Schlangen daraus.«
Die Schlange, mit der Moses und Aaron vor Pharao gaukelten, wie heutigentags der Haui, ist die hochberühmte Aspis der Griechen und Römer, die Ara oder Aufgerichtete der alten Ägypter, das Sinnbild der Erhabenheit, deren Bildnis man eingemeißelt sieht an den Tempeln zu beiden Seiten der Weltkugel, deren Nachbildung der König als zierendes Abzeichen seiner Hoheit und Herrschergewalt an der Stirne trug, der später nach dem altägyptischen Worte benamsete » Uräus«, die berühmteste Schlange der Erde. Was das wunderbare Nilvolk eigentlich bewogen hat, ihr einen so hervorragenden Platz unter den anderen Tiergestalten zu gewähren: ob die auffallende Stellung, die sie zuweilen annimmt, oder der Nutzen, den sie dem Ackerbautreibenden durch Aufzehrung der Ratten und Mäuse bringt, oder die entsetzliche Wirkung ihrer Giftzähne, muß ich dahingestellt sein lassen. Von der Aspis weiß fast jeder römische oder griechische Schriftsteller zu berichten, von ihrem Leben und Wirken, von der Verehrung, die sie genoß, der Verwendung, die sie fand, etwas mitzuteilen. Aber freilich vereinigt auch fast jeder Wahres und Falsches, Erfahrenes und Erdachtes.
Die Uräusschlange, Aspis, Haie oder ägyptische Brillenschlange ( Naja haje) übertrifft ihre asiatische Verwandte noch etwas an Größe, da die Länge eines ausgewachsenen Stückes reichlich zwei Meter beträgt. Hinsichtlich der Färbung läßt sich von ihr ebensowenig etwas allgemein Gültiges sagen als von der Brillenschlange. Die meisten und namentlich die ägyptischen Aspiden sehen auf der Oberseite gleichmäßig strohgelb, auf der unteren lichtgelb aus, haben jedoch in der Halsgegend mehrere verschieden breite, dunklere Querbänder, die sich über einige Schilder erstrecken. Nun aber gibt es Spielarten, die oben von Strohgelb bis Schwarzbraun alle Schattierungen und unten ebenfalls die verschiedensten Färbungen zeigen.
Angenommen, daß alle in Frage kommenden Aspiden zu einer Art gezählt werden müssen, hat man als Verbreitungsgebiet des gefährlichen Tieres ganz Afrika anzusehen. In den Nilländern kommt sie an geeigneten Orten sehr häufig vor; in Südostafrika und im Kaplande ist sie allgemein; an der Westküste fehlt sie nirgends; im Innern Afrikas hat sie Livingstone wiederholt beobachtet oder von ihr erzählen hören. Ihre Aufenthaltsorte sind verschieden. In dem baumlosen Ägypten bewohnt sie die Felder und die Wüste, zwischen Getrümmer und Felsgestein ihre Schlupfwinkel suchend, auch wohl in der Höhle einer Renn- oder Springmaus Wohnung nehmend; im Sudan und am Vorgebirge der Guten Hoffnung hält sie sich im Walde und in der Steppe auf, wo ihr verschiedene kleine Säugetiere überall Behausungen bereiten oder unterhöhltes Gewurzel der Bäume solche gewähren; in den Gebirgen, die sie keineswegs meidet, findet sie unter größeren Steinblöcken oder selbst in dem dichten Pflanzengestrüpp, das den Boden hier überzieht, der Versteckplätze genug. Sie ist nirgends selten; trotzdem begegnet man ihr nicht so häufig, als man glauben möchte. Ich habe sie in der Nähe verschiedener Tempel, im Urwalde und auch im abessinischen Hochlande erlegt; wenigstens nehme ich an, daß eine Giftnatter von zwei Meter Länge, die ich im Bogoslande mit einem Schrotschusse tötete, trotz der abweichenden Färbung unsere Aspis war.
Beachtenswert ist, daß die Ansiedler am Vorgebirge der Guten Hoffnung und die Neger der Westküste berichten, daß die Aspis ihr Gift von sich speien und dadurch einen Angreifer gefährden könne. Gordon Cumming versichert, daß ihm selbst ein derartiges Mißgeschick begegnet sei, und er infolgedessen eine ganze Nacht die heftigsten Schmerzen habe aushalten müssen. »Die Aspisschlangen«, schreibt mir Reichenow, »sind an der Goldküste sehr häufig. Sie bewohnen die gemischten Steppen und meiden den dichten Wald. In der Mittagshitze kriechen sie gern auf die Wege hinaus, um sich zu sonnen. Stößt dann jemand auf sie, so richten sie sich steil empor, zischen, blasen den Hals auf und speien eine Flüssigkeit auf die Entfernung eines Meters gegen den Ruhestörer, wobei sie immer nach den Augen zu zielen scheinen. Die Menge dieser Flüssigkeit ist ziemlich bedeutend, da die Schlangen oft dreimal hintereinander speien und ihnen schließlich der Saft vom Maule herabtropft. Nach Angabe der Missionare an der Goldküste sowie der Eingeborenen erfolgt Erblindung, wenn jener Geifer in das Auge kommt. Ich will bemerken, daß mir auch Effeldt von ähnlichen, an Klapperschlangen gemachten Erfahrungen berichtet, aber gleichzeitig versichert hat, daß solcher Speichel, der mit Gift vermischt sein kann, keine andere Wirkung auf die Hornhäute auszuüben vermag, als irgendeine andere ätzende Flüssigkeit.« übereinstimmend mit Reichenow erzählt mir Falkenstein von dem Anspeien der Uräusschlange und scheint dies als ein sehr gewöhnliches Vorkommnis zu betrachten.
Hinsichtlich der Art und Weise, sich zu bewegen, kommt die Haie, wie es scheint, vollständig mit der Brillenschlange überein. Auch sie ist gewandt auf dem Boden, geht oft und freiwillig ins Wasser, schwimmt sehr gut und klettert wie ihre Verwandte.
Die Beute der Aspis besteht in allerlei kleinen Tieren, insbesondere in Feld-, Renn- und Springmäusen, Vögeln, die am Boden leben, und deren Brut, Eidechsen, anderen Schlangen, Fröschen und Kröten, je nach Örtlichkeit und Gelegenheit.
Jeder ägyptische Gaukler fängt sich die Aspiden, deren er zu seinen Schaustellungen bedarf, selbst ein, und zwar auf sehr einfache Weise. Bewaffnet mit einem langen, starken Stocke aus Mimosenholz, dem sogenannten Nabut, besucht er versprechende Plätze und stöbert hier alle geeigneten Schlupfwinkel durch, bis er einer Haie ansichtig wird. An dem einen Ende des Stockes hat er ein Lumpenbündel befestigt, und dieses hält er der Schlange vor, sobald sie sich drohend aufrichtet und Miene macht, von der Verteidigung zum Angriff überzugehen. In der Wut beißt sie in die Lumpen, und in demselben Augenblick wirft der Fänger mit einer raschen Bewegung den Stock zurück, in der Absicht, ihr die Zähne auszubrechen. Niemals aber begnügt er sich mit einem Versuche, sondern foppt und reizt die Schlange so lange, bis sie viele Male gebissen, ihre Giftzähne bestimmt verloren und sich gleichzeitig vollständig erschöpft hat. Nunmehr preßt er ihren Kopf mit dem Knüppel fest auf den Boden, nähert sich vorsichtig, packt sie am Halse, drückt sie an der ihm bekannten Stelle des Nackens, versetzt sie in eine Art von Starrkrampf und untersucht ihr endlich das Maul, um zu sehen, ob wirklich die Giftzähne ausgerissen wurden. Auch er weiß sehr wohl, daß diese Waffen sich von selbst wieder ersetzen, und unterläßt es nie, von Zeit zu Zeit das alte Spiel zu wiederholen.
Von der Wahrheit vorstehender Worte habe ich mich durch eigene Beobachtung überzeugt. Während wir uns in Fajum am Mörissee aufhielten, erschien eines Tages ein Haui in unserer Wohnung und versicherte uns, daß in derselben Schlangen sich eingenistet hätten, und er gekommen sei, dieselben zu vertreiben. Ich entgegnete ihm, daß wir das letztere bereits selbst besorgt hätten, jedoch geneigt wären, ihm eine Schaustellung vor uns zu gestatten. Sofort öffnete er den mitgebrachten Schlangensack und ließ sechs bis acht Aspiden in unserm Zimmer »tanzen«. Nunmehr ersuchte ich ihn, mir einige zu bringen, die noch im Besitze ihrer Giftzähne seien, da ich wisse, daß die, die wir vor uns sähen, gedachte Zähne nicht mehr besäßen. Er beteuerte das Gegenteil, bis wir uns ihm als Schlangenbeschwörer aus Frankistan, dem Lande der Europäer, also gewissermaßen als Berufsgenossen vorstellten. Das Glück, das ich habe, wenn ich irgendeine Tierbude besuche und erkannt werde, nämlich, mit größter Zuvorkommenheit behandelt und »Herr Kollege« genannt zu werden, wurde mir auch in diesem Falle zuteil. Unser Haui zwinkerte vielsagend mit den Augen und ließ einige landläufige Redensarten über »leben und leben lassen, Härte des Schicksals, Schwierigkeit des Broterwerbes, dummes Volk, Söhne, Enkel, Urenkel und Nachkommen von Eseln« (worunter er seine hochachtbaren Schaugäste verstand) und ähnliches mehr vernehmen, versprach auch schließlich, wahrscheinlich mehr durch die in Aussicht gestellte Belohnung als durch Rücksicht der Berufsgenossenschaft bestimmt, mir, dem europäischen Schlangenbeschwörer, und dessen Freunde, dem berühmten Arzte, eine große Haie mit Giftzähnen zu bringen. Schon am andern Tage erschien er mit dem bekannten Ledersacke auf der Schulter wieder in unserm Zimmer, legte den Sack aus den Boden, öffnete ihn ohne alle Possen mit äußerster Vorsicht, hielt seinen Stock bereit und wartete auf das Erscheinen der Schlange. Hervor kam das zierliche Köpfchen: aber ehe noch so viel vom Leibe zu Tag gefördert worden war, daß die Haie zur » Ara« werden konnte, hatte er sie vermittels des Stockes zu Boden gedrückt, mit der Rechten im Nacken gepackt, mit der Linken die Leibesmitte samt des sie umhüllenden Ledersackes gefaßt und – entgegen starrten uns bei der Öffnung des Maules unversehrt beide Gifthaken. »So, mein Bruder«, sagte er, »mein Wort ist das der Wahrheit, meine Rede ohne Trug. Ich habe sie gefangen, die gefährliche, ohne sie zu verletzen. Gott, der erhabene, ist groß und Mohammed sein Prophet.«
Eine Minute später schwamm die Haie in einer mit Weingeist gefüllten, bauchigen Flasche und mühte sich vergebens, den Kork derselben auszustoßen. Minutenlang schien der Weingeist auf sie nicht den geringsten Einfluß zu äußern; nach Verlauf einer Viertelstunde aber wurden ihre Bewegungen matter, und wiederum eine Viertelstunde später lag sie, bewegungslos zusammengeringelt, am Boden des Gefäßes.
Die Aspis kommt oft lebend nach Europa, gewöhnlich aber auch nur mit ausgerissenen Giftzähnen, und geht dann meist zugrunde, obgleich sie sich leichter als andere Giftschlangen in die Gefangenschaft fügt, bald zum Fressen bequemt und nach und nach wirklich mit ihrem Geschick aussöhnt. Anfangs freilich wird sie, wenn sich der Pfleger ihrem Behältnisse nähert, regelmäßig zur »Ara« und bleibt manchmal stundenlang in ihrer aufgerichteten Stellung; später jedoch mindert sich ihre Reizbarkeit, obschon sie mit ihrem Pfleger wohl niemals in ein freundschaftliches Verhältnis tritt. Aspiden, die Effeldt gefangen hielt, gingen, trotzdem sie keine Gifthaken hatten, bald ans Fressen, nahmen zuerst lebende, später tote Mäuse und Vögel, bevorzugten die Säugetiere den Vögeln und verschmähten Kriechtiere und Lurche, griffen diese mindestens nicht an und bewiesen insofern Abscheu vor ihnen, als sie sich zurückzogen, wenn jene sich um sie her bewegten. Wasser schien zu ihrem Wohlbefinden unumgänglich nötig zu sein: sie badeten sehr regelmäßig und verweilten mit ersichtlichem Behagen stundenlang in ihrem Badebecken. Etwa nach Jahresfrist waren ihre Gifthaken wiederum ausgebildet und sie nunmehr nur mit äußerster Vorsicht zu behandeln, da ihre Angriffe unvermutet und blitzschnell geschehen, sie den Kopf auch erstaunlich weit vor- oder emporwerfen.
*
So schwierig es ist, die Abteilungen der Schlangen zu begrenzen, so leicht lassen sich die Seeschlangen ( Hydrini) erkennen und von allen übrigen unterscheiden: ihr Ruderschwanz ist ein so bezeichnendes Merkmal, daß sie unmöglich mit andern verwechselt werden können. Bei roher Vergleichung scheinen sie aalartigen Fischen ähnlicher zu sein als anderen Schlangen. Ihr Kopf ist verhältnismäßig klein, der Rumpf kurz, in seinem Vorderteile fast walzig, weiter hinten seitlich zusammengedrückt, der Schwanz sehr kurz und einem senkrecht gestellten Ruder vergleichbar. Die Nasenlöcher öffnen sich auf der Oberseite der Schnauze in großen Nasenschildern; die kleinen Augen haben runden Stern. Der Kopf wird stets mit großen, unregelmäßigen Schildern, der Leib mit kleinen Schuppen bekleidet, die auch auf der Unterseite nur ausnahmsweise zu Schildchen sich gestalten. Das Gebiß besteht aus kurzen, gefurchten Giftzähnen, an die sich hinten noch eine Anzahl kleinerer, leicht gerinnelter Zähne reihen; den Unterkiefer waffnen seiner ganzen Länge nach feste Fangzähne.
Mit dem fabelhaften Ungetüme, das zwar nicht im Meer, wohl aber von Zeit zu Zeit in den Köpfen der Schiffer und sodann auch regelmäßig in den Tagesblättern spukt, haben die Seeschlangen der Wissenschaft nichts gemein. Keine einzige von ihnen erreicht vier Meter an Länge; solche, die die Hälfte oder dritthalb Meter messen, zählen schon zu den seltenen Erscheinungen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Sippen sind gering, die zwischen den einzelnen Arten noch geringer.
Dem ausgezeichneten Baue entsprechen Aufenthalt und Lebensweise, so daß also diese Familie als eine in jeder Hinsicht nach außen wohl abgegrenzte erscheinen muß. Alle Seeschlangen leben, wie ihr Name sagt, ausschließlich im Meere. Das Indische und Stille Weltmeer, von den Küsten Madagaskars an bis zur Landenge von Panama, insbesondere aber die zwischen der südchinesischen und nordaustralischen Küste gelegenen Teile, gewähren ihnen Herberge. In ihrem Wesen, ihren Sitten und Gewohnheiten scheinen sich alle Arten zu gleichen. Eine Schilderung ihrer Lebensweise kann sich daher nicht auf einzelne Arten oder Sippen beschränken, sondern muß die gesamte Familie umfassen.
Unter den Plattschwänzen ( Platurus) ist die Zeilenschlange ( Platurus laticaudatus) die häufigste und bekannteste. Ihre Länge kann bis zu 1,6 Meter ansteigen, bleibt jedoch meist hinter diesen Maßen zurück. Die Grundfärbung der Oberseite ist mehr oder minder lebhaft bläulich- oder grünlichgrau, die der Unterseite gelblichweiß bis gummiguttgelb; die Zeichnung besteht aus fünfundzwanzig bis fünfzig schwarzen Ringen, die den ganzen Leib umgeben, und einem schwarzen Scheitelflecke, der mit einem zweiten Querflecke am Hinterhaupte und einem ebensolchen im Nacken jederseits durch ein am Kinn beginnendes, gleichgefärbtes Längsband verbunden wird, sowie endlich einem schwarzen Zügelstreifen, der, wie die Kopfbänder, von der lebhaft gelb gefärbten Schnauze scharf absticht. Das Verbreitungsgebiet der Zeilenschlange erstreckt sich von dem Bengalischen Meerbusen an bis zum Chinesischen Meer und der Küste Neuseelands.
Unter den sehr zahlreichen Arten der Sippe der Ruderschlangen ( Hydrophis), die den Kern der Familie bildet, verdient die Streifenruderschlange ( Hydrophis cyanocincta) genannt zu werden, weil sie eine der häufigsten aller Seeschlangen ist. Ihre Länge kann zwei Meter übersteigen. Die Grundfärbung der Oberseite ist olivengrün, die der Unterseite grünlichgelb; die Zeichnung besteht aus fünfzig bis siebzig schwarzen Querbändern, die vielfach abändern, bei jungen Tieren Ringe bilden und oft noch durch eine längs des Bauches verlaufende Linie verbunden werden, bei älteren nach der Unterseite zu mehr und mehr verschwinden, sich verwischen oder in Flecke auflösen, in der Regel aber bis zur Hälfte des Leibes reichen und in der Mitte des Leibes am breitesten sind. Der Verbreitungskreis erstreckt sich von Ceylon bis zum Japanischen Meer. Sie ist häufig an den Küsten erstgenannter Insel, im Bengalischen Meerbusen und im Ostindischen Inselmeere.
Zu den Pelamiden ( Pelamis) endlich gehört als bekannteste Art der Sippe die Plättchenschlange ( Pelamis bicolor). Ihre Färbung ist ein dunkles Braunschwarz, die der Unterseite ein lichtes Hellbraun, Ockergelb oder Weiß; beide Farben, die sich scharf voneinander scheiden oder durch eine lichtere Linie voneinander getrennt werden, gehen in der Schwanzgegend ineinander über, so daß hier Bänder und Flecke entstehen. Die Länge des Tieres erreicht nur ausnahmsweise einen Meter. Die Plättchenschlange ist die gemeinste und bekannteste Art ihrer Familie; denn ihr Verbreitungskreis erstreckt sich von Otaheiti bis nach Indien und von Madagaskar bis Panama. Sie kommt häufig vor in der Nähe der Küsten von Bengalen, Malabar, Sumatra, Java, Celebes, China und Port Jackson.
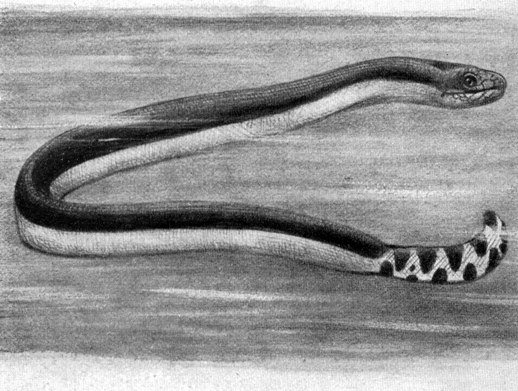
Plättchenschlange ( Pelamis bicolor)
Erfahrene Schiffer, die das Indische Weltmeer zu wiederholten Malen durchkreuzten und sich gewöhnten, auf dessen Erscheinungen zu achten, sehen es als ein Zeichen von der Nähe des Landes an, wenn sie Seeschlangen wahrnehmen; denn diese entfernen sich nur ausnahmsweise von den Küsten, die erwachsenen, wie es scheint, immer noch eher als die jungen, da letztere, laut Cantor, stets viel häufiger gefangen werden als jene. Eine gewisse Nähe des Landes scheint Bedingung für ihr Leben zu sein; Küstentiere aber sind sie ebensowenig als Bewohner weiter inselloser Seeflächen, so leicht es ihnen auch werden dürfte, diese zu durchwandern, und so bestimmt sie zu Zeiten, vielleicht bewogen durch geschlechtliche Triebe, dem Strande mehr als sonst sich nähern. Ihr Lieblingsaufenthalt sind die breiten Meeresarme zwischen den Inseln, wahrscheinlich dem hier verhältnismäßig ruhigen Wasser zu Gefallen. Allerdings hat man sie zuweilen auch in hohem Meere angetroffen, dann aber immer als verschlagene betrachtet, die durch Stürme gewaltsam weitergeführt worden waren. Bis in das Atlantische Weltmeer hat sich, soviel bis jetzt bekannt, noch niemals eine derartige, Schlange verirrt. Zuweilen geschieht es, daß sie mit der Flut in den Küstenflüssen emporgeführt werden; aber auch hier bemerkt man sie immer nur kurze Zeit, weil sie nicht imstande sind, in süßen Gewässern zu leben. Russell, Cantor und Fayrer erfuhren, daß alle Seeschlangen, die lebend in ihren Besitz kamen, zwei oder drei, höchstens zehn Tage nach ihrer Gefangennahme verendeten, selbst wenn man sie im Salzwasser hielt; und auch andre Beobachtungen beweisen, daß unsre Schlangen in demselben Sinne Seetiere sind wie Wale oder Weltmeervögel, daß sie außerhalb des Meeres nicht bestehen können.
Über die Lebensweise sind wir, wie leicht erklärlich, noch keineswegs genügend unterrichtet. Abweichend von den Ordnungsverwandten sieht man die Seeschlangen gewöhnlich in sehr großer Anzahl beisammen, zuweilen in Gesellschaften, die auf eine Strecke hin das Wasser förmlich erfüllen mit ihrer Menge. Sie schwimmen hier mit hochgehaltenen Köpfen, unter ähnlichen Bewegungen wie andere Schlangen auch, übertreffen diese, mindestens alle nicht zeitlebens im Wasser lebenden Arten, aber bei weitem durch die Leichtigkeit, Zierlichkeit und Anmut, wie sie die Wellen zerteilen. Ihr breiter Ruderschwanz, die auf der Oberseite gelegenen, durch eine Klappe verschließbaren Nasenlöcher, die geräumigen Lungen und selbst der kleine Kopf und dünnwalzige Vorderteil oder die seitliche Zusammenpressung ihres ganzen Leibes, vielleicht sogar die eigentümlichen Schuppen vereinigen sich, um sie zu hochbegabten Seeraubtieren zu stempeln. Der Schwanz, der bei vielen Arten zugleich als Greifwerkzeug dienen kann, entspricht in jeder Beziehung dem der Fische, treibt sie mit Pfeilesschnelle durch die Wogen und wird zum Anker, wenn sie über Korallenbänken oder Felsblöcken ruhen wollen; die hochgelegenen Nasenlöcher gestatten ihnen, in der bequemsten Weise Luft zu schöpfen, und ihre geräumigen Lungen, länger als alle übrigen Schlangen unter Wasser zu verweilen, der dünne Hals endlich, eine Beute durch jähen Vorstoß oder gewandte seitliche Bewegungen mit Sicherheit zu erfassen, mindestens tödlich zu verwunden. Alle Beobachter, die sie in dem klaren Wasser schwimmen sahen, stimmen überein in der Bewunderung ihrer ebenso gewandten als behenden Bewegungen. Bei ruhigem Wetter liegen sie anscheinend schlafend an der Oberfläche, sind nicht gerade scheu, geben sich aber doch auch nicht sorgloser Ruhe hin. Zuweilen stört sie ein zwischen ihnen dahinsegelndes Schiff kaum in ihrem Treiben, ein anderes Mal regt sie das geringste, ihnen verdächtig erscheinende Geräusch, das Herannahen eines Bootes, auf: sie entleeren ihre Lungen, tauchen in die Tiefe hinab, und eine Reihe von aufsteigenden Luftperlen ist alles, was von ihrem Vorhandensein noch Kunde gibt. Daß sie in beträchtliche Tiefen hinabsinken, hat die Untersuchung ihres Magens erwiesen, daß sie unter Wasser auch längere Zeit der Ruhe pflegen, bestimmte Beobachtung dargetan. Als man beabsichtigte, auf den Basselsfelsen, den Überresten der von der See verschlungenen Giri-Inseln, einen Leuchtturm zu gründen, bemerkte man bei der ersten Landung unter den Hunderten und Tausenden von Fischen, die die zahlreichen Höhlen dieser Felsen belebten, eine Menge von Seeschlangen, darunter einzelne von anderthalb Meter Länge, die hier zusammengeringelt lagen, der Ruhe pflegten und die Störung so übel nahmen, daß sie wütend nach den Stangen bissen, mit denen man die Löcher untersuchte. Singalesen, die den europäischen Baumeistern zur Führung dienten, versicherten, daß die Seeschlangen nicht allein tödlich vergiften, sondern ihren Gegner auch durch Umschlingung zu schädigen suchen sollen, überhaupt stimmen die neueren Beobachter in dem einen überein, daß diese Schlangen keineswegs träge oder gutmütige, sondern im Gegenteil höchst behende, jähzornige und wütende Geschöpfe sind, die in ihrem Element, genau ebenso wie die Giftschlangen auf dem Lande, ingrimmig nach jedem vermeintlichen oder wirklichen Gegner beißen. Im Verhältnis zu ihrer zahllosen Menge, geschieht es allerdings selten, daß sie einen Menschen beißen; dies aber beruht einzig und allein in der Art und Weise, wie der Mensch ihr Element besucht, und in ihrer Scheu vor jeder Störung. Die flachen Stellen, auf denen sie sich aufhalten, betritt so leicht kein Fischer, und vor dem ankommenden Boote ziehen sie sich, wenn auch nicht immer, so doch in der Regel, zurück: unvorsichtig Badende aber werden nicht allzuselten von ihnen gebissen, und die beim Fischen an das Land gezogenen würden viel Unheil anrichten, wären die Fischer nicht vollständig mit der Gefahr vertraut, die für sie ungeschickte Behandlung der unerwünschten, oft in nur zu großer Anzahl gewonnenen Beute im Gefolge haben kann. Die Furcht aller eingeborenen Fischer vor den Seeschlangen ist durchaus begründet; denn der Biß derselben kommt in seiner Wirkung mit dem anderer Furchenzähner vollständig überein. Hiervon haben sich die indischen Forscher, namentlich Russell und Cantor, durch angestellte Versuche genügend überzeugt, und wenn Siebold beobachtete, daß Matrosen gefangene Seeschlangen durch die Hand zogen, ohne gebissen zu werden, so wissen wir andererseits auch, daß englische Seefahrer das Gegenteil erfahren und infolge des Bisses ihr Leben lassen mußten.
Ein derartiger Fall ereignete sich im Mai des Jahres 1869 und betraf einen Schiffskapitän, der beim Baden im Wasser gebissen worden war. Die Wunde schmerzte ihn so wenig, daß der Mann glaubte, von einer Krabbe gezwickt worden zu sein. Auch später merkte er von einer Vergiftung nicht das geringste, sprach längere Zeit mit einem seiner Freunde, unterhielt sich mit dessen Kindern, spielte und sang, befand sich überhaupt in der besten Stimmung und verspürte nur dann und wann ein eigentümliches, über seinen ganzen Körper verlaufendes Glühen, das ihm aber eher angenehm als beschwerlich wurde und sein Aussehen nur insofern veränderte, als es den Freund zu der Bemerkung veranlaßte, niemals habe der Kapitän wohler ausgesehen als heute. Bei der Rückkehr auf sein Schiff, etwa drei Stunden nach dem Bade, wurde ihm die Zunge und damit auch das Sprechen schwer, und nach und nach bemerkte er, daß eine anfänglich kaum wahrnehmbare Steifheit seiner Glieder sich immer weiter verbreitete. Er nahm etwas Branntwein und sandte nach dem Arzte, der auch bald erschien und Arznei verordnete, aber erst später durch einen Burmanen auf die wirkliche Ursache der Krankheit aufmerksam gemacht werden mußte. Bei genauerer Untersuchung der gebissenen Stelle, seitlich der Achillessehne, nahe dem Knöchel, fand man zwei kleine Wunden, die kaum Entzündung hervorgerufen hatten und nicht viel anders als Mückenstiche aussahen. Der Arzt griff hierauf zu den ihm heilsam erscheinenden Mitteln, ließ den Kranken auch oft Branntwein und Hanfabsud trinken; alle Mittel aber fruchteten nicht mehr. Denn der Kapitän wurde kränker und kränker und erlag, einundsiebzig Stunden nach dem Bisse, der Vergiftung. Hieraus und ferner aus zahllosen Tierversuchen ergibt sich, daß die Seeschlangen in ihrem Elemente ebenso furchtbar sind als die verwandten Giftschlangen auf dem Lande.
Die Nahrung aller Seeschlangen besteht, wie selbstverständlich, in Fischen und Krebstieren; ersteren stellen die erwachsenen, letzteren die jungen nach. Günther fand in den aufgeschnittenen Magen verschiedener Seeschlangen kleine Fische von fast allen Familien, die mit ihnen dieselben Meere bewohnen, darunter auch solche mit sehr starken und spitzigen Dornen und anderen stechenden Horngebilden. Eine derartige Bewaffnung kann die Fische ebensowenig vor den Seeschlangen schützen, als diese an dem Verschlingen der Beute behindern. Sie töten durch Gift und kümmern sich vor und nach dem Tode der Beute um deren Schutzwaffen nicht im geringsten, im letzteren Falle schon deshalb nicht, weil sie alle Fische mit dem Kopfe voran verschlingen. Alte Seeschlangen sind sehr gefräßig. Gewöhnlich betreiben sie ihre Jagd in den oberen Wasserschichten, bei stürmischem Wetter aber in größeren Tiefen. An Gefangenen hat man beobachtet, daß das Auge einer bedeutenden Ausdehnung und Zusammenziehung fähig ist, also in sehr verschiedenen Tiefen seine Dienste tun kann. Volles, d. h. nicht durch Wasser gebrochenes Tageslicht wirkt so heftig auf das Auge ein, daß sich der Stern bis zu einem Pünktchen zusammenzieht, und die Tiere, wie aus ihren ungeschickten Bewegungen hervorgeht, förmlich geblendet sind.
Über die Fortpflanzung der Seeschlangen ist man längere Zeit im Zweifel gewesen, neuerdings aber belehrt worden. Die Ruderschlangen paaren sich, nach Cantors Beobachtungen, im Februar und März, umschlingen sich während der Begattung und treiben vereinigt längere Zeit auf den Wellen umher, durch wechselseitige Bewegungen sich forthelfend, über die Dauer der Trächtigkeit konnte sich Cantor nicht vergewissern, glaubt aber, daß dieselbe etwa sieben Monate beanspruchen mag. Die Jungen sprengen die Eischale bei ihrer Geburt und führen von nun an das Leben ihrer Eltern.
Als die Feinde der Seeschlangen hat man die ostindischen Seeadler und die Haifische kennen gelernt. In dem Magen der letzteren fand Peron regelmäßig Überreste unserer Kriechtiere, die höchst wahrscheinlich während ihres Schlafes gefangen und ohne Furcht vor den Giftzähnen in dem weiten Schlunde begraben worden waren. Nicht minder gefährlich als die furchtbaren Würger der See und wohl auch andere große Raubfische scheinen ihnen heftige Stürme zu werden, die sie oft massenweise an das Land schleudern. Hier sind sie verloren, falls nicht eine ihnen freundliche Welle sie wiederum in die heimische Tiefe zurückführt. So gewandt sie sich hier benehmen, so ungeschickt und hilflos erscheinen sie auf trockenem Lande. Sie versuchen kaum zu kriechen, kaum einen Teil ihres Leibes zu bewegen, beißen zwar anfänglich noch wütend um sich, ermatten aber bald und vergessen dann sogar, ihre furchtbaren Waffen zu gebrauchen. Das Licht blendet sie, der ungewohnte Aufenthalt raubt ihnen nicht allein ihre Kraft, sondern, so will es scheinen, auch ihre Besinnung. Nach wenig Tagen verenden sie ebenso sicher wie an das Land geschleuderte Wale. Den genannten Feinden und feindlichen Gewalten gesellt sich der Mensch zu. Kein eingeborener Fischer wirft die Seeschlangen, die er unter allerlei Fischen mit dem Netze an das Land zieht, ohne Not wieder in das Wasser, sondern jeder sucht ihrer so viele umzubringen, als er vermag. Erheblicher Schaden erwächst ihnen dadurch ebensowenig wie durch ihre sämtlichen übrigen Feinde. Das Meer schützt sie leider besser, als es zu wünschen wäre, und ihre, wenn auch nicht auffällige, so doch nicht unerhebliche Vermehrungsfähigkeit gleicht alle Verluste, die ihr Geschlecht erleidet, rasch wieder aus.
*
Die Vipern ( Viperidae) sind sehr übereinstimmend gebaute und ausgezeichnete Giftschlangen. Sie kennzeichnet der sehr gedrungene, zuweilen fast unförmlich dicke Leib, der drei-, richtiger ungleichseitig viereckige, platte, auf der Oberseite der Schnauze beschuppte oder mit sehr zahlreichen und kleinen, durchaus unregelmäßig gestalteten und angeordneten Schildern bekleidete Kopf sowie endlich der kurze, stumpf kegelförmige, nur ausnahmsweise greiffähige Schwanz.
Den Kern der Familie bildet die Sippe der Ottern ( Vipera), deren unterscheidendes Merkmal in den geteilten und in zwei Längsreihen angeordneten Schwanzschildern beruht. Alle in Europa lebenden Vipern sind Ottern.
Als Urbild der Otternsippe und der gesamten Familie überhaupt betrachten wir die Kreuzotter oder Otter und Adder schlechthin ( Vipera berus). Ihre Färbung ist überaus verschieden, ein dunkler, längs des ganzen Rückens verlaufender Zickzackstreifen aber stets vorhanden und deshalb als Merkmal beachtenswert.
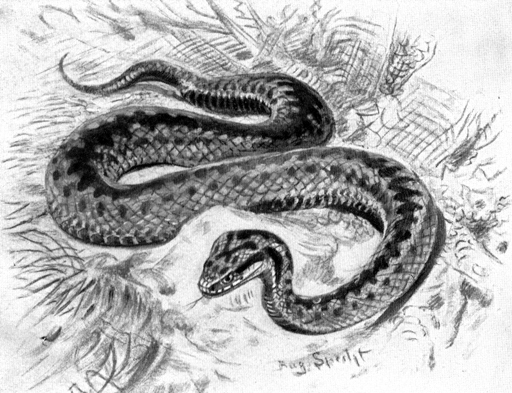
Kreuzotter ( Vipera berus)
Als echte Viper unterscheidet sich die Kreuzotter schon durch ihre Gestalt von den übrigen Schlangen Deutschlands und den meisten Europas, ihre nächsten Verwandten, die Viper und Sandotter, selbstverständlich ausgenommen. Der Kopf ist hinten merklich breiter als der Hals, ziemlich flach, vorn sanft zugerundet, der Hals deutlich abgesetzt, seitlich ein wenig zusammengedrückt, sein Querschnitt also längsrund, der Leib gegen den Hals bedeutend verdickt, auf dem Rücken abgeflacht, breiter als hoch, auf dem Bauche platt, der Schwanz verhältnismäßig kurz, im letzten Drittteile seiner Länge auffallend verdünnt und in eine kurze, harte Spitze endigend. Vom Halse an verdickt sich der Leib allmählich bis zur Körpermitte und verschmächtigt sich von hier an wiederum bis zum Schwanze, in den er ohne merklichen Absatz übergeht. Männchen und Weibchen unterscheiden sich in der Gestalt dadurch, daß bei ersterem der Leib kürzer und schmächtiger, der Schwanz hingegen verhältnismäßig länger und dicker ist als bei letzterem. Die Länge des erwachsenen Männchens beträgt etwa dreiundsechzig Zentimeter, selten zwei bis drei Zentimeter mehr, meistens um mindestens ebensoviel weniger; die Länge des Weibchens kann bis auf fünfundsiebzig Zentimeter ansteigen. Als Regel läßt sich aufstellen, daß der Kopf der Kreuzotter etwa den zwanzigsten Teil, der Schwanz des Männchens den sechsten, der des Weibchens den achten Teil der Leibeslänge beträgt: ein Verhältnis, das bei keiner deutschen Schlange weiter gefunden wird.
Wenige Schlangen dürfte es geben, die in ihrer Färbung so abweichen wie die Kreuzotter; jedoch läßt sich immerhin als Regel aufstellen, daß die Grundfärbung des Männchens in lichten, die des Weibchens in dunklen Farbentönen schattiert, bei ersterem also weiße, silbergraue, lichtaschgraue, meergrüne, lichtgelbe, lichtbraune, bei letzterem braungraue, rotbraune oder ölgrüne, schwarzbraune und ähnliche Farben vorherrschen. So verschieden aber auch die Grundfärbung sein mag: das dunkle Längszackenband hebt sich merklich ab und wird nur bei sehr tief gefärbten Weibchen wenig oder nicht bemerkt. Dieses Band, das »Kainszeichen« unserer europäischen Giftschlangen, wie Linck es genannt hat, verläuft im Zickzack vom Nacken an bis zur Schwanzspitze über den ganzen Rücken und wird jederseits von einer Längsreihe dunklerer Flecke bekleidet. Aber nicht allein seine Breite, sondern auch die Gestalt der einzelnen Flecke, die es zusammensetzen, ist sehr verschieden. In der Regel reihen sich schief gestellte, verschoben viereckige oder winkelrechte, querliegende Rauten aneinander, oder aber das Band löst sich in einzelne, in die Quere gezogene, auch wohl rundliche Flecke auf, und ebenso können die seitlichen Flecke, die gewöhnlich mit den größeren abwechseln, in kleinere Tüpfel zerfallen. Die Färbung des Bandes richtet sich, laut Strauch, nach der Grundfärbung des Tieres, derart, daß bei den hell gelblichbraunen oder fast sandfarbenen Kreuzottern die Binden und Flecke hell kastanienbraun, bei den dunkler gefärbten braun in verschiedenen Abstufungen und bei den ganz dunklen oder kastanienbraunen endlich vollkommen schwarz erscheinen. Neben diesem Zickzackbande hat man noch die Kopfzeichnung, der die Kreuzotter den Namen dankt, zu beachten. Zwei Längsstreifen, von regellosen Flecken und Strichen umgeben, zieren die Mitte des Scheitels und nähern sich hier zuweilen bis zur Berührung, beginnen auf dem Augenschilde, laufen von hier aus auf die Mitte des Scheitels zu, werden manchmal durch einen gleichfarbigen Fleck verbunden und entfernen sich wieder voneinander, nach hinten hin ein deutliches Dreieck bildend, dessen Winkel nach vorn sich richtet, und gleichsam zwischen sich das erstere verschobene Viereck der Rückenzeichnung aufnehmend. Die Unterseite der Kreuzotter ist meist dunkelgrau oder selbst schwarz; jeder Schild zeigt aber gewöhnlich mehrere gelbliche, außerordentlich verschieden gestaltete, einzeln stehende oder zusammenfließende Flecke. Die oben sehr hell gefärbten Kreuzottern sehen auch auf der Unterseite lichter, bis bräunlichgelb aus, und die einzelnen Schilder tragen vereinzelte kleine Flecke von schwärzlicher oder doch dunklerer Färbung.
Das große, runde, feurige Auge erhält durch den vorspringenden Brauenschild, unter dem es liegt, etwas Tückisches und Trotziges, und trägt wirklich dazu bei, die Kreuzotter zu kennzeichnen, zumal, wenn man nicht vergißt, daß bei keiner mitteldeutschen Schlange weiter der Stern eine schiefe, von vorn und oben nach unten und hinten gerichtete Längsspalte ist. Bei hellem Sonnenlichte zieht sich diese Spalte zu einem kaum merklichen Ritz zusammen, während sie sich im Dunkel außerordentlich erweitert. Die Färbung der Regenbogenhaut ist gewöhnlich ein lebhaftes Feuerrot, bei dunklen Weibchen ein lichtes Rötlichbraun.
Unter den Spielarten hat die dunkle, die das Volk vorzugsweise »Höllennatter« zu nennen pflegt, eine gewisse Bedeutung erlangt, weil sie lange Zeit als besondere Art ( Vipera prester) angesehen wurde. Sorgfältigeren Beobachtern mußte jedoch bald auffallen, daß alle Höllennattern Weibchen waren, und als man nun endlich trächtige Höllennattern erhielt und fand, daß die Jungen in keiner Hinsicht von anderen Kreuzottern sich unterschieden, konnte es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß man es nur mit einer Spielart zu tun hatte.
Das Verbreitungsgebiet der Kreuzotter ist nicht nur größer als das jeder anderen in Europa vorkommenden Ordnungsverwandten, sondern ausgedehnter als das jeder anderen Landschlange überhaupt; denn es erstreckt sich, laut Strauch, von Portugal nach Osten hin bis zur Insel Sachalin, überschreitet in Skandinavien den Polarkreis und reicht nach Süden hin einerseits bis ins südliche Spanien, andererseits bis zur Nordgrenze von Persien. In Deutschland dürfte sie in keinem Lande fehlen, obgleich sie in Nassau und in den Rheinlanden überhaupt selten zu sein scheint und in der Bayerischen Pfalz bis jetzt noch nicht einmal beobachtet wurde. Sie ist häufig in Baden, insbesondere auf dem Schwarzwalde, nicht minder auch in Württemberg, wo sie zumal auf der Schwäbischen und Rauhen Alb in größerer Anzahl auftritt; sie findet sich in allen Kreisen Bayerns mit Ausnahme der Pfalz, ebenso in ganz Norddeutschland, in einzelnen Heidegegenden stellenweise ungemein häufig, bewohnt nicht minder die Mitte und den Osten unseres Vaterlandes, Thüringen, Sachsen, Schlesien, Pommern, Posen, Ost- und Westpreußen, lebt ebenso in fast allen Staaten Oesterreichs. Alles in allem ergibt sich, daß das Verbreitungsgebiet der Kreuzotter sich vom neunten bis einhundertsechzigsten Grad östlicher Länge von Ferro und vom achtunddreißigsten bis zum siebenundsechzigsten Grade nördlicher Breite erstreckt.
Innerhalb dieses ungeheuren Ländergebietes fehlt sie zwar hier und da, immer aber nur auf sehr eng begrenzten Stellen. Im übrigen bewohnt sie jede Örtlichkeit, möge sie so verschieden sein als sie wolle: Wald und Heide ebensogut wie Weinberge, Wiesen, Felder, Moore und selbst Steppen. In den Alpen steigt sie, nach den Angaben von Schinz und Tschudi, bis zu einem zweitausend Meter über dem Meere gelegenen Gürtel empor, tritt also noch sehr oft oberhalb der Laubholzgrenze auf und gefällt sich demnach in einem Gelände, in dem sie höchstens drei Monate im Jahre ihrer Freiheit sich erfreuen kann, drei Viertel ihres Lebens aber winterschlafend verträumen muß. Unter ähnlichen Umständen verbringt sie auch im Norden Europas, unter nicht viel besseren in den Steppen Mittelsibiriens ihr Dasein. Bedingung zu ihrem Wohlbefinden ist, daß sie gute Schlupfwinkel, genügende Nahrung und Sonnenschein hat; im übrigen scheint sie besondere Ansprüche an die Örtlichkeit, die ihr Wohnung gewähren soll, nicht zu erheben. Steinige, mit Gebüsch überwucherte Halden, bebuschte Felswände, Heide, Laub- und Nadelholzdickichte, in denen jedoch der Sonne zugängliche, freie Plätze nicht fehlen dürfen, insbesondere aber Moorgegenden oder Steppen, bieten ihr alles, was sie zum Leben bedarf. An solchen Orten begegnet man ihr hier und da in erschreckender Anzahl: im Brennerstädter Forste im Lüneburgischen wurden beim Heumachen innerhalb dreier Tage auf einer Fläche von nur wenigen Hektaren einige dreißig Stück getötet. Gewisse Heidegegenden in Norddeutschland sind geradezu verrufen wegen der Menge dieser Giftschlangen. Im reinen Hochwalde findet man sie nicht; ist jedoch der Boden hier mit Heide bedeckt, so meidet sie selbst den Hochbestand nicht, wandert ebenso auf Örtlichkeiten, wo sie zeitweilig nicht vorkam, allgemach ein, wenn sich der Boden derart verändert, daß sie Sicherung und Beute findet, aber auch aus, wenn entgegengesetzte Umstände eintreten.
Die eigentliche Wohnung unserer Schlange ist eine vorgefundene Höhlung im Boden unter dem Gewurzel der Bäume oder im Gestein, ein Maus- oder Maulwurfsloch, ein verlassener Fuchs- oder Kaninchenbau, eine Kluft und ein ähnlicher Schlupfwinkel, in dessen Nähe womöglich ein kleines, freies Plätzchen sich findet, auf dem sie ihren wärmebedürftigen Leib den Strahlen der Sonne aussetzen kann. Wenn sie nicht die Paarungslust erregt und außer ihrer Zeit zum Umherwandern treibt, findet man sie tagsüber stets in der Nähe des gedachten Schlupfwinkels, nach dem sie bei Gefahr zurückkehrt. Bei herannahendem Gewitter soll sie, nach den Beobachtungen unseres Lenz, ebenfalls zuweilen kleine Streifzüge antreten; die Regel aber ist, daß sie sich bei Tage niemals weit von der Höhle entfernt.
Lenz war der Ansicht, daß die Kreuzotter ein echtes Tagtier sei, »da wenige Tiere sich so anhaltend wie sie dem Sonnenschein aussetzen«, fügt vorstehenden Worten jedoch hinzu, daß sich schwerer angeben läßt, wie sie sich des Nachts verhalte. Hätte der Zufall unseren Forscher belehrt wie mich, hätte er einmal an denselben Orten, die er bei Mondschein nach Kreuzottern absuchte, in dunkler Nacht ein Feuer angezündet, er würde anderer Ansicht geworden sein. Die »Vorliebe« der Kreuzotter für den Sonnenschein beweist nur das eine: daß sie, wie ihre Verwandten überhaupt, Wärme über alles liebt und sich soviel wie möglich diesen Hochgenuß zu verschaffen sucht, keineswegs aber, daß sie ein Tagtier ist. Schon die jedermann auffallende Trägheit, die sie bekundet, wenn sie sich sonnt, die Gleichgültigkeit um alles, was sie nicht unmittelbar berührt, deutet darauf hin, daß sie sich tagsüber nicht in wachem Zustande, sondern eher in einer Art von Halbschlummer befindet. Alle Nachttiere ohne Ausnahme lieben die Sonne, obgleich sie das Licht scheuen und vermeiden; die Katze oder die Eule, die sich ebenfalls besonnen lassen, find dafür sprechende Belege: gefangene Eulen gehen zugrunde, wenn man ihnen längere Zeit die Sonne gänzlich entzieht. Für die Kreuzotter nun, für ein Kriechtier, dessen Wärme mit der umgebenden steigt und fällt, ist es unabweisliches Bedürfnis, stundenlang in den Strahlen der Sonne sich zu recken, eine Wohltat, dem Leibe die Wärme zu verschaffen, die ihr das träg umlaufende Blut nicht gewähren kann. Aber ein Tagtier ist sie nicht, diese Schlange, ebensowenig wie irgendeine andere ihrer Familie. Umsonst wurde ihr das einer ungewöhnlichen Ausdehnung und Zusammenziehung fähige Auge nicht gegeben, umsonst dasselbe nicht noch besonders geschützt durch die vorspringende Braue; denn jede Anlage, jede Fähigkeit, die ein Tier besitzt, wird von ihm auch in Anwendung gebracht. Erst mit Beginn der Dämmerung beginnt die Kreuzotter ihre Tätigkeit, ihre Geschäfte, ihre Jagd. Von dieser Wahrheit kann sich jeder überzeugen, der Ottern gefangenhält und den Käfig so einrichtet, daß er, ohne von den Tieren bemerkt zu werden, sehen kann, was vorgeht, oder da, wo Kreuzottern häufig sind, nachts ein Feuer anzündet. Der ungewohnte Lichtstrahl fällt den jetzt munteren Tieren auf, und sie eilen herbei, um sich über die fremdartige Erscheinung Kunde zu verschaffen, kriechen dicht bis an das Feuer heran, starren verwundert in die Glut und entschließen sich scheinbar nur schwer, umzukehren. Wem es also daran gelegen ist, die Kreuzotter zu fangen, erreicht seinen Zweck des Nachts mit Hilfe des Feuers viel leichter als bei Tage, erreicht ihn selbst da, wo er in den Mittagsstunden vergeblich suchte, vorausgefetzt natürlich, daß die Örtlichkeit wirklich von Ottern bewohnt wird.
Erkenntnis des Irrtums rücksichtlich der Zeit, in der die Kreuzotter tätig ist, berichtigt teilweise auch die allgemein gültigen, früher von mir selbst geteilten Ansichten über ihre Begabungen und Eigenschaften. Wer sie nur bei Tage beobachtet hat, sagt die Wahrheit, wenn er sie selbst anderen Schlangen gegenüber ein überaus träges, bewegungsunlustiges, stumpfsinniges und geistloses Tier nennt; wer sie bei Nacht beobachtet, gewinnt bald eine andere Meinung. Nach meinen gegenwärtigen Anschauungen glaube ich die Ansicht aussprechen zu dürfen, daß alle Nachtschlangen, und somit auch unsere Kreuzottern, wenn ihre Zeit gekommen, sich in annähernd derselben Weise benehmen wie die Tagschlangen, deren Treiben wir beobachten können, daß sie beispielsweise also auch wirklich auf Beute jagen und nicht bloß, wie unsere bisherigen Beobachtungen glaubhaft erscheinen lassen, auf dem Anstande liegen, in der Erwartung, daß irgendeine Beute in ihre Nähe komme, um von ihr ergriffen werden zu können. Für diese Ansicht vermag ich schon jetzt eine bestimmte Beobachtung geltend zu machen. In einer prachtvollen Sommernacht bei vollem Mondscheine ging Struck mit einem Freunde auf breitem Wege durch gemischte Waldungen. Die Freunde lagerten sich gegen elf Uhr neben dem Wege, hörten nach einiger Zeit in der Entfernung von etwa siebzehn Schritten etwas rascheln und sahen hier eine Maus vom Gebüsche her auf den Weg, rasch hinter ihr drein aber eine Schlange laufen. Die Jagd ging auf dem Wege an fünfzehn Schritte weit hin; dann holte die Schlange die Maus ein, zischte und packte die Beute. Strucks Begleiter, ein Forstmann, nahm sein Gewehr, gab Feuer und fand eine tote Maus und eine sterbende Kreuzotter. Derselbe Beobachter hat auch bemerkt, wie kleinen Feuern, durch die das Wild nachts vom Getreide verscheucht werden soll, Kreuzottern sich nahen, vorausgesetzt, daß die Leute sich ruhig verhalten, wogegen sie Reißaus zu nehmen pflegen, wenn jemand mit einem Knüttel auf sie losgeht.
Das Wesen der Kreuzotter, soweit wir es kennen, ist nichts weniger als ansprechend, die blinde, grenzenlose Wut, die sie, gereizt, bekundet, geradezu abstoßend. »Ich habe einmal«, sagt Lenz, »eine Otter eine ganze Stunde lang gereizt, wo sie dann unaufhörlich fauchte und nach mir biß, so daß ich es am Ende satt hatte, sie aber lange noch nicht. In solcher Wut beißt sie häufig, auch wenn sich der Gegenstand, der sie gereizt hatte, entfernte, in die Luft, in Häufchen Moos und dergleichen, vorzüglich aber, wenn es im Sonnenschein geschieht, nach ihrem eigenen oder nach anderer Schatten. Sie hat dann den Körper zusammengeringelt und den Hals in der Mitte des gebildeten Tellers eingezogen, um ihn bei jedem Bisse, der etwa fünfzehn, höchstens dreißig Zentimeter weit reicht, vorschnellen zu können. Das Einziehen des Halses ist immer ein Zeichen der Absicht, zu beißen; sie beißt auch fast nie, ohne sich erst auf diese Weise vorbereitet zu haben, und zieht ebenso schnell den Hals wieder ein, wenn sie sich nicht zu tief verbissen hat, daß ihr dies unmöglich wird. Selbst wenn man ihr einen Gegenstand von der Größe einer Maus vorhält, beißt sie oft fehl, zielt also schlecht. Wenn sie wütend wird und beißen will, zieht sie nicht nur erst den Hals ein, sondern stößt auch, falls sie Bedenkzeit hat und ihr der Gegenstand nicht plötzlich nahe kommt, die Zunge oft und schnell, etwa so weit als ihr Kopf lang ist, vor, und dabei glühen ihre Augen; aber während sie beißt, ist ihre Zunge eingezogen; auch berührt sie mit dieser vor dem Bisse den Feind nur selten. Wird sie plötzlich vom Feinde überrascht, und beißt sie dann augenblicklich zu, so zischt sie selten vorher; je mehr Bedenkzeit sie aber hat, je höher ihr Ingrimm sich steigert, je mehr und heftiger dagegen. Das Zischen oder Fauchen geschieht in der Regel bei geschlossenem Munde und wird hervorgebracht, indem sie heftiger als gewöhnlich aus- und einatmet; es besteht aus zwei verschiedenen, jedoch sich ähnelnden Lauten, die ungefähr in demselben Zeitraume abwechseln, in dem ein Mensch aus- und einatmet. Beim Ausstoßen der Luft ist der Laut stark und tief, beim Einziehen derselben schwächer und höher. Ich hielt einer anhaltend und heftig zischenden Otter eine am Rande eines Stäbchens befestigte Flaumfeder vor die Nase, an der ich das Aus- und Einziehen der Luft deutlich wahrnahm, fand jedoch, daß die Bewegung der Luft dabei nur äußerst gering ist. überhaupt bläst sich die Kreuzotter, sobald sie böse ist, stark auf, so daß dann selbst abgemagerte voll und fett aussehen. In noch höherem Grade geschieht dies, wenn man sie in das Wasser wirft; dann aber aus dem Grunde, um sich durch die eingezogene Luft zu erleichtern. Sie ist immer auf ihrer Hut und zur Verteidigung und zum Angriff gleich bereit. Daher findet man sie fast nie, selbst wenn sie noch so ungestört ist, ohne daß sie das Köpfchen schief emporreckt. Obgleich (bei Tage) mit ziemlicher Blindheit geschlagen, weiß sie doch sehr wohl einen Unterschied zwischen den sich ihr nahenden Gegenständen zu machen, und man beobachtet sehr leicht, daß sie am liebsten nach warmblütigen Tieren und unter diesen wieder am liebsten nach Mäusen beißt. Auch sieht man, wenn man sie in ein recht helles Glas setzt, daß sie weit lieber nach der bloßen Hand fährt, wenn man diese von außen daran bringt, als wenn man z. B. das Glas mit dem Ärmel, einem Stäbchen usw. berührt.
»In der Gefangenschaft verträgt sie sich in einer geräumigen Kiste mit allen kleineren Tieren, außer mit Mäusen, sehr gut; ja, ich habe öfters gesehen, daß sich Erdechsen, Frösche und Vögelchen, wenn sie einmal eingewohnt waren, ruhig auf ihr sitzend sonnten, auch in der Freiheit Ottern angetroffen, auf denen Eidechsen sich gemächlich gelagert haben. Einmal habe ich einen recht artigen Auftritt erlebt. Es schien nämlich in der Schlangenkiste die Sonne nur auf ein ganz kleines Fleckchen, und dieses war von den Ottern sogleich in Beschlag genommen worden. Da kam eine Eidechse herbei, suchte vergeblich nach einem Plätzchen und biß nun, weil sie keines fand, eine Otter ganz behutsam in die Seite, um sie zum Weichen zu bringen, woran sich jene aber gar nicht kehrte. Die Eidechse lagerte sich endlich neben den Ottern und außerhalb der Sonne. Andere Schlangen und Blindschleichen lagern sich ebenfalls gern neben, auf und unter die Otter, als wenn sie ihresgleichen wäre. Wenn ihr Käfer über den Leib laufen, achtet sie es nicht; marschieren sie aber auf ihrem Kopfe, so schüttelt sie nur, jedoch ohne zu zürnen.
»Es ist allgemeiner Glaube, daß die Otter springt und in der Wut sogar auf weite Strecken verfolgt. Weder ich, noch mein Schlangenfänger haben je dergleichen gesehen? auch hat mir nie ein Mensch, der die Ottern genau kennt, etwas Ähnliches erzählt. Ich habe mir sehr oft nicht nur in der Stube, sondern auch im Freien viel Mühe gegeben, sie zum Springen zu reizen, aber immer vergeblich. Indessen gewährt es doch viel Vergnügen, wenn man eine in aller Ruhe aus dem Boden, den sie zu beherrschen wähnt, ruhende Otter überrascht und sie nun mit einem Rütchen neckt. Zuweilen zieht sie sich so zusammen, daß sie ein kleines Türmchen bildet, auf dessen Spitze das drohende Köpfchen steht; aber sie bleibt auch im breiten Teller liegen. Alle ihre Muskeln sind in unaufhörlicher Bewegung, so daß man ihre Farbe nicht recht erkennen kann, und unaufhörlich zucken ihre Bisse, wie aus einer düstern Wetterwolke die Blitze, nach dem Ruhestörer hin. Nie aber habe ich gesehen, daß sie auch nur dreißig Zentimeter weit absichtlich gesprungen wäre; zuweilen nur, wenn man sie plötzlich in einer gestreckten Lage überrascht, wo sie sich nicht die Zeit nimmt, den ganzen Leib tellerförmig aufzurollen, sondern bloß den Hals einzieht und dann mit schneller Bewegung ihn wieder auszieht und zubeißt, geschieht es, daß diese Bewegung auch ihren übrigen Körper etwas vorschnellt.
»Oft verrät sich die Kreuzotter in ihrer blinden Bosheit selbst, wenn sie, im Grase oder Gesträuche verborgen, vom Vorübergehenden nicht bemerkt, anstatt sich ruhig zu verhalten, ein wildes Gezisch erhebt und nach ihm beißt, so daß man sie oft nicht eher wahrnimmt, als bis man selbst oder doch der Stiefel und die Kleider den Biß schon weghaben. Zuweilen flieht sie gleich nach dem ersten oder zweiten Bisse; öfters schleicht sie sich auch schon, wenn sie Menschen in ihrer Nähe bemerkt, ohne weiteres davon.« Letzteres geschieht des Nachts, wenn sie wirklich vollständig munter ist, gewiß regelmäßig, und daher mag es kommen, daß um diese Zeit weit weniger Menschen von ihr gebissen werden, als man annehmen möchte, auch wenn man in Betracht zieht, daß nach Sonnenuntergang ihre Lieblingsorte wenig besucht werden.
Die Nahrung der Kreuzotter besteht vorzugsweise, jedoch nicht ausschließlich, in warmblütigen Tieren, insbesondere in Mäusen, die sie jedem anderen Fraße vorzieht, Spitzmäusen und jungen Maulwürfen. Am meisten müssen, nach Lenz, die Erd- oder Ackermäuse von ihr leiden, »weil sie unter unsern Mäusearten die langsamsten und gutmütigsten sind, weit weniger die schnellen, schlauen Feldmäuse. Spitzmäuse werden auch nicht verschont. Maulwürfe habe ich zwar noch nie im Magen der Ottern gefunden, zweifle jedoch nicht im geringsten daran, daß sie sich weidlich an dem fetten Schmause laben werden, wenn sie zufällig ein Nestchen voller Jungen finden.« Daß sie die Mäuse nicht bloß über, sondern auch unter der Erde fängt, geht aus den Untersuchungen unsers Lenz hervor: denn er fand in dem Magen der von ihm zergliederten, wie er sagt, öfters junge, ganz nackte Mäuse oder Spitzmäuse, die sie doch nur aus dem unterirdischen Neste geholt haben konnten. Junge Vögel, zumal die der Erdbrüter, mögen ihr oft zum Opfer fallen, und es ist keineswegs unwahrscheinlich, daß sie viele Nester ausraubt. Darauf hin deutet auch das Betragen der alten Vögel, die, wenn sie eine Otter erblicken, großen Lärm erheben, überhaupt lebhafte Unruhe an den Tag legen. Frösche verzehrt sie wohl bloß im Notfalle, Eidechsen nur, solange sie selbst noch jung ist. Es bringt der Kreuzotter wie andern Schlangen keinen Schaden, wenn sie längere Zeit hungern muß; dafür nimmt sie aber auch, wenn ihr das Jagdglück hold ist, eine reichliche Mahlzeit zu sich. Lenz fand bei seinen Untersuchungen drei erwachsene Mäuse, eine hinter der andern, in Speiseröhre und Magen.
Das Sommerleben unserer Schlange beginnt erst im April, obgleich man sie in günstigen Frühjahren schon um die Mitte des März außerhalb ihrer Winterherberge sieht, ja eine oder die andere bei besonders günstiger Witterung, ausnahmsweise schon früher und selbst mitten im Winter im Freien bemerken kann. Die »Adder«, Wie das Tier im Plattdeutschen heißt, hält den Winterschlaf gesellig ab. Man findet, nach meines Bruders Beobachtungen fünfzehn bis fünfundzwanzig Stück dicht zusammen unter dem Gewurzel von Wacholder und alten, halb vermoderten Erlen- und Birkenstumpfen, wohin sie sich mit Beginn des Frostes bis zur Wiederkehr des Frühlings zusammenziehen. Gewöhnlich entdecken die Holzarbeiter beim Ausroden alter Wurzelstämme derartige Winterlager und verfehlen dann nicht, der gesamten Schlafgesellschaft den Garaus zu machen. Mit wahrer Genugtuung haben wir erfahren, daß der Iltis über diese Tatsache weit genauer unterrichtet ist, als wir es bisher waren. Er sucht im Winter derartige Lager auf und holt sich davon nach Bedarf. Beim Ausmachen eines Iltis fand mein Bruder, mitten im Winter natürlich, einige Frösche und drei »Addern«, die das Tier nach seinem Baue geschleppt hatte, nachdem es die Vorsicht gebraucht, ihnen die Wirbelsäule dicht hinter dem Kopfe zu durchbeißen. Schließlich noch die Bemerkung, daß der Winterschlaf der Otter nicht sehr fest ist: bei einiger Störung richtet sie den Kopf auf, kriecht langsam umher und züngelt; das Auge jedoch erscheint müde und matt.
Die Paarung beginnt erst, wenn das Frühlingswetter beständig geworden ist, gewöhnlich anfangs April und von dieser Zeit an bis Ende des Monats und selbst bis Anfang Mai. Ausnahmsweise geschieht es, daß sich die Kreuzottern auch zu einer ungewöhnlichen Zeit paaren. So fand Effeldt im Jahre 1843 am fünfzehnten März ein verschlungenes Pärchen in der Begattung; so erwähnt Lenz eines Falles, wo man am achtzehnten Dezember vormittags bei schönem, warmem Wetter zwei dieser Tiere in der Paarung begriffen sah. Letztgenannter hält es deshalb für möglich, daß zuweilen auch im Frühjahre schon Eier gelegt werden können. In der Regel hecken die Ottern erst im August und September. Höchst wahrscheinlich vereinigen sich die Tiere des Nachts, bleiben aber mehrere Stunden in innigster Umschlingung, so daß man sie noch am folgenden Tage auf der Stelle, die sie zum Brautbett erwählten, liegen sehen kann. Wie schon bemerkt, geschieht es, daß sich mehrere Kreuzotterpärchen während der Begattung verknäueln und dann einen Haufen bilden, der möglicherweise zu der alten Sage vom Haupte der Gorgonen Veranlassung gegeben hat. Nach den Untersuchungen von Lenz paaren sich die Kreuzottern erst, wenn sie beinahe das volle Maß ihrer Größe erreicht haben; gedachter Forscher fand keine unter fünfzig Zentimeter Länge, die zur vollkommenen Ausbildung geeignete Eier im Leibe gehabt hätte. Die Anzahl der Jungen, die ein Weibchen zur Welt bringt, richtet sich nach Alter und Größe der Mutter: jüngere werfen deren fünf bis sechs, ältere zwölf bis vierzehn Stück. Der Geburtshergang selbst ist von Lenz ebenfalls beobachtet und sehr ausführlich beschrieben worden. »Wenn die Otter heckt«, sagt er, »so liegt sie ausgestreckt da und drückt ein Ei nach dem andern aus der Mündung des Darmschlauches, in den die Eiergänge münden, hervor, ohne Zweifel abwechselnd, so daß, wenn aus dem einen Eiergange ein Ei gelegt ist, eines aus dem andern folgt. Beim Legen hebt sie den Schwanz schief und oft in einem Bogen empor, während der Leib auf dem Boden ruht. Anfangs ist letzterer bis zum Schwanze dick; sobald aber das erste Ei gelegt ist, sieht der Zuschauer sehr deutlich das folgende nachrücken und bemerkt, wie sich jedesmal hinter dem zu legenden Ei der Körper einzieht, um es weiter und endlich herauszupressen. Zwischen dem Erscheinen der Eier vergehen jedesmal mehrere Minuten, zuweilen auch Viertel- oder ganze Stunden. Währenddem ist nach meinen vielfältigen Beobachtungen die Kreuzotter ungemein gutmütig. Kaum ist das Ei gelegt, so dehnt sich auch das darin befindliche Junge, zerreißt die seine Eischale und kriecht hervor. Jetzt hängt ihm noch der Dottersack am Leibe; er aber bleibt liegen, indem das Tierchen beim Herumkriechen die Nabelgefäße zerreißt und nun, in jeder Hinsicht vollkommen, ohne an Mutter und Vater zu denken, auf eigene Gefahr den argen Lebenslauf beginnt. Bei der Geburt sind sie meist dreiundzwanzig Zentimeter oder etwas darüber lang und in der Mitte des Körpers etwa einen Zentimeter dick. Kopf, Schilder, Schuppen, Zähne, Zahnscheide usw. sind wie bei den Alten gestaltet, sie aber mit einer sehr seinen, durchsichtigen, lose anliegenden Oberhaut bekleidet, unter der die Farbe weit heller erscheint. Wenige Minuten oder Stunden nach der Geburt streifen sie diese Oberhaut ganz wie die Alten ab, und so ist denn die Häutung das erste wichtige Geschäft ihres Lebens.
»Unter den bei mir geborenen Otterchen habe ich immer nur etwa den fünften Teil Männchen gefunden, auch draußen weit mehr Weibchen als Männchen, dagegen ebensoviel alte Männchen als alte Weibchen. Was mag die Ursache dieser Erscheinung sein?
»Sobald das Otterchen das Tageslicht erblickt hat, geht es, ohne die geringsten Ansprüche an die Liebe der Mutter zu machen, die sich doch nicht um ihre Kinder bekümmert, und ohne mit seinen Geschwistern einen freundlichen Blick zu wechseln, seinen Weg. Man findet diese kleinen Tierchen vereinzelt hier und dort. Aber besitzen sie auch wirklich schon, wenn auch nur in geringem Maße, ihren Anteil des tödlichen Giftes, auf dessen Kraft sie sich zu verlassen scheinen? Es war wohl der Mühe wert, hierüber einige Versuche anzustellen. Ich nahm daher ein Junges, das etwa in fünf Tagen hätte geboren werden müssen, aus einer Alten, die ich zu diesem Zwecke soeben getötet hatte, durchstach ihm den Kopf an der Stelle, wo die Giftdrüsen sitzen, mehrmals mit einer Nadel und verwundete damit einen Kreuzschnabel, der aber davon gar nicht litt. Mit einer andern jungen Otter und einem andern Kreuzschnabel verfuhr ich dann ebenso, aber wieder mit demselben Erfolge. Bald darauf ließ ich eine junge, halbwüchsige Maus in einen Kasten, worin sich sechzehn, im Durchschnitt sechs Tage alte, bei mir geheckte Kreuzotterchen befanden. Die Maus zeigte anfangs gar keine Furcht; aber während sie da herumschnupperte, erhob sich allerwärts ein feines, jedoch grimmiges Gezisch: alle blickten wütend nach ihr, und, wohin sie kam, zuckten Bisse. Sie suchte der drohenden Gefahr durch Windungen auszuweichen, bekam aber doch zehn Bisse, wovon einige der heftigsten in die Schnauze und den linken Hinterfuß drangen; ja, zweimal hatte sich ein Otterchen so stark in sie verbissen, daß es eine Strecke weit von ihr mit fortgeschleppt wurde. Ich nahm nun die Maus heraus, sie hinkte, Putzte sich öfters Hinterfuß und Schnauze, wurde matt, lebte aber doch noch etwas über eine Stunde, dann starb sie. In eine andere Kiste, worin sich vierundzwanzig ebensolche Otterchen befanden, ließ ich nun den Bruder jener Maus, und der Erfolg war fast ganz derselbe.« Andere Beobachtungen stimmen mit Vorstehendem überein. Aus einer derselben, die Kirsch anstellte, geht hervor, daß auch die erst vor wenigen Minuten dem Ei entkrochenen Ottern tödlich zu vergiften vermögen.
Unter allen deutschen Schlangen bringt die Kreuzotter, was Vertilgung schädlicher Tiere anlangt, den größten Nutzen: und dennoch dankt ihr niemand die Verdienste, die sie sich erwirbt, sucht jedermann sie zu vernichten, wo und wie er es vermag! Und in der Tat, bei keinem deutschen Tiere weiter ist die rücksichtsloseste, unnachsichtlichste Verfolgung in demselben Grade gerechtfertigt wie bei ihr. Linck hat wahrscheinlich recht, wenn er annimmt, daß in Deutschland alljährlich zwei Menschen an den Folgen des Bisses der Kreuzotter sterben und zwanzigmal mehr durch sie vergiftet, aber noch gerettet werden.
Über die Wirkung des Giftes besitzen wir einen eingehenden Bericht, der um so wichtiger ist, als er von einem Arzte herrührt, der diese Wirkung an sich selbst erfuhr. Eine ausgewachsene Kreuzotter biß Heinzel, wie er selbst erzählt, am achtundzwanzigsten Juni nach ein Uhr mittags, als er sie aus einem Gefäße in ein anderes bringen wollte, in die rechte, seitliche Nagelfurche des rechten Daumens. Der Tag war heiß, das Tier groß, gereizt, hatte gewiß seit drei Tagen nicht gebissen, die Stelle eine günstige, weil die Schlange sie mit dem Kiefer ganz zu umfassen vermochte, die Zähne also ihrer ganzen Länge nach eindringen konnten. Auch waren die Wunden so tief gelegen, daß nur die wenigen Tropfen Blut, die allmählich die Nagelfurche anfüllten, ihre Stelle andeuteten, die Schmerzen beim Bisse aber trotzdem bedeutend. Unser Berichterstatter zuckte, obwohl er sich als nicht wehleidig bezeichnet, am ganzen Körper, als ob ihn ein elektrischer Schlag getroffen hätte, fühlte auch im Augenblicke des Einstiches ganz deutlich eine blitzähnliche Fortpflanzung des Schmerzes längs des Daumens, der Außenseite der Handwurzelfläche, dann quer übersetzend zur Ellenbogenseite des Armes und an derselben fortlaufend bis zur Achselhöhle, wo die Empfindung sich festsetzte. »Ich unterband«, sagt er, »den Daumen leicht und sog die Wunde aus; ich schnitt sie aber nicht aus, brannte und ätzte auch nicht, weil ich im allgemeinen die Sache unterschätzte, und dann, weil ich mir über die Wirkung des Giftes eine irrtümliche Ansicht gebildet hatte, die mir alle diese Mittel als unzweckmäßig erscheinen ließ. Vom Augenblicke des Gebissenwerdens an aber war ich wie betäubt, und fünf bis zehn Minuten nachher befiel mich ein schwacher Schwindel, auch eine kurze Ohnmacht, die ich sitzend überstand. Der Schwindel verließ mich von nun an nicht mehr bis zum dreißigsten Juni mittags. Um zwei Uhr erst wurde ich zum zweiten Male ohnmächtig. Die Einstichstelle hatte sich mittlerweile blaugrau gefärbt und war, wie der ganze Daumen, geschwollen und schmerzhaft. Die Ohnmachten wurden nun immer zahlreicher; ich konnte jedoch ihren Eintritt durch Willenseinfluß um einige Minuten hinausschieben; nur dauerten sie dann länger. Von zwei bis drei Uhr schwoll die ganze Hand und auch der Arm bis zur Achsel so an, daß ich ihn kaum mehr heben konnte; um zweieinhalb Uhr wurde meine Stimme so tonlos, daß ich nur schwer verstanden wurde; bei größerer Anstrengung vermochte ich sie aber wieder tönen zu machen. Zur selben Zeit begann auch unter heftigen Schmerzen der Magen anzuschwellen; nach drei Uhr trat zum ersten Male Erbrechen, bald darauf Abführung ein. Dann kamen unschmerzhafte Krämpfe in kleinen Teilen der Bauchmuskeln, an verschiedenen Körperstellen und fortdauernder Krampf der Blase. Ich wurde im äußersten Grade kraftlos, lag meistens am Boden, sah und hörte schlecht, empfand brennenden Durst und fühlte fortwährend eine erstarrende Kälte sowohl am ganzen Körper als auch in dem geschwollenen Arme, an dem genau in der Richtung, die mir durch den ersten Schmerz bezeichnet worden war, Blutunterlaufungen eintraten. Schmerzen verursachte mir damals nur der geschwollene Magen, weil er ausgiebige Einatmung unmöglich machte. Im übrigen war die Atmung nicht gehindert, auch kein Herzklopfen oder Kopfschmerz vorhanden. Meine Umgebung sagte, die Entstellung und der Verfall meines Gesichtes sei so stark gewesen, daß ich ganz unkenntlich geworden wäre. Auch soll ich öfters irre gesprochen haben; ich war aber, außer wenn ich in Ohnmacht lag, ganz gut bei Bewußtsein. Nur fing ich manchmal zu sprechen an und konnte oder wollte aus Schwäche den Satz nicht vollenden. Um sieben Uhr, also sechs Stunden nach dem Bisse, hörten die Ohnmächten, die allgemeinen Krämpfe, das Erbrechen und Abführen und bald darauf auch der Magenschmerz ganz auf; ich trank einige Schluck Opiumtinktur und verbrachte die Nacht zwar schlaflos, aber ruhig im Bette und wurde nur durch die Schmerzen des anschwellenden Körpers gestört. Diese Schwellungen nahmen folgenden Verlauf. Als ich um sieben Uhr meinen Arm untersuchte, war er, wie die Finger und die Hand, beinahe um das Doppelte geschwollen, die Bißstelle blutschwarz und von ihr ausgehend ein unregelmäßiges Band von rötlich und rot gefärbten Stellen sichtbar, die sich, über die Innenfläche der Handwurzel zur Ellenbogenseite des Armes fortsetzend, bis zur Achsel erstreckten. Die Achselhöhle war ebenfalls sehr stark und gleichmäßig geschwollen; nirgends ließen sich Gefäßstränge oder Drüsenhaufen durchfühlen.« Im Verlaufe der ersten Nacht schwoll der Arm noch mehr an, und die Blutunterlaufungen mehrten sich so, daß er über und über rot und blau wurde. Geschwulst und Blutunterlaufungen hatten sich übrigens auch von der Achsel über die Brust bis zum Rippenrande, und am folgenden Tage bis zum Hüftbeine fortgepflanzt, die Schmerzen der geschwollenen Teile, deren Wärme unmerklich höher war als die des übrigen Körpers, sich gesteigert, und nur, wenn der Kranke schwitzte, konnte er etwas Besserung verspüren. Empfindlichkeit gegen Druck und Spannung minderten sich nach Anwendung einer von einem Arzte verschriebenen Salbe, jeder Versuch aber, sich aufzurichten, hatte Schwindel oder eine längere Ohnmacht zur Folge. Der Kranke fühlte Bedürfnis zum Schwitzen, und wenn Schweiß eingetreten war, stets eine bedeutende Abnahme der Schmerzen, ebenso auch eine Minderung des Schwindels. Die Harnbeschwerden bestanden fort, der Puls war klein und schwach, der Appetit gut, der Schlaf höchst unruhig. Am dreißigsten Juni setzten sich Geschwulst und Blutunterlaufungen seitlich über die Bauchwand und ebenso über die Hüfte herab bis zum halben Oberschenkel fort: damit aber hatte sie ihre größte Ausdehnung erreicht, und es begann nun an den Fingern bereits die Abschwellung sich bemerklich zu machen. Nach längerem Schwitzen verschwand mittags der Schwindel, und der Kranke konnte nachmittags wieder einige Stunden auf sein. Der Arm schmerzte zwar noch heftig, der Puls war noch klein und schwach und das unangenehme Kältegefühl noch vorhanden, die Harnbeschwerde jedoch gemindert, der Appetit gut und der Durst mäßig. Am ersten Juli ging die Geschwulst an Hand, Hüfte und Bauchwand zurück, und gleichzeitig verschwanden auch die Harnbeschwerden; doch war die Schwäche noch bedeutend und alles übrige beim alten geblieben. Am achten Juli war die Geschwulst am ganzen Brustkorbe zurückgegangen, und zeigten sich zum letzten Male die in den verflossenen drei Tagen fortwährend sich bildenden neuen Blutunterlaufungen. Der Schlaf wurde ruhiger, obwohl der Arm noch immer heftig schmerzte, und der Verfall und die Verfärbung des Gesichtes noch sehr bemerklich waren. In den nächsten acht Tagen schwanden Geschwulst und Blutunterlaufungen gänzlich; nur machten sich noch drei Wochen lang beim Stuhlgange leichte Schmerzen bemerklich. »Heute, am zehnten August, sechs Wochen nach dem Bisse«, schließt der Berichterstatter, »tritt gegen Abend eine leichte Schwellung der rechten Hand ein. Die Haut ist an allen angegriffenen Stellen schmutzig gefärbt und sehr empfindlich gegen Druck und Witterungswechsel. Ich kann nicht auf der rechten Seite liegen; der rechte Arm ist unkräftig und schmerzt manchmal stundenlang stark. Ich bin viel magerer als vorher, habe das Kältegefühl noch nicht gänzlich verloren, fühlte mich oft tagelang ohne Grund kraftlos, und meine Gesichtsfarbe ist verändert geblieben. Ich habe die Überzeugung, daß ein Biß, der unmittelbar eine große Hohlader trifft, fast immer den Tod nach sich ziehen, und daß dann jeder Heilungsversuch ein fruchtloser sein wird.«
Jeder Lehrer sollte daher seine Schüler über die Kreuzotter belehren, jeder sie unterrichten, wie sie, ohne sich zu gefährden, ein derartiges Tier vernichten, wenn sie es finden, jeder Vater seinen Kindern mitteilen, daß ein einziger kräftiger Rutenhieb auf das Rückgrat der Kreuzotter sie umbringt, so zählebig sie auch ist! Nur daß man sich nie und nimmer verleiten lasse, das gefällte Tier ohne die genügende Vorsicht aufzunehmen; denn die Beweglichkeit währt noch lange fort, nachdem die Otter den tödlichen Streich empfangen, und die Gefährlichkeit ihrer Giftzähne wird selbst dann nicht gemindert, wenn ein scharfer Hieb den Kopf vom Leibe trennte! Der abgehauene Schlangenkopf beißt noch fast ebenso wütend um sich wie vordem, als die Schlange noch lebte, Minuten und Viertelstunden nach der Enthauptung der Seite sich zurichtend, von der er sich befehdet glaubt. Und das Gift verliert, ich wiederhole es, seine Wirksamkeit keineswegs so bald nach dem Tode; denn selbst getrocknet und wieder aufgeweicht, ist es, wie die in dieser Hinsicht angestellten vielfachen Versuche beweisen, noch fähig, das Blut eines höheren Säugetieres zu zerstören. Vorsicht also muß jedem eingeschärft werden, der Lust und Willen zeigt, zur Verminderung der Giftschlangen beizutragen.
Was nun die Behandlung desjenigen anlangt, der das Unglück hat, gebissen zu werden, so will ich nochmals gesagt haben, daß, nach unseren bisherigen Erfahrungen, Weingeist, d.h. Arrak, Kognak, Rum, Branntwein, in sehr starken Gaben genossen, das wirksamste aller der unzähligen Gegenmittel ist, die man versucht hat, daß also jedermann imstande ist, einen durch die Kreuzotter Verwundeten zu behandeln, da er sich auch in dem kleinsten Dorfe Branntwein verschaffen kann. Unter den Gebirgsbewohnern Oberbayerns ist dieses vortreffliche Mittel übrigens, wie ich neuerdings aus sicherer Quelle erfahren, allgemein bekannt und wird fast regelmäßig mit Erfolg angewendet. Zur Beruhigung derer, die von der Anwendung in solchen Fällen schlimmere Folgen als einen Rausch befürchten, will ich ausdrücklich bemerken, daß die durch einen Otternbiß erkrankten Menschen auch nach unmäßigem Branntweingenusse von dem Rausche nichts verspüren. Daß man außerdem, wenn man kann, die Bißstelle aussaugt, ausschneidet und ausbrennt, oder doch bis zur Erlangung ärztlicher Hilfe einen harten Gegenstand, beispielsweise ein Steinchen, so fest, als man es leiden kann, auf sie bindet: dies alles bedarf, wie ich meine, besonderer Erwähnung nicht. Im südwestlichen Europa wird die Kreuzotter teilweise ersetzt und vertreten durch die Viper ( Vipera aspis). Sie erreicht fast genau dieselbe Größe wie die Kreuzotter, ist aber etwas gedrungener gebaut und breitköpfiger als diese. Das sicherste Merkmal zur Unterscheidung beider Arten bilden, nach Strauchs Untersuchungen, die Schuppenreihen, die den Augapfel von den darunter gelegenen Oberlippenschildern trennen, und deren Anzahl bei der Viper stets zwei beträgt, wogegen die Kreuzotter nur eine derartige Reihe aufweist.
»Während die Kreuzotter«, bemerkt Strauch, »die mittleren und nördlichen Gegenden des europäisch-asiatischen Festlandes bewohnt und mit einem verhältnismäßig kleinen Teile ihres Verbreitungsbezirkes dem Mittelmeergebiete angehört, findet sich die Viper ausschließlich in letzterem und überschreitet nur in Frankreich die Grenzen desselben.« Die Viper lebt in Portugal und Spanien, verbreitet sich über einen großen Teil Frankreichs, ist in der Schweiz in allen gebirgigen Gegenden, besonders aber im Jura und einigen Teilen der Kantone Waadt und Wallis häufig, in Italien die gemeinste Giftschlange, wird in Griechenland seltener, lebt aber noch in Nordafrika. Innerhalb der deutschen Grenzen beschränkt sich ihr Vorkommen, soviel bis jetzt bekannt, ausschließlich auf Lothringen, die Pfalz und das südliche Bayern. In Österreich endlich scheint sie weiter verbreitet zu sein, als wir gegenwärtig annehmen. Mit Bestimmtheit kennt man sie aus Tirol. In ihrem Wesen bekundet sie die größte Ähnlichkeit mit dem Gebaren der Kreuzotter.
*
Eine tiefe Grube jederseits der Schnauze zwischen den Nasenlöchern und den Augen, die einen Blindsack bildet und weder mit der Nase noch mit den Augen in Verbindung steht, ist das bezeichnende Merkmal der Gruben- oder Lochottern ( Crotalidae). Außerdem unterscheiden sich die betreffenden Schlangen von den Vipern durch größere Schlankheit des Leibes und meist auch durch etwas längeren, zuweilen greiffähigen Schwanz. Der Kopf ist eiförmig oder stumpf dreieckig, hinten verbreitert, deutlich vom Halse abgesetzt; die Nasenlöcher liegen seitlich der Schnauze; die mäßig großen Augen haben senkrecht geschlitzten Stern. Die Beschilderung des Kopfes ist unvollständig; die übrige Beschuppung stimmt im wesentlichen mit der Bekleidung der Vipern überein. Obwohl die Vipern an Gefährlichkeit und Böswilligkeit schwerlich hinter den Grubenottern zurückstehen, gelten diese doch als die am meisten zu fürchtenden Schlangen der Erde, und in der Tat darf man behaupten, daß ihre Giftwerkzeuge am höchsten entwickelt sind. Sie gelten als der Fluch der Länder, die sie bewohnen, hemmen und hindern den Anbau weiter Strecken und fordern alljährlich viele Opfer.
Die bekannteste Grubenotter ist die Klapperschlange ( Crotalus horridus), ausgezeichnet vor allen übrigen durch das Anhängsel, das sie am Ende ihres Schwanzes trägt, die Klapper oder Rassel, über deren Bedeutung man sich vergeblich den Kopf zerbrochen hat. Sie besteht aus einer größeren oder geringeren Anzahl ineinander steckender, leicht zusammengedrückter, Hohlkegeln vergleichbarer Hornkörper, die auswendig drei Erhöhungen zeigen, mit der Spitze nach dem Schwanzende zu gerichtet stehen und von dem nächstfolgenden Kegel überstülpt werden; jeder einzelne Körper setzt sich auf zwei Buckeln des nach dem Leibe zu folgenden fest, verbindet sich aber nur lose mit ihm, so daß eine Bewegung aller Hornkegel und ein gegenseitiges Reiben derselben möglich wird. Diese Rassel ist offenbar ein Gebilde der Oberhaut und wahrscheinlich nichts anderes als eine Reihe umgewandelter Schuppen.
Die Klapperschlange kennzeichnet sich dadurch, daß sie außer den großen Brauenschildern über jedem Auge vorn auf der Schnauze noch zwei Paare größerer Schilder besitzt, zwischen denen kleinere sich einschieben. An den großen dreieckigen Rüsselschild schließt sich jederseits der vierseitige Nasen- und an diesen weiter nach rückwärts ein zweiter kleinerer Schild an, der aus dem Grunde wichtig erscheint, weil zwischen ihm und dem Nasenschilde die Nasenlöcher münden. Der Raum zwischen den beiden letztgenannten Schildern wird durch kleinere unregelmäßige, nach der Seite zu meist etwas vergrößerte Schildchen ausgefüllt; schon zwischen den Brauenschildern aber beginnen die länglich rautenförmigen, gekielten Schindelschuppen, die die ganze Oberseite bekleiden und in siebenundzwanzig Längsstreifen verlaufen. Die Grundfärbung des Oberkörpers ist ein düsteres Graubraun; die Zeichnung besteht aus unregelmäßigen schwarzen Querbinden, die auf dem dunklen Schwänze sich verlieren; die Unterseite ist auf gelblichweißem Grunde mit kleinen schwarzen Punkten gezeichnet. Sehr alte Weibchen sollen eine Länge von fast zwei Metern erreichen; solche von 1,6 Meter Länge gehören jedoch schon zu den Seltenheiten.
Das Wohngebiet der Klapperschlange erstreckt sich vom Golfe von Mexiko an nach Norden hin bis zum sechsundvierzigsten Grade nördlicher Breite, wenn auch nur im westlichen Amerika; wenigstens geben alle Berichterstatter übereinstimmend an, daß die Schlange im Osten oder auf der atlantischen Seite des Landes höchstens bis zum See Champlain vorkommt. »Man kann annehmen«, sagt Geyer, »daß sie da nicht mehr heimisch ist, wo der Maisbau wegen öfterer Sommerfröste aufhört.« Noch in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts war sie in allen noch nicht bebauten Gegenden so erschreckend häufig, daß zwei Männer, die des von ihnen hochgeschätzten Schlangenfettes halber regelmäßige Jagden auf Klapperschlangen anstellten, im Laufe von drei Tagen elfhundertvier Stück erlegen konnten. Dem fortschreitenden Anbau des Landes und der Vermehrung der Schweine schreibt man es zu, daß sie sich stetig vermindert.
»Der Lieblingsaufenthalt der Klapperschlange«, fährt Geyer fort, »sind Örtlichkeiten, wo felsige, sonnige oder überhaupt öde Anhöhen von fruchtbaren, grasigen Tälern, Flüssen, Bächen oder Quellwiesen begrenzt werden; nur wenn regelmäßige, schwere Taue die weite Ebene erfrischen, ist sie da anzutreffen, sonst nicht. Sie ist ein gegen den Witterungswechsel höchst empfindliches Tier und ändert ihren Aufenthalt schon während des Tages fast stündlich. Bei schönem, hellem Morgen eines heißen Tages badet sie sich im Tau und wählt dann ein geeignetes Plätzchen auf einem Pfade oder breiten Steine, um sich zu sonnen und zu trocknen; später, in der Mittagshitze, sucht sie trockene, schattige Orte auf, um hier ruhig zu liegen, entfernt sich jedoch auch jetzt nicht weit von sonnigen Stellen. Wenn während mehrerer Nächte kein Tau gefallen, findet man sie oft an den Rändern von Pfützen und Flüssen; aber nur auf ihrer Raubjagd geht sie in das Wasser selbst. Gegen Regen ist sie sehr empfindlich. Ihre Wohnungen sind verschieden, in angebauten, bevölkerten Gegenden und in Wildnissen. Hier wohnt sie in sogenannten Herbergen, dort nur vereinzelt, hier in gewaltsam eingenommenen Höhlungen, dort meist in Verstecken. Zu ersteren gehören die Baue der Präriehunde, der Erdeichhörnchen, der Ratten, Mäuse und endlich die der Uferschwalbe, obgleich letztere für die größten Stücke kaum zugänglich zu sein scheinen. Allein die Klapperschlange bohrt mittels ihrer festen Schuppen an Kopf und Körper sehr leicht in feste Erde oder losen Sandstein, zumal wenn es darauf ankommt, die Löcher bloß zu erweitern. In einem spärlich beschatteten Abhange von neuem Sandsteine des oberen Des Moines-Flusses im jetzigen Staate Iowa, von ungefähr achtzig Meter Höhe, sahen wir Massen von Klapperschlangen und fanden, daß sie aus den erweiterten Höhlen der Uferschwalben ihren Kopf herausstreckten. In der Nähe von Ansiedlungen findet man sie selten oder nie in größerer Anzahl, es sei denn während der Begattungszeit, Ende April oder anfangs Mai. Hier hält sie sich in Spalten und Ritzen der Felsen, in Mauern und unter Gebäuden, in hohlen Bäumen und auf flachen Steinen, Holzklaftern und Reisighaufen auf; ja, man findet sie sogar unter den Dielen von Wohnungen, in den Schlupfwinkeln der Ratten und Mäuse.
»Der Winteraufenthalt mag wohl so wie der anderer Schlangen sehr oft ein zufälliger sein. Das Tier wird durch einige warme Oktobertage noch einmal von der gewählten Herberge weggelockt, durch plötzliche Kälte überrascht und muß dann sein einstweiliges Versteck zum Bette für den Winter benutzen; daher findet man oft in Prärien unter einzelnen Steinen im Freien Klapperschlangen, die hier mit gefülltem Magen den Winter verbringen wollen. Ihr Schlaf gleicht ganz dem anderer Kriechtiere, nur daß sie sich womöglich einen trockenen, abgeschlossenen Winteraufenthalt wählen.« Audubon, der das Tier sehr ausführlich schildert, erzählt folgendes: »Ich befand mich einst mit mehreren Bekannten im Winter auf der Entenjagd. Als wir uns unser Mittagessen bereiten wollten, zündeten wir in der Nähe des Sees Feuer an und begannen, eine Ente zu rupfen. Einer meiner Begleiter wollte einen Klotz herbeirollen und entdeckte bei dieser Gelegenheit eine zusammengewickelte, erstarrte, große Klapperschlange. Sie war stocksteif; ich ließ sie daher zu fernerer Beobachtung in meinen Büchsenranzen stecken, den ich auf dem Rücken hatte. Bald darauf, während unsere Enten an hölzernen Gabeln über dem Feuer brieten, bemerkte ich, daß hinter mir sich etwas regte. Anfangs glaubte ich, es zapple eine Ente, die sich wieder erholt habe; bald aber fiel mir das gefährliche Tier ein, und ich bat daher meinen Begleiter, nach der Schlange zu sehen, schleuderte auch den Ranzen geschwind weit von mir weg. Die Schlange war bereits vollkommen lebenskräftig, kroch hervor und fing an zu klappern, während sie den Kopf in die Höhe reckte, den Körper zusammenringelte und sich so auf jeden Angriff gefaßt machte. Da sie sich weit vom Feuer befand, glaubte ich, daß die Kälte sie bald wieder still machen würde; und noch ehe unsere Ente gebraten war, hörte sie auf zu klappern und suchte einen Zufluchtsort. Bald darauf war sie wieder so starr als vorher. Wir nahmen sie mit nach Hause und weckten sie unterwegs mehrmals aus ihrer Erstarrung, indem wir sie an das Feuer brachten.« Eine anderweitige Mitteilung gibt Palizot-Beauvois nach eigenen Beobachtungen. »Am liebsten hält die Klapperschlange ihre Winterruhe in der Nähe der Quellen. Wir wühlten mehrere Herbergen an den Ufern des Moritzflusses auf. Gekrümmte Gänge liefen nach einer Art von Kammer, die in einer Entfernung von zwei bis drei Metern vom Eingange lag; dort ruhten mehrere Schlangen zusammen auf dem vom Wasser befeuchteten Grunde, ohne jegliche Bewegung. Unser Führer brachte uns sodann an einen Sumpf, der zwanzig bis dreißig Zentimeter hoch mit Torfmoos bedeckt war. Die Oberfläche des Mooses war vom Froste hart; unter der Moosfläche aber fanden wir mehrere Klapperschlangen, die langsam auf dem vom Wasser benetzten ungefrorenen Boden umherkrochen. Sie verbergen sich im Herbste vor der Tag- und Nachtgleiche, nachdem sie sich gehäutet haben, und erscheinen im Frühling zu entsprechender Zeit.«
Geyer hält die Klapperschlange für ein Tagtier und versichert, daß sie jede Nacht so regelmäßig in ihrer Wohnung sei, wie man es nur bei Haustieren gewahren könne, da er selbst beobachtet habe, daß eine derartige Schlange am Fuße eines hohlen Baumes volle vier Wochen hindurch an jedem Abend sich zeigte, bei Tage aber nicht zu erblicken war. Daß die Folgerung, die Geyer, von dieser Beobachtung ausgehend, auf das Tagleben der Schlangen zieht, nicht richtig ist, geht aus seinen übrigen Angaben zur Genüge hervor. Um die Behauptung, daß die Klapperschlange ein Gesellschaftstier sei, zu begründen, erzählt er folgendes Abenteuer. »Bei meiner Rückkehr von einer Sammelreise langte ich am zweiundzwanzigsten August am Fuße eines hohen Berges an, der von dem rauschenden Spokan bespült wird. Ich beschloß, hier auf einer von Gesträuch umgebenen Wiese zu übernachten. Gleich nachdem ich abgestiegen, ging ich an den Fluß, um zu trinken, fand eine Pflanze und wurde beim Aufsuchen anderer von einer großen Klapperschlange angegriffen, die ich augenblicklich erlegte. Als ich später mein Abendessen zu mir nahm, hörte ich Lärm; ein Maultier, das ich für die Nacht in der Nähe angebunden hatte, wurde höchst unruhig; doch ich verließ meine Mahlzeit nicht und nahm erst, nachdem ich fertig war, mein Trinkgefäß, um Wasser aus dem Flusse zu holen. Der Lärm, den ich noch hörte, schien nahe und war etwa mit dem Geräusch zu vergleichen, das entsteht, wenn man Stangen oder Stäbe auf der Erde schleift. Sobald ich die kleine grasige Wiese überschritten hatte und an dem etwa einen Meter über der Kiesfläche erhöhten Ufer stand, erblickte ich eine zahllose Menge von Klapperschlangen, schnellend und wirbelnd, auf der kiesigen Fläche. Der Mond schien hell, und ich konnte deutlich sehen, wie sie unter- und übereinander wegkrochen, besonders in der Nähe der abgerundeten Granitblöcke, die hier und da zerstreut lagen, und um die sie fortwährend herumrasselten. Der Lärm wurde vermehrt durch das Rauschen ihrer schuppigen Körper auf dem Kiese; der Gestank war ekelhaft und unerträglich. Von Furcht ergriffen, zog ich mich nach meinem Wachtfeuer zurück und hüllte mich in meine wollene Decke; denn ich fürchtete, daß es diesen Gästen einfallen könnte, zu meinem Feuer zu kommen und mich im Schlafe zu stören und anzugreifen. Der Lärm hielt an bis gegen zehn Uhr, woraus er nach und nach ein Ende nahm. Jetzt legte ich mich schlafen. Sobald der Tag anbrach, stand ich auf, sattelte mein Maultier und suchte nach meinen Pferden, um dieses unangenehme Lager zu verlassen, kehrte aber nach einem fruchtlosen Ritte von mehreren Stunden zurück, ohne sie aufzufinden, und war so gezwungen, zu bleiben. Nun begann ich, die kiesige Fläche am Ufer zu untersuchen, fand diese aber gänzlich verlassen und ebenso ruhig wie am Nachmittage vorher. Nur die Klapperschlange, die ich getötet hatte, lag noch da. Noch nicht zufrieden mit dieser Untersuchung, hieb ich mir einen Hebel aus und fing an, die großen, flachen Steine am Ufer aufzuheben, in dem Glauben, daß die Schlangen hier sein müßten; aber bei all meinem Suchen konnte ich auch nicht eine erblicken. Einige Tage nach meinem Schlangenabenteuer hatte ich das Vergnügen, den Oberfaktor Macdonald zu Fort Colville zu treffen. Als ich ihm die oben berichtete Tatsache mitteilte, versicherte er mir zu meinem großen Erstaunen, daß er am einundzwanzigsten August, also einen Tag vor mir, dasselbe am Ufer des Columbia erlebt habe.«
Die meisten Beobachter beschreiben die Klapperschlange als ein überaus träges, langsames Geschöpf, und Beauvois sagt sogar, daß wenige Schlangen so gutmütig seien als sie. »Nie fällt sie von selbst Tiere an, deren sie nicht zur Nahrung bedarf; nie beißt sie, wenn sie nicht erschreckt oder berührt wird. Oft bin ich in einer Entfernung von nur wenigen Zentimetern an ihr vorübergegangen, ohne daß sie die geringste Lust zeigt, mich zu beißen. Ich habe ihre Gegenwart wegen des Rasselns ihrer Klapper immer im voraus bemerkt, und während ich mich ohne Eile entfernte, rührte sie sich nicht und ließ mir Zeit, einen Stock abzuschneiden, um sie zu töten.« Diese Angabe gilt nur bedingungsweise; denn sie bezieht sich auf das Betragen der Schlange während der Zeit ihrer Ruhe: wenn sie wirklich munter ist, verhält sich die Sache anders. »Die Klapperschlange«, sagt Geyer, »ist rasch in ihren Fortbewegungen, ohne sich sehr anzustrengen, zu krümmen oder zu biegen. Letzteres ist es, das ihr scheinbar eine langsame Bewegung gibt; bedenkt man aber die Strecke, die sie in einer Sekunde zurücklegt, so ergibt sich eine bedeutende Schnelligkeit. Auf ihren Raub stürzt sie sich mit zunehmender Geschwindigkeit, die zuletzt dem Fluge eines Vogels gleicht. So sah ich einst bei einem Bauernhofe in Missouri eine Klapperschlange von einem Baumstamme herab auf ein junges Huhn schießen und es, beim Flügel fassend, blitzschnell nach einem nackten Felseneilande tragen, so daß ich ihr kaum folgen konnte. Ein gut geworfener Stein brachte sie zum Anhalten: sie umwickelte nun ihr Opfer und ließ es mit dem Rachen los, biß es aber, sobald ich mich ruhig verhielt, in den Kopf. Beim zweiten Steinwurfe ließ sie das Opfer wieder los, hielt es dann abermals beim Flügel ziemlich hoch empor. Bald zeigte sie Lust, davonzugehen; aber scharf getroffen von einem Steine, ließ sie ihre halbtote Beute fahren und rollte sich zur Wehr auf. Ich tötete sie nun. Noch größere Schnelligkeit bewunderte ich bei einer Klapperschlange am oberen Mississippi bei der Jagd auf ein Grundeichhörnchen.« Von einer Eichhörnchenjagd, die baumauf und baumab ging, berichtet auch Audubon. Alle übrigen Beobachter sprechen der Klapperschlange Kletterfertigkeit gänzlich ab. Eher noch, als sie Bäume besteigt, geht sie ins Wasser, wenn sie auch dasselbe nicht gerade aufsuchen mag. Daß sie zuweilen Seen oder Flüsse übersetzt und sich im Wasser sehr schnell bewegt, hat schon der alte Kalm angegeben. »Sie sieht dabei wie aufgeblasen aus und schwimmt auch völlig wie eine Blase auf dem Wasser. Sie hier anzugreifen, ist nicht rätlich, weil sie sich, wie man erfahren hat, plötzlich in das Fahrzeug werfen kann.«
Die Nahrung besteht aus kleinen Säugetieren, Vögeln und Lurchen, namentlich Fröschen. An meinen Gefangenen habe ich niemals bemerkt, daß sie die ihnen vorgeworfenen Opfer gewürgt hätten, wohl aber kam es zuweilen vor, daß sie sich nicht die Mühe nahmen, eine kleinere Beute vor dem Verschlingen zu vergiften, dieselbe vielmehr ohne weiteres ergriffen und, ganz so wie Nattern Frösche, hinabzuwürgen begannen. Dieselbe Beobachtung hat auch Schmidt an den von ihm gepflegten Klapperschlangen gemacht. Nach reichlich genossener Mahlzeit soll sie einen fürchterlichen Gestank von sich geben, der nicht bloß den feinsinnigen Tieren, sondern auch den Menschen auffällt. Diese Angabe wird von mehreren Beobachtern bestritten, von andern auf das bestimmteste behauptet. An Gefangenen habe ich, wie ich ausdrücklich bemerken will, zuweilen nicht den geringsten, zuweilen einen schwachen moschusartigen Geruch verspürt.
Die Fortpflanzung beginnt in den ersten Frühlingsmonaten, und die Vereinigung der Geschlechter geschieht genau ebenso wie bei den Kreuzottern. »Die Begattungsweise dieser Tiere«, sagt Audubon, »ist so widerlich, daß ich ihrer gar nicht gedenken würde, wäre sie nicht im höchsten Grade merkwürdig. Zu Anfang des Frühlings kriechen die Schlangen, nachdem sie ihre Haut gewechselt, glänzend im frischesten Farbenspiele und voller Leben und Feuer im Auge, hervor. Männchen und Weibchen schweifen auf den lichten, sonnigen Stellen der Hölzer umher und schlingen sich, wenn sie sich begegnen, ineinander, bis zwanzig, dreißig und noch mehr zu einem scheußlichen Knäuel sich vereinigend. Dabei sind die sämtlichen Köpfe in allen Richtungen nach außen gekehrt, die Rachen aufgerissen, und sie zischen und klappern. In dieser Lage bleiben sie mehrere Tage an einer und derselben Stelle liegen. Man würde sich in die größte Gefahr begeben, wollte man sich einer solchen Gruppe nähern; denn sobald sie einen Feind erblicken, lösen sie sich alle geschwind auf und machen Jagd auf ihn.« Letzteres ist höchst wahrscheinlich nicht richtig; das Verknäueln der begattungslustigen Tiere aber unterliegt keinem Zweifel, wird auch durch Geyer, der Berichte der Indianer wiedergibt, bestätigt. Die Eihüllen werden im August gelegt, und die Jungen sprengen sie wenige Minuten später, ohne daß sich die Mutter weiter um sie bekümmert.
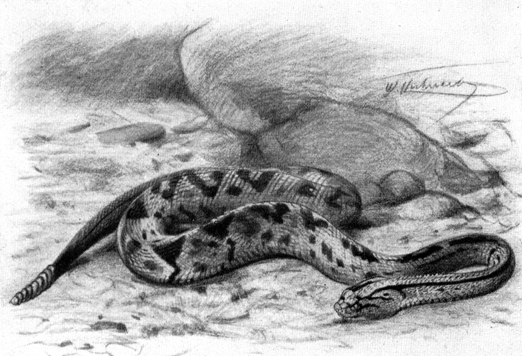
Klapperschlange ( Crotalus horridus)
»Der schlimmste Feind der Klapperschlange ist ein sehr harter Winter, besonders wenn er sich früh und plötzlich einstellt; ausgedehnte Frühjahrsüberschwemmungen schaden ihr nicht minder und ebenso die Wald- und Steppenbrände. Man hat Beispiele, daß ganze Gegenden von ihr durch harte Winter, Überschwemmungen oder Brände gesäubert wurden, so häufig sie auch vorher sich da aufhielt. Allgemein geht die Sage, daß die Schweine Klapperschlangen vertilgen und auffressen, auch daß das Gift derselben ihnen nicht schade, und es haben diese Sage sogar mehrere Forscher für bare Münze genommen, obgleich sie im Grunde bloß eine leere Behauptung ist. Viele Versuche, die ich anstellte, bestätigten, was ich immer fand: daß die Schweine ebenso wie andere Haustiere lebende Klapperschlangen scheuen und auch die toten, in Stücke zerhackten, nie anrühren.« Ich habe die letzten Angaben Geyers nicht unterdrücken wollen, muß jedoch bemerken, daß schon die ersten Berichterstatter die Nützlichkeit der Schweine als Klapperschlangenvertilger hervorheben und neuere Beobachter hierin vollständig mit ihnen übereinstimmen. »Keine Örtlichkeit in Oregon«, sagt Brown, »war früher mehr von Klapperschlangen bevölkert als die Täler des Columbiaflusses. Einige Zeit nachdem die ersten Ansiedler in diesen Teil des Landes gekommen waren, wurden diese Schlangen so lästig als nur möglich. Denn sie kamen selbst in das Innere der Häuser und krochen unter die Betten der Leute. Alle Anstrengungen, ihrer Herr zu werden, erwiesen sich als vergeblich, bis die Schweine allgemein verbreitete Haustiere des Landes geworden waren. Die nützlichen Geschöpfe wurden in den Eichenwäldern gemästet und meist so gut als gänzlich sich selbst überlassen. Von dieser Zeit an begann die Herrschaft der Klapperschlangen zu sinken, und gegenwärtig sind diese hier so selten, daß ich in einem Zeiträume von vierzehn Tagen, während dem ich, Pflanzen sammelnd, beständig das Land nach allen Seiten zu Fuß durchmaß, in einem Umkreise von sechs oder sieben englischen Meilen auch nicht eine einzige gesehen zu haben mich erinnere. Erst nachdem ich jenseits der von den Schweinen besuchten Orte gekommen war, wurden die Klapperschlangen wieder häufiger. Zwischen den Schweinen und den Schlangen scheint eine natürliche Abneigung zu herrschen. Sobald ein Schwein eine Schlange sieht, stürzt es unter lautem Grunzen auf dieselbe los, setzt, ehe noch der Giftwurm seine Zähne einschlagen kann, einen Fuß in dessen Nacken, zerquetscht ihn und frißt ihn dann ruhig auf. Die Indianer kennen diese gegenseitige Feindschaft wohl, und mehr als einmal habe ich erlebt, daß eine Indianerin zu den Ansiedlern kam, um sich ein Stück frisches Schweinefleisch auszubitten. Sie wolle, sagte sie, dasselbe beim Beerensuchen um ihre Knöchel binden, um gegen die Bisse der Klapperschlange geschützt zu sein. Im südlichen Oregon scheint die schwerlich begründete Auffassung, daß selbst das Fleisch der Schweine gegen Schlangenbisse schütze, weit verbreitet zu sein; ja man versteigt sich sogar zu der Behauptung, das Schweinefleisch sei ein Heilmittel gegen das Schlangengift. Wahr aber mag es sein, daß eine dicke Lage von Fett das Schwein selbst vor dem Eindringen des Giftes in das Blut bewahrte.« In gleichem Sinne spricht sich Bruhin aus. »Die Klapperschlangen«, sagt er, »waren früher in der Grafschaft Milwaukee keineswegs selten, sind jetzt aber durch die tatkräftige Verfolgung von seiten der Menschen und der Schweine beinahe gänzlich ausgerottet. Mir wenigstens gelang es in einem Zeiträume von fünf Jahren bei allen Streif- und Querzügen durch Busch, Feld und Sumpf nicht, einer einzigen habhaft oder auch nur ansichtig zu werden.« Nach diesen übereinstimmenden Mitteilungen verschiedener Beobachter, von denen anscheinend keiner etwas von dem anderen weiß, und nach ähnlichen Wahrnehmungen in anderen Gegenden glaube ich, daß Geyer die Wirksamkeit des Schweines unterschätzt hat.
Sehr viele Klapperschlangen werden auf den Landstraßen erlegt und überfahren. Jeder steigt gern von seinem Pferde, um die Anzahl dieser garstigen Tiere zu verringern. So vielen ich auch begegnet und so viele ich erlegt habe, so konnte ich doch einen Schauder vor diesen Tieren nie überwinden, obgleich ich bloß ein einziges Mal in die Schuhspitze gebissen wurde, ohne jedoch verwundet zu werden. Doch weicht man in Amerika vor einer Klapperschlange nur zurück in der Absicht, einen Stein oder Stock zu finden, um sie zu erlegen. Jeder kleine Knabe tötet sie; die Furcht vor ihr ist also unbedeutend. In den bewohnten Gegenden Nordamerikas gehört sie bereits zu den Seltenheiten, da die unablässige Verfolgung denn doch ihre Wirkung nicht verfehlt hat.
Viele Tiere kennen und fürchten die Klapperschlange. Pferde und Rinder scheuen sich vor ihr und entfliehen, sobald sie sie gewahren; Hunde stellen sie, halten sich aber in achtungsvoller Ferne, Vögel erheben bei ihrem Anblicke lautes Angstgeschrei. »In einer Entfernung von etwa zwanzig Schritten von meinem Hause«, erzählt Duden, »sah ich eine etwa anderthalb Meter lange Klapperschlange, die sich eben am Fuße eines Nußbaumes ausgerollt und eine angreifende Stellung gegen meine Hunde angenommen hatte. Ihr Schweif war in steter Bewegung und verursachte ein Geräusch, wie das eines Scherenschleifers, während sie den geöffneten, hochgehobenen Rachen meinen beiden Hunden entgegenstreckte. Diese blickten unbeweglich, wie mit äußerster Verwunderung, auf das drohende Tier und wagten nicht, es anzugreifen, obgleich keiner von ihnen zu furchtsam war, sich mit Wölfen zu messen. Auch zwei Katzen standen umher, von gleicher Verwunderung befangen. Ich war besorgt für das Los meiner Haustiere; die Schlange aber änderte plötzlich ihre Stellung und setzte ihren Weg fort. Hunde und Katzen wichen ihr sorgfältig aus, verfolgten sie aber dennoch, wie es schien, aus bloßer Neugier. Ich schoß ihr eine volle Ladung in den Leib und machte alsdann mit einem Stocke ihrem zähen Leben ein Ende. Keines der Haustiere konnte ich dahin bringen, sich dem leblosen Körper mehr zu nähern, als sie sich vorher der lebenden Schlange genähert hatten.«
Von mehreren Beobachtern ist die Behauptung ausgesprochen worden, daß die Klapperschlange vor dem Bisse immer zu rasseln pflege; dies ist jedoch nicht ganz richtig. »Geht sie«, sagt Geyer, »langsam, so schleppt sie die Rassel völlig; ist sie aber auf der Flucht, so hebt sie solche in die Höhe, rasselt aber ununterbrochen wie vorher; nur wenn sie ihren Raub verfolgt, hört man nichts davon. Das Rasseln klingt wie das Geräusch, das ein Schleifer hervorbringt. In den Prärien des oberen Missouri leben kleine Heuschrecken, die beim Fortfliegen genau dasselbe Geräusch verursachen. Die Klapperschlange warnt auch nicht immer, sondern nur, wenn sie erschrickt oder sich angegriffen sieht. Sehr oft sah ich eine daliegen, wo ich einen Augenblick vorher kaum einen zehntel Meter entfernt gestanden hatte.« Soviel wir beurteilen können, ist das Rasseln nichts weiter als ein Zeichen größerer Erregung, die sich ja auch bei anderen Schlangen durch heftiges Bewegen mit der Schwanzspitze zu erkennen gibt. Die von mir gepflegten oder sonstwie in Gefangenschaft gesehenen Klapperschlangen rasselten stets, wenn sie irgendwie gestört zu werden glaubten, gewöhnlich schon, sobald man das Zimmer betrat, in dem ihre Käfige standen. Beim Rasseln nehmen sie in der Regel die Stellung an, die aus unserer Abbildung wiedergegeben worden ist, indem sie den Kopf zwanzig bis dreißig Zentimeter über den Boden erheben, den Hals, um sogleich die zum Vorstoße nötige Länge des Vorderleibes frei zu haben, S-förmig biegen, und die Schwanzspitze mit der Rassel zwischen den Windungen, wie ganz richtig dargestellt, hinter der Biegung des Halses emporstrecken. Das Geräusch, das auch nach meiner Ansicht am besten mit dem Zirpen einer Heuschrecke verglichen werden kann, jedoch minder hell, vielmehr sehr dumpf, ich möchte sagen, tonlos klingt, wird durch seitliches Hin- und Herbewegen des Schwanzes hervorgebracht; die Schwingungen geschehen aber so schnell, daß das Auge nicht mehr imstande ist, die Schwanzspitze zu unterscheiden, sondern wie bei allen schnell sich bewegenden Körpern nur einen Schatten derselben gewahrt. Wahrhaft bewunderungswürdig ist die Ausdauer, mit der eine Klapperschlange rasselt. Solange sie sich bedroht fühlt, verbleibt sie in der angenommenen Stellung und rasselt fort. Ich habe mir es, boshaft genug, zum Vergnügen gereichen lassen, ihre Ausdauer zu erproben; sie aber hat mich ermüdet. Tritt man ein wenig von der erregten Schlange zurück, so wird das Rasseln schwächer, nähert man sich ihr wiederum, so verstärkt sich auch der Laut, und dies um so mehr, je mehr ihre Furcht und ihr Zorn sich steigern. Nach meinen Beobachtungen glaube ich annehmen zu dürfen, daß sie stets rasselt, wenn sie einen sich nahenden Menschen rechtzeitig zu sehen bekommt, und nur dann lautlos zubeißt, wenn sie von einem solchen vollständig überrascht wurde.
Der Biß ist immer sehr gefährlich, weil die außerordentlich großen, nadelspitzen Zähne auch eine dichte Bekleidung oder ein dickes Fell durchdringen. »Sie beißt«, sagt Geyer, »mit einer Kraft, die man in ihr nicht vermutet. Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß sie nicht springen kann, machte ich es mir zum Zeitvertreib, ihre Beißlust zu beobachten. Ich fand, daß die Giftzähne keineswegs so leicht abbrechen, selbst wenn man den Stock, in dem sie sich festgebissen hat, dreht; ja, man kann das ganze Tier mitdrehen und in die Höhe heben. Läßt es los, so tut es dies nur, um die Zähne zu erhalten, beißt jedoch augenblicklich wieder ein. Eine große, mit zwölf Rasselgliedern versehene, gegen zwei Meter lange Klapperschlange biß, nachdem ich sie gelähmt, etwa dreißigmal in einen Hickorystab von drei Zentimeter Durchmesser, riß an der betreffenden Stelle die Rinde bis auf den Splint ab und zerbiß auch diesen noch. Je länger man dieses Spiel treibt, um so wütender wird die Schlange, und zuletzt erfolgen die Bisse erstaunlich rasch aufeinander; schließlich aber stellt sich die Ermattung ein, und Furcht tritt an die Stelle der Wut.
»Eine andere Gelegenheit, die Kraft des Bisses zu erfahren, bot sich mir einmal in der Prärie am Missouri dar. Ich bemerkte einen ausgewachsenen Ochsen, der wie wütend auf mich zukam. Um ihm nicht vor die Hörner zu geraten, lenkte ich den Kopf meines Pferdes seitwärts und setzte es zugleich in kurzen Galopp. Der Ochse strich neben einem niedrigen Strauche dicht an mir vorüber, und dabei sah ich, daß eine große Klapperschlange hinter seiner Kinnlade hing. Ich setzte ihm nach. Er beschrieb einen weiten Bogen, rannte endlich mit voller Kraft in einen Apfelhain, brach auf der anderen Seite durch, und hatte seinen Feind abgestreift. Um die Folgen des Bisses zu beobachten, stieg ich ab. Der Ochse ging langsam zu den übrigen grasenden Rindern, weidete aber nicht; einige Minuten später stand er still, hing den Kopf und neigte ihn nach der der Wunde entgegengesetzten Seite; von den Knien herab nach den Fesselgelenken bemerkte ich ein Schwanken, das immer mehr zunahm, als ich ihn trieb. Die gebissene Stelle war schon bis zum Ohr hinauf stark geschwollen. Dies war vormittags zwischen neun und zehn Uhr. Am folgenden Tage gegen vier Uhr nachmittags kehrte ich zurück und fand das Tier noch auf derselben Stelle, das Maul mit Erde überzogen, trocken, offen, die geschwollene Zunge heraushängend und mit trockener Erde bedeckt; darunter aber war ein ziemlich tiefes Loch in den Boden geleckt worden. Die Bißwunde eiterte und wurde von Schwärmen von Fliegen umlagert. Da Wohnungen nicht in der Nähe waren, konnte ich nichts für das arme Tier tun; doch schnitt ich ihm einen Arm voll Gras, tauchte es in das Wasser und legte es ihm vor sein Maul.
»Sehr verschieden äußern sich die Wirkungen des Giftes, je nachdem die Klapperschlange mehr oder weniger gereizt ist. Als minder giftig gilt der Biß bei feuchtem, kühlem Wetter, als sehr gefährlich gleich nach ihrem Hervorkriechen aus der Winterherberge und während der Augusthitze. Um diese Zeit ist man nirgends sicher vor ihr; sie befindet sich dann in ihrer höchsten Regsamkeit, ist kampflustig und rasselt einem oft mehrere Schritte entgegen.«
Gefangene Klapperschlangen trotzen oft lange, gehen jedoch, falls ihr Käfig nur einigermaßen zweckentsprechend hergerichtet wurde, schließlich an das Futter. Eine, die ich kaufte, fraß sieben Monate lang nicht das geringste, obwohl sie die Tiere, die ich ihr zum Opfer bot, tötete, und bequemte sich erst nach Ablauf der angegebenen Zeit, nachdem sie fast bis zum Gerippe abgemagert war, eine von ihr vergiftete Ratte zu verzehren. Wenn ich zwei Monate als die geringste Zeit annehme, die sie in Gefangenschaft verbracht hatte, bevor sie in meinen Besitz gelangt«, darf ich also sagen, daß ihr ein dreivierteljähriger Nahrungsmangel nichts geschadet hat. Während ihres freiwilligen Fastens trank sie oft Wasser, badete, häutete sich auch wiederholt, schien nach jeder Häutung Futter zu verlangen, zeigte sich bissiger und lebhafter, als sie früher gewesen war, tötete die Tiere und ließ sie liegen, bis sie endlich doch eine Ratte verschlang und nunmehr so regelmäßig zu fressen begann, daß sie im Verlaufe von zwei Monaten wieder ihre frühere Fülle und Rundung erlangt hatte. Bei einigermaßen zuträglicher Pflege halten sich die Klapperschlangen vortrefflich in Gefangenschaft: von einzelnen weiß man, daß sie zehn, zwölf Jahre im Käfig ausgedauert haben. Anfänglich befinden sie sich, wie ihre Verwandten, fast fortwährend in gereiztem Zustande; nach und nach aber mindert sich ihre Bosheit, und schließlich lernen sie ihren Wärter wirklich als ihren Ernährer kennen, beißen mindestens nicht mehr so unsinnig nach ihm, beziehungsweise nach dem sich ihrem Käsige nahenden Menschen als früher. Mit ihresgleichen vertragen sie sich ausgezeichnet.
Über die Bißwirkung erfahren wir durch den Prinzen von Wied folgendes: »Die Brasilianer kennen, wenngleich ihre Kuren mit mancherlei abergläubischen Vornahmen, Gebeten, Formeln und dergleichen verbunden sind, einige wichtige Hauptmittel gegen den Schlangenbiß. Hierher gehören: das Ausschneiden und Ausbrennen der Wunde sowie mancherlei Kräuteraufgüsse, die man als Aufschläge oder innerlich anwendet, und die im letzteren Falle gewöhnlich schweißtreibend wirken. Dieser gegen den Schlangenbiß gebrauchten Pflanzen hat man eine bedeutete Anzahl; hierher gehören mehrere Arten der Aristolochia, Bignonia, Jacaranda, z. B. das Angelim branco, die Plumeria, die Verbena virgata und andere, deren ein jeder Ratgeber in solchen Fällen gewöhnlich andere und immer bessere kennen will. Man schabt und quetscht die Wurzeln, Blätter und Früchte, gibt sie ein und legt sie äußerlich auf; manche sind gut, um die Wunde zu reizen, andere, wohl die meisten, schweißtreibend usw.« In seiner Reisebeschreibung erzählt der Prinz mehrere Fälle, in denen von Schlangen Gebissene geheilt wurden. Einem jungen Puri umband man den gebissenen Fuß, schnitt und saugte die Wunde aus und gab ihm innerlich anstatt eines anderen schweißtreibenden Mittels Branntwein ein. »Nach mehrmaligem Ausbrennen mit Schießpulver legte man den Kranken in ein Schlafnetz und streute gepulverte spanische Fliege in die Wunde. Der Fuß schwoll sehr an. Ein eben anwesender Bergmann brachte zwei Wurzeln, die er sehr rühmte; die eine war schwammig und geschmacklos, wurde deshalb auch verworfen; von der anderen, die sehr bitter war und die der Aristolochia ringens zu sein schien, wurde ein starker Tee bereitet. Ob erfolgtes Erbrechen von dem Tee, dem Branntwein oder von dem Schlangengifte selbst herrührte, war schwer zu entscheiden. Nach einer ruhigen Nacht waren Fuß und Schenkel bis zum doppelten Umfange angeschwollen, der Kranke aber so gereizt, daß er beim geringsten Geräusch schrie und weinte. Da er Blut aus dem Munde warf, gab man ihm kein Mittel mehr; auf den Fuß wurden ihm Blätter, wahrscheinlich der Plumeria obovata, gelegt, die der Kranke sehr lobte, weil sie ihn außerordentlich kühlten. In die Wunde streute man ein Pulver aus der Wurzel dieser Pflanze. Er genas nun bald. Neuerdings geschieht die Bekämpfung der Wirkungen des Schlangenbisses auf serumtherapeutischem Wege, also durch Einimpfung des Antiserums. In schlangenreichen Gegenden Brasiliens hat jeder dieses Serum zur Hand, um sich erforderlichenfalls sofort eine Einspritzung machen zu können. Hergestellt wird dieses Antiserum in besonderen Instituten, von denen das Instituto Butantan« das bekannteste ist. Hier werden unzählige Klapper- und andere Giftschlangen gehalten und regelmäßig ihres Giftes entleert, aus dem dann auf die von der Herstellung der Impflymphe her bekannte Weise das Antiserum hergestellt wird. Herausgeber.
» Stumme Klapperschlange ( Crotalus mutus)«, nannte Linné eine der fürchterlichsten Grubenottern Südamerikas, den Buschmeister der holländischen Ansiedler Guayanas, den Sururuku der Brasilianer, der den Klapperschlangen allerdings bis aus die Bildung des Schwanzes ähnelt, anstatt der Klapper aber nur vier bis fünf kleinere, zugespitzte Schuppen und einen Dorn am Ende des Schwanzes trägt und deshalb von Daudin zum Vertreter der Sippe der Lachesisschlangen ( Lachesis) erhoben wurde.
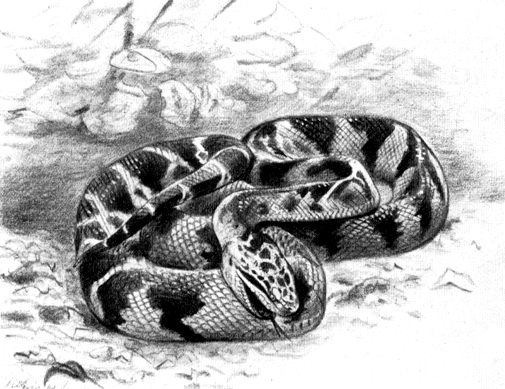
Buschmeister ( Lachesis muta)
Der Buschmeister ( Lachesis muta) erreicht eine Länge von 2,5 Meter und darüber, und ist oben auf rötlichgelbem Grunde mit einer Längsreihe großer, schwarzbrauner Rauten, deren jede zwei kleine, hellere Flecke einschließt, gezeichnet, auf der Unterseite blaß gelblichweiß, glänzend wie Porzellan. Die Rückenfärbung wird auf dem Halse dunkler, die Zeichnung geht auf dem Kopfe in unregelmäßige Flecken von schwarzbrauner Färbung über.
»Der herzförmige, durch die Giftdrüsen namhaft erweiterte Kopf der schön gezeichneten Schlange«, sagt Schomburgk, »der sich auffallend scharf gegen den Hals absetzt, wie die über einen Zentimeter langen Giftfänge, verkünden schon von ferne die Gefährlichkeit des Buschmeisters; und lebte er nicht in den Hochwaldungen, in denen er während des Tages auf der Erde zusammengerollt liegt, wäre er häufiger, als er es wirklich ist: dem Wanderer würde auf jedem Schritt und Tritt der Tod entgegenlauern, da, nach der allgemeinen Aussage der Indianer, diese Schlange nicht wie die übrigen vor dem Menschen flieht, sondern, in Schraubenlinien zusammengewunden, den sich ihr Nahenden ruhig erwartet und sich dann mit Pfeilesschnelle auf ihn stürzt. Sie ist unstreitig die giftigste und gefährlichste aller in Guayana vorkommenden Grubenottern, und ihr Biß soll unbedingt tödlich sein.« Mit dieser Schilderung stimmen alle Angaben anderer Beobachter überein.
Sie ist eine große, nett gezeichnete, träge Schlange, die, wie man sagt, die Dicke eines Mannesschenkels erreicht, und liebt zu ihrem Aufenthalt kühle, schattenreiche Wälder, in denen man sie gewöhnlich zusammengerollt auf dem Boden ruhend findet. Auf die Bäume steigt sie nicht. Ihre Lebensart und Sitten gleichen denen der Klapperschlange sehr.
Der artenreichsten Sippe der ganzen Familie ( Bothrops) wollen wir den Namen der Lochottern belassen. Die hierzu zu zählenden Grubenottern sind verhältnismäßig schlank gebaute Tiere mit dreieckigem Kopfe, den, die vorderste Spitze der Schnauze und die Augenbrauengegend ausgenommen, nur kleine Schuppen, nicht aber Schilder, bekleiden, und mäßig langem, oft greiffähigem Schwanze. Alle zu dieser Gruppe zählenden Schlangen leben im indischen und südamerikanischen Gebiete und stehen sich in ihren Sitten und Gewohnheiten ebenso nahe wie hinsichtlich ihrer Gestalt und Färbung. Viele sind, wie dies ihr Greifschwanz schon anzeigt, entschiedene Baumschlangen, die den größten Teil ihres Lebens im Gezweige der Bäume oder überhaupt auf Pflanzen verbringen und nur dann und wann zum Boden herabkommen: andere leben nur auf dem Boden.
Um die Lebensweise der Kletterlochottern kennenzulernen, genügt es, wenn ich das von einer Art der Gruppe mir Bekannte nachstehend zusammenzufassen versuche.
Die Baumotter oder Budru-Pam der Malaien ( Bothrops erythrurus), eine nur mittelgroße Art der Gruppe, erreicht eine Länge von fünfundachtzig Zentimeter und ist auf der Oberseite grasgrün, seitlich etwas lichter, unterseits grünlichweiß gefärbt. Von der weißen Oberlippe über dem Auge weg und an der Kopfseite fortlaufend, zieht sich zuweilen eine rein gleichgefärbte Linie nach dem Hinterkopfe, und ebenso bemerkt man gewöhnlich eine aus weißen oder gelben Punkten gebildete Trennungslinie zwischen den in einundzwanzig bis dreiunddreißig Reihen geordneten Rückenschuppen und den Bauchschildern.
Das Verbreitungsgebiet der Baumotter erstreckt sich von der Indischen Halbinsel bis nach China. Nach Stoliczkas Beobachtungen lebt sie in sehr namhafter Anzahl auf hügeligem Lande in der Nähe Mulmeins, und zwar fast ausschließlich auf Bäumen. Ihre Färbung ähnelt der des Blattwerkes verschiedener Bäume in so hohem Grade, daß man sie kaum wahrzunehmen imstande ist. Stoliczka sah jüngere Schlangen dieser Art oft auch auf niederen Pflanzen, und Cantor begegnete ihnen ebenso dann und wann auf dem Boden. Das Gezweige der Bäume beherrschen sie vollständig; denn sie klettern nicht allein vorzüglich, sondern verstehen ebenso möglichst bequeme Lagen und Stellungen anzunehmen. Der Greifschwanz wird um einen Ast oder den Oberteil des Stengels eines Doldengewächses geschlungen, um dem Leibe den nötigen Halt zu gewähren, und dieser ruht dann entweder gerade ausgestreckt oder in mehrere Windungen gelegt oder auch teilweise zusammengeringelt regungslos auf breiten Blättern oder Ästen und Zweigen, als wäre er ein Teil der Pflanze selbst. Eine derartig ihrer Ruhe sich hingebende oder schlafende Baumschlange bekümmert sich nur dann um die Außenwelt, wenn ihr dies unbedingt notwendig erscheint. Ohne sich zu rühren, läßt sie Menschen an sich herantreten, ohne heftige Bewegungen zu machen, sich sogar wegnehmen, und nur dann, wenn man sie mit dem Stocke drückt oder einer Zange kneipt, versucht sie zu beißen. Einmal erregt aber, bekundet auch sie den Jähzorn aller Giftschlangen, reißt, wie Martens hervorhebt, den Rachen so weit auf, daß Ober- und Unterkiefer fast in einer Ebene stehen, und bietet dann mit den spitzigen, aus dem rosenroten Zahnfleische vorstehenden Giftzähnen einen geradezu erschreckenden Anblick. In den vorgehaltenen Stock beißt sie in der Wut so heftig, daß sie sich selbst die Gifthaken ausbricht.
Ebenso munter als bei Tage schläfrig dürfte die Baumotter des Nachts sein. Denn um diese Zeit erst beginnt sie ihre Jagden auf allerlei kleinere Vögel, Säugetiere, Baum- und andere Frösche und auch auf Kerbtiere, die nach Stoliczkas Ansicht sogar den Hauptteil ihrer Nahrung bilden sollen. Genannter Forscher fand niemals die Reste von Wirbeltieren in den Magen der von ihm untersuchten Baumschlangen, wagt jedoch nicht, daran zu zweifeln, daß sie kleinere Tiere höherer Klassen ebenfalls umbringe, wenn dies ohne besondere Schwierigkeiten geschehen kann.
Das Gift der Baumottern wird allgemein als nicht besonders wirksam bezeichnet; gleichwohl unterliegt es keinem Zweifel, daß auch sie sehr gefährlich verwunden können. Der Mensch leidet aus dem einfachen Grunde weniger durch sie als durch andere Giftschlangen, weil sie durch ihr Baumleben seltener mit ihm in Berührung kommen als letztere. Daß auch sie ihn aufs ernsteste gefährden können, ist leider durch mehrere Fälle verbürgt worden. Weitaus die meisten Berichte stimmen darin überein, daß die von Baumottern gebissenen Menschen zwar sehr leiden, aber doch nur höchst selten der Vergiftung erliegen.
*
Das amerikanische Festland beherbergt zwei Lochottern, die Schararaka und die Labaria, beide einander in Gestalt, Färbung und Wesen zum Täuschen ähnlich, daher wahrscheinlicherweise nichts anderes als Spielarten eines und desselben Tieres.
Die Schararaka ( Bothrops brasiliensis) wird nach Messungen des Prinzen von Wied 1,42 Meter lang, soll aber, wie Tschudi mitgeteilt wurde, eine Länge von 1,8 Meter erreichen können. Ihr breiter eiförmiger, stark von dem dünnen Halse abgesetzter Kopf verschmälert sich etwas vor den Augen; die Schnauze ist rundlich zugespitzt, ein wenig aufgeworfen und schief abgestutzt; der mäßig schlanke Rumpf erscheint, weil das Rückgrat kielartig hervortritt, fast dreieckig; der kurze, zum Greifen nicht geeignete Schwanz ist dünn und zugespitzt. Färbung und Zeichnung scheinen erheblich abzuändern. Nach Wied ist die Schararaka auf dem Kopfe graubraun, in der Stirngegend dunkler gestreift und gepunktet, übrigens oberseits auf einfach bräunlichgrauem, oft etwas mehr ins Bläuliche, oft mehr ins Bräunliche fallendem Grunde jederseits mit dunkelgrauen oder schwärzlichbraunen, großen dreieckigen Flecken gezeichnet, die am Rande der Bauchschilder breit sind und nach dem Rücken hinauf schmäler werden, meistens wechselständig, zum Teil aber auch mit ihren Spitzen vereinigt sind oder durch graubraune Flecke verbunden werden. Diese Flecke zeigen sämtlich einen allmählich dunkler werdenden Rand, besonders nach oben, und an ihrem Grunde jederseits einen runden, dunkel braungrauen Punkt, sind am Rumpfe deutlich, am Halse undeutlich ausgedrückt und bilden am Schwänze breite Querbinden. Die gelblichweiße Grundfärbung des Bauches, dessen Schilder je zwei grauliche Marmelflecke tragen, wird durch eine Reihe runder, graubrauner Flecke von der dunklen Oberseite getrennt. Bei jungen Schararakas ist die Schwanzspitze weiß.
Die zweite Art, Labaria genannt ( Bothrops atrox), hat, nach Untersuchung des Prinzen von Wied, die Gestalt und deren Verhältnisse, die Bildung der Schuppen, ja selbst die Verteilung der Farben mit der Schararaka gemein; der Bauch aber ist nicht weißlich, sondern dunkler gefärbt und jederseits durch ein paar Reihen weißer Fleckchen geziert; auch läuft vom Auge nach dem Mundwinkel hin ein breiter, dunkelbrauner Streifen.
Die Lebensweise beider Arten oder Spielarten unterscheidet sich in keiner Weise, so daß wir das über diese und jene Bekannte unbedenklich auf jede von ihnen beziehen dürfen. Die Schararaka ist nach Angabe des Prinzen von Wied die gemeinste Giftschlange in Brasilien, auch überall verbreitet, da sie gleich gern in den trockenen, erhitzten Gebüschen und in den hohen, feuchten, dunklen Urwäldern lebt; die Labaria kommt, laut Schomburgk, ebenfalls in ganz Guayana vor, ist auch ebenso häufig an der Küste wie im Innern, hier und da auch in der freien Savanne, obwohl sie die dichten Waldungen der Steppe vorzuziehen scheint. Tagsüber sieht man sie, der Ruhe pflegend, zusammengerollt auf dem Boden liegen und sich nur dann zum Angriffe bereiten, wenn man ihr zu nahe tritt. Ihre Bewegungen find während dieser Zeit langsam und träge; beim Beißen aber wirft auch sie den Vorderteil ihres Leibes mit der allen Giftschlangen eigenen, blitzartigen Schnelligkeit vor. Weder der Prinz noch Schomburgk haben sie jemals klettern sehen; dagegen beobachtete sie der letztgenannte Forscher zu seiner nicht geringen Verwunderung auf einem seiner Ausflüge am Flusse Haiama im Wasser, fischend, wie eine alte jagdkundige Indianerin ihm versicherte. Für gewöhnlich freilich werden Schararaka und Labaria auf dem Lande ihrer Nahrung nachgehen und, wie die Verwandten, wohl hauptsächlich kleinen Säugetieren nachstellen; hierüber aber sind mir keine bestimmten Angaben bekannt, und ebensowenig vermag ich über die Fortpflanzung mehr zu sagen, als daß auch diese Lochottern ausgetragene Eier legen oder lebendige Junge zur Welt bringen.
Beide Giftschlangen werden in ihrer bezüglichen Heimat im höchsten Grade gefürchtet, sind auch in der Tat äußerst gefährliche Tiere. »Die Indianer und selbst die portugiesischen Jäger«, sagt der Prinz, »gehen beständig mit bloßen Füßen auf die Jagd; Schuhe und Strümpfe sind hier für den Landmann eine seltene, teure Sache, deren man sich bloß an den Festtagen bedient. Die Leute sind eben dadurch dem Bisse der Schlangen, die oft im dürren Laube verborgen liegen, weit mehr ausgesetzt; dennoch trifft ein solcher Fall seltener zu, als man denken sollte. Ich hatte einst einen Tapir angeschossen und war mit einem indianischen Jäger ans Land gestiegen, um die blutigen Spuren des Tieres zu verfolgen, als plötzlich mein Indianer um Hilfe rief. Er war zufällig den furchtbaren Zähnen einer anderthalb Meter langen Schararaka höchst nahe glommen und konnte nun in dem verworrenen Dickicht nicht geschwind genug entfliehen. Glücklicherweise für ihn fiel mein erster Blick auf das drohend sich erhebende Tier, das den Rachen weit geöffnet, die Giftzähne vorwärts gerichtet hatte und eben auf den kaum zwei Schritte weit entfernten Jäger losspringen wollte, aber auch in demselben Augenblicke von meinem Schusse tot zu Boden gestreckt wurde. Der Indianer war so sehr von dem Schrecken gelähmt, daß er sich erst nach einiger Zeit wieder erholen konnte, und dies gab mir einen Beweis, wie sehr der durch die unerwartete Nähe eines so gefährlichen Tieres verursachte Schrecken auf kleinere Tiere wirken müsse, daß man also keine anziehende oder betäubende Kraft bei den Giftschlangen anzunehmen brauche. Die in das Kanu gelegte tote Schlange erregte bei unserer Rückkehr unter den versammelten Indianern allgemeinen Abscheu, und sie begriffen nicht, wozu ich dieses Tier in die Hand nahm, genau untersuchte, beschrieb und ausmaß. Gute, starke Stiefel und sehr weite Beinkleider sind dem Jäger in heißen Ländern besonders anzuraten, da sie vor der Gefahr, von giftigen Schlangen gebissen zu werden, ziemlich schützen.«
Der Biß der beiden Schlangen endet zwar nicht in allen Fällen mit dem Tode, ruft aber unter allen Umständen, falls nicht sofort die geeigneten Gegenmittel angewendet werden, die ernstesten Zufälle hervor. Tschudi nimmt an, daß etwa zwei Drittel aller Gebissenen, die nicht augenblicklich die betreffenden Mittel in Anwendung brachten, ihr Leben verlieren, fügt dem aber hinzu, daß der Biß demungeachtet ärztlichem Einschreiten etwas mehr Zeit lasse und zu mehr Hoffnung auf Genesung berechtige.