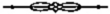|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ein Märchen.
Es war einmal ein Land, das war das schönste von allen Ländern, und das Schloß des Herzogs, dem es gehörte, lag an einem See, der war so blau, kein Blaufärber hätte ihn blauer färben können.
Einmal, vor langer, langer Zeit, war der Ritter Wendelin mit seinem Knappen Jörg an diesen See gekommen und hatte an seinen Ufern nichts gefunden als wüste Heide und nackte Felsen. Aber das Land mußte früher ein anderes Ansehen gehabt haben; denn an manchen Stellen lagen zerbrochene Säulen und marmorne Statuen mit abgebrochenen Nasen und Händen ringsumher. An den Berglehnen gab es noch altes Gemäuer, das früher wohl fruchtbare Erde und Weinstöcke getragen haben mochte; aber der Regen hatte längst die Bodenkrume von den Felsen gewaschen, und in den zusammengesunkenen Bauwerken und eingestürzten Kellern hausten jetzt Füchse, Nachtvögel und anderes Getier.
Der Ritter war kein Grübler; wie er aber Umschau hielt, dachte er doch: »Was hier wohl vorgegangen sein mag?«; und der Knappe dachte dasselbe und folgte seinem Herrn. Der führte sein Rößlein an das Ufer des Sees, um es zu tränken; denn es fehlte zwar nicht an Wasserbetten im Lande, aber es gab in ihnen nichts als nackte Steine, grauen, ausgetrockneten Gries und Streusand für so viele Schreiber, wie Fische im Meer sind.
»Wenn der See nun salzig schmeckte wie das tote Meer im heiligen Lande?« frug der Ritter; und der Knappe versetzte: »Pfui tausend, das wäre!«
Während jener hienach die Hand zum Munde führte, um das Wasser, das ja leider keinenfalls Wein war, zu kosten, hörte er auf einmal ein wunderliches Getön. Das klang sehr jammervoll und betrübt, aber doch weich und lieblich. Es schien von einem arg gequälten Weibe zu kommen, und das war dem Ritter gerade recht; denn er war ausgezogen, um Abenteuer zu suchen.
Er hatte auch manches glücklich bestanden, und an Jörgs Sattel hingen die Schwanzspitzen von sieben Lindwürmern, die sein Herr schon erlegt. Aber eine Frau mit schöner, rührender Stimme in großer Gefahr, – das war ein seltener Fund und dem Ritter auch noch nie in den Weg gekommen. Der Knappe sah ihm das helle Vergnügen aus den Augen leuchten, rieb sich die Stirn und dachte: »Heulen möchte man über den Jammer; aber was so einen Ritter nicht alles freut!«
Das Wasser des Sees war indes gar nicht salzig, ja absonderlich süß, und als Wendelin die Grotte erreicht hatte, aus der die singende Stimme kam, da fand er eine junge Frau, die viel schöner war als alle Weiber, die er und der grauköpfige Jörg jemals gesehen. Wohl sah sie bleich aus, aber ihre Lippen schimmerten so feucht und rot wie Erdbeerfleisch, ihr Auge war blau wie der Himmel im heiligen Lande, und ihr Haar glänzte so licht wie lauter Sonnenstrahlen. Dem Ritter schlug das Herz bei ihrem Anblick sehr hoch, und er konnte gar nichts sagen, aber er bemerkte doch, daß sie Ketten an Händen und Füßen trug und daß ihr schönes Haar um einen smaragdenen Reifen, der von der Decke der Grotte niederhing, geschlungen war; sie aber nahm weder seiner noch des Knappen wahr, der die Hand über die Augen hielt, um sie besser zu sehen.
Da faßte Herrn Wendelin heißer Ingrimm; denn aus den großen Augen der Frau rollten viele Thränen auf das Kleid, das schon so naßgeweint war, als hätte man sie eben aus dem See gezogen.
Wie der Ritter auch dies bemerkte, wurde er noch mitleidiger, als er vorher zornig gewesen, und Jörg, ein weichmütiger Mann, mußte laut schluchzen; denn das Weib hatte ein gar zu rührsames Ansehen. So klang denn des Ritters Stimme bewegt genug, als er die Gefangene anrief und ihr sagte, daß er ein Deutscher sei, Wendelin heiße und ausgezogen sei, um Drachen zu töten und für jeden das Schwert zu ziehen, der Unrecht erleide. Er habe schon manchen Strauß bestanden und verlange nichts Besseres, als für sie zu kämpfen.
Da hörte sie auf zu weinen, aber sie schüttelte, soweit das gefesselte Haar dies zuließ, traurig das Haupt und sagte: »Mein Feind ist zu mächtig. Du bist ein schöner, jungem Gesell und gewiß der Liebling einer Mutter zu Hause, und ich will nicht, daß es auch Dir wie den anderen ergehe. Sieh den Nußbaum dort! Die weißen Kürbisse an den nackten Aesten, das sind ihre Schädel. Zieh schnell Deines Weges; denn der böse Geist, der mich gefangen hält und nicht freigeben will, bis ich ihm gelobe, sein Weib zu werden, kommt bald zurück. Er heißt Misdral und ist sehr stark und mächtig. Seine Wohnung ist das wüste Felsenland drüben am nördlichen Ufer des Sees. Habe Dank für den guten Willen und ziehe weiter.«
Doch der Ritter folgte diesem Rat mit nichten, sondern trat, ohne viele Worte zu machen, auf die schöne Frau zu und erfaßte ihr Haar, um es von dem Ringe zu lösen; wie er aber den Smaragd berührte, züngelten ihm zwei braune Schlangen entgegen.
»So,« sagte Herr Wendelin, schlug die eine Hand mit einem wuchtigen Griff um die Hälse und die andere um die Schwänze der Vipern, riß sie auseinander und schleuderte sie auf die Klippen am See.
Als die Gefangene das sah, atmete sie auf und sprach: »Nun glaube ich, das es Dir gelingt, mich zu befreien. Zieh mir den Ring von der Hand!«
Der Ritter gehorchte, und als er die Finger der Frau, die dünn und spitz waren, berührte, wurde ihm sehr wohl und warm ums Herz, und er würde sie gern geküßt haben; aber er streifte ihr nur den Ring ab, und wie er dann versuchte, ihn an die Spitze des eigenen kleinen Fingers zu zwängen, sprach das Weib: »Wenn Du ihn drehst, wird er Dich in einen Edelfalken verwandeln; denn wisse . . . Aber wehe uns . . . Wo das Wasser dort aufbraust, da kommt er geschwommen.«
Kaum hatte sie dies gesagt, als aus dem See ein gräßliches Ungetüm emporschnob. Das sah aus wie morscher, grauer Bimsstein. Zwei Kröten schauten ihm aus den Augenhöhlen, statt des Haares floß ihm brauner Seetang in wüstem Gewirr triefend über Nacken und Stirn, und statt der Zähne trug es lange eiserne Nägel im Maule, die einander über den Lippen kreuzten.
»Ein schöner Freier,« dachte der Knappe. »Wenn der steinerne Bursche kein weiches Stellchen am Leibe hat, komm' ich sicher um meinen Dienst.«
Der Ritter hatte ähnliche Gedanken und ging darum dem bösen Geiste nicht mit dem Schwerte zu Leibe, sondern hob ein mächtiges Granitstück vom Boden und schleuderte es dem Riesen gerad an die Stirn. Da nieste der und fuhr sich mit der Hand über die Augen, als habe er eine Fliege zu wehren. Dann schaute er sich um, und als er den Ritter bemerkte, wieherte er laut auf und verwandelte sich in einen feuerschnaubenden Drachen. Das freute Herrn Wendelin; denn mit solchem Gewürm zu kämpfen, war ihm eine liebe Gewohnheit; doch kaum hatte sein gutes Schwert in die Weiche des Ungetüms eine blutende Wunde gestoßen, als sich der Gegner plötzlich von der Erde erhob und in Gestalt eines Greifen auf ihn eindrang. Nun wurde die Gegenwehr schwer; aber Herr Wendelin fürchtete sich nicht und wußte Arm und Schwert zu brauchen, auch als ihn der böse Geist in vielen anderen wechselnden Gestalten bedrängte. Zuletzt merkte der Ritter dennoch, daß die Kraft ihm erlahmte. Das Gewicht des Schwertes schien sich zu verhundertfachen und ein Zentner an jedem seiner Glieder zu hängen. Dem Knappen ward es dabei schwül ums Herz, und er hielt es für geraten, abseits zu reiten; denn das Ding konnte diesmal schlecht enden. Dem Ritter wankten bereits die Kniee, und als der Riese, der die Gestalt eines Einhorns angenommen hatte, ihm an den Schild rannte, sank er zu Boden.
Da schrumpfte das Untier plötzlich zusammen und schoß als schwarze, hurtige Ratte auf ihn zu.
Nun schwanden Herrn Wendelin die Sinne; aber aus der Grotte, in der das gefangene Weib sich befand, hörte er's rufen: »Der Ring, gedenke des Ringes!«
Da glückte es ihm, dem goldenen Reifen am kleinen Finger einen leisen Stoß mit dem Daumen zu versetzen, und alsbald fühlte er sich so leicht und frei wie nie zuvor, und es war ihm, als verhärte sich sein ermattetes Herz zu einer Sprungfeder von geschmeidigem Stahl. Dabei ward ihm gar froh und übermütig zu Mute, und es überkam ihn eine so tolle Rauflust, als wär' er wieder vierzehn Jahre alt geworden. Ein wunderlicher Drang trieb ihn hoch in die Luft, und er folgte ihm und regte, als hätte er sich solcher zeitlebens bedient, zwei bunte Flügel, die ihm plötzlich gewachsen waren. Schon rieb sich sein gefiederter Rücken an einer Wolke, und doch sah er alles, was tief unter ihm auf der Erde vorging, so deutlich wie nie zuvor. Auch das Kleinste zeigte sich seinen verschärften Augen sonnenklar und wie in einem besonders hellen und glatten Spiegel. So sah er auch jedes Härchen an der Ratte da unten, und wieder trieb ihn ein Drang, dem er, ohne zu denken oder zu wägen, folgen mußte, der Drang, niederzuschießen und dem Langschwanz mit Fängen und Schnabel den Garaus zu machen. – Wendelin hatte sich in einen Edelfalken verwandelt, und die Ratte wehrte sich vergebens gegen seinen kräftigen Angriff.
Die gefangene Frau war alledem erst ängstlich, dann freudevoll gefolgt; wie aber der Falke die Ratte festhielt und ihr Wunde auf Wunde schlug, rief sie den Knappen herbei und befahl ihm, sie von den Fesseln zu befreien, und diese Arbeit fiel dem Jörg nicht sauer, ja sie behagte ihm so wohl, daß er sich gar nicht beeilte.
Als die Frau endlich ledig aller Bande dastand, reckte und streckte sie sich, und dabei ward sie immer schöner und herrlicher. Dann ergriff sie den smaragdenen Ring, um den der Zauberer das Goldhaar geschlungen, schwang ihn hoch in die Luft und rief: »Falke, werde, was Du gewesen. Misdral, höre Dein Urteil!«
Da empfing Wendelin sogleich seine ritterliche Gestalt zurück, und sie kam ihm recht schwer vor, nachdem er einmal ein Falke gewesen; die Ratte aber dehnte sich und schwoll an und wurde wieder zu einem Riesen von Bimsstein; doch der Unhold ging nicht mehr aufrecht, sondern wälzte sich winselnd und heulend wie ein geschlagener Hund vor den Füßen der schönen Frau. Da sagte sie: »Nun hab' ich den Smaragd, in dem Deine Macht über mich schlummert. Ich kann Dich vernichten, allein ich heiße Clementine, und so will ich Dir Gnade widerfahren lassen. Aber ich banne Dich in Deine Felsen, da sollst Du bleiben, bis zur letzten Stunde des letzten Tages. Papaluka, Paparuka, – Smaragd, verrichte das Deine!«
Da wurde der Riese von Bimsstein so glühend wie schmelzendes Eisen. Nur einmal erhob er noch die geballte Faust, um Wendelin damit zu bedrohen, dann stürzte er sich in den See, und zischend und dampfend schlug das Wasser über ihm zusammen.
Nun stand der Ritter der Frau allein gegenüber; und als sie ihn frug, welchen Dank er begehre, da wußte er nichts zu fordern, als daß sie sein liebes Weib werden und ihm in die Heimat nach Deutschland folgen möge; sie aber errötete und sagte traurig: »Ich kann dies Land nicht verlassen; auch darf ich keines Sterblichen Gattin sein. Aber ich weiß, wie man Helden belohnt, und so biete ich Dir die Lippen zum Kusse.«
Da kniete er vor ihr nieder, und sie nahm sein Haupt zwischen die schlanken Hände und vermählte den Mund mit dem seinen.
Als das der Knappe Jörg sah, seufzte er still vor sich hin und dachte: »Warum ist mein Vater bloß ein Müller gewesen? Was so einem Ritter doch alles vergönnt ist! Aber mit dem Kusse wird es hoffentlich nicht abgethan sein, und wenn sie keine knauserige Fee ist, gibt es vielleicht noch ein Tischleindeckedich als Aufgeld.«
Doch Clementine gewährte dem Erretter reicheren Lohn; denn als sie bemerkte, daß in Wendelins braunem Haar während des Kampfes mit dem bösen Geiste eine Locke an der linken Schläfe ergraut war, sprach sie: »Dies Land soll Dir fortan gehören, und weil Dir eine Locke im wackeren Streite gegen das Unrecht gries und grau geworden, sollst Du von nun an Herzog Griso heißen. Jeder Fürst, ja auch der Kaiser wird die Würde anerkennen, die ich Dir, meinem Retter, verlieh; wenn aber das Haus, zu dessen Ahnherrn ich Dich bestimmte, mit Nachkommen gesegnet wird, will ich bei jedem Erstgebornen Patenstelle vertreten. Alle Söhne Deines Stammes, die ersten wie die letzten, soll die graue Locke zieren, mögen sie schwarz oder braun oder blond sein. Sie leistet Deinen Nachkommen Bürgschaft, daß viele Gaben des Glückes sie erwarten. Aber meine Macht ist begrenzt, und wenn höhere Gewalten mich einmal hindern, einem Deiner Enkel meine Gunst zu bethätigen, dann wird die Locke ihm fehlen, und es wird von ihm allein abhängen, wie sich sein Leben gestaltet. Und nun noch eins: Gib mir den Ring zurück und nimm dafür diesen Spiegel, der Dir und den Deinen das, was ihr lieb habt, zeigen wird, auch wenn es in weiter Ferne weilet.«
»So wird es mir immerdar vergönnt sein, Dich, holde Frau, mir vor die Augen zu zaubern,« rief der Ritter.
Da lächelte die Fee und sagte: »Nein, Herzog Griso; der Spiegel zeigt Dir nur sterbliche Wesen, und ich weiß ein Weib für Dich, das Du lieber anschauen sollst als jedes Spiegelbild, und wär' es auch das einer Fee. Habe Dank! Du bist Herzog, und nun empfange Dein Reich!«
Damit verschwand sie, und alsbald zog ein leises Sausen und Klingen durch die Luft, und der Boden der Einöde bekleidete sich mit frischem Grün, die trockenen Flußbetten füllten sich mit klarem, rieselndem Wasser, und an seinem Rande erwuchsen blumige Auen, schattige Haine und Wälder. Das zerfallene Terrassengemäuer an den Berglehnen festigte sich und stieg in die Höhe und bedeckte sich mit Erde, die Weinstöcke und Fruchtbäume trug. Dörfer und Städte erhoben sich und traten aus dem Lande hervor. Köstliche Gärten voll bunter Blumen, Oliven-, Orangen-, Zitronen-, Feigen- und Granatbäume schmückten sich mit dunklen oder goldenen Früchten und tausendkernigen Aepfeln. In der Nähe der Grotte, in der die Fee gefangen gewesen, erwuchs ein Park von unvergleichlicher Schönheit, und in ihm begannen Quellen zu rieseln, Springbrunnen hoch aufzurauschen, und um goldenes und silbernes Netzwerk und bedeckte Laubengänge wand sich Schlinggewächs und kletterte daran mit tausend Rankenarmen und Rebenhänden eilfertig und üppig empor.
Die gefallenen Säulen richteten sich auf, den zerstörten Marmorbildern wuchsen neue Nasen und Hände, und im Hintergrunde dieser Herrlichkeit erblickte der junge Herzog plötzlich, erst wie ein Nebelbild, dann mit fest umrissenen Formen ein fürstliches Schloß mit Altanen, Söllern und Säulenhallen und mit hohen Statuen von Erz und Marmor am Saume des flachen Daches.
Der Knappe Jörg sperrte den Mund weit auf; wie er aber die Vorhalle betrat, schloß er ihn nur, um ihm für künftige Arbeit Erholung zu gönnen; denn es dampfte ihm aus der Küche lieblicher Bratengeruch entgegen, und weil sein Hunger noch größer war als die Neugier, befahl er dem willigen Koch, für seines Leibes Wohlfahrt zu sorgen.
Ritter Wendelin schritt indes durch Gänge und Zimmer, Säle und Hallen. Dort wimmelte es überall von Dienern, Leibwächtern und Heiducken, aus den Ställen klang das Gestampf von harten Rosseshufen und das Klirren der Halfterketten, die sich an vollen Krippen rieben. Trompeterchöre bliesen schmetternde Fanfaren, und das versammelte Volk im Vorhof rief tausendstimmig wieder und immer wieder: »Unser erlauchter Herzog von Griso, Wendelin I, soll leben!«
Der Ritter winkte den guten Leuten herablassend zu, und als der Kanzler sich tief vor ihm verneigte und in einer wohlgesetzten Rede des edlen Herzogs hohe Verdienste um das Reich pries, von denen Wendelin selbst gar nichts wußte, hörte er ihm doch ganz ernsthaft zu. – Er hatte so viele Abenteuer erlebt, daß ihm das ruhige Sitzen auf dem Throne recht wohl behagte. Er gab sich auch Mühe, sich des Amtes, das er der Fee verdankte, würdig zu zeigen, und als er das Herrschen vom Abc an gründlich erlernt hatte, zog er nach Deutschland. Dort freite er sein Bäschen Walpurga und führte es in den Palast und herrschte mit ihr viele Jahre über das schöne Herzogtum. Die fünf Söhne, die sein Weib ihm schenkte, kamen alle mit der grauen Locke zur Welt und wurden wackere Männer, die dem Vater Heerfolge leisteten, brüderlich zusammenhielten und auf manchem Kriegszuge die Grenzen des Landes erweiterten.
So verging eine lange Zeit und ein Nachkomme des tapferen Wendelin folgte dem andern. Der Erstgeborne wurde immer mit dem Namen des Ahnherrn genannt, und am Tauftage eines jeden Sohnes erschien die Fee Clementine. Keiner sah sie, aber ein leises Klingen, das durch das Schloß zog, verriet ihre Nähe, und wenn es nachließ, hatte sich das weiße Haar an der Schläfe des Neugebornen zu einer Locke gekrümmt.
Als fünfhundert Jahre um waren, wurde Wendelin XV. zu Grabe getragen. Mit einer stattlicheren grauen Locke wie er, war noch kein Griso zur Welt gekommen, und doch hatte er jung die Augen geschlossen. Die Weisen des Landes sagten, es komme auch auf die besonders begünstigten Menschen nur ein gewisses Maß von Wohlsein und Glück, und dies habe sich bei Wendelin XV. in dreißig Jahre zusammengedrängt.
Allerdings war diesem Herzog von Kindheit an alles zum Besten gediehen. Schon als Kronprinz hatte man das Allergrößte von ihm erwartet, und trotzdem war er ein ganz vorzüglicher Herrscher geworden. Jedermann hatte ihn geliebt, das Heer war unter seiner Führung von Sieg zu Sieg geeilt, eine reiche Ernte hatte, so lange er das Scepter führte, die andere abgelöst, und die schönste, tugendhafteste Fürstentochter war seine Gemahlin gewesen.
In einer heißen Schlacht hatte er, während ihn das Siegesgeschrei der Seinen umbrauste, den Tod gefunden. Was eines Menschen Herz nur immer begehren mag, war ihm zu teil geworden; nur das Glück, einen Nachkommen sein eigen zu nennen, hatte er nicht zu kosten bekommen; aber er war doch mit der Hoffnung auf einen Erben dahingeschieden.
Jetzt wehten schwarze Fahnen von den Zinnen des Schlosses, die Säulen an der lustigen Vorhalle waren mit Flor umwickelt, die goldenen Kutschen schwarz lackirt, und die Mähnen und Schweife der herzoglichen Rosse mit dunklen Bändern durchflochten worden. Der Jägermeister hatte die bunten Vögel im Tiergarten dunkel färben und der Schulmeister die Schreibhefte der Buben mit schwarzen Umschlägen versehen lassen. Die fröhlichen Spielleute im Lande sangen nichts als traurige Lieder in dumpfem Moll, und jeder Unterthan legte ein Zeichen der Trauer an. Als die rubinrote Nase des Hofkellermeisters sich gerade damals bläulich färbte, hielt der Hofmarschall dies nur für natürlich. Selbst die Säuglinge lagen in Steckkissen mit schwarzen Bändern. Aber auch in den Herzen sah es traurig aus, und am betrübtesten in dem der jungen, verwitweten Herzogin. Die hatte auch alle leuchtenden Farben abgethan und ging in tiefem, tiefem Schwarz, aber ihre schönen, sanften Augen waren ganz gegen die Kleiderordnung des Hofes feuerrot geworden von lauter Weinen.
Am liebsten wäre sie dem Verstorbenen ins Grab gefolgt; doch eine süße, mächtige Hoffnung und die Aussicht auf beseligende Pflichten hielt sie im Leben zurück und warf milde Sonnenstrahlen in die Zukunft, die ihr noch schwärzer vorkommen wollte als die Trauergewänder der Höflinge, die sie umgaben.
So vergingen fünf lange Monate, und am ersten Tage des sechsten erhob sich Kanonendonner auf der Burg der Residenzstadt. Ein Schuß nach dem andern erschütterte die Luft, aber die Bürger wurden nicht von den Geschützen geweckt. Sie hatten ohnehin kein Auge geschlossen; denn die Aeltesten wußten sich keiner Nacht wie der vergangenen zu erinnern. Von der Felsenlandschaft am nördlichen Ufer des Sees her, wo der böse Geist Misdral hauste, war ein furchtbares Unwetter heraufgezogen und hatte sich über der Stadt und dem herzoglichen Palast entladen. Es war ein Krachen, Rollen, Pfeifen und Brausen gewesen, als sei der jüngste Tag angebrochen. Die Blitze hatten nicht wie sonst das Dunkel mit dünnen, zackigen Lichtschneiden, schnell wie nur sie selbst sind, zersägt, sondern waren als feurige Kugeln zur Erde gefallen, und doch hatte keiner gezündet. Die Turmwächter erzählten, über das dunkle Gewölk sei wie ein Strom von Milch, der sich über schwarze Wolle ergießt, eine silberweiße Masse geflossen, und aus der Höhe habe man mitten unter dem Prasseln und Rollen des Donners lieblichen Saitenklang vernommen. Den hatten auch viele Bürger gehört, und der Hof-Instrumentenmacher versicherte, es hätte geklungen, als sei eines seiner Klaviere – wenn auch nicht von den allerbesten – zwischen Himmel und Erde gespielt worden.
Sobald die Kanonen auf der Burg zu donnern begannen, traten die Leute auf die Straße, und die Gassenkehrer, die die Ziegel und Schieferstücke zusammenfegten, die der Sturm von den Dächern gerissen, ließen die Besen ruhen und lauschten. Der Konstabler verbrauchte heut viel Pulver, und den Männern und Weibern, die die Schüsse zählten, wurde die Zeit lang; denn das Krachen nahm gar kein Ende. Sechzig Schüsse bedeuteten eine Prinzessin, hundertundeiner einen Prinzen. Wie der einundsechzigste fiel, jubelte man auf: denn man wußte nun, daß die Herzogin einen Sohn geboren, – als aber dem hundertundersten ein hundertundzweiter folgte, meinte ein verschmitzter Advokat, es könnten wohl zwei Prinzessinnen sein; beim hundertundzweiundsechzigsten riet man auf ein Mädchen und einen Knaben; beim hundertundachtzigsten rief der Schulmeister, dem sein Weib sieben Töchter geschenkt hatte: »Möglicherweise ein Drilling feminini generis!« Aber diese Vermutung ward schon durch den hundertundeinundachtzigsten Schuß beseitigt, und erst als das Donnern beim zweihundertundzweiten aufhörte, wußte man, die geliebte Landesmutter sei von einem Knabenpärchen genesen.
Die Residenz schwamm in Freude. Statt der Trauerfahnen wurden Flaggen mit den bunten Landesfarben aufgehißt, an den Schaufenstern der Schnittwarenhändler gab es wieder rote, blaue und gelbe Stoffe zu sehen, die Höflinge strichen die Falten von der Stirn und übten sich wieder im Lächeln.
Jedermann war herzensfroh; nur der Astrolog, die alten Weiber und einige Gelehrte machten bedenkliche Gesichter; denn die in solcher Nacht geborenen Kinder waren zweifellos unter recht üblen Zeichen zur Welt gekommen. Auch im herzoglichen Schlosse war die Freude nicht ungetrübt, und gerade die treuesten Diener des Hauses schienen besorgt und steckten die Köpfe zusammen.
Beide Knaben waren nämlich zwar gesund und wohlgebildet, doch bei dem zweitgeborenen fehlte der graue Haarstreif, der bisher jedem neugeborenen Griso eigen gewesen.
Der Hausmeister Pepe, ein direkter Nachkomme des Knappen Jörg, der die Geschichte des Ahnherrn der herzoglichen Familie aufs beste kannte, denn sein Großvater hatte sie ihm erzählt, war so niedergeschlagen, als sei ihm ein großes Unglück begegnet, und als er am Abend mit dem Kellermeister, dem Silberbewahrer und dem Tafeldecker beim Weine saß, hielt er mit seinen Befürchtungen nicht zurück. – Wie bei ihm, so stand auch bald bei seinen Genossen die Ueberzeugung fest, das Unheil habe an die Pforte des glücklichen Hauses der Griso gepocht.
Dem zweiten Knaben war ein schweres Schicksal beschieden. Das glaubte nicht nur das Gesinde, sondern bald auch der ganze Hofstaat; denn das üble Horoskop des Astrologen wurde bekannt, die Weisen des Landes stimmten dem Sternseher bei, und bald erwies es sich, daß selbst die Fee Clementine gegen das dem zweiten Prinzen drohende Unheil ohnmächtig sei; denn am Tauftage ließ sich weder das sanfte Tönen, noch der Wohlgeruch wahrnehmen, der sonst ihre Nähe verkündete. Aber sie war doch wohl dem herzoglichen Hause nicht fern geblieben; denn das Haar des Erstgebornen hatte sich an der Schläfe zu einer weißen Locke gekrümmt. Das des zweiten Prinzen war dagegen braun geblieben, und man konnte darin auch mit dem Vergrößerungsglase nichts Weißes entdecken. Dies erfüllte das Herz der jungen Mutter mit großer Besorgnis; und als sie die alte Nonna, die schon die Wärterin ihres verstorbenen Gatten gewesen, zu sich heranrief, um sie zu fragen, wie es bei der Taufe ihres Gemahls gewesen, brach sie in lautes Schluchzen aus und verriet der Herzogin endlich auch alles, was der Astrolog und die Weisen dem zweiten Knaben vorausgesagt hatten. Ein Griso, der ohne graue Locke durch die Welt gehen sollte! Es war unerhört, war gräßlich, und so nannte die Alte das arme kleine Wesen auch einmal über das andere ein »Unglückskind« und »ein liebes, beklagenswertes Prinzchen«.
Da erinnerte sich die Mutter des letzten Traumes, in dem sie gesehen hatte, wie ein Drache ihren jüngeren Knaben anfiel; und eine große Bangigkeit um ihn erfüllte nun ihr Herz, und sie ließ ihn sich reichen, und als er ganz nackt vor ihr lag, betastete sie mit den schwachen Händen seinen kleinen, runden Kopf, den geraden Rücken und die zierlichen Beinchen. Ach, wie ihr das wohlthat! Es war ein tadellos gewachsenes Kind, ihr Kind, ihr Eigen, und es fehlte ihm nichts als die graue Locke. Sie konnte sich nicht müde an ihm sehen, und endlich neigte sie sich zu ihm nieder und sagte leise: »Du liebes kleines Herzblatt, Du bist gerade so gut und echt wie Dein Bruder. Der wird ein Herzog, und dies Glück ist nicht gar groß, und wir wollen's ihm gönnen. Die Unterthanen machen ihm später schon Sorgen genug. Für sie wird er ein gewaltiger Mann werden müssen, und die Amme gibt ihm wohl kräftigere Nahrung als ich schwaches Weib. Aber Dich, armes, herziges Unglückswürmchen, Dich nähre ich selbst mit der eigenen Brust, und wenn es Dir im Leben nicht wohl geht, an mir soll's nicht liegen.«
Als dann der älteste Priester kam, um sie zu fragen, welchen Namen sie für den zweiten Knaben ausgesucht habe – denn daß der erstgeborne Wendelin XVI. heißen müsse, das verstand sich von selbst – erinnerte sie sich wieder an ihren Traum und sagte schnell: »Georg; denn der hat den Drachen getötet.«
Da schaute der Greis sie verständnisvoll an und sagte ernst: »Das ist ein guter Name für ihn.«
Die Zeit verging, und beide Prinzen gediehen prächtig. Georg ward von der eigenen Mutter, Wendelin von der Amme genährt. Darauf lernten sie erst lallen, dann laufen, dann reden; denn das machen die Söhne eines Herzogs mit der grauen Locke gerade so wie alle anderen Buben. Und doch ist kein Kind wie das andere, und wenn ein Ausbund von einem Schulmeister ein vollkommenes Werk über die Erziehung schreiben wollte, so müßten darin so viele Kapitel stehen, wie es Knaben und Mädchen gibt auf Erden, und es würde darum nicht zu den dünnsten Büchern gehören.
Was nun die beiden herzoglichen Zwillinge anging, so zeigten sie sich vom ersten Tage an sehr verschieden geartet. Das Haar Wendelins war schlicht und würde ohne die graue Locke, die ihm wie ein silbernes Fragezeichen an der linken Schläfe hing, vollkommen schwarz gewesen sein; Georg hatte dagegen einen hellbraunen Krauskopf. An Wuchs blieben sie einander gleich bis zum siebenten Jahre, dann aber begann der jüngere Knabe sich länger zu strecken als sein Bruder. Sie liebten einander sehr, doch das Spiel, das dem einen gefiel, behagte dem andern nur selten, und es konnte scheinen, ihre Augen seien nach verschiedenen Rezepten gemacht; denn Georg sah mit den seinen vieles weiß, was sein Bruder schwarz sah.
Beide wurden sorglich gehütet, und man ließ sie niemals allein. Dem Erstgeborenen war das auch ganz recht; denn er lag gern still und ließ sich Kühlung zufächeln und die Fliegen abwedeln. Dabei mußte man ihm Märchen vorlesen; denn die gefielen ihm, bis er dabei einnickte. Es war erstaunlich, wie lange und tief er schlafen konnte. Die Höflinge sagten, er kräftige sich für die Anstrengungen der künftigen Regierung.
Bevor er ordentlich sprechen konnte, verstand er es schon ausgezeichnet, sich bedienen zu lassen, und was andere für ihn thun konnten, dafür rührte er selbst keinen Finger. Dabei war sein stilles Gesicht mit den großen, müden Augen schön über die Maßen, und die eigene Mutter sah ihn oft scheu und ehrerbietig an wie ein Wunder. Um ihn brauchte sie sich niemals zu sorgen; denn im ganzen Lande gab es kein Kind, das braver und folgsamer gewesen wäre.
Mit dem Unglückskinde Georg sah es dagegen ganz anders aus. Diesen mußte man bewachen und hüten; denn es steckte ihm gar böser Uebermut im Blute, und man hätte meinen können, er rufe das Unheil, das ihm so sicher bevorstand, geflissentlich herbei. Wo es nur anging, entzog er sich den Dienern und Wärtern. Er ersann waghalsige Spiele und verleitete die wilden Buben der Schloßbeamten und Gärtner mitzumachen, was er sich ausgedacht hatte.
Bauen und immer bauen war sein schönstes Vergnügen.
Bald errichtete er Häuser aus rohen Steinen, bald grub er tiefe Höhlen mit Kammern und Sälen in den Sand. Dabei rührte er die Hände fleißiger als seine armen Spielkameraden, und wenn er beschmutzt und mit triefender Stirn in das Schloß zurückkehrte, schüttelten die Höflinge bedenklich den Kopf und schauten befriedigt auf Wendelin, der als echtes Herzogskind sich die schneeweißen Hände niemals beschmutzte.
Georg war von gemeinerem Schlage als sein hoher Bruder, das war sonnenklar. Wenn dieser über Hitze klagte, sprang Georg in den See, wenn Wendelin fror, pries jener die frische, schneidige Luft. Für ihn hätte die Herzogin gern hundert Augen gehabt, und sie schalt und tadelte ihn oft, während ihr anderer Sohn nichts von ihr zu hören bekam als gütige Worte. Aber Georg flog ihr oft ganz unprinzlich stürmisch an die Brust, und dann küßte und herzte sie ihn und ließ ihn nicht aus den Armen; wenn sie sich dagegen zärtlich gegen den Erstgeborenen erwies, drückte sie ihm nur die Lippen auf die Stirn oder streichelte ihm das Haar. Georg war gar nicht so schön wie sein Bruder und hatte nur ein derbes, frisches Bubengesicht, aber seine Augen waren besonders tief und treu, und die Mutter fand alles darin wieder, was ihr selbst das Herz bewegte.
Beide waren so glücklich wie jedes Kind, das im Sonnenscheine der Mutterliebe aufwächst; aber die Herren und Frauen am Hofe und die Palastbeamten hatten doch längst bemerkt, daß das Unheil schon jetzt mit dem jüngeren Prinzen sein Spiel trieb. Wie häufig zog er sich die Ungnade der gütigen Frau Herzogin zu! Und die Unfälle, die schon den elfjährigen Knaben betroffen hatten, waren gar nicht zu zählen. Beim Baden hatte er sich zu weit in den See hinausgewagt und wäre beinahe ertrunken, in der Reitbahn war er von einem wilden Pferde über die Schranken geschleudert worden, und der Leibchirurgus wurde wegen blutender Löcher im Kopfe und gequetschter Gliedmaßen am Leibe des zweiten Prinzen so oft der Mond wechselt aus der Ruhe gestört.
Wenn auch keiner dem wilden Knaben gram war, außer dem Hofmarschall und dem Zeremonienmeister, so beklagte doch jedermann das Unglückskind. Aber wie scharf das Schicksal den armen Georg verfolgte, das wurde erst recht deutlich, als einmal das steinerne Haus, das er mit anderen Buben errichtet hatte, über ihm zusammenstürzte. Man zog ihn besinnungslos unter den Quadern und Blöcken hervor, und der Hausmeister, der auf das Geschrei der Kameraden Georgs herbeigeeilt war, legte ihn in der Prinzenstube aufs Bett und pflegte ihn, während man den Arzt rief.
Die Wärterin Nonna leistete dem Hausmeister Beistand, und die beiden treuen Menschen schütteten sich dabei gegenseitig das Herz aus. Sie erinnerten einander an die bösen Vorzeichen, die die Geburt des Prinzen begleitet hatten, und Pepe sprach die Befürchtung aus, daß das Unglückskind nicht wieder aufkommen würde.
»Leider, leider,« sagte er, »wird es am Ende auch für das liebe Herzogsblut am besten sein, wenn ihn der Himmel jetzt schon zu sich nimmt: denn ein früher Tod ist immer noch besser als ein langes Leben in lauter Ungemach und Elend.«
Der Knabe hatte dies alles Wort für Wort vernommen; denn er konnte zwar noch kein Glied rühren und mußte auch die Augen geschlossen halten, doch Gehör und Verstand waren wach geblieben.
Die alte Nonna hatte bei der Rede des wackeren Pepe viele Thränen vergossen, und er versuchte noch, ihr Mut zuzusprechen, als Georg sich plötzlich aufrichtete, die Augen mit dem Rücken der Hände rieb und sich reckte und streckte. Dann sprang er plötzlich, munter wie eine Bachstelze, aus dem Bette.
Die beiden Alten schrieen laut auf vor Erstaunen und lachten dann noch lauter vor Freude, aber der Leibchirurgus, der gerade ins Zimmer trat, machte ein bitterböses und enttäuschtes Gesicht; denn die schöne Aussicht, einem Herzogskinde das Leben zu retten, wurde ihm hier vor den leiblichen Augen zu Wasser.
Die Herzogin war während dieses üblen Vorfalles abwesend gewesen. Als sie heimkehrte, zwang sie sich erst zu scheltenden Worten, dann aber ließ sie der mütterlichen Liebe freien Lauf, und wie Georg ihr die Hände um den Hals schlang und sie fragte, ob es denn wahr sei, daß er lauter Unglück haben würde, so lang er lebe, hätte sie gern laut aufgeschluchzt; doch sie hielt die Thränen gewaltsam zurück und nannte Pepe und Nonna alte Einfaltspinsel, und die Vorzeichen, von denen sie geredet, thörichtes Zeug. Dann lief sie schnell aus dem Zimmer, und es war Georg, als hörte er sie draußen weinen. Er hatte es ihrem Leugnen angehört, daß sie ihn nur zu beruhigen trachtete, und von Stund an hielt er sich selbst für ein Unglückskind. Das war freilich übel, doch hatte es auch sein Gutes; denn er erwartete jeden Morgen einen schlimmen Tag; wenn er aber am Abend nichts als Lust und Freude erfahren, ging er dankbar für das Gute, das er genossen und das ihm doch eigentlich gar nicht zukam, ins Bett. Von jener Zeit an ließ ihn die Mutter strenger als bisher überwachen, ging ihm selbst nach, wie eine Henne, die Entlein ausgebrütet, und verbot ihm, mit Steinen zu bauen.
Die edle Frau wurde gerade jetzt auch von anderen Sorgen bedrängt; denn ihr Nachbar, ein König, der von ihrem Gatten und dessen Vater in manchem Kriege besiegt worden war, hielt es nun, da das Land der Griso nur von einer Frau und ihrem Statthalter regiert ward, an der Zeit, in das Herzogtum einzufallen und die Provinzen, die er an die Grisos verloren, zurückzuerobern. Der Marschall Moustache führte das Heer, und bald stand eine Schlacht bevor, die, wie alle Schlachten, entweder mit einem Siege oder mit einer Niederlage enden mußte.
Eines Tages erschien ein Bote aus dem Lager und brachte einen Brief des tapfern Moustache, der um mehr Truppen bat, da das Heer des Feindes dem seinen stark überlegen. – Da berief der Statthalter den großen Rat, bei dem die Frau Herzogin nicht fehlen durfte, und während die weisen Herren unter ihrem Vorsitze tagten, ließ sie zum erstenmal seit langen Wochen Georg aus den Augen.
Das bemerkte der wilde Bursch mit Vergnügen, und weil der See heute besonders bewegt war, schlich er sich, während sein Bruder wegen des schlechten Wetters zu Hause blieb, an das Ufer, sprang mit dem Sohne des Obergondeliers in ein Boot und trieb es mit starken Ruderschlägen keck durch die Wellen. Die braunen Locken des Knaben flatterten im Winde, und wenn eine Woge den Nachen recht hoch warf, jubelte er laut auf vor Vergnügen. Er durfte sonst nur mit besonderer Erlaubnis und auf einem wohlbemannten, sicheren Fahrzeuge auf den See, und auch dies hatte sich stets im Bereiche seiner südlichen Hälfte zu halten. Das war denn immer ein mäßiges Vergnügen gewesen; aber so ganz frei und als sein eigener Herr gegen Wind und Wogenschwall anzukämpfen, das war eine Herzenslust ohnegleichen.
Die nördliche Hälfte des Sees hatte er noch niemals besucht, und gerade dort war es immer so unheimlich dunkel, und da – das hatte ihm die Nonna erzählt – sollten Geister hausen und einen gebannten, gräßlichen Riesen von Bimsstein bewachen. Vielleicht bekam er den schauerlichen Spuk zu sehen, wenn es ihm bis zum andern Ufer vorzudringen gelang. Das war eine köstliche Aussicht! Und so wandte er den Kiel des Nachens nach Mitternacht, befahl dem Gefährten, die Ruder wacker zu rühren, und that das Gleiche.
Als sie weiter nach Norden kamen, begannen die Wogen sehr hoch zu gehen; ein Sturm erhob sich und schnitt ihm in das feuchte Gesicht, doch je toller der See sich geberdete, desto froher und freier ward ihm zu Sinne.
Sein Gefährte begann sich zu fürchten und drängte zur Rückkehr, er aber machte sein Prinzenrecht geltend und gebot ihm mit einer Strenge, die ihm sonst fremd war, zu gehorchen, wenn er befehle.
Da wurde es plötzlich dunkel um ihn her, und als sei ein gewaltiges Flußpferd unter den Nachen geglitten und schnelle ihn mit dem Rücken in die Luft, flog er hoch in die Höhe. Nun fühlte Georg, wie ihn ein wirbelnder Strudel erfaßte und in raschen Kreisen niederzwang in die Tiefe. Der Atem und das Bewußtsein vergingen ihm, und als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer verschlossenen Höhle unter lauter wunderlichen Gebilden von graubraunem triefenden Tropfstein. Durch das Gewölbe ihm zu Häupten ertönte ein lautes, grunzendes Lachen, und eine Stimme, die wie das Gebell eines heiseren Hundes klang, rief einmal über das andere: »Da haben wir die Wendelinbrut, da hätt' ich den Griso.«
Nun erinnerte Georg sich wieder an alles, was er von Pepe und der Frau Nonna erst zufällig gehört und dann herausgefragt hatte. Er war in die Hände des bösen Geistes Misdral gefallen, und nun sollte das echte und rechte Unglück, das ihn von Kind auf bedroht hatte, wirklich beginnen. Ihn fror und hungerte sehr, und als er an den schönen Garten zu Hause und den gedeckten Tisch im väterlichen Schlosse, an dem man so behaglich auf hochlehnigen Stühlen zugreifen konnte, und an die wohlgenährten Aufwärter dachte, wurde ihm ganz flau zu Mute.
Dabei fiel ihm auch ein, wie großen Kummer sein Ausbleiben der Mutter verursachen würde. Er sah sie vor dem inneren Auge mit aufgelöstem Haar weinend umherschweifen, ihn suchen und immer wieder suchen.
Wie er noch kleiner gewesen war, hatte sie ihn oft in ihr Bett genommen und Rotkäppchen mit ihm gespielt. Daran mußte er nun denken, und daß sie gewiß in der nächsten Nacht und vielen anderen Nächten mit feuchten Augen und ruhelos auf den seidenen Kissen liegen würde. Da fühlte er, daß ihm Thränen ins Auge stiegen; dann aber ward er zornig und stampfte vor Unwillen gegen sich selbst mit dem Fuße.
Er zählte erst dreizehn Jahre, und doch war ihm als einem echten Griso das Bangen und Grauen so fremd wie seinem Ahnherrn Wendelin I.; ja, als er die Stimme des bösen Misdral wieder vernahm, und er die Verwünschungen mit anhören mußte, die er gegen die Seinen ausstieß, wurde er von neuem Ingrimm ergriffen und las, wie es der erste Wendelin vor fünfhundert Jahren gethan hatte, einen Stein auf, um ihn dem Unhold in das runzelige Gesicht zu schleudern. Aber Misdral zeigte sich nicht, und der gefangene Georg durfte ihn auch nicht zu sehen erwarten; denn er hatte dem Gespräche zweier Geister entnommen, daß der böse Geist wegen eines Eides, den er der Fee geleistet, sich nicht an ihm vergreifen dürfe, und darum vorhabe, ihn verhungern zu lassen. Diese Aussicht schien dem Knaben um so weniger reizend, je unbehaglicher ihm jetzt schon in der Magengegend zu Mute war.
Die Höhle empfing einiges Licht aus einer Oeffnung in der Felsendecke, und als er nicht mehr weinen konnte und lange genug zornig gegen sich selbst und den bösen Misdral gewesen war, wußte er nichts Besseres zu thun, als sich in seinem Kerker umzuschauen und die Tropfsteingebilde zu betrachten, die ihn rings umgaben. Davon sah eines aus wie eine Kanzel und ein anderes wie ein Kamel, ein drittes aber reizte ihn zum Lachen; denn es hatte ein Gesicht, das dem herzoglichen Oberweinküfer mit der großen doppelten Nase ganz ähnlich sah. An einem der Pfeiler glaubte er ein trauerndes Weib zu bemerken, und dabei traten ihm wieder Thränen ins Auge. Aber er wollte nicht weinen und schaute zur Decke empor. Da hingen lange Stalaktiten, von denen viele wie Eiszapfen und andere wie feuchte graue Wäsche aussahen. Die erinnerten ihn wieder an den Trockenplatz hinter dem Schloßgarten, wo hier ein langer Strumpf und dort ein breites Hemd von der Leine herunterhing, die man im Herbst an Pflaumenbäume mit blauen, saftigen Früchten befestigte, und nun ward der Hunger in ihm so rege, daß er den Gürtel fester über den Hüften zusammenzog und laut zu stöhnen begann.
Dann wurde es Nacht. – Die Höhle verdunkelte sich, und er versuchte zu schlafen, aber er konnte es nicht, obwohl Tropfen auf Tropfen mit gleichmäßigem eintönigen Geplätscher von der Decke in die Wassertümpel am Boden fiel.
Je später es wurde, desto mehr quälte ihn der Hunger und das Schwirren der Fledermäuse, die er im Dunkeln nicht sah.
Daß es Tag werden möge, darnach sehnte er sich besonders, und mehr als einmal erhob er in seiner Bedrängnis die Hände und betete um Rettung, aber weit inbrünstiger noch um ein Stückchen Brot und das Licht des Morgens. So saß er in sich versunken still und biß sich, um doch wenigstens etwas zu kauen, die Nägel. Da hörte er in einer der Lachen am Boden etwas plätschern. Das mußte ein Fisch sein! Und wie er sich aufrichtete, um zu lauschen, war es ihm, als ob eine leise Stimme ihm riefe. Nun spitzte er die Ohren ganz scharf. Und jetzt! – Nein, er täuschte sich nicht, jetzt klang es hell und freundlich von unten herauf: »Georg, armer Bursch, bist Du wach?«
Wie das ihm gut that, und wie schnell er aufsprang und die Frage bejahte! Nun war er gerettet, das schien ihm so gewiß, wie daß zweimal zwei vier, obgleich es doch ganz anders hätte kommen können.
Ueber der Lache, aus der die leise Stimme erklungen war, glänzte jetzt ein matter Lichtschein, und ein hübscher Goldfisch streckte den Kopf aus dem Wasser, machte eine runde Schnute und sagte mit kaum vernehmbarer Stimme; denn ein rechter Fisch bringt es wegen der fehlenden Lunge im Reden niemals weit, daß Georgs Patin, die Fee Clementine, ihn sende. Seine Herrin sei zwar keineswegs mit seinem Ungehorsam zufrieden, weil er aber sonst ein braver Bub und sie den Grisos zugethan sei, wollte sie ihm diesmal aus der Not helfen.
Da rief der Knabe: »Nach Hause, nur nach Hause. Schaff mich zu meiner Mutter!«
»Das würde freilich das Einfachste sein,« entgegnete der Fisch, »und es steht auch in unserer Macht, Deinen Wunsch zu erfüllen – aber wenn Dich meine Gebieterin aus der Gewalt des bösen Misdral befreit, so muß sie ihm dafür gestatten, Deinem Hause ein anderes Leid zuzufügen. Euer Heer steht im Felde, und wenn Du zu den Deinen zurückkehrst, wird der Riese Euren Feinden helfen, sie werden die Euren schlagen, Eure Residenz erobern, und es kann leicht geschehen, daß dabei Deiner Mutter Uebles widerfährt.«
Da fuhr Georg straff in die Höhe und schwenkte abweisend die Hand. Dann senkte er den Lockenkopf und sagte bescheiden und traurig: »Dann bleibe ich hier und verhungere.«
Da schlug der Fisch vor Vergnügen mit dem Schwänzchen das Wasser, daß es hoch aufspritzte, und sprach weiter, obgleich ihn die erste Meldung schon ganz heiser machte: »Nein, nein, so schlimm soll's nicht werden. Wenn Du bereit bist, als armer Bursche in die Welt zu ziehen und niemandem zu sagen, daß Du ein Prinz bist, woher Du stammst, und wohin Du gehörst, dann wird kein Feind Eurem Heere und der Frau Herzogin etwas anhaben können.«
»Und ich werde meine Mutter und den Wendelin nie wieder sehen?« frug Georg, und über die Wangen lief es ihm nun so naß wie über den Tropfstein.
»Doch, doch,« entgegnen der Fisch, »wenn Du Dich wacker hältst und etwas Gutes und Großes zu stande gebracht hast, darfst Du zu den Deinen zurück.«
»Etwas Gutes und Großes,« wiederholte Georg. »Das muß sehr schwer sein. Und wenn ich wirklich dergleichen fertig bringe, woher weiß ich denn, ob die Fee es auch dafür hält?«
»Sobald die graue Locke Dir wächst, magst Du jedermann sagen, daß Du ein Herzogskind bist, und darfst nach Hause,« lispelte der Fisch. »Folge mir jetzt. Ich leuchte Dir voran; es ist ein Glück, daß Du viel gelaufen und hübsch mager bist, sonst würdest Du vielleicht unterwegs stecken bleiben. Nun gib acht. Diese Lache fließt durch einen Gang im Berge in den See ab. Ich schwimme Dir voran, bis zu dem großen Teiche, in dem das Quellwasser dieses Gebirges sich sammelt. Dann muß ich mich rechts halten, um in den See zurückzugelangen; Du aber schwimmst in den linken Kanal, und der wird Dich eine Stunde lang forttragen und dann mit der Quelle des großen Vitalestromes ins Freie führen. Dem folgst Du, bis er sich gen Osten wendet, und steigst dann über den Berg und wanderst immer nach Norden. Halte die Hand unter meine Schnute, damit ich Dir Reisegeld gebe.«
Georg that, wie ihm geheißen, und der Fisch spie ihm vierzig blanke Groschen in die Hand. Mit einem jeden sollte er die Zehrung für einen Tag und das Quartier für eine Nacht bezahlen.
Nun tauchte der Fisch tief unter, Georg aber warf sich ihm nach in die Lache und folgte dem Lichtschein, der von seinem schuppigen Führer ausging. Bisweilen wurde der Felsengang, in dem er auf dem Bauche durch flaches Wasser hinkroch, so eng, daß er sich den Kopf stieß und die Schultern zusammenzwängen mußte. Manchmal dachte er, daß er zwischen den Felsen stecken bleiben würde wie ein Keil im Holze. Aber er machte sich immer wieder los und kam in den großen Quellteich, wo viele Mädchen mit grünem Haar und schuppigem Schwanz sich tummelten und ihn einluden, mit ihnen Fangen zu spielen. Aber der Fisch riet ihm, sich nicht bei den müßigen Dirnen aufzuhalten, und nahm von ihm Abschied.
Nun war Georg wieder allein und ließ sich von dem schnellen unterirdischen Flusse forttragen. Endlich trat dieser als Vitalefluß ins Freie, und der Knabe fiel mit ihm über eine Felsenwand in ein großes, von grünem Laubwerk umkränztes Becken. Da spritzte das Wasser hoch auf, die Forellen darin bekamen einen großen Schreck, ein Hund begann laut zu bellen, und der Hirt, der am Ufer gesessen hatte, fuhr in die Höhe; denn das bunte Paket, das da mit dem Quell über den Felsen gesaust kam, tauchte nun aus dem Wasser auf und hatte ganz das Ansehen eines hübschen, dreizehnjährigen Buben.
Solcher stand denn auch bald triefend und pustend vor ihm und sah den Käse und das Brot, das der weißbärtige Schäfer verzehrte, sehnsüchtig an.
Der mußte sehr, sehr alt sein und war dazu taub, aber er verstand in den Augen des nassen Buben zu lesen, und weil er gerade die Ziegen gemolken hatte, reichte er ihm freundlich einen Becher Milch. Dann brach er auch ein Stück Brot und forderte Georg auf, sich in die Sonne zu setzen, die vor einer Stunde aufgegangen war.
So wie diese Mahlzeit hatte dem Prinzen noch keine gemundet, und während er aß und trank und sich sonnte, würde er jeden für närrisch gehalten haben, der ihm gesagt hätte, daß er ein Unglückskind sei.
Als er satt war, dankte er dem Hirten und reichte ihm einen der Groschen, den der Fisch ihm gegeben, doch der Alte wies ihn zurück.
Da erwachte in dem Knaben der prinzliche Stolz, und er schob ihm, weil er doch von einem in Lumpen gekleideten Mann nichts geschenkt haben wollte, das Geld wieder zurück; doch der Hirt nahm es auch diesmal nicht an. Wie er aber auf die kostbaren Kleider des Prinzen, die auch das Wasser nicht verdorben hatte, einen Blick geworfen, schüttelte er den Kopf und sagte ernst: »Was arme Hand gern gibt, das zahlt kein Geld. Behalt Deinen Groschen.«
Da errötete Georg über und über, steckte sein Silberstück ein und sagte: »So vergelt es Dir Gott.« Das ging ihm ganz leicht und herzlich über die Lippen, und doch war es das Wort, mit dem die Bettler im Lande der Grisos zu danken pflegten.
Bis Mittag folgte er dem Strome ganz schnell, um sich trocken zu laufen, und dabei dachte er an allerlei, aber es ging so rasch, daß er weder etwas Frohes, noch Trübes recht festhalten konnte; als er jedoch unter einem blühenden Holunderbusch Rast hielt, kam ihm wieder die Mutter in den Sinn, und daß er ihr so großen Kummer bereite, und sein Bruder und die Nonna und der alte Pepe, und nun ward er sehr traurig und weinte, weil er sie vielleicht nie mehr wiedersehen sollte; denn wie konnte er etwas Gutes und Großes vollbringen, und der Fisch hatte es doch von ihm verlangt. Er blieb auch drei Tage lang ganz niedergeschlagen, und wenn er an spielenden Buben oder an einer Linde vorbeikam, unter der Burschen und Mädchen lustig tanzten und sangen, dachte er: »Ihr habt es gut; ihr seid keine Unglückskinder wie ich.«
In der ersten Nacht blieb er in einer Mühle, in der zweiten in einer Herberge und in der dritten in einer Schmiede zur Nacht, und als er in aller Frühe aufbrechen wollte, kam ein Reiter hastig geritten und rief dem Meister zu, der vor der Werkstätte stand: »Die Schlacht ist verloren. Der König flieht. Die Grisos ziehen auf die Residenz zu.«
Da lachte Georg laut auf, und als der Bote dies hörte, schlug er nach ihm mit der Gerte; aber er traf ihn nicht, und der Knabe lief nun weiter, und es kam ihm vor, als hätte ihm jemand die Last abgenommen, die ihn bisher bei der Wanderung bedrückte. Einmal flog es ihm auch durch den Sinn, daß die Seinen und der Feldherr Moustache die Schlacht verloren hätten, wenn er ein Prinz geblieben wäre und, statt sich die Füße auf der Landstraße wund zu laufen, sich's daheim wohl sein ließe.
Es war noch früh, als er zu der Stelle gelangte, wo der Fluß sich nach Osten wendet. Von hier aus mußte er sich nordwärts halten und fand einen Weg, der durch den Wald auf die Spitze der Bergkette am Ufer des Flusses führte. Der Tau hing noch an den Gräsern, und in dem Eichen- und Buchenlaub über ihm flötete, rief, girrte, zirpte und hackte es so lustig, als ob alles, was Vogel heißt, mit Sing und Sang ein Fest feierte, und der Specht den Takt dazu schlüge. In den Zweigen spielte Sonnenschein, auf dem blumigen Boden lagen die Schatten der Blätter wie lauter runde Guldenstücke, und obgleich er bergan stieg, kam ihm das Atmen wunderbar leicht vor, und auf einmal, er wußte selbst nicht warum, sang er ein Lied, das er von den Gärtnerburschen gelernt hatte, frisch und aus voller Brust in den Wald hinein. Um Mittag glaubte er die Höhe erreicht zu haben, aber hinter ihr erhob sich ein noch höherer Gebirgszug, und nachdem er gerastet und das Butterbrot, das die Frau des Schmiedes ihm mitgegeben, verzehrt hatte, wanderte er weiter und gelangte, als die Sonne sich zum Untergang neigte, auf die höchste Bergesspitze weit und breit.
Von da aus konnte er den Fluß wiederum sehen. Der schlängelte sich glänzend und gleißend wie eine silberne Schlange durch grünes Wiesenland. Waldige Höhen zogen neben ihm hin, die Spitzen des Forstes waren vom Widerschein der sinkenden Sonne mit leuchtenden Bändern verbrämt, und über die schneeigen Firnen des fernen Felsengebirges breitete sich ein rosiger Schimmer, der ihn an die Pfirsichblüten daheim erinnerte. Die grauen, steinigen Höhen hinter ihm umwallte nun ein zarter, veilchenfarbener Duft, und ganz, ganz weit im Süden leuchtete etwas Blaues auf, und das konnte der liebe, heimische See sein, den er vielleicht nie wiedersehen sollte. Das Andre war alles wunderschön, und das Herz füllte sich ihm bis zum Ueberfließen mit Erinnerungen und Hoffnungen. Er wandte die feuchten Augen bald nach rechts, bald nach links, und nirgends fanden sie eine Grenze. Wie weit, wie unermeßlich weit war die Welt, und sie sollte von nun an sein Heim sein, nicht mehr der enge, hoch ummauerte Schloßgarten zu Hause. Zwei Adler wiegten sich unter den sanft erglühenden Lämmerwölkchen, und nun sagte er sich, daß er nicht weniger ungebunden umherziehen könne auf Erden als sie in der Luft. Da faßte ihn das Gefühl, ganz frei zu sein, mit voller Gewalt, und er riß das Hütlein vom Kopfe, schwang es lustig hoch über sich hin und eilte schnell wie beim Wettlauf den Berg hinunter und fand in der Klause eines Einsiedlers gastliche Ausnahme für die Nacht.
Von nun an bereitete das Wandern ihm Lust. Er war ein Unglückskind, – da half kein Leugnen, – aber einem Glückskinde konnte doch nicht viel anders zu Mute sein als ihm. Am dreißigsten Tage fand er in dem flachen Lande, wohin er schon längst gelangt war, einen Reisegefährten. Der war der Sohn eines Steinmetzen und weit älter als er; aber er nahm den lustigen jungen Vagabunden dennoch als Kameraden an, und weil er gerade von der Wanderschaft heimkehrte und bald bemerkte, daß Georg ein anstelliger, kernhafter Bursch mit offenem Kopf war, beredete er ihn, sich bei seinem Vater in die Lehre zu geben. Der hieß Kraft und war ein tüchtiger Meister, und nahm den Reisegefährten seines Sohnes, der gerade den letzten Groschen an den Mann gebracht hatte, gern bei sich auf. So wurde aus dem Herzogskinde ein Steinmetzlehrling.