
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
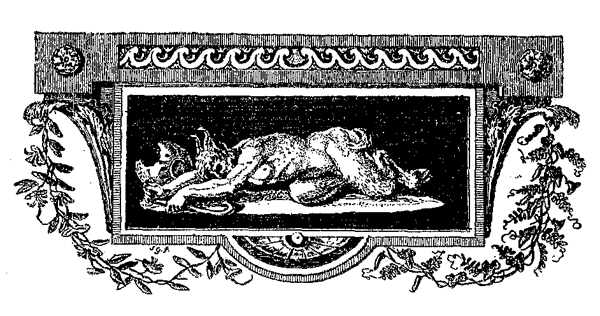
»Und der wilde Knabe brach's
Röslein auf der Heiden.«
Zu den Beziehungen aus ihrer Mädchenzeit, die Frau Brion in diesen Tagen wieder befestigte, gehörten auch die zu der Baronin v. Dietrich. Sie waren als junge Mädchen zusammen eingesegnet worden, hatten sich eingeladen und Briefe gewechselt. Nach der Verheiratung der Baronin war das junge, hübsche Fräulein Schöll gern gesehener Gast auf den Gütern der Familie, die überall im Elsaß Land, Schlösser und Bergwerke besaß. (Das Gütchen bei Sesenheim war eine spätere Erwerbung und wurde nur selten von ihnen bewohnt.) Seit einiger Zeit bekleidete Herr von Dietrich ein Ehrenamt in Straßburg, das häufig seine Anwesenheit forderte. So hatte er sich in der Umgegend ein Sommerhaus gemietet.
Dorthin waren die Brions eingeladen. Auch die Schöllschen Töchter waren aufgefordert. Es würde eine durchaus zwanglose Veranstaltung sein.
So wurden denn an einem zartverhangenen blauen Tage die fünf Damen in einer Dietrichschen Kutsche abgeholt und fuhren in bester Stimmung auf schattigen Chausseen, an Feldern vorbei, über Flußbrücken und neben duftenden Auen her zu den Gastfreunden. Salome war ganz still, aus Respekt vor dem prächtig gekleideten Kutscher und dem Bedienten, der mit gravitätisch übereinandergeschlagenen Armen zwischen den Hinterrädern saß. Sie blickte hochnäsig auf die Spaziergänger und Reiter, an denen sie vorbeiflog. Ihre Wangen waren, unter aufgelegtem Puder hochgerötet. Friederike dagegen sah blaß aus. So gern sie sich sonst unter vergnügten Menschen heiter mitbewegte, heute wäre sie recht gern zu Haus geblieben. Sie war so müde geworden hier in Straßburg.
*
Goethe hatte im Herbst vorigen Jahres mit einigen jungen Elsässern einen Ausflug in die Vogesen unternommen und war dann allein zurückgeblieben, um die Technik des Bergbaues gründlicher zu studieren, die ihn fesselte. Freiherr von Dietrich, bei dem er im Bärenthal um Erlaubnis der Besichtigung nachsuchte, gewann sogleich Interesse für den schönen und lebendigen jungen Studenten und forderte ihn auf, ihn in Straßburg zu besuchen.
Goethe aber, eben damals jedes gesellschaftlichen Treibens überdrüssig, hatte den Besuch versäumt und einen vorläufigen Entschuldigungsbrief geschrieben. Heute nun hatten von den paar jungen Herren, die man zu den Damen hinzugebeten, noch in letzter Stunde zwei abgesagt, so daß man für die Abendtafel der Jugend auf die gefürchtete Zahl 13 angewiesen war. Frau von Dietrich, zwar selbst frei von Aberglauben, aber für die Stimmung ihrer Gäste besorgt, überlegte, ob sie ihr ganzes Arrangement verändern und Alter und Jugend an einer einzigen Tafel vereinigen solle, als ihr der junge Goethe einfiel, von dem sowohl ihr Gatte wie Frau Brion soviel Rühmens machten. So bat sie ihren Mann, ihm ein Billett zu schreiben und ihn kommen zu lassen. Auch solle der junge Mann sehr schön vorlesen, wie sie aus Sesenheim erfahren. Eigene Dichtungen.
Und so geschah es, daß Frau Brion, die mit einer alten Dame auf dem Wege nach der »Einsiedelei«, wo man die Jugend Federball und Reifen spielen sehen wollte, durch die Parkalleen promenierte, sich plötzlich einem eleganten Herren gegenübersah in silbergrauem Galarock, der sich ehrfurchtsvoll verneigte und ihr die Hand küßte.
»Sie hier?« Sie hatte Goethe nicht gleich erkannt. »Warum so spät?« fuhr sie unzufrieden, fast zankend fort.
»Ein unverdienter, reizender Zufall. Man hat mich nachgeladen. Als Vierzehnten.«
Ein Diener, ihm entgegengeschickt, führte ihn zur Schloßherrin. Er verbeugte sich noch einmal tief vor beiden Damen und ging, federnd vor Jugend und guter Laune, den gelb bestreuten Kiesweg entlang, dem Schlößchen zu.
»Mir scheint, meine Teure, Sie lieben diesen jungen Mann nicht sehr? Ihre Begrüßung wenigstens klang zum Verwechseln einer Verwünschung ähnlich.«
Da, inmitten dieser Umgebung, die ihr die eigenen schönen Jugendtage zurückrief, fing die sonst so vernünftige und beherrschte Sesenheimer Familienmutter zu schluchzen an. Sie lehnte ihren Kopf an die nach Puder duftende Wange ihrer alten Gönnerin und sagte ihr all ihre Sorge um Friederike. Und nun hätte, bald nach ihrer Ankunft, da man auf den Terrassen Erfrischungen anbot, Frau von Dietrich von ihrem Sommernachbarn gesprochen, dem Oberamtmann Traumann, wohlhabend, Witwer mit einem dreijährigen Töchterchen, der sich beim ersten Anblick in Friederike verliebt hätte. Der ansehnliche Mann ließ sich sofort vorstellen und ist dann mit Friederike in den Park gegangen.
»Und nun muß dieser unselige Goethe wieder dazwischen kommen! Dieser Mensch, der keinen gleichgültig läßt, der ihm einmal begegnet!«
Die alte Dame wischte der Bekümmerten mit ihrem Spitzentüchlein die Tränenspuren ab, reichte ihr das Riechfläschchen und sodann das Puderbüchschen mit Spiegel, sich wiederherzustellen. Aber Frau Brion hatte nun keine Ruhe mehr. Sie wollte Friederike aufsuchen, ihr vorstellen, eine wieviel bessere und geachtetere Stellung sie haben würde an der Seite dieses Mannes, der hier im Lande festsaß, als an der des jungen Brausewindes, der selber noch nicht einmal wußte, was aus ihm wurde.
Friederike war ja immer ein verständiges, sanftes Kind gewesen. Sie würde das schon einsehen!
In ihrer Erregung ging sie so rasch vorwärts, daß die in ihre steifen Kleider eingesperrte, zerbrechliche, alte Dame, die an ihrem Arme hing, kaum mitfolgen konnte. – – –
Frau Brion kannte ihre Tochter doch recht wenig.
Die war am Arm des eifrig konversierenden Mannes unbefangen und gelassen durch den Park spaziert und hatte bei seinen etwas oberflächlich und nicht besonders witzigen Bemerkungen über begegnende Paare, über Straßburger Stadtverhältnisse, die schöne Lage seiner Sommerwohnung immer nur mit Freude gedacht: was geht das alles mich an? Und hat mich jemals solches Gespräch fesseln können? Früher? Da ich noch nichts wußte von Menschen, die flammen können?
Der Oberamtmann mißverstand ihre strahlenden Augen. Er begann mit gerührter Stimme davon zu sprechen, wie einsam er sei nach dem Tode seiner blonden Frau. Und wie sehr Friederike ihr ähnlich sehe. Dem kleinen Mädchen fehle die Mutter, dem Hausstand die Hausfrau, vor allem aber ihm selbst die Gattin. Er sei ein ruhiger Mann, der seine Zerstreuungen nicht außerhalb des Hauses suche, der gern am Abend mit einer zärtlichen Seele sein Kartenspielchen mache oder Patiencen für sie lege.
Friederike hatte ihr frohes Lachein beibehalten.
Da er aber nun, sie im dämmerigen »Labyrinth« an der Hand haltend, mit ihr die künstlich verworrenen Wege ging und, an einer stillen Grotte angelangt, damit begann, ihr Galanterien ins Ohr zu flüstern, machte sie sich freundlich von ihm los.
»Wie sonderbar es in der Welt bestellt ist,« sagte sie nachdenklich, »Sie legen hier alles Schönste und Liebste vor mich hin, das sich ein Mädchen nur ersinnen kann – denn auch Sie selber, Monsieur Traumann, ich sage es ohne Scheu –, Sie selber können nicht leicht einem Mädchen mißfallen. Mich aber schreckt das alles; es beschämt mich, daß ich Undank zeigen muß. Aber ich – – ich gehöre mir nicht mehr.«
Ihre Stimme tönte silberner und klarer als je. Aber es klang eine schmerzliche Ergebung mit hinein, die traurig machte. Und die überzeugte.
Der junge Witwer senkte den Kopf. »Sie wollen mir also nicht helfen, Mademoiselle Brion?«
»Helfen? Ich glaube sogar, ich könnte das.«
Er sah sie fragend an. Sein hübsches, blondes Gesicht sah schon halb getröstet aus.
Friederike redete schwesterlich. »Sie sind Witwer, Monsieur Traumann, an Zärtlichkeit gewöhnt; Ihr Herz verlangt danach. Nun, ich weiß ein junges Mädchen, nicht glücklich in ihrer eigenen Familie, das nur darauf wartet, so recht von Herzen lieben zu können. Und dieses junge Mädchen ist hier. Ganz in unserer Nähe«
Unwillkürlich blickte er um. Sie nahm ihn schwesterlich bei der Hand. »Sie haben mich in das Labyrinth hineingeführt; jetzt bin ich es, die Sie wieder hinausgeleitet. Zurück ins Tageslicht.«
Draußen trafen sie auf andere Promenierende. Die Kusinen waren darunter. Ein altes Fräulein mit ihnen. Friederike winkte Margret. »Komm doch mit uns. Herr Traumann erzählt mir gerade so lieb von seinem Maidele.«
Margret kam heran. Der junge Witwer betrachtete sie aufmerksam, wie sie verschüchtert und sehnsüchtig unter den dunklen Bäumen stand, die braunen Augen voll Wartens. Er sah nach Friederike hin. Die nickte leise. Da verstand er.
Margret hatte sich bei Friederike eingehängt, Herr Traumann ging an ihrer anderen Seite. Und bald hatte Friederike ein Gespräch in Gang gebracht zwischen diesen beiden bescheidenen, guten, aber ziemlich oberflächlichen Menschen. Ein Gespräch, in dem Herr Traumann sich erkundigte, ob die Mamsell Schöll wohl den großen Markt besuchen werde, der im Oktober in Straßburg stattfand und bei dem es immer in der Stadt hoch herging? Und Margret fragte, ob sie der Kleinen nicht ein Kleidchen sticken dürfe? Sie tat das so gern. Und Herr Traumann sagte ihr, daß sie hübsch und daß ihr Füßchen entzückend sei.
Da zweigte ein Weg zur Einsiedelei ab, und Friederike bog hinein. Sie werde dort zum Reifenspiel erwartet. Die anderen blieben zurück. – –
Ein kühles, goldiges Grün webte in dem Laubgang, den Friederike durchschritt. So leicht ging sie, daß sie es selber wohlig wahrnahm. Als habe das Bekenntnis vorhin im Labyrinth ihr Fesseln gelöst. »Ich gehöre mir nicht mehr.« Nichts von Hoffnung lag darin und nichts von Furcht. Nur ein Lautwerden der Wahrheit. Darüber hinaus dachte sie nicht.
Der Laubgang veränderte seine Richtung. Ein Wegzeichen zeigte an, daß es nun »zur Einsiedelei« gehe. Und bald öffnete sich der Ausblick auf die altertümlich hergerichtete Kapelle mit ihrem Glockentürmchen. Die zueinander geneigten Alleebäume umrahmten das Bild, das für die Vorwärtsschreitende immer deutlicher und bunter wurde. Jetzt sah sie hellgekleidete Menschen, die auf dem samtgeschorenen Rasenplatze mit hochgehobenen Armen ihre Bälle und Reifen warfen und auffingen. Viel Blau und Rosa, wehende Bänder, fliegende Locken. Man hörte das Taktaktak der Unterhaltung; dazwischen kleine Lachmelodien. Vor der Buchsbaumhecke, die den Platz kulissenartig abschloß, ein Halbkreis von Sesseln, aus denen heraus die älteren Personen das Spiel belorgnettierten.
Man ließ Friederike keine Zeit zu längerer Betrachtung. Sie hatte reizend ausgesehen, wie sie in ihrer frohen, raschen Art aus der Wegwölbung heraustrat, unschuldig umheräugend wie ein junges Waldtier. Und die naive Sicherheit, mit der sie sich sogleich am Spiel beteiligte, schaffte ihr Geltung auch in diesem Kreise, in den sie im übrigen keineswegs hineinpaßte. Unbekümmert um die freundlich oder unfreundlich abschätzenden Blicke, die ihr folgten, griff sie zu dem Reifenstock, den man ihr bot, und war bald mit voller Seele bei dem Spiel. Ganz anders als die übrigen jungen Damen, die das Spiel nur trieben, um sich in allerhand graziösen Stellungen zeigen zu dürfen. Nur flüchtig prägte sich ihr beim Laufen, Fangen, Werfen die oder jene Erscheinung ein. Sie sah die Mutter kommen, sich in einem der Sessel niederlassen und umherschauen, sah, nicht weit von ihr, die Baronin von Oberkirch sitzen, die, lebhaft den Fächer bewegend, mit dem Freiherrn von Dietrich plauderte, der hinter ihrem Stuhl stand.
Beide schienen zu einem Herrn hinzusprechen, der durch die Platane halb verdeckt war. Man sah nur Hut und Hand von ihm. Dieser Hut, diese Hand schienen ihr bekannt. Aber sie dachte nicht weiter darüber nach.
Plötzlich fühlte sie sich derb am Kleid gezerrt. Salome. Das Gesicht voll Verdruß.
»Kein Mensch kümmert sich hier um einen. Du auch nicht, Friederike.«
»Ich sah dich nicht, ich dachte, du wärst mit Jeanne?«
»War ich auch. Ein Vergnügen, das ich auch zu Hause haben kann, wenn's mir danach wäre!«
»Warum hast du nicht mit uns hier Reifen gespielt?«
Sie drehte sich vor ihr rundum. »In diesem langen Kleide laufen?«
Sie sah grotesk aus mit ihren ungestümen Bewegungen in dem breiten Stadtkleide, das sie sich von Margret geborgt hatte und dessen Rüschengarnitur von allen Büschen gerupft und zerschlissen war. Dazu die enggeschnürte Taille, die ihre junge, frische Üppigkeit zu Plumpheit werden ließ. Das aus der Stirn gekämmte, hochgetürmte Haar entstellte sie vollends.
Friederike legte mitleidig den Arm um sie und führte sie zu einer Bank, die am Ausgang des Laubganges stand. Aber Salome sprang wieder auf. Die Füße taten ihr weh. Sie wollte in die Garderobe gehen, die Schuhe ausziehen und die Füße eine Weile dort erholen.
So ging denn Friederike zu ihrem Spiel zurück. Höher, immer höher flogen ihre Reifen. Ein kindlicher Ehrgeiz hatte sie erfaßt, es den anderen Spielern zuvorzutun. Und jetzt – sie hatte eine übermütige Kraft verbraucht, ihn vom Stock zu schnellen – jetzt war ihr Reif gar in der Luft verschwunden.
Gleich darauf aber sah man ihn im Ahornbaume drüben. Sein rotes Band, das sich gelöst hatte, flatterte frei in der Luft. Eine Männerhand griff nach dem Flüchtling. Diese Hand steckte in breiter Spitzenmanschette über silbergrauem Ärmel. Die Hand hatte zu kurz gegriffen. Jetzt ein Sprung – drüben richteten sich alle Gesichter empor – der Zweig schwankte, der Reifen war an seinem Band herabgezerrt worden.
Friederike stockte der Atem, war es möglich?
Und da kam er schon quer über den Rasen gelaufen, aller Augen auf sich gerichtet. Er verbeugte sich scherzhaft zeremoniell vor Friederike.
»Hier meldet sich der Flüchtling zurück. Sie sehen, er hat es nicht lange ausgehalten, fern von Ihnen. Er bittet um neue Gefangenschaft.«
In seinen Augen blitzte es keck: von mir spreche ich.
Friederike, nicht so gewandt wie er, brachte nur ein »Das ist unverhofft!« hervor.
Sie drückte den Reifen an sich wie ein lebendes Wesen und begann mit Zärtlichkeit ihn neu zu umwickeln.
Goethe sah auf ihr gesenktes, goldenes Köpfchen herab. Lieblicher schien sie ihm als je.
Ein recht ländliches »Oha« weckte ihn aus seinem stillen Glück. Salome stürzte herbei, faßte Goethes Hand und schüttelte sie.
»Oha, wie kommen Sie denn hier hereingeschneit? Das ist mal recht! Gut, daß man nun doch einen vernünftigen Menschen hat, mit dem man über was Bekanntes schwätzen kann!«
Goethe, erst etwas betroffen von dem Überfall, dem lauten Sprechen, das weder in diese Gesellschaft noch in seine Stimmung paßte, erwiderte jetzt lachend: »Aber ich bin in diesem Augenblicke gar kein vernünftiger Mensch, Mamsell Salome.«
»Gott sei Dank!« Sie brach in lautes Lachen aus. »Um so besser. Da wollen wir einen gehörigen Unsinn miteinander treiben. A la Sesenheim.«
Zur rechten Zeit kam jetzt Frau Brion hinzu, das auffällige Gebaren ihrer Tochter zu unterbrechen.
»Es geht nun bald zu Tisch,« sagte sie beherrscht, »dir als Braut hat man einen würdigen Tischnachbarn gegeben. Den Herrn von Wurmbheim aus Fort Louis, den du ja schon kennst. Er wartet drüben auf dich.« Sie führte sie weg.
Goethe lächelte. »Welche kluge, würdige Frau, Ihre Mutter. Wie verschieden können doch Schwestern sein«, fügte er hinzu.
Es lag Liebkosung in seinen Worten.
»Das Sälmel ist halt ein Vogel, den man nicht hinter Gitter setzen darf«, sagte Friederike zuredend.
»Und Sie, Friederike, blieben auch hinterm Gitter frei wie der Vogel auf dem Zweige. Draußen und drinnen unverändert.«
Sie sah ihn von der Seite an. »Das macht, mein Freund, Sie sind ja neben mir. Ich verlange weder hinaus noch herein, wenn Sie bei mir sind.«
»Kind, Kind!« Es klang fast warnend.
Friederike machte einen Schritt nach der Gesellschaft hin. »Wir müssen nun wohl zu den andern gehn, man sieht auf uns.«
Sie begegneten Frau von Dietrich, die mit der Oberkirch ging. »Wissen Sie, daß Sie nichts Raffinierteres für sich hätten ersinnen können,« sagte die Oberkirch liebenswürdig zu Friederike, »als dieses ländliche Kostüm?«
»Es ist unsere alte Tracht«, sagte Friederike einfach. »Auf dem Lande bei uns hat sie sich noch erhalten.«
»Ich weiß! Und es ist so klug, keine Zentifolie sein zu wollen, wenn man ein reizendes Heideröschen sein darf. Ist es nicht so?« Sie wandte sich an Frau von Dietrich.
»Ganz so. Und, wie ich eben erfahre, fehlen dem lieben Wildröschen auch seine schützenden Dornen nicht. Sie brauchen nicht so betroffen auszusehen, meine liebe junge Freundin, wir werden uns verstehn, wenn ich Ihnen erzähle, daß mich Monsieur Traumann soeben beauftragt hat, bei Madame Scholl für ihn den Freiwerber zu machen. Bitte, kündigen Sie mich ihr für Sonntag vormittag an.«
»Das freut mich.« Es klang so von Herzen erleichtert, daß alle zu begreifen und zu lachen begannen.
Goethe, plötzlich ernst geworden, hatte ein undurchdringliches Gesicht.
Die Oberkirch neigte sich zu ihm. Sie spürte einen Zusammenhang zwischen dem jungen Juristen und dem lieblichen Pfarrerskinde. Nach Frauenart wollte sie ein wenig spionieren. »Das Fräulein ist eigentlich noch viel zu jung zur Ehestifterin«, sagte sie leichthin. »Man sollte meinen, sie habe ihr eigenes Schicksal bereits sicher unter Dach?« Und da sie den Verstummten auf jede weise zum Sprechen reizen wollte, fuhr sie fort: »Es täte mir leid!« Sie freute sich, wie gut sie gerechnet hatte. Dann, ein wenig boshaft: »Die Heideröslein entblättern schnell, wenn man sie pflückt. Und der Wanderer, der sich unterwegs das Röslein an die Brust steckt, wirft es weg, wenn er am Ziele ist.«
»Nein, nein!«
Sie erschrak. Seine Augen, die sich auf sie richteten, standen voll Qual. Die kultivierte Dame begriff, daß sie ungeschickt eine Wunde betastet hatte. In einer mütterlichen Wallung nahm sie Goethes Hand und streichelte sie.
Er achtete nicht darauf.
Nun sollte man zu Tisch gehn. Frau von Dietrich flüsterte Goethe zu, sie habe ihm die hochgebildete Kusine der Frau von Oberkirch zugedacht. Sie sei aus Paris.
Vor der Baronin selber verbeugte sich der Hausherr.
»Was beobachten Sie?« fragte er, da sie sich auf der Freitreppe an seinem Arm noch einmal umwandte, die langgestielte Lorgnette vor die Augen nahm und in den Garten zurückschaute, in dem die Paare sich jetzt ordneten.
»Ich wollte sehn, mit wem die kleine Brion sich tröstet.«
»Tröstet? Warum?«
»Es scheint sich da etwas angesponnen zu haben mit dem jungen Goethe.« Und sie seufzte wieder ihr »Schade«. Diesmal aber galt es nicht dem Röslein, sondern dem Wanderer. »Womöglich wird er an ihr hängen bleiben«, meinte sie sorgenvoll. »Und dann adieu Genie und Laufbahn. Und für unsere Salons ist er dann auch verloren, ein so interessanter Gesellschafter.«
Herr von Dietrich folgte mit den Augen Friederike, die, mit einem jungen Forstbeamten gepaart, ihm anmutig ihren Pompadour zu halten gab, wahrend sie gefällig einem jungen Mädchen die Halskrause glättete, die sich verdrückt hatte.
»Erstaunlich, wie sie sich in dem fremden Kreise zurechtfindet, ja, ihn durch ihre Liebenswürdigkeit beinah beherrscht. Das Mädchen ist reizend.«
»Mir scheint, Sie würden sich gleichfalls ganz gern an dieses Idyll verlieren?«
»Ich? Das Schäferkostüm würde mir wahrscheinlich ebensogut stehn wie das Magistratskleid. Aber das Mädchen sieht nicht aus, als ob sie Gefallen finden würde an solchem Spiel.«
»So wiederhole ich mein ›Desto schlimmer‹. Eine Pfarrerstochter, die geheiratet werden will! Ein Mädchen ohne alle Konnexion! Was braucht sich dieser vielversprechende junge Mann überhaupt schon jetzt zu binden?«
Der Baron schwieg einen Augenblick. Dann sagte er in einem Tone, der sonderbar ernst war: »Den bindet nichts und niemand, teure Freundin. Glauben Sie mir. Wen die Gottheit zur Größe bestimmt hat, dem hat sie auch die Kraft und Grausamkeit verliehn, zurückzustoßen, was ihn am Wachstum hindern, ihn an die Erde ketten will.«
Er hatte ernster gesprochen als gewöhnlich.
»Und Sie glauben bestimmt, daß dieser junge Mensch – – Sie prophezeien ihm eine Zukunft? Eine große Karriere?«
Dietrich lächelte. Diese Frau, die Bücher schrieb, hatte nichts vom Genie begriffen. Artig lenkte er zurück: »Aber wozu von Zukunft orakeln. Lassen Sie mich lieber die Gegenwart genießen, die in ihrer liebenswürdigen Form mir zur Seite geht.«
Sie bedankte mit freundlichem Kopfneigen sein Kompliment. Dann traten sie in den kerzenhellen duftenden Gartensaal, in dem das Souper beginnen sollte.
Alan hätte für Goethe in seiner jetzigen Verfassung keine geeignetere Tischdame wählen können als das Fräulein von Ranfft. Begierig, ihre literarischen Kenntnisse zu zeigen, sprach sie ganze Abhandlungen über Diderot. Und das in einem so geschwinden und gezierten Französisch, daß Goethe kaum folgen konnte. Einmal wollte sie etwas über Klopstock wissen, wartete aber die Antwort nicht ab, sondern schwatzte selber unaufhörlich fort.
Goethe war ihr dankbar dafür. Er saß da und nagte die Unterlippe. Sein Puls jagte. Mit aller Kraft wehrte er sich gegen das Wort, das ihm die Oberkirch zugeworfen: »Am Ziel wirft man das Röslein weg.« »Nein, nein!« Er wehrte sich dagegen, wie man sich gegen eine Krankheit wehrt, die man schon in den Gliedern fühlt.
»Was haben Sie uns mitgebracht?« fragte ihn Frau von Dietrich nach aufgehobener Tafel. »Wenn Sie uns etwas Ernstes vorlesen wollen, so setzen wir es am besten vor Beginn der Musikvorträge. Lesen Sie dagegen etwas Heiteres, so – –. Aber Sie sehen ja aus wie das verkörperte schlechte Gewissen? Sie wollen uns doch nicht etwa im Stich lassen?«
Goethe stand in peinlichster Verlegenheit. Unmöglich konnte er sagen, daß die Freude, Friederike hier zu überraschen, ihn die Aufforderung – die ja eigentlich ein Befehl war, hatte vergessen lassen. Er murmelte etwas wie »In der Eile nichts vorbereiten können«, »hätte nicht wagen dürfen – –«
Die Dietrich konnte ihre Betroffenheit nur schwer verbergen. Betrübt blickte sie auf die Paare, die jetzt an ihnen vorbei in den Musiksaal drängten. »Was machen wir nur? Man hat Sie der Gesellschaft versprochen. Alle diese schönen Damen warten schon auf Sie. Man darf sie nicht enttäuschen, was tun?«
Goethe stand ratlos, innerlich zornig über die beschämende Situation, in die er sich gebracht hatte. Aber Frau von Dietrich lächelte schon wieder. Sie ging auf Friederike zu, die mit ihrem Tischherrn plaudernd herankam. »Wissen Sie, Mademoiselle, daß eigentlich Sie an dem ganzen Unglück schuld sind?«
»Ich?« Sie wurde flammend rot.
»Ganz Sesenheim. Hätte Ihre liebe Mama nicht so verlockend von Ihren Vorleseabenden erzählt, ich hätte nie den Gedanken gehabt –«
Friederike kämpfte mit einer leichten Verlegenheit. Der hilflose Liebste aber tat ihr so leid, daß sie auf Beistand sann.
»Nun, wenn Sesenheim schuld ist, muß Sesenheim auch wieder gutmachen«, sagte sie endlich zierlich. Sie wandte sich an Goethe: »Erzählen Sie doch das Märchen, mit dem Sie bei uns alle unsere Gäste entzückten. Ich bin sicher, es würde auch hier gefallen.«
»Also erzählen, erzählen!« riefen die Umstehenden.
Der Musiksaal war gefüllt. Das kleine Konzert hatte bereits mit einer sommerlichen Barkarole begonnen, die wiegend und wohllautend die Zuhörer umschmeichelte. Friederike war, gleich nach ihrer kleinen Rede, entflohn und hatte sich, ganz durchklopft von einem ungebärdigen Herzschlag, ihr Sesselchen hinter die Vorhänge der tiefen Fensternische gerückt. Sie freute sich auf die Wiederholung des lieben Märchens. Und doch war eine sonderbare Angst in ihr. Fürchtete sie die Liebeshymne hier vor den fremden Ohren? Meinte sie, ihr Liebster würde vielleicht nicht gefallen als Erzähler? Jetzt hatte die Musik geendet, der Beifall war vorbei. Herr von Dietrich betrat die kleine Estrade und kündete die zweite Nummer des kleinen Programms an: ein Märchen, »Der Zwergenring«, vom Verfasser selbst erzählt. Er knüpfte ein paar liebenswürdige Bemerkungen an.
Nun kam Goethe. Immer wieder von neuem liebte Friederike das Durchflammte seines Gehens, Stehenbleibens, wie er den Kopf hob, die mächtigen Augen über die Menschen hinziehen ließ. Allmählich wurde sie ruhiger und konnte folgen. Da war der abenteuerlustige Ritter wieder, der Hofstaat des Zwergenkönigs, die Taufe ohne Täufling, die Beschlüsse der Hofweisen, die Ausrüstung der Prinzessin zur Brautfahrt ins Märchenland, die Verlobung, das regelmäßige Verschwinden des Prinzeßchens in ihrer Kassette. Alles war da, fast in den gleichen Worten. Aber es schien Friederike, als fehle dieser Märchenwelt heute das Treuherzige und Selbstverständliche, von dem man damals so wohlig überströmt war. Es war jetzt etwas Wehmütiges hineingeraten, etwas Unruhiges, das traurig machte.
Die Prinzessin führt den Geliebten an den väterlichen Palast. Sie gesteht ihm ihre Herkunft, ihr Schicksal, und eröffnet ihm die Bedingungen, die für ihn an den Vollzug der Heirat geknüpft sind. Der Ritter zaudert. Soll er sich wirklich festbannen lassen in ein Zwergenleben, zwischen Gräsern, Moosen, Blümchen und Kiesbrocken, die ihm wie Felsen scheinen würden? Er fühlt seine angeborene Bestimmung zu Taten, zu Wirksamkeit ins Weite. Aber während er noch sinnt, verschwindet seine Schöne traurig in ihrer Kassette, die er nun weinend, zärtlich auf den Knien hielt. Jeden Tag wächst seine Sehnsucht nach ihr, seine Leidenschaft. Er empfindet immer heftiger den Liebreiz, die Güte, den inneren Wert des kleinen Wesens. Und als sie endlich wieder erscheint, sinken sie sich glückselig in die Arme. Die Hochzeit wird gefeiert, die heilige Zeremonie des Ringansteckens unter Beihilfe von sieben körperkräftigen Priestern vollendet. Sogleich schrumpft das Paar zusammen, bekommt Spannenhöhe.
Es folgt nun die Schilderung aller Freuden im Zwergenreiche, wie Friederike sie schon kennt. Dann aber hört sie neue Worte. Worte, die ihr das Herz zerreißen.
Der Ritter kann seinen vorigen Zustand nicht vergessen. Fr trägt ein Ideal von sich selber im Herzen: das Ideal seiner früheren Größe. Inmitten aller Seligkeiten, Freuden und Zerstreuungen quält ihn das. Er versucht manchmal, den Zwergenring zu lockern, abzustreifen, aber der zieht sich nach jedem solchen Versuche um so fester zusammen, so daß er ihm zuletzt schmerzhaft ins Fleisch schneidet.
Friederike hatte sich angstvoll vorgebeugt, was redete er da? Klingt das nicht, als schildere er im Märchenritter eigne Schmerzen?
Der Atem stockt ihr. Je weiter er erzählt, um so gewisser wird es ihr: »Er meint ja sich. Meint sich und uns!« Ihr Blut gefriert. Es ist wie Sterben.
Und Goethe erzählt weiter an seinem Märchen: Der Ritter verbirgt die verräterische Wunde so gut es gehen will. Er versucht es, sich in den Seligkeiten seiner Liebe zu vergessen. Er kann es nicht. Mitten im behaglichen Kreise der liebenswürdigen kleinen Eltern, Schwestern, Bäschen, angesichts seiner angebeteten Frau bricht er in Klagen und Verwünschungen aus: wie ein blinder Gaul am Mahlstein komme er sich vor, immer in derselben engen Runde umhergetrieben. »Man hat nur einmal im Leben seine Jugendkräfte. wer sie nicht nutzt für sich und andere, wer sich selber nicht bis zu seinem Höchsten treibt, der begeht ein Verbrechen.« Unter Mühen und Qualen feilt er sich den Zwergenring vom Finger. Der Vater bittet ihn, um's Himmels willen doch wenigstens aus dem Palast herauszutreten, er würde ihn sonst sprengen. Er will die Gemahlin mit sich nehmen. Aber sie schüttelt das Köpfchen. Ihre Zeit der Verwandlungsmöglichkeit ist abgelaufen, die Luft da oben ist ihr zu hoch, das Menschenvolk zu plump und ungeschlacht. Sie paßt nicht dafür.
Da tritt er weinend aus dem Palast heraus, der geborstene Ring fällt ihm herab, er schießt mit Gewalt in die Höhe. So tief er sich auch bückt, das Zwergenschloß ist für ihn im hohen Gras nicht mehr zu finden.
Schweren Herzens wandert er in die weite Welt hinaus. Er besiegt Landesfeinde, erschlägt gefährliche Untiere, erringt sich Königreiche. Die Narbe aber an seinem Finger verheilt nicht. Sie ist sein Talisman. Immer, wenn er im Begriff ist, vom selbstgewählten Wege abzuirren, sein Leben in Vergnügen oder Bequemlichkeit zu verbringen, erinnert ihn ein Schmerz an jenen Zwergenring, den er vom Finger feilte, um nicht als ein Kleiner leben zu müssen. –
Das Märchen war zu Ende. Bleich und entspannt saß Goethe noch einige Minuten auf seinem Stuhl und blickte fremd in den Saal hinunter, aus dem ihm diskreter Beifall entgegenkam. Dann stand er auf. Seine Augen suchten. Friederike zitterte hinter ihrem Vorhange. Unaufhörlich rannen ihr Tränen übers Gesicht.
Im Publikum machte sich eine sonderbare Heiterkeit bemerkbar. Man tuschelte und schwatzte.
Herr von Dietrich kam und drückte Goethe dankend die Hand. »Wundern Sie sich nicht über unsere Ausgelassenheit. Sie hat eine besondere Ursache. Was nämlich mich, sowie einige andere Personen noch besonders erfreute, ist die feine Art, mit der Sie Märchen und Wirklichkeit zu einer so interessanten Dichtung verschmelzen.«
Jetzt drängten auch andere hinzu mit Fragen. Es stellte sich heraus, daß einige Anwesende das so deutlich geschilderte ungleiche Ehepaar kannten. Und daß auch die von Goethe erfundenen Zustände und Erlebnisse in einem gewissen Maße der Wirklichkeit entsprächen.
Es handelte sich um eine winzig kleine rheinische Sängerin, die auf Brautfahrt ging, sich einen möglichst stattlichen Gemahl zu suchen. Bis sie zuletzt in einem elsässischen Landedelmann, einem weitläufigen verwandten der Dietrichs, den Wünschenswertesten gefunden und ihn, trotz ihrer Kleinheit, zum Sklaven gemacht hatte, der ihr die Kassette mit ihren Brillanten überall nachtragen mußte. Man schilderte den Haushalt mit viel zu kleinen Möbeln, die geringen Eßportionen, an denen der Mann verhungerte. Es komme gar nicht selten vor, berichtete man, daß das kleine Wesen, hurtig wie ein Kobold, auf einen Sessel springt und ihren Riesen ohrfeigt.
Goethe stand jetzt ruhig da inmitten der Amüsierten, wohlerzogen jede Frage beantwortend. Immer wieder aber sah er sich forschend um. Jetzt streifte sein Blick Friederikes Fensternische. Er sah sie. Friederike starrte ungläubig in sein Gesicht, das sich durchaus veränderte, hell wurde in jenem raschen Aufstrahlen, das sie aus glücklichen Stunden so gut an ihm kannte. Jetzt machte er eine Bewegung mit der Hand. Halb Gruß, halb Lockung. Eine Liebkosung.
Friederikes Augen weiteten sich, was war das? Hatte sie sich denn getäuscht?
Sie sah sich um. Niemand im Saal schien anderes gehört zu haben als ein recht vergnügliches Märchen. Man tuschelte und lachte immer noch. Und war zufrieden mit sich, Märchen, Welt und allem übrigen. Friederike lehnte sich in ihr Versteck zurück. Wußten sie denn nicht, daß eine unter ihnen saß, der man soeben das Todesurteil gesprochen? Sie schloß die Augen. Alles war so weh und verworren.
Eine Sonate begann. Sie war den Tönen dankbar, die ihr Zeit ließen, sich im Dunkel ihres Elends einen Weg zu suchen.
Suchen? Ach, sie kannte nur den einen. Und der hieß: Liebe, Liebe, Liebe. –
Das Konzert war zu Ende. Friederike erhob sich. Sie hatte die Kraft zu stehn, zu sprechen und zu gehn, wie die andern taten. Dann kam der Augenblick, vor dem sie sich gefürchtet hatte: Das Ende des kleinen Konzertes. Die Begegnung.
»Endlich gefunden!« Als er so vor ihr stand, sie vertraut anlächelte unter all den fremden Menschen, ihre kalte Hand von seiner warmen guten gefaßt, vergaß sie für einen Augenblick alle Bitterkeit, alle Qualen.
Er sah sie forschend an: »Sie sind unzufrieden mit mir, Mamsell Brion? Ich weiß, ich habe schlecht erzählt. Manches kam ganz anders als ich wollte.«
»Der Schluß ist traurig«, sagte sie mit bebenden Lippen.
Er zog sie von den Leuten fort, hinaus ins Freie. Unter einer Hängeweide blieb er stehn. »Was ist mit Ihnen, Friederike? Hab' ich Sie betrübt?«
Jedes ahnungslose Wort ein Blitzstrahl, der sie brennt. Und auf einmal versteht sie. In ihrer großen, unerschütterlichen Liebe zu diesem Dichtermenschen versteht das einfache Mädchen, was ihrem Liebsten geschehen ist! Ja, diese gelassen schönbewegten Lippen, die jetzt zärtliche Worte zu ihr reden, sie sind der Maskenmund gewesen, aus dem sein Dämon grausame Worte schrie. Worte, von denen er selber nichts weiß. Noch nicht!
Eines Tages aber werden die Schmerzen aufwachen, die in ihm schlummern. Sie werden eigene, bewußte Worte finden, Anklagen, Verwünschungen, wie sie der Ritter im Märchen fand. Entsetzliche Worte!
Jedes von ihnen hat sich ihr eingegraben. Blutig.
Eine böse Lust fallt sie an, den Nachtwandler zu wecken. Aber unversehens hat ihr Herz sich schon mit Mitleid angefüllt. War er nicht unglücklicher als sie? Sie brauchte nichts zu tun, als ihn zu lieben. Er liebte sie und mußte sie verlassen. Wie schützend breitete sie die Arme aus. Und dann, mit einem kleinen, hellen Schrei, wie die Vögel schreien, die zu ihren Nestern fliehn, stürzt sie ihm um den Hals und küßt ihn wie noch nie. Noch ist er da. Noch weiß er nicht, daß er leidet. Daß er sie bald verläßt. Sie aber weiß es. Weiß, daß ihr Tag nur kurz ist. Und daß sie ihm abgewinnen muß, was irgend er ihr noch zu geben vermag.
Aus dem Gartensaal tönt jetzt Tanzmusik. Friederike horcht empor. »Tanzen, laß uns tanzen.« Sie laufen zum Saal zurück, mischen sich in die Reihen. Zwei Fröhliche unter den Fröhlichen.
Spat abends fuhr man heim. Viele Sterne leuchteten. Salome war in bester Laune, hatte zuletzt noch allerlei Anschluß gefunden, hatte geplaudert, getanzt und war mit sich zufrieden. Das Bräutchen Margret schmiegte sich beglückt und still an Friederike. Jeanne kritisierte säuerlich die Gäste. Frau Brion sah mit wachen Augen auf den Schein der Wagenlichter, der über den Chausseesand fegte. Ihr war weh um Friederike.
