
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Barbados, West-Indien.
Ein donnergleicher Schnarcher des Walrosses weckte mich, und gleich darauf hatte ich den zweiten Schreck: Wir ankerten im Morgendämmern vor fremder Küste, und kleine Boote umschwärmten den »Bologna«. Fünf Minuten später sauste ich auf Deck. Oben wartete schon der dänische Botaniker und wir verhandelten sofort mit »König Dixie«, uns ans Land zu bringen. Vorsichtig kletterten wir die Schiffsleiter hinab, während unsere Mitreisenden in Kaffeegenüssen schwelgten. Wir wollten Flora und Fauna studieren und die »Allgemeinheit« abstreifen.
Der Hafen von Queenstown ist so winzig, daß nur Segelschiffe einlaufen können und zwei vor der Einfahrt gescheiterte Schiffe legten Zeugnis davon ab, wie sehr die Insel von Stürmen heimgesucht wird, ist sie doch die erste, die dem Atlantik im Osten neuerdings Widerstand bietet.
Der schwarze Schutzmann in weißer Uniform grüßte ganz militärisch, als wir vorbeischritten, und Herr G. entledigte sich mit bewundernswerter Gewandtheit der vielen kleinen Negerlein, die sämtlich einige Kupferstücke haben wollten und die bereit waren, uns überallhin zu führen und weiß der Himmel was alles für uns zu tun.
Schon auf dem ersten freien Platze, auf dem das Nelsonmonument errichtet war, sahen wir Tropenfrüchte, besonders Zuckerrohr, doch da wir kein englisches Geld hatten, begnügten wir uns mit dem Anblick der Bündel. Alles begeisterte mich – die schwarzen Wägelchen mit Dach, aber ohne Seitenwände, die schwarzen Kutscher unter lichtbraunem Riesensonnenschirm; die netten Negerbauten aus graubraunem Holz, deren Fenster wie Klappen in einer Mausefalle auf- und zuflogen und aus denen sich von Zeit zu Zeit ein Negerkopf schob, um uns grinsend einen guten Morgen zu wünschen; die dicken Negerfrauen in weißen, straff gestärkten Kleidern und die fast unbekleidete Jugend.
Die englischen Villen standen sämtlich in einem herrlich gepflegten Garten und waren vorwiegend einstöckig, sehr luftig gebaut und von hohen, fremdartigen Tropenbäumen beschattet.
Eine lange Allee von Königspalmen nahm uns auf und führte uns hinaus ins Freie. In diesem Augenblick fühlte ich mich für alle Leiden bezahlt, denn ich sah zum erstenmal die echten Tropen mit ihrer blendenden Pracht, dem Zauber des Ungewohnten, der drückenden Wärme, ohne die Schattenseiten auch nur zu ahnen. So geht es gar vielen Reisenden, die durch das malerische Aequatorialgebiet einfach durch reisen. Herrn G.'s Warnungen, kein Wasser zu trinken, dies oder das nicht anzurühren, ein Tuch über den Nacken zu binden, nicht ins hohe Gras zu steigen und so weiter, erhöhten nur den Reiz des Neuen. Selbst die Gefahren wurden zu Freuden …
Wir erreichten das Meer. Vor uns lagen die Schätze der Tropensee, eine Unzahl von Muscheln und Korallen, von komischen Krabben und seltsamen Versteinerungen. Wenn Herr G. mir nicht einfach alle aus der Hand genommen und sie weggeworfen hätte, würde ich mit einem ganzen Steinhaufen herumgelaufen sein, so entzückt war ich von diesen unbeschreiblichen Gebilden. Wo die Korallen aus dem Wasser schimmerten, wirkte es lichtgrün und wurde erst später tiefblau, und das grelle Weiß des Strandes mit diesem Grün und Blau bildete eine Farbenharmonie, wie ich sie nur selten geschaut.
Mein Gefährte erklärte die Namen der Bäume, der Vögel, der Pflanzen, untersuchte das Gestein, forschte nach Würmern und Insekten. Ich lernte da an einem Tage, was ich sonst wohl kaum in Monaten erfahren hätte. Mit steigender Begeisterung gingen wir tiefer ins Land hinein.
Auf dem alten Friedhof sahen wir die ersten Kolibris. Winzig wie große Hirschkäfer wippten sie sich am äußersten Ende eines breiten Tropengrashalms und wirkten ganz schwarz, bis eine jähe Bewegung das Gefieder aufleuchten machte. Dann schimmerten sie rot, grün, blau, gelb an den verschiedenen Körperteilchen und wechselten bei jeder Bewegung und Beleuchtung. Ein Negerlein erbot sich, einen zu fangen, und wurde schlimm hergenommen. Das ist von der Regierung streng verboten. Man bestraft das Töten dieser und anderer Vögel (es gibt auch weiße und blaue Reiher) mit dreißig Tagen Gefängnis. Bemerkenswert sind die Ruderschwänze und die wilden Tauben, die braun sind und schwarzgeränderte Flügel haben. Die weißumrandeten Augen der Ruderschwänze wirken wie dickknopfige weiße Stecknadeln im dunklen Gefieder; der Schwanz ist immer einseitig gesenkt.
Nun waren wir mitten in einer Zuckerpflanzung und beide ganz arm. Herr G. meinte, daß der Diebstahl eines kurzen Rohres niemand ärmer, mich aber um Wissen viel reicher machen würde, und so holte er eins, das wir in Stücke schnitten und wissensdurstig kauten. Es schmeckte süßlich, eher langweilig als nicht und ist, bis auf zwei oder drei spätere Versuche, das einzige Rohr geblieben, das je mit meinen Zähnen Bekanntschaft machte. Wenn ich schon so lange an einer zähen Sache herumbeißen soll, muß sie wenigstens besser schmecken. Sonst ist sie einfach Kaugummi zur Kiefermassage.
Damals aber brachte ich noch einige Begeisterung auf, und mitten in unser sündiges Frohlocken kam die Strafe. Aus heiterem Himmel (jedenfalls war das jähe Aufsteigen der Wolken uns entgangen) stürzte ein Tropenguß herab, der uns, obschon wir sofort unter das übermannshohe Zuckerrohr flüchteten, in wenigen Minuten bis auf die Haut durchnäßte. Dann blies der Wind die Wolken davon, und die heiße Tropensonne trocknete zwei weiße Jammergestalten.
Ich entdeckte im Lauf der Wanderungen einen schönen, etwas an unsere Akazien erinnernden Baum, mit noch viel zarter gefiederten Blättchen und daran eine Frucht. Herr G. erkannte ihn als Tamarinde, und bald aßen wir das braune Fleisch aus brauner, leicht zu zerbrechender Schote. Es schmeckte säuerlich süß, und ich stopfte nach Herzenslust, bis mein Begleiter sagte:
»Mein Fräulein, die Tamarinde hat medizinischen Wert! Wenn Sie nicht hinter jedem Busch verschwinden wollen …«
Ein Wort genügt dem Weisen. Ich warf den Rest der Schoten fort.
Am Abend kamen wir zu einem Feld mit einer Kuh. Nichts Erschütterndes an diesem Umstand, aber Herr G. klopfte ihr plötzlich auf die äußerste Verlängerung und nannte sie »alte Dame«. Ob sie daran Anstoß fand oder Vertraulichkeiten nicht mochte, bleibt dahingestellt. Jedenfalls drehte sie sich um, erhaschte Herrn G. bei der Hose und warf ihn in die Luft. Es geschah ihm nichts, denn er flog auf's Gras, aber ich kam in den Geruch des Heldentums – ungerechterweise, da die Kuh angebunden war – weil ich trotzdem an ihr vorbeiging.
Todmüde kehrte ich heim und dennoch überbefriedigt. Ich hatte die erste Tropenweihe empfangen. So mochte Columbus gefühlt haben, als sich ihm, so nahe von Barbados, eine neue Welt aufgetan. Ich bereute kein Opfer. Lernen wollte ich, schreiben, malen, das erlebte Wunder in jeder Weise anderen mitteilen.
Noch einmal fühlte ich, als ob es mir vergönnt sein würde, die Welt aus den Angeln zu heben. Ich schaukelte auf dem Taupfeiler, den Blechsuppenteller in der Hand, und mir zu Füßen lagen die gehorsamen Untertanen.
O Bologna, Bologna!
Trinidad.
Auf jeder Reise kann man merken, wie sich der geistige Horizont weitet, wie er wächst und man selbst mit ihm. In so fremden Gebieten ist das Wachstum fast schmerzlich; denn es geht allzu schnell vor sich, erschüttert sogar körperlich durch die Fülle der Eindrücke, verbunden mit neuer Umgebung.
Wir glitten in den Orinoco.
Er kam aus den unerforschten Höhen, kannte die innersten Geheimnisse Venezuelas, hatte an seinen Ufern einst Männer wie Walter Raleigh gesehen und rieb seine Wasser an der bitteren Cinchonarinde. Nun stießen wir, zwanzig Meilen von seiner Mündung entfernt, hier auf ihn, und noch war er süß, unbeeinflußt vom Meer, voll Hölzern, die er sich als Herr mitgenommen, Schlangen, Tierleichen, allerlei Gräserwerk in den Atlantik hinausschwemmend. Er war voll Medusen, die wie unzählige Tennisbälle aus den grünen Wassern schimmerten, und deren Berührung Badenden einen heftigen Schmerz verursacht.
Ueber das Schiff flogen die Fregattenvögel mit ihrem langen schwarzen Leib dem » Port of Spain« zu. So nahe die Inseln voneinanderliegen, so verschieden sind sie. Barbados ist beinahe flach, höchstens Hügelchen; Trinidad ist eine bergige, sehr ausgedehnte Insel, die Wasserfälle von großer Schönheit aufweist und den berühmten Pechsee enthält, aus dem ein bedeutender Teil des Asphaltbedarfs der Welt gedeckt wird. In der Matte ist er noch flüssig, an den Ufern schon fest, aber immer noch sehr heiß. Die Ausdünstungen sind schwer einzuatmen.
Hier findet man neben den Negern sehr viele Inder, die als Kulis eingeführt wurden und auf den verschiedenen Pflanzungen arbeiten. Die Frauen tragen den Nasenring, wie in Indien selbst, bewegen sich indessen sonst freier.
Die meisten Häuser, besonders die der ärmeren Leute, sind aus Holz mit einem Wellblechdach, und man findet auch Hütten, die aus alten Blechbüchsen erbaut worden sind. Dicke Wände sind nicht vonnöten, und alles ist verwendbar, was den Regen abhält.
Neben den steifen Königspalmen, den schlanken, immer windgebeugten Kokospalmen, findet man die Mauritia flexuosa, eine sehr schöne Fächerpalme, die aus Afrika stammt. Ich trank da meine erste Kokosmilch, ein fades Getränk, das ich nie wieder anrühren mochte. Man nimmt dazu die noch unreife grüne Nuß, die so groß wie ein heimischer Kürbis ist, schneidet oben ein Loch hinein und trinkt auf diese Weise. Dabei ist einem aber stets die Nase im Wege, und trinkt man nicht vorsichtig, so tropft der lichte Saft herab, und das Kleid erhält Flecke.
Nach Jamaica ist Trinidad die größte der westindischen Inseln. Sie verdankt ihren Namen dem Umstand, daß sie an einem Dreifaltigkeitstage entdeckt worden war.
Spät abends sah ich zum erstenmal das bewunderte Kreuz des Südens. Es ist lange nicht so auffallend, wie ich es mir gedacht hatte, und kann einzig mit dem lateinischen Kreuzzeichen – den vier Punkten – verglichen werden. Dennoch ist es ein eigenes Gefühl, ihm gegenüberzustehen. Der große Bär stand schon verkehrt mit dem Polarstern darunter. Noch ein paar Tage, und er bleibt verschwunden. Was würde ich alles erlebt haben, bis ich ihn wiedersah, den Stern meiner Kindheit?
Draußen zog unklar die Küste von Venezuela vorüber. Die ersten Eroberer hatten die Pfahlbauten bestaunt, die neugierig tief in das Meer hineinwateten wie muschelsuchende Kinder, und hatten das ganze Land danach »Klein-Venedig« benannt. Ueberflüssig zu betonen, daß es durch nichts anderes als das Wasser an Venedig erinnert.
La Guayra.
Ich blinzelte ins Finstere, starrte angestrengt auf den hohen Berg hin, der direkt aus dem Wasser emporstieg und erdrückend wirkte, und erkannte einige Häuschen, die an ihm emporkletterten. Dann kam ein rotes Flimmern über die Landschaft, etwas Düsterhehres, und einige Sekunden später ein weiches Silbergerinnsel. Unmittelbar darauf ist es heller Tag, so rasend schnell ist der Sonnenaufgang in den Tropen, pünktlich um sechs.
»Niemand darf landen!« wurde uns vom ersten Offizier gesagt. »Es herrscht die Pest, und wer hier ans Land ginge, der dürfte nicht nach Panama weiterfahren.«
Traurig kaute ich mein Frühstücksbrötchen. Solch ein Pech! Ich wanderte auf dem breiten Wellenbrecher des Hafens auf und ab, auf und ab. Einige Schritte vor mir lag die Stadt, und ich sollte nicht hineindürfen? Nicht die Kaffeepflanzungen sehen, nicht nach Carácas fahren? Unmöglich!
Auf und ab, auf und ab, zehnmal an der Wache vorbei, immer sehr unschuldig, immer ein wenig näher einem alten Zaun, der einige Planken verloren hatte. Die Wache wurde müde, setzte sich. Ich pendelte hin und her, blieb auch oft lange stehen und bewunderte die herrlichste Brandung, die ich je gesehen. Zwanzig Meter hoch sprang der Schaum über die Klippen und benetzte noch den hohen Wellenbrecher.
Wieder war ich beim Zaun. Ich bin mager und klein. Ein Ruck, und ich stand draußen. Ohne mich umzuwenden, betrat ich La Guayra, bereit zu schwören, daß ich den »Bologna« nie in meinem Leben gesehen hätte.
So heiß ist selten ein Ort; denn nicht ein Windhauch findet Einlaß. Der hohe Berg umklammert den Ort und droht ihn zu erdrücken. Auf die kahlen, vom Erdbeben zerrissenen, von den Tropengüssen abgeschwemmten Felsen sticht die Sonne vom Morgen bis zum Abend mit unverminderter Kraft. Es ist daher kein Wunder, daß hier das gelbe Fieber mit Pest und Cholera ihr verheerendes Werk tun. Eine prunklose Kirche mit vier Heiligenstatuen davor, die sämtlich recht traurige Gesichter machen, ein Park, der wohl möchte, aber nicht kann, ein Kokoswäldchen, das viele Nüsse, doch leider keinen Schatten gibt, – das sind die auffindbaren Wunder von La Guayra. Unweit des Kokoswäldchens steht indessen die Eisenbahn, deren Zug aus zwei Wagen erster und zwei zweiter Klasse zusammengesetzt ist.
Die Weißen sollen in der Ersten fahren, doch wenn man kein Geld hat, fährt man ebensogut auch in der Zweiten.
Hellbraun, zumeist Mischlinge, sind die Einwohner. Sie krochen mit ihren Riesenbündeln wie müde Ameisen auf den Zug, verstauten sich und ihre Päckchen auf, über und unter den Sitzen, kauten Zuckerrohr und erteilten bereitwillig Auskunft über alles. Die Männer unter den breitkrempigen Strohhüten bohrten ihre kohlschwarzen Augen in mich; im Wesen der Frauen lag etwas Schwermütiges, Lebensmüdes.
Sobald man eine gewisse Höhe erreicht, bläst ein frischer Wind, und man erholt sich vom toten Gestein. Palme reiht sich an Palme, unbekanntes Strauchwerk wird zum grünen Wall. Nach und nach entfalteten sich die Kaffeepflanzungen. Auf dem glänzenden, dunkelgrünen, leicht gezackten Laub saßen die hellroten Beerenbüschelchen wie winzige Sträußlein, außerordentlich reizvoll. Dicht am Stamm eines dünnen, zackenblättrigen Baumes hingen riesige Früchte – die gepriesenen Papayas, aus denen die Nordamerikaner das Pepsin gewinnen; Chirimoyas, die schuppigen Zuckeräpfel, pendelten an vorspringenden Aesten; Sapodillas lagen in Körbchen. Sie ähneln täuschend unseren Kartoffeln und haben ein weißes, süßliches Fleisch. Anderes, mir noch unerklärtes Obst ruhte in reizenden Bastkörbchen, die man überall in Venezuela an Stelle von Tüten bekommt, um das gekaufte Obst leichter heimzutragen, und überall leuchtete die Bougainvillia in ihrem unvergleichlichen Purpurviolett.
Carácas liegt einige hundert Meter über dem Meeresspiegel und wackelt fast ununterbrochen. Erdbeben gehören gewissermaßen zur Tagesordnung, und die Häuser sind schon mit Rücksicht darauf gebaut. Niedere Bauten, kleine Fenster, Gassen, die gerade sein möchten und nicht können, ein Park, eine Kirche, die so viel Sprünge wie ein Altweibergesicht Runzeln hat, Geschäfte voll von Ladenhockern aus Osten und Westen und hinter und über all dem der Zauber Süd-Amerikas, der Wind des Geheimnisvollen, Unerforschten, der von den Niederungen des Orinocos, von den Gipfeln der fernen Anden bis hierher weht. Düfte vom Atlantik, vom Antillenmeer, vom Stillen Ozean, von Gebieten so furchtbar und todbringend, wie unser Gedanke sie kaum faßt, … und dazu das leichte Wanken des Bodens, das plötzlich wie ein Memento mori durch alles Sehen und Erfahren bricht …
Spät am Abend kehrte ich müde nach La Guayra zurück, traf Herrn G., der auch durchgebrannt war und mich tüchtig auszankte, daß ich nicht mit ihm gegangen war, und später meine eigene Eßgruppe, die erklärte, sich etwas von La Guayra ansehen zu wollen. Man hatte ein kurzes Aussteigen doch gestattet. Sie nahmen uns mit und wir beschauten … das nächste Gasthaus.
Der erste Offizier lächelte bei meinem Kommen, sagte aber nichts. Von der Brücke sieht man eben allerlei, und selbst die kleinste Schriftstellerin, die durch die engste Plankenöffnung kriecht, bleibt nicht immer verborgen. Aber wer zwischen Osten und Westen fährt, hat auch gelernt, im Notfall beide Augen zuzudrücken.
Puerto Cabello.
In diesem schönen Hafen, den wir nun anliefen, um nach zwei Stunden wieder abzufahren, erhielt ich wieder eine Warnung, die ebenso unbeachtet wie die erste, an mir abglitt. Die hübsche deutsche Kaufmannsfrau, die kein Wort ihres künftigen Landes verstand, lehnte neben mir an der Reeling, und vereint feilschten wir um Papageien und die entzückenden Zuckervögel, die ich nur dort gesehen habe. Sie sind von einem herrlichen Blau, wie Leberblümchen im Vorfrühling, haben einen tiefhimmelblauen Fleck oben auf dem Kopfe und die Flügel ganz schmal, aber scharlachrot gerandet. Sie nähren sich von Mehlwürmern und ähnlichen Dingen und sind daher schwer zu halten, aber ihre Schönheit begeisterte uns. Einige der reicheren Leute kauften auch Aras, die hühnergroßen, sehr bunten Tropenpapageien, deren durchdringendes Geschrei sie sehr unangenehm macht. Mir setzte jemand solch ein schwerbeschnabeltes Unding auf die Hand, und da stand ich – unfähig, das Vieh abzulegen.
Während wir uns also ganz mit der Tierwelt beschäftigten und uns die Baumratten ansahen, die auf- und niederrasten, stellte sich unten vor dem Schiff ein brauner Farmer mit einem Strohdach erster Güte auf und begann, der schönen Blondine außerordentlich den Hof zu machen. Ich wurde zum Dolmetsch, und je verliebter er wurde, desto lebhafter verdolmetschte ich seine Liebesschwüre. Frau O. fühlte sich im Grunde geschmeichelt, und der Braune wurde derart aufgeregt, daß er ihr allen Ernstes zusprach, vom Schiff herabzuklettern und bei ihm als seine Gattin zu bleiben. All mein Beteuern, daß sie schon verheiratet war und einen weit besseren Gatten hatte, verfing nicht, und wenn nicht so viele Menschen herumgestanden wären, so glaube ich wirklich, daß er sie mit Gewalt vom Schiff gerissen und davongeschleppt hätte. Neben mir sagte der Zuckerbäcker von Riobamba sehr ernst: »In der Tat, weiße Frauen haben hier einen ungeheuren Wert.«
Ich lachte dummvergnügt in mich hinein. Mich freute es, daß ich hier, wie der Dollar daheim, ein Ding war, daß im Werte ständig stieg. Ganz breitspurig wanderte ich über's Deck.
Jemand drückte mir die Hand. Es war meine Landsmännin, die Gattin des Peruaners. Sie mußten hier aussteigen und wollten zu Fuß durch das Innere nach Peru. Was das bedeutete, wußten wir damals beide nicht. Das war eine Strecke wie von Palermo zum Nordkap, und ganz durch Urwaldgebiet.
Sie trug ein schwarzes Seidenkleid mit einem gelben Wasserfall von verblichenen Spitzen. Nichts trugen die beiden in der Hand, nicht einmal ein Taschentuch. Sie gingen in die neue Welt, wie man aus einer Elektrischen steigt. Langsam sah ich sie den Hafendamm entlangschreiten; ganz ohne Eile. Er hatte vielleicht drei, vier Pesos in der Tasche. Gewiß hat er sie ermordet, ehe eine Woche vorüber war. Dann mochte er wohl irgendwie in sein Land zurückgekehrt sein. So oft ich mich später über die Last selbst meines bescheidenen Gepäcks ärgerte, dachte ich mit Grauen an meine Landsmännin, die mit hängenden Armen in ein fremdes Land gegangen war, um vielleicht schon vor dem Sinken der Sonne den Tod zu treffen.
Und selbst für diese Begegnung mußte sie – unter den obwaltenden Umständen – noch dankbar sein.
Willemstad. Curaçao.
Nach neunstündiger Fahrt, neuerdings dem Norden zu, fuhren wir in einen Fluß, der ebensogut in Europa gelegen sein konnte. Die Häuser, die wir im Schein der Lampen erblickten, waren die Häuser Amsterdams; die Laute, die an unser Ohr schlugen, die Hollands. Wir hatten Wilhelmsstadt erreicht.
Früh am Morgen flüsterte Herr G., wir sollten uns allein aus dem Staube machen, denn sonst würden wir nichts kennen lernen, und so verschwanden wir unheimlich früh und durchwanderten die Stadt, die holländisch rein und holländisch langweilig war. In den Geschäften bunte Farben, auf dem Markte viel Obst, aber sonst nichts Tropenhaftes, denn die Insel ist ungewöhnlich trocken, infolgedessen auch gesund, entbehrt aber jener üppigen Bewaldung, deren sich nässere Inseln erfreuen. Dies war überdies die Trockenzeit – der Winter der Tropen – und so spärlich war das Grün selbst an einzelnen Sträuchern, daß ich eine Kuh Papier fressen sah. Ihre Milch mochte dementsprechend sein. Alles, was wir antrafen, waren Säulenkakteen, Aloen, Scheibenkakteen mit furchtbaren Dornen und einige halb verdorrte Schirmakazien.
Selten bin ich so lange über Hügel und Berge gewandert. Oft trennte ein Drahtzaun ein trostloses Gebiet vom anderen. Manchmal kroch ich auf allen Vieren unten durch, manchmal packte mich Herr G. und warf mich hinüber, was bei der sandigen Beschaffenheit des Bodens möglich war. Ballenkakteen, Akazien und Mangroven waren indessen alles, was wir entdeckten. Mangroven wachsen dicht am Strand, bleiben freudiggrün, blühen rot und lassen den langen, spitzzulaufenden Samen so fallen, daß er sich in den Sand oder Uferschlamm bohrt. Daraus entsteht ein neuer Baum. Die Rinde ist dunkel und so rauh wie ein Reibeisen. Sie dient auch den Eingeborenen einzelner Länder als ein solches. Wunderbare Muschel-, Krabben- und Korallenversteinerungen waren zu finden. Ein ganzer Berg bestand daraus.
Da erspähte ich den ersten Tropikvogel. Er ist ganz schwarz und gelb wie die einstige Kaiserfahne, oder besser orange.
Auf dem Rückweg hatten wir ein Abenteuer. Die sonndurchglühten Felsen bergen recht gefährliche Schlangen, und Herr G. befahl mir, Ausschau zu halten. Müde, die Arme verbrannt, das Gesicht aufgedunsen, hinkte ich talwärts, als ich einen furchtbaren Schmerz im linken Fuß verspürte und einen Schrei ausstieß. Mein Begleiter schnellte geschwind herum, ich erwartete, eine Sandviper an meinem Bein zu finden, entdeckte indessen einen Tellerkaktus, dessen ungewöhnlich lange braune Dornen mir tief ins Fleisch gedrungen waren.
»Wir müssen die Sache mit einem scharfen Ruck entfernen, sonst bricht irgend eine Spitze, und das Bein wird eitrig«, erklärte Herr G., packte meinen Hinterhuf und riß einen Dorn nach dem anderen weg. Wenn ich nicht im Geruch des Heldentums gestanden hätte, würde ich laut gebrüllt haben, so aber biß ich die Zähne zusammen und starrte tapfer ins Nichts.
»Was haben Sie in Curaçao gesehen?« fragte man auf dem Schiff. Nach langem Kreuzverhör erklärte man einstimmig: »Die Armen haben nichts gesehen, nicht einmal den weltberühmten Curaçao getrunken. Nein, so etwas!«
Wir beide lächelten nur.
Vom Curaçao bekam ich dennoch zu kosten. Sie waren alle gut auf dem »Bologna«.
Puerto Colombia.
Es war ein Josephitag und rauh für die Tropen. Wir konnten nicht einfahren, weil der lange Pier ausnahmsweise besetzt war; mehr als drei Dampfer auf einmal fanden nicht Raum. So hüllten wir uns in Decken und beobachteten die zahlreichen Pelikane, die auf dem Sand umherwanderten, und von Zeit zu Zeit tauchten. Der ungeheuer lange Schnabel gab ihnen ein komisch schwerfälliges Aussehen.
Wir waren alle stiller als sonst. Herr G. wollte zu Forschungszwecken den Magdalenenstrom emporziehen, und der deutsche Kaufmann mit seiner Frau beabsichtigte, sich in Medellin oder Bogotà niederzulassen. Er hatte sehr viele deutsche Stahlwaren mit und verkaufte in jedem Hafen etwas an die Eingeborenen, um fremde Valuta einzutauschen. Sein Spanisch war schwach, seine Frau sehr hübsch, sein gesunder Menschenverstand nicht auf Abenteuer eingestellt. Ich habe mich oft gefragt, wie es ihm ergangen sein mag.
Es blieb nur ein Deutscher an Bord – Don Luis, der den Beinamen »der Fresser« führte, weil er einen so gottgesegneten Appetit hatte und von der ganzen Mannschaft gefüttert wurde. Er mußte fast all die Kriegshungerjahre nachessen. Mein Idealismus stieß sich an seiner Eßlust und seiner Hose; ich nahm es nicht einmal mit genügender Anerkennung auf, als er mir am nächsten Morgen, nachdem ich von Herrn G. Abschied genommen hatte, in einem väterlichen Tone sagte:
»Es ist mir aufgetragen worden, über Sie zu wachen.«
Wag wußte er von Pflanzen und Vögeln und von der Art dieser Leute? Wir liefen zusammen über Berg und Tal, und ich knurrte innerlich über mein Einsamsein und ahnte nicht, daß mir ein Schutzengel zur Seite ging, der zu irdischen Zwecken die Flügel daheim gelassen und eine sehr verbrauchte Matrosenhose an hatte.
Puerto Colombia liegt zu Füßen von ziemlich hohen, bewaldeten Bergen, die zur Regenzeit sehr freundlich wirken müssen, nun aber braun und öde den kleinen Ort umschlossen. Die Gassen waren voller Flugsand, die Häuser ebenerdige Holzbauten, die Hütten der Eingeborenen einfach aus Lehm zusammengeworfen und im besten Falle einmal weiß gestrichen. Holzstangen versperren gitterartig die kleinen Fensterlein, auch die der europäischen Häuschen, deren Holzverschlag an einen Käfig erinnert. Durch diesen Käfig sprechen die Frauen zu den Vorübergehenden. Das Dach ist überall aus Palmenstroh. Die Kirche selbst ähnelt einem luftigen Stall. Die Orgel gibt nur einen Ton bei jeder fünften Taste, die Sakristei ist hinter einem gespannten Leinentuch hinter dem Hochaltar, und auf dem Kirchhof, an die Grabkreuze gebunden, weiden Ziegen.
Wir betrachteten die Hühnerleiter, die zur Kanzel führte und die Kuhglöcklein, die vor der Kirche von einer Querstange baumelten; hierauf nahmen wir Abschied von unseren Freunden, die schon im Zug nach Barranquilla saßen, der wie eine rollende Holzkiste aussah und von halbnackten Eingeborenen umringt war, die Herrn O. Rasiermesser abkauften, sie überall an sich ausprobierten, und die Frau O. sehnsüchtig anglotzten. Ein gelbbrauner Mischling wiederholte wie ein Papagei:
»Die schöne weiße Dame soll nach Medellin fahren, wo es kühler ist; hier wird sie bleich werden …«
Herr G. reichte mir die Hand. Der Zug machte ppppffff und Menschen, die ich lieb gewonnen, verschwanden im wachsenden Staube …
Unweit von Puerto Colombia lag die Ortschaft Sabanilla. Einst landeten alle Schiffe dort, doch nun war der Magdalenenstrom so weit vorgedrungen, daß er bis weit hinaus Strand und Meer versandete und man den Hafen verlegt hatte. Kokoswäldchen führten dahin. Wir erfuhren unterwegs – Don Luis hielt tapfer aus – daß man alles Trinkwasser von Barranquilla brachte und teuer bezahlen mußte.
Im Magdalenenstrom und auch im angrenzenden Meer darf nicht gebadet werden. Es wimmelt von Alligatoren.
Obschon die Tropensonne heiß auf alles schien, wurde uns das Herz seltsam schwer. Diese elenden Pfähle, die öde Gebiete, nicht Gärten, umfriedeten; diese schmutzigen Kinder mit geschwollenen Bäuchen; diese dürren braunen Abhänge und vor allem die zahllosen Aasgeier mit ihren breiten, schwarzen Flügeln und braunen Flügelrändern, die alle Straßenreinigung besorgten, und wie hungernd nach menschlichen Resten auf den leichten frischen Gräbern saßen. Langgestreckte, mittelgroße Hunde mit spitzzulaufenden, langen Ohren, schlichen immer scheu hinter jedem Fremden her, und aus den Augen der Eingeborenen brach etwas wie Abneigung oder doch Mißtrauen und etwas …
Ueber dieses Etwas wurde ich mir erst viel später klar.
Fünfzehn Tagreisen stromaufwärts liegt Colombias eigentliche Hauptstadt, das schöne, gesunde Bogotà; aber auch Medellin, fünf Tage Fahrt von Barranquilla, dem Hauptort von Atlantico, ist leichter bewohnbar, als die von Moskitos grausam heimgesuchten Küstenorte.
Cartagena de las Indias.
Auf der Insel Baru liegt das Fort San José.
Zum ersten Mal empfand ich die Tropenhitze geradezu schmerzlich. Graue Wolken schleppten träge über die niederen Hügel, und eine feuchte, dampfschwangere Schwüle lastete auf diesem »Carthago der Indianer«.
Wie überall begrüßte uns zuerst die Columbusstatue; hierauf kam das für Südamerika so bedeutende Denkmal der Dahingemetzelten von 1815 (Befreiungskrieg), die sich gegen die spanische Herrschaft aufgebäumt hatten, die Anlage des neuen Parks, die Wohnung des Erzbischofs, die alte Kirche von Nuestra Señora de Ladrinal und die weite Avenida, die zu den schönen, umgärteten Villen der Europäer führt.
Don Luis und ich durchquerten die ausgedehnte Stadt bis zur Popa, dem Hügel, der gleichsam ihren Kern bildet und der teilweise von Sümpfen umgeben ist, in welche die Tvarsläufer beim Nahen von Menschen flüchten. Es sind das Krabben, die nur seitwärts laufen können.
Alle Hütten waren mit Palmenstroh gedeckt, standen offen und erlaubten Einblick. Frauen hatten einen hohen Holzstößel in der Hand und stampften Mais oder Reis; andere zerrieben das Mehl auf einem flachen Lavastein oder kochten Flaschenkürbismus in breiten Tonkrügen. Sie waren stets gern redebereit und erzählten von ihren täglichen Sorgen und spärlichen Freuden. Die Kinder waren hübsch, splitternackt, scheu und hatten auf dem Bauch eine eigentümliche Schwellung, die Don Luis und ich dem Wasser zuschrieben, weshalb wir uns nichts aufwarten ließen. In Wahrheit waren diese apfelgroßen Vorsprünge nichts als vernachlässigte Nabel …
Die besseren Gärten waren voll von Sumacbäumen, den bunten Crotonsträuchern, den Trompetenbäumen und der feurigen Bougainvillia. Unweit des Hafens fanden wir zum ersten Mal die berühmten Elfenbeinnüsse, die von der Taguapalme gewonnen werden und so hart sind, daß man sie nur mit einer Eisenstange oder besonderen Instrumenten aufschlagen kann. Wir füllten uns damit die Taschen.
Kleine, schwarzgestrichene, offene Wägelchen laufen mit einem Geklirre durch die Straßen, als wäre der Verkehr riesengroß, und langohrige Hunde schnuppern nach Abfällen in allen Winkeln. Bei aller Tropenpracht wirkt Cartagena tot. Südamerika erfüllte mich mit einer Schwermut, die ich bei aller Anstrengung nicht abzuwerfen vermochte. Mir war 's, als fiele ich hoffnungslos zurück durch die Jahrhunderte, und etwas von der verborgenen Wildheit, gleich groß in Eroberern und Unterdrückten, beklemmte mich wie eine unsichtbar mir aufgebürdete Last.
Don Luis fühlte nichts davon. Selbst bei dieser Hitze aß er wie ein Löwe nach drei Hungertagen.
Vor der Limon Bay.
Bis Puerto Colombia hatte die arme deutsche Frau im Hospital gelegen. Nun wurden Kranke und Gesunde aus Deck gebracht, das Schiff geräuchert, das Deck gewaschen, der Rauchfang gescheuert, die Reeling gestrichen, das Messing geputzt, und jedem wurde eingeschärft, so rein und so frisch wie irgend möglich auszusehen, so sehr fürchtet sich jeder Kapitän vor den Amerikanern.
Alle Reisenden wurden klassenweise zusammengefangen und gezählt. Der Arzt, die Zollbeamten, die Polizei kamen uns schon entgegen. Wir wurden von oben bis unten angeschaut, und endlich, wie widerwillig, entlassen. Die Behörden flüsterten miteinander wie bei einem Sterbefall, und ich fing nur ein Wort auf: »Deutsche«. Es genügte. Ich wußte, daß unser Schicksal in die Wagschale fiel. Jedenfalls besaß ich das Visum für Panama, das die meisten nicht hatten, und kam mir gesichert vor. Damit und mit dem Paß »König Peters von Gottes Gnaden«, den niemand verstand, wahrscheinlich nicht einmal der betreffende König selbst, da einzelne Sachen slowenisch eingeschrieben waren, war ich über alle Polizei erhaben, wenn man mich auch verdächtigen mochte, ein Bolschewist, Anarchist, Idealist oder anderer »Mist« zu sein.
Jemand verlangte unseren Eid, weder in Colombia noch in Venezuela an Land gewesen zu sein. Mein Gewissen, sonst ziemlich stramm, dehnte sich wie ein abgenütztes Strumpfband, und ich vergaß für den Augenblick, jene Länder gesehen zu haben. Don Luis aß eine Sardellensemmel und vergaß auch. Gedächtnisschwäche ist häufig in den Tropen.
Schließlich handelte ich darin wie Wilson bei den vierzehn Punkten: ich dehnte sie aus, bis sie paßten.
Cristobal Colón.
Cristobal ist die Kanalzonenstadt, gehört den Amerikanern, hat die Gesetze, Sitten und Gebräuche, nur etwas von südlicher Sünde umhaucht, der Vereinigten Staaten. Colón gehört zur Republik von Panama; man spricht Spanisch, man tut, was man nicht soll, und man lebt in der verderbtesten Stadt der Welt – wenn man der Aussage Erfahrener vertraut.
Ich durchwanderte mit einem Italiener, der mir gelegentlich den Hof machte, die eigenartige Stadt mit ihren Holzschürzen, an Stelle von Hoteltüren, ihren japanischen und chinesischen Läden, den Panamahutverkäufern an den Ecken, den gedeckten Gängen (der erste Stock jedes Holzhauses ruht zur Hälfte auf Pfeilern, und darunter kann man unbehelligt von der Sonnenglut der Tropen oder den furchtbaren Güssen gehen), den Kokoshainen, der Strandpromenade, und traf dort einen Affen (einen echten, nicht menschlichen), der sich sofort in mich verliebte, mich mit seinen felligen Armen umschlang und unbedingt küssen wollte. Darob großer Jubel von seiten meines Begleiters, dem ich eben eine Rede über das Ungesunde und Unappetitliche der europäischen Kußlust gehalten hatte.
Die Friseurläden begeisterten mich. Die Opfer schwitzten so entsetzlich, daß sie nicht sitzen konnten, sondern ausgestreckt auf einer Art Operationsplatte lagen und so eingeseift und rasiert wurden. Japaner in weißen Aermelschürzen besorgten das schnell und schmerzlos.
In einem abgeschlossenen Parke liegen die Häuser der Quarantäne, völlig drahtumsponnen, grau von Farbe, und man merkt ihnen das Ungesunde schon förmlich an. Hierher werden die Pest- oder Choleraverdächtigen gebracht, die Gelbfiebersterbenden und die an Beriberi Erkrankten. Die schönsten Bauten sind die Hospitäler, und so groß war das allgemeine Sterben beim Kanalbau, daß auf jeden Meter Boden im sogenannten französischen Kanal ein Mann zu rechnen war.
Die eigenartigen Gil-Blas-Indianer landeten nur in der Nähe des alten Hafens und brachten ihre Inlandfrüchte zum Verkauf. Weiße dürfen kaum tagsüber auf einige Stunden in ihr Gebiet kommen und müssen vor Sonnenuntergang wieder abfahren. Diese Indianer tragen das Haar offen und lang und haben schwermütige, mandelförmige Augen. Ihre Haut ist rotbraun und manchmal tragen sie Arafedern im Haar oder als Gürtel um die Mitte.
Am Abend entfloh ich dem Italiener – um Liebesgesäusel anzuhören, war ich doch nicht auf Columbuspfaden! – und ging allein nach Colón. Der arme Don Luis durfte sich nicht ans Land rühren, und in gewisser Beziehung versüßte dies meine verbotene Freiheit. Ich war wie ein Seeräuberschiff, das jemand weiß gestrichen: unerkennbar. All das schien mir damals begehrenswert.
Auf dem Heimweg beging ich eine Dummheit. Dumme haben immer Schutzengel. Erst wenn man weise wird, muß man allein aufpassen. Vor mir stand nämlich ein Amerikaner und lud mich ein, den französischen Kanal in einer Barke hinaufzufahren, mit ihm. Warum? Weil ich rein aussah. Sehr schön. Ich freute mich, gewaschen auszusehen. Wie dumm ich war, sah ich ja leider nicht. Das Verbotene reizte. Er würde mich herumgondeln, wo Deutsche nicht gondeln sollten …
In der schnell dahinschießenden Dampfbarkasse, von der aus man die tausend Lichter der beiden Städte und all den Glanz des Kanals sah, kam die Geschichte so, wie jemand mit mehr Verstand es geahnt hätte, aber weil er ein Weißer war, blieb es beim gütlichen Zureden. Dennoch lernte ich in zehn Minuten, daß man nicht mit einem wildfremden Mann einen wildfremden Kanal hinauffährt. Ihm mein inneres Deutschtum zu verraten, hatte ich zum Schluß indessen nicht den Mut oder die Waghalsigkeit, denn er war ein hoher Hafenbeamter und hätte mir die Durchfahrt durch den Kanal verweigert. Auch wollte ich nicht gern über Bord fliegen – weniger um meinetwillen, als um des Passes halber, der in meiner Ledertasche ruhte.
Ich stieg daher weiser und stiller, doch ohne Schaden wieder aus der Barke aus. Eins hatte ich erfahren: die Deutschen würden unter Bewachung mit dem Zug nach Balboa gebracht werden. Kaum stand ich auf den alten Planken, so suchte ich Don Luis, der auf einer Taurolle schlief. All mein Rufen störte seine Träume nicht, bis ich eine schwere Elfenbeinnuß auf seine Nase niederfallen ließ. Da wachte er auf, und ich sagte ihm, daß man ihn früh am Morgen holen würde. Er traf daher alle Vorbereitungen und war bereit, als die Polizei eintraf.
In der ersten Klasse reiste ein Schweizer, der aus Versehen als Deutscher in die Schiffsliste eingetragen war. All sein Widerstand half nichts, er mußte in Morgenrock und Pantoffeln auf den Zug. In Balboa raste er zu seinem Konsul und beschwerte sich bitterlich. Dieser bemerkte tröstend:
»Jetzt sind Sie einmal hier – was soll ich machen?«
Don Luis aber, der immer ein Auge auf 's Praktische gerichtet hatte, begab sich zur Veloceagentur und sagte:
»Auf dem ›Bologna‹ bekäme ich zu essen. Wer aber füttert mich hier?«
Die Veloce schenkte ihm einen Dollar. Er kaufte um fünf Cents sechs Bananen, von denen er sogar mir eine brachte und war um 95 Cents vollwertiges Geld reicher. Da bedauerte ich beinahe, nicht auch polizeilich befördert worden zu sein, tröstete mich indessen mit dem Gedanken, daß ich immerhin den Kanal gesehen hatte. Eins schwor ich mir feierlich: In Panama wollte ich nie leben, nie! Es war zu heiß …
Wie kindisch wir Menschen sind!
Durch den Kanal.
Am Vorabend hatten wir 2000 Tonnen Kohle in wenigen Stunden geladen. Alles ging völlig maschinenmäßig. Die Kohle kam an hohen Eisengestellen in Ueber-Schiffshöhe angefahren, die Behälter machten von selbst einen Purzelbaum in der Luft, die Kohle fiel herab, ein neuer Behälter entleerte sich und fuhr davon – – bis alles schwarz und alle Kohle verschifft war.
Schon durch die infolge der heftigen Nordstürme immer mehr versandete Limonbucht und besonders durch den fünfzig Meilen langen, oft kaum 41 Fuß tiefen Kanal fahren die Schiffe sehr langsam. Der französische Kanal ist so eng, daß zwei Dampfer gerade aneinander vorbeifahren können. Unendlich dichtes, hellgrünes Unterholz bedeckt die beiden flachen Ufer. Hier wüteten zur Zeit Lesseps' (des Erbauers) zwei besonders gefürchtete, nun schon stark ausgerottete Mückenarten: die Anopheles, deren Biß die Malaria einimpft, und die Stegomyia, die Trägerin des gefürchteten gelben Fiebers. Den Kranken, der am vomito negro, dem schwarzen Erbrechen, wie man das gelbe Fieber in Panama nennt, erkrankt ist, steckt eine Stegomyia nicht länger als drei Tage an, während die tropische Malaria noch nach drei Jahren – auch wenn kein neuer Anfall erfolgte – im Blut auffindbar und auf eine weibliche Anopheles übertragbar bleibt.
Um die Kanalangestellten nach Möglichkeit vor diesen beiden gefährlichen Angreifern zu bewahren, sind sämtliche Häuschen mit einem feinen Drahtnetz umsponnen, und von Zeit zu Zeit wird auf alle Tümpel Petroleum geschüttet und, wo tunlich, Erde zum Austrocknen aufgeworfen.
Nach dem französischen Kanal kamen wir in die Gatunschleusen, wo das Schiff dreimal gehoben wurde, bis es 85 Fuß über dem atlantischen Meere stand. Sich das zu vergegenwärtigen, ist schwer. Sobald das Schiff vor dem ersten Tor steht, wird dieses langsam geöffnet, das Schiff gleitet hinein, das Tor schließt sich wieder und das Tor der zweiten Schleuse wird aufgemacht; dadurch stürzt das dort angesammelte Wasser in die erste Schleuse und hebt das Schiff, bis es die gewünschte Höhe erreicht hat; dann öffnet man wieder ein Tor, und endlich gleitet der Dampfer in den künstlichen Gatunsee, der aus dem Ausfluß des Chagresflusses entstanden ist und aus dem man – als ich durchfuhr – noch die Kronen der überschwemmten Urwaldbäume, wie weißgebleichte Gerippe, hervorragen sah. Hinter dem Gatunsee kommt der Culebra Cut – der entzweigeschnittene Berg – und wieder fährt das Schiff, zwar nicht mehr am elektrischen Gängelband vom Ufer her, wie durch den ersten Kanal, aber immer fast noch ohne Dampf durch diese enge Schlucht. Vor zwei Tagen war ein Abrutsch erfolgt, und die Baggermaschinen waren in voller Tätigkeit, während der ganze Abhang mit starken Wasserströmen bearbeitet wurde, um das lose Erdreich irgendwie zu festigen. Die Tiefe im Culebra Cut beträgt 49 Fuß.
Durch die Pedro-Miguelschleusen, die uns zum Stillen Ozean herablassen sollten, führten uns neuerdings die beiden elektrischen Wägelchen, nachdem das Schiff den eigenen Willen aufgegeben hatte und wie ein zahmer Hund an der Leine lief; nur kamen wir da in die schon volle Kammer und sanken in die sich leerende hinab. Durch die Miraflores-Schleusen erreichten wir wieder Meereshöhe.
Am Abend fischten wir Don Luis und seine beiden Leidensgefährten bei Balboa auf. An der Naosinsel vorbei glitten wir in den Stillen Ozean hinein. Der Golf von Panama war so still wie ein Inlandssee, und ein wunderbares Meerleuchten empfing uns.
Ich lag in der Kabine mit weit offenen Augen. Das Walroß schlief, die Schönheit von Lima, der alle den Hof machten, flocht ihre Zöpfe und alle anderen träumten. Die Betten hatten sich schon teilweise geleert. War es die Hitze – war es irgend eine Vorahnung – nie wieder fühlte ich mich wie vor dem Panamakanal. Es war mir, als sei ich in ein neues Leben getreten.

Panama-Kanal: Die Gatun-Schleusen
Am Aequator.
Früh am Morgen standen Don Luis und ich an der Reeling und ließen die einzelnen Inseln an uns vorbeiziehen. Vom Festland her wehte ein leichter Duft, der mit tausend Alpenblumen gewürzt schien, und die Spitzen der Cordilleren grüßten zu uns herüber. Feuerspeiende Berge kochten dort wie Riesenkessel, und aus den spitzen Gipfeln stieg der Rauch wie aus Riesenschloten. Vorn aber war alles tiefgrün und überfruchtbar und das Meer selbst so ruhig und warm, daß man das Fahren des »Bologna« kaum wahrnahm.
Gegen Abend erreichten wir Bahia in der tiefen Caraquezbucht. Nur selten läuft der Dampfer diesen verlassenen Ort an. Die Berge sind ringsumher überdicht bewaldet und die Pracht der Tropen entfaltet sich hier in ungewohnter todbringender Schönheit. Dichte Schichten modernden Laubes, faulender Nüsse, herausgequollener Säfte bedecken den Boden, den man durch das verschlungene, lianenbehangene Unterholz kaum sehen kann; in den hohen Baumkronen schwingen sich Affen, wiegen sich bunte Aras, springen die grauen Ardillos oder Baumratten, schwirren Papageien und uns fremde Vögel, hängen Schlangen in scheinbar lebloser Stellung wie Lianen, mit denen der Wind spielt, und erst wenn der Baum ganz im Sonnenlicht steht – fünfzig und mehr Fuß von seiner Wurzel entfernt – setzt er seine unbeschreiblich großen und grellfarbigen Blüten an. Nichts blüht auf dem Grunde; alles lacht hoch oben, kaum erkenntlich, im Sonnenlicht, und alles kämpft um diesen günstigen Platz, das Schwächere erstickend.
Die Eingeborenen, Indianer mit breiten Gesichtern und langem struppigen Haar, machen Tontöpfe, sammeln Früchte, bringen Rattankörbchen zum Verkauf und ihre Augen unter den buschigen Brauen sind bald schwermütig, bald lüstern. Die Weißen sehen müde aus und einsam, so einsam …
Wen nicht die Sucht nach schnellem Geld um jeden Preis treibt, der geht nicht in die heimtückischen Gebiete Ecuadors.
In dieser Bucht, die so still scheint wie keine, die ich je geschaut, beglückte mich das schönste Abendrot meines Lebens. Hinter den dicht bewaldeten stillen Hügeln, die einen Halbkreis bildeten, in dem wie ein blauer Stein in grüner Fassung das Meer lag, tauchten leuchtend weiße Wolken wie Wattebauschen auf. Der Rand des Himmels wurde glutrot, das Meer an dieser Stelle schwarzblau, während die Wolken über dem Haupte da rosa, drüben tiefgelb waren, sich zu herrlichen Feuergarben schlossen, die ganze Wölbung in einen Flammensee verwandelten und sich endlich in einem violett gewordenen Meere feurig spiegelten. Allmählich wurde alles verdrängt von einem feenhaften Rosalila, das in Purpurton verrann und schwarzrot endete, und in das der Mond wie eine scharfe Tuschzeichnung segelte.
In ihren Kanus, die aus einem einzigen ausgehöhlten Baumstamm bestanden, näherten sich am folgenden Morgen die Indianer, verkauften Tapotes, eine Frucht, wie ein Riesenapfel, mit braungrüner harter Schale, gelbem Fleisch und vier Kernen. Elfenbeinnüsse wurden fieberhaft verladen. Die Strohhütten der Braunen verschwanden endlich auf den blauen Wassern wie Schwämmchen, die davongleiten.
Es war nicht unerträglich heiß, obschon wir einen Grad unter dem Aequator waren. Am Tag vorher um drei hatten wir ihn gekreuzt. Heutzutage gibt es nur auf Segelschiffen noch die Taufe. Auf einem Dampfer merkt man nichts davon.
Insel an Insel glitt an uns vorüber; eine davon ähnelte einem schlafenden Toten. Mitten im Meer fand man auch deutlich die Spuren vieler Flüsse, denn allerlei Hölzer kamen angeschwemmt, sogar Wasserschlangen waren entdeckbar, und das Wasser war viel lichter und glatter an solchen Stellen. Kleine weiße Möwen mit schwarzen Flügelrändern begleiteten uns.
Zur Linken zeigte sich die Insel Santa Clara und zur Rechten die Punainsel, berühmt, weil deren Bewohner einst Pizarro heldenhaften Widerstand geleistet hatten. Zwischen beiden Inseln hindurch fuhr der »Bologna« mit lautem Getute in den Yambelikanal ein und nahm den Lotsen an Bord. Santa Marta, wo er eingestiegen war, besteht ganz aus Holzbauten, die am Rande die Form von Pfahlhäuschen haben und wie neugierige Kinder ins Wasser hineinwaten. Daneben stehen grellgrüne, kugelförmige Sträucher zwischen Palmen, Bananen und vereinzelten Maispflanzungen.
Um zwölf Uhr mittags fuhren wir in den Guayas ein. Er kommt aus den Tiefen von Ecuador und kennt die Gewässer, die von den berühmten Bergen der Cordilleren hinabfließen. Unzählige Baumstämme mit fremden Schlinggewächsen trieb er meerwärts an uns vorbei, aber auch allerlei Aas, Alligatoren und Fische, die sonderbar bunt und flach wirkten. Kleine nackte Jungen saßen auf treibenden Hölzern und ruderten mit den Füßen, unbekümmert um alles, was sich da im Strom an Schlangen, Alligatoren und Abfall versammelte. Der Guayas war hier noch fünfhundert Meter breit und die flachen Ufer derart dicht bewaldet, daß man unmöglich eine einzige Lichtung entdecken konnte. Bananen sollten in solcher Fülle reifen, daß man sie wegschenkte, nur um sie los zu werden. Alle Bäume strebten in die Höhe, die rückwärts gelegenen um so stärker, so daß die Ufer ein aufsteigendes Bild boten wie Sitze in einer Arena. Die Vögel und Affen waren in diesem Fall die Handelnden.
Von Zeit zu Zeit tauchten strohgedeckte Pfahlbauten aus dem Grün, und je näher wir der wichtigen Hafenstadt Ecuadors kamen, desto mehr ahnte man die Gegenwart von mächtigen Naturkräften. Hinter Riobamba dampften die Berge, zitterte der Boden, stürzten die mächtigen Wasser der Schneemassen in das ewig feuchte, gummi- und goldreiche Tropengebiet. Männer von eiserner Tatkraft wühlten da im Urwaldschlamm und suchten nach Gold, Kautschuk, Pflanzenmilch, Chinarinde und anderen wertvollen Dingen. Wenn sie nicht von den Eingeborenen heimtückisch ermordet oder von der Regierung übervorteilt, falsch angeklagt oder ausgewiesen worden waren, wenn sie nicht durch Schlangenbiß, wilde Tiere oder durch Pflanzengift den Tod gefunden hatten, und nicht an Beri-Beri – das den anfällt, der oft im Urwaldschlamm steht – Cholera, Pest oder einer anderen Tropenkrankheit gestorben waren, so kehrten sie in wenigen Jahren steinreich in ihre Heimat zurück. Wer aber wagte so viel? Höchstens ein Verzweifelter. Männer hinter Riobamba sind verzweifelte Männer …
Gegen drei Uhr näherten wir uns Guayaquil, und große Zettel warnten uns alle, nicht das Schiff zu verlassen, weil die Pest, Cholera, Ruhr, das Beri-Beri, gelbe Fieber und der Aussatz chronisch in dieser ungesunden, unreinen Stadt wüteten und das Schiff in Quarantäne müßte. Eine gute Meile im Fluß warf der »Bologna« Anker, und selbst da waren wir noch nicht sicher, von Mückenstichen verschont zu bleiben. Jeder Stich aber konnte uns Malaria, das gelbe Fieber oder sonst ein Uebel schlimmster Art einimpfen. Auch herrschte der Aussatz unter den ärmeren Leuten vor, so daß es nicht wünschenswert war, die geringste Sache käuflich zu erwerben. Niemand aus den Booten wurde auf 's Schiff gelassen.
Etwas von der Tragik eines neuen Lebensaufbaus streifte uns hier. Die drei Deutschen waren doch kräftige, bemittelte Menschen gewesen, nur der Peruaner und sein Weib arme Schlucker, aber in Guayaquil ahnte man, daß die, die hier landeten, einen verzweifelten Kampf aufnahmen. Da war der stämmige Zuckerbäcker, Goldsucher und Abenteurer, der auf Jahre im Gebiet des Chimborazo verschwinden wollte; der Kaufmann aus Firenze, der hier etwas anzufangen beschlossen hatte, und besonders das junge Ehepaar, das der allgemeine Gesprächsstoff war, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß der vorige, verschmähte Geliebte der Schönen unter den Auswanderern mitgekommen war. Die beiden Eheleute, sie in spitzenbesetzten Hemdhöschen und mit Lockendrehern, verwöhnt, zart von Gesundheit, lebensunklug, sehr kokett, er zu jung, um praktisch zu scheinen, wollten von hier aus ein Segelschiff nehmen, das sie in vierzehn Tagen nach den verlassensten Inseln der Südsee bringen sollte – nach den geradezu verwunschenen, ziemlich unfruchtbaren, von keinem Dampfer besuchten Galapagos, auf denen sie – die junge, gefallsüchtige Frau – jahrelang niemand sehen würde. Er dachte an Perlenfang und Ausbeutung eines Minerals, und beide wußten zusammen nichts über die Inseln, als daß sie bestanden und einige Landsleute einmal dahingegangen und nicht wiedergekehrt waren. Was ich über die Inseln sage, wußte auch ich erst nach Jahren, als ich selber – ein einsames Wesen – durch die schier unbegrenzte Südsee fuhr …
Die Guayaquiler hatten wie alle Mischlinge besserer Klasse in den Tropen Südamerikas eine ungesunde dunkelgelbe Gesichtsfarbe, flackernde, oft ausweichende Augen und einen sinnlichen Zug um den Mund. Die Bügelfalte war stets tadellos und war auch das einzig Vollkommene an ihnen. Hochmütig trabten sie über das Deck hin. Die eigentlichen Ecuadorianer waren reines Vollblut, sehr häßlich, breitknochig, finster, dick. Sie boten uns die Baumratten, die ganz grau sind und weiße Punkte an den langen Haarenden haben, Ardillos genannt, allerlei Papageien und auch schon Pumafelle an. Obst gab es in Uebermengen, wurde aber der Ansteckung wegen nicht oder höchstens verstohlen erstanden.
Die Braut in einem schwarzen Seidenkleid, spitzenbehängt und mit rosa Schleifen, nahm von uns allen Abschied und kletterte ins Boot. Sie hätte beinahe jeder Gesellschaftsklasse angehören können, – besonders so lange sie schwieg; beim Manne sah man sofort, wohin er gehörte. Ich habe das unterwegs immer wieder beobachtet. Die Frau geht; wie der Mann hinzutritt, sagt man sofort: »Aha!«
Es gingen auch die anderen Reisenden vom Schiff, sie durften aber nicht wieder zurückkehren. Wer den »Bologna« verlassen hatte, der blieb in Ecuador. Fragliches Glück!
Guayaquil.
Vom Schiff aus konnte man ganz gut die winkeligen Straßen, die, wie von einem Irrsinnigen angelegt, hinab- und hinaufgingen, und mehr Katzenköpfe als Menschen hatten, beobachten. Wagen schwankten wie im Sturm, und Indianer kauerten überall, wo sie nicht hingehörten: auf fremden Türschwellen, auf fremden Körben, auf den reichlich aufgestapelten Säcken der Veloce.
Hinter der Stadt, schon auf dem ersten Hügel, war der Wasserbehälter, damit – wenn bei Erdbeben ein Feuer drohte – die Wassermengen herabstürzen und Guayaquil überschwemmen konnten. Der Rauch ferner Feuerberge verdunkelte nicht selten den Ort auf Stunden; Aschenregen war häufig.
Ich saß mit Don Luis auf dem äußersten Bug des Schiffes. Es war eine glühend heiße Nacht. Nach und nach verschwanden alle Frauen, denn die Mückenplage nahm zu, und ein heißer, drückender Wind wimmerte im Takelwerk. Das Schnarren und Knattern der Kräne, das Heulen der Ladewinden erhöhten noch das Unangenehme der Stunde. Unser Gespräch schlief ein. Vielleicht schnarchte sogar Don Luis ein wenig. Wenn ja, so schnarchte er nicht lange, denn ein gewaltiger Tropenguß rasselte ohne Warnung auf uns nieder. Don Luis äußerte einige Kraftausdrücke aus der Zeit der Kriegsmarine, und ich sprang die Treppe in das Inferno hinab.
Im Schlafsaal brannte das Licht – wie immer. Vollständige Stille herrschte. Die Frauen lagen wie tot auf den Betten, hatten alle, selbst die letzte Bekleidung abgestreift und waren Schweißtümpel, die schwer atmeten, ohne sonst auch nur einen Finger zu rühren. Ich kletterte ins Bett, warf das Kleid ab und zog einen leichten Kimono über. Es ist mir zur Gewohnheit geworden, unter allen Umständen irgend etwas anzuhaben, das es mir gestattet, unter Menschen zu gehen. Man kann im Leben nie wissen …
An ein Schlafen war nicht zu denken. Im engen Raum mochten wir fünfzig Grad Celsius haben. Grüne Stechmücken, sehr groß, sehr schön, sehr surrend, sehr bissig, flogen über uns hin und nippten da und dort. Die menschlichen Tümpel rochen.
Auf einmal vernahm ich ein im Schlafraum verbotenes Geräusch. Jemand küßte! Wer war der Verwegene? Und warum machte er, wenn er schon das Gebot der Menschen und der Götter brach, solch einen Heidenlärm? Ich setzte mich auf.
Mein Bett war wie der Chimborazo – erhaben über die geringeren Gipfel. Nur das Walroß versperrte mir einige Aussicht. Indessen vermochte ich, selbst knieend, nichts zu entdecken.
Noch einmal ein schußartiger Schnalzer! Das war ja empörend! Die Schönheit von Lima, im Rest eines Hemdchens, setzte sich auf. Wir sahen uns an. Haarsträubend! Ein Geist konnte es nicht sein, und unsere irdischen Augen sahen nichts als Leere.
Da spähte ich zufällig über das Walroß hinweg zum Fenster, und in der Oeffnung, sie ausfüllend, bemerkte ich das häßlichste Gesicht, das mich je entsetzt hatte. Eine braune Fratze, umrandet von wulstigem, ungekämmtem, schwarzem Haar, ein Mund, der von Ohr zu Ohr reichte und ein wahres Alligatorengebiß enthielt, eine Nase wie ein vertretener Männerpantoffel, vorstehende Backenknochen in rotbraunen Hängebacken, und in all dieser unangenehmen Fleischmasse zwei schwarze Augen gierglänzend, wie die eines hungrigen Pumas. Und diese Mareritterscheinung sagte mir in scharfklingendem Spanisch:
»Ich liebe dich!« und nach einer kurzen Pause, die nackten Frauen betrachtend – »ich liebe euch alle!«
Eine derart schmeichelhafte Aeußerung behält man nicht neidisch für sich. Ich weckte die anderen, um sie an dem Glücke teilnehmen zu lassen. Im zweiten und dritten Fensterloch zeigten sich weitere Verehrer, alle von ebenso blendendem Liebreiz. Da ich nicht schlafen konnte, war ich ganz zufrieden, mir den Spaß anzuschauen und anzuhören, denn meine Geschlechtsgenossinnen waren – als Evas überrascht – ein wenig krustig.
Je glühender die Liebesbeteuerungen wurden, desto krustiger wurden die Angebeteten. »Aequatorialaffe, Affensohn«, und ähnliche Bezeichnungen wurden laut, und alles, was an Abfall zu finden war, wurde den Belagerern ins Gesicht geworfen. Selbst das Walroß beteiligte sich am allgemeinen Gefecht. Als aber die Angreifer faule Orangen auf uns zu werfen begannen und die Geschosse vorwiegend auf mir landeten, hatte ich vom Scherz genug und ließ den ersten Offizier verständigen. Er kam und ließ unsere Luken zuschrauben und die Türe sperren. Kein Auflehnen half. Mit den Leuten einen Kampf zu beginnen, hätte der Schiffsgesellschaft geschadet, und man wußte nie, wann die Indianer, die sich auf Leichtern ohne Mühe bis ans Schiff ziehen lassen konnten, etwa über Bord klettern und uns vergewaltigen oder entführen würden.
Und selbst diese ernste Mahnung ging unbeachtet – bis auf den gehabten Spaß – an mir vorüber. Die ganze Nacht schmorten wir im eigenen Fett, und am Morgen stiegen wir, mehr tot als lebend, aufs Deck. So heiß ist mir nie früher und selten einmal später gewesen …
Kaum hatten wir das Frühstücksbrötchen verspeist, so kam der junge Italiener, der in Guayaquil ein neues Leben beginnen wollte, und erzählte uns ganz verstört, wie verwahrlost der Ort, wie rauh die Menschen, wie undankbar das Land ist … Er nahm von jedem Taupfeiler des »Bologna« Abschied, und ich weiß nicht, ob er unseren Weggang lange überlebt hat. Nur wer ganz rücksichtslos ist, kommt in den Ländern der Mischlinge fort.
Um halb zwei verließen wir Guayaquil und mir war's, als stünde auf dem vernachlässigten Marktplatz, der bis zum Ufer reichte, eine zarte Gestalt in einem schwarzen Seidenkleide. Genau wie damals die Peruanerin. Sie winkte und winkte.
Schnell trieben wir stromabwärts. Ich blieb vorn am Bug und empfand ein leichtes Frösteln. Es war sehr schön, die Welt zu umsegeln, aber ganz das Gegenteil, an einsamer Küste ein neues Leben aufzubauen. Und in einer Woche würde auch ich so stehen und viel aufbauen müssen, ehe ich weiter durfte, denn ich allein ahnte, wie wenig Geld mir geblieben war.
»Was schütteln Sie sich wie ein Alligator, der aus Versehen eine Flasche Rizinus verschluckt hat?« fragte Don Luis.
»Es bläst kühl über uns hin«, erwiderte ich zusammenschauernd.
»Ja, ja – kein Wunder, denn es bläst vom Südpol her«, behauptete er und hüstelte.
So etwas einige Grade unter dem Aequator! Ich folgte dem Schutzengel zur Abfütterung.
Der grüne Strahl.
Am Abend sagte Don Luis:
»Schauen Sie durch dieses Fernglas und sagen Sie mir, was Sie sehen!«
Ich tat, wie geheißen. Es war ein wunderbarer Tropenabend, der Horizont ganz klar, der Himmel zu Häupten leicht bewölkt. Langsam sank der rote Sonnenball, berührte das Wasser, verschwand.
Aber ehe die Sonne ganz und gar verschwunden war, zeigte sich eine unbeschreiblich schöne, smaragdgrüne Halbscheibe – ein grüner Strahl, der unvergeßlich blieb.
»Sahen Sie ihn?« forschte Don Luis, zum erstenmal ergriffen.
Ich nickte.
»Es war der grüne Strahl – etwas, das man nur in der Wüste oder auf sehr ruhigem weiten Meer schauen kann. Man sagt, daß der sich nie über seine echten Herzensgefühle täuscht, der den grünen Strahl gesehen hat.«
Im nächsten Augenblick schon war es dunkel, und der Mond ging auf. Es gibt keinen Uebergang in den Tropen.
Weiter und weiter dem Süden zu dampfte der »Bologna«. In Callao stiegen die meisten der noch vorhandenen Reisenden aus. Dann …
Lima, in Peru.
Vor dem Hafenbecken von Callao lag eine kleine, kahle Insel, – die Quarantäne. Auf den hellblauen, sonnegeküßten Wassern ruhten Millionen von Seevögeln. Ich habe weder früher noch später eine derartige Menge erblickt. Sie verdunkelten die Sonne, wenn sie aufflogen, sie punktierten das Meer, sie flimmerten vor den Augen. Das waren die Vögel, die auf den einsamen Felsen der Küste den kostbaren Guano ablagerten.
Unser Schiff hielt sehr weit ab vom Hafen, und wir fuhren in einem kleinen Boot ans Land. Eine Weile waren wir der Schrecken der Geldwechsler, weil wir versuchten, Lire und anderes entwertetes Geld günstig einzutauschen, dann brachten wir mit englischem Gelde einen unbedeutenden Betrag zusammen – groß kann er nicht gewesen sein, nachdem wir im Kaffeehaus kein Trinkgeld zu geben vermochten – und fuhren nach Lima, der Hauptstadt Perus, einst die Stadt der Könige und eine halbe Stunde von Callao gelegen.
Die Berge schichteten sich in sieben Lagen hintereinander. Es war ein wundersamer Anblick. Ueber sie hinweg führte der Weg nach den Bergwerken von Cerro del Pasco, wo Hängebrücken die grausigsten Schluchten übergingen und ein Tunnel in den anderen lief, bis man zum ewigen Schnee gelangte. Am Wegrand wuchs Alfalfa und obschon es um Lima nie regnet, sondern nur zur Winterszeit ein unglaublich dichter Nebel fällt, stand der Mais schön und schon fast vor der Reife. Die rundblättrigen chilenischen Weiden wechselten mit den hochstämmigen, buschigen peruanischen ab.
Lima selbst ist eine Stadt in spanischem Stil mit einer großen Domkirche, aus der nun eben – es war Karfreitag – alle Würdenträger in langer Prozession aus den Toren traten. Sie hatten goldschimmernde Helme mit rotem, weißem und seltener mit blauem Federbusch und sehr reiche, strahlende Uniformen. Bei ihrem Erscheinen begannen vier Musikkapellen, jede etwas anderes, in ihrer Ecke der Plaza de Armas zu spielen, und die Menge jubelte. In feierlichem Zuge trug man Christum zu Grabe. Alle Frauen trugen schwarze Mantillen und ihre braungelben Gesichter, umrandet von dem schwarzen Tuch, sahen unglaublich häßlich aus – sie wirkten wie Totenschädel. Von den berühmten Limaschönheiten bemerkten wir nicht eine. Wenn die etwas helleren Gesichter gar gepudert waren, wurden sie zu abscheulichen Fratzen.
Die Häuser Limas sind vorwiegend einstöckig, und überall findet man die sonderbaren Fensterkäfige, die den Insassen das Licht und den Vorbeigehenden den Eintritt nehmen. Alle Frauen müssen hinter solchen Gittern sitzen. Wie notwendig dies ist, erfuhr ich erst viel später.
Ich wandelte mit Don Luis durch ganz Lima, als ob wir bezahlt wären, über die Rimacbrücke zum Cerro San Cristobal und zu jenem Stadtviertel, in dem die Arena liegt. Hier lagen seltsamerweise auch die Klöster. Eine lange Allee begrenzte sie.
In den Geschäften entdeckten wir kleine, geschnitzte Kalabassen, in denen der Mate oder Paraguaytee zubereitet wird; in der geräumigen Markthalle lagen die großen roten Chilepfeffer, die violettbraunen Eierpflaumen, Blasebälge aus Stroh, niedere Tonkrüge, Butter in Maisstroh, allerlei Tropenobst und nette Körbchen durcheinander, und auf alle Fragen wurde uns bereitwilligst Auskunft gegeben. Im Tiergarten sah ich den peruanischen Bären – ganz schwarz und nur um die Ohren gelb gestreift – den Kondor und viele Gürteltiere.
Auf dem »Bologna« war unter den Reisenden zweiter Klasse ein Agent einer Textilfirma gewesen, der sich mir oft in unliebsamer, später in belustigender Art genähert hatte, weil er sich offenbar einbildete, ich müsse auf Abenteuer, nicht nach Wissen, unterwegs sein, und wie oft ich ihn auch angeblasen, lud er mich dennoch am Tage vor unserer Ankunft in Lima ein, drei Wochen auf seine Kosten in Lima zu verbringen. Nun sagte Don Luis, der entweder wissen wollte, aus welchem Holz ich war oder der seiner Jugend wegen tatsächlich naiv geblieben, ich möge diese Einladung doch annehmen. Ich wurde stachelig wie ein Tropenigel, und fragte ihn, ob er schon jemand begegnet wäre, der etwas um nichts zu geben bereit gewesen. Wir hatten beinahe einen Wortwechsel, als er mich aufforderte, den Herrn aufzusuchen, denn die Anschrift seiner Wohnung hatte er uns beim Abschied gegeben. In drei Wochen wollte er nach Chile weiter, in acht Wochen über Argentinien und Brasilien heim.
Ich weigerte mich, mit diesem »bösen Menschen« etwas zu tun zu haben, betrachtete ihn als Ausbund des Zügellosen und wanderte stolz an dem genannten Hause vorbei. Don Luis sagte nichts. Wenn er weise gewesen ist, hat er sich wohl gedacht: »Du wirst noch anders urteilen.«
Auf dem »Bologna« hatte er ein schönes junges Mädchen verehrt, das von seinem greisen und etwas weichbeinigen Vormund nach Chile begleitet wurde, um an einen reichen, aber sehr bejahrten Mann verheiratet zu werden. Das hinderte seine Schutzbefohlene natürlich nicht, das freie Leben noch recht zu genießen, und ich selbst beobachtete mit großer Belustigung, wie Herr L. und die »rote Dame«, wie wir sie nannten, immer hinter einer Kiste, einer Kajüte, einer Leiter verschwanden, sich küßten und versteckten, während der kurzsichtige alte Herr – die Brille auf der Nase – verzweifelt nach den beiden Sündern suchte. Da ich stets neben Don Luis, der ebenfalls schrieb, meine Aufzeichnungen machte oder etwas las, meinte der alte Herr, daß seine Nichte ebenso ruhig sitzen sollte, und warf von Zeit zu Zeit ganz wehmütige Blicke auf mich. Heute nun war die rote Dame um ihren Verehrer und ich um meinen Plagegeist gekommen …
Don Luis war ein richtiges Kind. Als es gegen Abend ging, bettelte er, in ein Lichtspielhaus zu gehen. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen und mag Lichtspielhäuser bei bester Gesundheit nicht, doch wollte ich nicht unfreundlich erscheinen, und so wohnten wir dem Leiden und Sterben Christi bei. So oft die bösen Manschen kamen, pfiffen, schrien, trampelten die Zuschauer, und, was uns beiden so viel Spaß machte, war diese erregte Menge, die alles miterlebte und in ihrer Uebertreibung wie wild war.
Sehr ernüchtert aber waren wir, als wir eine halbe Stunde später in Callao am Strand standen und vergeblich nach irgend einem Boot Ausschau hielten. Kein Mann, kein Boot und unser Schiff zwei Meilen vom Ufer. Wer konnte sagen, ob sich der Kapitän nicht doch entschlossen hatte, schon bei Tagesanbruch abzudampfen?
Als wir uns schon halb entschieden hatten, in einem Strandboot zu übernachten, was weder weich nach warm zu werden versprach, näherte sich ein Mann, der uns hinzurudern versprach. Zuerst verlor er ein Ruder, dann kam er nicht vom Fleck, hierauf stieß uns die Strömung gegen ein Riff, ferner entgingen wir um ein Haar einer Schiffsschraube, da eben ein Dampfer abfuhr, als wir uns dem Orte näherten, und Don Luis wünschte nichts in Stoßseufzern als:
»Dich sollte man bei der deutschen Kriegsmarine haben!!«
Wir zahlten dem Wicht die versprochenen zwei Soles (einen Dollar) und Don Luis stürzte sich auf die Schüssel Sardinen und Salat, die ein Matrose für ihn versteckt hatte. Ich begab mich sofort zu Bett. Plötzlich hatte ich Angst vor der Zukunft.
Vor Mollendo.
Der Mond – ein kalter Mond – glotzte hinter dem Rauchfang hervor. Ein kalter Wind, der erste Bote des kommenden Winters der südlichen Halbkugel, blies von Kap Horn herauf. Wie Einsamkeit lag es in der Luft, und die hohen Wellen schaukelten den »Bologna« so sehr, daß ich der Seekrankheit näher rückte als damals im Sturm des Atlantik. Don Enrique, der Kellner der Zweiten, der mir in letzter Zeit die Speisen auf ordentlichen Tellern gegeben hatte, was mich von meiner zerstobenen Bande trennte, gab mir Nüsse und Ratschläge, der Infermiere eine Orange und einen Apfel und viele gute Wünsche. Ich klagte über die Mücken von Guayaquil und er sagte mit Nachdruck:
»Gott gebe, daß Sie nie ärgere Mücken finden! Hüten Sie sich vor den zweibeinigen Insekten!«
Ich nickte und dankte. Das war die einzige Warnung, die mir jemand zuteil werden ließ.
Zu Don Luis frohlockte ich:
»Endlich werde ich diesen übelriechenden Kasten los sein und mich wieder in einem Bett ausstrecken dürfen – etwas, das mir 45 Tage lang unmöglich gewesen ist.«
Der junge Mann meinte ganz ernst:
»Vielleicht werden Sie vor Ablauf einer Woche schon wünschen, im engen Bett des »Bologna« liegen zu dürfen.«
Ich aber träumte von den Altertümern der Inkas, den Wundern vom Titicaca, den Schönheiten der hohen Anden und lächelte überlegen.
Im offenen Kanu, einen Indianer vorn, einen hinten, wollte ich den Ucayali hinunterfahren, mit einem Puma als Strandbegleiter und einer Schlange in den Baumwipfeln als Begleiterin. Nichts schreckte mich. Niemand fiel es ein, mich aufzuklären. Heute glaube ich, daß mein Mut nicht nur mich, sondern selbst weisere Menschen über meine Zukunft hinwegtäuschte …
Den ganzen Ostersonntag hatten wir einzig die braune, unwirtliche Küste mit den steil ansteigenden Bergen gesehen, am Ostermontag früh um acht Uhr warf der »Bologna« Anker vor Mollendo. Ich hatte schon einige gottverlassene Häfen besucht, aber dies war der gottverlassenste. Das Fischerdorf Mollendo thronte hoch oben auf einer steilabfallenden Klippe, und rund herum sah man nichts als kahle, rotbraune Berge mit vereinzelten weißen Stellen – den Nitratfeldern. Da es nie regnete, sammelten sich diese Salze und bildeten gletscherähnliche, glitzernde Flächen. Diese und der stellenweise ganz weiße Sand erhöhten den Eindruck des Trostlosen. Der Wellengang war so furchtbar, daß die sehr geräumige Barke wie eine Nußschale tanzte und man die Reisenden hineinwerfen mußte. Schreiende Träger überschwemmten das Schiff und feilschten um den Landungspreis. Wie die Wilden rissen sie sich um mein bescheidenes Gepäck. Ich nahm Abschied vom Capitano d'arme, vom Infermiere, von Don Enrique. Zwei Reisende nach Bolivien stiegen ebenfalls aus. Oben an der Reeling stand Don Luis und winkte, winkte …
Nie wieder auf der ganzen Welt habe ich das Meer zu Schlagsahne gepeitscht gesehen – dick und gelb – wie vor Mollendo. Die Brandung warf sich wütend gegen die braunen Felsen, der Große Ozean ließ seine verhaltene Wut an dieser Küste aus, die erregten Wellen von Kap Horn her beruhigten sich erst vor Callao. Drohend schrien die Möwen.
In die Barke wurde ein Ding, halb Stuhl, halb Korb, herabgeleiert. Mein Koffer war schon glücklich oben auf den Klippen, meine Erika vertraute ich niemandem an. Sie war in meinem Reiseplaid verborgen, weil auf Maschinen ein hoher Zoll zu entrichten war, den man nie wieder zurückerhielt. Nun hielt ich das kostbare Bündel in der Rechten, die Tasche und die Korbseile in der Linken, als ich, schwupps, in die Höhe sauste, eine Halbdrehung in der Luft beschrieb und kopfabwärts den Klippen zusteuerte. Mit einem erleichterten Aufseufzer wurde ich aus dem Korb gezogen.
Vor mir stand die Zoll- und Paßbehörde. Die wenigen Reisenden hielten ihre Pässe in der Hand und machten unglückliche Gesichter. Ich fischte meinen Paß aus der Tasche, als mir der nächste Beamte mit einer Verbeugung erklärte:
»Bei den Damen nicht nötig!«
Aha, hier begann mein Frauenwert! Ich wuchs zwei Zoll in die Höhe. Der Zollbeamte erkundigte sich nach dem Inhalt meines Gepäcks, und die zwei Zoll Länge verschwanden. Ich öffnete den Koffer.
»Und das ist Ihr Bett?«
Ich nickte. Mein Herz zitterte um die verborgene Erika.
»Gehen Sie!«
Ich gab meinen Koffer einer Strandhyäne und trug meine geliebte Maschine sorgfältig selbst. Keine rauhe Hand sollte die Erika berühren.
Ich hatte Glück. Der Andenzug, der nur zweimal wöchentlich fuhr, sollte um elf Uhr abgehen. Stolz schob ich am Schalter mein Geldstück dem Beamten entgegen. Er gab mir die Karte und einige Silbermünzen. Als ich auf dem noch einsamen Bahnsteig stand und die Kofferhyäne verabschiedete – einen unheimlichen Menschen mit Zähnen wie ein greiser Hai – näherte sich mir das sonderbarste Wesen, das ich bis dahin getroffen. Es trug Frauenkleidung, hatte indessen einen kurzen schütteren Bart, eine schwarze Warze auf der Nase und ein scharfes, dennoch verkürzt wirkendes Kinn. Ein vorsintflutlicher Hut saß auf dem Kopf, und eine Mantilla hing um die Schultern. Zwei kleine braune Jungen mit Zuckerrohrbündeln flankierten das Wunder.
»Wohin reisen Sie?« fragte es.
»Nach Cuzco; heute nur nach Arequipa.«
»Ich bin ebenfalls aus Cuzco, eine Schneiderin. Wieviel zahlten Sie für die Karte?«
Ich zeigte, was mir geblieben.
»Und Sie sind eine Deutsche? Meine Landsmännin?« (Sie sah nach jedem anderen Volke eher aus.)
Ich bejahte zögernd. Ihr Bart flößte mir ein gewisses Grauen ein. Ihr Geschlecht, wie ihre Staatsangehörigkeit mußten auf guten Glauben hingenommen werden.
»Er hat Sie betrogen! Geben Sie mir Karte und Geld!«
Sie steuerte auf den Schalter zu und entriß dem Manne ein kleineres Goldstück, wetterte, tobte.
»Er behauptet, sich geirrt zu haben,« erklärte sie pustend.
»Diese Männer! Ich aber werde Sie beschützen, denn wir sind Landsleute.«
Auf Grund dieses Bandes zwischen uns überließ ich ihr – nicht mit zu viel Vertrauen – meinen Koffer und die Erika zur Bewachung und durchwanderte Mollendo, ein Gefüge von Holzbauten, die braun wie die Berge und der heiße Sand und ablehnend wie die Brandung dieser Küste scheinen. Eine trockene, lähmende Hitze entströmt dem Erdreich ringsumher. Die Leute betrachten einen mit eigentümlich gierigen Blicken, in denen ein Bodensatz von Mißtrauen lauert.
Von dem höchsten Punkt des Ortes schaute ich zum letzten Mal auf den fernen »Bologna«. Niemand war der teuren Landungskosten halber ans Land gefahren. Das große Schiff war der einzige Fleck auf den unendlichen Wassern. Sie trugen es weiter dem Süden zu. Erst heute begann meine Columbusfahrt, denn erst heute war ich allein, auf mich selbst angewiesen.
Ich mußte mein Bestes tun – heute und allzeit.
Vielleicht lief in diesem Augenblick das bärtige Unding der hohen Anden mit meiner Erika davon. Unerträglicher Gedanke! Ich flog dem Bahnhof zu.
Den hohen Anden zu.
Der Zug hatte nur erste und zweite Klasse; ich gehörte zum Abschaum ohne Geld. Indianer mit Riesenbündeln – Bettzeug, Läuse und Kinder enthaltend – kletterten in den langen Wagen, der vier Längsreihen von Sitzen, zwei unter den Fenstern, zwei in der Mitte mit sich treffenden Lehnen hatte, und verstauten ihre Habseligkeiten (Hühner, Körbe, kleine Kinder, Hunde unter, Obst, Bündel und größere Kinder auf den Bänken) so gut es ging. Die Männer trugen den Poncho – ein wollenes Tuch, das ein Loch zum Durchstecken des Kopfes hat – die Frauen kurze Blusen, die oft Einblick zu fraglichen Reizen gestatteten, und sehr faltige, glockenartige Röcke aus dunkelrotem Tuch oder buntem Kattun. Die Kinder trugen ihr Geburtshemd und irgend einen Lumpen darüber. Hungrig waren sie alle, selbst die Hühner und die Hunde, die in gewissen Zwischenräumen, vereint mit den Kindern, die Beschaffenheit meiner Beine unter der Bank untersuchten. Neben mir saß die Schneiderin von Cuzco mit ihren beiden Enkelkindern, die selbst für mein ungeübtes Auge braun wie Nüsse und erwiesene Mischlinge waren (nicht meinem seligen Landsmann zuzuschreiben!) und von denen sie immer behauptete, sie wären durch die Tropensonne von Mollendo so braun geworden …
Weiß zu sein in einem Lande, in dem alle von Zitrone zu Roßkastanie schattierten, ist ein unbezahlbarer Vorteil. Ich frohlockte, ihn zu besitzen. Wie ein Dollar unter österreichischen Nachkriegskronen kam ich mir vor. Gans!
Die Steigung war ununterbrochen. Die braunen Berge, die weißen Felder rückten heran. Man mußte die Augen zukneifen, um nicht etwas von dem feinen Sand hinein zu bekommen und zu erkranken. Die Brandung toste noch eine Weile weiter und verstummte hinter uns. Die Reisenden zogen überall Zuckerrohr zum Kauen hervor. Sie bissen mit Geduld an den zähen Stengeln und spien den breiigen Rest mit viel Geschick über meinen Kopf hinweg zum Fenster hinaus. Wie Mückenschwärme sausten die gekauten Stücke durch die Luft. Ich selbst mußte eine Weile mitkauen. Wenn in Rom, tu' wie die Römer …
Der Flugsand bildete Dünen, die an Gräber erinnerten. Nichts als Gestein und Sonnenglut, bis man das fruchtbare, oasenartige Gebiet hinter Cachendo erreichte. Hier gediehen allerlei Tropenfrüchte und Verkäuferinnen kletterten mit schönen länglichen Körben durch den Zug und traten auf ein halbes Dutzend Füße, ehe sie wieder beim Abschiedspfiff aus dem schon fahrenden Zug sprangen.
In La Joya konnte man das Mittagsmahl halten – Picante. Alte Indianerinnen saßen auf dem Erdboden neben Riesentontöpfen und schöpften, die belebten Zöpfe schüttelnd, mit einem Blechlöffel Reis und zerstampften Pfeffer aller Arten auf Blechteller. Jede Portion kostete 10 Centavos, und hatte die Alte zufällig zu viel gegeben, so warf sie den Ueberfluß mit der braunen Hand in den Topf zurück. Für unbegehrte Lausdraufgaben war nicht mehr zu zahlen.
Die Höflichkeit der hohen Anden befiehlt Gastfreundschaft gegen den Fremden. Man soll den größten Leckerbissen vom eigenen Teller mit der eigenen Gabel oder dem Löffel dem Gast in den Mund schieben. Ich fand mich als Gegenstand weitherzigen Wohlwollens im Zug. Meine Forscherbegeisterung gestattete es mir damals noch, all das Gebotene tapfer zu verschlucken in der Hoffnung, wenn schon nicht in der Ueberzeugung, daß nicht etwa eine Laus gerade diesen Löffelvoll zierte.
Bei San José, wo es frisch zu werden begann (1478 Meter), brachte man gute Butterkipfel, die mir den Laus- und Pfeffergeschmack etwas abnahmen. Das ist übrigens das gefürchtete Verugagebiet; denn nur in dieser Höhe zeigt sich diese unheimliche Krankheit. Der Kranke leidet an dauerndem Fieber, hat häßliche blauviolette Flecken im Gesicht, fühlt sich so elend wie bei Typhus und stirbt unfehlbar daran, zuzeiten schnell, zuzeiten erst nach Jahren.
Ich staunte die immer großartiger werdende Landschaft an und wartete auf den vielbeschriebenen Misti, den Wunderberg Perus. Plötzlich winkte mir der Indianer, und ich sah zur entgegengesetzten Fensterseite hinaus. Zwischen zwei Bergketten erhob sich eine herrliche, schneeweiße, oben abgerundete Masse. Wie losgetrennt von der Erde schien mir der Berg. Er grüßte, winkte gleichsam und warnte. Hoch stand er über mir, nicht nur räumlich, sondern auch innerlich. Er hatte eine Seele, und diese Seele gehörte dem Ewigen an; hatte nichts zeitlich Gebundenes. Nie wieder hatte ich dieses Empfinden einem Berge gegenüber, nicht einmal dem heiligen Berge Japans, der dem Misti ähnelt. Es war mir damals und ist mir heute noch, als bände uns beide ein längstbegrabenes Geheimnis.
Es dunkelte. Die Ebene von Arequipa, dicht zu Füßen des mächtigen Vulkans, dehnte sich mehr und mehr. Tiabaya und Tingo schwanden, und als das letzte Rot vom Schneehaupt des Misti gewichen war, hielt der Zug in Arequipa, der zweiten Hauptstadt von Peru, im Herzen der hohen Anden.
Ich hob meine Erika aus dem Netz.
In Arequipa.
»Nun müssen wir ein Zimmer finden, das nicht allzu viel kostet,« meinte die Schneiderin von Cuzco, die sich wie eine Klette an mich geheftet hatte, und entdeckte einen kleinen Jungen, der den Koffer auf den Kopf schwang und uns voraneilte. Hinter ihm kam die mutige Bartdame mit zwei Taschen, dahinter die beiden Jungen mit den Zuckerrohrbündeln und zuletzt meine Wenigkeit mit Schreibmaschine und Handtäschchen. So wanderten wir durch die pechfinsteren Gassen von Hotel zu Hotel, von Einkehrhaus zu Einkehrhaus, und immer war alles besetzt. Bei jeder Wegbiegung wurden unsere Sachen schwerer, und ich ächzte vor Müdigkeit, als wir endlich in das Hotel francia e Inglaterra hinkten, wo der Wirt uns sagte:
»Ich habe nur ein Zimmer zu vier Soles frei, mit einzig zwei Betten.«
Gern hätte ich, um allein schlafen zu dürfen, die vier Soles bezahlt, doch wie konnte ich meine Landsmännin, die mich unter ihre haarigen, nicht fedrigen Fittiche genommen, ohne Obdach stehen lassen? Wir betteten daher die beiden Braunen auf ein wackeliges Sofa und nahmen selbst von den beiden Betten Besitz. Ebenso teilte ich mein Essen mit dem einen, sie das ihre mit dem anderen der Kinder. Zu viel war es für niemand gewesen …
So wenig die Geschichte meinen Träumen entsprach, so tröstete mich der Umstand, wenigstens ein Bett für mich allein zu haben, und da es ein ungewöhnlich großes war, legte ich mich vor Freude einmal der Länge und einmal der Breite nach hinein; streckte meine Glieder wie ein Polyp seine Fangarme und wand mich wie ein Lindwurm in neuem Tale; dann wünschte mir die Schneiderin aus Cuzco »gute Nacht«, und ich schloß die Augen in der irrtümlichen Erwartung, sofort einschlafen zu dürfen.
Das Zimmer hatte kein Fenster, wohl aber eine verdrahtete Oeffnung, die auf irgend ein Gewölbe ging, und mir war es, als spräche jemand dicht daran im Flüsterton. Ich lauschte, vermochte indessen keine einzelnen Worte zu unterscheiden und versank durch diese Laute allmählich in einen Zustand zwischen Wachen und Schlaf.
» Jesus de mi corazón!«
Ich schnellte empor. Das Licht brannte, und meine ehrenwerte Landsmännin saß aufrecht im Bett und rief alle Heiligen an. Sie hatte Krämpfe in der rechten Wade. Mit meinem heutigen Wissen hätte ich ihr geraten, sofort aus dem Bett und schwer auf den Boden zu springen – das sicherste Heilmittel – damals starrte ich sie ermüdet an und wußte ihr nicht zu helfen.
»Heraus, heraus, ihr faulen Schlingel! So geht es! Man darbt und arbeitet für solch ein Kinderzeug, und wenn man etwas braucht – – auf, auf, Carlito, und reib' mir das Bein! Uiiii, auuuu, corazón de Jesus!«
Der schlaftrunkene Junge saß auf ihrem Bett und Bein und knetete an der Wade herum. Das Jammern gab nach, der Kleine kletterte zurück auf den Divan und ich schloß die Augen.
» Jesus de mi corazón!«
Es half nichts; erst gegen Morgen nahmen die Krämpfe und das Gezeter ab, und ich verfiel in einen kurzen, unruhigen Schlummer, einzig um einen ganz furchtbaren Traum von Pest und Blindheit zu träumen.
»Welch böses Omen!« dachte ich beim Erwachen. Ob der Aufenthalt dem Traum entsprechen würde? Ich frühstückte in Eile, bezahlte meine Rechnung, nahm Abschied von der Schneiderin von Cuzco und begann die Zimmersuche. Diesmal sollte es mir nicht wie in Genua gehen …
Unweit von Francis e Inglaterra wölbte sich das eiserne Gittertor der berühmten Kathedrale von Arequipa, unter der sich das Herz des Misti befinden sollte und die im Laufe der Jahrhunderte schon so oft zerstört worden war. Ihr Anblick berührte mich eigentümlich: ich verspürte eine jähe Furcht, etwas wie ein Erinnern, das dennoch kein Erinnern sein konnte. Es war mir, als sollte dieser mir fremde Bau bestimmend für mein Leben werden. Ich wollte eintreten und wagte es nicht, weil ich keine Mantilla besaß. Da ich indessen über dem blauen Seidenmützchen noch den weißen Reiseschleier trug, winkte mir ein Priester, einzutreten. Die Kirche war schmucklos, verglichen mit anderen Kirchen lateinischer Völker, und nur ein Kruzifix von bedeutender Größe mit sonderbar wandernden Augen fiel mir auf. Das Morgenlicht lag in roten Lachen auf den weißen Fliesen, und oben, in den Fensterbogen, krächzten die Raben.
Ganz beklommen machte ich mich auf Zimmersuche.
Um drei Uhr nachmittags war ich nahe daran, mit der bärtigen Schneiderin nach Cuzco weiterzureisen; denn entweder vermietete man nicht, oder das Zimmer hatte keine Fenster, so daß man gezwungen war, die Tür angelweit offen zu lassen. So unwissend ich war, ahnte ich doch, daß dies unbedingt zu verwerfen war, und mühte mich ab, etwas besser Gelegenes zu entdecken. Jemand riet mir etwas in der Calle Jerusalem, und die Frau, zu der ich meinen Wunsch aussprach, geleitete mich durch ein enges Mauergefüge zu einem fensterlosen Loch, das keinen Boden und nur eine Brettererhöhung für das Bettzeug hatte.
»Licht brauchen Sie wenig,« meinte sie gutmütig, »denn wenn am Abend die Esel in die Stallungen zurückgekehrt sind, brennen die Knechte Kerzen vor den Türen und der Widerschein der Stalllaternen kommt Ihnen zugute.«
So sehr ich meine Ansprüche herabgeschraubt hatte, so nieder waren sie noch nicht. Ich suchte neuerdings ein Zimmer im Herzen der Stadt, gelangte bis zur Markthalle jenseits des kleinen Parks und fand in der Casa rosada Unterkunft.
Die Frau, die mir das Haus empfohlen hatte, sagte mir:
»Es wohnen gute Leute dort und schlechte.«
Das bestimmte mich, den guten wie den bösen Leuten auszuweichen. Man konnte, wo man wollte, gewiß auch allein sein, und es war der einzige bewohnbare Raum, den ich entdeckt hatte. In einem erstklassigen Hotel zu wohnen, wäre mir zu teuer gewesen, und selbst da ist es mehr als fraglich, ob ich mit weniger Gefahren davongekommen sein würde.
Ich zog ein.

Peru: Arequipa mit dem Misti
In der Casa rosada.
Mein Zimmer hatte einen für Arequipa ungeheuren Luxus: zwei Fenster! Da es eigentlich einen sogenannten zweiten Stock hatte (nicht höher als ein erster bei uns), war dies möglich, aber beide Fenster, auf die ich so ungemein stolz war, waren in Wahrheit Türen – eine auf den Gang mündend, der zur Treppe führte, eine in Verbindung mit dem Balkon, der die Vorderseite des Baus entlanglief. Meine Haupttür schloß ich mit einem Vorhängeschloß, vor die Verandatür aber zog ich ein Sofa von Riesengewicht, das nur drei Beine hatte. Die Türen, die in andere Zimmer rechts und links führten, waren auf meiner Seite versperrt und verriegelt. Ich untersuchte meine vier Festungseingänge jeden Tag.
Sonst enthielt das Zimmer einen gebrochenen Waschtisch mit blindem Spiegel, ein Bett mit Matratze, Kissen und einem Leinentuch, so, daß ich das Reiseplaid darauflegte, – einen Tisch samt Stuhl und das tote Sofa. Die Aussicht allein war wunderschön – vorn über die Markthalle, hinten über die Dächer bis zum Chachani.
Meine Hausfrau war ein trübselig aussehendes, eingeschrumpftes Mischlingsweib, und das Kind – wenn es ihr Kind war – hieß Casimir und bediente mich zuzeiten. Der gewisse Ort, auch ein Luxus in Arequipa, wo man »wie die Könige in alter Zeit« am liebsten hinter 's Haus geht, hatte eine undurchsichtige Scheibe und keinen Riegel, so daß man abwehrend grunzen mußte, wenn man Schritte vernahm. Meist rief man artigkeitshalber dem Nahenden auch entgegen, wie lange man noch zu verbleiben gedachte, und bei Andrang gab man dem, der es eiliger hatte, den Vortritt. Herren besuchten lieber dunkle Straßenecken, die in Arequipa vorwiegend diesem Zweck dienen, und die Indianerfrauen breiten mitten auf der Straße ihre Röcke aus – immer an der Sonnenseite – und besorgen, was nicht aufgeschoben werden kann. Dabei rufen sie die Vorübergehenden ruhig an, fragen nach dem Preis der Eier, besprechen Familienangelegenheiten und lassen sich von Eselherden nicht verjagen. Hat eine Frau etwa weniger Anrecht auf den Straßenstaub als ein Langohr?
Am Abend drehte immer jemand eine Drehorgel, und die ganze Nacht hindurch heulten die Hunde, heulten doppelt, wenn die Glocken läuteten und der Boden wankte, weil es im Misti kochte.
Ich entschied mich zum Bleiben und arbeitete so brav wie nie zuvor. Ich lieh mir sogar von Casimir einen Besen aus, mit dem ich den Staub hinausfegte, – eine Tugend, die ich bis dahin noch nie entfaltet hatte, und in meiner Freizeit (zwischen der literarischen Arbeit) zeichnete und malte ich fieberhaft. Eine Anzeige in der Zeitung brachte mir unverhofft viele Antworten ein, und ich sah mich schon mit vollen Säcken das alte Inkareich verlassen. Ich lächelte wie ein Krampus auf einer Zuckerschachtel und war »columbusser« denn je.
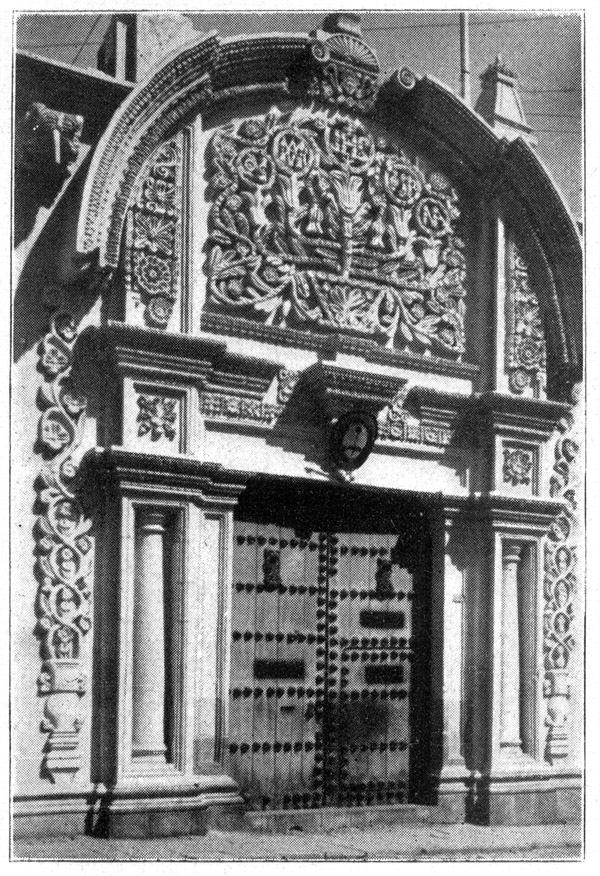
Peru: Altspanisches Portal in Arequipa
Das Maisabenteuer.
In drei Tagen war ich »auscolumbust« und der »geschwollene Kopf« auf den ursprünglichen Umfang zurückgeführt. Von da ab kannte ich meine Grenzen und hatte überdies das Gruseln erlernt. Die Taupfeilertapferkeit war weg. Von da an ging ich durch das Leben als Weib, nicht als verrücktes Mägdelein …
Und das kam so.
Ich hatte mich bei dem vornehmsten Advokaten der Stadt vorstellen müssen, da er beabsichtigte, mir den Unterricht seiner Kinder – dreizehn an der Zahl – für alle Gegenstände in englischer Sprache zu übergeben, und um einen besseren Eindruck hervorzurufen, hatte ich mein bestes Kostüm aus rotschwarzer Seide angezogen. Sehr befriedigt – was ich verdienen würde, reichte dahin, mein Zimmer, und, wenn ich sehr vorsichtig wirtschaftete, meine Kost zu bezahlen, – und in meiner Freude stolperte ich unachtsam dahin, bis mich auf der Plaza de Armas vor der Kathedrale jemand anrief. Es war ein Mitreisender des »Bologna«, der mir sagte, daß ich mich im fremden Lande einsam fühlen mußte, und mich fragte, ob ich Lust hätte, seine Schwester zu besuchen. Ich war einsam und folgte ihm sofort. Die Sonne schien hell, es war drei Uhr nachmittags, und die Wohnung der jungen Frau nicht allzu weit entfernt.
Im Hofe hatte er Lamas, und mein Entzücken kannte keine Grenzen. Bis dahin hatte ich sie höchstens in einem Tiergarten gesehen, nun konnte ich ungestört ihr weiches Fell, ihren langen Hals, die verächtlich gerümpfte Nase, die hohen Beine bestaunen; nur angreifen durfte ich sie nicht, denn für derlei Vertraulichkeiten sind sie nicht zu haben: da spucken sie dem Verwegenen einfach ins Gesicht.
»Ich werde dem Fräulein unsere Felder und Bäume zeigen«, sagte er, und ich begleitete den jungen Mann über die Maisfelder, die durch breite, aber niedere Steinwälle voneinander getrennt und schon deshalb bemerkenswert waren, weil sie so hoch wuchsen, wie man es bei uns nie erlebt. Manche Halme erreichten eine Höhe von drei Metern, und daher bewegte ich mich auf dem schmalen Pfade wie in einem Wald.
Damals trug ich immer Handschuhe und dachte so wenig daran, sie auszuziehen – selbst an heißen Sommertagen – wie mein Hemd. Umso befremdlicher war es, daß ich auf einmal ein Drängen verspürte, mich der Lederhandschuhe zu entledigen und sie in meine Handtasche zu stecken, die Paß und Geld und einige wichtige Briefe enthielt. Kaum aber hatte ich das getan, so fühlte ich mich an den Schultern erfaßt und auf den schmalen Pfad niedergedrückt. Noch immer war ich eher erstaunt als bestürzt und starrte der Braunhaut groß ins Gesicht.
Hierauf folgten die Ereignisse schnell aufeinander. Mir blieb nur ein dunkles Erinnern an einen Kampf, der uns schnell vom schmalen Pfad unten im Graben landete, so daß mein neues Staatskleid mit einer sandigen Kruste bedeckt wurde, was meine Erbitterung noch erhöhte. Von Zeit zu Zeit verlor ich die Tasche und schwamm gewissermaßen zu ihr zurück, riß sie an mich und kämpfte weiter, ohne daß der Peruaner mich auf die Beine kommen ließ. Alle meine Bitten, alle meine Vorstellungen blieben unerhört und ernteten einzig ein kaltes »Es nützt nichts!« Das Menschtier kniete mit all seiner Schwere auf mir und vereitelte jede Bewegung außer der meiner Arme.
Da warf ich den Kopf zurück und schrie so laut, wie ich es meiner Lunge nie zugetraut hätte. Laut genug, ganz Arequipa von den Toten zu erwecken, aber ich erweckte nichts als einen sehr kleinen Jungen, der angstvoll in den Graben spähte. Das Menschtier saß noch auf mir und preßte seine dicke, arbeitsharte Hand auf meinen Mund. Meine Zähne sind noch von Mutter Natur eingehängt; sehr gute überdies. Ich vertiefte sie in die Pfote. Das Tier ließ los. Ein Stoß, gerade als er zum Kinde sprach, um es wegzujagen, und ich war frei. Ehe er mich zu packen vermochte, war ich den Abhang hinaufgelaufen und rannte aus Leibeskräften dem Weichbild der Stadt zu.
Hinter mir raunte der Mann, aber ich war flinker. Erst als ich vor einem Kakteengebüsch landete und fünf Meter unter mir die Straße sah – ich mußte mich verlaufen haben – erreichte er mich auf dem unteren Pfade. Ich hatte die Demütigung, mich von ihm herabheben lassen zu müssen, aber hier waren schon so viele Fußgänger, daß ich mich nicht mehr zu weigern brauchte. Wortlos ging ich von ihm hinweg; er sprach zu tauben Ohren. Nun machte ich ihm keinerlei Vorwürfe mehr. Es mußte auch meine Unvorsichtigkeit gewesen sein, die das Unheil ermöglicht hatte.
Als ich heimwanderte, dachte ich ohne Ende:
»Wie seltsam du bist! Ein so großer Schrecken, eine so starke seelische Erschütterung und endlich auch eine körperliche, denn ich war wie ein leerer Sack hin- und hergeflogen, und du weinst nicht, du fällst nicht in Ohnmacht, du tust mit einem Worte nichts!«
Ich verstand mich nicht, wenigstens damals nicht. Im Augenblick bewahrte ich eine mir unerklärliche Ruhe; aber mein ganzes Leben lang blieb mir die Furcht vor dem männlichen Menschtier zurück, und etwas von dem kindlichen Vertrauen, das ich bei all dem theoretischen Wissen über dieses Gebiet noch besessen hatte, war auf immer verloren.
Die Eule.
Am folgenden Tage, gerade als ich meinen Tee im winzigen Schnellsieder kochte, klopfte jemand an meine stets versperrte Tür. Ich öffnete und sah einen alten Mann mit geschwollener Rotnase, tiefliegenden Augen, Barthaaren wie die einer zerzausten Zahnbürste und Ohren wie die Kotflügel eines Lastkraftwagens.
»Ich bin Ihr Hausherr!« erklärte das Gebilde.
Bisher hatte ich mir eingebildet, einzig der verschrumpften Alten zahlen oder Auskunft geben zu müssen; indessen – dem Hausherrn schloß man nicht so leicht die Türe, und als er bat, eintreten zu dürfen, gab ich den Weg frei; nicht überliebenswürdig.
»Was machen Sie?«
Auf dem Tisch lag der Pinsel und meine Malerarbeiten. Der Mann wurde sofort unverschämt und gebrauchte Worte, wie ich sie selbst in meiner Muttersprache noch nie vernommen hatte. Er wollte mich berühren, und ich wich ihm aus; das Zimmer war geräumig, aber eine Sache ist es, jemand hereinzulassen, eine ganz andere, ihn wieder hinauszubringen. Mein Teewasser lief über, meine kostbare Zeit wurde vergeudet; wie zwei Narren, schneller und schneller, rannten wir um den Tisch. Ich war weder imstande noch geneigt, den Rest meines Lebens im Laufen um fremde Tische zu vergeuden. Ueber die Schulter warf ich zurück:
»Bisher habe ich die Peruaner für anständige Menschen gehalten, doch heute überzeuge ich mich, daß sie – wie die Chilenen ganz richtig urteilen – Schweine sind.«
Das wirkte! Die Rotnase blieb stehen und fluchte das Blaue vom Himmel und das Braune aus der Erde heraus. Er endete mit den Worten:
»Ich bin der reiche Besitzer dieser ganzen Straße und habe in meinem Leben Französinnen, Engländerinnen, Deutsche gehabt. Ich werde auch …«
»Diese Tür von außen zumachen und zwar mit etwas Beweglichkeit!«
»Alle Blinden und Narren, doch außerhalb dieses Zimmers!« unterbrach ich ihn.
»Ich werde …«
»Draußen …«
Das war ja viel verlangt, denn draußen konnte er mich nicht gut umbringen, wenn ich drinnen blieb; aber Logik war weder seine, noch meine starke Seite in jenen Augenblicken. Er ging, und ich versperrte die Tür hinter ihm. Auf der offenen Stiege, die im Grunde nur eine gebrochene Leiter war, hörte ich ihn brummen:
»Dieses dreimal verruchte Weib, diese stolze Señorita, ich …« und es folgten alle haarsträubenden Beschreibungen, deren seine Trinkereinbildung fähig war. Ich zitterte hinter der dünnen Wand; denn auszuziehen war mir aus Geldrücksichten fast unmöglich, und zu bleiben, schien gefährlich.
Seltsam war es daher, daß die Eule nie wieder unangenehm wurde und sogar nach Kräften darauf schaute, daß andere Männer mir im Haus nicht lästig fielen. Trotzdem bewegte sich eine wahre Völkerwanderung zu meinem Zimmer. Durch das verhängte Fenster sahen sie nichts, aber auf dem Boden lagen sie und spähten angelegentlich herein. Was in aller Welt konnte ich tun, daß ich die Tür verschloß? In Peru tut man alles, auch das Unbeschreiblichste, bei offener Pforte. Die Paarung der Indianer geschieht auf freiem Felde.
In drei Tagen hatte ich mir das Lächeln abgewöhnt. Wer mit mir sprach, dem sah ich kalt in die Augen, mit einem Mund, der sich nie verzog. Ich begann, es bitter zu beklagen, als einziger Dollar unter entwerteten Geldsorten zu wandeln.
In La Pacheta.
Ich litt an einer sonderbaren Krankheit. Wo ich auch sein mochte – daheim, auf der Straße, im Bett oder selbst im Schlaf – plötzlich hatte ich einen jähen heftigen Schmerz zwischen den Schulterblättern und mußte erbrechen. Immer nur Wasser, selbst unmittelbar nach einer Mahlzeit. Ich hatte keinen Berater und kein Geld zu ärztlicher Behandlung. So wartete ich, daß die Sache von selber gut würde, was nach einer Woche auch wirklich geschah.
Während ich indessen noch mit ungewissem Magen (es mag die gefürchtete Höhenkrankheit gewesen sein, die man im Andengebiet erwischt, denn Arequipa liegt 2301 Meter hoch) herumlief, durchwanderte ich die ganze Umgebung und schlug am liebsten den Weg nach dem Friedhof ein. Da blühten im Schatten der peruanischen Weiden, die höher und schlanker als die europäischen und oft windverkrümmt sind, die Kapuzinerrosen wie feurige Herzen, und die weite Ebene erstreckte sich vom Fuße des Misti bis zu den Hügeln um Tiabaya – ein Kranz braunen Gesteins, nur selten von einem vereinzelten Baum unterbrochen. Der langgezogene Pichupichu und der ihm gegenüberliegende Chachani waren wie der mächtige Misti schneegekrönt – ein wundersamer Gegensatz zu den Palmen auf der Plaza de Armas und den Gärten der Stadt.
Mitten auf dem Wege nach La Pacheta befand sich ein kleines weißes Kirchlein, so verlassen wie ich selbst, und über dem Eingang standen die mich eigentümlich ergreifenden Worte:
»Es vergehen die Zeiten, es sterben die Geschlechter: einzig Gott dauert ewig.«
Der Friedhof selbst war ganz klein, die Gräber der Armen hatten nur ein Holzstück schief in das Erdreich gebohrt, doch die Reicheren ruhten der Breite nach in einer dicken Steinmauer und hatten vorn um die Grabtafel einen Kranz oder eine Schleife. Diese Grabtafel ist aus Glas mit einem kleinen Gitter darüber und im Sarge trocknet der Tote langsam ein.
La Pacheta ist ein langgestrecktes Indianerdorf mit Hütten, die aus losem Gestein und etwas Lehm zusammengewürfelt sind, unregelmäßige Strohdächer – mit allerlei Hölzern gegen den Wind daraufgeworfen – tragen, und sämtlich ohne Fenster sind. Der Fußboden ist nur gestampfte Erde, und Meerschweinchen, Hühner, ein Esel oder Lama nehmen weiteren Raum weg. Auf alten Hadern voll Ungeziefer liegen die Männer und Frauen, die den Dunst nicht länger ertragen können, stecken den Kopf über die Schwelle heraus, während der Körper drinnen in der Hütte bleibt. Geht man am Abend daran vorüber, so glaubt man, Enthauptete anzutreffen. Bissige schwarze Hunde, die den Ausländer riechen, und die man sich nur mit Steinwürfen vom Leibe halten kann, durchstreifen solche Dörfer und die ganze Umgebung von Arequipa.
Auf dem Rückweg von La Pacheta wurde ich von einer Familie angesprochen, mußte in einer winzigen Chicheria die berühmte Chicha – das bei den Inkas heilige Maisbier – kosten, das süßsäuerlich schmeckt, faul macht und wie Wasser zu Ueberschwemmungszeiten aussieht. Als es dämmerte, sagte mir die Frau des Hauses:
»Ich lasse Sie nicht heimgehen, denn so spät ist es gefährlich.«
Diese Leute, die so rührend gut gegen mich waren, stammten aus Puno an den Ufern des Titicaca. Ich verbrachte die Nacht in ihrem Steinhäuschen und kehrte am folgenden Tage obstbeladen nach der Stadt zurück. Nun war ich nicht länger allein. Mutiger nahm ich mein Tagewerk auf.
Beim Unterricht.
Die folgenden Tage verstrichen regelmäßig. Ich hatte sehr viel Glück gehabt. Vormittags unterrichtete ich die dreizehn Kinder des reichen Advokaten, der ein besonderes Schulstübchen hatte, von dem aus man in den stillen Hof mit Palmen sah, der jedem spanischen Hause eigen ist. Ich unterrichtete von acht bis elf, und zwar in sämtlichen Lehrfächern, mit Ausnahme von Mathematik und Physik, alles in englischer Sprache. Von elf bis zwölf aß ich in Eile Brot und kochte Tee, von zwölf bis halb eins gab ich englischen Unterricht in der Calle Jerusalem, den allerdümmsten vier Kindern, die ich je kennen gelernt, und die dazu noch faul und ungezogen waren. Von zwei bis fünf las ich in der öffentlichen Bücherei in allerlei alten Schriften über die Kinder der Sonne und kopierte alte Zeichnungen. Von fünf bis sieben machte ich meine örtlichen Entdeckungsreisen. Am liebsten begab ich mich in die Richtung des Misti, wo ebenfalls ein verlassener Friedhof war und man auf den windschiefen Holzstücken die seltsamsten Bilder und Zeichen, teils noch aus dem unterdrückten Sonnenglauben, entdecken konnte. Da schimmerten die Schluchten des Misti wie gestocktes Blut, flammte der Himmel wie das Trugbild eines ungeheuren reifen Kornfeldes im Sonnenlicht, knisterte der Sand unter dem Getrabe der Lamas, die wie Teufel über die Ebene daherrasten und deren lange Ohren wie Hörner aufstanden. Aasgeier kauerten um frisches Aas, und unzählige gebleichte Tiergebeine bestreuten das ganze Gebiet. Aus irgend einem Steinloch flatterte das scharlachrote Tuch, das eine Chicheria ankündigte, und Meerschweinchen liefen über das niedere Gestrüpp, das den Boden da und dort mit grünlichen Blättern und gelben Blumen überzog. Von sieben bis acht hatte ich dreimal wöchentlich noch einen Schüler, und sobald er gegangen war, schrieb ich meine Briefe.
Oft weckte mich ein Erdbeben schon früh am Morgen. In jedem Fall begann ich mein Tagewerk um sechs. In der freien Minute schrieb oder malte ich, und wie sehr ich mich auch nach besserer Kost sehnte, war ich nie ungehalten darüber, eben vorderhand nur Brot und Tee zur Magenfüllung kaufen zu können. Wer hohe Ziele hat, darf kleine Opfer nicht scheuen.
In der Stadt.
Arequipa bedeutet »jenseits der Berge« und das trifft zu. Auch jenseits von aller Berührung mit der Außenwelt ist die Stadt. Kein Reisender verirrt sich hin, der nicht in unerläßlichen Geschäften dorthin muß, und die wenigen Weißen, die man sieht, gehen mit finsteren Gesichtern durch die Straßen. Ich versuchte vergeblich, Anschluß an die Reichsdeutschen zu gewinnen. Sie waren mir dort und damals als ehemaliger Oesterreicherin aufsässig. An die Engländer oder Franzosen, gering an der Zahl, wagte ich mich nicht heran, und so war ich in diesem feindlichen Land mutterseelenallein. Verlangte ich irgend eine Auskunft, wurde sie nur unwillig oder gar nicht erteilt. Ein Verkehr mit Männern war durch die Eigenart der Peruaner unmöglich gemacht, denn jeder Mann ging vom tiefernstesten Gespräch sofort zum gemeinsten Verhalten über. Selbst auf offener Straße hieß es vorsichtig sein, und irgend eine einsamere Stelle war – mitten am Tage – schon eine wahre Mörderfalle. Wie ein Hexenkessel war der Ort; aus jeder unbewachten Ritze brach ein Zweibein, und wenn ich nach dem Maisabenteuer nicht alle meine Sinne wach gehalten hätte, würde ich, wer weiß wie oft, auf öffentlicher Straße vergewaltigt worden sein. Männer, die mich auf der Straße (mitten im Geschäftsviertel!) trafen, hielten mir wortlos eine Handvoll Gold hin, und Angebote dieser Art hagelten auf mich nieder Kaufte ich in einem Laden eine Kerze, eine Schachtel Zündhölzer, so erkundigte sich zuerst der Händler selbst, ob ich »allein« war, der Angestellte drückte mir die Ware in verletzender Weise in die Hand; ein Kunde versuchte, mich in ein Gespräch zu ziehen, um mir Vorschläge zu machen, und vor der Tür wartete ein anderer. Ich ertappte mich ständig auf dem im Grunde komischen Gedanken
»Wenn du mich ansprichst, so töte ich dich!«
Kein Trappist in seinem Kloster ging mit einem ärgeren Memento-mori-Gesicht durch die Stadt als die kleine Schriftstellerin, die sich vor ungezählten Zeitaltern (so lang schien mir die Zeit!) eingebildet hatte, ein zweiter Columbus zu sein.
In unseren Tagen, in denen man frei an das »Ausleben« und »Auskosten« glaubt, scheint es den meisten meiner Leser vermutlich albern, über derartige Sachen so viele Worte zu verlieren. Ich aber schreibe als Frau, und für ein Weib ist der Körper ein unberührbares Heiligtum. Verschenken kann man es gegebenenfalls an ihn, den man zum Heiligen erhebt; davon von Wilden Besitz ergreifen zu lassen, ist etwas völlig anderes. Ueberdies ist es meine feste Ueberzeugung, daß der Mensch auch in der Kunst nur Gemeines leisten kann, der in seinem innersten Leben alles Ideale abstreift. Ein Wirtshausglas ist kein Altarkelch, und wer in der Kunst das Höchste und Reinste, das die Menschheit Erhebendste schaffen will, der darf auch den Leib nicht durch den Sumpf ziehen. Ein Nachgeben, ein Michverschenken hätte durch den Wechsel von Eindrücken und die Kraft neuer Erlebnisse auch mein Streben erstickt, mein Lernen gehemmt, mein Schaffen auf ganz andere Furchen getrieben. Das Erreichen irgend eines Ziels hängt in erster Linie davon ab, daß man sich nie zersplittert. Von den Dollarkönigen bis zu den größten Gelehrten findet man das als Richtschnur des ganzen Seins. Als Mensch mag man abseits laufen von der Masse der Menschen – vielleicht sogar der tiefsten Menscherfahrungen – aber das, was man unbedingt als Lebensleitmotiv gewählt hat, wird zuletzt rein und klar ausklingen.
Mein Dasein gehörte der Feder; modern gesprochen meiner »Erika«. Darin fühlte ich – vielleicht auch mit Selbstüberhebung –, daß ich etwas zu leisten, der Menschheit etwas zu geben vermochte, das ganz so, in dieser Eigenart, kein anderer vermochte. Nicht besser oder schlechter als andere: einfach gerade so!
Deshalb ging ich trotz all meiner Entbehrungen an den glänzendsten Angeboten vorüber. Ich sparte meine Kräfte für ein einziges Ziel.
Die furchtbare, schonungslose Sinnlichkeit ringsumher war die Kulisse zum sonderbarsten Straßenbild der Welt. Die Häuser hatten zuzeiten flache, in der Regel aber des Erdbebens wegen gewölbte Dächer. Sie waren blau oder rosa gestrichen, hatten vorspringende, unheimlich wirkende eiserne Fensterkörbe (wie nötig für alle Frauen, zeigen meine Erfahrungen!), hohe Torbogen, durch die man den Patio oder Hof sehen konnte und – in ärmeren Vierteln – Tür an Tür an Stelle der Fenster. In diesen halbdunklen Räumen suchten sich die Bewohner gegenseitig Läuse, paarten sich die Menschen, wuschen sich die Mädchen, kochten die alten Indianerweiber oder schöpften Chicha aus irdenen Krügen. Lamas stoben über das holprige Pflaster, Esel trugen übergroße Lasten oder waren Reittiere, auf denen der Mann nicht selten mit dem Gesicht dem Schwanz zugekehrt saß, um leichter mit seinem Hintermann zu plaudern. In einzelnen Höfen, doch nur selten, da sie die Kälte der Schneefelder braucht, sah man auch eine Vicuña, ein Tierchen von der Größe eines Schafes mit lichtkastanienbraunem Fell, das wundersam weich und so lang war, daß es um die Knöchel flatterte. In alter Zeit hatten nur die echten Inkas das Recht gehabt, sich aus dieser Wolle Kleider weben zu lassen.
Wenn ich Eile hatte und mir ein besonders gutes Nachtmahl vergönnen wollte, kaufte ich eine Käsesemmel. Das tat ich allerdings erst, als ich ziemlich abgehärtet geworden war und mich das Leben flach geschlagen hatte. Am Eingang des kleinen Parks, in dem scharfnadelige Araucaria standen – die seltsamen Nadelbäume Südamerikas – saß ein junges Weib mit einem Körbchen und einem Kind. Das Kind war mit Hadern auf den Rücken der Händlerin gebunden, die mit untergeschlagenen Beinen auf dem Pflaster saß und auf einem Fetzen, der einmal rein gewesen sein mochte, Käsebrötchen ausgelegt hatte, die von Hunden beschnuppert, vom Kind betastet, von Eseln und Lamas gestreift und von Käufern prüfend gedrückt wurden. Ich aber war eine Ausnahmekundin, und für mich kam immer ein frisches Brötchen aus dem Korb; das Messer, das zum Schneiden diente, wurde aus der Brust gezogen (tauchte jedenfalls aus dem losen Leibchen auf), und der Käse wurde aus einem Papierrestchen gewickelt. Solch ein Käsebrot kostete fünf Centavos, und, wenn es ging, kaufte ich zwei zum Abendbrot, obschon ich selbst dann nicht selten halb hungrig blieb.
Was mich indessen am meisten anzog – mit dem Gruseln, mit dem ein Mörder zur Stelle seines Verbrechens zurück muß –, war der Bach von Arequipa. Er durchströmte, klug geleitet, als Kanal den ganzen Ort und war eine wahre Fundgrube für Kinder, die chronisch darin fischten. Er enthielt alles – von alten Knöpfen bis zum entsetzlichsten Unrat. Morgens torkelten kleine Kinder zum Tor hinaus und entleerten gewisse Gefäße in ihn; alte Indianerinnen, die eine Chicheria hatten, füllten daraus die Tonkrüge und wuschen darin die Gläser; Geschirr wurde darin geschwemmt, alte Hosen gewaschen, die Jungen spielten Springbrunnen an seinem Ufer, und abends war er für alle Leute Abortersatz. Leute, die von den Bergen kamen und ihren durchlöcherten, bandlosen Strohhut zu sehr »belebt« fanden, tauchten ihn hinein, spülten Haar oder Zöpfe ab und setzten ihn wieder auf. Nur die außerordentliche Trockenheit der Luft – Wäschestücke trockneten in zwei bis drei Stunden im Zimmer, die Lippen sprangen, die Hände wurden rauh, die Haut überhaupt spröde, und das Haar knisterte bei der geringsten Bewegung infolge der starken Elektrizität – verhinderte, daß die Pest wütete; denn außer von diesem Bach wurde in Arequipa nichts weggeräumt. Alles Aas wurde vor die Stadt geworfen (auch erst dann, wenn der Hausbesitzer den Gestank vor seinem Hause nicht mehr aushielt) und von Aasgeiern verzehrt, und jede Nacht um zehn Uhr warf man alle Abfälle, Papier, Fetzwerk und so weiter auf die Straße. Die herrenlosen Hunde stürzten herbei und fraßen alles auf – selbst das Unverdaulichste. Manche Nacht war der Vorrat noch zu knapp, da griffen die großen die kleinen Hunde an, und man hörte das grausigste Angst- und Schmerzgeheul. Von Zeit zu Zeit vergiftete man diese Hunde, und dann stolperte man tagelang über verwesende Reste …
Obschon mir jede Sache zum Hindernis wurde und ich ständig verschreckt meinen Pflichten nachging, lernte ich allerhand. Kapuzinerrosen werden in Peru zum Beispiel gegen Rheumatismus verwendet, indem man Blüten, Blätter und Stengel auf das Feuer legt, heiß werden läßt und damit die Glieder einreibt. Die gelben Sandblumen sollten bei Frauen die Milch im Ueberfluß treiben, mit dem Seifenkraut, einem niederen Strauch mit feingefiederten Blättern, wusch man Kleider, die Tomaten wuchsen in Zwetschenform und wie solche an den Zweigen eines mittelgroßen Baumes, die Granadillas oder Riesenpassionsfrüchte zierten Lauben wie manchmal Kürbisse bei uns. Ich lernte die indischen Feigen kennen und essen (man soll sie vor Sonnenaufgang pflücken, weil die feinen Dornchen auf der Haut dann noch weich sind und nicht die Finger verletzen), und sah auf den Maisfeldern die rote Blume, hier »Diener ohne Gebieter« genannt. Die grünen Knollen der Kartoffeln werden von den Schafen gefressen und von den Kindern zum Spielen verwendet. Ist der Mais geerntet, so kauen die Leute die Stengel wie Zuckerrohr.
Gegen Abend ging ich am Hospital Goyaneche durch die Avenida Libertad dem Misti zu. Er sprach zu mir wie ein sehr weiser, abgeklärter Vater zu einem sehr kleinen und dummen Kind. Er aber war immerhin der Einzige, der vom Ewigen und Reinen zu mir sprach, und deshalb liebte ich ihn wie etwas Beseeltes.
Der Indianerangriff.
Drei Wochen lebte ich nun schon in Arequipa, und mir schienen sie wie drei Jahre. Die guten Leute in La Pacheta hatten mich gebeten, den Sonntag draußen bei ihnen zu verbringen, und mit welcher Freude ich loszog, ist gar nicht zu beschreiben. Einmal würde ich wieder sprechen dürfen, etwas Warmes essen, von all diesen Wilden entfernt sein.
Die Sonne floß in goldigen Wellen über den Schnee des Misti nieder. Chilenische Weiden mit ihren runden, glatten Blättern, die im Sonnenlicht wie Spiegelchen glitzerten, begrenzten zerstreut die steinumfaßten Felder; die Berge wirkten im wechselnden Licht bald braun, bald grünlich, bald violettblau; in der Ferne hinter Tingo erspähte man den Corapuna ( cora = Gold, puna = Eis); am steinigen Wegrand wuchsen die indischen Feigen am Ende ihrer tellerförmigen, stacheligen Kakteenblätter; Esel mit Milchkarren und Gemüse in den beiden runden Seitenkörben rannten an mir vorüber, und der strahlend blaue Himmel wölbte sich über der bergumschlossenen, braunsandigen Ebene. In der Ferne entdeckte man ein niederes weißes Gebäude in halber Berghöhe – das Bad Jesus – und darunter noch eins, das Pesthospital …
Ich hatte schon ungefähr Dreiviertel des Weges zurückgelegt, als ich von zwei jungen Männern überholt wurde. Sie erklärten, alle Ausländerinnen zu lieben, stellten tausend Fragen und wurden so zudringlich, daß ich – um keinerlei Gewalttat heraufzubeschwören – bald ja, bald nein und nicht mehr zur Antwort gab. Als eine Frau sie zufällig ansprach, benützte ich die Gelegenheit, schnell auszuschreiten, und bin ich einmal richtig im Schwung, so kommt mir so bald niemand nach.
Das Mittagessen war vorüber, und wir saßen alle plaudernd in der Hinterstube, die den beiden Töchtern gehörte, als draußen ein Lärm ungewohnter Art hörbar wurde und Herr P. hinausging, um nach dem Grunde zu forschen. Bald darauf verschwand seine Frau, dann seine Tochter; sie kehrten verstört zurück, nur um wieder zu verschwinden, und als ich beunruhigt nach dem Grunde fragte, wurde mir stockend mitgeteilt, daß eine Anzahl Cholos (Indianer) vor dem Häuschen versammelt waren und mich verlangten. Zwei Männer hätten ihnen erzählt, ich wäre ein verkleideter chilenischer oder bolivianischer Spion (die Stimmung gegen beide Länder war damals sehr feindlich), und mein kurzes Haar allein beweise, daß ich unmöglich eine Frau sein könne. Sie wollten mich ausgeliefert haben, um mich zu entkleiden und …
Was sollte, was in aller Welt konnte ich tun? Ueber die Felder entweichen? Undenkbar! Sie hatten überall Wächter aufgestellt. Hinaustreten und mit der Meute vernünftig reden? Wenn Indianer einmal wild geworden sind, kann sie niemand beherrschen. Da reißen sie alten Freunden das Herz aus lebendigem Leibe.
Und was mich erwartete, war noch viel schlimmer. Der Tod konnte erst nach Stunden oder nach langem Siechtum eintreten. An eine Verteidigung war nicht zu denken. Schon flogen schwere Steine auf das Strohdach des Häuschens. Ich durfte die armen Leute nicht um meinetwillen um Leben und Gut bringen. Was aber tun?
Ich sah mich nach einem Messer um. Selbstmord war der einzig denkbare Ausweg. Das Gehirn versagte. Ich hätte so gern einen anderen Tod gewählt. Das allmähliche Verbluten war mir schrecklich. Inzwischen würde noch Zeit bleiben …
Die drei Frauen rangen die Hände, der Mann war wieder zum Tor gegangen, um durch die Holzwand zu verhandeln. Ich ergriff das Brotmesser, das noch auf dem Tische liegen geblieben war. Gab es keinen Ausweg?
Selbst in dieser Stunde heulte ich nicht. Ganz ruhig stand ich neben dem Tisch und dachte, dachte. Es galt zu handeln, nicht nutzlos zu klagen.
Pferdegetrappel, Stimmen.
Mein Gastgeber stürzte herbei. Der Polizeiinspektor kehrte von seiner Finca, seinem Landgut, zurück. Sechs Mann begleiteten ihn. Er las meinen Paß, sprach mit mir, ging hinaus und beruhigte die Leute. Widerwillig, wie knurrende Hunde vor höherer Gewalt, zogen sie sich zurück. Ich wurde mit Obst, Blumen und Leckerbissen beladen and die ganze Familie begleitete mich zur Grenze von La Pacheta. Der Polizeiinspektor und seine Mannschaft sicherten den Rückzug. Mir wurde geraten, nirgends allein hinzugehen und nicht wieder nach La Pacheta zurückzukehren. So endete die Freundschaft mit den einzigen guten Menschen, die ich in Peru kennen gelernt hatte.
Diesmal hatte mein Abenteuer sofort einen tieferen Eindruck auf mich gemacht. Ich wurde von einer eigenen hoffnungslosen Schwermut befallen, die mich fürchten ließ, Peru nie oder in jedem Falle nicht, wie ich es betreten hatte, verlassen zu können. An einen sofortigen Wechsel war nicht zu denken, da mir meine Mittel kaum eine Reise nach Cuzco oder La Paz in Bolivien gestattet haben würden, und gewiß waren die Menschen dort nicht besser, die Verdienstmöglichkeiten aber vermutlich schlechter. Ich mußte einfach durchhalten. Wer in den Fluß springt, muß an 's Ufer schwimmen oder ertrinken.
Vor der Kathedrale.
Ich war an jenem Abend zu erschüttert, um allein zu bleiben. Um acht Uhr spielte die Musik auf der Plaza de armas unter Palmen, und unter den hellerleuchteten Säulenhallen der Hotels und Geschäfte gingen die Mädchen und Frauen auf und ab, wurden gegrüßt und bekrittelt, auf die Wagschale ihres Frauenwertes (rein geschlechtlich!) gelegt und in bissigen Bemerkungen gewogen. Nicht so auf dem schwach beleuchteten Pflaster vor der Kathedrale, wo ich unbehelligt meinen Träumen nachhängen konnte. In der Mitte des langen Fußsteigs führten drei Stufen zur Plaza nieder. Gerade, als ich sie erreichte, rief jemand in nächster Nähe:
»Alma!«
Nun kannte niemand – auf tausend und abertausend Meilen hinaus – meinen Taufnamen. Ungläubig, mit weit offenen Augen, wandte ich mich um.
Unten, am Fuß der kleinen Steintreppe, stand Davido L…, der »böse Italiener«, und breitete im Scherz, weil er alle meine Abneigung gegen Vertraulichkeiten kannte, die Arme aus. Es kostete mich unglaubliche Selbstüberwindung, mich nicht mit einem Aufschrei wirklich an seine Brust zu werfen. Gegen die Peruaner war er ja der goldflügeligste Engel!
So reichte ich ihm die Hand, und meine Augen strahlten; dann, unvermittelt, begann ich meine Klagen. Wie ein Kind, das heimgefunden, sprudelte ich mein Weh hervor, und als er mich zum Abendbrot einlud, nahm ich glatt an. Schon der Gedanke einer Trennung war mir unerträglich. Es war nicht seine Persönlichkeit, es war der »Bologna« mit all seiner Sicherheit, mit der geliebten italienischen Sprache, der Güte ringsumher, das vertraute Altgewohnte. Das, was hier in gestreiften Hosen neben mir ging, war Europa, war die Heimat …
Vielleicht verstand er, der Heimatgeborene, etwas von dem, was in mir vorging, denn so nett er gegen mich war und so beständig wir zusammen Ausflüge machten – besonders nach Tiabaya, wo wir ein Küchlein mit unserem Auto überfuhren – nie wieder überschritt er die Grenze des Freundschaftlichen. Er behandelte mich – dies wurde mir viel später erst richtig klar – wie ein Kind, das jemand verwundet hatte. Auf dem »Bologna« hatte er mir mehr als einmal zu meiner unbegrenzten Entrüstung gesagt:
»Ich habe eine Tochter, doch wenn sie so reisen wollte wie Sie, würde ich sie totschießen! Lieber das als ein solches Leben!«
Nun hatte ich begonnen, ihn zu verstehen. Für eine alleinstehende Frau war das Reisen in solchen Ländern undenkbar oder in jedem Falle derart aufreibend, daß es besser sein mußte, sie tot zu wissen …
Wir standen am Vorabend seiner Abreise vor dem Pichupichu und machten eine Mondfinsternis mit. Er beschwor mich, mit ihm bis nach Chile zu reisen. In Chile würde ich Don Luis finden und auf jeden Fall geschützter sein.
Aus eigenen Mitteln war – selbst wenn ich meine Verträge mit den Schülern brechen wollte – nicht daran zu denken. Ebenso wenig wollte ich auf seine Kosten reisen, und so blieb ich doppelt verlassen, um zwei Eier und eine liebe Erinnerung reicher, in Arequipa zurück. Er reiste hinab zu Don Luis und der roten Dame und zurück nach Europa.
Was würde ich alles geleistet haben müssen, was gesehen und erlernt, bis auch ich daran denken durfte! Noch litt ich an Heimweh.
Obschon ich es in seinem ganzen Umfange nicht zugeben wollte, blieb ich in Furcht zurück. Zwei Dinge trugen dazu bei: ein furchtbarer Mord war vor dem Molino de Hurtado um sieben Uhr abends an ganz begangener Stelle mitten in der Stadt verübt worden. Ein Mann hatte eine bessere Frau mit losen Pflastersteinen nicht nur erschlagen, sondern die Leiche geschändet. In einer nahen Nebengasse war ich selbst bei einem Haar über einen splitternackten, auf dem Pflaster liegenden Mann gefallen, und hinter mir schien immer irgend jemand zu schleichen, besonders gegen Abend, sobald ich meinen Schüler verließ. Ja, sogar dieser Schüler war eine wachsende Gefahr: Ich saß immer mit einem Auge auf den Rückzug gerichtet, mit dem anderen auf dem Buch und ich bewachte jede Bewegung so scharf, als ob ich einen Löwen im Käfig unterrichtete. Das tat der Stunde und den Nerven Abbruch.
Die zweite Sache war der Umstand, daß in den Zeitungen fortwährend Anzeigen zu lesen waren, die etwa so lauteten:
|
»Zwölfjähriges Mädchen, blaues Kleid, roter Hut, in der Straße San Juan de Dios am soundsovielten um zehn Uhr verschwunden. Um Auskunft, die … etc. wird gebeten.« |
Es verschwanden Knaben, doch vorwiegend Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren. Ob im Zusammenhang mit dem Mädchenhandel oder zu Götzenopfern, war nicht festzustellen. Gefunden wurden sie nie.
Alle diese Gefahren sah ich besser als Männer, die davon weniger berührt werden, oder flüchtige Durchreisende, die mit dem Volk in keinerlei Berührung traten und durch den Aufenthalt in einem erstklassigen Hotel immer einen gewissen Anschluß an Europäer fanden. Ich, die ich wie eine aus dem Volke leben, mich bewegen und kämpfen mußte, ich lernte die Welt ohne Maske kennen …
Der Schrecken in der Nacht.
Die Tage vergingen wie ein Mareritt; aber sie vergingen. Ich erfuhr viel über den Aberglauben in Peru, hörte von Hexen und Verzauberung und konnte gut verstehen, daß in solcher Umgebung und mit dem Herzen des Misti unter der Kathedrale alles glaubhaft schien. Ueber dem Tor alter Kirchen sah ich die Götter der Inkas – Sonne und Mond – neben dem Kreuze, und gewiß beichteten Indianer noch immer am Rande der Flüsse auf offenem Felde. Jedenfalls rissen sie sich eine Wimper aus, wenn sie zufällig die Sonne von einer Anhöhe aus begrüßten, und spien Cocablätter in Anbetung auf eine Huaca, einen merkwürdig geformten Stein, der zum Götzen wurde. Vermochten sie dem Priester den Tod eines Zwillingskindes zu verheimlichen, so bewahrten sie die Leiche in einem Tontopf im Hause selbst auf, damit sie zur glückbringenden Huaca werde.
Die Zahl der Schüler hatte sich etwas vergrößert, und ich durfte hoffen, nach Cuzco und La Paz weiterreisen zu können, sobald mein dreimonatiger Vertrag mit dem Vater der dreizehn Kinder abgelaufen war. Dies waren im Grunde meine liebsten Schülerinnen, obschon ich auch fand, daß der Geist der Mädchen zu nichts Idealem Aufschwung zu nehmen vermochte. Die schönsten Werke der Literatur ließen sie unberührt, das höchste Streben der Menschheit war ihnen nur ein leerer Traum und selbst ihr Glaube war ein Gemisch von Zeremonie und Aberglauben ohne Tiefe. Seltsam berührte es mich, daß sie nie sagten, wie alt sie waren und daß sie, obschon die älteste höchstens etwas über achtzehn war, schon recht verblüht wirkten. Sie waren gelblich, galten aber vor der Welt schon als »Weiße«.
Am Montag hatte sich bei mir durch das Trinken ungesunden Wassers die Ruhr entwickelt; ein Verwandter der Dreizehn gab mir eine Flüssigkeit, die als Geheimnis behandelt wurde und durch die ich tatsächlich in vierundzwanzig Stunden genas. Ich mußte jede Stunde zehn Tropfen in einer Schale siedenden Wassers trinken und unbedingt fasten.
Obschon die Anfälle Freitag ganz und gar überstanden waren, legte ich mich doch nicht nur im Nachthemd, sondern noch mit dem Schlafrock bekleidet, nieder, nachdem ich wie immer meinen Rundgang gemacht und alle Schlösser untersucht hatte. Die Hunde heulten wie jede Nacht, die Drehorgel spielte irgend einen spanischen Tanz und das Klappern der Fußgänger folgte mir bis tief in den Schlaf.
Während ich – die Ohren mit Watte verstopft, um überhaupt einschlafen zu können – auf meinem sehr verwanzten Bette lag, träumte ich von Italien, ging gerade mit meiner Tante durch eine sehr enge, sehr belebte Straße, plauderte italienisch und vernahm dennoch hinter mir, dicht am Ohr, in englischer Sprache die Worte: »Wach auf! Wach auf!«
Gegen meine Gewohnheit gehorchte ich dem Befehl augenblicklich. Mein Herz klopfte laut. Ich zog die Wattebauschchen aus den Ohren und setzte mich auf dem Ellbogen aus. Kein Laut ringsumher. Hunde und Menschen waren verstummt, der Mond war am Ende des letzten Viertels, und trotz der Glasscheiben war mein Zimmer in geradezu schwarzer Finsternis.
»Wie dumm!« dachte ich angestrengt in die Stille schauend. »Warum sitze ich hier mitten in der Nacht und starre in den Raum hinein?«
Ich war eben im Begriff, mich zurückzulegen, als eine Gestalt – ein unerkennbares Etwas – sich lautlos dicht vor dem Bett bewegte. Sie schwankte hin und her wie eine Riesenschlange, die ein Tier hypnotisiert. Noch fühlte ich keine Furcht, nur wachsendes Staunen. Was in aller Welt wackelte so?
Im nächsten Augenblick kam mir das Verstehen. Bei verschlossenen Türen, Gott allein wußte wie, war ein Mann in mein Zimmer eingedrungen. Ich dachte an den Totschlag vor dem Molino de Hurtado und wußte, daß ich verloren war. Dreimal schrie ich, doch nicht wie damals beim Maisabenteuer, sondern stiller, durchdringender. Ich verstand zum erstenmal, warum man vom »Gerinnen des Marks in den Knochen« sprach. Selbst der Mann war davon angegriffen, denn er flüsterte:
»Schsch! Ein Verbrecher ist entsprungen und irrt über die Dächer! Ich beobachte ihn von hier aus!«
Die Antwort betäubte mich. Wie war der Mann in mein Zimmer gekommen? Tür und Fenster waren zu, die Seitentüren auf meiner Seite verriegelt. War er durch den Boden gestiegen? Was sollte, was konnte ich tun?
Das Licht war nicht zu erreichen, denn man drehte es mitten im Raum an, und zwischen mir und dem Unbekannten war kein Platz zum Durchgleiten. Im Nebenraum hüstelte jemand, ohne auf meinen Notschrei zu Hilfe zu kommen. Nun wußte ich, was ich immer geahnt hatte: daß man in Peru völlig allein war, unter Tieren, nicht unter Menschen. Der Unbekannte, von dem ich nichts als eine Art Mützenrand erkennen konnte, rief leise, aber drohend, die Hand in die Tasche versenkend:
»Wenn Sie wieder schreien, töte ich Sie!« Und sofort darauf in der schonungslosen, barbarischen Art jener Männer: »Ich will dich genießen!« Als ob ich ein Butterbrot oder ein Glas Bier gewesen wäre!!
Mein maßloses Grauen hatte mich verlassen. Ich wußte, daß der Tod das angenehmste Ding war, das ich ersehnen konnte, und da ich den Fall schon klar am Tage überlegt hatte (Warnungen genug hatte ich erhalten!), so verlor ich keine Gehirnkraft im Nachdenken. Eins wollte ich: So verzweifelt kämpfen, daß er mich töten mußte, ehe …
Aber teuer zahlen sollte er für das zweifelhafte Vergnügen!
Ich habe eine sonderbare Eigenart: Ich kann nichts im Leben ohne Schuhe unternehmen. Ob es das Gefühl ist, daß ich barfuß nicht fünf Schritte weit käme, ob es eine ererbte Eigenschaft ist, ich könnte es nicht sagen, doch wenn ein Schiff in Gefahr scheint, ein Feueralarm ertönt oder jemand einfach an der Türschelle zieht – immer muß ich zuerst wenigstens Pantoffel anhaben, und ehe ich mein Leben teuer verkaufte, wollte ich kampffähige Schuhe aufweisen. Warum? Gott allein weiß es.
Meine kindische Pantoffelsucht rettete mich; denn als ich die Hand nach den Fußhüllen ausstreckte, ergriff ich die Eisenstange, die ich – weitere Angriffe meines Hausherrn befürchtend – neben meinem Bette liegen hatte und deren Gegenwart mir ganz entfallen war.
»Ich will dich genießen!«
Alles, was ich hier umständlich beschreibe, spielte sich in wenigen Minuten ab. Blitzschnell arbeitete das Gehirn, und eine Sekunde lang hegte ich den Wunsch, dem Tier die Stange mit voller Wucht auf den Kopf zu schlagen und damit ein- für allemal frei zu werden, aber sogar da wußte ich, daß ich nie wieder froh werden würde: daß er mir tot viel unangenehmer erscheinen müßte als lebend, und so stieß ich ihm die schwere Stange lieber mit voller Wucht in die Brust. Er hatte Gefahr geahnt und sich nicht in der ersten Leidenschaft auf mich gestürzt. Nun flog er durch die Weite des Zimmers und sank neben der Wand nieder. Ich sprang aus dem Bett und erreichte mit einem katzenartigen Sprung die Türe, riß sie auf, sauste die halsbrecherische Leiter, die ich am Tage mit äußerster Vorsicht betrat, hinunter – ich glaube, ich sprang beinahe vom ersten Stock glatt in den erhöhten Patio hinab – und schlug mit der Eisenstange an jede einzelne Türe, fand und weckte die »Eule« und fragte mich die ganze Zeit, ob der Verbrecher nicht am Ende, nachdem er mich verloren hatte, mit meiner Tasche und allen Dokumenten durchbrannte.
An die Folgeereignisse erinnere ich mich nur wie durch einen Schleier. Die Eule warf sich auf den Liegenden, und sie kämpften einen Kampf auf Leben und Tod. Dem Hausherrn war es wohl am meisten leid, daß nicht er mir so nahe gewesen, und ich weiß, daß ich ihm die Eisenstange hinhielt, ohne jedwedes menschliches Gefühl zu verspüren. Alle Einwohner bildeten einen Kranz um die Kämpfenden und jemand lief heulend um die Polizei. Um meinetwillen hätte sich keine Seele gerührt.
Es war vier Uhr früh, ehe wir zur Ruhe kamen. Der Mann hatte die Glasscheibe durchschnitten und von innen ganz leise das Vorhängeschloß aufgemacht. Wenn ich nicht die Traumwarnung erhalten hätte, würde er mich schlafend überfallen haben.
An jenem schrecklichen Samstag ging ich von Gericht zu Gericht, stets vom Schutzmann begleitet, der auch allzeit sehr höflich links ging. Alle Tugend der Peruaner beginnt und endet damit. Selbst die Priester winkten mir immer, an der Innenseite der Häuser (der Damenseite) zu gehen, eine Artigkeit, die ich ausgerechnet in diesem wilden Lande nicht schätzte; denn damit wurde mir, im Falle eines Angriffs, die Flucht abgeschnitten. Ich pendelte daher – aller Vorschrift zum Trotz – an der äußersten Fußsteiggrenze.
Nachmittags um drei landete ich vor dem obersten Richter. Der Angeklagte weinte. Er war noch nie abgestraft worden. Das war sein erstes Vergehen, und er entschuldigte sich mit der Behauptung, daß es ihm unmöglich gewesen sei, der Versuchung zu widerstehen, die weiße Frau zu besuchen, die neben ihm wohnte. Ich hatte ihn nie gesehen, geschweige denn ermutigt. Der Richter sprach ihn frei. Später erfuhr ich, daß er selbst einer Zuhälterin viel Geld gegeben hatte, um ihm ein sechzehnjähriges Mädchen zuzuführen, das er vergewaltigte. Da verstand ich sein Urteil …
Das ist das Land, wo man die Guten bestraft und die Bösen belohnt.
Ich hatte mich in der Nacht der Tropen (die Luftwärme fällt um zwanzig Grad) derart erkältet, daß ich mich nicht rühren konnte. An ein Packen war nicht zu denken. Drei Tage war ich »unausstreckbar« und weinte bei jeder Bewegung; hierauf begann ich nochmals eine schwierige Wohnungssuche; denn die dreizehn Kinder wollten mich nicht vorzeitig gehen lassen, und ich war zu anständig, um durchzubrennen.
Jene, die nur an sich denken, fahren indessen im Leben weitaus besser. In der ersten Nacht schob sich eine Hand durch die Oeffnung. Ich schrie: »Wer da?« und der Arm verschwand. Keine Schritte. Ich brannte die ganze Nacht Licht. Riesenratten marschierten durch den Raum; die Wanzen ergötzten sich. Ich hielt Gewissenserforschung, denn jedes Schlafen blieb ausgeschlossen. Was hatte ich unternommen? War irgend ein Gewinn solche Opfer wert?
Ich hatte nach all der Aufregung nicht geweint; wie üblich ging ich meinen verschiedenen Pflichten nach, aber ich nahm in einer Woche um fünf Kilo ab, und die Angst, in einem ganz finsteren Zimmer zu schlafen, ist mir für's Leben geblieben. Noch heute erwache ich zuzeiten und starre verschreckt in das Dunkel in Angst vor einem Menschtier, das an meinem Lager steht …

Peru: Lamakarawane
In Yanaguara.
Ehe ich noch ein Zimmer gefunden hatte, wurde ich von einem zugereisten Franzosen und einem Einheimischen, dessen geistige Höhe mir einige Sicherheit zu gewähren schien, eingeladen, nach Yanaguara zu wandern. Es liegt jenseits von Arequipa auf dem Weg zur Sternwarte. Die Häuser sind wie aus einem Bilderbuch geschnitten, so eckig, seltsam, buntbemalt, mit Stuck beladen; böse Hunde kläffen hinter dem Fremden her; neugierige Blicke heften sich an die Fersen des Wanderers. Da lernte ich zum erstenmal die Tintenpflanze mit ihren blauroten Beeren kennen, den Tauri, einen Baum mit doldenartigen, roten Blüten, dessen Rinde zum Gerben des Leders dient, und andere Gewächse.
Das Pfarrhaus ist im altspanischen Kolonialstil erbaut, und als uns der geistliche Herr erkannte, winkte er uns, einzutreten. Er zeigte uns Bücher, die über zweihundert Jahre alt waren und von denen eins eine gruselige Beschreibung der peruanischen Pest (des schwarzen Erbrechens) enthielt. Auch erzählte er uns von einer alten Schrift in seinem Besitz, die ein Bergwerk im Gebiete des heutigen Arica genau beschrieb und angab, daß jenes Gestein Diamanten, Smaragde und Rubine in großen Mengen eingesprengt habe, doch wollte der alte Herr das Geheimnis nicht verraten, weil dieses Gebiet heute zu Chile gehörte und man noch immer hoffte, es einmal an Peru zurückfallen zu sehen. Das Werk ist in sehr klarer Schrift verfaßt und aus echtem Pergament.
In Yanaguara bewundert man das Grab des Generals Moran, und in der uralten Kirche befindet sich ein wundertätiges Gnadenbild der Mutter Gottes aus Wachs, das von Kaiser Karl dem Fünften für Cuzco geschenkt wurde, auf der Durchreise indessen auf Quetschua sagte: »Hier bleibe ich!« Die Mutter Gottes hat einen Mantel voll Silberstickerei und Ohrringe mit echten Brillanten nebst einer zarten Krone auf dem Haupte. Die Kirche selbst ist über dreihundert Jahre alt und weist den verschnörkelten, überladenen Stil auf, der damals in Spanien Sitte war. Bilder aus dem Jahre 1607, und ein anderes, neueres, das schreckliche Erdbeben von 1784 darstellend, zieren die Wände, und im Taufbecken wurden alle Edlen von Arequipa getauft. In den Nebenschiffen sah man ebenfalls alte Bilder, auf denen das Haar der Madonna sternenüberrieselt war.
Der Pfarrer ersuchte mich, da ich keine Mantilla hatte, den Hut abzunehmen und den Gedanken, so mit dem Hute in der Hand (nicht nur bildlich genommen) herumzuwandern, fand ich unendlich komisch, und es bestärkte dies nur meine Ueberzeugung, daß in Südamerika der christliche Glaube ein seelenloses Getue von Zeremonien war. Er äußerte sich nicht im Leben, nicht in der Kunst, sondern nur in abergläubischen Gebräuchen und sinnlichen Gebärden. Als ob es dem lieben Herrgott angenehmer sein sollte, mich ohne Hut herumspazieren zu sehen!
Der Pfarrer – selbst eine malerische Gestalt, beleibt, das gerötete Gesicht voll Bartstoppeln, einen abgedienten Strohhut auf und einen langen, schwarzen Talar mit breitem Kragen an – zeigte uns mit großem Stolz seinen Garten, der voll Pfeffer- und Paprikasträuchern, einem Chirimoyabaum und unzähligen Nelken war.
In einem kleinen Krämerladen aßen wir Brot und Käse. In Fässern rund um uns lag Cau-cau oder Fischlaich. Im frischen Zustand ist er grünlich oder hellgelb, später orangefarbig.
Bevor wir den Ort verließen, kehrten wir in einer Chicheria ein. Ein kleines Mädchen deckte den Tisch mit Fingern, die seit der Geburt Wasser nur durch ein Mißgeschick kennen gelernt hatten, und mit einem Tuch, das den Händen entsprach und von meinen Begleitern sofort der Maid nachgeworfen wurde, was sie sehr übel nahm. Hierauf erhielten wir Picante, Salat mit kleinen Stückchen Huhn oder Meerschweinchen, Kuttelfleck mit blauen Kartoffeln und endlich ein Riesenglas Chicha, von dem wir nur nippten. Die Peruaner beginnen gegen Mittag, Chicha zu trinken und werden von da ab faul, behauptet man. Fauler als am Morgen können sie, meiner Ansicht nach, jedoch auf keinen Fall sein. Ein Truthahn ärgerte sich über einen Leierkasten und schrie dazu.
Als wir heimkehrten, war es kühl, und ich merkte, daß der Peruaner mehr darunter litt, als wir Europäer.
Im neuen Heim.
Der größte Uebelstand beim Zimmersuchen war der Mangel eines gewissen Ortes. Man zog Leute vor, die sich dieser Geschäfte an den Straßen entledigten. Zum Schluß fand ich indessen ein gassenseitiges Zimmer in der Calle Jerusalem, dicht neben einer Tischlerwerkstatt, so daß ich das erquickliche Gefühl hatte, man sägte und hobelte an meinem zukünftigen Sarge.
Am Abend wollte ich den Luxus in Gestalt des Ortes aufsuchen. Eine Schachtel Zündhölzer in der Hand, machte ich mich auf den Weg, kreuzte den Hof und öffnete die Türe. Ein Truthahn beherrschte den Sitz und machte keine Miene, sich um meinetwillen herabzubemühen. Ich mochte schreien, stoßen, blasen …, der Truthahn saß, und da ich füglich nicht unverrichteter Sache abziehen wollte, setzte ich mich endlich zu ihm hin und ließ mich ordentlich anpecken. Zum Glück wurde er am nächsten Tage schon gegessen und meine nächtlichen Wanderungen dadurch erleichtert.
Meine Hausfrau lud mich im Austausch für die damals sehr gesuchten jugoslavischen Marken zum Abendbrot ein. Wir hatten Chupo, die Lieblingsspeise der Eingeborenen, die als Grundlage Chilepfeffer, Wasser und Salz hat und der allerlei Gemüse beigemengt wird, auch eine Torte, reich mit Quittenmarmelade gefüllt.
Das Zimmer war ruhiger, heller, angenehmer als mein Bau in der Casa rosada, dennoch wurde ich das Gefühl kommender Gefahr nicht los.
Der Stelzfuß.
Ich lief bei allen Spaziergängen wie ein Hund an der Leine, wenn nicht der Franzose und sein Freund mich begleiteten. Am meisten ging ich nach Tingo, weil die Elektrische da entlangfuhr, und ich immer hoffen konnte, im Fall von Gefahr auf den Wagen zu springen. In Tingo, das sehr an unsere heimischen Marktflecken erinnert, gibt es heiße Bäder. Wer da will, entkleidet sich hinter einem Holzzaun und steigt nackt ins Wasser. Männer wie Frauen. Man zahlt zehn Centavos für diesen Genuß. Die Centavos hätte ich aufgebracht, doch den Mut nicht. Es war gar nicht wünschenswert, als Dollar unbeschützt unter Geldmist zu sein …
Zwischen Tingo und Arequipa, wo die Elektrische die Bahnstrecke kreuzte, stand ein Wärterhaus. Es war ein Holzbau ohne Einrichtung, mit halber Tür und einer Fensteröffnung. Vor dem Haus stand eine Bank und vor der Bank ein Mann. Der gute Tutankamon mag sein Zeitgenosse gewesen sein. Alt, uralt. Alt und beinlos. Er humpelte auf Krücken und sah dreiviertel tot aus. Eines Tages redete er mich an.
Wir besprachen die Hitze des Tages, den Staub der Reichsstraße, die Höhe der Preise. Er forderte mich auf, in sein Haus zu treten und zu rasten. Das war ein halbes Haus und der Mann nicht einmal eine ganze Menschhälfte, daher trat ich ein. Kaum saß ich ordentlich, sprach dieses Gebilde von Liebe! Ein Pfund Sterling in Gold! Mir war zum Lachen und zum Weinen. Ich wünschte dem Zeitgenossen Tutankamons guten Tag und entfernte mich gelassen. Ein Glück, daß er keinen Fuß hatte. Immerhin versuchte er noch, auf den Krücken hinter mir herzulaufen. Worte von »Gold« und »Bier« folgten mir und endlich Drohungen. Besuchen würde er mich, in ganz Arequipa würde er mich suchen. Ob ich etwa glaubte, das Fehlen seiner Beine und die Zahl seiner Jahre …?
Tagelang hielt ich ängstliche Ausschau nach einem Mann ohne Beine, aber mit Herz.
Mir ist die umgekehrte Verbindung allzeit lieber gewesen.
Bis hierher kann ich immer in Erinnerungen wühlen, doch dann schlägt nach all den Jahren die Welle der Bitterkeit hoch, und ich lasse sechs Wochen unberührt in den Brunnen der Zeit fallen, Wochen, in denen meine Seele viel lernte, besonders daß sich im menschlichen Dasein alles um die Macht der Sinne dreht und wenige, gar wenige Leute von der Pest der Leidenschaft befreit stehen können, wie hochgeistig sie auch sonst sein mögen; daß es immer das Weib ist, nicht das entwickelte Ich, was ein Mann – irgend ein Mann – sucht; daß es im Leben nicht auf die Leistungsfähigkeit eines Einzelwesens ankommt, sondern auf die Lust- oder Unlustgefühle, die solch ein Einzelwesen in anderen entwickelt. Gegen die Anschauung der ganzen Welt habe ich mich damals aufgebäumt, bereit, allein zu stehen, und allein habe ich auch seither gestanden. Meine Kunst ist mein Alles geworden; aber die Männer, die mich trafen, behaupteten, daß ich überhaupt nur zur Freundschaft fähig bin und von der Liebe nichts weiß.
Wenn Liebe dem peruanischen Begehren gleichkommt, dann sage ich mit Freude: Nein, Gott sei Dank!
Damals schrieb ich, ehe ich Arequipa verließ, in mein Tagebuch: »Glücklich die Menschen, die ohne höheres Streben durch die Welt ziehen! Sie leben in der Schale ihrer stumpfen Zufriedenheit und Unwissenheit ein beschauliches Tierleben und kennen keines der Leiden, denen ein Dichter, Forscher oder Denker ausgesetzt ist. Oft wünschte ich, streblos, wunschlos, tierisch zu sein; dann litte mein Körper nicht heute unter Hunger und Kälte und bliebe meiner Seele das Fegefeuer erspart. Was ist die Welt? Eine Menge von Leuten, die einen beneiden, anfeinden, mißverstehen, oder die teilnahmlos an uns vorbeigleiten. Und darum opfert man Jugend, Gesundheit, den Frieden der Seele?! – – Und das Schlimmste ist: Man handelt nicht mit freiem Willen. Man folgt einem inneren Zwange, einer Macht, die keine Gnade kennt und die antreibt. Selig er, der davon verschont geblieben. Alles Schöne, was wir sehen, das Mehr, das wir fühlen, ist über- und überbezahlt mit den Leiden, den Opfern. Wenn wir manchmal ein Stücklein Himmel offen sehen – was ist das? Wir leben dafür körperlich und seelisch in der Hölle. Unser Forschen, unser Schaffen wird mit tausend Opfern und Tränen bezahlt; unsere Freundschaften – selten wie der grüne Strahl bei Sonnenuntergang – kosten uns leicht den Frieden der Seele, und was gibt uns Mit- oder Nachwelt, was gibt uns selbst die Gottheit als Entschädigung für solches Leid? Nichts. Im besten Falle (und wie selten!) einen Namen.«
Vor dem Misti.
»Fate show thy force; ourselves we do not owe;
What is decreed must be – and be it so!«
Shakespeare.
Meine Zeit war abgelaufen; gleichzeitig wußte ich, daß es Selbstmord war, über La Paz und das Peru gleichstehende Bolivien allein nach Chile zu reisen. Mein einziges Sehnen, wenn nach all den Aufregungen ein Sehnen geblieben war, bestand darin, zu Englisch sprechenden Leuten zu fliehen. Der nächste Punkt in dieser Beziehung war Panama. Und obschon altgebacken, besaß ich dennoch das Visum der Republik auf meinem Paß.
Wie fieberhaft ich zu verdienen versuchte! In der Hinterstube einer Krämerin erteilte ich einer armen Verkäuferin englischen Unterricht. Sie konnte nur zwanzig Centavos zahlen, aber ich war verzweifelt, wollte unbedingt fort, und zwanzig Centavos genügten für meine tägliche Kost.
Der einzige Schüler, der nicht gemein gegen mich vorgegangen war, schenkte mir einen alten Inkaschatz – einen Teufel, wie er ihn nannte, – vor dem seine Frau sich fürchtete. Ich speiste einmal in seinem Hause und schaute hinüber nach Yanaguara, betrachtete die Pappelallee, wo man mir kopfgroße Steine herabgerollt hatte, um mich damit zu erschlagen, den Fluß, über den zurück ich nach dem Maisabenteuer geflüchtet war, und den Misti, der bläulich umsponnen und erdfern auf mich herniederlächelte. Nicht berührte ihn das Kleinliche eines Menschendaseins …
Nach Erhalt dieses Inkaschatzes hatte ich noch mehr Unglück als zuvor, ohne es indessen dem Götzen zuzuschreiben. Ich weiß, daß ich einen ganzen langen Sonntag hindurch regungslos vor ihm verharrte und Coca kaute, um herauszufinden, ob man tatsächlich weder Hunger noch Durst verspüre. Eine tiefe Gleichgültigkeit bemächtigte sich meiner; ich wollte nichts, als sitzen, regungslos sitzen. Die Blätter schmeckten bitter, durften auch nicht gekaut werden, sondern mußten mit der Zunge gegen den Gaumen gedrückt, langsam ausgesogen werden. Wunschlos blieb ich, aber am nächsten Tage war ich so erschöpft, daß es mich bedeutende Anstrengung kostete, mich weit genug zu schleppen, um mein tägliches Brot in der Markthalle einzukaufen.
Aus der nur in der Montaña, im sogenannten Tropengebiet jenseits der Anden vorkommenden Coca macht man das berühmte Cocain. Das Einsammeln erfordert sehr viel Sorgfalt, denn die Blätter müssen vorsichtig abgezupft, etwas, doch nicht zu sehr getrocknet und in luftigen Doppelkörbchen verladen werden, die Lamas über die ungeheure Bergkette bis in die Nähe der Eisenbahn tragen. Die Indianer kauen Coca, wie man bei uns Tabak raucht. Um den Gürtel tragen sie einen länglichen Sack, der voll grünlicher Blätter ist, die sie von Zeit zu Zeit in den Mund schieben. Wenn sie das regelmäßig tun, können sie ohne Beschwerde große Lasten tragen, verspüren weder Schlaf noch Hunger, noch Durst, bleiben aber sehr mager. Sie wahrsagen aus dem Fall der Blättchen, sie speien die grüne, gekaute Masse einer Huaca als höchste Verehrung zu, und die Mischlinge und Weißen kochen Tee, der ebenfalls anregt und den Schlaf bannen soll. Ich war wohl zu unterernährt, um von Coca allein leben zu können.
Am Abend vor meiner Abreise wollte ich jemandem ein Paket schicken. Ich traf unterwegs einen kleinen Jungen – acht oder zehn Jahre alt – und bot ihm zwanzig Centavos an (ein Vermögen in Kinderaugen), um mich zu begleiten und die Sachen abzuliefern. Er hatte einen verschreckten Ausdruck im Gesicht und verharrte regungslos auf der Zimmerschwelle. Ich bin nie ein Künstler im Binden gewesen, und auch da versagte die Schnur, daher rief ich dem Knaben zu, mir ein wenig zu helfen.
»Verzeihen Sie, aber ich wage es nicht!« sagte er, die Augen voll Abwehr.
»Die Ausländer werden dir nichts tun,« sagte ich bitter, mich vergessend. »Ihr Peruaner seid es, die dem Ausländer bei jedem Schritt gefährlich werden und er allein ist es, der sich vor euch zu fürchten hat.«
»Ah, Señorita,« meinte er, offenbar geneigt, meinen Worten Glauben zu schenken, »seien Sie nicht böse, aber ich bin so verschreckt. Vor einigen Tagen hat mich ebenfalls eine Señorita in ihr Haus genommen und sie hat …«
Sie hatte sich – ein Weib! – an diesem Kinde vergriffen! In diesem Augenblick hätte ich in die Knie sinken und vor Scham über mein Geschlecht, die Menschheit, die ganze sündige Welt, Seelenerbrechen haben können – – und mögen.
Einige Stunden später stand ich vor dem Misti, über den wie das Blut der Gerechten der verglutende Strahlenschwanz des Tages glitt. Hinter mir, seelisch und räumlich entfernt, bellten die bissigen Hunde, kreischten die Weiber, jammerten die Kinder, stoben die Lamaherden heimwärts über die weite trostlose Ebene, wie Teufel vor dem Winde. Finster gähnten die Schluchten der Berge, drohend, feindselig knisterte der Sand, und hinter den windgebeugten, zerzausten Weiden, die wie Hexenfinger aus dem Boden ragten, ging langsam der Mond auf …
Da tat ich, was ich nie getan hatte: Ich hob die Hände wie einst die Propheten Israels und verfluchte das ganze Land mit einer rührenden Unparteilichkeit – den Erdboden, die Pflanzen, die Steine, die Tiere, die Menschen und alles, was ihnen gehörte. Ich nahm nur den Misti aus, von dem immer etwas wie überlegenes, erdfernes Mitleid für mich ausgegangen zu sein schien, und die Esel von Arequipa (aber nur die vierbeinigen!), denn die hatten es ebenso schlecht da wie ich selbst.
Auf dem Heimweg, vor dem Goyaneche, traf ich das Kind eines Köhlers, das mühsam einen Korb heimschleppte. Das Mädchen sprach mich an und sagte – trotz seiner kurzen vierzehn Jahre: »Für uns Frauen ist hier das Leben sehr schwer.«
»Ach, Kind,« erwiderte ich und das Weinen war mir nahe, »das Leben ist für uns Frauen ja überall schwer …«
Vor meinem Fenster, das einen Riesenkäfig trug, der alle Raubtiere abhielt, heulten die hungrigen Köter die ganze Nacht und fraßen sich gegenseitig auf. Wild waren sie, doch noch lange nicht so wild wie die Menschen.
Von der großartigen Kultur der Kinder der Sonne war nichts als irgend ein altes Gemäuer noch vorhanden. Die Mischlinge aber hatten weder die Tugenden ihrer indianischen noch ihrer europäischen Vorfahren. Ich verstand, warum die Nordamerikaner dieses Land, das so wunderbar und so reich ist, den Schmutzfleck auf der Landkarte Südamerikas nennen.
Um eine Muschel …
Um Mollendo fiel der schwere Tau der Winterszeit, und spärliches Grün, nicht Gras, nicht richtig Pflanze, bedeckte teilweise das braune Gestein. Die Tropensonne schien durch ein dichtes Dunstgewebe, aber immer noch kräftig genug, den Schweiß aus allen Poren zu treiben. Der erwartete »Imperial« war noch nicht eingetroffen. Im Hotel folgten mir die Augen der Männer wie Dolchstiche, und, um ihnen zu entgehen, trat ich ins Freie.
Ich wollte am Strande Muscheln suchen. Ein Weib, das ich befragte, zeigte mir den Weg und schwor hoch und teuer, daß es sicher war, ihn zu betreten. Er führte über den Rücken der Klippen in eine Vertiefung hinab. Als ich mich plötzlich vorbeugte, um hinabzuspähen, sah ich, wohl hundert Meter unter mir, vier Männer auf einem Baumstamm sitzen. Sofort fuhr ich so erschrocken zurück, als ob ich vier Pumas unten erspäht hätte, und schlug den Weg nach Mollendo ein. Das letzte Haus war nicht in zehn Minuten Wegentfernung gelegen, doch hinderte der braune Sand einigermaßen das Gehen. Jedenfalls hatte ich nicht zwanzig Schritte getan, als ich mich einem Manne in Eisenbahnuniform gegenübersah, der mir geheimnisvoll winkte, mich ruhig zu verhalten, und mir zuflüsterte:
»Kehren Sie um, denn vier Männer suchen nach Ihnen.«
Das glaubte ich gern wie das Evangelium. Ich hatte die Pumas unter mir erblickt, und sie hatten, eine Sekunde lang zu mir heraufgeschaut.
»Wir müssen den unteren Weg gegen die Klippen einschlagen,« meinte der Mann, und da ich weder vorwärts, noch gut rückwärts konnte, mußte ich wohl oder übel tun, was im Augenblick das Richtigste schien, – mich der Führung des Beamten anvertrauen. Er trug die Bahnuniform und das flößte mir einige Zuversicht ein. Ich begann, ihn nach Mutter und Geschwistern auszufragen, und ließ durchblicken, wie froh ich war, in ihm jemand zu entdecken, der bessere Anschauungen hatte.
Wir erreichten die Vertiefung unweit des Meeres und ich hob zum Scheine eine Muschel auf, während der Mann ein Versteck hinter den Felsen suchte.
»Hätte ich nur eine Waffe, so würde ich denen da oben schon zeigen,« murmelte er.
Wir blieben indessen nicht lange, denn die Hyänen tauchten unweit von uns auf, und in meiner Angst hastete ich weiter. Hinter einem Sandhügel fanden wir Schutz. Da sagte der Mann zu mir:
»Es macht sich mir nicht bezahlt, mich mit diesen vier Menschen einer Fremden wegen zu verfeinden, aber wenn Sie …«
»Warum ich? Es gibt ja hier tausend Frauen …«
»Nicht weiße Frauen; nein, um Geld ist mir nichts,« als ich ihm mein sauer verdientes Geld anbot, »aber eine weiße Frau – dafür wage ich alles! Was tut 's? Niemand auf Erden weiß es!«
Damals, im heißen Sand von Mollendo, habe ich vor einem Mitmenschen im Staube gekniet und habe ihn beschworen, mir aus dieser Not zu helfen. Er griff mich nicht an, aber helfen wollte er nicht. Er bemerkte nur, er müsse um drei Uhr im Dienst sein und wolle mich meinem Geschick überlassen. Vergeblich forschte ich nach einem Ausweg. Nach Mejia waren es zwei Stunden im heißen Sand zu laufen; hinter mir, über die Ebene zerstreut, waren die Männer; gegen die Berge hin traf man die verwilderten Holzarbeiter, und auf dem Klippenpfad zurück wollte er mich nur schützend führen, wenn …
Da packte mich eine dumpfe Wut, und ich sagte dem Manne, er möge nur gehen. Ich raffte mich vom Boden auf, ergriff meine Tasche und steuerte geradeswegs auf die Klippen – die furchtbaren Klippen von Mollendo – zu. Hier war das Meer so wild wie die Bewohner dieses verruchten Landes. In wenigen Sekunden würde ich tot sein.
»Wohin wollen Sie?« rief mir der Beamte ungewiß nach.
»Das geht Sie nichts an!«
Ich hatte die Klippen schon beinahe erreicht, als er mich einholte.
»Nun springe ich hinein!« erklärte ich und trat vor.
Er mußte sich da wohl gedacht haben: Geld, Frau und möglicherweise etwas Seelenruhe sind in dem Fall unnütz weg, und er bat mich, einige Minuten zu warten und mein gesamtes Bargeld ihm zu übergeben. Damit wollte er die vier Männer abkaufen und mich sicher auf dem Bahngeleise nach Mollendo bringen.
Ich gab ihm alles; denn was nützte mir Geld unten im gelben Schaum der Brandung? Er kaufte die Leute los, und zehn Minuten später stand ich auf dem Hauptplatz des elenden Fischerdorfes und besaß außer Fahrkarte dritter Klasse (der einzigen, die zu erstehen meine Ersparnisse hingelangt hatten) und zehn amerikanischen Dollars in einem Beutelchen um den Hals nichts als meinen Koffer und meine Erika.
Fünf Dollars wechselte ich mit Verlust (nachdem ich sie in Arequipa ebenfalls mit Verlust erstanden hatte) noch am gleichen Abend, um früh am folgenden Tage meine Rechnung und die Haifische zu bezahlen, die mein mageres Gepäck nach dem »Imperial« schleppten; fünf Dollars blieben mir in einem fremden Lande unter ganz fremden Menschen, um damit ein neues Leben aufzubauen …
Meine letzte Erinnerung gleicht meiner ersten: Ich hatte mich nachts fest eingesperrt und lag auf dem Lager, hitze- und sorgengefoltert. Würde man mich ohne Vorweisung von Geld nach Panama hineinlassen? Was würde ich da beginnen? Warum hatte mich niemand gewarnt? Die Uhr schlug Stunde auf Stunde im Gastzimmer nebenan, und immer noch wälzte ich mich auf dem brennendheißen Lager, als sich trotz meines Schlüssels im Innern die Türe mühelos öffnete und sich ein brauner Kopf in der entstandenen Oeffnung zeigte.
»Was wollen Sie?!« herrschte ich ihn an, bereit, ihm an die Kehle zu springen.
Der Kopf verschwand bis auf eine Haarlocke.
»Ich wollte nur fragen,« stammelte der Kellner unsicher, »ob Sie noch eine Decke brauchen, weil es kühler geworden ist.«
Das bei dreißig Grad im Schatten! Meine Antwort ließ keinen Zweifel über meine Gefühle aufkommen. Dann schob ich einen Stuhl vor die Tür und hob den Wasserkrug auf den Stuhl. Wenn nun jemand eindrang, mußte der Krug stürzen und mich wecken.
Gnade dem, der kommen würde!
Aber es kam nur der Tag mit seinen tausend Sorgen.
An der Reede von Mollendo.
»Land der Verbrecher, leb' wohl! Nicht um den größten der Inkaschätze möchte ich dich wieder besuchen! Land, wo die Sinne herrschen und jedes bessere Empfinden schweigt.«
Ich schrieb dies damals – und mit vollem Recht – in mein Tagebuch, als ich auf meinem Koffer an Bord des »Imperial« saß und meine Mitreisenden in Augenschein nahm. Vorwiegend waren es Indianer mit ihren Riesenbündeln, mit Hühnern und einem zahmen Papagei, mit Kindern ohne Ende, mit Bettzeugbündeln, die sich zu bunten Deckflächen öffneten. Ich hatte kein Bettzeug, fand keinen Sitz außer auf meinem Koffer selbst in einer leergebliebenen Ecke unweit des gewissen Ortes, der nur von Männern besucht wurde. Frauen und Mädchen benützten ohne Scham gewisse unentbehrliche Gefäße, die sie über die Reeling entleerten. Einzelne Kinder fingen sich gegenseitig Läuse – wohl eine Erinnerung an jene fernen Inkatage, in denen jedes Kind täglich beim Dorfältesten zwölf Läuse abzuliefern hatte, um sich früh an eine nützliche Beschäftigung zu gewöhnen.
Nach einer Weile brachte man das Mittagsbrot – einen fraglichen Eimer voll von einer noch fraglicheren Suppe und schöpfte sie in die Schüsseln aus, die jedermann bereit hielt. Ich hatte kein Gefäß – nichts als das Schälchen meines Schnellsieders, denn ich wußte nicht, daß man auf dieser Linie als Deckpassagier Bettzeug und Geschirr mitzubringen hatte. Ich faßte daher nur eine schwache Schale voll und sogar noch einen Knochen darin, so daß mich der Aufseher sofort fragte, ob ich für Geschirr extra zahlen wollte. Auch würde ich, um verhältnismäßig wenig Geld, eine bessere Kost erhalten haben, aber alle Hoffnung strandete an meiner völligen Mittellosigkeit. Die fünf Dollars mußten für Panama bleiben.
Ich lehnte daher alle Hilfe ab.
Die Stunden vergingen allzu langsam. Ich kauerte in meiner zugigen Ecke und drückte meine Erika an mich. Den Plaid hatte ich ihr abgenommen und mich selbst hineingehüllt, denn der schwere Tau durchnäßte mich und machte mich frösteln. Langsam ging der Anker hoch, die braune, ungastliche Reede von Mollendo wich zurück, und durch die unaufhörlich fallenden Tränen sah ich nichts als das braune Gestein und die schimmernden Nitratfelder.
Gegen Abend kam einer der Offiziere, nachdem ich bei den geringeren Seeleuten immer jedwedes Angebot besserer Unterkunft abgelehnt hatte, und allmählich entlockte man mir den Bericht meiner peruanischen Abenteuer. Chile und Peru sind alte, erbitterte Feinde, und kaum hatte man vernommen, wie schlecht es mir im Lande der wunderbaren Inkakultur gegangen war, als man alles aufbot, mich die Schrecken der hohen Anden vergessen zu machen. Ausgeraubt wie ich war, verlangte man keinerlei Geld von mir, sondern brachte mir auf schönen Tellern die Kost der ersten Klasse (es gab nur Deck und Salon auf dem »Imperial«), und der diensthabende Offizier versprach mir, ein Bett aufstellen zu lassen, sobald »diese peruanischen Tiere« in Callas ausgeschifft worden waren. Die erste Nacht lag ich auf einer geborgten Matratze mit dem Gesicht nach unten, die Tasche gegen den Magen gedrückt und die ausgestreckte Hand auf meiner Erika …
Hinter Payta.
Ich hatte mein Bett mitten auf dem Deck, und am entgegengesetzten Ende hatte ein Jude aus Chile das seine. Er kümmerte sich wenig um mich, denn er spielte den ganzen Tag mit der eben freien Mannschaft Poker und schlief, ohne zu schnarchen, die ganze lange Nacht, so daß er mir Schutz ohne Aergernis war. Luis Ramirez brachte mir die Kost der Ersten, und je bitterlicher ich weinte, desto mehr Zucker tat er in den Morgen- und Nachmittagstee, bis nichts als Zuckersatz übrig blieb. Eines Tages blickte ich mit so viel Verzweiflung auf die Trümmer meiner Träume und meines erhofften Seins, daß ich unwillkürlich den Entschluß faßte, über die Reeling hinab in die den Propeller umrauschende Wogenmenge zu springen, als ich seinen Arm auf dem meinen fühlte und seine gelassene Stimme mir sagte:
»Mir täte der Arme leid, der hier hineinfiele, denn es wimmelt von Haifischen, die uns ständig folgen.«
In den Wellen zu enden, das schien mir angenehm genug, aber so langsam von vielen Seiten angeknabbert zu werden, davor schauderte ich doch zurück. Ich setzte mich auf das Bett und starrte auf die schwimmende Küste von Peru hinter Payta, dem elenden Pestloch, das schon viermal niedergebrannt werden mußte, und das immer wieder mit all seinen Krankheitskeimen zu neuem Leben ersteht. Trostlos in trostloser, verlassener Gegend liegt es da, und nur, wenn der Mond auf all das Gestein und die Strohdächer der baufälligen Hütten fällt, tritt ein gewisser Zauber an den Tag, der den Peruaner sagen läßt: »Im Mondenschein ist selbst Payta schön.«
Manchmal kam der junge Unterkoch, sprach von Liebe und von seinen Lebenshoffnungen und trug seine Gedichte vor. Mir war's, als spräche ein Kind zu seiner wiedererstandenen Urgroßmutter, so weit zurück schien mir all das, was ich einst geträumt und die Welt, wie ich sie vor Peru gesehen. Das Schlimmste der ganzen Fahrt aber waren die kurzen Stunden vor Callas gewesen. Nun war der Himmel verdeckt, ein nasser dichter Nebel lag trauerschwanger auf den fahlen Wassern, und keine fünfzig Meter von uns lagerte der »Bologna«. Eine einzige Fahrt schob sich zwischen meine Erfahrungen und jenes Schiffsleben, und da schaukelte er so dicht neben mir und nichts war sich gleich geblieben – nicht einmal das Wetter!
Als wir die grüne Küste von Ecuador erreichten, erging der Befehl der Zwangsimpfung. Auch ich wurde hinter den roten Teppich geschoben und wurde geimpft, worauf mir der Schiffsarzt gedämpft (der harrenden Opfer wegen) zuraunte:
»Immer zu Ihren Diensten!«
Dabei küßte er mich.
Als Deckpassagier ist man immer ziemlich machtberaubt, in meiner Lage ganz besonders. Ich erkundigte mich daher nur bei der Mannschaft nach seiner Volkszugehörigkeit und erfuhr, daß man – um keinerlei Unannehmlichkeiten mit der peruanischen Hafenbehörde zu haben – stets als Schiffsarzt einen Peruaner wähle. Das hatte ich mir gleich gedacht. Zweibeine mit menschenähnlichen Gesichtern …
Im Golf von Panama.
Um fünf Uhr früh ermöglichte Luis Ramirez mir ein Bad. Gegen sechs wurde das Schiff nervös; denn es zeigte sich das Boot mit der gelben Flagge. Der amerikanische Arzt kam an Bord, und ihm folgte, kurze Zeit darauf, der Polizeiinspektor samt Schwanz.
Ich war zu verzweifelt, um auch nur weinen zu wollen. Das wäre aber schon der Augenuntersuchung halber nicht wünschenswert gewesen. Mein Leben hing von dieser Untersuchung ab; denn verweigerte man mir aus Geld-, Gesundheits- oder Paßgründen das Einlaufen in Panama, so war ich fest entschlossen – ob Haifische oder nicht Haifische – vor den Augen der Behörden in den Golf hinab zu springen. Alles auf Erden eher, als eine Rückkehr nach Peru …
Fünf Südamerikaner, der Jude, ein Neger und meine Wenigkeit sollten als Deckfahrer landen. Die anderen sprachen kein Englisch. Sie mußten ihr Geld vorzeigen und wurden als minderwertiges Zeug behandelt. Dann erklärte ich dem Beamten, daß ich einer Studienreise um die Welt halber zu sparen gezwungen und auf dem Wege nach Japan begriffen war. Mein Englisch war, wie es sein sollte, daher war ich Mensch.
»Haben Sie genügende Mittel?«
Ich bejahte. Würde er sie sehen wollen?
Aber er dachte sich wohl, wer nach Japan wolle, der müsse auch Geld haben, und zu meiner Erleichterung wandte er sich ab. Mein Visum, das so teuer erkauft zu haben, ich damals so sehr beklagte, war – bei allem Alter – ein regelrechtes Visum, und meine Augen, vierundzwanzig Stunden tränenlos erhalten, sahen gesund aus, als der Arzt das Lid, an den Wimpern reißend, hob. Unten auf dem Hafendamm stand ein weiterer Paßbeamter und überprüfte nochmals die Pässe. Im Augenblick zählte er die Häupter der Lieben eines reichen Nordamerikaners, der mit nicht weniger als sechs Frauen reiste, von denen jede wie ein Mont Blanc wirkte. Kein Wunder, daß der Beamte die Frauen wie Rübezahl einst seine Rüben zählte und die Zahl scheinbar nie eine zufriedenstellende war. Ich schwamm dicht an die Mont-Blancgruppe heran, glitt in ihrem Strom dem Beamten näher und näher und verschwand an ihm vorbei im Kielwasser der Großen; erreichte den Ausgang, befand mich im Freien.
Ich stand auf dem Boden der Vereinigten Staaten unter Englisch sprechenden Menschen und durfte neu aufbauen.
Mit fünf Dollars in der Tasche.
Dennoch kam mir nicht einmal der Gedanke, geschweige denn der Wunsch, die Reise aufzugeben und geschlagen heimzukehren. Gerade nun dachte ich mir, wie einst mein Vater, als er mit gezogenem Säbel durch die Elbe dem Feinde entgegenschwamm: Siegen oder sterben!
Fürs Nachgeben bin ich nie gewesen …
Bei den drei Grazien.
Es war eine schreckliche Wohnungssuche, denn in der Kanalzone, in den traumhaft schönen, blumenüberwucherten Häuschen durften nur Kanalangestellte wohnen, und unten in der Stadt fand man viele leere, doch wenig eingerichtete Zimmerchen. Wenn man sie fand, so kosteten sie viel zu viel für meinen armen Beutel. Erst in der Avenida B entdeckte ich eine Hinterbude, für die ich täglich zahlen durfte und zwar fünfzig Cents für die Nacht oder drei Dollar wöchentlich. Ich zahlte sofort für eine Woche im voraus, um mich ein wenig rühren zu können, ließ mein Gepäck bringen und nahm Abschied von Luis Ramirez und der Mannschaft des »Imperial«, deren Güte gegen mich nur Gott allein je bezahlen kann.
Meine drei Hausfrauen – gelb wie welkes Laub, vom Leben wie vom Herbstwind gerüttelt, hausten im zweiten Stock eines düsteren Holzbaus, vereint mit einem Vater, dessen Hauptbeschäftigung es schien, auf einem gewissen Ort zu sitzen (ein Raum, durch dessen Bodenfurchen man allerdings Einblick in einen anderen Ort gleicher Art gewann und durch die man zahlreiche interessante Beobachtungen anzustellen imstande war), einem Bruder, der nichts verdiente und immer mit offenem Munde herumlief und einem ganz jungen Bruder, dessen Aufgabe es schien, die Familie zu erhalten. Er vertrat Singer-Nähmaschine. Bei aller Armut hielten sich diese gelben Grazien eine kleine Köchin, zwei Farbabstufungen unter ihnen, der sie monatlich sechzehn Pesos (Halbdollar) zahlten und die nachts auf dem Küchenboden auf alten Lumpen schlief. Wenn ich nach zehn Uhr noch Wasser holte, sah ich sie auf den Hadern liegen und einen Berg bilden, über den die großen Tropenkakerlaken wanderten. Neben ihr lagen die beiden weiteren Hausgenossen – zwei kleine Negerlein, das Mädchen neun, der Knabe zwölf Jahre alt, die wie Tiere behandelt, mit der Hundepeitsche geschlagen und zu aller Arbeit angehalten wurden. Wenn sie die Küchenreste erhielten, aßen beide aus einem Napf, auf der Schwelle meines Zimmers sitzend, die Pfötchen als Besteck. Solche Negerkinder werden ganz klein aus irgend einer Abfallbüchse gehoben, in die eine schwarze Mutter sie lebend geworfen hat, und so lange sie nicht selbständig sind, um davonzulaufen, müssen sie im Hause solcher Pflegeeltern alle schweren Arbeiten verrichten. Später werden die Jungen oft Diebe, die Mädchen Straßenpilgerinnen.
Früh am Morgen machten sie Melassenwürstchen. Sie kauften den dicken Zuckersaft billig ein und kneteten ihn daheim auf der Veranda. Manchmal, wenn der dunkelbraune Teig zu klebrig war, spien sie in die Hände, um ihn leichter zu ziehen, und seit ich das gesehen hatte, wollte ich keine der gedrehten goldiggelben fertigen Würstchen mehr, die auf einem Brett aufgestapelt, von Jungen durch die Straßen zum Verkauf getragen wurden.
Die drei folgenden Wochen sind mir immer wie ein Mareritt in der Erinnerung geblieben – nicht schaurigtief wie die Greuel und ewigen Gefahren von Peru, sondern trüb wie das Waten in einem Sumpf voll Giftpflanzen und gelegentlichen Krokodilen. Da war zuerst die unerträgliche Hitze. Quälte sie mich doppelt und dreifach, weil mein Blut trotz der Entbehrungen noch nicht genügend verdünnt war, oder wirkte die große Menge Feuchtigkeit, die sich täglich einige Male zu Wolken ballte, in schaurigen Güssen niedertoste, und aus der glutenden Erdoberfläche in erneuten Dämpfen aufstieg, so betäubend – ich kann es noch heute nicht sagen. Ich weiß nur, daß ich mich gar oft aufs Bett werfen und in äußerster Erschlaffung liegen bleiben mußte, und daß ich mein Gesicht so lange trocken zu reiben versuchte, bis die Haut entzündet war. Die Nächte waren kühler, doch immer warm genug, um ohne Ueberwurf schweißfeucht zu bleiben, und zu dieser Hitze kam die Hautkrankheit, die schon auf dem »Imperial« ihren Anfang genommen und die der Schiffsarzt zum Glück nicht entdeckt hatte. Der Halbfranzose, den ich in Arequipa kennen gelernt, hatte mir – aus Brotneid, wie ich vermute, da auch er zu unterrichten gezwungen war – irgend ein Gift in die Chicha geschüttet, die wir auf unserem Ausflüge nach Yanaguara genossen hatten. Kein Arzt vermochte, diese seltsame Krankheit zu heilen und erst drei Jahre später, in Japan, vergingen die letzten Pünktchen. Sie verriet sich äußerlich einzig durch wandernde Punkte, innerlich dagegen durch ein Jucken, das völlig ins Bockshorn trieb. Ich kratzte mich wie ein Dschungelaffe, wo ich ging und stand, einmal die Beine, einmal die Arme oder die Brust, und am ärgsten wurde es am Abend, so daß ich die ersten Wochen von Mitternacht bis drei Uhr früh Abwaschungen mit Boraxwasser machen mußte und erst durch Erschlaffung endlich in unruhigen Schlummer versank.
Das war indessen nur der Baß zum eigentlichen Sopran meiner Leiden. Das Schlafen auf dem zugigen Deckbett hatte mir allerlei Gliederschmerzen eingetragen, jäher Zahnschmerz quälte mich, die zerrütteten Nerven wollten sich nicht beruhigen, und dazu war ich verdammt, die äußersten Entbehrungen auf mich zu nehmen, nur um mein bescheidenes Zimmer erhalten zu können. Jedes Versagen meinerseits – körperlich oder seelisch – hätte mich in den Kanal geschwemmt, daher ließ ich mir nichts anmerken und tat, als ob mir nichts abginge. Einmal täglich kaufte ich um 10 Cents Brot und zitterte vor der Alten, die in der Bäckerstube saß und schlechteres Gewicht verabreichte, als der junge Mann, der mir – meines Geschlechts halber – ein Viertelweckchen als Draufgabe schenkte. Kaum hatte ich das Brot gegessen, als ich von mehr Brot träumte, und dazu hatte ich nichts als schlechtes, tropenheißes Wasser zu trinken. Als es einmal nachts regnete, fing ich das vom Dach ablaufende Regenwasser in meinem Krug auf und fand es, da es viel kälter war, reiner Nektar. Sonst bin ich nie ein Freund des Wassers, außer zu Waschzwecken, gewesen …
Was für Tantalusqualen ich auf Schritt und Tritt zu erleiden hatte! In jeder Apotheke verkaufte man Eiskaffee und Gefrorenes, aus jedem Speisehaus quoll verlockender Duft, und, wie um alles zu krönen, verkaufte man in offenen Buden »heiße Hunde«, das heißt Wiener Würstchen. So oft ich durch die Kanalzone ging, die durchweg wie ein Park war und in der man allerlei Obstbäume angepflanzt hatte, hob ich verstohlen die winzigen Jobos (stark duftende, kleine Früchte ähnlich den Pflaumen, doch mit großem Kern) auf und saugte an ihnen, um das Gefühl des Essens zu haben. Einmal hob ich ein Stückchen Eis auf, das der Eismann verloren hatte. Der Dampf von seiner Ware war so stark, daß er wie in eine Wolke gehüllt mit seiner Karre dahinfuhr.
Doch alle diese Leiden erblaßten vor der Geldsorge, die mit jedem Tage drückender wurde. In keinem der Geschäfte, Aemter oder Verkaufshallen war irgend etwas zu verdienen und nach jeder Abweisung kam die Frage, ob man nicht geneigt wäre zu …
Zum Schluß ging ich zum amerikanischen Roten Kreuz, erhielt ein kleines Darlehen und erklärte mich bereit, in den Hospitälern der Zone die Nachttöpfe zu waschen, wenn ich nur angestellt werden würde, doch selbst diese Möglichkeit versagte. Ein Mann wollte mich als Ausschenkmamsell in seiner Bar anstellen, als er mich aber sah, erklärte er, daß ich dazu nicht passe – zu zart und zu vornehm – wie er sich ausdrückte.
Die Schritte, die ich da in Arbeitssuche täglich zurückgelegt, hätten mich wohl beinahe zu Fuß nach Europa zurückgebracht, und immer tat ich sie mit leerem Magen und ohne Freude; immer mit der Versuchung, den leichten Weg einzuschlagen, der so dicht zur Hand war, und immer mit dem Gedanken verankert, daß mit mir – dem äußeren Ich – auch alles, was Ideal und Kunst in mir war, unfehlbar ersticken würde. Das verlieh mir die nötige Geduld, weiter zu kämpfen.
Gegen Ende der dritten Woche entschloß ich mich, den geringen Schmuck, den ich besaß, zu versetzen, und erkundigte mich bei dem Besitzer des Arbeitsvermittlungsamtes nach dem besten »Onkel« von Panama. Ich war fast täglich zu dem alten Herrn gegangen, der ein Deutscher war und mir höchst liebenswürdig entgegen kam, und dieser schlug mir vor, mit ihm vereint ein Uebersetzungsbüro zu errichten. Ich malte in zehn Sprachen die Ankündigung an eine Tafel, die wir vor die Tür stellten, und wenn sie auch nur eine geringe Kundenzahl ergab, so traten doch unzählige Matrosen aller Herren Länder ein und plauderten ein wenig. An Sprachübung in jedem Fall fehlte es mir nicht. Allmählich übernahm ich die Pflichten des Amtes – gering an der Zahl – das Eintragen der offenen Stellen und der Arbeitsuchenden, vorwiegend Negerinnen, der Häuser, die zu verkaufen waren und ihrer Einrichtung, die ebenfalls in ein Buch eingetragen wurde, das Bedienen des Fernsprechers und das Bewachen des flaugehenden Geschäftchens, wenn der Besitzer zum Markt ging, um das tägliche Grünzeug für seine Frau einzukaufen. Dafür bot er mir in seinem Hause Kost und Wohnung an, und weil ich so gut wie mittellos geworden, sah ich mich gegen meinen Willen zur Annahme gezwungen.
Im Bananenwinkel.
Wenn ich so viel von meinen persönlichen Erlebnissen als Einleitung anführe, so geschieht es mit der Absicht, meine Geschlechtsgenossinnen zu warnen, sich unüberlegt in ähnliche Gefahren zu stürzen. Das Reisen in den Tropen ist etwas wesentlich Verschiedenes von dem in Europa, und in den Tropen neuerdings weit schwerer für eine Frau als für einen Mann, tritt doch zu den allgemeinen unvermeidlichen Uebeln die unbeschreibliche, vor keinem Verbrechen zurückschreckende Sittenlosigkeit des Aequatorialgebiets und der in jedem Menschen dort lauernde Verdacht, man habe es – reist eine alleinstehende Frau – mit einer Spionin oder einer schlimmen Abenteurerin zu tun. Ersteklassereisende dagegen fahren wie Mehlsäcke mit Adreßschein – sie rollen durch das Land und lernen nichts, weil sie sich in einem magischen Kreis ihresgleichen bewegen und das Volk an ihnen wie ein Kinobild vorbeistreift. Hauptbedingung für solche Studienreise ist nicht Mut, sondern Ausdauer und die Kraft unbedingten Ertragens aller Widerwärtigkeiten. Damit aber überzahlt man alles, auch das Schönste, was die Tropen überhaupt zu bieten vermögen.
Das Haus des Deutschen lag am Ende der Kaledoniastraße, jenseits des Negerviertels, in dem Europäer nicht zu wohnen pflegen. Es verschwand hinter den hohen, hellgrünen Blättern der Bananen und bestand aus einem braunen Pfahlbau mit drei Zimmern – einer Rumpelkammer, die geschlossen war, einem Wohnzimmer, in dem alte Möbel planlos herumstanden und staubige Bücher die Wandbretter, Stühle und Tische zierten, und dem Schlafzimmer des alten Ehepaars, an das die Küche grenzte. Ich erhielt im Wohnzimmer ein Feldbett, das bei jeder Bewegung knarrte und in dem ich mich nie umwenden durfte, ohne mich tadelnd angerufen zu hören; denn die Tür zum Schlafraum blieb offen, während alle Fenster – bei dieser Hitze! – geschlossen wurden und ich nicht atmen konnte. Das Badezimmer durfte nie naß gemacht werden, daher wusch ich mich in einer Wanne draußen auf der offenen Veranda, wenn alles schlief, und so oft ich einen Ort besuchen wollte, mußte ich an den Ehebetten vorbeipilgern.
Um fünf Uhr morgens wurde aufgestanden, und wenn ich ungesehen in die Kleider wollte, mußte ich es auch tun. Noch war es stockfinster und zuzeiten lag das Mondlicht wie Rauhreif auf dem herrlichen Bananenlaub. Die Blättchen des Gummibaums, die sich abends wie Kinderhändchen zum Gebet geschlossen hatten, öffneten sich sachte; die Ranken der Fieberwinde wurden straffer, und ganz gelbe Vögel – etwas größer als unsere Kanarienvögel – setzten sich aus das Verandageländer und starrten uns noch schlaftrunken an. Irgend eine Zaragüeya – ein südamerikanisches Wiesel, das den Hühnern nachstellt und seine Kleinen auf dem Rücken trägt, jedes Kinderschwänzlein um den zurückgelegten Schwanz der Mutter gewunden – stahl sich durch das hohe, stachelige Gras, das von Brennesseln und Dorngestrüpp durchzogen war, und im Mangolaub raschelten die Ruderschwänze, der Tropikvogel und andere befiederte Gäste.
Plötzlich überzog den Himmel ein düsteres Rot wie der Widerschein eines fernen Lavastroms, dann versilberte sich rasch das ganze Bild, wurde sekundenlang zu flüssigem Gold und – – klar und rein stand die Sonne am Himmel. Von Finsternis zu Licht dauerte der Uebergang nicht fünf Minuten.
Nach dem Kaffee setzte ich mich auf die Veranda und malte, während der Deutsche im Garten herumstöberte und seine Frau mit vergrämten Blicken die Betten in ihrem Zimmer machte. Sie nannte mich nie beim Namen: so oft sie etwas von mir wollte, sagte sie einzig: »So, kleines Ding, setzen Sie sich nicht dahin, das ist meines Mannes Platz!« oder: »Es ist Zeit, ins Amt zu gehen, kleines Ding!«
Er ging nämlich schon um halbacht aus dem Hause, und ich trachtete, etwas vor neun unten zu sein. Da wir erst um sechs Uhr schlossen und ich nie untertags frei hatte, schien mir das reichlich genug. Nie habe ich Menschen gesehen, die teils bewußt, teils sicher unbewußt, so viel versucht haben, alles Schone in mir zu ersticken, wie diese beiden, die in ihrer Art gewiß beflissen waren, gut gegen mich zu sein. Der Osten wirkt auf uns Weiße sehr häufig entsittlichend, und er war zwanzig Jahre in China gewesen, wo die Vielweiberei blüht, in Panama fünfzehn Jahre, das sehr schön, sehr ungesund und sehr sündig ist, und dabei hatten sich die Ansichten meines Gastgebers unzweifelhaft verschoben, denn er nahm jede Gelegenheit wahr, mir unmögliche Geschichten zu erzählen, mich auf alles Schlechte ringsumher aufmerksam zu machen und mich von allem, was mir innerer Halt sein konnte, langsam abzuschrauben. Stand ich abends vor meiner Badewanne und starrte in das wundersame Flimmern der Sterne, so rief er mich zu Bett; wollte ich irgend ein gutes Buch lesen, so verhinderte er mich daran nach Kräften, und würde ich es nicht zur Bedingung gemacht haben, abends in der Bücherei studieren zu dürfen, so hätte ich ohne Ausspannen um acht Uhr, wie das Ehepaar selbst, ins Bett gemußt. Diese kurze Frist aber rettete mich; denn was sich an Widerwärtigem angesammelt hatte, glitt in meiner kurzen Freizeit von mir ab. Ich flüchtete in die Kanalzone, vertiefte mich in die bezaubernde Tropenpracht und wurde wieder – Mensch.
Diese Anlagen waren herrlich. Die Crotonsträucher leuchteten am Tage in allen Farben – vorwiegend gelb, lichtgrün, rot und schwarz – die zarten Bambusrohre spreizten ihre Blätter und zitterten im Winde; die weißen Blüten der Tempelblumen schneiten über den Boden hin, und die dolchartigen grellroten Blätter der Poincetta brachen aus dem dreistufigen Grün ringsumher. Wie Perlen schimmerten die Tropensterne im Mondlicht, und an den Bananen floß ein breiter Silberstrom nieder. Palmen rauschten, vielwurzelige Banyanbäume versperrten den Weg, kopfgroße Kalabassen baumelten von vorspringenden Aesten, und der sogenannte Liebeswein bildete ein Meer rosenroter Blüten auf den grün und weiß gestrichenen Kanalhäuschen. Zuckerrohr und Melonenbäume, Guanábanas mit ihren Stachelfrüchten, Flammenbäume mit langen braunen Schoten und andere Pflanzenwunder der Tropen begrenzten die breiten, schön geteerten glatten Wege, und wen man traf, der war nett gekleidet und Europäer …
Schwüler war das Bild unten in Panama selbst. Die winzigen Räume standen offen, und drinnen lagen Frauen in schlafhemdartigen Gewändern auf langen Schaukelstühlen, fächelten sich träge und wippten Strohpantoffeln mit der linken Zehe; Zwergpapageien kletterten an Stühlen empor und piepsten schwach. In den Vorhallen standen Kochherde, und darauf brieten dicke, heitere Negerinnen Fische in abscheulich riechendem Fett; bleichbraune Frauen huschten auf die Straße und fanden Glutaugen, die begehrten und nahmen; nackte Kinder überkugelten sich; an allen Ecken saßen Frauenmumien, die das Leben ans Ufer geworfen hatte, und verkauften Lotteriezettel; kleine Jungen boten Hirse- und Kokoskuchen feil, Affen zeigten sich in einem Hinduladen, Tabak aus Sumatra bedeckte den Boden eines anderen Raumes, und Panamahüte standen auf Ständern auf dem Fußsteig selbst. Dazwischen aber flutete das bunte Leben des Kanalgebiets vorüber – Japanerinnen trippelten in ihren Kimonos, Chinesinnen in engen, schwarzen Hosen, Panaminierinnen in ihrer bauschigen Tracht, Negerinnen in ihrer komischen Stärkwäsche (selbst das Hemd wird gestärkt!), Indianerinnen in ihren Brustflecken und den weiten Röcken und Mischlinge in europäischer Tracht, das Gesicht zur Maske gepudert und geschminkt. Männer aller Länder, Völker und Farben umgaukelten, was hier weibisch war.
Auf dem Kutschbock der zweirädrigen Wagen und der kleinen vierrädrigen Wägelchen, saß ein Kutscher unter einem Riesenregenschirm, der fast größer als das Gefährt war, und auf der Plaza Santa Anna befanden sich die Schuhputzerjungen, eine schwarze Zunft, die tagsüber mit ihrem einzigen beweglichen Gut, der Schuhbürstenkiste, von Straße zu Straße wandelten und menschliche Fußhüllen angriffen, und die nachts auf dem Fußsteig vor irgend einem chinesischen Chop-Suey-Restaurant schliefen. Zuzeiten gab ihnen der Verkäufer des Wurzelbiers (Sarsaparilla) einen Trank oder ein Obsthändler eine faulende Banane, und was Kleidung anbelangt waren sie bescheiden in die Reste irgend einer abgelegten Männerhose gehüllt. Bis zum zwölften Lebensjahre war überdies eine derartige Hülle überhaupt nicht vonnöten. Wozu in aller Welt war man denn in eine schwarze Haut schon hineingeboren.
Die ganze Kaledoniastraße gehörte den Negern und auch die kleinere Markthalle, in der neben Yam (einer Knollenfrucht) dünne lange Chinesenbohnenschoten, Peitsai (chin. Salat), Rosella (Blüten, die, als Gemüse und als Obst gekocht, gegessen werden können), purpurfarbige Heckenäpfel, Brotfrucht und andere Tropensachen zu kaufen waren und wo man die Rieseneidechsen oder Iguanas angebunden sah, die von den Schwarzen als Leckerbissen gegessen werden und weißes Fleisch haben sollen, während die gepökelten Eier, zu gelben Rosenkränzen zusammengefaßt, als besondere Speise verkauft werden. Auch ich kaufte einige und aß zwei gekocht. Sie schmeckten wie hartgesottene Dotter und rochen … wie Ostereier um Allerseelen. Ich verbrauchte einen halben Dollar in Arzneien, um die Iguana wieder auszubrüten, denn sie rannte mir im Körper auf und ab, bis ich grün und gelb war.
Ich war begeistert von all dem Neuen trotz all meiner Uebel und malte früh am Morgen flott darauf los. Das erbitterte die alte Frau, und als ich abends heimkehrte, waren Malsachen – Farben, Pinsel, Farbstifte – alles weg. Der Sohn der schwarzen Wäscherin hatte ausgerechnet dies aus meiner Rumpelkammerlade gezogen. Beschuldigen durfte ich die Dame nicht, wohl aber jammerte ich derart um die Sachen, daß der alte Herr mir einen bescheidenen Malkasten schenkte. Die Kreiden aber, die ich verloren hatte, waren mir unersetzlich.
Was ich alles versuchte! Am meisten verdiente ich mit kleinen Weihnachtskarten, die ich nach englischer Art in Buchform und mit Bändchen herstellte und für die ich – Malerei und Material – 23 Cents das Stück erhielt. Malen gestattete mir der alte Herr noch am liebsten in den langen Bürostunden, und so brachte ich langsam genug Karten zusammen, um etwas zu ersparen und um mir gelegentlich Zeichenpapier, eine Marke oder ähnliches zu leisten. Auf diese Weise konnte ich aber noch hundert Jahre in Panama sitzen! In meiner Verzweiflung versuchte ich Arbeit für den katholischen Wohlfahrtsverein zu erhalten, schrieb auch einige Sachen, wurde indessen nie honoriert. Der einzige Vorteil, den ich davon hatte, war die Bekanntschaft mit Präsident Harding, der – eben erwählt – die Kanalzone besuchte und der mir, da ich gerade im Heim anwesend war, auch die Hand reichte. Die Deutschen erhofften damals unendlich viel von ihm. Hoffnungen verrinnen ja bekanntlich wie Nebel …
Unterdessen wurde meine Lage im Bananenwinkel – zu keiner Zeit rosig – völlig unhaltbar. Wenn ich morgens vom Haus ging, wußte ich nie, ob ich dahin zurückkehren oder noch vor Nachtanbruch Selbstmord begehen würde. Durch die langen Stunden des Tages warf mir der alte Herr Undankbarkeit vor, weil ich seinen Antrag, im Büro seine Nebenfrau zu werden, glatt abgewiesen hatte. Ich war ihm für alles empfangene Gute außerordentlich dankbar; aber selbst Dankbarkeit hat Grenzen und seine chinesische Lebensanschauung verfing bei mir nicht.
»Chinesinnen sind glücklich, auch wenn der Mann mehrere Frauen hat. Er versorgt sie vollkommen und nimmt ihnen alle Gedanken für das tägliche Sein,« bemerkte er.
»Ich habe selbst Gedanken und bin keine Chinesin!« erwiderte ich trocken. So begannen die Reibereien. Eines Tages sperrte er gegen alle Gewohnheit die Türe zu und ergriff mich am Arm.
»In meinem Leben habe ich noch immer erhalten, was ich wollte!« Auch das hatte er schon oft gesagt.
»Jeder Schuh findet seinen Leisten, und heute wirst du diesem Schuh der Leisten sein, der ihm beweist, daß man nicht allzeit bekommt, was man will!« Eine nützliche Weisheitsregel, die denkbarst eingepaukt werden soll, und damit hängte ich mich ganz einfach an seinen größten Schatz – den langen grauen Bart.
Wir hatten etwa drei Minuten einer sehr bewegten Zeit. Ich hatte von Peru her Uebung in derlei Sachen. Zum Schluß flog ich mit einem Krach in eine Ecke und mein Kampfpartner in die andere, weder zum Vorteil unserer Rippen noch zu dem der wenigen morschen Büromöbel.
Von da ab ließ er mich wohl nicht aus seinem Hause scheiden, aber er behandelte mich wie ein Tier, und seiner schwerhörigen, sehr eifersüchtigen Gattin, die kummergedrückt umherschlich, hätte ich es nicht übers Herz gebracht, die nackte Wahrheit zu sagen. Ich malte daher fieberhaft und wartete.
Vielleicht war ich zu zermürbt, um mit Gewalt einen Bruch herbeizuführen. Die Stelle eines öffentlichen Dolmetschs war ausgeschrieben gewesen; ich hatte mich beworben, zur Prüfung gemeldet und sie auch abgelegt, obschon sie ja für mich unverhältnismäßig schwerer, als für die anderen Kandidaten war, da jene von ihrer Muttersprache aus übersetzten, ich aber zwei mir fremde Sprachen in eine dritte übersetzen mußte und mir die gesetzlichen Amerikanismen ziemlich fremd geblieben waren. Dennoch erhielt ich hohe Noten.
Das Lob allein half mir indessen nicht, denn die Wochen vergingen, Weihnachten nahte, und ich vernahm nichts weiter. Abendkurse für Mischlinge waren durchgefallen, die Bezahlung in einem Zeitungskiosk zu gering, um mir selbst das einfachste Leben zu ermöglichen; denn ich mußte – wie sehr ich auch hungern mochte – Europäerin bleiben, durfte in keinem Negerloch wohnen oder Negernebenverdienste suchen.
Eine nette Amerikanerin, die Gattin eines Bahnbeamten, die infolgedessen in der Zone selbst wohnte – für mich das Begehrenswerteste, was es gab – lud mich zuzeiten ein, zu ihr zu kommen, doch das Verbot auszugehen oder irgend einen Verkehr zu pflegen, machte ein Willfahren undenkbar. Dennoch gelang es ihr, mir einmal im Vorbeieilen zuzuflüstern:
»Wenn Sie sich gezwungen sehen sollten, hier wegzugehen, so steht Ihnen unser Hans offen.«
Zwei Tage später erinnerte ich mich daran.
Es war Weihnachten. Die glühendste Tropensonne brannte auf Panama nieder und machte die Baumwolle auf dem Weg nach Las Sabanas reifen. Die Bäume wirkten wie Kirschen in Blüte oder Schnee in grüner Landschaft. Ich freute mich schon, am Christtag nach Alt-Panama wandern zu dürfen. Jeden zweiten Sonntag mußte ich daheim bleiben und meine Wäsche waschen, und da ich die Arbeit nicht gewohnt und durch den Tropenaufenthalt, die Sorgen und Leiden so geschwächt war, griff es mich derart an, daß ich einige Tage hindurch nicht gut schreiben und gar nicht malen konnte. Ich bäumte mich immer stärker gegen diese Arbeit auf, die mir nicht nur Kräfte, sondern den einzigen kostbaren Tag raubte, an dem ich mir etwas ansehen konnte, was vom Standpunkt meiner Studienreise, von dem der Journalistin und von dem der Malerin unerläßlich war. Anstatt mir darin zu helfen, wurde mir von allen, die ich traf, mit großer Ueberzeugung gepredigt, daß nur der Rausch der Sinne der echte Lebenswert genannt werden durfte. Je mehr man es betonte, desto überzeugter wurde ich vom Gegenteil und desto begeisterter starrte ich an einsamer Stelle ins Abendrot oder versenkte mich in den Anblick der Tropengewächse mit ihren farbentollen Blüten, den langen Halmen, an deren Enden die Kolibris schaukelten und summten, oder ließ das Mondlicht an mir niederrieseln, während die Bananen lispelten und irgend ein Nachtvogel aufkrächzte. Es gab Kunst, Musik, Wissen, Schönheit – es gab noch viele Werte außer geschlechtlicher Sinnenlust. Von dem starken Gegenstrom, den ich indessen anderthalb Jahre in dieser Hinsicht entwickelte, ist mir ein Ekel verblieben, der mich an das entgegengesetzte Ende geschleudert hat. Aus diesem Grunde ist meine Warnung so eingehend.
Es wurde nichts aus Alt-Panama. Ich sollte daheim sitzen und der Frau Gesellschaft leisten beim Weihnachtsessen, dem der Hausherr selbst nicht beiwohnte. Es fand um zwei Uhr statt und war eine düstere Sache aus Nudeln und Verstimmung. Nach dem Essen schickte sie »das kleine Ding« fort, und allen Verboten zum Trotz wanderte ich nach der Ruine.
Der Boden vor dem zerstörten Kloster, der alten Kirche, dem elenden Rasthaus ist zeitgeheiligter Boden. Hier stieg Vasco Nuñez de Balboa 1513 mit der entrollten Flagge Spaniens ins Meer und nahm Besitz vom Stillen Ozean für Ferdinand und Isabella – unschuldig wie ein Kind, das von einem Juwelenkästchen einer Königin Besitz ergreift. Vom Gipfel des Darien hatte er beide Weltmeere erblickt.
In Alt-Panama zitterten die spanischen Mönche, die wenigen bekehrten Indianer und die ersten Abenteurer und Händler vor dem berühmten Seefahrer Francis Drake, der den Ort dreimal ausplünderte und einäscherte. Bis hierher waren einst die Inkas, die Kinder der Sonne, mit ihren Goldlasten auf Lamarücken gekommen; von hier reichte das Wasser ungebrochen bis nach Neu-Guinea.
So still ist das Meer hier, daß man glaubt, es liegen die toten Jahrhunderte wie ein Bahrtuch darauf, und so tot und schläfrig wirkt die überwucherte Ruine, die Brücke mit einem einzigen Bogen, die Urwaldbäume mit ihrer weißen Rinde und ihrem einförmig grünen Laub. Schirmameisen laufen in zwei Reihen – einer kommenden und einer gehenden – den Weg entlang, und jedes der schwarzen Tierchen trägt ein dreieckig zugebissenes Blatt wie einen grünen Sonnenschirm hoch. In wenigen Stunden sind sie imstande, einen Baum kahl zu fressen. Tiefer im Urwald springen die Kapuziner-Affen – gelb mit einem schwarzen Käppchen auf dem Kopfe –, hängt das Aï oder Faultier mit dem Kopf nach unten, sieht man, wenn man sich ruhig verhält, ein Armadillo oder kann, erreicht man einen breiteren Fluß, auch von einem Alligator überrascht werden. Der Tucan mit seinem schweren Schnabel thront auf einem vorragenden Ast, und an Schlangen fehlt es nicht. Am schönsten sind die grünen wie die bunten Papageien, die in den Palmenkronen schwätzen, und der rote Kardinal, der wie eine stengellose Blüte niederzufallen scheint. Und die Fülle von Insekten!
Ich schwelgte in der Menge des Neuen, ohne darüber die Zeit zu vergessen, doch, wie sehr ich gleich mich bemühte, die schnellste Gangart einzuhalten, brauchte ich volle zwei Stunden auf Schusters Rappen. Im Bananenwinkel herrschte Gewitterschwüle, und am folgenden Morgen entlud sich – vor der alten Frau – das Gewitter. Wenn ich nicht gehorchen – in allem gehorchen wolle, so könnte ich auf der Stelle gehen …
Meine Gesamtersparnisse, fürsorglich in die Zipfel eines Taschentuchs gebunden, beliefen sich auf elf Dollars – meine Einnahmen von Monaten, nicht Wochen! Und mit diesen geringen Mitteln sollte ich an einem so hoffnungslosen Orte neu aufbauen? Dennoch zögerte ich nicht einen Augenblick. Anstatt auf die Knie zu sinken und unbedingten Gehorsam zu versprechen, packte ich meine geringen Habseligkeiten. Die Erbitterung des Alten kannte keine Grenzen.
»Sie gehen? Sie gehen?« murmelte er, und etwas wie Schmerz klang durch. Dann, von Wut befallen, forderte er mich auf, zu zeigen, was ich eingepackt hatte. Wer kannte mich?
Wortlos packte ich meinen kleinen Koffer und drehte ihn um, daß die Sachen in alle Richtungen flogen. Beschämt drehte er sich ab und ging ins Amt. Ich dankte seiner Frau, suchte ein Zimmer in Panama und holte mein Gepäck, was einen der kostbaren Dollars verschlang.
Hinter mir schloß sich die Gartenpforte des Bananenwinkels und damit jener Abschnitt meines Lebens, in dem ich Sklavin gewesen war.
Zwischen Trompeter und Pfiff.
Nun hauste ich in einem Hotel der Avenida B und zahlte wöchentlich drei Dollars für den finsteren Raum. Die Wände, der Boden, die Leute waren braun, und ich sehnte mich krank nach dem Grün der Bananen. Neben mir wohnte ein Trompeter, der immerfort blies – entweder auf der Trompete oder als Schnarchender. In den Tropen gibt es keine ganzen Wände – ein Gitterwerk beginnt etwa einen halben Meter oder höchstens einen Meter vor der Decke und hat die Bestimmung, frische Luft durch alle Räume durchwehen zu lassen. Man kann durch dieses Gitterwerk zum Nachbar hineinspähen oder auch etwas auf ihn werfen; in jedem Fall gibt es nichts, was den Ohren verborgen bleibt …
Unten, im Gasthofgarten, pfiffen die Hausburschen oder sangen, wenn es Neger waren, ununterbrochen Hymnen. Kein Volk lebt so tierisch unbefangen dahin, wie diese nach Amerika verpflanzten Schwarzen, und keins singt mit solcher Ausdauer geistliche Lieder. Sie beten das Vaterunser zu Zauberzwecken von hinten nach vorn, sie brennen die Kerze des »heiligen Antonius des Feuers« (des Teufels) an der verkehrten Seite an, um jemand damit zu rufen, und stecken in eine ebensolche Kerze zu erhöhter Wirkung drei schwarzköpfige Stecknadeln in Kreuzform. Wer jemand töten will, läßt für den noch Lebenden eine heilige Messe samt Gesängen lesen und wenn der Tod besonders schnell eintreten soll, so legt man den Namen des zu Sterbenden verkehrt geschrieben unter das Kopfkissen eines Toten mit in den Sarg. Es gibt kein Gebot, das nicht täglich gebrochen würde, aber sowohl die Neger wie auch ihre Seelenhirten sind überzeugt, es mit strengster Glaubensbefolgung zu tun zu haben.
Neben mir hauste eine Russin, deren Streitworte mit ihrem Mann und deren Bratengeruch immer störend zu mir hereindrangen. Sie trug die Asche ihres Kindes in einer kleinen Vase im Koffer mit sich herum, und ich hatte stets das Gefühl, daß sie sich einmal irren und sie als Zahnpulver verwenden würde. Allerdings weiß ich nicht, ob sie sich je die Zähne putzte!
Mit Mühe und Not fand ich zwei Schülerinnen – Amerikanerinnen für Spanisch – und eine davon riet mir, zu einem gewissen Photographen zu gehen und ihm meine Dienste anzutragen. Sie warnte mich indessen, daß er »ein Mann wie alle Männer« war, doch darin hatte sie unrecht. Er nahm meine Arbeit nach einigem Zögern an, das heißt, er ersuchte mich, jeden Abend von sieben bis zehn Uhr bei ihm zu entwickeln und die Platten zu schwemmen, und zahlte dafür 15 Dollars monatlich. Ich erzählte ihm, weshalb ich den alten Deutschen verlassen hatte, und daß mir um diese Art Leben nichts war, und obschon ich jeden Abend in der Dunkelkammer mit ihm auf einer Kiste stehend arbeiten mußte, sagte er nie etwas, das mein Bleiben unmöglich gemacht hätte. Er gab mir fast immer etwas zu essen und war von rührender Güte gegen mich. Von allen Männern im schönen und sündigen Panama war er der einzige, der mir nach unserer ersten Unterredung sagte:
»Kümmern Sie sich nicht um das, was Ihnen hier gesagt wird. Was Sie für Recht ansehen und als Ihren besonderen Weg gewählt haben, das ist – von Ihrem Standpunkt und für Ihre Entwicklung – das unbedingt Richtige. Menschen können nicht so wachsen, wie andere biegen; jedes Wesen hat den Keim zu seiner Einzelentfaltung in sich und niemand soll dagegen arbeiten.«
Er war Jude, aber er stach selbst von den meisten Christen höchst vorteilhaft ab …
So malte ich in meiner kleinen Bude, schrieb und unterrichtete, lernte entwickeln und suchte weiter nach Erwerbsmöglichkeiten.
Und Neujahr kam und ging.
In der Kanalzone.
Ich hatte den Schotten und seine Frau besucht, und allmählich verbrachte ich mehr und mehr Stunden bei ihnen in der Zone. Zuzeiten schlief ich sogar draußen, denn Herr M. hatte Nachtdienst und Frau M. ängstigte sich allein, da viele Einbruchsdiebstähle vorgekommen waren.
Heute ist es anders; denn Präsident Harding, dem die Zone als Eldorado geschildert worden war, und der nur zwei Tage da geschmort hatte, schaffte bald die früheren Vorteile der Beamten ab. Damals hatte jeder Kanalangestellte seine freie Wohnung, die besseren und älteren sogar ihr eigenes Häuschen, doch nie ein bestimmtes. Die Einrichtung gehörte der Kanalverwaltung, so daß kein Angestellter mehr als sein Bettzeug und Geschirr mitzubringen hatte. Kam die Kündigung, so kam vierundzwanzig Stunden später auch schon der Wagen, und man siedelte um. Ich selbst bewohnte in den folgenden Monaten Ancon, Balboa, La Boca, das Quarantänegebiet und neuerdings Ancon – Orte, die über zehn Meilen in der Runde zerstreut sind.
Außerdem wurde den Kanalbeamten unentgeltlich Holz zugestellt, Licht und Wasser waren frei, und das so notwendige Eis kostete bei zwanzig Pfund täglich nur zwei Dollars monatlich. In den Kommissarien kaufte man gegen Kanalkarte und Namen weit billiger als in Panama ein, und wer erkrankte, wurde im Hospital unentgeltlich behandelt. Dagegen durfte niemand daheim behandelt werden und alle Frauen mußten im Hospital entbinden.
Sehr streng war die Reinlichkeitsinspektion. Nirgends durfte Schmutz sichtbar sein, stehendes Wasser gehalten oder Obstschalen weggeworfen werden. Nicht nur in der Kanalzone, sondern auch in Panama selbst, hatte jedes Haus eine große, mit einem festen Deckel versehene Abfallbüchse, die täglich geleert wurde. Alle Tümpel wurden mit Petroleum begossen, und wo das Gebüsch zu dicht war und Mücken Unterschlupf fanden, wurde sofort ausgeschlagen. Die Straßen waren wie gewaschen.
Die Häuschen selbst waren die besten Tropenbauten, die ich auf der ganzen Reise gesehen habe. Das innere Gerüst war aus Holz, die Außenwände jedoch aus feinem Drahtnetz. Eine breite, sehr schöne, immer mit Blumen umsponnene Veranda bildete den Hauptteil des Hauses und war allgemeiner Wohnraum. Die Schlafzimmer hatten Jalousien von innen, die geschlossen werden konnten, und die Küche war zur Hälfte aus Holz. Der Wind konnte Tag und Nacht durchblasen, ohne Insekten hereinzutragen, und das einzig Störende war der feine Schleier vor den Augen, der alles wie durch einen Nebel erkennen ließ. Auf dem Dach des kleinen Porticos lag nicht selten eine Iguana und sonnte sich unter rosenrotem Liebeswein oder glühender Bougainvillia. Wie ein verkleinerter Drache sah das Tier mit seinem Stachelrücken, großen Kopf und langen Schwanz aus, war aber so harmlos, daß es immer auf der Hut vor dem geringsten Angreifer war.
In dieser Umgebung fand ich zum erstenmal wieder zu mir zurück. Die Stille, die prachtvolle Tropenwelt rings um mich her, die Liebe des Ehepaars und dazu die reizende Nelly, die Perle von Ancon, – der weiße Zwergpinsch, der im Hause die Stelle einer Tochter einnahm und so sehr Mensch geworden schien in den zwölf Jahren Erdensein, daß ein Verkehr mit Vierfüßlern überhaupt nicht mehr in Frage kam …
Einmal wusch ich meine Kleidung im Waschbecken der Hinterveranda. Eine Weile sah mir Frau M. andächtig, doch ohne Begeisterung zu, dann nahm sie mir das Kleid aus der Hand und sagte:
»Gehen Sie auf die Veranda, Kind, wo mein Mann sitzt. Sprechen Sie mit ihm und malen Sie; denn das verstehen Sie ausgezeichnet. Das Kleid aber … bewahre mich! Das wasche ich lieber selbst!«
Und so geschah es, daß ich mit meiner Wäsche nie wieder etwas zu tun hatte und lieber Blumenbilder malte, die nach Schottland an die Verwandten des lieben Ehepaares gingen. Als Hausfrau habe ich nie geleuchtet …
»Es ist ein langer Weg, der keine Krümmung kennt.«
Schlaftrunken wackelte ich in die Küche. Frau M. drehte gerade Pfannkuchen um, und die reizende Nelly beobachtete sie dabei so klug, wie es nur ein Hund kann, der schon beinahe Mensch geworden ist und für Pfannkuchen überdies eine betonte Schwäche hat. Ueber die Schulter hinweg rief mir die Pfannkuchenkünstlerin zu:
»Wissen Sie, was man meinem Manne gestern abend gesagt hat? Ihre Ernennung zum Dolmetsch von Panama soll in der Zeitung stehen.«
Mein Schlaf war weg. Wo? Wie? Wann?
Der Aufruhr endete mit meinem Davonstürzen zum Nachbar und dem Wiedererscheinen mit dem Hauptblatt der Republik. Unsere Pfannkuchen brannten an und verkohlten trotz Nellys warnendem Gewimmer, während wir lasen, daß ich zum Dolmetsch von Stadt und Provinz von Panama ernannt worden war. O Seligkeit ohne Ende!
Der Tag verging wie im Traum. Ich sauste zum Postamt hinunter, ich fand richtig die Ernennung, ich lief ins Justizgebände und leistete feierlich meinen Amtsschwur, ich wählte die Bücherei auf der Plaza zu meinem Aufenthaltsort und wurde nun sozusagen noch dafür bezahlt, daß ich da saß und arbeitete: ich trug meinen Namen in das große Buch ein und – o Krone der Freuden! – man überreichte mir die Siegel. Als Gehalt waren 150 Pesos ausgesetzt und für jede Privatsache durfte ich extra rechnen. Es gab sechs Gerichtshöfe, in die ich in Panama selbst gerufen werden konnte, und nötigenfalls würde ich auch verreisen müssen.
Am Abend rief ich durch die Türe: »Wer kommt?«
»Unser liebes kleines Mädchen!«
»Nichts da! Der Dolmetsch von Stadt und Provinz von Panama!«
Selbst Nelly bellte vor Freude …
Im Kreisgericht vier.
Zur Zeit, als ich Dolmetsch von Panama wurde, erregte ein Fall besonderes Aufsehen. Es handelte sich um einen gewissen Neger Samuels, der des Mordes angeklagt war und schon drei Monate in Untersuchungshaft saß. Nun kannte ich den Fall schon von meinen Freunden her; denn Samuels waren die Nachbarn von Herrn und Frau M. draußen in Las Sabanas, wo sie eine kleine Pflanzung hatten. Nach Art der Neger kam es wohl manchmal zum Streit, und Frau M. erzählte lachend, daß die Umgebung überzeugt gewesen war, die schwarze Nachbarin habe unter dem Wohnhaus einen Knochen vom Coco Solo (dem Friedhof) vergraben, um zur Rache für eine Hühnerunart (Frau M.'s Hühner hatten Mais weggefressen) eine böse Krankheit heraufzubeschwören, ein Glaube, der dadurch seine Bekräftigung gefunden, daß Frau M. tatsächlich derart an Malaria gelitten hatte, und wie leblos liegen geblieben war. Sie aber, die gute Seele, erzählte nichts vom Knochen, sondern nur von der Güte der Negerin, die ihr während der Krankheit beigestanden und ihr den Haushalt besorgt hatte. Ueberhaupt wußte die Schottin immer nur Gutes von jedermann zu sagen und beschrieb die Menschen stets in so goldigem Licht, daß ich mich oft fragte, warum mir solche Wunder nicht unterlaufen waren, bis ich entdeckte, daß alle Menschen für sie der Widerschein der eigenen Herzensgüte waren. Sie rief so selbstlos in den Menschenwald hinein, daß sogar der schlimmste Baum noch ein gutes Echo hören ließ. Seither wußte ich genau, daß die Menschen manchmal keine Engel gegen mich waren, weil ich selbst vom Engelzustand viele Meilen entfernt war.
Es versteht sich also, daß Frau M. die Negerin und ihren gesetzlichen Anhänger als unübertrefflich schilderte und sich den Fall sehr zu Herzen nahm. Wie groß war daher die Freude aller, als ich bei der ersten großen Verhandlung als Dolmetsch neben dem Angeklagten saß. Mein Entzücken bewegte sich dagegen in sehr engen Grenzen; denn so wichtig ich mir auch vorkam, so durcheiste mich der Gedanke, daß der geringste Fehler, die flüchtigste Unaufmerksamkeit meinerseits dem Angeklagten das Leben kosten könne, und ich schwitzte daher ärger als je zuvor im heißen und sündigen Panama.
Es gibt in der Republik keine Schwurgerichte. Die zwölf Geschworenen sind unbekannte Personen. Der Richter entscheidet den Fall immer selbst nach reiflicher Ueberlegung, beraten von dem Verteidiger und dem öffentlichen Ankläger. Es soll da heißen: »Wer schmiert, der fährt« und mit der Gerechtigkeit nimmt man es in Panama nicht so genau. Das darf nicht verwundern, denn die ganzen Lebensbegriffe sind dort andere, und Verhältnisse bestimmen nicht nur Menschen, sondern auch Obrigkeiten. Bezeichnend ist, daß die Republik einen von den Vereinigten Staaten aufgestellten fremden Revisor hat, damit die Zahlungen geleistet und die Beamten, Lehrer und staatlichen Angestellten genau entlohnt werden. Von den Leuten besserer Klasse lebt einer vom anderen. Wer Geld hat, der gibt und erhält andere, und wenn er verschuldet ist, geht auch er und lebt vom Gelde eines weiteren. Wie bei den Tropenpflanzen eine auf der anderen wächst und die unterste erstickt wird, so geschieht es auch unter den Menschen.
Das ist alles, was ich – die ich der Republik zu Dank verpflichtet bin – sagen möchte.
Die Verhandlung begann um zwei Uhr nachmittags und dauerte bis sechs. Neben mir, zusammengedrückt und mit Tränen in den Augen, saß der alte Samuels, und neben ihm stand die braune Säule der Gerechtigkeit mit einem Knüppel. Auf einem hohen Stuhl, der meine Füße in der Luft ließ, saß der »Herr Dolmetsch«, wie ich angesprochen wurde, und hinter mir schnauften eher als atmeten Samuels' Frau und die nächsten Freunde und Zuhörer hinter dem käfigartigen Bau, der die »Galerie« bildete. Der Schreiber, ein weiterer Schriftführer und der Verteidiger waren links, der öffentliche Ankläger rechts vom Richter, und vor dem Fenster baumelte eine Kalabasse an einem Ast und schien mir zuzunicken.
Kurz erzählt drehte es sich um folgendes:
Samuels brachte jeden Abend Kohle nach der Stadt, und da er sie des Zolls halber um halbzwölf nicht mehr einführen durfte, stellte er das Fuhrwerk ein und begab sich zu Fuß nach Hause. Unterwegs traf er eine Negerin vor ihrem Hause stehend an und verplauderte sich mit ihr zehn Minuten. Während er hier müßig die Zeit vergeudete – Warnung! – betrat ein Mann (nach der ersten Aussage ein Soldat) das Geschäft eines Chinesen und begann auf die drei darin befindlichen Asiaten zu schießen. Der Besitzer wurde schwer verletzt, die anderen versteckten sich hinter dem Ladentisch und brüllten aus Leibeskräften. Der Lärm verscheuchte den Räuber, und als der Schutzmann schnell die Nachbarschaft durchforschte, fand er niemand außer Samuels. Er verhaftete ihn und schleppte ihn sofort zu den Chinesen, die vor Angst halb blind und halb taub waren, und die in dem Neger den Räuber zu erkennen wähnten. Auf diese Angabe hin wurde Samuels sofort ins Gefängnis geworfen, und da seine Frau sich schämte, ihn als Arrestanten öffentliche Arbeiten verrichten zu sehen, trug sie ihm täglich zweimal das Essen von Caledonia Road bis zur Bucht – eine gute halbe Stunde weit –, gab alles Geld, das sie besaß und das sie verdiente (Negerinnen verdienen am schnellsten und leichtesten durch »Liebe«) dem Verteidiger, der sich Zeit ließ und den Fall erst im Januar, mehr als drei Monate nach dem Vorfall, zur Verhandlung brachte.
Der öffentliche Ankläger zerzupfte Samuels und brachte allerlei Zeugen vor, die beweisen sollten, wie nichtswürdig der arme Mann gewesen, unter anderem einen Jamaikaneger mit einem Sprachfehler und völliger Unfähigkeit, seine Gedanken so herauszubringen, daß sie Kopf oder Schwanz hatten. Ich mußte ihn immer wieder unterbrechen, um seine sinnlosen Behauptungen, etwas zu Sinn verdichtet, dem Gerichtshof zu übersetzen. Er sagte »Fferd« bei jedem dritten Wort und berichtete in einer halben Stunde, was ein gesunder Mensch in zwei Minuten erledigt hätte – daß Samuels einmal, vor Jahren, für ein verlaufenes Pferd keinen Schadenersatz zahlen wollte, und daß man das »Fferd« später wirklich auf einem nahen Acker fand.
Heiter war auch der Chinese, der so verwirrt war, daß er auf jede Frage die verkehrte Antwort gab.
»Wie lange sind Sie in Panama?«
»Einundzwanzig Jahre.«
Verwunderung, weil der Mann jung aussah.
»Wie alt sind Sie?«
»Sechs Monate.«
Gelächter.
»Wann kamen Sie an?«
»Samuels guter Mann, unschuldig.«
Der Gerichtshof mußte ihn schließlich einfach wegjagen. Er stotterte und schwitzte zum Erbarmen, schlimmer als der Dolmetsch oder der Angeklagte.
Der Verteidiger wusch den Angeschwärzten rein, stellte die Stückchen, in die der Angeklagte zerlegt worden war, neuerdings zusammen und bewies, wie undenkbar das Verbrechen war. Um sechs Ahr wurde Samuels zurückgeführt, und ich stob die Treppen hinunter. Wenn meine Arbeit vorüber war, verschwand ich wie ein geölter Blitz. Es ist immer weise, als Frau schnell zum Rückzug zu blasen.
Auf Palo Seco.
Von La Boca (dem Mund) sah man über den hier auslaufenden Kanal hinüber nach der künstlichen Naosinsel und weiter hinaus auf den Golf von Panama mit den zerstreuten Perleninseln. Man sah auch die niedere, vorspringende Insel Palo Seco, die man nur mit ärztlicher Erlaubnis und unter strenger ärztlicher Aufsicht besuchen darf.
Mehr noch als auf dem Gemäuer Alt-Panamas liegen hier die toten Jahrhunderte wie versteinerte Wolken, die das Niederfallen vergessen und so – als Bahrtuch – dicht über der stillen Insel schweben. Wie Gerippe leuchten die weißen Rinden der Urwaldbäume aus dem eintönigen Grün und sogar die herrlichen tiefblauen handgroßen Falter bewegen sich langsam wie Sargträger. Wir sind auf der Aussatzinsel, dem Ort der Lebendigtoten.
Oben, auf der niederen Anhöhe, befinden sich die Wohnhäuschen, ein bescheidenes Lichtspielhaus, winzige Gärten, ein Tropenpark voll fremdartiger Vögel, die scheinbar verschleierte Stimmen haben. Die Kranken arbeiten im Garten oder sitzen auf bereitstehenden Bänken oder liegen – eine übelriechende faulende Masse – auf den Betten drinnen im luftigen Raum, aber wo sie auch sein mögen, immer geht der Tod unsichtbar an ihrer Seite, und immer krampfen sie sich an das Sein, während sie doch nach Erlösung schreien. Die Augen sind verschwollen und rot, die Zunge dick und ungehorchend, das Gesicht voll weißlicher oder violetter Flecke, und von den Händen und Füßen fehlen alle oder einzelne Glieder. Dieser Kranke hat die schuppige, jener die feuchte Art des Aussatzes, und in den Blicken aller brennt der Wunsch, nochmals von der Außenwelt zu hören. Kein Brief erreicht sie, und bei ihren Angehörigen rollt das Leben mit tausend neuen Anforderungen heran und läßt sie – die Verstoßenen – unberührt, als wären sie längst schon begraben.
Als ich einmal nach Toboga, der ersten der Perleninseln, fuhr, brachte man ein achtjähriges Mädchen nach der Insel der Geächteten. Es hatte eine feuerrote Warnungsschärpe um und saß in einem kleinen Boot, das angekoppelt wurde. Nichts Schrecklicheres, als das endliche Entgleiten dieses Bootes vor Palo Seco. Einsargen eines Menschen bei lebendigem Leibe …
Unten, in Panama, wo alle Rassen der Welt Schulter reiben miteinander, schreitet immer unsichtbar, doch allen bewußt, der vielartige Schauertod: die Pest, die Cholera, das gelbe Fieber, das in wenigen Stunden dahinrafft, der Aussatz, die tückische tropische Malaria, und vielleicht erklärt sich der glühende Lebenshunger dieser Menschen aus der Anwesenheit so furchtbarer Gefahren, ist doch schon Palo Seco allein ein wahres » Memento mori«.
Der schwarze Magier.
Ein Reisewerk, in dem nur die allerpersönlichsten Erfahrungen Platz finden können, erlaubt kein Beschreiben des verzweigten Aberglaubens, lernte ich doch über die Wudu-Opfer, den Indianerdämonenkurs, die Geisterbeschwörungen in Urwaldgrotten, den Liebeszauber der Negerinnen und so weiter genug, einen ganzen Band zu füllen, daher möchte ich nur ein einziges Abenteuer in Zauberkreisen anführen, das für mich immerhin schwerwiegende Folgen hatte.
Als Dolmetsch kam ich mit allerlei Leuten zusammen. Panama hat eine bedeutende Einwohnerzahl, doch die Europäer stechen heraus, und überdies zog mich meine Stellung sehr ins öffentliche Licht. Ging ich auf der Straße, so hörte ich gar oft hinter mir » el Señor interprete« sagen, was mich belustigte, denn niemand sah weniger nach Mann aus als ich. Die Richter nannten mich weit treffender: »Das Dolmetschlein«, und der Richter des fünften Kreisgerichtes lächelte immer, wenn er mich wie eine Elster oben auf dem schwarzen Würdenstuhl sitzen sah, von dem ich, so oft ich sprach, wie ein Kind heruntergleiten mußte.
Da sich jeder Verbrecher gewissermaßen als mein Freund betrachtete, ich auch sehr häufig Privatübersetzungen erhielt, so kam ich unter anderen mit einem Columbianer zusammen der – flüchtig betrachtet – das unscheinbarste Ding der Welt war und eine ungeheure Abneigung gegen das Waschen hatte. Da er auf seinem Rad stets einen tadellos weißen, mit Duftwasser besprengten Hund mitführte, erlaubte ich mir die Frage, warum er diese lobenswerte Reinlichkeit nicht auf sich selbst ausdehne, und erfuhr, daß dies seiner Männlichkeit Abbruch tue. »Es schwächt meine Liebeskraft,« meinte er. Seit jener Zeit war es immer mein Verlangen, ganz Südamerika einmal täglich unter Wasser zu setzen. Das würde den Leuten seelisch und körperlich wohltun. Ob die Engländer eine so beherrschte, großartige Nation sind, weil sie sich so viel waschen? Es lebe das Wasser!
Von Zeit zu Zeit brachte mir jener Columbianer von starkem Geruch und unschuldsvollem Aussehen Uebersetzungen, die ich ihm billig ausführte. Er erzählte mir eine Menge vom Urwaldleben, und seine Kenntnis der Zaubergetränke war überwältigend. Er konnte Liebestränke brauen, Zauberlampen zusammenstellen, Menschen zur Trunksucht verleiten oder sie davon heilen, aus dem Kaffeesatz wahrsagen, jemand vergiften, daß er einfach an Herzschwäche starb, und verschiedene wertvolle Dinge dieser Art … Ich hörte ihm gern zu, und Frau M. erlaubte ihm zu kommen, wenn sie sich auch in solchen Fällen – zur Schonung der Geruchsnerven – auf die Hinterveranda zurückzog.
Eines Tages sprang er wie gewöhnlich wieder im ganzen Raume auf und ab und plauderte über Zaubersachen, die ich, da dies mein Lieblingsstudium war, lebhaft verfolgte und aufschrieb. Allmählich kam er indessen auf das Leben selbst zu sprechen, vom Glück der Liebe und all dem Kram, von dem ich ohnehin die Ohren übervoll hatte. Zu meiner inneren Ueberraschung begann ich zu denken, daß er ja recht habe, daß man vom Dasein nichts besitze als gerade diese Sinnenlust, daß man um jeden Preis alle Erfahrungen auskosten müsse, und erst, als neben diesen Gedanken ein noch tieferes Empfinden in mir gleichsam sagte, »wie seltsam fremd du heute denkst«, wurde es mir klar, daß mich der Zauberer hypnotisierte, und zwar von hinten und ohne äußere Behelfe. Alle Hochachtung! Ich setzte indessen Gegenstrom ein und empfahl mich. Einen gehässigeren Blick habe ich selten in Menschenaugen gesehen …
Nun hatte ich, obschon ich in die Zone gezogen war, teils aus Vorsicht, um nie wieder in eine abhängige Stellung zu geraten, teils um nicht in der Kanalzone zu leben, wenn ich Dolmetsch von Panama war, das Zimmer neben Russin und Trompeter beibehalten und arbeitete da über Mittag. Ich nahm ein kleines Futterpaket aus der Zone mit und legte es, mit schriftstellerischem Ordnungssinn, auf mein Bett. Wollte ich es aber zu Mittag essen, so wurde mir sonderbar übel, und ich ließ es liegen. Auch hegte ich immer den Wunsch, zu schlafen, sobald ich mein Zimmer betreten hatte, überwand indessen das Begehren, weil ich meist zu malen oder zu übersetzen hatte. Eines Tages sagte Frau M. zu mir:
»Kind, was ist Ihnen? Sie sehen so elend aus und essen nicht mehr. Was haben Sie?«
»Mir ist nicht schlecht; ich bin nur ewig müde, am meisten unten in meinem Zimmer.« Und ich beschrieb ihr meine Gefühle beim Betreten des Raumes.
Frau M. war seelengut, doch teilte sie mit anderen Amerikanern das starke Vorurteil gegen alles, was nicht englisch sprach und weiß war. Sie schöpfte sofort Verdacht, begleitete mich hinab und durchstöberte den Raum mit der Miene eines Geheimpolizisten. Wir entdeckten den Diebstahl mehrerer an und für sich geringwertiger, von mir oft berührter Sachen, wie auch das Verschwinden meiner Handtasche, in der ich eine Gedichtsammlung aufgehoben hatte, deren Verlust mir besonders naheging. Erst als wir das Bett machten – es hatte nur zwei Bettlaken und ein Kissen darauf, – bemerkten wir, daß ein feines Pulver darüber hin verstreut war. Es war durch das Abnehmen des Bettzeugs zum Teil verschüttet worden, doch war genug vorhanden, um uns zu überzeugen, daß es eine unangenehme, betäubende Wirkung besaß. Da packte Frau M. meine Koffer und trug alles sofort nach Balboa mit.
Natürlich zeigte ich den Diebstahl bei Gericht an. Oeffentlicher Dolmetsch sein und bestohlen werden wie ein unbekannter Nigger! Es waren auch alle Beamten Aug' und Ohr für das Dolmetschlein, indessen wurden die Uebeltäter nicht gefunden. Aus der Anzeige erwuchs jedoch ein heiteres und ein tragisches Erlebnis.
Da ich ausgeraubt und fast getötet worden war – obschon ich vermute, daß sich der schwarze Magier beim Trompeter eingeschlichen, durch das Gitter das Pulver geschüttet und gehofft hatte, mich nachts im Schlaf äußerst geschwächt zu überfallen, nicht ahnend, daß ich nie in Panama übernachtete, – wollte ich das Zimmer ohne Kündigung verlassen, und Frau M. gab mir darin recht. Gerade als ich die Nützlichkeit eines Auszugs erwog, erschien ein Schutzmann. Der kleine Russe verbarg sich unter dem Bett, seine Mutter wurde unhörbar und stellte sogar den Zwiebelbraten vom Herd; der Trompeter verstummte, der Hausknecht verdunstete, und meine Wirtin verschwand in die innersten Gemächer. Was ein übles Gewissen alles vermag! Das Komische an der Sache sah ich allein; denn der Schutzmann kam keineswegs um den Diebstahl zu erforschen; er war »Mann wie alle Männer« und nahm die Gelegenheit beim Schopf, mit einer guten Ausrede zu mir zu kommen und vorsichtig anzufragen, ob ich mich – so allein – nicht nach einem Schutz sehnte. Wer schützt bester als ein Schutzmann?
Ich war von bodenloser Dummheit und ebenso tiefer Höflichkeit. Wie ich ihn anlächelte und nett auf ihn einsprach und ihn für den Diebstahl interessierte, wie ich seine Anspielungen nicht begreifen konnte. Rein vernagelt! Zum Schluß begaben wir uns vereint die Treppe hinab. Das Haus war ein Sarg: leer und still. Erst als wir zum Tore hinaus waren, blies der Trompeter die Arie, die im sündigen Panama dem deutschen »Es ist im Leben häßlich eingerichtet« entspricht.
Das zweite Nachspiel überzeugte mich, daß man als Frau in Tropenstaaten nicht leben konnte, wenn man nicht an kaputten Nerven vorzeitig ins Grab zu klettern beabsichtigte. Ich saß in der Bücherei und machte Vorstudien für Mittelamerika, als wieder ein Schutzmann (sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen) auftauchte und mich mit feierlich ernsten Gebärden bat, in den Hof hinaus zu treten, weil er mir in der Diebstahlsgeschichte Mitteilungen zu machen hatte. Ich tat wie geheißen, und er erzählte mir im gleichen Flüsterton des Vertrauens, daß wir den Verbrecher nie finden würden (eine Ansicht, die ich lebhaft teilte), und daß mir nur ein Wesen in ganz Panama dies zu sagen vermöge. Wer? Ein Obimann (ein Negerzauberpriester). Obimänner hatte ich schon eine ganze Menge kennen gelernt, und überdies war ich sicher, auch durch zehn Obimänner nichts zurück zu erhalten, und in schonender Weise teilte ich der Säule der Gerechtigkeit diese meine Ueberzeugung mit. Die Säule bat indessen so beweglich, ihn doch einmal zu solch einem (Manne zu begleiten, daß ich bedingungsweise einwilligte und erklärte, einmal kommen zu wollen, wenn es meine sehr in Anspruch genommene Zeit erlauben würde.
Er reichte mir eine Karte mit seinem Namen und bat, mich um sieben Uhr an der Ecke erwarten zu dürfen. Wir trennten uns voll ausgesuchter Höflichkeit, und ich lächelte, weil eine Frau am sichersten lächelt, wenn sie einen Wunsch nicht zu erfüllen geneigt ist.
Am Nachmittag trat ich bei meinem Photographen ein und zeigte ihm die Anschrift, indem ich seine (Meinung einholte.
»Ich glaube zu wissen, wo das ist!« erklärte er, »werde mich jedoch selbst hinbegeben, um sicher zu sein!«
Ich dankte ihm, und am Abend, während wir aus der Kiste in der Dunkelkammer standen und entwickelten, sagte er sehr nachdenklich:
»Die Sache ist recht gefährlich für Sie. Das Haus, das Sie besuchen sollen, wird allerdings von ihm bewohnt, liegt indessen dicht am Eingang zur Straße der roten Laternen (das Reich der Freudenmädchen) und Sie müssen wissen, daß die Frau, die in jener Straße angetroffen wird – aus was immer für einem Grund sie dahin geraten ist, ein Jahr lang darin bleiben und … ihre Tätigkeit ausüben muß. Das kann von der Polizei erzwungen werden.«
Und dazu hatte mich ein Schutzmann der Republik – mich, eine beeidete Amtsperson – verleiten wollen …
Schneller als sonst verließ ich von da ab die verschiedenen Gerichtsgebände und faßte traurigen Herzens den Entschluß, bald die sehr günstige Stellung aufzugeben und weiterzureisen.
Potpourri.
Täglich ging ich von Balboa nach Panama an der hohen Mangogruppe kurz vor dem Halbweghaus und dem berüchtigten Coco Solo vorüber. Erst war das junge Laub rotlila gewesen, dann hellgrün, nun standen die Blätter wie grüne Dolche nach allen Richtungen, und an den langen Fruchtfäden hingen die goldgelben, oft rötlich angehauchten Früchte nieder. Wer wollte, durfte sie auflesen, doch bei vielen Leuten brachen die Mangogeschwüre aus. Der Geschmack ist gut, doch stören die Fäden, die an den Zähnen hängen bleiben.
Ich hatte alle Tropenfrüchte und Gemüsearten kennen gelernt, von der gelbfleischigen Yucca bis zum rötlichen, moorrübenartigen Badu, am liebsten aber aß ich die Brotfrucht in Scheiben geschnitten, gebraten und mit Butter übergossen. Wir hatten indessen nie Kuhbutter, sondern Kokosfett, weil sich dieses besser hielt. Auch nur Blechbutter (aus Büchsen), weil sich frische Butter selbst auf Eis nicht gut halten wollte, weshalb wir im Scherz riefen:
»Die Kuh auf den Tisch!«
Das Tropenrind ist nämlich sehr mager und gibt fast keine Milch. Selbst das Fleisch ist zäh und unschmackhaft, und die Stiere sind lange nicht so wild wie in Europa. Die Tropen wirken drückend auf Menschen und Vieh. Bei den Menschen geht das leicht in Arbeitsunlust über.
Wunderbar waren die Mainächte. Man war in der sogenannten Trockenzeit (es regnete täglich einmal, während sonst drei bis vier Gewitter niedergingen), und die Kanalzonewiesen waren von Leuchtkäfern derart besucht, daß es wie ein Sternenfall aussah. Oft stand ich vor dem mächtigen Golf und beobachtete das Meerleuchten; hinter mir, als leuchtender Regen, gingen die Glühwürmchen nieder, und über mir funkelten die Sterne wie hinter einem Schleier von leicht glänzenden Tränen. In der Ferne, scharf und schwarz Umrissen, zeigte sich der berühmte Pik von Darien …
Und unbemerkt, von kleinen Abenteuern durchbrochen, glitt der Mai in den Juni. Samuels war nach langen Verhandlungen freigesprochen worden. Unzählige Verbrecher hatten neben mir gesessen und mir ihr Leid vorgeklagt. Um Geld und Wissen reicher dachte ich an die Abreise.
Von meinen Gerichtserlebnissen möchte ich nur noch zwei hervorheben: Zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, hatten zur Karnevalszeit, der wildesten und zügellosesten selbst in dieser Stadt der Laster, vierzig Dollars gestohlen und in Knallbonbons und Feuerwerk verpufft. Der Knabe war acht, das Mädchen, eine kleine Negerin, zehn Jahre alt. Diese Kinder wurden mit gewöhnlichen Verbrechern eingesperrt und waren monatelang in Untersuchungshaft.
Ein anderes Mal hatte ich in der Vorverhandlung zwei kleine schwarze Freudenmädchen vor mir. Sie waren erst einen Monat im Viertel der roten Laternen und waren dreizehn und vierzehn Jahre alt. Als sich der Richter auf einige Minuten entfernte, tat ich, was ich sonst nie tat, ich stellte eine persönliche Frage an die Angeklagten. Sie waren so kindlich, hatten so gute große Glotzaugen in runden, ausdruckslosen Gesichtern, daß ich forschte, wie es ihnen im Freudenhaus gefiele. Vielleicht schossen mir Rettungsgedanken durch den Kopf; jedenfalls überraschte mich die Antwort:
»So – so!« meinten sie und zogen die Lippen krumm.
Sie hatten einem chilenischen Matrosen die Augen verbunden, während der würdige Zuhälter die Uhr und die Geldtasche aus den über dem Bett hängenden Kleidern zog. Später kam der Mann vor mich. Es kostete mich da zum ersten Mal Mühe, gegen einen Menschen vollkommen unparteiisch zu sein und lediglich meiner Pflicht zu genügen. Am liebsten hätte ich ihn mit Fußtritten die Treppe hinabgerollt. Aber ich war beeideter Dolmetsch und saß auf meinen Gefühlen.
Die Nordamerikaner, die vor mich gebracht wurden, waren immer in einem Zustand kochender Wut. In den Vereinigten Staaten war das Trinken verboten, und daher holten sie in Panama das Verbotene nach. Sie waren immer todbetrunken, so daß sie gar nicht merkten, was mit ihnen vorging. Meist wurden ihnen im Kerker die Schuhe vom Leib gestohlen, und, was sie am meisten entrüstete, war der Umstand, daß sie unverköstigt blieben. Ein junger Mann war in einem Wagen mit zehn Negerinnen ausgefahren, und hatte erst wahrgenommen, daß alles nicht gewesen, wie es sein sollte, als er auf offener Landstraße im Staub und mit einem Loch im Kopf erwachte. In der Regel wurde eine hohe Kaution erlegt, und die ließ man dann verfallen. Es war dies, wenn nicht die billigste, so doch die einfachste Lösung der Sache. Ein sehr hoch bezahlter Advokat wusch in anderen Angelegenheiten die Amerikaner des Nordens rein. Es ging aber nie ohne hohe Geldverluste ab. Die »Gringos« sind schwer verhaßt, und wenn sie einem Spanisch-Amerikaner in die Hände fallen …
Bevor ich Panama verließ, sah ich die beiden Freudenmädchen noch einmal. Das ältere war durch einen Schutzmann schwanger gemacht und hatte ein verwahrlostes, gemein gewordenes Aussehen. In den Zügen des kleineren Kindes lag hilflose Trauer.
In der Höhe von Veraguas.
Sie waren alle sehr gut gegen mich gewesen, und meine Seele war voll Dank; auf den tiefsten Tiefen meines Denkens aber lag der angeschwemmte Unrat, der mir zugeworfen worden war, und die Bitterkeit, daß der Mann im Weibe nur den Gegenstand seiner flüchtigen Lust und nicht ein Wesen sieht, dem er sich mitteilt, mit dem er des Lebens Wechselfälle verständnistief miterlebt, das er seiner Eigenschaften und Eigenheiten – kurz, des Gesamtbildes halber lieb hat, diese Bitterkeit ist nie wieder von mir gewichen. Sie hat mir etwas überlegen Kühles verliehen, das mich unberührt durch alle Gefahren gleiten läßt; denn um das Spielzeug des Augenblicks zu sein, dazu bin ich mir zu gut, aber es hat das in mir gebrochen, was unerläßlich ist, um Liebe, irgend eine Art der Liebe, zu empfinden. Heute steht zwischen der physischen Hülle eines Mannes und mir der unsichtbare Schutzkäfig, wie man ihn sichtbar und aus Gußeisen in Peru findet. Durch diesen Kasten hindurch beschaue ich mir leidenschaftslos seine Seele. Durch ihn kann ich aber auch nie den Weg zu einem Gefährten finden …
Es hat im Leben alles seine Licht- und seine Schattenseiten. Dies gehört nicht zu einem Reisewerk. Mein Bericht ist indessen nicht allein ein Anführen von Blumen, die ich gemalt und Häusern, die ich bewohnt, oder Ländern, die ich bereist habe, sondern er zeigt auch die Wirkung, die eine solche Reise auf das Gemüt einer Frau ausübt, und ist eine Warnung. Frauen, die ein gesundes, alltägliches und folglich glückliches Leben genießen wollen, bleiben am besten daheim oder wenigstens in Europa, und vielleicht lernt durch meine Offenherzigkeit einmal ein Mann, daß die Methode des Troglodyten, der seine Gattin mit der Keule niederschlug, um sie zu besitzen, auf die Frau des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr betörend (oder betäubend) wirkt.
Ich fuhr mit einem Dampfer der Pacific Mail, der vorwiegend Frachten mitführte, und nur eine erste und eine dritte Klasse hatte. Wie gewöhnlich fuhr ich in der Dritten, und wie damals, bei meiner Abfahrt von Europa, folgten mir Blitz und Donner, war ich umgeben von Araberinnen. Eine Lehrerin aus Jerusalem wanderte mit ihrer Mutter nach Las Honduras aus, und sie hing an mir wie eine Klette. Ich war vom Direktor der Veloce empfohlen worden, und als ich mich zum nie verlockenden Dritteklassefraß hinabbegab, teilte mir der erste Offizier mit, daß ich etwas von der Kost der Ersten erhalten würde. Obschon ich, wie die übrigen, in unserer Schlafkabine essen mußte, hatte ich doch besseres Gedeck und erhielt verdaulichere Sachen. Die Frau eines Negers, dessen Freund Schiffskoch war und die nach San Francisco reiste, war meine Tischgenossin und schlief auch unter mir. Sie hatte ein Töchterchen namens Beryl, schwarz wie eine Schornsteinbürste und ebenso frisiert. Mutter und Kind waren so sauber, daß ich mein Schicksal leichter ertrug.
Unter mir lagen drei Araberinnen, in der einen Ecke ein Wrack aus mehreren Rassen zusammengegossen, und vor der Kabine lagen nachts die Matrosen in so wenig Kleidung, wie die strenge amerikanische Schiffsbehörde gestattete. Dicht daran grenzten die Maschinenräume, und auf der anderen Seite die Küchen. Wenn man berichtet, daß wir ohnehin eine Lufttemperatur von 40 Grad Celsius im Schatten hatten, wird man mir glauben, daß ich morgens als nasser Klumpen mit elendem Gefühl aufstand.
Der Schiffsarzt – diese edlen Herren haben oft nicht einmal das Gehirn einer Laus, vermutlich der Grund, warum sie Schiffsärzte sind – riß mein Augenlid hoch und erklärte mich für blind. Da ich später wenigstens sechs Stunden täglich auf Deck schrieb, hat er sich hoffentlich überzeugt, daß ich ein Paar gutsehender Augen hatte. Auch wollte er mich impfen, was ich gewaltig übelnahm. Dreimal in einem Jahre geimpft zu werden, ist mehr als Fleisch und Blut – jedenfalls ein Frauenarm, der nicht wie das Gesicht eines reichsdeutschen Studenten aussehen soll – ertragen kann.
Italiener sind reizend – siehe den »Bologna«! – aber schmutzig sind sie, Gott vergebe ihnen! Auf der Pacific Mail waren genug unerläßliche Orte, und sogar besonders für Frauen bestimmte, und alle rein! Die Betten hatten Kopfkissen und weiße Bettlaken, und man hatte ordentliche Tische, von denen man essen konnte, ohne einseitig auf einem Taupfeiler schaukeln zu müssen.
Wir fuhren an der Küste von Veraguas vorbei. Da hausen sehr viele wilde Indianer, und man kennt noch Teufelsbeschwörungen eigenster Art. Es geht da fast wie bei einer spiritistischen Sitzung zu, und allerlei grauenhafte, mattschimmernde Schemen zeigen sich an den Felswänden der Grotte. Hier vernimmt man auch schon das merkwürdige Brüllen der Brüllaffen, das den Uneingeweihten fürchten läßt, es befinde sich ein Löwe in der Nähe.
Costa Rica.
Ich rollte aus dem Bett wie eine Kugel. Je nasser, desto besser, denn da erträgt man die Hitze leichter. Ein amerikanisches Frühstück aus Eiern, gebratenem Speck, Butterbrot, Pfannkuchen, Kartoffelscheiben und Pflaumenkompott bestehend, brachte mich neuerdings zu Kräften, und ich kletterte auf Deck, um mir das neue Land zu betrachten.
In Costa Rica, besonders an der Ostküste, sind die Bewohner von lichterer Hautfarbe als in den anderen mittelamerikanischen Republiken, und die Hauptstadt, San José, hat ein besseres und angenehmeres Klima als die übrigen Städte von Bedeutung in jener Gegend. Herrliche Berge bilden einen malerischen Hintergrund, obschon ihr vulkanischer Charakter eine unleugbare Gefahr bildet.
Hauptausfuhr sind Kaffee und Bananen. Zehn Millionen Hände (so nennt man in den Tropen die Dolden oder Zweige der Bananen) werden jährlich versandt und eine einzige »Hand« hat oft 60 bis 100 Früchte. Die Schiffe der United Fruit Company kommen von Panama, laufen Puerto Limon an und bringen Bananen, Ananas, Mangos und andere Tropenfrüchte in vier Tagen nach New Orleans, von wo sie nach allen Teilen der Vereinigten Staaten verschickt werden. Die Schiffe, die eine große Zahl praktischer Eisschränke oder richtiger Eiskammern mitführen, bringen die Obstarten der gemäßigten Zone zurück nach den Tropen.
Gegen elf Uhr vormittags fuhren wir an den Herraduraerhebungen vorbei tiefer in den Golf von Nicoya, und ich erkundigte mich rasch bei meinem Bordschutzgeist, ob ich ans Land gehen dürfe. Er riet mir, zuerst etwas zu essen, aber ich überlegte, daß man ja täglich essen, keineswegs jedoch jeden Tag einen neuen Hafen anlaufen könne, und so einigte ich mich hinsichtlich der Fahrt vom Schiff zum Land mit einem Cholo und sprang in das Boot »Europa«. Das hatte heimatlichen Klang.
Puntarenas (Sandspitze) soll ein ungesundes Klima, besonders für Sänger, haben, die leicht die Stimme verlieren, so lange sie da verweilen, doch bin ich ja keine Sängerin, und überdies bedurfte ich, die ich so einsam reiste, der Stimme kaum zum Stellen notwendiger Fragen.
Die niedrigen Holzhäuser stehen zu beiden Seiten auffallend weiter, sandiger, aber mit gutem Fußsteig versehener Straßen, und die Turmspitze der kleinen Kirche lugt malerisch aus dem Grün der Kokospalmen. Das Grand Hotel Imperial ist groß für den Ort, denn unter Blinden ist der Einäugige König.
Nachdem ich die Markthalle durchwandert und auf stürmisches Drängen hin Sapodillas gekauft hatte, die nach nichts schmeckten, obschon man mir beteuerte, ich würde nach dem ersten Dutzend noch zwei weitere essen wollen, wanderte ich aus dem Ort hinaus und befand mich bald auf einem engen Pfad, der durch Unterholz führte. So oft ich Schritte vernahm, verbarg ich mich. Meine Erfahrungen hatten mich gewitzigt. Besser war's, einer möglichen Gefahr auszuweichen, als sich in einen Kampf mit irgend einem sinnlich erregten Manntier einzulassen. Darauf ging es ja doch in den meisten Fällen hinaus!
Vor Tieren hatte ich keine Angst, obschon es weder an Tausendfüßlern noch an Giftschlangen fehlt, und als ich aus dem tiefen Grün das spitze Gesichtchen eines Uistiti oder Titi vorblicken sah, fühlte ich mich von meinem Ausflug vollkommen befriedigt. Diese kleinen Affen Mittelamerikas sind wirklich niedlich. Die Heul- und die Kapuzineraffen mit ihrem dunklen Fleck auf dem Scheitel bekommt man viel schwerer zu sehen, aber prächtig war es schon, den Falterreichtum zu genießen und den Flug eines grellroten Kardinals zu beobachten. Ich verhielt mich lange ganz still, um die Tierwelt zu beruhigen, und da huschten die grünblauen Eidechsen bald ganz unverschämt über meine Schuhe, es zeigte sich auf niederem Ast ein wunderschöner Vogel mit tiefgelber Brust, weißem Köpfchen, schwarzen Flügeln und dunklem Schwanz. Eine haarige Spinne ließ sich an sonneglitzerndem Faden nieder und schlich sich unendlich langsam an einen grünschillernden Käfer heran. Im Dickicht hinter mir raschelte es; wohl eine Schlange. Dieses Geräusch weckte mich, erinnerte mich daran, daß unser Schiff nur einen Tag lang hier liegen bleiben sollte.
Die Bewohner von Puntarenas sahen mir wie dem berühmten Lindwurm nach, denn die meisten Durchreisenden finden es nicht der Mühe wert, ans Land zu gehen. Die Bootsleute der »Europa« begegneten mir und grinsten mich wie alte Bekannte an und riefen » Hallo, Miss!«, weil sie alle weißen Frauen für Amerikanerinnen halten.
Fast am anderen Ende des Ortes sah ich eine braune Frau in einem Gärtchen. Ich blieb am Zaune stehen und lächelte. Sie lächelte zurück. Als sich mein Lächeln vertiefte, trat sie näher und begann zu sprechen, lud mich ein, in das Hänschen zu kommen, und erzählte von Land und Leuten. Sie zeigte mir eine Art Walker aus Lavastein, mit dem sie auf einer dunklen Lavaplatte Mais und anderes Getreide so lange walkte, bis es ziemlich feinmehlig geworden war – jedenfalls fein genug, um daraus einen flachen Kuchen zu formen, der auf ungefetteter Pfanne über nicht zu starker Glut gebacken wurde. Es war das für die ärmeren Leute der billigste Brotersatz.
Im Garten, in den sie mich später führte, hatte sie einen Marañonbaum, von dem die tiefgelben, auf einer Seite sehr einladend roten Früchte von birnenartiger Gestalt, doch mit dem grauen Kern am äußersten Fruchtende eben reifend niederhingen. Auch Tamarindenbäume, eine Chirimoya und anderes Obst. Dicht an der Holzwand reiften die violetten Eierpflaumen oder Berengenas, die ein sehr gutes Gemüse darstellen.
Sie schenkte mir von diesen ihren Besitztümern je eine Probe, und als ich – schon im Weggehen – noch einmal zurückgrüßte, trat sie auf die staubige Straße heraus und rief mir nach:
»Grüßen Sie mir Ihre Mutter, kleine Señorita, denn auch ich habe Kinder unter dem Herzen getragen und ahne, wie es der zu Mute sein muß, die nun allein daheim weilt und nicht weiß, wo sich ihr Kind befindet.«
Nach Sonnenuntergang fuhren wir wieder hinaus in das offene Meer.
Nicaragua.
Ein neuer Fahrgast war an Bord gekommen in Costa Rica – eine braune Frau mit zwei Kindern und einem Chinesen, der sehr alt und der überdies auch ihr Gatte war. Mittelamerikanerinnen heiraten gern chinesische Kaufleute, weil sie bei ihnen nicht schwere körperliche Arbeiten zu verrichten brauchen und nur die Verpflichtung haben, viele Kinder zu gebären, eine Pflicht, die sie nur zu gern erfüllen. Nun fuhr diese gelbe Menschruine in ihr Land zurück, vermutlich damit die Gebeine in der geliebten Heimaterde ruhten, und nahm Frau und Kinder in das fremde Land. Ich bangte um das Schicksal der gutmütigen und nicht üblen Frau, die da in ein feindliches Land voll fremder Sitten einer sehr fraglichen Zukunft entgegenfuhr. Sie hatte eine belustigende Art, vor jeder Rede immer »Wenn Gott will« zu sagen und, wenn sie überrascht wurde, » Ave Maria purisima« auszurufen. Ihr Söhnchen, der kleine Jesus, trug ein Schnellfeuerhöschen und heulte immerzu. Das Mädchen war braver.
Die Dampfbarkasse, die den neunzigjährigen Herrn Holtmann, den reichsten Mann des Landes, aufs Schiff gebracht hatte, trug mich ans Land. Ich war etwas scheu, denn Nicaragua sollte das wildeste Land Mittelamerikas sein, und ich hatte noch Peru frisch in der Erinnerung. An Land aber wollte ich. Man studiert weder Menschen noch Pflanzen vom Deck aus.
Nicht ein Reisender der ersten Klasse, geschweige denn der dritten fuhr ans Land. Die meisten Menschen fahren wie die Reisekoffer durch die Welt, und die größte Zahl der sogenannten Touristen, die behaupten, alles gesehen zu haben, liest alles in einem Buche nach und sitzt dann einfach im Gasthaus und schlürft Eiskaffee oder nimmt Whisky-Soda. Ich will gar nicht leugnen, daß es angenehmer ist, als in der Tropenglut herumzulaufen. Man redete mir zu, erst das Mittagsmahl abzuwarten, doch ich erwiderte, daß man im Leben täglich essen, nicht aber täglich ein neues Land betreten könne, und so stand ich um zehn Uhr früh schon am Strand des lieblichen San Juan del Sur, einer so stillen, tiefgrünen, sonnigen Bucht, wie ich nie wieder eine angetroffen habe.
Mein Erscheinen im Orte erweckte, der Seltenheit solcher Gäste wegen, entsprechendes Aufsehen, und als ich auf dem freien Marktplatz einen geschnitzten Flaschenkürbis kaufte, hatte ich gleich einen Kreis junger Nicaraguaner um mich, die mir berichteten, daß die » Señoritas« von San Juan del Sur diese Schnitzarbeiten ausführten. Köchinnen verließen den Herd, um mich anzustaunen, faule Hausfrauen, die, im Liegestuhl versunken, einen Pantoffel mit der großen Zehe wippten und sich fächelten, erwachten zu Tätigkeit und beugten sich über die niedere Holzbrüstung der braunen Holzveranda. Unendlich armselig wirkten diese Bauten nach den schönen Panamakanalhäuschen.
Der Kirchturm steht getrennt vom eigentlichen Bau, und um beide hat der Meßner aus eigener Tasche einen Garten angelegt, in dem viele Tropenblumen und besonders die »Vulkanblume« blühen. Sie ist weichrosa und heißt im Osten die »törichte Jungfrau«. Sie erinnert am ehesten an unseren Flieder. Die Poinciana regia oder Schirmmimose war in Blüte, und daher brachen die scharlachroten, blattlosen Riesenkronen wie Feuerschirme aus dem umliegenden Grün, während aus dem gelbweißen Sande die entflatterten Blüten einen herrlichen Teppich bildeten, und hier, an diesem verträumten Strand, der hügelumkettet war, sah ich auch zum ersten Male den berüchtigten Manzanillo oder Giftbaum, unter dem einzuschlafen schon das Verderben sein sollte. So arg ist es nicht, aber es ist wohl möglich, daß die mächtige Tropensonne die Früchte und Blätter so sehr erhitzt, daß die Feuchtigkeit (also der Giftsaft) in kleinen Mengen verdunstet und dadurch von dem unter dem Baume Ruhenden tatsächlich eingeatmet werden kann. Die Frucht ist in der Tat außerordentlich giftig, und viele Morde werden mit dem Saft des grünen, harmlos scheinenden Apfels ausgeführt. Man erlaubte mir nicht einmal, aus wissenschaftlichem Interesse einen Manzanillo mitzunehmen, obschon die hellgrüne Frucht in Mengen unter dem steifen dunklen Blattwerk hervorschaute und leicht erreichbar war.
Ich durchwanderte die ganze Umgebung und schlug auch den Weg ein, der zur Trockenzeit hin zum Maraguasee führt, der aber nun ein Meer von Schlamm mit einigen für Fußgänger oder Reiter verwendbaren Furchen war. Als ich indessen Pferdehufschläge vernahm, verbarg ich mich im nächsten Gestrüpp, bis der bösartig aussehende Reiter verschwunden war. Ich hatte nicht die Absicht, die peruanischen Erfahrungen zu wiederholen. Auch trug ich nun einen vergifteten Dolch bei mir, so daß ein Abenteuer nicht nur mir teuer zu stehen gekommen wäre …
Wenn unter Tieren, trage Klauen!
Auf dieser Landstraße nach Rivas traf ich bei einer Schmiede viele Frauen und näherte mich daher dem Gebäude. Sie hatten einen großen grauen Affen und luden mich ein, ihn anzuschauen. So lieferte er uns genug Gesprächsstoff, und als wir warm geworden waren, erzählten sie mir viel von den dortigen Verhältnissen und etwas über den Aberglauben der Eingeborenen, über den Mischlinge stets erhaben scheinen und von dessen Wahrheit sie innerlich dennoch fest überzeugt sind.
Als ich später durch das Dorf wanderte, rief man mich in viele Häuser, zeigte mir da geschnitzte Kürbisse, dort einen Hirsekuchen und oft Zainoschweinchen, seltsame Tierchen, die an ein Schwein erinnern, aber dicht und steif behaart sind und lange scharfe Krallen an den Zehen haben, mit denen sie gut klettern. Sie lassen sich leicht zähmen. Da sie indessen sehr schnell wachsen und mit Vorliebe auf Kasten, Tür und Tisch klettern, malte ich mir die Freude meiner künftigen amerikanischen Hausfrau über solch ein »Schoßschweinchen« aus und lehnte dankend ab.
Nicaragua ist ein außerordentlich reiches Land, in dem jedoch ein Ausländer (ich kannte viele, die es versucht hatten, in Panama) kein Fortkommen findet. Die Mischlinge beuten ihn aus, stellen sich liebenswürdig und scheuen vor keiner Niedertracht hinter dem Rücken zurück, trachten ihm nach Gut und Leben, und von den Indianern wird er begreiflicherweise ebenso stark und offener gehaßt. Sollte ihm Erfolg trotz aller Hindernisse blühen, so findet die Regierung immer ein Mittel, ihn seines Geldes zu berauben, ehe er das Land verläßt, und nur wenigen Leuten ist es gelungen, festen Fuß zu fassen. Die Nordamerikaner aber kamen in Massen und schoben sich mit der kalten rücksichtslosen Tatkraft, die ihnen eigen ist, vor, bestachen und blendeten mit ihrem Gelde und erreichten es schon nahezu, in den Besitz der Ländereien um die Seen zu kommen, da sie den Bau eines zweiten und ihnen besser gelegenen Kanals zwischen Atlantik und Pazifik planen; denn der Panamakanal könnte mit wenigen Bombenwürfen aus der Luft unbrauchbar gemacht werden, und ist das geschehen, so muß die Flotte um Kap Horn den Weg nach Hawaii und den Philippinen einschlagen und käme in diesem Fall zur Verteidigung selbst Kaliforniens längst zu spät.
Erst in Corinto brach der Haß gegen die Amerikaner so recht durch, und die einfachsten Frauen klagten über die geheime Macht, die Lebensmittelpreise hinauftrieb und den Einfluß des eigenen Volkes erbarmungslos unterdrückte. In der Tat kann man in ganz Nicaragua sehr gut mit nordamerikanischem Geld zahlen.
Leon ist die Stadt der Kunst und des Wissens. Granada erfreut sich guten Rufes, und erst dann kommt Managua, die Hauptstadt. Das Land verdankt seinen Namen dem einstigen Häuptling Nicarao.
Es gibt in San Juan nur eine zweiklassige Volksschule, und wer mehr wissen will – doch wenige sind so neugierig – muß einen größeren Ort aufsuchen.
Corinto.
»Wir sind in einem Hafen.«
Die Negerin, ihren schwarzen Edelstein im Arm, rief es, und ich fuhr vom Lager auf wie ein Soldat, der im Dienste eingeschlafen ist. Schweißtriefend kroch ich aufs Deck. Der Baderaum lag am äußersten Ende des unteren Schiffsteils und reichte nicht ganz bis zur Schiffswand, so daß irgend ein vorwitziger Matrose sich den Spaß machen konnte, plötzlich über die Scheidewand zu spähen. Das machte das Bad weniger erquicklich, als es bei Seewasser ohnedies schon war.
Vom Schiff aus überrascht Corinto. Die Häuser sind nicht länger ebenerdig, haben Bogengänge und wirken ganz ansehnlich, doch geht man erst den Hafendamm entlang, so schwindet das Trugbild, und man steht mitten in einer echten, drittklassigen Tropenstadt mit ebenerdigen Holzhütten, Gärten, aus denen Kokospalmen und Icacos ragen, sumpfige Gräben, mit Dorngestrüpp eingefaßt, und Sand, der die Füße schnell ermüdet. Sobald ich der Araberin aus dem Postamt geholfen hatte und meine Zecke aus dem heiligen Lande losgeworden war, wanderte ich durch den Ort, und ein kleiner Junge, der seine schulzwanglose Kindheit mit Schabernack ausfüllte, zeigte mir mit belustigter Miene die Schule, in der der Lehrer eben ein Opferlamm verprügelte. Ein kleines Mädchen, braun wie ein Tontopf und fast ebenso geistsprühend, machte mich später auf die Kirche aufmerksam und wies nach dem Park – einem traurigen Orte ohne Bänke – worauf ich mich wie üblich in die Markthalle begab, um mir die Gemüse- und Obstarten anzusehen und die, die ich später malen wollte, zu kaufen. Handgemalte Tonkrüge und Palmenstrohkörbchen begeisterten mich am meisten, waren aber zu umständlich mitzunehmen.
Einsam wie immer durchwanderte ich planlos die weiten Straßen, in denen das Gras die Pflasterung bildet, und in denen es nicht die üblichen Holzzäune, sondern dichte Reihen von langblättrigem Stachelkaktus zur Abwehr gab. In einem Garten stand eine Nicaraguanerin und sprach mich an, schenkte mir Icacos und lud mich endlich in ihre Hütte ein, wo sie mir im Flüsterton viel über die verhaßten Gringos und später viel über das Leben überhaupt erzählte. Der Raum war sehr einfach, enthielt nur die unentbehrlichsten Möbelstücke und roch stark nach Kreolin. Sie sagte, daß dies so sein müsse, um die Schlangen abzuhalten, die sonst in das Haus kämen. Daher ginge sie auch nie ohne Licht ins Freie und zöge es vor, sogar im Raum ein Oellämpchen brennen zu lassen. Erschlüge man eine Schlange, so müsse man immer darauf gefaßt sein, auch noch die zweite zu finden. Die Korallenschlange mit schöner hellroter Zeichnung, die Klapperschlange, die indessen immer warnend klapperte, die schwarze Schlange und die gefürchtete Castellano seien die schlimmsten, doch behauptete die Frau, ein Gegengift aus verschiedenen Kräutern zu besitzen.
Ich blieb bei ihr, bis die ersten Schatten in blauen Streifen dahintanzten, besah mir einige Felder, kaufte die erfrischenden, doldenartigen grünbeerigen Mañones und sprach mit den Kindern, die unter hohen Schattenbäumen Reiskuchen, die in Blätter gewickelt waren, verkauften, während alte Frauen ihre Schürzen für mich aufbreiteten, so daß ich auf dem Marktplatz unter ihnen sitzen und mit ihnen plaudern konnte; sie boten Affen, Perroquitos und große Papageien feil, und jede beschrieb ihre Provinz als die beste und reichste. Es gab Gold und Silber in den Bergen, Marmor, Kupfer und andere Erze, und die Wälder haben herrliche Hölzer wie Palo campeche, Gummibäume und so weiter. Die wildesten Indianer leben an der ungesunden Moskitoküste am Atlantik; sie zählen die Tage nach Nächten, die Monate nach den Monden und nennen ein Jahr »nam«.
Die Sonne sank mit der Jähe der Tropen; ich saß wieder auf Deck und belauschte zwei politisierende Nicaraguaner. Die schwarzen Umrisse des Corro negro hoben sich noch ab, dann schwand Corinto, wie so vieles aus meinem Leben geschwunden, und ich saß mit meiner Blumenlast von Nicaraguablüten (kleine Tulpen von üblem Geruch), dem Jasmin der Guten Hoffnung und den trockenen Totenblumen auf der Deckbark und fühlte die nie endende Einsamkeit wie ein Bahrtuch auf mir. Ich sprach mit anderen nur, um zu lernen! Ich ging durch das Leben wie ein Trappist, dem Schweigen und der Arbeit geweiht.
Amapala, Las Honduras.
Der Golf von Fonseca ist unbeschreiblich; er soll prächtiger sein als die Einfahrt nach Rio de Janeiro. Die Schatten der Nacht mit ihrem tiefen Tropenblau lagen noch auf Bergen und Wassern als wir einfuhren, und dem Geschnatter der Araberinnen verdankte ich es, daß ich den Coseguina schon im Finstern erspähte. Er warf Rauchgarben von bedeutender Höhe aus, und im herrschenden Dunkel leuchteten sie wie Feuer.
Die Sonne kam – ein glutender Ball – und vergraute das Bild eine Sekunde lang, dann verwandelte sie, ihr Rot abwerfend, wie ein König seinen Purpurmantel abwirft, das Meer in glitzernde blaue Streifen, aus denen wie Smaragde die Inselchen traten. Sie waren alle sehr dicht bewaldet, hügelig, von Faltern umgaukelt, in hellstes Sonnenlicht getaucht – und dazu die ernsteren Berge des Hintergrundes, das flimmernde Wasser, der Zug der Möwen, der Rauch des Coseguinas und endlich das Bewußtsein, daß hier drei Republiken zusammenstießen – all dies gab der Landschaft einen erhebenden Reiz.
Einmal soll der Golf ein geschlossener See gewesen sein, der erst durch ein Erdbeben mit dem Meer verbunden wurde. Sein Flächeninhalt beträgt ungefähr achttausend Kilometer, und seine Buchten gleichen den Windungen einer verfolgten Schlange. Die Inseln Zacate Grande, Tigre, Gueguensi, Exposicion, Verde und Guca gehören zu Las Honduras, und gegenüber von Zacate Grande befindet sich der kaum hundert Kilometer lange Strand des Festlandes. Der übrige Boden gehört im Norden San Salvador, im Süden Nicaragua.
Amapala liegt aus der Tigerinsel, hat stark aufsteigende Gassen und ist so wild, daß Fremde nur ungern landen. Halbnackte Indianer mit schaurigen Wuschelköpfen rudern heran und führen ans Land. Auch die Araberinnen stiegen hier aus, und die Mutter der Lehrerin lud mich zu sich nach Tegucigalpa, was lieb von ihr war. Diese Leute und die Chinesen sind die einzigen, die in Mittelamerika zu Geld kommen können; denn sie denken nur an das Verdienen, sind mit jeder Unterkunft zufrieden und brauchen ihrer Rasse halber keinerlei Aufwand zu treiben. Es gibt Leute, die zwanzig Jahre in einer Stadt leben und nie spazieren gehen. Sie kennen die gewöhnlichsten Straßen nicht, sie kehren heim, ohne das Land wahrhaft gesehen zu haben; tagsüber arbeiten sie fieberhaft im Geschäft, und nachts sind ihnen ihre Frauen alles. In Erinnerung an die heißen Nächte durchdösen sie den Morgen. Darin verstehen sich die dunklen Eingeborenen.
Die Straßennamen sind gelungen: die Straße des Entzückens (ein elendes Winkelwerk!), die Distelstraße, die Brücke der Tapferkeit, das Gäßchen des Reichtums (an Abfällen) und so weiter. Männer mit gierigen Glutaugen, in denen schon die Bestie erwacht, den spitzen Hut fast im Nacken; Weiber mit schweren Bündeln, oben im Bündel das Kind, in der Regel mit Blusen, deren Kürze ein Bewundern des Magens gestattet, bekleidet.
Das Schiff liegt lange im Golf von Fonseca; denn Elfenbein- und Tolunüsse, Kautschuk, Schlangenhäute, Felle und Kopra werden verladen. Vom Meere aus führt die alte Reichsstraße allmählich hinauf in die fast unbekannten Hochtäler von Las Honduras und erreicht endlich auf einer Hochebene die Hauptstadt des Landes, Tegucigalpa, was »Stadt der Silberhügel« bedeutet. Das ist der politische, Comayagua dagegen der geschichtliche Mittelpunkt. Das Land heißt »die Tiefen«, weil das Meer an der atlantischen Seite ungewöhnlich tief ist.
Am großartigsten sind wohl die Ruinen von Copan, wo man Tempel mit Reliefbildern von geflügelten Soldaten finden soll, und wo sich Monolithen aus glattem Granit aus dem Dschungeldickicht erheben und beweisen, daß hier eine wunderbare Kultur untergegangen ist. Grotten gibt es da und Gestein, wie man sie nirgends in der Nähe findet, was manche Forscher auf den Gedanken brachte, es müsse dieses Volk schon Flugwerkzeuge besessen haben, um fremde Waren hinaufzuschaffen. So weit erstrecken sich die Ruinen, daß man annimmt, es müsse diese Stadt so groß wie das heutige London gewesen sein. Die Hieroglyphen, die dem Maya-Alphabet oder einer noch älteren Zivilisation entstammen, sind unentzifferbar.
Ein anderes, leichter besuchbares Wunder von Las Honduras ist die Blutquelle. Ein Bach aus echtem Blut fließt aus einer Grotte und hat nicht nur das Aussehen, sondern auch den widerlichen Blutgeruch, und tiefer unten, wo sich der Bach erweitert und stockt, sitzen viele Gallinazos oder Aasgeier und nähren sich von diesem verwesenden Blute. Die Indianer fliehen den Ort, da sie die Grotte voll böser Geister wähnen, doch die Europäer haben nun entdeckt, daß Millionen von Fledermäusen darin ihre Brutstellen haben, und daß sich diese Fledermäuse von den drei Monate hindurch auf den umliegenden Abhängen weidenden Rindern nähren. Das so gewonnene Blut fließt auf den Grottenboden und von da ins Freie. Dennoch ist der Ort unheimlich.
Unbeschreiblich schön sind die Urwälder mit ihren Drachenblut- und Seidenwollbäumen und verschiedenen Harzen, den direkt aus dem Erdboden schon abzweigenden Manaccapalmen, den kostbaren Färbehölzern und dem Copaiba, aus dem man den wertvollen Perubalsam gewinnt; unheimlich auch die Schlangen, die von den langen Aesten im Halbdunkel des Urwaldes schwingen und auf ein Opfer lauern. Zuzeiten kann man, wenn man sich still verhält, einen Coatl (einen dachsartigen Bären), ein Ocelot (einen kleinen Leoparden) oder ein Opossum oder Beuteltier erspähen, aber am meisten fühlt man die Hitze und die Angst vor den Mitmenschen …
Von San Lorenzo kann man mit einem kleinen Boot wieder nach Amapala zurück.
San Salvador.
Je heiliger der Name, desto schlechter in der Regel die Menschen. Wir liegen vor Cucuco, dem Hafen von La Union. Himmel, welches Loch! Man ist dankbar, daß ein gütiges Geschick einen nicht zum Bleiben verurteilt hat.
Die Cholos kamen in einem Hosenrest und einem breiten Strohhut auf Deck, was einen Mitreisenden sagen ließ: »Er hat ein Hemd, das nie zerreißt und vollständig sitzt.« Für wasserdicht schien es der Braune nicht zu halten, denn dem Wasser wich er aus wie der Teufel dem Weihsprengel …
Der Schiffsarzt von dunkler Farbe sprang aufs Deck und wurde von unserem Eisenbart begrüßt. Die Soldaten in hellbrauner Uniform, aber ohne Schuhe, versuchten stramm zu stehen, und drei Köter suchten ihren Besitzer.
La Union liegt über vier Kilometer von dem kleinen Hafenort entfernt, doch da das Schiff bis zum Abend blieb, folgte ich dem Rate einiger Leute und bestieg das vorsintflutliche Ding, das man in San Salvador Zug nannte und das an eine Kaffeemühle mit einer angekoppelten Kaffeebüchse erinnerte. In diesem einen Wagen saßen Männer und Frauen mit mächtigen Bündeln und besprachen Kaffeepreise und andere Tagesneuigkeiten.
»Wann kommt der Zug zurück?« fragte ich den Führer des urzeitlichen Dampfrosses, als ich ihm meine zehn Centavos überreichte.
»Oh, es gehen viele Züge!« meinte er. »Einer kommt um vier Uhr hierher zurück.«
Ich gab mich damit zufrieden und vertiefte mich in den Anblick der Landschaft.
Man fuhr mitten durch einen Urwald, der immer wieder versuchte, das ihm geraubte Gebiet zurückzuerobern. Die mächtigen Wurzeln der Seidenwollbäume bildeten wahre Bänke; das Gewirr der Schlingpflanzen war so ungeheuer, daß man nicht wußte, ob, was da baumelte, im Dunkel zitterte oder drohend vorgestreckt schien, einzig das dicke Stammgewirr der Lianen oder diese oder jene gefährliche Giftschlange war. In Cucuco hatte ich viele trockene Häute von Riesenschlangen gesehen und vermutete daher den Urwald schon da voll dieses Getiers. Aus dem tiefen Grün brachen am Rande rote Blüten, und auf dem Erdboden lagen Nüsse und Kerne, wie ich sie noch nie geschaut hatte.
Die Kaffeemühle hielt, die unzähligen Päckchen verschwanden samt deren Besitzern, und ich wanderte hinter ihnen drein der Stadt zu. Die Gassen waren elend, unberechenbar auf- und absteigend, schmutzig und nur selten Gärten aufweisend. Die Pflastersteine waren groß und uneben, der Fußsteig schmal und die Hunde bissig. Kein Tier nimmt derart den Charakter der Menschen an wie der Hund. Wo die Hunde bissig sind, sind es auch die Menschen. Ochsen zogen plumpe zweirädrige Wagen, die Räder waren ohne Speichen und der Lenker schien an Verstand seinen Ochsen gleich. Das Bürgermeisteramt wurde von Soldaten bewacht, und die Domkirche war im Zusammenfallen; denn Erdbeben sind häufig in La Union. Hübsch war der Park mit seinen Königspalmen, und der Marktplatz war interessant, weil alle Ladenhüter Europas sich in den dortigen Buden versammelt hatten. Die Verkäuferinnen waren dumm oder mürrisch, und was zum Verkauf geboten wurde, war schlecht. In Riesenkörben, flach wie ein heimischer Wäschekorb, lag Kaffee, und das Gemüse war welk. Hüte aus Karls des Großen Zeiten auf Stangen wie Häupter von geköpften Verbrechern, und Eier, daß sich eine europäische Henne sicher solcher Erbsen geschämt hätte.
Die Männer kamen aus den niedrigen verwahrlosten Steinbauten und grüßten mich mit höhnischen Bemerkungen. Sie erschöpften endlich ihre englische Wortkenntnis, und nur ein besonders dicker Braunbauch rief mir zärtlich » Darling« nach. Ich drehte mich um und rief »Dummkopf« zurück, um seine Sprachkenntnis nützlich zu vergrößern. Bevor sein träges Tropengehirn das verarbeitet hatte, war ich um die nächste Ecke verschwunden.
Nach etwa zweistündigem Herumirren näherte ich mich wieder dem Bahnhof. Es ging gegen vier, und um sechs Uhr sollte das Schiff abfahren. Der Zug brauchte etwa eine Viertelstunde, also hatte ich Zeit.
Vier Uhr und nichts kam. Ein Viertel nach fünf und Stille. Da fragte ich den Beamten, wann der Zug eigentlich abginge. »Um sechs!« hieß es. Ich warf ein, daß er nach Angabe des Schaffners und auch der Fahrgäste um vier Uhr abgehen sollte.
»Ich weiß nicht!« meinte der Herr Stationschef und ging in sein Loch zurück.
Nach einer Weile trommelte ich ihn wieder heraus, um ihn zu fragen, wie lange man zu Fuß gehen müsse.
Es war zwecklos zu fragen, ob der Weg sicher war. Ich entschloß mich, um völlig sicher zu gehen, wenigstens was die Richtung anbelangte, dem Geleise zu folgen. Da mußte ich nach Cucuco kommen.
Ich ging und ging. Die Tropensonne besaß noch ihre volle Kraft. Sie riß mir die Haut vom Nacken, den der Hut nicht stark genug beschattete; sie verbrannte mir die nackten Arme, bis sich die rote Haut in Blasen zu trennen begann; dabei verbrannte mir der glühende Sand die Sohlen meiner Schuhe und endlich meine Fußsohlen, was ich bedeutend unangenehmer empfand. Durch die Strümpfe spürte ich die heiße Bodenausstrahlung und das Braten der Sonnenstrahlen wie tausend Nadelstiche und immer wieder mußte ich den Hut lüften, um das Gehirn auskühlen zu lassen. Ich legte grünes Laub in den Hut, weil das dem Kopf gut tat und ihn schützte.
Aber alle diese Leiden waren nichts, verglichen mit der geheimen Seelenqual, die mich verzehrte. Ich ging nicht nur zum ersten Mal ganz allein durch ein Stück Urwald, ich ging allein als weiße Frau in einem tollen Lande; aus dem nahen Gestrüpp, das jede Aussicht verhinderte, konnte ein kleiner Leopard springen, sich eine Riesenschlange strecken, ein Tropenbär stürzen; in den Sandlöchern mochten Vipern verborgen sein, und wer sagte mir, daß nicht wilde Indianer herabgestiegen waren von den Inlandhöhen, um den Dampfer aus sicherer Entfernung anzustaunen? Sie konnten aus dem Dickicht einen Pfeil losschießen, sie konnten mich mit ihren Speeren überfallen und – Aergstes von allem – ich konnte auf dem einsamen Wege einem Mischling begegnen. Unwillkürlich griff ich bei diesem Gedanken nach dem Dolch in meiner Tasche.
An einem klaren Wintertage daheim schnell auszuschreiten ist ein Vergnügen; in den Tropen über den Boden hinwegzufliegen, der unter den Füßen brennt, ist ein ganz anderes Vergnügen. Ich schnob wie ein Kriegsroß vor dem Angriff, ehe ich den Urwald ganz erreichte. Dann fühlte ich mich durch die hohen Bäume und das Strauchwerk so weit gedeckt, daß ich es wagte, etwas ruhiger dahinzugehen. Zweimal glaubte ich, jemand hinter mir kommen zu hören, und zweimal brach ich durch das Gestrüpp in den Urwald ein, um darin Schutz zu suchen. In solchen Augenblicken waren mir alle Raubtiere und alle Schlangen gleichgültig.
Bei jedem Schritt wechselten die Empfindungen. Es raschelte rund um mich, und ich bemühte mich zu erraten, welches Tier und von welcher Größe es sein mochte; es krachte in den Baumkronen, und ich erwartete irgend ein Wurfgeschoß von einem Affen oder einem Wilden; es knisterte vorsichtig, und ich fragte mich, ob ein Ocelot oder ein verborgener Feind in fast lautlosem Nahen war.
Nicht nur erhoben Kokospalmen ihre feurigen Kronen über die verschiedenformigen, undurchdringlichen Baummasten, es wuchs am Wegrand auch oft ein Dornengebüsch und eine Kakteengruppe, durch die eine Elefantenherde nicht durchgedrungen sein würde, und gerade als ich solch einen Wall erreichte, erblickte ich, bei der Biegung hinter mir, ein Zweibein männlichen Geschlechts und im Augenblick noch unbestimmbarer Abart.
War ich früher stramm ausgeschritten, so setzte ich jetzt mein Wetterbein nach vorn, ungeachtet um den Schweiß, der in Bächen an mir niederrann. Hinter mir, kaum näherrückend, kam das Zweibein.
Ich flog über den Boden dahin – nicht laufend, aber mit einem von Peru her einstudierten schwingenden Schritt, der die Kilometer fraß. Hinter mir keuchte der Unbekannte. Ich hatte manch einen glühenden Verehrer jener Erdstriche auf solche Art kalt gelaufen.
Auf einmal rief das menschliche Ocelot beschwörend hinter mir:
» Signorina!«
Ich drehte mich um. Der Anruf war nicht spanisch, und überdies war ich bereit, vom Frieden zum Kampf überzugehen. Etwas Aderlassung würde seine Liebesglut behaglich dämpfen.
»Gott sei Dank, daß ich Sie eingeholt habe!« stöhnte der Unbekannte. »Ich will auch zum Schiff zurück, und dieser Esel von einem Stationsbeamten …«
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Es war ein Italiener, der von Las Honduras in ein anderes gottverlassenes Reich Mittelamerikas reiste, um dort Rosinen und Florentinerwasser zu verkaufen. Vereint legten wir den Weg zurück, und er erzählte mir, was er gelitten hatte, wenn er ein Krachen dicht neben sich vernommen, und zeigte mir seinen Hals, der gleich dem meinen rot wie der Kamm eines erregten Hahns war.
Halbtot, mit heraushängender Zunge und verkohlten Füßen stolperten wir gegen halbsechs den Hafendamm entlang, als uns ein sonderbar knarrendes Geräusch hinter uns erschreckte und vom Geleise scheuchte.
Es war der Zug, der mit uns zugleich in Cucuco eintraf!
Der Italiener machte von seiner Muttersprache ausgiebigen Gebrauch. Ich schlich mich auf Deck und ins Badezimmer.
Mir fehlten die Worte.
La Libertad.
Ihr Götter – schon wieder ein Loch!
Weiche, langgestreckte Erhebungen und vorn am Strand, wie aus einer Kinderkiste genommen, eine Anzahl irgendwie hingestellter windschiefer Hütten. Die Brandung wütend, so daß man wie bei Mollendo mit dem Kran ans Land gezogen werden mußte und dafür den Landpiraten einen Dollar zahlen sollte. Aber wer etwas sehen will, darf die Opfer nicht scheuen.
Die Reisenden der ersten Klasse, die mich zuerst wie den wandelnden Aussatz gemieden hatten – sie waren ja die Reichen! – waren (vielleicht weil ich sie wie die Cholerabazillen mied) zur Ueberzeugung gelangt, daß ich vielleicht trotz der entehrenden Dritten ein Mensch sein mochte und sogar ein denkender, weil Tiere nämlich kein Tagebuch zu führen pflegen, oder doch höchstens nur Hunde an beliebten Straßenecken …
So mußte ich bei meiner Heimkehr von meinen Landerfahrungen erzählen; denn niemand wollte sich der Mühe unterziehen, selbst an die unbehagliche Küste mit ihrer Fiebergefahr zu gehen. In La Libertad stieg nun zu meiner Verwunderung auch ein Herr ans Land, um – wie er behauptete – ein Meerbad einzunehmen und um zu erforschen, wann der Zug ins Inland fuhr und ob man die Hauptstadt San Salvador in einem Tage erreichen, besehen und das Schiff erreichen könne.
Ich hatte ein Abenteuer mit San Salvador-Zügen gehabt und wünschte nicht, etwa zwanzig Kilometer laufend zurückzustürzen. Ich besah mir daher den Ort und die Umgebung. Man behauptet, daß die Leute hier fleißiger seien, und das scheint der Fall zu sein, denn auf den Abhängen sind schon Kaffeepflanzungen, und im Tal findet man Zuckerrohr, Mais, Taro und Yuca. Die Höhengebiete sind gesunder und kühler als die der Nachbarn, und das trägt natürlich zu größerer Wirksamkeit bei. Die besten Kaffeeanlagen sind die bei Sonsonate, wohin man außerhalb von La Libertad schon schauen kann. Dahinter liegt San Salvador.
Die alten Azteken nannten das Land Cuscatlan oder »Land der Halsketten«, das will sagen »der Reichtümer«. Hinter der heutigen Hauptstadt »im Tal der Hängematten« (weil Erdbeben so sehr an der Tagesordnung sind) kommt Asutuxtepeque oder »Ort der Schildkröten«, und Sonsonate bedeutet »Ort der Wasser« und wurde von Pedro de Alvarado im sechzehnten Jahrhundert gegründet.
Die Leute sind braun, schmutzig, arm. Die Sümpfe der Ebene erzeugen Fieber, und die Schiffe, die anlaufen, sind gering an der Zahl. Die winzigen Spezereiläden sind alle in Händen von Chinesen, der vereinzelte Stoffladen – wenn vorhanden – wird meist von einem Araber geführt. Ich sollte für meine Negerin Haarnadeln kaufen und versuchte es in drei Häfen vergebens, ehe ich diesen Luxusartikel bei einem Chinesen erstand. Die Frauen lassen das Haar einfach offen hängen und waschen nur von Zeit zu Zeit den Lausüberschuß ab.
Gegen Abend traf ich den Mitreisenden am Strande. Er lud mich zu einem Meerbad ein, aber ich bin nicht gern im Salzwasser und hatte keine Sehnsucht, in der mir angebotenen Herrenhose (die mir allerdings bis unter die Achseln gereicht hätte, denn ich bin fünf Fuß nicht hoch) die bewundernden Vornehmen von La Libertad zu beglücken. Da ich aber auch gern erfahren wollte, ob man endlich von Acajutla aus noch bis San Salvador kommen könnte, willigte ich ein, mit ihm zum Agenten zu gehen und spanisch zu verhandeln.
Nun ist eine Weltreise schon deshalb eine Schnellschule des Lebens, weil die Menschen hier überstürzter die Politur abspringen lassen als daheim, und deshalb erlernt man an einem Tage, was man in Europa – wo die Tünche besser klebt – oft erst nach Monaten oder, wenn man wie ich Pech gehabt hat, erst nach Jahren erlernt.
Der Mitreisende hatte an Bord eine ungewöhnlich schöne, sehr stattliche und entzückend gekleidete Frau, die überdies nette Umgangsformen und einigen Verstand hatte. Sie war unzweifelhaft die weitaus schönste Frau auf dem ganzen Schiff und natürlich weiß. Ich bin klein, war damals braun gebraten wie ein Indianerkind, und mein Spiegel sagte mir jeden Morgen, daß ich mir nicht einmal selber schön vorkommen konnte, und sich selbst findet sogar der Teufel schön. Andere Leute würden mich unter die unleugbar Häßlichen zählen, und mir machte der Mann eine Liebeserklärung. Ich hatte seit Genua genug an Alter und Weisheit zugenommen, um die Erklärung ins richtige Fach zu tun, aber damals freute ich mich zum ersten Mal, nie geheiratet zu haben. Wenn jeder Mann jede Frau mit jeder Vogelscheuche jedesmal, wenn er loskam, hintergehen wollte?!! …
Der Agent wohnte im dritten Stock, und eine unbequeme Holztreppe, ungewöhnlich steil und halsbrecherisch, führte nach oben. Ehe ich es wußte, hatte mich der Amerikaner vom Boden aufgehoben, und keuchte mit mir treppaufwärts. Zuerst wollte ich mich wehren, dann dachte ich mir, daß etwas Erringen von konzentrierter Lebensweisheit auch den Zweibeinen männlicher Ausgabe von Nutzen war, und so ließ ich mich drei Stockwerke hinaufschleppen. Wir hatten 40 Grad im Schatten, und ich war nie vom Stiegensteigen – auch bei minderer Hitze – ein Freund gewesen. Wenn es ihm also Spaß machte, wie ein Wüstenkamel meine 47 Kilo schwankend und keuchend drei Stockwerke hoch zu schleppen, so sollte er die körperliche Hebung haben. Daraus würde er später lernen, daß man zuweilen etwas umsonst im Leben tut, und daß man, selbst im Meer der Liebe, zuzeiten auf ein Riff oder einen Wellenbrecher stößt. Das war seelenfördernd …
Die Auskunft des Agenten war unbefriedigend. Hinab ging ich übrigens die Treppe auf eigenen Füßen. Bescheidenheit ist eine Zier!
»Hast du dich unterhalten, Liebster?« fragte seine Frau, als uns der Kran aus dem Korb warf.
»Es war wunderschön!« sagte er.
De gustibus …
Acajutla zu Füßen des Izalco.
Das ist der wichtigste Hafen von San Salvador, dieses kleine Dorf voll Strohhütten, Aasgeiern und nackten Kindern. Wir lagen wieder weitab vom Strand, und die Hitze, vereint mit der Fliegenplage (sie flogen vom Land her zu uns), war unerträglich. Auf den verankerten Fahrzeugen, die menschenleer schaukelten, saß da und dort ein Ibis.
Das Landen war sehr kostspielig. Einen Dollar jede Fahrt und überdies einen Dollar Landungstaxe. In solch einem Loch! Die Leute kranken an Selbstüberhebung.
Ist man indessen einmal am Land, so findet man dennoch einen gewissen Zauber. Hinter dem Ort erheben sich, unheimlich rasch und spitz ansteigend drei Vulkane im Halbkreis – der Izalco, der San Miguel und die Santa Ana. Den ganzen Tag hindurch lagen Wolken wie Trauerschleier verhüllend um die Spitzen, doch gegen Abend zogen sie meerwärts, und man sah das Ausbrechen des Feuers auf dem Izalco, der oft »der Leuchtturm Mittelamerikas« genannt wird.
Aasgeier, kleine Gärten, Falter jeder Farbe und Form im nahen Urwald, der von Dornpalmen strotzt, vernachlässigte Felder, abgearbeitete Frauen und überall im Dorfe brennender Lavasand, schwarz und von der Sonne allzu leicht erhitzt. Von hier geht der Zug nach der Hauptstadt.
Keine Worte vermögen die Schwermut zu schildern, die über diesen süd- und mittelamerikanischen Hasendörfern liegt. Der Sand, die Berge, die Leute sind tot. Sie schienen mir jedes Mal wie durch einen Zauberspruch zu einem unfühlenden Augenblicksleben erweckt. Immer das gleiche Grün des Hintergrundes, die gleichen vernachlässigten, unbequemen Holzhütten, die trostlos traurigen Frauenaugen, die lüsternen Blicke der Männer, die das einzig Lebende in all der toten Herrlichkeit sind, und darüber, wie ein Unheilssiegel, die glühende Sonne der Tropen. Ich habe später viele Dörfer aus noch einsameren Landstrecken, aus verstreuten Inseln gesehen; aber nie sind sie mir so tot vorgekommen wie diese Orte der spanischen Republiken. Als ob Spaniens sterbender Geist sie todbringend angehaucht hätte.
Die arme Costaricanerin mit ihrem Chinesengatten sagte mit einem Seufzer:
»Gott zuerst, wenn wir nur aus diesen Löchern schon draußen wären!«
Das schwarze Stück Menschlein unter mir bekam einen Zahn und nahm die Welt krumm. Es brachte mich um die geringe Ruhe, die man zwischen Maschine und Küche im Tiefschlund des Schiffes in tropischen Gewässern zu finden vermochte. Jede Fahrt wurde für mich zum Fegefeuer …
San José de Guatemala.
Um fünf Uhr früh schrillte das Schiff schon »Guten Morgen«, und ich fuhr vom Seegras oder Stroh auf – denn nicht einmal in dichterischer Freiheit will ich von dem Bett »aus den Federn« sagen – um ans Land zu gehen. Da aber der braune Pillendreher noch nicht die übliche Borduntersuchung vorgenommen hatte, wartete ich auf meinen gebratenen Speck, gefolgt von Pfannkuchen und eingeleitet durch eine Grapefruit – eine bittere Riesenorange – das beste gegen Seekrankheit.
Es ist von San José beim besten Willen nichts zu sagen, als daß es die üblichen breiten Gassen voll Lavasand, Sonne, Aasgeiern, nackten Kindern und haarlosen Hunden hat, und daß die Glocke im Kirchturm schief hängt. Der Markt besteht aus Palmenstrohdächern wie Schwämme, unter denen die Buden stehen. Er bietet nichts. Eine eiförmige dunkelfarbige Frucht soll die Suppe sehr verbessern. Alligatorbirnen wurden aufs Schiff getragen. Man ißt sie mit Whisky eingegossen oder mit Salz, Essig und Oel. Ich mag sie nicht.
Im Urwald, in den ich mich mit altem Leichtsinn wagte – dreifach unüberlegt der Menschen, der Tiere und des gefährlichen Tropensumpffiebers wegen – fand ich ganz herrliche Falter, die meisten schneeweiß in allen Größen, doch einige so tiefgelb, daß sie fast braun wirkten und mehrere mit bunten Flügeln. Die Nachtfalter aber sind so groß wie Spatzen und wirken ungemein haarig. Manchmal umkreisten mich auch die dickhalsigen schwarzen Geier. Bei einem verfallenen Hause schreckte ich eine Iguana auf, doch kaum hatte ich mich über ihre Flucht laut ergötzt, so fuhr mir der Schrecken in die Glieder; denn hinter dem Gestrüpp erspähte ich ein gesatteltes Pferd. Da ich seine Gemütsart nicht kannte und noch weniger die seines Gebieters, blies ich zum übereilten Rückzug und floh tief in den Busch, ehe ich auf Umwegen den Strand neuerdings erreichte. Ich lernte mehrere neue Palmen und eine Anzahl öliger Palmnüsse kennen; aber die gefährlichen Stechmücken, die mich angriffen, und der heiße Sand, der durch das Leder meiner Sandalen brannte, machten das Wandern wie immer zur Pein. Kurz vor San José traf ich ein junges Mischlingsweib, und sie zeigte mir auf Wunsch die Viscoyonüsse, die den echten und gesuchten Coyolnüssen ähnlich sind und vom Stamm einer niederen Palme hängen, deren Wedel indessen, derart mit Dornen gespickt, den Zutritt sehr erschweren. Um die Chacras oder Holzhütten der Umgebung fand ich Gärten mit Mangos, Bananen und Kalabassen.
Die Leute sind furchtbar arm. Fleisch haben sie nur selten. Das beste, das sie Fremden anbieten, ist Schlangenfleisch, das in Scheiben geschnitten und wie unser Aal gebraten wird. Es schmeckt nicht schlecht, – kostete ich doch aus wissenschaftlichen Gründen trotz Abneigung davon – aber da viele Giftschlangen gegessen werden, dringt das Gift in den Körper ein und erzeugt häßlichen Ausschlag, der in einer Art Eiterbeule endet. Gastlich aber sind sie bei aller Armut, diese armen braunen Menschen von Guatemala, von denen neunzig vom Hundert nicht lesen können!
Die »goldene Tugend« gleicht der von Peru – hochmütig ohne Ehrgeiz, sinnlich und dabei weiberverachtend, roh gegen die Untergebenen, schnell eingeschüchtert von den Vorgesetzten und von glühendem Haß gegen die Europäer erfüllt. Nichts an ihnen ist tadellos als die Bügelfalte des Beinkleides, und ihre gelbe Gesichtsfarbe, die sie gern weiß nennen möchten, hat etwas Krankhaftes, das mich den einfachen Mann aus dem Volke mit seinem gesunden Braun vorziehen ließ.
Champerico.
Von da geht die Bahn nach der Hauptstadt Guatemala, wo es etwas kühler und angenehmer sein soll. Das ist wünschenswert, denn in Champerico war die Hitze unerträglich. Ich hatte Wadenkrämpfe, und überdies war in der Nacht ein furchtbares Gewitter niedergegangen. Nun toste die Brandung wie ein wildes Tier. Kein Hafen ist so heimtückisch wie die weite Reede von Champerico.
Drei Vulkane begrenzten auch hier den Gesichtskreis. Mangroven greifen mit ihrem saftigen Grün und ihren feurigroten Blüten tief in das Meer hinein, und die goldgelben Mangos hängen an langen Fäden von den breitkronigen Bäumen. Windgebeugte Kokospalmen spiegeln sich im Blau der See, und schwarzer Lavasand umgibt die hellbraunen Häuser. Die wenigen Geschäfte sind in Händen von Chinesen. In Guatemala herrscht indessen das gelbe Fieber, und Reisende werden nur ungern an Land gelassen.
Hier findet man – tiefer im Urwald – das »ruhige Herz«, eine schöne Blume, und den Baum, dessen Frucht Affenhand heißt. Leider konnte ich kein gut erhaltenes Stück finden, so sehr ich auch danach suchte. Aus dem Wachs einer Pflanze machen die Eingeborenen Kerzen.
Im Wappen von Guatemala findet man den heiligen Vogel Quetzal. Vor vielen Jahrhunderten kam einmal ein lichter Lehrer in diese Erdstriche, und was er an Weisheit lehrte, blieb teilweise im Volk erhalten. Die Zauberpriester der Azteken nannten diesen Meister unbekannter Herkunft Quetzalcoatl, und sein Sinnbild war die gefiederte Schlange.
Vor der Abfahrt kam der amerikanische Konsul an Bord. Er war schon bejahrt, und sein Name war die ganze Küste Mittelamerikas hinab bekannt, nicht nur in Champerico. Eingeborene besuchten ihn, wenn sie vom Innern herabstiegen, und wer ein Geschäft plante, zog ihn zu Rate. Mitten unter den Holzbauten steht ein etwas besseres, doch keineswegs behagliches Holzhaus: sein Schloß. Er sagt, daß er lieber der erste Mann in Champerico als ein Unbekannter in den Vereinigten Staaten sei. In seinem Fall wäre ich lieber der letzte Mann in Nord-Amerika als der erste in Champerico.
Das Friedhofsabenteuer.
Spät am folgenden Abend erreichten wir den Isthmus von Tehnantepec, und als es nächtelte, ankerten wir den Felsen von Salina Cruz gegenüber. Von diesem ersten Hafen Mexikos sprachen die Seeleute wie wir von Wien oder Berlin, und ich konnte kaum das Tagen erwarten, um diese Großstadt mit Nachtleben (alle männlichen Reisenden waren abends noch ans Land geeilt) wenigstens bei Sonnenlicht in Augenschein zu nehmen. Was ich sah, als ich aufs Deck wankte, waren steil ansteigende, scharfe Felsen, welche fast unbewaldet waren und nur in den Spalten Kandelaberkakteen, Teller- und Schlangenkakteen, Aloen und Stachelflechten aufwiesen. Der Ort aber kletterte nach kurzer Ebene den Berg hinauf, und von irgend einer Größe war nichts zu erspähen, wenn die Zahl der Häuser auch die aller anderen Hafenorte überstieg, und die wichtigsten Bauten in der Tat aus Stein waren.
Dunkelhäutige (Menschen schritten an mir vorüber – viel dunkelhäutigere, als ich bisher getroffen – und der Schnitt der Augen war beinahe mongolisch. Etwas Wildes und zugleich Schwermuttiefes liegt in den Zügen; vielleicht ist das die letzte Spur ihrer Aztekenvorfahren.
Ich mußte meine grüne Landungskarte vorzeigen, ehe ich das Hafengebiet verlassen durfte, und die kurze freie Strecke betrat, der entlang man nachts Landende überfallen und ausrauben sollte. Einladend war das Land in dieser Hinsicht nicht.
Die Lagerhäuser wurden von den Engländern angelegt und kosteten über eine Million, denn hier sollte der Zucker aus Haiti aufgestapelt werden, doch der Panamakanal machte dem Unternehmen ein Ende. Der Weg vom Hafen, am Zollamt und dem Regierungsbesitztum vorüber, das mit einem hohen Eisengitter umzäunt ist, dehnt sich und ist unangenehm sonnig; er führt über die Schienen der Eisenbahn, die nach Tehnantepec geht. Salina Cruz liegt nämlich an der engsten Stelle der Landenge von Tehnantepec, wo nur 216 Kilometer den Atlantic vom Pazifik trennen, und in der reichen Provinz Oaxaca.
Der heiße Sand verbrannte mir wieder schmerzhaft die Füße, ehe ich mitten im Ort war, dessen Häuser bessere Holzbauten mit verzierten Veranden waren und schon ein echt mexikanisches Aussehen hatten; doch als ich das äußerste Ende der Flachstadt erreichte und nach links abbog, stand ich mitten unter elenden Bambushäuschen. Die Wände waren so lose zusammengefügt, daß man wie durch ein Gitter alles, was darin geschah, beobachten konnte, und da die Bewohner ebenso neugierig waren, mich anzustaunen und auszufragen, wie ich sie, landete ich bald in einer dieser Hütten.
Die Tracht der Mexikaner ist seltsam. Die Männer haben Hüte wie der Misti, – doch ohne Schnee – eine radgleiche Krempe gekrönt von einem Zuckerhut. Um einen Dollar hätte ich solch einen Hut kaufen, ihn aber höchstens durch die Welt mir voran rollen können, denn er war nicht viel kleiner als meine Wenigkeit. Hemd und Hose oder Ueberreste solcher Dinge vollenden die Männerkleidung; die Frauen aber hatten eine kurzärmelige Bluse, die vor dem Magen endete und bei manchen Bewegungen einen Teil der Brust sehen ließ, während ein sehr faltiger Rock die geheimsten Reize verbarg. Kopf und Füße verblieben unbedeckt. Die Kinder liefen nackt herum.
Mexiko ist ein armes Land bei all seinem Erzreichtum, seinen kostbaren Pflanzen, seinen ausgedehnten Erdölquellen. So arm, daß die Leute ganz und gar nicht gastlich sind. Selbst in Guatemala bot man mir von den einheimischen Speisen oder dem Obst zu kosten an, doch nie in Mexiko. Was man haben wollte, mußte man kaufen, und die Leute fanden eine Sache, die fünf Centavos kostete, schon teuer.
Im einzigen Raum, den die Hütte enthielt, kauerte die Frau vor dem Holzkohlenherdchen, das nicht einen Fuß hoch war, und briet Tortillas, das mexikanische Brot, aus grobem Maismehl. Ihre Tochter stand am schrägstehenden Lavastein und walkte mit einem Lavastößel das grobe Mehl mit etwas Wasser zu einer flachen Masse. Sobald diese gefestigt und glatt genug geworden war, reichte sie einen solchen ganz dünnen Pfannkuchen der Mutter, die ihn in die leicht bestaubte Eisenschüssel (ebenfalls flach) warf und ohne Fett über gelindem Feuer briet. Die Tortilla ist ganz gut, aber schwer verdaulich und erweckt das Gefühl des Gesättigtseins. In einem Tongefäß hatte die Frau gekochte Flaschenkürbisse, die mit dem Saft des eben gepreßten Zuckerrohrs gesüßt waren. Das war das Mittagessen – vielleicht die einzige Mahlzeit – der Leute.
Einrichtung gab es keine. Zwei oder drei Kisten, einige Hadern, zu einem Haufen gesammelt und nachts wohl das Bett darstellend, und quer durch den Raum schwebend die Hängematte, in der immer nur der Herr des Hauses lag, während sich seine bessere Hälfte abplagen mußte. Mit vornehmer Ueberlegenheit sah er auf sie herab.
Ich ging von Hütte zu Hütte, beantwortete Fragen und stellte sie. Immer arbeiteten die rundlichen Frauen alles, was getan werden mußte. Ihre Bluse war unter der Brust mittels eines Knotens zeitweise verengt, doch hinten immer offen. Die Männer brummten verstohlen über die Regierung und die Priester, die so viel Geld zur Eheschließung forderten, daß viele Leute lieber in freier Liebe zusammenlebten. Auch später erfuhr ich von gebildeteren Leuten, wie sehr die reichen Pflanzer, die Ausländer und selbst die Priester das Volk ausnützen, und das gibt wohl die Erklärung für die heutigen Priesterverfolgungen ab.
Weiter und weiter. Die Abhänge waren voll Kakteen, und schon nach kurzem Versuch gab ich die Entdeckungsreisen ins Pflanzenreich auf und begab mich wieder zurück in den besseren Teil der Stadt. Mir folgten die Rufe der Frauen, die mir gutmütig zuwinkten, und das Klappern der Männersandalen im heißen Sand. Ich besuchte die Kirche, in der man einen Holzchristus hatte, dem echtes Menschenhaar angeklebt war, die Mutter Gottes ein prachtvolles Gewand aus schwarzem Samt trug und die Heiligen ungewöhnlich dumme Gesichter schnitten. In der Hauptstraße waren alle Geschäfte in Araber- oder in Chinesenhänden und selbst die beiden Gasthäuser wurden von Ausländern geleitet (Guasti und Gambrinus). Auch das ist ein Zeichen, wie unternehmungsunlustig die Bewohner Mittelamerikas sind. Alle Bergwerke, alle Großhandelshäuser, alle kleinen Läden werden von Ausländern bedient. Der Stadtpark hatte nur gebrochene Bänke.
An Bord hatte man mir schon öfter gesagt, daß ich es nicht versäumen solle, den sehr interessanten Friedhof, der unweit der Stadt gelegen ist, in Augenschein zu nehmen, und nach dem Mittagessen begab ich mich trotz vierzig Grad im Schatten auf den Weg, ihn zu suchen. Ich fand mehrere sehr schöne, bunte Steine, die ich sammelte, und hatte schon das niedrige Buschwerk vor der Friedhofsmauer erreicht, als ich ein Mannszweibein auf mich zukommen merkte.
Die Mexikaner, ebenso wenig wie die anderen spanischen Mischrassen, verschwenden in Liebesangelegenheiten ihre Zeit. In zwei Minuten hatte er mir sein Herz, eine Menge Geld und die Heirat angeboten. In weiteren zwei Minuten hatte ich seine lockenden Anerbietungen höflich abgewiesen. Da erfaßte er mich wie einen Sack und schleppte mich kurzer Hand auf den geschichtlichen Friedhof. Ich zappelte vorn mit den Armen und hinten mit den Beinen in der Luft, aber für den Augenblick hatte er die Oberhand, denn sein Hut allein war schon größer als ich.
Er legte oder richtiger stellte mich auf das passendste Grab und kaum hatte ich wieder Boden unter den Ledersandalen, als auch ich zum Angriff überging. Mit einem Ruck hatte ich den Dolch aus der Tasche und sagte:
»Mensch, dieser Dolch ist in Curare, das tödlichste aller Gifte, getaucht. Wenn ich Sie mit diesem Dolche (der verrostet war und schaurig aussah!) auch nur ritze, müssen Sie in spätestens drei Stunden auf elendeste Weise sterben!«
Nun war er ja nicht ganz überzeugt, daß es sich mit dem Dolche und dem Gift gerade so schlimm verhielt, aber Angst hatte er immerhin, und deshalb begann er, andere Saiten aufzuziehen. Er entnahm seiner Brieftasche eine überraschende Menge von Zehndollarnoten, und legte sie dicht vor dem Grabstein nieder, stammelte viel Unsinn von kurzen zehn Minuten und wimmerte wie ein Hund, der den Stock sieht und dennoch einen saftigen Braten will. In solchen Augenblicken lernte ich sehr viel über das Leben, die Sinne und die Männer. Es gab mir von den Einrichtungen des lieben Herrgotts eine höchst mindere Meinung …
»Heben Sie das Geld auf,« befahl ich, »und stecken Sie es ein. Ich bedarf dessen nicht. Ich bedarf auch – Gott sei 's gelobt – keines Mannszweibeins und dieser Liebe, die keine Liebe ist. Ich bin ein Mensch und kein Vieh! Und nun marsch mir voran Salina Cruz zu, oder mein Dolch geht Ihnen in die Haut!«
Im Gänsemarsch, er knurrend und fluchend, ich die Augen auf seine Wirbelsäule gerichtet, kehrten wir, an den bunten Steinen, die ich alle liegen lassen mußte, vorüber, nach der Stadt zurück, und es geschah, daß ich auf dem berühmten Friedhof gewesen war und nichts von ihm gesehen hatte.
Am Abend erzählte ich irgend jemand mein Abenteuer. Noch einmal lernte ich viel über Menschen und deren Art. All jene Erstklassepassagiere, die sich sonst nie um mich gekümmert hatten, besuchten meinen Aussatzplatz (ich saß dort etwas abgeschieden von den übrigen) und forschten mich aus. Nie aus Mitempfinden, stets nur des Gruselns wegen, und von da ab waren sie allzeit begierig zu erfahren, was ich auf dem Lande »erlebt« hatte.
Nur die Costarikanerin sagte:
»Gott zuerst, gegen uns Frauen ist das Leben Feind.«
Vor Jahren war Salina Cruz so ungesund, daß die meisten starben, die über acht Tage blieben; heute sind die Verhältnisse leidlicher, doch weit entfernt von gut. Der Ort ist sehr gut befestigt, und der weite Wellenbrecher schützt die Einfahrt. Ehe dieser künstliche Hafen angelegt war, mußte der Kapitän mit zwei schleifenden Ankern lavieren.
So fruchtbar ist das höher gelegene Inland, daß die Kaffeebäume bis zu zehn Pfund, die Zitronenbäume 5000 Zitronen im Jahr tragen, das Zuckerrohr dreißig Fuß hoch wird und die Tabakblätter eine Länge von 50 cm erreichen.
Mein letzter Eindruck von Salina Cruz war der fette chinesische Waschmann, der das gewaschene Bündel der Schiffs- und Offizierswäsche pustend über die Landungsbrücke schleppte, und ein Mexikaner, der dem Schiffskoch grinsend eine kleine Katze schenkte. Dann glitten wir am Leuchtturmhügel hinaus ins freie Meer …
Acapulco.
Die Katze fand unser Schiff ein Erdbebengebiet und schrie die ganze Nacht. Sie vereitelte die geringe Schlafmöglichkeit, die wir besessen hatten. Die Hitze war tödlich. Eine neue Mitreisende mit drei Kindern wälzte sich nackt und stöhnend auf dem Boden, die Costaricarin seufzte » Ave Maria purisima«, und ich kugelte hilflos von Ost nach West, ohne die Augen schließen zu können. Draußen, auf dem Gang, jammerten die Matrosen und Heizer.
Ein Tag ohne Landen; am Abend Gewitter.
Noch eine Nacht der Leiden, dann glitten wir durch die Einfahrt in den Hafen von Acapulco, einem höchst eigenartigen Ort, wie ich ihn so nie wieder gesehen habe. Die Häuser kletterten mit viel Anmut und Geschick den steilen, kantigen Fels hinan, und man steigt nicht auf Erde aufwärts, sondern klimmt auf allen Vieren (wenigstens wenn man nicht in Acapulco geboren ist), über runde, ungeheure, ganz glatte Steinblöcke, die das Aussehen jener Felsen im hohen Norden Skandinaviens haben, die vom Eis glatt geschliffen worden sind. Die Hauptstraßen in der Ebene, zwei an der Zahl, haben, wie in Panama, einen vorspringenden ersten Stock, so daß man sich unter einem gedeckten Fußsteig – etwas sehr Nützlichem zur Sonnen- und Regenzeit – befindet, doch die zahllosen Rohrhütten, die über den Berg verstreut sind, liegen in winzigen Gärten. Vor solch einem Garten blieb ich stehen, und die Frau darin rief mich zu sich herein. Wie gewöhnlich hatte der Raum wenige Möbel, aber er war doch außer der Hängematte um einen Tisch, einige Stühle und einen Schrank reicher.
Ich weiß nicht, wie es kam, aber von dieser Frau erfuhr ich mehr über Land und Leute, als durch alle die Bücher, die ich vorher gelesen hatte. Sie erzählte ihr Leben, und darin, wie in einem Spiegel, entrollte sich das ganze Mexiko mit seinem Licht und seinen Schatten.
Sie war eine Witwe und gehörte zu Acapulco, wie einer der Riesensteine, die den Aufstieg erschweren. Früh morgens ging sie in den Wald hinein, der hier nicht so üppig wie tiefer im Süden war, bearbeitete das Maisfeld auf der ersten Lichtung und sah nach dem Zuckerrohr auf der zweiten, sammelte Brennholz auf dem Heimweg und pflückte junges Laub bestimmter Bäume an Stelle von Kohl oder Spinat. Wie einfach das klang! Wenn sie indessen Holz sammelte, hielt sie immer scharfe Ausschau nach der gefürchteten Korallen- und besonders nach der grünen Schlange, die nicht auswich, und die, sich zusammenziehend, sich dem Feinde entgegenwirft. Ich glaube, der richtige Name ist Peitschenschlange, weil sie wie ein Peitschenhieb losfährt. Auch mußte die Frau beim Durcheilen des Urwaldstückleins sorgfältig nach oben schauen, denn zuzeiten lauerte eine Riesenschlange auf Beute, ließ sich aus dem dichten Laubwerk und Lianengewirr herab und umstrickte das Opfer, oder es schlich sich ungesehen ein Raubtier auf sie los.
Arm mußte sie sein trotz der netteren Hütte und des Gärtchens voll Blumen und einzelnen Obstbäumen, denn sie erzählte mit angehaltenem Atem von den Glücklichen, die vom süßen Stadtbrot essen durften, das 15 Centavos das Laibchen kostete. Mais kostete 15 Centavos das Liter, hundert Bananen zur Reifezeit nur 25 Centavos, Majoran in Büscheln 5 Centavos, einfaches Brot 5 Centavos, und Zuckerbrötchen gab es zwei für l0 Centavos! Dennoch klagte sie über die teuren Zeiten.
Dann – als wir vertrauter wurden – erzählte sie im Hütteninnern von den Schrecknissen der Revolution. Die feindlichen Truppen zogen durch Acapulco, raubten, mordeten und plünderten, wo und wann sie nur konnten. Mädchen und Frauen wurden mitgeschleppt und mußten dem Heere zu Diensten stehen, Knaben und Männer wurden erstochen, die Hütten ausgeraubt und niedergebrannt. Vier Tage lang lag sie mit Gatten und Kindern verborgen und ohne Nahrung oder Licht in der Hütte, während Truppenteile durchzogen. Sie wagten nichts zu kochen, damit der aufsteigende Rauch sie nicht verrate, und nachts eilten fremde Menschen durch die finstere Hütte, die so leer war, daß sie nichts, nicht einmal die Verborgenen unter moderndem Maisstroh fanden. Seit vier Jahren – lange Zeit – hatte es keinen Bürgerkrieg mehr gegeben, und man erholte sich langsam.
Später, als wir unter Baumwollstauden und Maranonbäumen im Gärtchen saßen, erzählte sie vom großen Theaterbrand, bei dem so viele umgekommen waren, und vom gefürchteten Cyklon im Jahre 1910, der ganze Häuser ins Meer getragen, vom Cordenazo de San Francisco – dem furchtbaren Wind, der zuzeiten am vierten Oktober blies und viel Unheil anstiftete, – und immer liefen die Schweinchen unter unseren Stühlen dahin und durchkrappelten die offene Hütte, in der zwei Kinder in der Hängematte lagen und einzuschlafen versuchten.
Ich schenkte der Frau ein Geldstück, weil sie so arm schien und mir ihre schlichten Erzählungen das ganze Lebensbild jahrein, jahraus von Acapulco entschleiert hatten. Ob sich das herumsprach oder ob die Acapulcaner nur ungewöhnlich neugierig waren, weiß ich nicht, aber man rief mich in Hütte auf Hütte, und immer lag der Mann in der Hängematte, arbeitete die Frau vor dem Herde kauernd und saß ich auf einer umgestülpten Kiste, beantwortete Fragen und stellte sie, erfuhr, daß man eine nahende Riesenschlange am besten mit Steinwürfen vertreibt, wo die Schildkröten ihre Eier in den Sand legen, wie man nach Gold in den Bergen sucht und wo man in Mexiko dies oder jenes findet. Man sprach vom Ocelot, vom Puma, den Wildkatzen, dem Opossum oder Beuteltier, dem Coyote und so weiter. Wenn das Beuteltier verfolgt wird, stellt es sich nicht selten tot, läßt sich herumwerfen und rührt sich so wenig, daß man nicht einmal das Atmen bemerken kann, doch kaum ist der Feind weg, so springt es auf und läuft davon, daher sagt man in ganz Amerika »Opossum spielen«, das heißt, sich tot oder unwissend stellen.
Endlich war ich die Schar der Neugierigen losgeworden und wanderte allein über weitere Felsen und noch krummere Bergstraßen, wo schöne rosa Winden und die herrlichen Vulkanblumen blühten, sah Perroquitos mit einem gelben Fleck, doch größer als die in Panama, und kroch in eine Quebrada oder Schlucht hinab, wo Esel weideten, nicht ohne Besuchskarten zu hinterlassen. Abends spielt in dieser Quebrada unten am Meer die Musik, und die Füße der Schönen treten in die Eselserinnerungen.

Mexiko: Indianische Fruchtverkäufer auf dem Markt
An den Jiguerillos vorüber, aus deren Früchten die Eingeborenen Seife machen, gelangte ich wieder auf einen Bergabhang, auf dem Pincones, ein Abführmittel, wuchs, und besuchte einen Fischer in seiner Lehmhütte. Er erzählte, wie er die Schildkröten fing, indem er sie durch den Hals spießte und wie erbärmlich sie schrien, wenn dies geschah, wie man das Schildpatt ins Wasser legen müsse, um es bearbeiten zu können, und wie man es erst biegen könne, wenn es stark, aber vorsichtig erhitzt worden war. Die Riesenschildkröten werden nur gegessen, das Gehäuse ist wenig wert. Die Eier – oft zwölf Dutzend von einem Tier – werden in den warmen Sand gelegt und die Stelle mit den Pfoten gut vertrappelt. Die Eier der Riesenschildkröte sind fischig im Geschmack und so groß wie eine Orange.
Mein letzter Weg war zur altspanischen Festung jenseits der Klippen, wo man noch die ehemaligen Folterwerkzeuge sehen konnte. Von der angrenzenden Kaserne, zu der ein Palmenhain führt, genießt man eine sehr schöne Fernsicht über den verzweigten Klippenbau und Acapulco auf den Abhängen der Felsen.
Wohin man indessen in Acapulco geht, so wird man geduzt. Die Köter sind gut und – so weit ich Erfahrung habe – die Mannszweibeine leidlich. Von allen Orten war mir Acapulco weitaus der liebste. Oft wunderte ich mich über den Grund, und erst viel später erfuhr ich, daß schon seit Jahrhunderten Japaner nach Acapulco kamen und sich da ansiedelten. Das Mildere und Höflichere im Wesen verdanken die Bewohner gewiß der Beimischung aus Asien. Von hier aus fuhren einst die ersten spanischen Entdecker nach den Philippinen. Vier Monate dauerte die Hin-, vier Monate die Rückfahrt, wenn sie Glück hatten …
Um das Schiff lagen viele Kähne mit Verkaufsgegenständen – Zigarren, Schildpattwaren, Früchte, Körbchen und Tongefäße. Ich setzte mich dankbar an den Speisetisch; denn ich hatte seit dem Frühstück nichts gegessen, und es war Nacht.
Manzanillo.
Das Aepflein!
Ein hübscher Name für einen häßlichen Ort. Ich war froh, vom Schiff zu kommen. Auf so langer Fahrt werden die Männer wild, kämpfen, brummen, lieben; die Kinder, Affen und Papageien ergänzen den Lärm; das ewige Fleischessen macht krank und die Hitze erzeugt Gliederschmerzen. Wenn ich eine Weile in der gleichen Stellung verblieb, wurden die Gelenke ungehorsam wie das Elastik in einer Gliederpuppe. Die Schmerzen dauerten Tag und Nacht. Man bezahlt eine Studienreise sehr hoch. Wer nur im Deckstuhl liegt, hat es freilich besser. Ich muß, wenn ich todmüde auf Deck gekommen bin, malen oder schreiben. Und ich bin ein Opfer der Dritten …
Als ich die Leiter hinabhumpelte, standen vier Schiffer bereit. Jeder erhaschte mich bei einem Körperteil, um mich in sein Boot zu ziehen, und ich sah Sterne. Zuletzt siegte der braune Affe, der meinen solidesten Teil, das Magengebiet, erwischt hatte, und entriß mich mit einem Ruck den anderen. Dabei fielen wir bei einem Haar ins Wasser. So landet man in Manzanillo.
Auch Manzanillo klettert zwei Hügel empor, die indessen nur wie grüne Schnecken auf einsamer Landstraße inmitten der weiteren Ebene und der geringen Erhebungen des Hinterlandes wirkten. Weit dahinter schieben sich höhere Berge heran, und deshalb bläst ein etwas kühlerer Wind herunter. Die Leute waren weniger gastlich oder neugierig; vielleicht machte ich auch – da mir elend war – weniger freundlich einladende Nasenlöcher.
Alles reitet auf Mauleseln und Eseln, die sogar durch die schmutzigsten und abschüssigsten Gäßchen sicher gehen. In die weitere Umgebung wagte ich mich nicht, da die Mexikaner das Lasso gebrauchen und so nicht selten auch Menschenopfer einfangen, die dann neben ihren Rossen herlaufen und ihnen blindlings, Gott weiß wohin, folgen müssen.
Die Köter waren nicht bösartig, obgleich keiner so schöne Namen wie in Acapulco (Schmetterling, Hausfreund, Freudennuß) führte.
Vor dem Ort waren einfache Häuschen aus alten Petroleumbüchsen erbaut worden; Fenster hatte man vergessen, und die Bank davor war eine Reihe alter Zuckerkisten. Die Ziegel der besseren Häuser erinnern an sanft ansteigende Wellenkämme und verraten daher doch schon Eigenart. Von hier fährt die Eisenbahn nach Colima und ist in zwei Tagen in Mexiko, der Hauptstadt.
Später besuchte ich, wie überall, den Markt, beschaute die dunkelvioletten, runden Tomaten, die eine äußere grüne Schutzhülle haben, die Granatäpfel, Alligatorbirnen, Zitronen und die luftballonartigen, bald roten, bald blauen oder grünen, nußgroßen Kugeln, die in Wahrheit Kaugummi sind. An solch einer Kugel, die den Mund völlig ausfüllt, kaut man drei Stunden. Man verkaufte auch in Essig gelegtes Kraut, saure Gurken und vor allem Bananen und Zuckerrohr.
Schweine, wohin man schaut, und Zopilote, die allen Unrat auffressen; zwei kleine Friedhöfe hinter dem Hügel unweit eines Sees, wo man von Fiebermücken angefallen wird, und vor allem Fliegen. Millionen!
Hier findet man die gefürchtete Palanca- und die Weinschlange, die sich durch starken Weingeruch zu erkennen gibt, und im Meer gibt es Mantel-, Schleier-, Schwert- und Sägefische.
Als ich am Abend im Park von Manzanillo, dem Giftäpfelein, saß, klopfte mir jemand von hinten auf die Schulter. Es war ein kleines Mädchen. Es lachte mich an und fragte mich nach meinem Namen und woher ich gekommen. Wir sprachen eine Weile zusammen, und die kleine Mexikanerin gab mir ein »Zuckerl«. Ich habe oft an das Kind gedacht; es war die einzige Gabe aus Mexiko …
An Bord verteilte der Kapitän Handtücher an alle Passagiere und die Mannschaft, und wir mußten auf die Fliegenjagd gehen. Das Schiff war schwarz von ihnen, und wir fegten die Leichen der Erschlagenen ins Meer.
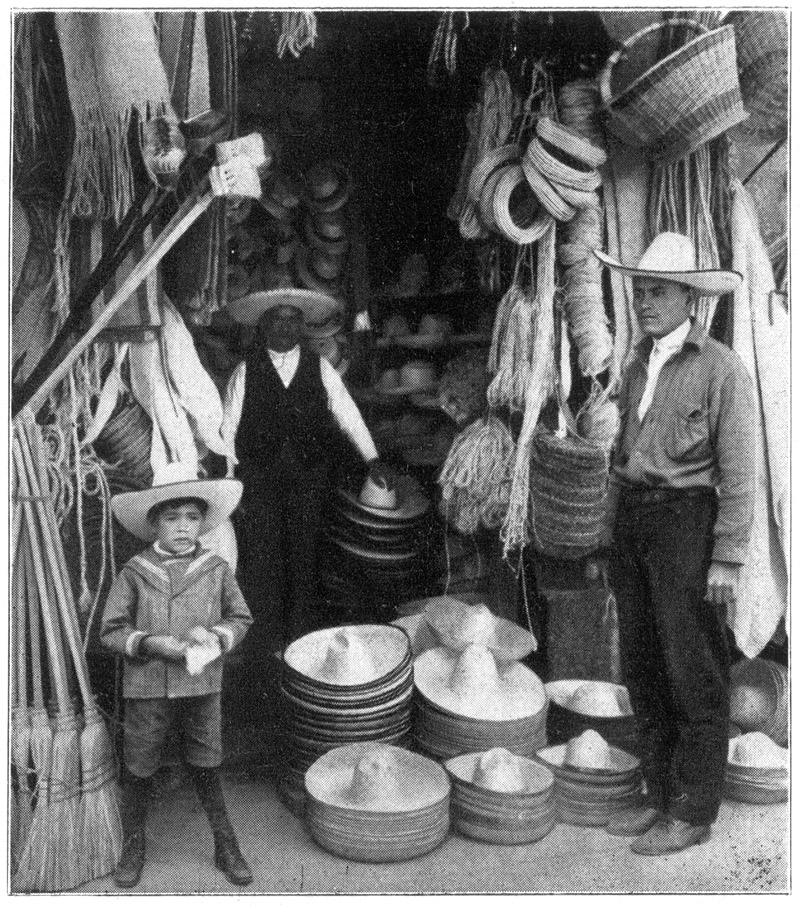
Mexiko: Ein Laden für Mexikanerhüte
Mazatlan.
Der Ort liegt an dem Wendekreis des Krebses und ist heißer als andere Orte Mexikos.
Und Fliegen!!! Der Kapitän blieb drei Meilen draußen vor Anker, um der Brut zu entgehen, und als ich an Land ging, glaubte ich auf Rosinen zu gehen. Es waren aber nur Fliegen, die auf dem Sande saßen.
In der Markthalle war alles, aber auch alles unter Netzen, und unter den Netzen saßen noch Fliegen. Sie gingen in Nase und Ohren; sie waren allgegenwärtig. Schwarz waren die Wände von ihren Zeichnungen und schwarz alles, worauf sie sich niederließen.
Das Colegio Aleman, von einem Deutschen geleitet, ist sehr hübsch gelegen; die Kirche nett, die Geschäfte schon vielversprechend, und die kugelförmig geschnittenen großen Bäume auf dem freien Platz entschieden eigenartig anziehend. Wer die Hitze und die Spanier liebt, kann in Mazatlan schon leben. Ich freue mich, den letzten Hafen erreicht zu haben, der Mittelamerika angehört. Zu bitter ist mein Reisen durch die Gebiete der Mischlinge gewesen.
Die Stadt – denn das ist sie schon – liegt in der Sinaloaprovinz, an der Einfahrt in den tiefen und heißen Golf von Kalifornien, wo Perlmuttermuscheln und Schildkröten in Mengen zu finden sind und von wo aus man die reichsten Bergwerke Mexikos erreichen kann. Hier findet man ebenfalls einige Ruinen aus der Aztekenzeit, und oben auf dem Hügel der Einfahrt liegt die Sternwarte.
Dicht vor Mazatlan liegen die Revillagigedoinseln, auf denen einige Engländer in trostloser Einsamkeit leben; eine der Inseln ist Strafkolonie, und ein Amerikaner, der einmal in Mexiko ein berühmter Räuberhauptmann war, denkt dort über die Wechselfälle des Lebens nach.
Vor Los Angeles.
Ein 25 Meter langer Walfisch tauchte in Schiffsnähe auf und spie Wasser und Weltverachtung neben uns aus. Die Küste war kahl und trostlos bis dicht vor San Diego. Das Wetter war umgeschlagen und plötzlich kalt. Ich hüllte mich in meinen Jerusalemschal und fror, daß die Zähne klapperten. Möwen, schneeweiß mit grauen Schwingen, zogen vorüber, und fliegende Fische schnellten aus dem Wasser empor.
Los Angeles ist der Ort der Sterbenden. Die Leute, die hier gute Geschäfte machen, sind vor allem die Bestattungsunternehmer. Es werden Leichenzimmer angezündet und wie Hotelzimmer gemietet. Viele glauben in diesem milden Klima in ewigem Sonnenschein gesunden zu können und lasten ihre Knochen im weichen braunen Sand. Die verschiedenen religiösen Sekten blühen hier aus dem gleichen Grunde; denn bei so viel Bestattung interessiert das Kommende. Erst in dritter Linie kommen die Filmgesellschaften.
Hinter Los Angeles liegt das Imperial Valley (Kaisertal), und das liegt mitten in der Wüste. Im Hause selbst ist zur Sommerszeit die Hitze so ungeheuer, daß man nicht den bloßen Arm auf eine Holztischplatte legen kann, ohne das Empfinden einer Verbrennung zu verspüren. Viel ärger als in den Tropen ist die Hitze der Subtropen in den kurzen Sommermonaten, doch dafür ist der Winter ein langer, sonniger Herbst.
Hinter San Diego kam San Pedro und Santa Monica. Früh am Morgen fuhren wir am Kap Santa Barbara vorüber und gegen neun Uhr an dem von Concepcion mit dem besten Leuchtturm der ganzen Küste. Der weiße Rauch eines Zuges glitt wie ein Nebelschweif die kahle braune Küste entlang.
Masern sind ausgebrochen. Das wird die Landung noch erschweren.
Auf der Engelinsel.
Bei den Nordamerikanern ist alles Pose: Ihr Fortschrittsgeist, der nur die Neugierde eines Kindes ist und schnell erlischt, wenn nicht großer Gelderfolg der Lohn ist; ihre Sucht nach Tugend, die das Land »trocken« macht und nur Trinker erzieht, dabei aber Millionen in erhöhten Preisen in die Taschen der Händler spielt; ihr Drang nach Wissen, der wie ein fliegender Fisch über die Oberfläche schießt, und ihr Volkstum (ihre gepriesene Demokratie), die nur auf dem Papier und im Munde ist, denn nirgends auf Erden wird der arme Schlucker, der sich nicht die erste Klasse nach Amerika leisten kann, so elend und schimpflich schlecht behandelt, wie gerade in dem »freien« Lande. Und an der Westküste können die Nordamerikaner nicht einmal einwenden, daß sie den Strom der Zuwanderung hemmen und prüfen müssen. Es wandert ja so gut wie niemand von da ein, und warum darf der Schurke, der in der Ersten fährt, seiner paar Dollars halber unter Bücklingen ans Land, während der arme Gebildete in der Dritten sich jede Demütigung gefallen lassen soll?
Vor dem Landen – es war zwei Uhr nachmittags, und nur die Passagiere der ersten Klasse konnten an einem Samstag abgefertigt werden, die armen Teufel der Dritten, die es wahrlich nötiger hatten, aus der Hölle herauszugelangen, sollten nach der Engelinsel – drückte mir ein Matrose eine dickbauchige Flasche in den Arm und sagte mir, ich möge »Magenmittel« sagen, wenn ich am Zollamt vorbeiginge. Gleichzeitig bemächtigte er sich meiner Schreibmaschine und eilte davon, und meiner Erika wäre ich mit zehn Schnapsflaschen durch feindlichen Kugelregen nachgegangen. Auf dem Schifflein tauschten wir unsere Schätze. Das ist amerikanische Ehrlichkeit!
Die Engelinsel war bald erreicht, und durch einen schönen Park begaben wir uns hügelwärts. All unser Gepäck war in einem Raum neben dem Landungsdamm geblieben. Als wir in den Schlafsaal traten, stiegen mir die Haare zu Berge. Drei Reihen Eisenbetten wie in Gefängnissen waren übereinandergetürmt – dreiundvierzig Betten alles in allem – und nicht ein Stuhl im ganzen weiten, unfreundlichen Raum!
Mit Hilfe der Negerin legten wir sechs Matratzen auf zwei der untersten Betten und füllten damit die Oeffnung so weit aus, daß wir das Kind unbesorgt zwischen uns legen konnten, sonst wäre es sicher auf den harten Boden gefallen. Graue Wolldecken, aus denen wer weiß wer und wieviele gelegen hatten, wurden uns auf besonderes Verlangen gegeben, und als ich ernstlich böse wurde, gestattete man mir als Schriftstellerin, etwas aus meinem Koffer vom Landungsplatz zu holen. Hierauf wurde uns gesagt, daß jedes Verlassen des ersten Stockes und das Betreten der Treppe mit 14 Tagen Arrest bestraft werden würde. Im Speisesaal waren Männer und Frauen streng geschieden, und Gatte und Gattin durften nicht zusammen sprechen. So schnell wurde aufgetragen, daß man das Gebotene in sich hineinwerfen und in den »Kerker« zurückkehren mußte. Die henkellosen Kaffeetassen – für Chinesinnen und Japanerinnen bestimmt – brannten die Finger.
So viel Wanzen habe ich selten in einer Nacht genossen wie in jener auf der Engelinsel. Beryl weinte fortwährend und ihr Wässerlein lief trotz eines Tuchschutzwalls zu mir herüber. Die Frau aus Guatemala mit ihrer Dienerin schnarchte wie ein Walroß und die Costaricarin stöhnte » Ave Maria purisima«.
Gott zuerst, das war wirklich eine Höllenreise!
Am nächsten Morgen stellte ich meine Erika (die ich erobert hatte) auf eins der untersten Betten und schrieb stehend meine Reiseberichte heim. Ich war die Einzige, die englisch sprach, außer der Negerin, die zu erschreckt war, um einen Laut auszustoßen, und daher hieß es immer:
»Eine Ihrer Gruppe hat … die Treppe erreicht, den Deckel des Hauses der Erleichterung offen gelassen, das Wasser ausgeschüttet« oder eine andere Unart begangen. Zu »meiner Gruppe« gehörten Chinesinnen, Frauen aus Mittelamerika, dunkle Mischlinge, die ich kaum je angesprochen hatte. Unter all diesen war ich die einzige weiße Frau. Zum Schluß begannen wir aber alle, gemeinsam darüber zu lachen; denn wie kam ich endlich dazu, andächtig dabei stehen zu müssen, wenn eine »meiner Gruppe« die Kloake putzte oder nach ihrem Kinde den Boden aufwischte?
Der ganze Sonntag verging uns im Gefängnis, denn so schön die Anlagen waren und so blau der Himmel, wir durften uns nicht aus dem dumpfen Kerkerraum rühren und wurden selbst, polizeilich bewacht wie Verbrecher, in den Speisesaal zur halblauen Fütterung geführt. Noch eine Wanzennacht mit Beryl als Springbrunnen und die gutherzige Negerin zur Rassendurchduftung (alle Neger und auch die Indianer haben einen betont starken Rassengeruch), noch einen Morgen mit dem Geräusch der Asiaten in unseren Ohren, die sich vor der Türe die Zähne putzten und die Zunge reinschabten, dann führte man uns den Hügel hinauf zum Arzt, der mir bei der Augenuntersuchung fast die Wimpern ausriß, mir in Mund, Hals und beinahe in den Magen hinabschaute, mich Knie- und Armbewegungen machen ließ und mich endlich noch zum Frauenarzt schickte. Die Frau Doktor begnügte sich zu ihrem und meinem Heile mit einem Blick auf mein Gesicht. Ich dachte schon, es würde auf eine Jungfrauenuntersuchung ankommen, da diese Menschabart in den Vereinigten Staaten meiner späteren Erfahrung nach zu den vorgeschichtlichen Erscheinungen gehören dürfte, und endlich durfte ich als Führerin meiner Gruppe zu weiterer Untersuchung zum nächsten Behördenteil gehen. Hier mußten wir beweisen, daß wir lesen und schreiben konnten. Vor mir las die Costaricarin und die reiche Pflanzerin aus Guatemala, die es bitter beklagte, die Dritte gewählt zu haben, und dann kam ich, bereit, mit einem sanften Lächeln zu beteuern, weder in Wort noch in Schrift einer Sprache fähig zu sein. Der Beamte studierte indessen meinen Paß, in dem Journalistin stand, und stellte keinerlei Frage. Auch war ich ja der unglückliche Dolmetsch meiner Gruppe gewesen, von der ich nun Abschied nahm. Die Mutter der nassen Beryl, die mir dankbar war, empfahl mir eine Negerbekannte, und ungeachtet etwaiger Farb- und Rassenvorurteile anderer begab ich mich in ihrem Schlepptau nach Divesadero Road, wo ich ein kleines Zimmerchen inne hatte – das angenehmste, das ich seit Jahren bewohnt, weil es so unbedingt still war und ich außerordentlich lautempfindlich bin.
Am goldenen Tor.
San Francisco ist sehr schön. Die Straßen erinnern an London, auch die Aufschriften und das reiche Anzeigenwesen, doch fehlt der Stadt – bis auf das berüchtigte Chinesenviertel – der Reiz des Unerwarteten. Man weiß, wo eine Straße beginnen und wo sie enden wird, auch wenn sie drei Meilen lang sein sollte; man ahnt nach dem ersten Haus, wie alle weiteren Häuser dieser Reihe innen und auch draußen sein werden; man stößt nie auf etwas Altes, Sonderformiges, Ungewohntes. Das macht die Stadt ein wenig langweilig.
Am herrlichsten ist die öffentliche Bücherei, in der man Bücher in den verschiedensten Sprachen gegen die Unterschrift eines Hausbesitzers oder den Erlag von – glaube ich – zehn Dollars ausgeliehen erhalten kann, und wo angenehme Tische zu tiefem Studium im großen Saal einladen. Sonst findet man die üblichen Vorteile der Großstadt, doch weniger Musik als bei uns und keine Oper.
Die Geschäfte hatten für mich einen gewissen Reiz der Neuheit. Das beste bleiben die Delikatessenhandlungen, in denen man nicht nur die üblichen Wurst- und Brotsachen, sondern auch allerlei fertige Salate (Fisch-, Bohnen-, Erdäpfel-, Kraut- und gemischten Salat), Mayonnaise, heiße Würstchen, gekochten Hummer und andere Leckerbissen erhält, so daß man nie zu kochen braucht und dennoch gut speisen kann. Ich lebte von krachenden Röllchen und etwas Leberwurst, kochte Tee dazu und aß Pfirsiche in Mengen. Selten nahm ich drei Mahlzeiten zu mir. Infolge großer Gelenkschmerzen durch die plötzliche Abkühlung (San Francisco schien mir im August ein Eiskeller nach den Tropen) arbeitete und studierte ich im Bett unter vier Decken, aß mein Frühstück erst nach elf Uhr und machte daher das Mittagsmahl daraus, schrieb zwei oder drei Stunden auf der Erika, begab mich auf Studienwanderungen durch die Stadt oder nach dem Park des Goldenen Tores, malte, wenn noch Zeit blieb, tauschte Bücher in der Bücherei ein, kaufte wieder Röllchen und etwas Wurstsachen und kroch damit – Büchern, Wurst, Brot und so weiter – ins Bett, um unter den vier Decken schmerzlos die leiblichen und die geistigen Genüsse bis gegen Mitternacht zu genießen.
Das Schönste von San Francisco ist unzweifelhaft der Goalden Gate Park. Er liegt in erreichbarer Nähe von Divesadero Road (erreichbar ist für mich, was innerhalb einer halben Gehstunde liegt) und ist wie ein Wald in tiefer Einsamkeit. Man ahnt nicht die Nähe einer Großstadt. Hohe Eukalypten mit ihren mattgraugrünen, steifen, sichelförmigen Blättern bilden einen Schutzwall gegen die Straße und gleichzeitig einen ausgedehnten Hain. Die warme Sonne entlockt ihnen den harzigen Geruch, der so wohltuend wirkt, und das Mondlicht verwandelt sie alle in schimmernde Halbmonde.
Außer ihnen findet man Araukarien (Nadelbäume mit auffallend dicken zwergartigen Nadeln), subtropische Palmenarten, Ziersträucher aller Gattungen und Länder und Blumenbeete, die in allen Farben aus dem grünen Rasen glühen. Weiße Säulen spiegeln sich unvermittelt in kleinen, von buntlaubigen Bäumen umstellten Weihern, und überall, wo man auch geht, laufen einem zahm die grauen Eichhörnchen Amerikas entgegen, klettern einem selbst auf den Arm und betteln in entzückender Weise um Nüsse und Leckerbissen. Auch viele Vögel sind zahm, und unterzieht man sich der Mühe, den Park zu durchqueren, so erreicht man am unruhigen felsigen Strand die Klippen, auf denen die Seehunde tollen. Sie sind gar nicht scheu und machen die gelungensten Purzelbäume ins Wasser.
In San Francisco hatte ich zwei unerwartete Freuden: Man hatte mir zugeredet, doch auch für obersteirische Blätter zu schreiben, und mir fünf Adressen geschickt. Ein Beitrag erschien viel später im Obersteirer Blatt, drei blieben unbeantwortet und endeten vermutlich im Papierkorb, und der fünfte und – wie ich glaubte – schlechteste Beitrag (jedenfalls war mir der Panamakanal schon etwas über geworden als Thema) erhielt eine sehr nette Antwort vom Schriftleiter der Knittelfelder Zeitung, der um fremde Marken und weitere Beiträge bat und natürlich »Lieber Herr Karlin!« schrieb. Allmählich entspann sich zwischen uns eine bis auf den heutigen Tag bestehende Freundschaft.
Die zweite Freude löste sich unmittelbarer fruchtbringend aus. Herr Dr. Perz, der damalige Schriftleiter der Cillier Zeitung, hatte seine Schwester in San Francisco verheiratet, und diese hatte den Wunsch geäußert, mich, falls ich wider Erwarten nordwärts kommen sollte, kennen zu lernen. Nun besuchte ich sie und verbrachte viele sehr schöne Stunden in ihrem Hause, zumeist in ihrer Küche, für die ich große Vorliebe entwickelte.
Frau Rom sagte mir eines Tages: »San Francisco ist wunderschön! Hier ist es nie heiß!«
»Das merke ich zu meinem Schmerze,« erwiderte ich zähneklappernd, »mir ist noch nie warm geworden.« Meine erste Handlung war es auch gewesen, mir ein Wolljäckchen und warme Handschuhe zu kaufen, und wenn ich an einem windstillen Tage an der Sonnenseite eines Hauses dahinlief, konnte ich mir sogar vorstellen, daß es nicht unbedingt kalt war. Aber warm???!

Das Goldene Tor, die Einfahrt in den Hafen von San Franzisco bei Sonnenuntergang
Los Altos.
Ich kam durch Frau Rom mit sehr vielen Oesterreichern und Deutschen zusammen und wurde im Kraftwagen bis nach Los Altos geführt. Diese Vorstadt liegt wohl dreißig Meilen oder mehr außerhalb von San Francisco im Hügelland und die Fahrt dahin unter Eukalypten und sich verfärbenden Bäumen war wunderschön. Bald ist man unter Obstbäumen, unter denen die Pflaumen als blauer Teppich liegen (Pfirsiche werden den Schweinen vorgeworfen). Ueber all dem ist ein leuchtend blauer Himmel, und die Berge sind mattrotbraun, das einzig Tote im Bilde.
Es ist eine Eigenart der Vereinigten Staaten, daß man überall im Freien ein Zelt aufschlagen und wohnen kann. Wo ein freies Grundstück ist, darf man eine Weile lang wohnen, und daher ist eine Sommerfrische mit Kessel und wandernden Wänden sehr billig und interessant, wenn auch nicht übermäßig behaglich. Wir picknickten ebenfalls auf solch einem baumübersäten Rasen und genossen die Schönheit ringsumher, bevor wir bis nach Los Altos fuhren und auch da reichlich bewirtet wurden. Das war eine typische Farm mit Mandel-, Pfirsich-, Pflaumen-, Birn- und Nußbäumen. Die blühenden Bäume waren vorwiegend Akazienarten und Pfeffersträucher.
Von Los Altos aus kann man Mount Hamilton besteigen und die berühmte Sternwarte besuchen, doch gerade im August sind die Klapperschlangen blind, weil sie ihre Haut wechseln und infolgedessen nicht imstande, ihr übliches Warnungsklappern hören zu lassen, weshalb Bisse zu befürchten sind. Wir unterließen aus diesem Grunde den Aufstieg.
Wunderbar sind die in einiger Entfernung hinter Berkerley schon anzutreffenden Rotholzbäume. Sie sind teilweise so ungeheuer, daß ein Wagen mit Pferden durch ein Loch im Stamm unweit der Wurzel durchfahren kann, und vierzig Männer umspannen kaum die größten; doch schöner und wundersamer als das seltsame Schimmern ihrer rötlichen Rinde im Sonnenlicht und als der kerzengerade Stamm, ist ihr hohes Alter. Man vermutet, daß sie schon zu Christi Geburt große Bäume gewesen sein müssen, und daß manche vielleicht das Alter der Pyramiden haben. Was also hat solch ein Baum gesehen! Wie oft mag die Erde um San Francisco in Sprüngen aufgeklafft sein, um sich viel später wieder zu schließen? Welche Veränderungen hat das Meer, die Bucht hier erfahren? Was mag wohl der Wind, der bald von Alaska herabbläst, bald von Japan und China hersausend endlich diesen Widerstand findet, ihnen zugeflüstert haben? Was wissen ihre Kronen vom Sein der Welt?
Von den Wolkenkratzern, den betrunkenen Amerikanern und von Dingen, die jedermann aus tausend Berichten weiß, will ich gar nicht sprechen. Erwähnen möchte ich dagegen, daß eine sehr schöne Sitte es der anständigen Frau gestattet, sich – wenn sie allein nachts gehen muß – in die Flagge der Streifen und Sterne zu hüllen. Beleidigt oder belästigt sie nun ein Mann, so beschimpft er die eigene Landesfahne und wird sehr streng bestraft. Für Ueberfall – auch wenn die Frau keine anständige sein sollte – ist die Strafe bei erwiesener Gewalt fünfzehn Jahre schwerer Kerker. Vergreift sich ein Neger, so wird er gelyncht. Man wandert also ziemlich sorglos durch San Francisco. Im kalten Klima – und der Wind kann einem das Mark gerinnen machen – gehen die Mannszweibeine (zum Unterschied von richtigen Männern so genannt) nicht so leicht aus den Fugen.
Ganz schlimm ist der Nebel. Manchmal verließ ich um zehn Uhr die Bücherei und fand das Straßenpflaster völlig naß.
»O Himmel, es regnet!« rief ich da wohl entsetzt, mit den Gedanken mitleidig bei meinen weißen Schuhen mit absatzlosen Gummisohlen, von denen ich ebenso wenig wie von meiner Erika zu trennen war.
»Woher denn, Miß«, meinte da irgend ein San Franciscaner wegwerfend, »das ist ja nur Nebel!«
Immerhin Luftfeuchtigkeit genug, einen Mantel zu durchdringen und das Gefühl nasser Kälte zu erzeugen.
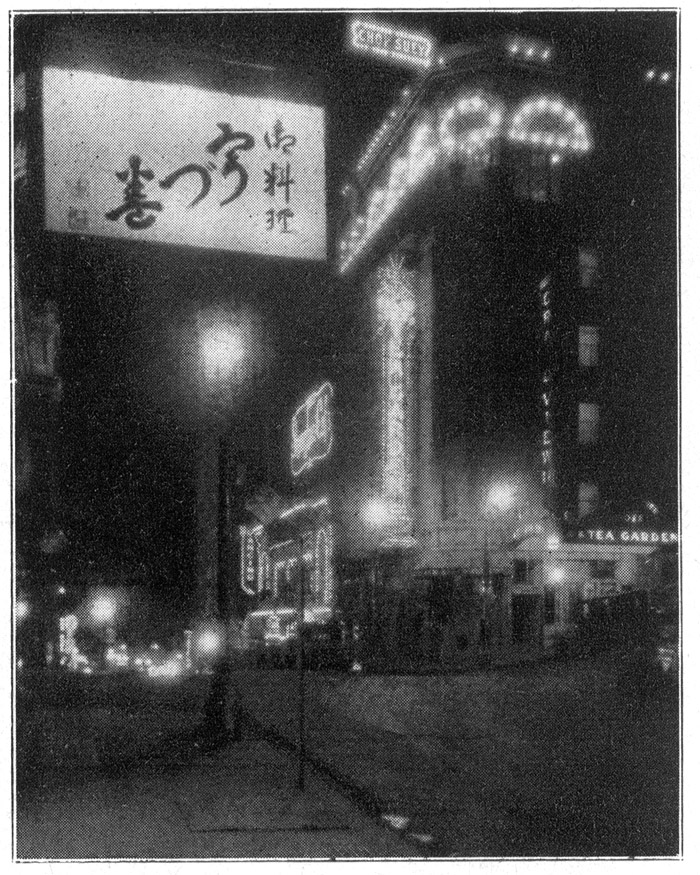
San Franzisko: Nachtstimmung im Chinesenviertel
Auf dem »Empire State«.
Zwei Monate verweilte ich in San Francisco, lernte Land und Leute kennen und durfte mich in der prachtvollen Bücherei auf meine weitere Fahrt vorbereiten; denn nur nach eingehender Vorbereitung hat ein beschränkter Aufenthalt in einem Lande Wert, sonst sieht man einzig das Oberflächliche und geht ewig irre.
Ich wählte endlich zum Ziel die Sandwichinseln, heute Hawaii, von wo aus ich entweder nach dem eigentlichen Südseeinselreich abschwenken oder den Weg nach Japan einschlagen konnte.
Es war der erste feierliche Dampferabschied. Von Genua war ich bei fallendem Regen im Dunkeln weggefahren, von Peru aus hatte ich nur Küstendampfer benützt, doch der »Empire State« kreuzte die ungeheure Fläche des Stillen Ozeans, und daher spielte die Musik feierliche Weisen, während die Taue gelöst wurden. Papierschlangen flogen durch die Luft. Menschen weinten oder winkten, und wieder fuhr ich mutterseelenallein in die Ferne.
Und noch einmal im Zwischendeck.
Zu Land bin ich – vermutlich weil ich irgendwo auf Erden Haus und Weingarten habe – der Kapitalist, der auf das Volk herabsieht, nicht in Hochmut, bewahre, aber doch mit dem unzweifelhaften Empfinden einer Grenze. Ich schätze geputzte Fingernägel und Nasen, ich liebe gute Umgangsformen, und ein ungeschliffenes Wesen, auch wenn von Tugenden begleitet, hat bei mir nie sonderlich viel Anklang; auf Deck dagegen bin ich nicht nur Sozialist, sondern ein erbitterter Kommunist und geheimer Umstürzler. Warum behandelt man den, der nicht mehr als fünfzig Dollars für eine kürzere Fahrt bezahlen kann, wie ein minderwertiges Tier und den, der hundertfünfzig aus seinem Ueberfluß zahlt, wie einen gottbegnadeten Fürsten? Einfachere Lager, einfachere Kost, ungünstigere Schiffsteile zur Verfügung – all das ist selbstverständlich, aber dieses wegwerfende Behandeln der Zwischendeckreisenden ist etwas, das in unserem Volkszeitalter verboten werden müßte. Die Amerikaner, die immer von ihrer gepriesenen Volksherrschaft reden, kennen überhaupt nur Erste und Dritte. In der Dritten fährt »Tier«, in der Ersten die Spitzen der Nation.
Auf diesen Dampfern ist in der Ersten auch die Farblinie gezogen. Chinesen, selbst wenn reich, Japaner oder andere »Farbige« wie man da sagt, dürfen nicht aufgenommen werden. Sie fahren in der Dritten unter der menschlichen Ausschußware. Aus diesem Grunde saß auch ich mit einer Russin, die Amerikanerin geworden war und einen Chinesen geheiratet hatte, unten im grausen Zwischendeck, obschon sie das Geld zu besserer Ueberfahrt besaß. Außer uns beiden gab es nur Japanerinnen, Chinesinnen, einige Portugiesinnen (ebenfalls braun und nicht weiß), eine Philippinoschönheit wie eine eingedorrte Walnuß und irgend ein Wesen, aus mehreren Rassen zusammengegossen. Die Asiatinnen waren natürlich alle verheiratet, und die Männer kamen zu allen Stunden des Tages und der Nacht, sprachen laut, aßen in der Kabine, kleideten sich um. Ich hatte, wie immer, um ein Oberbett gebeten und sah auf all das Treiben mit meiner Erika hinab. So unsicher waren die Verhältnisse, daß ich die Schuhe anbehalten mußte, um sie über Nacht nicht zu verlieren, und mein Koffer, mein einziger Koffer, war unten im Schiffsraum. Aus Versehen hatte man ihn mir weggenommen und dort hineingeworfen. In Honolulu konnte man ihn nicht finden, beteuerte, ihn auf den Damm gestellt zu haben, und zahlte mir für den Verlust trotz all meines Zorns keinerlei Entschädigung. Der Koffer fuhr unterdessen nach Singapore und kehrte nach drei Monaten ehrlos und etwas stärker verbogen, samt Inhalt zu mir zurück. Darin befand sich das von mir selbst zusammengestellte und handgeschriebene Wörterbuch in zehn Sprachen und der peruanische Götze, so daß meine Freude beim Wiedersehen ungeteilt war.
Das Geschrei der Kinder war ununterbrochen im Schlafraum, und orientalische Frauen – besonders Japanerinnen – schlagen die Kleinen nie. Sie klopfen ihnen beruhigend auf den Rücken und damit endet alles. Hat das Kind sich ausgebrüllt, so ist es von selbst wieder still.
Am schrecklichsten empfand ich das Essen. Wir aßen an langen ungedeckten Tischen, und die Speisen wurden mitten daraufgestellt. Nun mußte man zusehen, daß man etwas erhaschte, denn die Portugiesen waren wie Wilde. Sie überluden ihre Teller in der Angst, nicht genug zu erhalten, und die besten Brocken waren weg, ehe man an den Topf herankam. Oft ließen sie Speise zurück, aber immer auf ihren Tellern …
Auch war die Kost so geschmacklos, daß wir oft den Chinesen Reis abbettelten.
Der Steward und Obersteward waren sehr nett, und auch die Offiziere – bei den wenigen Begegnungen – zuvorkommend. Es sprach sich herum, daß eine Journalistin in der Dritten fuhr, und bald brachten mir die Damen Körbe von schönem Obst (Abschiedsgaben aus der Heimat) zur Verteilung unter die armen Asiatinnen, und ich hatte auch selbst Obst genug. Mich reizten am meisten die Körbchen selbst, die ich aber, um mich nicht zu belasten, schließlich dennoch wegschenkte. Von da ab stiegen Männchen und Weibchen auf das niedere Deck herab, und zuerst hatte ich große Freude daran. Als aber eine alte Dame mich wie einen vorzeitlichen Dinosaurus nach allen Seiten drehte, mich nach dem Alter meiner Eltern fragte und meine Kopfweite (die angeblich eine besondere war) zu messen begann, wurde meine Begeisterung zu Wasser. Ich schien mir wie eine Leiche auf dem Aufschneidetisch. So nett die Gaben waren, so empfand ich die Demütigungen bitter, da ich nicht das Gefühl hegen konnte, die Gaben von Gleichgestellten zu erhalten. Was immer ich zu Lande war – zu Wasser war ich nun ein Stück der menschlichen Ausschußware und das übergroße Interesse, das meinem vom Zahn der Zeit und des Schicksals stark verbissenen Hute gezollt wurde, trieb mir die Gänsehaut über den Rücken. Nichts empfand ich auf meiner weiten Reise so furchtbar, wie die Blicke der Ersten auf mich unten im Zwischendeck. Da hinauf gehörte ich meiner heimatlichen Stellung, meiner Bildung und meinen Wünschen nach, und hier unten, in Schmutz, Unwissenheit und Unschliff mußte ich mich herumtreiben, einzig weil wir ehemaligen Oesterreicher ein verarmtes Volk geworden sind …
Güte aber herrscht unter dem Wrack des Zwischendecks und man lernt das Leben tausendmal besser kennen. Was erzählten mir alle die, die eine westliche Sprache verstanden! Und beim Abschied drückte mir eine Chinesin mit geheimnisvoller Gebärde einen Brief in die Hand. Ich nickte, eilte vom Schiff und steckte das Papier in die Tasche. Später, als ich das Schreiben aufgeben wollte, sah ich zu meinem Schrecken, daß keine Adresse daraufstand, und als ich es erbrach, um Näheres zu erfahren, fand ich für mich einen Dollarschein! Selbst die Asiatin hatte ermessen, wie arm ich sein mußte, um als Europäerin im Zwischendeck zu reisen. Sie half als Frau der Frau …
Honolulu auf Oahu.
Hilo mit dem wunderbaren Krater von Hale mau mau, dem »Haus des ewigen Feuers«, der einen Teil von Kilauea einnimmt, ist die größte der Hawaiischen Inseln; doch Honolulu auf der kleineren Insel Oahu ist der Haupthafen der Gruppe und wird von allen Schiffen berührt, die von Osten nach Westen fahren. Es hat daher einen ausgedehnten Hafen, und man findet da Menschen aus aller Herren Ländern, die alle fühlen, daß sie ihre Sitten und oft ihr Herz daheim im Mutterlande gelassen. Aus diesem Grunde ist Honolulu nicht viel weniger sündig als das schöne Panama, aber man verzeiht ihm die Sünde schwerer, weil es Weiße sind, denen die Gruppe gehört, und nicht Mischlinge, und weil das Klima nicht so verheerend wie das Mittelamerikas ist. Die Inseln liegen an der Aequatorialgrenze und sind im Winter angenehm warm, im Sommer nicht unerträglich heiß (für Tropenbegriffe).
Die Insel Oahu ist wild zerklüftet, und man merkt es den Bergen an, daß hier das unterirdische Feuer erbarmungslos gewütet, die scharfen Tropengüsse das Erdreich bearbeitet haben, denn alle Abhänge sind rissig und stark gefurcht; die Spitzen sehen oft haarscharf aus, und das Felsgestein schimmert überall aus dem hellen Grün. Es gibt nichts Schöneres als das enge, ansteigende Nuuanutal, wo der Weg von Guavabäumen (gelbe Früchte mit vielen roten Samen, schmackhaft, aber mit im Anfang unangenehmem Geruch) und den langnadeligen Kasuarinabäumen (Eisenholz) begrenzt ist, und das in einer Reihe steilabfallender Felsen endet, über die hinab der siegreiche Kamehameha seine Feinde in den Tod auf den Klippen und in das Meer trieb. Wunderschön lichtgrün und glatt wirken die Wiesen, lieblich blühen die großen, hellfarbigen Tropenblumen, goldgelb leuchten aus dem Gesträuch der Gärten die Kelche des Alimanders und mit weichem Rieseln fließen die Bäche aus geklüftetem Gestein. Japaner und Chinesen arbeiten in ihren Gärten, und um den Pali, die obersten Felsen, wirbeln die feinen weißen Nebel, in denen die Elfen hausen sollen.
Lieblicher, weiter ist das Manoatal, in dem es fast immer regnet, wenn der Regen auch eher einem starken Nebelreißen gleicht und überraschend schöne Regenbogen ihm folgen. Berühmt ist natürlich der Strand unter dem Diamantenhaupt – der weite Strand von Waikiki (springendes Seewasser), wo die Leute baden und der beliebte Sport des Wellenreitens stattfindet, wo in den Berg eingebaut, allen verborgen, die Kanonen sind und wo man die Wasserbehälter mit den Tropenfischen findet. Ich gerate nicht leicht in Entzücken, aber diese Fische sind mir immer als das Prachtvollste der Südsee erschienen. Ihre Formen sind so seltsam – sie gleichen Fröschen der Vorzeit, breiten Bändern, flachen Tellern, Schmetterlingen, Nadelkissen und anderen undenkbaren Dingen, und dabei haben sie Farben, wie man sie nur im Künstlerrausch träumen kann: tiefgelb mit einem leuchtenden schwarzen Schatten, blau wie ein Sommerhimmel mit rosa Lichtern, lichtgrün wie ein warmer Lenzwald im Mai mit braunen Schatten und goldig wie zerflossenes Sonnenlicht. Manchmal haben sie das Auge auf dem Rücken, oft hervorstehend wie einen Knopf, zuzeiten wie eine Perle auf dem schwarzen Streifen um den Körper und immer schimmern sie im Wasser wie aus feinster Seide gemacht. Man sieht den gefährlichen Polypen mit seinen furchtbaren Fangarmen und die Meerspinne mit ihren unzähligen Beinen. Stundenlang konnte ich durch das graue Häuschen wandern und die Wunder der Tiefen bestaunen.
Oahu ist die befestigtste Insel der Nordamerikaner, und sechzig bis achtzigtausend Mann liegen auf der Ebene in Baracken und Zelten, um bereit zu sein, die Gruppe gegen die Japaner zu verteidigen. Im Grunde aber ahnt jeder Amerikaner, daß sie gegen eine feindliche Flotte nicht zu halten ist. Auch erhöht ein anderer Umstand das Interesse der beiden Großmächte des Stillen Ozeans an diesen Inseln. Um Oahu hebt sich langsam der Meeresboden; warum, weiß man nicht genau, wahrscheinlich infolge von Sandverschiebungen und Druck von der Behringstraße herab. Sicher ist, daß schon in fünfzig Jahren ein Gebiet wie das heutige Kalifornien dazugewachsen sein wird, und die Amerikaner dadurch in unerwarteten Landbesitz kommen werden, was auch den Japanern nicht unwillkommen schiene.
Ich wohnte in einem Holzbau in Circular Lane. Nicht immer konnte ich wohnen, wo ich wollte, mußte ich doch auf Billigkeit den ersten Wert legen. Die Aussicht ging auf die Punschschale (Punschbowl), – einen alten Krater unmittelbar hinter Honolulu und seiner Form halber so genannt – und einige Gärten. Immer war es grün um mich her, und ich bedurfte dessen in einer Art, wie ich das heute gar nicht genug beschreiben kann. Obschon ich mich scheinbar ganz von Peru erholt hatte, waren mir zwei Dinge geblieben: eine große Verbitterung und Gereiztheit, die in langen Weinkrämpfen zu enden pflegten und die sich nicht überwinden ließen, und ein seelisches und geistiges Unklarsein, das sich besonders im Gespräch kundtat. Ich konnte meine Gedanken nicht wie einst klar ausdrücken, außer auf schriftlichem Wege, und ich erhielt meine geistige Vollkraft erst lange nach Japan zurück …
Dies aber machte mich empfindlich und menschenscheu, und die Demütigungen, die mir in Honolulu wurden, waren die schwersten der ganzen Reise, wenn sie auch – im milderen Licht der Vergangenheit, nicht so schaurig waren. Sie bezogen sich durchweg auf meine Kleider.
»Mein Gott, warum pudern und schminken Sie sich nicht? Warum tragen Sie nicht moderne Kleider? Warum nicht Seidenstrümpfe?«, kurz, der Fragen war kein Ende. Einmal sagte mir ein steinreicher Amerikaner, dessen Korrespondenz ich gern geleitet hätte:
»Ich würde Sie gern anstellen, wenn Sie wie eine Tausenddollarpuppe angezogen wären …«
»Ich dachte, Sie brauchten jemand, der für Sie arbeiten kann!« erwiderte ich kalt und verließ das Amt.
Ein anderes Mal sagte mir jemand:
»Gut, ich stelle Sie an, doch jeden Sonntag müssen Sie mit mir hinausfahren, und da werden wir eine herrliche Zeit haben!«
Ich lehnte das Anerbieten ab. Nicht aus Prüderie, wie ich schon oft erwähnt habe. Ein Weib mag sich schenken – das ist ihr Eigenrecht. Man tauscht sich für höhere Werte aus. Sich aber mit Haut und Haar einem Vorgesetzten »auszuleihen«, ist mir auch zur Zeit größten Hungers nicht in den Sinn gekommen. Eine Frau muß auf sich einen Preis setzen, ganz besonders, wenn sie Künstlerin ist. Ein Schwein wühlt mit anderen Schweinen im Dreck, ein Adler paart sich meinetwegen in den Lüften oder schwebt allein. Dem Schlamm überläßt er, was in den Schlamm gehört. Dort ließ ich die Mannzweibeine dieser Auflage.
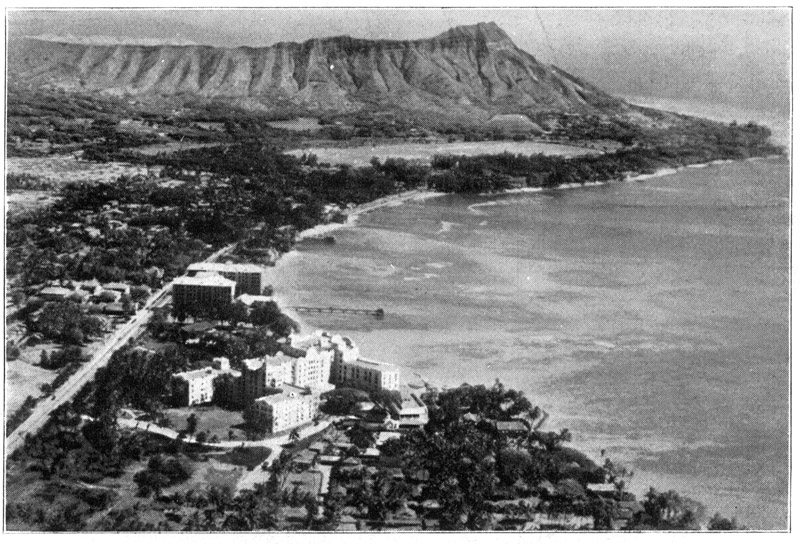
Hawai: Luftaufnahme von Waikiki
Das Blatt im Zaun.
Indessen – trotz Mangel an Schminke und Puder, die mir immer eine widrige Tünche gewesen, der ich fern geblieben bin, wie allem, was falsch ist oder unrichtige Vorstellungen erweckt, – und trotz meiner Kleider, die weder schön noch modern waren – fehlte es mir nicht an einer gewissen allgemeinen Anerkennung. Das kam so:
Schon auf dem »Empire State« hatte man sehr liebenswürdig von der Schiffahrtsgesellschaft aus den Schriftleiter des Star Bulletin auf mich aufmerksam gemacht, und zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich »interviewt«. Schon in Panama hatte man über mich berichtet, doch in gedrängter Form. Hier aber schrieb man eine lange Wurst über meine Reise, meine Erlebnisse und Pläne und dadurch wußte jeder in der weißen Ansiedlung (in Honolulu gibt es, wie schon erwähnt, alle Rassen und Völker, und die Europäer sind im Verhältnis gering an der Zahl), wer ich war und was ich in Hawaii wollte.
Eines Abends saß ich wie gewöhnlich in der schönen luftigen Bücherei und studierte die Vorgeschichte der Inseln, als sich jemand von rückwärts über mich neigte und meinen Namen nannte. Ich sah auf und erkannte einen Bekannten aus Panama, der mir seine Adresse mit der Bitte gelassen hatte, über die Inseln als Aufenthalt für Pflanzer zu berichten. Da ich indessen noch keinerlei Erfahrung erworben hatte, war keine Antwort abgegangen, und hier war er nun auf dem Wege nach dem Südseeinselreich, um sich irgendwo niederzulassen. Als er Honolulu erreicht hatte und einsam durch die Straßen ging, sah er in einem Zaun eine zusammengerollte Zeitung, die jemand weggeworfen hatte, und auf der ersten Seite, ihm ins Gesicht starrend, war mein Name! Nun wußte er, daß ich an zwei Orten früher oder später auftauchen würde: am Postamt und in einer Bücherei. So ging er zuerst in die Bücherei, und am ersten Tisch – noch mit dem Hut aus Panama – saß ich.
Er blieb mehrere Monate in Honolulu, und da er nach Tahiti wollte, unterrichtete ich ihn in freien Augenblicken in französischer Sprache. Geld dafür nahm ich keins, denn wir waren im Augenblick beide arm, doch kaufte er mir bei einer erfahrenen Japanerin zuzeiten eine Apfeltorte, die ich mit Freuden verschlang und die – warm genossen – auch verdaut wurde. In kaltem Zustand war sie schon gefährlicher, doch besaß ich damals noch eine Magenwand wie die Haut eines Nashorns und überlebte viele solche Torten.
Die Zuckermühle.
Weit fort von Honolulu wagte ich mich in der ersten Zeit nie, denn ich war zu sehr verschreckt geblieben, aber mit dem alten Südsee-Ansiedler ging ich gern in die Schluchten, und eines Tages überholte uns ein Kraftwagen auf der Straße nach Eewa. Der Herr rief uns an, erklärte, er kenne mich (gesegneter Star Bulletin!) und lud uns beide ein, mit ihm zu fahren. Es war der Schulinspektor, und ich hatte dadurch Gelegenheit, viele Schulen zu besuchen, die Unterrichtsart Amerikas in fremder Ansiedlung kennen zu lernen und mich über all die Kinder zu freuen, die gelb, braun oder bleichorange auf den Bänken saßen. Einzelne Kinder waren nicht nur sehr aufgeweckt, sondern auch lieb, und als ich ihnen von unserem Land erzählte – den Schnee vor allen Dingen beschreibend, von dem sie keine Ahnung hatten – sprachen mich viele harmlos an und forschten mich über Europa aus.
Hierauf führte uns der Herr in die angrenzende Zuckermühle; denn Zucker ist neben Ananas und Bananen das Haupterzeugnis von Hawaii. Auf den Feldern arbeiten Portugiesen und in der Fabrik Filipinos, zuzeiten auch Chinesen. Man zieht natürlich eigene Staatsangehörige vor und vermeidet das Anstellen von Japanern, die sehr tüchtige Arbeiter, doch zu sehr mit Augen und Ohren versehen sind, die alles hören, alles sehen und die es dann ermöglichen, daß die Japaner den Weißen alles nachmachen.
Das Zuckerrohr ist sehr schwer zu bearbeiten. Es erfordert richtiges Anpflanzen und Beobachten, genügend Regen bis nahe zur Reife und dann Dürre oder wenigstens starke, ununterbrochene Sonne, dann wird das Rohr süß. Es ist sehr hart und kann nur einzeln mit dem Messer geschnitten werden; es wiegt viel und ist so hart, daß man es mühselig zum Wagen trägt, und dennoch können die Wagen nicht näher in das Feld hinein; es muß, nachdem es geschnitten wurde, möglichst schnell gemahlen werden, wenn sich der Zuckergehalt nicht erheblich vermindern soll, und all das erfordert geschickte und zahlreiche Hände zur richtigen Zeit.
In der Fabrik – ich glaube der größten ihrer Art –, ist alles so gebaut, daß weder Stoff noch Zeit verloren gehen. Die Wagen fahren in die hohe Halle hinein, die in der Mitte eine breite und tiefe Rinne hat, und in die man mit Hilfe von einer Art Eisenrechen das Zuckerrohr vom Wagen wirft. Dann bewegt sich diese Rinne aufwärts, wo im ersten Stock die Arbeiter die Masse erwarten und sie schnell in die Mühlen werfen, von wo aus der Saft in riesige Fässer, der Braunzucker in breite Kübel und der Rest zur Rumbereitung abgesondert wird. Der Braunzucker wird hier nicht verfeinert, sondern wird nach Amerika geschickt, und Rum darf heute nicht mehr gemacht werden. Daher verwendet man den Saft als Sirup und füllt ihn in Büchsen. Was an reiner Faserung übrig bleibt, das geht in die Heizräume und speist das Feuer, so daß Brennmaterial gespart und alles verwertet wird …
Die Arbeiter bekommen einen Dollar täglich und freie Wohnung in kleinen Holzhütten. Uns scheint ein Dollar nun allerdings sehr viel Geld, aber sein Kaufwert ist in Hawaii sehr verringert. Ein Laib Brot (kleiner als unsere Zwanziggroschenweckchen) kostet zehn Cents, fünf Bananen zehn Cents, ein Liter Milch zwanzig Cents, ein Ei fünf Cents usw. Bei Europäern kommt hinzu, daß sie gewisse Rassenpflichten haben, sich besser kleiden, sich nur in besseren Gasthöfen zeigen müssen, ein Umstand, der zu peinlicher, versteckter Entbehrung führt. Ich ging immer durch die Straßen, als ob ich aus dem besten Gasthof getreten sei, aber mein Magen knurrte in einer wahren Jeremiade, denn zum Frühstück gab es Tee und Brot und zum Nachmittagsmahl (Abendbrot und Mittagstisch) Brot mit Tee. Vor dem Schlafengehen einen Apfel oder eine Banane, und wenn es gut ging, eine der genannten Apfeltorten, die den Magen mit genug Ballast beschwerten, um das Gefühl von Sättigung hervorzurufen. Man fühlte sich damit wie ein Schiff vor dem Kentern. Später, als meine Kräfte nachzugeben drohten, kaufte ich beim Chinesen Schweinefleisch und Bohnen in einer Fünfzehncentsbüchse. Das Schweinefleisch war unsichtbar bis auf ein Stücklein Fett von Nußgröße ganz oben, doch die Bohnen waren gut. Ich trank ungezuckerten Tee dazu, studierte, malte, schrieb und wanderte über zwei Stunden täglich in und um Honolulu, ohne je in Klagen auszubrechen oder jemand zu belästigen. Ich bezahlte mein Zimmer pünktlich, auch wenn ich hungrig blieb, und ließ nie den Gedanken fallen, die Weltumseglung zu beenden, – aber mit der Lust und dem Mut, die ich auf dem »Bologna« gehabt, war es zu Ende.
Der Ueberfall.
Allmählich verdiente ich etwas, selbst in dieser Stadt, dem furchtbarsten Orte fürs Verdienen. Gegen Weihnachten verkaufte ich allerlei Handzeichnungen, und später übersetzte ich für die Zuckerversuchsanstalt ( Sugar Experiment Station), wo man sehr gut bezahlte. Es waren meist Arbeiten aus dem Spanischen ins Englische, und fachtechnisch. So gern ich sie hatte, so selten waren sie indessen. Immerhin halfen sie mir über wirkliche Not hinweg. Es blieb mir unmöglich, die Weiterreise zu ersparen, es gestattete mir aber dieses Uebersetzen wenigstens, ohne Sorge um die nächste Zukunft zu leben, und Einladungen da und dort ließen mich die täglichen »Bohnen« mit Schweinefleischgeruch ertragen.
Da aber kam das Unglück.
Das Haus, in dem ich mein Heim hatte, war von Mischlingen bewohnt. Ich versuchte, mich ihnen fernzuhalten. (Man weiß nämlich da oft nicht, wie man wieder frei wird, denn so gutmütig diese Menschenkreuzungen find, so gehen sie gern zu einer uns Europäern unangenehmen Vertraulichkeit über.
Meine Tür schloß schlecht und ließ sich höchstens von innen gut verriegeln. Der Umstand, daß der Bau aus Holz war und die Laden unversperrt blieben, trug zur Unsicherheit bei, und daher war es kein Wunder, daß ich – die ich nicht genug Geld besaß, um eine Bank in Anspruch zu nehmen – mein ganzes Vermögen (allzu klein!) in der Handtasche mit herumtrug. In den heißen Tropen etwas unter der Kleidung zu tragen, ist unmöglich.
Ich war mit zwei bekannten Damen nach Kaimuki in die Sternwarte gegangen. Wir hatten den Mond und einige Planeten bestaunt und waren nach neun Uhr wieder in Honolulu angekommen. Als ich von meinen Begleiterinnen Abschied genommen hatte, ging ich die breite, hell erleuchtete Beretania Street entlang und bemerkte unter einer Laterne einen dunklen hochgewachsenen Mann – scheinbar einen Filipino. Ich ging ruhig an ihm vorüber. Einige Sekunden später vernahm ich mir folgende Schritte und eilte schneller dahin. Alles, was ich befürchtete, war, wieder belästigt zu werden, denn in dieser Hinsicht war das »Paradies des Stillen Ozeans«, wie es die Amerikaner nannten, fast so schlimm wie Peru. Die Belästigungen arteten zuzeiten bis zur Gemeinheit aus und machten mich jeden Mann, der sich mir näherte, gut, schlecht oder gleichgültig, fürchten. Ich bin klein, und es ist nicht sonderlich angenehm, plötzlich etwas wie eine Tigerpranke auf dem Oberarm zu verspüren und eine Tigerstimme von Leidenschaft und deren Freuden (von mir sehr angezweifelt) ins Ohr gebrummt zu erhalten, um so weniger, wenn man einige Tage lang die Spuren der Pranke blau auf dem Arm und die Spuren der Worte schwarz auf dem Herzen trägt.
Die Straße war weder einsam noch stark besucht, obschon es eine der Hauptstraßen war. Kraftwagen sausten in Menge an mir vorüber, und einzelne Fußgänger gingen in geringer Entfernung in ein Haus. Da bemerkte ich die Schritte des Unbekannten dicht hinter mir, wich triebmäßig scharf zur Seite, fühlte einen stechenden Schmerz im Rücken, einen weiteren in der linken Hand und lag flach auf der Nase auf dem harten Pflaster. In der verletzten Hand hielt ich den durchrissenen Riemen meiner ledernen Handtasche.
Obschon ich den Rücken wund und die Vorderansicht meines Seins noch wunder hatte, war ich blitzschnell auf den Beinen; denn hier lief jemand sozusagen mit meiner Persönlichkeit davon. Selbst an das Geld dachte ich nicht in erster Linie: in der Tasche war mein Paß, und ohne Paß war ich völlig machtlos in fremdem Lande. Ich flog, so schnell meine Füße mich trugen, laut schreiend hinter dem Räuber her.
Nicht ein Kraftwagen hielt, wieviel bittende Zeichen ich auch machte; niemand kam auf meine Notrufe herbei, bis ich einen Japaner traf, dieser lief, da er frischer war, nach ein paar gekeuchten Worten von mir hinter dem Manne her; ein Amerikaner gesellte sich, hundert Schritte weiter unten, uns zu. Der Mann bog in eine dunkle Seitengasse; wir nach. Der Amerikaner als der frischeste, erreichte ihn im Augenblick, als der Dieb in einen kohlschwarzen Hohlweg abschwenkte, lief im Anprall an ihm vorüber und verlor einige kostbare Sekunden im Wenden und Einbiegen; der Japaner, der dem Manne ebenfalls recht nahe gerückt war, fiel in ein nicht wahrgenommenes Loch vor dem Hohlweg, und ich traf mit heraushängender Zunge atemlos ein und konnte keinen Schritt mehr machen. So standen wir vor der finsteren Hohlgasse und mußten bei aller Tragik zum Schluß lachen.
Wie sehr wir auch suchten, der Mann war uns entgangen. Die Polizei, die wir sofort anklingelten, erschien dreiviertel Stunden später und richtete nichts aus. Arm wie eine Kirchenmaus und ohne jedwede Urkunde schlich ich heim.
Seidenstrümpfe.
Das ist die Odyssee einer Frau, einer jungen und kleinen, deshalb breche ich die Geschichte des Raubes nicht hier ab. Meine Geschlechtsgenossinnen sollen wissen, mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hat, wenn man im fernen Ausland mit geringen Mitteln (vor dem Geld verbeugen sich alle), nur der Kunst leben wollend, allein reist.
Früh am Morgen begab ich mich zum Star Bulletin – denn war ich nicht gewissermaßen der Findling des Blattes und daher verpflichtet, interessante Neuigkeiten dem »Stern« zukommen zu lassen? – und erzählte mein Abenteuer. In der Abendausgabe erschien denn auch eine lange Besprechung an erster Stelle und es wurde dem Diebe vorgeschlagen, wenigstens den Paß in einen Umschlag zu tun und an mich zurückzusenden. Einige wertvolle Briefe, ein schwarzer Achat, all mein Geld und all meine Urkunden waren verloren …
Wenn ich gedacht hätte, daß der Mann doch nicht lesen konnte oder wollte, und daß meine Bekannten, die leider lesen konnten und wollten, handeln würden, wie sie es taten, so hätte ich dem Star Bulletin wahrlich nicht mein Abenteuer mitgeteilt. Die Tränen, die ich über den Verlust vergoß, waren nichts, verglichen mit den Tränen und dem Aerger, den ich in der nächsten Woche zu ertragen hatte. Der Fernsprecher, der in Amerika in jedem Hause zu finden ist, klingelte den ganzen Tag. Und wenn ich das übliche »Hallo« hineinrief, so kam es über den Draht schon zurück:
»Aber ich begreife nicht! Wie kann man sein ganzes Geld bei sich tragen! Jeder vernünftige Mensch …!« und so weiter, bis ich den Strom unterbrach und abklingelte. Nach der Tat sind Menschen immer sehr klug.
Mrs. M., die stets sehr gut gegen mich gewesen, berief mich sofort zu sich. Ich lief spornstreichs zu ihr. Als ich die Treppe emporstieg, sah ich wohl kleiner und wackeliger aus als gewöhnlich, denn sie schlug die Hände zusammen und sagte:
»Nein, so geht es nicht weiter! Sie müssen sich einen Geliebten nehmen, um beschützt zu sein!«
Mit meinen chronisch blau und grün gequetschten Armen, die mir einen angenehmen Vorgeschmack von dem gaben, was »Liebe« bei einem Mann bedeuten mußte, wenn er das Recht besaß, einen am ganzen Leibe blau und grün zu quetschen, kann man sich denken, mit welcher Begeisterung ich den Vorschlag entgegennahm. Ich habe es immer als Zeichen großer Selbstbeherrschung von mir angesehen, daß ich mich nur um die eigene Achse drehte und im Weggehen bemerkte:
»Von zwei Uebeln wähle ich, so oft als tunlich, das kleinere!«
Am Abend klingelte es wieder an, und Mrs. M. entschuldigte sich.
»Sie haben keine Ahnung, wie schwach und klein Sie ausschauen!« rief sie reumütig über den Draht.
War das nicht eben der erste Grund, mich vor dem Grünundblauzustand bewahren zu wollen? Ich verstehe vermutlich die Männer in diesem Punkt nicht, doch sicher noch weit weniger die Frauen …
Die Ratschläge waren erbitternd – eingestanden, doch der Umstand, der mich damals wie ein vorzeitlicher Drache Luft und Wut schnauben ließ und mich heute am meisten zum Lachen reizt, war das Strumpfangebot. In Europa fängt die Liebe (oder was landläufig diesen Namen trägt) wenigstens mit Blumen, Zuckerwerk oder Fensterwanderung an; in Amerika mit Strümpfen. Jeder Mann meiner weiten Bekanntschaft, der mich innerhalb der »Diebeswoche« traf, lächelte eigenartig und versicherte im Laufe des Gesprächs, daß ich reizende Beine hätte, und daß sie in Seidenstrümpfen – die zu geben ihm eine Riesenfreude wäre – noch entzückender wirken müßten, worauf ich immer behauptete, daß sie sich – für mich, die ich als Besitzerin solch reizender Beine wohl Hauptperson bei der Sache war – angenehmer in Baumwollstrümpfen anfühlten, die auch – Dank sei der Vorsehung und den Wirkfabriken! – weit leichter zu stopfen waren. Wenn ich all die Strumpfangebote angenommen hätte, würde ich ein Geschäft errichtet haben. Da ich sie ablehnte, nahm ich nicht an Fußbekleidung, sondern nur an Menschenkenntnis zu.
Nach einer Woche wurde ich grob, im Kubikgrad grob! Ob ich jemanden um Hilfe angebettelt hätte? Ob ich unter jemandem stünde? Ob mir über mich selbst das Verfügungsrecht fehlte? Und ich mied alle, die ich kannte, wie die leibhaftige Pest. Das half! Ich erhielt von der Zuckeruntersuchungsanstalt Uebersetzungen, die mich über Wasser hielten, machte Auszüge aus Urkunden für jemand anderen und übersetzte ein Buch aus dem Dänischen ins Englische für das Bishop-Museum. Da ich hoch nach Geld springen mußte, ließen mich alle sehr hoch springen, nur die Zuckergesellschaft nicht. Sie bezahlte immer gut, und ich verlangte nie mehr, als ich als Dolmetsch in Panama verlangt hatte. Irgend ein Ausnützen eines anderen ist mir immer widerlich gewesen.
»Ihre kleine Freundin ist eine Gans!« sagten die Seidenstrumpfanbieter zu Mrs. M. und ich freute mich dessen. Gänse dürfen bekanntlich mit eigenen Federn herumlaufen.
Als Wellenreiter.
Eines Abends lud man mich nach Waikiki ein. Wir stiegen in ein Auslegerkanu – ich in einem geborgten Mantel, da mir stets kalt war – und fuhren im Mondschein auf das Meer hinaus. Vor uns dehnte sich die glitzernde Fläche, hinter uns grinste schwarz der unheimliche Pali, der stark befestigte Diamantenkopf und der weiße Strand von Waikiki. Das Wellenreiten begeisterte mich. Wir warteten, weit draußen vor der Riffbrandung, auf eine Welle. Sahen wir sie kommen, so ruderten wir alle wie toll, um ihr voranzueilen. Plötzlich schoß sie daher, hob das Kanu und trieb uns mit rasender Schnelligkeit dem Strande zu …
Einmal aber ruderten wir nicht schnell genug, und die Welle bäumte sich turmhoch hinter uns. Wie eine schaurig grüne Mauer hob es sich dicht hinter mir, dann – – platsch! – – kam ein Niagara auf uns nieder und füllte das Boot bis zum Rande. Naß wie ein voller Schwamm saßen wir da.
»Steigen Sie aus, damit wir das Boot ausleeren!« meinte Frau F., und ich mußte lachen, denn wir konnten alle nur ins Meer steigen. Das taten wir denn auch, ich samt Hut und Mantel, was um so komischer wurde, sobald ich ins Boot zurück wollte, denn als meine Gummischuhe einmal oben aus der Wasserfläche waren, wollten sie um keinen Preis wieder zurück, und ich mußte wie ein toter Fisch ins Kanu gehoben werden.
In fremden Kleidern lag ich später aus dem weißen Sand und aß Würstchen, während die Hawaiier auf dem Ukulele spielten und ihre alten Lieder sangen. Unendlich schwermütig klang es.
Die Hawaiier sind sehr gastlich. Ihr Leibgericht ist der Poi, eine sauergewordene Masse gekochten Taros, wie Kleister aussehend und wie ein solcher mit Säurezusatz schmeckend. Man ißt ihn aus einer Kokosschale mit dem gut geleckten Zeigefinger, der daher auch der Poifinger heißt. Gewaschen braucht die Schale nicht zu werden; denn man wäscht sie ohnedies mit dem Finger gut aus. In alter Zeit verlangte es die Gastlichkeit, daß man eine Poiladung erst im eigenen Munde zur Kugel rollte und sie dann dem Gast mit der Zunge in den Mund schob, doch die Weißen zeigten so viel Abneigung gegen diese hawaiische Fütterungsart, daß sie langsam eingestellt wurde.
Mitten im bleichen Mondlicht tanzten sie nun die Hulahula im Grasrock, einen verbotenen, schaurig sinnlichen Tanz. Um ihn bester vorführen zu können, lösen die Frauen den Mädchen langsam das Fleisch von den Rippen und erleichtern dadurch das Muskelspiel. Da die Kanaken (»Kanaka« bedeutet heute Südseeinsulaner, ist aber ein polynesisches Wort, das einfach »Mann« bedeutet) sehr dick werden, hängen indessen diese losen Fleischmassen in späteren Jahren recht verunschönend herab.

Hawai: Eingeborenenschönheit
Der letzte Prinz Hawaiis.
In alten Zeiten zeigten sich sonderbare Veränderungen am Himmel und eigenartige Fische am Strand von Waikiki, wenn ein Prinz aus echtem Häuptlings- oder Königsblut starb, und nun lag der letzte echte Prinz von Hawaii auf der Bahre.
Eine ganze Woche lag er so in der sehr christlichen Kirche mit sehr heidnischen Bräuchen. Wir gingen um drei Uhr morgens vom Strandweg hinein und auf das Chor. Unten, im Schiff der Kirche, stand die riesige Bahre, und am Kopfende saß die Gattin des Toten, umgeben von den Nächsten ihres Hofes, auf einer Art Thron. Tag und Nacht mußte sie wachen und durfte sich nur für kurze Mahlzeiten entfernen. Sie war ganz in Weiß gekleidet und hob sich hell vom grünen Hintergrund der Zierbäume ab.
Rund um die Bahre standen die Männer aus unvermischtem Blut in den herrlichen Federmänteln der alten Zeiten, die nun zum letzten Mal von Lebenden getragen werden sollten. So schön und seltsam sind sie, daß ein Mantel auf eine Million Dollar geschätzt wird. Sie sind aus gelben und roten Federn sehr geschmackvoll zusammengestellt. Diese Federchen aber wurden von eigenen Vogelfängern den Vögeln lebend vom Schwanz ausgezupft und die Tierchen wieder fliegen gelassen, um weitere Federn zu entwickeln, denn ein Vogel hatte einzig zwei Federn! Es brauchte fast hundert Jahre, ehe solch ein Mantel zustande kam. Kamehameha, der bedeutendste Häuptling (meist König genannt) trug solch einen und im ganzen gibt es vier oder fünf. Die übrigen Herren trugen Federkragen, immer noch schön und kostspielig genug, doch nur die Schultern deckend, nicht bis zu den Füßen fallend. Sie alle standen regungslos bis auf die Bewegung des einen Arms, der das Kahili bewegte. Das ist ein großer Federfächer oder richtiger Wedel, der bewegt werden muß, um die Geister von der Leiche abzuhalten. Riesenkahilis von drei Meter Höhe standen um die Bahre im weiteren Umkreis und wurden ebenfalls von Zeit zu Zeit sachte geschwungen.
Am schönsten und ergreifendsten war der Gesang. Alte Hawaiierinnen, die noch die unheimlichen Klagegesänge beherrschen, ließen ihre Stimmen ertönen, und etwas so Prachtvolles, so Markerschütterndes, so Geisterhaftes habe ich nie, nie wieder vernommen. Es klang wie eine Beschwörung durch die Kirche, war durchaus heidnisch und wundersam ergreifend. Man fühlte sich zurückversetzt in das Reich des Einst, ahnte die finsteren Dörfer, durch die niemand zu gehen wagte, denn der Zauberpriester hielt heimlich Ausschau nach einem Opfer und nahm, wer da ging, um ihn den Göttern zu weihen, wenn bei festlichen Anlässen der kleine Hund, der völlig haarlos und oft an einer Frauenbrust groß geworden war, nicht genügte. Da stand – in solch einer Nacht – wohl der berüchtigte Knochenbrecher auf dem Weg zum Pali und umschlang jeden, der sich vorbeiwagte, ihm einfach die Rippen und darauf das Genick brechend, bis der weise Jüngling, nackt und gut mit Oel gerieben, um schlüpfrig zu sein, sich an ihm vorbeiwagte und ihn seinerseits tötete. Da vernahm man das wilde Kriegsgeschrei, das Stürzen zu den langen Kriegsbooten, das Schürfen des Holzes auf nassem Sande und dahinter das Heulen der Weiber …
Durch dieses Singen jauchzte die Brandung, lachte die Sonne der Tropen, wimmerte die Wildheit eines Urvolkes, und unten, ununterbrochen und lautlos, gingen die Kahilis hin und her, neben und über der Fürstenleiche. Verstummten oben die Frauen, so sangen unten die Männer, und wieder dachte man an schroffe Felsen, an verheerende Springfluten, wie sie oft die Küste dieser Inseln aufsuchen, träumte von Polo, der grausamen Feuergöttin, die im Hale mau mau, im Hause des ewigen Feuers, schlummerte und auf irdische Geliebte wartete, die sie ins Verderben lockte.
Und dann dachte man an Neu-Hawaii, an die aussterbenden Kanaken, die minderwertigen Mischlinge, die Fremden, die hier die Herren spielten und neue Laster zu altbekannten fügten; die ihre neuen Waffen den alten Kriegern aufbürdeten und die aus allem Geld schlugen, selbst aus der Sonne am Strand von Waikiki, wo die schiefen Kokospalmen ihre Träume den Wellen anvertrauten und der Wind wie eine Mutter an der Wiege in den langnadeligen Kasuarinen säuselte.
Schriftstellerfreuden.
Es gab Tage, an denen ich verzweifeln wollte. Nach dem Ueberfall konnte ich mir keine Bohnen mit Fleischgeruch mehr leisten, und mein bejahrter Schüler war abgereist. Er suchte eine passende Pflanzung, und auf Hawaii war in dieser Hinsicht nichts zu machen; denn Land war teuer und wenn man es auch gut bestellte, wußte man nie genau, wohin mit dem Ertrag. Er entschied sich daher erst für Pago-Pago im amerikanischen Samoa und verblieb zum Schluß auf einer Insel unweit von Tahiti. Mit ihm verschwanden auch die Apfeltorten aus meinem Eßbereich.
Und immer noch saß ich im verhaßten Paradies des Stillen Ozeans und mußte mir von jeder Frau meine Kleider als unmodern vorwerfen und mir von jedem Mannszweibein, das einen Blitzableiter suchte, eine Herznachahmung billigster Auflage nachwerfen lassen.
Da schrieb mir meine Mutter, daß mein Werk »Mein kleiner Chinese« nun endlich bei den Deutschen Buchwerkstätten erschienen war, und einige Wochen später erreichten mich günstige Besprechungen zusammen mit den Büchern. Der Postbeamte musterte die deutsche Anschrift mit böswilligen Blicken – damals wurden die Reichsdeutschen noch bitter gehaßt (1921) –, aber ich wanderte mit der Last sehr vergnügt heim, bedeckte das Bett mit Büchern und stellte mir noch einmal, allerdings nicht mehr so lebhaft wie damals auf dem Taupfeiler des »Bologna«, vor, daß ich bestimmt war, der Welt ein Bein auszureißen.
Heute fühle ich dagegen, daß mir – bildlich gesprochen wenigstens – die Welt ein Bein ausgerissen hat. So geht es auf dieser rundlichen Welt, die die beste aller bekannten Welten sein soll. Wenn es die beste ist, dann ist sie ein arg mißlungener Lehmpatzen.
Die Zeugenschaft.
Einmal mußte ich einer Bekannten als Zeugin dienen. Die Gerichtssachen habe ich ganz vergessen. Genug, daß ich als stummer Gegenstand vielen Begegnungen mit Gerichtsherren beiwohnte. Das trug mir nicht nur fünf Dollars, sondern ein unerwartetes Anerbieten ein, für das ich noch heute dankbar bin. Die Dame bot mir an, mir das Reisegeld nach Japan zu leihen. Für dort hatte ich aus der Heimat Empfehlungen und war sicher, mit meinen Sprachkenntnissen so viel zu verdienen, um leben zu können.
Von San Francisco nach Hawaii darf man nur auf amerikanischen, von Hawaii nach Japan dagegen nur auf japanischen Schiffen fahren – so sind die Bestimmungen, die wohl die Gesellschaften reich, die Reisenden dagegen arm machen.
Wieder nahm ich eine Karte – die allerbilligste – und dazu auf einem orientalischen Dampfer. Hier gab es vier Klassen: die Erste, Zweite, Mittel und Dritte. Selbstredend fuhr ich mit dem geborgten Geld (hundert für die Fahrt, fünfzig für den ersten Anprall) in der Dritten.
Möglicherweise war ich durch meine zweijährigen Entbehrungen und die ewigen Sorgen, Schrecknisse und das schwere Studium, das ich neben meiner Brotarbeit verfolgte, schon herabgekommen – jedenfalls empfand ich diesmal den Abstieg in den Schiffsunterraum drückender als je zuvor. Schon der Geruch, der einem entgegenschlägt, faul, ranzig, voll Oel, Seekrankheitsresten und schweißtriefender Menschheit, ist furchtbar. Man sollte über der Treppenöffnung die Worte vom Höllentor anbringen:
»Laßt, die ihr eingeht, jede Hoffnung schwinden!«
Gewiß ist, daß ich meine Hoffnung draußen ließ, als ich die Kabine betrat. Es gab Lagerstätten – drei oder vier in einem dreieckigen Raum – aber ohne Bettzeug, ohne Decken, ohne Kissen; nichts als gähnende Bretter. Ein halbverrücktes Weib unbestimmter Rasse lief ein und aus. Ein Diener, der kein Wort englisch verstand, brachte eine zerschabte, henkellose Tasse mit Grüntee. Ich brach in Tränen aus …
Die Honolulufreunde waren alle sehr nett gewesen. Sie hatten mich trotz alles Sträubens in neue modernlinige Kleider gesteckt, mir einen ihrer Ansicht nach christlichen Hut auf meinen Bubikopf gedrückt und mich so sehr mit Leis behängt, daß ich wie eine wandernde Blumenkönigin aussah. Diese Leis oder Gewinde gibt man immer den Abreisenden. Sie sind teils aus duftenden Blumen, teils aus Seide oder gedrehtem gelben Crepepapier, teils aus roten Glücksbohnen. Nun saß ich als geknickte Blume in all der Herrlichkeit auf einem Bett, das aus nichts als harten Brettern bestand, und schlang meine Arme um die getreue Erika.
Ihr taten wenigstens die Bretter nicht weh.
Nach einer geraumen Weile rief man mich zum Abendbrot. Ich saß an einem kleinen Holztisch ganz allein. Zwei unabgeschmalzene Kartoffeln starrten mir verträumt und unlustig ins Gesicht, und ein wässeriger Kohl vermengte seine fragwürdigen Düfte mit denen ringsumher. Seitlich öffneten sich die Mannschaftskabinen, der Vorratsraum, der Waschraum, und mir gegenüber, mit dem Schiffsankerzeichen, grinste ein wichtiger, doch nicht sehr appetitlicher Ort, der halb offen stand.
Dem japanischen Geschlechtsempfinden gemäß war ich von den männlichen Reisenden – drei an der Zahl – getrennt worden, und wenn ich an ihre traurigen, verschlossenen Gesichter denke, bin ich dankbar dafür. Aber so in einem dumpfen Schiffsgang in stolzer Einsamkeit unverarbeitetes Gemüse und ein Stück riechendes Fleisch zu verzehren, ermangelte jedes Reizes, und alles, was ich tun konnte, war, auf Deck zu steigen und in einer Ecke weiter zu weinen.
»Sind Sie seekrank?« fragte plötzlich ein Seeoffizier und neigte sich über mich.
»Nein, danke!« erwiderte ich und versuchte zufrieden und tapfer dreinzuschauen.
»Gehören Sie in die Erste?« fragte er, wohl vom neuen Kleid und den schönen Gewinden getäuscht und vielleicht auch von etwas anderem, das mich immer wieder zu meiner Klasse zurückführte. Da sagte ich traurig, daß ich hinabgehörte.
Er ging, und ich saß auf dem Rand der Deckklappe und dachte mir, daß Tugend – vielgepriesen in Schönschreibheften und Sonntags zwischen elf und zwölf in Kirchen – keinerlei praktischen Lebenswert zu haben schien, denn hätte ich all die Seidenstrümpfe für meine gepriesenen Knieverlängerungen angenommen, so säße ich jetzt oben in der Ersten. Nun saß ich – in Tugend und Tränen gehüllt – auf dem zugigen Deck der gesellschaftlich Aussätzigen. Und dabei hätte ich gern gewettet, daß ich mehr gelernt hatte als all die Jodel, die da oben zu Musik die Kinnbacken bewegten. Die aßen nicht mit dem Blick auf den Ort, wohin die Tafelreste endlich getragen wurden!
Wie schon erwähnt, zur See bin ich Kommunist.
Auf einmal berührte mich wieder der Hauch einer Stimme (Japaner berühren nicht körperlich, Ehre sei ihnen!), und ein Matrose winkte mir geheimnisvoll, ihm zu folgen. Ich stieg in die Tiefen hinab und durchgondelte das ganze Schiffsinnere, bis ich wirr im Kopf war, dann schob sich eine Tür, endlich ein Vorhang zurück – ich stand in einer sehr netten, ganz leeren Kabine und oben, auf dem besten Bett mit Decken, Leintüchern, Kissen und so weiter saß – – – meine Erika!!!
Man hatte mich also in die Mittelklasse befördert.
Da wußte ich, was ich mir immer schon gedacht hatte, daß sie gut sind – die Japaner.
Die fünf Schweigsamen.
In der Mittelklasse waren nur einige Japanerinnen mit Kindern, von denen eins immer auf dem Rücken, das andere an der Brust lebte, und fünf Männer, die Slawen waren und einem Trappistenorden angehören mochten, wenigstens was Schweigsamkeit anbelangte. Wir saßen am gleichen Tisch und aßen Kartoffeln und Fleisch, das schon einen Stich hatte, Tag auf Tag; wir grüßten uns auf Russisch und schwiegen uns sonst in allen lebenden und toten Sprachen aus. Ich kroch ins Bett zu meiner Erika und verbrachte meine unbehagliche Seereise teils auf dem Bauch, teils auf dem Rücken. So weit als tunlich studierte ich das Schiffsleben und erging mich in philosophischen Erwägungen, unterbrochen von praktischen Versuchen, warum der Benjo oder »Ort der Einsamkeit« ein viereckiges Loch (warum nicht rund?) hatte und warum an einer Breitseite ein Porzellanbrett mit einem kleinen Schwung nach innen befestigt war. Da man die männlichen (Mitreisenden über derartige Entdeckungen nicht leicht befragen, noch anderen Besuchern zuschauen kann, blieb ich bis Japan im Ungewissen und erfuhr erst viel später, daß dieser unbequeme Vorbau als Kniestütze gedacht ist. In der Tat kann man bei dem Modell knieweich werden …
Einige Tage vor der Ankunft kam einer der Schweigsamen zu mir und zerstörte meinen Glauben an sein Trappistentum, indem er mich ersuchte, ihm einen Liebesbrief aus dem Kroatischen ins Deutsche zu übersetzen. Ich verstehe kein Wort kroatisch, doch meine Kenntnis des Slowenischen, wenn auch lückenhaft, besonders in modernen Ausdrücken, ermöglichte es mir, den Sinn zu entdecken, und dann – Liebesbriefe gehen Gott sei Dank nach einer einfachen Form. Dabei aber erfuhr ich, daß wir Landsleute waren.
Eine Sache erbitterte mich ungemein. Um den Opfern der Verfrachtung – denn was waren wir anders als Kisten, die verschifft wurden? – eine Abwechslung zu bereiten, gab man am Abend, wenn die Magen nicht in Umdrehung waren und der Himmel klar blieb, auf Deck Lichtspiele, und da sah ich einen Film, der die Grausamkeiten der Deutschen in der furchtbarsten Art zeigte. Vergewaltigungen, Töten und Aushungern der Kinder, Brand, Totschlag und so weiter, und das sahen Asiaten, die ja nicht wissen konnten, daß es sich bei diesen Filmen um Hetzpolitik handelte, die selbst bei uns im Kriege nur mittelmäßig gezogen und heute jedwede Bedeutung verloren hatte. Solch ein Film verpflanzte aber unter Millionen und Abermillionen Menschen die Vorstellung, daß die Reichsdeutschen das widrigste Gesindel auf Erden waren. Ich habe nicht begriffen, warum gegen den Verkauf solcher Filme von seiten Deutschlands nie stärkerer Widerstand geleistet wurde. Das war ja volksehrenrührig, und ich hätte mich jeder, auch einer feindlichen Nation gegenüber, so einer Sache Einhalt zu bieten berufen gefühlt.
Auf dieser Fahrt verlor ich einen Tag aus meinem Leben, denn ich schlief an einem Donnerstag ein und wachte an einem Samstag auf. Dabei schlief ich indessen nicht achtundvierzig Stunden, sondern kreuzte nur den hundertachtzigsten Grad.
Elf Tage fuhr ich an fernen Inseln vorüber, dann merkte ich kühlere Luft, obschon wir Anfang Juni hatten und dann hieß es:
»Morgen sind wir in Japan!«