
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
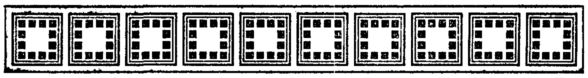
Im Herbst 1887 erging sich der elsässische Student auf dem Pflaster Berlins. Er trug den weißen Stürmer der Berliner Studentenverbindung Wingolf, ließ kunstfertig den Couleurstock durch alle fünf Finger radschlagen und gab sich zunächst einmal unbefangen den Eindrücken hin.
Das Losungswort jener akademischen Verbindung heißt: »δί ένός πάντα«, durch einen alles. Ich war zur Philologie übergetreten, blieb aber in der Theologie eingeschrieben: ein Zugeständnis an meinen Vater, der an seinem Wunsche festhielt. Mit prächtigen und reinlich denkenden Kameraden ward ein lebenslustiges Wintersemester begonnen. Unsre Kneipe lag irgendwo in Hintersälen der breiten Hauptstraße Unter den Linden. Ich beteiligte mich mit Lust und Liebe am Verbindungstreiben, auch am Fechtunterricht, wobei ich freilich lieber den kleinen Schweizer »Perkêo« gegenüber hatte als den großen und kräftigen Ostfriesen, vor dessen wuchtigen Hieben der Schläger nur so in die Ecke flog. Seit dem Heidelberger Mückenstich schwoll mir das rechte Handgelenk peinlich rasch an; und so gab es auf diesem Felde nicht viel Ehre einzuheimsen.
Im übrigen waren hier die deutschen Gaue auf das anregendste vertreten und bereicherten sich wechselseitig. So blieb man in dieser jugendfrischen Lebenslust vor dem Zigeunertum der Literaten bewahrt und hielt gleichwohl alle Sinne offen, immer bereit, aufzuhorchen, sobald ein Klang aus der Welt der Dichtung herüberflog.
Die Universität war mir eigentlich nur noch Vorwand, nicht mehr Mittelpunkt meines tiefsten Strebens. Beim alten Zeller wurde Geschichte der Philosophie belegt, bei Dillmann Jesaias; ich hörte Erich Schmidt und Richard M. Meyer, lauschte Treitschkes hinreißendem Pathos, streckte den Kopf in eine anthropologische Vorlesung von Du Bois-Raymond, in ein Schopenhauer-Kolleg von Simmel – und wo ich sonst noch genascht, doch nicht belegt haben mag. Denn nur das Allernotwendigste wurde bezahlt. Die akademische Methode hatte ich in Straßburg kennen gelernt und bin ihr dankbar. Aber sie war mir nur Mittel, nicht Ziel.
Daß ich mich gehörig im Lesezimmer, häufig in den Museen herumtrieb, versteht sich von selbst. Und überaus lieb war mir mein sonniges Dachstübchen in der Karlstraße. Das gewährte verheißungsvolle Weitschau auf die oft vom zärtlichsten Abendrot umspielte goldene Siegessäule vor dem Brandenburger Tor. Wie sparsam lebte sich's da oben! Wie listig teilte ich meine paar Vorräte ein! Denn es galt, den Aufenthalt hier in der Weltstadt, fern vom elsässischen Winkel, solange als möglich auszudehnen. Hier mußte doch wohl endlich die Entscheidung fallen: Theologie oder Dichtung?
Die Familie meiner Wirte war von tüchtigem altberlinischem Schlag. Der Vater arbeitete als Schmied in einer Fabrik; er trug den Bart nach dem Schnitt des geliebten alten Kaisers. Sie berlinerten miteinander so flink, und ich meinerseits hielt ebenso an meiner süddeutsch gefärbten Aussprache fest, daß wir einander in den ersten Wochen oft gar nicht verstanden. Das tat unsrer Freundschaft keinen Abbruch. Hübsche, brave Kinder gaben einen angenehmen Begriff von diesem alteingesessenen Bürgertum. Jedermann ging fleißig seinem Tagewerk nach, und abends drängten sie sich in der Küche zusammen.
Das massige Stadtgebilde, das sich zu meinen Füßen ausdehnte, wuchs aus einer märkischen Residenz in die deutsche Reichshauptstadt empor. Der Odem und Pulsschlag des Stadtlebens trug alle Zeichen dieses raschen Emporstrebens. Man konnte Berlin wachsen sehen, man spürte die wirkenden Energien in allen Poren. Es waren noch nicht die Lebensstrudel der Gegenwart, noch nicht diese eigentümliche Benzinluft, noch nicht die Fülle und Überfülle von Vergnügungsstätten samt rudelweise umherpirschendem Laster. Doch auch in jener Zeit der Weißbierkneipen mußte man sein Arbeitsfeld und seine seelische Kraft fest umgrenzen, um da nicht mitgewirbelt zu werden wie Staub und trockener Pferdedünger.
Dieses unaufhörliche Treiben, dieses Aneinandervorübereilen, diese kalte Teilnahmlosigkeit der zahllos die Straßen durchhastenden Menschen trieb einen seelesuchenden Wanderer ganz von selber wieder in die Einsamkeit. Unsäglich viele Leute, viele bewundernswerte Arbeitskraft: und wenig Seele!
Aber da war der Kaisergedanke. In dieser Stadt wohnte der Deutsche Kaiser: sein Palast erhob sich der Universität genau gegenüber. Es war rührend, zu beobachten, wie diese Altberliner ein persönliches Gemütsverhältnis zu ihrem greisen König und Kaiser bekundeten. Auch für uns Kommilitonen war immer eine der ersten Fragen: »Hast du den Kaiser schon gesehen?« Also stellte man sich dann beim Aufzug der nahen Hauptwache in die Volksmenge und sang ein »Deutschland über alles« mit empor zu den Fenstern, wenn dort das gütig vornehme Gesicht des Monarchen auftauchte. Wir gewannen das historische Eckfenster lieb und den Mann dazu, der dort drinnen den Reichsgedanken vertrat. Ein halbes Jahr später, als er im Sterben lag, hielt auch ich lange Stunden und die halbe Nacht in der stummen, dichtgepreßten Menschenmasse aus, bis die Trauernachricht von Mund zu Mund flog. Meine Wirtsleute weinten bitterlich. In jener letzten Nacht sah ich auch einmal Bismarcks großen Schattenriß. Es war eine schwere, naßkalte Stimmung. Kronprinz Friedrich selber todkrank! Wir Studenten, in Vollwichs, bildeten am eisigen Begräbnistage an ebenderselben Stelle vor dem nun verhängten Fenster Spalier, als der majestätische Leichenzug westwärts vorüberzog.
Unvergeßliche reichsdeutsche Eindrücke! Sie ließen an edler Größe alles hinter sich zurück, was mir der südwestdeutsche Winkel bis jetzt gespendet hatte.
Mochten auch die Wasser der Spree trüb und träge stillzustehen scheinen; mochten für den Waldsohn die gebirgslosen Horizonte schwer zu ertragen sein: man hatte doch seine tiefe Freude an den Reizen der Mark. Diese Kiefernlandschaften mit den fernen feinen Sonnenuntergängen und den einsamen Waldseen waren etwas unbedingt Neues.
Nun aber verlangte das Literaturproblem Lösung.
Ein junger Mann, der was taugt, ist von der Christophorus-Stimmung besessen, nur dem Stärksten dienen zu wollen. Wenn nicht einem großen Menschen, so doch einer großen und würdigen Idee. Mit diesem hohen Begriff sah auch ich mich in der Literatur um. Aufgerüttelt hatte mich Bleibtreus Schrift »Die Revolution der Literatur«. Ich widersprach ihr zwar oft ingrimmig, aber in dieser stürmischen Rede glühte Heroismus. Da war etwas vom Tatzengriff des Genies. Es arbeitete in mir, ließ mir keine Ruhe. Feder her: ich schrieb an Bleibtreu!
Karl Bleibtreu wohnte damals im nahen Charlottenburg. Mein Brief verschwand nicht im Papierkorb. »Vortrefflich!« war seine Antwort (November 1887):
»Ich unterschreibe all Ihre geistvoll ausgedrückten und klar erkannten Anschauungen. Diese Anschauung vertrete ich aber bisher leider ganz allein, was Ihnen durch Leκtüre aller einschlägigen Werκe bekannt werden dürfte. Schwer ist's, wie Sie wünschen, einzelne Werke zu nennen. Ich empfehle Ihnen in erster Linie ›Die Verkommenen‹ von Kretzer und meine Novellen ›Schlechte Gesellschaft‹, überhaupt die Werke der beiden eben Genannten. Die meinen erstrecken sich freilich auf alle Gebiete, und mehreres davon steht mit dem System des sogenannten Realismus in gar keinem Zusammenhang. Irre ich nicht sehr, so dürfte mein Ende November erscheinender dreibändiger Roman ›Größenwahn‹ Ihnen manches bieten, was Sie bisher vermißt haben. Es würde mich ungemein freuen, falls Sie mir sofort nach Lektüre desselben Ihre Eindrücke spezifizieren wollen. Mit bestem Dank für das bewiesene Vertrauen bin ich Ihr ganz ergebener
Karl Bleibtreu.«
Damit war die Verbindung mit der lebendigen Literatur hergestellt.
Bleibtreu veröffentlichte, ohne meinen Namen zu nennen, nur als »Stimme aus dem Publikum«, ein Stück aus meinem Brief im Vorwort zu seinem »Größenwahn«. Daß er den Zukunftsdichter, den er hier schildert, zugleich Friedrich Leonhart nannte, war mir eine überraschende Ermunterung. Er läßt seinen Helden kämpfen gegen den Zeitgeist, äußerlich unterliegen, geistig aber zuletzt den Sieg behalten. Ich hatte im einzelnen künstlerische Bedenken gegen den Roman, war aber doch von dem Zug des Ganzen ergriffen.
Das abgedruckte Stück meines Briefes, in Bleibtreus Vorwort, bezeugt in jedem Satz, daß ich aus der Theologie kam. »Was die Propheten dem alttestamentarischen Verheißungsvolk waren« – so heißt es da –, »das müssen unsre wahren Dichter sein. Wie es dort Lügenpropheten gibt, gibt es bei uns Lügendichter. Alle Sensationsfabrikanten, alle sentimentalen Liederdrechsler, alle Verherrlicher der Sinnlichkeit, das heißt der bloßen Erscheinungswelt, alle Blaustrümpfelei mit ihrer übertünchten Alltagssittlichkeit – nenne ich Lügenpropheten. Nur wer im Ewigen webt und atmet, wem alle Erscheinungsformen nur Symbole sind, wer alles Sinnliche aufs Ewige bezieht und im Zeitlichen als solchen keinen Frieden findet – nur dessen Weltanschauung ist eine dichterische. Eine ernste Kunst ist die Poesie, ernst und groß wie das Christentum. Lange genug haben wir eine heidnisch-griechisch-antike Ästhetik und Poesie gehabt. Zeit ist's, daß wir endlich eine christlich-germanischmoderne Dichtung bekommen. Der Realismus ist nicht eine Partei, nicht eine Schule – was der wahre Realismus will, ist ewig. Es ist ein totaler Umschwung in unsern bisherigen Anschauungen, der sich hier vorbereitet. Die antike Ästhetik mit ihrem Schön und Häßlich ist nichts; auf den ewigen Gesichtspunkt, von dem aus man alles auffaßt, kommt alles an.«
Das war der Ton, mit dem ich von der Religion her in die deutsche Dichtung einzudringen suchte.
Karl Bleibtreu sitzt heute ziemlich bitter in der Schweiz; sein glutvoll in die Literatur eintretender Geist ist trotz zahllosen Arbeiten nur in den Schlachtenbildern durchgedrungen. Mir ziemt kein Urteil über sein Künstlertum; doch sein Verleger-Mißgeschick darf man feststellen. In seiner Großzügigkeit war Heroenstimmung eines Byron, eines Carlyle und Schopenhauer gärend lebendig; er blieb mehr Temperament als Gestalter. Ihn fesselten Genies wie Napoleon, Cromwell, Friedrich der Große; ja, Buddhismus und Theosophie tauchten zuletzt in seinem weiten Gesichtsfeld auf. Die englische Leidenschaftsdichtung um Shakespeare und Byron lag ihm näher als die Verstandeskunst der geschmackvoll abgeklärten Franzosen. Vom Genie sprach er oft; Genie spürte er mit Recht in sich selber. Wenn er den Messias der deutschen Dichtung ankündigte, so glitt ihm das Gefühl in die Feder, daß er selber dieser Messias sei. Er verachtete das Literatengeschmeiß unsäglich; um seine Lippen war immer ein Zug der Verachtung; und doch tauchte seine stämmige, kaum mittelgroße Gestalt immer wieder in den Berliner Literaturcafés auf, wo man den vollbärtigen Mann mit den deutschen Blauaugen oft recht rücksichtslos schimpfen hörte – auf Juden und Christen, was ihm gerade in den Wurf kam.
Rasch fiel mir an diesem Dichter ein zwiespältiger Zug auf. Heroismus und männlichen Trotz im Munde und gewiß auch im Herzen – und doch wieder diese Teilnahme am Berliner Kneipen- und Kaffeehaustreiben? Er verachtet das Gesindel – setzt sich aber doch zu ihm und kann vom Kleinkampf nicht loskommen? Er verehrt Napoleon und alles Geniale – schätzt aber auch den Grobnaturalisten Zola als einen Großen und schreibt Kellnerinnen-Novellen? Die Naturalisten schauten und malten, Bleibtreu dachte und trotzte: wo aber blieben dort und hier die Innigkeit und Erschütterung des liebenden Erlebnisses, diese Kernkraft aller Dichtung? Hat nicht einst Klopstock eben dadurch die edelsten Herzen gewonnen?
Ich blieb auf meiner Dachkammer. Mein eigenes Programm formte sich unter dem Titel »Reformation der Literatur«, offenbar in Anlehnung an Bleitreu, zugleich aber in milderndem Gegensatz zu dessen Schrift. Bleibtreu las die Blätter in Handschrift, gab sie befürwortend an Wilhelm Friedrich, und dieser veröffentlichte die Gedanken im Sommer 1888 in der Zeitschrift jener Stürmer und Dränger: in der von M. G. Conrad und Karl Bleibtreu geleiteten »Gesellschaft«.
Es war, in allem betonten Realismus, ein religiöser Ton, mit dem ich in die Literatur eintrat. Eins ist not! »Ein religiöses Moment ist es, das sich von nun an in der Poesie geltend machen wird ... der Geist des Christentums wird neue Jünger zeugen, wird sich andre Priester erküren und andre Tonarten als das abgeleierte Kanzelpathos. Seid bereit, ihr Poeten von Gottes Gnaden!«
Gleichzeitig mit diesem ästhetischen Programm erschien mein Erstlingsdrama »Naphtali«, der Auszug aus Ägypten, dieses Schmerzenskind meiner theologisch belasteten Muse. Naphtali ist ein junger Ebräer, der über der sinnlichen Lust zu einer Ägypterin den Auszug seines Volkes nach Kanaan versäumt, zwischen zwei Völker gerät und sich verzweifelnd ins Rote Meer stürzt.
Wieder war Bleibtreu der erste, der sich dazu äußerte (Juli 1888):
»Ich sage Ihnen besten Dank für Ihren geistvollen Brief, noch mehr aber für Ihr hochbedeutendes Drama, das ich sofort las. Ich werde es geeigneter Hand zur Besprechung geben und habe dies bereits dem Betreffenden aufgetragen. Da Sie, wie Sie schreiben, Berlin verlassen, so spreche ich den Wunsch aus, daß es Ihnen vergönnt sein möge, sich auf der Bahn Ihres prächtigen Erstlings fortzuentwickeln, und daß ich auch später von Ihnen hören werde. Mit aufrichtiger Wertschätzung Ihr ergebener
Karl Bleibtreu.«
So war mein Eintritt in die Literatur nach jeder Richtung hin vollzogen: programmatisch und schöpferisch. Und zwar im Zeichen des großgestimmten Anregers Bleibtreu, dessen ich dankbar gedenke.
Das Weltwesen um mich her mutete mich immer fremder an. Wenn ich abends aus meiner Kammer in die dicke Luft der vollen Straßen hinaustrat: was für Gesichter waren denn dies?! Sie hatten alle einen sonderbar fremdartigen Einschlag von Spöttelei; den spähenden Zügen schien alles Gemüt zu fehlen. Sie flegelten sich in Kaffeehäusern äußerst lässig auf Sofas herum; sie witzelten in den Pausen der Theateraufführungen; sie schienen sich mit zuckenden Mundwinkeln und blinzelnden Augen immer über irgendetwas lustig zu machen. Über was denn wohl? Und über wen? Über mich etwa und mein Provinzlertum? Sollte dieser piffige oder lüsterne Zug Überlegenheit und Lebensklugheit vortäuschen? Die Witze und Gespräche, die man an geselligen Tischen belauschte, drehten sich um Weiber, Honorare, Theater, Konzert, Geldverdienen, Geschäft und immer wieder Geschäft. Es war ihnen nichts heilig. Auch die Kunst war hier Geschäft.
In meinem unberuhigten Herzen war eine Glut, die in Briefen und dichterischen Blättern nur unvollkommenen Ausdruck fand. Sobald die erste Genugtuung über die erweiterten Lebensgrenzen und das erste Entzücken an den großen und neuen Eindrücken verrauscht waren, sah ich mich einer erschütternden Tragik ausgesetzt. Dieses Berlin der Emporkömmlinge, das von Literaten und Geschäftsleuten wimmelte, war dies die Welt, die ich zu suchen ausgezogen war? Um dieser Welt willen lohnte sich wahrlich nicht der schwere Bruch mit den seelischen Reichtümern und ehrwürdigen Überlieferungen des Elternhauses!
Über meine persönlichen Stimmungen in jenen ersten Berliner Jahren geben Briefe an meinen elsässischen Jugendfreund Heinrich Peter getreue Anschauung.
Berlin, 9. Januar 1888.
Lieber Heinrich!
Da ich von meinem vielen Arbeiten, Denken, Sinnen, Budesitzen, Lesezimmerhocken gänzlich abgeklappt und fertig bin, benutze ich die wenige Produktionskraft, die mir noch geblieben, um Dir, Du lieber Vernachlässigter, wieder einmal ein kleines Lebenszeichen zukommen zu lassen.
Über mein Treiben allhier in der Weltstadt ist nicht Multa, wohl aber Multum zu berichten. Nicht in Berlin lebe ich, sondern in – ja, was weiß ich? In einer andern, unterirdischen Welt. Ein Gedicht vom 19. November, Punkt Mitternacht entstanden, als ich am Fenster lehnte und über die lampenerhellte und sternenbeschienene Riesenstadt blickte, wird Dir meine jetzige Stimmung klarlegen.
Ich aber – eure Weisheit lass' ich euch
Und ziehe stolz in meine Innenwelt
Als König ein, zum Dichter feierlich
Gekrönet mit dem Dornkranz der
Entsagung.
Allein mit mir, allein in meinem Reich!
O weiser Pöbel, der da unten sich
Im Straßennetz der Weltstadt fiebernd abmüht,
Du ahnst nicht, daß der blasse Sonderling,
Der droben am Mansardenfenster lehnt,
Sich reicher weiß als all die Börsenhelden,
Die breit und protzig sich in Kutschen dehnen.
Nur zu! Da draußen ist ein stilles Feld,
Bauplätze für die Ewigkeit sind dort
Zu mieten – oh! Bescheid'ne Plätzchen sind's,
Für manch bequemen Fettwanst gar zu eng
Und unbehaglich! Toller Tor! Wenn nun
Die Würmer dein gemästet Fleisch verzehrt,
Was bleibt – so sag' uns doch! – was bleibt von dir?
Ich aber – mein Besitz bleibt ewig! Denn
Mein Königreich ist nicht von dieser Welt ...
Dies meine Grundstimmung. Ich bin am glücklichsten, wenn ich in dieser meiner Innenwelt lebe, das Haupt im Himmel, die Füße auf Erden.
Ich habe hier Freunde gefunden, die mich verstehen. N., für Theologie, Philosophie und Poesie sehr begeistert, ein idealer, innerlich gereifter Mensch, nur leider in seinen Anschauungen von der Person Christi ziemlich zum Negativen neigend) ich bin aber auch hierin in meiner Auffassung und Beurteilung milder und weitherziger geworden. Ferner ein cand. phil., Einjähriger, der ein glänzendes Staatsexamen hinter sich hat, ein ruhiger, gleichmütiger, für Literatur sehr interessierter Kerl, besucht mich fast allabendlich, allwo wir – oder vielmehr ich ihm: du kennst ja das geringe geistige Leben eines Einjährigen! – neueste Gedanken und Geschichten austauschen. Auch ein Freund N.s ist mit mir bekannt geworden, hat mich zu seinem Geburtstag nach Steglitz eingeladen, pfuscht gleichfalls den Schriftstellern ins Handwerk. Fühle mich – ohne Eitelkeit! – ihnen allen jedoch in meiner gesamten ethischen und ästhetischen Weltanschauung unendlich überlegen. Auch mit vielen andern läßt sich über geistige Dinge, Soziales, Politisches sehr anregend plaudern, so daß ein geistiger Zug verklärend über diesem Verbindungsleben ruht.
Was soll ich von meinem Innenleben erzählen? Ich wüßte kein Ende zu finden. Wie gewachsen bin ich in diesem Semester, hier, wo man sich allen literarischen und sonstigen Ereignissen so nahe fühlt! Hier, wo ich weiß, jeder der Vorübergehenden könnte irgendein berühmter Mann sein: Wildenbruch, Freytag, Bleibtreu usw.! Alle fast wohnen hier in Berlin. Das reißt einen so mitten ins Leben hinein; alles, was ich lese, wird mir so unmittelbar! Zwar verkehre ich mit keinem von ihnen, weder brieflich noch persönlich; auch Bleibtreu habe ich bis jetzt außer jenem einen Male nicht geschrieben. Was soll ich schreiben, wo alle Bände Papier nicht ausreichen, diese wogende Gedankenwelt da drinnen niederzuschreiben?! Wieviel Pläne zu Novellen, Dramen, einem Roman und einem Epos liegen bereit! Hätt' ich aber nur Zeit, Kraft, Talent, Ausdauer – Geld!!
Was ich in diesem Semester geschrieben – ich sage Dir's nicht. Ist ja doch alles erfolglos. Auf gedruckte Werkchen warte nur nicht! Erst einen Verleger finden – aber die Jämmerlichkeit unsrer literarischen Geschäfte ist ohne Grenzen. Könnt' ich, ja, könnt' ich euch allen, meinen Verwandten und Bekannten, meinem Vater vor allem, ein gedrucktes Werk – gleichviel ob gut oder schlecht – vorlegen und mich damit als zum Dichter und Schriftsteller bestimmt ausweisen! Aber es soll eben nicht sein. Da liegen meine Fragmente und Pläne und Splittergedanken und Trümmerwerke zerschellt am Strande. Und ich suche immer wieder nach neuen und besseren Schiffen, um ins unbekannte Land der neuen, großen, weltbefreienden Dichtung zu gelangen.
Theologie habe ich nichts, nicht einen Pfifferling getan. Alle Kollegs geschwänzt, mich kaum als Student gefühlt. Hier oben in meinem Zimmerchen saß ich, in Büchern und Papieren und meiner Gedankenwelt, oder ging einsam durch die Straßen und besah mir die Menschen und ihr Treiben und machte meine verächtlichen Glossen.
Aber mutlos, ziellos, unsicher bin ich nicht. Was festes Amt, was Frauenliebe und Winkelglück? Auch die Riesengestalt des Heilandes hatte nicht, wohin er sein Haupt legte. Wenn uns nur unsre Innenwelt treu bleibt, die ewige Welt da drinnen, und die Liebe zur gesamten Menschheit und ihren Leiden!
Auf die Ausbildung der eignen Persönlichkeit kommt es an. Wir müssen allem Winkelglück entsagen, um uns der gesamten Menschheit opfern zu können. Was hab' ich von schönen Geschichten, spannenden Romanen, netten Gedichten! Auf den ewigen Geist, der alles durchweht, was durch eine solche ausgebildete, priesterliche Dichterpersönlichkeit berührt wird, auf das kommt's an! Gib acht, Heinrich, was ich einst sagte: die Religion muß eine Heirat mit der Poesie eingehen. Es wird sich erfüllen! Bitte du Gott, daß dein Freund die Anfänge dieser neuen Literatur erlebe – ja, vielleicht auch ein bißchen mitwirke!
Verzeih den flüchtigen Brief, Lieber! Grüße die Freunde!
Dein F.
Man wird diesen ältesten mir erhaltenen Berliner Studentenbrief gewiß jugendlich-unreif finden, das ist ja selbstverständlich. Aber anderseits: wie scharf ausgeprägt, ja trotzig, tritt hier bereits eine meiner Grundanschauungen völlig fertig in die Erscheinung!
Der Zeitgeist hatte vor dreißig Fahren eine andre Grundanschauung. Der Zeitgeist sagte: die Naturwissenschaft muß mit der Poesie eine Heirat eingehen – nicht die Religion; ja, die Wissenschaft muß die Religion geradezu ersetzen.
Mit alledem aber war ich selbst in der Lage meines »Naphtali«: nicht mehr in meiner verlassenen Welt der Überlieferung und noch nicht in neuen Formen des Seelenfriedens. Das Stück erregte im Elsaß, wo es zu Pfingsten ankam, bedenkliches Kopfschütteln; auch bei meinem Vater, der im übrigen den ernsten Grundton nicht überhörte. Die Veröffentlichung hatte nicht genügt, meinen Beruf zum Dichter oder Schriftsteller zu erweisen. Und ich selbst war von meiner Begabung keineswegs überzeugt.
Im Vorwort versichert der Anfänger, daß er von der Revolution der Literatur bei Niederschrift dieses Erstlingswerks noch wenig vernommen habe. »Nur das eine revolutionäre Element beherrschte mich von jeher(!), ein angeborener Widerwille gegen Pathos und Schönrederei, Jambenpoesie und Theaterphrasen.« Götz und die Räuber – wird weiter versichert – waren »mir von jeher teurer als selbst ein Tasso oder überhaupt eins der tadelfreien klassischen Kunstwerke«. Den Tadel, daß im »Naphtali« die Theatersprache verletzt sei, höre der Verfasser lieber, als wenn ihm »Halmsche Jambenglätte nachgerühmt würde«.
Man liest derlei in späteren Jahren nicht ohne Lächeln. Aber der Schluß des unreifen Ergusses war immerhin bemerkenswert: »Man sage jedoch nicht, Stoff und Konflikt sei fern hergeholt – o nein! Greift nur in euer eigen Herz: ihr werdet finden, daß er gar zu nahe liegt!«
Hier schon war ich bestrebt, wie auch später und wie in meiner Lebensgestaltung, das persönliche Schicksal erweiternd zu verflechten mit dem Gesamtschicksal der Gemeinschaft: neben Naphtali steht Moses und seine Sendung. Das erkannte und lobte mein erster Kritiker, Conrad Alberti, der das Jugendwerk in der »Gesellschaft« anzeigte:
»... Mit einer Kunst, wie sie nur ernsten dichterischen Talenten gegeben ist, hat Herr L. eins der schwierigsten dichterischen Probleme gelöst, welche Aufgaben dieser Art bieten: das Ineinanderweben der großen geschichtlichen Aktion und der individuellen Schicksale des Helden... Diese Klippe, an welcher so viele erfahrene Meister oft genug gescheitert sind – z. B. Wildenbruch im »Fürsten von Verona« – hat unser junger Dichter mit einer verblüffenden Fertigkeit umschifft. Die Charakteristik ist zum Teil meisterlich, die Gegenüberstellung der echt jüdischen nervösen Unbotmäßigkeit Naphtalis und der göttlichen Erhabenheit des großen Propheten äußerst glücklich, und die Sprache erhebt sich nicht selten zu weihevoller und stürmischer Kraft, namentlich in den letzten Akten, welche hoch über den etwas matten ersten stehen. Eine markige Wucht liegt in den Straßenszenen.«
Noch ein paar anerkennende Besprechungen da und dort flossen spärlich – und damit war die Sache erledigt. In meiner Studentenverbindung erhielt ich fortan den Kneipnamen Naphtali und, nach Jugendweise, fast noch mehr Neckerei als Anerkennung.
Übrigens war inzwischen ein zweiter deutscher Dichter in meinen Gesichtskreis getreten: Ernst von Wildenbruch. Und zwar unter für ihn sehr bezeichnenden Umständen. Wir Studenten führten im Vittoriatheater ein Lutherfestspiel auf; der erste Akt erregte Anstoß und wurde von der Zensur verboten. Was nun? Alles ist eingedrillt, die Öffentlichkeit bearbeitet, ein Komitee und mehrere hundert junge Menschen längst an der Arbeit – die Sache durfte nicht ins Wasser fallen. Also einen neuen ersten Akt her! Wer schreibt uns den? Natürlich Wildenbruch! Einige unsrer Komiteemitglieder fahren hinaus, legen ihm den verzweifelten Fall und das Trümpelmannsche Buch vor; er fängt sofort Feuer, bittet die Herren, zu warten oder nach kurzer Zeit wiederzukommen – und wirft einen ersten Akt zu Papier, der wirklich Hand und Fuß hatte. Gleich in den nächsten Tagen hatten wir Ausschußmitglieder nebst einigen Professoren erst oben im Foyer Sitzung über die Sache und statteten dem anwesenden Wildenbruch unsern Dank ab. Dann führten wir ihn hinunter auf die Bühne, wo die Masse der Studenten und mitspielenden Damen versammelt war. Einen Stuhl auf den Tisch, den Dichter mit kräftigen Armen hinaufgeschwungen – und da thronte nun Wildenbruch und las den Versammelten in seiner ungelenk-stürmischen Art den neuen ersten Aufzug vor. Die dröhnende Begeisterung läßt sich denken!
Das zweite Berliner Semester ging zu Ende. Die qualvolle Stunde nahte, wo ich zurück sollte in heimische Enge! In Staatsexamen und bürgerlichen Beruf!
So erklärt sich ein andrer Brief, der dieses Seelenbild abrunden möge.
Berlin, Juli 1888.
Lieber Heinrich!
Über Naphtali will ich nicht mehr schreiben. Ich kenne seine großen Schwächen, seine Unreife, seine ungeschickten Ausdrücke. Ein Jugendwerk, ein Machwerk, eine Scharteke, nicht wert, daß man auch nur das Titelblatt lese! Lassen wir ihn in den Orkus der literarischen Mißgeburten und halbreifen Embryonen auf immer versinken!
Auf! Nach Neuerem, nach Größerem! Oder vielmehr – fort mit allem! Talent hab' ich nicht, weder Lust noch Kraft, etwas zu schaffen! Ein ödes, tatenloses Siechen und Sumpfen vom Frühschoppen bis zum späten Kaffee im Café Bauer um ein oder zwei Uhr morgens ist mein verächtlich Tagewerk.
Es liegt wie ein Bann über mir, den ich nicht zu brechen vermag. In Gesellschaft komme ich nicht, mit Damen verkehrt man nicht – ich meine: anständigen, feingebildeten Damen der höheren Gesellschaft –, jeder Besuch stürzt mich in Aufregung, Beklemmung, innere Befangenheit. Es ist mir, als preßte man mir bei solchen Fällen beide Lungenflügel zusammen, als müßt' ich mich mit plötzlichem Ruck aus dieser Beklemmung aufreihen, müßte tief aufatmen! Ich bin eben zu sehr Gefühlsmensch, um ein gewandter Gesellschafter zu sein. Und nun, wie Du mit Recht mahnst, mich losreißen, mich auf eigne Füße stellen, energisch überall verkehren – als Journalist?! Ich habe keine Erfahrung, keine Gewandtheit, keine Energie. Als weichlicher Träumer und schlafmütziger Gefühlsmensch schlendre ich in den Straßen umher. Ewig in einem Halbschlaf! Gott besser's! Das Ganze wird wohl mit einer Lungenschwindsucht oder ähnlichem enden – freu' Dich, Lieber, so können wir zusammen sterben!
Meine »Reformation der Literatur« nimmt sich allerdings sehr einsiedlerisch aus neben dem Materialismus der meisten übrigen Mitarbeiter der »Gesellschaft«. Ich selbst wundre mich ungemein, daß Bleibtreu mir die Veröffentlichung angeboten. Mit den »Jüngsten« habe ich nicht die geringste Gemeinschaft. Im Gegenteil! Allein bin ich herangewachsen, allein wandre ich weiter – ja so! ich will ja jetzt Pfarrer werden!
Aber wie richtig siehst Du ein: »Ich glaube, wenn Du auch jetzt Deine poetische Gedankenwelt in Stücke schlügst, früher oder später wirst Du doch wieder die Trümmer zusammensuchen und Dir eine neue Welt aufbauen.« Ich fürchte das nur zu sehr! Lege doch, lieber Heinrich, den Gedanken, daß ich mich ganz und gar der Literatur – nur den Professor laß fort! – widmen müßte, meinem Vater nahe! Du tust mir einen großen Dienst damit. Offen gestanden: ich denke gar nicht, kann nicht an Amt und Pfarrer und dergleichen denken! Ich hoffe vielmehr im Laufe des Winters wieder irgend etwas fertig zu machen, wohl ein Drama, und dann wieder vor Papa, vor mich selber und vor das Publikum zu treten: »Bin ich ein Dichter?!«
Ich lese eben Bleibtreus »Größenwahn«. Großartig! Der Dichter, den er darin als den erwarteten »Messias« dieser Zeit schildert, heißt Friedrich Leonhart – eine Ähnlichkeit mit meinem Namen, der in mir bittre Wehmut über mein eignes, zerbröckelndes Dichten hervorruft.
Leb' wohl, Lieber! Lassen wir den großen Weltenlauf über uns Zwerge hinrollen! Ob der kleine Lienhard 'was wird oder als verkümmerte Alltagspflanze dahinwelkt – gleichviel! Es muß alles geschehen, wie es geschieht.
Gott mit Dir und mit mir! In vier Wochen bin ich zu Hause.
Dein F.
Aber so knirschend und kummervoll dieser Brief auch klang ich war bereits viel zu sehr mit dem Literaturleben verfilzt und verflochten, als daß ich mich gänzlich hätte lösen können. Aus den Lutherfestspielen war ein Akademisch-dramatischer Verein hervorgegangen, mit dem ich Fühlung hatte, wenn ich mich auch nicht selber betätigte. Ich erinnere mich da noch an allerlei lebenslustige und kunsthungrige Gesellen; die Namen und Menschen Rauch, Huth, Grothe, Eichholz sind mir im Gedächtnis geblieben. Der erste leitet jetzt ein hübsches kleines Theater in Wiesbaden; der zweite wurde zu Leipzig ein nicht unbedeutender Charakterspieler und begegnete mir später wieder in meinem dort aufgeführten »König Arthur«; der dritte erwarb sich einen Ruf als Weltreisender; der vierte ist irgendwo ein höherer Jurist, zu dem er damals schon als »Kardinal Cajetan« mit ätzend scharfer Stimme Anlage verriet. Und endlich der Lutherdarsteller selber, Hugo Euler, jetzt Rektor in Berlin, wurde mir ein lieber treuer Freund, mit dem ich hernach im Riesengebirge, auf dem Rennstieg, in Norwegen wanderte, und mit dem sich's vortrefflich plaudern und schweigen läßt.
Der literarische Hintergrund, vor dem sich das Erzählte abspielte, war damals bedeutsam genug.
Wenige Monate vor meiner Ankunft in Berlin war ein kaum dreißigjähriger Privatdozent dort hinweggestorben, der mir wichtig hätte werden können: Heinrich von Stein. Er war ein Idealist aus dem Bayreuther Kreise, hatte Richard Wagners Sohn vorübergehend erzogen, mit Nietzsche, Gobineau, Malwida von Meysenbug persönliche Beziehungen gehabt. Er stand sehr einsam im zolaistischen Naturalismus Berlins; ein Herzschlag raffte den überarbeiteten schlanken blonden Mann dahin; er starb in einem Krankenhaus, buchstäblich so einsam, wie er dort gelebt hatte; denn auch die Krankenschwester hatte gerade das Zimmer verlassen. Er hatte vom Katheder aus ohne Widerhall gegen den Zeitgeist gerungen. Ich wußte damals nichts von dem Dasein dieses philosophisch und dichterisch gestimmten Geistes; als ich ihn später entdeckte, setzte ich sein Bildnis und eine ausführliche Charakterskizze an die Spitze meiner »Wege nach Weimar«.
Unmittelbar nach ihm, in jenem ersten Winter, den ich in Berlin verbrachte, glitt fernab in den Hochalpen Friedrich Nietzsche, ebenso unbeachtet wie der spröde Stein, in den Wahnsinn über. Ein merkwürdiges Jahrzehnt, jene achtziger Jahre! Hintereinander starben bedeutende Vertreter der idealistischen Weltanschauung dahin, gleichsam als ob sie keinen Sauerstoff mehr fänden in der beklemmenden Luft: Wagner, Liszt, Gobineau, Carlyle, Emerson – alle sind innerhalb weniger Jahre gestorben. Dadurch war eine geistige Entwicklungslinie beendet, die niemand bei uns aufnahm, da nun vielmehr von allen Seiten der Naturalismus eines Zola und die vernünftelnde Gesellschaftskritik eines Ibsen in den deutschen Literaturgeist einzogen.
An die genannten idealistischen Großen, auch an Stein und an manche Forderung Nietzsches hätte ich mich angliedern und ihr Werk fortsetzen können. Aber mit dem nun einsetzenden Klein-Naturalismus und mit dem sozialen Moralismus Fühlung zu gewinnen, wurde mir grauenhaft schwer. Mein Wesen war nicht auf Kritik und Zergliederung angelegt. Da war es mir oft, als wenn mir jemand tatsächlich – wie es in einem der hier mitgeteilten Briefe heißt – beide Lungenflügel zusammenpreßte. Ich war gewohnt, in Wäldern und Bergen, auf Hügeln und Äckern oder in kosmischen Nächten Atem zu holen, nicht in Spelunken der Entartung – nicht in Hauptmanns »Vor Sonnenaufgang« noch in Ibsens »Gespenstern«.
Dies waren die beiden wirksamen Stücke, die nun der von Berlin ausgehenden neuen Dichtung auf Jahrzehnte hinaus das Gepräge gaben. Ich erlebte sie nicht mehr mit. Denn im Spätsommer 1888 verließ ich Berlin, um noch einmal ein ratloses Semester in Straßburg zu verbringen, leidenschaftlich beschäftigt mit neuen dichterischen Plänen.
In jenen Jahren vollzog sich ein bemerkenswerter literarischer Wettkampf. Der Verleger der sogenannten »Jüngstdeutschen« um Bleibtreu und Conrad war Wilhelm Friedrich in Leipzig; ihm trat gegenüber der Verleger Samuel Fischer in Berlin. Bei Friedrich erschien die »Gesellschaft«; bei Fischer die »Freie Bühne«. Gründer und Leiter dieser Wochenschrift war gleichfalls ein Anfänger wie Fischer: der kluge und umsichtige Otto Brahm. Dieser gründete mit einigen andern Gesinnungsgenossen, um naturalistische Werke durchzusetzen, gleichzeitig eine Freie Bühne, nach der er dann seine Zeitschrift benannte. Die Berliner Aufführung der »Gespenster« (1889) erregte Aufsehen und Aufregung; sie drang siegreich durch. Noch lärmender und widerspruchsvoller ging die Aufführung des Hauptmannschen Verfallsbildes »Vor Sonnenaufgang« an den Berliner Kunstfreunden vorüber; aber auch hier siegte der Naturalismus. Es begann damit jene Reihe von Erstaufführungen, die für das Berlin der neunziger Jahre bezeichnende gesellschaftliche Ereignisse wurden: wobei nicht nur mit Händen und Kehlkopf, sondern auch mit Hausschlüsselpfiffen gearbeitet wurde. Ich habe, als ich 1890 nach Berlin zurückgekehrt war, manche Theaterschlacht dieser Art miterlebt.
Dieser Freien Bühne gegenüber versuchten die um Bleibtreu eine »Deutsche Bühne« hochzubringen. Es war ein harmloses und ohnmächtiges Unternehmen. Hier stand auch mein »Naphtali« auf dem Programm; aber er kam nicht zur Aufführung. Das Stück versäumte ebenso den Anschluß wie der Held an das Volk Israel. Denn die deutsche Bühne verkrachte nach einigen Aufführungen, die freie Bühne blieb. S. Fischer gedieh zu seinem heutigen Ansehen; W. Friedrich machte nach einigen Jahren Bankrott.
Ein ungemein reizvolles Schauspiel!
Der Heroismus geriet unter die Räder des Naturalismus. Denn jener war unreif, dieser aber besaß Kunst. Die sogenannte »deutsche« Bühne hatte mit Bleibtreus Napoleondrama begonnen, eine Stoffwahl, die bewies, daß man das Deutsche noch nicht kräftig und rein herauszuarbeiten wußte – so wenig wie ich mit meinem altägyptischen Naphtali. Die Freie Bühne ihrerseits war ganz auf Nahblick eingestellt; sie begann mit keinem Geniekultus, sondern mit der genauen Schilderung eines gegenwärtigen Entartungszustandes. Die Leute der Deutschen Bühne waren nicht alle frei von Antisemitismus, der in den Zeiten eines Stöcker und Dühring eine vernehmliche Stimme hatte; die Führer der Freien Bühne aber waren Israeliten. Letztere siegten; jene andern gerieten bedeutungslos in den Hintergrund.
Dieser eigenartige Vorgang im Berliner Geistesleben blieb nicht auf die Literatur beschränkt. Wir erlebten gleichzeitig in der Politik die Entlassung Bismarcks. Immer mächtiger aber schwollen Liberalismus, Demokratie und Sozialdemokratie empor und gaben der Reichshauptstadt die bezeichnende rote Parteifarbe. Diese Massen beherrschten den Berliner Lebenston; das Genie Bismarck saß grollend abseits im Sachsenwald.
Aber auch in mir wühlte der demokratische Zeitgeist. Ich verbrachte den Winter 1888/89 noch einmal im Straßburger Thomasstift unter lauter Theologen, nunmehr aber Ketzer durch und durch; denn auf meinem Pult lag die Handschrift einer sozialen Tragödie »Weltrevolution«. Und gleichzeitig suchte ich in einem novellistischen Blätterwirrsal »Die weiße Frau« mit den verlebten Berliner Eindrücken fertig zu werden. Was für ein Winter! Wie oft wohl sah ich vor dem winzigen Öfchen, in deren einem ich vor ein paar Jahren unter strömenden Tränen die erste Handschrift des »Naphtali« verbrannt hatte, und starrte ins Nichts! An dieser Stätte, wo ich meine Studentenzeit begonnen hatte, sollte sie auch enden. Nach Schluß des Semesters schlich ich ohne Abschied oder Exmatrikel still nach Hause und erklärte meinem Vater: »Hier bin ich – und kehre nie mehr zur Universität zurück!«
Der verzweifelte Seelenkampf zwischen meinem künstlerischen Phantasiedrang und dem väterlichen Wunsche samt letzter Bitte meiner sterbenden Mutter war auf das Höchste gestiegen. Dieser Zwiespalt zwischen dem schrankenlosen Drang zur Ferne und dem dumpfen Zwang der Nähe war kaum noch zu ertragen. Ich hatte keinen einzigen Berater, aber auch keinen. Der schwerkranke Heinrich kam nicht in Betracht. So lief ich in den heimischen Wäldern umher. Die Leute hielten mich für verrückt und bedauerten den Schulmeister von Schillersdorf, der soviel Geld und Hoffnungen an diesen mißratenen Sohn verwandt hatte.
Ich hatte also den Winter im friedlichen Thomasstift damit verbracht, ein leidenschaftliches Trauerspiel »Weltrevolution« aufs Papier zu schleudern: die Schilderung einer zukünftigen europäischen Arbeiter-Revolution. Wie Naphtali der Gewalt der Ereignisse nicht gewachsen ist, so erliegt auch dieser moderne Sturmegg, der Held der Weltrevolution, den vulkanischen Mächten, die er heraufbeschworen hat. Die Vertreter der verschiedenen Nationen geraten hintereinander; es war damals schon meine Überzeugung – und der Weltkrieg hat meinem Instinkt recht gegeben – daß der wieder erstarkende Nationalismus einst die europäische Verbrüderung der »internationalen Sozialdemokratie« zertrümmern werde. In abstraktem Freiheitsdrang verachtet mein Revolutionär Sturmegg die Heimat; sein Mädchen heißt Marie, wie meine Waldfrau aus dem Wasgenwald; es ist tragische Ironie, daß er, der die ganze weite Welt befreien wollte, in ihrer engen Kammer stirbt, rettungslos umstellt von der wiedererstarkten Macht des Polizeistaates.
So schrieb ich mir die Berliner Demokratie vom Leibe. Daneben hatte ich Tagebuchblätter aus dortigen Gefühlschaos zusammengeflickt, in dürftige Form gebracht und gab sie unter dem Titel »Die weiße Frau« gleichzeitig mit der Tragödie heraus (1889). Auch hier der Gegensatz zwischen chaotischer Welt und dem Drang nach Harmonie und Frieden. Die Blätter sind durchpulst vom Willen zum Sieg, ermangeln aber der formbeherrschenden Kraft in jeder Beziehung. Es war Erlebnis seelischer Art, wie ich überhaupt nur innerlich Erlebtes prägen kann. Auch das, was ich später »Weimar« nannte, ist erlebt und erliebt.
Bleibtreu rief mir in jenem Winter noch ein ernstes Wort zu: »Da Sie sich vom Geist getrieben fühlen, wird jede Warnung müßig und nutzlos sein, daß Literatur heute nur Martyrium bedeutet, für den Berufenen wenigstens. Sie werden also fürs erste weiterwandeln auf der betretenen Bahn, um bald genug zu erkennen, warum der Wohlmeindste in diesem Sumpf selbstsuchtvergiftet werden muß.«
Das Wort ist mir lange nachgegangen. Und Bleibtreus eigne Verbitterung war mir eine Warnung. Mein Vater las in Sorgen seine zweite Streitschrift »Der Kampf ums Dasein der Literatur« und sprach sie mit mir durch. Lindners Schicksal, der in Berlin in Elend und Wahnsinn untergegangen war, schien – nach Vaters Befürchtung – auch mir zu drohen.
Meinen Prosaversuch »Die weiße Frau« lehnte Bleibtreu, mit Recht, auf das unzweideutigste ab. »Man sollte kaum glauben, daß Sie Naphtali vorher geschrieben haben! Kehren Sie zum Drama zurück! Ihr Roman-Tagebuch ist – verzeihen Sie – eine ziemlich unreife Mischung aus meiner schlechten Gesellschaft und meinem ›Größenwahn‹. Seien Sie sicher, daß jeder dies auf den ersten Blick erkennen müßte. Daß sich vielfach echte Gefühlstöne und Schmerzenslaute sowie schwungvolle und tiefgeschürfte Gedanken finden, versteht sich bei Ihnen von selbst. Da ich bis Herbst ins Ausland verreise, wünsche ich Ihnen bis dahin alles Gute. Mit Hochachtung Karl Bleibtreu.«
Es war ein deutlicher Abschied.
Auch für mich war eine Epoche zu Ende. Es galt nun, sich in irgendeiner neuen Form überhaupt erst wieder ins Leben hineinzutasten. Denn dieser dumpfe Zustand im Vaterhause konnte nicht andauern. Wie weiter? Versuchen wir als Hauslehrer zunächst einmal dem Leben einen Sinn und eine nicht ganz nutzlose Tätigkeit abzuringen!
Es bot sich in Großlichterfelde bei Berlin die schöne und schwere Aufgabe, einen blinden Knaben zu erziehen. Auch war man ja hier noch der Theologie nahe; denn der Vater des etwa zwölfjährigen Jungen war Professor der hebräischen Sprache an der Universität Berlin und ein bekannter Fachmann in judaistischen Fragen, die Mutter eine Hamburgerin echtester Prägung. Es herrschte eine unverkünstelte evangelische Lebensanschauung im Hause, dessen einziges Kind seit einer Gehirnhautentzündung in frühen Lebensjahren von so schwerem Schicksal heimgesucht war.
Die Behandlung dieses an sich liebenswürdigen und gutartigen Knaben war von besonderer Schwierigkeit. Er war außer seiner Blindheit mit Epilepsie behaftet. Vor mir hatten rasch hintereinander vier Hauslehrer umsonst die Aufgabe versucht; man sah mit Bangen meinem eigenen Versuch entgegen, dem so von der Außenwelt abgeschlossenen und von persönlichen Launen oder Dumpfheiten abhängigen kleinen Sonderling eine innere Welt beizubringen. Gleich der erste Spaziergang im Garten der Villa mußte entscheiden: »Ob Max sich an Sie gewöhnen wird?« Ich hatte den lieben Jungen am Arm; seine lichtlosen Augen waren durch eine dunkle Brille und eine Schirmmütze verdeckt; er war ganz auf sein Gehör und auf sein Tastgefühl angewiesen, derart, daß er ordentlich die Ohren bewegen konnte. Wir plauderten miteinander; ich in meiner damals noch stärker ausgeprägten süddeutschen Tonart, die dem norddeutschen Knaben neu war. Mich erfüllte rasch unendliches Mitleid. Was ist all unser aufreibendes Literaturtreiben neben solch einem Lebensleid! Die Fluten der Liebe überströmten mein Herz und zeigten mir hier eine erwärmende Aufgabe, die jenes papierne Wesen zurückdrängen konnte. Max schien diesen ganz allgemeinen Zug der Hinneigung zu spüren. Denn es war mir ein unvergeßlicher Vorgang, wie der Kleine plötzlich hinter dem Schutz des Hauses – er hörte das am Schall der Tritte – stehenblieb, meinen Kopf zu sich herabzog und mir in der herzigsten Weise gestand, daß er mir gut sei. Wir sind während der zwei Hauslehrerjahre und später bis an seinen Tod Freunde geblieben.
Ich verfertigte für seine tastenden Finger geographische Karten, auf denen die Flüsse mit Leim gezogen, die Städte mit Reißbrettnägeln bezeichnet waren. Rechnen, Geschichte, Religion, Sprachen mußten wesentlich durch das Gehör bewältigt werden; er kannte zwar die Blindenschrift, doch griff ihn das Schreiben leicht an. Und immer mußte man erzählen und anregen, wobei er auch für Heiterkeit und scherzhafte Reimereien viel Sinn besaß. Dazwischen freilich, an manchen Tagen sehr häufig, kamen seine Anfälle, wobei er unter Krämpfen die erloschenen Augen verdrehte und leise wimmernd zu Boden fiel, wenn man ihn nicht rasch auffing. Am unangenehmsten war es für mich schüchternen und scheuen Menschen, wenn dergleichen einmal auf einem Spaziergang vorkam, wo ich dann den Zusammengebrochenen manchmal auf den Armen nach Hause tragen mußte.
Wie unsicher stand ich den vielen Abendgesellschaften des Hauses gegenüber! Was war ich? Nichts. Wie sollte ich dieses Nichts den Fragern deuten oder begründen? Die Ankündigung jeder neuen Geselligkeit verursachte mir fast körperliches Unbehagen. Aber es nützte nichts; ich mußte hinunter.
Während der beiden Hauslehrerjahre ging ich vorsichtige Patrouillengänge in das nahe literarische Berlin. Hier war eine Stadt zu erobern. Aber mit welchen Mitteln? Doch wohl mit den Mitteln des Künstlers und Dichters: mit Schönheit, Güte und Geisteskraft. Diese Fähigkeiten waren jedoch in mir selber viel zu kärglich ausgebildet; es reichte, was ich besaß, eben hin, einem blinden Knaben eine Innenwelt zu schaffen, nicht aber eine grotze Stadt zu beseelen. Mit einer Aufruhrtragödie »Spartacus«, einem unendlich düsteren, im Schwarzen Tod endenden Trauerspiel »Tauler« oder einer Unmasse lyrischer Gedichte war nichts zu erobern.
Als einst bei einer nächtlichen Feuersbrunst – unsrer Villa gegenüber – gefährliche Funken flogen, beschwor mich unser erregter Hausherr, meine wichtigsten Papiere in Sicherheit zu bringen. »Ich habe keine wichtigen Papiere.« Da er aber nicht nachließ, legte ich das Spartacus-Bruchstück oben auf seine Manuskripte – und so wanderte der ganze Korb in den entfernten Hühnerstall, während ich den Gartenschlauch festschraubte und mit tüchtigen Güssen den Kampf mit den Funken aufnahm. Es ging gut vorüber; Spartacus kam von den Hühnern zurück. Er hätte ruhig dort bleiben können.
Wohl wimmelte mein Notizbuch von selbstermunternden Kampfliedern:
Auf, nach Berlin! Bestürmt wird nun die schwarze Stadt!
Der deutsche Mai wirft seine Blütenwogen
In einem weiten, duftig weißen Bogen
Rings um den Qualm, der niemals Frühling hat –,
aber Aufschwung und Schwermut hielten sich die Wage:
Für meine ekle Verbitt'rung
Vergessenstrank!
Oh, meine Freunde, wie bin ich
So krank!
Ich höre das Pack dort bespötteln
Das Flammengemüt,
Das mir auf den Lippen und drinnen
Im Herzen glüht.
Ich wage nimmer zu reden,
Verfolgungskrank –
Oh, meine Freunde, gebt mir
Vergessenstrank!
Nicht diesen höhnisch verzog'nen
Modernen Mund!
Gebt mir ein Tröpfchen Liebe,
So bin ich gesund!
Ich suchte keine Literatur, ich suchte Liebe. Die Anklageliteratur jener Zeit gab mir nichts von dieser großen, weltumfassenden, seelenbeglückenden Liebe. Und mein Mädchen war weit. Wenn mein Max zur Ruhe war und nebenan schlief – wie lange noch ging ich hin und her!
Tief in der Nacht! Meine Stirne brennt!
Ich kann nicht zur Ruhe kommen.
Ich hab' den alten Zimmermarsch
Mal wieder aufgenommen.
Pantoffelschlürfen hin und her,
Die Brust voll Wut und Klage –
So schleichen meine Nächte hin,
So kommen meine Tage.
Drüben in Berlin hielt unterdessen der naturalistische Zeitgeist seinen Siegeslauf. Dieser Siegeslauf war berechtigt; denn die Dichter besahen in ihrer Art Kunst und Kraft. Ibsen, Zola, Tolstoi, Hauptmann und Sudermann waren dort die Führer zu neuen künstlerischen Ausdrucksformen. Wer sich nicht anschloß, geriet unter die Räder. Auch Strindberg und andre Skandinavier nebst Polen, Galiziern, Slawen fanden sich dort in Literaturgruppen und Kaffeehäusern zusammen. »Als erst das Schwarze Ferkel entdeckt war« – erzählt ein Teilnehmer (Franz Servaes in Westermanns Monatsheften, September 1915) –, »eine von Strindberg so genannte Probierstube für Weine und zahllose Schnäpse in der Neuen Wilhelmstraße, kam Organisation in die Gelage. Jetzt war ein allabendliches Hauptlager aufgeschlagen, in dem vor allem Skandinavier und Polen den Ton angaben, aber auch trinkfeste Deutsche: Dehmel, genannt der wilde Mann, Scheerbart, Bierbaum, zu finden waren. Natürlich auch Damen. Der Gesamtton an diesen Trinkabenden war ein orgiastischer. Jegliche Art von Umsturz in Kunst und Gesellschaft, und selbst auch im staatlichen Leben, wurde in visionären Predigten verkündet und gefeiert. Dann wurde gebrüllt, gesungen und getanzt. Dann plötzlich von Strindberg oder einem andern unter allgemeinem Stillschweigen hell und zart auf der Laute geklimpert. Dann wieder losgerast. Wer eigentlich bezahlte, ist niemals mit Sicherheit festgestellt worden. Doch scheint der Wirt, trotz zerbrochenen Fensterscheiben und eingeschlagenen Glastüren, allemal auf seine Rechnung gekommen zu sein.«
Ein ähnlicher, doch wohl milder gestimmter Kreis scheint sich in Friedrichshagen damals gesammelt zu haben; sie hatten alle miteinander Fühlung: Holz, Schlaf, Bölsche, Wille, die Brüder Hart – und was da sonst noch aufgetaucht und längst wieder verschollen ist. Daneben wurde in der Freien Bühne tüchtig gearbeitet. So wob sich aus gemeinsamen Zügen jener Zeitgeist zusammen. Ich hörte davon, horchte auch öfters hinein, aber ich hielt mich abseits. Und nur eine Begegnung schien plötzlich bedeutsam werden zu wollen: mit Otto Brahm.
Brahm war auf meine Tragödie »Weltrevolution« aufmerksam geworden. Er druckte einige meiner Aufsätze, zum Teil unter Decknamen, in seiner »Freien Bühne« ab. Er wünschte mich persönlich kennenzulernen. Wie zwei Jahre früher vor Bleibtreu, so stand ich jetzt vor Brahm. Aber welch ein Unterschied! Bleibtreu sah ich meines Wissens in der lauten Unruhe einer durchqualmten Bierstube; Brahm in einem einfachen Hinterzimmer, wo mir der kleine bartlose Mann in etwas nachlässiger Kleidung die Tür selber öffnete und mit leiser Stimme ein Gesprach begann. Meine revolutionäre Tragödie habe ihm imponiert, sagte er ungefähr; aber sie sei zu sehr mit Gedankenpathos belastet; er stellte mir seine »Freie Bühne« zur Verfügung: ich solle mir darin das Herz leicht schreiben und dann künstlerisch reiner zur Dichtung zurückkehren.
So etwa empfing mich dieser kluge Kritiker und umsichtige Organisator. Ja, er bat mich, öfters persönlich zu ihm zu kommen und Gegenstände, die sich literarisch verwenden ließen, mit ihm zu besprechen. Ich hatte hier also die Möglichkeit, nach und nach in den Brahmschen Kreis hineinzuwachsen. Meine Entwicklung wäre dann wohl gänzlich anders geworden. Wie in der Literatur, so geschah es nun auch mit meinem Einzelschicksal: Bleibtreu verschwand aus meinem Gesichtskreis, Brahm stand im Vordergrund.
Ich weiß nicht mehr, wie es gekommen ist, daß wir beide, Brahm und ich, trotz diesem freundlichen Entgegenkommen einander nicht näherrückten. Ich war menschlich unbefangen; auch andere Literaten kamen mir unbefangen entgegen, z. B. Jakobowski, der eine literarische Gruppe um sich scharte. Gegenüber Brahms Welt jedoch wuchs in mir geistiges Unbehagen, ohne daß es zu einem eigentlichen Zerwürfnis kam. In einem Brief an Freund Heinrich (27. August 1890) finden sich plötzlich folgende Worte: »Mit Otto Brahm, dem Herausgeber der ›Freien Bühne‹, bin ich nahezu auseinander. Ein längeres Gespräch mit ihm vor einigen Wochen hat mich überzeugt, daß unser Geist furchtbar verschieden ist. Seitdem habe ich ihm keinen Artikel mehr geschrieben. Diese Leute sind so kalt, so nüchtern, so modern-rationalistisch, so undeutsch, so wissenschaftlich, so religionslos!«
Es war vorbei. Ich las mit leidenschaftlichem Eifer das damals stark wirkende Buch »Rembrandt als Erzieher« und suchte fortan mit ganzer Kraft, im Gegensatz zum internationalen Naturalismus, ein deutsches Ideal in meinem Dichten und Denken herauszugestalten.
In meinem lyrischen Tagebuch jener Jahre ging ich immer mehr der Tagesmode zu Leibe:
Sozialpolitik und Wissenschaft,
Mit Ibsens Apothekerkraft
In welsche Tiegel ergossen;
Dann eine Brühe von Anatomie,
Physiologie und Psychiatrie
Über die neue Poesie –
Dies, dramenweise genossen:
Jagt, sag' ich euch, in einem Nu,
Dieweil's gewaltig stinkt und beißt,
Den letzten Rest von heiligem Geist
Dem Teufel zu!
Und damals schon, am 1. April 1891, vermerkt mein Notizbuch einen Wunsch, der sich dann immer stärker herausgestaltet hat:
Der deutsche Staatenwirrwarr hat
Seinen Bändiger gefunden –
Nun einen Bismarck dem Seelengewirr,
Einen kernigen, gesunden!
Wieder und wieder wurde mir die Waldnatur und das Gedenken an Wasgenwald und Jugendliebe, deren Kräfte ich in mir aufgespeichert hatte, eine Seelenstärkung. Wie viel Sorge in den Briefen meines Vaters! Wie mochte er, nach seiner Gewohnheit, tief in die Nacht hinein im mondhellen Garten auf und ab gehen, sein Pfeifchen rauchen und für seine Kinder ein Gebet gen Himmel senden! Er war mir mehr als nur Person, er war mir Vertreter deutschreligiöser Ideale:
Ich weiß ein Dorf voll Mondlicht,
Da geht ein alter Mann
Im Garten spät spazieren
Und träumt den Vollmond an.
Die Bauern schlafen alle.
Er sinnt und raucht und geht,
Und für den Fernen schickt er
Gen Himmel ein Gebet.
Immer kühner und trotziger, ja übermütig, gestaltete sich in der Überfülle meiner lyrischen Ergüsse die innere Welt. Der Drang zum Jasagen und Liebhaben war denn doch zu mächtig. Und ebenso der Glaube an den endlichen Sieg, an den schließlich doch wohl auch mir noch beschiedenen Seelenfrieden. »Wir werden doch einst, o meine Kraft, den Sieg behalten! Wie jenes Abendrot, das seine Klarheit über alle Horizonte wirft, wie diese aufsteigende Mondnacht, die ihre Milde breitet über alle Welt: hellfröhlich und ernst und nachtstill, o meine Kraft du, mein deutsches Gemüt, so werden wir doch einst den Sieg behalten!« ...
Erwache, vielgeruf'ner Rotbart, komm!
Zersprenge ganz den halbgeborst'nen Berg:
Und zu des deutschen Reiches Kraft und Einheit
Gib auch den alten markigen deutschen Geist!
In diesem Blättergewirr war also schon für den Hauslehrer, wie man sieht, die Richtung deutsch und deutlich vorgezeichnet, die sein Geist einzuschlagen hatte.
Es fanden sich auch einige Geistesgesellen nach Freund Heinrichs Tod. Da war mir eines Tages, im Jahre 1889, als ich noch ratlos zu Hause saß, ein Brief aus Worms zugegangen, ich möchte mich an einer Festschrift für das dortige Herrigsche Volkstheater beteiligen. Das geschah gerne. Der Briefschreiber lud mich zur Einweihung nach Worms; er würde mich am Bahnhof erwarten und als Erkennungszeichen ein Taschentuch in der Hand halten. So schüttelten wir uns dort in der alten Nibelungenstadt zum erstenmal die Hand. Wie war er auf mich aufmerksam geworden? Er hatte in der »Gesellschaft« meine »Reformation der Literatur« gelesen, hatte sich einen reifen Mann unter dem Verfasser vorgestellt und war nicht wenig erstaunt, als ein Flaumbart aus dem Wagen sprang. Dieser ernste, unermüdlich arbeitende Hesse kam während meiner Hauslehrerjahre auf einige Semester nach Berlin. Er hatte in kinderreicher Familie eine ähnlich schwere Entwicklung durchgemacht wie ich, aber in katholischen Formen; sein Schicksal hatte ihn sogar einmal vorübergehend nach Nordafrika verschlagen, wo er Zögling des Kardinals Lavigerie war. Nun lebte er sich wieder in das akademische Deutschtum ein. Wir lasen, stritten und darbten miteinander, als ich nach meiner Hauslehrerzeit längere Monate in Berlin verbrachte, jeder zäh seinem freilich noch ungeklärten Ideal getreu und noch nicht befreit von den konfessionellen oder dogmatischen Eierschalen. Ich will nicht sagen, daß ich bei diesen Kämpfen zwischen Katholik und Protestant immer die besseren Gründe hatte, aber ich hatte die besseren Nerven. Nach solchen Nachtgefechten, die sich oft bis zwei und drei Uhr morgens ausdehnten, lag der Freund zermürbt und knurrend zu Bett, ich meinerseits sah tröstend davor. Wir lächelten später über diese jugendlichen Schlachten, als wir uns zu Paris, Straßburg, Einsiedeln, München immer wieder trafen, und blieben lebenslang Freunde, und zwar Freunde jener Art, die auch nach langem getrenntem Wandern sich umarmen, als ob sie gestern erst auseinandergegangen wären. Der Mann, von dem ich spreche, hat übrigens einen literarischen Namen: es ist der Herausgeber des Münchner »Hochland«, Professor Karl Muth.
Einem kleinen Kreise jener Jahre gehörte ferner ein heutiger Berliner Arzt an, durchaus nordostdeutscher Typus, auf Schopenhauers wuchtigen Ernst eingestellt und mit der Kraft der Ehrfurcht vor großen Gedanken und Menschen prächtig ausgerüstet. Freund Seeliger wurde gut ergänzt durch einen derb zufassenden Rechtsanwalt, dessen Berliner Schnoddrigkeit sich mit thüringischem Gemüt eigenwüchsig verband und nicht ohne dichterischen Einschlag war. Eng mit Seeliger und Hercher befreundet, eine schlanke, hohe Gestalt neben dem untersetzten Rechtsanwalt, der ihn kräftiglich zu necken pflegte, schritt mit beweglicher Denkart und Heller, unermüdlicher Stimme ein andrer einher, der nachher als Gründer des Harzer Bergtheaters berühmt geworden ist. Ernst Wachler verleugnete nie die Formen der guten Familie und nahm auch gröbere Scherze so leicht nicht übel, da er als elastischer Geist immer zu Plänen bereit war, wobei er in seinen Zeitschriften manches Schöne geboten hat. Einige andre gesellten sich zu diesem wertvollen Grundstamm als Gäste hinzu. Seinen besonderen Weg schritt bummelnd und philosophierend ein Architekt, der bei menschlich vorzüglichen Grundanlagen ein wichtiges Bindeglied war, sein Leben jedoch nur mangelhaft zu bauen wußte. Die Veröffentlichung meines »Naphtali« hatte mir diese Freunde verschafft. Und da jeder von einer anderen Seite kam und sein Päckchen Sondergedanken mitbrachte, der eine von Schopenhauer, der andre von Nietzsche oder vom Wodanskultus, der dritte und vierte aus evangelischer und katholischer Kirchlichkeit, so konnte es nicht ausbleiben, daß wir uns bei unfern Zusammenkünften herzhaft in die Haare gerieten. Es war eine belebende elektrische Reibung. Und der Blick ward erweitert.
Einige Hochsommermonate in Partenkirchen, ein weiterer Aufenthalt in München, im Elsaß und zu Paris lüfteten Herz und Hirn aus. Ich kehrte im Frühjahr 1893 zu schriftstellerischem Schaffen nach Berlin zurück. Immer mehr arbeitete sich der deutsche Grundton ins klare. Als ich den Sommer 1895 wieder im Elsaß verbrachte und mit Muth und Euler auf den Vogesenkämmen wanderte, schrieb ich mein erstes eigentliches Buch, die »Wasgaufahrten«, und gab gleichzeitig meine ersten Gedichte heraus, »Lieder eines Elsässers«, die nun in die lyrische Gesamtausgabe hereingenommen sind. Ein Schelmenspiel, »Eulenspiegels Ausfahrt«, war vorausgegangen (1894).
Indem ich die zahllosen unveröffentlichten Gedichte jener Jahre, Gedichte der Entlastung und der Ermutigung, wieder durchblättere, fällt mir ein Stimmungsbild aus den bayerischen Hochalpen auf. Ich weiß noch, wie ich in jenem Sommer 1892 todmüde im Hochtal von Partenkirchen ankam. Berlin lag hinter mir; es bedeutete alles in allem, trotz wertvollen Errungenschaften, eine Niederlage. Oft sah ich an einem Waldrand und ertappte mich darauf, daß mir Tränen übers Gesicht liefen, wenn ich in diese Hochsommerstille hinaushorchte. Da meldete sich dann wieder, wie ein Brunnenrauschen aus der Tiefe, das innere Ideal. In einem Gedicht jenes Sommers ist es deutlich geprägt; die zwei mittleren Strophen lauten:
...Tiefblaue Nacht! So schlug um Griechenland
Ein reiches Meer die wunderbare Bläue,
Daraus der Schönheit Götterbild erstand,
Daß sich ein glücklich Volk daran erfreue.
Auch ich bin heute Nacht am Griechenstrand:
Die Augen auf ein weitblau Meer gewandt
Schau' ich das süße Götterbild aufs neue:
Mein Attika ist diese Hochlandsruh'!
Tiefblaue Nacht, mein Griechenmeer bist du!
Sie haben lange Jahre mich gemieden.
Die ich als Knabe doch so warm verehrt:
Die
Griechenklarheit und der
Christenfrieden
Und
deutsche Mannheit, jener beiden wert.
Ich meinte schon, sie sei mir nie beschieden,
Ein Wahn sei alle Harmonie hienieden,
Ein Tor und Schwärmer, wer die drei begehrt:
Da warf mich Gott an diesen Alpenstrand,
Wo ich im Blau der Nacht sie wiederfand ...
Wie auch das Maß meiner Begabung sein mochte: der Ton war gefunden. Es galt nun, diesen Ton, dieses Hand-in-Hand von Bekenntnis und Dichtung, im Laufe der Jahre immer reiner und reifer herauszugestalten.