
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Aus unserer bisherigen Betrachtung ergiebt sich, daß Helle, Finsterniß und Farbe, im engsten Sinne genommen, Zustände, Modifikationen des Auges sind, welche unmittelbar bloß empfunden werden. Eine gründliche Betrachtung der Farbe muß von diesem Begriff derselben ausgehn und demnach damit anfangen, sie als physiologische Erscheinung zu untersuchen. Denn um regelrecht und überlegt zu Werke zu gehn, muß man, ehe man zu einer gegebenen Wirkung die Ursache zu entdecken unternimmt, vorher diese Wirkung selbst vollständig kennen lernen; weil man allein aus ihr Data zur Auffindung der Ursache schöpfen kann und nur sie die Richtung und den Leitfaden zu dieser giebt. Neuton's Fundamentalversehn war eben, daß er, ohne die Wirkung irgend genau und ihren innern Beziehungen nach kennen zu lernen, voreilig zur Aufsuchung der Ursache schritt. Jedoch ist das selbe Versehn allen Farbentheorien, von den ältesten bis auf die letzte von Goethe, gemeinsam: sie alle reden bloß davon, welche Modifikation der Oberfläche ein Körper, oder welche Modifikation das Licht, sei es durch Zerlegung in seine Bestandtheile, sei es durch Trübung, oder sonstige Verbindung mit dem Schatten, erleiden muß, um Farbe zu zeigen, d. h. um jene specifische Empfindung im Auge zu erregen, die sich nicht beschreiben, sondern nur sinnlich nachweisen läßt. Statt Dessen ist offenbar der rechte Weg, sich zunächst an diese Empfindung selbst zu wenden, um zu erforschen, ob nicht aus ihrer Beschaffenheit und Gesetzmäßigkeit sich herausbringen ließe, worin sie an und für sich, also physiologisch, bestehe. Offenbar wird eine solche genaue Kenntniß der Wirkung, von welcher eigentlich, wenn man von Farben spricht, die Rede ist, auch Data liefern zur Auffindung der Ursache, d. h. des äußern Reizes, der solche Empfindung erregt. Zunächst nämlich muß überall zu jeder möglichen Modifikation einer Wirkung eine ihr genau entsprechende Modifikabilität der Ursache nachweisbar seyn; ferner, wo die Modifikationen der Wirkung keine scharfe Gränzen gegen einander zeigen, da dürfen auch in der Ursache dergleichen nicht abgesteckt seyn, sondern muß auch hier die selbe Allmäligkeit der Uebergänge sich vorfinden; endlich, wo die Wirkung Gegensätze zeigt, d. h. eine gänzliche Umkehrung ihres Charakters gestattet, da müssen auch hiezu die Bedingungen in der Natur der Ursache liegen, gemäß der Regel des Aristoteles: των γαρ εναντιων τα εναντια αιτια ( nam contrariorum contrariae sunt causae) de generat. et corrupt. II, 10. Diesem Allen gemäß, wird man finden, daß meine Theorie, welche die Farbe nur an sich selbst, d. h. als gegebene specifische Empfindung im Auge betrachtet, schon Data a priori an die Hand giebt zur Beurtheilung der Neutonischen und Goethe'schen Lehre vom Objektiven der Farbe, d. h. von den äußern Ursachen, die im Auge solche Empfindung erregen: und da wird sich ergeben, daß Alles für die Göthe'sche und gegen die Neutonische Lehre spricht. – Also erst nach der Betrachtung der Farbe als solcher, d. h. als specifischer Empfindung im Auge, ist, als eine von ihr völlig verschiedene, die der äußeren Ursachen jener besondern Modifikationen der Lichtempfindung anzustellen, d. h. die Betrachtung derjenigen Farben, welche Goethe sehr richtig in physische und chemische eingetheilt hat.
Es ist unbezweifelte Lehre der Physiologie, daß alle Sensibilität nie reine Passivität sei, sondern Reaktion auf empfangenen Reiz. Sogar in specieller Hinsicht auf das Auge, und namentlich sofern es Farben sieht, hat sie schon Aristoteles ausgesprochen: ου μονον πασχει, αλλα και αντιποιει το των χροματων αισθητηριον ( non modo patitur sensorium, quo natura colorum percipitur, sed etiam vicissim agit) de insomniis, 2. – Eine sehr überzeugende Auseinandersetzung der Sache findet man, unter andern, in Darwin's Zoonomia p. 19 seqq. – Ich werde die dem Auge überhaupt eigenthümliche Reaktion auf äußern Reiz seine Thätigkeit nennen und zwar, näher, die Thätigkeit der Retina; da diese der unbezweifelte Sitz Dessen ist, was beim Sehn in der bloßen Empfindung besteht. Dasjenige, was durch sich selbst, unmittelbar und ursprünglich, diese Thätigkeit anreizt, ist das Licht. Das die volle Einwirkung des Lichts empfangende Auge äußert also die volle Thätigkeit der Retina. Mit Abwesenheit des Lichtes, oder Finsterniß, tritt Unthätigkeit der Retina ein.
Körper, welche unter Einwirkung des Lichtes auf sie, ganz wie das Licht selbst auf das Auge zurückwirken, sind glänzend, oder Spiegel.
Weiß aber sind die Körper, welche, der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt, nicht ganz wie das Licht selbst auf das Auge zurückwirken, sondern mit einer geringen Verschiedenheit, nämlich mit einer gewissen Milderung und gleichmäßigen Verbreitung, die man, wenn man nicht von der Erscheinung im Auge auf ihre Ursache abgehn will, nicht näher bestimmen kann, als daß sie die Abwesenheit des Glanzes und der strahlenden Beschaffenheit des Lichtes sei. Man könnte, wie man strahlende Wärme von der diffundirten unterscheidet, die Weiße diffundirtes Licht nennen. Will man aber die Wirkung durch die Ursache ausdrücken, dann ist Goethes Erklärung des auf physischem Wege erscheinenden Weißen, daß es die vollendete Trübe sei, überaus treffend und richtig. Körper, welche, unter Einwirkung des Lichtes auf sie, gar nicht auf das Auge zurückwirken, sind schwarz.
Vom Glanze wird in dieser ganzen Betrachtung, als etwas ihren Gegenstand nicht Angehendem, abgesehn. Das Weiße wird als das zurückwirkende Licht, und daher die Wirkung Beider (des Lichtes und des Weißen) auf das Auge als im Wesentlichen dieselbe angesehn. Wir sagen demnach: unter Einwirkung des Lichtes, oder des Weißen, ist die Retina in voller Thätigkeit: mit Abwesenheit jener Beiden aber, d. h. bei Finsterniß, oder Schwarz, tritt Unthätigkeit der Retina ein.
Die Einwirkung des Lichtes und des Weißen auf die Retina und die aus ihr erfolgende Thätigkeit derselben hat Grade, in denen, mit stetigem Uebergang, das Licht der Finsterniß und das Weiße dem Schwarzen sich annähert. Im ersten Fall heißen sie Halbschatten und im andern Grau. Wir erhalten also folgende zwei Reihen der Bestimmungen der Thätigkeit der Retina, die im Wesentlichen nur eine Reihe ausmachen und bloß durch den Nebenumstand der unmittelbaren, oder der vermittelten Einwirkung des Reizes auseinandertreten:
| Licht; | Halbschatten; | Finsterniß. |
| Weiß; | Grau; | Schwarz. |
Die Grade der verminderten Thätigkeit der Retina (Halbschatten und Grau) bezeichnen eine nur theilweise Intensität derselben: ich nenne deshalb die Möglichkeit solcher Grade überhaupt die intensive Theilbarkeit der Thätigkeit der Retina.
Wie wir die Thätigkeit der Retina intensive theilbar fanden, so kann dieselbe auch, da sie einem ausgedehnten Organ inhärirt, eben mit diesem, extensive getheilt werden: wodurch eine extensive Theilbarkeit der Thätigkeit der Retina gegeben ist.
Das Daseyn dieser ergiebt sich schon daraus, daß das Auge mannigfaltige Eindrücke zugleich, also neben einander, erhalten kann. Besonders hervorgehoben aber wird es durch die von Goethe (Farbenlehre, Bd. I. S. 9 und 13) dargestellte Erfahrung, daß ein schwarzes Kreuz auf weißem Grunde, eine Weile angesehn und dann diesen Eindruck gegen den gleichgültigen einer grauen oder dämmernden Fläche vertauscht, die umgekehrte Erscheinung im Auge veranlaßt, nämlich ein weißes Kreuz auf schwarzem Grunde. Der Versuch läßt sich jeden Augenblick am Fensterkreuze machen. Diese Erscheinung erklärt sich daraus, daß auf denjenigen Stellen der Retina, welche vom weißen Grunde getroffen wurden, die Thätigkeit derselben durch diesen Reiz so erschöpft ist, daß sie gleich darauf nicht mehr merklich erregt werden kann durch den viel geringern Reiz der grauen Fläche, welche hingegen auf die übrigen, vorhin vom schwarzen Kreuz getroffenen und während dieser Unthätigkeit ausgeruhten Stellen, mit ihrer ganzen Kraft wirkt und daselbst einen dieser angemessenen intensiven Grad der vollen Thätigkeit der Retina hervorruft. Demnach ist die Umkehrung der Erscheinung hier eigentlich nur scheinbar, wenigstens nicht, wie man übrigens zu glauben geneigt seyn möchte, spontan, nämlich eine wirkliche Aktion, in die der vorhin ausgeruhte Theil von selbst geriethe: denn, wenn man, nach erhaltenem Eindruck, das Auge schließt (wobei man aber die Augen mit der Hand bedecken muß), oder ins völlig Finstere sieht, so kehrt die Erscheinung sich nicht um; sondern bloß der empfangene Eindruck dauert eine Weile fort; wie Dies auch Goethe angiebt (F. L. Bd. 1. Th. 1, § 20): diese Thatsache würde mit jener Annahme nicht zu vereinigen seyn. Wenn man jedoch hiebei die Augen mit der Hand zu bedecken vernachlässigt; so wird das durch die Augenlieder eindringende Licht die oben angeführte Wirkung einer grauen Fläche thun und demnach die Erscheinung allerdings sich umkehren: daß aber Dies die Folge des besagtermaaßen eindringenden Lichtes ist, geht daraus hervor, daß, sobald man alsdann die Augen mit der Hand bedeckt, die Umkehrung sogleich wegfällt. Diese Erfahrung hat schon Franklin gemacht, dessen eigenen Bericht darüber Goethe wiedergiebt, im historischen Theil seiner Farbenlehre. – Es ist erfordert, daß man hierüber im Klaren sei, damit man die wesentliche Verschiedenheit dieser Erscheinung von der sogleich zu erörternden wohl erkenne.
Die bis hieher dargestellte und keinem Zweifel unterworfene intensive und extensive Theilbarkeit der Thätigkeit der Retina läßt sich zusammenfassen unter den gemeinsamen Begriff einer quantitativen Theilbarkeit der Thätigkeit der Retina. Nunmehr aber ist mein Vorhaben zu zeigen, daß noch eine dritte, von jenen beiden toto genere verschiedene Theilung jener Thätigkeit vorgehn kann, nämlich eine qualitative, und daß diese wirklich vollzogen wird, sobald dem Auge irgend eine Farbe, auf welchem Wege es auch sei, gegenwärtig ist. Zu dieser Betrachtung bietet uns die am Ende des vorigen Paragraphs erwähnte Erscheinung einen bequemen Uebergang dar. Ich werde sie sogleich nochmals vor die Augen bringen.
Zuvor aber muß ich hier dem Leser die Eröffnung machen, daß zum Verständniß des jetzt folgenden eigentlichen Kerns meiner Theorie der Farbe die Autopsie unerläßlich ist, er also die hier sogleich anzugebenden Versuche selbst nachzumachen hat. Glücklicherweise ist Dies äußerst leicht. Es bedarf dazu weiter nichts, als einiger, in den anzugebenden Farben, lebhaft gefärbter Stückchen Papiers, oder Seidenbandes, welche man in die hier angenommene Scheibenform, oder auch in jede beliebige andere, wenige Quadratzolle groß, schneidet, solche auf eine graue, oder weiße Stubenthüre leicht befestigt und alsdann, nach etwan 30 Sekunden unverwandten Anschauens derselben, sie schnell wegreißt, jedoch die Stelle, welche sie einnahmen, im Auge behält, woselbst jetzt, statt der dagewesenen, eine völlig andere Farbe, in der selben Figur, sich zeigt. Diese kann nicht ausbleiben: sollte man sie nicht sogleich wahrnehmen; so liegt Dies bloß am Mangel gehöriger Aufmerksamkeit und der Gewohnheit darauf zu achten. Die größte Energie erlangt das Experiment, wenn man Stückchen lebhaft gefärbter Seide an die Fensterscheibe klebt, wo man sie vom Lichte durchdrungen sieht. – Ohne diese Autopsie aber wird man nicht eigentlich wissen, wovon im weitern Verfolg durchweg die Rede ist, sondern sich mit bloßen Worten herumschleppen.
Man betrachte also zuvörderst, 20 bis 30 Sekunden hindurch, eine weiße Scheibe auf schwarzem Grunde, und sehe sodann auf eine dämmernde oder hellgraue Fläche: da wird dem Auge sich eine schwarze Scheibe auf hellem Grunde darstellen. Dies ist noch völlig die Erscheinung der extensiven Theilbarkeit der Thätigkeit der Retina. Auf der Stelle derselben nämlich, welche von der weißen Scheibe afficirt war, ist hiedurch die Sehkraft auf eine Weile erschöpft, wodurch völlige Unthätigkeit derselben, unter schwächerem Reize, eintritt. Man kann Dies damit vergleichen, daß ein Tropfen Schwefeläther, der auf der Hand verdunstet, die Wärme dieser Stelle wegnimmt, bis sie allmälig sich wieder herstellt. – Nunmehr aber setze man an die Stelle der weißen Scheibe eine gelbe. Jetzt wird, wenn man auf die graue Fläche blickt, statt der schwarzen Scheibe, welche die völlige Unthätigkeit dieser Stelle der Retina aussprach, sich eine violette darstellen. Dies ist was Goethe treffend das physiologische Farbenspektrum nennt; wie er denn auch sämmtliche hiehergehörige Thatsachen, mit großer Richtigkeit und erschöpfender Vollständigkeit, dargestellt hat, jedoch darüber nicht hinausgegangen ist. Uns nun aber beschäftigt gegenwärtig das Rationale der Sache, also der hier vor sich gehende physiologische Proceß, und wird es um so ernstlicher, als, meiner Meinung nach, allein aus der richtigen Erklärung desselben ein wahres Verständniß des eigentlichen Wesens der Farbe überhaupt möglich ist, aber aus ihr klar hervorgeht, sobald man nur Augen und Kopf zugleich anwenden will. Nämlich aus der Anschauung des besagten Phänomens und aus der aufmerksamen Vergleichung Dessen, was auf eine weiße, mit Dem, was auf eine gelbe Scheibe im Auge folgt, ergiebt sich mir nachstehende Erklärung dieses Vorgangs, welche zunächst keiner andern Begründung fähig ist, noch bedarf, als eben der unmittelbaren Beurtheilung des Phänomens selbst, indem sie bloß der richtige Ausdruck desselben ist. Denn hier sind wir zu dem Punkte gelangt, wo der sinnliche Eindruck das Seinige gethan hat, weiter nichts zu geben vermag, und nunmehr die Reihe an die Urtheilskraft kommt, das empirisch Gegebene zu verstehn und auszusprechen. Jedoch wird die Richtigkeit dieser Erklärung aus unserer ferneren Betrachtung, die jenes Phänomen unter seinen verschiedenen Phasen verfolgt, mehr und mehr hervortreten, endlich aber ihre volle Bestätigung erhalten durch die § 10 darzulegende Rechnungsprobe der Sache.
Bei der Darstellung der gelben Scheibe im Auge ist nicht, wie vorhin von der weißen, die volle Thätigkeit der Retina erregt und dadurch mehr oder weniger erschöpft worden; sondern die gelbe Scheibe vermochte nur einen Theil derselben hervorzurufen, den andern zurücklassend; so daß jene Thätigkeit der Retina sich nunmehr qualitativ getheilt hat und in zwei Hälften auseinandergetreten ist, davon die eine sich als gelbe Scheibe darstellte, die andere dagegen zurückblieb und nun von selbst, ohne neuen äußern Reiz, als violettes Spektrum nachfolgt. Beide, die gelbe Scheibe und das violette Spektrum, als die bei dieser Erscheinung getrennten qualitativen Hälften der vollen Thätigkeit der Retina, sind zusammengenommen dieser gleich: ich nenne daher, und in diesem Sinn, jede das Komplement der andern. Da nun aber ferner der Eindruck des Gelben dem des vollen Lichtes, oder des Weißen, viel näher kommt, als der Eindruck des Violetten; so müssen wir zur ersten Annahme sogleich die zweite fügen, nämlich daß die qualitativen Hälften, in welche hier die Thätigkeit der Retina sich theilte, einander nicht gleich sind, sondern die gelbe Farbe ein viel größerer qualitativer Theil jener Thätigkeit ist, als ihr Komplement, die violette. Man bemerke aber wohl, daß das unwesentliche Hell und Dunkel, welches die Vermischung der Farbe mit Weiß oder Schwarz ist und unten noch besonders erörtert werden soll, hier nicht gemeint ist und nichts zur Sache thut. Jede Farbe nämlich hat einen Punkt der größten Reinheit und Freiheit von allem Weiß und Schwarz, welcher Punkt, auf Runge's sehr sinnreich erdachter Farbenkugel, durch den Aequator, der vom weißen und schwarzen Pol gleich fern liegt, dargestellt ist. Auf diesen Aequator nämlich sind sämmtliche Farben aufgetragen, mit ganz unmerklichen Uebergängen der einen in die andere; so daß z. B. das Roth, nach der einen Seite hin, ganz allmälig ins Orange, dieses ins Gelbe, dieses ins Grüne, dieses ins Blaue, dieses ins Violette übergeht, welches letztere wieder zum Roth zurückkehrt. Diese sämmtlichen Farben aber zeigen nur auf dem Aequator sich in voller Energie, und verlieren diese, nach dem schwarzen Pole hin, durch Verdunkelung, nach dem weißen hin, durch Verblassung, mehr und mehr. Auf diesem Punkt ihrer größten Energie nun also, wie solchen der Aequator darstellt, hat jede Farbe eine innere und wesentliche Annäherung zum Weißen, oder Aehnlichkeit mit dem Eindruck des vollen Lichtes, und andererseits wieder eine dieser im umgekehrten Verhältniß entsprechende Dunkelheit, also Annäherung zur Finsterniß. Durch diesen jeder Farbe wesentlichen und eigenthümlichen Grad von Helle, oder Dunkelheit, sind sie demnach, auch abgesehn von ihrer sonstigen Differenz, schon von einander verschieden, indem die eine dem Weißen, die andere dem Schwarzen näher steht; und diese Verschiedenheit ist augenfällig. Jene der Farbe wesentliche innere Helle ist von aller ihr durch zufällige Beimischung gegebenen sehr unterschieden, indem die Farbe sie im Zustand ihrer größten Energie beibehält, das zufällige, eingemischte Weiß aber diese schwächt. So ist z. B. Violett unter allen Farben die wesentlich dunkelste, unwirksamste; Gelb dagegen die wesentlich hellste und heiterste: nun kann zwar das Violette, durch Beimischung von Weiß, sehr hell werden; aber es erhält dadurch keine größere Energie, vielmehr verliert es nur noch mehr von der ihm eigenthümlichen, und wird in ein blasses, mattes, dem Hellgrau ähnliches Lila verwandelt, das keineswegs sich mit der Energie des Gelben vergleichen kann, ja nicht ein Mal die des Blauen je erreicht. Umgekehrt kann man allen und auch den wesentlich hellsten Farben, durch Beimischung von Schwarz, jeden beliebigen Grad von Dunkelheit ertheilen; welches ihnen aufgedrungene Dunkel aber ebenfalls sogleich ihre Energie schwächt: so, wenn aus Gelb Braun wird. An der Wirksamkeit der Farben als solcher also, an ihrer Energie, läßt sich erkennen, ob sie rein sind und frei von allem ihrem Wesen fremden Schwarz oder Weiß. Durch seine innere, wesentliche Helligkeit nun, giebt das Gelbe sich als einen ungleich größeren qualitativen Theil der Thätigkeit des Auges zu erkennen, als sein Komplement, das Violette, welches vielmehr von allen Farben die dunkelste ist.
Man lasse nunmehr die zum Beispiel gebrauchte vorhin gelbe Scheibe rothgelb werden; so wird das Violett des darauf erscheinenden Spektrums sich vom Rothen genau so viel entfernen, als die Scheibe sich demselben genähert hat: ist diese gerade in der Mitte zwischen Gelb und Roth, also Orange; so ist das Spektrum rein Blau. Das Orange ist vom Weißen, als der vollen Thätigkeit der Retina, schon ferner, als das Gelbe, und dagegen das Blau, sein Komplement, um eben so viel dem Weißen näher, als das Violette. Hier sind also die qualitativen Hälften der getheilten Thätigkeit sich schon viel weniger ungleich. Ganz gleich werden sie endlich, wenn die Scheibe roth und das Spektrum vollkommen grün wird. Unter Roth ist hier jedoch Goethes Purpur, d. h. das wahre, reine, weder ins Gelbe, noch ins Violette irgend ziehende Roth (so ziemlich die Farbe des auf einer weißen Porzellantasse aufgetrockneten Karmins), zu verstehn, nicht aber Neuton's Roth, das prismatische, als welches ganz und gar gelbroth ist. Jenes wahre, reine Roth nun also ist vom Weißen und vom Schwarzen gerade so weit entfernt, wie sein Komplement, das vollkommene Grün. Demnach stellen diese beiden Farben die in zwei gleiche Hälften qualitativ getheilte Thätigkeit der Retina dar. Hieraus erklärt sich ihre auffallende, jede andere übertreffende Harmonie, die Stärke, mit der sie sich fordern und hervorrufen, und die ausgezeichnete Schönheit, die wir jeder derselben für sich und noch mehr beiden neben einander zuerkennen; daher keine andere Farbe den Vergleich mit ihnen aushält und ich diese beiden völlig gleichen Hälften der qualitativ getheilten Thätigkeit der Retina, Roth und Grün, χρωματα κατ' εξοχην couleurs par excellence nennen möchte; weil sie das Phänomen der Bipartition der Thätigkeit der Retina in höchster Vollkommenheit darstellen. Denn in jedem andern Farbenpaar steht die eine Farbe dem Weißen näher, als dem Schwarzen, und die andere umgekehrt: nur in diesem ist es nicht so; die Theilung der Thätigkeit der Retina ist hier in eminentem Grade qualitativ, das Quantitative macht sich nicht, wie dort, direkt fühlbar. – Geht nun endlich unsere zuletzt roth gewesene Scheibe ins Blaurothe (Violette) über; so wird nunmehr das Spektrum gelb, und wir durchwandern den selben Kreis in entgegengesetzter Richtung.
Folgende Verhältnisse lassen sich freilich vor der Hand nicht beweisen und müssen insofern sich gefallen lassen hypothetisch zu heißen Die Angabe zweier, allenfalls zum Beweise für sie dienender Experimente findet man am Ende des § 13.: allein aus der Anschauung erhalten sie eine so entschiedene, unmittelbare Bewährung und Ueberzeugungskraft, daß schwerlich Jemand sie im Ernst und aufrichtig ableugnen wird; daher eben auch der Prof. A. Rosas, der im ersten Bande seines Handbuchs der Augenheilkunde sich per fas et nefas das Meinige aneignet, diese Verhältnisse geradezu als selbstevident einführt (das Nähere hierüber findet man im »Willen in der Natur«, 2. Aufl. S. 15). Wie nämlich Roth und Grün die beiden völlig gleichen qualitativen Hälften der Thätigkeit der Retina sind, so ist Orange ⅔ dieser Thätigkeit, und sein Komplement Blau nur ⅓; Gelb ist ¾ der vollen Thätigkeit, und sein Komplement Violett nur ¼. Es darf uns hiebei nicht irre machen, daß Violett, da es zwischen Roth, das ½ ist, und Blau, das ⅓ ist, in der Mitte liegt, doch nur ¼ seyn soll: es ist hier wie in der Chemie: aus den Bestandtheilen läßt sich die Qualität der Zusammensetzung nicht vorhersagen. Violett ist die dunkelste aller Farben, obgleich es aus zwei hellern, als es selbst ist, entsteht; daher es auch, sobald es nach einer oder der andern Seite sich neigt, heller wird. Dies gilt von keiner andern Farbe: Orange wird heller, wenn es zum Gelben, dunkler, wenn es zum Rothen sich neigt; Grün, heller nach der gelben, dunkler nach der blauen Seite; Gelb, als die hellste aller Farben, thut umgekehrt das Selbe, was sein Komplement, das Violett: es wird nämlich dunkler, es mag sich zur orangen oder zur grünen Seite neigen. – Aus der Annahme eines solchen, in ganzen und den ersten Zahlen ausdrückbaren Verhältnisses, und zwar allein daraus, erklärt es sich vollkommen, warum Gelb, Orange, Roth, Grün, Blau, Violett feste und ausgezeichnete Punkte im sonst völlig stetigen und unendlich nüancirten Farbenkreise, wie ihn der Aequator der Runge'schen Farbenkugel darstellt, sind, und man sie durch Beilegung besonderer Namen überall und von jeher dafür erkannt hat. Liegen ja doch zwischen ihnen unzählige Farbennüancen, deren jede eben so gut einen eigenen Namen haben könnte: worauf also beruht das Vorrecht jener sechs? Auf dem soeben angeführten Grunde, daß in ihnen die Bipartition der Thätigkeit der Retina sich in den einfachsten Brüchen darstellt. Gerade so, wie auf der Tonleiter, welche ja ebenfalls in einen von der untern zur obern Oktave, durch unmerkliche Uebergänge, heulend aufsteigenden Ton sich auflösen läßt, die 7 Stufen abgesteckt sind (wodurch eben sie zur Leiter, scala, wird) und eigene Namen erhalten haben, abstrakt als Prime, Sekunde, Terz u. s. w., konkret als ut, re, mi u. s. w., bloß aus dem Grunde, daß die Schwingungen gerade dieser Töne in rationalem Zahlenverhältniß zu einander stehn. – Bemerkenswerth ist es, daß schon Aristoteles gemuthmaaßt hat, daß dem Unterschiede der Farben, wie dem der Töne, ein Zahlenverhältniß zum Grunde liegen müsse und daß, jenachdem dasselbe rational oder irrational wäre, die Farben rein und unrein ausfielen. Nur weiß er nicht, worauf eigentlich dasselbe beruhen soll. Die Stelle steht im Buche de sensu et sensibili, c. 3, in der Mitte: εστι εστι μεν οὑτως ὑπολαβειν κ. τ. λ.; wobei ich bemerke, daß man vor τρια γαρ einzuschalten hat τα μεν.
Anmerkung: Man hat nicht Anstoß daran zu nehmen, daß, indem die qualitative Theilung der Thätigkeit des Auges zum Unterschied und im Gegensatz der bloß quantitativen aufgestellt worden, dennoch bei jener von gleichen und ungleichen Hälften, also einem quantitativen Verhältniß, die Rede ist. Jede qualitative Theilung nämlich ist zugleich, in einer untergeordneten Hinsicht, eine quantitative. So ist jede chemische Scheidung eine qualitative Theilung der Materie, im Gegensatz der bloß quantitativen, mechanischen Theilung: nothwendig ist aber auch jene zugleich immer noch eine quantitative, ein Teilen der Masse als Masse, eben wie die mechanische. –
Die gegebene Erklärung der Farbe ist also im Wesentlichen folgende. Die Farbe ist die qualitativ getheilte Thätigkeit der Retina. Die Verschiedenheit der Farben ist das Resultat der Verschiedenheit der qualitativen Hälften, in welche diese Thätigkeit auseinandergehn kann, und ihres Verhältnisses zu einander. Gleich können diese Hälften nur Ein Mal seyn, und dann stellen sie das wahre Roth und das vollkommene Grün dar. Ungleich können sie in unzähligen Verhältnissen seyn, und daher ist die Zahl der möglichen Farben unendlich. Jeder Farbe wird, nach ihrer Erscheinung, ihr im Auge zurückgebliebenes Komplement zur vollen Thätigkeit der Retina, als physiologisches Spektrum, nachfolgen. Dies geschieht, weil die Nervennatur der Retina es mit sich bringt, daß, wenn sie, durch die Beschaffenheit eines äußern Reizes, zur Theilung ihrer Thätigkeit in zwei qualitativ verschiedene Hälften genöthigt worden ist, dann der vom Reiz hervorgerufenen Hälfte, nach Wegnahme desselben, die andere von selbst nachfolgt: indem nämlich die Retina den natürlichen Trieb hat, ihre Thätigkeit ganz zu äußern, sucht sie, nachdem solche auseinandergerissen war, sie wieder zu ergänzen. Ein je größerer Theil der vollen Thätigkeit der Retina eine Farbe ist, ein desto kleinerer muß ihr Komplement zu dieser Thätigkeit seyn: d. h. mehr eine Farbe, und zwar wesentlich, nicht zufällig, hell, dem Weißen nahe ist, desto dunkler, der Finsterniß näher, wird das nach ihr sich zeigende Spektrum seyn; und umgekehrt. Da der Farbenkreis eine zusammenhängende stetige Größe, ohne innre Gränzen, ist, und alle seine Farben durch unmerkliche Nüancen in einander übergehn; so erscheint es, wenn man auf diesem Standpunkt stehn bleibt, als beliebig, wie viele Farben man annehmen will. Nun aber finden sich bei allen Völkern, zu allen Zeiten, für Roth, Grün, Orange, Blau, Gelb, Violett, besondere Namen, welche überall verstanden werden, als die nämlichen, ganz bestimmten Farben bezeichnend; obschon diese in der Natur höchst selten rein und vollkommen vorkommen: sie müssen daher gewissermaaßen a priori erkannt seyn, auf analoge Weise, wie die regelmäßigen geometrischen Figuren, als welche in der Wirklichkeit gar nicht vollkommen darzustellen sind und doch von uns, mit allen ihren Eigenschaften, vollkommen erkannt und verstanden werden. Wenn nun gleich jene Namen den wirklichen Farben meistens nur a potiori beigelegt werden, d. h. jede vorkommende Farbe nach derjenigen aus jenen sechs benannt wird, der sie am nächsten kommt; so weiß doch Jeder sie von der Farbe, der jener Name im engsten Sinn angehört, noch immer zu unterscheiden und anzugeben, ob und wie sie von dieser abweicht, z. B. ob ein empirisch gegebenes Gelb rein sei, oder ob es ins Grüne oder Orange ziehe: er muß also eine Norm, ein Ideal, eine Epikurische Anticipation anticipationem, quam appellat προληψιν Epicurus, i. e. anteceptam animo rei quandam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quaeri, nec disputari potest. (Cic. de nat. Deor. I, 16.) der gelben und jeder Farbe, unabhängig von der Erfahrung, in sich tragen, mit welcher er jede wirkliche Farbe vergleicht. Den Schlüssel hiezu giebt uns einzig und allein die Erkenntniß, daß das sich als in gewissen ganzen und den ersten Zahlen ausdrückbar darstellende Verhältniß der beiden Hälften, in welche, bei den angeführten Farben, die Thätigkeit der Retina sich theilt, diesen drei Farbenpaaren einen Vorzug giebt, der sie vor allen andern auszeichnet. Demgemäß bezieht unsere Prüfung der Reinheit einer gegebenen Farbe, z. B. ob dieses Gelb genau ein solches sei, oder aber ins Grüne, oder auch ins Orange falle, sich auf die genaue Richtigkeit des durch sie ausgedrückten Bruchs. Daß wir aber dies arithmetische Verhältniß durch das bloße Gefühl beurtheilen können, erhält einen Beleg von der Musik, deren Harmonie auf den viel größeren und komplicirteren Zahlenverhältnissen der gleichzeitigen Schwingungen beruht, deren Töne wir jedoch, nach dem bloßen Gehöre, höchst genau und dennoch arithmetisch beurtheilen; so daß jeder regelrecht beschaffene Mensch im Stande ist, anzugeben, ob ein angeschlagener Ton die richtige Terz, Quinte, oder Octave eines andern sei. Wie die sieben Töne der Skala sich von den unzähligen andern, der Möglichkeit nach, zwischen ihnen liegenden nur durch die Rationalität ihrer Vibrationszahlen auszeichnen; so auch die sechs mit eigenen Namen belegten Farben von den unzähligen zwischen ihnen liegenden nur durch die Rationalität und Simplicität des in ihnen sich darstellenden Bruches der Thätigkeit der Retina. Wie ich, ein Instrument stimmend, die Richtigkeit eines Tones dadurch prüfe, daß ich seine Quinte oder Octave anschlage; so prüfe ich die Reinheit einer vorliegenden Farbe dadurch, daß ich ihr physiologisches Spektrum hervorrufe, dessen Farbe oft leichter zu beurtheilen ist, als sie selbst: so habe ich z. B., daß das Grün des Grases stark ins Gelbe fällt, erst daraus ersehn, daß das Roth seines Spektrums stark ins Violette zieht. Wenn wir nicht eine subjektive Anticipation der 6 Hauptfarben hätten, die uns eine Norm a priori für sie giebt; so würden wir, da dann die Bezeichnung derselben durch eigene Namen bloß konventionell wäre, wie die der Modefarben es wirklich ist, über die Reinheit einer gegebenen Farbe kein Urtheil haben und demnach Manches gar nicht verstehn können, z. B. was Goethe vom wahren Roth sagt, daß es nicht das gewöhnliche Scharlachroth sei, als welches gelbroth ist, sondern mehr das des Karmins; während jetzt Dies sehr wohl verständlich und dann auch einleuchtend ist.
Aus meiner Darstellung ergiebt sich folgendes Schema:
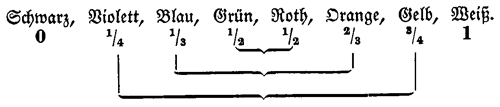
Schwarz und Weiß, da sie keine Brüche, also keine qualitative Theilung darstellen, sind nicht, im eigentlichen Sinne, Farben; wie man Dies auch allezeit erkannt hat. Sie stehn hier bloß als Gränzpfosten, zur Erläuterung der Sache. Die wahre Farbentheorie hat es demnach stets mit Farbenpaaren zu thun, und die Reinheit einer gegebenen Farbe beruht auf der Richtigkeit des in ihr sich darstellenden Bruchs. Hingegen eine bestimmte Anzahl, z. B. sieben, unabhängig von der Thätigkeit der Retina und den Verhältnissen ihrer Theilbarkeit, realistisch, da draußen vorhandener Ur-Farben, die zusammen die Summe aller Farben ausmachten, anzunehmen, ist absurd. Die Zahl der Farben ist unendlich: dennoch enthalten jede zwei entgegengesetzte Farben die Elemente, die volle Möglichkeit aller andern. Hierin liegt die Ursache davon, daß wenn man von den chemischen drei Grundfarben, Roth, Gelb, Blau, ausgeht, jede von ihnen die beiden andern im Verein zum Komplement hat. Denn die Farbe erscheint immer als Dualität; da sie die qualitative Bipartition der Thätigkeit der Retina ist. Chromatologisch darf man daher gar nicht von einzelnen Farben reden, sondern nur von Farbenpaaren, deren jedes die ganze, in zwei Hälften zerfallene Thätigkeit der Retina enthält. Die Theilungspunkte sind unzählig, und, als durch äußere Ursachen bestimmt, insofern für das Auge zufällig. Sobald aber die eine Hälfte gegeben ist, folgt die andere, als ihr Komplement, nothwendig. Dies ist Dem zu vergleichen, daß in der Musik der Grundton willkürlich, mit ihm aber alles andere bestimmt ist. Es war, dem Gesagten zufolge, eine doppelte Absurdität, die Summe aller Farben aus einer ungeraden Zahl bestehn zu lassen: hierin blieben aber die Neutonianer sich immer treu, wenn sie auch von der Zahl, welche ihr Meister festgesetzt, abgiengen und bald fünf bald drei Urfarben annahmen.
Diese nunmehr dargestellte, sich qualitativ theilende Thätigkeit der Retina glaube ich mit dem vollsten Recht eine Polarität nennen zu können, ohne zu den häufigen Mißbräuchen, welche dieser Begriff in der Periode der Schelling'schen Naturphilosophie erlitten hat, einen neuen zu fügen. Jene eigenthümliche Funktion der Retina wird dadurch unter einen Gesichtspunkt gebracht mit andern Erscheinungen, mit welchen sie Dieses gemein hat, daß zwei, in specie entgegengesetzte, in genere aber identische Erscheinungen wesentlich einander bedingen, dergestalt, daß keine ohne die andere weder gesetzt noch aufgehoben werden kann, dennoch aber so, daß sie nur in der Trennung und im Gegensatze bestehn und ihre Vereinigung, nach der sie beständig streben, eben das Ende und Verschwinden beider ist. Die Polarität der Retina hat indessen das Unterscheidende, daß bei ihr in der Zeit, also successiv ist, was bei den andern polarischen Erscheinungen im Raum, also simultan. Ferner hat sie das Besondere, daß der Indifferenzpunkt, wiewohl innerhalb gewisser Gränzen, verrückbar ist. Der hier aufgestellte und mit dem anschaulichsten Beispiele verbundene Begriff einer qualitativ getheilten Thätigkeit möchte sogar der Grundbegriff aller Polarität seyn und unter ihn sich Magnetismus, Elektricität und Galvanismus bringen lassen, von welchen Jedes nur die Erscheinung einer in zwei sich bedingende, sich suchende und zur Wiedervereinigung strebende Hälften zerfallenen Thätigkeit ist. In diesem Sinne können wir sodann einen auf sie alle passenden Ausdruck in Plato's Worten aufstellen: επειδη ουν ἡ φυσις διχα ετμηθη, ποθουν ἑκαστον το ἡμισυ το αὑτου, ξυνηει. Auch fallen sie unter den großen chinesischen Gegensatz des Yin und Yang. Die Polarität des Auges könnte sogar, als die uns zunächst liegende, uns über das innere Wesen aller Polarität in mancher Hinsicht Aufschlüsse geben. Indem man die bei den andern übliche Bezeichnung auch auf sie anwendet, wird man nicht anstehn, das + dem Roth, Orange und Gelb, hingegen das - dem Grün, Blau und Violett beizulegen; weil die hellste Farbe und der größte Zahlenbruch der negativen Seite, das Grün, an Quantität der Thätigkeit, erst der dunkelsten Farbe und dem kleinsten Bruch der positiven Seite, dem Roth, gleichkommt. Dieser polare Gegensatz muß sich bei der vollkommensten Theilung der Thätigkeit der Retina, welches die in zwei gleiche Hälften ist, am schärfsten aussprechen; daher denn Roth das Auge so merklich angreift und Grün dagegen es ausruht. – Ob nun vielleicht, bei solcher qualitativen Theilung der Thätigkeit der Retina, die Choroidea, oder auch das pigmentum nigrum, auf irgend eine Weise, mitwirke, könnte am Ersten aus der Obduktion der Augen solcher Personen abzunehmen seyn, denen die Fähigkeit Farben zu sehn abgieng, und auf welche ich weiter unten zurückkommen werde.
Zu der aufgestellten Theorie der Farbe gehört nun aber wesentlich noch folgende, für dieselbe, wie auch für Goethes Farbenlehre, sehr wichtige Betrachtung, welche, das bis hieher Vorgetragene als feststehend genommen, eine Ableitung a priori des von Goethe so nachdrücklich behaupteten und wiederholt urgirten, wesentlichen σκιερον der Farbe ist. Bekanntlich bezeichnet er mit diesem Ausdruck ihre dem Schatten, oder dem Grau, verwandte Natur, vermöge welcher sie stets heller, als Schwarz, und dunkler, als Weiß ist.
Wir haben bei der qualitativ getheilten Thätigkeit der Retina das Hervortreten der einen Hälfte wesentlich bedingt gefunden durch die Unthätigkeit der andern, wenigstens auf der selbigen Stelle. Unthätigkeit der Retina aber ist, wie oben gesagt. Finsterniß. Demnach muß das als Farbe erscheinende Hervortreten der qualitativen Hälfte der Thätigkeit der Retina durchaus von einem gewissen Grade von Finsterniß, also von einiger Dunkelheit, begleitet seyn. Dies hat sie nun gemein mit der intensiv getheilten Thätigkeit der Retina, die wir oben im Grau, oder Halbschatten, erkannt haben: und diese Gemeinschaft eben, Dieses, daß dort qualitativ ist, was hier intensiv, hat Goethe richtig aufgefaßt und durch den Ausdruck σκιερον bezeichnet. Jedoch waltet hiebei folgender sehr bedeutender Unterschied ob. Daß die Thätigkeit der Retina, der Intensität nach, nur theilweise ist, führt keine specifische und wesentliche Veränderung derselben herbei und bedingt keinen eigenthümlichen Effekt; sondern es ist eben nur eine zufällige, gradweise Verminderung der vollen Thätigkeit. Bei der qualitativ theilweisen Thätigkeit der Retina hingegen, hat die hervortretende Thätigkeit der einen Hälfte die Unthätigkeit der andern zur wesentlichen und nothwendigen Bedingung: denn sie besteht nur durch diesen Gegensatz. Aus dieser Scheidung aber und ihren mannigfaltigen Verhältnissen entspringt der eigenthümliche Reiz, der heitere und ergötzliche Eindruck der Farbe, im Gegensatz des ihr an Helligkeit gleichen, aber traurigen Grau; wie auch ihr, bei aller Verschiedenheit der Farben, sich gleich bleibendes, ganz specifisches Wesen. Dieses beruht nämlich gerade darauf, daß, vermöge eines polaren Auseinandertretens die lebhafte Thätigkeit der einen Hälfte die gänzliche Ruhe der andern zur Stütze hat. Hieraus erklärt sich auch, warum das Weiße, wenn zwischen Farben befindlich, so auffallend nüchtern aussieht; während das Grau trübsälig und das Schwarz finster ist. Imgleichen wird begreiflich, warum Abwesenheit des Reizes der Farbe, also Schwarz und Weiß, jenes bei uns, dieses bei den Chinesen, Trauer symbolisiren. – In Folge des Unterschiedes zwischen bloß intensiver und qualitativer Theilung der Thätigkeit der Retina können wir ganz füglich den Halbschatten und das Grau gleichnißweise eine bloß mechanische, wenn gleich unendlich feine Mengung des Lichts mit der Finsterniß nennen; hingegen die, in der qualitativ partiellen Thätigkeit der Retina bestehende, Farbe, als eine chemische Vereinigung und innige Durchdringung des Lichts und der Finsterniß ansehn: denn Beide neutralisiren hier gleichsam einander, und indem jedes seine eigene Natur aufgiebt, entsteht ein neues Produkt, das mit jenen Beiden nur noch entfernte Aehnlichkeit, dagegen hervorstechenden eigenen Charakter hat. Diese aus der qualitativ theilweisen Thätigkeit der Retina nothwendig hervorgehende Vermählung des Lichts mit der Finsterniß, deren Phänomen die Farbe ist, bewährt und erläutert also was Goethe vollkommen richtig und treffend bemerkt hat, daß die Farbe wesentlich ein Schattenartiges, ein σκιερον sei. Ueber diesen Goethe'schen Satz aber hinaus, lehrt sie uns noch, daß eben Dasjenige, was in jeder dem Auge gegenwärtigen Farbe, als Ursache ihrer dunkleren Natur, die Rolle des σκιερον spielt, es wieder ist, was nachher als nachfolgendes Spektrum hervortretend, dem Auge erscheint: in diesem Spektrum selbst aber übernimmt die vorher dagewesene Farbe nunmehr die Rolle des σκιερον, indem ihr Inhalt das jetzige Deficit ausmacht.
In der dargelegten schattigen Natur der Farbe könnte man gewissermaaßen die Quelle der Neutonischen Irrlehre suchen, »daß die Farben Theile des bei der Brechung zersplitterten Lichtstrahls wären«. Er sah nämlich, daß die Farbe dunkler ist, als das Licht, oder das Weiße, nahm nun als extensiv was intensiv ist, als mechanisch was dynamisch ist, als quantitativ was qualitativ ist, als objektiv was subjektiv ist, indem er im Lichte suchte was im Auge zu suchen war, und ließ demnach den Lichtstrahl aus sieben farbigen, noch dazu ( Spartam quam nactus es orna!) in ihrem Verhältniß den sieben Intervallen der Tonleiter gleichen Strahlen zusammengesetzt seyn, denen die Farbe, nach vom Auge unabhängigen Gesetzen, als eine qualitas occulta einwohne. Daß er dabei die Siebenzahl einzig und allein der Tonleiter zu Liebe gewählt hat, ist nicht dem mindesten Zweifel unterworfen: er durfte ja nur die Augen aufmachen, um zu sehn, daß am prismatischen Spektrum durchaus nicht 7 Farben sind, sondern bloß vier, von denen, bei größerer Entfernung des Prismas, die zwei mittleren, Blau und Gelb, über einander greifen und dadurch Grün bilden. Daß noch jetzt die Optiker 7 Farben im Spektrum aufzählen, ist der Gipfel der Lächerlichkeit. Wollte man es aber ernsthaft nehmen, so wäre man, 44 Jahre nach dem Auftreten der Goethe'schen Farbenlehre, berechtigt, es eine unverschämte Lüge zu nennen: denn man hat nachgerade Geduld genug gehabt.
Daß bei allen Dem auch im Neutonischen Irrthum ein entferntes Analogon, eine Ahndung der Wahrheit gelegen hat, ist nicht abzuleugnen und ergiebt sich eben von dem Gesichtspunkt unserer Betrachtung aus. Dieser gemäß nämlich haben wir, statt des getheilten Lichtstrahls, eine getheilte Thätigkeit der Retina: jedoch statt der sieben Theile haben wir nur zwei, aber auch wieder unzählige, je nachdem man es nimmt. Denn die Thätigkeit der Retina wird bei jeder möglichen Farbe halbirt; aber der Durchschnittspunkte gleichsam sind unzählige und daraus entspringen die Nüancen der Farben, die, auch abgesehn vom Blaß oder Dunkel derselben, wovon bald die Rede seyn wird, unzählig sind. Demnach wären wir auf diese Weise von einer Theilung des Sonnenstrahls zu einer Theilung der Thätigkeit der Retina zurückgeführt. Dieser Weg der Betrachtung überhaupt aber, der vom beobachteten Gegenstand auf den Beobachter selbst, vom Objektiven zum Subjektiven, zurück geht, ließe sich durch ein Paar der glänzendesten Beispiele in der Geschichte der Wissenschaften empfehlen und als der richtige beurkunden: denn
Non aliter, si parva licet componere magnis,
hat Kopernikus an die Stelle der Bewegung des ganzen Firmaments, die der Erde, und der große Kant an die Stelle der objektiv erkannten und in der Ontologie aufgestellten, absoluten Beschaffenheiten aller Dinge, die Erkenntnißformen des Subjekts gesetzt. Γνωθι σαυτον stand auf dem Tempel zu Delphi!
Anmerkung: Da wir hier ein Mal darauf aufmerksam geworden, daß wir in unserer Erklärung der Farbe vom Lichte zum Auge zurückgegangen sind, so daß für uns die Farben nichts weiter, als in polaren Gegensätzen erscheinende Aktionen des Auges selbst sind; so mag auch die Bemerkung Platz finden, daß eine Ahndung hievon immer dagewesen ist, sofern die Philosophen stets gemuthmaaßt haben, daß die Farbe viel mehr dem Auge, als den Dingen angehöre; wie denn auch besonders Locke unter seinen sekundären Qualitäten der Dinge allemal die Farbe obenan stellt und überhaupt kein Philosoph jemals die Farbe für einen wirklichen wesentlichen Bestandtheil der Körper hat wollen gelten lassen, während mancher nicht etwan nur Ausdehnung und Gewicht, sondern auch jede Beschaffenheit der Oberfläche, das Weiche und Harte, Glatte und Rauhe, ja zur Noth lieber den Geruch und Geschmack des Dings für wirkliche konstituirende Bestandtheile desselben gelten ließ, als die Farbe. Andererseits mußte man doch die Farbe als etwas dem Dinge Anhängendes, zu seinen Eigenschaften Gehörendes anerkennen, aber dennoch wiederum als Etwas, das bei den allerverschiedensten Dingen sich völlig gleich, und bei übrigens gleichen verschieden findet, daher unwesentlich seyn muß. Dies alles machte die Farbe zu einem schwierigen, perplexen und darum verdrießlichen Thema. Dieserhalb sagt denn auch ein alter Skribent, wie Goethe anführt: »Hält man dem Stier ein rothes Tuch vor, so wird er wüthend; aber der Philosoph, wenn man nur überhaupt von Farbe spricht, fängt an zu rasen.«
Ein wesentlicher Unterschied meiner Theorie von der Neutonischen besteht noch darin, daß diese (wie schon erwähnt) jede Farbe bloß als eine qualitas occulta (colorifica) eines der sieben homogenen Lichter anführt, ihr einen Namen giebt und sie dann laufen läßt; wobei die specifische Verschiedenheit der Farben und die eigenthümliche Wirkung einer jeden ganz und gar unerklärt bleibt. Meine Theorie hingegen giebt über diese Eigenthümlichkeiten Aufschluß und macht uns begreiflich, worin der Grund des specifischen Eindrucks und der besondern Wirkung jeder einzelnen Farbe liege; indem sie uns dieselbe erkennen lehrt als einen ganz bestimmten, durch einen Bruch ausgedrückten Theil der Thätigkeit der Retina, ferner als entweder zur += oder zur -=Seite des Auseinandertretens jener Thätigkeit gehörig. Wir erhalten also erst hier die bisher stets vermißte Annäherung unsers Gedankens von der Farbe zur Empfindung derselben. Denn selbst Goethe begnügt sich damit, die Farben in warme und kalte einzutheilen und stellt das Uebrige seinen ästhetischen Betrachtungen anheim.
Die nunmehr im Umriß aufgestellte Theorie der Farbe, welcher zu Folge diese eine qualitativ partielle Thätigkeit der Retina ist, führt von selbst, und noch mehr wenn man ihre oben berührte Analogie mit der Neutonischen Irrlehre betrachtet, auf die Frage, ob denn nicht, durch Wiedervereinigung der beiden qualitativen Hälften der Thätigkeit der Retina, welche sich uns in jeder Farbe und ihrem physiologischen Komplement darstellen, die volle Thätigkeit der Retina, d. i. die Wirkung des reinen Lichtes, oder des Weißen sich herstellen lasse, – eben wie, nach Neuton's Behauptung, aus den sieben Farben der ganze Lichtstrahl, oder das Weiße, sich wieder zusammensetzen lassen soll. Inwiefern nun diese Frage, in Hinsicht auf Theorie und Praxis, zu bejahen sei, wird besser gezeigt werden können, nachdem die aufgestellte Theorie der Farbe noch durch folgende ihr angehörige Erörterung ergänzt seyn wird.
Außer dem Verhältniß der Farben zu einander, im in sich geschlossenen durch völlig stetige Uebergänge verschmolzenen Farbenkreise, bemerken wir, wie schon oben (§ 5) berührt, noch, daß jede Farbe an und für sich ein Maximum von Energie hat, welches auf der Runge'schen Farbenkugel der Aequator darstellt, und von welchem abgehend, sie einerseits durch Verblassen ins Weiße, andererseits durch Verdunkeln ins Schwarze sich verliert. Unserer Darstellung gemäß ist dies nur folgendermaaßen zu erklären. Indem, durch äußern Reiz veranlaßt, die volle Thätigkeit der Retina sich qualitativ theilt und so irgend eine Farbe entsteht, kann jedoch ein Theil dieser vollen Thätigkeit unzersetzt bleiben. Ich rede nicht von einem Theil der Retina, der in ungetheilter Thätigkeit bleiben kann, während die Thätigkeit eines andern sich qualitativ theilt: dies wird noch unten zur Sprache kommen; sondern ich sage: die Thätigkeit der Retina, gleichviel ob auf ihrer ganzen Fläche, oder einem Theil derselben, kann, indem sie, zur Hervorbringung der Farbe, sich qualitativ theilt, noch einen ungetheilten Rest zugleich beibehalten, und dieser wiederum kann entweder ganz aktiv, oder ganz ruhend, oder zwischen beiden, d. h. intensiv theilweise thätig seyn. Nach Maaßgabe hievon nun wird alsdann die Farbe, statt in ihrer vollen Energie, sich blaß, oder auch schwärzlich, in vielen Abstufungen, zeigen. Man sieht leicht ein, daß in diesem Fall eine Vereinigung der intensiven Theilung der Thätigkeit der Retina mit der qualitativen Statt hat. Am anschaulichsten wird dieses dadurch, daß, wenn man eine durch ein ihr unwesentliches Schwarz verdunkelte und geschwächte Farbe betrachtet, ihr darauf als Spektrum sich zeigendes Komplement um eben so viel durch Blässe geschwächt erscheint, Wenn man eine Farbe lebhaft, energisch, brennend nennt, so bedeutet dies, dem Gesagten zufolge, eigentlich, daß bei ihrer Gegenwart die ganze Thätigkeit des Auges sich rein theile, ohne daß ein ungeteilter Rest übrig bleibe.
Ich kehre jetzt zurück zu der oben aufgeworfenen Frage, nach der Wiederherstellung der vollen Thätigkeit der Retina, oder des Weißen, durch Vereinigung zweier entgegengesetzter Farben. Es ergiebt sich von selbst, daß wenn diese Farben schwärzlich waren, d. h. ein Theil der Thätigkeit der Retina unzersetzt und zugleich auch inaktiv blieb, diese Finsterniß durch jene Vereinigung nicht aufgehoben wird, also Grau übrig bleibt. Waren aber die Farben in voller Energie, d. h. die Thätigkeit der Retina ohne Ueberrest getheilt, oder auch waren sie blaß, d. h. war der unzersetzte Ueberrest derselben aktiv; so muß, zufolge unserer Theorie, welche zwei entgegengesetzte Farben als gegenseitige Ergänzungen zur vollen Thätigkeit der Retina, durch deren Theilung sie entstanden sind, betrachtet, ohne allen Zweifel, die Vereinigung solcher Farben die volle Thätigkeit der Retina herstellen, also den Eindruck des reinen Lichts, oder des Weißen, hervorbringen. Auf ein Beispiel angewandt ließe sich dieses in Formeln so ausdrücken:
Roth = voller Thätigkeit der Retina – Grün
Grün = voller Thätigkeit der Retina – Roth
Roth + Grün = voller Thätigkeit der Retina = der Wirkung des Lichts, oder des Weißen.
Auch die praktische Darstellung hievon hat keine Schwierigkeit, sobald wir bei den Farben im engsten Sinne stehn bleiben d. h. bei den Affektionen des Auges. Alsdann aber haben wir es allein mit physiologischen Farben zu thun, zudem wäre das Resultat des Experiments bloß ihr Ausbleiben, und dieser experimentale Beweis möchte Manchem zu immateriell und ätherisch vorkommen. Er ist übrigens dieser. Wenn man z. B. ein lebhaftes Roth ansieht, so wird ein grünes Spektrum folgen; sieht man ein Grün an, so folgt ein rothes Spektrum. Blickt man nun aber, nach angeschautem Roth, sogleich und mit der selben Stelle der Retina eben so lange auf ein wirkliches Grünes, so bleiben beide Spektra aus.
Eigentliche Ueberzeugung kann nur das Experiment der Herstellung des Weißen aus physischen, oder gar aus chemischen Farben bewirken. Hier ist es aber immer einer besondern Schwierigkeit unterworfen. Wenn wir nämlich uns an diese Farben halten wollen; so sind wir eigentlich von der Farbe abgegangen zu der Ursache, die als Reiz auf das Auge wirkend, es zur Hervorbringung der Farbe, d. h. zur qualitativen Theilung seiner Thätigkeit, veranlaßt. Weiter unten wird von den Ursachen der Farbe in diesem Sinn und ihrem Verhältniß zur Farbe im engsten Sinn die Rede seyn. Hieher gehört nur Folgendes. Die Herstellung des Weißen aus zwei Farben beruht, unserer Theorie zu Folge, einzig und allein auf physiologischem Grunde, nämlich darauf, daß es zwei Farben seien, in welche die Thätigkeit der Retina auseinandergetreten ist, also ein physiologisches Farbenpaar, in welchem Sinn allein und ausschließlich sie Ergänzungsfarben zu nennen sind. Solche zwei Farben müssen, zur Herstellung des Weißen aus ihnen, ganz eigentlich wieder vereinigt werden, und zwar auf der Retina selbst, also dadurch, daß die beiden gesonderten Hälften der Thätigkeit dieser zugleich angeregt werden, woraus dann ihre volle Thätigkeit, das Weiße, sich herstellt. Dies aber kann nur dadurch geschehn, daß die zwei äußern Ursachen, jede von welchen im Auge die Ergänzungsfarbe der andern erregt, ein Mal zugleich und doch gesondert auf eine und die selbe Stelle der Retina wirken. Dies nun wieder ist nur unter besondern Umständen und Bedingungen möglich. Zunächst kann es nicht dadurch geschehn, daß man zwei chemische Farben zusammenmischt: denn diese wirken alsdann zwar im Verein, aber nicht gesondert. Dazu kommt, daß in der äußern materiellen Ursache der Farbe (d. h. in der chemischen oder physischen Farbe) nicht nur für die Aktivität der einen Hälfte der Thätigkeit der Retina, sondern auch für die Ruhe der andern, welche als das der Farbe wesentliche σκιερον erscheint, eine ihr entsprechende konkrete Ursache, ein materieller Repräsentant, sich vorfinden muß, welcher, auch nach der Vereinigung entgegengesetzter Farben, als Materie beharrt, seine Wirkung zu thun fortfährt und immer Grau verursachen wird. Er giebt zwar, sobald, durch die Vereinigung der Gegensätze, die Farben als Farben verschwunden sind, die Rolle auf, die er bei Hervorbringung derselben spielte: allein er bleibt jetzt als caput mortuum, oder als ihre abgeworfene Hülle zurück, und wie er vorhin zur qualitativen Theilung der Thätigkeit der Retina beitrug, so wirkt er jetzt eine intensiv theilweise Thätigkeit derselben, d. h. Grau. Dieserwegen nun wird an chemischen Farben, ihrer durchaus materialen Natur wegen, die Herstellung des Weißen aus einem Farbenpaar wohl nie dargestellt werden können, wenn nicht etwan besondere Modifikationen hinzutreten: ein Beispiel jener Herstellung unter solchen werde ich etwas weiter unten beibringen. Hingegen bei physischen Farben, ja, in einzelnen Fällen, beim Verein physischer und chemischer, läßt jene Darstellung sich schon ausführen. Ist indessen bei der physischen Farbe die vermittelnde Trübe grob materialer Natur und vielleicht auch noch dazu nicht ganz gleichartig und stellenweis undurchsichtig, wie ein angerauchtes Glas, ein kohlenführender Rauch, ein Pergament u. dgl.; so gelingt auch hier, aus den angeführten Gründen, das Experiment nicht vollkommen. Dies ist hingegen der Fall bei den prismatischen Farben: denn hier ist das Trübe, als ein bloßes Nebenbild, von so zarter Natur, daß, wenn es, bei der Vereinigung entgegengesetzter Farben, auch nicht wirklich aufgehoben wird, es entweder, sobald es nicht mehr durch seine Stellung, vermöge welcher es die Farben hervorbrachte, bedeutsam ist, auch nicht mehr sichtbar bleibt, oder auch, wie jede gehäufte Trübe, eben Weiß giebt. – Man erzeuge, im objektiven prismatischen Versuch, durch die Vereinigung des Violett eines Prismas mit dem Gelbroth eines andern, das wahre Roth (Goethes Purpur), führe auf dieses das Grün aus der Mitte eines dritten Prismas, und die Stelle erscheint weiß. Goethe selbst führt (Bd. I, p. 600, § 556) diesen Versuch an, will ihn jedoch, wegen seiner, übrigens gerechten, Polemik gegen Neuton, nicht als Beispiel und Beweis der Herstellung des Weißen aus Farben gelten lassen. Allein der Grund den er dagegen vorbringt, daß nämlich hier ein dreifaches Sonnenlicht das eigentlich doch vorhandene Grau unsichtbar mache, ist in der That nicht triftig. Denn jede dieser drei prismatischen Farben enthält hier schon das σκιερον so gut, als das Sonnenlicht, in sich. Wie nun jedes dieser drei σκιερων für sich, des mit ihm verbundenen Lichtes ungeachtet, doch in jeder einzelnen der drei Farben sichtbar ist, so kann dadurch, daß drei solche σκιερα mit sammt ihren drei Lichtern vereinigt werden, das Ganze nicht an Helle gewinnen. Wenn Divisor und Dividendus mit der gleichen Zahl multiplicirt werden, ändert der Quotient sich nicht. Nicht die vermehrte Erleuchtung also, die durch das vermehrte Dunkel ausgewogen wird, sondern der Gegensatz der Farben ist es, der hier den Eindruck des reinen Lichts oder des Weißen herstellt. Zugleich leichter und deutlicher, dabei noch augenscheinlicher dem Goethe'schen Einwurf nicht unterworfen, kann man dies Experiment auf folgende Weise machen. Man führe zwei prismatische Farbenspektra dergestalt über einander, daß das Violett des ersten das Gelb des zweiten, und das Blau des ersten das Orange (Neuton's Roth) des zweiten deckt; dann wird ebenfalls aus der Vereinigung eines jeden dieser zwei Farbenpaare Weiß entstehn, und zwar wird, weil beide Farbenpaare neben einander liegen, die weiße Stelle noch ein Mal so breit seyn, als im vorigen Versuch. Dies ist Neuton's 13tes Experiment des 2ten Theils des ersten Buchs. Dennoch stimmt es durchaus nicht zu seiner Theorie: denn er mag nun (wie er nach Gelegenheit abwechselnd thut) sieben oder unzählige homogene Lichter annehmen; so decken sich hier überall immer nur zwei, nicht aber sieben oder unzählige. Man kann dies Experiment auch mit einem Prisma ausführen. Auf schwarzem Grunde habe man zwei weiße Quadrate, ein größeres und ein kleineres; letzteres 3 bis 4 Linien unter dem andern. Diese betrachte man durch das Prisma, und gehe nun so lange rückwärts, bis das Violett des kleineren das Gelb des größeren und das Blau des kleineren das Orange (Neuton's Roth) des größeren bedeckt; wo dann diese ganze Stelle weiß erscheinen wird. So läßt sich also mit prismatischen Farben die Herstellung des Weißen an allen drei Hauptfarbenpaaren zeigen. Ferner läßt der Versuch sich subjektiv sogar mit Hinzuziehung einer chemischen Farbe machen: nur muß man alsdann ein solches Farbenpaar wählen, das aus den ungleichsten qualitativen Hälften der Thätigkeit der Retina besteht, also Gelb und Violett, und zwar muß die größte, also wesentlich hellste Hälfte die chemische Farbe, die kleinere, also dunklere, die physische Farbe seyn; weil nur dann das beharrende materielle σκιερον der chemischen Farbe nicht Masse genug hat, um merklich zu wirken. Man sehe ein energisch gelbes, völlig ebenes und fleckenloses Papier auf weißem Grund durch das Prisma an: die Stelle wo der violette Saum das Gelbe deckt, wird völlig weiß erscheinen. Das Selbe geschieht, wenn man das objektive Spektrum auf ein gelbes Papier fallen läßt; doch ist wegen der undeutlicheren Ränder des objektiven Spektrums der Erfolg hier nicht ganz so frappant. Mit den andern Farbenpaaren gelingt dieser Versuch unvollkommener, doch um so besser, je heller wesentlich die chemische Farbe ist. Einen ähnlichen und oft sich sogar von selbst einstellenden Versuch liefert der, im Mai die Gärten und meistens auch, in Vasen, die Zimmer zierende Spanische Flieder ( Syringa vulgaris, in Niedersachsen Sirene, in Süddeutschland Nägelchen, Franz. lila) und zwar die violettblauen Exemplare desselben, indem er beim Kerzenlichte weiß erscheint: denn sein bläuliches Violett wird vollkommen ergänzt durch das ins Orange ziehende Gelb der Kerzenbeleuchtung. Endlich sogar aus zwei chemischen Farben läßt sich das Weiße herstellen, unter der besondern Bestimmung, daß solche, eben wie die physischen, vom Lichte durchdrungen seien und daher ihr σκιερον, sobald es, indem durch Aufhebung des Gegensatzes die Farben verschwinden, seine Bedeutsamkeit verliert, für sich nicht merklich mehr wirken kann, z. B. durch Vereinigung einer transparenten mit einer reflektirten Farbe, wenn man auf einen Spiegel aus blauem Glase das Licht durch ein rothgelbes Glas fallen läßt. Sogar mit einer nicht transparenten Farbe gelingt es noch: man werfe in eine Schaale aus blauem Glase eine Gold- und eine Silber-Münze: jene wird weiß, diese blau erscheinen. Desgleichen, ein auf beiden Seiten blau gefärbtes Papier abgespiegelt von polirtem Kupfer. Ferner eine Rose, bloß von dem durch eine grünseidene Gardine fallenden Lichte beleuchtet. Und endlich auch aus zwei nicht transparenten chemischen Farben, in einem von Helmholtz angegebenen Experiment. Helmholtz (in seiner Habilitationsschrift »über die Theorie der zusammengesetzten Farben«, 1852, p. 19) giebt folgende Art der Herstellung des Weißen aus Komplementärfarben an: eine senkrecht aufgestellte Spiegelscheibe; auf deren einen Seite ein Rothes, etwan ein Stück Papier, eine Oblate; auf der andern ein Grünes, so gesehn, daß das Spiegelbild des Grünen das Rothe decke; – giebt Weiß. Bei allen diesen Versuchen müssen jedoch die beiden Farben von gleicher Energie und gleicher Reinheit seyn. Endlich scheint sogar ausnahmsweise ein aus der wirklichen Verbindung zweier chemischer, jedoch im transparenten Zustande befindlicher Farben hergestelltes Weiß alles weiße Glas zu seyn, wie ich Dies schon in der ersten Auflage, also 1816, angegeben habe. Nämlich in den Glashütten geräth bekanntlich meist alles Glas ursprünglich grün; wovon die Ursache sein Eisengehalt ist. Dieses ins Gelbliche ziehende Grün läßt man aber nur dem schlechtern Glase: um es aufzuheben und weißes Glas zu liefern, braucht man, als empirisch gefundenes Gegenmittel, einen Zusatz von Braunstein; welches Manganoxyd aber an sich das Glas violettlich roth färbt, wie an den rothen Glasflüssen zu sehn und auch daran, daß wenn, bei der Verfertigung des weißen Glases, zu viel Braunstein der grünen Masse zugesetzt ist, das Glas röthlich spielt, wie manche Biergläser und vorzüglich die Englischen Fensterscheiben.
Die angeführten Beispiele mögen hinreichen zur Bestätigung Dessen, was aus meiner Theorie nothwendig folgt, daß aus zwei entgegengesetzten Farben das Weiße allerdings herzustellen ist; sobald man nur es so anzustellen weiß, daß die beiden äußern, erregenden Ursachen zweier Ergänzungsfarben, ohne sich selbst direkt zu vermischen, zugleich auf die selbe Stelle der Retina wirken. Diese Herstellung nun aber ist ein schlagender Beweis der Wahrheit meiner Theorie. Das Faktum selbst wird nirgends geleugnet; aber die wahre Ursache wird nicht begriffen; sondern man legt demselben, und zugleich der Thatsache des physiologischen Farbenspektrums, in Gemäßheit der Neutonischen Pseudotheorie, eine ganz falsche Auslegung unter. Ersteres nämlich soll, wie bekannt, auf dem Wiederzusammenkommen der homogenen Lichter beruhen; davon weiterhin: für das physiologische Spektrum aber gilt noch immer die Erklärung, welche, bald nach der Entdeckung desselben durch Büffon, der Pater Scherffer gegeben hat, in seiner »Abhandlung von den zufälligen Farben«, Wien 1765, und früher »de coloribus accidentalibus«, 1761. Sie geht dahin, daß das Auge, durch das längere Anschauen einer Farbe ermüdet, für diese Sorte homogener Lichtstrahlen die Empfänglichkeit verlöre; daher es dann ein gleich darauf angeschautes Weiß nur mit Ausschluß eben jener homogenen Farbestrahlen empfände, weshalb es dasselbe nicht mehr weiß sähe, sondern statt dessen ein Produkt der übrigen homogenen Strahlen, die mit jener ersten Farbe zusammen das Weiße ausmachen, empfände: dieses Produkt nun also soll die als physiologisches Spektrum erscheinende Farbe seyn. Diese Auslegung der Sache läßt sich aber ex suppositis als absurd erkennen. Denn nach angeschautem Violett erblickt das Auge auf einer weißen (noch besser aber auf einer grauen) Fläche ein gelbes Spektrum. Dieses Gelb müßte nun das Produkt der, nach Ausscheidung des Violetten, übrig bleibenden 6 homogenen Lichter, also aus Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau und Indigoblau zusammengesetzt seyn: daraus Gelb zu brauen probire man! Vor Allen probire es Herr Pouillet, welcher, als ächter und geschworener Stock-Neutonianer, sich nicht entblödet, in seinen allbekannten Eléments de physique, Vol. 2, p. 223, die knollige Absurdität hinzuschreiben: l'orangé et le vert (mithin die 3 chemischen Grundfarben) donnent du jaune. Man sollte meinen, daß diese Chromatiker blind wären; doch sind sie bloß blindgläubig. Eigentlich aber sind für sie die Farben bloße Worte, bloße Namen, oder gar Zahlen: sie kennen sie nicht wirklich, sie sehn sie nicht an. Dem Melloni kann ich es noch immer nicht vergessen, daß ich, vor ungefähr 25 Jahren, in einem von ihm aufgesetzten Verzeichniß aller Farben mit ihren Nüancen, ein grünliches Roth angeführt gefunden habe! Humboldt im dritten Bande des Kosmos spricht von der Farbe als rechtgläubiger, imperturbirter Neutonianer in folgenden Stellen: pp. 86, 93, 108, 129, 169, 170, 300, besonders p. 496 und dazu Nota 539 »die am meisten brechbaren Farben im Spektro, vom Blau bis zum Violett, ergänzen sich, Weiß zu bilden, mit den weniger brechbaren von Roth bis Grün [!]. Das gelbe Mondlicht erscheint bei Tage weiß, weil die blauen Luftschichten, durch welche wir es sehn, die Komplementärfarben zum Gelb darbieten«! Er beweist seine Qualifikation zum Urtheilen über Farben p. 295, wo er von röthlich grün spricht! Er thut sehr gut sich bei Lebzeiten ein Monument setzen zu lassen: denn nach seinem Tode wird es Keinem einfallen. – Aus der obigen Mischung der 6 übrigen Farben also wird sich nie etwas Anderes, als Straßenkothfarbe ergeben, statt Gelb. Zudem ist ja das Gelb selbst ein homogenes Licht: wie sollte es denn erst das Resultat jener Mischung seyn? Aber schon die einfache Thatsache, daß ein homogenes Licht, für sich allein, vollkommen die komplementäre, als physiologisches Spektrum ihm nachfolgende Farbe des andern ist, wie Gelb des Violetten, Blau des Orangen, Roth des Grünen, und vice versa, stößt die Scherffer'sche Erklärung über den Haufen; indem es zeigt, daß was nach anhaltendem Anschauen einer Farbe das Auge auf der weißen Fläche erblickt, nichts weniger als eine Vereinigung der 6 übrigen homogenen Lichter, sondern stets nur eines derselben ist: z. B. nach angeschautem Violett Gelb. Auch darf nicht angenommen werden, daß, nach Wegnahme eines der 7 homogenen Lichtstrahlen, die übrigen 6 im Verein jetzt nichts weiter, als die Farbe eines einzigen andern aus ihrer Zahl darstellen sollten: denn da würde man eine Ursache ohne Wirkung annehmen, indem die 5 andern die Farbe jenes einzigen nicht veränderten. Das Unstatthafte der Scherffer'schen Erklärung geht auch schon daraus hervor, daß das physiologische Farbenspektrum nicht allein auf einem weißen Grunde gesehn wird, sondern auch vollkommen gut und deutlich auf einem völlig schwarzen und dazu beschatteten Grunde, ja sogar mit geschlossenen und noch dazu mit der Hand bedeckten Augen. Dies hatte bereits Büffon angegeben, und Scherffer selbst gesteht es, § 17 seiner Schrift, ein. Hier haben wir nun wieder einen Fall, wo einer falschen Theorie, sobald sie zu einem bestimmten Punkte gelangt ist, die Natur geradezu in den Weg tritt und ihr die Lüge ins Gesicht wirft. Auch wird hiebei Scherffer sehr betreten und gesteht, hier liege die größte Schwierigkeit. Jedoch, statt an seiner Theorie, die nimmermehr damit bestehn kann, irre zu werden, greift er nach allerlei elenden und absurden Hypothesen, windet sich erbärmlich und läßt zuletzt die Sache auf sich beruhen. Endlich auch auf jeder gefärbten Fläche stellt das physiologische Spektrum sich dar; wo freilich ein Konflikt ihrer Farbe mit der physiologischen entsteht: demgemäß erscheint, wenn man, ein durch angestarrtes Violett erregtes gelbes Spektrum im Auge habend, ein blaues Papier ansieht, Grün, entstehend aus der Verbindung des Blauen und Gelben: Dies beweist unwiderleglich, daß das physiologische Spektrum dem Grunde, auf den es fällt, etwas hinzufügt, nicht aber von ihm etwas abzieht: denn aus Blau wird nicht durch irgend eine Wegnahme Grün, sondern durch eine Hinzufügung, nämlich des Gelben. – Uebrigens ist begreiflicherweise eine weiße und noch viel mehr eine graue, oder beschattete Fläche dem Hervortreten des physiologischen Farbenspektrums besonders günstig: weil, was die Thätigkeit des Auges überhaupt erregt, auch das spontane Hervortreten ihrer qualitativen Hälfte entgegenkommend erleichtern muß: eine graue Fläche, die schon an sich nur einen Theil, nämlich einen intensiven, der Thätigkeit des Auges hervorruft, muß das bereits determinirte Hervortreten eines qualitativen Theils vorzüglich begünstigen. Auch hängt dieses mit dem zusammen, was Goethe (Bd. 1, S. 216) bemerkt, daß die chemische Farbe eines weißen Grundes bedürfe um zu erscheinen. – Daß der Schatten, bei farbiger Beleuchtung, nur dann das Komplement dieser Farbe zeigt, wann ihn eine zweite farblose Beleuchtung erhellt, kommt daher, daß jeder Schatten nur Halbschatten ist, und jener daher auch, wenn gleich nur schwach, von der farbigen Beleuchtung tingirt ist, welche Färbung erst, indem eine farblose Beleuchtung auf ihn fällt, in dem Grade verdünnt und geschwächt wird, daß, wo er das Auge trifft, dieses das Komplement der farbigen Beleuchtung hervorbringen kann. – Gegen die Scherffer'sche Auslegung des physiologischen Spektrums spricht ebenfalls die bekannte Erfahrung, daß wir dasselbe am deutlichsten und leichtesten früh Morgens, gleich nach dem Erwachen, ansichtig werden: gerade dann aber ist, in Folge der langen Ruhe, die Retina in vollster Kraft, also am wenigsten geeignet, durch das, einige Sekunden lang fortgesetzte, anhaltende Anschauen einer Farbe ermüdet und bis zur Unempfindlichkeit gegen dieselbe abgestumpft zu werden. – Alles hier Angeführte beweist unwiderleglich, daß das physiologische Spektrum aus der selbsteigenen Kraft der Retina erzeugt wird, zur Aktion derselben gehört, nicht aber ein durch die Ermüdung derselben mangelhaft und verkümmert ausfallender Eindruck einer weißen Fläche ist. Ich mußte aber diese Scherffer'sche Auslegung gründlich widerlegen; weil sie, bei den Neutonianern, noch in Geltung steht. Mit Bedauern erwähne ich, daß sogar Cüvier sie vorgebracht hat, in seiner Anatomie comparée, leç. 12, art. 1; worauf dieselbe als seine eigene neue Erfindung verkündet und belobt worden ist in Jameson's Edinburgh' new philosophical Journal, 1828, April–Sept., p. 190. Daß die gemeinen Kompendienschreiber sie noch immer wiederkauen, ist nicht der Erwähnung werth, und daß Prof. Dove, noch im Jahr 1853, in seiner »Darstellung der Farbenlehre«, sie S. 157 uns zum Besten giebt, darf uns in einem Buche dieser Art nicht wundern.
Auf jener Scherffer'schen Theorie beruht nun aber die ganze Lehre von den komplementären Farben aller heutigen Physiker und all ihr Gerede darüber. Als wahre Inkurable verstehn sie die Sache noch immer objektiv, im Neuton'schen Sinn: demgemäß bezieht ihr häufig erwähntes Komplement sich immer nur auf das Neuton'sche Spektrum von 7 Farben und bedeutet einen Theil dieser, getrennt von den übrigen, die dadurch ergänzt werden zum weißen Lichte als der Summe aller homogenen Lichter; wie Dies auch Pouillet, in seinen Eléments de physique, vol. 2, § 393, ausführlich darlegt. Diese Auffassung der Sache aber ist grundfalsch und absurd: und daß sie 44 Jahre nach Goethes Farbenlehre und 40 Jahre nach dieser meiner Theorie noch in vollem Ansehn steht und der Jugend aufgebunden wird, ist unverzeihlich.
Andererseits jedoch ist nicht zu leugnen, daß Goethe, indem er die Herstellung des Weißen aus Farben unbedingt verneinte, zu weit gieng und von der Wahrheit abirrte. Er that es indessen nur, weil er beständig die Neutonische Irrlehre im Auge hatte und gegen diese mit Recht behauptete, daß die Anhäufung der Farben nicht zum Lichte führe, da jede Farbe sowohl der Finsterniß als dem Licht angehöre: er wollte also das σκιερον der Farbe durch jene Verneinung besonders geltend machen, und obwohl er wußte, daß die sich physiologisch fordernden Farben, wenn vermischt, sich als Farben zerstören, so erklärte er dies doch hauptsächlich aus der dabei Statt habenden Mischung der drei Grundfarben im chemischen Sinn und wollte Grau als das unbedingte und wesentliche Resultat behaupten. Weil er nämlich nicht bis zum letzten Grund aller Farbenerscheinung überhaupt, welcher rein physiologisch ist, vorgedrungen war, sondern sein Ziel im obersten Grundgesetz aller physischen Farben erreicht hatte; so war auch der wahre letzte Grund davon, daß entgegengesetzte Farben vereinigt sich aufheben, weil sie nämlich qualitative Hälften der getheilten Thätigkeit der Retina sind, welche also jetzt wieder zusammengesetzt wird, ihm noch verborgen geblieben und eben dadurch auch der eigentliche Grund und das innere Wesen des von ihm so sehr urgirten, von der Farbe unzertrennlichen σκιερον, daß dies nämlich nichts Anderes, als die Erscheinung der Ruhe der inaktiven Hälfte der Thätigkeit der Retina ist und dasselbe folglich durch die Wiedervereinigung beider Hälften ebenfalls ganz und gar verschwinden muß; daß also endlich das Grau, welches die chemischen Farben, bei ihrem Verschwinden durch Vereinigung der Gegensätze, übrig lassen, nicht den Farben selbst, sondern nur der materialen Bedingung in dieser ihrer grob materialen Ursache angehört und in Bezug auf die Farben als solche ein zufälliges genannt werden kann. Es wäre übrigens die größte Unbilligkeit und Undankbarkeit, wenn man Goethen einen Vorwurf daraus machen wollte, daß in einem weitläuftigen Werk, welches so viele Irrthümer aufdeckt und so viele neue Wahrheiten lehrt, diese Irrung sich vorfindet. Der wahre Grund der Herstellung des Weißen aus zwei Farben konnte erst in Folge meiner Theorie an den Tag kommen. Multi pertransibunt et augebitur scientia.
Jedoch andererseits nun wieder kann man keineswegs behaupten, daß Neuton in diesem Punkte die Wahrheit getroffen habe. Denn wenn auch zugegeben werden muß, daß er im Allgemeinen lehrt, aus Farben lasse sich das Weiße herstellen; so bleibt doch der Sinn, in welchem er es sagt, nämlich die Lehre, daß die sieben Farben die Grundbestandtheile des Lichts seien, welches aus ihrer Vereinigung rekomponirt werde, von Grund aus falsch. Der physiologische Gegensatz der Farben, auf dem ihr ganzes Wesen beruht und in Bezug auf welchen allein die Herstellung des Weißen, oder des vollen Lichteindrucks, aus Farben, und zwar aus zwei, aus jedem beliebigen Farbenpaar, nicht aus sieben bestimmten Farben, Statt hat, ist ihm immer unbekannt, ja, ungeahndet geblieben, und mit diesem auch die wahre Natur der Farbe. Zudem beweist die Herstellung des Weißen aus zwei Farben die Unmöglichkeit derselben aus sieben. Man kann also zu Gunsten Neuton's weiter nichts sagen, als daß er zufällig einen der Wahrheit nahe kommenden Ausspruch gethan hat. Weil er aber diesen in einem falschen Sinn und zum Behuf einer falschen Theorie vorbrachte; so sind auch die Experimente, durch die er ihn belegen will, größtentheils ungenügend und falsch. Eben hiedurch verleitete er nun Goethen, im Widerspruch gegen jene falsche Theorie, zu viel zu leugnen. Und so ist denn der seltsame Fall eingetreten, daß das wahre und wirkliche Faktum der Herstellung des vollen Lichteindrucks oder des Weißen, durch Vereinigung von Farben (man muß hier unbestimmt lassen ob zwei oder sieben), von Neuton aus einem unrichtigen Grund und zum Behuf einer falschen Theorie behauptet, von Goethen aber im Zusammenhange eines sonst richtigen Systems von Thatsachen geleugnet ist. Wäre dasselbe im Neutonischen Sinne wahr, oder überhaupt Neuton's Theorie richtig; so müßte zunächst jede Vereinigung zweier der von ihm angenommenen Grundfarben sofort eine hellere Farbe, als jede von ihnen allein ist, geben; weil die Vereinigung zweier homogener Theile des in solche zerfallenen weißen Lichtes sofort ein Rückschritt zur Herstellung dieses weißen Lichtes wäre. Allein Jenes ist nicht ein einziges Mal der Fall. Bringen wir nämlich die drei im chemischen Sinne fundamentalen Farben, aus denen alle übrigen zusammengesetzt sind, paarweise zusammen; so giebt Blau mit Roth Violett, welches dunkler ist, als jede von beiden; Blau mit Gelb giebt Grün, welches, obwohl etwas heller als jenes, doch viel dunkler als dieses ist; Gelb mit Roth giebt Orange, welches heller als dieses, aber dunkler als jenes ist. Schon hierin liegt eigentlich eine hinreichende Widerlegung der Neuton'schen Theorie.
Aber die rechte, faktische, bündige und unabweisbare Widerlegung derselben ist der achromatische Refraktor; daher eben auch Neuton, sehr konsequent, einen solchen für unmöglich hielt. Besteht nämlich das weiße Licht aus sieben Lichtarten, deren jede eine andere Farbe und zugleich eine andere Brechbarkeit hat; so ist Brechung unzertrennlich von Isolation der Lichter und sind nothwendig der Grad der Brechung und die Farbe jedes Lichts unzertrennliche Gefährten: alsdann muß, wo Licht gebrochen ist, es sich auch gefärbt zeigen; wie sehr auch dabei die Brechung vermannigfaltigt und komplicirt, hin und her, hinauf und herab gezogen werden mag; so lange nur nicht alle sieben Strahlen vollzählig wieder auf einen Klumpen zusammengebracht sind und dadurch, nach Neuton'scher Theorie, das Weiße rekomponirt, zugleich aber auch aller Wirkung der Brechung ein Ende gemacht, nämlich Alles wieder an Ort und Stelle gebracht ist. Als nun aber die Erfindung der Achromasie das Gegentheil dieses Resultats an den Tag legte, da griffen die Neutonianer, in ihrer Verlegenheit, zu einer Erklärung, welche man mit Goethen für sinnlosen Wortkram zu halten, sich sehr versucht fühlt: denn, beim besten Willen, ist es sehr schwer, ihr auch nur einen verständlichen Sinn, d. h. ein anschaulich einigermaaßen Vorstellbares, unterzulegen. Da soll nämlich neben der Farbenbrechung noch eine von ihr verschiedene Farbenzerstreuung Statt finden und hierunter zu verstehn seyn das Sichentfernen der einzelnen farbigen Lichter von einander, das Auseinandertreten derselben, welches die nächste Ursache der Verlängerung des Spektri wäre. Dasselbe ist aber, ex hypothesi, die Wirkung der verschiedenen Brechbarkeit jener farbigen Strahlen. Beruht nun also diese sogenannte Zerstreuung, d. h. die Verlängerung des Spektri, also des Sonnenbildes nach der Brechung, darauf, daß das Licht aus verschiedenen farbigen Lichtern besteht, deren jedes, seiner Natur nach, eine verschiedene Brechbarkeit hat, d. h. in einem andern Winkel bricht; so muß doch diese bestimmte Brechbarkeit jedes Lichtes, als seine wesentliche, von ihm unzertrennliche Eigenschaft, stets und überall ihm anhängen, also das einzelne homogene Licht stets auf die selbe Weise gebrochen werden, eben wie es stets auf die selbe Weise gefärbt ist. Denn der Neuton'sche homogene Lichtstrahl und seine Farbe sind durchaus Eines und das Selbe: er ist eben ein farbiger Strahl und sonst nichts: mithin wo der Strahl ist, da ist seine Farbe, und wo diese ist, da ist der Strahl. Liegt es, ex hypothesi, in der Natur eines jeden solchen, anders gefärbten Strahls, auch in einem andern Winkel zu brechen; so wird ihn in diesen und jeden Winkel auch seine Farbe begleiten: folglich müssen dann bei jeder Brechung die verschiedenen Farben zum Vorschein kommen. Um also der von den Neutonianern beliebten Erklärung »zwei verschiedenartige brechende Mittel können das Licht gleich stark brechen, aber die Farben in verschiedenem Grade zerstreuen« einen Sinn unterzulegen, müssen wir annehmen, daß, während Krown- und Flint-Glas das Licht im Ganzen, also das weiße Licht, gleich stark brechen, dennoch die Theile, aus welchen eben dieses Ganze durch und durch besteht, vom Flint- anders, als vom Krown-Glas gebrochen werden, also ihre Brechbarkeit ändern. Eine harte Nuß! – Ferner müssen sie ihre Brechbarkeit in der Weise ändern, daß, bei Anwendung von Flintglas, die brechbarsten Strahlen noch stärkere Brechbarkeit erhalten, die am wenigsten brechbaren hingegen eine noch geringere Brechbarkeit annehmen; daß also dieses Flintglas die Brechbarkeit gewisser Strahlen vermehre und zugleich die gewisser anderer vermindere, und dabei dennoch das Ganze, welches allein aus diesen Strahlen besteht, seine vorherige Brechbarkeit behalte. Nichtsdestoweniger steht dieses so schwer faßliche Dogma noch immer in allgemeinem Kredit und Respekt, und kann man, bis auf den heutigen Tag, aus den optischen Schriften aller Nationen ersehn, wie ernsthaft von der Differenz zwischen Refraktion und Dispersion geredet wird. Doch jetzt zur Wahrheit!
Die nächste und wesentlichste Ursache der mittelst der Kombination eines Konvexglases aus Krown- und eines Konkavglases aus Flint-Glas zu Wege gebrachten Achromasie muß, wie alle Herstellung des Weißen aus Farben, eine physiologische seyn, nämlich die Herstellung der vollen Thätigkeit der Retina, auf den von den physischen Farben getroffenen Stellen, indem daselbst, zwar nicht 7, aber doch 2 Farben, nämlich zwei sich zu jener Thätigkeit ergänzende Farben, auf einander gebracht werden, also ein Farbenpaar wieder vereinigt wird. Objektiv, oder physikalisch, wird Dies, in gegenwärtigem Fall, folgendermaaßen herbeigeführt. Durch die zweimalige Refraktion, in entgegengesetzter Richtung (mittelst Konkav- und Konvex-Glas), entsteht auch die entgegengesetzte Farbenerscheinung, nämlich einerseits ein gelbrother Rand mit gelbem Saum, und andererseits ein blauer Rand mit violettem Saum. Diese zweimalige Refraktion, in entgegengesetzter Richtung, führt aber auch zugleich jene beiden farbigen Randerscheinungen dergestalt über einander, daß der blaue Rand den gelbrothen Rand und der violette Saum den gelben Saum deckt, wodurch diese zwei physiologischen Farbenpaare, nämlich das von ⅓ und ⅔, und das von ¼ und ¾ der vollen Thätigkeit der Netzhaut, wieder vereinigt werden, mithin auch die Farblosigkeit wieder hergestellt wird. Dies also ist die nächste Ursache der Achromasie.
Was nun aber ist die entferntere? Da nämlich das verlangte dioptrische Resultat, – ein Ueberschuß farblos bleibender Refraktion, – dadurch herbeigeführt wird, daß das in entgegengesetzter Richtung wirkende Flintglas, schon bei bedeutend geringerer Refraktion, die Farbenerscheinung des Krownglases, durch eine gleich breite ihr entgegengesetzte zu neutralisiren vermag, weil seine eigenen Farben-Ränder und Säume schon ursprünglich bedeutend breiter, als die des Krownglases sind; so entsteht die Frage: wie geht es zu, daß zwei verschiedenartige brechende Mittel, bei gleicher Brechung, eine so sehr verschiedene Breite der Farbenerscheinung geben? – Hievon läßt sich sehr genügende Rechenschaft, gemäß der Goethe'schen Theorie, geben, wenn man nämlich diese etwas weiter und dadurch deutlicher ausführt, als er selbst es gethan hat. Seine Ableitung der prismatischen Farbenerscheinung aus seinem obersten Grundsatz, den er Urphänomen nennt, ist vollkommen richtig: nur hat er sie nicht genug ins Einzelne herabgeführt; während doch ohne eine gewisse Akribologie solchen Dingen kein Genüge geschieht. Er erklärt ganz richtig jene farbige, die Refraktion begleitende Randerscheinung aus einem, das durch Brechung verrückte Hauptbild begleitenden Nebenbilde. Aber er hat nicht die Lage und Wirkungsweise dieses Nebenbildes ganz speciell bestimmt und durch eine Zeichnung veranschaulicht; ja, er spricht durchweg nur von einem Nebenbilde; wodurch denn die Sache so zu stehn kommt, daß wir annehmen müssen, nicht bloß das Licht, oder leuchtende Bild, sondern auch die es umgebende Finsterniß erleide eine Brechung. Ich muß daher hier seine Sache ergänzen, um zu zeigen, wie eigentlich jene, bei gleicher Brechung, aber verschiedenen brechenden Substanzen, verschiedene Breite der farbigen Randerscheinung entsteht, welche die Neutonianer durch den sinnlosen Ausdruck einer Verschiedenheit der Refraktion und Dispersion bezeichnen.
Zuvor ein Wort über den Ursprung dieser, bei der Refraktion, das Hauptbild begleitenden Nebenbilder. Natura non facit saltus; so lautet das Gesetz der Kontinuität aller Veränderungen, vermöge dessen, in der Natur, kein Uebergang, sei er im Raum, oder in der Zeit, oder im Grade irgend einer Eigenschaft, ganz abrupt eintritt. Nun wird das Licht, bei seinem Eintritt in das Prisma, und abermals bei seinem Austritt, also zwei Mal, von seinem geraden Wege plötzlich abgelenkt. Sollen wir nun voraussetzen, Dies geschehe so abrupt und mit solcher Schärfe, daß dabei das Licht auch nicht die geringste Vermischung mit der es umgebenden Finsterniß erlitte, sondern, mitten durch diese, in so bedeutenden Winkeln sich schwenkend, doch seine Gränzen auf das Schärfste bewahrte, – so daß es in ganz unvermischter Lauterkeit durchkäme und ganz vollständig zusammenbliebe? Ist nicht vielmehr die Annahme naturgemäßer, daß, sowohl bei der ersten, als bei der zweiten Brechung, ein sehr kleiner Theil dieser Lichtmasse nicht schnell genug in die neue Richtung komme, sich dadurch etwas absondere und nun, gleichsam eine Erinnerung des eben verlassenen Weges nachtragend, als Nebenbild das Hauptbild begleite, nach der einen Brechung etwas über, nach der andern etwas unter ihm schwebend? Deshalb hat man auch bemerkt, daß mit jeder Brechung des Lichts eine Lichtschwächung nothwendig verbunden ist. (Birnbaum, Reich der Wolken, p. 61.) Ja, man könnte hiebei an die Polarisation des Lichts, mittelst eines Spiegels, denken, der einen Theil desselben zurückwirft, einen andern durchläßt. Das Wesentliche des Vorgangs aber ist, daß, bei der Brechung, das Licht mit der es begränzenden Finsterniß eine so innige Verschmelzung eingeht, daß diese nicht mehr, wie z. B. Halbschatten thun, bloß die intensive, sondern die qualitative Theilung der Thätigkeit der Retina hervorruft.
Beifolgende Figur zeigt nun specieller, wie aus der Wirkung jener beiden, bei der prismatischen Refraktion abfallenden Nebenbilder, gemäß dem Goethe'schen Grundgesetze, die vier prismatischen Farben entstehn, als welche allein, nicht aber sieben, wirklich vorhanden sind.
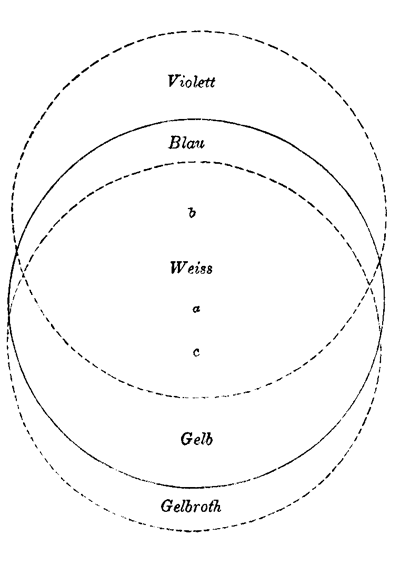
Diese Figur stellt eine, auf schwarzes glanzloses Papier geklebte, weiße Papierscheibe, von etwan 4 Zoll Durchmesser, vor, wie sie, durch das Prisma, aus einer Entfernung von etwan drei Schritten angeschaut, in der Natur und nicht nach Neutonischen Fiktionen, sich darstellt. Hievon nun aber hat Jeder, der wissen will wovon die Rede sei, sich durch Autopsie zu überzeugen. Er wird alsdann, das Prisma vor die Augen haltend und bald näher, bald ferner tretend, die beiden Nebenbilder beinahe geradezu und unmittelbar wahrnehmen, und wird sehn, wie sie, seiner Bewegung folgend, sich vom Hauptbilde bald mehr, bald weniger entfernen und über einander schieben. Tritt er beträchtlich weiter zurück, so greifen Blau und Gelb über einander, und er genießt das höchst erbauliche Schauspiel, aus ihnen das Neutonische homogene Licht Grün, das reine Urgrün, sich zusammensetzen zu sehn. – Prismatische Versuche überhaupt lassen sich auf zweierlei Weise machen: entweder so, daß die Refraktion der Reflexion, oder so, daß diese jener vorhergeht: Ersteres geschieht, wenn das Sonnenbild durch das Prisma auf die Wand fällt; Letzteres, wenn man durch das Prisma ein weißes Bild betrachtet. Diese letztere Art ist nicht nur weniger umständlich auszuführen, sondern zeigt auch das eigentliche Phänomen viel deutlicher; welches theils daher kommt, daß hier die Wirkung der Refraktion unmittelbar zum Auge gelangt, wodurch man den Vortheil hat, die Wirkung aus erster Hand zu erhalten, während man sie, bei jener andern Art, erst aus zweiter Hand, nämlich nach geschehener Reflexion von der Wand, erhält; theils daher, daß hier das Licht unmittelbar von einem nahen, scharf begränzten und nicht blendenden Gegenstande ausgeht; während, bei der ersten Art, es direkt das Bild eines 20 Millionen Meilen entfernten, dem entsprechend großen und eigenes Licht ausstrahlenden Körpers ist, welches durch das Prisma fährt. Daher zeigt denn die hier abgebildete weiße Scheibe (deren Stelle, bei der ersten Art, die Sonne vertritt) ganz deutlich die sie begleitenden, auf Anlaß einer zweimaligen, sie nach oben verrückenden Refraktion entstandenen zwei Nebenbilder. Das von der ersten Refraktion, die beim Eintritt des Lichts in das Prisma Statt findet, herrührende Nebenbild schleppt hinten nach und bleibt daher mit seinem äußersten Rande noch in der Finsterniß stecken und von ihr überzogen; das andere hingegen, welches bei der zweiten Refraktion, also beim Austritt des Lichts aus dem Prisma, entsteht, eilt vor und zieht sich deshalb über die Finsterniß her. Die Wirkungsart beider erstreckt sich aber auch, wiewohl schwächer, auf den Theil des Hauptbildes, der durch ihren Verlust geschwächt ist; daher nur der Theil desselben, welcher von beiden Nebenbildern bedeckt bleibt und also sein volles Licht behält, weiß erscheint: da hingegen, wo ein Nebenbild allein mit der Finsterniß kämpft, oder das durch den Abgang dieses Nebenbildes etwas geschwächte Hauptbild schon von der Finsterniß beeinträchtigt wird, entstehn Farben, und zwar dem Goethe'schen Gesetze gemäß. Demnach sehn wir am obern Theile, wo ein Nebenbild allein voreilend sich über die schwarze Fläche zieht. Violett entstehn; darunter aber, wo schon das Hauptbild, jedoch durch Verlust geschwächt, wirkt, Blau: am untern Theile des Bildes hingegen zeigt sich da, wo das einzelne Nebenbild in der Finsterniß stecken bleibt, Gelbroth, darüber aber, wo schon das geschwächte Hauptbild durchscheint. Gelb; eben wie die aufgehende Sonne, zuerst vom niedern, dickern Dunstkreise bedeckt, gelbroth, in den dünnern angelangt, nur noch gelb erscheint. Eben weil, dieser Auslegung zufolge, nicht die weiße Scheibe allein das Hervorbringende der Farben ist, sondern die Finsterniß als zweiter Faktor mitwirkt, fällt die Farbenerscheinung viel besser aus, wenn die weiße Scheibe auf einem schwarzen Grunde haftet, als wenn auf einem hellgrauen.
Nach dieser Erklärung der prismatischen Erscheinung wird es uns nicht schwer werden, wenigstens im Allgemeinen zu begreifen, warum, bei gleicher Brechung des Lichts, einige brechende Mittel, wie eben das Flintglas, eine breitere, andere, wie das Krownglas, eine schmälere, farbige Randerscheinung geben; oder, in der Sprache der Neutonianer, worauf die Ungleichmäßigkeit der Lichtbrechung und Farbenzerstreuung, ihrer Möglichkeit nach, beruhe. Die Brechung nämlich ist die Entfernung des Hauptbildes von seiner Einfallslinie; die Zerstreuung hingegen ist die dabei eintretende Entfernung der beiden Nebenbilder vom Hauptbilde: dieses Accidenz nun aber finden wir bei verschiedenartigen lichtbrechenden Substanzen in verschiedenem Grade vorhanden. Demnach können zwei durchsichtige Körper gleiche Brechungskraft haben, d.h. das durch sie gehende Lichtbild gleich weit von seiner Einfallslinie ablenken; dabei jedoch können die Nebenbilder, welche allein die Farbenerscheinung verursachen, bei der Brechung durch den einen Körper mehr, als bei der durch den andern, sich vom Hauptbilde entfernen.
Um nun diese Rechenschaft von der Sache mit der so oft wiederholten, oben analysirten, Neutonianischen Erklärung des Phänomens zu vergleichen, wähle ich den Ausdruck dieser letztern, welcher, am 27. Oktober 1836, in den »Münchner Gelehrten Anzeigen«, nach den philosophical Transactions, mit folgenden Worten gegeben wird: »Verschiedene durchsichtige Substanzen brechen die verschiedenen homogenen Lichter in sehr ungleichem Verhältniß Jedoch die Summe derselben, das weiße Licht, in gleichem! setze ich ergänzend hinzu.; so daß das Spektrum, durch verschiedene brechende Mittel erzeugt, bei übrigens gleichen Umständen, eine sehr verschiedene Ausdehnung erlangt.« – Wenn die Verlängerung des Spektrums überhaupt von der ungleichen Brechbarkeit der homogenen Lichter selbst herrührte; so müßte sie überall dem Grade der Brechung gemäß ausfallen, und demnach könnte nur in Folge größerer Brechungskraft eines Mittels größere Verlängerung des Bildes entstehn. Ist nun aber Dies nicht der Fall, sondern giebt von zwei, gleich stark brechenden Mitteln das eine ein längeres, das andere ein kürzeres Spektrum; so beweist Dies, daß die Verlängerung des Spektri nicht direkte Wirkung der Brechung, sondern bloß Wirkung eines die Brechung begleitenden Accidenz sei. Ein solches nun sind die dabei entstehenden Nebenbilder: diese können sehr wohl, bei gleicher Brechung, nach Beschaffenheit der brechenden Substanz, sich mehr oder weniger vom Hauptbilde entfernen.
Ich bemerke noch der Vollständigkeit wegen, daß, wie die Abweichung einer Farbe von ihrer höchsten Energie, entweder ins Blasse oder ins Dunkle, eine Vereinigung der qualitativen Theilung der Thätigkeit der Retina mit der intensiven ist, gleichermaaßen auch die extensive Theilung mit der qualitativen sich verbindet, indem ein Theil der Retina die eine, ein anderer eine andere Farbe auf äußern Reiz hervorbringt, wo dann bekanntlich, nach Aufhören des Reizes, die beiden geforderten Farben an jeder Stelle sich als Spektra einfinden. Beim gewöhnlichen Gebrauch des Auges werden meistens alle drei Arten der Theilung der Thätigkeit desselben zugleich und im Verein vollzogen.
Wollte man etwan darin eine Schwierigkeit finden, daß, meiner Theorie zufolge, beim Anblick einer sehr bunten Fläche, die Thätigkeit der Retina, an hundert Stellen zugleich, in sehr verschiedenen Proportionen, getheilt würde; so erwäge man, daß beim Anhören der Harmonie eines zahlreichen Orchesters, oder der schnellen Läufe eines Virtuosen, das Trommelfell und der Gehörnerv, bald simultan, bald in der raschesten Succession, in Schwingungen nach verschiedenen Zahlenverhältnissen versetzt wird, welche die Intelligenz alle auffaßt, arithmetisch abschätzt, die ästhetische Wirkung davon empfängt und jede Abweichung von, der mathematischen Richtigkeit eines Tones sogleich bemerkt: dann wird man finden, daß ich dem viel vollkommeneren Gesichtssinn nicht zu viel zugetraut habe.
Hier verdient nun noch ein besonderes, gewissermaaßen abnormes Phänomen erwähnt zu werden, welches mit der Scherffer'schen Auslegung schlechterdings unvereinbar ist, mithin zu ihrer Widerlegung beiträgt, nach der meinigen aber noch einer besondern Erklärung bedarf. Wenn nämlich auf einer großen gefärbten Fläche einige kleinere, farblose Stellen sind; so werden diese, wann nachher das durch die gefärbte Fläche hervorgerufene physiologische Spektrum eintritt, nicht mehr farblos bleiben, sondern sich in der zuerst dagewesenen Farbe der ganzen Fläche selbst darstellen, obgleich sie keineswegs vom Komplement derselben afficirt gewesen sind. Z. B. auf das Anschauen einer grünen Hausmauer mit kleinen grauen Fenstern, folgt als Spektrum eine rothe Mauer, nicht mit grauen, sondern mit grünen Fenstern. Gemäß meiner Theorie haben wir Dies daraus zu erklären, daß, nachdem auf der ganzen Retina eine bestimmte qualitative Hälfte ihrer Thätigkeit, durch die gefärbte Fläche, hervorgerufen war, jedoch einige kleine Stellen von dieser Erregung ausgeschlossen blieben, und nun nachher, beim Aufhören des äußern Reizes, die Ergänzung der durch ihn erregten Thätigkeitshälfte sich als Spektrum einstellt, alsdann die davon ausgeschlossen gebliebenen Stellen, auf konsensuelle Weise, in jene zuerst dagewesene qualitative Hälfte der Thätigkeit gerathen, indem sie jetzt gleichsam nachahmen, was vorhin der ganze übrige Theil der Retina gethan hat, während sie allein, durch Ausbleiben des Reizes, davon ausgeschlossen waren; mithin daß sie, so zu sagen, nachexerciren.
Auch mag hier die Bemerkung Platz finden, daß diejenigen Spektra, welche durch mechanische Erschütterung des Auges, und die, welche durch Blendung hervorgebracht werden, der Art nach als einerlei anzusehn und nur dem Grade nach verschieden sind. Man kann sie füglich pathologische Spektra nennen: denn wie die erstern durch offenbare Verletzung entstehn, so sind die letztern Erscheinungen einer durch Ueberreizung hervorgebrachten transitorischen Zerrüttung der Thätigkeit der Retina, welche alsdann, gleichsam aus ihrem Gleichgewicht gebracht, sich krampfhaft bald so, bald anders theilt und so die Erscheinungen zeigt, welche Goethe (Bd. 1, S. 15) beschreibt. Ein geblendetes Auge hat, wenn es ins Helle sieht, ein rothes, wenn ins Dunkle, ein grünes Spektrum, eben weil seine Thätigkeit durch die Gewalt des Ueberreizes getheilt ist und nun, nach Maaßgabe des äußern Verhältnisses, bald die eine bald die andere Hälfte hervortritt.
Die der Blendung entgegengesetzte Verletzung des Auges ist die Anstrengung desselben in der Dämmerung. Bei der Blendung ist der Reiz von außen zu stark, bei der Anstrengung in der Dämmerung ist er zu schwach. Durch den mangelnden äußern Reiz des Lichtes ist nämlich die Thätigkeit der Retina intensiv getheilt und nur ein kleiner Theil derselben ist wirklich aufgeregt. Dieser wird nun aber durch willkürliche Anstrengung, z. B. beim Lesen, vermehrt, also ein intensiver Theil der Thätigkeit wird ohne Reiz, ganz durch innere Anstrengung, aufgeregt. Um die Schädlichkeit hievon recht anschaulich zu machen, bietet sich mir kein anderer, als ein obscöner Vergleich dar. Jenes schadet nämlich auf die selbe Art, wie Onanie und überhaupt jede, ohne Einwirkung des naturgemäßen Reizes von außen, durch bloße Phantasie entstehende Aufreizung der Genitalien viel schwächender ist, als die wirkliche natürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes.
Warum die künstliche Beleuchtung der Lichtflamme das Auge mehr angreift, als das Tageslicht, wird durch meine Theorie erst eigentlich verständlich. Die Lichtflamme beleuchtet Alles röthlichgelb (daher auch die blauen Schatten). Folglich sind, so lange wir bei Licht sehn, immer nur etwas über 2/3 der Thätigkeit der Retina erregt und tragen die ganze Anstrengung des Sehns, während beinahe 1/3 feiert. Dies muß auf eine ähnliche Art schwächen, wie der Gebrauch eines geschliffenen Glases vor einem Auge; ja, um so mehr, als hier die Theilung der Thätigkeit der Retina keine bloß intensive, sondern eine qualitative ist, und die Retina, unausgesetzt, lange Zeit in derselben gehalten wird: daher auch ihr Drang das Komplement hervorzubringen, welchen sie bei Gelegenheit jedes anderweitig schwach beleuchteten Schattens sogleich durch Färbung desselben befriedigt. Es war daher ein guter Vorschlag, die Nachtbeleuchtung durch blaue, ganz wenig ins Violette spielende Gläser, dem Tageslicht ähnlich zu machen; wobei ich, aus eigener Erfahrung, empfehle, daß man die Gläser ja nicht zu dunkel, oder zu dick, nehme; da sonst nur der Anschein der Dämmerung entsteht. Man sehe übrigens Parrot, traite de la manière de changer la lumière artificielle en une lumière semblable à celle du jour. Strasb. 1791.
Einen hinzukommenden Beweis von der subjektiven Natur der Farbe, daß sie nämlich eine Funktion des Auges selbst ist, folglich diesem unmittelbar angehört und erst sekundär und mittelbar den Gegenständen, giebt uns zunächst der Daguerrotyp, der, auf seinem rein objektiven Wege, alles Sichtbare der Körper wiedergiebt, nur nicht die Farbe. Einen andern, noch schlagenderen Beweis liefern uns die zwar selten, aber doch hin und wieder vorkommenden Menschen, welche gar keine Farben sehn, deren Retina also die Fähigkeit zur qualitativen Theilung ihrer Thätigkeit mangelt. Sie sehn demnach nur die Gradationen des Hellen und Dunkeln, folglich stellt ihnen die Welt sich dar, wie ein getuschtes Bild, oder ein Kupferstich, oder ein Daguerrotyp: sie ist des eigenthümlichen Reizes beraubt, welchen die Zugabe der Farbe ihr für uns verleiht. Ein Beispiel davon findet sich schon im 67. Bande der philosophical Transactions vom J. 1777, woselbst (S. 260) ausführlicher Bericht ertheilt wird über drei Brüder Harris, die sämmtlich keine Farben sahen; und im folgenden Bande steht ein Aufsatz von J. Scott, der keine Farben sah, welchen Fehler mehrere Glieder seiner Familie ebenfalls hatten. An dem selben Mangel litt der zu seiner Zeit berühmte, in Hamburg lebende Arzt Unzer: dieser war jedoch bemüht, ihn möglichst zu verbergen, weil er daran ein offenbares Hinderniß bei der Diagnose und Semiotik hatte. Seine Frau hatte ein Mal, um der Sache auf den Grund zu kommen, sich blau geschminkt; worauf er bloß bemerkte, daß sie heute zu viel Roth aufgelegt habe. Ich verdanke diese Nachricht einem Maler Demiani, welcher vor 40 Jahren Gallerie-Inspektor in Dresden war, und dem die Sache einst dadurch bekannt geworden war, daß er jene Frau porträtirt hatte, worauf Unzer ihm gestand, daß und warum er über das Kolorit nicht urtheilen könne. Noch ein Beispiel dieser Art liefert ein Herr v. Zimmermann, welcher im Anfang dieses Jahrhunderts in Riga lebte. Die folgenden Nachrichten über ihn verbürgt mir der Verleger dieser Schrift J. F. Hartknoch, im J. 1815., der ihn selbst gekannt hat und sich auch auf den Herrn Oberschuldirektor Albanus beruft, welcher Erzieher jenes Herrn gewesen ist. Für diesen Herrn v. Zimmermann also war durchaus keine Farbe vorhanden: er sah Alles nur weiß, schwarz und in Nüancen von Grau. Er spielte sehr gut Billard, und da dieses in Riga mit gelbgefärbten und rothen Bällen geschieht, konnte er solche doch sehr wohl unterscheiden, weil ihm die rothen viel dunkler aussahen. (Nach meiner Theorie mußte ihm, bei reinen Farben, roth um die Hälfte dunkler als gelb seyn.) Man hat mit ihm einen Versuch angestellt, der in Hinsicht auf meine Theorie nicht glücklicher hätte erdacht werden können. Er trug eine rothe Uniform: man legte ihm statt ihrer eine grüne hin; er bemerkte gar nichts, zog diese an und war im Begriff damit auf die Parade zu gehn. Denn freilich mußte für ihn reines Roth und reines Grün sich so gleich seyn, wie ½=½ ist. Seiner Retina fehlte also gänzlich die Fähigkeit, ihre Thätigkeit qualitativ zu theilen. – Viel weniger selten sind Leute, welche die Farben nur sehr unvollkommen sehn, indem sie einige derselben erkennen, jedoch die meisten nicht. Mir sind, in eigener Erfahrung, drei Solche vorgekommen: sie konnten am wenigsten Roth und Grün unterscheiden, aus der soeben angegebenen Ursache. Daß eine solche Achromatoblepsie auch temporär eintreten kann ist zu ersehn aus einer Abhandlung von Th. Clemens »Farbenblindheit während der Schwangerschaft, nebst einigen Erörterungen über Farbenblindheit im Allgemeinen«, befindlich im Archiv für physiologische Heilkunde vom Jahre 1858. (Ueber Farbenblindheit vergl. auch G. Wilson, Researches on Colour-Blindness, Edinburgh 1855.)
Wir haben bisher die Farben in der engsten Bedeutung betrachtet, nämlich als Zustände, Affektionen des Auges. Diese Betrachtung ist der erste und wesentlichste Theil der Farbenlehre, die Farbenlehre im engsten Sinne, welche, als solche, allen ferneren Untersuchungen über die Farben zum Grunde liegen muß und mit der sie stets in Uebereinstimmung bleiben müssen. An diesen ersten Theil hat sich als der zweite zu schließen die Betrachtung der Ursachen, welche, von außen als Reize auf das Auge wirkend, nicht, wie das reine Licht und das Weiße, die ungetheilte Thätigkeit der Retina, in stärkern oder schwächern Graden, sondern immer nur eine qualitative Hälfte derselben hervorrufen. Diese äußern Ursachen hat Goethe sehr richtig und treffend in zwei Klassen gesondert, nämlich in die chemischen und physischen Farben, d. h. in die den Körpern inhärirenden, bleibenden Farben, und die bloß temporären, durch irgend eine besondere Kombination des Lichtes mit den durchsichtigen Medien entstehenden. Sollte nun ihr Unterschied durch einen einzigen völlig allgemeinen Ausdruck bezeichnet werden, so würde ich sagen: physische Farben sind diejenigen Ursachen der Erregung einer qualitativen Hälfte der Thätigkeit der Retina, die uns als solche zugänglich sind; daher wir einsehn, daß, wenn wir auch über die Art ihres Wirkens noch uneinig sind, dasselbe doch gewissen Gesetzen unterworfen seyn muß, die auch unter den verschiedensten Umständen und bei den verschiedensten Materien obwalten, so daß das Phänomen stets auf sie zurückgeführt werden kann: die chemischen Farben hingegen sind die, bei denen Dies nicht der Fall ist; sondern deren Ursache wir erkennen, ohne die Art ihres speciellen Wirkens auf das Auge irgend zu begreifen. Denn, wenn wir gleich wissen, daß z. B. dieser oder jener chemische Niederschlag diese bestimmte Farbe giebt und insofern ihre Ursache ist; so wissen wir hier doch nicht die Ursache der Farbe als solcher, nicht das Gesetz demzufolge sie hier eintritt, sondern ihr Eintreten wird nur a posteriori erkannt und bleibt für uns insofern zufällig. Von den physischen Farben hingegen wissen wir als solchen die Ursache, das Gesetz ihrer Erscheinung; daher auch unsere Erkenntniß derselben nicht an bestimmte Materien gebunden ist, sondern von jeder gilt: so z. B. entsteht Gelb, sobald Licht durch ein trübes Mittel bricht, dies mag nun ein Pergament, eine Flüssigkeit, ein Dunst, oder das prismatische Nebenbild seyn. – Auch Schwarz und Weiß sind physisch wie chemisch vorhanden: das physische Schwarz ist die Finsterniß, das physische Weiß die vollendete Trübe. Dem Gesagten zufolge kann man die physischen Farben auch die verständlichen, die chemischen aber die unverständlichen nennen. Durch Zurückführung der chemischen Farben auf physische, in irgend einem Sinne, würde der zweite Theil der Farbenlehre zur Vollendung gebracht seyn. Neuton hat hievon das gerade Gegentheil gethan und die physischen Farben auf chemische zurückgeführt, indem er lehrt, bei der Brechung zersplittere sich der weiße Strahl in sieben ungleich brechbare Theile, und diese hätten eben per accidens eine violette, indigoblaue u. s. w. Farbe.
Ueber die chemische Farbe werde ich weiterhin Einiges bei- s bringen: hier zunächst von der physischen. Da der äußere Reiz der Thätigkeit der Retina zuletzt immer das Licht ist; so muß für die Modifikation jener Thätigkeit, in deren Empfindung die Farbe besteht, auch eine ihr genau entsprechende Modifikation des Lichtes nachgewiesen werden können. Welche dieses sei, ist das punctum controversiae zwischen Neuton und Goethe, welches, in letzter Instanz, durch vorgelegte Thatsachen und Versuche, unter richtiger Beurtheilung derselben, zu entscheiden ist. Wenn wir nun aber in Erwägung nehmen, was oben § 2 über den nothwendigen Parallelismus zwischen Ursache und Wirkung beigebracht worden ist; so werden wir nicht zweifeln, daß schon die, durch das Bisherige gewonnene, genauere Erkenntniß der zu erklärenden Wirkung, also der Farbe als physiologischer Thatsache, uns in den Stand setzt, auch über die nachgeforschten äußern Ursachen derselben, unabhängig von aller experimentalen Untersuchung und also insofern a priori, Einiges festzustellen. Dies wäre hauptsächlich Folgendes.
1) Die Farben selbst, ihre Verhältnisse zu einander und die Gesetzmäßigkeit ihrer Erscheinung, dies Alles liegt im Auge selbst, und ist nur eine besondere Modifikation der Thätigkeit der Retina. Die äußere Ursache kann nur als Reiz, als Anlaß zur Aeußerung jener Thätigkeit, also nur sehr untergeordnet wirken: sie kann bei der Hervorbringung der Farbe im Auge, d. i. bei der Erregung der Polarität seiner Retina, immer nur eine solche Rolle spielen, wie bei Hervorrufung der im Körper schlummernden Elektricität, d. i. Trennung des +E und -E, die Reibung. Keineswegs aber können die Farben in bestimmter Zahl irgendwo außer dem Auge, rein objektiv, vorhanden seyn, dort bestimmte Gesetze und Verhältnisse zu einander haben und nun ganz fertig dem Auge überliefert werden. Wollte man, trotz allen Diesem, eine Vereinigung meiner Theorie mit der Neutonischen bewerkstelligen; so ließe dieser unglückliche Gedanke sich nur ausführen mittelst der Annahme der wunderlichsten harmonia praestabilita, zu welcher jemals ein Menschenkopf in seiner spekulativen Bedrängniß griff. Zufolge derselben nämlich müßten gewisse Farben, obwohl sie im Auge, nach den Gesetzen seiner Funktionen, eben wie alle übrigen unzähligen Farben, entstehn, dennoch schon im Lichte selbst, und zwar in dessen Bestandtheilen, eigens dazu bereit liegende, gleichsam bestellte Ursachen haben.
2) Jede Farbe ist die qualitative Hälfte der vollen Thätigkeit der Retina, zu der sie durch eine andere Farbe, ihr Komplement, ergänzt wird. Folglich giebt es durchaus nur Farbenpaare und keine einzelne Farben: also kann man nicht sieben, eine ungerade Zahl, einzig wirklich existirende Farben annehmen.
3) Die Farben bilden einen stetigen Kreis, innerhalb dessen es keine Gränzen, keine feste Punkte giebt, den Aequator der oben § 5 beschriebenen Runge'schen Farbenkugel. Durch Theilung dieses Kreises in zwei Hälften entsteht jede Farbe, und ihr ergänzender Gegensatz ist sofort gegeben: beide zusammen enthalten immer potentialiter den ganzen Kreis. Die Farben sind also der Zahl nach unendlich: daher kann man durchaus weder sieben, noch irgend eine andere bestimmte Zahl feststehender Farben annehmen. Bloß durch das rationale, leicht aufzufassende und in den ersten Zahlen ausdrückbare Verhältniß, in welchem, bei gewissen Farben, die Thätigkeit der Retina sich theilt, zeichnen sich drei Farbenpaare besonders aus und sind deshalb immer und überall durch eigene Namen bezeichnet worden; wozu außer diesem kein anderer Grund ist, da sie übrigens vor den andern nichts voraus haben.
4) Der unendlichen Anzahl möglicher Farben, welche aus der, auf unendliche Weisen modifikabeln Theilbarkeit der Thätigkeit der Retina entspringt, muß auch in der als Reiz wirkenden äußern Ursache eine eben so unendliche und der zartesten Uebergänge fähige Modifikabilität entsprechen. Dies leistet aber keineswegs die Annahme von sieben oder irgend einer bestimmten Anzahl homogener Lichter, als Theile des weißen Lichtes, die jedes für sich steif und starr dastehn, mit einander aber vereinigt, nie etwas anderes geben könnten, als einen Schritt zur Rückkehr in die Farblosigkeit. Ich weiß wohl, daß Neuton bisweilen, wenn der Zusammenhang seines Gewebes es fordert, versichert, es sei mit den sieben homogenen Lichtern im Grunde doch nur Spaaß, sie seien gar nicht homogen, sondern höchst zusammengesetzt, nämlich aus unendlich vielen wirklich und eigentlich homogenen Lichtern. Dies könnte nun, auch hier vorgebracht, allenfalls gegen die Anforderung dieser Nummer die homogenen Lichter retten: das selbe Argument verdirbt sie aber um so sicherer in der nächsten: denn, nicht zu gedenken, daß sie jetzt nur so existiren wie Demokrits Atome, so folgt, daß jedes echte homogene Licht, d.h. jede wirkliche Urfarbe, sich zum Weißen verhält, wie ein unendlich kleiner Bruch zu Eins, wodurch sie durchaus in Dunkelheit verschwindet und unsichtbar wird. – Auf das Vollkommenste dagegen genügt der hier gemachten Forderung Goethes Lehre. Denn ein Trübes, das sich bald diesseit bald jenseit des Lichtes befinden, dabei in unzähligen Graden bald dichter bald durchsichtiger seyn, das endlich auch von beiden Seiten ungleich in den verschiedensten Verhältnissen beleuchtet werden kann: dies giebt uns in der Ursache die selbe unendliche Modifikabilität wieder, die wir in der Wirkung gefunden hatten.
5) Das der Farbe wesentliche σκιερον, oder ihre schattige Natur, haben wir im Auge darin begründet gefunden, daß die nur halbe Thätigkeit der Retina die Ruhe der andern Hälfte voraussetzt, deren Ausdruck eben jenes σκιερον ist, dessen, durch diese Nothwendigkeit, in der Farbe sich darstellende innige Verbindung mit dem Licht wir einer chemischen Mischung des Lichtes und der Finsterniß verglichen haben. Dieses σκιερον muß sich auch außer dem Auge, in der äußern Ursache, auf irgend eine Art repräsentirt wiederfinden. In diesem Punkt würde nun zwar Neuton's Lehre, daß die Farbe immer 1/7 des ganzen Lichtes sei, höchst nothdürftig genügen, indem sie nämlich die Farbe für ein minder Helles, als das Weiße, anerkennt, jedoch in dem übertriebenen Maaße, daß, der Helle nach, alle Farben (mit unbedeutenden Unterschieden) sich einzeln zum Weißen verhalten, etwan wie 1 zu 7, oder allenfalls zu 6; wir aber wissen, daß sogar die schwächste und dunkelste aller Farben, das Violett, sich zum Weißen verhält, wie 1 zu 4; blau, wie 1 zu 3; grün und roth, wie 1 zu 2; und gelb, gar wie 3 zu 4. In der vorhergehenden Nummer ist schon gesagt worden, wie gar schlimm es hier um die Neutonische Theorie steht, wenn man, wie ihre eigentlich esoterische Lehre ist, statt sieben homogener Lichter, unendliche annimmt. – Hingegen entspricht auch der Forderung über das σκιερον auf das vollkommenste und befriedigendeste das von Goethe aufgestellte Urphänomen. Aus Licht und Finsterniß, im innigsten Verein, läßt er die Farbe entstehn. Ein verdunkeltes Licht erregt im Auge Gelb; eine erleuchtete Finsterniß Blau: beides jedoch darf nicht unmittelbar geschehn, wodurch bloß Dämmerung, Grau, intensive Theilung der Thätigkeit der Retina entstände; sondern mittelst des Dazwischentretens eines dritten, des Trüben, welches gleichsam das menstruum der chemischen Durchdringung des Lichtes und der Finsterniß wird, welche nunmehr die Polarität des Auges, d. i. die qualitative Theilung seiner Thätigkeit, hervorruft. – Goethe stellt, nachdem er den physiologischen Gegensatz der Farben, in allen seinen Phänomenen, trefflich geschildert hat, als physischen Gegensatz Gelb und Blau auf, als welche aus entgegengesetzten Ursachen entstehn: Gelb, dadurch daß ein Trübes dem Auge das Licht hemmt: Blau, indem das Auge durch ein beleuchtetes Trübes in das Finstere sieht. Es hat nun mit diesem physischen Gegensatz auch seine völlige Richtigkeit, so lange man ihn als allgemeinen Ausdruck für zwei Hauptverhältnisse aller physischen Farben versteht, und Blau und Gelb hier gleichsam als Repräsentanten zweier Klassen, der kalten und warmen Farben, ansieht. Wollte man aber es im engsten Sinne verstehn und gerade zwischen Gelb und Blau einen bestehenden physischen Gegensatz annehmen; so müßte man befremdet werden durch die Inkongruenz des Gegensatzes der physiologischen Farben mit dem der physischen, indem ja der eigentliche Gegensatz von Blau Orange, und von Gelb Violett ist, und vorauszusetzen war, daß das Verhältniß, welches zwischen den Farben, im eigentlichen Sinn, besteht, auch zwischen ihren außer dem Auge liegenden Ursachen sich wieder finden müßte; in Gemäßheit des oben erwähnten Aristotelischen Satzes των εναντιων τα εναντια αιτια ( contrariorum contrariae sunt causae) de generat. et corrupt. c. 10. Allerdings ist es auch so, und jene Inkongruenz ist bloß scheinbar. Denn genauer betrachtet giebt der selbe und nämliche Grad von Trübe, welcher, vor die Finsterniß gezogen und beleuchtet, reines Blau erregt, wenn er umgekehrt das Licht hemmt, nicht Gelb, sondern Orange; und eben so wird allemal ein und der selbe Grad von Trübe, unter in Bezug auf Licht und Finsterniß entgegengesetzten Umständen, zwei entgegengesetzte, einander ergänzende Farben geben. Daß dies seyn muß, geht schon a priori aus folgender Betrachtung hervor. Die geforderte und nachher als Spektrum hervortretende Farbe ist das Komplement der gegebenen: daher muß ihr so viel von der vollen Thätigkeit des Auges abgehn, als jene davon hat; d. h. sie muß gerade so viel Finsterniß (σκιερον) enthalten, als jene Licht enthält. Nun ist bei allen physischen Farben der positiven Seite (d. h. allen die zwischen Gelb und Roth (liegen) das Trübe Ursache ihrer Finsterniß, da es das Licht hemmt; umgekehrt ist bei allen Farben der negativen Seite das Trübe Ursache ihrer Helle, indem es das auffallende Licht, welches sich sonst in die Finsterniß verlöre, zurückwirft. Also muß, unter entgegengesetzten Umständen, die nämliche Trübe in einem Fall gerade so viel Erhellung verursachen, als im umgekehrten Verfinsterung: und da gezeigt ist, daß jede Farbe so viel Helle enthalten muß, als ihr Komplement Dunkelheit enthält; so wird nothwendig die nämliche Trübe, bei entgegengesetzter Beleuchtung, die zwei Farben geben, welche sich fordern und ergänzen. Hieran nun aber haben wir einen vollkommenen Beweis a priori von der Wahrheit des Goethe'schen Urphänomens und der Richtigkeit seiner ganzen Theorie der physischen Farben; welchen ich wohl zu beachten bitte. Nämlich bloß von der Kenntniß der Farbe im engsten Sinn, also als Phänomen im Auge, ausgehend, haben wir gefunden, daß ihre äußere Ursache ein vermindertes Licht seyn muß, jedoch ein auf eine bestimmte Art vermindertes, die das Eigenthümliche haben muß, daß sie jeder Farbe gerade so viel Licht ertheilt, als ihrem Komplement Finsterniß, σκιερον. Dies aber kann auf einem unfehlbaren und allen Fällen angemessenen Wege nur dadurch geschehn, daß die Ursache der Helle in einer gegebenen Farbe gerade die Ursache des Schattigen, oder Dunkeln, in ihrem Komplement sei. Denn conversa causa, convertitur effectus. Dieser Forderung nun genügt allein, aber auch vollkommen, die Scheidewand eines zwischen Licht und Finsterniß eingeschobenen Trüben, indem sie, unter entgegengesetzter Beleuchtung, allezeit zwei sich physiologisch ergänzende Farben verursacht, welche, je nach dem Grade der Dicke und Dichtigkeit dieses Trüben, verschieden ausfallen, zusammen aber immer zum Weißen, d. h. zur vollen Thätigkeit der Retina, einander ergänzen. Bei der größten Dünne des Trüben werden diese Farben die gelbe und violette seyn; bei zunehmender Dichtigkeit desselben werden sie allmälig in Orange und Blau übergehn und endlich, bei noch größerer, Roth und Grün werden; welches letztere jedoch auf diesem einfachen Wege nicht wohl darzustellen ist; obgleich der Himmel, bei Sonnenuntergang und Aufgang, es bisweilen zu schwacher Erscheinung bringt. Wird endlich die Trübe vollendet, d. h. bis zur Undurchdringlichkeit verdichtet; so erscheint, bei auffallendem Lichte, Weiß; bei dahinter befindlichem, die Finsterniß, oder Schwarz. – In Folge dieser Ableitung des Goethe'schen Urphänomens aus meiner Theorie, verdient dasselbe nicht mehr so zu heißen. Denn es ist nicht, wie Goethe es nahm, ein schlechthin Gegebenes und aller Erklärung auf immer Entzogenes: vielmehr ist es nur die Ursache, wie sie, meiner Theorie zufolge, zur Hervorbringung der Wirkung, also der Halbirung der Thätigkeit der Retina, erfordert ist. Eigentliches Urphänomen ist allein die organische Fähigkeit der Retina, ihre Nerventhätigkeit in zwei qualitativ entgegengesetzte, bald gleiche, bald ungleiche Hälften auseinandergehn und successiv hervortreten zu lassen. Dabei freilich müssen wir stehn bleiben, indem, von hier an, sich nur noch Endursachen absehn lassen; wie uns dies in der Physiologie durchgängig begegnet: also etwan, daß wir, durch die Farbe, ein Mittel mehr haben, die Dinge zu unterscheiden und zu erkennen.
Aus der gegebenen Ableitung des Goethe'schen Urphänomens folgt auch, daß der physische Gegensatz immer mit dem physiologischen zusammentreffen und übereinstimmen muß. Das prismatische Spektrum bestätigt an den vier Farben, die es ursprünglich und im einfachsten Zustande zeigt, das Gesagte vollkommen; wie aus der oben gegebenen Abbildung desselben leicht zu ersehn. Nämlich die doppelt dichte Trübung eines doppelten Nebenbildes erzeugt an einer Seite den blauen und an der andern den gelb-rothen Rand, also zwei Komplemente zur vollen Thätigkeit der Retina: und die halb so dichte Trübe giebt, an korrespondirenden Stellen, den violetten und den gelben Saum, die ebenfalls einander ergänzen. Also treffen physischer und physiologischer Gegensatz völlig zusammen. Eben so geben gewisse trübe Auflösungen, aus Quassia, lignum nephriticum und ähnliche, bei durchfallendem Lichte dasjenige Gelb, welches die Ergänzungsfarbe des Blauen ist, das sie bei auffallendem Lichte zeigen. Sogar Tabaksdampf, gegen das Licht geblasen, erscheint schmutzig orange; gegen die Schattenseite geblasen, blau. – Diesem Allen zufolge gilt der physische Gegensatz von Gelb und Blau, den Goethe aufstellt, durchaus nur im Allgemeinen, nämlich sofern Gelb und Blau hier nicht zwei Farben, sondern zwei Klassen von Farben bedeuten. Es ist nothwendig sich diese Restriktion zu merken. Wenn nun aber Goethe noch weiter geht, und diesen physischen Gegensatz von Gelb und Blau einen polaren nennt; so würde ich ihm nur mittelst einer höchst gezwungenen Auslegung beistimmen können, und muß von ihm abweichen. Denn polarischen Gegensatz haben, wie meine ganze Darstellung zeigt, nur die Farben in engster Bedeutung, als Affektionen der Retina, deren Polarisation, d. h. Auseinandertreten in qualitativ entgegengesetzte Thätigkeiten, sie eben offenbaren. Polarität des Lichtes behaupten, heißt durchaus Theilung des Lichtes behaupten. Indem Goethe letztere verwirft, nun aber doch von einer Polarität der Farben, unabhängig vom Auge, redet, die Farbe selbst aber aus dem Konflikte des Lichtes mit dem Trüben oder Dunkeln erklärt, sie nicht weiter ableitend; so könnte jene Polarität der Farbe nichts anderes, als eine Polarität dieses Konflikts seyn. Die Unzulässigkeit hievon bedarf keiner Auseinandersetzung. Jede Polarität muß aus einer Einheit entspringen, deren Entzweiung mit sich selbst, deren Auseinandertreten in zwei qualitative Gegensätze sie ist: keineswegs aber kann aus dem zufälligen Zusammentreffen zweier Dinge verschiedenen Ursprungs, wie Licht und trübes Mittel sind, je Polarität entstehn. –
Was nun endlich die chemische Farbe betrifft, so ist sie offenbar eine eigenthümliche Modifikation der Oberfläche der Körper, die aber so fein ist, daß wir sie übrigens durchaus nicht erkennen und unterscheiden können, sondern sie einzig und allein sich kund giebt durch die Fähigkeit, diese oder jede bestimmte Hälfte der Thätigkeit des Auges hervorzurufen. Diese Fähigkeit ist für uns noch eine qualitas occulta. Leicht einzusehn aber ist es, daß eine so zarte und feine Modifikation der Oberfläche, selbst durch unbedeutende Umstände, stark verändert werden und daher nicht in verhältnißmäßigem Zusammenhange stehn kann mit den innern und wesentlichen Eigenschaften des Körpers. Diese leichte Veränderlichkeit der chemischen Farben geht so weit, daß bisweilen einem gänzlichen Wechsel der Farbe nur eine äußerst geringfügige, oder selbst gar nicht ein Mal nachweisbare Veränderung in den Eigenschaften des Körpers, dem sie inhärirt, entspricht. So z. B. ist der durch Zusammenschmelzen des Merkurs mit dem Schwefel erlangte Zinnober schwarz, – eben wie eine ähnliche Verbindung des Bleies mit dem Schwefel: erst nachdem er sublimirt worden, nimmt der Zinnober die bekannte feuerrothe Farbe an; wobei jedoch eine chemische Veränderung an ihm nicht nachweisbar ist. Durch bloße Erwärmung wird rothes Quecksilberoxyd schwarzbraun, und gelber, basischer salpetersaurer Merkur roth. Eine bekannte chinesische Schminke kommt uns auf Stückchen dünner Pappe aufgetragen zu und ist dann dunkelgrün: mit benetztem Finger berührt färbt sie diesen augenblicklich hochroth. Selbst das Rothwerden der Krebse durch Kochen gehört hieher; auch das Umschlagen des Grüns mancher Blätter in Roth, beim ersten Frost, und das Rothwerden der Aepfel auf der Seite, die von der Sonne beschienen wird, welches man einer stärkern Desoxydation dieser Seite zuschreiben will; imgleichen, daß einige Pflanzen den Stengel und das ganze Gerippe des Blattes hochroth haben, das Parenchyma aber grün; überhaupt die Vielfarbigkeit mancher Blumenblätter, wie auch die der Varietäten einer einzigen Art, der Tulpen, Nelken, Malven, Georginen u. s. w. In andern Fällen können wir die chemische Differenz, welche von der Farbe angezeigt wird, als eine sehr geringe nachweisen, z. B. wann Lakmustinktur, oder Veilchensaft, durch die leichteste Spur von Oxydation, oder Alkalisation, ihre Farbe ändern. Dies Alles bestätigt einerseits die aus meiner Theorie hervorgehende vorwaltend subjektive Natur der Farbe, welche man immer gefühlt hat, wie das alte Sprichwort des goûts et des couleurs il ne faut disputer, imgleichen das bewährte nimium non crede colori bezeugt, und wegen welcher die Farbe beinah zum Symbol der Trüglichkeit und Unbeständigkeit geworden ist, so daß man es stets gefährlich gefunden hat, bei der Farbe stehn zu bleiben. Dieserwegen hat man sich in Acht zu nehmen, daß man den Farben in der Natur nicht zu viel Bedeutsamkeit beilege. Andererseits nun aber lehren uns die angeführten Beispiele, daß das Auge das empfindlichste Reagens, im chemischen Sinne, ist; indem es nicht nur die geringsten nachweisbaren, sondern sogar solche Veränderungen der Mischung, die kein anderes Reagens anzeigt, uns augenblicklich zu erkennen giebt. Auf dieser unvergleichlichen Empfindlichkeit des Auges beruht überhaupt die Möglichkeit der chemischen Farben, welche an sich selbst noch ganz unerklärt ist, während wir in die physischen, durch Goethe, die richtige Einsicht endlich erlangt haben; ungeachtet die vorgeschobene Neutonische falsche Theorie solche erschwerte. Die physischen Farben verhalten sich zu den chemischen ganz so, wie der durch den galvanischen Apparat hervorgebrachte und insofern aus seiner nächsten Ursache verständliche Magnetismus zu dem im Stahl und in den Eisenerzen fixirten. Jener giebt einen temporären Magneten, der nur durch eine Komplikation von Umständen besteht und, sobald sie wegfallen, es zu seyn aufhört: dieser hingegen ist einem Körper einverleibt, unveränderlich und bis jetzt unerklärt. Er ist hineingebannt, wie ein verzauberter Prinz: das Selbe nun gilt von der chemischen Farbe eines Körpers. Daher liefern uns ein anderes Gleichniß die Turmaline, in ihrem Verhältniß zu den Körpern, an welchen nur durch Reibung eine vorübergehende Elektricität sich hervorrufen läßt: denn wie die physischen Farben nur durch eine Kombination von Umständen hervortreten, die chemischen hingegen bloß der Beleuchtung bedürfen, um zu erscheinen; so bedürfen die Turmaline bloß der Erwärmung, um die ihnen jederzeit inwohnende Elektricität zu zeigen.
Eine allgemeine Erklärung der chemischen Farben scheint mir in Folgendem zu liegen. Licht und Wärme sind Metamorphosen von einander. Die Sonnenstrahlen sind kalt, so lange sie leuchten: erst wann sie, auf undurchsichtige Körper treffend, zu leuchten aufhören, verwandelt sich ihr Licht in Wärme; daher sie Dieses Saussüre'sche Experiment erwähnt Schelling »Weltseele« p. 38., durch eine dünne Eisplatte in einen innerlich verkohlten Kasten fallend, daselbst das Thermometer zu beträchtlichem Steigen bringen, ohne die Eisplatte zu schmelzen, ja, sogar ein aus Eis geschliffenes Brennglas zündet, ohne dabei selbst zu schmelzen; – welches nicht seyn könnte, wenn es ursprüngliche und unveränderliche, von den Lichtstrahlen verschiedene Wärmestrahlen gäbe, die jenen beigemischt von der Sonne ausgesandt würden, folglich schon als solche durch das Eis giengen, daher auch als solche wirken und es schmelzen müßten. (Eine über eine Pflanze gesetzte Glasglocke bringt einen hohen Grad von Wärme hervor, weil das Licht augenblicklich durchgeht und sich auf dem opaken Boden in Wärme verwandelt: dieser Wärme aber ist das Glas nicht so leicht permeabel, wie dem Lichte; daher häuft sie sich unter der Glocke an und erreicht einen hohen Grad.) Umgekehrt verwandelt die Wärme sich in Licht, beim Glühen der Steine, des Glases, der Metalle (auch in irrespirabeln Gasarten), und des Flußspathes sogar bei geringer Erwärmung. Die, nach Beschaffenheit eines Körpers, speciell modificirte Weise, wie er das auf ihn fallende Licht in Wärme verwandelt, ist, für unser Auge, seine chemische Farbe. Diese wird um so dunkler ausfallen, je leichter und vollkommener jener Umwandlungsproceß vor sich geht; daher schwarze Körper am leichtesten warm werden: Dies ist Alles, was wir von ihr wissen. Doch wird hieraus begreiflich, wie die verschiedenen Farben des prismatischen Spektrums die Körper verschiedentlich erwärmen: auch läßt sich absehn, wie eine bloß physische Farbe eine chemische hervorbringen kann, indem z. B. Chlorsilber durch freies, also weißes Sonnenlicht geschwärzt wird, sogar aber auch die Farben des prismatischen Spektrums annimmt, wenn es diesem längere Zeit hindurch ausgesetzt bleibt. Denn hier ist die entstehende chemische Farbe, für unser Auge, der Ausdruck der modificirten und dadurch geschwächten Weise, wie das Chlorsilber das Licht empfängt und in Wärme verwandelt, während der freie, unverkümmerte Hergang dieses Processes, bei weißem Licht, sich durch die schwarze Färbung kund giebt. – Wie Wärme und Licht Metamorphosen von einander sind; so ist eine andere Metamorphose der Wärme die Elektricität, wie der Seebeck'sche Thermoelektricismus beweist, wo Wismuth und Antimonium, wenn an einander gelöthet, die ihnen mitgetheilte Wärme sogleich in Elektricität verwandeln. In Licht verwandelt die Elektricität sich beim elektrischen Funken und beim Ausströhmen im luftleeren Raum, und in Wärme, wenn ihr Strohm im Elektroden gehemmt wird, wo dieser glüht und, wenn von Eisen, verbrennt. –
Die Richtigkeit der von mir aufgefundenen Zahlenbrüche, nach welchen, bei den sechs Hauptfarben, die Thätigkeit der Retina sich qualitativ theilt, ist, wie schon gesagt, eine augenfällige, bleibt aber Sache des unmittelbaren Urtheils und muß als selbstevident genommen werden; da sie zu beweisen schwer, vielleicht unmöglich ist. Doch will ich hier zwei Wege angeben, auf denen allenfalls ein Beweis zu finden seyn möchte. Man hat öfter eine genaue Bestimmung der Verhältnisse gesucht, in welchen die drei chemischen Grundfarben paarweise zu mischen sind, um genau die zwischen ihnen gerade in der Mitte liegende Farbe hervorzubringen. Namentlich haben Lichtenberg Anmerkungen zur Abhandlung de affinitate colorum, in oper. ined. Tobiae Mayeri, cura Lichtenberg.], Erxleben Physikalische Bibliothek, Bd. 1. St. 4. S. 403 ff. und Lambert Beschreibung einer Farbenpyramide. Berlin 1772. mit der Beantwortung dieser Frage sich beschäftigt. Allein sowohl die Bestimmung der eigentlichen Bedeutung des Problems, als eine wissenschaftliche und nicht lediglich empirische Auflösung desselben, ergiebt sich erst aus meiner Theorie. Ich muß jedoch die Bemerkung voranschicken, daß die zu diesen Versuchen anzuwendenden Pigmente absolut vollkommene Farben haben müssen, d. h. solche, welche 1) die ganze Thätigkeit des Auges theilen, ohne einen ungetheilten Rest zu lassen, die demnach frei von allem ihrem Wesen fremden Blaß oder Dunkel sind, also höchst brennende, energische Farben. 2) Solche Farben, die genau ⅓, ½ und ¾ der Thätigkeit des Auges sind, also vollkommenes Blau, Roth und Gelb, d. h. die drei chemischen Grundfarben in höchster Reinheit. Wenn man nun, mit solchen Farben operirend, z. B. aus Blau, welches 1/3 der vollen Thätigkeit ist, und Gelb, welches ¾ ist, Grün, welches ½ ist, zusammensetzen will; so muß die Menge des Blauen zu der des Gelben sich umgekehrt verhalten, wie die Differenz zwischen ⅓ und ½ zur Differenz zwischen ¾ und ½: denn, um so viel als die eine gegebene Farbe der zusammenzusetzenden näher liegt als die andere, um so viel mehr von ihr, und um so viel als die andere gegebene weiter von der zusammenzusetzenden liegt, um so viel weniger von ihr, muß man nehmen. Also drei Theile Blau und zwei Theile Gelb geben vollkommenes Grün. Man mische sie als trockne Pulver, damit die Pigmente nicht chemisch auf einander wirken, und dem Maaße, nicht dem Gewichte nach. Die an diesem Beispiel aufgestellte Regel gilt für jede Mischung solcher Art. Die genaue Uebereinstimmung des Resultats nun mit den von mir aufgestellten Zahlenverhältnissen der verschiedenen Hälften, in welche die Thätigkeit der Retina in den drei Hauptfarbenpaaren auseinandertritt, würde den Beweis für die Richtigkeit dieser liefern. Freilich aber bleibt das Urtheil, sowohl über die Richtigkeit des Resultats, als auch über die Vollkommenheit der zur Mischung genommenen Farben, immer der Empfindung überlassen. Diese wird aber nie bei Seite gesetzt werden können, wenn man von Farben redet. – Eine andere Art, den Beweis für die in Rede stehenden Zahlenbrüche zu führen, wäre folgende. Man verschaffe sich vollkommen schwarzen und vollkommen weißen Sand, und mische diese in sechs Verhältnissen, deren jedes einer der sechs Hauptfarben an Dunkelheit genau gleichkommt. Dann muß sich ergeben, daß das Verhältniß des schwarzen zum weißen Sande bei jeder Farbe dem derselben von mir beigelegten Zahlenbruche entspricht, also z. B. zu einem dem Gelben an Dunkelheit gleich kommenden Grau drei Theile weißen und ein Theil schwarzen Sandes genommen wäre, ein dem Violetten entsprechendes Grau hingegen die Mischung des Sandes gerade in umgekehrtem Verhältniß erfordert hätte; Grün und Roth hingegen von beiden gleich viel. Jedoch entsteht hiebei die Schwierigkeit, zu bestimmen, welches Grau jeder Farbe an Dunkelheit gleich kommt. Dies ließe sich dadurch entscheiden, daß man die Farbe, hart neben dem Grau, durch das Prisma betrachtete, um zu sehn, welches von Beiden sich bei der Refraktion als Helles zum Dunkeln verhält: sind sie hierin gleich, so muß die Refraktion keine Farbenerscheinung geben.
Zuvörderst will ich hier ein Paar artige Thatsachen beibringen, welche zur Bestätigung des Goethe'schen Grundsatzes der physischen Farben dienen, von ihm selbst aber nicht bemerkt worden sind.
Wenn man, in einem finstern Zimmer, die Elektricität des Konduktors in eine luftleere Glasröhre ausströhmen läßt; so erscheint dieses elektrische Licht sehr schön violett. Hier ist, eben wie bei den blauen Flammen, das Licht selbst zugleich das trübe Mittel: denn es ist kein wesentlicher Unterschied, ob das erleuchtete Trübe, durch welches man ins Dunkele sieht, eigenes oder reflektirtes Licht ins Auge wirft. Weil aber hier dies elektrische Licht ein überaus dünnes und schwaches ist, verursacht es, ganz nach Goethes Lehre, violett; statt daß auch die schwächste Flamme, wie die des Schwefels, Weingeistes u. s. w., schon blau verursacht.
Ein alltäglicher und vulgarer, aber von Goethen übersehener Beleg zu seiner Theorie ist, daß manche mit rothem Wein oder dunkelm Bier gefüllte Bouteillen, nachdem sie längere Zeit im Keller gelegen haben, oft eine beträchtliche Trübung des Glases, durch einen Ansatz im Innern, erleiden, in Folge welcher sie alsdann, bei auffallendem Lichte, blau erscheinen, und eben so, wenn man, nachdem sie ausgeleert sind, etwas Schwarzes dahinter hält: bei durchscheinendem Lichte hingegen zeigen sie die Farbe der Flüssigkeit, oder, wenn leer, des Glases.
Sogar aber ist die Farbe der blauen Augen keine chemische, sondern bloß eine physische, dem Goethe'schen Gesetze gemäß entstehende. Denn nach Magendie's Bericht über die Anatomie des Auges ( Précis élémentaire de physiologie, Vol. I., p. 60, 61, deuxième édition) ist die hintere Wand der Iris mit einer schwarzen Materie bekleidet, welche, bei braunen oder schwarzen Augen, unmittelbar durchscheint. Bei blauen Augen aber ist das Gewebe der Iris weißlich, – also trübe, – und die durchscheinende schwarze Unterlage bringt das Blau der Augen hervor. (Dans les yeux bleus le tissu de l'iris est à peu près blanc; c'est la couche noire postérieure, qui paraît à peu près seule et détermine la couleur des yeux.) Dies ist bestätigt von Helmholtz »über das Sehn des Menschen«, p. 8. – Eben so verhält es sich mit der blauen Farbe der Venen, als welche ebenfalls nur physisch ist: sie entsteht, indem das schwärzliche Venenblut durch die Wände des Gefäßes schimmert.
In kolossaler Größe aber giebt uns einen Beleg zum Goethe'schen Gesetz der neu entdeckte Planet Neptun. Nämlich die auf dem Observatorio des Collegium Romanum vom Pater Secchi angestellten und in den Comptes rendus vom 22. September 1856 mitgetheilten astronomischen Beobachtungen enthalten die bestimmt ausgesprochene Angabe, daß jener große Planet dunstförmig (nébuleux) sei und seine Farbe meerblau (couleur de mer bleuâtre). Natürlich! denn wir haben hier ein von der Sonne beleuchtetes Trübes, mit einem finstern Grunde hinter sich.
Die gefärbten Ringe, welche sich zeigen, wenn man zwei geschliffene Spiegelgläser, oder auch konvex geschliffene Gläser, mit den Fingern fest zusammenpreßt, erkläre ich mir auf folgende Weise. Das Glas hat eine beträchtliche Elasticität. Daher giebt, bei jener starken Compression, die Oberfläche etwas nach und wird eingedrückt: dadurch verliert sie, auf den Augenblick, die vollkommene Glätte und Ebenheit, wodurch dann eine gradweise zunehmende Trübung entsteht, derjenigen, welche mattgeschliffenes Glas zeigt, verwandt. Wir haben also auch hier ein trübes Mittel, und die verschiedenen Abstufungen seiner Trübung, bei theils auffallendem, theils durchgehendem Licht, verursachen die farbigen Ringe. Läßt man das Glas los, so stellt alsbald die Elasticität seinen vorigen Zustand wieder her, und die Ringe verschwinden. Etwas Spiritus über irgend ein geschliffenes Glas gewischt, giebt ganz eben solche Farben, nur nicht rund, sondern in Linien. Auf ganz analoge Weise verhält es sich mit den Seifenblasen, welche den Neuton zuerst zur Betrachtung der gefärbten Ringe veranlaßten. Das Seifenwasser ist ein trübes Mittel: auf der Seifenblase bald herabfließend, bald wieder sich seitwärts verbreitend, selbst in aufsteigender Richtung, bietet es dem Lichte abwechselnde, verschiedene Grade von Trübung dar, welche hier eben so die farbigen Ringe und ihren Wechsel verursachen. In der Revue des deux Mondes vom 1. Januar 1858 sagt Babinet, daß bei der Sonnenfinsterniß im März, da sie, beinahe total, nur 1/10 der Sonne übrig lassen wird, das durch eine enge Oeffnung einfallende Licht derselben, nicht wie sonst, einen Kreis, sondern eine Lünelle, ein schmales Mondsegment, gleich dem nach dem Neumond, an die Wand werfen wird. Dies bestätigt Goethes Farbenlehre, indem es beweist, daß, wie er lehrt, durch das foramen exiguum nicht ein Strahlenbündel einfällt, sondern ein kleines Bild der Sonne, welches sodann durch die Brechung verschoben wird.
Bei fast allen neu entdeckten Wahrheiten findet sich nachmals, daß schon früher eine Spur von ihnen dagewesen, etwas ihnen sehr Aehnliches gesagt, ja, wohl gar sie selbst geradezu ausgesprochen worden sind, ohne Beachtung zu finden, meistens weil der Aufsteller selbst ihren Werth nicht erkannt und ihren Folgenreichthum nicht begriffen hatte; welches ihn verhinderte, sie auszuführen. In dergleichen Fällen hatte man, wenngleich nicht die Pflanze, doch den Saamen gehabt.
So finden wir denn auch von Goethes Grundgesetz der physischen Farben, oder seinem Urphänomen, die Hälfte schon vom Aristoteles ausgesprochenen seinen Meteorologicis, III, 4: Φαινεται το λαμπρον δια του μελανος, η εν τῳ μελανι (διαφερει γαρ ουδεν), φοινικουν. ὁρᾳν δ' ἐξεστι το γε των χλωρων ξυλων πυρ, ὡς ερυθραν εχει την φλογα, δια το τῳ καπνῳ πολλῳ μεμιχθαι το πυρ, λαμπρον ον και λευκον· και δι' αχλυος και καπνου ὁ ἡλιος φαινεται φοινικους. [quodcunque fulgidum est, per atrum, aut in atro (nihil enim refert) puniceum apparet: videre enim licet ignem, e virentibus lignis conflatum, rubram flammam habere; propterea quod ignis, suapte natura fulgidus albusque, multo fumo admixtus est: quin etiam sol ipse per caliginem et fumum puniceus apparet.] Das Selbe wiederholt, mit beinahe den selben Worten und als Aristotelische Lehre, Stobäos (Eclog. phys. I, 31). Und die andere Hälfte des Goethe'schen Grundgesetzes hat schon Leonardo da Vinci in seinem trattato della pittura, CLI dargelegt. (Siehe: Brücke, über die Farben, welche trübe Medien im auffallenden und durchfallenden Lichte zeigen, 1852, p. 10.) Ich kann nicht umhin zu bemerken, daß von diesem fast allgemeinen Schicksal, welches den Fluch pereant qui ante nos nostra dixerunt hervorgerufen hat, meine Farbentheorie eine glückliche Ausnahme macht: denn nie und nirgends ist es, vor 1816, Jemanden eingefallen, die Farbe, diese so objektive Erscheinung, als die halbirte Thätigkeit der Retina zu betrachten und in diesem Sinn jeder einzelnen Farbe ihren bestimmten Zahlenbruch anzuweisen, der mit dem einer andern die Einheit ergänzt, welche das Weiße, die volle Thätigkeit der Retina, darstellt. Und doch sind diese Brüche so entschieden einleuchtend, daß Herr Prof. Rosas, indem er sie sich aneignen möchte, sie geradezu als selbst-evident einführt, in seinem »Handbuch der Augenheilkunde«, von 1830, Bd. 1, § 535, und auch S. 308. Ich darf also wohl mit Jordanus Brunus sagen:
Obductum tenuitque diu quod tempus avarum,
Mi liceat densis promere de tenebris.
Seit 1816 freilich hat Mancher es als seine eigene Waare einzuschwärzen gesucht, mich gar nicht, oder doch nur so beiläufig erwähnend, daß Keiner ein Arg daraus hat. –
Bloß in zwei Punkten nöthigt meine Theorie mich von Goethen abzuweichen, nämlich im Betreff der wahren Polarität der Farben, wie oben auseinandergesetzt, und hinsichtlich der Herstellung des Weißen aus Farben, welche letztere Goethe mir nie verziehn, jedoch auch nie, weder mündlich noch brieflich, nur irgend ein Argument dagegen vorgebracht hat.
Diese beiden Abweichungen von Goethe werden aber um so unbestochener und aus rein objektiven Gründen entsprungen erscheinen, als ich vom Werthe des Goethe'schen Werkes durchdrungen bin und es für vollkommen würdig achte, einen der größten Geister aller Zeiten zum Urheber zu haben. Allein selbst wenn sie von einem solchen stammt, kann eine neugeschaffene Lehre doch fast nicht ohne Wunder gleich bei ihrem Entstehn schon so vollendet seyn, daß nichts hinzuzusetzen, nichts zu berichtigen für die Nachfolger übrig bliebe. Wenn daher die von mir nachgewiesenen Unrichtigkeiten, wenn vielleicht noch andere in Goethes Werk enthalten sind; so ist dies unbeträchtlich gegen die Wahrheit des Ganzen, und wird als Fehler völlig ausgelöscht durch das große Verdienst, jenes, jetzt bald zwei Jahrhunderte hindurch verehrte und geglaubte, wunderliche Gemisch von Selbsttäuschung und absichtlichem Betruge in seiner Blöße gezeigt und zugleich eine im Ganzen richtige Darstellung des in Betrachtung genommenen Theils der Natur geliefert zu haben:
Μηδεν ἁμαρτειν εστιν θεων, και παντα κατορθουν· Εν βιοτῃ μοιραν δ' ουτι φυγειν επορον. Niemals zu fehlen ist Sache der Götter, und Alles zu treffen: Sterblichen ward nicht vergönnt, ihrem Geschick zu entgehn. Uns aber liegt ob, das Geleistete anzuerkennen, es dankbar und mit reinem Sinn aufzunehmen, und dann nach Kräften zu möglichster Vollkommenheit weiter zu bilden.
Hievon ist nun freilich bisher das Gegentheil geschehn. Goethes Farbenlehre hat eine nicht nur kalte, sondern entschieden ungünstige Aufnahme gefunden: ja sie ist (credite posteri!) gleich Anfangs förmlich durchgefallen, indem sie öffentlich, von allen Seiten und ohne eigentliche Opposition, das einstimmige Verdammungsurtheil der Leute vom Fach erfahren hat, auf deren Auktorität das übrige gebildete Publikum, schon durch Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit hiezu prädisponirt, sich der eigenen Prüfung sehr gern entübrigt; daher auch jetzt, nach 44 Jahren, es dabei sein Bewenden hat. So theilt denn dieses Werk Goethes mit manchen aus früheren Zeiten, denen ihr Gegenstand, nicht dessen Behandlung, höhern Rang giebt, die Ehre, nach seinem Auftreten viele Jahre hindurch fast unberührt gelegen zu haben; und noch am heutigen Tage ertönt Neuton's Theorie ungestört von allen Kathedern und wird in den Kompendien nach wie vor angestimmt.
Um dieses Schicksal der Goethe'schen Farbenlehre zu begreifen, darf man nicht außer Acht lassen, wie groß und wie verderblich der Einfluß ist, den auf die Wissenschaften, ja, auf alle geistige Leistungen, der Wille ausübt, d. h. die Neigungen, und noch eigentlicher zu reden, die schlechten, niedrigen Neigungen. In Deutschland, als dem Vaterlande jener wissenschaftlichen Leistung Goethes, ist ihr Schicksal am unverzeihlichsten. Den Engländern hat der Maler und Gallerie-Inspektor Eastlake, im J. 1840, eine so höchst vortreffliche Uebersetzung der Farbenlehre Goethes geliefert, daß sie das Original vollkommen wiedergiebt und dabei sich leichter liest, ja, leichter zu verstehn ist, als dieses. Da muß man sehn, wie Brewster, der sie in der Edinburgh review recensirt, sich dazu gebärdet, nämlich ungefähr so, wie eine Tigerin, in deren Höhle man dringt, ihr die Jungen zu entreißen. Ist etwan Dies der Ton der ruhigen und sichern bessern Ueberzeugung, dem Irrthum eines großen Mannes gegenüber? Es ist vielmehr der Ton des intellektuellen schlechten Gewissens, welches, mit Schrecken, das Recht auf der andern Seite spürt und nun entschlossen ist, die ohne Prüfung gedankenlos angenommene Scheinwissenschaft, durch deren Festhalten man sich bereits kompromittirt hat, jetzt als Nationaleigenthum πυξ και λαξ zu vertheidigen. Wird nun also, bei den Engländern, die Neutonische Farbenlehre als Nationalsache genommen; so wäre eine gute Französische Uebersetzung des Goethe'schen Werkes höchst wünschenswerth, denn von der Französischen Gelehrtenwelt, als einer insofern neutralen, wäre noch am Ersten Gerechtigkeit zu hoffen. Jedoch sehn wir auch sie durch ihre ganz auf der Homogenenlichtertheorie basirten Lehren von den Aethervibrationen, von der Thermochrose, Interferenz u. s. w., in dieser Sache tief kompromittirt; daher denn auch von ihrer Lehnspflichtigkeit gegen die Neutonische Farbenlehre belustigende Proben vorkommen. So z. B. erzählt im Journal des savans, April 1836, Biot mit Herzensbeifall, wie Arago gar pfiffige Experimente angestellt habe, um zu ermitteln, ob nicht etwan die 7 homogenen Lichter eine ungleiche Schnelligkeit der Fortpflanzung hätten; so daß von den veränderlichen Fixsternen, die bald näher bald ferner stehn, etwan das rothe, oder das violette Licht zuerst anlangte und daher der Stern successiv verschieden gefärbt erschiene: er hätte aber am Ende glücklich herausgebracht, daß Dem doch nicht so sei. Sancta simplicitas! – Recht artig macht es auch Herr Becquerel, der in einem Mémoire présenté à l'acad. des Sciences, le 13 Juin 1842, vor der Akademie, das alte Lied von Frischem anstimmt, als wäre es ein neues: si on réfracte un faisceau (!) de rayons solaires à travers un prisme, on distingue assez nettement (hier klopft das Gewissen an) sept sortes de couleurs, qui sont: le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo (diese Mischung von ¾ Schwarz mit ¼ Blau soll im Lichte stecken!) et le violet. Da Hr. Becquerel dieses Stück aus dem Neutonischen Credo 32 Jahre nach dem Erscheinen der Goethe'schen Farbenlehre noch so unbefangen und furchtlos herzusagen sich nicht entblödet; so könnte man sich versucht fühlen, ihm assez nettement zu deklariren: »Entweder ihr seid blind oder ihr lügt.« Allein man würde ihm doch Unrecht thun: denn es liegt bloß daran, daß Hr. Becquerel dem Neuton mehr glaubt, als seinen eigenen, zwei offenen Augen. Das wirkt die Neuton-Superstition. – Specielle Erwähnung verdient hier noch das große, zweibändige Kompendium der Physik (élémens de physique) von Pouillet, welches, auf Anordnung der Regierung, dem öffentlichen Unterricht in Frankreich zum Grunde gelegt wird. Da finden wir (Liv. VI. P. I. ch. 3) auf 20 großen Seiten die ganze Neutonische geoffenbarte Farbenlehre vorgetragen, mit der Sicherheit und Dreistigkeit, als wäre es ein Evangelium, und mit sämmtlichen Neutonischen Taschenspielerstückchen, nebst ihren Kautelen und Hinterlisten. Wer mit dem wahren Thatbestande und Zusammenhange der Sachen vertraut ist, wird dieses Kapitel nicht ohne große, wenn auch bisweilen durch Lachen unterbrochene, Indignation lesen, indem er sieht, wie das Falsche und Absurde der heranwachsenden Generation von Neuem aufgebunden wird, unter gänzlicher Verschweigung der Widerlegung, – eine kolossale ignoratio elenchi! – Das Empörendeste ist die Sorgfalt, mit der die bloß auf Täuschung berechneten und sonst völlig unmotivirten Nebenumstände beigebracht werden, worunter auch einige von späterer Erfindung sind: denn Dies verräth die fortdauernde Absichtlichkeit des Betruges. Z. E. § 392, Nr. 3 (edit. de Paris 1847) wird ein Versuch beschrieben, der darthun soll, daß durch Vereinigung der sieben angeblichen prismatischen Farben Weiß hergestellt werde: da wird nun eine pappene Scheibe, von 1 Fuß Durchmesser, mit zwei schwarzen Zonen bemalt, die eine rings um die Peripherie, die andere rings um das Centralloch: zwischen beiden Zonen werden, in der Richtung der Radien, die mit den sieben prismatischen Farben tingirten Papierstreifen, in vielmaliger Wiederholung, aufgeklebt, und jetzt wird die Scheibe in schnelle Wirbelung versetzt, wodurch nunmehr die Farbenzone weiß erscheinen soll. Von den beiden schwarzen Zonen aber wird mit keiner Silbe Rechenschaft gegeben, ist auch ehrlicherweise keine zu geben möglich, da sie ganz zweckwidrig die Farbenzone, welche allein zur Sache gehört, schmälern. Wozu also sind sie da? – Das würde Goethe euch sogleich sagen; in dessen Ermangelung nunmehr ich es muß: Damit der Kontrast und die physiologische Nachwirkung des Schwarzen das durch jene Farbenmischung allein hervorgebrachte »niederträchtige Grau« so hervorhebe, daß es für Weiß gelten könne. Mit solchen Taschenspielerstreichen also wird die Französische studierende Jugend düpirt, in majorem Neutoni gloriam. Denn schon vor der erklecklichen Verbesserung durch die zwei schwarzen Zonen, als welche neuere Erfindung ist, hat Goethe dieses Stück folgendermaaßen besungen:
Newtonisch Weiß den Kindern vorzuzeigen,
Die pädagog'schem Ernst sogleich sich neigen,
Trat einst ein Lehrer auf, mit Schwungrads Possen:
Auf selbem war ein Farbenkreis geschlossen.
Das dorlte nun. »Betracht' es mir genau!
Was siehst du, Knabe?« Nun, was seh' ich?
Grau?
»Du siehst nicht recht! Glaubst du, daß ich das leide?
Weiß, dummer Junge, Weiß! so sagt's Mollweide.«
Dieses verstockte Festhalten an der Neutonischen Farbenlehre, und somit an der ganz objektiven Existenz der Farbe, hat sich an den Physikern dadurch gerächt, daß es sie zu einer mechanischen, krassen, Cartesianischen, ja, Demokritischen Farbentheorie geführt hat, nach welcher die Farbe auf der Verschiedenheit der Schwingungen eines gewissen Aethers beruhen soll, mit welchem sie sehr vertraut umgehn und ganz dreist um sich werfen, der aber ein völlig hypothetisches, ja mythologisches und recht eigentlich aus der Luft gegriffenes Wesen ist. Vergl. Welt als Wille und Vorstellung, 3. Aufl. Bd. II. S. 358 fg. Denn daß, wenn er existirte, er vielleicht indirekt die Ursache der, in Hinsicht auf eine Berechnung angenommenen, Verfrühung eines Kometen gewesen seyn könnte, – wird doch wohl Keiner als einen Beweis seiner Existenz geltend machen wollen. (Gegen Enke's Erklärung der Beschleunigung seines Kometen aus dem Widerstand des Aethers hat sich gleich Anfangs Bessel erklärt und gesagt, man könne hundert Ursachen angeben, aus denen jene Beschleunigung sich eben so gut erklären ließe. Vergl. Comptes rendus, vom 6. Dezember 1858, p. 893.) Sie aber stellen jetzt getrost genaue Berechnungen der imaginären Längen der imaginären Schwingungen eines imaginären Aethers an: denn wenn sie nur Zahlen haben, sind sie zufrieden, und somit werden bemeldete Schwingungslängen in Milliontheilchen eines Millimeters vergnüglich berechnet; – wobei es eine belustigende Zugabe ist, daß sie die schnellsten Schwingungen der dunkelsten und unwirksamsten aller Farben, dem Violett, zutheilen; die langsamsten hingegen dem unser Auge so lebhaft afficirenden und selbst Thiere in Aufruhr versetzenden Roth. Aber, wie schon gesagt, für sie sind die Farben bloße Namen: sie sehn sie nicht an, sondern gehn ans Kalkuliren: das ist ihr Element, darin sie sich wohl befinden.
Uebrigens hat man sich nicht bloß vor der Theorie dieser modernen Neutonischen Chromatologen zu hüten, sondern wird wohlthun, auch bei den Thatsachen und Experimenten zwei Mal zuzusehn. Da sind z. B. die Frauenhofer'schen Linien, von denen so viel Wesens gemacht worden ist und angenommen wird, sie steckten im Lichte selbst, oder wären die Zwischenräume der gesonderten, äußerst zahlreichen, eigentlich homogenen Lichter, wären daher auch anders beschaffen, je nachdem es Licht der Sonne, der Venus, des Syrius, des Blitzes, oder einer Lampe sei. Ich habe, mit vortrefflichen Instrumenten, wiederholte Versuche, ganz nach Pouillet's Anweisung, gemacht, ohne sie je zu erhalten; so daß ich es aufgegeben hatte, als mir zufällig die deutsche Bearbeitung des Pouillet von I. Müller in die Hände fiel. Dieser ehrliche Deutsche sagt (2te Aufl. Bd. 1. S. 416) aus, was Pouillet weislich verschweigt, nämlich, daß die Linien nicht erscheinen, wenn nicht eine zweite Spalte unmittelbar vor dem Prisma angebracht wird. Dies hat mich in der Meinung, welche ich schon vorher hegte, bestätigt, daß nämlich die alleinige Ursache dieser Linien die Ränder der Spalte sind: ich wünsche daher, daß Jemand die Weitläuftigkeit nicht scheuen möge, ein Mal bogenförmige oder geschlängelte, oder fein gezahnte Spalten (aus Messing und mit Schrauben, wie die gebräuchlichen) verfertigen zu lassen; wo dann, höchst wahrscheinlich, die Frauenhofer'schen Linien, zum Skandal der gelehrten Welt, ihren wahren Ursprung durch ihre Gestalt verrathen werden, – wie ein im Ehebruche gezeugtes Kind, durch die Aehnlichkeit, seinen Vater. Ja, dies ist um so wahrscheinlicher, als es ein ganz gleiches Bewandniß hat mit dem von Pouillet (Bd. 2. § 365) angegebenen Experiment, durch ein kleines rundes Loch das Licht auf eine weiße Fläche fallen zu lassen, wo dann in dem sich darstellenden Lichtkreise eine Menge koncentrischer Ringe seyn sollen, die mir ebenfalls ausgeblieben sind und von denen eben so der ehrliche Müller uns (Bd. 1. § 218) eröffnet, daß ein zweites Loch, vor dem ersten angebracht, dazu erfordert ist, ja, hinzusetzt, daß wenn man, statt dieses Loches, eine feine Spalte anwendet, dann statt der koncentrischen Ringe parallele Streifen erscheinen. Da haben wir ja die Frauenhofer'schen Linien! Ich kann nicht umhin, zu wünschen, daß ein Mal ein guter und unbefangener Kopf, ganz unabhängig von der Neutonischen Theorie und den mythologischen Aetherschwingungen, die gesammten, von den französischen Optikern und dem Frauenhofer hoch angehäuften, so höchst komplicirten chromatischen Experimente, mit Inbegriff der sogenannten Lichtpolarisation und Interferenz, vornähme und den wahren Zusammenhang aller dieser Erscheinungen herauszufinden suchte. Denn mit der Vermehrung der Thatsachen hat die der Einsicht keineswegs gleichen Schritt gehalten, vielmehr hinkt diese erbärmlich hinterdrein. Und Dies ist sehr natürlich: denn die Erfahrung, zumal durch Anhäufung und Komplikation der Bedingungen, zu vermehren, ist Jeder tauglich; sie auszulegen Wenige und Seltene. Ueberhaupt haben die Physiker, zumal in unsern Tagen, sich durchgängig weniger um die Gründe, als um die Folgen der Naturpotenzen bekümmert, also um die Wirkungen, folglich Anwendungen derselben, z. B. um die Benutzung der Kraft elastischer Dünste zu Maschinen, Dampfschiffen und Lokomotiven, oder des Elektromagnetismus zu Telegraphen, des Achromatismus zu Fernröhren u. s. w. Dadurch eben erlangen sie Respekt beim Volke: aber was die Gründe betrifft, so hat es gute Wege, und da wird z. B. der letztgenannte noch immer über den Neutonischen Kamm geschoren, so wenig er dazu paßt, es mag biegen oder brechen.
Die Frauenhofer'schen Linien sollen, wenn das Spektrum vom elektrischen Lichte kommt, statt schwarz, glänzend seyn (siehe Pouillet). In einem Bericht darüber, » Sur la lumière électrique par Masson«, in den Comptes rendus de l'ac. d. sc., vom 16. April 1855, wird nach genauer Untersuchung angegeben, daß die Ursache dieser rayes brillantes die metallischen glühenden Partikeln der beim Schluß in Berührung stehenden Elektroden sind, welche von der Hitze losgerissen und vom elektrischen Strohm in die Höhe gerissen werden. Bringt man den elektrischen Funken unter Wasser hervor, so bleiben sie aus.
Ueber die Polarisation des Lichts haben die Franzosen nichts als unsinnige Theorien, aus der Undulation und der homogenen Lichter-Lehre, nebst Rechnungen, die sich auf nichts gründen. Stets sind sie eilig, nur zu messen und zu rechnen, halten es für die Hauptsache: le calcul! le calcul! ist ihr Feldgeschrei. Aber ich sage: où le calcul commence, l'intelligence des phénomènes cesse: während Einer bloße Zahlen und Zeichen im Kopfe hat, kann er nicht dem Kausalzusammenhang auf die Spur kommen. Das Wieviel und Wiegroß hat für praktische Zwecke Wichtigkeit: in der Theorie aber kommt es hauptsächlich und zunächst auf das Was an. Dies erlangt, kann man hinsichtlich des Wieviel und Wiegroß mit einer ungefähren Schätzung weit genug kommen.
Goethe wieder war zu alt, als die Phänomene entdeckt wurden, – fieng an zu radotiren.
Ich lege mir im Allgemeinen die Sache so aus. Die Reflexion des Lichts im Winkel von 35° zerlegt wirklich das Licht in zwei verschiedene Bestandtheile, davon der reflektirte besondere Eigenschaften zeigt, die aber alle darauf zurücklaufen, daß dieses Licht nunmehr, eines integrirenden Bestandtheils beraubt, sich schwach und schlaff, eben dadurch aber auch zur Erzeugung physischer Farben sehr geneigt zeigt: denn jede physische Farbe entsteht stets aus einer besondern Dämpfung, Schwächung des Lichts. Jene specifische Schwächung also zeigt es zunächst darin, daß es von den zwei Bildern des Isländischen Kalkspaths nur Eines liefert: das andere entstand also vermöge des andern, jetzt ausgeschiedenen Lichtbestandtheils. Sodann den schnell gekühlten Glaskubus kann es nicht ganz ausfüllen, verbreitet sich jedoch nicht gleichmäßig in demselben, sondern zieht sich zusammen, wodurch es einige Stellen erleuchtet und andere leer läßt, die dadurch schwarz erscheinen und in gewissen Lagen ein Kreuz bilden, eigentlich aber zwei biegsame, schwarze Banden darstellen, die, je nachdem man den Kubus dreht, ihn bald wellenförmig in allerlei Richtungen durchziehn, bald einen schwarzen Rand bilden und bloß, wann der Kubus seine Seite horizontal dem Auge zuwendet, in der Mitte, wie ein X, zusammenstoßen und so das Kreuz darstellen: jedoch ist, um dies Alles deutlich zu sehn, ein Parallelepipedon, und nicht der eigentliche Kubus, der geeigneteste Glaskörper. Die vier gelben Flecken in den Winkeln des Kreuzes lassen sich ebenfalls durch Drehn als Streifen am Rande vertheilen. Im Ganzen zeugen sie von der großen Neigung dieses, eines integrirenden Bestandtheils beraubten Lichtes, physische Farben zu erzeugen, unter welchen bekanntlich die gelbe am leichtesten entsteht. Besagte Neigung giebt sich nun in allerlei Phänomenen kund: Glimmer- oder Gypsspath-Blättchen auf den Kubus, oder auf einander gelegt, zeigen allerlei Farben. Die Neutonischen Ringe, welche, um durch Spiegelglas oder Linsen hervorgebracht zu werden, sonst stets eines gewissen Druckes bedürfen, entstehn im polarisirten Licht mit größter Leichtigkeit: besonders bringen zwei geschliffene Bergkrystallplatten sie ohne andern Druck, als den ihres eigenen Gewichts, in größter Schönheit und wundervoller Regelmäßigkeit hervor.
Das größte Wunder des polarisirten Lichtes liefert freilich das in eine Zange zwischen zwei Turmalinplatten eingeklemmte Stück Doppelspath, indem es ein, je nach der Lage schwarzes, oder weißes Kreuz, umgeben von einer Gloria Neutonischer Ringe, sehn läßt. Daß nämlich der Doppelspath das Licht ebenfalls (wie die Reflexion im Winkel von 35°) polarisirt, scheint gewiß. Dies Wunder muß also doch aus obigen Principien abzuleiten seyn. –
Die schwere Ungerechtigkeit, welche Goethe hinsichtlich seiner Farbenlehre hat erleiden müssen, hat gar mancherlei Ursachen, welche alle aufzuzählen so schonungslos, wie unerquicklich wäre. Eine derselben aber können wir in Horazens Worten aussprechen:
turpe putant, quae
imberbi didicere, senes perdenda faleri.
Das selbe Schicksal ist jedoch, wie die Geschichte aller Wissenschaften bezeugt, jeder bedeutenden Entdeckung, so lange sie neu war, zu Theil geworden und ist etwas, darüber sich die Wenigen nicht wundern werden, welchen die Einsicht geworden ist, »daß das Treffliche selten gefunden, seltner geschätzt wird«, und »daß das Absurde eigentlich die Welt erfüllt«. Inzwischen wird auch für Goethes Farbenlehre der Tag der Gerechtigkeit nicht ausbleiben; und dann wird abermals ein Ausspruch des Helvetius sich bestätigen: le mérite est comme la poudre: son explosion est d'autant plus forte, qu'elle est plus comprimée (de l'espr. disc. II. ch. 10), und wird sodann das in der Litterargeschichte schon so oft wiederholte Schauspiel von Neuem aufgeführt und zum Schluß gelangt seyn.
Aber der Nachkomme, der eine Nachkomme aus Millionen, welcher sich der Kraft bewußt seyn wird, in Kunst oder Wissenschaft etwas Eigenthümliches, Neues, Außerordentliches hervorzubringen, und der daher in der Kunst wahrscheinlich mit irgend einer alten Weise, in der Wissenschaft aber gewiß mit irgend einem alten Wahn in Opposition tritt, möge dereinst doch dieser, bevor er sein Werk den Zeitgenossen hingiebt, sich mit der Geschichte der Farbenlehre Goethes bekannt machen: er lerne aus den Optics, die dann nur noch als Material der Litterargeschichte in den Bibliotheken ruhen werden, das alsdann schon längst in keinem Kopfe mehr spukende Neutonische Gespenst kennen: er lese darauf Goethes Farbenlehre selbst, deren Hauptinhalt, kurz und bündig, ihm schon auf der Schule eingeprägt seyn wird: endlich auch lese er von den Dokumenten der Aufnahme des Goethe'schen Werkes so viel, als die Würmer übrig gelassen haben werden und sein Gleichmuth erträgt: er vergleiche nunmehr den handgreiflichen Trug, die taschenspielerischen Versuche der Neutonischen Optics, mit den so einfachen, so leicht faßlichen, so unverkennbaren Wahrheiten, die Goethe vortrug: er bedenke endlich, daß Goethe mit seinem Werke zu einer Zeit aufgetreten ist, wo der wohlverdiente Lorbeer sein ehrwürdiges Haupt kränzte und er, wenigstens bei den Edelsten seiner Zeit, einen Ruhm, eine Verehrung erlangt hatte, die seinem Verdienst und seiner Geistesgröße doch einigermaaßen entsprachen, wo er also der allgemeinen Aufmerksamkeit gewiß war: – und dann sehe er, wie wenig, wie so gar nichts Alles dieses vermochte gegen jene Sinnesart, die nun ein Mal dem Menschengeschlecht im Allgemeinen eigen ist. Nach dieser Betrachtung ziehe er nicht etwan die Hände zurück; sondern vollende sein Werk, weil diese Arbeit die Blüthe seines Lebens ist, die zur Frucht gedeihen will: er gebe es hin; aber wissend wem, und gefaßt.