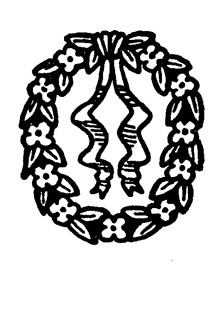|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
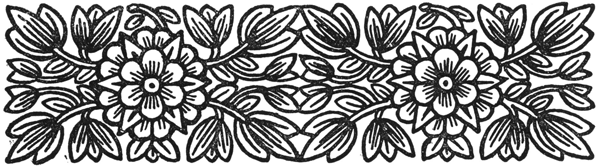
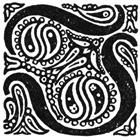 In Cypern liegt eine Stadt, genannt Famagusta, darin wohnte ein edler Bürger alten, löblichen Herkommens, genannt Theodorus: dem hatten seine Eltern groß Gut hinterlassen, also daß er reich und mächtig war. Dabei war er jung, eines fröhlichen Muts und bedachte wenig, wie seine Eltern zuzeiten das Ihre gespart und gemehrt hatten. Sein Gemüt war ganz und gar auf zeitliche Ehre, Freude und Wollust des Leibes gerichtet, er führte einen königlichen Staat mit stechen, turnieren, dem König zu Hof reiten und vertat damit großes Gut. Das verdroß seine Freunde und Verwandten: darum gedachten sie ihm ein Weib zu geben, ob sie ihn damit von solchem bösen Leben ziehen möchten, und schlugen ihm das vor. Es gefiel ihm wohl, und er verhieß, ihnen darin zu folgen.
In Cypern liegt eine Stadt, genannt Famagusta, darin wohnte ein edler Bürger alten, löblichen Herkommens, genannt Theodorus: dem hatten seine Eltern groß Gut hinterlassen, also daß er reich und mächtig war. Dabei war er jung, eines fröhlichen Muts und bedachte wenig, wie seine Eltern zuzeiten das Ihre gespart und gemehrt hatten. Sein Gemüt war ganz und gar auf zeitliche Ehre, Freude und Wollust des Leibes gerichtet, er führte einen königlichen Staat mit stechen, turnieren, dem König zu Hof reiten und vertat damit großes Gut. Das verdroß seine Freunde und Verwandten: darum gedachten sie ihm ein Weib zu geben, ob sie ihn damit von solchem bösen Leben ziehen möchten, und schlugen ihm das vor. Es gefiel ihm wohl, und er verhieß, ihnen darin zu folgen.
Und als er sich in ihren Willen gegeben, fingen die Freunde an, für ihn nachzufragen um ein Gemahl. Es war aber ein edler Bürger in der Stadt Nicosia, der Hauptstadt in Cypern, da die Könige gemeiniglich Hof hielten Nikosia, sonst auch Leukosia, jetzt und in alter Zeit die Hauptstadt Cyperns, liegt im Innern der Insel in einer Ebene am Pedias. Famagusta ist eine Hafenstadt an dem großen Meerbusen der Ostküste, heute ein unbedeutender Platz voller Ruinen, zur Zeit der Kämpfe zwischen Christen und Sarazenen ein Hauptwaffenplatz. Cypern wurde auf dem dritten Kreuzzuge von dem englischen Könige Richard Löwenherz erobert und dem französischen Grafen von Lusignan zu Lehen gegeben. (Vergl. Band 48 dieser Folge: »Die schöne Melusine«.) Die Lusignans herrschten hier als Könige bis 1475. Ihnen folgten noch für ein Jahrhundert die Venediger.: der hatte eine schöne Tochter, geheißen Gratiana: die ward ihm verlobt und nicht weiter nachgefragt, was er für ein Mann wäre. Sondern weil er im Rufe stand, so reich und mächtig zu sein, ward ihm die Jungfrau heimgeführt. Er richtete eine köstliche Hochzeit an, wie denn Gewohnheit ist, daß reiche Leute zu solcher Zeit Reichtum und Herrlichkeit beweisen. Als nun die Hochzeit vollbracht war, und jedermann an seine Ruhe ging, nahm Theodorus die Jungfrau und lebte mit ihr freundlich und tugendlich, woran die Verwandten der Frau Wohlgefallen hatten und meinten, sie hätten ein gut Werk vollbracht, daß sie Theodorus, der so wild war, mit einem Weibe also zahm gemacht hatten; jedoch war ihnen unkund, daß der Natur nicht wohl zu widerstreben sei. Indem empfing Gratiana einen Sohn und gebar ihn, ehe das Jahr nach der Hochzeit zuende war, worüber die Verwandten beider Teile erfreut waren. Der Sohn ward getauft und Fortunatus geheißen. Und wiewohl Theodorus auch freudig war, so fing er doch sein altes Wesen wieder an mit stechen, turnieren, vielen Knechten und köstlichen Rossen und ritt dem König zu, ließ Weib und Kind, fragte nicht wie es ging, verkaufte heut ein Gut und morgen ein anderes: das trieb er lang und viel, bis er nichts mehr zu verkaufen noch zu versetzen hatte, und kam also in Armut, verzehrte seine jungen Tage unnützlich und war so arm, daß er weder Knecht noch Magd halten mochte, und mußte die gute Frau Gratiana als ein armes Weib selber kochen und waschen.
Und als sie nun einmal zu Tisch saßen und essen wollten, hätten sie gern wohlgelebt, wenn sie es gehabt hätten. Da sah der Vater den Sohn gar ernstlich an und seufzte von Grund seines Herzens. Das ersah der Sohn, der nun bei achtzehn Jahr alt war und nichts konnte als lesen und seinen Namen schreiben! Doch verstand er wohl mit Federspiel und anderm Waidwerk Man richtete Falken, Weihe, Sperber und andere Stoßvögel ab zur Jagd auf Vögel und kleines Gewild. Der Jäger trug den Jagdvogel (Federspiel) auf der beschuhten Hand. Wenn sich ein Wild zeigte, nahm er ihm die Kappe vom Kopfe und warf ihn auf. Der schwang sich dann in die Höhe und stieß auf das Wild (Reiher, Ente, Hase), wenn er es eräugt hatte, und brachte es dem Jäger. Diese vornehme Art der Jagd wurde Beize genannt und war besonders in Südeuropa heimisch. Die Höfe hielten zur Pflege und Abrichtung der Federspiele besonders geübte Diener, Falkner geheißen. Unter anderm Waidwerk ist wohl die Jagd mit Hatz- und Spürhunden zu verstehen. umzugehen, das denn auch seine Kurzweil war; der fing an und sprach zu dem Vater: O mein lieber Vater, was liegt dir an? Ich habe gar wohl an dir gemerkt, wenn du mich ansiehst, daß du betrübt wirst; darum so bitt ich dich, lieber Vater, sage mir, hab ich dich irgend erzürnt, das laß mich wissen, denn ich bin willens, ganz nach deinem Willen zu leben. Der Vater antwortete: O lieber Sohn, darum ich traure, daran hast du keine Schuld, ich kann auch niemand beschuldigen als mich selbst. Wenn ich gedenke, wie großes Gut ich besessen habe, und wie unnützerweise ich dessen ledig geworden bin, das doch meine Vorfahren so getreulich erspart hatten, und wenn ich dich dann ansehe und gedenke, daß ich dir weder raten noch helfen kann, so hab ich groß Herzeleid und Tag und Nacht keine Ruhe. Dazu sehe ich, wie mich alle die verlassen, mit denen ich mein Gut so mildiglich geteilt habe: denen bin ich jetzt ein unwerter Gast.
Darauf antwortete Fortunatus: O allerliebster Vater, laß ab von deinem Trauern und sorge nicht für mich: ich bin jung, stark und gesund, ich will gehen in fremdes Land und dienen, es ist noch viel Glück in der Welt, ich hoffe zu Gott, mir wird dessen auch noch ein Teil. Du aber hast einen gnädigen Herrn an unserm Könige, dem mache dich unterwürfig und diene ihm, so verläßt er dich und meine Mutter nicht bis an euer Ende. Für mich sorge nicht, ich bin erzogen, wofür ich euch großen Dank sage. Hiermit stand er auf, und ging mit einem Federspiel, so er hatte, aus dem Hause ans Meer und gedachte, was er anfahen sollte, daß er nicht mehr zu seinem Vater käme, damit er sich nicht über ihn betrübe. Und als er an dem Meer hin und her ging, da lag im Hafen eine Venediger Galeere Nach dem Abflauen der Kreuzzüge, im 14. und 15. Jahrhundert, entstand zwischen Südeuropa und dem Morgenlande ein reger Handels- und Reiseverkehr, der vornehmlich durch die Flotten der Venediger vermittelt wurde. Galeeren hießen die Kriegsschiffe auf dem Mittelmeer bis ins 18. Jahrh. Sie waren lang und schmal gebaut, mit langen Ruderbänken, die mit Sträflingen und Gefangenen bemannt wurden. Dazu führten sie zwei dreieckige Segel und vorn und hinten Aufbauten für die Stücke und Soldaten., welche Pilger nach Jerusalem gebracht hatte; auf der war ein Graf von Flandern Die niederdeutsche Küstenlandschaft Flandern gehört jetzt zu Belgien, Holland und Frankreich; sie war im neunten Jahrhundert als eine Markgrafschaft des deutschen Reichs gegen die Normannen gegründet. Der Graf von Flandern war später zugleich Lehenträger der deutschen und der französischen Krone. Die fruchtbare Landschaft mit ihren reichen Städten, wie Gent und Brügge, kam 1384 an Philipp den Kühnen von Burgund und 1477 an Maximilian von Habsburg. Nach mannigfaltigem Wechsel wurde die Landschaft 1815 so geteilt, wie oben angegeben. Die Bewohner, Flamen oder Vlämen, sprechen einen niederdeutschen Dialekt., dem waren zwei Knechte gestorben. Und als der Graf keine Geschäfte mehr bei dem König hatte und der Schiffpatron fertig war und man zur Abfahrt blies, ging der Graf und viel andere Edelleute mit ihm zuschiffe: das sah der betrübte Fortunatus und gedachte: O möchte ich ein Knecht dieses Herrn werden und fahren mit ihm so weit, daß ich nicht mehr nach Cypern käme! Ging also dem Grafen entgegen und begrüßte ihn gar artig, daran der Graf wohl merkte, daß es keines Bauern Sohn wäre, und hub an und sprach: Gnädiger Herr, ich habe vernommen, daß euch Knechte abgegangen sind. Bedarf Euer Gnaden nicht eines andern? Der Graf fragte: Was kannst du? Er antwortete: Ich kann jagen und beizen, und was zum Waidwerk gehört; dazu einen reisigen Knecht Reisige Knechte oder Reisige nannte man die mit Helm, Panzer, Schild und Lanze schwerbewaffneten Reiter der mittelalterlichen Heere. Sie waren nicht Ritter oder Standesherren, sondern nahmen für Sold oder als Dienstleute an der Kriegsfahrt teil. vorstellen, wenn es vonnöten ist. Der Graf sagte: Du wärst mir schon recht; aber ich bin von fernen Landen und fürchte, du ziehst nicht so fern von deiner Heimat. Fortunatus antwortete: O gnädiger Herr, Ihr könnt nicht so fern ziehen, daß ich nicht wollte, es wär noch viermal so fern. Der Graf sprach: Was muß ich dir zu Lohn geben? Fortunatus sprach: Gnädiger Herr, ich begehre keinen Lohn: darnach ich diene, darnach lohnet mir. Dem Grafen gefielen die Worte des Jungen wohl und er sprach: Die Galeere will gleich abgehen, bist du fertig? Er sagte: Ja Herr, und warf das Federspiel, so er in der Hand hatte, in die Luft, ließ es fliegen und ging ungesegnet und ohne Urlaub von Vater und Mutter mit dem Grafen als ein Knecht in die Galeere, fuhr also vom Lande und hatte wenig bar Geld bei sich, kam aber in kurzer Zeit mit gutem Glück gen Venedig.
Und als sie gen Venedig kamen, hatte der Graf schon zuvor alle Herrlichkeit daselbst gesehen, darum ihn nicht mehr gelüstete, länger dazubleiben: seine Begierde stand nach seiner Heimat und zu seinen guten Freunden, wie er denn auch willens war, so ihm Gott vom heiligen Land wieder heim hülfe, ein Gemahl zu nehmen, eines Herzogs Tochter von Cleve, die schön und jung war; und es war alles auf seine Wiederkunft verabredet: desto größer war sein Verlangen nach hause. Er rüstete sich also zur Reise, ließ Pferde kaufen, kaufte auch zu Venedig schöne Kleinode von Sammet und Gold und was sonst zu einer köstlichen Hochzeit gehört. Wiewohl er viel Knechte hatte, so konnte doch keiner Welsch (Italienisch) wie Fortunatus, und der war auch geschickt zum Kaufen und Reden. Darob hatte der Graf ein groß Wohlgefallen und gewann ihn lieb: das merkte Fortunatus und befliß sich, seinem Herrn je länger je besser zu dienen. Er war allezeit der letzte und am Morgen der erste bei ihm, das merkte der Herr. Und als man nun dem Grafen viele Rosse gekauft hatte, darunter etliche schlimm waren, da hielt der Graf eine Musterung darüber, verteilte sie unter seine Diener und gab Fortunatus eins von den besten. Daß verdroß die anderen Knechte. Da fingen sie an ihn zu hassen und sprach einer zu dem andern: Seht an, hat uns der Teufel mit dem Welschen betrogen. Nicht desto minder mußten sie ihm mit seinem Herrn reiten lassen, und durfte ihn keiner beim Grafen verklagen oder verunglimpfen. Der Graf kam also mit Freuden heim und ward herrlich empfangen von allem seinem Volk, denn sie hatten ihn gar lieb, und er war ein frommer Graf, der seine Untertanen auch lieb hatte. Als er nun in sein Land gekommen war, da kamen seine Nachbarn und guten Freunde, die empfingen ihn gar schön und lobten Gott, daß er so eine gottselige Reise vollbracht hätte, fingen auch an von dem Verlöbnis zu sprechen: damit war er gar wohl zufrieden und bat und begehrte nur, daß die Sache vor sich ginge, was auch in kurzen Tagen geschah. Da ward ihm des Herzogs Tochter von Cleve vermählt und eine große und köstliche Hochzeit gehalten, wovon viel zu schreiben wäre, denn es kamen viel Fürsten und Herren dazu. Da ward gestochen, turniert, scharf gerannt und ander Ritterspiel getrieben vor den schönen und edeln Frauen. Wie viel aber die Fürsten und Herren edeler Knechte oder andrer Diener mit sich auf die Hochzeit gebracht hatten, so war doch keiner unter ihnen, dessen Dienst und Wesen Frauen und Männern besser gefiel denn Fortunatus. Sie fragten den Grafen, von wannen ihm der höfliche Diener käme. Er sagte ihnen, wie er zu ihm gekommen wäre auf der Heimfahrt von Jerusalem, und sagte, wie er ein so guter Jäger wäre: die Vögel in der Luft und die Tiere in den Wäldern wären nicht vor ihm sicher, zudem könnte er sonst wohl dienen und jedermann behandeln, nachdem er wäre. Durch solches Lob, so ihm sein Herr gab, ward ihm viel geschenkt von Fürsten und Herren und von edeln Frauen.
Als nun die Fürsten und Herren gestochen hatten, ward der Herzog von Cleve und der Graf, sein Tochtermann, zurate, sie wollten den Dienern der Herren, so auf der Hochzeit wären, zwei Kleinode, bei zweihundert Kronen wert, ausstellen: darum sollten sie zwei Tage stechen; und die achtzig Diener sollten sich in vier Rotten von zwanzig teilen und jeden Tag zwei Rotten gegeneinander stechen, und wer das beste täte, der sollte der Kleinode eins haben. Des waren die Diener froh, und jeder verhoffte das beste zu tun. Als sie nun den ersten Tagen stachen, zwanzig gegen zwanzig, da gewann den Preis ein Diener des Herzogs von Brabant; und als sie den andern Tag stachen, da gewann Fortunatus den Preis. Das mißfiel den meisten der Diener, und sie baten alle den Timotheus, der das Kleinod gewonnen hatte, daß er den Fortunatus herausfordere, mit ihm zu stechen, und ihm sein Kleinod gegen das seine setze! Timotheus konnte die Bitte seinen guten Gesellen nicht wohl abschlagen und entbot dem Fortunatus, daß er sein Kleinod gegen das seine setzen wollte und mit ihm darum stechen vor den Frauen und Jungfrauen, und welcher das beste täte, der sollte die Kleinode beide haben. Da Fortunatus das vernahm, bedachte er sich nicht lange, wiewohl er zuvor nie gestochen hatte, und sagte ihm das zu. Die Mär kam vor die Herren, daß Timotheus und Fortunatus miteinander stechen wollten um ihr Kleinod; das hörten sie gern. Also rüsteten sie sich gleich und kamen auf den Plan, ritten männlich aneinander, und hätte jeder gern das beste getan; doch im vierten Ritt rannte Fortunatus den Timotheus hinter seinen Gaul, eine Lanze lang, und gewann die zwei Kleinode, die wohl zweihundert Kronen wert waren. Da erhub sich erst ein großer Neid und Haß, allermeist aber unter des Grafen von Flandern Dienern. Aber der Graf sah gern, daß seiner Diener einer die Kleinode gewonnen hatte, wußte nichts um den Unwillen, so seine Diener gegen Fortunatus hatten, auch wagte es keiner dem Grafen zu sagen.
Nun war ein listiger Fuchs namens Rupert, der sprach, hätt er zehn Kronen bar, so wollt er sich unterstehen, den Welschen dazu zu bringen, daß er von freien Stücken eilends hinwegreite ohne Urlaub seines Herrn; auch wollt er es so anstellen, daß keiner von ihnen deshalb in Verdacht käme. Sie sprachen alle zu ihm: O lieber Rupert, kannst du das, warum feierst du denn? Er sprach: Ich kann es ohne Geld nicht zuwege bringen: gebt mir ein jeder eine halbe Krone, und bringe ich ihn nicht von Hof, so will ich einem jeden eine ganze Krone dafür geben. Sie waren alle willig, und wer sie nicht bar hatte, dem liehen die andern, also daß sie fünfzehn Kronen zusammenbrachten, und gaben sie dem Rupert. Da sprach er: Nun rede mir niemand dazwischen und tue jedermann wie zuvor in allen Dingen. Also gesellte sich Rupert zu Fortunatus, war gar freundlich mit ihm und sagte ihm alle Geschichten, die im Lande geschehen waren: das hörte Fortunatus gern; auch fing er an, ihn zu lustigen Gesellen zu führen, und wo sie also hinkamen, sandte Rupert allemal aus nach Wein und anderm Geschlecke, lobte ihn sehr, wie er so reich und edel wäre, was Fortunatus wohl leiden mochte. Doch wollte Fortunatus allweg auch Geld geben; Rupert aber wollte nichts haben und sagte, er wäre ihm lieber denn keiner seiner Brüder, und was er hätte, das gönnte er ihm: solche gute Worte gab er ihm viel. Diese Gesellschaft trieben sie lang, daß es die andern Diener verdroß und sie sprachen: Meinet Rupert, den Fortunatus mit solchem Leben wegzubringen? Ja wäre er jenseits des Meeres in Cypern und wüßte solches Leben hier, er sorgte, daß er bald herkäme. Fürwahr, tut Rupert nicht, was er uns verheißen, er muß uns dreißig Kronen geben und wär es sein letzter Heller. Das erfuhr Rupert, spottete seiner Gesellen, und sprach: Ich weiß mir sonst keinen Tag mehr zu machen als mit euerm Geld.
Doch, als sie das Geld gar verzehrt hatten, eines Abends spät, da sich der Graf mit seinem Gemahl zur Ruhe begeben und niemand auf den Dienst zu warten brauchte, kam Rupert zu Fortunatus in seine Schlafkammer und sagte: Mir ist etwas insgeheim gesagt worden, von meines Herrn Kanzler, der mein besonders guter Freund ist; und wiewohl er es mir hoch und teuer, so lieb mir seine Freundschaft sei, verboten hat, so kann ich es doch dir, als meinem guten Gönner, nicht verhalten. Denn es ist ein Handel, der dich auch betreffen möchte. Und dies ist die Sache: Da, wie du weißt, unser Herr und Graf sich ein edles und schönes Gemahl genommen, sie dazu viel schöner Frauen und Jungfrauen in ihrem Frauenzimmer hat, so ist ihm die Furcht gekommen, die möchten mit den jungen Kämmerlingen, die ihnen aufwarten, Liebeshändel anfangen. Denn wiewohl er verhofft, daß sie ehrsam seien und nichts Ungebührliches tun möchten, weiß er doch, daß es ein blind Ding um die Liebe ist und sie zwei Menschen zusammen bringt, sie mögen wollen oder nicht, und niemand sie scheiden kann als allein der Tod. Dieweil nun unser Herr bei seinen Reisen bei den Türken und Mohren gesehen hat, wie die Herren – so auch viel Frauen in ihren Häusern halten – verschnittene Diener in das Frauenhaus legen, so hat ihm solcher Gebrauch gar wohl gefallen und ist ihm in den Sinn gekommen, darnach sich zu halten. Und wenn er morgen nach Löwen in Brabant reitet, wo er mit einem andern Grafen zu rechten hat, (und dort ein gar geschickter Meister wohnt) will er da die vier Frauendiener verschneiden lassen – es sei ihnen lieb oder leid – und sie alsdann wieder in das Frauenzimmer tun und den Frauen dienen lassen wie zuvor. Denn so, meint er, würde die Liebe keinen Eingang finden und er Ruhe haben in seinem Frauenzimmer.
Und da Fortunatus die Worte vernahm, erschrak er darüber sehr und fragte ihn, ob er nirgend einen Ausgang aus der Stadt wüßte. Er wollte ihn bitten, daß er ihm den wiese, so wollte er von Stund an hinweg und seines Herrn Vornehmen nicht erwarten. Und gäb er mir all sein Gut und könnte mich zum König in Engelland machen, so will ich ihm keinen Tag mehr dienen. Darum, lieber Rupert, hilf und rat, daß ich hinweg komme. Rupert sprach: Wisse, lieber Fortunatus, die Stadt ist aller Orten verschlossen, und niemand kann aus- und einkommen bis morgen früh, so man Messe läutet, da schleußt man das Tor Porte de Vache, das ist die Kühpforte, am frühesten auf. Aber, lieber Fortunatus, wenn es um mich eine solche Gestalt hätte, als um dich, so wollte ich mich dessen nicht weigern, denn du wärst ein gemachter Junker dein Lebtag, und ich wollte, daß man mich zu solchem bestimmte, wollte mich gar nicht bedenken, mich willig darein zu ergeben. Fortunatus sprach: Ich wollte eher betteln gehen und keine Nacht liegen, da ich die andere gelegen. Rupert sprach: Mir ist leid, daß ich dir diese Dinge geoffenbart habe, da ich sehe, daß du darum hinwegwillst, denn ich habe all mein Hoffen auf dich gehabt, daß wir als Brüder miteinander leben und unsre Zeit vertreiben wollten. Da du aber von hinnen willst, so laß mich doch durch Briefe wissen, wo du dein Wesen haben wirst. So dann unser Herr sein Frauenhaus versehen hat, wollt ich dir schreiben, so möchtest du wiederkommen, denn mir zweifelt nicht, du hast allweg einen gnädigen Herrn. Fortunatus antwortete gar schnell: Du sollst mir weder schreiben noch entbieten, denn dieweil ich lebe, so komm ich an den Hof nicht mehr; auch sollst du nicht offenbaren, daß ich also davon geritten bin, ich sei denn zuvor drei Tage hinweg gewesen. Das verhieß ihm Rupert, nahm also Urlaub von ihm und stellte sich gar kläglich an, als ob es ihm gar leid wäre, und gesegnete ihn mit dem ganzen himmlischen Heer. O, was guter Worte gingen da aus einem falschen Herzen: Judas wäre da ein frommer Mann gewesen. Es war nun um Mitternacht, da gemeiniglich jedermann schläft; aber Fortunatus kam kein Schlaf in seine Augen, ihn gedeuchte jede Stunde eines Tages lang, denn er besorgte, der Graf würde es inne, daß er hinweg wollte, und ließe ihn fangen. Er erwartete mit Angst und Not, bis der Tag anbrach, da war er auf, gestiefelt und gespornt, nahm sein Federspiel und Hund, als ob er auf die Jagd reiten wollte, und ritt hinweg und eilte so sehr, und wär ihm ein Aug entfallen, so hätte er es nicht aufgehoben.
Und als er bei zehn Meilen geritten war, da kaufte er ein ander Pferd, saß darauf und ritt eilends weiter; doch sandte er dem Grafen sein Roß, Hund und Federspiel alles wieder heim, daß er nicht Ursach hätte ihm nachzusenden. Da nun der Graf erfuhr, daß Fortunatus hinweg war ohne Urlaub, da er ihm doch nichts Böses bewiesen, auch ihm noch keinen Sold gegeben hatte, nahm es ihn Wunder, fragte darum die Diener alle und jeglichen insbesondere, ob keiner wüßte, was doch die Ursach wäre seines Entweichens: sie sagten alle, sie wüßten es nicht, und schwuren, sie hätten ihm kein Leid getan. Der Graf ging selber zu seinem Gemahl in das Frauenzimmer und fragte sie, ob ihm jemand Verdruß hätte getan. Aber niemand wußte, was die Ursach seines Hinwegscheidens wäre. Sein Gemahl und ihre Frauen sagten, daß ihm nie ein Leid geschehen wäre, weder mit Worten noch mit Werken, denn am Abend, als er von ihnen gegangen, war er fröhlicher gewesen als je, hätte ihnen von seinem Land gesagt und wie die Frauen da gekleidet gingen, und von andern Sitten und Gewohnheiten, und das mit so bösem Deutsch, daß sie das Lachen nicht hätten verbergen können. Und da er uns lachen sah, fing er auch an zu lachen, und mit lachendem Mund ist er von uns geschieden. Der Graf sprach: Kann ich jetzt nicht inne werden, warum er hinweg ist, so werde ich es hernach inne, und fürwahr, werde ich es inne, daß etwa einer der Meinen Ursache seines Hinwegscheidens ist, er soll es entgelten, denn ohne Ursache ist er nicht von hinnen geschieden: ich weiß, daß er bei fünfhundert Kronen verdienen konnte, während er hie gewesen ist, und ich hätte gemeint, er sollte sein Lebtag nicht hinweg begehrt haben. Ich sehe aber wohl, daß er nicht Lust hat wieder zu kommen, weil er seine Kleinode und was er Gutes besaß, mit sich hinweggenommen hat.
Da nun Rupert sah, wie es seinem Herrn so leid um ihn war, befiel ihn die Furcht, seiner Gesellen einer möchte etwa sagen, wie Rupert ihn hinweg geschafft hätte. Da ging er zu jedem insbesondere und bat sie, nicht zu melden, daß er daran Ursache wäre: das gelobten sie ihm gar treulich zu tun. Sie hätten aber gern gewußt, mit welcher List er ihn dazu gebracht, daß er so eilends ohne Urlaub (als ob er was Arges verbrochen hätte) entflohen wäre. Da war einer unter ihnen, der vor den andern bei Ruperten wohlgelitten war: der lag ihm an mit fragen und wollte wissen, wie er ihn hinweg gebracht hätte. Da er nicht abließ mit fragen, sagte er ihm, wie Fortunatus ihm von seinem Vater erzählt hätte, wie er in Armut gekommen wäre und an des Königs Hof von Cypern diente: da hab ich ihm gesagt, wie ein reitender Bote eilends zum König von England gefahren sei, ihm zu sagen, daß der König von Cypern tot sei, und er habe noch bei gesundem Leib seinen Vater Theodorus in den Grafenstand erhoben und ihm eine Grafschaft gegeben, denn ein Graf mit Namen Anshelm von Terracina wär ohne Leibeserben verstorben. Und da Theodorus der erste gewesen, der ihn um das Lehen gebeten hätte, wenn es ihm heimfiele, so habe ihm der König die Grafschaft gleich eingegeben, ihm und seinen Erben, ihn auch mit Brief und Siegel darüber versorgt nach aller Notdurft. Da ich das sagte, gab er meiner Rede nicht viel Glauben, denn er sprach: Ich wollte gern, daß es meinem Vater wohl ginge. Auf solches ist er weggeritten. Da die andern Diener diese Rede vernahmen, sprach einer zu dem andern: Wie ist Fortunatus so unklug gewesen: wäre ihm ein solch Glück zugefallen, und er hätte das unserm Herrn gesagt, der hätte ihn wohl anständig ausgerüstet und unserer drei oder vier mit ihm gesandt: so wär er mit großen Ehren von hinnen gekommen und hätte einen gnädigen Herrn sein Lebtag gehabt.
Nun lassen wir den Grafen mit seinen Dienern, die nicht wußten, wie Rupert mit Lügen umginge, und vernehmen, wie es Fortunatus fürder ergangen ist. Als er ein ander Roß kaufte und seinem Herrn das seine wieder sandte, hatte er noch immer Sorge, man setze ihm nach, eilte also noch besser, bis er gen Calais kam: da setzte er sich in ein Schiff und fuhr gen England, denn er fürchtete sich so sehr, daß er sich diesseits des Meeres nicht für sicher hielt. Als er nun nach England kam und vermeinte sicher zu sein, fing er an wieder gutes Muts zu werden. Kam also in die Hauptstadt Englands, genannt London, da von allen Orten der Welt Kaufleute liegen und ihr Gewerb treiben: da war eine Galeere aus Cypern angekommen, mit köstlichem Kaufmannsgut und vielen Kaufleuten. Darunter waren zwei Jünglinge, die reiche Väter in Cypern hatten und denen viel köstliches Kaufmannsgut befohlen war. Sie waren aber zuvor nie ausgewesen und wußten nicht viel, wie man sich halten soll in fremden Landen, als so viel sie von ihren Vätern gehört hatten, deren guter Unterweisung sie hätten folgen sollen. Da nun die Galeere mit dem Kaufmannsgut ausgeladen und dem König der Zoll gegeben war, daß ein jeder mochte kaufen und verkaufen, fingen die zwei Jünglinge auch an, ihr Kaufmannsgut zu verkaufen, und lösten ein groß Geld, worüber sie Freude hatten, denn sie waren nicht gewohnt, mit barem Geld umzugehen. Zu denen kam Fortunatus, begrüßten einander gar schön, wurden gute Gesellen und fanden gleich eine unnütze Rotte Buben, zu denen sie sich gesellten: die wußten die Leute zu leckern mit Spielen und mit Wohlleben. Sie lebten also in Freude, und das trieben sie bis zu einem halben Jahr: da war es bald an dem, daß sie nicht viel bar Geld mehr hatten; doch war der eine mehr los geworden als der andere.
Fortunatus, der am wenigsten hatte, ward auch am ersten fertig. Seinen Gesellen erging es nicht viel besser, denn was sie zu London gelöst, das war alles vertan mit lustigen Gesellen. Da war die Liebe bald aus; nichts destoweniger meinten sie, noch geliebt zu sein: des ward ihrer nicht wenig gespottet: fahrt hin, und holet mehr! Indem waren die Kaufleute von Cypern fertig mit kaufen und verkaufen, und der Patron rüstete sich, hinweg zu fahren. Auch gingen die zwei Jünglinge in die Herberge über ihre Rechnung und fanden wohl, daß sie viel Geldes gelöst, aber nicht viel Ware dafür gekauft hatten nach ihres Vaters Anweisung: es war alles um nassen Zucker hinweg gegeben; und wäre des Geldes mehr gewesen, so wäre es auch dahin gegangen. Doch setzten sie sich auf die Galeere und fuhren wieder heim, ohne Kaufmannsschatz; wie sie aber von ihren Vätern empfangen werden, da laß ich sie sorgen.
Als Fortunatus allein und ohne Geld war, gedachte er, hätte ich zwei oder drei Kronen, so wollt ich nach Frankreich: vielleicht fände ich einen Herrn; ging also wieder zu einem seiner Gesellen und bat, daß er ihm zwei oder drei Kronen liehe, er wollte nach Flandern zu einem Vetter; da hätte er vierhundert Kronen, die wolle er holen und sich dann erst recht lustig mit ihm machen. Der sprach: Weißt du Geld zu holen, das magst du wohl tun, doch ohne meinen Schaden. Daran verstand er wohl, daß er da kein Geld zu erwarten hätte und gedachte bei sich selbst: hätte ich mein Geld wieder, ich wollte es nicht mehr dahin aufzubewahren geben, und so ging er davon ohne Abschied.
Da Fortunatus also verlassen war, gedachte er: ich muß dienen so lange, bis ich zwei oder drei Kronen bekomme. Und ging er des Morgens an den Platz, den man nennet die Lombarder Straße, da all die Welschen zusammen kommen, und fragte allda, ob jemand eines Knechts bedürfte. Da war ein reicher Kaufmann von Florenz, der gar köstlich Hof und viele Knechte hielt, denn er brauchte sie alle in seinem Gewerb und Handel: der dingte Fortunatus, verhieß ihm zwei Kronen monatlich zu geben und führte ihn mit sich heim. Da fing er gleich an bei Tische zu dienen, wobei der Herr im Haus, Jeronimo Roberti, wohl sah, daß er mehr bei ehrsamen Leuten gewesen. Da sandte er ihn, Güter auf die Schiffe zu führen, und wenn die Schiffe kamen, sie zu entladen, denn die großen Schiffe konnten bei zwanzig Meilen nicht zu der Stadt kommen; und was er ihm befahl, verrichtete er gar wohl.
Nun war ein Florentiner, eines reichen Mannes Sohn, genannt Andreas, dem hatte sein Vater großes Gut gegeben, und ihn damit gen Brügge in Flandern Brügge, die Hauptstadt der belgischen Provinz Westflandern, ist jetzt eine stille Binnenstadt, 15 km vom Meer. Seitdem die Kanäle, die sie mit dem Meere verbinden, versandeten und der Welthandel andere Wege einschlug, ist die Stadt entvölkert und verarmt. Im fünfzehnten Jahrhundert hatte sie wohl 200 000 Bewohner, jetzt kaum den vierten Teil. Prachtvolle Wohnhäuser, Kirchen und Kunstwerke erinnern an die geschwundene Herrlichkeit der Stadt, die vom 13. bis ins 16. Jahrh. der Mittelpunkt des Welthandels im Norden war, wie Venedig im Süden. gesandt: das hatte er auch in kurzer Zeit unnütz vertan; aber damit begnügte er sich nicht, sondern nahm Wechsel auf seinen Vater, dem er schrieb, er wolle ihm viel Gut senden. Das glaubte der, und bezahlte also für den Sohn so lange und viel, bis daß er nichts mehr hatte, und wartete fest auf das Kaufmannsgut, so ihm sein Sohn schicken sollte. Er soll es ihm noch senden, wie unser Söhnlein auch. Als nun der Bube gar nichts mehr hatte und den Glauben verloren unter den Kaufleuten, Er verlor den Kredit (wie im folgenden ausgeführt wird). auch unter Schelmen und Buben, daß ihm niemand weder leihen, geben noch borgen wollte, gedachte er, er wollte gen Florenz: da fände er vielleicht eine alte Witwe, mit der er sich herausrisse. Als er nun heimwärts fuhr, kam er in eine Stadt in Frankreich, genannt Turin: »Turin in Welschland« müßte es wohl richtiger heißen; denn zur Zeit, als der Roman geschrieben wurde (um 1440), besaßen die Franzosen keiner Art Herrschaft in Italien. Doch herrschten sie in Turin von 1506-1562 und später noch verschiedentlich. da lag ein reicher Edelmann gefangen, der war von London aus England. Das hörte er von dem Wirt und sprach: Lieber Wirt, kann ich nicht zu dem gefangenen Mann kommen? Der Wirt sprach: Ich will euch wohl zu ihm führen; er liegt aber so hart angeschmiedet, daß es euch erbarmen wird. Als nun Andreas zu dem Gefangenen kam, redete er englisch: des war der Gefangene froh und fragte ihn, ob er nicht zu London den Jeronimo Roberti kännte. Er sprach: Ich kenne ihn wohl, und er ist mein guter Freund. Da sprach der Gefangene: Lieber Andreas, laß deine Reise nach Florenz und zieh hin zu Jeronimo Roberti und sage ihm, daß er helfe und rate, daß ich losgekauft werde. Er kennt mich und weiß wohl, was ich im Vermögen habe. Meine Verwandten meinen, der König solle mich auslösen, weil ich in seinem Dienst gefangen wurde; aber der König will es nicht tun, weil er sagt, er habe mir einen großen Sold gegeben, täglich vier Kronen auf zwei Pferde: warum ich nicht weiter umgeritten sei, daß ich den Feinden nicht in die Hände gefallen wäre. Zum andern zieme es sich nicht, daß ein König Gefangene löse, denn wenn man einen Gefangenen um tausend Kronen losließe, so müßte ein König zehntausend geben. Aus diesen Gründen lösen sie mich nicht, und währt es noch eine Weile, so komm ich um meine heilen Glieder, denn schon fangen mir die Schenkel an zu faulen. Darum sage dem Jeronimo Roberti, daß er mich ledige, ich wolle ihm das ausgelegte Geld dreifach wiedergeben. Nun lieber Andreas, gib dir Mühe und wende allen Fleiß an: so verheiße und gelobe ich dir, daß ich dir fünfhundert Kronen geben will, und will dir auch dazu ein gutes Amt schaffen. Sage auch meinen Verwandten, wie du hier bei mir gewesen seist, und daß sie meine Bürgen werden sollen bei Jeronimo. Andreas sagte zu dem Gefangenen, er wollte sich treulich in der Sache bemühen; zog also gen London und brachte die Sache, so ihm befohlen, an den Jeronimo Roberti. Dem gefiel die Sache wohl, wenn er nur gewiß gewesen wäre, daß ihm für eine Krone drei würden. Nun kannte er den Andreas, daß er ein böser Bube war; nichts destoweniger sagte er zu ihm: Gehe hin zu den Verwandten und an des Königs Hof: magst du den Weg finden, daß man mir Bürgschaft tut, so will ich ihm das Geld darleihen. Andreas fragte nach des Gefangenen Freunden und sagte ihnen, wie es um ihn stünde, wie er so hart angeschmiedet wäre: es lag ihnen aber nicht so hart an. Sie sagten ihm, er sollte zu dem König oder seinen Räten gehen und ihnen solches vorhalten, denn er wäre in des Königs Diensten geschickt gewesen.
Als er nun gen Hof kam und nicht vorkommen konnte mit seiner Sache, hörte er sagen, daß der König von England dem Herzog von Burgund seine Schwester zum Gemahl gegeben hatte, dem er noch schuldig war, Kleinodien zu senden, die er mit vieler Mühe zusammengebracht hatte – denn es waren gar köstliche Kleinodien. Er hatte sie einem frommen Edelmann übergeben, der auch zu London in der Stadt war und Weib und Kind da hatte.
Da aber Andreas am Hof sagen hörte, wie man dem Edelmann köstliche Kleinodien befohlen, fing er an und gesellte sich zu ihm und sagte, da er vernommen, daß der König dem Herzog von Burgund durch ihn köstliche Kleinodien senden wollte, so bäte er ihn gar freundlich, daß er ihn die Kleinodien sehen ließe. Denn er wär ein Juwelier und hätte zu Florenz gehört, wie der König köstlichen Kleinodien nachfragte, und wäre deswegen so weit her gekommen, in der Hoffnung, der König sollte ihm auch etliche Stück abkaufen. Der fromme Edelmann sprach: So kommt mit mir, ich will sie euch sehen lassen, und führte ihn mit sich heim. Nun war es längst Mittag; da sprach er: Wir wollen zuvor essen, so wird meine Frau nicht unwillig. Sie aßen also miteinander und tischten gar lange, wie es denn Gewohnheit in England ist. Als sie nun gegessen hatten und fröhlich gewesen waren, führte er ihn in seine Schlafkammer, schloß eine gar schöne Kiste auf und brachte die Kleinodien in einem schönen Lädlein herbei und ließ sie ihn genugsam besehen. Es waren fünf Kleinodien, die kosteten sechzigtausend Kronen, je länger man sie ansah, je besser sie einem gefielen. Andreas lobte sie sehr und sprach: Ich habe wohl etliche Stück; wären sie also eingefaßt, sie sollten diese ausstechen. Das hörte der Edelmann gerne und gedachte: hat er so köstliche Kleinodien, so muß unser Herr König noch mehr kaufen. Sie gingen also wieder gen Hof. Da sprach Andreas: Morgen um Mittag sollt ihr mit mir essen in Jeronimo Roberti Haus: so will ich euch auch meine Kleinode lassen sehen. Das gefiel dem Edelmann wohl.
Also ging Andreas zu Jeronimo Roberti und sprach: Ich habe einen Mann gefunden an des Königs Hof: ich hoffe, der wird helfen, daß wir den Gefangenen ledig machen und daß auch gute und gewisse Bürgschaft dafür geschehen muß auf des Königs Zoll. Dem Jeronimo Roberti gefiel das wohl. Andreas sprach: Bereitet morgen die Mahlzeit desto besser, so bringe ich ihn, daß er mit uns isset. Das geschah, und des Morgens um die Mahlzeit brachte Andreas den Mann, und ehe sie zutische saßen, sagte Andreas zu Jeronimo: Man soll nicht viel von dem gefangenen Mann reden, denn es muß heimlich zugehen. Also aßen sie, waren fröhlich und tischten lange, und als die Mahlzeit geschehen war, ging Jeronimo in seine Schreibstube. Da sagte Andreas zu dem Edelmann: Kommt mit mir hinauf in meine Kammer, so will ich euch meine Kleinode auch sehen lassen. Sie gingen also miteinander in eine Kammer: die war über dem Saal, darin sie gesessen hatten. Und als sie in die Kammer kamen, tat Andreas, als wollte er eine große Truhe aufschließen, zuckte ein Messer und stach den Edelmann, daß er fiel, und schnitt ihm die Gurgel ab, nahm ihm einen goldenen Ring, den er noch an seinem Daumen hatte Auf alten Bildnissen sieht man häufig, daß die Herren den Siegelring am Daumen oder Zeigefinger tragen, was ja für den häufigen Gebrauch bequemer war, als ihn am vierten Finger zu tragen., darein auch sein Insiegel künstlich gegraben war, und nahm die Schlüssel von seinem Gürtel, ging eilends in des Edelmanns Haus zu seiner Frau und sprach zu ihr: Frau, euer Gemahl sendet mich zu euch, daß ihr ihm die Kleinode schicket, so er mich gestern sehen ließ, und sendet hierbei auch zum Wahrzeichen seinen Ring, Siegel und die Schlüssel zum Kästlein, darin die Kleinode liegen. Die Frau glaubte seinen Worten und schloß den Behälter auf: sie fanden aber die Kleinode nicht; der Schlüssel waren drei, sie suchten an allen Orten, aber umsonst. Zuletzt gab sie ihm alles wieder, und sprach: Geht und sagt, wir können sie nicht finden; er solle selbst kommen und sehen, wo sie seien. Andreas erschrak sehr, daß er einen Mord begangen und doch die Kleinode nicht bekommen hätte; denn er hatte gleich damit davon gehen wollen.
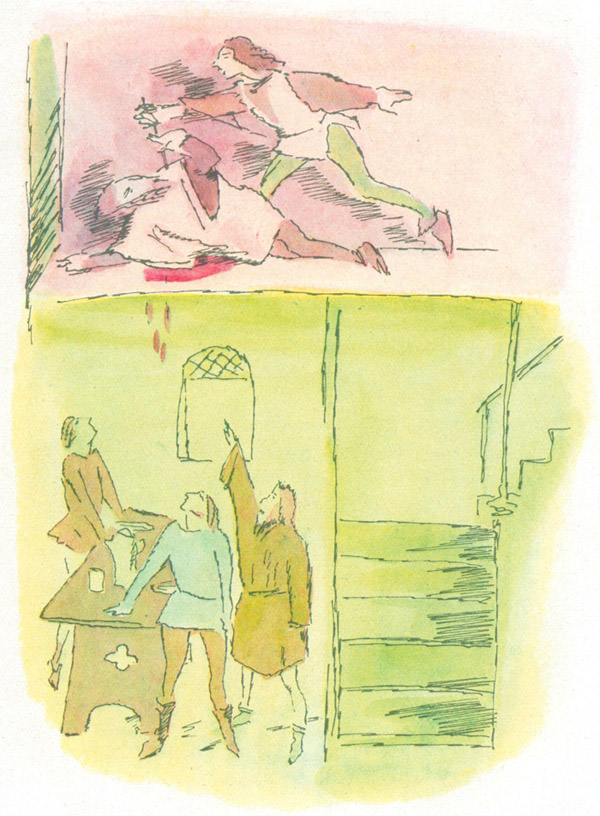
Bd. 49, S. 33. Text siehe S. 33
Dieweil er aber in des Edelmanns Haus gegangen, war das Blut durch die Dielen in den Saal geflossen: das sah der Herr und rief alsbald seinen Knechten und sprach: Von wannen kommt das Blut? Sie liefen und sahen zu: da fanden sie den frommen Edelmann tot liegen. Sie erschraken sehr, und vor großem Schreck wußten sie nicht, was sie tun sollten.
Als sie nun also standen, so kommt der Schalk, sie schrieen ihn an: Was hast du getan, daß du den Edelmann ermordet hast? Er sprach: Der Bösewicht wollte mich ermordet haben, denn er vermeinte köstliche Kleinode bei mir zu finden; so ist es mir viel lieber, ich habe ihn ermordet, denn er mich: Darum schweigt still und macht kein Geschrei, so will ich den Mann in den Abort werfen, und wenn ihm jemand nachfragt, so sagt: Ich weiß nicht. Als sie gegessen hatten, gingen sie hinweg, seitdem haben wir keinen gesehen. Damit warf er den Leichnam in den Abort und eilte Tag und Nacht, daß er aus dem Lande kam, durfte an keinem Ort nicht bleiben, er fürchtete, ihm würden Boten nachgeschickt, daß er gestraft würde um die große Untat. Er kam gen Venedig und verdingte sich für einen Ruderer auf eine Galeere und fuhr gen Alexandria; und sobald er dahin kam, verleugnete er den christlichen Glauben: da ward der Schalk wohl gehalten und war auch sicher vor der Missetat, so er getan, und hätte er hundert Christen gemordet, so wär er sicher gewesen.
Als sich nun die Sache den Tag verlaufen hatte, da kam Fortunatus gen London von Sanduwick Sanduwick, jetzt Sandwich (Sandbucht) ist ein kleiner Flecken, 3 km vom Meere entfernt, westlich der Themsemündung und nicht weit von Dover. Ehemals war es einer der wichtigsten Häfen Englands., wo er seines Herrn Gut in ein Schiff geladen hatte. Als er nun sein Geschäft, so ihm befohlen war, gar wohl vollendet hatte und in seines Herrn Haus kam, da ward er nicht so freundlich empfangen, als ein andermal, wenn er aus gewesen war; auch bedeuchte ihn, als ob der Herr, Gesellen, Knechte und Mägde nicht so fröhlich wären, als er sie gelassen hatte, was ihn sehr bekümmerte. Er fragte die Haushälterin, was sich verlaufen hätte in seinem Abwesen, daß alle traurig wären. Die gute alte Haushälterin, der auch der Herr sehr lieb war, sagte zu ihm: Fortunatus, laß es dich nicht bekümmern, denn unserm Herrn ist ein Brief kommen von Florenz, wie ihm so gar ein guter Freund gestorben sei, darum er sehr betrübt ist. Er ist ihm nicht so nahe verwandt, daß er schwarz tragen dürfte; ihm aber wäre lieber ein Bruder gestorben, denn der gute Freund. Dabei ließ es Fortunatus auch bleiben und fragte nicht weiter und half ihnen auch traurig sein.
Als nun der Edelmann die Nacht nicht heim kam, auch seiner Frau nichts entboten hatte, nahm es sie Wunder; doch schwieg sie still, und da er des Morgens abermals nicht kam, sandte die Frau aus an ihre guten Freunde an des Königs Hof, ihrem Gemahl nachzufragen, ob ihn der König in seinem Dienst versandt hätte, oder wo er wäre. Und sobald man hörte, daß man ihm nachfragte, da nahm es die Räte selbst Wunder, daß der Mann nicht gen Hof gekommen war. Die Zeitung kam also vor den König, der sprach: Geht gleich in sein Haus und seht, ob er die Kleinodien mit habe; denn dem König fiel in seinen Sinn, er möchte mit den Kleinodien hinweg sein. Denn wiewohl er ihn für einen Biedermann hielt, so gedachte er doch, das große Gut hätte ihn zu einem Bösewicht gemacht. Also ward es ruchbar, so daß je einer den andern fragte, ob er nicht wüßte, wo der Edelmann hingekommen wäre; aber niemand wußte von ihm zu sagen. Der König sandte gar eilends zu seiner Frauen Haus, daß man fragt und sähe, wo die Kleinodien wären; denn wiewohl ihm der Edelmann lieb war, ließ er doch den Kleinodien besser nachfragen denn dem frommen Mann, wobei man wohl merken mag, wann es an das Gut geht, daß alle Liebe aus ist. Und da man die Frau fragte, wo ihr Mann und die Kleinodien wären, sprach sie: Es ist heute der dritte Tag, daß ich ihn nicht gesehen habe. Was sagte er aber, da er zuletzt von euch ging? Sie sprach: Er wollte mit den Florentinern essen und sandte einen mit seinem Siegel und den Schlüsseln: ich solle ihm die Kleinodien senden; er wäre in Jeronimo Robertis Haus, da wären viel köstliche Kleinodien, die wollte man gegeneinander schätzen. Also führte ich ihn in meine Kammer und tat ihm die Behälter auf, dazu er denn die Schlüssel hatte; wir aber fanden dieselben nicht, und ging der Mann ohne sie hinweg, was er ungern tat; er hieß mich alles durchsuchen, wir konnten sie aber nicht finden. Er fragte mich, ob mein Mann nicht noch besondere Verschlüsse gehabt. Ich sprach, er hätte kein anderes. Denn alles Gut, das er hatte, seine Siegel und Briefe legte er all in das Kästlein; darin waren auch die Kleinodien. Sie waren aber nicht mehr da, denn wären sie noch darin gewesen, so hätte ich sie ihm gesandt.
Da die Boten das hörten, ließen sie alle Kisten, Behälter und Truhen aufbrechen: sie fanden aber die Kleinodien nicht. Die Frau erschrak gar sehr, daß man ihr in ihrem Hause also Gewalt täte, auch erschraken des Königs Boten, daß man weder den Mann noch die Kleinodien finden konnte. Das sagte man dem König. Der König war mehr traurig um die Kleinodien denn um das Geld, so sie gekostet, denn man findet solche Dinge nicht zu Kauf, wenn man auch Geld hat. Der König und seine Räte wußten nicht, was bei der Sache zu tun wäre; doch beschlossen sie, man sollte Jeronimo Roberti und all sein Gesinde verhaften, daß sie Rechenschaft über den Mann gäben. Das geschah am fünften Tage, nachdem der Mann ermordet war. Da warteten des Richters Knechte, bis daß man die Mahlzeit aß, fielen in das Haus und fanden sie alle beieinander, Mann und Frau, zwei Schreiber, einen Knecht, einen Stallknecht, zwei Mägde und Fortunatus, also daß ihrer neun Personen waren. Man führte sie ins Gefängnis, jeden in ein besonderes, fragte auch jeden insbesondere, wo die zwei Männer hingekommen wären. Sie sagten alle gleich: Als sie gegessen hatten, sind sie hinweg gegangen und wir haben sie darnach nicht mehr gesehen, noch von ihnen gehört. Das genügte; sie nahmen dem Herrn und den andern alle ihre Schlüssel, gingen in das Haus und suchten in allen Ställen, Kellern, in den Gewölbern, wo sie ihre Kaufmannswaren liegen hatten, und allen Orten, ob sie den Mann vielleicht vergraben hätten: sie fanden aber nichts. Und als sie schon hinweg gehen wollten, da war einer, der hatte eine große brennende Kerze oder ein Windlicht in der Hand, womit er alle finstere Winkel durchsuchte, aber doch nichts fand. Indem zieht er aus einer Bettstatt eine große Hand voll Stroh, zündet das an und warf es in den Abort, und wie er hinabblickt, da sieht er des Mannes Schenkel emporstehen. Da fing er an und schrie mit lauter Stimme: Mord über Mord! der Mann liegt hie in dem Abort! Also brach man den Abort auf und zog den Mann heraus mit der abgestochenen Kehle und legte ihn vor des Jeronimo Haus auf die offene Straße, so unsauber als er auch war. Und da die Englischen den großen Mord sahen, ward ein solch groß Geschrei über die Florenzer und alle Lombarder, daß sie sich verbergen und versperren mußten, denn wo man sie auf der Gasse getroffen, wären sie von dem gemeinen Mann alle erschlagen worden. Behend kam die Zeitung vor den König und vor den Richter: da ward befohlen, daß man Herren und Knechte peinigen und martern sollte, daß man des rechten Grundes inne würde, wie es mit dem Mann ergangen; auch sollte man jeden besonders legen und die Aussagen aufschreiben. Besonders aber sollte man den Kleinodien nachfragen.
Also kam der Henker und nahm zuerst den Herrn und schlug ihn an die Wage, peinigte ihn gar hart, er sollte sagen, wer den Mann ermordet und warum sie ihn ermordet hätten, auch wo des Königs Kleinodien wären? Der gute Jeronimo merkte wohl an dem großen Ungestüm und der harten Marter, die man ihm antat, daß man des Mords inne geworden, der in seinem Hause ohne sein Wissen geschehen und ihm sehr leid war; und weil er sah, daß es nicht anders sein möchte, fing er an und sagte, wie alles ergangen wäre: daß Andreas ihn gebeten, ein gut Mahl zu bereiten, er sollte einen Edelmann zugaste haben, der ihm helfen sollte, einen andern Edelmann frei zu machen, der zu Turin in Frankreich gefangen läge; und daß er das in aller Güte getan, seinem gnädigen Herrn, dem König und dem ganzen Land zu lieb, auch nicht anders gewußt habe. Da aber die Mahlzeit vorbei war und ich ohne auf sie zu achten, in meiner Schreibstube saß und schrieb und nach dem Schreiben hinausging, da sah ich, daß das Blut von der Decke des Eßsaals niederrann. Ich sandte meine Knechte nachzusehen: da kamen sie und sagten, wie es aussähe. Ich wußte nicht, wie es zugegangen war: darüber kommt der Schalk Andreas gelaufen, den stellte ich zur Rede um den Mord. Er sagte, der andere habe ihn ermorden wollen, aber Gott habe ihm das Glück gegeben, ihm zuvorzukommen. Da nahm er den Mann und warf ihn in den Abort und ging gleich hinweg; wo er aber hingekommen ist, weiß ich nicht. Und wie er sagte, also sagten die andern alle, wenn man sie peinigte und marterte. Aber Fortunatus der bekannte nichts, wie sehr man ihn auch peinigte, denn er war gar nicht zuhaus gewesen, da sich die Sache begeben hatte.
Als man nichts anderes erfahren konnte, auch nicht wo die Kleinodien hingekommen waren, ward der König gar zornig und befahl, daß man sie alle miteinander hängen sollte und mit eisernen Ketten festschmieden, auf daß sie nicht herabgenommen würden, noch von selber herabfielen. Er ließ ihnen einen neuen Galgen bauen zwischen der Stadt und dem Westminster Westminster, jetzt ein Stadtteil von Innerlondon, war noch im 15. Jahrh. ein selbständiger Ort nördlich von London. Dort liegt die berühmte Westminster-Abtei, die Begräbnisstätte der englischen Könige.; daran hing man zuerst die zwei Mägde, fing dann bei dem Herrn an und stieg wieder hinab zu den niedrigsten. Als Fortunatus sah, wie es zuging, und auch nicht anders wußte, denn man würde ihn auch henken, gedachte er: O lieber Gott! wär ich bei meinem frommen Herrn und Grafen geblieben und hätte mich lassen zu einem Frauenhüter machen, so wär ich jetzund nicht in diese Angst und Not gekommen. Und als man den Koch henken wollte, welcher der letzte vor Fortunatus und ein Engländer war, da schrie er mit lauter Stimme, daß es jedermann hörte, wie Fortunatus nichts um die Sache wüßte. Der Richter wußte zwar, daß er unschuldig war, dennoch wollte er ihn henken lassen und war seine Meinung, ließe er ihn ledig, so würde er sonst zutode geschlagen. Doch ward so viel mit dem Richter geredet, daß er ihn nicht sollte henken lassen, weil er kein Florentiner und unschuldig wäre, bis der Richter zu Fortunatus sprach: Nun mache dich bald aus dem Land, denn die Frauen auf der Gasse werden dich zutode schlagen, und gab ihm zween Knechte zu, die führten ihn an das Wasser; und er fuhr darüber und ging so lang, bis er wieder aus dem Lande kam.
Da nun Jeronimo mit seinem Gesind gehenkt war, ließ der König das gemeine Volk in Jeronimos Haus Sackman machen Sackman machen, von dem englischen to sack, was hier plündern bedeutet. Verwandt ist unser »einsacken«., doch hatten des Königs Räte das beste vorweggenommen. Wer da fand, der hatte, da brauchte niemand Rechenschaft zu geben.
Da die andern Florentiner und Lombarden hörten, wie man also Sackman gemacht hatte, fürchteten sie für ihr Gut und Leben und sandten dem König eine große Summe Geldes, daß er ihnen ein sicher Geleit gebe, weil sie keine Schuld hätten. Also ward auch der König zur Gütigkeit bewegt und gab ihnen ein frei sicher Geleit, daß sie möchten wandeln, kaufen und verkaufen, wie sie zuvor getan hätten. Daß aber solche Schmach Jeronimo Roberti widerfuhr, geschah wegen Verschweigung des Mordes, nach kaiserlichem Recht.
Als nun solches geschehen, hätte der König gern gewußt, wo seine Kleinodien hingekommen, ob sie ihm wieder werden möchten, um die er so groß Gut gegeben. Er ließ also ausrufen, wer wahre Kundschaft sagen könne, wo die Kleinodien hingekommen, dem sollte man tausend Nobel geben. Nobel ( noble) ist der Name einer englischen Goldmünze, die vom 14. bis ins 16. Jahrh. geprägt wurde und auf einer Seite ein Schiff, auf der andern eine Rose oder ein Kreuz zeigte. Die Münze war später auch auf dem Festlande, namentlich in Norddeutschland im Umlauf. (S. Anmerk. 21). Da ward an viel Königshöfe, Fürsten und Herren geschrieben, auch an die reichen mächtigen Städte, ob jemand käme, der solche Kleinodien feil trüge, so sollte man ihn festnehmen. Es erfolgte aber nichts darauf; jedoch war großer Eifer darum, denn jedermann hätte gern das Geld verdient. Das stund also an, bis des Edelmanns Frau ihren Mann dreißig Tage lang betrauert und darnach das Leid von Tag zu Tag immer mehr ablegte und anfing, ihre Gespielen und Nachbarinnen zugaste zu laden. Unter denen war eine, die auch kürzlich Witwe geworden; die sprach: Wollt ihr mir folgen, ich wollt' euch lehren, wie ihr euers Mannes Tod bald vergessen werdet. Macht euer Bett in eine andre Kammer, oder wenn ihr das nicht tun wollt, setzt die Bettstatt an einen andern Ort, und wenn ihr euch nachts niederlegt, so gedenkt an einen jungen Gesellen, den ihr gern zu einem Mann haben wollt, und sprecht aus Übermut: Die Toten zu den Toten, und die Lebendigen zu den Lebendigen; also tat ich, da mein Mann gestorben war. Die Frau sprach: O liebe Schwester, mein Mann ist mir so lieb gewesen, daß ich sein sobald nicht vergessen kann. Doch hatte sie die Worte gar wohl gemerkt, und sobald die Frau aus dem Hause war, fing sie gleich an, ihre Schlafkammer aufzuräumen und ihres Mannes Kisten und Truhen aus der Kammer zu tragen und ihre an die Statt zu setzen, auch des Mannes Bettstatt an einen andern Ort zu stellen. Und da man die Bettstatt verrückte, da stand das Lädlein mit den Kleinodien unter dem Bett bei einem Stollen. Das ersah die Frau, erkannte das Lädlein und bewahrte es auf, hieß die Kammer zurüsten, wie sie schon angefangen hatten, und schickte darauf nach einem ihrer nächsten Freunde, zu dem sie sagte, wie sie die Kleinodien ganz von ohngefähr gefunden hätte, und wenn sie das Bett nicht verändert hätte, so möchten sie noch lange gelegen sein, denn da hätte sie niemand gesucht. Sie begehrte also ihres Freundes Rat, wie sie sich mit den Kleinodien verhalten sollte.
Da ihr Freund hörte, daß die Kleinodien gefunden waren, so war er froh, und sagte zu der Frau: So ihr meines Rats begehrt, so will ich euch raten, was mich das beste dünket. Mein Rat ist, daß ihr die Kleinodien von Stund an nehmet, so will ich mit euch gehen und zusehen, daß man uns selber vor den König läßt, um die Kleinodien in seine Hand zu überantworten. Sagt ihm dann die ganze Wahrheit, wie ihr die Kleinodien gefunden habt, und stellt ihm anheim, was er euch zu Findelohn gäbe. Denn sollte man die Kleinodien dem König vorenthalten, großen Findelohn von ihm zu erhalten, oder die Kleinodien in fremde Länder schicken und verkaufen, dazu ist es zu weit über alle Lande ausgerufen worden, daß man die Kleinodien, die der König verloren hat, nun kennt, und so man ihrer inne würde, kämen alle die, die damit umgingen, um Gut und Leben, und die Kleinodien würden alsdann dem König wiedergegeben.
Der Rat gefiel der Frau gar wohl; sie kleidete sich gar schön an, doch wie eine Witwe gegen ihren Mann soll, und ging also mit ihrem Freund in des Königs Palast und begehrte selbst vor den König zu kommen. Das ward dem König kund getan, der ihnen auch vergönnte, daß sie in den königlichen Saal eingelassen wurden. Und als sie vor den König kamen, kniete sie nieder, erwies dem König große Ehre und sprach: Gnädigster Herr König, ich, Eure arme Dienerin, komme vor Eure königliche Majestät, und tue Euch zu wissen, daß ich die Kleinodien, so Ihr in meinem Hause gehabt und meinem Ehemann seliger zur Übermachung an die Herzogin von Burgund anbefohlen waren, dieses Tages gefunden habe in meiner Schlafkammer hinter einem Stollen der Bettlade. Denn ich wollte das Bett verändern, da fand ich das Lädlein, und sobald ich das gefunden, hab ich mich beeilt, dasselbe in Eure Hände zu liefern. Und gab ihm damit die Kleinodien in seine Hände. Der König tat das Lädlein auf und fand die Kleinodien, wie sie sein sollten. Da war er froh und verordnete, daß sie an den Ort kämen, dahin sie gehörten.
Der König hatte ein großes Wohlgefallen, daß die Frau so geflissen war und die Kleinodien niemand vertraut hätte als ihm, und gedachte, billig wäre es, daß er sie begabte und ihres Leides tröstete, weil ihr frommer Mann um dieser Kleinodien willen um sein Leben gekommen war. Und rief einem jungen Edelmann an seinem Hof, der hübsch und wohlgestalt war, und sprach: Ich hab eine Bitte an dich, die sollst du mir nicht versagen. Der Jüngling sprach: Gnädiger Herr König, Ihr sollt keine Bitte an mich tun, sondern mir gebieten, so will ich Euern Geboten gehorsam sein.
Also ließ der König einen Priester kommen, und gleich in seiner Gegenwart gab er der Witwe den Jüngling zu einem Gemahl und begabte sie gar reichlich, daß sie in Freuden miteinander leben mochten. Die Frau aber ging zu ihrer Gespielin und dankte ihr gar für den Rat, so sie ihr gegeben, daß sie ihre Bettstatt verändern sollte, und sagte: So ich euerm Rat nicht gefolgt, so hätte der König seine Kleinodien nicht, noch ich einen hübschen Mann: darum tuet der gut, wer weiser Leute Rate folgt.
Nun höret, wie es Fortunatus weiter ging, da er vom Galgen entledigt war. Als er kein Geld mehr hatte, da eilte er sehr, daß er von den Englischen käme und kam in die Picardie Picardie hieß eine französische Provinz am Kanal, die östlich von Artois und Flandern, westlich von der Normandie begrenzt wurde. Die Hauptstadt ist Amiens. Die Picardie war eine freie Grafschaft, wurde später mit Burgund und bald darauf (1477) mit Frankreich vereinigt.: da hätte er gerne gedient, konnte aber keinen Herrn bekommen. Er ging also weiter und kam in Britannien in einen sehr wilden Wald (als wenn es der Böhmer- oder Thüringer Wald wäre), darin verirrte er sich und ging den ganzen Tag und konnte nicht herauskommen, und als es Nacht ward, kam er zu einer alten Glashütte, in der man vor vielen Jahren Glas gemacht hatte: da ward er froh und meinte, er sollte Leute darin finden; aber da war niemand. Doch blieb er die Nacht in der armen Hütte mit großem Hunger und vieler Sorge vor den wilden Tieren, die in dem Wald ihre Wohnung hatten, auch mit großem Verlangen nach dem Tag, denn er hoffte, Gott werde ihm da aus dem Wald helfen, daß er nicht also Hungers sterbe. Als er aber am Tage quer durch das Holz gehen sollte, ging er nach der Länge, und je mehr er ging, je weniger er aus dem Holz kommen konnte. Also verging ihm auch der andere Tag mit großem Herzeleid; als es aber Nacht werden wollte, ward er ganz kraftlos, indem er in zwei Tagen nichts gegessen hatte; da kam er von ohngefähr zu einem Brunnen, da trank er mit großer Lust, denn es gab ihm Kraft; und als er bei dem Brunnen saß, fing der Mond an gar hell zu scheinen. Da hörte er ein wildes Prasseln in dem Wald und einen Bären brummen. Er gedachte, wie ihm da nicht nütze lang zu sitzen, noch zu fliehen, denn die wilden Tiere würden ihn bald übereilen; ihm wäre besser auf einen Baum zu steigen, und zunächst bei dem Brunnen stieg er auf einen Baum, der viel Äste hatte, und sah von da, wie die wilden Tiere mancherlei Gattung kamen zu trinken, sich schlugen und bissen und ein wildes Wesen miteinander hatten. Darunter war auch ein halbwüchsiger Bär, der roch Fortunatus auf dem Baum und fing an, auf den Baum zu steigen: er fürchtete ihn sehr, stieg je länger je höher auf den Baum und der Bär ihm nach. Da aber Fortunatus nicht ferner hinauf kommen mochte, legte er sich auf einen Ast, zog seinen Degen aus und stach dem Bären in den Kopf und gab ihm gar manche Wunde. Der Bär war zornig, ließ seine vordern Tatzen von dem Baum und schlug nach Fortunatus so grimmig, daß ihm die hintern auch davon entwischten. Er fiel hinter sich von dem Baum herunter und machte ein groß Prasseln, daß es im Wald erscholl: da flohen die andern Tiere alle, so schnell sie mochten. Nun waren sie alle hinweg bis auf den gefallenen Bären, der lag unter dem Baum und war so hart gefallen, daß er nicht von der Stelle kommen konnte, doch nicht gar tot. Fortunatus saß auf dem Baum und getraute sich nicht hinab, doch schläferte ihn so sehr, daß er fürchtete, wenn er entschliefe, so möchte er vom Baum sich lahm oder gar zutode fallen. Endlich stieg er mit klopfendem Herzen hinab, nahm seinen Degen und erstach den Bären, legte seinen Mund auf des Bären Wunden und saugte das warme Blut in sich, daß es ihm ein wenig Kraft gäbe. Da gedachte er, hätte ich jetzund Feuer, ich wollte mich des Hungers wohl erwehren. Doch war ihm des Schlafs so not, daß er sich neben den toten Bären legte und entschlief, und tat einen guten Schlaf bis morgens gegen den Tag: da erwachte er und sah ein schönes Frauenbild vor sich stehen.
Fortunatus fing an Gott inniglich zu loben und sprach: O allmächtiger Gott; ich sage dir Dank, daß ich doch einen Menschen sehe vor meinem Tod, und sprach: O liebe Jungfrau, ich bitte euch durch die Ehre Gottes, ihr wollt mir helfen und raten, daß ich aus diesem Wald komme, denn es ist heute der dritte Tag, daß ich in diesem Wald umgehe ohne alle Speis, und er sagte, wie es ihm mit dem Bären ergangen wäre. Sie hub an und sprach: Woher bist du? Er sprach: Ich bin aus Cypern. Sie sagte: Was suchst du hier zu Lande? Er sprach: Mich zwingt die Armut, daß ich hier umherschweife und suche, ob Gott mir so viel Glück verleihe, daß ich zeitliche Nahrung haben möchte. Sie sprach: Fortunatus, erschrick nicht, in bin Fortuna, Fortuna ist der lateinische Name der Göttin des unberechenbaren Schicksals, die den Menschen Glück und Unglück zuteilt. (Im deutschen Götterhimmel heißt sie »Frau Sälde«). Ihr Name mag in Deutschland durch die Theologen oder die damals auflebende Beschäftigung mit den Werken der alten Heiden bekannt geworden sein. und durch des Himmels Einfluß und der Planeten und Sterne sind mir sechs Tugenden vertraut, von welchen ich eine, zwei, mehrere oder alle verleihen darf, doch je nach dem Stand der Gestirne: nämlich Weisheit, Reichtum, Stärke, Gesundheit, Schönheit und langes Leben. Erwähle dir eine von den sechsen und bedenke dich nicht lang, denn deine Stunde, das Glück zu erwerben, ist schier schon verlaufen. Also bedachte er sich nicht lange und sprach: So begehre ich Reichtum, daß ich immer Geld genug habe. Alsbald zog sie einen Seckel heraus, gab ihn dem Fortunatus und sprach: Nimm den Seckel, und so oft du darein greifst, in welchem Lande du auch sein magst, so oft findest du zehn Stück Goldes, desselben Landes Währung. Und dieser Seckel soll diese Tugend behalten während deines oder deiner ehelichen Kinder Leben, hernach nicht mehr; und wenn er auch aus euern in andere Hände käme, so hat er doch noch diese Tugend und Kraft: darum nimm ihn wohl in Hut. Fortunatus, wie sehr ihn hungerte, so gab ihm der Seckel und die Hoffnung Kraft, daß er sprach: O allertugendreichste Jungfrau, weil ihr mich also herrlich begabt habt, so ist es billig, daß ich um euretwillen auch etwas zu tun pflichtig sei und der Guttat nicht vergesse, so ihr mir getan habt. Die Jungfrau hub an und sprach gar gütlich zu Fortunatus: Dieweil du so willig bist, mir etwas zu vergelten, um die Guttat, so dir von mir geschehen ist, so will ich dir drei Dinge befehlen, die du dein Lebtag immer auf den heutigen Tag um meinetwillen tun sollst: Zum ersten, sollst du den heutigen Tag feiern, zum andern, kein Weib minnen, zum dritten, alle Jahr auf diesen Tag, in welchem Lande du auch seist, acht haben, wo ein armer Mann eine mannbare Tochter habe, der er gern einen Mann gäbe und es vor Armut nicht vermag: die sollst du anständig kleiden, so auch Vater und Mutter, und sie erfreuen mit vierhundert Stück Goldes von des Landes Währung: zum Gedächtnis, daß du heut erfreut bist worden von mir, so erfreue du alle Jahr eine arme Jungfrau.
Fortunatus antwortete ihr und sprach: O allertugendreichste Jungfrau, ihr sollt ohne Sorge sein, ich will diese Dinge redlich und unverbrüchlich halten, wie ich es jetzt in mein Herz eingedrückt und gefaßt habe zu unvergeßlichem Andenken. Doch bei dem allen lag er Fortuna auch an, daß er aus dem Wald käme, und sprach: O wohlgestalte Jungfrau, nun ratet und helfet, daß ich aus diesem Walde komme. Sie sprach: Daß du dich in diesem Wald verirrt hast, was du für ein Unglück hieltest, das ist dir zum Glück ausgeschlagen. Und sprach zu ihm: Folge mir nach! Da führte sie ihn quer durch den Wald auf einen gebahnten Weg und sprach zu ihm: Diesen Weg gehe gerad vor dich hin und kehre dich nicht um, siehe auch nicht, wo ich hinkomme; tust du das, so kommst du bald aus dem Wald. Also tat Fortunatus nach der Jungfrau Rat, so gut er konnte, und ging den Weg eilends vor sich hin und kam aus dem Wald. Da sah er vor sich ein großes Haus, das war eine Herberge, wo gemeiniglich die Leute aßen, welche durch den Wald reisen wollten. Und als Fortunatus nahe zu der Herberg kam, da saß er nieder, zog den Gabseckel aus dem Busen, und wollte sehen ob es wahr wäre, was ihm gesagt worden, auch damit er davon hätte zu zehren, indem er kein ander Geld hatte: griff also in den Seckel und zog heraus zehn Kronen. Des ward er froh und ging mit großen Freuden in das Wirtshaus und sprach zum Wirt, daß er ihm zu essen gäbe, denn ihn hungre sehr, er wollte es ihm wohl bezahlen. Das gefiel dem Wirt sehr wohl, trug ihm ehrlich auf, das beste, so er hatte.
Fortunatus sättigte sich seines Hungers, blieb zween Tage da, ließ es sich wohl schmecken auf den ausgestandenen Hunger, bezahlte den Wirt nach seinem Verlangen und hub an zu wandern.
Nun war ein Schloß und kleines Städtlein zwei Meilen von dem Wald, darauf ein Graf wohnte, den man den Waldgrafen nannte, der trug die Gerechtigkeit den Wald zu beschirmen von dem Herzog von Britannia zu Lehen Britannia ist hier die französische Halbinsel Bretagne zwischen Kanal und Ozean, die ihren Namen von den aus England und Wales (Britanien) eingewanderten Kelten erhalten hatte. Sie war bis 1491 ein ziemlich selbständiges Herzogtum.. Dahin kam Fortunatus zu dem besten Wirt, ließ sich wohl aufwarten und fragte den Wirt, ob hie nicht hübsche Rosse zu kaufen wären. Er sagte: Es ist ein fremder Kaufmann gestern hergekommen wohl mit fünfzehn hübschen Pferden, der will auf die Hochzeit, so der Herzog von Britannien halten soll mit des Königs Tochter von Aragonia In Spanien bestanden um die Mitte des 15. Jahrh. neben dem Reiche der Mauren in Granada eine Reihe kleiner christlicher Königreiche. Das Reich Aragonien lag an den Pyrenäen auf beiden Seiten des Ebro, durch Navarra vom Ozean und durch Katalonien (damals im Besitz der Mauren) vom Mittelmeer getrennt. Durch Eroberungen im Mittelmeer (Sardinien, Sizilien) war Aragonien im 15. Jahrh. eine zeitlang Hauptmacht am Mittelmeer. (S. Anmerk. 42.): der hat drei Rosse unter seinen fünfzehn, dafür will ihm unser Herr, der Graf, dreihundert Kronen geben; er will aber dreihundert und zwanzig Kronen haben, und ist der Streit um zwanzig Kronen. Fortunatus ging heimlich in seine Kammer, nahm aus seinem Seckel sechshundert Kronen und tat die in einen andern Seckel, ging zum Wirt und sprach: Wo ist der Mann mit den Rossen? Hat er so hübsche Rosse, so wollt ich sie gern sehen. Der Wirt sprach: Ich fürchte, er läßt sie euch nicht sehen: unser Herr, der Graf, hat kaum vermocht, daß er sie ihn hat sehen lassen. Fortunatus sagte: Gefallen mir die Rosse, so mag ich sie eher kaufen denn der Graf. Dem Wirt bedeuchte es spöttlich, daß er so reichlich redete und nicht Kleider darnach anhatte, auch zufuße ging: doch führte er ihn zu dem Roßtäuscher und redete so viel mit ihm, daß er ihn die Rosse sehen ließ. Er musterte sie, und alle gefielen ihm wohl, doch wollte er nur die drei, so der Graf kaufen wollte. Er hatte auch wohl verstanden, daß der Streit um zwanzig Kronen gewesen war, zog gleich heraus und gab ihm dreihundert und zwanzig Kronen und hieß die Rosse in sein Wirtshaus führen; darauf schickte er nach dem Sattler, hieß ihn Sattel und Zeug gar köstlich machen und befahl dem Wirt, daß er ihm zu zwei reisigen Knechten verhülfe: denen wollte er guten Sold geben. Dieweil er aber so verfuhr, ward der Graf inne, daß Fortunatus die Rosse gekauft hatte: darob hatte er großen Unwillen und griesgramte bei sich selbst, denn die Rosse gefielen ihm wohl; er hätte sie der zwanzig Kronen willen nicht gelassen, denn er wollte auf die Hochzeit und sich da auch sehen lassen; und im Zorn schickte er seiner Diener einen zu dem Wirt und ließ ihn fragen, was Manns der wäre, der ihm die Rosse vor der Hand weggekauft hätte? Der Wirt sagte, er kenne ihn nicht, er wäre in seine Herberg gekommen zufuß und in armen Kleidern und hätte zu ihm gesagt, er sollt es ihm wohl erbieten, er werde es ihm wohl bezahlen. Und der Wirt sprach: Er gefiel mir so wohl, wenn er einmal bei mir gegessen hätte, ich hätte ihm zum zweitenmal nichts gegeben, ich wäre denn zuvor für die erste Mahlzeit bezahlt gewesen. Der Knecht ward zornig auf den Wirt und fragte, warum er mit ihm gegangen wäre, die Rosse zu kaufen. Er sprach: Ich habe getan, wie ein jeder frommer Wirt seinem Gast tun soll, wie er auch mit Ehren wohl tun darf: er bat mich, mit ihm zu gehen; ich hätte aber nicht gemeint, daß er einen Esel hätte mögen bezahlen.
Der Knecht kam zum Grafen und sagte ihm, was er vernommen hatte. Als der Graf hörte, daß er kein geborner Edelmann war, sprach er zu den Dienern in großem Zorn: Gehet hin und fahet den Mann, er hat das Geld gestohlen, oder einen andern drum ermordet. Also fingen sie ihn, führten ihn in ein übel Gefängnis und fragten, von wannen er wäre. Er sagte, daß er von Cypern wäre, aus einer Stadt Famagusta. Sie fragten ihn, wer sein Vater wäre. Er sprach: Ein armer Edelmann. Das hörte der Graf gern, daß er also von fernen Landen war, und ließ ihn weiter fragen, von wannen ihm das bare Geld käme, daß er also reich wäre. Er sagte, es wäre sein, er verhoffte, daß er nicht schuldig wär zu sagen, von wannen ihm sein Geld käme: wär aber jemand, der ihn beschuldigte, daß er ihm Gewalt oder Unrecht getan, dem wollt er Antwort geben vor seinen Gnaden. Der Graf sprach: Dir hilft keine Ausrede, du mußt sagen, von wannen dir das Geld kommt. Und ließ ihn an die Stätte führen, wo man die Übeltäter marterte. Als Fortunatus sah, wie man mit ihm umgehen wollte, erschrak er sehr; doch dachte er in seinem Gemüt, er wollte lieber sterben, denn die Tugend des Seckels sagen. Und als er also hing mit schwerem Gewicht beladen, sagte er, daß man ihn ablösen sollte, so wollte er sagen was man ihn fragte. Und als er herab kam, sprach der Graf: Nun sage, von wannen kommen dir so viel guter Kronen? Er fing an und sagte: Wie ich im Wald verirrt gewesen bis an den dritten Tag ohne Speis und Trank, und da mir Gott die Gnade gab, daß ich aus dem Wald kam, fand ich einen Seckel, darin waren sechshundert und zehn Kronen. Der Graf sprach: Wo ist der Seckel? Fortunatus sprach zu dem Grafen: Da ich das Geld gezählt, tat ich's in meinen Seckel und warf den leeren Seckel in das Wasser, so vor dem Wald fleußt. Der Graf sprach: O du Schalk, wolltest du mir das Meine entfremden? Du sollst wissen, daß mir dein Leib und Gut verfallen ist, denn was in dem Wald ist, das gehört mir zu und ist mein eigen Gut. Fortunatus sprach: Gnädiger Herr, ich habe um solche Eure Gerechtigkeit nicht gewußt, sondern lobte Gott, und hielt es für Gottes Gabe. Der Graf sagte: Mir liegt nichts daran, daß du es nicht gewußt hast: hast du nicht gehört, wer nicht weiß, der soll fragen? Und kurz um, richt dich darnach, heut nehm ich dir all dein Gut, und morgen das Leben. Fortunatus gedachte bei sich selbst: O ich Armer, ich hatte die Wahl unter den sechs Gaben, warum erwählte ich nicht Weisheit für Reichtum? So wär ich jetzt nicht in großer Angst und Not. Da fing er an Gnade zu begehren: O gnädiger Herr habt mit mir Armen Barmherzigkeit: wozu ist Euch mein Sterben nutz? Nehmt Euer gefundenes Gut und laßt mir das Leben, so will ich Gott treulich für Euch bitten die Zeit meines Lebens. Dem Grafen kam es hart an, ihn leben zu lassen, denn er sorgte, wo er hinkäme und solches von ihm klagte, würde es ihm zur Schande gereichen bei frommen Fürsten und Herren. Doch erbarmte er sich und schenkte ihm das Leben: aber morgens früh vor Tag ließ er ihn aus der Stadt führen und schwören, sein Lebtag nicht mehr in des Grafen Land zu kommen, was er auch tat. Fortunatus war heimlich froh, daß er noch so davon kam, denn hätte der Graf die rechte Sache gewußt, er wäre also nicht davon gekommen.
Da Fortunatus also ledig war, durfte er nicht über seinen Seckel gehen, daß er Geld nähme und zehrte, ging also zwei Tagreisen betteln, denn er sorgte, fände man, daß er Geld hätte, möchte man ihn wieder fangen. Indem kam er gen Nantes, einer Hauptstadt von Britannien, die liegt am Meer und ist ein Seehafen. Da lag viel Volks von Fürsten und Herren, die alle auf die Königin warteten. Da tat man nichts als stechen, tanzen und alle Freud und Wollust treiben: das sah er gerne, gedachte aber, sollt ich auch mit machen, wie ich es denn wohl vermag, so möcht es mir hier gehen wie mit dem Waldgrafen. Doch kaufte er zwei schöne Rosse und dingte einen Knecht, bekleidete sich und seinen Knecht gar schön, ließ die Pferde wohl zurichten und ritt in die beste Herberge, so zu Nantes war, wollte also die Hochzeit sehen und das Ende der Festlichkeiten erwarten. Die Königin kam übers Meer her, da schickte man ihr viel stattliche Schiffe entgegen, sie herrlich zu empfangen. Aber noch köstlicher ward sie empfangen, da sie an das Land kam, von ihrem Herrn und Gemahl und von andern Fürsten und Herren. Also hatte der Herzog eine prächtige Hochzeit, die währte sechs Wochen und drei Tage.
Fortunatus sah das alles und hatte ein Wohlgefallen daran, tät auch nichts anders, denn daß er gen Hof ging und ritt. Wenn er aber ausritt, ließ er nichts in der Herberge: das gefiel dem Wirt nicht, denn er kannte ihn nicht und besorgte, er ritte ohne Zahlung hinweg, wie ihm vormals mehr geschehen war, und noch auf solchen Hochzeiten geschieht. Drum sprach er zu Fortunatus: Mein lieber Freund, ich kenne euch nicht, tut so wohl, und bezahlt mich alle Tage. Fortunatus lachte und sprach zu ihm: Lieber Wirt, ich will nicht unbezahlt wegreiten; zog also aus seinem Seckel hundert gute Kronen, gab sie dem Wirt und sprach: Das Geld nehmt, und wenn euch bedünkt, daß ich und die mit mir kommen, mehr verzehrt haben, will ich euch mehr geben: ihr braucht mir keine Rechnung zu legen. Der Wirt nahm das Geld und fing an, Fortunatus in Ehren zu halten: wo er an ihm vorbeiging, griff er an seine Kappe, setzte ihn zu den Vornehmsten oben an die Tafel, gab ihm auch eine schönere Kammer ein, als er zuvor gehabt hatte.
Als Fortunatus bei andern Herrn am Tische saß, kamen mancherlei Sprecher und Spielleute vor der Herren Tisch, den Leuten Kurzweil zu machen, auch daß sie Geld verdieneten. Nun kam ein alter Edelmann und klagte den Herren seine Armut und sagte, er wär ein Edelmann aus Hibernia geboren Hibernia war der bei den Griechen und Römern gebräuchliche Name für die von Kelten bewohnte Insel Irland. Der Name kommt von dem keltischen Worte Erin, d. i. Westinsel. Daraus haben sich sowohl Hibernia als Irland gebildet. Bis ins frühe Mittelalter hieß die Insel auch Großschottland., und wär sieben Jahre umhergezogen, hätte zwei Kaisertümer und zwanzig christliche Königreiche durchfahren; mehr wären ihrer nicht in der Christenheit. Er hätte sich verzehrt und begehrte, daß sie ihm beisteuerten, damit er wieder heim käme. Da war ein Graf an der Tafel, der sprach: Wie heißen die Reiche alle? Der Edelmann fing an, sie nacheinander aufzuzählen und sprach: Es ist kein Königreich, das nicht drei oder vier Herzoge unter sich hat, ohne die Fürsten und Herren, weltliche und geistliche, die Land und Leute haben. Die hab ich alle besucht, und von jedem Land, das eine besondere Sprache hat, so viel begriffen, daß ich zur Notdurft mit den Leuten reden kann. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wie jeder König und Herzog heißt, da ich an seinem Hof war, und wie weit ein Königreich von dem andern ist. Der Graf sprach: Ich wollte wohl, daß ich an allen Orten mit gewesen wäre, jedoch müßt ich jetzt wieder hier sein. Ich glaube wohl, daß es viel Zeit und Geld braucht, die Länder alle zu besehen. Der Edelmann sprach: Ja Herr, es wird einer Gutes und Böses innen, man muß manche elende Herberge sich gefallen lassen und große Verschmähung leiden. Der Graf schenkte ihm vier Kronen und sagte zu ihm, wenn es ihm gefiele, so möchte er da bleiben: so lange die Feste währten, wollte er für ihn zahlen. Jener dankte ihm und sagte, ihn verlange heim zu den Seinen, nachdem er so lange ausgewesen; und dankte ihm der getanen Schenkung.
Nun hatte Fortunatus wohl gemerkt auf die Reden des alten Edelmanns; da gedachte er bei sich, möchte er mir melden, daß er mich durch die Länder führte, ich wollte ihn reichlich begaben. Sobald nun die Mahlzeit aus war, schickte er nach ihm und fragte, wie er mit Namen heiße. Er sprach: Leopoldus. Fortunatus sprach: Ich habe verstanden, wie du so weit gereist und an viel königlichen Höfen gewesen bist. Ich bin jung und wollte gern in meinen jungen Tagen reisen, weil ich's vermag: möchtest du mich also führen, so wollte ich dir ein Pferd geben und einen Knecht dingen, dich halten als meinen Bruder, dazu dir guten Sold geben. Leopoldus sprach: Ich möchte leiden, daß man mich ehrlich hielte und dazu genug gäbe. Ich bin aber alt und hab Weib und Kind: die wissen von mir nichts, und die natürliche Liebe zwingt mich, wieder zu ihnen zu kommen.
Er sprach: Leopoldus, entschließ dich meinen Willen zu vollbringen, so will ich mit dir gen Hibernia und will dein Weib und Kind, so sie noch am Leben, anständig begaben, und wenn wir unsere Reise vollbracht haben und wir gen Famagusta (in Cypern gelegen) kommen, will ich dich mit Knechten und Mägden, wenn es dir gefällt, dein lebenlang versehen. Leopoldus gedachte, der junge Mann verheißt mir viel: wär ich der Sache gewiß, so wär es ein Glück in meinem Alter. Und sprach zu ihm: Ich will euch zu willen werden, sofern ihr euerm Verheißen genug tut und es auch ausführen könnt. Und fangt es nicht an, so ihr nicht viel bar Geld habt oder aufzubringen wißt, denn ohne Geld kann es nicht geschehen. Fortunatus sprach zu Leopold: Sorget nicht, ich weiß in jedem Land genug Geld aufzubringen, darum verheiß du mir bei mir zu bleiben und die Reise auszuführen. Er sprach: So verheißet mir auch das, was ihr mir versprochen habt. Also gelobten sie beide je einer dem andern bei guten Treuen, einander nicht zu verlassen in keiner Not. Als sie nun einig geworden, zog Fortunatus gleich zweihundert Kronen heraus, gab sie Leopoldus und sagte: Gehe hin und kaufe zwei hübsche Pferde, spare kein Geld und dinge dir einen eigenen Knecht, und wenn er dir nicht gefällt, so dinge dir einen andern, und wenn du kein Geld mehr hast, so will ich dir mehr geben und dich nicht ohne Geld lassen. Das gefiel Leopolden wohl und gedachte, es wäre ein guter Anfang: da rüstete er sich nach ganzer Lust; desgleichen tat Fortunatus: er nahm nicht mehr denn zwei Knechte und einen Knaben, also daß ihrer sechs waren, und sie wurden eins, wie sie die Länder und Königreiche durchfahren und zuerst das römische Reich besehen wollten Das römische Reich: d. h. das heilige römische Reich deutscher Nation, der Staatenverein, den Karl der Große gegründet und über den der sogenannte deutsche Kaiser im 15. Jahrh. noch eine nominelle Hoheit ausübte. Da auch viel romanische und slavische Länder dazu gezählt wurden, hatte es einen viel größeren Umfang als das heutige deutsche Reich.: ritten also zunächst nach Nürnberg, auf Donauwörth und Augsburg, Nördlingen, Ulm, Constanz, Basel, Straßburg, Mainz, Köln. Nachdem aber zogen sie von Köln gen Brügge in Flandern, und von Brügge gen London, in die Hauptstadt des Königs von England, sind vier Tagreisen, darnach von London gen Edinburg, ist eine Hauptstadt in Schottland, und ist neun Tagreisen voneinander.
Und als sie dahin gekommen waren, hatten sie noch sechs Tagreisen nach Hibernia, d. i. Irland, in die Stadt, darin Leopoldus daheim war. Da bat Leopoldus seinen Herrn Fortunatus, mit ihm dahin zu reiten, was er ihm gern verwilligte. Sie fuhren also gen Hibernia und kamen in die Stadt Waldrik Waldrik, eine Verdeutschung des keltischen Ortsnamens Valdric., wo Leopoldus daheim war. Der fand Weib und Kind, wie er sie gelassen hatte, doch sein Sohn hatte ein Weib genommen und seine Tochter einen Mann; sie waren alle seiner Ankunft froh. Weil aber Fortunatus wußte, daß nicht viel Übriges da war, gab er dem Leopold hundert Nobel, daß er alle Sachen reichlich zurichtete, so wollt er zu ihm kommen und fröhlich mit ihm sein. Also ließ Leopold alle Sachen gar köstlich zurichten und lud dazu seine Kinder samt Mann und Weib und andere gute Freunde, und hielt also köstlich Hof, daß es jedermann freute in der ganzen Stadt. Fortunatus war fröhlich mit ihm, und als er gegessen hatte, rief er Leopold und sagte zu sich: Du sollst Urlaub nehmen von Weib und Kindern: nimm hier drei Seckel, in jedem sind fünfhundert Nobel (einer besser denn dritthalb Gulden rheinisch) Da aus der Mark (ca. 250 g) Reingold ursprünglich 70 Goldgulden geprägt wurden, müßte man den Nobel auf einen Goldgehalt von etwa 10 g berechnen, was nach dem jetzigen Goldwerte etwa 28 Reichsmark ergibt. Da aber sowohl Gewicht als Feingehalt der Goldmünzen im 15. Jahrh. sehr verschlechtert waren, ist die Rechnung höchst unsicher. Der Kaufwert des Goldes war damals natürlich weit höher als heute.; einen sollst du deinem Weib, den andern deinem Sohn, und den dritten deiner Tochter zur Letze Es war allgemeine Sitte, daß der Gast beim Abschied den Gastgeber, vornehmlich die Hausfrau beschenkte. Diese ursprünglich zur Bestreitung eines Abschiedmahles bestimmte Gabe, wurde Letzt oder Letze genannt. Ein Rest dieser Sitte ist unser Brauch, den Dienstboten des Wirtes Trinkgelder zu geben. lassen, daß sie Zehrung haben. Da ward er froh, dankte ihm der großen Gabe und erfreute damit Weib und Kinder.
Nun hatte Fortunatus gehört, daß noch zwei Tagreisen bis in die Stadt wären, da St. Patricius' Fegfeuer ist (liegt in Hibernia), das wollt er auch beschauen. Sie ritten mit Freuden in die Stadt Wernichs, darin ist eine große Abtei, und in derselben Kirche hinter dem Fronaltar Fronaltar d. i. Altar des Herrn, der Altar, in dem das heilige Sakrament aufbewahrt wird. Der Altar wird jetzt meist Hochaltar genannt, weil er auf dem erhöhten Chor der Kirche steht. ist die Tür, da man geht in die finstere Höhle, die genannt ist St. Patricius' Fegfeuer Sankt Patrizius, gewöhnlich Patrik genannt, der Apostel und Schutzheilige Irlands, war ein sagenhafter Heiliger, der nach der gewöhnlichen Überlieferung im 4. Jahrh. in Schottland geboren wurde und um 430 als Missionar und Bischof nach Irland kam, die Inselbewohner bekehrte und ein reiches kirchliches Gemeinde- und Schulwesen begründete. Die hier genannte Höhle lag auf einer Insel des Flusses Dery in der Provinz Ulster und wurde schon am Ende des 12. Jahrh. von vielen Pilgern aufgesucht. Doch wurde sie wegen mancherlei Mißbräuche nach 1492 auf päpstlichen Befehl geschlossen.. Nun läßt man niemand darein ohne des Abts Erlaubnis. Leopold ging zum Abt und bekam Urlaub, daß sie hinein durften; doch fragte der Abt von wannen der Herr wäre. Er sagte ihm, er wäre von Cypern. Darauf lud der Abt Fortunatus und die Seinen zugaste, was Fortunatus sich zu großer Ehre aufnahm, und als er zu der Mahlzeit gehen wollte, kaufte er ein Faß des besten Weins, so er fand, und schenkte es dem Abt, weil der Wein sehr teuer da ist. Der Abt nahm es zu großem Dank an, indem sonst wenig Wein im Kloster gebraucht ward, als zu dem Gottesdienst.
Als sie nun die Mahlzeit vollbracht hatten, fing Fortunatus an und sprach: Gnädiger Herr, ist es nicht wider Eure Würde, so begehre ich zu wissen, woher es kommt, daß gesagt wird, daß hie St. Patricius Fegfeuer sei? Der Abt sprach: Das will ich euch sagen: Es ist vor vielen Jahren hier, wo jetzt die Stadt und das Gotteshaus liegt, eine wilde Wüste gewesen, und nicht fern von hinnen war ein Abt Patricius genannt, gar ein andächtiger Mann, der ging oft her in diese Wüste um Buße zu tun, und einmal fand er diese Höhle, die sehr lang und tief ist: darein ging er so weit, daß er nicht herauszukommen wußte. Da fiel er auf seine Kniee und bat Gott, wäre es nicht wider seinen göttlichen Willen, daß er ihm aus der Höhle hülfe. Dieweil er Gott mit großer Andacht bat, hörte er noch weiter ein jämmerlich Geschrei, als ob da eine Menge Leute gepeinigt würden. Darob erschrak er sehr; doch verlieh ihm Gott, daß er wieder aus der Höhle kam. Dafür dankte er treulich Gott, kam in sein Kloster, und war frömmer denn vorher. Dahin ist nun durch andächtige Leute dieses Kloster gebaut worden. Fortunatus sagte: Was sagen die Pilger, so sie heraus kommen? Der Abt sprach: Ich frage keinen, doch sagen etliche, sie haben gehört elendiglich rufen; so haben andere nichts gehört noch gesehen, als daß ihnen sehr gegraust hat. Fortunatus sprach: Ich bin von fern hieher gekommen, und sollte ich nicht in die Höhle gehen, wo man das von mir sagte, wär es mir ein Schimpf. Ich will also nicht von hinnen, ohne in das Fegfeuer gegangen zu sein.
Der Abt sagte ihm: So ihr denn hinein wollt, so gehet nicht zu weit, denn es sind viel Abwege darin, daß man sich leichthin verirren mag, wie etlichen bei meinem Gedenken geschehen ist, die man erst am vierten Tage gefunden hat. Fortunatus fragte Leopold, ob er mit ihm darein wollte? Er sagte: Ja, ich gehe mit euch und will bei euch bleiben, so lang mir Gott das Leben verleiht. Das gefiel Fortunatus. Morgens früh schickten sie sich, und empfingen das heilige Sacrament, darnach schloß man ihnen die Tür der Höhle auf, die hinter dem Frohnaltar in dem Kloster ist, da traten sie hinein, die Priester gesegneten sie und schlossen die Tür hinter ihnen, die nicht eher aufgetan ward als den andern Morgen um die Zeit, wo sie hineingegangen waren: so geschah es alle Tage. Da gingen sie in der Finsternis die Höhle tief hinab, wie in einen Keller, bis sie auf ebenen Boden kamen: da nahmen sie sich bei den Händen, damit sie nicht voneinander kämen, und gingen vorwärts, um bis an das Ende der Höhle zu gelangen und dann umzukehren. Sie fanden aber kein Ende und wurden einig, wieder an den Eingang der Höhle zu gehen, konnten aber nicht dazu kommen und gingen so lange, bis sie müde wurden. Sie setzten sich zur Ruh und hofften, wenn man ihnen an der Tür riefe, würden sie es hören und dem Ton nachgehen können, um hinaus zu kommen. Als man aber des Morgens die Tür aufschloß und ihnen rief, waren sie so weit entfernt, daß sie es nicht hören konnten: da schloß man die Tür wieder zu. Nun war den beiden ein Grausen angekommen, daß sie nicht mehr wußten, wie lange sie in der Höhle seien. Sie gingen hin und her und wußten nicht aus noch ein; der Hunger fiel sie an, sie huben an zu verzagen und ihr Leben verloren zu geben. Fortunatus fing an und sprach: O allmächtiger Gott, nun komm uns zuhülfe, denn hier hilft weder Gold noch Silber! Sie setzten sich wieder nieder wie verzweifelte Leute und hörten und sahen nichts. Am dritten Morgen kamen die Priester, schlossen die Pforte der Höhle abermals auf und riefen. Als aber niemand Antwort gab, gingen sie zu dem Abt und sagten ihm das Leid, besonders um Fortunatus, der ihnen so guten Wein geschenkt hätte. Auch liefen ihre Knechte und gehuben sich gar übel um die Herren.
Der Abt wußte einen alten Mann, der vor vielen Jahren die Höhle mit Schnüren abgemessen. Zu dem schickte er und sprach, er sollte sehen, ob er die Männer herausbringen könne. Die Knechte verhießen ihm hundert Nobel. Er sprach: Sind sie noch am Leben, so bringe ich sie heraus. Er rüstete sich mit seinem Gezeuge und ging hin, schlug sein Instrument ein und durchsuchte eine Höhle nach der andern, bis er sie fand. Des waren sie froh, indem sie ganz ohnmächtig und schwach geworden. Also hieß er sie, daß sie sich an ihm hielten wie ein Blinder an einem Sehenden; er aber ging der Schnur nach, die er an sein Instrument befestigt hatte, und mit der Hülfe Gottes und des alten Mannes kamen sie wieder zu den Leuten. Des war der Abt froh, und hätte gar ungern gewollt, daß die Pilger wären verloren worden, denn er besorgte, es würden keine Pilger mehr dahin kommen, wodurch ihm und seinem Kloster großer Gewinn abgehen würde. Wohl möchte einer sprechen: Warum geht man nicht mit Lichtern oder Laternen in die Höhle? Es ist zu wissen, daß die Höhle keinerlei Licht leidet. Nun sagten die Knechte dem Fortunatus, wie sie diesem alten Mann hundert Nobel verheißen, daß er sie gesucht hätte: die gab er ihm bar und mehr mit großem Dank, und ließ in der Herberg ein köstlich Mal zurichten, lud den Abt und alle seine Brüder dazu und lobte Gott, daß er ihm abermals aus einer großen Angst geholfen, und ließ dem Abt und Kloster hundert Gulden zum Abschied, daß sie Gott für ihn bitten sollten. Also nahmen sie Urlaub von dem Abt und traten ihre Reise an, ritten zurück den nächsten Weg gen Calais, denn hinter Hibernia ist es so wild, daß man nicht weiter kommen mag, und ritten gen St. Jobst in der Picardie Sankt Jobst in der Picardie ist wahrscheinlich der Ort Saint Just en Chaussee im Departement Oise, nördlich von Clermont., darnach gen Paris, durch Frankreich, durch Hispanien, durch Neapolis, durch Rom bis gen Venedig.
Da sie nun zu Venedig waren, hörten sie, wie der Kaiser von Konstantinopel einen Sohn hätte, den wollte er zum Kaiser krönen lassen, damit er das Regiment schon bei seinem Leben anträte, denn er war alt. Das hatten die Venediger vernommen: da richteten sie eine Galeere zu und schickten eine stattliche Gesandtschaft mit vielen köstlichen Kleinodien, die sie dem neuen Kaiser schenkten. Die Stelle bezeugt, daß zur Zeit, als der Fortunatusroman geschrieben wurde, die Türken Konstantinopel noch nicht erobert hatten, sondern hier noch ein griechischer Kaiser herrschte. (Anmerk. 29 und 42) Die griechische Herrschaft beschränkte sich auf die Stadt und ihre nächste Umgebung und stützte sich mehr auf die Flotten der Venediger als auf die eigene Kraft. Da ging Fortunatus und dingte sich und seine Leute auch auf die Galeere und fuhr mit den Venedigern gen Konstantinopel, welches eine große Stadt ist. Dahin kam auch so viel Volk, daß man keine Herberge finden konnte. Den Venedigern ward ein eignes Haus angewiesen, sie wollten aber keinen Fremden bei sich haben. Nun suchte Fortunatus lange nach einem Hause für sich und sein Volk, zuletzt fand er einen Wirt, der ein Dieb war. Bei dem waren sie zur Herberge und gingen alle Tage und sahen dem Fest und den prächtigen Aufzügen zu, davon viel zu schreiben wäre. Ich will aber nur erzählen, wie es Fortunatus ergangen ist.
Als Fortunatus alle Tage zu dem Fest ausging, hatten sie eine eigne Kammer, die verschlossen sie und meinten, damit wär ihre Sache versorgt. Aber der Wirt hatte einen heimlichen Eingang in Fortunatus' Kammer mittels einer hölzernen Wand, daraus er ein Brett nehmen und wieder zutun konnte, daß es niemand merkte: dadurch ging er aus und ein. Während sie bei dem Fest waren, hatte er ihre Bündel und Mantelsäcke durchsucht, darin er kein bar Geld fand, was ihm fremd vorkam und gedachte, sie trügen das Geld bei sich eingenäht in den Wämsern. Als sie nun etliche Tage bei ihm gezehrt hatten, rechneten sie mit dem Wirt: da gab er acht, woraus er das Geld gäbe und sah, daß Fortunatus Geld unter dem Tisch hervorbrachte und es Leopold gab, welcher den Wirt bezahlte. Nun hatte Fortunatus Leopold befohlen, daß er keinem Wirt etwas abbrechen sollte: was einer begehrte, das sollte er ihm geben. Das tat er mit diesem Wirt auch: das gefiel ihm wohl, doch genügte es ihm nicht, er hätte gern alles und den Seckel zum Geld gehabt.
Nun war der Tag nahe, wo Fortunatus verheißen hatte, einer armen Tochter einen Mann zu geben und sie zu begaben mit vierhundert Stück Goldes von des Landes Währung. Er hub also an und fragte den Wirt: ob er nicht einen Mann wüßte, der eine fromme Tochter hätte, die mannbar wäre, ihr aber von Armut wegen keinen Mann geben könnte. Er sollte den Vater zu ihm schicken, so wollt er ihm die Tochter anständig aussteuern. Der Wirt sprach: Ja, ich weiß ihrer mehr denn eine, und morgen will ich euch einen frommen und ehrbaren Mann zuführen; er soll auch seine Tochter mit hieher zu euch bringen. Das gefiel Fortunatus gar wohl. Was dachte sich aber der Wirt? Ich will ihnen noch diese Nacht das Geld stehlen, dieweil sie noch haben, denn warte ich länger, so geben sie es aus. Und in der Nacht stieg er durch das Loch, als sie hart schliefen, durchsuchte ihre Kleider und vermeinte große Flicken mit Goldstücken unter ihren Wämsern zu finden; er fand aber nichts. Da schnitt er Leopold den Seckel ab, darin waren 10 Dukaten; desgleichen tat er Fortunatus; als er aber den Seckel hervorbrachte und ihn von außen befühlte und nichts darin war, da warf er den Seckel unter die Bettstatt. Darauf ging er zu den drei Knechten, schnitt ihnen alle die Seckel ab, darinnen er Geld fand, und öffnete Tür und Fenster, als wären Diebe von der Gasse hineingestiegen.
Und als Leopold erwachte und Tür und Fenster offen sah, fing er an seine Knechte zu schelten, und fragte, warum sie heimlich ausgingen und ihren Herrn also in Unruh setzten. Die Knechte schliefen und fuhren auf aus dem Schlaf. Ein jeder sprach, er hätte nichts getan. Da erschrak Leopold und sah bald nach seinem Seckel: der war abgeschnitten, und die Stümpf hingen an dem Gürtel. Er rief Fortunatus und sprach: Herr, unsre Kammer steht an allen Orten offen, und ist mir euer Geld, so ich noch hatte, gestohlen. Das hörten die Knechte, denen war es auch so ergangen. Fortunatus sah bald nach seinem Wams, daran er den Glückseckel trug, und fand, daß er ihm auch abgeschnitten war. Man mag denken, ob er erschrak! Ja, er erschrak so sehr, daß er ohnmächtig niedersank und lag gleich einem Toten. Leopold und die Knechte erschraken und hatten ein Leid um ihren Herrn; sie wußten aber nicht, wie groß sein Verlust war. Sie salbten und rieben ihn, bis sie ihn wieder zu seiner Vernunft brachten.
Da sie also in der größten Angst waren, kam der Wirt, stellte sich gar verwundert und fragte, was Wesens sie machten. Sie sagten ihm, ihnen wär all ihr Geld gestohlen. Der Wirt sprach: Was seid ihr aber für Leute? Habt ihr nicht eine wohl versperrte Kammer? Warum habt ihr euch nicht vorgesehen? Sie sagten: Wir hatten Fenster und Türen versperrt, nun aber alles offen gefunden. Der Wirt sprach: Seht zu, ob ihr es euch nicht selbst untereinander gestohlen habt. Es ist zwar viel fremdes Volk allhie, ich weiß nicht, was jedes kann. Als sie sich aber so übel gehuben, ging er auch zu Fortunatus und sah, wie er seine Gestalt so gar verwandelt hatte, und sprach: Ist es des Geldes viel, so ihr verloren habt? Sie sagten, es wäre nicht viel. Da sprach der Wirt: Wie mögt ihr euch denn so übel gehaben um ein gering Geld? Ihr wolltet gestern einer armen Tochter einen Mann geben: erspart das Geld und verzehrt es. Fortunatus antwortete dem Wirt gar traurig: Mir ist mehr leid um den Seckel als um das Geld, das ich verloren habe: es war ein kleines Wechselbriefchen darin, das niemand eines Pfennigs Wert nutz ist. Da der Wirt sah, daß Fortunatus so betrübt war, ward er, wiewohl er ein Schalk war, zur Barmherzigkeit bewegt, und sprach: Laßt uns suchen, ob man den Seckel nicht findet, denn keiner hat Freude an einem leeren Seckel. Er hieß die Knechte suchen, da kroch einer unter das Bett und fand den Seckel und sprach: Hie liegt ein leerer Seckel und brachte ihn dem Herrn und fragte, ob das der rechte Seckel wäre. Er sprach: Laß mich sehen ob er der rechte sei, der mir abgeschnitten ist. Da war es der rechte.
Nun fürchtete Fortunatus, weil der Seckel abgeschnitten wäre, daß er die Tugend verloren hätte; durfte aber nicht darein greifen vor den Leuten, denn ihm wäre leid gewesen, wenn ein Mensch die Tugend des Seckels gewußt hätte: er sorgte, er würde um das Leben wegen des Seckels kommen. Fortunatus legte sich wieder nieder, denn man sah wohl, daß er schwach war; und unter der Decke tat er seinen Seckel auf, griff hinein und fand, daß der Seckel noch alle Kräfte hatte wie vorher, dessen er sehr erfreut war. Doch war der Schrecken so groß gewesen, daß er nicht sobald zu seiner Farbe und Stärke kommen konnte, blieb also den Tag still liegen. Leopold wollte ihn trösten und sprach: O Herr, gehabt euch nicht so übel, wir haben noch schöne Rosse, silberne Ketten, goldene Ringe und andere Kleinodien, und so wir nicht Geld haben, wollen wir euch mit der Hülfe Gottes auch wohl heimhelfen, ich bin durch manches Königreich gezogen ohne Geld. Leopold meinte, er wäre so reich in seiner Heimat, wenn er heimkäme, daß ihm kein Verlust schaden möchte. Fortunatus redete gar ohnmächtig, und sprach: Wer das Gut verliert, verliert die Vernunft. Weisheit wäre zu erwählen vor Reichtum, Stärke, Gesundheit, Schöne und langes Leben: das mag man keinem stehlen, und damit schwieg er. Leopold verstand die Worte nicht, wußte nicht, wie er die Wahl gehabt hatte unter diesen Stücken allen, doch fragte er nicht weiter und meinte, er wüßte nicht, was er sagte in der Ohnmacht. Mit Mühe brachten sie ihn dazu, daß er aß und wieder zu sich selbst kam und seine rechte Farbe gewann.
Da hub er wieder an fröhlich zu werden; doch als es Nacht ward, befahl er den Knechten, daß sie Lichter kauften und die ganze Nacht brennen ließen und jeder sein bloßes Schwert zu sich legte, damit sie nicht mehr also beraubt würden: das geschah. Fortunatus hatte die Trümmer, so von dem Seckel abgekommen waren, gar stark wieder angemacht und ließ den Seckel, so lang er lebte, nicht mehr an dem Wams hängen, sondern bewahrte ihn allweg so wohl, daß ihm den niemand mehr stehlen konnte. Des Morgens stand er auf mit seinem Volk und ging in die Sophienkirche Die Sophienkirche (Hagia Sophia) ist das herrlichste Denkmal der altchristlichen Kunst und wurde von dem großen Griechenkaiser Justinian von 530 bis 540 erbaut. Um einen quadratischen Raum, den auf vier Pfeilern eine gewaltige Kuppel (32 m Durchmesser) überwölbt, liegt ein Kranz von Nischen und Kapellen. Seit der Eroberung Konstantinopels (1453) haben die Türken sie in eine Moschee verwandelt, und die schönen Mosaikbilder an Wänden und Decken haben sie übertüncht., darin gar eine schöne Kapelle ist, die genannt wird zu unserer lieben Frauen: da gab er den Priestern zwei Goldstücke, daß sie ein Hochamt sängen, unsrer lieben Frauen zu Lob und Ehren, dazu den Lobgesang Te Deum laudamus. Da das Amt und der Lobgesang vollbracht waren, ging er wiederum mit seinem Volk an den Platz, wo die Wechsler standen, und als er da war, hieß er die Knechte heimgehen, die Mahlzeit zuzurüsten und die Rosse zu besorgen, und gab Leopold Geld und sagte: Gehe, kaufe fünf neue Seckel, so will ich zu einem Wechsler gehen und will Geld holen: ich habe keine Freude, wenn wir ohne Geld sind. Leopold tat, was ihm befohlen war, und brachte fünf leere Seckel. Fortunatus tat bald in einen Seckel hundert Dukaten und gab sie dem Leopold, daß er ausgäbe und sich versähe, auch niemand Mangel leiden ließe: wenn er nichts mehr hätte, so wollte er ihm mehr geben. Er gab jedem Knecht einen neuen Seckel und jedem zehn Dukaten darein und sagte zu ihnen, sie sollten fröhlich sein und nur Sorge tragen, daß ihm kein Schade mehr widerführe, wie ihm zuvor geschehen wäre. Sie dankten ihm höflich und sagten, sie wollten seinem Befehl nachleben.
Fortunatus tat fünfhundert Dukaten in den fünften Seckel und schickte nach dem Wirt und sprach: Wie ich euch schon gesagt habe, wo ein frommer Mann eine mannbare Tochter hätte, dem wollt ich sie aussteuern. Er sprach: Ich weiß ihrer mehr als einen; doch will ich euch einen daher bringen und die Tochter mit ihm, daß ihr sie seht, ob sie euch recht sind. Das gefiel ihm wohl.
Der Wirt ging zu einem frommen Mann und sagte, es wär ein reicher Gast bei ihm; er sollt seine Tochter zu sich nehmen und mit ihm gehen: er hoffe, seine Sache sollte gut werden.
Der Tochter Vater war ein Schreiner, ein frommer einfältiger Mann; der sagte: Ich will meine Tochter nicht hinführen, er will sie vielleicht zu Unehren bringen und ihr dann einen Rock kaufen: damit wäre weder mir noch ihr gedient. Will er ihr etwas Gutes tun, so komme er zu mir. Das verdroß den Wirt sehr, und er sagte es Fortunatus und meinte, er sollte auch einen Verdruß daran haben. Er hatte aber ein Wohlgefallen daran und sprach: Führt mich zu dem Mann, und nahm Leopold auch mit sich.
Als sie in des Mannes Haus kamen, sprach er zu ihm: Ich habe vernommen, wie du eine Tochter habest, die erwachsen ist: laß sie doch herkommen und die Mutter mit ihr. Er sprach: Was soll sie? Fortunatus sprach: Heiß sie kommen, es ist ihr Glück. Er rief der Mutter und der Tochter: sie kamen beide und schämten sich sehr, denn sie hatten böse Kleider an; die Tochter stellte sich hinter die Mutter, daß man desto weniger ihre bösen Kleider sehen sollte. Fortunatus sagte: Jungfrau geht hervor. Sie war schön und gerade. Er fragte den Vater, wie alt die Tochter wäre. Sie sagten, zwanzig Jahr. Er sprach: Wie habt ihr sie so alt werden lassen und ihr nicht einen Mann gegeben? Die Mutter mochte nicht warten, bis der Vater Antwort gab und sagte, sie wäre vor sechs Jahren groß genug gewesen; sie hätten aber nichts gehabt, sie auszusteuern. Fortunatus sprach: Wenn ich ihr eine gute Aussteuer gebe, wißt ihr einen Mann für sie? Die Mutter sprach: Ich weiß ihrer genug: unser Nachbar hat einen Sohn, der ist ihr hold: hätte sie etwas, er nähme sie gern. Er fragte die Jungfrau und sprach: Wie gefiel euch denn euers Nachbars Sohn? Sie sprach: Ich will nicht wählen: den Vater und Mutter mir geben, den will ich haben; sollte ich ohne einen Mann sterben, so will ich keinen selber nehmen. Die Mutter mochte nicht schweigen und sprach: Herr, sie lügt, ich weiß daß sie ihm gar hold ist und daß sie ihn von ganzem Herzen gerne hätte.
Fortunatus schickte den Wirt nach dem Jüngling, und als er kam, gefiel er ihm wohl. Er nahm den Seckel, darein er die vierhundert Dukaten getan hatte, und schüttete die vor sie auf den Tisch und sagte zum Jüngling (der bei zwanzig Jahr alt war): Willst du die Jungfrau zur Ehe? und Jungfrau, willst du den Jüngling zur Ehe? so will ich euch dies wenige Geld zu einer Aussteuer geben. Der Jüngling sprach: Ist euch die Sache Ernst, so ist mir die Sache recht. Die Mutter antwortete schnell: So ist es meiner Tochter auch recht. Also schickte er nach dem Priester und ließ sie zusammengeben vor Vater und Mutter der Braut und des Bräutigams, damit er wüßte, daß es eine gesegnete Ehe wäre. Darauf gab er ihnen das bare Geld, wie er es gebracht hatte, und der Braut Vater zehn Dukaten, daß er sich und sein Weib kleidete, und noch zehn Dukaten, daß sie Hochzeit hielten. Dessen waren sie alle von Herzen froh, dankten Fortunatus und lobten Gott eifrig und sagten: Gott hat den Mann vom Himmel gesandt.
Als nun die Ehe geschlossen war, gingen sie wieder in die Herberge. Leopold nahm Wunder, daß sein Herr so mild war, so viel Geld ausgab und sich so übel gehub um das wenige Geld, das ihm war gestohlen worden. Nun schmerzte es den Wirt sehr, daß er den Seckel mit den vierhundert Dukaten nicht gefunden, da er doch alle ihre Bündel durchsucht hatte, ergrimmte bei sich selbst und gedachte: hat er so viel auszugeben, so muß ich mich noch mehr unterstehen, ihnen die Taschen zu leeren.
Der Wirt wußte, daß sie des nachts große Lichtkerzen brennen ließen, die sie besonders hatten machen lassen; und als sie wieder zu des Kaisers Fest gingen, machte sich der Wirt wieder in ihre Kammer, bohrte Löcher in die Kerzen, tat Wasser darein und verklebte das, also daß die Kerzen, wenn sie zwei Stunden gebrannt hatten, von selber erloschen. Nun war es um die Zeit, daß des Kaisers Fest ein Ende hatte: da gedachte der Wirt, Fortunatus würde nicht länger bleiben, er dürfte sich nicht säumen, und unterfing sich, des nachts seinen Gästen abermals einen Schaden zuzufügen. Darauf gab er ihnen zu Nacht den besten Wein zu trinken, den er bekommen mochte, und war selbst auch fröhlich mit ihnen, in der Meinung, sie sollten wohl darauf schlafen. Als sie nun zubette gingen und ihr Nachtlicht zugerichtet, auch ihre bloßen Schwerter bei sich hatten, vermeinten sie, ohne alle Sorge zu schlafen, wie sie auch taten.
Der Wirt aber schlief diese Nacht nicht, sondern gedachte sein Vorhaben zu vollbringen, und da er sah, daß das Licht erloschen war, kroch er wieder durch das Loch, kam zu Leopold und fing an, ihm unter dem Kopf zu knistern. Leopold schlief nicht und hatte gar ein wohlschneidend Schwert bei sich auf der Decke liegen, eilends erwischte er das und hieb gegen ihn; der Dieb bückte sich, aber nicht genug: da verwundete er ihn so hart in den Hals, daß er weder Ach noch Weh sprach und also tot lag. Leopold rief den Knechten gar zornig und sprach: Warum habt ihr das Licht ausgelöscht? Sie sagten alle, sie hätten es nicht ausgelöscht.
Leopold sprach: Gehe einer gleich und zünde ein Licht an, und ihr andern stellt euch mit bloßen Schwertern unter die Türe und laßt niemand hinaus, denn es ist ein Dieb in der Kammer. Der eine Knecht lief bald und brachte ein Licht und sprach: Tut die Tür wohl zu, daß uns der Dieb nicht entrinne. Sie fingen an zu suchen: da fanden sie den Wirt mit der Wunde im Hals tot liegen bei Leopolds Bettstatt. Da das Fortunatus hörte, erschrak er mehr denn all sein Lebtag und sprach: O Gott, wäre ich nie nach Konstantinopel gekommen! Es wäre zu ertragen gewesen, wenn wir um unser Gut gekommen wären: jetzo kommen wir um Gut und Leben. O allmächtiger Gott! komm uns Armen zuhülfe, denn sonst kann uns niemand helfen! Wir sind fremd, und wenn wir schon die Wahrheit sagen, so wird uns nicht geglaubt. Bieten wir dann viel Geld um unsere Freiheit, so denken sie, wir haben das Leben verwirkt, das Geld würde ihnen doch zuteil und noch vielmehr dazu. Da sprach Fortunatus zu Leopold: O wehe, wie hast du so übel getan, daß du den Wirt hast zutod geschlagen: hättest du ihn verwundet bis auf den Tod und nur nicht gar zutod geschlagen, so wollten wir mit der Hülfe Gottes und mit barem Geld unser Leben in Sicherheit setzen. Leopold sagte: Es ist finster gewesen, ich wußte nicht, was ich traf: ich schlug nach einem Dieb, der mir unter dem Kopf knisterte, den habe ich getroffen und wollte Gott, daß alle Welt wüßte, auf welche Art er wäre zutod geschlagen worden, so dürften wir nicht sorgen weder für Leben noch Gut. Fortunatus sagte: O wir mögen dazu nicht kommen, daß wir den Wirt zu einem Dieb machen, seine Freunde lassens nicht geschehen: uns hilft weder Rede noch Geld.
Da nun Leopold sah, daß sein Herr und die Knechte so gar erschrocken und betrübt waren, sagte er: Wie seid ihr so verzagt: hie hilft kein Trauern, die Sache ist geschehen, wir können den Dieb nicht wieder lebendig machen; laßt uns Vernunft brauchen, wie wir aus der Sache kommen. Fortunatus sprach: Ich wüßte nicht zu raten, denn daß ich abermals gedächte, warum ich nicht Weisheit für Reichtum erwählt habe, da ich es wohl vermocht hätte; und sagte er zu Leopold, so er etwas Gutes zu raten wüßte, sollte er es tun, denn es wäre jetzt vonnöten. Leopold sprach: So folget mir und tut, was ich euch heiße, so will ich uns mit der Hülf Gottes mit Leib und Gut und ohne alles Hindernis von hinnen bringen. Dieser Worte von dem alten Leopold wurden sie alle froh.
Leopoldus sprach: Nun seid still, rede niemand, verbergt auch das Licht. Da nahm er den toten Wirt auf seinen Rücken, trug ihn hinten in der Herberge zu dem Stall: da war ein tiefer Brunnen, darin warf er den Wirt mit dem Kopf voran; das Wasser war so tief, daß ihn niemand sehen mochte. Solches geschah um Mitternacht, daß es niemand hörte noch sah. Leopold kam wieder zu Fortunatus und sprach: Ich habe uns des Diebs abgeholfen, daß man in langer Zeit nicht wissen wird wo er hingekommen ist. Ihr bildet euch wohl nicht ein, daß er es den Leuten gesagt haben wird, daß er hierherkommen wolle, uns zu bestehlen. Also weiß niemand, daß ihm von uns Leid geschehen sei: darum seid fröhlich. Er sprach zu den Knechten: Geht zu den Rossen, rüstet sie zu und fanget an zu singen und zu sagen von schönen Frauen, und sorgt, daß keiner traurige Gebärden habe. Also wollen wir auch tun, und sobald es Tag will werden, wollen wir hinwegreiten, und hätten wir den alten und den jungen Kaiser von Konstantinopel erschlagen, so wollten wir davonkommen. Die Worte hörte Fortunatus gern, fing an sich fröhlich zu gehaben, mehr denn ihm zumute war.
Da die Knechte fröhlich waren und die Rosse zugerüstet hatten, riefen sie den Knechten und Mägden des Wirts, schickten nach Malvasier, Malvasier heißt der Wein von Napoli di Malvasia an der Ostküste der griechischen Halbinsel Morea. Er war im Mittelalter sehr beliebt. den man da gut fand: da mußte jedermann mittrinken. Den Knechten gaben sie einen Dukaten Trinkgeld und den Mägden auch einen und waren guter Dinge. Leopold sprach: Ich hoffe, wir kommen in einem Monat wieder: so wollen wir erst ein lustig Leben führen. Fortunatus sprach zu den Knechten und Mägden: Grüßt den Wirt und die Wirtin: sagt ihnen, ich wollt ihnen den Malvasier an das Bett gebracht haben; ich gedachte aber, Ruhe tät ihnen besser. Mit solchen lustigen Reden saßen sie auf und ritten eilends hinweg der Türkei zu Schon im 14. Jahrh. hatten die Türken auf der Balkanhalbinsel, nördlich von Konstantinopel, festen Fuß gefaßt. Adrianopel war seit 1361 ihre Hauptstadt. Ende des Jahrhunderts drangen sie schon weit nach Norden vor bis tief in Ungarn hinein und die dortigen Fürsten, namentlich der ungarische (später auch deutsche) König Sigismund erlitten von ihnen vernichtende Niederlagen. Mitte des 15. Jahrh. standen alle Balkanstaaten bis zur Donau mehr oder weniger unter türkischer Hoheit oder waren Zankäpfel zwischen ungarischen und türkischen Machtgelüsten. und kamen also in des türkischen Kaisers Land, in eine Stadt, die heißt Karofa, in welcher der türkische Kaiser einen Amtmann hatte, dem befohlen war, den Pilgern oder christlichen Kaufleuten, so durch sein Land reisten, Geleit zu geben. Das wußte Leopold wohl, und sobald er dahin kam, ging er zu dem Amtmann und sagte, ihrer wären sechs Wallbrüder, die begehrten Geleit und einen Dolmetscher, der mit ihnen ritte. Er sagte: Ich gebe euch Geleite genug, doch will ich vier Dukaten von einem jeden haben und dem Knecht alle Tage einen Dukaten und freie Zehrung. Leopold wehrte sich ein wenig, doch machte er nicht viel Worte und gab ihm das Geld. Er gab ihm einen geschriebenen Geleitbrief und wies ihnen einen landeskundigen Mann zu; damit meinte er, wären sie versorgt. Also ritten sie durch die Türkei. Da nun Fortunatus sah, daß er keine Sorge mehr haben dürfte, und ihm der Schrecken, der ihn zu Konstantinopel befallen hatte, vergangen war, fing er erst an wieder fröhlich zu werden und Scherzreden zu treiben. Sie ritten an des türkischen Kaisers Hof, sahen den großen Reichtum und die Menge des Volks, so er aufbot, wenn er zu Felde zog, und verwunderten sich, wie ein Mann so viel Volks möchte zusammen bringen, und auch, daß so viel abgefallene Christen unter dem Volk waren, was ihnen sehr übel gefiel. Fortunatus blieb nicht lange an dem Hof und zog durch die kleine und große Wallachei, darinnen herrschte Dracula Waida, Die Walachei liegt zwischen den Karpaten und der Donau und bildet jetzt einen Teil des Königreichs Rumänien. Der westliche Teil heißt die kleine, der östliche die große Walachei. Hier war um die Mitte des 13. Jahrh. ein einheimisches Fürstengeschlecht zur Herrschaft gekommen, das aber bald unter türkischem, bald unter ungarischem Einfluß stand. Der im Volksbuche genannte Drakula Waida mag entweder Wlad II. Drakul (1431-1445) sein, der in Nürnberg von König Sigismund mit der Walachei belehnt wurde, oder Wlad IV. Drakul (1456-1462), dessen Grausamkeit so berüchtigt war, daß selbst in Deutschland eine Flugschrift darüber erschien. – Bosnien war schon im 12. Jahrh. ein Fürstentum, das erst unter ungarischer Hoheit stand, aber im 14. Jahrh. zur Selbständigkeit gedieh und seine Macht über Serbien und Dalmatien ausdehnte. Da nannten seine Herrscher sich Könige. Doch war ihre Macht im 15. Jahrh. sehr im Sinken und die Türken die eigentlichen Herren im Lande. – Dalmatien war damals im Besitz der Venediger. Kroatien, im 11. und 12. Jahrhundert mit Dalmatien zu einem Königreiche vereint, war im 15. Jahrhundert schon lange ein ungarisches Kronland unter dem Namen eines Königreiches. und kam in das Königreich Bosnien, von da zog er in das Königreich Croatien, von Croation in das Königreich Dalmatien, von Dalmatien gen Ofen, der Hauptstadt von Ungarn, von Ofen gen Krakau in Polen, von Krakau gen Kopenhagen, der Hauptstadt von Dänemark, von Kopenhagen gen Stockholm, der Hauptstadt von Schweden, von Stockholm gen Bergen in Norwegen, von Norwegen durch Dänemark nach Prag, der Hauptstadt von Böhmen, von Prag den nächsten Weg durch das Herzogtum Sachsen und durch Frankenland, darnach auf Augsburg, von dannen er mit etlichen Kaufleuten, denen er große Freundschaft erwies und sie aller Kosten frei hielt, in wenig Tagen nach Venedig kam. Dieser Länder Sitten und Glauben hat Fortunatus alle selbst in ein Büchlein zusammen geschrieben und alle fürstlichen Geschenke aufgehoben und mit sich heim nach Cypern geführt.

Bd. 49, S. 65. Text siehe S. 62
Als er nun zu Venedig war, freute er sich und gedachte: Hier sind viel reiche Leute, da darfst du auch merken lassen, daß du Geld hast, und fragte nach köstlichen Kleinodien, deren man auch genug vor ihn brachte. Darunter waren viele, die ihm gefielen, und zu welchem Preise man sie ihm auch bot, so ging er selten ohne Kauf davon, wodurch die Venediger eine merkliche Summe bares Geld lösten und Fortunatus hoch in Ehren hielten. Nun wußte er wohl, wie er seinen Vater Theodorus und seine Mutter Gratiana, als er von Famagusta gefahren, in großer Armut gelassen, und fing an und ließ köstliche Leinwand machen, schönes Hausgerät kaufen, und kaufte alles zwiefach, was man in einem Hause braucht, dingte sich und sein Gut auf eine Galeere und fuhr also gen Cypern und kam glücklich gen Famagusta, nachdem er wohl fünfzehn Jahre ausgewesen. Und als er in die Stadt kam, ward ihm gleich gesagt, wie sein Vater und seine Mutter gestorben wären, was ihm gar leid war. Jedoch mietete er alsbald ein großes Haus und ließ sein Hab und Gut hineinführen, dingte noch mehr Knechte und Mägde und fing an herrlich zu hausen, ward auch von jedermann gar ehrenvoll empfangen und gehalten, wiewohl es etliche Wunder nahm, von wannen ihm so großer Reichtum käme, indem die meisten wohl wußten, daß er in großer Armut von dannen gezogen war.
Und als er in Famagusta war, kaufte er seines Vaters Haus und noch mehr Häuser dazu, ließ sie alle abbrechen, und baute sich einen köstlichen Palast, den ließ er auf das allerzierlichste machen, denn er hatte gar viel köstlicher Gebäude gesehen. Und bei dem Palast ließ er eine gar schöne Kirche bauen und um die Kirche dreizehn Häuser, stiftete eine Probstei zu zwölf Kaplänen, die sollten allezeit singen und lesen. Dazu gab er Zinsen, Gülten und Renten. Der Probst bekam dreihundert Dukaten, und ein Kaplan alle Jahr hundert. Auch ließ er in der Kirche zwei Gräber machen, seinen Vater und Mutter ausgraben und in das eine Grab legen, und das andere sollte auf ihn und seine Erben warten. Als nun der Palast und die Kirche ganz fertig waren und er großes Wohlgefallen daran hatte, gedachte er bei sich: einem solchen Palast geziemt wohl ein ehrsames Wesen, und setzte sich vor, ein Gemahl zu nehmen. Und da man inne ward, daß er willens war, ein Weib zu nehmen, war jedermann froh, und Reich und Arm, Edel und Unedel richtete seine Töchter mit Kleidern und Kleinodien zu, so gut er mochte, und gedachte, vielleicht gibt Gott meiner Tochter das Glück so gut als einer andern, und jeder hätte gern seine Tochter dahin gebracht. Also wurden viele Töchter schön gekleidet, die sonst lange ohne so schöne Kleider geblieben wären.
Nun war ein Graf nicht weit von Famagusta, der hatte drei Töchter, die vor andern schön waren: dem riet der König, er solle dem Fortunatus seine Töchter antragen lassen, und wenn es ihm recht wäre, so wollte er selbst das beste dazu reden. Der Graf war nicht reich, doch sagte er: Herr König, wenn er meiner Töchter eine begehrte, wolltet Ihr mir's raten? Er hat ja weder Land noch Leute: hat er viel bar Geld gehabt oder noch, so seht ihr wohl, er hat viel Geld verbaut, das keinen Nutzen trägt, so mag er das übrige auch noch los werden und wie sein Vater in Armut kommen, denn es ist geschwind geschehen, daß große Barschaft vertan wird. Der König sprach zu dem Grafen: Ich habe von Leuten, die es gesehen haben, vernommen, daß er viel köstliche Kleinodien hat, man kaufte eine Grafschaft dafür; doch ist ihm noch keines feil. Ich höre soviel von ihm sagen, wie er so manches Land und Königreich durchfahren habe, halte also dafür, wüßte er nicht seine Sache zu einem guten Ende zu bringen, er hätte nicht so einen köstlichen Palast gebaut, noch eine so köstliche Kirche machen lassen, die er so herrlich begabt hat mit guten und sichern Zinsen auf ewige Zeit. Es wäre noch mein Rat (wenn es ihm gefiele), du gäbest ihm deiner Töchter eine, und ist es dir gefällig, so will ich meinen Fleiß anwenden, daß solches geschehe. Denn Fortunatus gefällt mir wohl, ich sehe lieber, er habe ein edles Gemahl, denn eine Bäuerin, und es würde mich verdrießen, wenn ein unadeliges Weib den Palast besitzen und darin Wohnung haben sollte. Da nun der Graf hörte, daß dem König Fortunatus' Wesen wohlgefiel, fing er an und sprach: Gnädiger Herr König, ich vernehme an Eurer Rede wohl, daß Ihr ein Gefallen daran hättet, wenn ich dem Fortunatus meiner Töchter eine gäbe: dessen laß ich Euch volle Gewalt, zu tun wie Euch beliebt. Da der König das vernahm, sprach er zu dem Grafen Nimian: Sende deine Töchter meiner Gemahlin, der Königin: so will ich sie zieren lassen, in Hoffnung, ihm werde eine gefallen; doch will ich ihm die Wahl geben, daß er nehme, welche er wolle. Auch will ich dir zu Liebe die Heirat so machen, daß du kein Heiratgut zu geben brauchst; müßte man aber etwas geben, so will ich es selbst ausrichten, weil du mir freie Gewalt befohlen hast. Graf Nimian dankte seinen königlichen Gnaden und sagte, was seine königliche Gnade befehle, das wolle er tun, und nahm Urlaub von dem König, ritt heim zu seinem Gemahl und sagte ihr alles, was sich zwischen ihm und dem König verlaufen hätte. Das gefiel der Gräfin alles wohl, nur daß sie Fortunatus nicht edel genug deuchte, und daß er die Wahl haben sollte unter ihren dreien Töchtern, denn eine unter den dreien wär ihr die liebste. Der Graf fragte, welche es wäre. Das wollte sie ihm mit nichten sagen. Doch folgte sie seinem Willen und richtete die Töchter zu, gab ihnen eine Hofmeisterin, Knechte und Mägde, wie solchem Adel geziemt, und kamen also an des Königs von Cypern Hof. Da wurden alle drei und alle, die mit ihnen gekommen waren, von dem König und der Königin freundlich empfangen. Da wurden sie unterwiesen in Hofzucht und was sonst zum adeligen Wesen gehört. Sie waren schön und wurden von Tag zu Tag noch schöner, und da es den König Zeit deuchte, sandte er eine stattliche Botschaft zu Fortunatus, daß er zu ihm käme; doch ward ihm nicht gesagt, warum er nach ihm geschickt hätte; er wußte, daß er einen gnädigen Herrn an dem König hatte. Er rüstete sich eilends, ritt fröhlich zu seinem Herrn, dem König, und ward sehr wohl empfangen.
Da sprach der König zu ihm: Fortunatus, du bist mein Hintersaß Hintersaß, einer der seinen Grundbesitz nicht als freies Erbe, sondern von einem andern als Lehen oder zur Pacht übernommen hat. Hier soviel als Lehenträger., und ich vermeine, was ich dir rate, dem solltest du folgen, denn ich gönne dir alles Gute. Ich habe wohl vernommen, wie du so einen köstlichen Palast und eine herrliche Kirche hast bauen lassen und nun willens bist, dir ein Gemahl zu nehmen; ich habe aber Sorge, du möchtest eine nehmen, die mir nicht gefällig wäre, und habe gedacht, dir ein Gemahl von allen Ehren zu geben, dadurch du und deine Erben geehrt werden sollen.
Fortunatus sprach: Gnädiger König, es ist wahr, ich bin willens, mir ein Gemahl zu nehmen; ich vernehme aber, daß Eure königliche Gnade so herablassend ist und mir so gnädig und günstig sein will, mich zu versehen: so will ich weiter keine Frage noch Sorge nach einer haben, sondern all mein Vertrauen in Eure königliche Gnade setzen. Da der König die Antwort von Fortunatus hatte und vom Graf Nimian und die Töchter in seiner Gewalt, gedachte er: Hie hab ich gut eine Ehe zu machen, und sprach zu Fortunatus: Ich weiß drei schöne Töchter, alle drei Gräfinnen von Vater und Mutter; die älteste ist achtzehn Jahre alt und heißt Gemiana, die andre siebzehn Jahre und heißt Marsepia, die dritte dreizehn und heißt Cassandra. Unter diesen dreien will ich dir die Wahl lassen, ich will dir auch zulassen, daß du eine nach der andern sehen magst; oder willst du sie alle drei auf einmal sehen? Fortunatus bedachte sich nicht lange und sprach: Großmächtigster König, da Ihr mir eine solche Wahl gelassen habt, so begehre ich, daß ich sie alle drei nebeneinander sehen möge und reden höre. Der König sprach zu Fortunatus: Was du begehrst, soll dir geschehen, und entbot der Königin, sie solle das Frauenzimmer und ihre Jungfrauen wohl auszieren: er wollte selber darein kommen und einen Gast mit sich bringen. Das tat die Königin mit Fleiß, denn sie versah sich wohl, warum es geschähe.
Und da es den König Zeit deuchte, nahm er Fortunatus allein und wollte mit ihm gehen. Fortunatus sprach: Gnädiger Herr König, ist es nicht wider Euch, so laßt diesen meinen alten Diener mit mir gehen. Der König ließ es geschehen: sie nahmen also Leopold, den alten Mann, auch mit und kamen in das Frauenzimmer. Da stund die Königin auf und alle ihre Jungfrauen und empfingen den König gar herrlich und die Gäste auch. Also setzte sich der König nieder, und Fortunatus stand neben dem König.
Also sprach der König: Laßt mir kommen die drei Jungfrauen Gemiana, Marsepia und Cassandra. Alsbald standen sie auf, gingen durch den Saal, und ehe sie zum König kamen, taten sie demselben dreimal Reverenz, knieten nieder, wie sie das wohl konnten und wie es ihnen auch anstand. Der König hieß sie aufstehen und fing an und sprach zu der ältesten: Gemiana, sage mir an, bist du lieber bei der Königin oder bei Graf Nimian, deinem Vater und der Gräfin, deiner Mutter? Sie sprach: Gnädiger Herr und König, mir geziemt nicht, diese Frage zu beantworten, und wenn mir auch eins lieber wäre als das andere, so dürfte ich doch mein Wohlgefallen nicht ansehen, sondern was Euer Gnaden und mein Herr Vater gebieten, solchem Gebot soll ich gehorsam sein.
Also sprach er zu der andern: Marsepia, sage mir die Wahrheit: wen liebst du am meisten, den Grafen, deinen Herrn Vater, oder die Gräfin, deine Frau Mutter? Sie antwortete und sprach: O gnädiger Herr König, diese Frage ziemt mir nicht zu beantworten, ich habe sie beide von ganzem Herzen lieb; wenn ich aber einen lieber hätte als den andern, so wäre mir doch leid, wenn es mein eigen Herzen wissen sollte, und soll das mein Mund verkündigen, des müßte ich mich gar sehr schämen, da ich alle Treu und Liebe bei ihnen beiden finde.
Der König sprach zur dritten und jüngsten: Cassandra, sage mir, wenn jetzt ein schöner Tanz wäre auf unserm Platz von Fürsten und Herren und von viel edeln Frauen und Jungfrauen und es wäre hie der Graf und die Gräfin, euer Vater und Mutter: das eine spräche: Tochter, gehe zum Tanz, und das andere spräche: gehe nicht, welchem Gebot wolltest du folgen? Allergnädigster Herr König, sprach sie, Ihr wißt, daß ich noch jung bin und Vernunft nicht vor den Jahren kommt, so mag Eure königliche hohe Vernunft den Leichtsinn der Jugend wohl ermessen, und wenn ich eins vor dem andern erwählte, so würd ich immer eins von beiden erzürnen, was ich gar ungern tun wollte.
Der König sprach: Wenn aber eins oder das andere sein müßte? Cassandra sprach: So begehre ich Jahr und Tag mich darauf zu bedenken, und weiser Leute Rat zu folgen, ehe ich Antwort auf diese Frage gebe. Dabei ließ der König Cassandra bleiben und fragte sie nicht ferner.
Als nun der König Urlaub nahm von der Königin und den andern im Frauenzimmer, ging er in seinen Palast; da folgten ihm Fortunatus und Leopold nach, und als sie in des Königs Zimmer kamen, sprach der König zu Fortunatus: Du hast begehrt, die drei Töchter zu sehen und reden zu hören; nun habe ich dir mehr getan, denn du begehrt hast, denn du hast sie gesehen stehen, gehen, lange und genugsam reden. Nun erwäge in dir selbst, welche dir zu einem ehelichen Gemahl gefällt. Fortunatus sprach: Gnädiger Herr, sie gefallen mir alle drei so wohl, daß ich nicht weiß, welche ich erkiesen soll; und ich bitte von Euer königlichen Gnade, mir eine kleine Zeit zu vergönnen, daß ich mich mit meinem alten Diener Leopold berede. Der König sprach: Des habe Urlaub. Also gingen sie miteinander an einen besondern und heimlichen Ort.
Fortunatus sprach zu Leopold: Du hast die drei Töchter gesehen und gehört sowohl als ich: nun weißt du wohl, daß niemand so weise ist in seinen Sachen, daß er nicht allweg um Rat fragen sollte. Also frage ich dich und begehre deines Rats in der Sache, daß du mir hierin treulich raten wollest, als ob es deine eigene Seele beträfe. Leopold erschrak sehr, da er so hoch ermahnt ward, und sprach: Herr, in dieser Sache ist nicht wohl zu raten, denn einem gefällt gar oft ein Ding wohl, und seinem eignen Bruder mißfällt es; so ißt einer gern Fleisch, der andere gern Fische: darum so kann euch niemand in dieser Sache besser raten, denn ihr selbst, denn ihr seid es auch, der die Bürden tragen muß.
Fortunatus sprach: Das alles weiß ich wohl, und daß ich mir ein Gemahl nehme, und sonst niemanden: ich wollte aber, daß du mir die Heimlichkeit deines Herzens eröffnetest, da du doch so viel Menschen kennen gelernt und an ihrer Gestalt und Bildung bemerkt hast, was Treu oder Untreu vorbedeute. Leopold riet ungern in dieser Sache, denn er fürchtete, wenn er nicht zu der riete, die seinem Herrn am besten gefiele, daß er dadurch seine Huld verlieren möchte. Da fing er an und sprach: Herr, sie gefallen mir alle drei wohl; ich habe sie auch mit allem Fleiß eine nach der andern betrachtet, und nach ihrem Aussehen bedünkt mich, sie seien Schwestern oder Geschwisterkinder, kann auch an ihrer Gestalt und Bildung keine Untreu merken.
Fortunatus sprach: Zu welcher rietest du mir aber? Leopold sprach: Ich will nicht zuerst raten, und ihr sollt auch nicht zuerst raten, denn was euch wohlgefiele, davon dürft ich nicht sagen, daß es mir weniger gefiele. Er sprach: Darum nehmt diese Kreide und schreibt auf den Tisch in euerm Winkel; so will ich mit dieser im andern Winkel schreiben. Das gefiel Fortunatus wohl, und schrieb also jeder seine Meinung, und da sie geschrieben hatten und ein jedes des andern Meinung las, hatten sie beide Cassandra geschrieben. Des war Fortunatus froh, daß sie beide einerlei Sinnes waren; noch fröhlicher war Leopold, daß ihm Gott in seinen Sinn gegeben hätte, daß er auch zu der geraten, die seinem Herrn am allerbesten gefallen. Und da sie mit der Sache eins wurden, ging Fortunatus wieder zu dem König und sagte: Gnädiger Herr König, Eure königliche Gnade hat mir eine Wahl verliehen, die ich billig mit unvergessenem Dank und steter Dienstbarkeit gegen Eure königliche Gnaden verdienen soll, denn obgleich ich mich solcher Wahl unwürdig bedünke und es gegen Eure königliche Majestät noch nicht verdient habe, so steht mir doch zu, daß ich es künftig verdiene. Demnach ist nun mein Begehren, daß ihr mir Cassandra gebet. Dir geschehe nach deinem Begehren, sprach der König, und schickte alsbald nach der Königin, daß sie zu ihm käme und Cassandra mit sich brächte, was auch sogleich geschah.
Also kam die Königin und brachte Cassandra mit sich. Der König schickte alsbald nach seinem Kaplan und ließ sie zusammengeben. Cassandra war unmutig, daß sie also sollte vermählt werden ohne Wissen und Anwesenheit ihres Vaters und ihrer Mutter; allein der König wollte es doch also haben, sie wurden also zusammengegeben. Und als sie zusammengegeben waren, da kamen die andern Frauen und Jungfrauen und der Braut Schwestern und wünschten der Braut Glück; die zwei Schwestern weinten gar sehr. Fortunatus fragte, warum sie also weinten. Da ward ihm gesagt, daß sie der Braut rechte Schwestern wären von Vater und Mutter, und also ging er zu ihnen, tröstete sie, und sprach: Trauert nicht, ihr sollt eurer Betrübnis getröstet werden. Und sandte alsbald gen Famagusta nach den Kleinodien, die er mit sich von Venedig gebracht hatte, und schenkte dem König und der Königin die zwei besten, darnach der Braut und ihren zwei Schwestern, begabte auch alle Frauen und Jungfrauen, die der Königin Frauenzimmer waren Die Frauen wohnten in den Burgen in einem abgelegenen Gebäude, Frauenhaus oder Frauenzimmer genannt. Der Name übertrug sich von dem Gebäude auf die Insassen. Man sagte »das Frauenzimmer« von der Gesamtheit der Bewohner des Frauenhauses. »Die Königin und ihr Frauenzimmer« bedeutet so »die Königin und ihre Hofdamen«., gar köstlich, was sie auch zu großem Dank aufnahmen. Und also schickte der König nach Graf Nimian und nach der Gräfin. Da das Fortunatus hörte, schickte er Leopold aus und gab ihm bar tausend Dukaten, daß er die sollte der Gräfin in ihren Schoß schütten und ihr sagen, ihr Tochtermann schicke sie ihr, daß sie fröhlich auf die Hochzeit käme.
Nun war die Gräfin unmutig, daß Fortunatus die jüngste Tochter genommen hatte, denn sie war ihr die liebste; da ihr aber Leopold die tausend Dukaten in den Schoß schüttete, ließ sie den Unmut fahren und rüstete sich mit dem Grafen alsbald herrlich, mit wohlbekleidetem Hofgesind, mit Wagen und was zu solchen Ehren gehört, und kam zu dem König: da wurden sie herrlich empfangen, da war ihnen die Herberge gar köstlich zugerichtet mit allem, was man an Kost und Trank bedurfte. Da sprach Graf Nimian zu der Gräfin: Frau, wir sind öfter hie gewesen, aber solche Ehre ist uns noch nie widerfahren. Haben wir einen so gnädigen König bekommen und so einen mächtigen Tochtermann durch unsre Tochter Cassandra, so wollen wir Gott Dank sagen, daß er uns solche Gnade verliehen hat. Und als sie angekommen waren, sprach der König zu Fortunatus: Ich will die Hochzeit zurüsten lassen und will, daß dies Fest hier vollbracht werde. Fortunatus sprach: Gnädiger Herr König, laßt mich die Hochzeit zu Famagusta in meinem neuen Schloß halten: ich hab es noch nicht eingeweiht und noch kein Fest darin begangen. Der König sprach: Ich wollte es darum tun, daß dem Graf Nimian und dir desto weniger Kosten darauf gingen. Fortunatus sprach: Mich sollen keine Kosten dauern noch reuen, und ich bitte Eure königliche Majestät, daß ihr selbst in hoher Person mit der Königin und allem Volk gen Famagusta kommen wollet: kann ich dann Euren Gnaden und denen, so mit Euch kommen, nicht Ehr erbieten, wie sie es würdig wären, so sollen sie doch keinen Mangel spüren, so wenig als Euer Gnaden hie hat.
Da der König hörte, daß Fortunatus so reichlich redete, gedachte er: Ich möchte doch das Wesen gern sehen, und sagte zu ihm: Dein Wille geschehe, reite hin und rüste dich zu, so will ich mit der Königin kommen und dir deine Gemahlin bringen, dazu Schwäher und Schwieger und Volks genug. Des war Fortunatus froh, dankte dem König und sprach: Ihr sollt nicht lange ausbleiben, in drei Tagen wird alles eingerichtet sein, und ritt eilends gen Famagusta, sah zu, was ihm noch mangelte und ließ das alles kaufen. Also kam der König mit großem Volk und ward gar schön empfangen von Fortunatus. Da war sehr große Freude, die da vollbracht wurde mit tanzen, singen und köstlichem Saitenspiel; wo eins aufhörte, fing das andere an, bis man die schöne Jungfrau Cassandra dem Fortunatus gab in dem schönen neuen Palast, der so nach aller Lust gebaut war. Ob nun wohl der Braut Mutter sah, daß alles köstlich zuging, gefiel es ihr doch nicht, dieweil er nicht eigen Land noch Leute hatte, und sagte das ihrem Herrn. Der Graf Nimian sprach: Laß dich das nicht kümmern, ich hoffe, er wird unsere Tochter nach Ehren beraten. Des Morgens früh kam der König und Fortunatus' Schwäher und Schwieger und forderten der Braut die Morgengabe. Fortunatus sagte: Ich habe weder Land noch Leute: ich will ihr geben fünf tausend bare Dukaten, dafür kauft ihr ein Schloß oder eine Stadt, darauf sie versorgt sei. Der König sprach: Diesen Sachen will ich Rat schaffen: hie ist der Graf von Ligorno, der hat große Not, und muß Geld haben, er hat ein Schloß und eine Stadt, drei Meilen von hier, die wollen wir ihm abkaufen, Land und Leute mit allen Gerechtigkeiten. Sie schickten also nach dem Grafen und kauften ihm Stadt und Schloß ab für sieben tausend Dukaten. Da gab er Leopold den Schlüssel zu einer Kiste, die in seinem Schlafgemach stand; der zahlte sie bar. Also ward der Kauf geschlossen, und der Graf von Ligorno gab seine Gerechtigkeit vor dem König in Cassandras Hand auf und sprach sie aller seiner Ansprüche an Schloß und Stadt frei und ledig. Da ward viel über den Kauf geredet: der eine sprach, es wäre zehntausend Dukaten wert, der andere sagte: hätte ich soviel Geld, ich wollte es nicht dafür geben. Als dies vollbracht war, fing der Braut Mutter erst an fröhlich zu werden und sich zur Kirche zu rüsten. Die Kirche, die Fortunatus nicht weit von seinem Palast hatte bauen lassen, war überaus köstlich dazu aufgeschmückt. Und als das Amt vollbracht war, ging der König, der Bräutigam und die Braut, ein jeder nach seinem Stand, in den Palast zu der Mahlzeit, die also köstlich bereitet war, daß viel davon zu schreiben wäre.
Da man nun fröhlich war, gedachte Fortunatus, wie er eine Ergötzung anstelle, damit dem König und der Königin die Zeit zu vertreiben, gab also drei Kleinodien aus. Das erste war sechshundert Dukaten wert, darum sollten die Herren, Ritter und Edelleute drei Tage stechen, und wer das beste täte und den Preis erwürbe, sollte das Kleinod haben. Ferner gab er ein Kleinod aus, vierhundert Dukaten wert: darum sollten die Bürger und ihre Genossen auch drei Tage stechen, und wer das beste täte, der sollte das andere Kleinod gewonnen haben. Ferner gab er ein Kleinod aus zweihundert Dukaten an Wert: darum sollten alle reisigen Knechte stechen sowohl der Herren als der Städte auch drei Tage, und wer das beste täte, der sollte das Kleinod haben. Da mag man wohl denken, wie sich jeder befliß und gern das beste getan hätte des Ruhms willen vor den schönen Frauen und Jungfrauen, wie auch um die Kleinode zu gewinnen. Also ward täglich zwei- oder dreimal gestochen und dazwischen bald getanzt, bald gegessen.
Dies Wesen und Freudenspiel trieb man vierzehn Tage: da wollte der König nicht mehr bleiben, und als er hinwegzog, ritt jedermann mit ihm. Fortunatus hätte gern gesehen, daß sie länger dageblieben wären, besonders sein Schwäher und seine Schwieger: das wollten sie aber nicht tun, denn sie sahen die großen Kosten, die darauf gingen, und sorgten, er möchte dadurch in Armut kommen. Als nun der König weg ritt, machte sich Fortunatus auch auf und gab dem König das Geleit fern hinaus, wandte sich dann zu dem König und dankte ihm für die hohe Gnade, daß er auf seine Hochzeit gekommen war. Also nahm er untertänig Abschied von dem König und der Königin, auch von Schwäher und Schwieger, dem Grafen und der Gräfin und von allem Volk, dankte ihnen, daß sie bei seinem Fest gewesen waren, und ritt wiederum zu seiner schönen Cassandra.
Da nun das fremde Volk hinweg war, fing er eine neue Hochzeit an und lud nun erst alle Bürger und Bürgerinnen ein und hatte ein großes Fest mit ihnen. Das trieb er acht Tage, wodurch ihm große Gunst und Wohlwollen von der ganzen Stadt Famagusta zuteil ward. Da dieses Fest und Wohlleben auch ein Ende nahm, wollte er ein ruhiges Leben anfangen und sprach zu Leopold: Guter Freund, gib mir zu verstehen, was dein Wille sei: ich will dir zwischen drei Dingen die Wahl lassen, und wie du wählst, so soll dir geschehen. Willst du heim, so will ich dir vier Knechte geben, die dich herrlich heimbegleiten, und dir dazu geben, daß du dein Lebtag ein Auskommen hast. Oder willst du hie zu Famagusta bleiben, so will ich dir ein eigen Haus kaufen und soviel dazu geben, daß du drei Knechte und zwei Mägde halten kannst, die deiner pflegen und dir keinen Mangel lassen. Oder willst du bei mir in meinem Palast sein, so sollst du in allen Dingen deine Notdurft haben, so gut als ich selbst: was du erwählst, das soll dir zugesagt und redlich gehalten werden. Leopoldus dankte ihm der Ehrerbietung und der verstatteten Wahl und sagte, er hätte es nie um Gott noch um ihn verdient, daß ihm in seinen alten Tagen so viel Ehr und Güte widerfahren sollte, und sprach: Mir ziemt nicht heimzureiten, ich bin alt und schwach und möchte unterwegs sterben; wenn ich aber auch heimkäme, so ist Hibernia ein hartes rauhes Land, wo weder Wein noch andere edle Früchte wachsen, an die ich mich hier gewöhnt habe, und würde vielleicht bald sterben.
Daß ich meine Wohnung bei euch sollte haben, ist mir auch nicht zuträglich, denn ich bin alt und ungestalt, ihr aber habt ein schön Gemahl und viel hübscher Jungfrauen und Knechte, die euch viel Kurzweil machen können: denen würde ich allen zuwider werden, denn alten Leuten gefällt nicht allezeit das Wesen der Jungen. Also wiewohl ich an Eurer mildreichen Güte nicht zweifle, kiese und erwähle ich doch, ihr wollt mir ein eigenes Hauswesen bestellen, darin ich mein Leben vollende; bitte und begehre jedoch, daß ich damit nicht aus Euerm Rat verstoßen werde, solang uns Gott das Leben gönnet. Das sagte ihm Fortunatus zu, kaufte ihm sein eigen Haus, gab ihm Knechte und Mägde, darzu alle Monat hundert Dukaten. Des freute sich Leopoldus, daß er nicht mehr auf den Dienst zu warten brauchte. Er setzte sich nieder und stand auf, aß und trank früh oder spät, wie es sich ihm fügte. Nichtsdestoweniger ging er alle Morgen in die Kirche, in die auch Fortunatus ging, und bewies sich alle Tage gar fleißig, woran Fortunatus seine Treue spürte. Nachdem Leopoldus in solchen Ehren ein halb Jahr verlebt, ward er siech und mit tödlicher Krankheit umfangen. Da ward nach vielen Ärzten geschickt, ihm mochte aber niemand helfen. Und also starb der gute Leopoldus: das war Fortunatus gar leid und ließ ihn gar herrlich begraben in seiner Kirche, die er gebaut und gestiftet hatte.
Als nun Fortunatus und sein Gemahl Cassandra beieinander in großen Freuden lebten und alles hatten, was man haben soll, und an nichts Mangel, baten sie Gott, daß er ihnen Erben geben wollte, zumal Fortunatus wohl wußte, daß der Seckel seine Kraft verlieren würde, so er nicht eheliche Leibeserben bekäme; doch sagte er davon Cassandra nichts, als daß er gar gern Kinder von ihr hätte. Wie aber Gott alle ernstlichen Gebete erhört, so erhörte er sie auch, Cassandra ward schwanger und gebar einen Sohn. Dessen war Fortunatus und jedermann mit ihm erfreut. Das Kind ward getauft und Ampedo geheißen. Hierauf ward Cassandra wieder schwanger und brachte noch einen Sohn, der auch mit Freuden getauft und Andolosia geheißen ward, also daß Fortunatus zween wohlgeschaffene hübsche Knaben hatte, die er und seine liebe Cassandra mit großem Fleiß und Liebe erzogen; jedoch war Andolosia allzeit kühner, denn Ampedo, wie er sich auch hernach erwies. Wiewohl nun Fortunatus gern mehr Erben von Cassandra gesehen hätte, so gebar sie doch nicht mehr, was ihr gar leid war, denn sie hätte auch gern eine Tochter oder zwei gehabt.
Und als Fortunatus zwölf Jahr bei Cassandra gewesen und sich keines Erben mehr versah, fing es ihn an zu verdrießen, zu Famagusta zu sein, wiewohl er alle Kurzweil hatte mit Spazierenreiten, mit hübschen Pferden, mit Federspielen, Jagen, Hetzen und Beizen. Er nahm sich vor, dieweil er alle christliche Königreiche durchzogen, auch vor seinem Tod die Heidenschaft, des Priester Johannis Land Im zwölften Jahrhundert, als die Kreuzfahrer Jerusalem verloren hatten, durchlief die sagenhafte Kunde das Abendland von einem christlichen Priesterkönig Johannes, der von Osten her, aus Indien, den Kreuzfahrern zuhülfe zöge. Als dann später um die Mitte des 13. Jahrh. Missionare aus dem Franziskanerorden in Asien vordrangen, beauftragte der Papst den Wilhelm Rubruk, nach dem Reiche des Priesters Johannes zu forschen. Dies und der Bericht des genannten Reisenden gaben jener Sage neue Nahrung. Um 1300 berichtet der berühmte Venediger Marco Polo (Anmerk. 35) von einem christlichen (nestorianischen) König in Indien, Priester Johannes genannt. Noch später nannte man in Europa den König der christlichen Äthiopier (Abessinier) Priester Johannes. Die Sage mag durch Verwandlung des Namens eines nordchinesischen Mongolenfürsten Chor-Chan in Johann (Jorchan, Jochanan) entstanden sein. Weil die Mongolenheere die Sarazenen von Osten angriffen und besiegten, kamen die Abendländer auf den Gedanken, ihre unbewußten Bundesgenossen für Christen zu halten. zu durchziehen, und sprach zu Cassandra: Ich habe eine Bitte an euch, daß ihr mir wollet erlauben hinwegzureisen. Sie fragte, wohin ihm doch sein Gemüt stünde. Er sagte ihr, sein Vorhaben wäre, weil er das halbe Teil der Welt gesehen, so wollte er das andere Teil auch durchfahren und sollte er sein Leben darüber verlieren. Da Cassandra hörte, daß ihm das Vorhaben ernst war, erschrak sie sehr, fing an zu bitten, daß er von seinem Vorhaben ließe, es würde ihn gereuen, und was er zuvor umgezogen wäre, das wär alles in der Christen Land, da er noch jung und stark gewesen und viel hätte erdulden mögen, das nun nicht mehr wäre, denn das Alter vermöge nicht, was der Jugend leicht zu tun sei. Auch seid ihr nun gewöhnt, ein ruhiges Leben zu haben: was wollt ihr euch jetzt unterfangen, unter die falschen Heiden zu ziehen? Ihr hört doch alle Tage, daß die Heiden keinem Christen treu noch hold sein mögen, sondern sie sind darauf von Natur bedacht, wie sie die Christen um Leib und Leben bringen. Und sie fiel ihm um den Hals und sprach: O du mein allerliebster und getreuster Gemahl, du meines Herzens Wohlgefallen, in den mein Leib und meine Seele all ihre Treue gesetzt haben, ich bitte euch um Gottes und der Jungfrau Maria Willen, tut es mir armem Weib und euern lieben Kindern zu Ehren und schlagt eure vorgenommene Reise aus dem Sinne und bleibet hie bei uns; hab ich euch in irgend einem Dinge erzürnet oder getan, daran ihr ein Mißfallen habt, das sollt ihr nur zu verstehen geben, so soll es hinfort vermieden bleiben und nicht mehr geschehen. Also weinte sie gar inniglich und war sehr betrübt. Fortunatus sprach: O allerliebstes Gemahl, gehabt euch nicht so übel, es ist um eine kleine Zeit zu tun, so komme ich mit Freuden wieder, und ich verheiß euch jetzt, daß ich alsdann nimmermehr von euch scheiden will, so lang uns Gott das Leben verleihet. Cassandra sprach: Wenn ich eures Wiederkommens gewiß wäre, so wollt ich eurer Heimkehr mit Freuden warten. Und wo ihr auch immer hinziehen wolltet, außer zu der ungetreuen Art, unter die ungläubigen Leute, die da allzeit des Christenbluts begehren, so wär es mir doch nicht so schwer. Fortunatus sprach: Diese Reise mag niemand wenden denn Gott und der Tod, und wenn ich von hinnen scheide, so will ich dir soviel Barschaft lassen, ob ich nicht wieder käme, daß du und die Kinder, euer Lebenlang in Freuden leben möget.
Da Cassandra sah, daß kein Bitten helfen mochte, da fing sie an und sprach: O allerliebster Gemahl, so es nicht anders sein mag, so kommt doch desto eher wieder und laßt die Treu und Liebe, so ihr uns bisher erwiesen habt, aus euerm Herzen nicht kommen, so wollen wir Gott Tag und Nacht für euch bitten, daß er euch Gesundheit verleihe und gut Wetter und Frieden und Wohlwollen von allen denen, durch deren Land und Gewalt ihr kommen werdet.
Fortunatus sagte ihr: Wollte Gott! daß dies Gebet an mir erfüllt werde; so traue ich Gott, ich komme glücklich wieder, ehe denn ich mir's vorgenommen habe.
Fortunatus hatte sich eine eigene Galeere bauen lassen und sie mit allen Waren und Kaufmannsgütern beladen, von welchen er wußte, daß sie in der Heidenschaft gebraucht werden. Auch hatte er erwogen, was er dem Sultan zum Geschenk bringen sollte, denn alle Nationen, so nach Alexandrien kamen, pflegten ihm große Spendungen zu bringen, besonders die Venediger und Florentiner, die ihm fast goldwerte Stücke Sammet und Seide verehren. Da ließ er sich von den besten Meistern und Goldschmieden einen köstlichen Schenktisch machen, mit allen Stücken, die dazu gehören, als Bechern, Schalen, Flaschen, Schüsseln, Tellern, Platten, Bratspießen, Rosten. Und als die Galeere fertig und beladen war, nahm er Urlaub von Weib und Kind und bestieg in Gottes Namen die Galeere; und als er gen Alexandrien kam, schickte man ihm ein kleines Schifflein entgegen und ließ fragen, von wannen das Schiff käme, wem es gehörte und womit es beladen wäre. Fortunatus gab alles an und bat, daß man ihm vor den Sultan hülfe, er brächte ihm eine Schenkung. Dazu waren des Sultans Diener beflissen, da sie hörten, daß er nicht mit leeren Händen käme, denn wer bringt, wird eingelassen, wie noch an vieler Herren Höfen geschieht; wer aber haben will, muß lange vor der Türe stehen. Und als er in des Sultans Palast kam, ließ er gar bald einen großen schönen Schenktisch aufrichten und die Kleinodien aufsetzen, die gar köstlich und schön anzusehen waren, und schickte darauf nach dem Sultan. Da der Sultan die Kleinodien sah, verwunderte er sich über ihre Menge und Schönheit und meinte, er hätte sie darum dahingebracht, daß er sie ihm abkaufen sollte und ließ ihn fragen, wie hoch er die Credenz schätze. Fortunatus ließ den Sultan wieder fragen, ob ihm die Kleinodien wohl gefielen. Er sagte: Gar wohl. Da Fortunatus hörte, daß sie ihm gefielen, war er froh, ließ den Sultan bitten, daß er es nicht verschmähen und sie zu einer Schenkung von ihm annehmen wollte. Da der König das hörte, nahm es ihn Wunder, daß ein einziger Kaufmann ihm eine so große Schenkung tun sollte, schätzte sie wohl auf fünftausend Dukaten und vermeinte, es wäre einer großen Gemeinde, als Venedig, Florenz, oder Genua viel zu viel, doch nahm er es an für eine Schenkung, gedachte jedoch: Es ist zu viel, sollt ich es ihm nicht wieder vergelten? Und ließ ihm hundert Karren Pfeffer geben, welche wohl so viel wert waren als die Kleinodien, die er ihm geschenkt hatte. Da die Venediger, Florenzer, Genueser und andere Herren, so dazumal in Alexandria lagen, hörten, daß der König dem Fortunatus eine so köstliche Schenkung gemacht hätte, der nie zuvor da gewesen war, da sie ihm doch alle Jahr einmal oder gar zweimal des Jahres eine große Schenkung machten, stets in seinem Lande lagen, ihm und dem ganzen Land großen Nutzen schafften und noch nie etwas von ihm zu Geschenk bekommen hatten, weder wenig noch viel, hatten sie einen Verdruß an des Fortunatus Wesen, zumal da er wohlfeiler verkaufte und teurer einkaufte als sie. Sie besorgten, er würde ihnen an ihrer Kaufmannschaft großen Schaden tun und die Christenlande überfüllen, daß sie ihre Waren desto wohlfeiler geben müßten. Da gedachten sie, könnten wir ihm doch bei dem Sultan einen Verdruß anrichten. Darauf machten sie dem Admiraldo, dem Obersten nach dem König im Land, große Schenkungen, damit er dem Fortunatus und den Seinen nicht so günstig wäre. Das merkte Fortunatus und schenkte allemal noch so viel. Das war dem Admiraldo ein gutes Spiel, er nahm von beiden Parteien das Geld und tat, was ihnen billig war; zu Fortunatus aber sagte er, wie er nur wünschte, daß seiner viel und oft gen Alexandria gekommen wären. Als nun Fortunatus einige Zeit zu Alexandria gewesen und sich gar herrlich hielt, lud ihn der König zugaste und etliche Kaufleute aus der Galeere mit ihm und erwies ihnen größere Ehre, als er andern Patronen je getan hatte; ebenso machte es auch der Admiraldo. Das verdroß erst die drei Nationen, denn nun sahen sie, daß ihre Schenkung übel angelegt war. Und als nun die Zeit kam, daß die Galeere von Alexandria hinweg fahren mußte, denn die Schiffe, die mit Kaufmannswaren gen Alexandria kamen, durften nicht länger als sechs Wochen bleiben, da machte Fortunatus einen andern Patron an seine Statt Patron hieß man den Schiffherrn oder dessen bevollmächtigten Stellvertreter, der für Schiff, Ladung und Mannschaft alle kaufmännischen und rechtlichen Geschäfte zu vollziehen hatte. Einen solchen nennt man heute Kargado oder Superkargo. und befahl ihm, mit der Galeere gen Spanien, Portugal, England und Flandern zu fahren, da zu kaufen und zu verkaufen und den Gewinn zu mehren, was er wohl tun mochte, da er beträchtliche Güter führte. Er befahl auch dem Patron, über zwei Jahre mit der Galeere wieder in Alexandria zu sein, denn alsdann gedächte er seine Reise vollbracht zu haben und wieder in Alexandria zu sein; wenn sie ihn aber alsdann nicht da fänden, sollten sie keine Rechnung auf ihn machen, daß er bei Leben wäre, und die Galeere seinem Gemahl Cassandra und seinen Söhnen in Famagusta überantworten.
Da Fortunatus allein war, gesellte er sich zu dem Admiraldo und bat ihn, daß er ihm bei dem Sultan frei Geleit durch sein Land erwirkte und einen Fördernisbrief an die Fürsten der Länder, die er zu sehen begehrte, als das Land des Kaisers von Persien, das großen Chans von Catai Die Mongolen hatten unter ihrem großen Führer Dschingis-Chan und seinen Söhnen ein unermeßliches Reich gegründet. Mitte des dreizehnten Jahrhunderts erstreckte es sich von der Weichsel bis ans chinesische Meer, vom Himalaja bis weit nach Sibirien. Von diesem Koloß, der bald zerbröckelte, gingen bis ins sechzehnte Jahrhundert neue Staatenbildungen aus, und das Gewoge der Völkermassen ebbte und flutete mehrmals bis nach Kleinasien und über die Grenzen der deutsch-slavischen Länder. Der Bericht eines Augenzeugen, des Venedigers Marco Polo, der von 1271 bis 1295 durch Persien, Iran und Pamir nach dem Reiche des Groß-Chans von Catai d. i. China reiste und dort zu hohem Ansehen kam, brachte zuerst einige Klarheit in die sagenhafte Kunde, die im Abendlande von den Wundern des Ostens umlief. Sein Werk wurde gleich nach seiner Niederschrift in zahlreichen Handschriften verbreitet und als Modebuch gelesen und hat zu den nun folgenden geographischen Entdeckungen und kaufmännischen Unternehmungen ungeheuern Anstoß gegeben. Noch viel mehr als der Originalbericht des Marco Polo war das Buch eines Fälschers verbreitet, des englischen Edelmanns Mandeville, der nicht über Ägypten hinauskam und für seinen Reisebericht die vorhandenen Schriftsteller, besonders Marco Polo ausschrieb. Sein Werk wurde als Volksbuch in die meisten abendländischen Sprachen übersetzt und seit Erfindung der Buchdruckerkunst unendlich oft gedruckt, zuerst deutsch 1481. Es steht in der Simrockschen Sammlung im 13. Bande: Hans von Montevilla. Dieses Volksbuch hat auch dem Verfasser des Fortunatus vorgelegen, wie eine Stelle im Original bezeugt (die bei Simrock fehlt): Wer gern wissen will, was Wunder, Abenteuer und Sitten in den Landen ist, der lese das Buch Johannem de Montevilla., des Priesters Johannes und andre benachbarte Länder. Das verschaffte ihm der Admiraldo und gab ihm auch Leute zu, die Wege und Stege und die Sprache der Länder kannten. Da rüstete sich Fortunatus mit seinen Begleitern auf das köstlichste und ließ alles, was man zu der Reise bedurfte, gegen bares Geld anschaffen. Darauf zog er aus und kam zuerst in des Kaisers von Persien Land, darauf in des großen Chans von Catai, darauf durch die Wüste gen Indiam in des Priesters Johannes Land, welches teils aus Inseln, teils aus festem Lande besteht und 72 Königreiche begreift, deren jedes viel Land und Leute und mächtige Schlösser und Städte unter sich hat. Dem Priester Johannes schenkte Fortunatus schöne Kleinode, die in dem Lande selten waren, gab auch den Kämmerlingen und bat, ihm Fördernis zu geben mit Leuten und Briefen, daß er käme gen Calecut Kalekut, die heutige Hafenstadt Calicut an der Westküste Ostindiens, war um die Mitte des 15. Jahrh. die Hauptstadt eines mächtigen mohammedanischen Fürsten, den die Europäer Zamorin nannten (Samundri d. i. Seekönig). Seit 1486 war es portugiesische Kolonie. – Bei dem Städtenamen »Lamecho« ist im Original zu lesen »wo der Verführer Machomet begraben liegt«. Darnach sollte man auf Medina schließen. Vermutlich aber ist der Ort, wo Fortunatus das Kamel zur Wüstenreise kauft, die heilige Stadt Mekka, die ja französisch » La Mecque« heißt. in das Land, wo der Pfeffer wächst. Da ist ein mächtiger König und von übergroßer Hitze gehet Mann und Weib nackt; da wächst der allerbeste Pfeffer in ganz India, in der Gestalt kleiner grüner Weinträublein. Als nun Fortunatus das alles gesehen, auch nicht weiter kommen mochte, gedachte er an sein liebes Gemahl Cassandra und seine beiden Söhne und hatte ein herzliches Verlangen nach Hause, wandte sich auch wieder heimwärts und ritt durch fremde Länder, dadurch er zuvor nicht gekommen war. Zunächst kam er auf dem Meer gefahren gen Lamecho: da kaufte er ein Kameltier und ritt durch die Wüste gen Jerusalem, die heilige Stadt heimzusuchen. Nun war die bestimmte Zeit, wo er mit seiner Galeere zusammentreffen sollte, bis auf zwei Monate herum, darum eilte er auf Alexandrien zu, dem Sultan Dank zu sagen für seine Fördernisbriefe, die ihm gute Dienste geleistet hatten. Er kam also wieder zum Herrn Admiraldo: der war froh und tät ihm große Ehre, da er hörte, daß er sich so ritterlich gewagt und so ferne Lande durchzogen hatte.
Als aber Fortunatus zu Alexandria wohl acht Tage gelegen und gewartet hatte, siehe, da kommt seine gute Galeere gefahren und hatte unterwegs so viel gewonnen und so viel köstliche Güter geladen, daß sie dreimal besser war, als da sie Fortunatus hinweggesandt. Dessen war er sehr froh, sonderlich, da er alle seine Leute frisch und gesund sah, die ihm auch Briefe von seiner allerliebsten Gemahl Cassandra brachten.
Hierauf sagte Fortunatus zu einem seiner Kaufleute, sie sollten bald verkaufen, damit sie desto eher heim kämen. Das taten sie und gaben alles billig, wer wohlfeil gibt, dem hilft Sanct Nicolaus verkaufen Sankt Nikolaus ist ein Hauptheiliger der griechischen Kirche, Bischof von Myra in Kleinasien anfangs des 4. Jahrh. Die Redensart »dem hilft St. Nikolaus verkaufen« mag sich auf eine Legende gründen oder auf den Umstand, daß der Nikolaustag (6. Dez.) in einem großen Teile Niederdeutschlands allgemeiner Geschenktag ist und so die Kaufleute guten Absatz haben., und wer kauft, wie man ihm ein Ding beut, der ist auch bald fertig. Während nun andre Galeeren sechs Wochen zu Alexandria lagen, so brachten sie alles in drei Wochen an den Mann. Da sie nun also geeilt hatten und das der Sultan vernahm, wollte er nicht, daß Fortunatus hinwegführe, er müßte denn zuvor mit ihm speisen, und lud ihn am Abend, als er den andern Morgen hinwegfahren wollte. Das konnte ihm Fortunatus nicht versagen und befahl, daß sich jedermann in die Galeere setzte und die Galeere aus dem Hafen in das Meer führe: sobald die Mahlzeit geschehen wäre, wollte er zu ihnen kommen. Also kam der Admiraldo, holte Fortunatus ab und führte ihn in des Königs Palast. Als sie nun nach Hof kamen, ward Fortunatus von dem König wohl empfangen, denn Fortunatus war dem König bekannt; da fragte der König, wie es ihm in fremden Landen ergangen wäre. Da sagte er ihm alles und dankte für die Förderungsbriefe, so er ihm gegeben hätte, denn dadurch wäre er bei andern Herren sehr gefördert worden, und hätte er die Briefe nicht gehabt, so hätte er die Reise nicht vollbringen mögen. Das gefiel dem Sultan gar wohl; ich muß aber eins dazu fügen: des Fortunatus Seckel war auch gut neben den Briefen. Indem sie also miteinander redeten, setzte man sich zu der köstlichen Tafel, bei der sie von fünfzehnhundert Mamelucken Die Mameluken, d. h. die Erkauften, waren ursprünglich Sklaven, welche die ägyptischen Sultane zu Kriegsdiensten in Asien ankauften. Wie so oft wurden auch hier die Knechte zu Herren: Von 1250 bis ins 16. Jahrh. herrschten Mamelukensultane über Ägypten. Die Mameluken der Frühzeit waren türkisch-tartarischer Abkunft, seit Ende des 14. Jahrh. aber sind die Mamelukensultane meist Tscherkessen, also Kaukasier. Möglich ist, daß viele von ihnen früher Christen waren. Doch sind die Mameluken kein Soldatenorden gewesen wie die osmanischen Janitscharen, die sich nur aus Christenknaben rekrutierten. – Die Mamelukensultane erwarben anfangs des 15. Jahrh. durch Eroberung eine Art Lehenshoheit über Cypern, was in unserer Erzählung nicht zum Ausdruck kommt. bedient wurden.
Als sie nun gegessen hatten und die Mamelucken, die abgefallenen Christen, noch bei zwölfhundert in dem Saal standen und auf den Dienst warteten, begehrte Fortunatus des Sultans Hofgesinde zu begaben: das vergönnte ihm der Sultan. Da öffnete er den Seckel unter dem Tisch, daß ihn niemand sehen möchte und die Kraft des Seckels verborgen bliebe. Und da er allen den Mamelucken und auch dem Koch und dem Kellner gegeben hatte, nahm es den Sultan Wunder, wie er so viel Geld hätte mögen bei sich tragen, und hielt es für eine große Ehre, die er ihm getan, daß er seine Diener so herrlich begabet, und sprach: Ihr seid ein Ehrenmann, und es geziemt sich wohl, daß man euch Ehre antue: kommt mit mir, ich will euch etwas sehen lassen, was ich habe. Da führte er ihn in einen Turm, der ganz steinern und stark gewölbt war. Und in einem Gewölbe waren sehr viel Kleinodien von Silber, auch lagen da große Haufen von Silbermünzen, wie man Korn aufschüttet. Darnach führte er ihn an ein ander Gewölb, das war voll güldener Kleinodien, darin standen viel große Truhen, die alle voll gemünzter Goldgulden waren. Darnach in ein drittes Gewölbe, das gar wohl verwahrt war, darin standen große Kisten, die alle voll köstlicher Kleinodien waren und großer Gezierde, so zu seinem Leib gehörte, wenn er sich wollt sehen lassen in seiner königlichen Majestät. Da waren Edelsteine ohne Zahl, und besonders hatte er zwei güldene Leuchter, und auf jedem standen zwei große Karfunkel, die so schön und hell waren, daß sie bei der Nacht schienen, als ob es Kerzenlichter wären. Fortunatus war sehr verwundert und lobte dem Sultan die Kleinodien gar sehr. Da der Sultan hörte, daß sie ihm wohl gefielen, sprach er: Ich habe noch ein Kleinod in meiner Schlafkammer, das ist mir lieber denn alles, das Ihr gesehen habt. Fortunatus sprach: Was mag das sein, das so köstlich ist? Das will ich dich sehen lassen, sprach der Sultan und führte ihn in seine Schlafkammer, die groß, schön und luftig war, und die Fenster sahen alle in das weite Meer. Also ging der Sultan über einen Kasten und brachte einen gar unscheinbaren haarlosen Filzhut hervor und sprach zu Fortunatus: Dieser Hut ist mir lieber denn alle Kleinodien, die du gesehen hast, aus der Ursache: hätte ich keine Kleinodien, so wüßte ich sie doch zu bekommen; aber einen solchen Hut wüßte ich nicht zuwege zu bringen. Fortunatus sprach: Gnädiger Herr, wäre es nicht wider Euer Majestät, so wollt ich gern wissen, was doch das Hütlein könnte, das Ihr so hoch achtet. Der Sultan sprach: Das will ich dir sagen: es hat die Tugend, wenn ich es aufsetze oder ein andrer, wo er dann begehrt zu sein, da ist er: damit habe ich viel Kurzweil, mehr denn mit meinem Schatze. Wenn ich meine Diener auf die Jagd sende und mich verlanget, daß ich gern bei ihnen sein wollte, so setze ich mein Hütlein auf, wünsche mich zu ihnen, so bin ich bei ihnen. Und wo ein Tier im Wald ist, will ich, so bin ich bei ihm und kann es den Jägern in die Hände liefern. Wenn ich dann Feindschaft habe und meine Soldaten im Feld sind, wenn ich will, so bin ich bei ihnen, und wenn ich will, so bin ich wieder in meinem Palast, da mich alle meine Kleinode nicht möchten hinbringen. Fortunatus sprach: Lebt der Meister noch, der es gemacht hat? Der Sultan antwortete: Das weiß ich nicht. Fortunatus gedachte: O möchte mir der Hut werden! Er schickte sich wohl zu meinem Seckel. Und sprach zu dem Sultan: Ich halte dafür, so der Hut so große Kraft hat, daß er auch ziemlich schwer sein und einen übel drücken werde, wenn man ihn auf hat. Der Sultan antwortete: Er ist nicht schwerer denn ein anderer Hut; hieß ihn sein Barett abtun und setzte ihm das Hütlein selbst auf und sprach: Ist es nicht wahr, daß er nicht schwerer ist, denn ein anderer Hut? Fortunatus antwortete: Gewiß, ich hätte nicht gemeint, daß er so leicht wäre, noch Ihr so töricht, daß Ihr mir den Hut hättet aufgesetzt. Indem wünschte er sich in seine Galeere, und sogleich war er darinnen, und sobald er in die Galeere kam, hieß er die Segel aufziehen, denn sie hatten gar einen starken Nachwind, daß sie gar schnell hinweg fuhren. Als nun der Sultan sah, daß Fortunatus sein allerbestes Kleinod hinweg hatte, stand er am Fenster, sah die Galeere abfahren, wußte nicht, was er tun sollte und gebot allem seinem Volk, dem Fortunatus nachzueilen und ihn gefangen zu bringen, denn er müßte sein Leben verlieren, daß er ihn also beraubt hätte. Also fuhren sie ihm nach; aber ehe sie sich rüsteten, war die Galeere schon so fern, daß sie niemand sehen mochte. Und als sie der Galeere etliche Tage nachgefahren waren, kam ihnen die Furcht, die Catalonischen Meerräuber Die christlichen Spanier führten ihren Befreiungs- und Vergeltungskrieg gegen die Mauren in einer sehr unzarten Manier. Und namentlich nach der Eroberung von Sardinien und Sizilien durch die Aragonier übten die Flotten der christlichen Seeräuber an den Schiffen der Sarazenen furchtbare Vergeltung. möchten an sie kommen; zum Streiten waren sie auch nicht gerüstet und wollten den Fuchs nicht beißen, kehrten also wieder um und sagten dem Sultan, sie hätten die Galeere nicht ereilen können. Da ward der Sultan traurig.
Da nun die Venediger, Florentiner und Genueser erfuhren, daß Fortunatus mit des Sultans bestem Kleinod davon gefahren, waren sie froh und sagten: er hat ihm den rechten Lohn gegeben, jetzt sind wir doch sicher vor ihm, daß er nicht mehr herkommt und uns so großen Schaden zufügen mag mit kaufen und verkaufen, als er uns getan hat.
Da nun der Sultan um das Kleinod kommen war, hätte er es gern wieder gehabt, wußte aber nicht, wie er es angreifen sollte, und gedachte: ob ich schon den Admiraldo oder meiner Fürsten einen zu ihm schickte, so sind sie den Christen nicht angenehm und möchten unterwegs gefangen werden. Doch entschloß er sich, eine höfliche Botschaft zu Fortunato gen Cypern zu schicken und bat den Hauptmann der Christen zu Alexandria (denn jede Nation hat ihren Konsul da, und diese pflegen unter sich einen Obern zu wählen), daß er ihm eine Reise diente, und sagte ihm die Ursache und worum es ihm zu tun wäre. Dieser erklärte sich bereit, in seinem Dienste zu fahren, wohin er wollte. Also ließ er ihm ein Schiff ausrüsten, bemannte es mit christlichen Schiffleuten und befahl ihm gen Famagusta zu Fortunatus zu fahren und ihm zu sagen, daß er ihm sein Hütlein wiederschickte, denn er hätte es ihn in Treuen sehen lassen, und wollt es zu Dank wieder von ihm annehmen und dafür seine Galeere voll guten Gewürzes senden. Wenn das aber Fortunatus nicht tun wollte, so sollt es der Hauptmann dem König in Cypern klagen, der sein Oberherr wäre, und ihn bitten, den Fortunatus anzuhalten, daß er ihm sein Kleinod, welches er ihm unredlich entführt, wieder schickte. Der Hauptmann, der ein Venediger war und Marcholando hieß, sagte dem Sultan zu, er werde die Botschaft verrichten und allen Fleiß dabei anwenden. Der Sultan gab ihm groß Gut, rüstete ihn köstlich aus und versprach ihn reichlich zu beschenken, wenn er das Kleinod wiederbrächte. Dem Sultan war so leid um den Hut, daß er keine Ruhe haben mochte; alle seine Mamelucken mußten auch traurig sein. Sie hatten den Fortunatus zuvor gelobt, da sie das Geld von ihm empfangen; als er aber ihren Sultan betrübt hatte, sagten sie, es wäre der größte Bösewicht, der auf Erden lebe.
Also fuhr Marcholando gen Cypern und kam gen Famagusta in den Hafen; es war aber Fortunatus wohl zehn Tage vor ihm dahin gekommen. Nun mögt ihr wohl gedenken, wie hoch und schön Fortunatus empfangen ward von seinem allerliebsten Gemahl Cassandra und wie er selbst sich freute, daß er so glücklich heimgekommen war. Die ganze Stadt freute sich mit ihm, denn viel Volks aus der Stadt, das mit Fortunatus ausgewesen, war nun mit ihm heimgekommen und hatte unterwegs viel gewonnen. Da nun Marcholando mit seiner Galeere landete, verwunderte er sich sehr, daß man so fröhlich in der Stadt war. Als nun Fortunatus inne ward, wie des Großsultans Botschaft gen Famagusta gekommen, versah er sich wohl, was die Ursache wäre, ließ ihm eine schöne Herberg bestellen und sie auf seine Kosten mit allem Nötigen versehen. Als nun Marcholando wohl drei Tage zu Famagusta gelegen, da schickte er zu Fortunatus und ließ ihm sagen, er hätte eine Botschaft an ihn auszurichten. Das vergönnte ihm Fortunatus; also kam er in seinen schönen Palast und sprach: Der Sultan von Babylon, Herr zu Alkairo und Alexandria, entbeut dir, Fortunatus seinen Gruß, durch mich, Marcholando, du wollest mich als seinen treuen Boten erkennen und ihm sein Kleinod durch mich zurückschicken.
Fortunatus antwortete und sprach: Mich nimmt Wunder, daß der Sultan nicht klüger war, da er mir sagte, welche Tugend das Hütlein hätte, und mir dasselbe aufs Haupt setzte, wodurch ich in große Angst und Not kam, die ich mein Lebtag nimmer vergessen werde; denn meine Galeere stand in dem weiten Meere, da wünschte ich mich hinein, und wenn ich die Galeere verfehlt hätte, wär ich um mein Leben kommen, das ich köstlicher schätze, denn des Sultans Königreich, weshalb ich denn gesonnen bin, das Kleinod nimmer von mir zu lassen, solang ich lebe. Da Marcholando das hörte, gedachte er ihn mit Verheißung großen Guts zu überreden und fing an und sprach: Fortunatus, lasset euch raten: was soll euch das Hütlein? Ich will euch dafür schaffen, was euch und euern Kindern viel besser und nützer ist denn das abgeschabte Hütlein, und hätte ich solcher Hütlein einen Sack voll, so wollte ich sie alle geben um den dritten Teil dessen, was ich euch dafür verschaffen will. Darum tut mir nach meinem Wunsche, so will ich euch versprechen, daß euch der Sultan eure Galeere beladet mit gutem Gewürz, als Pfeffer, Ingwer, Nägelein, Muskatnüß, Zimmetrinden und anderes mehr, das sich auf hundert Dukaten belaufen würde, und darzu sollt ihr das Hütlein nicht aus der Hand geben, bis ihr gewährt und bezahlt seid und euch die Galeere samt dem Gut zu euern sichern Händen überantwortet wird. Ist euch das genehm, so will ich selber auf eurer Galeere gen Alexandrien fahren und sie euch geladen hieher bringen in dem Vertrauen, wenn ich wiederkomme und bringe, was ich verheißen habe, daß ihr mir meines gnädigen Sultans Kleinod wiedergebt. Auch weiß ich wohl, daß das Kleinod in der ganzen weiten Welt nirgend das dritte Teil so viel gilt als der Sultan dafür gibt, und wäre es nicht zuvor sein gewesen, ihm wäre so weh nicht darnach.
Darauf antwortete Fortunatus kurz: Ich will des Sultans und eure Freundschaft gern haben; doch gedenke niemand das Hütlein aus meiner Gewalt zu bringen. Ich habe noch ein anderes Kleinod, das mir sehr lieb ist: die beiden müssen bei mir bleiben, solange ich lebe.
Auf diese Rede verfügte sich Marcholando zum König von Cypern, der des Fortunatus Oberherr war, klagte ihm das von Fortunatus und bat, daß er doch dem Sultan das Kleinod, daß er ihm entfremdet, wieder zurückschaffte, und so das nicht geschähe, so hätte er Sorge, es würde ein großer Krieg daraus entstehen. Der König antwortete Marcholando: Ich habe Fürsten und Herren mit mir, und so ich gebiete, tun sie was sie sollen. Hat nun der Sultan etwas an Fortunatus zu fordern, so ziehe er ihn vor Gericht, so will ich ihm Recht folgen lassen, wie billig ist. Da gedachte Marcholando: Hier werden die Heiden nicht viel Rechts gewinnen, rüstete also seine Galeere wieder zu und wollte davon.
Da war Fortunatus so gütig und lud ihn zugaste, erbot ihm große Ehre, beschenkte ihn mit vielen schönen Kleinodien, ließ ihm seine Galeere mit Speis und Trank wohl versehen und sprach: Ich bin dir nicht feind, daß du dem Sultan diese Botschaft geworben hast; doch hoffe ich, du seist mir auch nicht feind, daß ich ihm sein Hütlein nicht wieder schicke. Wenn der Sultan das Hütlein von mir hätte, er schickte es mir auch nicht wieder; auch würde es ihm niemand raten, wie mir auch von niemanden geraten wird, daß ich es ihm schicken soll.
Marcholando dankte dem Fortunatus für die Ehre und Schenkung, so er ihm getan, und sagte, solches wollte er dem Sultan hinterbringen; fuhr also unverrichteter Sache hinweg.
Als nun Fortunatus die ganze Welt durchreiset und sich ein volles Genügen zuwegen gebracht, fing er an und hielt einen köstlichen Stand, ließ seine zween Söhne auch hervorziehen, hielt sie herrlich und köstlich und dingte ihnen Leute, die sie alle ritterlichen Spiele lehrten, Stechen, Turnieren und Rennen, wozu der jüngste Sohn gar geneigt war und sich männlich in die Sache schickte. Darum gab Fortunatus viel Kleinode aus, um welche zu Famagusta gestochen ward, wobei sein jüngster Sohn allezeit das beste tat und den Preis gewann, daß jedermann sprach, Andolosia mache dem ganzen Lande Ehre. Darüber hatte Fortunatus große Freude, der also ein verjüngtes Leben führte und viel Kurzweil hatte mit seinem Hütlein, mit Hunden und Falken, mit seinem Sohn Andolosia und mit seinem allerliebsten Gemahl Cassandra. Als sie nun viele Jahre in allen Freuden gelebt, da ward die schöne Cassandra krank, einer schweren tödlichen Krankheit, daran sie sterben mußte trotz aller ärztlichen Hülfe. Das bekümmerte Fortunatus so sehr, daß er auch in eine böse Krankheit fiel, die Schwindsucht, und nahm von Tag zu Tag an seinem Leibe ab, duldete großes Siechtum, und es wurde je länger je schlechter mit ihm. Er schickte zu den allerbesten Ärzten, die man nur bekommen konnte, und gab und verhieß ihnen großes Gut. Sie wollten ihm aber gar keinen Trost geben, daß sie ihn gesund machen würden; doch wollten sie das beste tun, sein Leben zu fristen, solange sie könnten, und wandten darauf ihren Fleiß, nahmen auch Geld dafür genug. Fortunatus aber empfand keine Besserung, er konnte gar wohl merken, daß er dem Tod nicht entrinne.
Als er nun auf dem Todbette lag, sandte er nach seinen zweien Söhnen, Ampedo und Andolosia, und sprach: Sehet, lieben Söhne, eure Mutter, die euch mit großem Fleiß erzogen hat, ist nun mit Tod abgegangen. So ist nun die Zeit gekommen, daß ich auch aus dieser Welt scheiden muß, und also will ich euch sagen, wie ihr euch verhalten sollt nach meinem Tode, damit ihr bei Ehren bleibet, wie ich bis an mein Ende geblieben bin. Und sagte ihnen, wie er zwei Kleinodien hätte, den Seckel und was Tugend er hätte, nicht länger denn solange sie lebten; auch was Tugend das Hütlein hätte, wie groß Gut ihm der Sultan dafür wollte gegeben haben und befahl ihnen, sie sollten die Kleinodien nicht voneinander scheiden, sollten auch niemand sagen von dem Seckel. Denn also habe ich den Seckel sechzig Jahre gehabt und habe es keinem Menschen gesagt, und ihr seid jetzt die ersten, die es aus meinem Munde hören. Und noch eins will ich euch befehlen, lieben Söhne, daß ihr zu Ehren der Jungfrau, von der ich bin begabt worden mit diesem Glückseckel, hinfort alle Jahr den ersten des Brachmonats feiern wollet auf den Tag und eine arme Tochter, welcher Vater und Mutter zum ehelichen Stande nicht verhelfen können, begaben wollt mit hundert Goldstücken nach des Landes Währung. Das hab ich getan, solang ich den Seckel gehabt. Damit endete er sein Leben und seine zween Söhne ließen ihn herrlich begraben in die schöne Kirche, die Fortunatus selbst hatte bauen lassen.
Als nun ihr Vater gestorben, da trugen sie leid um ihn und hielten ihm die Jahreszeit Die gebräuchliche einjährige Trauerzeit, die keine Teilnahme an öffentlichen Festen erlaubte., wie es billig war. Dieweil nun Andolosia das Jahr stille gelegen und nicht stechen durfte, noch andere Hofweise treiben, da war er über seines Vaters Büchern gesessen und hatte gelesen, wie er so viele christliche Königreiche durchzogen, durch so viele Länder der Heiden gefahren war, was ihm wohl gefiel und ihm solche Lust machte, daß er sich ernstlich vornahm, auch zu wandern. Er sprach zu seinem Bruder Ampedo: Mein liebster Bruder, was wollen wir anfahen? Laßt uns wandern und nach Ehren streben, wie unser Herr Vater getan hat. Hast du nicht gelesen, wie er so weite Lande durchfahren ist, so lies es noch! Ampedo antwortete seinem Bruder gar gütlich und sprach: Wer wandern will, der wandere, es gelüstet mir gar nicht, ich könnte leicht hinkommen, wo es mir nicht so wohl wäre wie hier: ich will allhie zu Famagusta bleiben und mein Leben in dem schönen Palast verschleißen. Andolosia aber sprach: So du des Sinnes bist, so laß uns die Kleinode teilen. Ampedo antwortete: Willst du denn das Gebot deines Vaters übertreten? Weißt du nicht, daß es sein letzter Wille gewesen ist, daß wir die Kleinode nicht voneinander scheiden sollten? Andolosia sprach: Ich kehre mich nicht an die Rede, er ist tot, ich aber lebe noch und will teilen. Ampedo sprach: So nimm das Hütlein und ziehe, wohin du willst. Andolosia sprach: Nimm du es selbst und bleibe hier! Sie konnten nicht einig werden, denn jeder wollte den Seckel haben. Andolosia sprach: Lieber Bruder, ich weiß, wie wir es halten: wir wollen nach unsers Vaters Rat niemand zu unserer Teilung nehmen. So laß uns aus dem Seckel zwo Truhen mit Goldstücken füllen, die behalte du hier und lebe wohl, du magst sie dein Lebtag nicht verzehren; und behalte auch das Hütlein hier bei dir, damit du Kurzweil haben magst: und laß mir den Seckel, so will ich wandern und nach Ehren streben. Ich will sechs Jahre aus sein, und wenn ich wieder komme, so will ich dir den Seckel auch sechs Jahre lassen, und also wollen wir ihn gemeinsam haben und nutzen. Ampedo war ein gütiger Mensch, ließ es also geschehen, wie es sein Bruder erdacht hatte.
Da nun Andolosia den Seckel hatte, war er von ganzem Herzen froh und wohlgemut, rüstete sich mit guten Knechten und Pferden, nahm Urlaub von seinem Bruder und fuhr mit vierzig wohlgerüsteten Reisigen auf seiner eigenen Galeere von Famagusta bis in den Hafen Aiguesmortes Aigues mortes (Mordwasser ist ein französischer Hafen, westlich der Rhônemündung, etwa 4 km vom Mittelmeer, mit dem es durch einen jetzt versandeten Kanal verbunden ist. Es war Verschiffungshafen der französischen Kreuzheere. Die Stadt ist mit ihren mittelalterlichen Häusern und Festungswerken wohl erhalten.. Da stieg er an das Land und ritt zuerst an den Hof des Königs von Frankreich, gesellte sich zu den Edeln, Grafen und Freien, denn er machte großen Aufwand und ließ gar wohl mit sich umgehen: darum ward er von jedermann hochgehalten. Er diente auch dem König, als ob er sein verpflichteter Diener wäre. Wenn es sich begab, daß man stechen sollte, scharf rennen, ringen und springen, so tat er es allen andern zuvor. Und nach dem Stechen hielt man gewöhnlich großen Tanz mit edeln Frauen, wozu er auch berufen und hervorgezogen ward. Die Frauen fragten, wer er wäre. Da ward ihnen gesagt, er heiße Andolosia von Famagusta in Cypern und wär aus edelm Geschlecht. Der König lud ihn zugaste, und den Edeln war seine Gesellschaft angenehm. Darauf lud er die Edeln und ihre Frauen zugaste und gab ihnen gar ein köstlich Mahl. Darum ward er den edeln Frauen wohlgefällig, die nun um so lieber glaubten, daß er von edelm Stamm geboren sei.
Da war ein Edelmann an des Königs Hof, dessen Weib übertraf weit alle Frauen an Schönheit. Der Edelmann war oft bei Ritterspielen Andolosias Gesell, und diese zwei hielten sich gern zusammen. Nun kam es, daß Andolosia der Frau seines Gesellen über die Maßen hold wurde und er um sie zu werben begann. Und da er sie ihm nicht abgewinnen mochte und sie ihn noch dazu seiner Liebe wegen in ein Spottgerede brachte, faßte er einen großen Überdruß, dazubleiben, rief all sein Volk zu sich und ritt also ungesegnet und ohne des Königs Urlaub im Unmut von Paris.
Als nun Andolosia den Hof des Königs von Frankreich verlassen hatte, gedachte er: Es ist nur gut, daß mich die Weiber nicht um den Seckel betrogen haben, schlug sich die Sache aus dem Sinn und setzte sich vor, wie er nun erst anheben wollte, fröhlich zu sein und guten Mut zu haben, und ritt eines Ritts an den Hof des Königs von Aragonien Spanien hatte Mitte des 15. Jahrh. neben dem Maurenreiche im Süden eine Reihe christlicher Königreiche, die hier genannt werden. Aragonien und Kastilien wurden 1469 vereinigt. Der genannte König von Hispanien ist gewiß spätere Zutat, vielleicht durch den Drucker.. Darnach zu dem König von Navarra, zu dem König von Castilien, zu dem König von Portugal, zuletzt zu dem König von Hispanien. Da gefiel ihm das Volk und ihre Sitten so sehr, daß er sich und all sein Volk nach ihrem Landesgebrauch kleidete. Der König gewann ihn gar lieb, und da er in allen Streiten an der Spitze war und viel mannliche Taten verrichtete, schlug ihn der König zum Ritter. Nun war ein alter Graf an des Königs Hof, der eine einzige Tochter hatte: da wollte der König, Andolosia sollte sie zur Ehe nehmen, so werde er ihn zum Grafen machen an des Grafen Statt. Aber Andolosia gefiel des Grafen Tochter nicht, auch achtete er der reichsten Grafschaft nicht, denn er hatte genug in seinem Seckel. Darum nahm er Urlaub von dem König, dingte sich mit all seinem Volk auf ein Schiff und fuhr gen England.
Als er nun gen London kam, wo der König dazumal Hof hielt, bestellte er ein großes schönes Haus, ließ alles darin nötige überflüssig kaufen und fing an, Hof zu halten, als ob er ein Herzog wäre. Als das der König ersah, ließ er ihn fragen, ob er an seinen Hof kommen wollte. Andolosia antwortete, er wollte ihm gern dienen mit Leib und Gut. Indem begab es sich, daß der König von England einen Krieg führte wider den König von Schottland. Da zog Andolosia mit großem Volk auf eigne Kosten mit ihm und tat so manche ritterliche Tat, daß er vor allen andern gelobt ward, wiewohl er kein Engländer war. Als aber der Krieg aus war und jedermann heimzog, kam Andolosia auch wieder gen London und ward wohl empfangen von dem König, von den Frauen und von allem Volk.
Als sich nun das Kriegsvolk verlaufen hatte, lud der König Andolosia zugaste und führte ihn an die Tafel zu der Königin und seiner einzigen Tochter Agrippina: die war das allerschönste Frauenbild, so man in der Welt finden mochte, so weiß und zart, daß sie einer Feenkönigin verglichen ward. Diese schöne Jungfrau ward Andolosia gegenüber an den Tisch gesetzt, und als sie Andolosia ansah, ward er von inbrünstiger Liebe entzündet und sein Herz von solcher Wollust umfangen, daß er weder essen noch trinken mochte. Als nun die Mahlzeit vollbracht war und Andolosia wieder heim kam, gedachte er: O wollte Gott, daß ich von königlichem Stamm geboren wäre, so wollte ich dem König getreulich dienen mit festem Vertrauen, er müßte mir die schöne Agrippina vermählen: was wollt ich mehr als ein so schönes Gemahl? Da ich aber nicht hochgeboren bin, so kann ich doch nicht lassen, ihr hold zu sein und um ihre Liebe zu werben, was mir auch geschehe. Da fing er an zu stechen, der Königin und ihrer Tochter zu Lieb und Ehren. Darnach lud er auf einmal die Königin, ihre Tochter und die Frauenzimmer, so an dem Hof waren, und gab ihnen ein köstlich Mahl, daß sich jedermann darüber verwunderte; darzu schenkte er der Königin ein köstliches Kleinod, desgleichen der jungen Königin Agrippina und machte auch der Kammermeisterin und den Mägden der Königin große Geschenke, damit er desto angenehmer wäre, wenn er zu den Frauen käme. Das erfuhr der König, und als Andolosia einsmals gen Hof kam, sprach der König zu ihm: Mir sagen die Königin und meine Tochter, wie du ihnen so ein herrlich Mahl gegeben, warum ludest du mich nicht auch dazu? Andolosia sagte: Allergnädigster Herr und König, wenn Euer königliche Majestät mich, Euern Diener, nicht verschmähen wollte, wie eine große Freude sollte mir das sein! Der König sprach: Ich will morgen kommen und zehn mit mir bringen. Dessen war Andolosia gar froh, ging eilends heim und richtete alle Dinge gar köstlich zu. Und als alles bereit war, kam der König mit Grafen und Herren, und die Mahlzeit ward so herrlich vollbracht, daß der König Wunder darob hatte, wie auch alle andern, so mit dem König gekommen waren. Der König dachte: ich muß dem Andolosia ein wenig die Pracht legen und zu Schanden machen, ließ heimlich gebieten, man sollte den Seinen kein Holz verkaufen, damit er nicht kochen könnte, wenn er mit Andolosia zu Mittag essen sollte. Darauf sagte er zu Andolosia, er werde morgen sein Gast sein. Wiewohl Andolosia dessen froh war und gleich seine Diener aussandte, alles zu kaufen, was sich Gutes fand, so erschrak er doch des Mangels am Holze, wußte erst nicht, was das für eine Bewandtnis habe, noch womit er kochen sollte; als er aber merkte, daß es auf des Königs Gebot geschehe, schickte er eilends nach den Venedigern in London und ließ ihnen abkaufen Nägelein, Muskaten, Sandelholz und Zimmetrinden: das schüttete man an die Erde, zündete es an, kochte und bereitete die Speise dabei, als ob es Holz wäre.
Da es nun Zeit zur Mahlzeit war, gedachte der König, sie würde nicht bereit sein, nichts desto weniger saß er auf mit seinem Gefolge und ritt gen Andolosias Herberge.
Und als sie schier zum Hause kamen, da ging ihnen ein edeler, köstlicher Geruch entgegen, daß sie Wunder darob hatten, und je näher sie dem kamen, je stärker der Geruch ward. Der König ließ fragen, ob das Essen bereit wäre. Man sagte ihm: Ja und bei eitel Spezerei gekocht. Das verwunderte den König sehr. Als nun die Mahlzeit vollbracht war, kamen des Königs Diener wohl mit fünfhundert Pferden den König zu holen. Da sprach Andolosia zu dem König: Gnädiger Herr, ist es nicht wider Euch, so wollt ich Eurer Diener jeglichem zehn Kronen geben. Der König sprach: Ich laß es geschehen. Da wurden sie alle in einen Saal gerufen. Andolosia stand unter der Türe und gab einem nach dem andern zehn Kronen. Des wurden die Diener sehr froh und fingen allerlei an zu sagen von Andolosia.
Als nun der König in seinen Palast kam, sagte er seiner Gemahlin, wie ihm Andolosia so eine herrliche Mahlzeit gegeben hätte, die mit eitel Gewürz statt des Holzes gekocht worden, und daß er seiner Diener jeglichem zehn Kronen gegeben. Das nahm ihn Wunder, von wannen ihm so viel Geld käme, denn da war kein Sparen, sondern er trieb es je länger je herrlicher.
Die Königin sprach: Ich wüßte niemand, der das eher und besser erfahren könnte, denn Agrippina, unsere Tochter, er ist ihr hold und sagt ihr gewiß alles, was sie ihn fragt. Der König sprach: Ich möcht es gern erfahren. Es ist, als schöpfte er aus einem Brunnen, und wüßte ich einen Brunnen, daraus Geld zu schöpfen wäre, so wollt ich selber auch schöpfen. Die Königin sprach: Ich will sehen, ob ich es erfahre. Als nun die Königin in ihr Frauenzimmer kam, rief sie Agrippina zu sich allein und fing an mit ihr von dem köstlichen Leben zu sprechen, das Andolosia führte und sprach: Das verwundert den König und auch mich, da er doch weder Land noch Leute hat, von wannen ihm so groß Gut kommen sollte. Nun ist er dir gar hold, das kann ich an allen seinen Gebärden spüren; und wenn er wieder zu dir kommt, so will ich dir desto mehr Zeit lassen mit ihm zu reden: siehe zu, ob du von ihm erfahren magst, woher ihm der Reichtum kommt. Agrippina sprach: Ich will es versuchen.
Und als Andolosia nach Hof kam, ward er gar schön empfangen und bald in das Frauenzimmer gelassen, worüber er große Freude hatte. Nun war alles so bestellt, daß er allein zu reden kam mit der schönen Agrippina. Da fing Agrippina an und sprach: Andolosia, man sagt große Ehre von euch, wie ihr dem König eine so köstliche Mahlzeit gegeben und dazu alle seine Diener wohl begabt habt: nun sagt mir, habt ihr nicht Sorge, das euch das Geld gebrechen möge? Er sprach: Gnädige Frau, mir kann kein Geld zerrinnen, dieweil ich lebe. Agrippina sprach: So betet ihr billig für euern Vater, der euch so viel hinterlassen hat. Andolosia sprach: Ich bin so reich als mein Vater, und er war nie reicher, denn ich jetzt bin; doch war er anderer Gesinnung: ihn freute nur, die fremden Länder zu sehen; mich erfreuet nichts, denn schöne Frauen und Jungfrauen und wie ich deren Liebe und Gunst erwerben möchte. Agrippina sprach: Nun hab ich doch vernommen, daß ihr an vieler Könige Höfen gewesen, da schöne Frauen und Jungfrauen sind: habt ihr nichts gefunden, das euch gefallen hat? Andolosia sprach: Ich hab an sechs königlichen Höfen gedient und viel schöne Frauen und Jungfrauen gesehen, aber ihr übertrefft sie alle bei weitem durch Schönheit, Anstand und edles Wesen, womit ihr mein Herz also in Lieb entzündet, daß ich es nicht lassen kann, euch die große, unsägliche Liebe zu eröffnen, die ich zu euch trage. Ich weiß zwar wohl, daß ich von Adel nicht hoch genug geboren bin, aber die Liebe, die alles überwindet, zwingt mich so hart, daß ich es nicht lassen kann, euch um eure Liebe zu bitten. Die wollet mir nicht versagen, so will ich euch auch alles gewähren, worum ihr mich bittet. Agrippina sprach: Andolosia, sage mir die rechte Wahrheit, daß ich erkennen möge, von wannen dir so viel bar Geld und Reichtum kommt, so will ich auch nach deinem Willen leben. Des war Andolosia froh, und aus unbedachtem Mut und freudenreichem Herzen sprach er zu ihr: Allerliebste Agrippina, was ihr zu wissen begehrt will ich euch in ganzer Treue und Wahrheit sagen; aber gelobet mir auch eure Liebe bei guter Treue. Sie sprach: O du allerliebster Andolosia, du sollst nicht zweifeln an meiner Liebe noch an meinem Verheißen: was ich dir mit dem Mund verheiße, das soll dir alles in der Tat gehalten werden. Auf diese guten Worte sprach Andolosia zu der schönen Jungfrau: Nun hebt euere Schürze auf. Er zog seinen Glücksseckel heraus, zeigte ihn Agrippina und sprach: Dieweil ich diesen Seckel habe, so gebricht mir keines Geldes, zählte ihr tausend Kronen in ihren Schoß und sprach: Die seien euch geschenkt, und wollt ihr mehr haben, ich zähle euch mehr. Glaubet ihr nun, daß ich euch die rechte Wahrheit gesagt habe? Sie antwortete: Ich sehe und erkenne die Wahrheit, und mich nimmt nicht mehr Wunder eures Aufwandes. Er sprach: So gewährt mir nun, wie ich euch gewährt habe. Da sprach sie: Das will ich tun, mein lieber Andolosia. Die Königin wird diese Nacht bei dem König sein: so will ich es mit meiner Kämmerin einrichten, daß sie euch zu mir einlasse. Ohne die kann ich es nicht zuwege bringen; ihr müßt ihr gute Schenkung tun, damit es verschwiegen bleibe. Das sagte er ihr zu.

Bd. 49, S. 97. Text siehe S. 103
Sobald Andolosia hinweg ging, lief Agrippina mit den tausend Kronen im Schoß zu der Königin und sagte ihr mit großen Freuden, wie sie erfahren hätte, von wannen Andolosia das Geld käme, und wie sie ihm verheißen hätte, ihn auf den Abend zu empfangen. Das gefiel der Königin wohl, und sie sprach zu Agrippina: Weißt du wohl, welche Gestalt der Seckel hat und welche Farbe und Größe? Sie sprach: Ja, und schickte bald nach einem Seckler und ließ sich einen Seckel machen nach der Form von Andolosias Seckel; den machten sie lind, als ob er alt wär, und schickten zu ihrem Arzt und ließen ihn ein stark Getränk machen, davon man bald und so hart entschlief, daß man für tot da lag. Als der Trunk gemacht war, trugen sie ihn in Agrippinas Kammer und unterwiesen die oberste Kammermeisterin, wenn zu Abend Andolosia käme, daß sie ihn schön empfinge und in Agrippinas Gemach führte: dann wollte die Königin Agrippina zu ihr senden, und wenn sie also zusammen kämen, sollte sie allerlei Konfekt und Zuckerwerk auftragen und ihnen zu trinken reichen und wohl aufmerken, daß sie dem Andolosia den Trunk in den Becher schüttete. Und wie alles geordnet war, also geschah es. Andolosia kam gar heimlich und ward in Agrippinas Kammer geführt; sie kam und setzte sich zu ihm. Sie redeten gar zärtlich miteinander; die alte Kammermeisterin brachte Konfekt und bot ihnen zu trinken. Agrippina kredenzte ihm und sprach: Andolosia, ich bring euch einen freundlichen Trunk. Er hub auf und trank, daß er ihren Willen täte. Also brachte sie ihm der freundlichen Trünke einen nach dem andern, bis er den ganzen Trunk genommen hatte. Und alsbald sank er hin und entschlief so hart, daß er keine Empfindung mehr hatte, wie man auch mit ihm umginge. Da das Agrippina sah, war sie bald über ihm, riß ihm sein Wams auf, trennte seinen Glücksseckel ab und nähte ihm einen andern an dessen Statt. O Andolosia, wie war das ein ungleicher Tausch!
Agrippina brachte des Morgens der Königin den Seckel; sie versuchten ihn, ob er gut wäre und zählten viel Gulden daraus: da war kein Aufhören! Die Königin brachte dem König den Schoß voller Gulden und erzählte ihm, wie sie mit Andolosia umgegangen wären. Der König bat die Königin, sie sollte mit Agrippina reden, daß sie ihm den Seckel gebe, sie möchte sonst darum kommen: das tat die Königin. Agrippina wollte es aber nicht tun. Da bat sie, daß sie ihr ihn gäbe: das wollte sie auch nicht tun; und sie sagte, sie hätte ihr Leben daran gewagt, denn wenn er erwacht wäre, dieweil sie so mit ihm umgegangen wäre, so hätte er sie erschlagen, und das mit Recht.
Da Andolosia ausgeschlafen hatte und erwachte, blickte er um sich und sah niemand als die alte Kammermeisterin: diese fragte er, wo Agrippina hingekommen wäre. Sie sprach: Sie ist eben fortgegangen, die gnädige Frau Königin hat nach ihr geschickt. Mein Herr, wie habt Ihr so hart geschlafen? Ich hab lang an Euch geweckt, konnte Euch aber nicht erwecken, daß Ihr Freude und Kurzweil mit Agrippina gehabt hättet. Ihr habt so hart geschlafen, hätte ich nicht empfunden, daß Euch der Atem ginge, ich hätte gemeint, Ihr wärt tot gewesen. Da Andolosia hörte, daß er die Liebe der schönen Agrippina verschlafen, fing er an zu fluchen und sich selbst zu verwünschen. Die alte Kammermeisterin wollte ihn stillen und sprach zu ihm: Herr, gehabt Euch nicht so übel, was nicht geschehen ist, das kann noch geschehen. Andolosia sprach: Daß dich Gott strafe, du alte Lügnerin, warum hast du mich nicht geweckt? Ich hab all mein Lebtag nicht so hart geschlafen, wer mich nur ein wenig angerührt hätte, der hätte mich erweckt. Sie schwur hoch und teuer, sie hätte ihn gerüttelt, und gab ihm gute Worte, denn er hatte ihr am Abend zweihundert Kronen geschenkt; und mit den guten Worten führte sie ihn aus Agrippinas Kammer und aus des Königs Palast. Andolosia kam heim zu seinen Leuten und war nicht fröhlich, wie er sonst zu sein pflegte. Aber er wußte nicht, daß er Glück und Heil verschlafen hatte.
Nun hätte der König solcher Seckel auch gern einen gehabt, denn er meinte, Andolosia hätte deren mehr, er wär ja sonst ein Narr gewesen, daß er den einen so liederlich verwahrt hatte. Um nun solches zu erfahren, wollte er wieder mit Andolosia essen. Als Andolosia vernahm, daß der König abermals mit ihm essen wollte, rief er seinem Diener, dem er allemal drei- oder vierhundert Kronen gab, daß er das Haus versähe und alles Nötige anschaffte: dem sagte er, daß er ein köstlich Mahl zubereite, der König wollte abermals mit ihm essen. Sein Diener sagte: Herr, ich hab nicht Geld genug, denn es kostet viel. Andolosia, der nicht gutes Muts war, riß sein Wams auf, zog seinen Seckel heraus und wollte seinem Diener vierhundert Kronen geben. Und da er in den Seckel griff nach seiner alten Gewohnheit, fand er nichts. Er sah auf gen Himmel, von einer Wand zur andern. Er kehrte dem Seckel das Innere nach außen; aber da war kein Geld mehr. Da merkte er erst, daß er von Agrippina betrogen sei, und gedachte der Lehre, die sein Vater Fortunatus ihm und seinem Bruder so treulich auf seinem Todbette gegeben hatte, daß sie, solange sie lebten, niemand von dem Seckel sagen sollten. Aber es war versäumt und alle seine Hoffahrt nun aus. Da rief er alle seine Knechte, gab ihnen Urlaub, und sprach: Es ist nun bald zehn Jahr, daß ich euer Herr bin: ich habe euch anständig gehalten und keinen Mangel gelassen, ich bin auch keinem was schuldig, ihr seid alle bezahlt. Nun ist die Zeit kommen, daß ich nicht mehr Hof halten kann, wie ich's bisher getan, ich sag euch also der Gelübde, so ihr mir getan, ganz quitt, ledig und los; und versehe sich nun ein jeder, wie es ihn am besten dünkt, denn länger kann ich nicht bleiben, und hab auch nicht mehr Geldes als hundertundsechzig Kronen, davon schenk ich einem jeden zwo, auch mag er Roß und Harnisch zu eigen behalten. Der Rede erschraken die Diener sehr und einer sah den andern an, und es nahm sie groß Wunder, wo die Pracht über Nacht hin wäre. Da hub einer an und sprach. Getreuer lieber Herr, hat euch jemand Verdruß getan, das gebt uns zu verstehen: er muß sterben, und wäre es der König selbst, und sollten wir all unser Leben darum verlieren. Andolosia sprach: Von meinetwegen soll niemand fechten. Sie sprachen: Wir wollen also nicht von euch scheiden, sondern Roß, Harnisch und was wir haben, verkaufen und euch nicht verlassen. Andolosia sprach: Ich dank euch allen, liebe fromme Diener, der Ehrerbietung: so sich das Glück wieder zu mir kehrt, will ich das alles wieder vergelten. Aber wie ich gesagt habe, also tut und sattelt mir alsbald mein Pferd; ich will, daß keiner mit mir reite oder gehe. Die Knechte waren traurig um ihren frommen Herrn, bei dem sie so gute Tage gehabt hatten; doch brachten sie ihm sein Pferd. Da nahm er Urlaub von ihnen allen, saß auf und ritt und fuhr zu Wasser und Land den nächsten Weg gen Famagusta zu seinem Bruder Ampedo.
Und als er kam vor den schönen Palast, klopfte er an und ward alsbald eingelassen. Und als Ampedo vernahm, daß sein Bruder Andolosia gekommen war, ward er froh und meinte, er wolle nun auch Freud mit dem Seckel haben und forthin nicht mehr sparen, wie er zehn Jahre getan hatte. Er ging dem Bruder entgegen, empfing ihn mit großen Freuden und sagte, warum er allein käme und wo er sein Volk gelassen hätte. Da sagte er: Ich habe sie alle verlassen und danke Gott, daß ich heimgekommen bin. Ampedo sprach: Lieber Bruder, wie ist es doch ergangen? Das sage mir, denn es gefällt mir übel, daß du so allein gekommen bist. Er antwortete: Laß uns erst essen; und da sie die Mahlzeit vollbracht hatten, gingen sie miteinander in eine Kammer, da begann Andolosia mit trauriger Gebärde und demütiger Stimme und sprach: O allerliebster Bruder, ich muß dir leider böse Zeitung verkünden, daß ich so übel gefahren und um unsern Glücksseckel gekommen bin. Ach Gott! es ist mir ein herzliches Leid, weiß aber nicht zu helfen.
Ampedo erschrak von Grund seines Herzens, also daß er schier in Ohnmacht gefallen wäre, und mit großem Jammer sprach er: Ist er dir mit Gewalt genommen worden, oder hast du ihn verloren? Er antwortete: Ich habe das Gebot, das uns unser getreuer Vater auf dem Todbette gab, übertreten und einem lieben Menschen von dem Seckel gesagt, und sobald ich es ihm geoffenbart, hat er mich darum gebracht, dessen ich mich nicht zu ihm versehen hätte. Ampedo sprach: Hätten wir das Gebot unseres Vaters gehalten und die Kleinode nicht voneinander kommen lassen! Aber du wolltest nur fremde Lande erfahren: nun schau, wie wohl du es geschafft hast. Andolosia sprach: O lieber Bruder, es ist mir ein so großes Herzeleid, daß ich meines Lebens nicht mehr achte.
Als Ampedo diese Worte hörte, wollte er ihn trösten und sprach: Lieber Bruder, laß dir es nicht so schwer zu Herzen gehen, wir haben noch zwo Truhen voller Dukaten, auch bleibt uns das Hütlein: wir wollen dem Sultan schreiben, der gibt uns groß Gut dafür: so haben wir dennoch genug und können einen ehrlichen Stand führen unser lebenlang: laß den Seckel fahren. Andolosia sagte: Gewonnen Gut ist schwer aufzugeben: mein Begehren wäre, du gäbest mir das Hütlein, so bin ich der Hoffnung, den Seckel damit wiederzubekommen.
Ampedo sprach: Man sagt, wer sein Gut verliert, der verliert auch die Sinne: das spür ich auch an dir wohl. Da du uns um das Geld gebracht hast, so wolltest du uns auch gern um das Hütlein bringen. Aber fürwahr, mit meinem Willen sollst du es nicht hinwegführen; ich will dir wohl vergönnen, Kurzweil damit zu haben. Als Andolosia vernahm, daß ihm sein Bruder nicht vergönnen wollte, das Hütlein hinwegzuführen, gedachte er, so will ich ohne seine Gunst davon. Da sprach er zu Ampedo: Nun mein getreuer, lieber Bruder, hab ich übel getan, so will ich hinfort nach deinem Willen leben. Darauf schickte er die Knechte in den Forst, eine Jagd anzustellen: er wollte nachkommen. Als sie weg waren, sprach Andolosia: Lieber Bruder, leih mir das Hütlein, ich will in den Forst. Der Bruder war willig und brachte das Hütlein, und sobald er das hatte, ließ er die Jäger im Forst ihr Ding schaffen und kam mit dem Hütlein gen Genua und fragte nach den besten und köstlichsten Kleinodien, die man hatte, und ließ sich die in seine Herberge bringen. Da man ihm nun viel brachte, marktete er lange darum und legte sie in ein Tüchlein zusammen, als wollte er untersuchen, wie schwer sie wären, und fuhr also damit hinweg unbezahlt, und wie er in Genua getan hatte, also tät er zu Florenz und Venedig auch, und brachte die köstlichsten Kleinodien, so in den dreien Städten waren, zusammen ohne Geld. Als er die Kleinode hatte, zog er gen London in England. Nun wußte er wohl, wo die junge Königin Agrippina zur Kirchen ging, an der Straße bestellte er sich einen Laden und legte seine Kleinode da aus. Nun ging eines Tages Agrippina zur Kirche und hatte Mägde und Knechte vor und hinter sich, auch die alte Kammermeisterin, die ihm den Tolltrank gegeben hatte. Andolosia kannte sie alle noch; aber sie ihn nicht, das machte, er hatte eine andere Nase über der seinen, die so abenteuerlich gemacht war, daß ihn niemand erkennen konnte.
Als aber Agrippina vorüber war, nahm er zween schöne Ringe und schenkte sie den zwei alten Kammermeisterinnen, die stets bei Agrippina waren und ihr Vertrauen hatten, und bat sie, die Königin zu vermögen, daß sie ihn in ihren Palast holen ließe: so wollt er so köstliche Kleinode mit sich bringen, daß sie nie dergleichen gesehen hätte. Sie sagten ihm zu, sie wollten es bewirken, und als Agrippina von der Kirchen heim kam, zeigten sie der Königin die zween hübschen Ringe und sagten ihr, der Juwelier, so vor der Kirchen gestanden, hätte sie ihnen geschenkt, darum daß sie schafften, daß nach ihm gesendet würde, denn er hätte gar köstliche Kleinodien. Die Königin sprach: Ich glaube wohl, daß er köstliche Kleinode hat, weil er euch so zwei schöne Ringe geschenkt hat: heißt ihn herkommen, denn mich verlangt, die Kleinodien zu sehen. Er kam bald und ward in den Palast in einen Saal vor der Kammer Agrippinas geführt: da legte er seine Kleinodien aus, die Agrippina sehr wohl gefielen. Sie feilschte um die, welche ihr am besten gefielen. Nun waren Kleinodien darunter, die tausend Kronen wert waren und noch viel mehr, darfür bot sie ihm nicht das halbe Geld. Der Juwelier sprach: Gnädige Königin, ich hab oft gehört, daß Ihr die reichste Königin seid, so auf dem ganzen Erdreich ist, darum hab ich die allerschönsten Kleinodien, so man nur finden mag, ausgesucht, um sie Euern königlichen Gnaden zu bringen; aber Ihr bietet mir gar zu wenig, sie kosten mich sicher mehr. Begehret meiner übeln Zeit nicht umsonst, ich bin Euch so lang nachgereiset mit großen Sorgen, daß ich ermordet werden möchte um die Kleinodien. Gnädige Königin, legt zusammen, was Euch gefällt; was ich dann erleiden mag, das will ich mir abziehen lassen. Also las sie aus, was ihr am besten gefiel, klein und groß, wohl zehn Stück. Da rechnete der Juwelier eins zu dem andern, daß es sich auf fünftausend Kronen belief: das wollte sie ihm nicht dafür geben. Andolosia gedachte: Ich will mich nicht mit ihr darum schlagen; brächte sie nur den Seckel. Doch wurden sie des Kaufes eins um vier tausend Kronen. Also nahm die Königin die Kleinodien in ihren Schoß, ging in die Kammer über ihren Kasten, darin der Glücksseckel war, strickte ihn an ihrem Gürtel fest und kam heraus und wollte den Juwelier bezahlen. Da schickte sich der Juwelier, daß sie neben ihn kam, und als sie anhub zu zählen, da umfing er sie, faßte sie gar stark und wünschte sich mit ihr in eine wilde Wüste, da keine Wohnung wäre.
Sobald er das gewünscht, waren sie in einer kurzen Weile durch die Luft kommen auf eine gar elende Insel, die stößt an Hibernia, und saßen miteinander unter einem Baum, darauf waren viel schöner Äpfel. Und als die Königin unter dem Baum saß und hatte die Kleinodien, so sie kaufen wollte, in ihrem Schoß und den Glücksseckel an ihrem Gürtel, so siehet sie über sich und sieht viel schöner Äpfel über ihr hangen: da sprach sie zu dem Juwelier: Ach Gott, sage mir, wo sind wir, und wie sind wir daher gekommen? Ich bin so schwach: gäbst du mir der Äpfel einen, daß ich mich erlaben möchte? Und wußte nicht, daß es Andolosia war. Da legte er die Kleinode, so er noch hatte, in ihren Schoß und setzte das Wünschhütlein, das er trug, ihr auf das Haupt, damit es ihn am Klettern nicht hinderte. Und als er auf den Baum kam, und sehen wollte, wo die besten Äpfel hingen, saß Agrippina unter dem Baum und wußte nicht, wo sie war, noch wie ihr geschehen: Da fing sie an und sprach: Ach wollte Gott, daß ich wieder in meiner Schlafkammer wär! Und sobald sie das Wort sprach, fuhr sie durch die Luft und kam ohne allen Schaden in ihre Schlafkammer. Der König und die Königin und alles Hofgesind waren froh und fragten wo sie gewesen, und wo der Juwelier wäre, der sie hinweg geführt hätte. Sie sprach: Ich weiß es nicht, ich hab ihn auf einem Baum gelassen, fragt mich nicht mehr, ich muß ruhen, denn ich bin ganz blöd und müde geworden. Als nun Andolosia auf dem Baum saß und sah, daß Agrippina hinweg war mit Seckel, mit dem Hütlein, darzu mit allen Kleinodien, so er in dreien großen und mächtigen Städten zusammengebracht hatte, erschrak er, stieg herab, sah den Baum an und sprach: Verflucht sei der Baum und die Frucht und der ihn gepflanzt hat! Er sah hin und her, wußte nicht, wo er war, noch wohin er sich wenden sollte, und fing wieder an zu fluchen und sprach: Verflucht sei die Stunde, darin ich geboren, und jeder Tag, den ich verlebt habe. Grimmer Tod, warum hast du mich nicht erwürgt, ehe ich in diese Angst und Not kommen bin? Verflucht am meisten der Tag, wo ich Agrippina zum erstenmal sah. Wollte nur Gott, daß mein Bruder in dieser Wildnis bei mir wäre, so wollt ich ihn erwürgen und mich selber mit meinem Gürtel an einen Baum hängen: so wir dann tot und gestorben wären, hätte doch der Seckel keine Kraft mehr und möchte die alte Königin, die Unholdin, und das falsche ungetreue Herz Agrippinas keine Freude mehr haben mit dem köstlichen Seckel und den teuern Kleinodien.
Und da er also hin und her ging, ward es finster, daß er nicht mehr sah, da legte er sich nieder unter einen Baum und ruhte eine kleine Weile; er konnte aber nicht schlafen vor Angst, er versah sich auch nichts anders, denn in der Wildnis zu sterben, lag also da wie ein Verzweifelter und wäre lieber tot gewesen, denn daß er länger sollte gelebt haben.
Als es nun Tag ward, stand er auf und ging umher, konnte aber niemand sehen noch hören, kam also zu einem Baum, darauf standen schöne rote Äpfel, und weil ihn gar sehr hungerte, warf er in den Baum, daß zween große Äpfel herab fielen. Die aß er behend, und als er die Äpfel gegessen hatte, da wuchsen ihm zwei lange Hörner, wie eine Geiß hat. Alsbald lief er mit den Hörnern wider die Bäume und meinte sie herabzustoßen; aber es war alles vergebens.
Da schrie er mit lauter Stimme: O ich armer elender Mensch! O ich armer unglücklicher Mensch! wie kommt es, daß soviel Menschen auf Erden sind und niemand hier ist, der mir hülfe, daß ich zu den Leuten kommen möchte? O allmächtiger Gott; komme mir zuhülf in diesen meinen großen Nöten!
Und da er so jämmerlich schrie, hörte ihn ein Einsiedler, der wohl dreißig Jahr in der Wildnis gewohnt und nie einen Menschen gesehen hatte: der ging dem Geschrei nach, kam zu Andolosia und sprach: O du armer Mensch, wer hat dich hergebracht, oder was suchest du in dieser Wildnis? Er antwortete: Lieber Bruder, mir ist leid, daß ich hergekommen bin. Der Bruder sprach: Ich hab in dreißig Jahren nie einen Menschen gesehen noch gehört; ich wollte, du wärest auch nicht hieher gekommen. Andolosia, ganz ohnmächtig, fragte den Bruder, ob er nichts zu essen hätte? Der Einsiedler führte ihn in seine Klause, darin war weder Brot noch Wein: er hatte garnichts denn Obst und Wasser, davon lebte der Bruder; das war keine Speise für Andolosia. Er sprach zu ihm: Ich will dir weisen, wo du Speise und Trunk genug findest. Darauf fragte Andolosia: Lieber Bruder, wie soll ich tun mit den Hörnern, so ich habe? Man wird mich für ein Meerwunder ansehen. Der Bruder führte ihn einen kleinen Weg von seiner Klause, brach von einem andern Baum zween Äpfel ab und sprach: Lieber Sohn, nimm hin und iß die! Sobald Andolosia die Äpfel gegessen, waren ihm die Hörner ganz verschwunden. Da er das sah, fragte er ihn, wie es zuginge, daß er so bald Hörner bekommen und so bald wieder davon gekommen wäre. Der Bruder sprach: Der Schöpfer, der Himmel und Erde erschaffen hat und alles, so darinnen ist, hat auch diese Bäume erschaffen und ihnen die Natur gegeben, daß sie solche Frucht bringen, und ist auch ihresgleichen auf allem Erdreich nicht, denn allein in dieser Wildnis. Andolosia sprach: O lieber Bruder, erlaubet mir, daß ich von diesen Äpfeln etliche nehmen und mit mir hinwegtragen möge. Der Waldbruder sprach: Lieber Sohn, nimm was dir gefällig ist, frage mich nicht, sie sind nicht mein, ich habe garnichts eigenes, denn eine arme Seele, und kann ich sie dem Schöpfer, der sie mir gegeben hat, wieder überantworten, so hab ich wohl gestritten in dieser Welt. Ich kann an dir wohl merken, daß dein Sinn und Gemüt schwer beladen und umfangen ist wegen zeitlicher und vergänglicher Sachen: schlage sie aus dem Sinn und kehre dich zu Gott, es ist kein großer Verlust um eine kleine Wollust, so einer hat in diesem vergänglichen Leben. Diese Worte gingen Andolosia garnicht zu Herzen, er gedachte allezeit an seinen großen Schaden und sammelte manchen Apfel, davon die Hörner wuchsen, und nahm auch etliche der Äpfel, welche die Hörner vertrieben, und sprach zu dem Bruder: Nun weise mich auf den Weg zu den Leuten. Der Bruder führte ihn auf einen Weg und sprach: Nun gehe den Weg grad für dich, so kommst du an ein breites Wasser, das ist ein Meeresarm; und wenn du daran kommst, ist dann Flut, so warte bis die Ebbe kommt, und sobald es trocken ist, so hebe dich auf und geh auf einen hohen Turm zu, so kommst du zu einem Dorf; da findest du zu essen und zu trinken. Er dankte dem Bruder fleißig, nahm von ihm Urlaub und kam zu Kräften. Als er nun zu sich selber kam, fragte er, wo der nächste Weg gen London in England wäre. Da ward ihm gesagt, er wäre noch in Hibernia, er müsse durch das Königreich Schottland, hernach finge erst England an. Als Andolosia hörte, daß er so fern von London wäre, ward er unmutig, auch war ihm leid um die Äpfel, so er trug, denn er besorgte, sollte er solange unterwegs sein, die Äpfel würden Schaden nehmen. Und als die Leute merkten, daß er gern gen London wär gewesen, da wiesen sie ihm eine große Stadt, die war ein Seehafen, wo Schiffe von England, Flandern und Schottland lagen: daselbst fand er ein Schiff, das ihn gen London führte. Als er dahin kam, ließ er sich das eine Auge verdecken und setzte eine Perrücke auf, die ihn unkenntlich machte, und nahm ein Tischlein, setzte sich vor die Kirchentür, wo er wohl wußte, daß Agrippina, die junge Königin, hineingehen würde, legte die Äpfel auf ein schön weiß Tuch und rief: Äpfel von Damaskus, und so man ihn fragte, wie er einen gäbe, so sagte er: Für drei Kronen. Da ging jedermann davon; ihm wär auch leid gewesen, hätte sie jedermann kaufen wollen. Indem kommt die Königin mit ihren Jungfrauen und Dienern, wie auch ihre Kammermeisterin mit ihr: da rief er abermals: Äpfel von Damaskus. Die Königin sprach: Wie gibst du einen? Er sagte: Für drei Kronen. Sie sprach: Welche Tugend haben sie, daß du sie so teuer hältst? Er sprach: Sie geben einem Menschen Schöne, darzu scharfe Vernunft. Da das die junge Königin Agrippina hörte, befahl sie ihrer Kammermeisterin, daß sie zween kaufte, wie sie auch tat. Andolosia stellte seinen Kram wieder ein, denn ihm wollte niemand mehr abkaufen. Als nun die Königin heim kam, wartete sie nicht lange und aß die zween Äpfel, und sobald sie die gegessen hatte, sogleich wuchsen ihr zwei große Hörner unter so großen Kopfschmerzen, daß sie sich auf ihr Bett legte. Da aber die Hörner hervorgeschossen waren und das Kopfweh nachließ, stand sie auf, ging vor den Spiegel, und da sie sah, daß sie zwei so ungestalter hoher Hörner hatte, griff sie alsbald mit beiden Händen daran und meinte sie abzureißen; als es aber nicht sein konnte, rief sie zwei ihrer edeln Jungfrauen herbei. Als sie die Königin also sahen, erschracken sie sehr und segneten sich, als ob sie der böse Geist wäre. Die Königin war so sehr erschrocken, daß sie nicht reden konnte. Sie sprachen: O gnädige Königin, wie ist das zugegangen, daß Eure hohe Person eine solche Ungestalt empfangen hat? Sie antwortete ihnen: Ich weiß selber nicht: es ist vielleicht eine Plage, die mir Gott schickt; oder vielleicht kommt es mir von den Äpfeln von Damaskus, die mir der ungetreue Krämer verkauft hat. Nun ratet, ob ihr mir von den Hörnern helfen mögt? Die Mägde zogen hart daran, das litt sie geduldig; es half aber nichts. Des ward sie je länger je mehr bekümmert und sprach: O ich elendes Geschöpf! Was hilft mir nun, daß ich eines Königs Tochter bin und die reichste Prinzessin, die auf Erden lebt, und den Preis der Schöne von allen Weibern hatte, da ich jetzt einem unvernünftigen Tier gleich sehe? O daß ich nie geboren wäre! Kann man mir nicht von dieser Ungestalt helfen, so will ich mich selbst in der Themse ertränken. Ihrer obersten Jungfrauen eine fing an sie zu trösten und sprach: Gnädige Königin, Ihr sollt nicht verzagen, habt Ihr die Hörner bekommen können, so mögen sie wohl auch wieder hinweg gehen. Darum schickt nach hochgelehrten Ärzten: vielleicht wissen sie oder finden geschrieben, woraus solch Gewächs entspringt und womit es mag vertrieben werden. Die Rede gefiel ihr wohl. Sie sprach: So sagt niemand davon, und wenn jemand nach mir fragt, so sagt, ich sei nicht wohl und laßt niemand zu mir! Die alte Kammermeisterin schickte nach allen Ärzten und legte ihnen den Fall vor: einer Person, ihrer nahen Verwandten, wären zwei Hörner gewachsen: ob die zu vertreiben wären oder nicht? Da die Ärzte das hörten, nahm es sie groß Wunder, daß einem Menschen sollten zwei Hörner wachsen. Ein jeder begehrte mit großem Eifer die Person zu sehen. Die Magd sprach: Ihr mögt sie nicht sehen, ihr wüßtet ihr denn zu helfen, und wer das könnte, dem würde wohl gelohnt. Doch keiner war so beherzt, der sich unterstand die Hörner zu vertreiben: sie hätten es nie gehört, gelesen noch gesehen.
Und da die Ärzte der Magd die Sache also gar abschlugen, ward sie traurig, denn sie hätte gern gute Zeitung heimgebracht; da ihr aber die Ärzte keinen Trost gaben, wollte sie wieder heimgehen.
Da begegnete ihr Andolosia: der hatte sich durch eine große Nase entstellt und als ein Doktor angetan mit rotem Scharlachrock und großem roten Barett. Da sprach er zu ihr: Liebe Schaffnerin, ich sehe, daß ihr in drei Häuser von Ärzten gegangen seid: habt ihr Rat gefunden nach euerm Begehren? Zürnet nicht, daß ich frage, denn ich bin auch ein Doktor der Arznei, und liegt euch etwas an, das mögt ihr mir zu erkennen geben: es muß gar ein fremdes, großes Gebrechen sein, das ich mit der Hülfe Gottes nicht wüßte zu vertreiben. Die Hofmeisterin gedachte, Gott habe ihr den Doktor zugewiesen, und fing an und sagte ihm, wie einer namhaften Person ein seltsamer Schaden zugestoßen wäre und zwei Hörner aus dem Kopf geschossen, Geißhörnern gleich: und wisset ihr der Person zu helfen, so wird euch wohl gelohnt werden, denn sie hat kein Mangel an Geld noch an Gut. Der Doktor fing an gar gütlich zu lachen und sprach: Die Sache weiß ich und kann die Kunst, die Hörner zu vertreiben ohn alles Wehe; doch wird es Geld kosten. Ich weiß auch die Ursache, von wannen solche Hörner entspringen. Sie fragte: Lieber Herr Doktor, wovon kommt dies wunderbarliche Gewächs? Der Doktor antwortete der alten Kämmerin: Es kommt davon, wenn ein Mensch dem andern große Untreue tut und darüber viel Schadenfreude empfindet und doch diese Freude nicht öffentlich auslassen darf, denn sie muß auf irgend einem Wege hervorbrechen. Dem einen oder dem andern gerät es wohl, daß er sie nach oben hinausstößt; wo aber das nicht geschieht, da muß der Mensch sterben, denn die Hörner stoßen ihm das Herz ab. Und noch ist es nicht zwei Jahr, da ich an des Königs Hof von Hispanien war, da hatte ein mächtiger Graf eine schöne Tochter gar von großer Schöne, der waren zwei große Hörner hervorgeschossen, die ich ihr ganz vertrieben habe. Da die Hofmeisterin die Rede von dem Doktor vernahm, fragte sie ihn, wo er zu Haus wäre: sie wollte bald zu ihm kommen. Er sprach: Ich habe noch kein Haus gemietet, ich bin erst vor drei Tagen herkommen und bin in der Herberge zum Schwanen: da möget ihr nach mir fragen. Man nennt mich den Doktor mit der großen Nasen; wiewohl ich einen andern Namen habe, so kennt man mich doch am allerbesten dabei. Die Hofmeisterin ging bald mit großen Freuden zu der betrübten Königin und sprach: Gnädige Königin, seid fröhlich und gehabt Euch wohl, Eure Sache wird bald gut werden, und sagte ihr, wie sie drei Doktores ungetröstet hätten gehen lassen; darnach hätte sie einen gefunden, der sie wohl getröstet. Sie erzählte ihr alles, wie der Doktor mit ihr geredet hätte und wie er ihr zu helfen wüßte, und wie er auch einer Gräfin geholfen. Er hat mir auch gesagt, sprach sie, aus welcher Ursache solche Hörner entspringen, so daß ich ihm gerne glauben mag. Die traurige Königin, die auf dem Bette lag, sprach zu der Hofmeisterin: Warum hast du den Doktor nicht mit dir hergebracht? Du weißt, daß ich der Hörner so gerne los wäre. Geh gleich und bringe ihn, sag ihm, daß er alles mitbringe, was zur Sache dienlich sei und nichts spare; bringe ihm auch die hundert Kronen mit, und bedarf er mehr, so gib ihm, so viel er von dir begehrt.
Die Hofmeisterin ging hin, da sie den Doktor fand, und gab ihm hundert Kronen und sprach: Nun seid vorsichtig, denn zu der Person, dahin ich euch führen will, dürft ihr nur zur Nachtzeit kommen und es niemand sagen, denn ihr eigen Vater und Mutter wissen es nicht. Der Doktor sprach: Der Sache halber seid ihr sicher, es soll durch mich nicht auskommen, ich will mit euch gehen. Doch muß ich zuvor in die Apotheke und kaufen, was mir not sein wird zu brauchen. Also mögt ihr hier harren oder nach zwei Stunden wieder kommen. Sie sagte: sie wollte auf ihn warten, denn sie dürfte ohne ihn nicht heimkommen. Also ging der Doktor mit der großen ungestalten Nasen in eine Apotheke und kaufte ein wenig Rhabarber, ließ sich einen halben Apfel mit Zucker und Rhabarber überziehen, tat darzu sehr wohlschmeckende Dinge, die gar lieblich zu kosten und zu essen waren, kaufte auch in eine Büchse ein wenig wohlriechender Salben und nahm guten Bisam Bisam oder Moschus ist ein aus Drüsen des Moschustieres gewonnener starkriechender Stoff, der früher viel als Parfüm gebraucht wurde. zu sich und kam wieder zu der Hofmeisterin. Die führte ihn bei der Nacht zu der Königin. Die lag auf ihrem Bett hinter den Umhängen und empfing ihn gar ohnmächtig und schwach. Der Doktor sprach: Gnädige Frau, seid gutes Muts, mit der Hülfe Gottes und meiner Kunst soll Eure Sache bald gut werden. Nun richtet Euch auf und laßt mich sehen und greifen Euer Gebrechen: so kann ich Euch desto besser helfen. Agrippina schämte sich sehr, daß sie die Hörner sollte sehen lassen; doch setzte sie sich auf in dem Bette. Der Doktor griff die Hörner tapfer an und sprach: Man muß haben an jedes Horn ein Säcklein von Affenhaut, die will ich salben, und man muß sie warm halten! Die Hofmeisterin bestellte alsbald, daß ein alter Aff am Hof getötet, abgezogen und die Haut gebracht ward. Darauf fing der Arzt an und salbte ihr die Hörner mit dem Affenschmalz, zog ihr das Affenpelz-Säcklein darüber und sprach: Gnädige Frau, was ich jetzt den Hörnern getan habe, das wird sie bald lind machen; doch müssen sie durch Stuhlgänge vertrieben werden. Darum habe ich Konfekt mit mir gebracht, das müsset ihr essen und darauf ein Schläflein tun: so werdet ihr gewahr werden, daß sich die Sache gar bald zu Besserung schickt. Agrippina tat als eine Kranke, die gerne genesen wäre, und aß den halben Apfel, den ihr der Doktor gab von denen, welche die Hörner vertrieben, und als sie den gegessen hatte, fing die Kraft des Rhabarbers in ihrem Leibe zu wirken an und trieb sie zu Stuhle. Da sie nun wieder an ihr Bett kam, sprach der Doktor: Lasset uns sehen, ob die Arznei vielleicht gut getan habe, und griff oben an die Pelzsäcklein: da waren die Hörner um den vierten Teil verschwunden. Agrippina war den Hörnern so feind, daß sie gar sie nicht angreifen mochte; als man ihr aber sagte, sie hätten abgenommen, griff sie daran und fühlte wohl, daß sie kleiner geworden. Dessen freute sie sich sehr und bat den Doktor, Fleiß anzuwenden. Er sprach: Heute Nacht komme ich wieder und bringe, was not ist. Er ging in die Apotheke und ließ sich wieder einen halben Apfel überziehen und ihm einen andern Geschmack machen. Darauf ward er wieder bei der Nacht zu der Königin geführet, salbte ihr die Hörner und ließ die Säcklein kleiner machen, daß sie den Hörnern fest anlagen, gab ihr auch Konfekt, daß sie schlief. Und als sie ihre Stuhlgänge gehabt, besahen sie die Hörner: da waren sie wieder geschwunden und halb hinweg gegangen. Hatte sie sich zuvor gefreut, so freute sie sich jetzt noch mehr und bat den Doktor, daß er nicht abließe und fleißig fortarbeitete, sie wollte ihm seine Mühe wohl belohnen. Er sprach, wie er die zwo Nächte getan hätte, also würd er auch die dritte tun. Da er aber bei ihr saß und sie schlief, gedachte er: Zwei- oder dreitausend Kronen wären einem andern Arzt ein großer Lohn: und doch ist es gar nichts zu schätzen gegen das, was sie von mir hat. Ehe ich ihr die Hörner vertreibe, will ich anders mit ihr reden und ihr meine Meinung sagen. Will sie es nicht tun; wenn sie dann meinet, ich würde ihr die Hörner vertreiben, will ich ihr ein Konfekt machen, daß sie ihr wieder so lang werden wie zuvor. Sobald sie jetzt erwacht, will ich zu ihr sprechen, ich sei auch ein Doktor in der schwarzen Kunst (Zauberei) und habe einen Geist beschworen, daß er mir riete, was ich von ihr fordern sollte. Der habe mir gesagt, sie hätte zwei Kleinode, den Seckel und das Hütlein, das letzte müsse sie mir geben und dazu alle Jahr soviel, daß ich gleich einem Herren leben möge. Und dieweil er das bei sich gedachte, kam die Hofmeisterin mit einem Licht und wollte sehen, was die Königin machte: da schlief sie.
Der Doktor hatte sein Barett abgezogen, das entfiel ihm, und als er sich bückte, es wieder aufzuheben, so siehet er vorn unter der Bettstatt das Wünschhütlein auf der Erden liegen. Niemand hatte darauf acht gehabt, weil des Hütleins Tugend allen unbekannt war. Die Königin wußte auch nicht, daß sie durch die Kraft des Hütleins wieder heimgekommen war, denn hätte sie die Kraft des Hütleins gewußt, sie würde es an einen andern Nagel gehängt haben. Also sendet der Doktor die Kammermeisterin nach einer Büchsen, darin Arznei war, und während sie die Büchse holte, hub er das Hütlein eilends auf und verbarg es unter seinem Rock und gedachte: könnte mir der Seckel auch werden! Indem erwachte die Königin und kleidete sich schön an. Der Doktor zog ihr die Säcklein von den Hörnern, da waren sie ganz klein, daß sich die Königin sehr darüber freute. Die Hofmeisterin sprach zu ihr: Es ist noch um eine Nacht zu tun, so seid ihr genesen, dann werden wir auch des ungestalten Doktors los mit der wüsten Nasen, er möchte einem alle Männer verleiden. Da er das Hütlein hatte, sprach er: Gnädige Frau, ihr sehet wohl, wie es sich mit Euch gebessert hat. Nun kommt es nur noch darauf an, die Hörner aus der Hirnschale zu treiben, dazu gehören köstliche Sachen, und wenn ich sie hier nicht finde, so muß ich selbst reisen oder einen andern Doktor darnach senden, der sich auf die Sache verstehet, wie ich ihn denn bescheiden werde, wobei viel Geldes aufgeht; auch wollt ich gerne wissen, was Ihr mir zu Lohn geben wollt, wenn ihr der Hörner los werdet und Euer Kopf so glatt wird als er je gewesen ist. Die Königin sagte: Ich finde wohl, daß eure Kunst Grund hat: darum bitte ich euch, helft mir und spart kein Geld. Der Doktor sprach: Ihr sagt, ich soll kein Geld sparen, allein ich habe keins. Agrippina war karg, wiewohl sie den Seckel hatte, den man nicht erschöpfen mochte, und ging gemachsam nach der Truhen, die bei der Bettstatt stand, darin ihre allerliebsten Kleinodien und auch der Seckel war an einen starken Gürtel gebunden: den gürtete sie um und ging ans Licht zu dem Tisch, der bei einem schönen Fenster stand, und fing an zu zählen, und als sie bei dreihundert Kronen gezählt hatte, suchte der Doktor unter seinem Rock, als ob er einen Seckel suchte, darein er das Geld tun wollte, stellte sich, als wollt er das Geld fassen, warf das Barett hinweg und setzte das Hütlein auf, faßte die Königin, wünschte sich in einen wilden Wald, da keine Leute wären; und wie er gewünscht hatte, so geschah es alsobald durch die Kraft des Hütleins.
Als Agrippina hinweggeführt war, da lief die Kammermeisterin zu der alten Königin, ihrer Mutter, und sagte ihr, wie Agrippina abermals hinweggeführt worden, und wie es ihr vorher ergangen wäre mit den Hörnern und mit dem Arzt. Des erschrak die alte Königin; doch gedachte sie, wie sie das erstemal bald wiedergekommen sei, so werde es vielleicht diesmal auch geschehen: auch hat sie den Seckel bei sich, daß sie Geldes genug hat und die Leute wohl belohnen mag, daß sie ihr wieder heim helfen. Als sie aber den Tag und die Nacht gewartet und Agrippina nicht wieder kam, ging es der Königin, als einer Mutter, doch zu Herzen, daß sie um ihre schöne Tochter also kommen sollte, und sie ging mit traurigem Herzen zu dem König, sagte ihm alles, wie es ergangen wäre und wie sie der Arzt hinweggeführt hätte.
Der König sprach: O, das ist ein weiser Doktor, der kann mehr denn andere Ärzte: es ist niemand denn Andolosia, den ihr falscherweise betrogen habt. Ich kann wohl erkennen, daß der, welcher ihm solches Glück verliehen hat, ihm auch Weisheit verliehen habe, wenn er um den Seckel käme, daß er ihm wieder zuteil werden müsse. Das Glück will, daß er den Seckel habe und sonst niemand; wenn das Glück wollte, so hätte ich oder ein anderer auch einen solchen Seckel. Viel Männer sind in England, doch ist nur ein König darunter, das bin ich, wie mir von Gott und dem Glück solches verliehen ist. Eben auch ist es Andolosia verliehen, daß er allein den Seckel haben soll und sonst niemand. Hätten wir nur unsere Tochter wieder!
Die Königin sprach: Herr, tut so wohl und sendet Boten aus, ob man irgend erforschen möge, wo sie sei, damit sie nicht in Armut und Elend gerate. Der König sprach: Ich sende keine Boten aus, denn es wär uns eine Schande, daß wir sie nicht besser versorgt hätten.
Als nun Andolosia in dem wilden wüsten Wald mit Agrippina allein war, warf er den Doktorrock ganz offenbarlich von sich nieder, tät auch die große wüste Nase von sich und trat freventlich vor die schöne Agrippina. Alsbald erkannte sie, daß er Andolosia war, und erschrak von ganzem Herzen, daß sie nicht reden konnte, denn seine Augen glühten ihm im Kopf vor Zorn, daß sie nicht anders dachte, als er würde sie sogleich töten.
Alsbald nahm er ein Messer und schnitt ihr den Gürtel vom Leib, riß das Wams auf und steckte den Seckel wieder an den Ort, wo er ihn getragen hatte; den Gürtel aber schleuderte er gar unsanft hinweg. Das sah die arme Agrippina, und vor Angst zitterte ihr schöner Leib wie Lindenlaub im Winde. Andolosia fing an aus großem Zorn zu reden und sprach: O falsches ungetreues Weib, jetzt bist du mir zuteil worden, jetzund will ich dir solche Treue halten, wie du mir gehalten hast, da du mir den Seckel abtrenntest und einen falschen an seine Stelle nähtest. Du siehst nun, daß er wieder an seine alte Statt gekommen ist: jetzt laß dir deine Mutter und die alte Kammermeisterin raten und helfen, laß dir ein Getränk brauen, damit du mich betrügest. Aber fürwahr, wären die Unholdinnen beide bei dir, alle ihre Kunst hülfe ihnen nicht, daß sie den Seckel wieder von mir brächten. Agrippina, wie mochtest du es über dein Herz bringen, mir so große Untreue zu bezeugen, der ich dir so treu war und Leib, Seele und Gut mit dir geteilt hätte? Wie mochtest du einen männlichen Ritter, der alle Tag um deinetwillen stach, scharf rannte und turnierte, so in Armut und Elend stürzen? Und keinerlei Erbarmen hast du mit mir gehabt, und durch die Untreue, die du an mir begingst, wär ich schier verzweifelt und wollte mich erhängt haben, und wenn ich es getan hätte, so wärst du die Ursache gewesen, daß ich in die ewige Verdammnis geraten wäre. Als du nun den Seckel in deiner Gewalt hattest und dir gesagt ward, daß ich nichts mehr hätte, alle Knechte entlassen und allein hinwegreiten müßte, da ist dir nicht in den Sinn gekommen, mir ein Zehrgeld zu schicken, daß ich anständig heim kommen möchte zu meinen Verwandten. Nun urteile selbst, ist es nicht billig, daß ich mit dir Erbarmen habe, wie du es mit mir gehabt hast?
Agrippina, die alles Erschreckens voll war und nicht wußte, was sie sagen sollte, sah auf gen Himmel, und mit erschrockenem Herzen fing sie an zu reden und sprach: O tapferer strenger Ritter Andolosia, ich bekenne, daß ich erbärmlich und schändlich wider euch getan habe: ich bitte euch, sehet an die Blödigkeit, Unerfahrenheit und Leichtfertigkeit, die von Natur größer in den Weibern ist, jungen und alten, denn im männlichen Geschlecht, und wollet mir die Sache nicht zum ärgsten kehren und euern Zorn gegen mich armes Mädchen ablegen; vielmehr vergeltet Böses mit Gutem, wie einem edeln Ritter wohl geziemt. Er antwortete ihr und sprach: Der Zorn über die Schmach, die ihr mir zugefügt habt, ist noch so groß in meinem Herzen, daß ich euch nicht unverletzt lassen kann. Sie sprach: O Andolosia, bedenkt euch besser, welche Unehre wäre es euch, wenn man sagte, daß ihr ein armes Weib, eure Gefangene, allein in einer Wildnis verletzt hättet! Fürwahr, es wär eurer Ritterschaft eine Schande. Andolosia sprach: Wohlan, ich will meinem Zorn widerstehen und verheiße dir bei meiner ritterlichen Treue, daß ich dich nicht verletzen will, weder an deiner Ehre noch an deinem Leibe. Du hast aber noch ein Zeichen von mir, das mußt du bis in dein Grab von mir behalten, damit du mein eingedenk seist. Agrippina war in so großer Not und Lebensangst, daß sie die Hörner, die ihr noch auf dem Haupt standen, ganz vergessen hatte. Da aber Agrippina des Leibes und der Ehre gesichert war, kam sie noch besser zu sich selbst und fing an und sprach: O wollte Gott, daß ich meiner Hörner ledig und in meines Vaters Palast wäre. Da Andolosia hörte, daß sie anfing zu wünschen, lag das Hütlein nicht fern von ihr, da lief er alsbald und hob es auf, denn hätte sie es aufgehabt, so wäre sie abermals heimgekommen. Er nahm das Hütlein und steckte es fest in seinen Gürtel. Daran konnte Agrippina wohl merken, daß ihm das Hütlein lieb war und daß sie durch seine Kraft zweimal hinweggeführt worden. Da griesgramte sie in sich selbst und gedachte: Nun hast du die Kleinodien beide in deiner Gewalt gehabt und hast sie nicht können behalten. Doch durfte sie Andolosia ihren Zorn nicht merken lassen, sondern fing an und bat ihn freundlich, daß er sie der Hörner ledig machte und sie ihrem Vater wieder heimführte. Er sprach: Du mußt die Hörner behalten, so lang du lebst. Aber ich will dich gerne in deines Vaters Palast führen, so nahe, als du ihn sehen magst, aber hinein gehe ich nicht mehr. Sie bat ihn zum andern- und drittenmal, es half aber nichts.
Als Agrippina sah und merkte, daß kein Bitten mehr bei ihm half, sprach sie: Muß ich denn die Hörner behalten und so ungestalt sein, so begehre ich nicht wieder nach England, kein Mensch soll mich mehr sehen, noch kennen, auch nicht Vater und Mutter; darum führet mich an einen fremden Ort, wo mich niemand erkennt. Andolosia sprach: Du wärst nirgends besser als bei Vater und Mutter. Das wollte sie nicht und sprach: Führe mich in ein Kloster, daß ich von der Welt geschieden sei. Er sprach: Begehrst du das im Ernste? Sie sprach: Ja. Also rüstete er sich und führte sie durch die Luft gen Hibernia, nah ans Ende der Welt, nicht weit von St. Patricius Fegefeuer. In der Nähe ist ein großes, schönes Frauenkloster, darin nur Edelfrauen sind. Da ließ er sie auf dem Feld allein, ging in das Kloster zu der Äbtissin und sagte ihr, wie er ein ehrsames adeliges Fräulein mitgebracht hätte, die schön und gesund sei, nur daß ihr etwas aus ihrem Kopf gewachsen wäre, dessen sie sich schämte, und nicht bei ihren Freunden bleiben wollte, sondern an einem Ort zu sein begehrte, wo sie nicht bekannt wäre. Wollt ihr sie aufnehmen, so will ich euch die Pfründe Pfründe heißt eigentlich das mit einem kirchlichen Amte verbundene Einkommen. Viele Frauenorden (Stifter) verlangten von den Eintretenden die Aufbringung einer gewissen Rente in Liegenschaften oder Geld, damit der wirtschaftliche Bestand des Verbandes gesichert sei. In diesem Sinne ist das Wort Pfründe hier gebraucht (Einkauf). dreifach bezahlen. Die Äbtissin sprach: Wer hier eine Pfründe haben will, der muß zweihundert Kronen dafür geben, denn ich halte einer jeglichen eine Magd und geb ihnen, was sie bedürfen, und so ihr die Pfründe dreifach bezahlen wollt, so bringt sie nur her. Andolosia ging hin und brachte Agrippina zu der Äbtissin: die bewillkommnete sie. Agrippina dankte ihr gar züchtiglich und neigte sich so schön, daß die Äbtissin wohl sah, daß sie von hohem Stamm geboren sei; auch gefiel sie ihr von Gestalt wohl, nur erbarmte sie, daß die wohlgestalte Person die verfluchten Hörner sollt auf dem Haupt haben und sprach: Agrippina, begehrest du hier in diesem Kloster deine Wohnung zu haben? Sie antwortete demütig: Ja, gnädige Frau Äbtissin. Sie sprach: So wirst du mir gehorsam sein und täglich zur Messe und in den Chor gehen Manche Orden schreiben ihren geistlichen Mitgliedern vor, die kirchlichen Gebetstunden (Horen) im Chor der Kirche zu verrichten (Chordienst, Horasingen). Die Laienmitglieder der Orden nehmen daran nicht teil., und was du nicht kannst, das wirst du lernen müssen. Dazu ist dieser Orden nicht hart, und die in einen andern treten oder einen Ehemann nehmen will Hiernach war das Kloster, in das Andolosia die Agrippina einkaufte, kein geistliches, sondern ein weltliches Stift, wie ihrer als Versorgungsanstalten für vermögliche Jungfrauen gar viele bestanden. Die Mitglieder legten nur beschränkte Gelübde ab. Vielleicht war es auch ein Beguinenhaus, dessen Insassen sich nach der Regel des dritten Ordens vom h. Franziskus zu einem geistlichen Leben vereinigten., die mag es tun; allein das Geld, das man für die Pfründe gibt, wird keiner wieder herausgegeben. Agrippina sprach: Was des ehrwürdigen Klosters Gewohnheit und altes Herkommen ist, das soll um meinetwillen nicht verändert werden. Also zahlte Andolosia der Äbtissin sechshundert Kronen und bat sie, daß sie sich Agrippina befohlen sein ließe. Das sagte sie ihm gerne zu, denn sie war froh, daß sie so viel bar Geld empfangen hatte. Also nahm Andolosia Urlaub von der Äbtissin. Da sprach sie zu Agrippina: Gehe, gib deinem Freund das Geleit! Und also ging er hinweg, und da sie zu der Pforten kamen, sagte er zu ihr: Nun gesegne dich Gott und gebe, daß du lange gesund bleibest und in diesem Kloster die ewigen Freuden erwerbest! Sie sprach: Amen, fing aber jämmerlich an zu weinen und sprach: O tapferer strenger Ritter, ich hab ein festes Vertrauen zu Gott, daß er euch noch eine glückliche Stunde schickt, darin euer edles Herz zur Milde und Barmherzigkeit bewegt wird; alsdann gedenkt an mich arme Gefangene und erledigt mich, denn ich mag weder Gott noch der Welt dienen, so gram bin ich den Hörnern. Andolosia gingen die Worte zu Herzen, doch gab er ihr keine Antwort, als daß er sagte: Was Gott will, das geschehe. Damit ging er seiner Straße. Die betrübte Agrippina schloß die Pforte zu und ging zu der Äbtissin. Die gab ihr eine Magd zu, die ihr diente, und räumte ihr eine Kammer ein, darin sie stets allein war und Gott diente, so gut sie mochte, wiewohl ihr Gemüt nicht bei dem Gebet war.
Als nun Andolosia von Agrippina schied, war er gar ein fröhlicher Mann, setzte sein Hütlein auf und wünschte sich von einem Land zum andern, bis er kam gen Brügge in Flandern, wo Kurzweil ist von allen Dingen. Da erholte er sich von dem gehabten Unmut, rüstete sich wieder gar herrlich zu, kaufte vierzig schöner Pferde, dingte sich viel gute Knechte, kleidete sie alle in seine Farben und fing wieder an Ritterschaft zu treiben. Er ritt durch Deutschland und besah die schönen Städte des deutschen Reiches, zog dann gen Venedig, Florenz und Genua, schickte nach den Juwelieren, welchen er die Kleinode abgekauft hatte, und bezahlte sie alle bar, setzte sich dann mit Pferden und Knechten in ein Schiff und fuhr mit Freuden heim gen Famagusta zu seinem Bruder. Der empfing ihn gar schön und freute sich, daß er so herrlich geritten kam. Und als sie gegessen hatten, nahm Ampedo seinen Bruder Andolosia, führte ihn in seine Kammer und fragte, wie es ihm ergangen wäre. Da erzählte er ihm, wie er auch um das Hütlein gekommen wär. Ampedo erschrak so sehr, daß er niedersank, denn er hatte ihn nicht ausreden lassen. Andolosia labte seinen Bruder, und als er wieder zu sich kam, sagte er ihm, er sei zwar einmal darum gekommen, hätte sie aber beide durch List wieder in seine Gewalt gebracht, darum solle er nicht traurig sein. Darauf nahm er den Seckel aus dem Wams, zog das Hütlein aus dem Mantelsack, legte sie ihm beide vor und sprach: Lieber Bruder, nun nimm beide Kleinode und laß dir wohl damit sein nach deines Herzens Lust, das will ich dir von Herzen gönnen und will dir nichts darein reden. Ampedo sprach: Ich begehre des Seckels nicht, denn wer ihn hat, der muß zu aller Zeit Angst und Not darum leiden, das hab ich wohl gelesen, wie unserm Vater geschehen. Da Andolosia die Worte hörte, war er des Seckels froh und gedachte: Ich will ihm von dem andern Unglück nicht noch sagen, er möchte sonst zutode erschrecken. Und fing an, ein frohes Leben zu führen mit stechen, reiten, tanzen und dergleichen. Und als er nun eine Weil zu Famagusta gewesen, ritt er mit seinem Zeug an des Königs Hof, Kurzweil zu haben, und als er dahin kam, ward er von dem König und den Seinen gar wohl empfangen. Der König fragte ihn, wo er so lange gewesen. Andolosia erzählte ihm, wie er so manches Königreich durchfahren hätte. Der König fragte ihn, ob er auch nicht kürzlich in England gewesen wäre. Er sprach: Ja, gnädiger König. Der König sprach: Der König von England hat eine schöne Tochter, sein einziges Kind, mit Namen Agrippina, die wollt ich meinem Sohn zu einem Gemahl genommen haben; doch ist mir zu Ohren gekommen, wie die Tochter verloren sei: hast du nicht gehört, ob sie noch verloren ist oder wiedergefunden? Gnädiger Herr, sprach Andolosia, davon weiß ich Euer Gnaden wohl zu sagen, es ist wahr, er hat eine schöne Tochter, und durch Künste der Nigromantia ist sie gen Hibernia in ein Frauenkloster entführt, darin nur Edelfrauen sind: da hab ich noch vor kurzer Zeit mit ihr gesprochen. Der König sprach: Möcht es nicht sein, daß sie ihrem Vater wieder würde? Ich bin alt und wollte meinem Sohn das Königreich gern übertragen vor meinem Tod. Andolosia antwortete: Gnädiger Herr König, Euch und Euerm Sohn zu lieb, der aller Ehren wohl wert ist, will ich mich in dieser Sache befleißen und sie mit der Hülfe Gottes in kurzer Zeit in ihres Vaters Palast schaffen. Der König bat ihn, daß er es täte und kein Geld dabei sparte: er wollt es ihm und den Seinen vergelten. Andolosia sprach: Gnädiger Herr König, so rüstet eine stattliche Botschaft und sendet sie vierzehn Tage nach mir aus. So sollen sie die junge Königin zu London in ihres Vaters Palast finden: und hat er sie Euch verheißen, so wird er sie Euch auch senden. Der König sprach: Andolosia, lieber Freund, so vollende die Sache, daß kein Fehl daran sei, denn ich will eine herrliche Botschaft dahin schicken: sorge, daß sie nicht vergebens kommt!
Er sprach: Vertrauet mir und laßt den Prinzen abkonterfeien und überschickt das Bild, so werdet Ihr hören, daß der König und sein Gemahl Freude daran haben und desto mehr Begierde haben, ihre schöne Tochter einem so schönen Jüngling zu geben. Und da der junge König vernahm, wie Andolosia verschickt werden sollte, um ein Gemahl für ihn, begab er sich zu ihm und bat ihn freundlich, sich der Sache ernstlich anzunehmen, damit es nicht unterbliebe, denn er hatte viel gehört von der Schönheit und Vollkommenheit Agrippinens. Andolosia versprach ihm, er wolle allen Fleiß anwenden, nahm von ihm Urlaub und ritt mit seinem Volk wieder gen Famagusta. Da bat er seinen Bruder, daß er ihm das Hütlein leihen wollte, er werde bald wieder kommen. Ampedo war willig und ließ ihn das Hütlein wieder nehmen. Andolosia befahl seinem Kämmerer, daß er es seinem Volk wohl halte und ihnen nichts gebrechen ließe: er wollte bald wieder bei ihnen sein. Darauf nahm er das Hütlein und wünschte sich in die Wildnis, wo die Äpfel standen, davon die Hörner wuchsen und wieder vergingen. Alsbald war er da, und wie er zu den Bäumen kam, hingen sie voll schöner Äpfel. Nun wußte er nicht, welches die einen oder die andern wären, und mochte ungern dazu greifen, einen zu essen und mußte sich doch dazu entschließen, denn er konnte Agrippina der Hörner nicht entbinden, wenn er nicht der rechten Äpfel einen mitbrachte. Er nahm also nach Gutdünken einen Apfel und aß ihn: da wuchs ihm ein Horn; darnach aß er einen andern: da verschwand es ihm wieder. Also nahm er etliche von diesen und fuhr damit gen Hibernia vor das Kloster. Er klopfte an, ward eingelassen und zur Äbtissin geführt und bat die um eine heimliche Unterredung mit Agrippina. Die Äbtissin schickte nach ihr und gewährte das gern, denn sie kannte Andolosia noch wohl. Und als sie kam, empfing sie ihn schlecht, denn sie wußte nicht, warum er gekommen war, und erschrak ob seiner Ankunft. Da ging er mit ihr beiseit und sprach zu ihr: Agrippina, bist du den Hörnern noch so gram als du warst, da ich von dir ging? Sie sprach: Ja und je länger je mehr. Er sprach: Wenn du sie nun los würdest, wohin stünde dir der Sinn? Sie antwortete: Wohin sollt ich anders begehren, als gen London zu meinem Vater, dem König, und meiner Mutter, der Königin? Andolosia sprach: Agrippina, Gott hat dein Gebet erhört, und was du begehrst, des wirst du gewährt. Darauf gab er ihr einen Apfel zu essen, hieß sie ein wenig darauf ruhen und wieder aufstehen: da war sie der Hörner ganz ledig.
Die Magd, die ihr zugegeben war, die flocht und zierte ihr das Haupt: so ging sie vor die Äbtissin, und da sie Agrippina so schön geziert sah, rief sie allen Frauen im Kloster, daß sie Agrippina sehen sollten, wie sie so schön geworden wär in kurzer Zeit. Das nahm alle die Frauen Wunder, sonderlich, daß sie der Hörner in so kurzer Zeit war ledig worden. Andolosia sprach: Laßt euch das nicht Wunder nehmen, Gott vermag alle Dinge, ihm ist nichts unmöglich: darum so sehet, wem Gott wohl will, wider den mag niemand sein. Agrippina ist eine Königin, von königlichem Stamm geboren, ich will sie ihrem Vater und Mutter wieder zuführen, und ehe daß ein Monat vergeht, so wird sie vermählt einem jungen König und einem so schönen Jüngling, als jetzo auf Erden leben mag. Auf die Rede merkte Agrippina gar wohl. Also zahlte Andolosia der Äbtissin hundert Kronen: die ließ er ihr und den andern Frauen zur Letze und dankte ihr, daß sie Agrippina so gütlich gehalten; desgleichen dankte ihr auch Agrippina gar höflich. Darauf nahmen sie Urlaub und gingen aus dem Kloster. Da er in das Feld kam, rüstete er sich mit seinem Hütlein und führte die Königin gen London zu des Königs Palast und fuhr wieder seiner Straßen, denn er scheute den Palast, darin ihm so große Untreu geschehen war, kehrte gen Famagusta zu seinem Bruder und seinen Dienern.
Als nun Agrippina wieder gekommen und das der König und die Königin inne wurden, waren sie sehr froh und alle, die bei ihnen waren. Da hielt man ein großes Fest, daß die verlorne Tochter wieder gefunden war. Sie zierten Agrippina aufs allerköstlichste. Als sie nun in hohen Freuden lebten, da kam dem König die Zeitung, wie des Königs von Cypern ausgeschickte Boten mit großem Volk kämen, ihn zu bitten, daß er Agrippina, die junge Königin, ihrem jungen König vermählen wollte. Sie wurden gar schön empfangen, und als sie vier Tage da gewesen, schickte der König nach ihnen: sie kamen herrlich, jeder nach seinem Stand: ein Herzog, zwei Grafen und viel Ritter und Knechte, und fingen an, von der Heirat zu reden. Da die Königin vernahm, daß man Agrippinas wegen tagte, fiel ihr das schwer, ihre schöne liebe Tochter so fern von Land zu geben, zumal einem, von dem man nicht wußte, ob er krumm oder lahm, taub oder blind wäre. Als das die Boten von Cypern vernahmen, baten sie, daß sie mit der Königin reden dürften, und als sie kam, zogen sie das Bild ihres jungen Königs hervor und ließen es sehen. Da sie seine schöne Gestalt sahen, fragte der König, ob es auch so wäre. Da schwuren sie dem König und der Königin einen Eid, daß er noch viel schöner gestaltet, auch nicht mehr denn vier und zwanzig Jahr alt wäre: das gefiel ihnen gar wohl. Die Königin nahm das Bild des Königs, brachte ihn Agrippina und sagte ihr, wie man sie einem jungen König geben wollte, der noch viel schöner wäre, denn sie seine Gestalt sähe, wie sie denn auch von Andolosia gehört hatte. Sie gab dem Gemälde Glauben und ihren Willen darein: was der König und die Königin darin verfügten, dem wollte sie gehorsam sein. Da der König und die Königin Agrippinas Willen vernahmen, redeten sie weiter mit denen von Cypern, und so ward die Heirat beschlossen. Darnach ließ der König viel Schiffe zurichten, mit Leuten, Speis und was dazu gehört, und schmückte die junge Königin aus mit köstlichem Gewand und Kleinodien nach allen Ehren, gab ihr auch ein Geleit von vornehmen Frauen. Und als die Schiffe geladen und bereit waren, nahm die junge Königin Urlaub von Vater und Mutter und sprach: Gnädiger Herr Vater und gnädige Frau Mutter, der allmächtige Gott im Himmel wolle euch in seinem Schutz erhalten und euch Gesundheit und langes Leben geben! Sie kniete nieder vor ihrem Vater und mit großem Seufzen und weinenden Augen sprach sie: Ich begehre den Segen, da ich mich jetzt von euch scheiden muß und weiß, daß ich euch und meine Mutter nimmer wieder sehe. Der König sprach: Agrippina, meine liebste Tochter, der Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des h. Geistes, der ewigen Dreifaltigkeit, wolle dich beschirmen vor allem Herzeleid und verleihe dir und allen denen, die dir Gutes gönnen, Gesundheit, langes Leben, Friede und Genügsamkeit und das Wohlwollen aller Menschen. Der Königin Mutter konnte nicht mehr wünschen, darum sprach sie: Amen. Also stand Agrippina auf und ging zu Schiff mit all ihrem Volk, so mitfahren sollte; und da war jedermann leid, daß die schöne Königin schied und er sie nicht mehr sehen sollte. Also fuhren sie dahin in Gottes Namen: der verlieh ihnen gut Wetter, daß sie frisch und gesund gen Famagusta in Cypern kamen. Da hatte der König eine Herzogin, vier Gräfinnen und viel edeler Frauen bestellt: die empfingen die Königin gar herrlich. Da war auch köstlich Speis und Trank vorhanden und jedermann hatte genug, die Fremden wie die Einheimischen; jung und alt war froh, daß ihrem jungen König ein so schön Gemahl gekommen war. Da standen viel Rosse, Wagen und Karren bereit, und ward jedermann abgefertigt nach seinen Ehren. Also kamen sie gen Medusa, wo der König Hof hielt: der hatte die Vornehmsten seines Königreichs bestellt von Frauen und Mannen, und wie köstlich sie auch zu Famagusta empfangen worden, so wurden sie noch zehnmal herrlicher empfangen zu Medusa von der alten Königin und ihren Frauen, darnach von dem jungen König und seinem Volk. Dafür dankte sie sehr liebreich mit fröhlichem Angesicht und schönen Gebärden, und also ritten sie mit großen Freuden bis in den königlichen Palast, der mit aller Zierde auf das allerköstlichste zugerichtet war. Da begann ein köstliches Leben, und kamen alle Fürsten und Herren, so unter den König von Cypern gehören, zierlich geritten und brachten alle herrliche Gaben und Schenkungen, die sie ihrem Herrn, dem König, verehren wollten, ein jeder nach seinem Vermögen. Hiermit ward die Hochzeit angefangen, die währte sechs Wochen und drei Tage, und in der Zeit gab man jedermann genug. Und Andolosia schenkte unter andern Gaben ein Schiff mit Malvasier und Muskateller; der ward getrunken, als ob es Äpfeltrank gewesen wäre, denn sein war genug; auch war sonst kein Mangel, so lange die Hochzeit währte.
Und dieweil die Hochzeit währte, taten die Fürsten und Herren nichts anders, denn rennen und stechen, turnieren und Kurzweil treiben. Und am Abend beim Tanz gab man den Preis dem, der am Tag das beste getan hatte: dem setzte die Königin ein Kränzlein auf. Da wandte jeder Fleiß an, daß er Ehre einlegte vor der schönen Königin Agrippina. Bei diesen Turnieren stach auch Andolosia und tät allweg das beste in allen ritterlichen Spielen und gewann oft den Preis. Nun begab es sich, daß die Grafen, Ritter und Freien abermals ein Stechen hielten; und hatte Andolosia vorher viel ritterlicher Taten getan, so tat er jetzt noch viel mehr. Zuletzt, da der Preis ausgegeben werden sollte, der billig Andolosia gebührt hätte, war er der Ehren wegen dem Grafen Theodor von England gegeben, der als Begleiter der Königin mit ihr gekommen war. Des achtete Andolosia wenig und gönnte ihm die Ehre; doch sprach alles Volk, Andolosia hätte den Preis eher verdient als Graf Theodor. Als das Graf Theodor hörte, verdroß es ihn und ward ihm neidig und machte einen Bund mit dem Grafen von Limisso Limisso oder Lemiso ist eine ziemlich bedeutende Hafenstadt an der Südküste von Cypern., der auch wie er ein Seeräuber war und sein Raubschloß auf einer kleinen Insel unweit Famagusta hatte. Sie hielten Rat, wie sie dem Andolosia Schand und Spott zufügen oder ihn umbringen möchten, damit er vom Hofe käme und keinen Grafen oder Edelmann mehr ausstäche.
Als nun die Hochzeit ein Ende hatte und Andolosia heim gen Famagusta reiten wollte, da fielen die beiden Grafen Andolosia an, erstachen seine Diener und führten ihn auf die Insel gen Limisso in das Schloß, wo sie ihn wohl verwahrten, daß er nicht davon kommen könnte. Da versprach er denen, so ihn hüteten, groß Gut zu geben, daß sie ihm davon hülfen; sie wollten aber nicht trauen, vermeinten, wann er davon käme, so gäbe er ihnen nichts. Den Seckel durfte ihnen Andolosia nicht zeigen, weil er fürchtete, er möchte darum kommen; war also in großen Nöten. Die Zeitung kam vor den König, wie Andolosias Diener alle erstochen wären. Niemand wußte, ob Andolosia tot oder lebendig wäre, auch nicht, wer es getan hätte. Die Grafen aber ritten wieder an des Königs Hof, hielten sich still, als ob sie von nichts wüßten.
Da nun Andolosia verloren, ward es seinem Bruder Ampedo kund getan: der schickte bald Boten zu dem König und ließ ihn bitten, daß er hülfe, damit ihm sein Bruder wieder würde. Der König entbot ihm, es wäre ihm leid um seinen Bruder Andolosia; doch wollt er Fleiß anwenden, und könnte er erfahren, wo er wäre, so sollt ihn kein Geld dauern; und sollte es sein halb Reich kosten, so müßt er ihn frei machen.
Nun gedachte Ampedo, er wäre um seinen Bruder gekommen von wegen des Seckels und man würde Andolosia so lange martern, bis er auch von dem Hütlein aussagte, und alsdann würde man auch dessen habhaft werden, was nimmermehr geschehen solle. Er nahm also im Zorn das Hütlein, zerhackte es zu Stücken, warf die ins Feuer und blieb dabei stehen, bis sie zu Pulver verbrannt waren, daß niemand mehr seine Freude damit haben sollte. Nun hatte er stets Boten unterwegs zu dem König; aber soviel ihm auch Boten kamen, so brachten sie doch keine Botschaft, daß man erfahren hätte, wo sein Bruder hingekommen wäre. Darüber ward er so betrübt, daß er in eine tödliche Krankheit fiel und starb.
Als nun etliche Tage vorüber waren und die Grafen hörten, daß es dem König leid wäre um Andolosia, stellten sie sich auch betrübt. Da ließ der König ausrufen: Wer gewisse Kunde brächte, wo Andolosia hingekommen wäre, der sollte tausend Dukaten haben. Aber jedermann schwieg still. Indem nahm der Graf Limisso Urlaub von dem Könige und kam in sein Schloß, wo Andolosia in einem Turm gefangen lag. Und als er den Grafen sah, freute er sich und vermeinte, Hülfe und Gnade zu erlangen, denn er wußte nicht, warum er gefangen läge. Der Graf sprach: Andolosia, du bist mein Gefangener und mußt mir sagen, von wannen dir soviel Geld kommt: mache es kurz, denn ich will dich so martern, daß du froh bist zu bekennen. Da Andolosia das hörte, erschrak er sehr und sagte, zu Famagusta in seinem Haus, da wär eine Grube, die hätte ihm sein Vater auf dem Todesbette gezeigt, und wieviel er Geld nähme, so wäre allweg mehr darinnen: er sollte ihn also gefangen gen Famagusta führen, so wollte er ihm die Grube zeigen. Daran wollt der Graf kein Genügen haben und fing aufs neue an ihn zu martern und zu peinigen, er blieb aber auf seiner Aussage. Da der Graf merkte, daß er nicht bekennen wollte, ließ er ihn grausam quälen, bis ihm Andolosia den Seckel bekennen mußte. Da der Graf das hörte, nahm er den Seckel von ihm, versuchte ihn und fand ihn gerecht. Da ließ er den armen Andolosia wieder in den Stock setzen und übergab ihn seinem vertrauten Kerkermeister. Da bezahlte der Graf alle seine Schulden und kam mit Freuden wieder an des Königs Hof. Als Graf Theodor hörte, wie er den Seckel von ihm bekommen hätte, ward er sehr froh; doch sprach er: Es gefällt mir so nicht; er wäre besser tot als lebendig. Ich hab an des Königs Hof vernommen, er sei ein Doktor in der Nigromantia und könne wohl in die Lüfte fahren. Wenn er uns entwischte und der König erführe, wie es ihm ergangen, dürfte es uns das Leben kosten. Graf Limisso sprach: Er liegt hart gefangen und kann niemand schaden. Nun nahmen sie Geld aus dem Seckel, soviel sie wollten, doch hätte jeder gern den Seckel gehabt. Da wurden sie eins, es sollt ihn jeder ein halb Jahr ums andere haben. Nun war Graf Limisso der ältere, er hatte deswegen den Seckel das erste halbe Jahr.
Als nun die Grafen Geld genug hatten, durften sie es nicht kecklich gebrauchen, damit kein Argwohn auf sie fiele; und ob sie gleich in Freuden lebten, sagte doch Graf Theodor immer, Andolosia wäre besser tot denn lebendig, und besorgte, sie kämen um den Seckel. Er gedachte auch, wenn die Reihe an ihn käme, wollt er sich mit dem Seckel entfernen, damit er vor dem König und dem Grafen Limisso sicher wäre.
Eines Tages sprach er zu dem Grafen, er sollt ihm einen Brief geben, daß man ihn im Schloß Limisso zu dem Gefangenen ließe: das tät der Graf. Da fuhr Graf Theodor gen Limisso in das Gefängnis, wo Andolosia lag. Als der ihn sah, vermeinte er, Graf Limisso hätte ihn gesandt, damit er ihn frei ließe. Aber der Graf hub an und sprach: Sage mir Andolosia, hast du keinen Seckel mehr als den du meinem Gesellen gegeben hast? Gib mir auch einen! Er sprach: Gnädiger Herr Graf, ich hab keinen mehr; hätte ich aber einen, er wäre euch unversagt. Der Graf sprach: Man sagt, du seiest ein Doktor in der Nigromantia und könnest in die Lüfte fahren und die Teufel beschwören: warum lässest du dir nicht von dannen helfen? Er sprach: Herr Graf, ich kann es nicht, nur mit dem Seckel hab ich meine Kurzweil gehabt: den will ich nun euch und euerm Gesellen vor Gott und der Welt überlassen und keinen Anspruch mehr daran haben und bitte euch um die Ehre Gottes, daß ihr mich armen Mann freigebet, daß ich nicht so elendiglich ohne Beicht und Sakrament sterbe. Der Graf sprach: Willst du jetzt deiner Seele Heil betrachten, warum hast du es nicht getan, da du deinen Hochmut triebest vor dem König und uns alle Unehre bewiesest? Wo sind die schönen Frauen, denen du gedient hast und die dir den Preis gaben? Die heiß dir jetzt helfen. Ich höre wohl, du wärest gerne los: laß dir die Zeit nicht lang werden, ich will dir bald davon helfen. Da führte er den Hüter auf die Seite und bot ihm fünfzig Dukaten, daß er Andolosia erwürgte: das wollt er nicht tun, und sprach: Er ist ein schwacher Mann und stirbt bald von selbst. Der Graf sprach: Gib mir einen Strick, ich will ihn erwürgen; ich gehe nicht von dannen, er sei denn tot. Der Knecht wollt es auch nicht tun. Also nahm er seinen Gürtel, so er um hatte, und legte ihn dem Andolosia um den Hals, und mit seinem Dolch wirbelte er den Gürtel zu und erwürgte also Andolosia, gab dem Knecht Geld, daß er ihn hinweg täte; säumte sich hierauf nicht lang und nahm den Weg nach Cypern an des Königs Hof zu seinem Gesellen, dem Grafen Limisso. Der fragte ihn heimlich, wie es stünde um Andolosia. Er sprach: Es steht so um ihn, daß wir keinen Schaden mehr von ihm haben: ich hab ihn erwürgt, denn ich konnte keine Ruhe haben, bis ich wußte, daß er tot wäre. Er meinte, er hätte es wohlgemacht und wußte nicht, wie übel er getan hatte. Als nun drei Tage vergangen waren, da war das halbe Jahr aus, daß Graf Theodorus den Seckel auch ein halb Jahr haben sollte. So ging er mit Freuden zu dem Grafen Limisso, und sprach: Nimm soviel Geldes, als du genug hast, denn mir gehört jetzt der Seckel. Dessen weigerte sich der Graf nicht und sprach: Ich will es gern tun, aber wenn ich den Seckel ansehe, so erbarmt mich Andolosia: ich wollt, du hättest ihn nicht getötet, er wär von selbst gestorben. Graf Theodorus sprach: Toter Mann macht keinen Krieg. Also gingen sie in die Kammer, wo der Seckel war. Graf Theodorus nahm ihn in die Hand und wollt anfangen zu zählen, wie er sonst getan hatte; da war nichts mehr im Seckel. Sie wußten beide nicht, daß der Seckel die Kraft verloren hatte, weil Ampedo und Andolosia gestorben waren. Da sie aber kein Geld fanden, sah einer den andern an. Graf Theodorus sprach aus grimmigem Zorn: O falscher Graf, willst du mich also betrügen und mir einen andern Seckel anstatt des guten geben, das leid ich nicht: mache es nicht lang und bring den rechten Seckel! Er antwortete und sagte, dies wäre der Seckel, so er Andolosia genommen; er habe keinen andern: wie es zuginge, wüßte er nicht. Daran wollte Theodorus nicht genug haben, ward je länger je zorniger und sagte, er wollte ein Bösewicht an ihm werden, das würde nicht gut tun; und zog damit vom Leder. Da das der Graf Limisso sah, war er auch nicht faul; und sie machten ein Gepolter, daß die Knechte die Kammer aufstießen: da sahen sie ihre Herren miteinander fechten, liefen dazwischen und schieden sie voneinander. Doch war der Graf Limisso verwundet bis auf den Tod: das sahen seine Diener und fingen Theodor. Nun kam die Post vor den König nach Hof, wie die zween Grafen, die immer so gute Freunde gewesen, sich miteinander geschlagen hätten. Der König befahl, man sollte sie beide gefangen bringen, damit er die Ursache ihrer Uneinigkeit erführe. Und als man des Königs Gebot gehorsam sein und ihm die zwei Grafen bringen wollte, da konnte man den verwundeten Limisso nicht bringen, brachte also allein den Grafen Theodorus.
Nun ward der Graf Theodorus gefragt, warum sie beide, die sonst immer eins gewesen, sich jetzt miteinander geschlagen hätten. Wiewohl der Graf nicht gestehen wollte, doch mußte er zuletzt auf peinliche Frage damit heraus und sagte den Handel, wie sie mit Andolosia umgegangen. Da der König hörte, wie sie mit dem frommen Andolosia so übel verfahren wären, ward er von Herzen betrübt und zürnte über die Mörder; und sonder länger Bedenken gab er Urteil, man sollte sie aufs Rad legen, und wenn der Graf Limisso krank wäre, so sollte man ihn an die Richtstatt tragen, und wäre er tot, so sollte man seinen Leichnam auf das Rad legen. Und wie das Urteil ergangen war, also ward es an den zwei Grafen und Mördern vollbracht: sie wurden beide gerädert. Das war ihr rechter Lohn, sie hatten es wohl an dem frommen Andolosia verdient. Als nun die zwei Mörder um des Seckels wegen, mit dem sie doch nur eine kurze Zeit ihre Wollust gehabt hatten, auf die Räder gelegt und getötet worden, schickte der König von Stund an sein Volk in die Insel und ließ die einnehmen, Schlösser, Städte und Dörfer und besonders das Schloß, darin der gute und fromme Andolosia gefangen gelegen, und ließ darin fahen Mann und Weib; und alle, die um den Mord wußten und es verschwiegen hatten, ließ er ohne Barmherzigkeit vor dem Schloß erhenken. Er erfuhr auch, daß sie den Leichnam Andolosias in eine Wassergrube nicht fern vom Schloß geworfen hatten. Da befahl er, ihn herauszuziehen und gen Famagusta zu führen und ließ ihn mit großer Ehrerbietung daselbst begraben in die schöne Domkirche, die sein Vater gestiftet und gebaut hatte. Es war dem alten und jungen König und der jungen Königin Agrippina sehr leid um den getreuen Andolosia. Und weil sie alle beide, Ampedo und Andolosia, keine Erben hinterlassen hatten, nahm der König den herrlichen Palast selbst ein und fand darin große Schätze von Hauszier, Kleinodien und Barschaften. Und in den Palast zog der junge König und hielt darin lange Zeit Hof, bis sein Vater, der alte König, mit Tod abging und er das Königreich gar einnahm.

Es lebte ein weiser König namens Darius, der hatte drei Söhne, die er sehr liebte. Als er nun zu sterben kam, da setzte er alles, was ihm von seinem Vater überkommen war, seinem Erstgeborenen zum Erbe, dem zweiten gab er, was er bei Lebzeiten erworben, und dem jüngsten hinterließ er drei köstliche Dinge: einen Goldring, ein Halsband und das Wundertuch. Mit diesen Dingen aber war es so bestellt: Wer den Ring an seinem Finger trug, dem mußte jedermann hold sein und ihm alles geben, worum er bat. Und wer das Halsband auf seiner Brust trug, dem ward alles, was sein Herz sich erwünschte, wenn es irgend zu haben war. Aber wer auf dem Tuche saß und irgendwo zu sein wünschte, der war gleich an seinem Orte.
Die drei Spielwerke gab der König seinem jüngsten Sohne: er sollte aber zuvorderst den Wissenschaften obliegen und seine Mutter ihm die Erbstücke aufheben, bis er zu Verstand und Jahren gekommen sei. Gleich darauf verstarb der König und wurde mit ziemenden Ehren begraben.
Die beiden ältesten Söhne nun nahmen ihr Erbteil in Besitz, und dem jüngsten gab die Mutter den Ring, und ehe sie ihn von sich ließ, daß er auf eine Schule sich begebe, sagte sie zu ihm: Mein Sohn, erwirb dir alle Kenntnisse und Weisheit, und hüte dich vor den Frauen, daß sie dich nicht um deinen Ring betrügen!
Jonathas nun – so hieß der Sohn – nahm seinen Ring und suchte die Schule auf, und da war er fleißig und, wie man denken kann, glücklich in den Wissenschaften. Nachdem begegnete er einen Tag auf der Gasse einem Mädchen. Sie war hübsch und so faßte er schnell eine große Liebe zu ihr. Und weil sie ihm, durch die Kraft seines Ringes, auch gewogen war, so wurde sie seine Geliebte.
Nun wunderte sich das Mädchen, daß er so herrlich dahin lebte, obschon sie niemals Geld bei ihm sah. Und als er einmal guter Laune war, fragte sie ihn nach diesen Dingen und sagte, er könne es ihr schon vertrauen, denn sie liebe ihn mehr als sonst einer. Der Jüngling dachte an keine Falschheit und sagte ihr das Geheimnis des Ringes. Sie antwortete ihm: Siehe zu, daß du ihn nicht verlierst, denn du kommst jeden Tag zu viel fremden Menschen. Darum ist es besser, daß ich dir den Ring aufhebe. Weil er ihr vertraute, tat er nach ihrem Willen und gab ihr den Ring. Sie aber verbarg ihn, und da er heimkam und seinen Ring verlangte, wollte sie ihn nicht finden. Da fing er an, Mangel zu leiden, denn er hatte nichts, um sich zu erhalten. Darum trauerte er sehr und kam zu seiner Mutter heim und klagte ihr den Verlust des Ringes.
Die Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, ich habe dir vorher gesagt, daß du dich hütest vor den Weibern. Siehe, ich gebe dir hier das Halsband. Verwahre es sorgsamer als den Ring. Denn wenn du auch dieses verlierst, kommst du um deine Ehre und allen Vorteil.
Jonathas nahm das Halsband und kehrte zurück auf die Schule, und da er an das Tor der Stadt kam, begegnete ihm seine Geliebte, und sie empfing ihn voller Freude. Und weil er nicht um ihren Betrug wußte, nahm er sie auf wie zuvor. Nun lebten sie ganz herrlich, denn durch die Kraft seines Halsbandes bekam er alles, woran er nur dachte. Er stellte wie früher viele Schmäuse an und hielt Feste mit seinen Freunden. Des wunderte sich das Mädchen, da sie weder Gold noch Silber bei ihm sah, und sie dachte, daß er wieder ein neues Kleinod mit sich habe. Mit ihrer Schlauheit brachte sie ihn dazu, daß er ihr den Halsschmuck zeigte und seine Kraft verriet.
Sie aber redete ihm zu und sprach: Wie magst du doch das Geschmeide immer bei dir tragen? Du kommst an viele Orte, wo es sich verlieren könnte. Wäre es nicht besser, in einer Stunde wünschest du dir soviel, als für ein Jahr ausreicht. Und dann gibst du es mir aufzuheben! Der Jüngling aber gedachte seines Ringes und der Worte seiner Mutter und sagte zu ihr: Ich fürchte sehr, wie du meinen Ring verloren hast, so möchtest du mich auch um mein Halsband bringen. Und dann wäre mein Schaden noch viel größer. Aber sie versetzte darauf: Nicht so, durch den Verlust des Ringes bin ich schon fürsichtig geworden und lernte die Kunst, etwas zu bewahren. Und ich kann dir versprechen, daß mir niemand das Halsband forttragen wird. Der Jüngling glaubte den Worten seiner Freundin und übergab ihr das Kleinod.
So verging die Zeit, und als er alles aufgezehrt hatte, kam er zu ihr und verlangte sein Halsband. Sie aber sprach und schwur einen Eid darauf, es sei ihr heimlich genommen worden wie der Ring. Darüber weinte Jonathas bitterlich und sagte: Ich hatte doch den Verstand verloren, als ich dir nach dem Verluste des Ringes mein Halsband übergab. So machte er sich auf den Heimweg und kam mit viel Klagen zu seiner Mutter und berichtete ihr sein Unglück.
Die Mutter trauerte sehr über ihn und sagte: O mein lieber Sohn, warum hast du dein Vertrauen in ein Weib gesetzt, die dich zweimal betrogen hat! Jedermann wird dich nun einen Dummen heißen. So lerne endlich Klugheit, denn ich habe nichts mehr für dich als dieses Tuch, das dir der Vater gelassen hat. Wenn du auch dieses verlierst, darfst du nie wieder zu mir kommen!
Der Jüngling nahm das Tuch und reiste wieder auf seine Schule. Und da er in die Stadt kam, fand er seine Geliebte wieder und sie empfing ihn freundlich wie zuvor. Er aber breitete sein Tuch aus und sagte zu ihr: Meine Geliebte, dies Tuch hat mir mein Vater gelassen. Setze dich zu mir! Und als sie so getan hatte, dachte Jonathas sich weit weg, wo keine Menschenseele wäre. Und so kamen sie ans Ende der Welt in einen wilden Wald, der weit von allen Wohnungen der Menschen lag. Das Mädchen war sehr traurig, weil der Jüngling drohte, er wolle sie den wilden Tieren zum Fraße überlassen, wenn sie ihm Ring und Halsband nicht wieder schaffe. Das versprach sie gern, so es ihr irgend möglich sei und er ihr aus dieser Wildnis glücklich heim hülfe. Und weil sie ihn so jämmerlich bat, entdeckte er ihr die wunderbare entrückende Kraft des Tuches.
Dann setzten sie sich beide auf das Tuch, und er legte seinen Kopf auf ihren Schoß und schlief ein. Da zog sie das Tuch unter ihm hinweg und dachte: wäre ich doch, wo ich hergekommen bin! So kam sie davon und ließ den Jonathas schlafend in dem Forste. Wie der aufwachte und sein Tuch und die Geliebte nicht fand, wußte er bald, was da geschehen war, und weinte und klagte über sein Unglück, und bedachte sich umsonst, wie er davon kommen möchte.
Stand also auf, und nachdem er sich mit dem Kreuzzeichen beschützt hatte, fing er an zu gehen, bis er an ein Wasser kam. Dadurch mußte er waten, und weil es so bitter und heiß war, verbrühte es ihm seine Füße bis auf das Gebein. Da trauerte er noch mehr, schöpfte ein Gefäß voll von dem Wasser und trug es mit sich. Es hungerte ihn aber, und da er einen Baum mit Früchten sah, aß er davon, und sobald bekam er den Aussatz. Da sammelte er von den Früchten und nahm solche mit sich. Kam er bald durch ein ander Wasser, wovon seine Füße wieder mit heilem Fleische bedeckt wurden, und auch von diesem Wasser nahm er ein gefülltes Gefäß mit sich. Und als er weiter ging und ihn abermal hungerte, ersah er einen Baum und aß von seinen Früchten. Dadurch wurde sein Aussatz geheilt. Nun nahm er auch von diesen Früchten zu sich und ging hinweg.
Wie er aber weiter zog, da sah er ein Schloß vor sich liegen, und Leute begegneten ihm, die fragten ihn, wer er wäre. Der Jüngling sagte: Ich bin ein weiser Arzt. Da sagten die Leute: Der König des Landes liegt auf seiner Burg am Aussatz krank, wenn du ihn heilen kannst, magst du dir viel Lohn erwerben. Er sagte ihnen: Das will ich schon machen. Hiernach brachten sie ihn zu dem Könige, und er gab ihm von der zweiten Frucht zu essen, da verschwand der Aussatz; und als er von dem Heilwasser getrunken hatte, wuchs ihm das verlorene Fleisch wieder bei.
Der König gab dem Jonathas viel Geschenke, der aber hatte dort ein Schiff gefunden aus seiner Stadt und als es heimkehrte, ließ er sich damit nach der Stadt fahren. Bald lief ein Gerücht durch die Stadt von einem großen Arzte, der könne alle Krankheit heilen. Auch zu des Jünglings Geliebten, die eben auf den Tod krank lag, war die Kunde gekommen, und sie beschickte den Arzt und bat ihn zu sich. Jonathas kam zu ihr, aber keiner erkannte ihn und auch sie nicht. Er aber wußte wohl, wer da seine Hülfe begehrte und sagte ihr, daß seine Medizin keine Wirkung tun könnte, ehe der Kranke ihm alle seine Sünden bekannt, und jedem, den er jemals betrogen, sein Eigen wieder gegeben hätte.
So bekannte das Mädchen, daß sie den Jonathas um seine Kleinode betrogen und ihn in einer Wildnis den Tieren überlassen habe. Der fragte sie, wo jene Spielwerke hingekommen wären. Sie sagte: In meiner Truhe sind sie, und gab ihm die Schlüssel dazu. Da fand er sein Eigentum und nahm es an sich. Darauf gab er ihr von der bösen Frucht zu essen und das giftige Wasser zu trinken. Sobald sie davon genommen hatte, fühlte sie ihren Leib vertrocknen und große innerliche Schmerzen, daß sie gar erbärmlich schreien mußte.
Jonathas aber überließ sie ihrem Elende und machte sich mit seinen Schätzen zu seiner Mutter. Alles Volk war seiner Ankunft froh, und er erzählte seiner Mutter, wie ihn Gott von vielen bösen Gefahren erlöst und wieder zu seinem Besitz geholfen hätte. Darauf lebte er noch viele Jahre und beschloß sein Leben in aller Freude.
(Nach der Gräßeschen Übersetzung der Gesta Romanorum erzählt vom Herausgeber.)
[Anmerkungen eingearbeitet. joe_ebc für Gutenberg]