
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
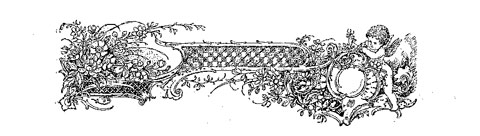
Sie war hässlich und wurde daher von den rohen Männern, die eine schöne Seele unter einem unschönen Äusseren nicht zu würdigen verstehen, etwas vernachlässigt. Aber sie war reich und wusste, dass die Männer nach dem Gelde der Mädchen angeln; sie hatte als Tochter wohlhabender Eltern eine ganze Menge gelernt, und da sie den Männern im allgemeinen mit grossem Misstrauen begegnete, galt sie als gescheites Frauenzimmer.
So war sie zwanzig Jahre alt geworden; ihre Mutter lebte, und sie hatte keine Lust, fünf Jahre zu warten, ehe sie über ihr Vermögen disponieren durfte. Daher überraschte sie ihre Freundinnen eines Tages mit ihrer Verlobungsanzeige.
»Sie verheiratet sich, um einen Mann zu haben,« sagten die einen.
»Sie verheiratet sich, um ihre Freiheit zu bekommen und einen Bedienten dazu,« sagten die andern.
»So dumm zu sein und zu heiraten,« sagten die dritten; – »sie weiss eben nicht, dass sie dann erst recht unmündig wird.«
»Habt keine Angst,« sagten wieder andere, »sie wird schon mündig werden, obschon sie sich verheiratet.« Wie sah er aus? Was war er? Wo hatte sie ihn kennen, gelernt?
Er war ein junger Rechtsanwalt von etwas weiblichem Äusseren, hohen Hüften und bleicher Gesichtsfarbe. Er war der einzige Sohn und von seiner Mutter und einer Tante erzogen worden. Bisher hatte er immer eine grosse Scheu vor jungen Mädchen gehabt, und er hasste die Leutnants, die so männlich waren und überall bevorzugt wurden. – So war er.
Sie trafen sich in einem Badeort auf der Réunion. Er war spät gekommen, und es gab keine Dame mehr für ihn. Die jungen Mädchen schleuderten ihm ihr frohes, triumphierendes Nein entgegen, als er kam, um sie aufzufordern, und viele schwenkten schon von weitem ihre vollgeschriebenen Tanzkarten, wie um eine aufdringliche Fliege zu verscheuchen.
Verletzt, gedemütigt, ging er auf die Veranda hinaus und zündete sich eine Cigarre an. Der Mond schien über die Linden des Parks und von den Beeten her duftete die Reseda. Er sah durch die Fenster, wie Paar auf Paar drin vorbeisauste, und bei den wollüstigen Walzerklängen bebte er vor Eifersucht und ohnmächtigem Begehren.
»Der Herr Rechtsanwalt sitzt hier und schwärmt?« fragte plötzlich eine Stimme neben ihm; »tanzen Sie denn nicht?«
»Weshalb tanzen Sie denn nicht, mein gnädiges Fräulein?« fragte er und sah auf.
»Weil ich hässlich bin und niemand mich haben will,« entgegnete sie.
Er betrachtete sie. Sie waren alte Bekannte, aber er hatte nie zu ihren Verehrern gehört. Sie war ausserordentlich gut gekleidet und ihre Augen drückten in diesem Moment solchen Schmerz aus, solche Verzweiflung über die Ungerechtigkeit der Natur, dass er lebhafte Sympathie für sie empfand.
»Mich will auch niemand haben,« sagte er. »Aber die Leutnants haben ja recht; in der natürlichen Zuchtwahl hat ja der Stärkere, Stattlichere, Geputztere immer recht. Sehen Sie doch diese Schultern und Epauletten ...«
»Pfui, wie Sie reden!«
»Verzeihen Sie! Aber man wird so bitter, wenn man in einem ungleichen Kampf steht! Wollen Sie vielleicht mit mir tanzen?«
»Geschieht es etwa aus Barmherzigkeit?«
»Ja, gegen mich.«
Er warf die Cigarre fort.
»Wissen Sie, was es heisst, sich ausgestossen fühlen, immer der letzte sein?« fuhr er mit Wärme fort.
»Ob ich das kenne!« rief sie aus. »Aber es sind nicht immer die Schlechtesten, die bei solchen Gelegenheiten wie die heutige unter den letzten stehen, nicht wahr? Es giebt noch andre Eigenschaften als Schönheit, die einen Wert im Leben haben.«
»Welche Eigenschaften schätzen Sie denn am Manne am höchsten?«
»Herzensgüte,« entgegnete sie bestimmt; »denn diese Eigenschaft ist selten bei Männern.«
»Güte und Schwäche pflegen aber gewöhnlich Hand in Hand zu gehen, und die Frauen sind gewöhnlich für Stärke und Kraft begeistert.«
»Was für Frauen? Die rohe Kraft hat ja ihre Zeit gehabt, und wir, die wir etwas höher in der Kultur stehen, wir sollten doch verständiger sein, und die brutale Muskelkraft nicht höher anschlagen als Herzensgüte.«
»Wir sollten!! Gewiss! Aber sehen Sie einmal durch dieses Fenster!«
»Für mich ist wahre Männlichkeit gleichbedeutend mit Adel des Gefühls, und Intelligenz des Herzens.«
»Sie könnten also einen Mann achten, den die ganze Welt einen Schwächling, eine Memme nennt? ...«
»Was geht mich die Welt und ihr Urteil an?«
»Wissen Sie, dass Sie ein ganz ungewöhnliches Mädchen sind?« fragte er mit wachsendem Interesse.
»Gar nicht aussergewöhnlich! Aber Ihr Männer seid so gewöhnt, alle weiblichen Wesen als eine Art Spielzeug zu betrachten, –«
»Welche Männer? Ich, mein gnädiges Fräulein, habe von Kindheit an zum Weibe wie zu einem höheren Wesen aufgeblickt, und von dem Tage an, wo mich ein Mädchen lieben sollte, und ich sie, wäre ich ihr Sklave.«
Adele sah ihn lange nachdenklich an. Dann sagte sie:
»Aber Sie, – Sie sind ein aussergewöhnlicher Mensch!«
Nachdem die beiden einander für ganz merkwürdige Spezies des armseligen Menschengeschlechts erklärt, das eitle Vergnügen des Tanzens einer scharfen Kritik unterzogen und Betrachtungen über die Melancholie eines Mondscheinabends angestellt hatten, gingen sie hinein und suchten sich ein Vis à vis zur Française.
Adele tanzte ausgezeichnet, und der junge Jurist gewann vollends ihr Herz dadurch, dass er tanzte wie ein »unschuldiges Mädchen«.
Nach Schluss der Franchise setzten sie sich wieder auf die Veranda.
»Was ist Liebe,« sagte Adele und blickte den Mond an, als wollte sie die Antwort auf ihre Frage vom Himmel herunter holen.
»Sympathie der Seelen,« flüsterte der junge Mann.
»Aber Sympathie kann leicht in Antipathie umschlagen, – das sieht man nur zu oft,« meinte Adele.
»Dann war es eben nicht die rechte Sympathie. Manche Materialisten behaupten, es gäbe gar keine Liebe, wenn es nicht zwei Geschlechter gäbe, und sie wagen zu behaupten, dass die sinnliche Liebe länger Bestand hat als die andre. Kann man sich etwas so Niedriges, so Tierisches denken als diese Liebe, die in der Geliebten nur das andre Geschlecht sieht?«
»Sprechen Sie nicht von den Materialisten.«
»Ja, ich musste von den Materialisten sprechen, um Ihnen klar zu machen, wie hoch ich meine Liebe zu einem Weibe halten würde, wenn ich je dazu käme, zu lieben. Sie brauchte nicht schön zu sein, Schönheit vergeht. Ich würde einen guten Kamerad, einen Freund in ihr sehen; ich würde ihr gegenüber nicht scheu und verlegen sein, wie gegen andere Mädchen. Nein, ich würde ihr ruhig entgegen gehen, wie ich jetzt zu Ihnen komme, und fragen: willst Du mein Freund fürs Leben sein?«
Adele sah mit Begeisterung auf den jungen Mann, der ihre Hand ergriffen hatte.
»Sie sind eine ideale Natur,« sagte sie, »und Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Sie haben mich, wenn ich recht verstanden habe, um meine Freundschaft gebeten? Die sollen Sie haben, aber erst eine Probe. Zeigen Sie mir, dass Sie für Ihre Freundschaft Demütigungen ertragen können.«
»Worin soll die Probe bestehen? Ich will alles thun!«
Adele knüpfte ihr goldenes Halsband mit daranhängendem Medaillon ab.
»Tragen Sie dies als Wahrzeichen unserer Freundschaft.«
»Ich will es tragen,« entgegnete der junge Mann etwas unsicher, »aber es wird dann heissen, wir seien verlobt.«
»Fürchten Sie das?«
»Durchaus nicht, wenn Du es willst! Willst Du es?«
»Ja, Axel, ich will, denn die Welt duldet keine Freundschaftsverbindungen zwischen Mann und Weib; die Welt ist so gemein, dass sie an ein reines Verhältnis zwischen Personen verschiedenen Geschlechts nicht glaubt.«
Und er trug seine Kette. Die Welt, die unter vier Augen sehr materialistisch ist, sagte, wie die Freundinnen: sie heiratet, um einen Mann, und er, um eine Frau zu bekommen. Es wurden selbst ein paar hässliche Anspielungen darauf gemacht, dass er sie um des Geldes willen nähme, da er selbst erklärt hatte, etwas so Gewöhnliches wie Liebe existierte zwischen ihnen nicht, und da die Freundschaft allein ja doch keinen dazu zwingt, ein gemeinsames Schlafzimmer zu teilen, wie Eheleute zu thun pflegen.
Sie heirateten sich. Die Welt bekam einen kleinen Wink, dass sie wie Geschwister zusammenleben wollten, und nun wartete man mit höhnischem Grinsen auf den Ausgang dieser grossen Reform des Ehelebens.
Die Neuvermählten reisten ins Ausland. Die Neuvermählten kamen wieder heim. Die junge Frau war blass und schlechter Laune; sie begann, Reitstunden zu nehmen. Die Welt legte die Ohren an und erwartete etwas. Der junge Rechtsanwalt sah aus, als hätte er ein Vergehen auf dem Gewissen, und ging herum und schämte sich.
»Sie leben eben wie Geschwister,« sagte lachend die Welt. »Dann wird es also wohl ein Geschwisterkind geben?«
»Ohne Liebe? Aber das ist ja! Ja, was ist es eigentlich?«
Das Faktum blieb bestehen, aber die Sympathie der Seelen begann nach und nach abzutropfen. Die verachtete Wirklichkeit brach rächend über sie herein.
Der Rechtsanwalt ging seinem Berufe nach, seine Frau überliess ihre Berufsarbeit einer Amme und einem Mädchen für alles. Dann empfand sie den Fluch der Beschäftigungslosigkeit. Sie hatte reichlich Zeit und Gelegenheit, sich zu entwickeln, und begann über ihre Lage nachzudenken. Sie war wenig befriedigt von derselben. War das ein Dasein für einen begabten Menschen, dazusitzen und nichts zu thun? Ihr Mann riskierte einmal die Bemerkung, dass sie das ja nicht nötig hätte, dass niemand sie zwänge, nichts zu thun. Aber er riskierte es nie wieder.
Ihre Thätigkeit wäre keine Thätigkeit.
Nein, thatenlos herumzuziehen wäre allerdings keine Beschäftigung. Weshalb nährte sie ihr Kind denn nicht?
Nähren? Nein, sie wollte etwas haben, womit sie Geld verdiente.
Ob sie denn so geldgierig war? Sie hatte ja mehr, als sie verzehren konnten, weshalb wollte sie Geld verdienen;
Um ihm gleichgestellt zu werden.
Gleichgestellt könnten sie nie werden, denn sie würde stets eine Stellung einnehmen, die er nie erreichen könnte. Die Natur hatte es einmal so eingerichtet, dass die Frau Mutter wurde, nicht der Mann.
Ach, das wäre ja Unsinn!
Es hätte ja auch umgekehrt sein können, – es war nun aber einmal so.
Ja, aber dieses Leben war unerträglich. Sie konnte nicht ausschliesslich für die Ihrigen leben, sie wollte auch andern Menschen nützen.
Sie könnte ja immerhin mit den Ihrigen anfangen, an die andern konnte man später denken.
So hätte die Unterhaltung in Ewigkeit fortgehen können; sie dauerte aber immerhin eine gute Stunde. Der Rechtsanwalt war natürlich den grössten Teil des Tages ausser dem Hause, und wenn er heimkam, hatte er Sprechstunde. Das brachte Adele zur Verzweiflung. Sie sah, wie er sich mit anderen Frauenzimmern einschloss und ihr Vertrauter wurde, und Sachen erfuhr, die er ihr nicht sagte. Immer standen Heimlichkeiten zwischen ihnen, und sie fühlte ihn sich überlegen.
Ein dumpfer Hass gegen das Ungerechte in ihrem Verhältnis zu einander begann sich in ihr zu regen; und sie sann auf ein Mittel, ihn aus seiner Stellung zu drängen; er sollte herabgezogen werden, um eine Gleichstellung zwischen ihnen zu ermöglichen.
Eines Tages rückte sie mit dem Plane heraus, ein Krankenhaus stiften zu wollen. Er riet ihr ab, da er für seine Person vollauf mit seiner Praxis zu thun hatte. Aber schliesslich meinte er, es würde vielleicht ganz gut sein, ihr eine Beschäftigung zu geben, – er würde dann mehr Ruhe haben.
Sie bekam ihr Krankenhaus und er sass mit ihr in der Direktion. Nachdem sie ein halbes Jahr »dirigiert« hatte, fühlte sie sich so bewandert in der ärztlichen Kunst, dass sie auf eigene Hand Rat zu geben begann.
Das sei keine grosse Sache, meinte sie.
Eines Tages ertappte sie den Arzt des Krankenhauses auf einem kleinen Versehen, und seitdem hatte sie kein Vertrauen mehr zu ihm. Die Folge davon war, dass sie eines Tages im Gefühle ihrer Überlegenheit seine Abwesenheit benutzte und ein Rezept schrieb. Es wurde auch ausgeführt und die Medizin von dem Patienten eingenommen, aber mit tötlichem Ausgang.
Man musste in eine andere Stadt ziehen, aber das Gleichgewicht war gestört, und es wurde noch mehr gestört durch die Ankunft eines neuen kleinen Weltbürgers. Auch war ihnen das fatale Gerücht aus ihrem früheren Wohnort in den jetzigen gefolgt.
Das Verhältnis zwischen den beiden Eheleuten war trist und unschön, denn Liebe hatte ja nie bestanden. Die Basis des frischen, starken, gesunden Naturtriebes fehlte, und ihr Zusammenleben war eigentlich nichts anderes, als ein auf dem lockeren Kalkül egoistischer Freundschaft gegründetes Konkubinat.
Was nun in ihrem Gehirn vorging, als sie den auf der Suche nach einem eingebildeten »Höheren« begangenen Missgriff entdeckte, davon sprach sie nicht, aber ihr Mann sollte es erfahren.
Sie fing an zu kränkeln, verlor den Appetit und wollte nicht ausgehen. Dabei magerte sie ab und begann zu hüsteln. Ihr Mann liess sie mehrmals untersuchen, aber die Ärzte kamen der Ursache der Krankheit nicht auf den Grund. Endlich gewöhnte er sich so an ihr beständiges Klagen, dass er gar nicht mehr darauf achtete.
»Es ist langweilig, eine kranke Frau zu haben,« sagte sie.
Er musste im Stillen zugeben, dass es weiter kein Vergnügen war, aber wenn er sie geliebt hätte, würde er so etwas weder empfunden noch zugegeben haben.
Sie nahm sichtlich ab, und er musste sich schliesslich dazu bequemen, sie zu einem berühmten Professor zu schicken.
Adele reiste zu dem Professor.
»Wie lange sind Sie schon krank?« fragte dieser.
»Ich bin eigentlich nie gesund gewesen, seit ich vom Lande, wo ich meine Jugend verlebt habe, in die Stadt gezogen bin.
»Sie gedeihen also nicht recht in der Stadtluft?«
»Gedeihen? Wer fragt danach, ob ich gedeihe oder nicht,« antwortete sie mit Märtyrermiene.
»Glauben Sie nicht, dass die Landluft Ihnen gut bekommen würde?« fragte der Professor.
»Ich glaube allerdings, dass das das einzige ist, was mich retten kann, wenn ich aufrichtig sein soll.«
»Nun, so leben Sie doch auf dem Lande!«
»Meines Mannes Carrière kann doch meinetwegen nicht zerstört werden.«
»Ach was, Sie sind ja reich, und Rechtsanwälte haben wir genug!«
»Sie denken also, Herr Professor, dass wir durchaus auf dem Lande leben müssen?«
»Ja, wenn Sie meinen, dass es Ihnen bekommt. Ich finde absolut keine andere Krankheit bei Ihnen, als sogenannte Nervosität, und ich denke, die Landluft wäre ganz gut dafür?«
Höchst niedergeschlagen kam Adele heim.
Na–a? –
Der Professor hatte sie zum Tode verurteilt, wenn sie weiter in der Stadt lebte.
Der Rechtsanwalt geriet ganz ausser sich beim Gedanken, dass er seine Praxis aufgeben sollte, und darin sah seine Frau den deutlichsten Beweis, dass er sich nicht das allermindeste aus ihr machte.
Er wollte nicht recht daran glauben, dass es sich um ihr Leben handelte.
So, – er wollte das also besser wissen, als der Professor? Er wollte, sie sollte sterben?
Das wollte er gewiss nicht und daher kaufte sie ein Landgut. Ein Inspektor sollte es verwalten. Der Rechtsanwalt war beschäftigungslos geworden. Die Tage zogen sich ihm endlos in die Länge, und er führte ein trübseliges Dasein. Da seine Einnahmen aufgehört hatten, musste er von dem Gelde seiner Frau leben. Im ersten halben Jahr las er viel; im zweiten steckte er das Lesen auf, weil er fand, dass nichts dabei herauskam, im dritten begann er zu sticken.
Seine Frau dagegen warf sich mit aller Macht auf die Landwirtschaft, ging bis zu den Knieen aufgeschürzt im Hofe herum, kam schmutzig nach Hause und roch nach dem Kuhstall. Sie fühlte sich in ihrem Element und kommandierte die Leute, dass es eine Lust war, denn sie war auf dem Lande geboren und verstand sich darauf.
Wenn der Rechtsanwalt über Beschäftigungslosigkeit klagte, dann sagte sie zu ihm: »Nimm Dir doch etwas vor! Kein Mensch braucht die Hände in den Schoss zu legen und nichts zu thun.«
Er ass, schlief und ging spazieren; alle Augenblick war er jemandem im Wege und bekam es von seiner Frau zu hören.
Eines Tages, als er wieder mit seinen Klagen kam, und das Mädchen die Kinder ohne Aufsicht gelassen hatte, sagte sie zu ihm: »Sieh doch nach den Kindern, dann hast Du gleich etwas zu thun.«
Er sah sie an, ob sie im Ernst sprach:
»Ja gewiss, – weshalb soll man sich nicht um seine eigenen Kinder kümmern, – findest Du das so wunderbar?«
Er dachte ein Weilchen nach und fand wirklich nichts dabei.
Nun ging er regelmässig jeden Tag mit den Kindern spazieren.
Eines Morgens, als er sie abholen kam, waren die Kinder noch nicht angezogen. Der Rechtsanwalt war ärgerlich und ging zu seiner Frau,, denn vor den Mädchen fürchtete er sich etwas.
»Warum sind denn die Kinder noch nicht fertig?« fragte er.
»Weil Marie etwas anderes vor hat. Zieh' Du sie doch an, Du hast ja nichts weiter zu thun. Ist es etwa eine Schande, seine eigenen Kinder anzuziehen?«
Er grübelte ein Weilchen und musste ihr schliesslich wieder recht geben: es war keine Schande. So kleidete er die Kleinen an.
Eines Morgens zog er es vor, allein auszugehen, mit der Büchse über der Schulter, obschon er niemals schoss.
Als er heimkam, ging seine Frau ihm entgegen.
»Weshalb warst Du heut' nicht mit den Kindern draussen?« fragte sie in ziemlich scharfem Ton.
»Weil es mir heute nicht passte!«
»Nicht passte! Glaubst Du, es passt mir, den ganzen Tag im Schmutz herumzulaufen? Ich finde wirklich, ein alter Mensch wie Du sollte sich schämen, auf dem Sofa herumzuliegen und nichts zu thun.«
Er schämte sich wirklich, und von dem Tage an war er als Kinderfrau angestellt, und pünktlich besorgte er seinen Dienst. Er sah nichts Unrechtes darin, aber er litt darunter, die ganze Sache erschien ihm einigermassen verkehrt, aber seine Frau wusste ihm immer alles plausibel zu machen.
Sie sass im Kontor und verhandelte mit Inspektor und Amtmann, sie stand im Speicher und wog die Portionen für die Knechte ab. Alle, die auf den Hof kamen, fragten nach der Frau, niemand nach dem Herrn.
Beim Spazierengehen geriet er eines Tages auf eine Wiese, wo Vieh weidete. Er wollte dem Kinde die Kühe zeigen, und führte es vorsichtig an die grasende Herde heran. Plötzlich erhob sich ein schwarzer grosser Kopf über die Rücken der andern Tiere und schaute die Ankommenden dumpf brüllend an.
Der Vater nahm die Kinder auf den Arm und rannte, was er konnte, nach dem Garten zu. Hier angekommen, warf er die Kinder hastig über den Zaun, und wollte sich ebenfalls hinüberschwingen, blieb aber mit seinem Rocke hängen. Als er auf der Wiese ein paar Frauen sah, rief er ihnen, so laut er konnte, entgegen:
»Der Stier! Der Stier!«
Aber die Frauen lachten nur, kamen herbei und nahmen sich der Kinder an, die im Dickicht übel zugerichtet worden waren.
»Seht Ihr denn den Stier nicht?« schrie er.
»Nee, – es giebt ja gar keinen Stier,« sagte die älteste von ihnen, »den haben wir ja vor vierzehn Tagen geschlachtet.«
Kleinlaut und verdriesslich kam er nach Hause, und beklagte sich bei seiner Frau über die Mädchen; sie lachte nur.
Am Nachmittag, als das Ehepaar allein im Saale sass, klopfte es an der Thür.
»Herein,« rief die Hausfrau.
Eins der Mädchen, die bei dem Abenteuer mit dem Stier zugegen gewesen waren, kam herein und trug das bewusste Halsband des Rechtsanwalts in der Hand.
»Das ist gewiss der gnädigen Frau ihres,« sagte sie zögernd.
Adele sah erst das Mädchen, dann ihren Mann an, der mit aufgerissenen Augen seine Kette betrachtete.
»Nein, das gehört dem Herrn,« sagte sie und nahm das Halsband in die Hand. »Danke, mein Kind, – der Herr wird Dir etwas zum Finderlohn geben.«
Der sass aber blass und unbeweglich da.
»Ich habe kein Geld bei mir, – wenden Sie sich an die gnädige Frau,« sagte er und steckte das Schmuckstück zu sich.
Seine Frau nahm eine Krone aus ihrem grossen Portemonnaie und gab es dem Mädchen, die sich zurückzog, offenbar, ohne das geringste von der ganzen Scene begriffen zu haben.
»Das hättest Du mir ersparen können,« sagte er in schmerzlichem Ton.
»Hast Du nicht die Courage, für Deine Worte und Thaten einzustehen? Schämst Du Dich, ein Geschenk von mir zu tragen, wo ich doch Deine trage? Du bist doch eigentlich ein armseliger Mensch! Und das will ein Mann sein!«
*
Adele musste zu einer Auktion fahren und sollte acht Tage fortbleiben; während der Zeit sollte ihr Mann in der Wirtschaft nach dem Rechten sehen.
Am ersten Tage kam die Köchin und bat um Geld zu Zucker und Kaffee; er gab es ihr. Drei Tage später kam sie wieder nach Geld zu demselben Zweck. Er drückte sein Erstaunen darüber aus, dass die erste Summe schon verbraucht war.
»Ich esse es ja nicht alleine auf,« sagte die Köchin grob, »und die gnädige Frau sagt nie etwas, wenn ich nach Geld komme.«
Er gab ihr das verlangte Geld, aber der kleine Vorfall hatte ihn neugierig gemacht, er schlug das Haushaltungsbuch auf und begann zu addieren.
Es war eine merkwürdige Summe, die bei diesen zwei Posten herauskam. Es stellte sich heraus, dass im Monat acht Kilo verbraucht worden waren. Nun setzte er seine Forschungen fort, – überall dasselbe Resultat. Er nahm nun das Hauptbuch vor und fand neben den unglaublichsten Ziffern auch die gröbsten Rechenfehler. Es zeigte sich, dass seine Frau nicht mit Brüchen zu rechnen verstand, und dass ganz unerhörte Diebstähle von Seiten der Dienstleute begangen wurden, die zum Ruin führen mussten.
Adele kam nach Hause, und der Rechtsanwalt musste einen ausführlichen Auktionsbericht anhören. Darauf räusperte er sich und wollte anfangen, aber seine Frau kam ihm zuvor und fragte:
»Na, wie bist Du mit den Leuten fertig geworden, mein alter Junge?«
»O, fertig geworden bin ich ganz gut, aber sie sind gewiss nicht ehrlich, das kannst Du glauben!«
»So? Sie sind nicht ehrlich?«
»Nein, – es sind z. B. viel zu grosse Posten Kaffee und Zucker da.«
»Woher weisst Du denn das?«
»Ich habe es im Wirtschaftsbuch gesehen.«
»Du hast also in meinen Büchern herumgeschnüffelt?«
»Geschnüffelt? Es hat mich interessiert, der Sache auf den Grund zu gehen, –«
»Aber was geht Dich das eigentlich an?«
»– Und da habe ich gesehen, dass Du Buch führst, ohne mit Brüchen rechnen zu können.«
»Was? – Das soll ich nicht können?«
»Nein, mein Kind, das kannst Du nicht, – und wenn es so weiter geht, dann müssen wir bald vor dem Ruin stehen. Deine ganze Rechnerei ist Humbug, mein gutes Kind, weiter nichts.«
»Was geht es Dich eigentlich an, wie meine Bücher aussehen?«
»Ja, sieh' mal, das Gesetz verlangt aber ordentliche Buchführung.«
»Bah, das Gesetz, – was kümmere ich mich um das Gesetz!«
»Das glaube ich schon, aber es hält sich doch an uns, – an mich jedenfalls, und deshalb werde ich von jetzt ab die Bücher führen.«
»Wir können ja einen Buchhalter nehmen.«
»Das ist nicht nötig, ich habe ja nichts anderes zu thun.«
Und dabei blieb es.
Aber seit ihr Mann an dem Pulte sass, und die Leute mit ihren Anliegen zu ihm kamen, verlor sich Adelens Interesse für Landleben und Landwirtschaft.
Eine grosse Veränderung ging mit ihr vor, und sie kümmerte sich bald weder um die Kühe, noch um Kälber, sondern blieb im Zimmer. Hier hockte sie nun und brütete über neuen Plänen.
Ihr Mann dagegen erwachte zu neuem Leben und warf sich mit Eifer auf die Landwirtschaft. Nun hatte er wieder das Übergewicht. Er kommandierte und überlegte, ordnete an und kontrollierte.
Eines Tages kam Adele aufs Kontor und bat ihn um tausend Kronen zur Anschaffung eines neuen Klaviers.
»Wo denkst Du hin!« sagte ihr Mann, »und gerade jetzt, wo der Hof umgebaut werden soll! Das geht unmöglich!«
»Was soll das heissen? Haben wir es nicht dazu? Reicht mein Geld nicht aus?«
»Dein Geld?«
»Gewiss, mein Geld, was ich in die Ehe gebracht habe.«
»Das ist doch, dächte ich, durch die Verheiratung Gemeingut der Familie geworden?«
»Mit andern Worten: Dein Eigentum, ja?«
»Nein, mein Kind, der Familie, habe ich gesagt. Die Familie ist eine kleine Gemeinde, die einzige, in der Eigentumsgemeinschaft existiert und anerkannt wird, mit dem Manne als Verwalter.«
»Weshalb kann denn der Verwalter nicht auch eine Frau sein?«
»Weil der Mann nicht die Kinder bekommt, und daher mehr Zeit dazu hat!«
»Weshalb können denn aber nicht alle beide verwalten?«
»Weshalb hat jede Aktiengesellschaft nur einen Direktor? Wenn die Frau sich auch an der Verwaltung beteiligen soll, dann muss es schliesslich das Kind auch, denn sie haben doch auch ein Recht darauf.«
»Ach, das ist Advokatenspitzfindigkeit! Aber ich finde es wirklich hart, dass ich hier stehen und um mein Geld betteln soll, wenn ich ein neues Klavier haben will.«
»Es ist jetzt nicht mehr allein Dein Geld.«
»Ist es etwa Deins?«
»Nein, meins auch nicht, es gehört eben der Familie. Du musst auch nicht so thöricht sein und von betteln reden, – die Klugheit gebietet aber, dass man den Verwalter des Vermögens fragt, ob man sich gerade jetzt eine grössere Luxusausgabe gestatten kann.«
»Hältst Du ein Klavier für einen Luxus?«
»Ein neues Klavier, wenn man ein altes hat, ja. Die Vermögenslage ist augenblicklich gerade nicht günstig, deshalb gestattet sie für jetzt den Ankauf eines neuen Pianinos nicht, obschon ich persönlich mich natürlich Deinem Wunsche nicht widersetzen kann noch will.«
»Tausend Kronen ruinieren einen noch nicht!«
»O ja, durch Schuldenmachen, wenn es auch nur tausend Kronen sind, kann man den Grund zu seinem Ruin legen.«
»Das bedeutet also, dass Du mir meine Bitte abschlägst?«
»Nein, das will ich damit nicht sagen, aber die Unserheit des Eigentums – – –«
»O Gott, wann wird der Tag kommen, wo die Frau ihr Vermögen selbst verwalten wird und nicht als Bettlerin vor ihrem Manne zu stehen braucht!«
»Wenn sie selbst arbeitet. – Ein Mann, – Dein Vater, – hat Dein Vermögen erarbeitet, aller Besitz, alles Vermögen ist von Männern angesammelt worden, und deshalb, siehst Du, wäre es gerecht, wenn die Schwester weniger erbte, als der Bruder, da der Bruder schon sozusagen mit der Verpflichtung geboren ist, einmal eine Frau zu ernähren, während den Frauen eine entsprechende Verpflichtung doch nicht obliegt. Verstehst Du das?«
»Sieh' mal an, Du hältst also eine ungleiche Teilung für gerecht? Kannst Du mit Deinem vielen Verstande solche Behauptung wirklich halten? Sollte man nicht immer gleich teilen?«
»Nein, durchaus nicht; es soll proportionaliter, je nach Verdienst geteilt werden. Der Faulpelz, der im Grase liegt und zusieht, wie die Maurer arbeiten, soll weniger haben, als der Maurer selbst.«
»So sagst Du also, ich wäre faul?«
»Hm! Es ist wohl das Beste, ich sage gar nichts, aber ich möchte Dich nur daran erinnern, dass Du mich für faul hieltest, wenn ich auf dem Sofa lag und las, und dass Du dieser Deiner Meinung auch ganz offen Ausdruck gegeben hast.«
»Was sollte ich also thun, bitte, sage mir das.«
»Mit den Kindern spazieren gehen.«
»Ich passe nicht zu Kindern.«
»Aber ich sollte passen, nicht wahr? – Höre einmal, liebes Kind, und lass Dir sagen, ein Weib, das behauptet, es passte nicht zu Kindern, ist eigentlich gar kein Weib. Ein Mann ist sie aber auch nicht, – was ist sie denn dann überhaupt, was meinst Du?«
»O pfui, pfui, dass Du so etwas zu der Mutter Deiner Kinder sagen kannst!«
»Was sagt man denn von einem Mann, der keine Neigung für das andere Geschlecht hat? Sagt man da nicht auch etwas Hässliches?«
»Ach, ich will gar nichts mehr hören!«
Und damit ging Adele in ihr Zimmer, schloss sich ein und – wurde krank. Der Arzt, – dieser allmächtige Berater, – erklärte die Landluft und Einsamkeit unzuträglich für sie, und eine Übersiedelung nach der Stadt wurde nötig, da sie sich einer langwierigen Kur unterziehen musste.
Die Stadt übte auch bald einen ausserordentlich günstigen Einfluss auf Adelens Gesundheitszustand aus, und die Rinnsteinluft gab ihrem Gesicht Farbe und Frische.
Der Rechtsanwalt verschaffte sich wieder Praxis und nun gab es für die üblen Launen beider wieder Ableiter aller Art.
Eines Tages teilten die Zeitungen mit, dass ein von Adele verfasstes Theaterstück zur Aufführung gelangen sollte.
»Siehst Du nun,« sagte sie triumphierend zum Manne, »dass eine Frau auch für höhere Ziele leben kann, als kochen und Kinder wiegen?«
Und das Stück kam wirklich zur Aufführung. Der Rechtsanwalt sass in der Prosceniumsloge wie unter einer kalten Douche, und nach Schluss des Theaters musste er bei einem kleinen Souper den Wirt spielen.
Seine Frau sass mitten in einem Schwärm von Bewunderern, denen er Schnäpse und Cigarren anbieten musste. Dann wurden Reden gehalten. Der Rechtsanwalt stand neben dem Kellner und überwachte die Champagnerkorken-Salutschüsse bei dem Toast auf die Frauen, in dem ein junger Poet, der noch an »das Weib« glaubte, die hochfliegendsten Zukunftshoffnungen äusserte.
Ein Schauspieler kam, klopfte den Rechtsanwalt auf die Schulter und bat ihn, doch eine bessere Champagnermarke geben zu lassen, als diese langweiligen Roederer. Die Kellner sprangen hin und her und fragten nach dem Mann der gnädigen Frau. Und Adele ermahnte ihn beständig, auch ja aufzupassen, ob die Rezensenten genug zu trinken hätten.
Jetzt war er wieder untendurch, und sie obenauf, und er empfand das in höchst unbehaglicher Weise. Als sie an jenem Abend endlich nach Hause kamen, war Adele ganz glückstrahlend: es war, als sei ihr eine Zentnerlast von der Seele genommen, und sie atmete leicht und frei. – Sie hatte geredet und war gehört worden, sie war stumm gewesen und hatte die Sprache wiederbekommen; sie schwärmte von der Zukunft, von neuen Plänen, neuen Eroberungen.
Der Mann sass schweigend dabei, wie ein nasser Holzklotz, der keine Resonanz giebt. Je mehr sie stieg, desto tiefer sank er.
»Du bist doch nicht etwa neidisch?« sagte sie und hielt mitten in ihrer begeisterten Rede inne.
»Wenn ich nicht Dein Mann wäre, würde ich es gewiss nicht sein,« entgegnete er; »ich freue mich ja über Deine Erfolge, aber mich vernichten sie, löschen sie aus. Du hast Rechte, aber ich habe auch Rechte. Die Ehe ist nun einmal Menschenfresserei: Esse ich Dich nicht auf, dann issest Du mich. Du hast mich aufgegessen, ich kann Dich nicht mehr lieben.«
»Hast Du mich denn jemals geliebt?«
»Nein, es ist wahr, wir haben die Ehe aufgebaut ohne Liebe, daher ist es nicht gegangen. Es geht der Ehe wie der Monarchie: Wenn das Prinzip des Alleinherrschertums aufhört, müssen beide sterben, die Monarchie wie die Ehe.«
»Und was soll an ihre Stelle treten?«
»Die Republik natürlich,« entgegnete er und begab sich in sein Zimmer.
