
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ida, ein schönes Burgfräulein von Neuerburg, wurde von manchem Ritter umworben. Sie schenkte ihre Hand und ihr Herz dem Ritter Kuno von Falkenstein. Der Ritter von Vianden, der ebenfalls das schöne Fräulein zur Frau begehrte, war darob sehr erzürnt. Als der Ritter von Falkenstein zur Hochzeit nach Neuerburg reiste, legte sich der Viandener auf der Berghöhe vor Neuerburg auf die Lauer. Es kam zu einem erbitterten Kampf. Die Übermacht des Viandeners war zu groß, und bald lagen die Begleiter des Bräutigams erschlagen am Boden.
Ritter Kuno mußte fliehen, und da ihm der Weg nach Falkenstein verlegt war, ritt er, so schnell ihn das Roß zu tragen vermochte, gen Neuerburg. Schon hatte er die rettende Burg vor Augen, da brach das Pferd, völlig erschöpft, tot zusammen. Unfern aber hörte er das Rufen und Schreien der Verfolger.
In seiner Not betete Ritter Kuno zur Gottesmutter um Hilfe. Sein Gebet wurde erhört. Plötzlich stand vor ihm eine lichte Gestalt und deutete wortlos auf eine alte Eiche. An deren Fuß befand sich ein dunkles Loch, welches in das Innere des hohlen Baumes führte. In diese Höhlung barg sich schnell Ritter Kuno.
Schon stürmten die Verfolger heran. Sie fanden das tote Pferd, den Reiter aber suchten sie vergebens. Als die Viandener wütend abgezogen waren, verließ Ritter Kuno das Versteck, dankte Gott für seine Rettung und eilte der Burg zu.
Nachdem er mit seiner jungen Frau auf Falkenstein Einzug gehalten hatte, ließ Ritter Kuno zum Dank für seine Errettung ein schön geschnitztes Muttergottesbild in der hohlen Eiche aufstellen. Dort steht es noch heute und ist von Alter und Kerzenrauch fast schwarz gefärbt. Und noch heute tragen die Menschen ihre Not und ihren Kummer zum Schwarzen Bildchen. Schon viele sind, wie einst Ritter Kuno, erhört worden.
Einst saßen die Söldner des Neuerburger Grafen in der Burgmühle zusammen und feierten einen Sieg ihres Herrn. Während sie eifrig dem süßen Weine zusprachen, prahlten sie mit Erlebnissen aus ihren Kämpfen und Kriegszügen. Jeder wollte größere Heldentaten als der andere vollbracht haben. Dazwischen ließen sie Kriegslieder erschallen, daß die nahen Berge widerhallten.
Ein junger Söldner, der noch von keinen Kriegsabenteuern berichten konnte, bot sich in übermütiger Laune an, jedes Wagnis zu vollbringen. Da rief ihm ein ergrauter Söldner höhnend zu, er möge einmal vom Mühlenfelsen mit seinem Rosse den Sprung in die Tiefe wagen.
Der Wein war dem jungen Mann zu Kopfe gestiegen, und ohne sich lange zu besinnen, sattelte er sein Pferd. Dann ritt er zur nächtlichen Stunde den Hügel hinauf, dessen Ausläufer zur Mühle führen. Hier gab er seinem Pferd die Sporen und raste über den schmalen Felsgrat dem Wasserfall zu.
Seine Zechgenossen standen vor der Mühle und sahen Roß und Reiter wie einen flüchtigen Schatten in den tosenden Abgrund des Wasserfalles stürzen. Ein dumpfer Fall, dann hörte man nur mehr das eintönige Donnern des Wassers. Die Söldner eilten hinab und fanden ihren jungen Kameraden zerschmettert in den Fluten der Enz. Stumm gingen sie von dannen und unterließen fürderhin das lügnerische Prahlen.
Graf Friedrich von Neuerburg, der Letzte seines Geschlechtes, hatte nur eine Tochter. Sie war verlobt mit dem Grafen von Falkenstein. Als einst der Ritter von Vianden eine Fehde mit dem Ritter von Falkenstein begann, zog der Neuerburger Graf seinem zukünftigen Schwiegersohn zu Hilfe.
Während der Zeit, da Vater und Bräutigam die Burg in Vianden belagerten, ging das gräfliche Fräulein eines Tages im Walerbachtal spazieren. Da nahte sich ihr ein gräflicher Jäger, der ihr schon lange heimlich nachgestellt hatte. An einsamer Stelle sprach er das Fräulein an und verlangte von ihr, dem Bräutigam die Treue zu brechen und ihm zu Willen zu sein. Mit Entrüstung wehrte das gräfliche Fräulein den zudringlichen Menschen ab. Darüber geriet der Jäger in solche Wut, daß er die Jungfrau mit einem Weidmesser niederstach.
Am gleichen Tage fiel auch ihr Bräutigam vor den Mauern der Burg Vianden. Damit war die lange Fehde beendet, und Graf Friedrich kehrte betrübten Herzens nach Neuerburg zurück. Wie groß war aber erst sein Schmerz, als man ihn an die Leiche seines Kindes führte.
Der Graf ließ an der Stelle, wo die grausige Mordtat geschah, eine Kapelle erbauen. Dorthin pilgerte er täglich bis zu seinem Tode. Die Kapelle ist verschwunden, aber das Tal hieß noch lange »Jufferndell«.
Der Mörder war nach der Tat geflohen und irrte viele Jahre ruhelos im Lande umher. Aber selbst im Grabe hat er keine Ruhe gefunden. In nächtlicher Stunde wandert er mit seiner Waffe und seinem Hund Bello durch das Tal, in dem er den Mord verübte. Schon mancher späte Wanderer will dem Ruhelosen begegnet sein und gehört haben, wie sein Ruf »Bello! -- Bello!« von den Bergen widerhallte.
Ein Herr von Manderscheid und einer von Neuerburg wollte dasselbe Fräulein zur Frau haben. Da lud der Neuerburger den Manderscheider zu sich ein. Der kam auch und besiegelte die Freundschaft. Nachher ging der Neuerburger gar noch ein Stück Wegs mit ihm heim. Bei der obersten Mühle aber stürzte er ihn den Felsen hinunter in die Enz.
Der Manderscheider hatte einen Hund bei sich; der wollte ihm nachspringen und seinen Herrn retten. Da band der Neuerburger dem Hund einen Stein an den Hals und warf ihn auch ins Wasser. Er hat alsdann das Fräulein geheiratet.
Als er am Hochzeitsabend allein war mit seiner Braut, ging plötzlich die Tür auf, und ein Hund kam herein mit einem Totenkopf im Maul; den legte er der Braut in den Schoß. Und der Hund hat gesprochen und hat gesagt: »Das ist das ewige Urteil!«
Später hat der Nachtwächter oftmals eine feurige Gestalt auf dem Friedhof an der Kirche umgehen sehen; das war der Ritter.
Der hat auch seine eigene Frau zum Burgfenster hinausgeworfen, an der Braubachseite. Die Dienerschaft kann man noch heute in später Abendstunde für seine Seele umgehen und beten hören. Auch das Heulen des Hundes wurde noch oft vernommen; man nannte ihn den »Brabichter Hund«.
Einst hatte sich eine Kuh der gräflichen Herde auf dem Weidegang verirrt, und der Hirtenjunge mußte ohne sie am Abend zurückkehren. Der Graf, dem dies gemeldet ward, war darob sehr erzürnt und befahl dem Jungen, die Kuh bis zur Frühe des nächsten Tages herbeizuschaffen. Komme er ohne das Tier zurück, so werde der Henker seines Amtes walten und ihn auspeitschen.
Die ganze Nacht über irrte der Junge suchend und weinend durch den Busch, über Waldwiesen und Ginsterfelder, durch Feld und Wald, aber nirgends konnte er die Kuh finden. Vor Müdigkeit taumelnd und fast betäubt vor Angst betrat er am Morgen wieder den Schloßhof.
Der Graf aber war ein harter Mann und befahl dem Henker, seine Pflicht zu tun. Nackt und schluchzend stand der Junge, an einen Pfahl gebunden, auf dem Schloßhof und mußte zusehen, wie der Henker die Lederpeitschen zurechtlegte. In dieser großen Not und Bedrängnis flehte er zu seinem Schutzengel um Hilfe.
Schon hob der Henker die Peitsche, als plötzlich vom Turm des Burgfrieds eine Taube ihr alltägliches Lied rief. Aber alle, die diese Stimme hörten, vernahmen aus dem Taubenlied den Ruf: »Loß d'n Hirt gon, Kuh kinnt' -- Loß d'n Hirt gon, Kuh kinnt! -- Guck!« Und als man vor das Schloßtor eilte, da sah man wirklich die verlorengegangene Kuh sich der Burg nähern.
Der Graf erließ dem Hirten gerührt die Strafe. Und da er selbst kinderlos war, nahm er den Jungen, der so offenbar unter Gottes Schutz stand, an Kindes statt an. Später wurde der Hirtenjunge selbst ein mächtiger Graf. Aber nie war er hart und unbarmherzig gegen seine Untergebenen, denn der Ruf der Tauben erinnerte ihn immer wieder an seine schwerste Stunde.
In einem Dorfe bei Neuerburg lebte der junge Knecht Mattes. Er liebte die Tochter des reichen Bauern, in dessen Haus er diente. Und das Mädchen erwiderte seine Liebe. Der Bauer aber war gegen diese Verbindung und jagte den Knecht vom Hofe. Um sein Ziel dennoch zu erreichen, verbündete sich Mattes mit dem Teufel. Er mußte dem Teufel versprechen, ihm die ersten fünf Kinder aus seiner Ehe zu überlassen. Da verhalf ihm der Teufel zur Ehe mit dem Mädchen.
Mattes lebte zufrieden und glücklich mit seiner Frau, bis sie fünf Kinder hatten. Da mahnte der Teufel, die Kinder an den vereinbarten Ort zu bringen. Oft klopft es nachts an das Fenster, und eine dumpfe Stimme forderte, das Versprechen einzulösen. »Was hast du versprochen?« fuhr die Frau auf. »Nichts, nichts, du hast geträumt!« beruhigte der Mann. Der Teufel aber ließ ihm keine Ruhe mehr.
Eines Tages arbeitete Mattes im Wald. Seine Frau brachte ihm das Essen. Sie möge schon mit dem Essen beginnen, bat Mattes, er habe noch etwas zu erledigen. Und er ging in den Wald hinein. Die Frau wartete. Als Mattes nicht zurückkehrte, suchte sie ihn im Wald. Aber sie fand ihn nicht. Da kehrte sie nach Hause zurück. Hier aber fand sie ihre fünf Kinder, von der Hand des Vaters erstochen, tot auf. Mattes hatte die Kinder getötet, um sie nicht in die Hand des Teufels fallen zu lassen.
Der unglückliche Vater stellte sich nach der Tat dem Gericht. Das Gericht verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Beim Görgenhof stand der Galgen, da mußte er hängen.
Auf der Neuerburg hielt sich eines Tages ein Fräulein von Leuchtenberg auf. Sie war die Verlobte des Grafen von Manderscheid, des Herrn der Burg. Dieses Fräulein fand man nach einer stürmischen Winternacht tot in ihrem Bette auf. Der Medikus ward gerufen. Er behauptete, das Fräulein sei vergiftet worden, und dies könne nur eine Hexe getan haben.
In der Stadt verhaftete man alsbald eine Frau namens Magdalena Pirken. Sie stand bei jung und alt in dem Geruche, eine Hexe zu sein. Zuerst leugnete sie jede Schuld. Als man sie aber auf die Folter spannte, legte sie ein Geständnis ab.
Frau Pirken berichtete: »Meine begangenen Zaubertaten schweben mir nur traumhaft vor der Seele. Ich kann nicht sagen, ob ich nur im Geiste oder auch leiblich an den Zaubertaten beteiligt war.
Vor etwa vier Jahren ging ich in den nahen Mühlenbusch. Es gesellte sich zu mir ein schwarzer, fremdartig gekleideter Mann. Er forderte mich auf, Gott ab- und ihm zuzuschwören. Er versprach mir dafür reiche Belohnung. Ich schwor Gott ab und versprach dem fremden Mann blinden Gehorsam.
Jeden Donnerstag kam der Schwarze und führte mich auf einem ebenso dunklen Bocke zum Schornstein hinaus. Auf dem Dache des obersten Stadtpförtleins ruhten wir aus. Dann zogen wir weiter zum Hexentanzplatz im Mühlenbusch, wo wir herrlich und in Freuden lebten.
Auf dem Hexentanzplatz haben wir auch beschlossen, das gräfliche Fräulein umzubringen. Auf dem Eligiusfriedhof an der Weiherstraße haben wir ein neugeborenes, noch ungetauftes Kind ausgegraben. Aus der Leiche haben wir den Gifttrank bereitet. Dann zogen wir zu nächtlicher Stunde in die Burg und brachten dem Fräulein den tödlichen Trunk bei.«
Magdalena Pirken wurde vom Neuerburger Hochgericht zum Tode durch das Feuer verurteilt. Auf einer Anhöhe beim heutigen Görgenhof wurde sie verbrannt. Ein Flurname heißt dort heute noch »Am Hochgericht«.
Die Bauern von Dahnen besaßen viele Pferde und Esel. Aber niemand wollte ihnen die Tiere auf dem Markt abkaufen, denn sie waren allzu knochig und mager. Eines Tages gingen sie mit ihrem Kummer zu Till Eulenspiegel. Der Schalk versprach, ihnen zu helfen. Sie sollten nur mit ihren Kleppern und Grautieren zum nächsten Neuerburger Markt fahren.
In der Frühe des Markttages zogen die Diekircher und Viandener Händler zuerst mit ihren wohlgenährten, schmucken Pferden und Eseln zum Stadttor herein. Ganz Neuerburg war auf den Beinen, um sich diese Prachttiere anzuschauen. Endlich kamen auch die Dahnener mit ihrem Vieh angefahren. Als man die mageren Tiere erblickte, überschüttete man deren Eigentümer mit Spott und Gelächter. Die Zuschauer drängten sich um die Bauern von Dahnen und ihre Tiere; auch die Händler aus Diekirch und Vianden kamen herbeigeeilt, um sich an diesem Schauspiel zu ergötzen.
Währenddessen hatte sich Eulenspiegel unbemerkt in die Küche eines Hauses eingeschlichen, wo eben dicke, ungeschälte Kartoffeln im heißen Wasser dampften. Rasch warf Eulenspiegel die heißen Kartoffeln in einen Sack, den er unter dem Mantel trug, und kehrte auf den Markt zurück.
Kein Mensch wachte bei den Tieren aus Diekirch und Vianden. So konnte Eulenspiegel unbemerkt heranschleichen und jedem Tier eine brühheiße Kartoffel unter den Schwanz legen. Dann mischte er sich mit dem unschuldigsten Gesicht der Welt unter die Zuschauer bei dem abgemagerten Vieh.
Inzwischen war bei den anderen Tieren etwas sehr Schlimmes geschehen. Denn als die armen Tiere den Brand fühlten, zogen sie den Schwanz und damit die Kartoffel noch fester an sich heran. Und da sie sich nicht anders helfen konnten, rissen sie sich von den Riemen und Stricken los und rannten wie besessen und rasend davon.
Jetzt erst bemerkten die Diekircher und Viandener das Unglück und liefen schimpfend hinter ihrem flüchtenden Vieh her. Allein, die vom Schmerz gequälten und ganz wild gewordenen Tiere liefen schnurstracks nach Diekirch und Vianden zurück.
Auf dem Marktplatz blieben nur mehr die dürren Esel und Gäule der Bauern aus Dahnen. Die fremden Kaufleute, die sehr weit hergekommen waren, mußten nun dieses magere Vieh zu einem ziemlich hohen Preis kaufen, wenn sie nicht vergebens gekommen sein wollten.
Vergnügt zogen die armen Bauern aus Dahnen nach Hause und zahlten Eulenspiegel einen hohen Lohn für seine Dienste.
Die Scheuerner wollten ihre Kapelle zuerst an die Banngrenze zwischen Neuerburg und Scheuern bauen. Sie fuhren Holz und Steine dahin. Aber am nächsten Morgen lagen Holz und Steine in der Dorfmitte.
Da meinten die Scheuerner, man habe ihnen einen Schabernack gespielt. Sie fuhren das Material wieder zurück. Nachts schliefen einige Männer auf dem Holz. Morgens lagen sie dann mit den Steinen und dem Holz in der Dorfmitte und waren es nicht gewahr worden.
Da errichteten sie die Kapelle in der Dorfmitte. An der Banngrenze aber errichteten sie ein Kreuz, das heute noch zu sehen ist. II. Erzählungen
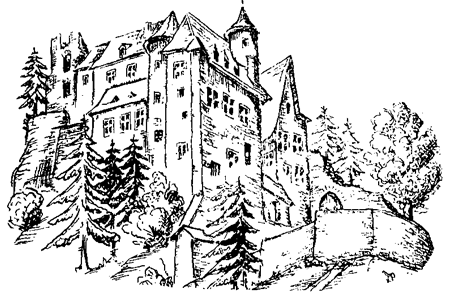
Am Eingang des Neuerburger Stadtwaldes Lindscheid, unmittelbar neben dem tiefgefurchten Waldweg, überragt eine mächtige Eiche die Wipfel des lichten Buchenwaldes. Noch vor einigen Jahrzehnten war es keine Seltenheit, daß man vor dem Baum, an dessen Stamm ein kleines Kruzifix befestigt war, betende Frauen und Mütter antraf. Einer alten Übung gemäß, deren Ursprung sich nicht ermitteln läßt, suchten sie hier im Gebete Zuflucht, wenn ein Kleinkind das Weinen nicht lassen wollte. Und seit altersher trägt der Baum den Namen »Kreijchkoos« (Koos = Eiche). Auf diesen Brauch und diesen Baum nimmt die nachfolgende Erzählung Bezug.
Annegret Buchen konnte es nicht länger mehr mit anhören. Das Kind in der Wiege schrie unentwegt, hochrot das Köpfchen, die kleinen Fäustchen geballt. Seit drei Tagen lag es im Fieber. Nur gelegentlich verfiel es in einen kurzen Schlaf der Erschöpfung, um aufs neue das Haus mit den schrillen Rufen eines gequälten kleinen Körpers zu erfüllen. Frau Annegret rief die älteste Tochter an die Wiege, zog ihren Mantel an und verließ das Haus.
Es war ein Nachmittag im Januar. Die Erde bedeckte eine leichte, frostflimmernde Schneedecke. Die Bäume entlang der Talstraße stießen ihre bizarren Äste in einen blankgefegten Himmel. Annegret Buchen wanderte talauf, verließ bald die Straße und strebte auf einem schmalen Fuhrweg dem großen Bergwald zu. Dort oben auf der Berghöhe stand jene alte, mit einem kleinen Kruzifix gekennzeichnete Eiche, zu der die Mütter seit altersher ihr Gebet trugen, wenn ein Kleinkind immerzu weinte. »Kreijchkoos« nannten sie den gedrungenen, weit ausladenden Baum an einer Weggabelung.
Annegret versuchte zu beten, aber ihre Gedanken verwirrten sich und kehrten immer wieder zurück an die Wiege des Kindes. Der Arzt hatte das Kind offenbar aufgegeben, denn er hatte angedeutet, in diesem Falle könne nur noch Gott helfen. Aber sie wollte das Kind nicht verlieren. Gerade an dieses halbjährige Nesthäkchen hatte sie ihr Herz verloren und, so mußte sie sich gestehen, darüber vielleicht etwas die drei größeren Geschwister benachteiligt. Ein weiteres Kind würde ihnen nicht mehr beschert sein. »Lieber Gott, erhalte mir das Kind!« Ihre Gedanken mündeten immer wieder in diesen beschwörenden Aufschrei zu Gott.
Der Waldweg war holprig. Der Frost nahm mit dem schwindenden Tageslicht zu; stoßweise umhüllte die Atemwolke ihr Gesicht. Dort lichtete sich der Wald. Über die toten Felder der Berghöhe und die dunklen Wälder der Hänge erblickte sie bereits die Häuser des nahen Städtchens, in denen die ersten Lichter aufglommen. Die Eiche wirkte düster und drohend, doch das am Stamm befestigte Kreuzbild schien verstehend und liebevoll auf sie herabzublicken. Hier, in der Stille, ohne die Hast des Aufstieges fiel ihr das Beten leichter. Die Perlen des Rosenkranzes glitten durch die frostklammen Finger, und während die Lippen den Gruß des Engels formten, sprachen ihre Gedanken immer wieder den Anruf »Herr, erhalte mir mein Kind!«.
Die Stille umgab sie wie die Weihe eines Gotteshauses, und der tröstliche Gleichklang des Gebetes beruhigte ihre Sinne. Die einzelnen Stämme des Waldes verschwammen in der Dämmerung zu einer dunklen Wand. Da war es ihr plötzlich, als sehe sie vor diesem samtschwarzen Hintergrund das fernere Leben ihres Kindes, das dort unten im Tal mit dem Tode rang. Gleich einer Vision sah sie es, krank an Leib und Geist, abseits ihrer Spielgefährten, gestoßen und gemieden. Sie sah es verlassen und verspottet, ohne den Schutz mütterlicher Sorge, hinausgestoßen in eine harte Welt, in der Genußsucht und Wohlstand Barmherzigkeit und Liebe verdecken. Ihr Flehruf zu Gott verstummte, und während ihr die Tränen langsam aus den Augen tropften, fügte sie dem Gebete zu »Der für uns das schwere Kreuz getragen hat«.
Als Annegret Buchen die Talstraße wieder erreicht hatte, flimmerte über ihr ein Sternenhimmel in friedvoller Pracht. Es war ihr zur Gewißheit geworden, daß daheim inzwischen der Tod eingekehrt war. Der Frieden dieser Nacht jedoch und die Erkenntnis, die ihr auf dem Berge zuteil geworden war, wogen so schwer, daß sie den Schmerz der Mutter in sich aufsogen.
Als Annegret wenige Tage später still und gefaßt hinter dem kleinen weißen Sarg einherschritt, wunderte sich mancher Dorfbewohner, denn er wußte nicht um den Kampf zwischen Gottes Vorsehung und mütterlicher Liebe, der sich dort am alten »Kreijchkoos« zugetragen hatte.
Man schrieb das Jahr 1635. Die Schatten des großen Krieges fielen auch über das Eifelstädtchen am Fuße der Neuerburg. Schweden, Franzosen und Holländer quartierten sich nacheinander ein und ließen zum Dank den Schwarzen Tod zurück. Die Herrschaft Neuerburg war ausgeplündert, die Äcker lagen verwüstet, die Ställe waren leer.
In dieser Not verlegten sich die Bürger des Städtchens auf eigene Viehhaltung, und es dauerte nicht lange, so war die Geiß fast in jedem Neuerburger Haushalt daheim. Es schien, als wollte die Natur die Verödung in Stall und Feld ausgleichen, denn die Tiere vermehrten sich mit solcher Fruchtbarkeit, daß in dem genannten Jahre mehr als 200 Ziegen im Städtchen gezählt wurden.
Mit lustigem Gemecker sprangen die Geißen auf den saftigen Talwiesen, kletterten an den felsigen Berghängen, naschten leider auch in den Gärten und Feldern und machten nicht einmal vor dem Eigentum des Grafen Franz Hermann von Manderscheid-Kail, des damaligen Herrn der Neuerburg halt.
Den Burghauptmann Peter Heimdal verdroß das lustig-freche Treiben der Geißen schon lange. Als die Klagen des herrschaftlichen Gärtners nicht aufhören wollten, berichtete er seinem auf der Stammburg in Manderscheid weilenden Herrn in einem umfangreichen Scriptum von der zunehmenden Geißeninvasion und ihren schädlichen Folgen.
Der Graf freilich hatte in dieser Kriegszeit andere und schlimmere Sorgen. So gab er ohne lange Überlegung den Befehl, die auf frischer Tat ertappten vierbeinigen Diebe kurzerhand zu inhaftieren. Zu ihrem eigenen Verdruß, zum Ärger des Burghauptmanns und zum Gespött der Neuerburger sahen sich die Offizianten (Polizei) mit einer sehr undankbaren Aufgabe betraut. Sie kostete ihnen weit mehr Schweiß als das Fangen zweibeiniger Diebe.
Sobald sich die braunen Lederpanzer und die federgeschmückten Barette blicken ließen, nahmen die Geißen mit lustigen Sprüngen und spöttischem Gemecker Reißaus. Zwar gelang es nach zwei Wochen angestrengten Dienstes, einige Gesetzesübertreter zu fassen, doch blieb nach kurzer Haftzeit keine andere Wahl, als die Delinquenten aus Futtermangel wieder zu entlassen. Das aber schien sowohl für die Geißen als auch für ihre Besitzer einem Freibrief gleichzukommen. Und ein Jahr später mußte der bekümmerte Burghauptmann eine reichhaltige Liste von Eigentumsdelikten, begangen durch diebische Ziegen, an seinen Herrn schicken.
Heftig tobte Graf Franz, und derart stürmisch war seine Rede, daß die Hand des Schreibgehilfen bei der Abfassung des Antwortbriefes zitterte und krausliche Zeichen nebst einigen Tintenklecksen aufs Papier malte. Soviel aber konnte der Burghauptmann unmißverständlich aus dem Brief herauslesen, daß er nunmehr Order habe, für die Abschaffung aller Geißen in Neuerburg innerhalb eines Monates Sorge zu tragen.
Die bösen Ahnungen, die ihn beschlichen, als er den Ausrufer mit der Hiobsbotschaft ins Städtchen schickte, sollten ihn nicht trügen. Bereits nach kurzer Zeit kehrte der Offiziant in größter Eile, schweißtriefend und in sehr ramponiertem Zustand zurück. Hatten doch die erbosten Bürger ihre angriffslustigsten Ziegenböcke freigelassen, als die scheppernde Schelle das Todesurteil für deren Gefolgschaft verkündete.
Es wurde Burghauptmann Heimdal klar, daß er mit seiner aus sechs Offizianten bestehenden Streitmacht diesen Krieg nicht gewinnen konnte; so bat er seinen Herrn um Verstärkung. Diesen Waffenstillstand nützen die Bürger aus. Sie schickten eine geharnischte Protestschrift an seine hochfürstlichen Gnaden, den Herrn von Chimai, Gouverneur von Luxemburg. Darin verklagten sie den Grafen wegen Verletzung der Bürger- und Stadtfreiheiten.
Sie hatten insofern Erfolg, als nun die Sache einem Gerichtshof übergeben wurde. Dem Grafen wurde vorläufig ein weiteres Einschreiten untersagt. In Neuerburg aber ging der »kalte Krieg« mit unverminderter Heftigkeit weiter. Die Bürger trieben von nun an vielfach mit Bedacht ihre Geißen in die herrschaftlichen Wälder und Gärten. Der Burghauptmann antwortete darauf nicht minder heimtückisch, indem er Fallen und Fanggruben anlegen ließ.
Von 1635 bis 1692, also fast ein ganzes Menschenalter, dauerte der Neuerburger Geißenkrieg. Eine gerichtliche Entscheidung in Luxemburg wurde nie gefällt. Die Geschichte aber traf ihre Entscheidung auch in Sachen Geißenkrieg, als am 3. Mai 1692 auf Befehl Ludwigs XIV. der Gouverneur Harcourt die Neuerburg sprengen und die Bastionen zerstören ließ.
Weite Teile der Burg verfielen, und die Ritter wurden vergessen, die Geißen aber weideten noch lange Zeit am Schloßberg.
Graf Heinrich von Vianden und Ritter Friedrich von Heuerburg schwadronierten in bester Stimmung im Rittersaal der Neuerburg. Was nicht unbedingt heißen soll, daß sie gute Freunde waren. Denn beide konnten, getreu einer langen Tradition, einander in der Seele nicht ausstehen. Das trügerische Einvernehmen war vielmehr auf den beträchtlichen Bierkonsum der Abendstunden zurückzuführen. Zudem erwarteten sie an diesem Abend den Austrag einer belustigenden Wette. Jeder behauptete nämlich, den trinkfreudigsten Knecht im Gefolge zu haben.
Als nun der Stiefel des Neuerburgers mehrmals kräftig gegen den Saalboden hämmerte, polterten alsbald gewichtige Schritte die Stiege herauf. Zwei prächtige Gestalten schoben sich durch die Tür herein: In den Vollmondgesichtern funkelten die roten Nasen eine beredte Sprache, gleich Dauben umspannte das Wams die gewichtigen Bäuche.
Die beiden Landsknechte postierten sich am Tisch ihrer Herren. Diese überwachten derweil das Füllen zweier mächtiger Reiterstiefel mit Gerstensaft. Als die beiden Stiefel gefüllt vor den Duellanten standen, warfen sich diese eher zufriedene als giftige Blicke zu. Auf das militärisch kurze Kommando »Sauft!« hoben die Landsknechte die gewaltigen Becher und begannen, in geübten Zügen das geliebte Naß die Kehle hinunter zu jagen. Die beiden Ritter spielten etwas nervös mit zwei Ellen, die dazu bestimmt waren, den nicht vertilgbaren Rest in den Stiefeln und damit den Sieger zu ermitteln.
Inzwischen näherten sich die Stiefel der beiden Trinkakrobaten mehr und mehr der horizontalen Lage. Ein vernehmliches und ununterbrochenes Glucksen war der einzige Laut im weiten Saal. Plötzlich jedoch verschluckte sich der Viandener Landsknecht etliche Male, sein Gesicht nahm eine tiefrote, fast bläuliche Färbung an, und mit resignierter Gebärde stellte er den Stiefel auf den Tisch. Schnell beugten sich die beiden Ritter gleichzeitig über den Stiefel, so daß ihre Köpfe unsanft in Berührung kamen: Der Stiefelschaft erwies sich als leer, doch blinkte aus dem Fußteil noch reichlich das gelbe Naß.
Inzwischen hatte der Neuerburger Landsknecht seinen Stiefel bereits über die Horizontale hinaufgebracht und schlürfte eben genußreich die letzten Tropfen aus dem Lederrohr. Kräftig rülpsend und mit einem nachdrücklichen Knall beförderte er den Stiefel auf den Tisch zurück. Der Stiefel fiel um und enthob so die beiden Richter einer Nagelprobe.
Ritter Friedrich sah triumphierend seinen Viandener »Bruder« an. Diesem entfuhr ein ebenso ärgerliches wie anerkennendes »Donnerwetter!« Dann lehnte er sich über den Tisch, fixierte den Sieger scharf und fragte: »Sag, Bursche, wie hast du dieses Gaukelstück fertiggebracht?«
Der Neuerburger Landsknecht wischte sich die letzten Schaumflocken vom bärtigen Kinn und sprach bedächtig: »Je nun, Herr, seit heute morgen habe ich schon manchen Trunk getan, bevor mir das Kunststück endlich gelang!«
Einst lebte in dem Dörfchen Scheuern ein Mann, der ein böses Weib hatte. Manches Jahr ertrug er ihr zänkisches Wesen und ihre schnellzüngige Art. Eines Tages jedoch riß ihm der Geduldfaden so vollständig, daß er ein Messer nahm und der Frau ein Stück der übelwollenden Zunge abschnitt.
Nun kehrte der häusliche Frieden ein, und auch der Schaden schien schnell zu verheilen. Die ungewohnte häusliche Ruhe aber bedrückte unseren Mann alsbald so sehr, daß er sich nach wenigen Tagen dem Richter in Neuerburg stellte. Obgleich der Richter dem Manne einiges Verständnis entgegenbrachte, mußte er ihn doch zum Tode durch den Strang verurteilen. Denn, wer andern an Leib oder Leben schadete, war dem Henker verfallen. Der Mann hatte das Urteil erwartet und nahm es gelassen auf.
Als der Tag der Hinrichtung kam, zogen hinter Richter, Henker und Übeltäter viele Schaulustige einher. Alle wunderten sich, daß der Mann auch auf seinem letzten Wege eine ruhige, fast heitere Miene zur Schau trug. In der Nähe des Görgenhofes heißt noch heute ein Flurname »Am Hochgericht«; hier stand der Galgen. Als der begleitende Priester ihm an der Richtstätte noch einmal Mut zusprach, antwortete der Mann mit einem verschmitzten Lächeln, er habe wenig Angst, denn das Fegfeuer habe er schon teilweise auf Erden bestanden.
Die Ruhe verließ den Delinquenten auch nicht, als ihm der Henker auf dem Gerüst das Hanfseil um den Hals legte. Auch seine letzte Bitte rief einiges Kopfschütteln hervor: Noch einmal wolle er in aller Ruhe sein Pfeiflein rauchen, das ihm sein Eheweib so oft mißgönnt hatte. Der Richter nickte lächelnd Gewährung, und der Henker griff sogar in seine Tasche und reichte dem Verurteilten zuvorkommend eine tabakgefüllte Schweinsblase.
Doch machte das Lächeln des Richters sehr schnell einer saueren Miene Platz, als er sehen mußte, wie der Mann eine Pfeife hervorzog, deren Kopf einem kleinen Butterfaß nicht viel an Größe nachstand. Und der Henker stellte zu seinem größten Mißvergnügen fest, daß sein Tabaksbeutel zusehends die einst pralle Form einbüßte.
Gemächlich setzte der Verurteilte die Pfeife mit Hilfe von Stein und Zunder in Brand. Dann begann er, genüßlich blaue Wölkchen aus seiner Pfeife zu saugen. Dem Richter schoß die Zornröte ins Gesicht; auch der Henker fühlte sich in seiner Würde nicht minder schwer verletzt. Unter den Zuschauern aber stieg hie und da ein glucksendes Lachen auf, das schließlich den Richter vollständig vergrämte.
Er gab dem Henker heimlich einen Wink, den dieser nur allzugerne sah und auch sofort in die Tat umsetzte. Er versetzte dem ahnungslos schmauchenden Manne einen Tritt in die Verlängerung des Rückens, daß dieser vom Gerüst stürzte. Der Galgen knarrte unter dem Zug des Seiles, ein einziger Schrei stieg aus der Menge auf. Unmittelbar darauf aber war ein mächtiger Plumps zu hören: Der Strick war gerissen; der Verurteilte fand sich am Fuße des Gerüstes auf dem Rasen wieder.
Zuerst einmal befreite sich der Mann von der unangenehmen Halskrause, die ihm die Luft abzuschnüren drohte. Dann glitten seine Augen suchend über den Rasen. Dort lag sie, seine geliebte Pfeife! Noch im Sitzen griff er danach und führte sie wieder zum Munde. In der erwartungsvollen Stille, die die Zuschauer ergriffen hatte, waren deutlich die energischen Züge des Mannes zu vernehmen.
Die Tücken des erneuten umständlichen Feuerschlagens blieben ihm tatsächlich erspart. Bald umhüllte wieder ein blaues Wölkchen sein Gesicht, das sich sofort zu einem freundlichen Lächeln verzog. Ruhig, wenn auch noch etwas taumelnd erhob sich der Verurteilte. Für einen Augenblick nahm er die Pfeife aus dem Mund und sagte bedächtig, fast vorwurfsvoll:
»Beij dem Spaaß wär mir d'Peijf bal ousgaangen!«
Bleibt noch hinzuzufügen, daß das Reißen des Strickes als Gottesurteil betrachtet wurde. Der Mann konnte unbeschwert wieder nach Scheuern zurückkehren.
Jener Ausspruch unter dem Galgen aber ist bis heute in der Westeifel als geflügeltes Wort erhalten geblieben. Man kann es immer wieder hören, wenn jemand einen jähen Schrecken erlitten hat.
Auf dem Wochenmarkt in Neuerburg herrschte ein lebhaftes Gedränge. Zwischen den Ständen wogten die Käufermassen hin und her. Unter den Marktbesuchern befand sich auch Velten, der als arger Langfinger bekannt war. Die alte Marktfrau Käth kannte seinen Ruf und beobachtete mit Ausdauer den unerwünschten Marktbesucher. Hinter ihrem Gemüsestand folgten ihre Augen unablässig dem Velten, während die Finger emsig die Stricknadeln handhabten.
Velten glaubte sich an einem Stand mit Bekleidung unbeobachtet, als er geschickt nach einer Mütze am Rande der Ausstellungsfläche griff und sie unter dem Kittel verbarg.
»Velten!« dröhnte da die sonore Stimme der Marktfrau wissend und anklagend an das Ohr des Diebes. Der zuckte zusammen, schaute erschreckt um, konnte aber den Rufer nicht entdecken. Aber auch der Verkäufer am Stand war hellhörig geworden, entdeckte den Verlust und rief lauthals nach der Polizei. Da gab Velten Fersegeld und drängte sich rücksichtslos durch die Menge. Hinterher einige Leute, die bei der bestohlenen Bude gestanden hatten. Doch wäre Velten die Flucht durch das Knäuel der Menge und die winkeligen Gassen gelungen, hätte er nicht am Stand der Marktfrau vorbei laufen müssen.
Käth hatte nicht nur das Herz auf dem rechten Fleck, sondern im richtigen Augenblick auch eine Schere zur Hand. Mit der schnitt sie dem Velten, der beim Vorüberdrängen ihren Stand in Gefahr brachte, unbemerkt den dünnen Strick entzwei, der in Ermangelung eines Gürtels die Hose hochhielt. Dem Velten wurde es plötzlich seltsam luftig um die Hinterfront, und ehe er sich die Sache recht erklären konnte, war die Hose schon zu einem Fallstrick auf den Füßen zusammengeschrumpft. Er stolperte und knallte recht unsanft auf das Pflaster. Während eine halb wütende, halb spottlustige Versammlung dem verdatterten Velten die Leviten las und ihn der Polizei übergab, hockte Käth wie immer hinter ihrem Stand und strickte an einem langen Männerstrumpf.

Ein Bauer brachte einem Neuerburger Müller einmal zwei Sack Korn zum Mahlen. Brauch war es früher, daß der Müller als Mahlkosten ein Zehnteil des Getreides behielt. Der Bauer schaute dem Müller mißtrauisch beim Abwägen zu und fragte unvermittelt: »Hott Ihr alt en agerohmten Spitzbuf gesehn?« Auf die verneinende Antwort machte der Bauer klar: »Daat aß, wann e Miller an der Housdier stäht!«
*
Ein Bauersmann hatte am Markttag in Neuerburg etwas über den Durst getrunken. Auf der Heimfahrt fiel er vom Wagen und verletzte sich innerlich. Man brachte ihn zum Dr. Hubert. Der fragte teilnahmsvoll: »Na, wo haben Sie sich denn weh getan?« Stöhnte der Patient: »Zwischen Neuerburg und Daudistel, Här Doktor!«
*
Zum Notar Felix Heß in Neuerburg kam ein Bauer, um sein Testament zu machen. Bestimmt und klar gab er an, wie er als Junggeselle sein Vermögen unter seine zahlreichen Neffen und Nichten aufzuteilen gedenke. So sollte der Neffe Hanni 3000 Mark, die Nichte Kathrin 3000 Mark, die Nichte Susann 4000 Mark, der Neffe Pittchen 6000 Mark, der Neffe Klos 6000 Mark erhalten, und so fort. Als aber der Segen überhaupt kein Ende nehmen wollte, sah sich der Notar doch schließlich zu der Frage veranlaßt, wo er denn ein solch großes Vermögen überhaupt habe. Worauf das Bäuerlein ganz trocken erwiderte: »Daat han eijch iwerhaupt net, äwer de han mech all mei Lebtag geärgert un scheckanert, dorfier well eijch se no mengem Dut och nooch e beßchen ärgeren!«
*
Der Postbus ab Neuerburg ist wieder einmal überfüllt. Eine rundliche Bauersfrau steigt ein und sieht sich vergeblich nach einem Platz um.
»Sie haben nichts, um zu sitzen, gute Frau«, sagt ein Fremder, der ihr behilflich sein will. »Ich habe sehr wohl was, um zu sitzen«, schallt die Antwort, »ich weiß bloß nicht, wo ich's hintun soll!«
*
Der alte Mann hatte sich aufrecht durch's Leben geschlagen, stand sich aber wegen seiner Aufrichtigkeit und Gradlinigkeit nicht besonders gut mit seinen Verwandten. Als er sterben wollte, erinnerten sich einige Vettern seiner, und zwei machten sich auf den Weg, den Sterbenden zu besuchen. Der Sterbende nahm die Trostworte schweigend entgegen und bat sie dann, sein Bett von der Wand zu rücken und an jeder Seite von ihm Platz zu nehmen. Darauf sprach er mit verlöschender Stimme: »Wall kaan eijch rohig sterwen, wie esen Herrgott zweschen zwing Spitzbufen«.
*
Ein Trierer Bischof reiste über Land. In unserer Gegend traf er einen armen Hirten, der auf karger Heide seine große Schafherde weidete. Der Bischof erkundigte sich nach seinem Lohn; es war eine erbärmlich kleine Summe. Er meinte zu dem Schäfer, er selber sei auch ein Hirt, aber er verdiene doch viel mehr als der Schafhirt. Der Hirt schien eifrig zu überlegen, um den Fall zu klären. Plötzlich erhellte sich sein Gesicht, und er meinte zum Bischof: »Daan hot Ihr secher de Sei (Säue) mat dobeij!«
*
Der alte Feechter (Feldschütz) in einem Dorf in unserer Nähe versah seinen Dienst ganz gut, aber mit dem Schreiben stand er auf Kriegsfuß. Eines Tages hatte er einen jungen Burschen zur Anzeige gebracht, weil er den Birnenbaum eines Nachbarn geplündert habe. Dieser wurde bestraft, erhob aber Einspruch bei Gericht, da er sich eines Birnendiebstahls nicht bewußt war. Der Amtsrichter fragte in der Verhandlung den Feldhüter, ob der Junge an den Birnen gewesen sei. »Daat net«, sagte der Feldhüter, »aber der Deiwel kaan Quetschen schreiwen!«
*
Auf dem Neuerburger Markt verkaufte eine Bauersfrau ein Schwein. Doch hatte sich der Ehemann die endgültige Zustimmung zum Verkauf vorbehalten. Als die Frau nach Hause kam, zeigte sich der Bauer mit der Höhe des erlösten Betrages einverstanden und richtete eine Karte folgenden Inhaltes an den Händler: »Ich bin mit dem Verkauf meiner Frau einverstanden. Sie können das Schwein behalten!«
*
Der Ortsbürgermeister erhielt ein behördliches Schreiben, in dem angefragt wurde, ob es im Ort zwei Müller gebe, oder ob Josef und Johann Müller identisch seien. Die Antwort lautete: »Hierorts gibt es nur einen Müller, der den Namen Johann Josef führt. Daß er ein Trinker ist, ist allgemein bekannt; ob er auch identisch ist, konnte nicht festgestellt werden!«
*
Franz Billmanns Geiz treibt oft seltsame Blüten. Da hat ihm unlängst der alte Hausarzt den Auftrag gegeben, ein Fläschchen mit Urin seiner von Krankheitsfurcht befallenen Frau zu bringen. Mit einer gefüllten Literflasche erscheint er einige Tage später beim Doktor. Der schüttelt den Kopf und meint, etwas weniger hätte auch genügt. Nach einiger Zeit des Wartens im Vorzimmer wird Franz ins Sprechzimmer gerufen. Freudestrahlend erscheint er kurz darauf wieder im Wartezimmer und belehrt flüsternd den dort wartenden Sohn. Diesmal habe er den Arzt aber drangekriegt und billig eine mehrfache Untersuchung erhalten: »D'Mamm as gesond, dou bas gesond, Käth as gesond an' d'Geeß (Geiß) as och nooch gesond!«
*