
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 28. Mai 18.. hatte der in dem Dorfe La Grange (Departement Haute-Vienne) wohnhafte Bauer Jean Marouty, welcher verheirathet und Vater zweier, noch unerwachsenen Kinder war, seinen Nachbaren, den Eheleuten Barriere, eine Partie Hanf gestohlen. Ohne daß er es ahnte, war er bei der Ausführung seines Vergehens von einem Einwohner des benachbarten Dorfes Blancbois beobachtet worden. Dieser Letztere, welcher zu dem bestohlenen Ehepaare in verwandtschaftlichem Verhältnisse stand, hatte zwei Monate vor dem erwähnten Diebstahl ebenfalls einen Abgang seines Eigenthums zu beklagen gehabt, und zwar waren es mehrere Säcke mit Feldfrüchten gewesen, die auf eine ihm unerklärliche Weise aus seinem Keller verschwunden waren. Raoul Renaud – dies war der Name des Betreffenden – hatte nach dem Thäter geforscht, seine Bemühungen waren jedoch ohne Erfolg geblieben, und indem er nun zufällig Zeuge eines ähnlichen Diebstahls wurde, glaubte Renaud, durch den Augenschein überzeugt, für beide Vergehen eine und dieselbe Person als Schuldigen annehmen zu können.
– Wer einmal stiehlt, der stiehlt auch zum zweiten Male, monologisirte Renaud; wenn ich also in Marouty den Dieb meiner Feldfrüchte vermuthe, so werde ich wohl nicht so ganz Unrecht haben. Natürlich wird er das Gegentheil behaupten, wenn ich ihm den Angriff gegen mein Eigenthum auf den Kopf zusage, und ich muß mich bescheiden, weil ich keine Beweise für meine Anklage habe. Mithin ist es nutzlos, in dieser Sache Etwas gegen ihn zu unternehmen. Ein Anderes ist es mit dem Diebstahl bei Barrieres, bei welchem ich ihn auf der That ertappt habe. Obgleich mich dies eigentlich wenig angeht, halte ich es doch für meine Pflicht, dem Vetter davon Mittheilung zu machen; wie er dann mit dem Burschen auseinanderkommt, ist seine Sache.
Und indem Renaud solchergestalt kalkulirte, ließ er seinem Gedanken die That folgen und begab sich sofort zu den bestohlenen Verwandten, sie von dem, was er gesehen, in Kenntniß setzend. Die beiden alten Leute, um sich den prozessualischen Weitläufigkeiten zu entziehen, unterhandelten zuvörderst mit dem Diebe, indem sie ihm den Vorschlag machten, daß sie, falls er seinen Raub freiwillig wieder herausgäbe und außerdem als Sühne eine geringe Summe an die Gemeindekasse zahlte, über sein Verbrechen Schweigen beobachten würden.
Marouty jedoch, in dem Glauben, daß ihn Niemand bei der Ausführung seiner That beobachtet habe und diese ihm daher nicht bewiesen werden könnte, stellte den Diebstahl nicht nur in Abrede, sondern heuchelte sogar die tiefste Entrüstung, wie man ihm, einen unbescholtenen Mann, überhaupt eine so niedrige und gemeine Handlungsweise zutrauen könnte. Um seine Unschuld zu beweisen, erbot er sich aus freien Stücken, seine Hütte einer genauen Durchsuchung unterwerfen zu lassen. Von diesem Anerbieten nahmen die Bestohlenen zwar Abstand, da sie wohl voraussetzen durften, daß Marouty seinen Raub bereits anderweitig in Sicherheit gebracht haben würde, bestanden aber nichtsdestoweniger auf ihrer Forderung. Der Beschuldigte, sich nun vollständig sicher fühlend, trieb indeß seine Frechheit so weit, daß er den von ihm Geschädigten drohte, sie wegen Ehrenkränkung und Verleumdung seines guten Rufes gerichtlich zu belangen. Das war den alten Leuten denn doch zu viel; den Verlust an ihrem Eigenthum hätten sie verschmerzt, aber ihr eigener guter Ruf erlitt eine Trübung, und sie mochten fürchten, als böswillige Denunzianten angesehen zu werden, wenn sie die Sache auf sich beruhen ließen und dem frechen Diebe nicht das Handwerk legen würden. Demgemäß strengten sie eine Klage gegen ihn an, auf Grund deren der Maire bei dem Verdächtigen eine Haussuchung veranstalten ließ. Obwohl dieselbe nun nichts Gravirendes gegen Marouty ergab, so wurde doch zu dessen nicht geringer Bestürzung der Diebstahl durch den eingangs erwähnten Zeugen vollständig erwiesen. Infolge dessen wurde der Angeklagte verurtheilt, das Gestohlene herauszugeben, eventuell den Geschädigten vollen Ersatz zu leisten, und er außerdem mit sechs Monaten Gefängniß bestraft. Die Strafe war hart und durch den Umstand verschärft worden, daß der Verurtheilte trotz seiner Ueberführung durch Raoul Renaud sich zu keinem offenen Geständniß herbeigelassen hatte.
Marouty, durch diesen seiner Behauptung nach ungerechten Urtheilsspruch, welcher ihm, dem Unschuldigen, für ewig das Brandmal der Schande aufdrücke, in die denkbar höchste Wuth versetzte, stieß bei seiner Abführung in das Gefängniß die heftigsten Drohungen gegen alle in der Sache Betheiligten aus und schwor, daß er es ganz besonders Barriere und Renaud entgelten lassen werde.
– Ihr habt mir meine Ehre genommen und mich zu einem Schuft gestempelt, schrie er den beiden letztgenannten Personen zu, aber ich will in Wahrheit ein Schuft sein, wenn ich mich nicht dafür an Eurem Leben und Eurem elenden Mammon pfände!
Diese Drohung hatte eine Strafverschärfung von einem Monat zur Folge; sie sollte indessen auf eine gräßliche Weise von dem Elenden erfüllt werden.

Seit dem erzählten Vorfalle waren 9 Monate verflossen. Marouty, seit einigen Wochen aus dem Gefängniß entlassen, befand sich wieder bei seiner Familie. Letztere war inzwischen von den Barrieres, welche sich Vorwürfe machten, die Kinder ihres Vaters, die Familie ihres Ernährers für längere Zeit beraubt zu haben, in jeder Art und Weise unterstützt worden. Man durfte dreist behaupten, daß, da die Frau des Gefangenen mit den ihr zugewiesenen, theils in Lebensmitteln, theils in baarem Gelde bestehenden Gaben gut zu wirtschaften verstand, der Haushalt der Familie ein geordneterer und besserer war, als zu jener Zeit, in welcher Marouty selbst für die Erhaltung desselben thätig sein mußte. Da hatte oftmals, weil der Eheherr den mühsam erworbenen Verdienst größtentheils in Getränken für seine eigene Person anzulegen pflegte, bittere Noth bei den Seinigen geherrscht, und Weib und Kinder waren an manchem Abend hungrig zu Bett gegangen, was während des Gatten und Vaters Strafverbüßung noch nicht einmal vorgekommen war. –
Der Verurtheilte legte während seiner Inhaftirung nicht die geringste Sehnsucht nach Weib und Kindern an den Tag, und sicherlich wäre er auch ohne jedweden Verkehr mit seiner Familie geblieben, wenn nicht seine Frau selbst den Wunsch, den Gatten bisweilen sehen und sprechen zu dürfen, geäußert hätte. Durch die Fürsprache des Geistlichen von la Grange und Blancbois – beide Dörfer hatten einen gemeinsamen Pfarrer – ward es ihr gestattet, den Gefangenen allwöchentlich zweimal zu besuchen. Diese Vergünstigung war ihr um so bereitwilliger zugestanden worden, als man sich von der liebenswürdigen und sittenreinen Frau einen günstigen Einfluß auf den verstockten und boshaften Charakter des Mannes versprach, eine Voraussetzung, die sich jedoch als irrig erweisen sollte.
Die arme Frau fand bei ihrem ersten Besuche eine Aufnahme, die sie keineswegs ermuthigte, denselben zu wiederholen. Marouty fragte sie, ob sie gekommen sei, ihm eine Predigt zu halten oder gute Lehren zu geben; Beides könnte sie sich ersparen, denn er würde doch thun, was ihm beliebte. Schließlich erklärte er ihr in dürren Worten, daß sie ihm einen Gefallen erzeugen würde, wenn sie dieser ersten Zusammenkunft keine weitere folgen ließe. Nach seinen Kindern fragte er gar nicht. Trotz dessen wiederholte Frau Marouty ihren Besuch und erreichte wenigstens soviel, daß der Gefangene sie stillschweigend duldet; der Versuch dagegen, auf seinen Charakter einzuwirken und den Gatten auf den Pfad des Guten zurückzuführen, mißlang ihr gänzlich. Vielleicht um ihn zum Aufgeben seines Racheplanes gegen Barriere zu bewegen, erzählte sie ihm eines Tages, daß das Ehepaar sich ihrer und ihrer Kinder angenommen und auf diese Weise feurige Kohlen auf sein Haupt sammle. Er hatte darauf hohnlachend erwidert, daß die Barriere gewiß gute Gründe hätten, in dieser Weise zu handeln; daß er dagegen redlich bemüht sein würde, ihnen zu vergelten, dessen dürften sie versichert sein. Seine Worte überzeugten sie, daß alle ihre Bemühungen auch nach dieser Richtung vergebliche seien, und so gab sie schließlich jede Hoffnung, den Vater ihrer Kinder umzustimmen, auf. Dagegen beschloß sie, sobald er aus der Haft entlassen worden, sorgsam über jeden seiner Schritte zu wachen und sobald sie irgend eine verdächtige Handlung ihres Gatten wahrnehmen würde, welche geeignet sei, das Leben oder Eigenthum derjenigen zu gefährden, die sie als ihre Wohlthäter betrachtete, den Bedrohten unverzüglich davon Nachricht zu geben.
Nachdem Marouty aus der Haft entlassen worden, erschien er in der ersten Zeit wie umgewandelt. Seiner Frau, ja selbst dem lieblichen Geplauder seiner Kinder gegenüber verhielt er sich mürrisch und schweigsam und vermied jeden Umgang mit seinen früheren Bekannten; auch in der Dorfkneipe, wo er sonst ein häufiger Gast gewesen, ließ er sich kaum noch blicken. Wollte es der Zufall, daß er Barrieres oder Renaud begegnete, so ging er schnell an ihnen vorüber, freilich ohne zu grüßen, doch auch ohne ihnen einen haßerfüllten Blick nachzuwerfen. Ahnte er, daß seine Frau jede seiner Handlungen ängstlich überwachte, oder wollte er seine Opfer erst vollständig sicher machen, oder hielt er die Gelegenheit noch nicht für günstig, um offen gegen sie hervorzutreten? Die Beantwortung dieser Fragen wird sich aus dem Folgenden ergeben. Uebrigens war es, als er sich wieder auf freien Füßen befand, sein erstes Geschäft gewesen, unter den Bewohnern der beiden Zwillingsdörfer La Grange und Blancbois das Gerücht auszustreuen, daß die Barriere trotz der bestimmten Aussage Renauds dennoch nicht überzeugt gewesen seien, daß er den Diebstahl an ihnen begangen habe. Diese Behauptung motivirte er durch den Umstand, daß das Ehepaar sich so warm seiner Familie angenommen hatte. Vielleicht hätte der Bösewicht seinen Zweck auch erreicht, und die Handlungsweise der Barrieres wäre mindestens in einem zweideutigen Lichte erschienen, wenn sie nicht eben über jeden Verdacht erhaben und als hochachtbar und wohlthätig in der ganzen Gemeinde bekannt gewesen wären, während der Verbreiter dieses Gerüchts allgemein von jeher als ein Lügner schlimmster Art – seine anderen Laster ungerechnet – verrufen war. Wie die Dinge aber lagen, erblickte man in diesen Verdächtigungen nur Gehässigkeit und Undankbarkeit, und Marouty erreichte dadurch nicht nur nichts, sondern schadete sich obendrein nur selbst. Die übrigen Bewohner der beiden Dörfer kannten ihn jetzt hinlänglich, um zu wissen, was sie von ihm zu halten hatten. Hatte man wirklich noch in Betreff dessen, ob seine Verurtheilung eine gerechtfertigte gewesen, hin und wieder Zweifel gehegt, so wären diese dadurch vollends beseitigt worden, daß während der ganzen Zeit, welche Marouty im Gefängnisse zugebracht hatte, weder in La Grange noch in den Nachbardörfern Diebstähle vorgekommen waren. Dies schien den Bauern ein Beweis zu sein, daß sie einzig und allein nur in Marouty denjenigen zu suchen hätten, welcher sich dieser Vergehen gegen das Eigenthum seiner Nächsten schuldig gemacht hatte.

Die Wohnung der beiden betagten Eheleute lag ziemlich isolirt, fast am Ende des Dorfes; hinter dem Hause befand sich ein kleiner Obst- und Gemüsegarten nebst einem Morgen Ackerland. Das Haus war von denen der übrigen Bauern etwa fünf Minuten entfernt. Die gesammte Einwohnerschaft des Dorfes bestand aus fünfzehn Bauern, von denen übrigens nur zehn eigenen Grund und Boden besaßen. Genau genommen konnte La Grange eigentlich nur als eine Art Vordorf des ihm auf der linken Seite benachbarten, einen Kilometer entfernten Blancbois gelten, welches einen fünfmal größeren Flächenraum einnahm als jenes. Die Grenze zwischen beiden Dörfern bildete auf der linken Seite das dort kaum zehn Meter breite Flüßchen Tardoire; rechts von La Grange und kaum zehn Minuten von Barrieres Wohnhaus entfernt zog sich ein dichter, mit vielen von dem erwähnten Flusse gebildeten Sümpfen erfüllter Wald hin, welcher sich bis zu dem Städtchen Chalus erstreckte. An seinem Ausgangs- oder, wenn man will, Anfangspunkte bei La Grange befindet sich ein verwittertes Monument, zum Andenken an Richard Löwenherz errichtet, welcher, als er am 28. März 1199 den rebellischen Grafen Bodomar von Limoges züchtigen und zur Uebergabe seiner festen Burg Limogen-Chalus zwingen wollte, an dieser Stelle von einem Pfeilschuß getroffen wurde und an den Folgen dieser Verwundung starb.
Wir haben diese kurze landschaftliche Schilderung für nothwendig gehalten, weil sie zum besseren Verständniß des Nachfolgenden dient, und fahren nach dieser Abschweifung von unserem ursprünglichen Plane in der Erzählung der Thatsachen fort.
Es war am 26. März, einem Freitag. Die Uhr auf dem Kirchthurm in Blancbois hatte soeben den Ablauf der zehnten Abendstunde verkündet. Ein scharfer Wind trug die Klänge klar und deutlich hinüber und ließ dieselben in einem allmählich sich abschwächenden Echo ersterben. Tiefe Finsterniß lagerte über der Gegend, und zuweilen trat der Mond aus den ihn verhüllenden Wolken und erhellte mit seinem geisterhaften, falben Lichte die Flur. Die einzelnen Gegenstände, auf Sekunden von einem schwachen, zitternden Lichtstrahl beleuchtet, schienen dann riesige gespenstische Formen anzunehmen, um im nächsten Momente wieder in undurchdringliches Dunkel zu verschwinden. Es war, kurz gesagt, eine Nacht, wie sie Jemand, der mit dem Gedanken umgeht, eine lichtscheue That zu begehen, sich nicht besser und geeigneter zur Ausführung derselben wünschen konnte.
In La Grange war es still und einsam; die Bauern mochten sich wohl längst zur Ruhe begeben haben oder hielten es wenigstens nicht für nöthig, Licht anzuzünden, um beim Schein desselben mit den Ihrigen zu schwatzen. Nur aus einer abseits stehenden, ärmlichen Hütte drang ein schwacher Lichtschein. Sie wurde vom Gemeindehirten bewohnt, welcher das den beiden Zwillingsdörfern gehörige Vieh unter seiner speziellen Obhut hatte. Die Ursache, weshalb er noch nicht seine Lagerstätte aufgesucht hatte, war darin zu suchen, daß er seine achtzehnjährige, einzige Tochter Marie erwartete, welche sich, um eine häusliche Angelegenheit zu erledigen, am Nachmittage des Tages nach der Stadt Chalus begeben hatte und bis zur Stunde noch nicht heimgekehrt war.
Aber auch noch die Fenster eines andern Hauses waren erhellt. Es war das Haus, in welchem Diejenigen wohnten, denen Marouty – wie er sich vor Gericht ausgedrückt – seine »Entehrung zu verdanken«, und welche zu verderben er geschworen hatte, kostete es auch sein eigenes Leben.
Die Barrieres befanden sich allein im Hause, ein Umstand, der bis dahin kaum jemals vorgekommen, und gerade heute, da er zum ersten Male eingetreten war, auch zum Verderben für sie ausschlagen sollte. Die in ihren Diensten stehenden Leute, ein Knecht und eine Magd, ein Liebespaar, hatten von der gutmütigen Herrschaft die Erlaubniß erhalten, einer in einem benachbarten Dorfe stattfindenden Tanzlustbarkeit beizuwohnen, und ihre Rückkehr war kaum vor dem frühen Morgen zu erwarten.

Die beiden alten Leute saßen, nachdem ihnen bis um neundreiviertel Uhr ihr Vetter Renaud Gesellschaft geleistet und sich dann wieder nach Hause begeben hatte, nebeneinander am Feuer in ihrer Küche, in einer gemüthlichen Unterhaltung begriffen. Die Thür der Wohnung, deren erstes Gelaß die Küche bildete, war, wie es die Sitte im Dorfe mit sich brachte, unverschlossen und wurde nur während der Nacht durch einen starken Riegel verschlossen. Sie verursachte, wenn sie geöffnet wurde, nicht das geringste Geräusch, ein Umstand, auf welchen der Inhaber der Wohnung besonders Gewicht legte; denn »Nichts«, – pflegte er zu seinen, ob dieser Eigenheit spöttelnden Nachbarn zu sagen – »könne ihn so sehr alteriren, als das Knarren oder Pfeifen einer sich öffnenden Thür«. Auch dieser Umstand, so unwesentlich er dem Leser auch erscheinen mag, sollte in diesem Falle doch von großer Bedeutung sein und für die beiden greisen Leute – Barriere zählte siebenzig, seine Gattin achtundsechzig Jahre – verhängnißvoll werden.
Die Unterhaltung des Ehepaares hatte sich während der Anwesenheit des Vetters um Marouty gedreht und bildete auch nach der Entfernung des Ersteren den ausschließlichen Gesprächsgegenstand.
– Ich glaube doch, Pierre, sagte die Frau im Laufe der Unterhaltung, daß Renaud ein wenig zu weit mit seinen Besorgnissen geht.
– Wie meinst Du das, Liese? fragte der Angeredete. Hältst Du das, was er von Marouty sagt, etwa für übertrieben oder für nicht vollkommen gerechtfertigt?
– Nun, wenn auch das gerade nicht, so vermag ich doch nicht daran zu glauben, daß er, wie der Vetter behauptet, Böses gegen uns im Schilde führen soll.
– Und ist ihm das nicht zuzutrauen nach jenen Worten, die er bei seiner Verurtheilung uns im Gerichtssaal entgegenschleuderte? Erinnerst Du Dich nicht mehr jener entsetzlichen Drohung?
– O nur zu wohl! antwortete die Frau, und sie vermochte sich einer unwillkürlichen Geberde des Schauders nicht zu erwehren. Es war furchtbar, ich werde diese Stunde all mein Lebtag nicht vergessen. Welche entsetzlichen Träume hatte ich damals mehrere Nächte hindurch! Ich sah Dich, im Blute schwimmend, zu meinen Füßen liegen und neben mir stand, hohnlachend, Marouty. Halbkrank war ich, als ich erwachte, von der Angst, die ich während des Traumes ausgestanden hatte, und dabei doch auch glücklich, daß es nur ein Traum gewesen war. Weißt Du es noch, Alter, fügte sie, tief aufathmend und mit einem Blick der Liebe auf den Gatten hinzu, wie wir uns damals herzten und küßten?
– Ja, versetzte er, ihre Hand mit Wärme drückend, und ich war froh, daß wir uns noch küssen und herzen konnten. Aber laß den dummen Traum vergessen sein; Du machst mir ordentlich Angst, wenn Du mir ihn mit allen seinen düsteren Einzelheiten wiederum schilderst.
– Ja, Du hast recht, ich will ihn auch ganz und gar vergessen. Es war ja eben nur ein Traum, und er kann, nein er wird niemals zur Wahrheit werden, denn was man auch über Marouty sagen mag, eines so abscheulichen Verbrechens kann ich ihn niemals für fähig halten. Auch halte ich jene Aeußerung, die uns so große Furcht einflößt, nur für eine Drohung, mit welcher er uns hat schrecken wollen, und das ist ihm freilich gelungen; auch mag er sie in der Uebereilung gesprochen haben; man äußert, wenn man aufgeregt ist, ja so Manches, was Einem hinterher leid thut. Die Wuth, daß er trotz seines Leugnens und trotzdem, daß ihm seiner Meinung nach der Diebstahl nicht bewiesen worden war, verurtheilt wurde, riß ihn zu den entsetzlichen Worten hin, die er schwerlich ernsthaft gemeint hat.
– Es ist möglich, daß Du recht hast und ich wünsche es von ganzem Herzen um unser beider willen, sagte der Mann mit einem leisen Seufzer, aber ich bezweifle es und fürchte vielmehr, daß er nur auf eine passende Gelegenheit wartet, um seine Drohung zur Wahrheit zu machen.
– Um aller Heiligen willen, Pierre, Du meinst also wirklich, daß er uns ans Leben will? fragte die alte Frau ängstlich.
Barriere zuckte mit den Schultern.
– Wer kann das wissen? antwortete er. Ich so wenig als Du. Gott allein, der in Maroutys Herz sieht, weiß es. Uebrigens, fuhr er, die Angst seiner Gattin gewahrend, mit einem halben Lächeln fort, übrigens habe ich das auch nicht mit meinen Worten sagen wollen. Was ich muthmaße, ist nur, daß der boshafte Mensch auf irgend einen tückischen Streich sinnt, den er vielleicht gegen uns zu führen beabsichtigt. Die lange Gefängnißhaft, die er freilich nur sich selbst zuzuschreiben hatte, hat ihm ja Zeit genug gelassen, darüber nachzusinnen.
– Und ich glaube gerade, daß sie ihn gebessert und zur Erkenntniß seines Fehltrittes gebracht haben mag. Du glaubst also das nicht?
– Ich glaube im Gegentheil, daß sie ihn nur noch tückischer und boshafter gemacht hat. Seine Frau, die ihn noch besser kennen muß als wir, würde uns wohl Manches über sein jetziges Verhalten gegen sie sagen können, wenn wir Gelegenheit hätten, sie dieserhalb zu. befragen, und er nicht jeden ihrer Schritte mit eifersüchtigen Augen bewachen würde.
– Wenn er nicht gebessert oder wenigstens überzeugt, daß er Unrecht gethan und die ihm auferlegte Strafe verdient hatte, aus dem Gefängniß zurückgekehrt ist, dann wäre diese ja nutzlos gewesen, und der Zweck des Gesetzes somit ein verfehlter zu nennen.
– Dieser wird auch bei den wenigsten Verbrechern erreicht. Sie kehren vielmehr schlimmer und verworfener aus dem Gefängniß zurück, als sie hinein gekommen sind. Die meisten sind für die Gesellschaft verloren und begehen neue, größere Unthaten als zuvor, denn im Kerker haben sie Gelegenheit gehabt, mit Anderen ihrer Gattung, zusammenzutreffen und von diesen neue Laster oder neue Kunstgriffe ihres Handwerks, die ihnen vorher unbekannt gewesen, zu lernen. Das Laster ist eben eine leichte Schule und wird jederzeit lern- und wißbegierige Schüler finden. Nur die eisernste Strenge kann, um die Zahl der Verbrechen und ihrer Jünger zu vermindern, hierbei von Nutzen sein, und wer diese in übel angebrachter Humanität verabscheuenswerth erklärt oder sie gar verdammt, der schadet nicht nur sich, sondern der ganzen Welt, denn er macht es dem Laster leicht, einen fruchtbaren Boden zu finden, zeugt eine Generation von Verbrechern und schafft sich und seinen Nebenmenschen ein zweites Sodom und Gomorrha.
Die Frau schauderte.
Pierre, sagte sie zitternd, halt ein, Du ziehst schreckliche Folgerungen! Wer Dich so sprechen hört, würde kaum glauben, daß Du früher Schullehrer gewesen und Deinen Schülern gegenüber selbst das Humanitätsprinzip in Anwendung gebracht hast. Deinen jetzigen Reden nach müßte man Dich für einen Tyrannen halten, während Du in Wahrheit kaum einen Wurm zu zertreten wagst.
– Kann ich denn anders, versetzte Barriere mit Bitterkeit, ist es denn übertrieben, was ich sage? In Amerika henkt man die Diebe, das ist freilich hart; aber gerade diese Härte erweist sich als heilsam, sie schreckt manchen Leichtsinnigen zurück, ein Verbrechen zu begehen, und naturgemäß muß durch diese harte Strafe die Zahl der Verbrecher sich vermindern. Man kann ja immerhin zwischen Diebstahl aus Noth, aus Leichtsinn, Genußsucht und anderen Motiven einen Unterschied machen bei Abmessung der Strafe. Ich tadle ja übrigens auch nicht die Humanität des Gesetzes, sondern nur seine Einseitigkeit. Es straft den Verbrecher; aber es schützt nicht Diejenigen genügend, welche er geschädigt hat; es schützt sie nicht vor seiner etwaigen Rache. Da heißt es immer: schütze Dich selber. Das Eine darf ich doch fordern, für den Verbrecher eine Strafe, die ihn unfähig macht und ihm die Gelegenheit entzieht, sich an seinem Opfer, das seine That zur Anzeige gebracht, zu rächen. Diese Strafe kann und dies wäre das Einfachste und dabei nicht unmenschlich, in Verbannung bestehen. Was ich von den Verbrechern im Allgemeinen gesagt, eben das muthmaße ich auch von Marouty. Müssen wir, die wir durch ihn geschädigt wurden, nicht eben deshalb, weil wir sein Vergehen zur Anzeige gebracht und damit unseren Nebenmenschen und dem Gesetze einen Dienst erwiesen haben, seine Rache fürchten? Sind wir etwa durch das Gesetz hinreichend davor geschützt? Oder siehst Du etwa in seinem gegenwärtigen Verhalten uns gegenüber, daß die lange Haft eine Besserung seines Charakters bewirkt hat? Ich glaube gar, Du bist so thöricht, dies zu glauben. Ist es denn nicht schon ein Zeugniß für seine gehässige Gesinnung, daß er uns für die Wohlthaten, die wir seiner Familie erwiesen haben, bei unseren Nachbaren zu verleumden gesucht hat?
– Ich kann Dir freilich nicht ganz Unrecht geben, Alter, bemerkte jetzt die Frau, welche bisher vergebens versucht hatte, ihren Gatten zu unterbrechen, und der nun, von seinen hastig gesprochenen Worten erschöpft, eine Pause machte. Es hat ihm indessen Niemand geglaubt, denn man kennt ihn und uns. Hüben und drüben wissen die Leute, daß wir jeden Armen unterstützen, soweit wir dies eben vermögen.
– Das Alles macht die Sache doch nicht besser, nahm der alte Schulmeister wieder das Wort. Das Faktum bleibt bestehen, daß sein Charakter ein grundschlechter sein muß; denn mancher andere, der sich eines Diebstahlsvergehens gegen uns schuldig gemacht, würde dadurch, daß wir dies seine unschuldige Familie nicht entgelten ließen, mindestens zur Erkenntniß seines Fehltritts gelangt sein.
– Und ich hoffe, auch Marouty wird noch zu dieser Erkenntniß gelangen und seinen schlechten Streich bereuen, erwiderte Frau Barriere mit jener Hartnäckigkeit, welche den zum Optimismus hinneigenden Personen zur zweiten Natur geworden ist. Sicherlich war es nur der erste Aerger, welcher ihn zu seiner Handlungsweise bestimmte, und er fühlt vielleicht schon Reue ...
– Frau, rief er ein wenig heftig, wie Du nur so sprechen kannst! Du bist so alt geworden, aber Du bist trotz Deines hohen Alters noch so vertrauensvoll wie ein Kind! Lehre mich doch Marouty nicht kennen! Er ... und Reue fühlen! Im Gegentheil, ich werde wohl Recht haben, wenn ich behaupte, daß er nur auf einen neuen Streich gegen uns sinnt.
– Ich glaube, Du siehst zu schwarz, Pierre, erwiderte seine Gattin mit einem schwachen Versuch zu lächeln; denn in der That empfand sie nicht weniger Angst als der neben ihr sitzende Eheherr. Dich hat der Vetter angesteckt mit seinen Befürchtungen.
– Ganz und gar nicht, Lise, versetzte der Mann. Ich urtheile nur nach dem was Maroutys Frau mir vor wenigen Tagen gesagt hat; Du weißt, daß sie uns gewarnt hat, auf unserer Hut zu sein, und ich denke, wir müssen diesen Wink wohl beachten.
– Nun, wir können uns ja vor Marouty in Acht nehmen, indem wir vermeiden, mit ihm zusammenzutreffen. Wenn wir ihm keine Gelegenheit geben, wird er uns auch nicht nahe treten.
– Möglich, das heißt, wenn er nicht selbst diese Gelegenheit herbeiführt. Ich kann mich einmal, so viel ich mich auch bestrebe, von dem Gedanken nicht losreißen; ich habe eine Ahnung, als ob uns etwas Schlimmes bevorstände, und ich habe mich selten getäuscht. Gott gebe es, daß mich diesmal meine Ahnungen trügen, fügte mit einem tiefen Seufzer der alte Mann hinzu.
– Amen! schloß seine Gattin, die Hände faltend.
Nach diesen Worten entstand eine kurze Pause zwischen den beiden alten Leuten. Jedes von ihnen hing seinen Gedanken nach. Dann nahm die Gattin wieder das Wort, indem sie sagte:
– Weißt Du, Alterchen, es wird spät. Ich dächte, wir könnten uns zur Ruhe begeben. Willst Du nicht so gut sein und den Riegel vor die Thür schieben?
– Ei potztausend, ja ... ich hätte das längst thun können! Daß ich auch daran nicht gedacht habe!

Indem Barriere dies ausrief, wollte er sich rasch erheben, um dem Wunsche seiner Gattin Folge zu leisten.
Kaum aber hatte der alte Schulmeister einen halben Schritt nach der Thür gemacht, als diese von außen geöffnet wurde, und der Lauf einer langen Flinte ihm entgegenstarrte.
Im selben Momente ertönte eine heftige Detonation, eine Kugel flog dicht an dem Ehepaar vorbei und drang, glücklicherweise jedoch ohne einen der beiden alten Leute zu verletzen, zwischen die auf dem Herde brennenden Holzscheite, diese aufwühlend und in das Gemach zerstreuend.
Das bedrohte Ehepaar rief laut um Hilfe, und auf sein Geschrei eilten mehrere Nachbaren herbei. Dieselben gewahrten, wie ein mit einer langen Flinte bewaffneter Mann aus dem Hause floh und dem nahen Walde zustürzte. An eine Verfolgung des Flüchtlings dachte in diesem Augenblicke Niemand; einer der herzugeeilten Bauern wollte in ihm Marouty erkannt haben. Man achtete jedoch nicht weiter auf ihn, sondern bemühte sich, den durch die verstreuten, brennenden Holzscheite in der Küche entstandenen Brand zu löschen und die bestürzten Inhaber der Wohnung zu beruhigen. Nachdem dies geschehen war, was etwa zehn Minuten in Anspruch nahm, wollten sich die Nachbaren wieder entfernen, als plötzlich ein zweiter Schuß fiel, welcher diesmal leider sein Ziel nicht verfehlte. Ohne einen anderen Laut als nur mehr ein leises Aechzen von sich zu geben, war Frau Barriere dicht an dem Heerde, an welchem sie noch soeben gestanden hatte, niedergesunken. Zwei von den nachbarlichen Helfern waren gleichfalls, wenn auch nur unbedeutend verwundet, und wiederum gewahrten einige der in der Küche anwesenden Personen, wie ein Mann mit der noch rauchenden Flinte im Arm in wildem Laufe davoneilte.
Es war jetzt kein Zweifel mehr, daß der Verüber dieses Attentates auf das alte Ehepaar kein Anderer war als Marouty, welcher jetzt von mehreren der in der Hütte befindlichen Bauern deutlich erkannt worden war. Dennoch besaß auch nicht ein einziger dieser zehn Personen den Muth, diesen frechen Mörder zu verfolgen, ja sie nahmen sogar Abstand, länger in der Behausung des von ihm Bedrohten zu verweilen, und dachten nicht daran, wenigstens ihn zu schützen und damit eines seiner Opfer – denn die Frau hatte bereits ihren letzten Athemzug gethan – zu retten. Und doch hatte Barriere Allen ohne Ausnahme, den Einen mehr, den Andern weniger, Wohlthaten erwiesen und ihnen Unterstützungen angedeihen lassen, ein Umstand, welcher ihn wohl dazu berechtigte, sich im Falle der Noth ihrer Hilfe für versichert halten zu dürfen. Der alte Schulmeister, welcher während seines ganzen Lebens Gelegenheit gehabt, die Undankbarkeit und die Selbstsucht seiner Nebenmenschen kennen zu lernen, er sollte auch jetzt, an der Schwelle des Grabes stehend, wieder die Erfahrung machen, daß die Menschen für die ihnen geleisteten Dienste kein Gedächtniß besitzen, ja ihre Undankbarkeit allein sollte für ihn die Veranlassung seines Todes durch die Hand eines ruchlosen Mörders werden.
Als die alte Frau mit leisem Wehlaut todt zu den Füßen ihres Gatten niedergesunken war, hatte die anwesenden Bauern ein panischer Schrecken ergriffen. Die erbärmlichen Feiglinge, für das eigene Leben fürchtend, stürzten in wilder Flucht davon in ihre Hütten, deren Thüren sie sogleich mit allem Möglichen, was sie in der Eile nur aufzufinden vermochten, verbarrikadirten.
– Es ist ein Wahnsinniger, schrieen zwei oder drei der Bauern, es ist Marouty, den die lange Kerkerhaft den Verstand verwirrt hat, und der uns Alle tödten wird, wenn wir ihm in den Weg treten. Wir müssen uns vor seiner blinden Wuth zu schützen suchen, so gut wir können, oder wir sind alle verloren.
Und als einer unter ihnen erklärte, man dürfe doch wenn man nicht ein himmelschreiendes Unrecht begehen wollte, den unglücklichen Barriere nicht im Stich lassen, welcher schutzlos der Wuth seines Angreifers preisgegeben sei, man müsse ihn vielmehr zu retten suchen, da wurde ihm erwidert:
– Ei, dann versucht es doch, Claus, und tragt Eure Haut dabei zu Markte! Wir müssen bestens für eine solche Kommission danken, die uns unser Leben kosten könnte! Hier heißt es, schütze Jeder sich selbst, und Barriere wird sich schon vor dem Wahnsinnigen zu schützen wissen!
Wenngleich Marouty seines vor längerer Zeit begangenen Fehltritts wegen in üblem Rufe bei seinen Nachbaren stand, so hielten sie es doch nicht für möglich, daß er ein so abscheulicher Bösewicht sein könne, um mit kaltem Blute diejenigen zu morden, welche seiner Familie Wohlthaten erwiesen hatten. Nach der Meinung der Bauern mußte er unbedingt wahnsinnig, sein entsetzliches Verbrechen nur eine Folge seiner augenblicklichen Geisteszerrüttung sein. Vielleicht – und wir wollen dies zu ihrer Ehre annehmen – war es eben nur diese bei ihnen plötzlich aufgetauchte Meinung, welche sie davon zurückhielt, dem bedrohten Schulmeister ihren Beistand angedeihen zu lassen, und sie vermochte, sich feige in ihre Wohnstätten zurückzuziehen. Unter anderen Umständen würde eine solche Feigheit auch durch nichts zu entschuldigen gewesen sein.
Der Einzige, der oben erwähnte Claus, welcher den redlichen Willen gezeigt hatte, dem bedrängten Barriere Beistand zu leisten, hatte, wie wir gesehen, bei seinen Gefährten keine Unterstützung gefunden, und da er nun, ohne diese zu handeln, nicht Muth genug besaß, zog er es daher ebenfalls vor, seine Person baldmöglichst in Sicherheit zu bringen. Somit blieb der unglückliche Schulmeister ganz auf sich selbst angewiesen, allein bei dem Leichnam seiner Gattin zurück. Er rief laut um Hilfe; aber sein verzweiflungsvolles Schreien blieb ohne Resultat; man vernahm es wohl, aber man wollte ihm nicht helfen. Einen Augenblick dachte er daran, aus dem Hause, das ihm keinen Schutz mehr zu gewähren schien, zu entfliehen; aber im nächsten Moment schon verwarf er diesen Gedanken wieder. Wohin auch sollte er sich flüchten, um sich vor dem Mörder zu verbergen? Dann fürchtete er auch, daß dieser vielleicht vor dem Hause Posto gefaßt habe, um ihn kaltblütig niederzuschießen, sobald er sich blicken lasse.
Es war finster in der Hütte; die Lampe war verlöscht, und nur die wenigen auf dem Herde noch glimmenden Holzscheite warfen von Zeit zu Zeit einen halb düstern, ungewissen Schein auf den Ort des Verbrechens. Ueber die Dielen rann das Blut der armen gemordeten Frau des unglücklichen Barriere, welcher verzweifelnd die Hände rang und unausgesetzt um Hilfe rief, sein Schreien bisweilen durch leises Schluchzen und Jammern unterbrechend. Die Thränen des Schmerzes um die theure Gefährtin seines Lebens, welche mehr denn 30 Jahre hindurch Freude und Leid mit ihm getheilt hatte und nun, von ruchloser Hand gemordet, kalt und leblos zu seinen Füßen lag, rannen dem alten Manne stromweiß über die Wangen; er besaß nicht einmal die Kraft, den Leichnam emporzuheben und auf das Bett zu legen. Um sicher zu sein, wagte er nicht die Lampe wieder anzuzünden, aus Furcht, der Mörder könnte durch den von außen wahrzunehmenden Lichtschein um so eher herbeigelockt werden. Auch die Thür war unverschlossen geblieben; Barriere hatte in seiner Angst vergessen, nach der jähen Flucht seiner Nachbaren den Riegel vorzuschieben.
So verstrichen fünfzehn entsetzliche, qualvolle Minuten, die dem unglücklichen Bewohner des Hauses eine Ewigkeit zu sein dünkten.
Endlich erschien, durch die verzweifelten Hilferufe des alten Mannes herbeigerufen, ein armes Mädchen, die achtzehnjährige Tochter des Gemeindehirten, welche in diesem Moment von einer häuslichen Angelegenheit, die sie in der benachbarten Stadt erledigt hatte, zurückkehrte. Vorsichtig öffnete das Mädchen die nur angelehnte Thür des Hauses und tastete sich, dem schwachen Scheine der glimmenden Holzscheite folgend, durch die Dunkelheit nach dem Herde hin, auf welchem sie die Lampe bemerkte, die sie sogleich anzündete. Sie fuhr entsetzt zurück, als sie die Blutlachen auf dem Fußboden und den Leichnam der alten Frau gewahrte, und vermochte einen halblauten Aufschrei nicht zu unterdrücken.
– Um aller Heiligen willen, stotterte sie schaudernd, was ist hier geschehen ... ein Mord ...
Dann, von einem plötzlichen Impuls getrieben, beugte sie sich hastig über den Leichnam.
Doch Barriere, welcher ihre Gedanken errathen haben mochte, schüttelte wehmüthig den Kopf und murmelte dumpf:
– Todt ... mein Gott ... mein Gott!
Und im Uebermaß seines Schmerzes bedeckte er schluchzend sein Antlitz mit den Händen.
Das junge Mädchen, tief erschüttert von diesem Schauspiel fragte nicht mehr. Schweigend bückte sie sich zu dem Körper der Gemordeten nieder, im Begriffe, denselben in ihre Arme zu nehmen und ihn auf das Bett zu tragen.
Da traf ein heftiger Knall ihr Ohr, es war ihr, als verschwände plötzlich der Boden unter ihren Füßen, sie wankte einen Moment und sank dann halb betäubt gegen die Mauer. Zugleich gewahrte sie, wie Barriere, zuerst mit den Händen in die Luft greifend, als suchte er nach einem Stützpunkte, dann aber lautlos, wie vom Schlage getroffen, neben dem Körper seiner Frau zusammenbrach.
Im nächsten Momente vernahm sie ein lautes, teuflisches Lachen, und aufblickend, bemerkte sie vor sich einen Mann stehen mit von Haß und Wuth gräßlich verzerrten Zügen, welcher sich kaltblütig auf den Kolben seiner langen Flinte stützte.
Das Mädchen vermochte, als sie ihn erblickte, einen Aufschrei nicht zu unterdrücken, sein Antlitz flößte ihr Grauen ein, und sie erbebte unwillkürlich, indem der Gedanke ihr Hirn durchzuckte, daß dieser abscheuliche Bösewicht auch sie tödten würde. Sie erkannte ihn nur zu gut; es war Marouty, der Dieb, welcher jetzt zum zweifachen Mörder geworden war und, mit seiner Rache nicht zufrieden, wahrscheinlich noch weitere Unthaten auszuführen beabsichtigte. Sein Verhalten sollte die Tochter des Gemeindehirten überzeugen, daß sie sich in ihren Voraussetzungen nicht getäuscht hatte.
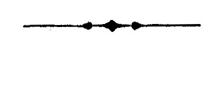
Marouty entfloh diesmal nicht von dem Schauplatze seines Verbrechens. Nachdem er sich einige Minuten an dem Schrecken des jungen Mädchens geweidet und dabei mit einem eigenthümlichen Blicke die schlanke Gestalt desselben betrachtet hatte, nahm er die Lampe in die Hand und beleuchtete kaltblütig die beiden Leichname. Sich auf diese Weise vergewissernd, daß die Opfer seiner Rache todt seien, nickte er befriedigt und murmelte mit satanischem Lachen:
– Sie sind kaput, alle Beide ... ich wußte, daß ich gut getroffen hatte; aber es fehlt noch einer, den ich bei ihnen wähnte, und der kurz zuvor noch hier gewesen sein muß. Er muß sich irgendwo im Hause versteckt halten, denn ich habe ihn nicht herauskommen gesehen. Nun, ich werde den Fuchs schon aus dem Loche zu treiben wissen, und wehe ihm dann, wenn er in meine Hände fällt!
Dann sich zu dem jungen Mädchen wendend, das in seiner Bestürzung keinen Versuch gemacht hatte, zu entfliehen, und seine Flucht auch schwerlich hätte bewerkstelligen können, da der Mörder ihm den Rückweg abgeschnitten hatte, sagte er:
– Wenn Dir Dein Leben lieb ist, Dirne, so entferne Dich sogleich, aber ohne jedes Geräusch, denn meine Rache ist noch nicht gestillt und ich habe hier noch etwas zu thun. Wenn Du zu schweigen verstehst, werde ich Dir nichts zu Leide thun, wo nicht, sollst Du nicht wünschen, mit mir Bekanntschaft gemacht zu haben. Marsch, packe Dich also oder ...
Er erhob bei seinen letzten Worten drohend die Flinte und legte sie auf das Mädchen an.
Die also Bedrohte wartete die Ausführung seiner Drohung nicht ab, sondern machte einen Schritt nach der Thür, welche der Mörder freigegeben hatte. In der Angst und Eile jedoch, mit welcher sie ihre Flucht bewerkstelligte, warf sie die Lampe um, die Marouty auf einen unweit der Thür stehenden Schemel gestellt hatte, und die Lampe verlöschte.
– Hölle und Teufel! ... Ungeschicktes Ding! fluchte der Mörder.
Dann mit einem plötzlichen rohen Auflachen fügte er schnell hinzu, die Worte in kurzen Intervallen hervorstoßend:
– Indessen ... wozu auch Licht? ... Du hast Recht ... das läßt sich allenfalls auch im Finstern erledigen ...
Was nun geschah, ist so gräßlich, daß wir zur Ehre der Menschheit an der Wahrheit zweifeln möchten, wenn wir es könnten; leider aber sprechen die Akten, in welchen die unter brennenden Thränen der Scham abgegebene Aussage der Tochter des Gemeindehirten verzeichnet steht, es klar und unwiderleglich aus. Zu den Dämonen der Rachsucht und Mordlust, die in Maroutys Herzen erwacht waren, hatte sich noch ein anderer, nicht minder fluchwürdiger und verdammenswerther gesellt. Ein einziger Blick war hinreichend gewesen, den schändlichen Bösewicht erkennen zu lassen, daß die vor ihm Stehende jung und nicht eben häßlich sei, und dieser eine Blick hatte genügt, über das Schicksal des jungen Mädchens zu entscheiden. Kaum hatte dieses Letztere nämlich einen Schritt nach der Thür gemacht, als es sich von hinten umfaßt fühlte.
– So leichten Kaufes, mein hübsches Püppchen, sollst Du mir doch nicht entkommen, höhnte der Bösewicht. Wir müssen die Bekanntschaft, die wir unter so eigenthümlichen Umständen gemacht, doch ein wenig feierlicher begehen.
Die Angst und Verzweiflung und die jungfräuliche Scham verliehen der Unglücklichen Riesenkräfte. Mit einer fast übermenschlichen Anstrengung gelang es ihr, den Räuber von sich abzuschütteln. Dieser, welcher auf einen derartigen kräftigen Widerstand nicht vorbereitet gewesen war, taumelte seitwärts und stürzte, über einen ihm im Wege stehenden Schemel stolpernd, zu Boden. Trotzdem wurde es ihm möglich, das in seiner Hand befindliche Pistol auf das Mädchen zu entladen. Glücklicherweise verfehlte die Kugel ihr Ziel infolge einer Wendung, welche das Mädchen gemacht hatte, und dieses wurde nur unbedeutend an der Wange und am Ohre verletzt. Ihre Haare, die Mütze, welche sie trug, und ein Theil ihres Antlitzes wurden von dem Pulver versengt, sie selbst aber, entkam glücklich dem Bereich des Mörders.

Ganz außer Athem langte die Tochter des Gemeindehirten bei ihrem Vater an. Dieser war um ihr verspätetes Ausbleiben bereits in großer Sorge gewesen, hatte mehrmals seine Hütte verlassen, um nach ihr auszuschauen, und just in dem Moment als sie erschien, sich selbst auf den Weg machen wollen, um nach ihrem Verbleib zu forschen. Er wußte noch nichts von den durch Marouty begangenen Mordthaten und erhielt erst Nachricht von diesen durch das Mädchen, welches ihm mit fliegendem Athem, von Scham und Entrüstung gerötheten Wangen und mit häufig von Schluchzen unterbrochener Stimme erzählte, wie es ihr nur mit Aufbietung aller ihrer Kräfte gelungen war, der ihr drohenden Gefahr zu entkommen.
Der muthige und über den auf sein geliebtes Kind vollführten Angriff furchtbar aufgeregte Mann machte sich sogleich trotz der Bitten der Tochter, die ihn beschwor, sein Leben nicht dem Wüthenden Preis zu geben, auf, den schändlichen Mörder zu verfolgen. Aber die Nachbaren, die er um Beistand anging, verweigerten ihm die erbetene Hilfe unter dem Vorgeben, daß sie nicht Lust hätten, sich der Wuth eines Wahnsinnigen auszusetzen.
– Ei, so schießt ihn doch nieder wie einen tollen Hund, erwiderte man ihm, wenn es Euch so sehr darum zu thun ist, mit den Gesetzen in Konflikt zu kommen. Ihr wißt wohl, daß Ihr dies nicht dürft, und daß Ihr nur von dem Recht der Nothwehr Gebrauch machen dürft, wenn Ihr der Angegriffene seid und Euer Leben in Gefahr steht. Uns aber laßt aus dem Spiel; wir wollen nicht dieses Wahnsinnigen wegen obendrein mit den Strafgesetzen Bekanntschaft machen.
– Und übrigens, bemerkte ein anderer Bauer, muß seine Wuth bald verraucht sein. Wir werden diesen Zeitpunkt ruhig erwarten und dann zusehen, daß wir den Verrückten lebendig fangen und unschädlich machen können.
– Feiglinge! murmelte der Gemeindehirt vor sich hin und wandte den Bauern den Rücken.
Einen Moment dachte er daran, allein den Kampf mit dem Bösewicht aufzunehmen, aber er verwarf diesen Gedanken als unausführbar bald wieder. Nur zu gut wußte er, daß die Bauern Recht hatten mit ihrer Behauptung, das Gesetz entschuldige nur den Fall der Nothwehr, aber es gestatte nicht, seinen Angreifer kaltblütig niederzuschießen, selbst wenn dieser, wie im vorliegenden Falle, ein zweifacher Mörder war. Das Gesetz verlangt eine Sühne, aber dieser Sühne muß ein Urtheil vorhergehen, und nicht jeder erste Beste sei berechtigt, dieses Urtheil an dem Schuldigen zu vollstrecken.
– Nun gut, sprach der entschlossene Hirte nach einigem Nachsinnen für sich, wenn mir die erbetene Hilfe auch hier nicht zugestanden worden, so ist damit noch nicht gesagt, daß ich sie nicht anderswo finden kann. Die drüben in Blancbois zeigen sich vielleicht bereitwilliger, ich werde mich also dorthin begeben, denn den entsetzlichen Unthaten dieses Bösewichts, den ich durchaus nicht für einen Verrückten halten kann, muß unter allen Umständen ein Ende gemacht werden.
Jerome Latour kehrte, dies sprechend, in seine Wohnung zurück, um seine Tochter zu beruhigen und sie von seinem Vorhaben in Kenntniß zu setzen, damit sie sich, falls er länger ausbliebe, nicht unnöthig ängstigen möchte. Dann machte er sich auf den Weg nach Blancbois. Daß auch dieses Unternehmen sich als ein vergebliches ausweisen würde, davon sollte er sich binnen wenigen Minuten durch den Augenschein überzeugen, zugleich aber auch inne werden, daß er sich hinsichtlich Maroutys, welchen er für vollkommen zurechnungsfähig erachtete, nicht getäuscht hatte.
Wir haben oben erwähnt, daß auf der linken Seite von la Grange das Flüßchen Tardoire die Grenze zwischen diesem und dem Nachbardorfe Blancbois bildet. Gegenwärtig führt an dieser Stelle eine solid gebaute, hölzerne Brücke über die Tardoire; zur Zeit unserer Erzählung aber existirte dieser bequeme Uebergang noch nicht, letzterer wurde vielmehr durch einen aus nebeneinandergelegten Baumstämmen gebildeten, kaum zwei Meter breiten Steg bewerkstelligt. Auch bediente man sich von Blancbois aus einer Fähre – die Bewohner von la Grange hatten es noch nicht zum eigenen Besitz einer solchen gebracht – nur von dem jenseitigen nach dem diesseitigen Ufer zu gelangen, oder um den Transport von Gegenständen von dem einen Dorfe nach dem andern zu veranlassen.
Man konnte jedoch von la Grange nach Blancbois und umgekehrt von dem letztern Dorfe nach dem ersteren noch auf eine andere Weise gelangen, freilich nur durch einen Mehraufwand von Zeit, welcher sich aus etwa 6 bis 7 Stunden bezifferte. Dieser Weg führte durch den auf der rechten Seite von la Grange belegenen Wald über das Städtchen Chalus und dann in entgegengesetzter Richtung durch das Kirchdorf Limoges, welches letztere von Blancbois fünf Kilometer entfernt lag. Dieser Weg wurde allerdings nur von solchen Personen benutzt, denen es auf einen Zeitverlust bei ihren Wanderungen nicht ankam oder denen es um einen Spaziergang in der frischen Waldesluft zu thun war. Die Bauern bedienten sich dieser Passage fast niemals oder doch nur dann, wenn sie durch irgend einen Umstand gezwungen wurden.
Während der die Grenzscheide zwischen diesen beiden Zwillingsdörfern bildende Fluß Tardoire im Sommer kaum zwei, höchstens drei Fuß Wasser hatte und daher ohne Gefahr durchwatet werden konnte, erreichte er im Frühjahr, wenn der Schnee auf dem Gebirge zu schmelzen begann, durch die von den Bergen herabströmenden Wassermassen bisweilen eine Tiefe von vier Metern und darüber; er trat dann häufig aus seinen Ufern und überschwemmte das ihm zunächst liegende Plateau. Bei solchen Gelegenheiten pflegte es sich wohl zu ereignen, daß der bei la Grange über die Tardoire führende Steg von den Fluthen fortgerissen wurde. Doch war dies nur dann und wann geschehen und seit den letzten drei Jahren, nachdem man dem Steg einen festeren Halt gegeben hatte, der ihn fähig machte, dem Anprall des Wassers Widerstand zu leisten, nicht vorgekommen.
Schon mehrmals hatte der Maire von Blancbois und la Grange die Bauern auf den Nutzen hingewiesen, welchen eine feste Holzbrücke gegenüber einem schwachen und gefährlich zu passirenden Weidenstege gewähren würde. Jene, hatte er ihnen eindringlich gesagt, würde dem Anstürmen der Fluthen kräftig Trotz bieten und zu allen Jahreszeiten einen sichern Uebergang von einem Dorfe zum andern darstellen, während der haltlose, rohe Weidensteg allen Launen des Wassers ausgesetzt und von problematischer Existenz sei und nicht die geringste Sicherheit gegen etwaige Unglücksfälle zu bieten vermöge, ja das Vorkommen von solchen überhaupt beschleunige. Die Bauern anerkannten allerdings die Vortheile, von welchen ihnen der Maire sprach, und sie würden auch sicherlich dem Bau der betreffenden Brücke keine Schwierigkeiten entgegengesetzt, sondern ihn vielmehr mit Freuden begrüßt haben – wenn ihnen nicht zugemuthet worden wäre, die Kosten desselben aus ihrer Tasche zu bestreiten. Da sie nun dies nicht mochten, hatte auch der Vorschlag des Maire keinen Anklang bei ihnen gefunden. Wenn es nun dann und wann vorgekommen, daß der bewußte Steg von den Fluthen fortgeschwemmt worden war und auch der Fährmann seine Schuldigkeit zu versäumen beliebte, so wußte man sich eben, wenn auch innerlich grollend, in das Unvermeidliche zu schicken: man wartete entweder so lange bis ein neuer Steg gezimmert worden, oder wem dies zu lange währte, der machte den Umweg über Chalus, um von hüben nach drüben oder umgekehrt zu gelangen.
Als nun der Gemeindehirt, um sich nach Blancbois zu begeben, an der Uebergangsstelle anlangte, wollte er seinen Augen nicht trauen und glaubte anfangs, daß er in der herrschenden Dunkelheit den Weg verfehlt habe. Aus diesem Grunde ging er einige Male am Ufer eine Strecke auf und ab, hoffend, den bekannten Uebergangssteg zu entdecken. Allein bald überzeugte er sich, daß all sein Suchen ein vergebliches sei, und er den Steg auch niemals finden würde, weil derselbe eben nicht mehr existirte.
– Alle Teufel! rief er ingrimmig. Was ist das? Der Steg ist fort! Sollten ihn die Fluthen fortgeschwemmt haben? Aber nein, das ist unmöglich! Wir haben weder einen Sturm gehabt, noch ist der Fluß so hoch gestiegen, daß er die Stämme hätte erreichen können. Hier ist eine Menschenhand im Spiele gewesen, es kann nicht anders sein! Kein Anderer als Marouty hat dieses neue Verbrechen ausgeführt. Es ist kein Zweifel möglich!
Und in der That, es war wie Latour vermuthete. Der mit außergewöhnlichen Kräften begabte Bösewicht hatte, um seinen scheußlichen Racheakt möglichst ungestört ausführen zu können, die Baumstämme, welche den Steg bildeten, auseinander getrennt und sie dann einzeln den Wellen des Flusses überlassen, welcher dieselben fortführte. Marouty hatte sein Zerstörungswerk in zweifacher Absicht gethan, einmal deshalb, um Renaud, welchen er zu den Barrieres hatte gehen gesehen, den Rückweg nach Blancbois abzuschneiden, dann aber auch, um zu vereiteln, daß die Bewohner von Blancbois von denen von La Grange zu Hilfe gerufen werden könnten, falls es diese letzteren gelüstete, ihn in seinem Rachewerk zu stören, respektive ihn selbst zu verfolgen. Er hatte sich dabei insofern verrechnet, als Renaud den verhängnißvollen Steg gerade kurz vor dem Momente passirte, als Marouty denselben zerstörte.
Der Hirt war, nachdem er eingesehen, daß es unmöglich sei, auf dem kürzesten Wege nach dem Nachbardorfe zu gelangen, einige Minuten, in Nachdenken versunken, stehen geblieben.
– Ich sehe ein, murmelte er düster vor sich hin, daß ich diesem Bösewicht gegenüber ohnmächtig bin und mir nichts Anderes übrig bleibt, als wie die Nachbarn unthätig seinen Verbrechen zuzusehen. Wer weiß, wieviel Unheil noch hätte verhütet werden können, wenn die Bauern dem Rathe des Maire gefolgt wären und anstatt dieses elenden Steges zum Bau einer festen Brücke geschritten sein würden. Mindestens aber wäre es mir doch möglich gewesen, die Nachbarn von drüben zur Hilfe zu rufen und den Halunken unschädlich zu machen.
Mit einem tiefen Seufzer wandte sich Jerome Latour zum Rückweg nach seiner Wohnung.
Auch während der folgenden Stunden wagte keiner der Bauern, sein Haus zu verlassen, und der Mörder blieb Herr im Dorfe.
Im selben Momente, als der Hirt seine Wohnung erreichte, gewahrte er plötzlich einen hellen Schein unfern des Waldes. Gleich darauf schoß eine mächtige Feuersäule an jener Stelle empor: Marouty hatte das Haus der von ihm hinterlistig gemordeten Opfer seiner Rachsucht angezündet und stand kaltblütig mit der Flinte in der Hand daneben, das Zerstörungswerk des Elementes überwachend, damit Niemand einen Versuch mache, das Feuer zu löschen. Seine Vorsicht war überflüssig, denn die feigen Bauern wagten weder sich dem brennenden Gebäude zu nähern, noch überhaupt ihre Wohnungen zu verlassen, noch auf den Mörder zu schießen. Dieser schaute mit satanischer Freude zu, wie Balken auf Balken zusammenstürzte und die Funken umherflogen. Er selbst schien gefeit zu sein gegen das Feuer; denn während rings um ihn die Flammen, feurigen Schlangen gleich, emporzüngelten und ein Regen von Funken auf ihn niederstürzte, blieb er doch unversehrt.
Bald hatten die Flammen auch die übrigen Gebäude ergriffen; in den Ställen flatterten die Hühner, ängstlich schreiend, hin und her; mit dem Knistern und Prasseln des Feuers, dem dumpfen Zusammenstürzen des brennenden Gebälks mischte sich das Brüllen der Thiere in den Ställen: die beiden Pferde, zwei Ziegen, eine Kuh, ein Ochse und zwei Schweine, mußten rettungslos den Flammen zum Opfer fallen, wenn ihnen nicht schleunige Hilfe zu Theil wurde, und – der Bösewicht sorgte dafür, daß Niemand den Versuch machte, die unglücklichen Thiere zu retten. Dennoch gelang es einem Theil der geängstigten Thiere, sich einen Weg durch die Flammen zu bahnen. Der Ochse, von einem Feuerbrand getroffen und dadurch wüthend gemacht, riß sich von seiner Koppel los und durchbrach die brennende Stallthür; an dem ruchlosen Anstifter des Brandes vorüber, der fast um ein Haar von ihm umgerissen worden wäre, sich aber durch einen Seitensprung zu salviren wußte, stürzte das wüthende Thier durch das Dorf und nahm seinen Weg nach dem Flusse zu. Die Kuh, eine Ziege und ein Theil der Hühner und Gänse stürmten und flatterten brüllend, blökend, schreiend und schnatternd hinter dem die Freiheit ihnen eröffnenden Thiere her; die übrigen zwei- und vierbeinigen Bewohner der Ställe aber fanden den Tod in den Flammen.
Auf Momente entzog der dichte Rauch den Bauern, die unthätig aus den Fenstern ihrer Häuser dem schrecklichen Schauspiele zuschauten, die Gestalt des Mörders, welcher seinen übrigen Verbrechen nun noch ein neues, das der Brandstiftung zugefügt hatte; bald aber kam er wieder zum Vorschein. Die Zuschauer gewahrten, wie er seine lange Flinte wild um seinen Kopf schwang und sie dann plötzlich auf den Gemeindehirten, welcher, mit einem tüchtigen Knüttel bewaffnet, sich Marouty von hinten zu nähern gesucht hatte, anlegte und abdrückte. Der also Bedrohte, sein Vorhaben entdeckt sehend, suchte sein Heil in schleuniger Flucht und entkam glücklich der ihm bestimmten Kugel, welche dicht an seinem Ohre vorbeipfiff.
Er vernahm nur mehr einzelne abgerissene Worte von der Drohung, die ihm der Mörder nachrief, daß sich Niemand unterstehen solle, sich in seine Nähe zu wagen, wenn er nicht diese Kühnheit mit dem Leben bezahlen wolle.
Dann, nachdem er einen furchtbaren Fluch ausgestoßen und drohend die Faust hinter dem Entfliehenden und gegen die Bauern emporgehoben hatte, wandte er sich wieder den brennenden Gebäuden zu.
Der abermalige mißglückte Versuch, sich der Person des Bösewichts zu versichern, hatte die Bauern vollends eingeschüchtert; aus Furcht, daß es Marouty belieben könnte, aus purer Kurzweil dem einen oder andern eine Kugel zuzusenden, schlossen sie jetzt vorsichtshalber ihre Fenster, blieben jedoch, auf diese Weise vor einem etwaigen Schusse gedeckt, hinter dem geschlossenen Flügel stehen und fuhren fort, das verdammenswerthe Treiben Maroutys zu beobachten.
Dieser Letzterer blieb auch während der noch übrigen Nachtstunden Herr der Situation, von Niemandem gehindert; denn auch Jerome Latour hatte sich endlich – wüthend darüber, daß ihn die übrigen Bauern feig im Stiche ließen, und durch seinen Versuch belehrt, wie gefahrvoll und nutzlos es sei, den Kampf mit dem Mörder allein aufzunehmen – in seine Wohnung zurückgezogen. Als die Flammen ihr Zerstörungswerk vollendet hatten, und das Grundstück des ermordeten Ehepaares sammt den darauf befindlichen Gebäuden gänzlich niedergebrannt war, stieß Marouty ein wildes Triumphgeschrei aus, warf seine Flinte über die Schulter und verschwand im Dunkel des Waldes.

Begreiflicherweise war am nächsten Morgen das ganze Dorf schon frühzeitig auf den Beinen. Die meisten Bewohner desselben hatten während der Nacht kein Auge geschlossen und mit banger Sehnsucht den Anbruch des Tages erwartet, aus Furcht, daß Marouty seinen Racheakt noch weiter ausdehnen und auch ihre Wohnstätten in Brand stecken möchte.
Die Morgensonne beleuchtete mit ihrem milden, freundlichen Licht den Schauplatz des Verbrechens. Sie vermochte ihm nicht das Düstere, Traurige zu nehmen, was sich dem Anblicke darbot und Jeden, welcher dieses trübselige Gemälde betrachtete, unwillkürlich zur Wehmuth stimmen mußte, wenn er sich vergegenwärtigte, daß noch kurz zuvor an dieser Stelle ein hübsches, freundliches Häuschen gestanden, in welchem friedliche, harmlose Leute ein zufriedenes Dasein geführt hatten. Wohin das Auge schaute, erblickte es nichts als Schutt und Trümmer und verkohltes Gebälk; mit der klaren Luft des Frühlingsmorgens mischten sich einzelne Rauchsäulen, welche in kurzen Intervallen aus den Trümmern emporstiegen und vom frischen Morgenwinde weiter gewirbelt wurden, und mit diesem noch rauchenden und schwälenden Trümmerhaufen bildete die Brandstätte einen krassen Kontrast zu dem geschäftigen, warm pulsirenden Leben ringsumher.
Mit dem Anbruch des Tages war auch den Bewohnern von la Grange der Muth zurückgekehrt und sie begannen sich der während der Nacht bewiesenen Feigheit zu schämen. Was sie im Dunkel der ersteren nicht gewagt, den Mörder zu verfolgen und sich womöglich seiner Person zu versichern, das beschlossen sie jetzt, wo sie sich ungleich gesicherter glaubten, nachzuholen.
Wie war es nur denkbar gewesen, daß ein einzelner Mann ein ganzes Dorf in Furcht und Schrecken zu setzen vermochte, derart, daß man ihn schalten und walten ließ, wie es ihm beliebte? Die Feigheit der Bauern bleibt eben unbegreiflich und wird nur durch den Umstand motivirt, daß sie Marouty schlechterdings für plötzlich von Wahnsinn erfaßt hielten und seine Unthaten als durch diesen hervorgerufen erklärten. Der beschränkte Verstand der Bewohner von La Grange hatte es nicht zu begreifen vermocht, daß ein Mensch, welcher sich im Besitz seiner fünf Sinne befindet, im Stande wäre, mit kaltem Blute so ungeheuerliche verabscheuenswürdige Verbrechen auszuführen. Wenn nun auch einzelne in der Handlungsweise Maroutys hervortretende Momente, – wie die nach seiner Entlassung aus der Haft bei ihm offen sich kundgebende Menschenscheu und Verschlossenheit, seine Wildheit und die starre Konsequenz, mit welcher er bei Ausführung seiner Unthaten zu Werke ging, ja sein ganzes Gebahren bei den letzteren überhaupt – eine derartige Voraussetzung als einigermaßen gerechtfertigt erscheinen ließ, so sprechen doch hinwiederum das Planmäßige, mit welchem er von Verbrechen zu Verbrechen fortschritt, sowie die bis auf die Beobachtung des geringfügigsten, seine Rachepläne betreffenden Umstandes sich erstreckende Raffinirtheit, welche er bei seinen Verbrechen bekundete, dagegen, daß er nicht im Vollbesitze seiner geistigen Fähigkeiten sich befunden hätte. Diese beiden letztgenannten Eigenschaften waren es denn auch, welche den Bauern den Beweis liefern sollten, wie irrig ihre Vermuthung hinsichtlich Maroutys Geisteszustandes gewesen.
In größter Eile wurden nun alle Vorkehrungen getroffen, den entflohenen Verbrecher zu verfolgen, an welchem Unternehmen sich die erwachsene männliche Einwohnerschaft des ganzen Dorfes betheiligte. Die Verfolger theilten sich in zwei Trupps, von denen der eine unter Anführung des Gemeindehirten vorläufig das ganze Dorf absuchen und sich dann, falls dies resultatlos blieb, dem andern Trupp anschließen sollte, der, von Klaus geführt, den Wald zu observiren hatte. Daß man auf die Hilfe der Nachbaren vom jenseitigen Ufer in Folge der gestörten Kommunikation nicht rechnen durfte, wußte man bereits, man kümmerte sich auch nicht besonders darum; die vorher noch so feigen Dörfler waren mit einem Male so kurragirt geworden, daß sie behaupteten, sie wären ihrer genug, um den Verbrecher zu fangen, und bedürften keines fremden Beistandes. Demgemäß setzte sich jede der beiden Abteilungen in Bewegung.
– Wenn Marouty sich überhaupt noch im Dorfe versteckt hält, kalkulirte der Gemeindehirt, so kann er nur in seinem eigenen Hause sein. Obwohl ich auch daran zweifle, kann es doch nicht schaden, wenn wir dort nachforschen.
Man begab sich also nach dem gedachten Hause. Zu seinem Erstaunen fand Jerome Latour die vor den Fenstern desselben befindlichen Laden, trotzdem es bereits in der siebenten Morgenstunde war, noch fest verschlossen. Das Gleiche erwies sich bei der Thür.
– Alle Wetter! sagte der Hirt stirnrunzelnd. Das scheint mir verdächtig. Entweder hat sich der Bursche in der That hierhin zurückgezogen und sich verschanzt, und dann können wir uns auf einen harten Kampf mit ihm gefaßt machen, oder ...
Er sprach den Gedanken nicht aus, der momentan in ihm aufgestiegen war, sondern näherte sich möglichst geräuschlos dem einen der Fenster und versuchte durch eine in dem Laden desselben angebrachte kleine Oeffnung in das Innere der Wohnung zu blicken. Allein die in dem Raume herrschende Finsterniß war so dicht, daß Latour nichts zu erkennen vermochte. Dennoch aber blieb er lauschend stehen, und seinen Leuten durch eine Geberde bedeutend, sich ruhig zu verhalten, legte er sein Ohr dicht an die Spalte des Fensterladens. Es war ihm, als ob er einen leisen Schmerzenslaut, welcher wie ein Stöhnen klang, vernommen hätte.
Die Worte ihres Anführers, wie überhaupt sein ganzes Gebahren waren auf die Bauern nicht ohne Eindruck geblieben. Ihre Mienen hatten einen fast ängstlichen Ausdruck angenommen und der eine drängte sich dicht an den Andern. Sie vermutheten irgend eine ihnen drohende Gefahr und blickten bald scheu nach dieser, bald nach jener Richtung, bald furchtsam auf ihren Anführer. Ihr noch soeben im Aufflammen begriffen gewesener Muth schien doch schon bedenklich herabgemindert zu sein.
Es scheint in der That so zu sein, wie ich vermuthete, murmelte Jerome Latour, indem er vom Fenster zurücktrat. Indessen kann man diesem Bösewicht gegenüber nicht vorsichtig genug sein. Treffen wir also unsere Vorkehrungen.
Nachdem er dann seine Gefährten ersucht hatte, das Haus zu umstellen, fügte er hinzu:
– Ich werde sehen, daß ich hineingelange. Ihr bleibt während dessen vor dem Hause. Solltet ihr jedoch einen Pfiff oder gar einen Schrei von mir vernehmen, dann werdet ihr ja wissen, was ihr zu thun habt.
Daß sein Vorhaben leichter ausgesprochen als auszuführen war, davon sollte er bald Gelegenheit haben sich zu überzeugen. Er hatte sich nach seinen Worten rasch der Thür genähert, und nachdem er sich vergewissert, daß er sie nicht zu öffnen vermochte, schlug er mit seinem Knotenstocke gegen die Füllung und schrie:
– Oeffnet, Marouty! Oeffnet, oder wir schlagen die Thür ein!
Keine Antwort erfolgte. Nur war es ihm, als ob er abermals ein dumpfes Stöhnen vernähme, ähnlich jenem, das wenige Minuten zuvor, als er lauschend am Fenster gestanden, an sein Ohr gedrungen war.
Der beherzte Mann erbleichte einen Moment, doch nicht aus Angst, sondern vor Abscheu: – er fürchtete einem neuen Verbrechen auf der Spur zu sein. Dann aber suchte er sich einzureden, daß er sich getäuscht haben, oder daß jenes Stöhnen möglicherweise eine List des Mörders sein könne, zu dem Zwecke veranlaßt, seine Verfolger in eine Falle zu locken.
Nachdem er einige Minuten hatte verstreichen lassen, wiederholte der Hirt seine Aufforderung. Als auch diese wirkungslos blieb, stemmte er sich mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft gegen die Thür. Umsonst, sie wankte zwar in ihren Angeln, doch sie wich nicht, und erst als einige von den Bauern, seine Anstrengungen gewahrend, hinzusprangen und ihn kräftig unterstützten, gab die Thür nach und brach zusammen.
Den derben Knittel, mit welchem er sich bewaffnet hatte, um seinen Kopf schwingend, trat Latour jetzt muthig in den noch halbdunkeln Raum und schrie:
– Kommt hervor aus Eurem Versteck, Marouty, oder ich schieße!
Diese Drohung brauchte der Hirt nur zu dem Zwecke, um den Bösewicht zu schrecken, denn kein einziger aus dem Trupp war mit einer Schußwaffe versehen, vielmehr hatten sie zur Hand genommen, was sie eben zu finden vermochten, und sie waren demgemäß theils mit Knotenstöcken, theils mit Harken oder Dreschflegeln bewaffnet. Nur zwei oder drei von Maroutys Verfolgern befanden sich im Besitz einer Flinte oder eines Pistols, und diese waren bei dem zweiten Trupp betheiligt.
Die Antwort, welche Jerome Latour zu Theil wurde, bestand in jenem unartikulirten, einem Stöhnen ähnlichen Laut, den er nun schon zweimal vernommen hatte.
– Immer dieser Ton! schrie der Hirt heftig. Mort de Dieu! Was geht denn hier vor?!
Eine Ahnung von etwas Furchtbarem durchzuckte ihn blitzschnell – derselbe Gedanke, dem er vorhin keine Worte geliehen hatte.
– Großer Gott! murmelte er vor sich hin. Der Elende hat sein Weib und seine Kinder ermordet!
Dann sich zu seinen Gefährten umwendend, welche ängstlich auf der Schwelle stehen geblieben waren und wohl fürchten mochten, daß Marouty irgendwo im Gemache versteckt sein könne und nur die Gelegenheit erspähe, sie der Reihe nach niederzuschießen, rief er:
– Schafft Licht! Oeffnet die Fensterladen! Man kann ja hier kaum die Hand vor Augen sehen! Es wird Zeit, daß wir endlich erfahren, was wir hier zu fürchten haben!
Und zu sich selbst sprechend, fügte er leise hinzu:
– Gott gebe, daß wir nicht Zeugen einer neuen Unthat werden!

Als das Licht der Morgensonne hell und klar in das Gemach drang, erblickte Jerome Latour im Hintergrunde auf einem ärmlichen Lager die Gattin Maroutys. Dieselbe war an Händen und Füßen gebunden, derart, daß sie weder eine Bewegung zu machen, noch sich emporzurichten vermochte. Um sie am Schreien zu verhindern, hatte der brutale Gatte ihr einen Knebel in den Mund gesteckt.
Nachdem der Hirt die Unglückliche befreit, berichtete ihm diese, daß Marouty sie am vergangenen Abend, als sie die beiden Kinder in der benachbarten Kammer zu Bett gebracht, plötzlich überfallen hatte. Im ersten Augenblicke hatte sie geglaubt, daß er tobsüchtig geworden sei, und sie habe sich heftig zur Wehre gesetzt; dennoch aber sei sie schließlich von ihm überwältigt und in der beschriebenen Weise gefesselt worden. Darauf hatte er ihr mitgetheilt, daß er jetzt an die Ausführung seiner Rache gehen und denjenigen, welche die Schuld daran trügen, daß er so lange Zeit im Gefängnisse habe zubringen müssen, den Garaus machen werde. Er habe vor Gericht geschworen, daß er seine Ehre nicht ungestraft brandmarken lasse, und diesen Schwur werde er halten, sollte es auch sein Leben kosten. Die Gelegenheit habe ihm nur gefehlt; jetzt aber sei diese gekommen, und er würde ein Narr sein, wenn er sie unbenutzt vorübergehen lasse. »Wenn Du eine vernünftige Frau wärst,« hatte er gesagt, »würde ich Dir die Freiheit lassen; ich müßte jedoch fürchten, daß Du mich verrathen und meine Rache vereiteln würdest. Besser wäre es freilich, ich schickte Dich den Anderen voran; aber ich will Dir um der Kinder willen das Leben schenken, und auch deshalb, weil Du eigentlich nicht schuld bist an meinem Unglück. Du hast nun genügend Zeit, darüber nachzudenken, in welcher Weise Du Dein künftiges Leben einrichten willst; denn Du kannst fortan – wenn anders meine Rache gelingt, und sie muß und wird gelingen – nicht mehr auf die Unterstützung Deiner Freunde rechnen. Was mich betrifft, so werden wir uns wohl schwerlich jemals wieder zu Gesicht bekommen. Leb also wohl, mein Schätzchen, und laß Dir die Zeit nicht lang werden.
Dann hatte er sie, laut auflachend, verlassen, und sie hatte gehört, wie er zuerst die Fensterladen und dann die Thür verschlossen. Seitdem hätte sie ihn nicht wiedergesehen. Nach seiner Entfernung habe sie mehrfach Versuche gemacht, sich zu befreien; aber alle ihre Anstrengungen seien erfolglos gewesen. Bald nachher hatte sie die Kinder weinen gehört, doch nur kurze Zeit, dann waren sie ruhig geworden, vielleicht wieder eingeschlafen. Sie hätte ohne Unterlaß zu dem Allmächtigen gebeten, daß er das abscheuliche Vorhaben ihres entmenschten Gatten nicht gelingen lassen möge, bis ihre Sinne sich verwirrt hatten und sich ihrer eine Art Betäubung bemächtigt habe. Sie sei erst wieder zum vollen Bewußtsein ihrer geistigen Fähigkeiten gelangt, als sie Stimmen außerhalb ihrer Hütte vernommen und man angefangen habe, die Thür derselben einzuschlagen, das sei Alles, was sie auszusagen vermöge.
Schweigend hatte Jerome Latour diesen Bericht der jungen Frau angehört, denselben nur hin und wieder durch eine Geberde des Abscheus oder des Schauders unterbrechend. Als sie geendet, konnte er sich nicht enthalten, in die Worte auszubrechen:
– Gottes Tod! dieses Scheusal verdient, daß ihm Stück für Stück die Glieder vom Leibe gerissen würden!
Dann, sich halb nach seinen Gefährten umwendend und sie mit einem halb verächtlichen, halb spöttischen Blick streifend, sagte er:
– Nun, Ihr habt gehört, was dieses arme Weib erzählt hat; seid Ihr noch so verblendet, Marouty für einen Wahnsinnigen zu halten?!
Die Bauern antworteten nicht, sondern ließen wie beschämt das Haupt sinken.
Die junge Frau, angstvoll den Blick auf ihren Befreier heftend, fragte mit zitternder Stimme:
– Und ... hat mein verworfener ... Mann seine ... schreckliche Drohung ...
Sie war nicht im Stande, das Furchtbare auszusprechen, die Worte wollten nicht über ihre Lippen; sie hegte noch eine schwache Hoffnung; leider vergebens.
Der Hirt blieb stumm, blickte nur düster zu Boden. Es war ihm unmöglich, diese unglückliche Frau von dem Geschehenen zu unterrichten. Wozu auch? Verschwiegen konnte es ihr ja doch nicht bleiben, der Augenschein würde sie es lehren, sobald sie nur ihre Hütte verließ und in das Dorf hinabging. Aber er, Jerome Latour, er wenigstens wollte doch nicht der Erste sein, der ihr die furchtbare Botschaft mittheilte.
Seine düstere Miene, sein Schweigen waren indeß deutlich genug. Sie errieth, was sie zu denken nicht gewagt hatte. Mit einem dumpfen Wehlaut sank sie auf ihr Lager zurück, das von Thränen geröthete Antlitz mit den Händen bedeckend.
So war denn das Entsetzliche geschehen; ihr Gatte hatte seiner Rachsucht Genüge gethan, und sie hatte die Armen, die ihre Wohlthäter gewesen, die sie selbst und ihre Kinder vor dem Hungertode geschützt, nicht retten können! Furchtbarer, qualvoller Gedanke! Sie fühlte sich mitschuldig, die Unglückliche, mitschuldig an dem ungeheuern Verbrechen ihres entmenschten Gatten. Und doch, wie hätte sie es denn verhindern sollen? Hatte sie denn zuvor irgend welche Kunde gehabt von dem Gräßlichen, was ihr Gatte seit Langem schon geplant haben mußte? Nein, auch nicht die leiseste Ahnung; sie konnte diese Frage mit ruhigem Gewissen verneinen. Er hatte ihr gegenüber nicht die geringste Andeutung gemacht, ja, ihren Verdacht, daß er gegen Barriere etwas Böses im Schilde führe, sogar einzuschläfern verstanden, indem er vor einigen Tagen – als eines der Kinder zufällig in seinem kindlichen Geplauder die Mutter gefragt, »ob denn die gute Tante Barriere bald wiederkomme« – zu ihr geäußert hatte, er anerkenne es, daß sie (die Barrieres) sich gut gegen seine Familie benommen hätten. Er sei ihnen auch gar nicht mehr böse, sähe sogar ein, daß er ihnen Dank schuldig wäre, und sie dürfe versichert sein, daß er sich allen Ernstes bemühen würde, diesen Dank bald abzutragen. Nur auf Renaud habe er noch einen Wurm, doch er denke auch mit diesem noch fertig zu werden. Sie hätte freilich seinen Worten nicht so obenhin Glauben beimessen sollen; aber er hatte mit so treuherziger Miene und in so freundlichem Tone zu ihr gesprochen, daß sie an der Wahrhaftigkeit nicht zu zweifeln vermocht.
– O Jean, hatte sie da in gerührtem Ton und mit freudestrahlenden Augen ausgerufen, Du weißt nicht, welche Last Du mir vom Herzen nimmst, und wie ich mich über Deine Worte freue! Du hast mich wirklich recht, recht angenehm überrascht dadurch, daß ich sehe, daß es Dir mit Deinem guten Vorhaben ernst ist. Gott sei Dank, nun wird Alles wieder gut werden, und wir glücklich sein.
– Ob mein Vorhaben ein gutes ist, wollen wir dahingestellt sein lassen. Die Welt hat vielleicht eine andere Ansicht darüber, hatte er ihr lachend erwidert. Daß es mir ernst ist mit dem, was ich gesagt habe, wirst Du ja nächstens sehen. Barrieres werden bald Gelegenheit haben, sich von meiner Dankbarkeit zu überzeugen, und auch dafür werde ich sorgen, daß Renaud mich nicht mehr eines Diebstahls beschuldigen kann.
– Und darf ich Barrieres mittheilen, wie Du jetzt über sie denkst, Jean? hatte sie dann freudig gesagt und er ihr, zwar etwas hastig, aber doch nicht unfreundlich geantwortet:
– Nein, auf keinen Fall! Du würdest mir nur den Spaß verderben.
– Gut, dann wird nachher die Ueberraschung um so größer sein.
– Das denke ich auch, hatte er lachend hinzugefügt und sich dabei vergnügt die Hände gerieben.
Und die Ueberraschung für die unglückliche Frau traf ein ... aber welch eine Ueberraschung! Eine schreckliche, gräßliche, leid- und schmerzvolle! So bitter, so entsetzlich, so unerhört war sie wohl nie in ihrem Leben enttäuscht worden! Daß ihr Gatte ein so raffinirter Heuchler sei, daß Alles, was er zu ihr vor wenigen Tagen gesprochen und worüber sie sich vom Grunde ihres Herzens gefreut hatte, nur die unerhörteste Verstellung, Lug und Trug gewesen, das hatte sie gestern Abend erfahren, nachdem er sie in einen hilflosen Zustand versetzt und es ihr unmöglich gemacht hatte, die von ihm Bedrohten zu warnen. Mit Blindheit mußte sie geschlagen gewesen sein, daß sie die Wahrheit nicht von der Lüge zu unterscheiden vermocht hatte, daß auch nicht das leiseste Mißtrauen in ihrem Herzen aufgedämmert war, daß sie seinen gleißnerischen Versicherungen Glauben geschenkt hatte; wie wäre es sonst möglich gewesen, daß sie, der der heimtückische, hinterlistige und rachsüchtige Charakter ihres Ehegatten doch genugsam bekannt sein mußte, sich auf eine so grobe Weise hatte täuschen lassen?! ... Als sie freilich ihre Thorheit erkannt, da hatte die unglückliche Frau zu Gott gefleht, daß er das Gräßliche nicht geschehen lassen möge, aber Gott hatte ihr Flehen nicht erhört zur Strafe für ihre Thorheit, und ihre Wohlthäter waren derselben zum Opfer gefallen. Wie geschmolzenes Blei fielen diese Vorwürfe, dem Gatten blindlings vertraut zu haben, auf ihre Seele. Eine schwere Sünde, eine Todsünde war es, welche sie begangen hatte, welche sie niemals zu sühnen vermöge, und die nimmer von ihr genommen werden würde. Immer und immer wieder mußte sie sich sagen, daß sie die Mitschuldige ihres verworfenen Gatten sei, daß sie in ihrem ganzen Leben niemals wieder ruhig sein könne; denn stets würde ihr die blutige Leiche ihres Wohlthäters vor Augen stehen. Und doch kannte sie noch nicht einmal das Schreckliche in seinem ganzen Umfange.
Indem diese Gedanken auf sie einstürmten und sie sich auf solche Weise selbst quälte und marterte, schluchzte die unglückliche junge Frau leise vor sich hin. Nur mit den Unthaten ihres Gatten sich beschäftigend, dachte sie in diesem Momente nicht an ihre Mutterpflicht, hatte sie ihrer Kinder ganz und gar vergessen, ihrer Kinder, welche ja auch die seinen waren, und welche einem verworfenen Bösewicht ihr Dasein verdankten. Erst die Worte ihres Befreiers entrissen die Aermste ihren Selbstquälereien und erinnerten sie an ihre Pflicht.
Angesichts des furchtbaren Seelenschmerzes, welcher sich so deutlich auf dem Antlitze der Unglücklichen aussprach, fühlte Jerome Latour tiefes Mitleid. Um sie einigermaßen zu beruhigen, sagte er ernst:
– Sie sind thöricht, wenn Sie sich Vorwürfe machen, liebe Frau. An dem, was Ihr Mann gethan hat, tragen Sie selbstverständlich nicht die leiseste Schuld. Es wird Niemandem einfallen, auch nur den Schatten eines Argwohns gegen Sie zu hegen, zumal wir Alle davon fest überzeugt sind, daß Sie das Geschehene verhindert haben würden, wenn dies in Ihrer Macht gelegen hätte. Was Ihren Mann betrifft, so wird die menschliche Gerechtigkeit ihn hoffentlich, wie er es verdient hat, zu strafen wissen. Sie sind indeß sein Weib nicht mehr, die von ihm begangenen Verbrechen haben jedes Band zwischen Ihnen und ihm zerrissen, und Sie selbst haben vorläufig an nichts Anderes zu denken als an Ihre Kinder ...
– Ach, meine Kinder ... meine armen Kinder! unterbrach ihn weinend die arme Mutter. Mein Gott, mein Gott, werde ich denn nicht immer, wenn ich sie sehe, an ihren verbrecherischen Vater denken müssen!
Dann, von einem Paroxismus tiefster Verzweiflung ergriffen, schrie sie fast gellend:
– Ha ... sie ... sie tragen seine verruchten Züge ... das Verbrechen erbt sich fort ... nein ... nein ... sie sind meine Kinder nicht mehr ... ich will ... ich kann sie nicht mehr sehen ... o, möchte Gott sie doch sterben lassen ... oder mich ... mich ... Allmächtiger, ich flehe Dich an ... tödte ... tödte sie und ... laß mich wahnsinnig werden ... damit ich sie ... sie nicht mehr sehe ...
Dem Hirten graute, als er diese irren, abgebrochenen Reden vernahm. Indem er auf die junge Frau blickte, vermochte er sich eines unwillkürlichen Schauders nicht zu erwehren. Sie glich fast in der That einer Wahnsinnigen, denn ihre Züge hatten sich konvulsivisch verzerrt und der Ausdruck ihrer Augen hatte etwas Eigenthümliches, Starres.
– Frau! rief Jerome Latour in strengem Ton. Wie könnt Ihr nur dergleichen Unsinn reden und Euch gegen Gott versündigen! Er hat Euch die Kinder gegeben, damit Ihr sie zu rechtschaffenen Menschen erziehen sollt. Das ist Eure heiligste Pflicht, und wenn ihr diese vernachlässigt, erst dann habt Ihr Euch Vorwürfe zu machen. Wohl ist Euch Schweres auferlegt worden von Gott, aber Ihr müßt es standhaft ertragen, damit die Sünden des Vaters nicht heimgesucht werden an den Kindern.
In diesem Moment ließ sich aus dem anstoßenden Raum das Geschrei einer Kinderstimme vernehmen.
Dieser Ton und vielleicht auch die eindringlichen Worte ihres Befreiers verfehlten ihre Wirkung auf die junge Frau nicht.
Mit einem leisen Aufschrei erhob sie sich von ihrem Lager und eilte in die Kammer zu dem Bettchen, auf welchem ihre beiden Kinder – ein Knabe von drei und ein Mädchen von zwei Jahren – ruhten. Sie umfaßte die beiden Kleinen und küßte und drückte sie unter heißen Thränen an ihr Herz.
– Ja, rief sie mit strahlenden Augen und mit dem Ausdruck reinster mütterlicher Zärtlichkeit in ihrem Antlitz, ja, Ihr werdet bei mir bleiben wie ich bei Euch, und ich will Euch zu guten Menschen erziehen, und Gott soll mich tausendfach strafen, wenn ich es nicht thue und meine Pflicht vergesse!
Der Hirt aber fuhr mit dem Aermel seiner Jacke über seine Augen, sie waren ihm feucht geworden. Im Bewußtsein, ein gutes Werk gethan zu haben, athmete er erleichtert auf; vielleicht hatte er durch seine Worte die Unglückliche vom Wahnsinn gerettet.
Dann, sich zu seinen Gefährten wendend, die stumm, aber teilnahmsvoll dieser Szene beigewohnt hatten, sagte er:
– Kommt, Leute, für uns giebt es hier nichts mehr zu thun, Ihr sehet, Derjenige, welchen wir zu finden wähnten, ist nicht hier, und wir müssen ihn anderswo suchen.
Die kleine Truppe eilte, sich der andern anzuschließen. Auch diese hatte über kein günstiges Resultat ihrer Nachforschungen zu berichten. Als sie am Flusse anlangte, hatte sie am Ufer desselben die Flinte Maroutys und seine Holzschuhe gefunden. Hatte er seinem Leben selber ein Ziel gesetzt und seinen Tod in den Wellen gesucht und gefunden? Nach dem Auffinden der betreffenden Gegenstände wie auch nach den Worten zu schließen, welche er am Abend vorher beim Abschied zu seiner Frau geäußert, ließ sich dies allerdings vermuthen. Oder hatte er nur eine List beabsichtigt, und wollte er seine Verfolger veranlassen, von ihrer Verfolgung abzustehen?
Indem die Bauern noch über den vorliegenden Fall berathschlagten und sich in Muthmaßungen ergingen, wurde vom jenseitigen Ufer die Fähre abgelassen, welche ihre Richtung nach La Grange nahm. In der Fähre befanden sich die beiden Dienstboten des ermordeten Ehepaares, die erst vor wenigen Minuten von ihrem Tanzvergnügen zurückgekehrt und, nicht wenig erstaunt, den Steg zerstört zu finden, gezwungen gewesen waren, sich der Fähre zu bedienen, um nach La Grange zu gelangen. Als die beiden jungen Leute die Nachricht von dem Geschehenen vernahmen, waren sie einem Moment wie vom Blitz getroffen; dann aber brachen sie in lautes Weheklagen, untermischt mit Verwünschungen gegen den Mörder und Brandstifter, aus.
– O mein lieber, guter Herr! O meine liebe, gute Frau! jammerten Beide einmal über das andere und weinten aufrichtige Thränen des Schmerzes und der Verzweiflung, denn sie hatten die Ermordeten wirklich geliebt, welche ihnen mehr Freund als Herrschaft gewesen waren.
Durch den zurückkehrenden Fährmann erhielten nun auch die Bewohner von Blancbois Kunde von den gräßlichen Ereignissen der vergangenen Nacht, welche natürlich das ganze Dorf in ungeheure Aufregung und Bestürzung versetzte. Seltsamerweise wollte man dort nichts von dem Feuer wahrgenommen haben, was sich vielleicht dadurch erklären läßt, daß das Grundstück des ermordeten Ehepaares durch den längs desselben sich hinziehenden Wald gedeckt wurde, und daß ferner der Wind die Flammen und den Rauch nach einer dem Nachbardorfe entgegengesetzten Richtung trieb. Was den Bewohnern von Blancbois indessen aufgefallen, war der Umstand, daß der nach dem Nachbardorfe führende Steg über Nacht plötzlich verschwunden war. Jedoch weit entfernt, die eigentliche Sachlage zu vermuthen, setzten sie das Verschwinden desselben vielmehr auf Rechnung eines jener elementaren Ereignisse wovon wir oben Erwähnung gethan haben.
Einige der Neugierigen von den Dörflern wollten sogleich nach La Grange hinüber, um den Schauplatz des Verbrechens in Augenschein zu nehmen. Der Fährmann jedoch, durch die die Polizei über beide Dörfer ausübenden Gensdarmen veranlaßt, verweigerte Jedem die Ueberfahrt mit dem Bemerken, daß er ohne spezielle Erlaubniß des Maire Niemanden seine Fähre betreten lassen dürfe. Mit diesem Bescheide mußte sich auch Renaud zufrieden geben. Derselbe, welchem das Geschehene mitgetheilt worden, hatte es anfangs nicht glauben wollen und war in der Absicht nach der Fährstelle geeilt, um sich ebenfalls nach dem Thatorte zu begeben und dort sich von der Wahrheit oder Unwahrheit des Gerüchtes zu überzeugen.
Unglücklicherweise war der Maire nicht in Blancbois anwesend. Derselbe hatte sich am Nachmittage des verflossenen Tages nach Chalus begeben, um seiner daselbst wohnenden verheiratheten Tochter, bei welcher ein freudiges Familienereigniß eingetreten war, einen Besuch abzustatten. Seine Rückkehr sollte erst am nächsten Abende erfolgen, so hatte er zu seinen Gensdarmen sich geäußert. Von diesem Vorhaben mußte Marouty jedenfalls Kunde erlangt haben, und dies hatte ihn bewogen, sich die Abwesenheit des Sicherheitsorgans zu Nutze zu machen und seine lange geplante Rache endlich zur Ausführung zu bringen. Er wußte, daß diese gelingen mußte, wenn Alles so eintraf, wie er es ausgeklügelt hatte, und kannte ferner seine Nachbarn zu gut, um nicht zu wissen, daß sie nicht wagen würden, ihm kräftigen Widerstand entgegen zu setzen. Er wußte endlich, daß infolge der durch die Abwesenheit des Maire unter den Bauern hervorgerufenen Rathlosigkeit und Unentschlossenheit er noch genügend Zeit haben würde, seine Flucht bewerkstelligen zu können, wenn anders er diese in der That beabsichtigte, um sich der Strafe für seine Verbrechen zu entziehen.
Der Zufall wollte es, daß der Maire früher, als er selbst geglaubt, von seinem Besuche zurückkehrte, und zwar traf er bereits um 10 Uhr Morgens in Blancbois wieder ein. Nachdem er von dem abscheulichen Verbrechen Kenntniß erhalten, begab er sich sogleich, von seinen Gendarmen und Renaud begleitet, nach der Brandstätte. Er ließ unter der Asche suchen, fand jedoch nur einige verbrannte Knochen. Dann machte auch er sich auf die Suche nach dem Mörder, ohne indeß zu einem Resultate zu gelangen. Die Voraussetzung, daß Marouty den Tod selbst gesucht und gefunden habe, schien sich bestätigen zu sollen; indessen als der Maire und der Instruktionsrichter den Fluß einer genaueren Observirung unterwarfen, entdeckten sie gleichwohl nichts, was einen Beweis für die Behauptung der Bauern geliefert hätte. Erst nach etwa vier Wochen fand man eines Tages in Blancbois einen gänzlich in Verwesung gerathenen männlichen Leichnam an das Land geschwemmt; ob derselbe jedoch der des Mörders und Brandstifters war, konnte mit Bestimmtheit nicht festgestellt werden.
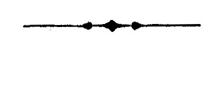
Ein Zeitraum von nahezu zehn Jahren liegt hinter jenen Ereignissen, welche wir in dem Vorhergegangenen der Wahrheit gemäß berichtet haben.
Während dieses Zeitraumes hatte sich in den beiden Dörfern La Grange und Blancbois Manches verändert. So war beispielsweise die durch Marouty bewirkte Zerstörung des von dem einen nach dem andern Dorfe führenden Kommunikationssteges die Veranlassung gewesen, daß die Bewohner beider Dörfer sich endlich zum Bau einer festen Brücke verstanden hatten. Dennoch war die Herstellung derselben erst auf wiederholtes ernstliches Drängen des Maire erfolgt, welcher die Bauern geradezu für Maroutys Unthaten verantwortlich gemacht und behauptet hatte, daß diese sicherlich nicht geschehen wären, wenn man schon damals seinen Rath befolgt hätte.
Von denjenigen Personen, welche Augenzeugen jener schrecklichen Verbrechen gewesen, waren einige inzwischen aus dem Leben geschieden, andere hatten ihren Wohnsitz gewechselt und waren nach der Stadt oder in ein anderes Dorf übergesiedelt. Zu den Letzteren gehörte die Wittwe des Mörders selbst. Diese hatte durch die Vermittelung des menschenfreundlichen Geistlichen ein Unterkommen als Haushälterin gefunden, und zwar bei einem in einem benachbarten Departement wohnenden Amtsbruder desselben, welcher sich zugleich erboten hatte, an den beiden Kindern der Unglücklichen Vaterstelle zu vertreten.
In La Grange und Blancbois dachte man kaum noch an das schreckliche Ereigniß; die Wenigen, die sich dessen erinnerten, vermieden geflissentlich, davon zu sprechen, vielleicht nur aus dem Grunde, weil sie wußten, wie wenig menschenfreundlich ihr damaliges Verhalten gewesen war, und weil sie sich ihrer dabei bewiesenen Feigheit schämen mochten.
Auf dem Platze, auf welchem einst das Grundstück des ermordeten Schulmeisters Barriere gestanden, erhob sich gegenwärtig ein solid gebautes Haus von zwei Stockwerken mit daran stoßendem Garten, Acker und Wiese, Stallgebäuden, Scheunen und dergleichen. Die Gebäude waren in mehr städtischem als ländlichem Stile angelegt und zeugten von vielem Geschmack. Auf dem Hofe des Bauerngutes tummelten sich in buntem Durcheinander Hühner, Enten und Gänse, Fasanen und Puter, auch spreizten zwei Pfauen ihr farbenreiches Gefieder, welche sämmtlich von zwei prächtigen Neufundländerhunden bisweilen hin und her gejagt wurden; in den Koben grunzten mehrere Schweine; in den Ställen wieherten Pferde, blöckten Rinder und Schafe. Kurz das Ganze war eine Musterwirthschaft im vollen Sinne des Wortes und wurde sicherlich von den minderbegüterten Bauern mit stillem Neid betrachtet.
Der glückliche Besitzer dieses umfangreichsten der Bauerngüter im ganzen Departement war der Vetter des ermordeten Ehepaares, Raould Renaud. Man durfte ihm wohl das Prädikat »glücklich« beilegen, denn er selbst behauptete, es zu sein, und weder seine wirthschaftlichen noch seine häuslichen Verhältnisse waren bisher durch irgend einen Schicksalsschlag getrübt worden. Indessen das Unglück pflegt oft nicht weit zu sein und gerade in dem Momente sich einzustellen, wenn wir es am wenigsten vermuthen und uns am glücklichsten dünken. Dann aber trifft es um so härter, und wir werden um so schmerzlicher und nachhaltiger davon berührt, als wir, sein Kommen nicht ahnend, gänzlich unvorbereitet und schutzlos ihm preisgegeben sind. Auch über das Haus Renaud sollte das Unglück seine schwarzen Fittiche breiten und der düstere Sohn desselben, der Schmerz, für eine Zeit lang darin seine unheimliche Herrschaft ausüben.
Renaud, welcher seit neun Jahren glücklicher Gatte und Familienvater war, hatte sich sechs Monate nach den obenerzählten Ereignissen mit der einzigen Tochter des Gemeindehirten, Marie Latour, verheirathet, und diese ihm im Laufe ihrer Ehe drei Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen geboren.
– Es muß wohl eine Heirath aus Liebe sein, hatten die Bauern unter sich geflüstert, als Renaud sein Weib heimführte, denn wie hätte er sich sonst so wegwerfen können und die Tochter unseres Gemeindehirten heirathen, die ja kaum ein Hemd auf dem Leibe ihr eigen nannte! Er hätte doch nur bei uns anfragen dürfen, und der Eine oder Andere von uns würde ihm mit Freuden seine Tochter gegeben haben und noch eine hübsche Mitgift dazu.
Wie wir gesehen, hatte Renaud Letzteres, was ihm seine Nachbarn diesseits und jenseits des Flusses mehr als einmal zu verstehen gegeben, nicht gemacht und war statt dessen seinem Herzen gefolgt. Das hübsche Kind Latours, welches dem Bösewicht Marouty gegenüber sich so muthig bewiesen und so tapfer für ihre jungfräuliche Ehre gekämpft, hatte es ihm angethan. Sie mußte sein Weib werden und sollte er ihretwegen, um sie zu erringen, auch sieben Jahre, wie Jakob um Lea, dienen müssen. Das hatte nun zwar weder ihr Vater noch sie selbst verlangt, dagegen auch nicht sogleich, wie man zu sagen pflegt, mit beiden Händen zugegriffen, – den fetten Bissen nicht entschlüpfen zu lassen, sondern, als er ihr seinen Antrag gemacht, sich erst drei Monate Bedenkzeit ausgebeten. Sie hatte ihm ferner gesagt, er möge sich zuvor selbst prüfen und Alles bedenken, bevor er einen Schritt thue, der ihn vielleicht mit allen seinen Nachbaren verfeinde. Er könne eine bessere Heirath eingehen als mit ihr, dem armen Mädchen, das ihm nichts weiter zu bieten vermöge als sich selbst und ihre Liebe. Renaud hatte ihr darauf geantwortet, daß er nur diese letztere wünsche und ihm diese Ersatz für alles Andere biete, auf welches er, wenn er auf ihren Besitz verzichten müßte, keinen Werth legen würde. Dann hatte er sie um Abkürzung der Bedenkzeit gebeten, da er zuvor schon, ehe er ihr überhaupt seinen Antrag gemacht, Alles reiflich überlegt habe. Darin aber war das Mädchen fest geblieben, ihren Wunsch damit motivirend, daß die Bauern vielleicht hämische Reden über sie führen möchten, die sie beleidigen würden. Er hatte dies eingesehen und sich ihrem Verlangen gefügt. Als sie aber, nachdem diese Bedenkzeit verflossen war, abermals ihn in seinem Entschlusse hatte wankend machen wollen, – wie sie ihm später lachend eingestand, nur um die Festigkeit seiner Liebe zu prüfen, – da hatte er ihr etwas heftig vorgeworfen, daß sie ihn unmöglich so aufrichtig lieben könnte, wie er sie. Daraufhin war sie ihm um den Hals gefallen und hatte ihm erklärt, daß sie je eher desto lieber ihn ihren Gatten nennen möchte ... und so war sie endlich sein Weib geworden.
Renaud hatte, als er seine junge Frau heimführte, sein bisheriges Eigenthum in Blancbois veräußert und auf dem ihm als dem nächsten Verwandten des ermordeten Ehepaares zugefallenen Landkomplex die obenbeschriebenen Gebäude aufführen lassen. Zugleich hatte er das daran stoßende, der Gemeinde gehörige Acker- und Wiesenland derselben abgekauft und somit den größten Theil des Dorfes La Grange erworben. Gleichzeitig waren die beiden Leute, welche in Barrieres Diensten gestanden hatten, und deren gesammte Habe ebenfalls ein Raub der Flammen geworden, von dem neuen Besitzer des Gutes übernommen worden und führten, nachdem sie sich ebenfalls verheirathet, über dasselbe eine Art Inspektion. Bald nach seiner Hochzeit hatte Renaud seinem Schwiegervater den Antrag gemacht, seinen Posten als Gemeindehirt aufzugeben und seine Wohnung fortan auf dem Gute zu nehmen. Auf ersteres war Jerome Latour um so eher eingegangen, als er den Bauern keine Gelegenheit geben wollte, über seinen Schwiegersohn zu spötteln; dagegen hatte er den zweiten Wunsch des Letzteren unerfüllt gelassen, weil er sich, wie er sich geäußert, von dem bescheidenen Häuschen, in welchem er lange Jahre mit seiner Frau und seinem Kinde ein glückliches und zufriedenes Dasein geführt, nicht hatte trennen mögen.
Wider Renauds Erwarten hatten die Bauern sich schneller über seine »idyllische Heirath mit dem Schäfermädel« – wie sie es nannten – beruhigt. Hatten sie in den ersten Wochen seiner jungen Ehe über »die Hirtendirne« gespöttelt, die jetzt, wo sie zur feinen Dame erhoben worden, »sicherlich die Nase rümpfen wird, wenn sie Kuhmist riecht, während sie ihn früher mit den Händen knetete«, »und uns über die Achsel ansehen wird, denn wir sind ja nicht mehr Ihresgleichen« ... so sollte dies bald in das Gegentheil umschlagen. »Die Verketzerung und die Verherrlichung sind zwei Bergspitzen«, sagt ein baskisches Sprüchwort, »und die Kluft zwischen beiden füllt nur ein Kehrmichnichtdran aus, willst Du von der ersten zur zweiten, so halte zuvor in der mittleren Haus«. Auch hier bethätigte sich das Gesagte. Es waren kaum zwei Monate verflossen, als die Bauern nicht genug des Lobes von der jungen Frau zu erzählen wußten.
– Wer hätte das von ihr gedacht, daß sie sich in die Wirtschaft so hinein finden würde! sagte der Eine.
– Das muß man der Bäuerin lassen, sie versteht zu wirthschaften, äußerte ein Anderer.
– Sie weiß die Knechte und Mägde im Zaume zu halten, man sieht sie überall, sprach ein Dritter.
– Renaud hat gar keine bessere Bäuerin finden können; sie hat Vernunft, bestätigte ein Vierter.
Und so ging es fort: Alle lobten, nicht Einer tadelte sie; die am ärgsten auf sie geschmäht, waren ihre eifrigsten Lobredner geworden. Und auf welche Weise hatte sich diese schnelle Umwandlung zu Gunsten der jungen Frau vollzogen? Einfach durch sie selbst, durch ihren Charakter, ihre guten Eigenschaften, durch ihr Verhalten gegen die Bauern und im eigenen Hause. Während sie in letzterem durch ihre rastlose Thätigkeit, Sauberkeit und Ordnungsliebe wie auch durch ihre milde herzgewinnende Freundlichkeit sich alle Dienstboten geneigt machte, gewann sie sich durch ihre Leutseligkeit gegen Jeden, mit welchem sie in Verkehr trat, und ihre liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit der sie selbst dem Aermsten zu dienen und ihm mit Rath und That beizustehen sich erbot, schnell Aller Herzen. Daß ihr Gatte diesen vortrefflichen Eigenschaften gegenüber nicht unempfindlich blieb, ist nach dem Gesagten selbstverständlich. Mit jedem neuen Tage gewann er seine junge Gattin lieber und er bereute es nicht, die Tochter des ärmsten und verachtetsten der Bauern anstatt jener des reichsten und angesehensten, auf welche er als vermögender Mann wohl hätte Anspruch erheben können, zu seinem Weibe gemacht zu haben. Er hatte mit einem Worte einen Schatz gefunden, um welchen ihn alle seine Nachbaren, welche noch kurz zuvor diese Perle in ihrer unscheinbaren Fassung nicht gewürdigt, von ganzem Herzen beneideten. Und was die junge Frau selbst betrifft, so werden wir wohl kaum nöthig haben, dem Leser zu versichern, daß auch sie ihren Gatten aufrichtig liebte; ihr ganzes Verhalten gegen ihn ließ dies zur Genüge erkennen. Kurz die beiden Gatten führten ein überaus glückliches und zufriedenes, auf gegenseitiger Uebereinstimmung der Charaktere und Neigungen basirendes, durch keine Disharmonien gestörtes Eheleben, das durch die Pfänder ihrer treuen Liebe, durch drei hübsche Kinder nur mehr verschönt wurde.
Und doch sollte dieses glückliche Leben eine Trübung erfahren. Wie hinter Blättern und Blumen versteckt die giftige Schlange lauert, bereit, sich auf ihr Opfer zu stürzen, so wartete dieser Glücklichen das Verhängniß in Gestalt eines ruchlosen, tückischen Bösewichts, welcher über die nichts ahnende Familie Trauer und Schmerz bringen sollte.

Es war am 5. Mai 18.. nach Sonnenuntergang, als Frau Renaud mit einer Handarbeit beschäftigt in der zu einem Lusthäuschen umgestalteten Laube ihres Gartens saß und die Heimkehr ihres Gatten mit ängstlich klopfendem Herzen erwartete, während in geringer Entfernung von ihr sich ihre drei Kinder nach Kinderart vergnügt umherbalgten.
Am Morgen dieses Tages hatte sich der Gutsherr, um eine geschäftliche Angelegenheit zu erledigen, die keinen Aufschub erleiden durfte und mit welcher er gleichwohl doch auch keinen Dienstboten hatte betrauen mögen, nach Limoges begeben. Er war fortgeritten, ohne sich von einem Knecht begleiten zu lassen und trotz der Einwendungen seiner Gattin, welche ihn gebeten, diesen Gang bis zum nächsten Tage wenigstens aufzuschieben, da sie eine dunkle Ahnung habe, als würde ihm oder ihr irgend etwas Böses zustoßen.
– Aber, Mariechen, hatte er spöttisch zu ihr gesagt, Du bist doch jetzt gar zu furchtsam. Seitdem wir verheirathet, hast Du Dich sehr zu Deinem Nachtheil verändert. Während Dir sonst der Gedanke an Furcht gar nicht in das Köpfchen wollte, bist Du in den zehn Jahren ein scheues Vögelchen geworden, das, wie es den Anschein hat, täglich mehr und mehr das dreiste Fliegen verlernt und kaum noch ängstlich flattert.
– Du hast freilich Recht, Raoul, hatte sie ihm mit einem schwachen Lächeln geantwortet, und indem sie den Versuch gemacht, auf seinen Scherz einzugehen, was ihr aber in ihrer erregten Gemüthsstimmung nicht gelungen war; aber zwischen damals und jetzt ist auch ein großer Unterschied. Damals hatte ich nur an mich allein zu denken, während ich jetzt Dich und die Kinder in meine Gedanken einschließen muß.
Da hatte er sie an seine Brust gezogen und sie geküßt und gerührt ausgerufen:
– Du bist und bleibst doch mein herziges, mein liebes Weib. Aber was in aller Welt fürchtest Du denn, wenn ich einmal ein paar Stunden nicht bei Dir bin? Du hast Deine Leute um Dich, hast sie Dir so gewöhnt, daß Du nur zu winken brauchst, und sie kommen und fragen, was Du wünschest. Wahrhaftig, ich könnte auf diese Liebe eifersüchtig sein, wenn sie mir nicht die beste Bürgschaft für Deine Sicherheit wäre. Was also fürchtest Du, daß Dir zustoßen könnte?
– O für mich nichts ... nur Deinetwegen bin ich besorgt, Raoul.
– Meinetwegen? Und weshalb? Ich bin freilich heute zum ersten Male, seitdem wir verheirathet sind, fast einen ganzen Tag vom Hause abwesend, doch das ist Nebensache. Was soll mir denn während der paar Stunden passiren? Du weißt ja, daß unser Dorf und dessen Nachbarschaft, aus welcher ich kaum herauskomme, wegen seines friedlichen Charakters seinerzeit öffentliche Anerkennung gefunden hat, ja deshalb förmlich berühmt ist. Der Weg, den ich zu nehmen habe, liegt unter diesem bewußten Breitengrade, was mit anderen Worten heißt, daß er sehr sicher zu passiren ist. Fürchtest Du denn, daß mich irgend ein moderner Räuberhauptmann überfallen und berauben könnte?
– O spotte nicht, Raoul! Der Spott kleidet Dich schlecht und klingt im Hinblick auf meine Angst profan. Wenn ich auch nicht fürchte, was Du angedeutet hast, so kann doch Niemand vorher wissen, was geschieht. Wenn Du zum Beispiel morgen oder an einem andern Tage reiten wolltest, würde ich weniger besorgt sein; aber heute, gerade heute ...
– Aber, Kind, Du weißt wohl, daß dies nicht angeht, und ist denn ein Tag nicht so gut wie der andere? Was hast Du denn gegen diesen Tag einzuwenden? Hast Du einmal an diesem Tage Unglück gehabt?
– Du weißt also nicht, was heute vor zehn Jahren geschehen ist? Du erinnerst Dich dessen nicht?
– Heute vor zehn Jahren? ... Nein, in der That ich weiß mich an nichts Besonders oder Bemerkenswerthes zu erinnern. Du mußt also schon so gut sein, meinem schwachen Erinnerungsvermögen zu Hilfe zu kommen.
– Gut, dann will ich es Dir sagen. Heute vor zehn Jahren wurde Marouty wegen Diebstahls verurtheilt, und an demselben Tage, am 5. Mai war es, als er den furchtbaren Schwur gethan hat, daß er sich an den Urhebern seiner That rächen würde, und Du weißt, auf welche gräßliche Weise er an Deinen unglücklichen Verwandten diesen Schwur erfüllt hat.
– Ah! wahrhaftig! Sieh, das hatte ich allerdings ganz vergessen. Das ist nun freilich keine angenehme Erinnerung, und dennoch hat sie für mich etwas Angenehmes; denn habe ich nicht gerade den scheußlichen Verbrechen dieses Bösewichts Dich, mein herziges Lieb, zu danken?
– Raoul! Du bist entsetzlich mit Deinen Spötteleien!
– Nun, laß es nur gut sein, Kind! Um aber wieder auf Deine grundlose Besorgniß zurückzukommen, so sehe ich immer noch nicht ein, weshalb mir dieser für uns Beide – ich gestehe es gern zu – bedeutungsvolle Tag gerade Unheil bringen sollte?
– Ich habe dies nicht gesagt und weiß es auch nicht ... und der Allmächtige wird es auch gewiß verhüten ... dennoch aber ängstige ich mich und kann nicht ruhig sein ... während Du abwesend bist ... mich peinigt fortwährend seit gestern eine böse Ahnung.
– Natürlich, das kann ich mir wohl denken. Du hast Dich wahrscheinlich schon die ganze Woche mit dem Gedanken an den heutigen Tag und an das vor zehn Jahren Geschehene geplagt; daher mag Deine Ahnung kommen, sonst wüßte ich sie mir nicht zu erklären. Oder bist Du etwa so thöricht zu glauben, daß Maroutys Geist mir erscheinen könnte?
– Du fällst schon wieder in Deinen Spott zurück, Raoul ... Wenn nun er ... Marouty selbst ... wenn er noch lebte ... o mir graut, wenn ich daran denke!
– Aber, Kind, das ist nun purer Unsinn, was Du da redest! Der Bösewicht ist lange todt, ist längst eine Speise der Würmer. Du weißt wohl, daß wir damals, vier Wochen nach seinem Verschwinden, seinen Leichnam gefunden haben, als ihn der Fluß, dem er jedenfalls zu schlecht gewesen, an das Ufer geworfen hatte.
– Man glaubte wenigstens, daß es sein Leichnam war, behaupten konnte es Niemand.
– Du hast es also nicht geglaubt? Du warst anderer Meinung? Wer aber sollte denn dieser unkenntliche Leichnam gewesen sein, wenn es nicht der Maroutys war.
– Das weiß ich allerdings nicht. Indessen habe ich es damals so wenig geglaubt wie heute, daß er sich selbst das Leben genommen haben sollte.
– Aber liebes Weib, ich selbst habe damals den Leichnam besichtigt, und ich war davon überzeugt, daß es der des Schurken war, und ich mich nicht getäuscht hatte. Auch seine Frau hat den Körper als den ihres Mannes erkannt, und das ist doch sicherlich ein Beweis, der gar nicht zu widerlegen ist. Nein, nein, Du fürchtest etwas, was nicht existirt. Marouty ist todt und begraben. Doch ich stehe hier und verplaudere die Zeit, anstatt meine Vorkehrungen zu treffen.
– So willst Du also durchaus heute reisen?
– Freilich, Kind, ich muß, selbst wenn ich auch nicht wollte.
– Nun, wenn es denn durchaus sein muß, so nimm wenigstens einen der Knechte mit Dir oder noch besser Otto – (es war dies der junge Bauer, welcher in Barrieres Diensten gestanden hatte und nachher in die Renauds getreten war) – er ist der zuverlässigste unserer Dienstboten.
– Aber ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ich einen Begleiter mit auf die kleine Reise nehmen soll, da ich meine Angelegenheit ganz allein zu erledigen habe und bereits um 4 Uhr Nachmittags, spätestens aber um 5 Uhr wieder hier zu sein und Dich in meine Arme zu schließen gedenke!
Nach diesen Worten hatte er sich zurückziehen und seine Vorkehrungen treffen wollen, als ihm seine Gattin noch nachrief:
– Du nimmst indessen jedenfalls eine Waffe mit, Liebster?
– Auch das ist eigentlich ganz überflüssig, hatte er lachend zurückgeantwortet, denn ich wüßte nicht, wozu ich mich ihrer bedienen sollte. Doch um Dich zu beruhigen und Dir nicht starrköpfig zu erscheinen, will ich Deinen Wunsch erfüllen und mich mit dem unnützen Dinge belasten.
Eine halbe Stunde später hatte er sich auf seinen Rothfuchs geschwungen und war fortgeritten, und die Gattin hatte mit einem tiefen schweren Seufzer ihm nachgeblickt, bis er ihren Augen entschwunden war.
Indem die junge Frau in der Gartenlaube sitzend und mit einer Handarbeit beschäftigt noch einmal in Gedanken das hier mitgetheilte Gespräch durchging, ergriff sie eine nervöse Unruhe, von welcher sie sich keine Rechenschaft zu geben vermochte. Es waren bereits Stunden über den von Raoul festgesetzten Termin verflossen, und noch immer ließ sich nicht in der Ferne der Hufschlag seines Rosses vernehmen.
– Mein Gott! murmelte die Gattin angstvoll. Schon sieben Uhr, und Raoul ist noch immer nicht zurück! Ich weiß nicht, auf welche Weise ich mir sein langes Ausbleiben erklären soll. Wenn ihm nur kein Unglück widerfahren ist, wenn nur nicht ... Sie mochte den Gedanken nicht ausdenken, welcher ihr Hirn momentan durchzuckte; er war zu entsetzlich, zu gräßlich. Mit Gewalt drängte sie ihn von sich, um irgend welche Entschuldigungen für das Ausbleiben des Gatten aufzusuchen, ohne doch solche zu finden. Immer wieder und wieder sagte sie sich, daß Raoul durch einen Zufall auf dem Rückwege sich verspätet, oder daß die Erledigung seines Geschäftes ihn länger in Anspruch genommen haben könnte, als er selbst es zuvor geahnt; aber ihre Vernunft sträubte sich auch gegen eine solche Annahme.
– Himmel, wenn er gar erst morgen zurückkehrte! begann sie von Neuem, nur um durch ihre eigenen Worte einen Versuch zu machen, ihre Unruhe und Angst zu beschwichtigen. Aber nein, das ist unmöglich; denn wenn dies seine Absicht wäre, hätte er wohl Mittel und Wege gefunden, um mich von einer solchen Aenderung seines Entschlusses zu benachrichtigen; er weiß ja, daß ich mich zu Tode ängstigen würde, wenn er mich ohne jede Nachricht ließe.
Sie versank wiederum in düsteres Sinnen, bis sie endlich, als es vom Kirchturm in Blancbois die achte Stunde schlug, ihre Angst nicht mehr bemeistern könnend, aufsprang und halb schluchzend ausrief:
– Nein, ich halte es nicht mehr länger aus ... ich vertrage diese Angst nicht mehr ... ich muß Gewißheit haben ... mir ahnt Entsetzliches! Der Allmächtige gebe, daß ich mich getäuscht habe.
Sie ließ den schon erwähnten Otto rufen und beauftragte ihn, sich in Begleitung zweier Knechte auf den Weg zu machen und ihrem Gatten entgegenzureiten, beziehungsweise ihn aufzusuchen und nicht eher zurückzukehren, als bis sie ihn gefunden hätten; denn, fügte sie hinzu, es müsse ihrem Gatten ein Unfall zugestoßen sein.
Die drei Dienstboten leisteten dem Befehle ihrer Herrin unverzüglich Folge.
Wiederum verging eine lange Stunde, welche der im Gartenhause zurückgebliebenen jungen Frau wie eine Ewigkeit erschien. Sie war eine Beute der furchtbarsten, entsetzlichsten Aufregung; ihr Herz klopfte zum Zerspringen, ihre Pulse flogen fieberisch, alles Blut drängte sich nach ihrem Kopfe, und sie wurde bald roth, bald bleich. Die Füße schienen ihr den Dienst versagen zu wollen, ihr ganzer Körper zitterte heftig.
Die Kinder waren durch die Magd zu Bett gebracht worden, nachdem sie der Mutter noch eine gute Nacht gewünscht und gefragt hatten, ob denn der Papa noch nicht zurückgekehrt sei, weil sie sich doch gern mit einem Kusse, wie gewöhnlich, von ihm verabschieden möchten. Das kindliche Geplauder hatte der armen Mutter tief ins Herz geschnitten und sie nur mit gewaltsamer Anstrengung über sich selbst ihre Thränen zurückhalten können, als sie die Pfänder ihrer Liebe geküßt hatte. Dann aber, nach deren Entfernung brach sie in Schluchzen aus und weinte vor sich hin.
Da, endlich nach Verlauf von einer langen halben Stunde – es war bereits ganz finster geworden – erhob sie, tief aufseufzend das Haupt. Sie glaubte die Stimmen der Knechte zu vernehmen, welche sich dem Grundstück zu nähern schienen. Sie horchte angestrengt und unterschied ganz deutlich die Stimme Ottos; die Entfernung zwischen ihm und ihr war jedoch zu groß, als daß sie hätte verstehen können, was er sagte. Einen Moment athmete sie, wie von einem furchtbaren Alp befreit, freudig auf: sie glaubte auch die Stimme des Gatten vernommen zu haben; aber im nächsten Moment sagte sie sich wieder, daß, wenn Raoul sich in der Begleitung der Knechte befände, er sicherlich ihnen vorausgeeilt sein und bereits die geliebte Gattin in seine Arme geschlossen haben würde; denn er mußte ja wissen, wie sehr sie sich um sein verspätetes Ausbleiben ängstigte. – Nein, Renaud befand sich nicht bei den Knechten; sie kehrten ohne ihn zurück, und doch hatte sie ihnen streng anbefohlen, nicht eher wieder nach Hause zu kommen, als bis sie dem Herrn begegnet seien. Es mußte sich etwas Ungewöhnliches ereignet haben, es war ein Unglück geschehen, es konnte nicht anders sein. Es litt sie nicht länger an ihrem Platze, sie wollte sich mit eigenen Augen überzeugen, was geschehen sei, sie mußte dieser sie furchtbar peinigenden Ungewißheit ein Ende machen, und sollte sie auch Schreckliches erfahren müssen; nur Klarheit! ... Sie wollte den Knechten entgegeneilen, aber sie hatte nicht die Kraft, sich von ihrem Sitze zu erheben, die Füße schienen ihr bleischwer und wie in den Boden gewurzelt zu sein, ächzend, schluchzend, die Augen voller Thränen, sank sie, nach einem abermaligen Versuch, aufzustehen, wieder auf die Bank zurück. Dann suchte sie mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen, aber diese war so dicht, daß sie nichts zu erkennen vermochte.
Während dessen hatten sich die Stimmen dem Gutshofe genähert. Es waren in der That die von der jungen Frau ausgesandten Knechte, welche zurückkehrten – doch sie kamen nicht allein, nicht resultatlos, wie ihre Gebieterin vermuthet hatte. Sie sprachen in halblautem und, wie es schien, in bedauerndem Tone untereinander. Die Unglückliche lauschte angestrengt auf diese Stimmen; doch nur einzelne abgerissene Worte trafen ihr Ohr; aber diese Worte schnitten ihr tief ins Herz, machten sie jäh erblassen, machten ihre Pulse stocken ...
– Mein Gott, was wird die Bäuerin sagen! ...
– Es muß sie tödten! ...
– Wenn sie es nur erst überwunden hätte! ...
– Wer hätte an ein solches Unglück gedacht!
– Wie es nur geschehen sein mag!
– Es wird wohl nie ermittelt werden können, denn der arme Herr ...
So klang es von verschiedenen Stimmen leise, kaum vernehmbar in das Ohr der Lauschenden und traf sie wie Keulenschläge.
Wortlos, keines Lautes mächtig, sprang die Unglückliche jäh empor und stürzte, mit von der Angst beflügelten Schritten, durch den Garten dem Hofthore zu.
Sie langte dort an, als eben die von ihr ausgesandten Knechte unter Vorantritt Ottos, welcher eine brennende Fackel in der Hand hielt, den Gutshof betreten wollten.
Was die Aermste sah, machte ihr Blut im ersten Moment zu Eis erstarren. Die Knechte trugen eine nothdürftig aus Baumzweigen hergestellte und mit Laub und Reisig bedeckte Bahre. Auf derselben lag, sorgsam mit den Jacken und Blousen der Knechte verhüllt, mit verbundenem Haupte, blutbedecktem Antlitz und geschlossenen Augen, regungslos der Körper eines Mannes.
Die junge Frau war zu der Bahre gestürzt, sie hatte die verhüllenden Kleidungsstücke mit ängstlicher Hast entfernt und ein einziger Blick ihr genügt, sie in dem regungslos Daliegenden ihren Gatten erkennen zu lassen. Im nächsten Moment war sie mit einem herzerschütternden Wehlaut ohnmächtig an der Bahre zusammengebrochen.
Während die schnell herbeigeilten weiblichen Dienstboten ihre Gebieterin auf ihr Zimmer schafften und sich dort bemühten, sie wieder zum Bewußtsein zurückzurufen, war der Körper Renauds von den Knechten in das Haus getragen worden.
Kaum fünf Minuten mochten verstrichen sein, als auch bereits der Wundarzt des Dorfes, von dem Schwiegervater des Gutsherrn begleitet, auf dem Gute anlangte. Das schnelle Erscheinen des Chirurgen erklärt sich durch den Umstand, daß Jerome Latour, welcher im Begriff gewesen war, sich nach dem Gutshofe zu begeben, um seiner Tochter einen Besuch abzustatten, in dem Momente, als er sein Haus verließ, zufälligerweise den Knechten begegnete, als diese mit dem Körper ihres Gebieters durch das Dorf schritten. Aufs heftigste erschrocken, hatte der ehemalige Hirt gefragt, was geschehen sei, und die Knechte hatten ihm darauf mitgetheilt, daß Renaud am Morgen dieses Tages nach Limoges habe reiten wollen und seiner Gattin versprochen hätte, um fünf Uhr Nachmittags wieder auf dem Gutshofe einzutreffen. Da er jedoch um sieben Uhr Abends noch nicht zurückgekehrt war, so hätte ihre Gebieterin ihnen, den Knechten, in der Voraussicht, daß dem Gutsherrn vielleicht ein Unfall zugestoßen sein möchte, den Auftrag ertheilt, dem Herrn entgegenzureiten, beziehungsweise ihn aufzusuchen und denselben Weg zu nehmen, den er vermuthlich genommen habe. Sie hatten, erzählten sie, die ausdrückliche Weisung erhalten, nicht eher zurückzukommen, als bis sie den Herrn getroffen, und wenn sie dieserhalb auch bis Limoges reiten sollten. Leider habe sich die Vermuthung ihrer Gebieterin bestätigt. Sie hätten deren Gatten etwa eine Stunde Weges vom Dorfe entfernt, an einer einsamen Stelle des Waldes, unter einem Baume liegend, bewußtlos und aus einer Kopfwunde heftig blutend, aufgefunden. Neben dem Körper des Gutsherrn habe ein geladenes Terzerol gelegen; was aber aus dem Rothfuchs geworden sei, den er geritten, wüßten sie nicht zu sagen. Derselbe werde sich wahrscheinlich, nachdem er durch irgend etwas erschreckt und, scheu geworden, seinen Herrn abgeworfen, irgend wohin verlaufen haben und werde wohl nächstens wieder eingefangen werden. Eine Erklärung des Unglücks wären sie nicht im Stande zu geben.
Jerome Latour hatte sich, nachdem ihm die Knechte das Geschehene berichtet, unverzüglich auf den Weg nach Blancbois begeben, um den daselbst wohnenden Chirurgen aufzusuchen. Er fand ihn glücklicherweise zu Hause und veranlaßte ihn, indem er ihn in kurzen Worten von dem Unfall in Kenntniß setzte, sich sogleich nach dem Gutshofe zu begeben.
Die Knechte hatten den schwerverletzten Gutsherrn vorsichtig auf die im Zimmer befindliche Ottomane niedergelegt und sich dann mit Ausnahme Ottos geräuschlos wieder entfernt. Dieser blickte mit unverkennbarer Theilnahme bald auf seinen Gebieter, bald ängstlich fragend auf den Wundarzt, wagte jedoch ebensowenig wie Jerome Latour, welcher ebenfalls im Zimmer geblieben war und neben der Ottomane stand, durch eine neugierige Frage die Untersuchung des Chirurgen zu stören. Renaud hatte noch kein Zeichen des wiederkehrenden Lebens von sich gegeben, und auch während der mehrere Minuten in Anspruch nehmenden Prüfung seines Zustandes durch den Wundarzt erwachte er nicht aus seiner todesähnlichen Betäubung. Erst als der Letztere den von den Knechten in der Eile nur oberflächlich angelegten Verband von der Kopfwunde entfernte, diese eingehend besichtigte und mit einem in Wasser getauchten Schwamm von dem darin angesammelten, geronnenen Blute reinigte, kündigte der Verletzte durch einen schwachen Seufzer an, daß noch nicht alles Leben in ihm erloschen sei.
Lebien schüttelte, indem er die Tiefe und Lage der Wunde prüfte, bedenklich das Haupt, ohne indeß eine Bemerkung zu machen, ebenso stillschweigend legte er einen Verband an.
In diesem Moment wurde die Thür des Zimmers geräuschlos geöffnet, und die Gattin des Verletzten erschien auf der Schwelle.
Es war inzwischen den Bemühungen der Mägde gelungen, die durch den Unfall ihres Gatten tödtlich erschrockene junge Frau wieder zum Bewußtsein zurückzurufen. Als sie aus ihrer Ohnmacht erwachte, war ihre erste Frage nach ihrem Gemahl, welchen sie bereits todt glaubte. Die Mägde, obwohl sie noch nichts Bestimmtes über den Zustand desselben erfahren hatten, erklärten ihr dennoch, wohl nur in der gutgemeinten Absicht, sie beruhigen zu wollen, daß er schwer, aber nicht gefährlich verwundet worden, und daß sie seinetwegen sich keinen Besorgnissen hinzugeben brauche, und er sich gewiß recht bald wieder erholen werde.
– Dem Allmächtigen sei Dank! ... So ist er also nicht todt? Er lebt ... ist nicht ermordet? hatte sie tiefaufathmend ausgerufen, während Thränen der Freude in ihren Augen glänzten.
– Ermordet? hatte eine der Mägde erstaunt und erschreckt geäußert. Wer soll denn einen Mord an dem Herrn begangen haben?
– Nun freilich! ... Wer anders als er ... Marouty ... der Bösewicht ... er ... er hat ihn überfallen!
– Marouty? ... Aber der ist ja lange todt! ... Und der Herr ist ja gar nicht einmal überfallen worden ... sein Pferd ist mit ihm durchgegangen und da ... da ist das Unglück geschehen, hat Otto gesagt! rief eine der Mägde, von einem Erstaunen in das andere fallend.
– Ich weiß das besser! hatte die junge Frau kurz geantwortet und in einem Tone, der keine Widerrede zuließ. Darauf hatte sie erklärt, daß sie keine Ruhe finden könne, ehe sie nicht selbst sich durch den Augenschein davon überzeugt, was sie von dem Befinden ihres Gatten zu hoffen oder zu fürchten habe.
Dann war sie gegangen, und die Mägde hatten ihr kopfschüttelnd nachgeblickt und untereinander geflüstert, daß der Unfall ihres Gatten den Verstand ihrer Gebieterin angegriffen habe, und daß es kein Wunder wäre, wenn sie obenein wahnsinnig würde.
Als die junge Frau in das Zimmer ihres Gatten trat, vermochte sie einen leisen Aufschrei nicht zu unterdrücken; eine Geberde des Chirurgen bedeutete ihr jedoch, sich möglichst ruhig zu verhalten, da er sonst nicht für die Heilung seines Patienten einstehen könne.
– Es ist also dennoch für sein Leben zu fürchten? fragte die junge Frau leise und mit angsterfülltem Blicke.
– Nicht, wenn meine Anordnungen pünktlich befolgt und alle Aufregungen von meinem Patienten ferngehalten werden, antwortete Lebien kurz und bestimmt, und um allen weiteren Fragen auszuweichen, fuhr er fort: Die Wunde Ihres Gemahls ist ziemlich tiefgehend und schwer, aber nicht absolut tödtlich. Er ist nur durch den starken Blutverlust ohnmächtig geworden und wird binnen wenigen Minuten sein Bewußtsein zurückerlangen. In Ihrem und seinem Interesse muß ich Ihnen jedoch rathen, ihn nicht durch Sprechen aufzuregen. Wir müßten sonst fürchten, daß das Wundfieber stärker auftritt, als ich wünschte.
Dies Alles war mit halblauter Stimme gesprochen worden, und die junge Frau deutete dem Chirurgen nur durch eine Geberde an, daß sie seinen Rath beherzigen werde.
Dennoch hielt es Lebien für angezeigt, in seinen Ermahnungen fortzufahren.
– Vor Allem, sprach er in seinem vorigen leisen Tone weiter, vermeiden Sie es, an den Kranken irgend welche Fragen, zum Beispiel über die Ursache seiner Verwundung zu richten. Um Sie indeß darüber nicht im Unklaren zu lassen, theile ich Ihnen mit, welches Resultat die Untersuchung der Wunde mir ergeben hat. Durch irgend etwas erschreckt, vielleicht durch einen plötzlich auffliegenden Vogel, oder was weiß ich – auch Pferde können bisweilen nervös werden – ist das Pferd mit Ihrem Herrn Gemahl durchgegangen und hat ihn abgeworfen, sozwar, daß derselbe mit dem Kopfe gegen einen Baumstamm gestürzt ist. Die Art der Verwundung läßt dies mit Sicherheit vermuthen. Die Knechte, welche Ihren Herrn Gemahl gefunden, werden Ihnen vielleicht noch genaueren Aufschluß geben können.
Die junge Frau schien durch diesen Aufschluß vollkommen befriedigt zu sein, denn sie erhob keine Einwendungen, sondern neigte nur zur Bestätigung das Haupt.
Der Wundarzt hatte mit seiner vorherigen Bemerkung betreffs seines Patienten nicht Unrecht gehabt; derselbe war aus seiner Betäubung erwacht und schien sogar die letzten Worte Lebiens, mit welchen sich dieser über die Ursache seiner Verwundung ausgesprochen hatte, gehört zu haben, denn ein flüchtiges Lächeln überflog sein Antlitz. Der Chirurg, welcher dies gewahrt hatte, wurde gleichzeitig durch eine verständnißvolle Geberde Renauds veranlaßt, sich ihm zu nähern.
Es waren nur wenige Worte, welche der Verwundete ihm zuflüsterte, und sie trafen auch nur das Ohr dessen, der sie vernehmen sollte. Derselbe war jedoch über den Inhalt des Vernommenen so erstaunt und erschreckt, daß er Mühe hatte, seine Bestürzung keinem der Anwesenden gewahren zu lassen und im ersten Moment glaubte, der Verletzte spräche im Fieber; im nächsten indeß überzeugte er sich, daß Jener vollkommen bei Bewußtsein sei.
Gleich darauf verabschiedete sich Lebien und ließ die beiden Gatten allein, beim Hinausgehen aus dem Zimmer Jerome Latour durch einen Wink bedeutend, ihm zu folgen.
Der ehemalige Hirt, der Einzige, welchem das Erschrecken des Wundarztes nicht entgangen war, ahnte bereits, daß dieser ihm eine Mittheilung zu machen habe. Dieselbe mußte wohl von höchster Wichtigkeit gewesen sein; denn Latour verließ kaum zehn Minuten später, nachdem er sich mit kurzen Worten von seiner Tochter verabschiedet hatte, in Begleitung der beiden auf den Mann dressirten Hunde Renauds das Gut, um sich abermals nach Blancbois, diesmal jedoch zu dem Maire, zu begeben.
Eine halbe Stunde darauf wurde der Wald, in welchem Renaud den Unfall erlitten hatte, von den sämmtlichen, dem Maire zur Verfügung stehenden Gensdarmen nach allen Richtungen durchsucht und – nichts Verdächtiges gefunden.
Man war bereits zu der Ueberzeugung gelangt, daß jene Mittheilung, welche der Gutsherr Renaud dem Wundarzt gemacht, nur mehr eine Fieberphantasie gewesen, und erhielt diese Ansicht auch aufrecht, als Ersterer nach seiner drei Monate später erfolgten gänzlichen Wiederherstellung behauptete, daß Alles, was er gesagt, auf Wahrheit beruhe, nämlich daß, als er am 5. Mai auf dem Rückwege von Chalus nach La Grange begriffen gewesen, ihm plötzlich das Pferd unter dem Leibe erschossen worden, und daß er selbst, noch ganz erschreckt von diesem unerwarteten Attentat, durch einen wild aussehenden Menschen mit einem Knittel niedergeschlagen worden sei. Mit Bestimmtheit habe er die Züge seines Angreifers nicht zu erkennen vermocht, es habe ihm jedoch geschienen, als ob derselbe mit Marouty Aehnlichkeit gehabt habe. Wenn man nun auch das Attentat selbst nicht bestritt, da es ja durch die Verwundung Renauds vollständig erwiesen war, und dies durch die Ansicht des Wundarztes, welcher behauptete, die Wunde könne nur von einem Stockschlage herrühren, unterstützt wurde, so bezweifelte man doch, daß der Schuldige der todtgeglaubte Marouty sein könne. Und wo war der Kadaver des Pferdes hingekommen, das der Angreifer doch erschossen haben sollte?
Das Räthsel sollte indessen gelöst werden.
Es war am 11. Oktober desselben Jahres, als ein im Walde von La Grange mit Holzsammeln beschäftigter Knabe in einiger Entfernung vor sich, aus dem Erdboden eine leichte Rauchwolke aufsteigen sah. Er schlich neugierig näher, vermochte aber nichts zu entdecken. Trotzdem hielt er es für nöthig, den Eltern dieses Phänomen mitzutheilen, die ihrerseits den Maire davon in Kenntniß setzten. Dieser ließ die verdächtige Stelle genauer untersuchen, und – was entdeckte man? Eine vollständig wohnlich eingerichtete Erdhöhle, in welcher man unter verschiedenen Nahrungsmitteln Stücke eingesalzenen Pferdefleisches, sowie ferner einen Sattel fand, dessen Knopf die Buchstaben J. R. trug, und welcher sich somit als das Eigenthum des Gutsherrn Jean Renaud in La Grange erwies, auch von diesem als der Sattel rekognoszirt wurde, welchen er am Tage des Ueberfalls seinem Rothfuchs aufgelegt hatte.
Wer aber war der Bewohner dieser Höhle, und wo hielt derselbe sich auf? Wahrscheinlich hatte er Wind davon bekommen, daß sein Asyl von der Dorfobrigkeit ausgespäht worden, und er hatte sich noch rechtzeitig aus dem Staube gemacht.
Während einer ganzen Woche wurde der Eingang der bewußten Höhle wie auch der Wald selbst scharf bewacht und die Höhle selbst endlich verschüttet; aber keine Spur des Verdächtigen ließ sich entdecken.
Da griff man endlich, es waren vierzehn Tage in resultatlosen Nachforschungen vergangen, auf die Anzeige der Haushälterin des Pfarrers von Souillac (einem Flecken im Departement Corrège, 126 Kilometer von La Grange und Blancbois entfernt) einen Landstreicher auf, welcher, nachdem er wegen Bettelns abschlägig beschieden worden, aus Rache dafür versucht hatte, das Pfarrhaus in Brand zu stecken. Die Affaire war umsomehr von Wichtigkeit, als die Haushälterin, eine verwittwete Frau, namens Marouty, in dem betreffenden Landstreicher ihren vor zehn Jahren verschollenen, angeblich gestorbenen Ehemann mit Bestimmtheit erkannt zu haben glaubte trotz seines verwilderten Aussehens.
Behufs weiterer Feststellung seiner Persönlichkeit wurde der Verhaftete nach La Grange transportirt und dort von verschiedenen Personen, zu welchen der Maire, Jerome Latour, Jean Renaud und dessen Gattin, sowie endlich der Geistliche von Blancbois gehörten, ebenfalls als der todtgeglaubte Marouty rekognoszirt.
Die mit ihm angestellten Verhöre bewiesen endlich, nachdem er zuerst frech zu leugnen versucht, daß der Landstreicher mit jenem vor zehn Jahren verschwundenen Marouty identisch, sowie daß er ferner derjenige Verbrecher sei, welcher Jean Renaud zu erschlagen und zu berauben versucht hatte, an Letzterem aber dadurch verhindert worden war, daß er geglaubt hatte, die Schritte von Personen zu vernehmen, welche sich dem Orte seiner That zu nähern schienen. Er hatte sich infolge dessen eiligst in jene Erdhütte zurückgezogen, welche er selbst vier Wochen vor seiner That entdeckt und seitdem bewohnt hatte. Seit seinem Verschwinden aus La Grange hatte er sich bettelnd und stehlend in den verschiedensten Gegenden Frankreichs herumgetrieben und war endlich, als er durch einen Zufall erfahren, daß das eine seiner Opfer, Renaud, welchen er bei dem Brande des Barriereschen Hauses umgekommen glaubte, noch lebe, mit dem Plane nach La Grange zurückgekehrt, bei der ersten sich ihm darbietenden Gelegenheit dem Schufte – wie er sich ausdrückte –, welcher an seinem Unglück die Hauptschuld trage, den Garaus zu machen, sowie dessen junger Frau, mit der er noch eine unterbrochene Schäferstunde nachzuholen habe, einen Besuch abzustatten.
Auf die Frage des ihn verhörenden Beamten, weshalb er damals, als er Barrieres Haus angezündet, nicht auch die übrigen Gebäude in Brand gesteckt hätte, antwortete der Bösewicht, daß er keine Ursache gehabt habe, sich an den anderen Bauern zu rächen; denn er wäre ein »schlechter Kerl« gewesen, wenn er Denjenigen Böses hätte thun wollen, die ihm doch nichts gethan hatten!! Würden die Bauern jedoch Miene gemacht haben, ihn in seiner Rache zu hindern, so hätte er natürlicher Weise das ganze Dorf in einen Aschenhaufen verwandelt.
Man machte ihm den Prozeß, und der scheußliche Bösewicht, der eine viel härtere Strafe verdient hatte, wurde, da er zu seinem gräßlichen Verbrechen aufgereizt worden war (!), nur zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt. Und selbst diese sollte ihm erlassen bleiben. Eine ekelhafte Krankheit, welche er sich bei seinem jahrelangen vagabondirenden Leben zugezogen hatte, kam während seiner Untersuchungshaft bei ihm zum Ausbruch, die furchtbaren Schmerzen, welche er durch diese Krankheit zu erdulden hatte und welche die ihn behandelnden Aerzte nicht zu lindern vermochten – vielleicht auch nicht lindern wollten –, war die einzige, aber gerechte Strafe, die ihm die göttliche Gerechtigkeit als Sühne seiner vielen Unthaten zudiktirt hatte; sie war aber auch genügend, um nach dreimonatlichen Qualen das Leben eines Bösewichts zu endigen, welcher noch gegenwärtig im ganzen Departement in der Erinnerung fortlebt unter dem Namen »das Scheusal von La Grange«.
Als Renaud seiner Gattin die Nachricht mittheilte, daß Marouty gestorben sei, sagte er:
– Mein herziges Weib hat doch Recht gehabt mit ihrer Behauptung, daß der Bösewicht von den Todten auferstanden war. Ich aber, der ich Dich verlacht, ich habe die Wahrheit dieser Behauptung praktisch an mir selber durchmachen müssen, so praktisch, daß ich dabei selber beinahe in das Reich der Schatten hinabgestiegen wäre. Doch diesmal darfst Du sicher sein, daß Marouty nicht wieder von den Todten auferstehen wird, oder zweifelst Du etwa noch?
– Nein, erwiderte sie, dem Gatten um den Hals fallend, in ernstem Tone, jetzt bin ich dessen gewiß. Jahrelang habe ich mich gefürchtet, jahrelang mich mit dem Gedanken getragen, daß der Bösewicht eines Tages wieder erscheinen und sich an Dir rächen könnte, und mich um Dich geängstigt; jetzt aber ängstige ich mich nicht mehr – denn Gott selbst hat ihn gerichtet!
