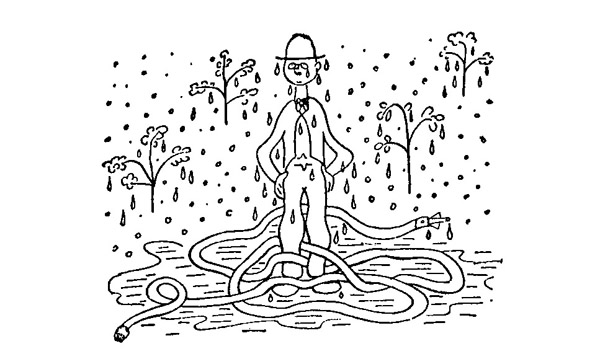|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Nach dem kanonischen Recht der Gärtner pfropft man im Juli die Rosen. Das wird gewöhnlich so gemacht: man bereitet einen wilden Rosenstock, einen Wildling oder eine Unterlage vor, auf der gepfropft werden soll; ferner eine große Menge Bast und schließlich ein Gärtner- oder Baummesser. Hat er alles beisammen, prüft der Gärtner die Schärfe des Baummessers an der Innenseite des Daumens; ist das Baummesser genügend scharf, schneidet es in den Daumen ein und hinterläßt eine klaffende und blutende Wundöffnung. Um diese windet man dann einige Meter Verband, wodurch auf dem Finger eine genügend große und volle Knospe entsteht. Das nennt man Rosen pfropfen. Ist kein wilder Rosenstock zur Hand, kann man sich den oben beschriebenen Schnitt in den Daumen auch bei einer anderen Gelegenheit zufügen, wie beim Zurichten der Stecklinge, Abschneiden der Wasserreiser oder abgeblühten Schäfte, Stutzen der Sträucher und ähnliches.

Nachdem er so das Okulieren der Rosen beendet hat, merkt der Gärtner, daß er die durch die Hitze ausgetrocknete und verhärtete Erde wieder auflockern sollte. Das wird ungefähr sechsmal im Jahre gemacht, und jedesmal wirft der Gärtner eine Unmenge Steine und anderen Unrat heraus. Diese Steine entstehen anscheinend aus irgendwelchen Samen oder Eiern, oder steigen beständig aus geheimnisvollen Erdtiefen herauf; vielleicht schwitzt die Erde die Steine irgendwie aus. Der Garten- oder Kulturboden, auch Humus oder Mulm genannt, besteht überhaupt aus bestimmten Ingredienzien, wie da sind: Erde, Dünger, verfaulte Blätter, Torf, Steine, Scherben von Biergläsern, zerbrochene Schlüssel, Nägel, Drähte, Knochen, hussitische Pfeile, Stanniol von Schokolade, Ziegel, alte Münzen, alte Pfeifen, Tafelglas, Spiegel, alte Namenstäfelchen, Blechgefäße, Bindfäden, Knöpfe, Schuhsohlen, Hundekot, Kohle, Topfhenkel, Waschschüsseln, Abwischtücher, Fläschchen, Kannen, Schnallen, Hufe, leere Konservenbüchsen, Isolatoren, Stücke von Zeitungen und unzählige andere Dinge, die der überraschte Gärtner bei jedem Auflockern aus seinen Beeten gewinnt. Vielleicht gräbt er einmal unter seinen Tulpen einen amerikanischen Ofen, Attilas Grab oder die Sibyllinischen Bücher aus; im Kulturboden kann man alles finden.
Aber die Hauptsorge im Juli bleibt allerdings das Begießen und Spritzen des Gartens. Begießt der Gärtner mit Gießkannen, zählt er die Kannen, so wie der Automobilist die Kilometer. »Uff«, erklärt er mit dem Stolz eines Rekordmanns, »heute habe ich fünfundvierzig Kannen geschleppt.« Wüßtet ihr doch, was das für eine Wohltat ist, wenn das kühle schäumende Wasser auf den ausgetrockneten Boden rieselt; wenn es gegen Abend auf den Blüten und Blättern, die von der eifrigen Dusche ganz schwer sind, funkelt; wenn dann der ganze Garten feucht und erleichtert aufatmet, so wie ein durstiger Wanderer aufatmet. – »Ahahah«, sagt der Wanderer, sich das Naß vom Barte wischend, »Donnerwetter, war das ein Durst. Wirtschaft, noch eins!« Und gleich läuft der Gärtner noch um eine Kanne für diesen julimäßigen Durst.
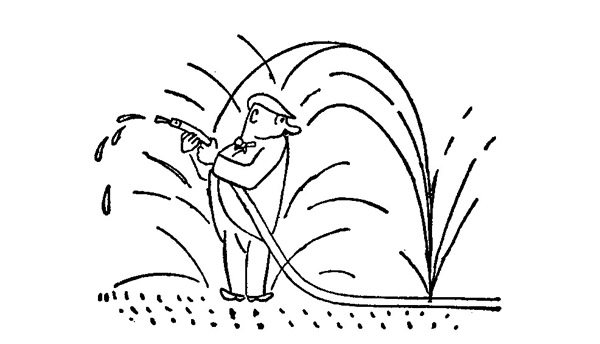
Mit einem Hydranten und einem Schlauch kann man allerdings schneller und großzügiger begießen, in verhältnismäßig kurzer Zeit bespritzt man nicht nur die Beete, sondern auch den Rasen, die Familie des Nachbarn, die gerade vespert, die Fußgänger auf der Straße, das Innere des Hauses, alle Familienmitglieder und am ausgiebigsten sich selbst. So ein Wasserstrahl aus dem Hydranten hat eine erstaunliche Wirkung, fast so wie ein Maschinengewehr; in einem Augenblick kann man damit eine Grube in der Erde auswaschen, die Perennen abmähen und die Kronen der Bäume herunterreißen. Außerordentlich erfrischend ist es, mit dem Schlauch gegen den Wind zu spritzen; das ist geradezu eine Wasserkur, so durch und durch naß wird man davon. Einen besonderen Gefallen findet der Schlauch daran, irgendwo in der Mitte ein Loch zu haben, wo man es am wenigsten vermutet. Dann steht man wie ein Wassergott inmitten der ausschießenden Strahlen, zu Füßen die zusammengerollte Seeschlange: ein überwältigender Anblick. Fühlt man sich sodann bis auf die Haut durchnäßt, erklärt man zufrieden, der Garten habe genug, und geht die Kleider trocknen. Indessen aber sagt der Garten bloß »Uff«, saugt die Fontäne ohne auch nur zu zucken ein und ist wieder trocken und durstig wie zuvor.

Die deutsche Philosophie behauptet, die grobe Wirklichkeit sei nur das, was ist, während das höhere, sittliche Gesetz »das Sein-Sollende« verkörpert. Der Gärtner also anerkennt besonders im Juli dieses höhere Gesetz und weiß sehr gut, was sein sollte. »Es sollte regnen«, sagt der Gärtner in seiner ausdrucksvollen Art.
Das ist nun einmal so: wenn es die sogenannten lebenspendenden Sonnenstrahlen auf über 50 Grad Celsius bringen, das Gras gelb wird, die Blätter an den Blumenstauden vertrocknen und die Äste der Baume, vor Durst und Hitze erschlafft, verdorren, wenn die Erde springt, steinhart wird oder in brennend heißen Staub zerfällt, geschieht in der Regel folgendes: 1. platzt der Schlauch, so daß der Gärtner nicht spritzen kann, 2. gibt es eine Störung im Wasserwerk, so daß überhaupt kein Wasser fließt.
In einer solchen Zeit netzt der Gärtner die Erde vergebens mit seinem Schweiß; stellt euch nur vor, wie er schwitzen müßte, damit es, sagen wir, wenigstens für einen kleinen Rasen reichte. Auch schimpfen, ja sogar fluchen, lästern und wütend ausspucken hilft da nichts, selbst wenn man mit jedem Spucken in den Garten hinausläuft (jeder Tropfen Feuchtigkeit ist gut!). Da also nimmt der Gärtner zu jenem höheren Gesetz seine Zuflucht und beginnt fatalistisch zu sagen: »Es sollte regnen!«
»Und wohin fahren Sie heuer auf Sommerfrische?«
»Ach, das ist meine geringste Sorge, regnen sollte es.«
»Und was sagen Sie zur Demission des Finanzministers?«
»Regnen sollte es, sage ich.«
Mein Lieber, wenn man sich so einen schönen Novemberregen vorstellt; vier, fünf, sechs Tage rauschen die kühlen Regenfäden nieder; es ist trüb und naßkalt, rinnt in die Schuhe, patscht unter den Füßen und dringt bis in die Knochen. – Wie gesagt, regnen sollte es.

Rosen und Flammenblumen, Sonnenbraut und Mädchenauge, Taglilie, Siegwurz, Glockenblumen und Eisenhut, Glockenwurz, Porst und Wucherblume – Gott sei Dank, es blüht noch genug, trotz der schlechten Verhältnisse. Immerfort blüht und verblüht etwas. Immerfort muß man die verblühten Stengel abschneiden und brummt dabei (zur Blume, keineswegs zu sich selbst): »Mit dir ist's auch schon Amen.«
Seht nur, diese Blumen, sind sie nicht wirklich wie die Frauen, so schön und frisch, die Augen könnte man sich an ihnen aussehen, und dennoch sieht man niemals ihre ganze Schönheit; etwas entgeht einem immer. Mein Gott, jede Schönheit ist so unersättlich! Aber sobald sie zu verblühen anfangen, ich weiß nicht, da halten sie schon gar nichts mehr auf sich (ich spreche von den Blumen), und wenn man grob sein wollte, würde man sagen, daß sie wie eine Schlampe aussehen. Ach, wie schade, meine liebliche Schöne (ich spreche von den Blumen), wie schade, daß die Zeit so vergeht; die Schönheit vergeht und nur der Gärtner besteht. Des Gärtners Herbst beginnt schon im März: mit dem ersten verblühten Schneeglöckchen.