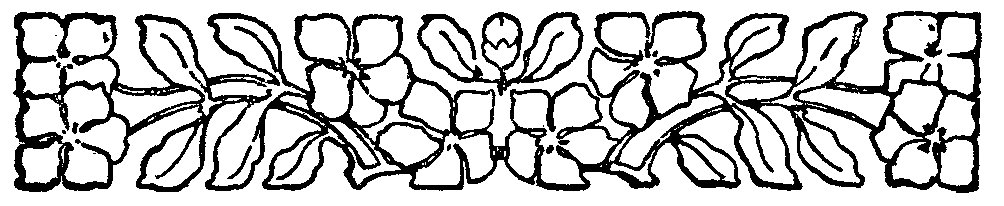|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wie so bunt der Kram gewesen,
Musterkarte, gib's zu lesen!
Goethe
Das Gastmahl im Hause des Kammerpräsidenten von Kalb nahm einen sehr befriedigenden Verlauf.
Mit dem Aufwande aller zu Gebote stehenden Mittel war im besten Zimmer die Tafel hergerichtet. Die Kammerpräsidentin hatte mit ihrer Schwiegertochter die nötigen Küchenanweisungen gegeben und die Dienerschaft angeleitet, während Gustchen für eine gefällige Außenseite und den Schmuck des Ganzen sorgte. Jeder grüne Zweig, den der November noch im Garten gelassen hatte, fiel unter ihrer Schere, ja sie entäußerte sich sogar einiger Blüten ihres dunkelroten Geraniums, um zierliche Sträuße für den Herzog und Goethe zu binden, und gab sich dabei der Hoffnung hin, einen, vielleicht beide Sträuße zu sich zurückkehren zu sehen.
Die gewünschten Gäste waren alle erschienen. Der Herzog hatte seinen Platz neben der Frau vom Hause und der jungen und reizenden Frau von Werthern, die, auf seinen Wunsch von Auguste eingeladen, mit Freuden gekommen war.
Emilie von Werthern, gewöhnlich Milli genannt, war mittelgroß und zart gebaut, ihr lebhaftes, blitzendes Auge, die dunkle, feingezeichnete Braue, die kleine gebogene Nase, der zarte, leidenschaftlich zuckende Mund, das rasch wechselnde Farben- und Mienenspiel machten ein höchst anziehendes Ganze. Man nannte sie kokett und tadelte ihr Suchen und Haschen nach jedem Vergnügen; doch ließ sich zu ihrer Entschuldigung anführen, daß sie mit einem viel älteren, rohen Manne verheiratet und kinderlos war.
Ihrer ganzen Anlage nach eine echte Enthusiastin, schien sie zu allem fähig, wenn ihr Gefühl angeregt wurde. Für und wider Partei nehmend, auflodernd, bebend und jubelnd, liebeselig sich anschmiegend, war sie zugleich schwankend in ihren Neigungen, zaghaft und zusammensinkend wie ein verlöschendes Strohfeuer. Eine solche Frau übte eine große Anziehungskraft auf den jungen, lebhaften Herzog. Auch an dem heutigen Mittage brach die Unterhaltung zwischen den beiden selten ab. Dem Herzog gegenüber saß Goethe zwischen Gustchen Kalb und Wieland. Auguste hatte sich glänzende Erfolge von dem heutigen Mittage versprochen, es blieb aber bei einigen flüchtigen Artigkeiten von Goethes Seite, und sie war genötigt, sich mit den ihr verehrten roten Geranien zu begnügen oder ihrem anderen Nachbar, dem Oberforstmeister von Wedel, ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Goethes Teilnahme wurde durch die Bekanntschaft mit Wieland in Anspruch genommen. Obgleich beide Männer im Alter, in der äußeren Erscheinung, im Denken und Leben durchaus verschieden waren, auch schon auf dem literarischen Kriegsfuß gestanden hatten – so fanden sie beide, bei diesem ersten persönlichen Zusammentreffen, doch so viele gleiche Interessen, daß sie sich eifrig miteinander beschäftigten.
Der Hofrat Wieland zählte damals zweiundvierzig Jahre, seine zarte Gestalt, das Saubere, Wohlgepflegte der ganzen Erscheinung hatte ihm den Beinamen: »Die zierliche Jungfrau« erworben, ein Titel, auf den er einigen Wert legte. Seit drei Jahren von der Herzogin- Mutter nach Weimar berufen, hatte er unter Aufsicht des Grafen Görtz die Erziehung Karl Augusts geleitet. Er galt wegen seiner heiteren Milde, seiner freundlichen Herzensgüte und auch als achtbarer Vater einer zahlreichen Familie bei seinem Zögling und besonders bei der Herzogin Anna Amalie außerordentlich viel. Man schätzte ihn als Menschen und Dichter gleich hoch und hatte den gegen ihn gerichteten Angriff Goethes dem jüngeren Mann übel genommen.
Wieland gegenüber, an der anderen Seite der Frau von Werthern, saß der junge Hildebrand von Einsiedel, im Pageninstitute zu Weimar erzogen, seit vier Wochen aber vom Herzog zum Hofrat ernannt. Welch ein feines, träumerisches Gesicht! Welch ein Ausdruck poetischer Versunkenheit in den tiefen, dunklen Augen! Welch zierlich anmutige Gestalt mit nachlässiger Haltung. Zerstreut spielten seine Finger mit einigen Brotkrumen oder bogen die herabhängenden Enden seiner weißen, spitzenbesetzten Krawatte in kleine Falten. Seine künstlerische Begabung war nicht unbedeutend; er liebte leidenschaftlich die Musik, spielte Violoncell mit Meisterschaft, komponierte und sang, auch versuchte er sich in der Poesie, fertigte Gelegenheitsgedichte und dramatische Sachen. Die Bekanntschaft mit dem vielbesprochenen Goethe interessierte ihn, und er folgte mit großer Aufmerksamkeit der Unterhaltung ihm gegenüber.
Neben Einsiedel auf der anderen Seite saß der Pagenhofmeister Musäus, jetzt Professor am Gymnasium. Ein vierzigjähriger, heiterer, harmloser Mann, aller Übertreibung und Gefühlsschwelgerei abgeneigt; er hatte mancherlei geschrieben und beschäftigte sich jetzt damit, die Volksmärchen der Deutschen zu sammeln und auf seine Art zu überarbeiten. Lebhaft beteiligte er sich an den literarischen Streitfragen und polemisierte eifrig gegen Lavater, dessen Lehren damals die Gemüter beherrschten und auch in Weimar enthusiastische Anhänger fanden.
Endlich wurde das Mahl aufgehoben und darauf die Unterhaltung in Gruppen vertraulich weitergeführt.
Der Herzog sprach noch an einem Fenster stehend mit Frau von Werthern, als Wieland mit geröteten Wangen und begeistert blitzenden Augen zu ihnen herantrat.
»Welch ein Mensch!« rief er lebhaft. »O mein teurer gnädiger Herr! Was soll ich Ihnen sagen? Wie ganz dieser Wolfgang beim ersten Anblick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in ihn bin, seit ich mit diesem herrlichen Jüngling geredet habe! Ja, meine Seele ist seit dem heutigen Mittag so voll von Goethe, wie ein Tautropfen von der Morgensonne!«
Karl August lächelte vergnügt.
»So ist es recht, mein alter ›Mentor‹«, entgegnete er. »Liebt euch, vertragt euch und laßt mich mit in eurer Liebe froh sein!«
Goethe trat in den Garten hinaus; es wurde ihm – umringt von dem aufgeregten Kreise, als dessen Mittelpunkt er sich fühlen mußte – zu eng und warm im Saal.
Gustchen Kalb huschte mit einem Glutblick an ihm vorüber. Draußen schien es den beiden Erhitzten milder geworden zu sein.
Einladend lag der Garten da, beglänzt von den letzten Strahlen der scheidenden Sonne. Das Boskett war durchsichtig kahl; rote und gelbe Blätter flatterten an den Zweigen oder tanzten im Luftzuge auf dem Rasen.
Goethe fühlte, daß er seine hübsche Nachbarin während des Mittagessens vernachlässigt habe, und deshalb folgte er ihr rasch.
Nach wenigen Schritten hatte er sie eingeholt und fragte, jetzt geschickt das Blatt wendend, warum sie ihn fliehe?
Das junge Mädchen entgegnete schmollend: »O, um Ihnen nicht lästig zu werden!«
Sie sah recht frisch und anziehend aus in diesem Augenblick, mit dem verdrießlich schelmischen Zug um den vollen Mund und dem unter gesenkten Wimpern hervorblitzenden Auge.
Goethe lachte und antwortete: »Soll man Ihnen glauben, daß Sie sich dieses zutrauen? Sie haben gewiß nie in den Spiegel gesehen und halten sich für abschreckend. Ich will Ihnen zum Trost sagen, daß dem nicht so ist. Wenn Sie sich mir entziehen, Gustchen, so laufe ich Ihnen durch die halbe Welt nach und hole Sie ein.«
»Versuchen Sie's!« rief sie neckisch und flog durch die blätterbestreuten, raschelnden Gartenwege.
Er folgte ihr und obgleich sie nicht schnell oder gewandt lief, so dauerte es doch einige Minuten – vielleicht wollte er es so – bis er sie einholte.
In einem kleinen Tannendickicht fing er sie, hielt sie mit beiden Armen fest und versicherte, er werde sie nicht eher loslassen, als bis sie zur Strafe für ihren Zweifel und den Gedanken an die Möglichkeit, ihm lästig zu werden, sich mit einem Kuß ausgelöst habe.
Gustchen wand und wehrte sich freilich, aber ein Blick in seine Augen machte sie gefügig, und sie erwiderte den Kuß des schönen Jünglings mit warmer Hingabe. Dann begann sie aufs neue zu fliehen, und wer weiß, wie oft sich das lohnende Spiel mit Haschen und Pfandgeben noch wiederholt hätte, wäre nicht plötzlich Christel Laßberg am Fenster des Nachbarhauses erschienen. Auguste war einen Augenblick erschrocken; sie näherte sich aber dann mit Goethe dem Fenster der unerwünschten Lauscherin. In einer Anwandlung gutmütiger Rücksicht für die Freundin rief sie nickend und winkend hinauf: Christel möge in den Garten kommen. Dann führte Gustchen den Genossen durch die Stachelbeerhecke.
»Wir machen ihr ein Vergnügen,« sagte sie, ihres Vorteils wohl bewußt; »das arme Ding lebt da wie im Käfig und ist so träumerisch und harmlos, daß wir plaudern können, was wir wollen, wenn wir bei ihr sind.«
Am Brunnen vor der Gartenstube traf man sich. Auguste hatte die Freundin nicht falsch beschuldigt; Christel erschien wortkarger und in sich versunkener denn je. Sie saß scheinbar teilnahmlos und mit niedergeschlagenen Augen auf einer Stufe zur Seite.
Die Blicke des erregten jungen Mannes kehrten unbefriedigt von dieser farblosen Knospe zu der strahlenden Blüte an seiner Seite zurück. Nach wenigen Versuchen, Christel mit in die Unterhaltung zu ziehen – die alle an ihrer scheuen Einsilbigkeit scheiterten – vergaß man ihrer Nähe und gab sich einem Geplauder hin, das durch den gewährten Kuß an Wärme und Ungezwungenheit gewann und beide Teile gleich gut unterhielt.
Endlich, als es bereits anfing zu dämmern, hörte man im Nachbargarten verschiedene Stimmen, dann den Herzog laut nach Goethe rufen, worauf das junge Paar zur Gesellschaft zurückeilte.
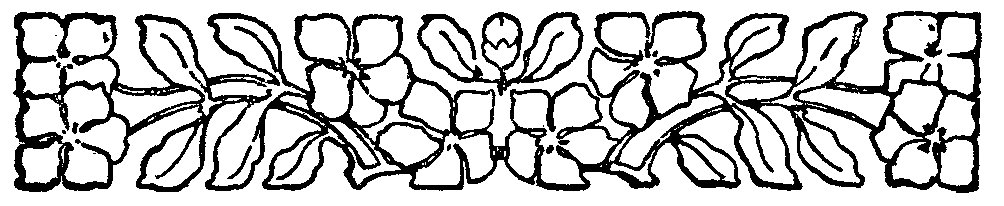
Was heißt schonender Tadel? Der deinen Fehler verkleinert?
Zugedeckt? Nein, der sich selber über den Fehler erhebt!
Halte dich im Stillen rein
Und laß es um dich wettern;
Je mehr du fühlst ein Mensch zu sein,
Desto ähnlicher bist du den Göttern.
Goethe.
»Kind, liebe Milli, ich will dich nicht kränken,« sagte eine würdige alte Dame, die in der Ecke ihres kleinen Sofas saß. Und sanft die tränenfeuchten Wangen der vor ihr knieenden Frau von Werthern streichelnd, fuhr sie fort: »Ich weiß, daß sich viel zu deiner Entschuldigung anführen läßt, und habe mich deswegen nie in eure häuslichen Verhältnisse gemischt. Ja, ich weiß, liebes Milchen, daß die Sitten immer lockerer werden, daß es wenige junge Frauen in Weimar gibt, welche nicht ihre ›Geschichten‹ haben. Sie wollen ihren süßen Liebesrausch mehrmals genießen. Es gibt so viele böse Beispiele um dich her, du bist lebhaft, jung und hübsch« – ein schwerer Seufzer entrang sich hier der alten Dame – »mein Sohn ist vielleicht nicht immer gegen dich, wie er sein sollte: sieh, Emilie, deshalb, aus allen diesen Gründen, welche mein armes Mutterherz beängstigen, nur deshalb rede ich jetzt so mit dir.«
Das getadelte junge Weib war wie geknickt mit gefalteten, vor die Augen gepreßten Händen auf das Kissen zu den Füßen der Mutter hingesunken.
Die alte Frau von Werthern hatte es bis jetzt schonend vermieden, mit ihrer Schwiegertochter deren eheliches Verhältnis zu besprechen. Sie fürchtete die festere Gestalt des Ausgesprochenen. Jetzt aber hielt sie eine Warnung für notwendig, da man Emilie beschuldigte, sie trachte, die junge Ehe ihres Fürsten zu stören; sie kokettiere mit dem Herzoge, sie dränge sich in die Gesellschaft der Männer. Ihre Gegenwart bei dem Kalbschen Herrendiner, ja, daß sie am Mittwoch abend wieder zum Tanz dort gewesen und Karl August nicht von ihrer Seite gewichen sei, regten die alte Dame schmerzlich auf.
Es hatte immer ein inniges Verhältnis zwischen Emilie und ihrer Schwiegermutter bestanden? alles war bisher zwischen ihnen besprochen worden, nie aber das nächste: der Sohn und Gatte. Ob Frau von Werthern diesen Sohn liebte? Er stammte aus der ersten Ehe ihres Mannes und war von zu roher Art, als daß eine edle Frau an ihm hätte Gefallen finden können. Die Rücksichten, welche er auf seine Stiefmutter nahm, waren durch Eigennutz bedingt; das Vermögen seines Vaters reichte nicht aus, seine kostspieligen Neigungen zu befriedigen. Die Mutter war sehr wohlhabend, freigebig dazu, kein Wunder, daß er jetzt auf ihre Zuschüsse, später auf die reiche Erbschaft spekulierte.
Nach dem Ausbruch verletzter Gefühle von seiten der jungen Frau ließ die Matrone ruhig eine Zeit der Sammlung verstreichen; sie hatte besänftigend ihre Hand auf die dunklen Locken der vor ihr Knieenden gelegt und blickte mit unendlichem Mitleid auf sie hinab.
Als Emilie das schmerzerfüllte Auge zur Mutter emporschlug, hätschelte diese sie wie ein Kind und sagte: »Ich weiß ja, mein Milchen, daß er nicht gut mit dir ist; ich weiß, daß er schuld hat; aber wenn er auch fehlte, so möchte ich doch meinen Liebling davor bewahren.«
»Liebe, gute Mutter!« stammelte die junge Frau, sich an sie schmiegend.
»Laß uns ohne Heftigkeit die Verhältnisse besprechen,« fuhr die alte Dame milde fort. »Ich sagte dir schon, daß ich nichts von den groben Beschuldigungen glaube, die von Übelwollenden ersonnen werden. Aber die Pflichten einer jungen Frau reichen weit und sind fein gesponnen; sie gleichen einem zarten, luftigen Schleier, in den ihr ganzes Wesen sich hüllen soll; entsteht nur ein kleiner Riß in dem kostbaren Gewebe, so zerrt die plumpe Hand der Menschen daran, und ohne daß die Trägerin es will oder weiß, ist ein Stückchen nach dem anderen von dem feinen Stoff zerfetzt. Sie steht zuletzt da, bloß und schutzlos allen Angriffen ausgesetzt. Daher hülle dich vorsichtig ein, mein Herzenskind, laß keine Seele ahnen, wie wenig dein Gatte und dein einsames Haus dich befriedigen, und halte deinen guten Namen unantastbar rein!«
»Und mein Glück, mein Lebensglück!« jammerte das junge Weib leise.
Die Matrone hatte nur an das Sollen, nicht an das Wollen und Begehren eines glühenden jungen Herzens gedacht.
»Die Pflichterfüllung wird dich glücklich machen!« sprach sie zum ersten Male in einem strengeren Tone.
Emilie richtete sich auf. »O, mein Leben ist jammervoll öde!« klagte sie. »Mutter, ich wollte, ich wäre tot!«
In der vorigen Weise fuhr die Greisin fort: »Du weißt, wie ich dich liebe! Mein Herz hängt nur an dir, aber ich möchte dich zehnmal lieber im Sarge sehen, als dich wirklich einer Pflichtverletzung schuldig wissen; das würde mich elend machen und schmerzbeladen in die Grube stürzen.«
Emilie schauderte. »Nie, nie will ich Ihnen den Kummer bereiten!« rief sie leidenschaftlich. »Ich schwöre es bei meiner ewigen Seligkeit! Nie sollen Sie sich meiner schämen; eher sterben als das!«
Eine lebhafte Umarmung folgte.
»Wohlan, mein Kind,« sagte endlich die Mutter, »so will ich alles versuchen, um auf meinen Sohn zu deinen Gunsten zu wirken. Er soll in dir meine alleinige Erbin respektieren, und was er von mir wünscht, nur durch dich erlangen, vielleicht wird das ihn zügeln.«
Nach und nach bewegte sich die Unterhaltung der beiden Frauen in ruhigeren Bahnen.
Die alte Frau ließ sich von Haus und Garten und einer neuen Einrichtung erzählen, welche vom Rittmeister getroffen war. Er hatte Geld gebraucht und gefunden, daß in dem der Mama gehörigen und von ihr für das junge Paar hergerichteten Hause einige Zimmer entbehrlich wären. Die junge Frau hatte sich beschränken müssen, und ein Mieter war in der Person des Bergrats Moritz von Einsiedel eingezogen.
Der neue Hausgenosse – Bruder des jungen Hofrats Hildebrand von Einsiedel – war ein Mann von sechsundzwanzig Jahren, ruhig, verschlossen, solid in jeder Hinsicht. Seine Anstellung im Bergfache hielt ihn oft monatelang von Weimar entfernt; der Rittmeister nannte ihn seinen Philister oder auch gar seine Schlafmütze. Einsiedel ließ sich durch keine Neckerei stören; er lächelte melancholisch und schwieg. Eifrig mit chemischen und mineralogischen Studien beschäftigt, zeigte er sich selten in Gesellschaften, tanzte gar nicht und bekümmerte sich um das schöne Geschlecht sehr wenig.
»War der Bergrat nicht bei Kalbs?« fragte die Matrone, »es ist sonderbar, daß man immer den jüngeren Bruder vorzieht.«
»Hildebrand ist einmal gut angeschrieben beim Herzoge. Ich glaube, Moritz ist ihm zu verständig, zu brav.«
»Man sagt, er sei steif und langweilig in Gesellschaften?«
»Er ist kein Geck, aber er hat mehr Geist in seinem Auge, als ein Dutzend anderer Männer zusammen.«
»Es ist schade, daß ich ihn so wenig kenne; da er bei euch wohnt, interessiere ich mich für ihn.«
»O, er verdient Ihr Interesse, teure Mama!«
»Ist er artig gegen dich?«
»Nein, er beachtet mich gar nicht, er ist immer beschäftigt; wir wechseln selten ein Wort.«
Die alte Dame fühlte sich von der Seite nicht beunruhigt. Eine kleine Verehrung aus der Ferne von ihr, dachte sie. Er ist zu beschäftigt, zu hypochondrisch, um einer jungen Frau gefährlich zu werden. Wenn ich nur über den Herzog ruhig sein kann, ist alles andere nebensächlich. Inniger denn je trennten sich die Frauen.
Am Nachmittage klirrten schwere Schritte im Vorzimmer der alten Frau von Werthern, sie kannte dieselben genau und erhob sich ein wenig, um den eintretenden Sohn zu begrüßen.
Der Rittmeister von Werthern war groß, breitschultrig und etwa vierzig Jahre alt. Seine roten und aufgedunsenen Züge, die unsteten Augen, das plumpe, derbe Auftreten sprachen von zügellosem Leben. Er schüttelte die Hand der alten Dame so heftig, daß ihr Mund sich schmerzlich verzog, und fragte dabei, wie sich seine verehrte Mutter befinde.
»Gut, mein Sohn,« entgegnete sie. »Ich freue mich, dich wiederzusehen; habe die Güte, dich zu mir zu setzen, und erzähle mir von deiner Reise und wann du zurückgekommen bist.«
Der Rittmeister warf sich auf einen Stuhl und stieß den Mops, der sich an ihn schmiegte, mit seinen gewaltigen Sporen plump zur Seite. Dann sprach er, sorgsam seinen schwarzen Bart streichend: »Diesen Morgen, in einem Trabe von Rudolstadt; habe dann gegessen und da bin ich. Möchte 'ne Geschäftssache mit Ihnen abreden, ist ein wenig eilig. Machte nur deshalb den scharfen Ritt und riskierte den Hektor – denn, um kurz zu sein, Sie werden von einem Soldaten keine lange Vorrede erwarten, Frau Mutter – ich bedarf eines Darlehns von Ihnen, um einen ausgezeichneten Handel abzuschließen.
»Steht da eine Fuchsstute in Rudolstadt, in die ich keineswegs verliebt bin. Kapitales Tier, ganz Pferd, knochig genug für einen Reiter wie ich, aber dabei elegant; süperbe Nachhand, ein Schweifträger erster Qualität, hoch von Hals und Widerrist, Sattellage und Nieren comme il faut, gute Zäumung, ganz rein und trocken von Knochen, sechs Jahre alt; der Preis ist mäßig, und ich könnte es mir nie vergeben, wenn ich diese Gelegenheit, ein brillantes Geschäft zu machen, ungenutzt vorübergehen ließe. Stein reflektiert für des Herzogs Stall auf den Gaul, doch hat er erst einen Boten herübergeschickt; währenddessen habe ich den Fuchs vorläufig bis morgen früh für mich angebunden. Ich weiß, bei Ihnen werden gewiß zwanzig Louisdor flott zu machen sein; sobald ich das Geld habe, sitze ich wieder auf.«
Die alte Dame hatte still und unbeweglich zugehört; sie fütterte ihren Mops mit etwas Zuckerbrot und wiegte jetzt nachdenklich den Kopf.
»Die Geldgeschäfte werden mir mehr und mehr lästig,« sagte sie ruhig, »da habe ich denn an diesem Morgen mit Emilie ausgemacht, daß sie meine Kasse führen, nachsehen, größere Ausgaben bestimmen, kurz, mein Finanzminister sein soll. Ich kann nicht gleich, da es kaum getroffen, gegen unser Abkommen handeln, es wird also ganz auf deine Frau ankommen, ob wir die erwünschte Gefälligkeit für dich haben können.«
Der Rittmeister starrte sie an; seine Stirnadel schwoll und heftig rief er: »Das ist ein Weiberkomplott gegen mich! Was soll das bedeuten? Emilie, diese kleine Putznärrin, verwaltet das Geld! Wollen Sie lauter Unterröcke dafür kaufen?«
»Ebenso gern wie Pferde,« sagte die Matrone gelassen.
Werthern sprang auf. Stampfend und klirrend lief er im Zimmer umher. Dann blieb er vor der Mutter stehen und sagte, sich gewaltsam beherrschend: »Dahinter steckt etwas. Sagen Sie's kurz, woran ich bin. Wollen Sie mich zu irgend etwas zwingen? Oder wollen Sie mich nur demütigen und beleidigen?«
»Du hast richtig erraten, daß ich etwas Besonderes bezwecke,« erwiderte sie. »Ich kenne deine Bedürfnisse, kenne deine Schätzung des Geldes und hoffe, deiner Frau, indem ich ihr den Reiz des Besitzes leihe, zu neuem Ansehen bei dir zu verhelfen. Du wirst mir zu gleichgültig gegen Milli; du kümmerst dich gar nicht mehr um sie; meine Bitten haben dich nicht zu ihr zurückgeführt, vielleicht tut es mein Geld. Du siehst, ich spiele mit offenen Karten und hoffe mein Spiel zu gewinnen.«
»Hat sie zu klagen gewagt, diese Törin?«
»Man braucht mir eure Verhältnisse weder zu erzählen, noch zu klagen; ich kenne sie, die ganze Stadt kennt sie. Alle Welt sieht, daß ihr jeder euren eigenen Weg einschlagt; und das ist keine Ehe, wie sie sein soll.«
»Was geht's die Welt an, ob wir miteinander auskommen? Ich will Freiheit! Emilie scheint sich gut zu amüsieren; mir kann eine zimperliche Frau, welche sich an mich hängt und mir vorlamentiert, nichts helfen; lassen Sie uns also gewähren!«
»Denkst du nie an deine Pflicht diesem jungen, schönen, dir anvertrauten Geschöpfe gegenüber?«
Der Rittmeister zuckte die Achseln. »Frau Mutter, ich bin eilig!« rief er, »die Moral ein andermal! Verlangen Sie, daß ich meine Frau auf offenem Markte küsse, oder was soll es sein? Handeln wir!«
»Gut,« antwortete die alte Frau mit schmerzlichem Ernst, »ich sehe, daß ich heute den rechten Weg eingeschlagen habe, mit dir zu verkehren. Die zwanzig Louisdor sind zu deiner Verfügung, wenn du mir dein Wort gibst, während der nächsten zwei Monate deine Frau in jede Gesellschaft zu begleiten, in welche sie zu gehen wünscht – also während dieser Zeit dich nie über einen Tag von ihr zu entfernen.«
»Sträflich langweilig! Aber wenn es nicht anders sein kann und mir damit das Geld geschenkt ist, so bin ich im stande, der süperben Fuchsstute das Opfer zu bringen.«
Die Mutter stand auf und ging an ihren glänzend ausgelegten Nußbaumschrank; nachdem sie ein paar Reihen aufgeschrieben und das Geld abgezählt hatte, legte sie den sonderbaren Kontrakt ihrem Sohne vor; dieser unterzeichnete ernsthaft und mit langen, schwerfälligen Buchstaben seinen Namen und strich das Geld vergnügt ein.
Spöttisch auflachend, rief er: »Sie wird mich nicht von ihrer Kontusche los! Die ganze Stadt soll Wunder schreien über einen so verwandelten Ehemann!«
Sein Dank war kurz und gleichgültig; er hatte sich ja das Geld verdienen müssen.
Möglichst rasch empfahl er sich und polterte mit Säbel und Sporen klirrend zum Hause hinaus.
Die alte Dame sah ihm tiefbetrübt nach.
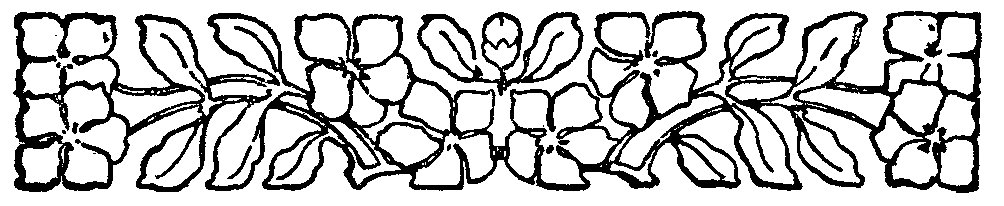
Ist das Chaos doch, beim Himmel!
Wie ein Maskenball zu achten.
Welch ein wunderlich Getümmel
Allerlei verschiedner Trachten!
Goethe.
Den nächsten Tag brachte Goethe größtenteils bei dem Herzoge im Fürstenhause zu; es drängte ihn, der Herzogin Luise seine Aufwartung zu machen, deren Bild ihm im Glanz idealer Reinheit und edelster Weiblichkeit vorschwebte.
In einem hübsch ausgestatteten Salon des ersten Stocks im Fürstenhause saß um die Mittagsstunde Luise von Hessen-Darmstadt mit ihren beiden Hofdamen Henriette von Wöllwarth und Adelaide von Waldner. Die Herzogin war eine schlanke, fast magere Gestalt und achtzehn Jahre alt; ihr ernstes blaues Auge, ihre matte Gesichtsfarbe, die stille Gleichmäßigkeit ihrer Züge und ihres Benehmens gaben ihr etwas knospenhaft Unentwickeltes. Sie trug nach dem Zeitgeschmack ein weißes Batistkleid, einen goldenen Gürtel, lange Filethandschuhe ohne Finger und ein umgestecktes Spitzentuch, ihr hellbraunes Haar war mit einem goldenen Kamm aufgenommen.
Die blühende, lachende Adelaide von Waldner sah neben der Fürstin wie eine Rose neben einer Lilie aus.
Henriette von Wöllwarth dagegen, die mit einem Papagei tändelnd am Fenster stand, wäre schwer einer Blume zu vergleichen gewesen; sie hatte etwas durchaus Reales in ihrer stattlich schönen Gestalt und dem gescheiten, kräftig geformten Gesicht; der Blick, welchen sie jetzt auf die beiden Jüngeren richtete, schien zu sagen: »Arme Kinder, ihr langweilt euch entsetzlich, wenn man euch nur helfen könnte!«
In der Tat waren alle drei unbeschäftigt und die Stimmung gedrückt.
Adelaide erzählte von der gestrigen Mittagsgesellschaft bei Kalbs – sie war in der Frühe bei Gustchen gewesen, um näheres zu hören – wurde aber nun allzu oft durch einen mißbilligenden Blick ihrer fein empfindenden und streng denkenden Herrin unterbrochen, so daß die Arme zuletzt selbst nicht mehr wußte, was sie sagen, was nicht sagen dürfe.
»Die letzte Pfandstrafe war sehr komisch, Durchlaucht,« sprach sie jetzt mit einem scheuen Lächeln. »Der Herr Kammerpräsident mußte Milli von Werthern, mitten im Kreise und auf den Knieen, eine Liebeserklärung machen, worauf die ganze Gesellschaft unter Gesang eine Runde um die beiden tanzte, und Emilie endlich den alten Herrn mit einem Kuß erlöste.«
In diesem Augenblick meldete der Lakai: »Seine Durchlaucht der Herr Herzog und Doktor Goethe!«
Luise winkte errötend, und die beiden jungen Männer traten rasch ein.
Der Herzog eilte auf seine Frau zu, küßte mit einer gewissen linkischen Befangenheit ihre Hand und rief strahlenden Auges, den Freund überblickend: »Da hast du unseren Gast, Luise!«
Die Herzogin verneigte sich, ein »Willkommen« flüsternd, der Herzog stellte Goethe den Hofdamen vor, und die kleine Versammlung setzte sich.
Die vielleicht nicht ganz geschlossene Tür aufstoßend, fuhr jetzt plötzlich ein großer, langhaariger Hühnerhund ins Zimmer und auf seinen Herrn, den Herzog, zu. Adelaide kreischte leise und faßte ihr Kleid zusammen, an dem der Hund vorbeirannte; die Herzogin blickte erschrocken und mißbilligend; Goethe stand auf, um das Tier hinauszulassen; der Herzog aber rief: »Laß doch die Diana hier! Kusch dich, Alte, hier zu mir!«
Der Hund, sich umsehend, legte aber freundlich wedelnd seinen großen Kopf auf den Schoß der jungen Herzogin, worauf diese ihn mit allen Zeichen des Widerwillens von sich abwehrte.
Karl August rief ihn jetzt streng zu sich her, das Tier gehorchte, der Frieden schien hergestellt, aber eine gewisse Mißstimmung war durch das Vorspiel in den kleinen Kreis gedrungen.
Luise besann sich soweit, Goethe nach seiner Reise zu fragen, dieser berichtete, wie er in Begleitung des Kammerjunkers von Kalb recht angenehm gefahren sei; der Herzog sagte inzwischen halblaut zu Adelaide von Waldner, ob sie die Einladung zu Kalbs, zum Abendtänzchen, angenommen habe, worauf die Kleine, rosig erglühend, mit strahlenden Augen bejahte. Henriette von Wöllwarth dagegen hatte für diesen Abend den Dienst bei der Herzogin, und man sah es ihr an, daß sie ungern dem lockenden Tanzvergnügen entsagte.
Luise schien das leise Hin und Her, das Geplauder der drei nicht zu bemerken; es entspann sich zwischen ihr und Goethe ein Gespräch, aus dem heimische Erinnerungen herausklangen, die freundliche Bande zwischen den beiden Süddeutschen knüpften. Endlich fragte sie, ob er heute bei Tafel sein werde, und schien angenehm von seinem Ja berührt.
Als die Herren wieder in des Herzogs Zimmer allein waren, konnte Goethe sich nicht enthalten, seinen Gefühlen der Verehrung für die Herzogin Worte zu leihen.
Er nannte ihr Wesen: von Anmut und Würde getragen, ganz fürstlich, und meinte, es werde einem neben ihr wie in der Kirche.
»Du hast recht,« sagte Karl August seufzend, »eine dumpfe, kühle Atmosphäre umgibt sie, in der einem fröstelt!«
Nach dem förmlichen Diner kehrte Goethe zu Kalbs zurück; ihn verlangte, ohne daß er es sich selbst gestand, das muntere, frische Gustchen wiederzusehen.
Er hatte eben in Frankfurt seine Verlobung mit Lili Schönemann gelöst, die ihn nicht so zu lieben gewußt, wie sein glühendes Herz es bedurfte, und kam nach Weimar mit der Sehnsucht, seine wunde Seele auszuheilen, für sein heiß aufquellendes Empfinden endlich ein würdiges, seinem Ideal entsprechendes, weibliches Wesen zu finden! Sein Herz, dem ein großes Gefühl zerstört war, glich einem frisch umgebrochenen Boden, der bereit ist, neue Saat aufzunehmen; wuchs erst eine Narbe, so konnte Neues schwerer Wurzeln schlagen. Seine reiche Natur wußte nicht hin mit der Fülle immer neu sprudelnder Lebenskraft! So sah er jedes schöne Mädchen, das ihm in den Weg trat, mit der inneren Frage an: »Was kannst du mir sein und geben? Bist du's, die meinem hohen Verlangen genügt?«
Goethe traf Auguste von Kalb bald im Garten, wo sie ihn mit neckender Koketterie empfing. Sie sang ihm ein Lied und die Zeit flog beiden unter Scherz und Gelächter dahin. Endlich erinnerte sich der Gast, daß er Wielanden seinen Besuch zugesagt habe, und gab die Tändelei mit der allzu entgegenkommenden Evatochter – innerlich wenig befriedigt – auf.
Der andere Gast in den Mauern Weimars, Luise von Göchhausen, wurde zwar bei ihrem Oheim geduldet, hatte aber keinen leichten Stand; weder Frau Ursula, noch Rohrmann waren freundlich gegen sie, ja sie übertrafen sogar ihren Herrn an mürrischer Abgeschlossenheit. Die junge Dame schien das nicht zu sehen, fügte sich, wo es nötig war, und trat übrigens sicher auf; welche Launen man an ihr versuchte, welche Gesichter man schnitt, an ihrem unverwüstlich guten Humor glitt alles ab.
Der erste aufregende Abend war dem alten Herrn von Göchhausen nicht schlecht bekommen, es zeigten sich keine bedenklichen Symptome, und er bewunderte sich selbst, als er am anderen Morgen Punkt acht Uhr seine Nichte an der Haustür traf, daß er ihr einen so freundlichen »Guten Morgen« zurückgeben konnte. Luise schien dankbar gerührt, sie küßte seine Hand, erkundigte sich, wie er geschlafen habe, und wünschte ihm eine angenehme Promenade.
Bei seiner Rückkehr saß Luise, freundlich lächelnd, neben seinem Frühstück. Als Rohrmann die Pfeife brachte, war sie es, welche dieselbe anzündete; heitere Plauderei würzte das Mahl; am Mittagessen nahm sie teil, als könne es nicht anders sein, und wirklich, die Zeit verging angenehmer als sonst.
Nach zwei Tagen gestand er sich, daß eine solche Gesellschaft sehr erfreulich sei. Aber – eine außergewöhnliche Ordnung der Dinge war es doch; zwei Personen mehr im Hause brachten eine nicht zu rechtfertigende Abweichung von der erprobten Regelmäßigkeit und erhebliche Mehrausgaben.
So beschloß er, zwischen den wichtigen Leibes- und Amtssorgen eine Stunde herauszusuchen, der Herzogin-Witwe seine Aufwartung zu machen und das junge Fräulein vorzustellen, um sie baldmöglichst los zu werden.
Der Herr Oberkämmerer Baron von Göchhausen wurde mit seiner Nichte gnädig empfangen, und die hohe Frau hörte das Lob des Mädchens, die gefühlvoll vorgebrachten Versicherungen seiner »Tendresse« für das einzige Kind des verstorbenen Bruders, mit Teilnahme an.
Auf seine Bitte, die junge Dame als Gesellschaftsfräulein anstellen zu wollen, antwortete die Herzogin mit dem Wunsche, das junge Mädchen öfter und allein zu sehen – ein sehr natürliches Begehren, da Luise bei diesem ersten Besuch fast nur durch ihr beredtes Mienenspiel sprechen konnte.
Man kam überein, daß Fräulein von Göchhausen am Donnerstag nachmittag allein zur Herzogin kommen solle. Dieselbe hatte sehr wohl das helle Licht in den lebhaften Augen, die kaum verhaltene Heiterkeit um den Mund bemerkt, und war einigermaßen gespannt, zu erfahren, was hinter den wenig harmonischen Zügen, diesem halb drolligen, halb ernsten Ausdruck versteckt liegen möge; so wartete sie mit Ungeduld auf den Tag, der ihr vielleicht eine passende Gefährtin bringen sollte.
Luise ihrerseits war entzückt von dem einnehmenden Wesen der Fürstin und begann, alle ihre Wünsche und Hoffnungen an Anna Amalie zu knüpfen.
Der Oberkämmerer aber fühlte sich überzeugt, daß dem Anliegen eines Mannes, wie er war, niemand widerstehen könne.
Der Donnerstag nachmittag kam, die Herzogin saß in ihrem Wohnzimmer an der Staffelei, sie führte nicht ohne Geschick den Pinsel und beschäftigte sich gern mit der Kunst. Sie wurde so sehr von der Arbeit hingenommen, daß sie wenig auf ihren Bibliothekar Jagemann achtete, der ihr vorlas.
Anna Amalie, erst sechsunddreißig Jahre alt, war noch immer eine schöne Frau. Sie besaß lebhafte, sprechende Züge und große, dunkle Augen, der Puder deckte kaum das glänzende Braun ihres reichen Haares, dessen zahllose Löckchen von einem goldenen Reif zusammengehalten wurden.
Nachdem sie eine Weile eifrig gemalt hatte, hielt sie inne. »Wir wollen die Lektüre später fortsetzen,« sagte sie und erhob sich. »Ich erwarte am heutigen Nachmittage einen Besuch, der mich allein finden soll.«
Der Bibliothekar schloß das Buch und zog sich zurück.
Die Herzogin wollte eben nach der Klingel greifen, um das Malgerät forttragen zu lassen, als ihr Kammerdiener eintrat und den Hofrat Wieland meldete.
»Ah, willkommen wie immer!« rief die Herrin erfreut.
Wieland kam, um von seinen Begegnungen mit Goethe zu berichten; zierlich und sauber, wie er stets erschienen, trat er in freudiger Bewegung ein; die Herzogin ging ihm lächelnd entgegen und reichte ihm die Hand zum Kusse.
»Nun, Sie Neidloser, Versöhnlichster!« sprach sie gütig, »ich weiß schon durch meinen Sohn, daß Sie ihm auch nicht widerstehen konnten! Und seit ich den wunderbaren Menschen sah, gebe ich Ihnen recht, man kann ihm nicht gram sein.«
»Also der Herzog führte Goethen bei Eurer Durchlaucht ein?«
»Ja, er hatte mir's versprochen, ihn gleich zu bringen.«
»Und ist Ihnen nicht, als sei ein neuer Stern über uns aufgegangen? O, wenn aus Weimar noch etwas Gescheites wird, ist es allein durch Goethe möglich!«
»Und sein Spottgedicht?.« fragte Anna Amalie neckisch, über Wielands schönen Eifer lächelnd.
»Solche Kerle muß man nicht mit gewöhnlichen Ellen messen! Ich drücke meine Seele an seine Brust und bete Gott an! Ist er doch mit Recht der geniale Feldherr jener feurigen Schar, welche jetzt mit Sturmessausen den deutschen Parnaß erklimmt!«
Die Herzogin bat den erregten Freund, sich zu ihr zu setzen, und ihr Genaueres von dem, was er mit Goethe gesprochen, und welche Empfindungen er gewonnen habe, mitzuteilen.
Wieland berichtete gern, er war ein lebendiger, geistvoller Erzähler und ein nervöser, feinorganisierter Mensch, der durch das Zusammensein mit Goethe von den allerlebendigsten Eindrücken erfüllt war.
Als er von Kalbs, von Goethes Besuch in seinem Hause, von ihren Unterhaltungen eingehend berichtet hatte, entgegnete die Herzogin ernst: »Ein mit solch reicher Fülle begabter Mensch hat sich durchzuarbeiten; man kann an diese gottbegnadigte Größe und Naturkraft nicht mit dem pharisäischen Bewußtsein eigener passiver Sittlichkeit herantreten. Ein voller Becher schäumt beim leisesten Anstoß über, es bleibt aber immer noch ein kräftiger Trunk nach. Wäre er nicht der geniale Stürmer, würde er Karl August nicht fesseln! Möchte diese Verbindung meinem Sohne zum Heil gereichen; hindern kann man ihn nicht, sich dem Ungewöhnlichen zu eigen zu geben!«
Die Unterhaltung wandte sich dann auf andere Gebiete; Anna Amalie erzählte von Luise von Göchhausen, und daß ein gutes Gefühl ihr sage: dies Mädchen passe für sie.
Sie holte einen Brief hervor, den die Markgräfin von Baden ihr übersandt hatte, und reichte ihn dem Vertrauten zum Lesen. Das Schreiben lautete:
»Karlsruhe, den 18. Oktober 1775.
Durchlauchtigste Herzogin!
Eure Liebden wollen allergnädigst excusieren, daß ich mich in einer Affäre an Eure Durchlaucht wende, welche anjetzt mein Gemüt in peinlicher Weise alteriert.
Ein junges Hoffräulein, welches ich während dreier Jahre an meine Person attachiert hatte, mußte uns einer jugendlichen Torheit halber verlassen.
Selbige ist hinausgezogen ohne sichere, konvenable Position für die Zukunft; in der Hoffnung, bei einem Oheim in Weimar, welcher sich bislang nicht um sie kümmerte und ein Sonderling sein soll, Aufnahme zu finden. Die arme Kleine heißt Luise von Göchhausen, ist Waise und ein liebes, drolliges Kind; ah, wir werden sie sehr vermissen!
Mein Ansuchen geht nun dahin, daß Eure Liebden huldvollst geruhen möchten, sich über das Schicksal besagten Frauenzimmers zu informieren, und wenn tunlich, Dero schützende Hand über sie zu breiten.
Gestatten Eure Durchlaucht mir, hinzuzufügen, daß man Dero hohem Schutze keine Unwürdige rekommandiert! Luise von Göchhausen hat nur Possen enfiliert, Ranküne geübt, wo die Versuchung hierzu nahe lag. Sie ist aber eine kleine muntere Närrin sans prétentions et sans caprices.
Sollten Höchstdieselben meiner Protegé Dero Gnade zuwenden, beeile ich mich, Eure Liebden meinen allerverpflichtetsten Dank abzustatten!
Eurer Herzoglichen Durchlaucht wohlaffektionierte Henriette, Markgräfin von Baden.«
»Was mag das Mädchen in Karlsruhe verübt haben?« fragte jetzt die Herzogin.
Bevor Wieland sich auf Mutmaßungen einlassen konnte, wurde das Fräulein von Göchhausen angemeldet.
Wieland empfahl sich.
Anna Amalie begrüßte die Eintretende gütig; sie beschloß die Wahrheitsliebe der ihr so warm Empfohlenen auf die Probe zu stellen und fragte zuerst, ob sie sich wohl bei ihrem Oheim fühle.
Mit einem Lächeln verhaltener Spottlust entgegnete Luise: daß man alten Leuten Absonderlichkeiten zu gut halten und für jegliche Gastfreundschaft dankbar sein müsse.
»Haben Sie die Markgräfin ungern verlassen?«
»O, außerordentlich ungern! Die Frau Markgräfin war stets die Huld selbst gegen mich. Hätte es nicht sein müssen, nimmer würde ich ihren Dienst aufgegeben haben!«
»Aber Sie folgten den Wünschen Ihres Oheims? Man muß das an Ihnen loben!«
»Eure Durchlaucht dürfen sich nicht in mir täuschen, so schwer es mir wird, den Oheim Lügen zu strafen; ich war gezwungen, Karlsruhe zu verlassen.«
»Wie das? Erzählen Sie, ich bin begierig, mehr zu hören. Was ließen Sie sich zu schulden kommen?«
Luise berichtete nun des näheren, wie sie in Karlsruhe von den Zudringlichkeiten eines alten Prinzen und Verwandten der Herrschaften verfolgt, sich habe hinreißen lassen, demselben unter Beihilfe ihrer treuen Kammerfrau – der Schulzin – Possen zu spielen, und wie ihre Entlassung eine der Lage angemessene Notwendigkeit gewesen sei.
»Als die Zeit meines Scheidens herankam,« schloß sie ihren Bericht, »nahm ich bewegten Abschied von den hochverehrten Herrschaften und fuhr mit meiner Getreuen den schönen Rheinstrom hinunter.
»Ich machte einen Strich durch alle Weinerlichkeit, die ebensowenig für mich paßt wie ein verliebtes Abenteuer, und gewann die Überzeugung, daß die Welt allerorten schön ist, und in dieser Überzeugung empfehle ich mich der Gewogenheit Eurer Durchlaucht.«
Mit diesem offenen Geständnis hatte der ehrliche, kecke Geist des Mädchens gesiegt: das Vertrauen der Herzogin war gewonnen.
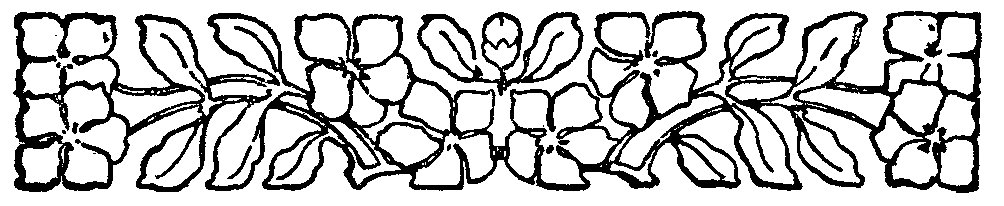
Ich erkenne dich nicht mehr!
Weg ist alles, was du liebtest.
Weg warum du dich betrübest,
Weg dein Fleiß und deine Ruh;
Ach, wie kamst du nur dazu?
Goethe.
Am 7. November 1775 Abends.
Um mich ist alles still, aber in mir wogt es; die Gedanken drängen und pochen und möchten hinaus; ich sehne mich an das Herz einer Mutter zu flüchten, der ich mein ganzes, volles Vertrauen geben könnte. Aber ich habe niemand so nah, so lieb, und die Gedanken müssen doch fort von meinem Herzen, das sie erdrücken. So will ich versuchen zu schreiben, was mich bewegt; Werther schrieb ja auch!
Da steht es, ich sehe es an; – ist denn eine Ähnlichkeit zwischen Werther und mir?
Ich bin ein törichtes Kind; mein Vater sagte mir es heute, als ich nach jenem Besuch nicht von der Brunnenstufe weichen wollte. – Welche Stunden süßer Träumerei!
Ich hatte keinen größeren Wunsch als: Wolfgang Goethe kennen zu lernen! – O wie mein Herz schlug, als die Hoffnung lebendige Gewißheit wurde! – Um Mittag liehen Kalbs von Tante Barbara silberne Löffel und wir hörten, daß sie eine Gasterei hätten, daß sogar der Herzog bei ihnen esse. Vater wurde ärgerlich und sagte: wenn sie nicht einmal ausreichend Löffel besäßen, wäre es Unsinn und Übermut, einen Fürsten zu Tisch zu bitten. Ich schaute in Kalbs Garten; da kam plötzlich Gustchen in großem Putz gelaufen, und ihr folgte ein Mann. Das war »Er«, ich wußte es gleich! Er trug sich wie Werther; frei wallendes Haar und schlanke Glieder; war es Werther? Nein! Eher ein Götz, so männlich und stark, ein Götz im Wertherkleide; oder lieber ein König in geringer Tracht, den man meint schon mit Krone und Zepter im Goldmantel auf dem Thron gesehen zu haben. Gustchen hatte den Mut, ihn zu necken, mit ihm zu schäkern, fortzulaufen; es ist häßlich, wenn Gustchen läuft, und er beeilte sich vielleicht deshalb, sie einzuholen. Bald waren sie nahe unter meinem Fenster, bald hier, bald dort, zwischen den Bäumen mit goldenen und roten Blättern.
Sie kamen zu mir in die Laube, und da präsentierte Gustchen ihn mir mit vielen komischen, förmlichen Reden; er lachte dazu; aber als sie ihn pries und ihm viele hochtönende Titel gab, unterbrach er sie und sagte: »Welche üble Meinung geben Sie dem Fräulein von meiner Eigenliebe, wenn Sie ihr einreden, ich lasse mir all den Ruhm gefallen.« – Dann wandte er sich zu mir und bat sehr artig um Vergebung, daß sie in unseren Garten eingedrungen wären.
Von dem, was er sprach, weiß ich nicht viel mehr; ich fühlte seinen Flammenblick bis in mein verwirrtes, bebendes Herz hinein. Ich saß ihm fast zu Füßen und hätte ewig so sitzen mögen. Dann und wann, wenn er mit Auguste sprach, wagte ich es, ihn anzusehen; O wie brannte sein Bild sich in meine Seele!
Plötzlich ertönte aus Kalbs Garten ein Ruf. »Das ist der Herzog!« sagte er und stand auf; sie grüßten mich, ich war schwindelnd wie im Traum, hätte ihn halten mögen und konnte weder ein Glied noch die Lippen bewegen; Gustchen schüttelte und küßte mich, »Kind, schlafe nicht ein,« rief sie und sprang fort, dem Herrlichen nach. Ich aber saß da, bis Vater kam und mich ein törichtes Ding nannte, weil ich am kalten Novemberabend am plätschernden Brunnen saß.
Am 8. November.
Auch heute habe ich ihn gesehen; wieder war er mit Gustchen am Nachmittage im Garten; sie sang ein Lied und lachte dann überlaut; wie häßlich das klang! Ich nähte an meinem Kleide zum Ball und dachte: ob es möglich wäre, daß ich schön sei? Die Frage verfolgte mich peinlich; ich mußte mir Auskunft suchen. Als Barbara, wie es ihre Gewohnheit ist, mich auskleidete, fragte ich sie: »Sage aufrichtig, Tante Barbara, bin ich schön oder häßlich?«
Sie blickte mich erstaunt an, nahm meinen Kopf in ihre lieben alten Hände, küßte mich auf Stirn und Mund und flüsterte: »Schön wie ein Engel, mein Herzenskind!«
Ein Schauer der Freude überlief mich. Schön wie ein Engel! – Warum soll ich mich nicht darüber freuen? Wird er mich häßlich finden? – Still, still! der Ball kommt, und dann will ich versuchen, mit ihm zu plaudern wie Gustchen; nein, so wie sie, kann ich nie sein!
Am 9. November.
Heute sind die Herren zur Jagd gefahren; sie versammelten sich auf dem Markte. War das ein fröhliches Leben, Lärmen, Kläffen, Rufen und Pfeifen! Der Herzog und Goethe knallten mit großen Hetzpeitschen gegeneinander, wodurch die Hunde an der Leine wie rasend wurden und einen Jungen, der sie hielt, umrissen. Der schöne Wedel blies auf dem Waldhorn eine drollige Melodie, helles Gelächter folgte; es war ein toller Lärm, ein seltsames Konzert! Dann fuhren die Jagdwagen heran, viele Herren stiegen ein, andere ritten. Gegen Abend sah ich sie zurückkommen, er und der Herzog waren zu Pferde. Er trug einen Pelzrock mit Schnüren und sah ganz herrlich aus. Eine halbe Stunde später sah ich, ihn in seinem gewöhnlichen Wertherkleide ausgehen, der Kammerjunker war bei ihm; sonst galt der für hübsch; heute sah er neben dem Unvergleichlichen wie ein Zwerg aus. Tante Barbara erzählte, die Herren seien ins Fürstenhaus zum Abendessen gegangen. – Gustchen kam und verkündete, daß sie auch ein neues Kleid von rotgeblümter Seide auf morgen bekommen habe; ob es schöner ist als meines? Die gute Tante will mir ihre Perlen zu morgen leihen. – Ist das Freude oder Angst, was mich so erstickend befällt, wenn ich an das Fest denke? Ich kann keinen Bissen genießen, und mein Herz pocht mir in der Kehle.
Am 10. Morgens
Heute ist der Tag! Heute! – Ich kann nichts weiter sagen.
Mittags.
Der Friseur ist eben dagewesen, mein Kopf ist fertig; aber wie schwer er ist, wie er schwankt; der Puder stäubt umher, sowie ich mich bewege; ich müsse mich ruhig halten, sagte der Mann, sonst verdürbe ich alles. Wie bleich ich aussehe; Tante wollte mir Schminke auflegen, aber ich litt es nicht; das Schminken ist eine Lüge, und damit gehe ich nicht vor sein Auge. Gustchen war derselben Meinung; sie freilich ist rot genug!
Abends.
Da bin ich wieder. Gottlob! Es ist vorbei. Für immer! Ich gehöre nicht unter die Menschen, ich bin verloren, hilflos, allein wie ein Tropfen im Meere. – O, die elende, unbehilfliche Scheu! – Ich habe mich meines Daseins geschämt und mich gesehnt, weit, weit weg zu sein. Und dann wieder das Glück, ihn ungehindert aus verborgener Ecke zu sehen, zu bewundern. Wie er stürmt und fliegt im Tanze, wie fest er den Arm um die Tänzerin schlingt, wie sein Auge leuchtet und seine Brust sich hebt in der Lust des Lebens und der Freude; o, wer so mit ihm genießen könnte!
Die Herzoginnen redeten mich gütig an, aber ich wußte nichts zu entgegnen; er stand in der Nähe, und ich wagte nicht, das Auge aufzuschlagen. So ließen sie mich stehen, und ich ging mit Tante Barbara in einen Winkel. Ich sollte tanzen, aber mein Vater hat vergessen, mich es lehren zu lassen, so konnte ich es nicht. Gustchen lachte, und mein Vater fluchte in den Bart, nur Barbara nahm sich meiner an.
Rasch gingen die Stunden vorüber; ich sah nur ihn, ich suchte ihn mir wieder und fand seine herrliche Gestalt bald unter der Menge. Es kam eine Lust des Schauens über mich, die mich ganz vergessen ließ, wo ich war; wie ein Geist fühlte ich mich um ihn schweben, leicht, frei, ohne Bangigkeit. Da trat mein Vater mit gerunzelter Stirn auf mich zu, er war zornrot im Gesichte, und seine Augen funkelten; ich erschrak, denn ich wußte, was das bedeute.
»Mir scheint, du bist hier überflüssig,« stieß er hervor. »Man mag und will dich nicht; der alte Laßberg braucht dergleichen nicht zweimal zu hören. Er geht, er geht mit Kind und Kegel, für immer; er hat ausgespielt, er ist weggeworfen!«
So redend, zog er mich heftig durch den Saal dem Ausgang zu; Tante Barbara hielt sich mit gefalteten Händen neben mir; meine Kniee bebten vor Schreck, die Lichter tanzten vor meinen Augen, ich konnte nicht mehr, ich stand still und war zum Umsinken. Da stürmte und wirbelte ein lustiges Paar heran; ich fühlte einen Anstoß der Tänzer und lag plötzlich am Boden. Meine Augen waren geschlossen, mein Körper war schlaff, aber ich konnte hören und begreifen, was um mich her vorging.
Seine Stimme war es, die ich hörte, sein Arm war es, der mich hielt, ich fühlte, ich wußte das.
»Schade!« sagte er. »Das arme Kind! Wie eine geknickte weiße Rose.«
Dann riß mein Vater mich an sich, der Tanzmeister rief: »Fortfahren!«, die Musik begann kräftig aufs neue, und weiter rauschte das wilde Leben des Balls, aus dem ich verschwunden, für das ich verloren war. Mein Vater hatte mich hinausgetragen, er wartete keine Sänfte ab, sondern hieß mich gehen. Er schlug seinen Mantel um mich, legte den Arm um meine Schulter und führte mich so nach unserem Hause. Keines sprach, aber in Vater tobte der Zorn, das fühlte ich. Tante Barbara hat mich wie immer ausgekleidet; sie hat mich geküßt und zärtlich getröstet, dann ist sie fortgegangen, ich aber mußte mein belastetes Gemüt diesen Blättern anvertrauen.
Was wird es weiter geben? Daß ich nicht zur Herzogin komme, ist klar, ich fühle es selbst, daß ich nicht dazu passe; aber er, er! Werde ich ihn wiedersehen? Wo? Wann? Werde ich je den Mut finden, mit ihm zu sprechen? Ach, und ohne ihn, wie öde, wie traurig ist das Leben! Ja, er ist meine Sonne; alles Nacht, kalte schwarze Nacht ohne den Strahlenden, Herrlichen!
Aber da dämmert schon der Tag; o der graue, einsame Novembertag meines ganzen künftigen Lebens!
Am ll. Abends.
Heute morgen ist die ganze Hofgesellschaft auf dem Eise gewesen, ich sah die bunte lachende Schar zurückkommen. Mir war, als seien sie alle aus einer anderen Welt. Er ging wieder neben Gustchen. Nachher kam diese und sagte mir, daß die Herzogin ein anderes Hoffräulein gewählt habe. Sie erzählte mir, daß ihr Bruder und Goethe Nachmittags zum Prinzen Konstantin nach Tiefurt führen, und daß sie dann wichtige Dinge mit mir überlegen wolle.
Der Nachmittag kam, und nie werde ich jene Stunde vergessen. Wir saßen, weil es bei dem Froste sonnig war, wieder am Brunnen. Vater hatte ich den ganzen Tag nicht gesehen; ich kenne das, wenn er einen schweren Groll zu überwinden hat, schließt er sich ein; Tante Barbara hielt noch ihren Mittagsschlaf. Gustchen war sehr zärtlich; sie ließ meine Hand nicht los und sagte mir, daß sie glücklich sei, eine Freundin zu haben, der sie alles anvertrauen könne.
»Wie findest du ihn?« fragte sie dann.
Ich errötete so sehr, daß mir die Tränen in die Augen traten und meine Hände bebten.
»Ah!« sagte sie, »du antwortest beredt genug; wie hübsch du bist, wenn du rot wirst und etwas Leben in deine Mienen kommt; sähe er dich so, würde er dich nicht fade nennen. Also du findest ihn entzückend?«
Gefoltert wandte ich mich ab. »Er ist sehr schön!« stotterte ich.
»Wer denn? Wir haben noch keinen Namen genannt,« spottete sie jetzt. »Aber sei nur ruhig, alle Mädchen in Weimar sagen heute: Er! und wissen, wen sie meinen. Ja, Wolfgang Goethe hat es gestern allen angetan; jung und alt hat er bezaubert, der himmlische Mensch. Und nun höre wohl zu, kleine Maus, er ist mein, mein, wenn ich ihn will, – was sagst du dazu?«
Ich glaube, ich stammelte einen förmlichen Glückwunsch und fühlte dabei, daß ich sehr blaß und schwindlig wurde.
Auguste fuhr fort: »Du gratulierst mir schon; so weit sind wir noch nicht, denn ich bin noch im Überlegen, wie ich's nehmen soll.«
Ich fragte, warum sie denn noch schwanke, da sie ihn doch so liebenswürdig finde.
Gustchen lachte. »Du bist ein Kind, ein pures Kind,« sagte sie. »Wenn eine Liebelei Ernst wird, und man an eine Heirat denkt, so braucht man dazu einige kleine Nebendinge außer dem entzückenden Epouseur. Ich bin nicht einmal im klaren über sein Vermögen; in den vier bis fünf Tagen unserer Bekanntschaft hat er nichts darüber geäußert. Dann soll sein Großvater ein Schneider gewesen sein, und eine solche Verwandtschaft darf ich meiner Familie nicht bieten. Da er nicht von Adel ist, würde ich mein Recht auf die Hofgesellschaften verlieren. Die Gunst, in der er beim Herzog steht, läßt sich verwerten, aber darauf zu rechnen ist nicht. Fürstengunst kommt heute und geht morgen!«
Ich hatte stumm ihren Überlegungen, die mich eisig durchkälteten, gelauscht; endlich fragte ich: »Aber hat er denn schon ernstlich um dich geworben?«
»Mit Hand und Mund hat er geworben, mein Zuckerpüppchen!« lachte sie, »wenn auch nicht mit dürren Worten und Heiratsplänen. Aber ich darf es auch, will ich ihn abweisen, nicht dahin kommen lassen, denn wenn er uns zürnt, kann das meiner Familie Nachteile bringen. Ich muß also meinen Entschluß fassen und klug sein.«
»Solche Sachen verstehe ich nicht,« sagte ich kurz. »Ich kann dir keinen Rat geben.«
Aber sie wollte auch keinen Rat; sie erzählte mir, was er ihr gesagt, es war viel Artiges – aber ich fand nicht die Herzenswärme darin, welche seine Augen ausstrahlten, nicht die Glut und Leidenschaft seines Werthers. Ich sprach es Augusten aus, sie aber spottete, meine eigenen Worte wiederholend: »Solche Sachen verstehst du nicht! Ich kann es nicht leugnen, daß ich sehr in ihn verliebt bin,« fuhr sie fort. »Er ist der schönste und bedeutendste Mann in ganz Weimar; es mag unverständig sein, aber ich will die Sache weiter gedeihen lassen; mag es auch zu einer Heirat kommen!«
Gustel hat mir einen Vers von ihm dagelassen, davon schreib' ich mir hier den Schluß:
Ach, aber ach! der Jüngling kam
Und nicht in acht das Veilchen nahm,
Zertrat das arme Veilchen.
Es sank und starb und freut sich noch:
›Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch
Durch ihn, durch ihn,
Zu seinen Füßen doch!‹
Bleibe nicht am Boden haften,
Frisch gewagt und frisch hinaus!
Kopf und Arm mit heitern Kräften,
überall sind sie zu Haus.
Wo wir uns der Sonne freuen.
Sind wir jeder Sorge los.
Daß wir uns in ihr zerstreuen.
Darum ist die Welt so groß!
Goethe.
In dämmeriger Sonntagsfrühe brach der Herzog mit dem Freunde auf, um seiner Ungeduld genug zu tun und mit ihm nach Kochberg, dem Gute des Oberstallmeisters von Stein, hinauszureiten. Ein Reitknecht mit Frühstücksvorräten in den Halftern folgte.
Der Torwärter mußte seinen Morgenschlaf abschütteln und das streng geschlossene Gattertor der Stadt öffnen, dann trabten sie draußen in den Morgennebel hinein.
Die Rosse schnoben und wieherten hinaus, und die beiden jungen Männer atmeten tiefer und genossen mit Lust die kräftige Frostluft, welche »wie mit marmorkühlen Händen« über die Gegend hinfuhr.
Es wurden nur wenige Worte gewechselt; gehoben von dem eigenen gestählten Frohmut, getragen von den elastischen Tieren unter ihnen, fühlten sie sich wie weltstürmende Centauren.
Nachdem durch einen langen scharfen Trab dem allseitigen Übermut genug getan war, mäßigte man die Gangart der Pferde und begann, aus dem instinktiven Behagen in das bewußte übergehend, ein Verlangen zu empfinden, sich dasselbe auszusprechen.
»Ist mir's doch,« rief Goethe fast mit einem Jauchzen, »wenn ich so dasitze und pflichtmäßig drauf los reite, als kriegte der Klepper unter mir eine herrliche Gestalt, unbezwingliche Luft und Flügel!«
»Ja, solch ein kalter, junger Tag birgt eine Fülle von Lebenskraft in sich!« sagte der Herzog, seine Glieder reckend und hoch aufatmend. »Sieh nur, welch wunderliche Nebelgebilde dort über die bereiften Stoppeln ziehen, wie sie sich zerreißend an die Baumäste hängen und drüben im Osten rosig und violett durchschimmern. Wir bekommen einen kalten, aber schönen Tag.«
Goethe entgegnete in bewegtem Tone: »Und nun mit der Ahnung eines Kommenden, mit der Hoffnung eines freudigen Findens, als wäre die Sonne selbst in meiner Seele, alle den Nebeln, dem wunderbaren Weben und Drängen ringsum entgegenzureiten und sie zu durchbrechen! Der ganze Inhalt meiner Freude ist ein wallendes Sehnen nach etwas, das ich nicht habe, das ich nicht anschauend erkenne. O lieber, gnädiger Herr, welche Fülle von Lust und großen Empfindungen birgt das Leben!«
»Und ich bin froh, wenn sich etwas findet, das dich fesselt,« erwiderte Karl August herzlich. »Du siehst mehr mit deinen Dichteraugen als unsereiner und erlebst mehr. – A propos, wie geht es dir bei Kalbs? Ist dir dort alles recht? Behandelt man dich nach deinen Wünschen?«
»Ich habe nicht zu klagen und möchte doch nicht zu lange in dem Hause bleiben. Zwischen Gustchen und mir ist ein Ton, ein Verkehr koketten Suchens und Spielens eingerissen, den ich kaum ändern, nicht lange ertragen kann. Es ist meine Schuld, aber dies Entgegenkommen habe ich nicht erwartet, und es tut mir für das Mädchen leid.«
»Mach dir keine Skrupel, die spielt so gut wie du,« lachte der Herzog, »ich werde aber bald für ein anderes Quartier sorgen.«
Sie ritten wieder in rascherem Tempo, um sich zu erwärmen, denn gerade beim Sonnenaufgänge wurde es bitter kalt. Mit wundervoller Farbenpracht brachen die ersten Sonnenstrahlen durch glitzernde Reif- und Nebelgebilde. Das siegesreiche Tagesgestirn warf leuchtende Blicke der Huld über die starre Fläche. Die feinen Eiskristalle an Gräsern und Zweigen schimmerten in blendender Pracht, das geringste Gebüsch glich einem Märchenwalde, die hohen, weitästigen Tannen wurden zu zauberischen Pyramiden. Während die Sonne höher stieg, den Nebel zerteilte, unterwarf und des Himmels zartes Blau durchglühte, blieb die Ferne noch in weichen Farbentönen. Gerade stieg der Rauch aus den zur Seite liegenden Gehöften auf und gewann, gegen die klare Himmelsbläue gesehen, rosige Tinten.
Der Herzog nahm das Gespräch wieder auf: »Wir haben in den nächsten Tagen noch einen Gast zu erwarten; ich glaube, ich erwähnte desselben nur flüchtig. Es ist auch so recht eigentlich kein Gast, denn ich habe ihn zum Kammerherrn ernannt. Noch vor meinem Regierungsantritt lernte ich in Baireuth den etwa dreißigjährigen Siegmund von Seckendorf kennen, der früher in sardinischen Diensten stand. Er hat deinen Werther ins Italienische übersetzt, dichtet, komponiert und schien mir in den Kreis zu passen, welchen ich mir zur richtigen Erfassung eines frohen, gefunden Lebensgenusses zu bilden trachte. Hoffentlich wird der gewandte, vielseitige Mann dir gefallen. Möchte er sich mit uns einleben!«
»Ich bringe ihm eine reine Empfindung entgegen und hoffe alles Gute,« sagte Goethe schlicht. »Mir tut es nur leid, wenn ich sehe, daß du zwischen dich und die Herzogin immer mehr Leute stellst.«
Das freudig belebte Gesicht des jungen Fürsten verfinsterte sich. »Ich kann mit ihr zu keinem Verständnis, keinem rechten Herzenston kommen. Mein Verlangen geht nach einem frischen, schönen, schnellkräftigen Wesen. Luise ist so verschlossen, so formvoll, so talentlos; eine Aureole der Langenweile umgibt sie, ein Parfüm der Korrektheit, das mir zuwider ist.«
»Ein Weib kann, um begehrenswert zu erscheinen, in allen Zügen und Formen des Wesens weich sein. Besitzt sie auch nicht deine rastlose, geistesdurchleuchtete Lebensfülle, so ist sie doch eine tief innerliche Natur, eine reizvolle Knospe, die für dich zu erschließen dir hohen Gewinn bringen wird. Du darfst nur nicht nachlassen, dich um sie zu mühen.«
»O Mentor!« rief der Herzog mit leichtsinniger Fröhlichkeit. »Wenn die Kühle wüßte, welch ein Sachwalter sie vertritt! Dir schenkte sie vielleicht ein Lächeln, das heißt, wenn die Dehors und ihre langnasige Oberhofmeisterin, die Gianini, es allergnädigst gestatten möchten. Pah, mich fröstelt, laß uns den Gäulen die Sporen geben!«
Die Pferde griffen munter aus; gegen neun Uhr wurde in Berka gefrühstückt und gefüttert, dann ging es mit frischer Lust über Blankenhain auf Kochberg zu.
Bald nach elf Uhr langte man vor dem überbauten Torweg an, der auf den Gutshof führte.
Die Herren ritten ein.
Ein breiter, mit einzelnen Ulmen besetzter und von Gebäuden umgebener Wirtschaftshof nahm sie auf. Geradeaus, vom Hof durch einen Graben getrennt, lag das schloßartige Herrenhaus; überschritt man die Grabenbrücke, so führte eine breite, von zwei kleinen Türmen flankierte Treppe auf einen inneren, mit Steinplatten belegten Hof, den die von der Herrschaft bewohnten Baulichkeiten einschlossen.
Als die Reiter vor der Grabenbrücke hielten, waren sie bereits von dem Oberstallmeister von Stein bemerkt worden, der zu ihrer Begrüßung herbeieilte. Der Herzog stellte seinen Begleiter vor und erfuhr, daß auch Rittmeister von Werthern mit Gemahlin als Gäste anwesend seien. Man fand die Gesellschaft in einem behaglich erwärmten Salon, wo die Damen den Eintretenden von einem Frühstückstisch entgegenkamen, welchen augenscheinlich die beiden Herren erst eben verlassen hatten. Der Herzog küßte beiden Damen die Hand und führte der Hausfrau seinen Freund zu.
Dieser hatte sogleich die schlanke Frauengestalt vor sich mit prüfenden Blicken überflogen.
Ja, sie war es! Das waren die weichen, durchgeistigten Züge, die ihn in ihren unvollkommenen Umrissen schon so wunderbar gefesselt hatten und ihn nun doch, anmutbelebt, wie ein ganz Neues, Unerwartetes überraschten. Da war weder Fülle noch Farbenreiz, weder Jugend noch Regelmäßigkeit der Züge, aber mehr als alle vollkommene Schönheit eine seelische Innigkeit des Ausdrucks, die unwiderstehlich – den, der solche Sprache verstand – zu diesem Weibe hinzwang.
Der Hausherr hatte auf dem Frühstückstische Kuverts für die Neuhinzukommenden bereit legen lassen. Hochlehnige Sessel wurden herangerückt, und Frau von Stein bat, da man um drei Uhr speisen werde, mit einem kleinen Imbiß nach dem Ritt fürlieb zu nehmen.
»Mit Vergnügen!« lachte der Herzog, »aller guten Dinge sind drei, frühstücken wir zum dritten Male in der reizenden Gesellschaft, die uns eine Gunst des Schicksals zuführt.« Er sah hierbei Milli von Werthern bezeichnend an und setzte sich zu ihr. Goethe gewann einen Platz an der Hausfrau Seite und konnte nun ihr zartes Profil, das so lange schon in seinen Gedanken lebte, genau studieren.
»Und was verschafft uns das Vergnügen dieses scharmanten Zusammentreffens?« fragte Karl August, den Madeira an die Lippen führend, mit schelmischem Augenzwinkern seine Nachbarin.
»Die neue Fuchsstute!« lachte Frau von Werthern, indem sie ihren Gatten ansah.
»In der Tat, Durchlaucht,« erklärte Herr von Stein beflissen, »ist jener kapitale Gaul wohl nicht ganz unschuldig an der Ehre dieses Besuchs.«
»Natürlich hätte ich den Fuchs lieber geritten,« sagte Werthern, »da sie aber mit wollte, und ich ja gerade des Gauls halber ein brillanter Ehemann bin – das Nähere erlassen mir wohl die Herrschaften – blieb mir nichts anderes übrig, als die Mähre einzuspannen, denn ich mußte Stein neidisch machen und sie nochmals vorreiten. Und da sind wir!«
Emilie hatte errötend und mit gesenkten Blicken die unzarten Anspielungen ihres Gatten hingenommen. Dem jungen Fürsten schwoll das Herz, er erbarmte sich ihrer und lenkte rasch das Gespräch auf andere Dinge.
Dann kamen die drei Steinschen Knaben in den Salon, um dem Herzog ihren Diener zu machen, man scherzte mit ihnen, und besonders Goethe wußte die Kinder bald an sich zu fesseln.
Nach dem Frühstück brannte den Pferdeliebhabern der Boden unter den Füßen. Werthern war glücklich, seine neue Errungenschaft, die er eigentlich dem Herzog und Stein weggeschnappt hatte, jetzt in vorteilhafter Weise vorführen zu können; er witterte etwas von der Möglichkeit eines guten Geschäfts und stürmte hinaus, um rasch satteln zu lassen.
Der Herzog fragte Milli, ob sie nicht von der Passion ihres Mannes angesteckt sei, und bat sie, mit auf den Hof zu kommen. Sie war einverstanden und schlüpfte in eine purpurrote Sammetjacke mit schwarzem Pelzbesatz, die ihr vortrefflich stand; so schloß sie sich den hinausgehenden Männern an.
Goethe bat Frau von Stein, ihm zu gestatten, daß er bei ihr im Zimmer bleibe, da seine Liebhaberei für Pferde nicht sonderlich groß sei. Sie bewilligte freundlich seine Bitte und führte ihn in ein kleines, nach dem Garten gelegenes Wohngemach. Hier saßen sie zusammen in der tiefen Fensternische und plauderten bald lebhaft.
Während draußen der vielbesprochene Fuchs und nach ihm die bevorzugten Insassen des Steinschen Stalls in allen Gangarten vorgeführt, kritisiert oder bewundert wurden, schlang sich drinnen wie aus feinen, goldenen Fäden ein Band, das zwei edle, nach Verständnis ringende Menschenseelen dauerhaft verknüpfen sollte. Da die beiden älteren Knaben zu ihrem Hofmeister zurückgekehrt waren, spielte der kleine dreijährige Fritz, gleich einem Symbol jenes Bandes, von einem zum anderen. Sein kindliches Geschwätz, seine Ansprüche füllten harmlos eine gedankenvolle Pause, oder gaben mit einem drolligen Einfall der Unterhaltung eine andere Wendung. Was hatte Goethe dieser Frau alles zu sagen! Nie war er sich so innerlich reich erschienen wie in ihrer Nähe!
Dann traten die Fragen des praktischen Lebens an die Hausfrau heran; ein Diener kam und wollte wissen, welches Gedeck, welches Silber, welchen Wein sie heute dem Herzog zu Ehren bestimme.
Frau von Stein erhob sich, um mit einer Entschuldigung den Gast zu verlassen; er bat, sie begleiten, ein bißchen mit Hausvätern zu dürfen; mütterlich gütig willigte sie ein; lief doch auch Fritzchen durch Küche und Keller mit, warum sollte sie dem neuen jungen Freunde nicht willfahren? Es war alles so zweifellos sicher, was sie und wie sie's tat. Wie gern fügte er sich dem Zauberbann dieser Natur ein!
Jetzt ging es von den fächerreichen, geschnitzten Leinenschränken mit der hochgeschichteten Haushaltswäsche zum Speisezimmer mit seinen Silber-, Glas- und Porzellanvorräten, von da zur Wirtschafterin in die Küche und sogar mit einem Lateinchen in den Weinkeller, wo sie Goethe die Sorten wies, Wert und Verwendung erklärte, und von wo er ihr die Flaschen für den Mittagsbedarf hinauftragen durfte. Wie freute ihn die geordnete Fülle des lange bestehenden Hauses!
Dann schlug sie vor, ihm den Park zu zeigen. Sie hüllte sich in einen Schal und führte ihn von dem quadernbelegten Hof durch einen Gang über eine gedeckte Brücke, auf der sie den Schloßgraben überschritten. Ein freier Platz, jetzt weißbestäubt von Reif und Schnee, lag vor ihnen, zur Seite ein schöner Gartenpavillon mit breiter, vasenbesetzter Treppe, hinter dessen Säulen man Glastüren schimmern sah; rechts lag eine Grotte mit mächtiger Efeuwand, deren dunkles Grün noch nicht ganz vom Schnee bedeckt war. Weiterhin ging es zu einem Karpfenteich, auf dem eben Herr Kästner, der Hauslehrer, mit Karl und Ernst das Eis versuchte. Von hier aus zogen sich zahlreiche kleine Gräben durch die Anlagen, von weißen Brücken überwölbt; hügelig dehnte sich der Park, mit alten Bäumen bestanden, weit hinaus, so daß es bald mehr ein Wald als Garten schien, in dem man lustwandelte.
Zurückkehrend sahen sie nahe dem Hause den Herzog mit Milli im scherzenden Zwiegespräch.
»Was halten Sie von der schönen Frau?« fragte die Stein, als sie das schäkernde Paar bemerkten. »Hatten Sie schon Gelegenheit, mit Emilien bekannt zu werden?«
»Ich sah sie oft in den wenigen Tagen. Sie ist eine liebeselige Enthusiastin, genußsüchtig und anschmiegend. Ihr Unglück, an diesen plumpen Maquignon verheiratet zu sein, entschuldigt vieles.«
»Sie haben scharf gesehen in der kurzen Zeit. Manche nehmen ihre Empfindsamkeit für Gefühlswärme.«
»Möchte sie Luise nie aus seinem Herzen verdrängen!« flüsterte er, sich zu seiner Begleiterin neigend, die mit einem verständnisvollen Blick antwortete.
Bald darauf rief eine kräftig geschwungene Glocke die ganze Gesellschaft zur Tafel.
Nach Tisch fand der Herzog Gelegenheit, den Freund zur Seite zu nehmen und zu fragen: ob seine Erwartungen erfüllt wären.
»Übertroffen, hundertmal übertroffen, mein lieber gnädiger Herr!« rief dieser warm. »Ein solches Weib kann einen aus allen Strudeln emporhalten. O, ich möchte im dreifachen Feuer geläutert werden, um ihrer Liebe wert zu sein!«
»Nimm dich in acht!« lachte Karl August, »die Liebe zu einer Frau ohne Schönheit soll die dauerhafteste sein! Übrigens wird es dir, nach dem, was du mir eben gestanden hast, nicht unerwünscht kommen, daß wir noch ein paar Tage bleiben; ich habe zu morgen mit Stein eine Jagdpartie verabredet; Wertherns wollen in der Frühe zurück, da er Dienst hat.«
Es war Goethen, als solle er dem Herzog um den Hals fallen, solch ein Gnadengeschenk war ihm diese Hoffnung, solches Wonnegefühl gab ihm die Aussicht auf die nächsten Tage.
Glückseliges Drängen und Verlangen des glühenden jungen Dichterherzens, dem sich mit einer neuen Liebe eine neue Welt auftat!