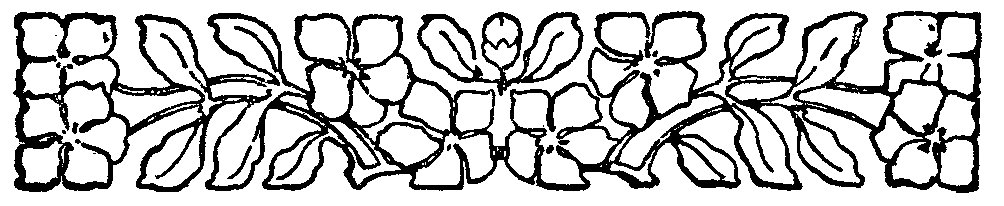|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Alles weg, was deinen Lauf stört!
Nur kein düster Streben!
Eh' er singt und eh' er aufhört,
Muß der Dichter leben.
Und so mag des Lebens Erzklang
Durch die Seele dröhnen!
Fühlt der Dichter sich das Herz bang,
Wird sich selbst versöhnen.
Goethe.
Der Herzog ließ am anderen Morgen den Grafen Görtz zu sich bescheiden und nahm ihn scharf ins Gebet.
Karl August konnte in solchen Fällen schonungslos herb sein, und der Übeltäter kam arg ins Gedränge. Der Fürst sagte ihm gerade vor den Kopf, er habe den gefälschten Brief auf Goethes Spur geworfen und, nur um dies zu können, den auffälligen Schritt getan, mit der Herzogin ihm gegenüber zu tanzen. Er habe ihn glauben machen wollen, daß Goethe der Herzogin bei der tour de main den Brief zuzustecken beabsichtigt.
Letztere Beschuldigung war richtig, die erstere nicht ganz und nur aus Schonung für Korona umgeformt.
Immerhin befand sich der Graf in einer großen Verlegenheit. Er kannte die Rücksichtslosigkeit seines jungen Gebieters, sein strenges Rechtsgefühl, das nicht mit sich markten ließ, und begriff, daß er nie wieder zu Gunst und Gnaden kommen werde, sein Spiel war verloren!
Er wählte also ein beliebtes Mittel, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen; er spielte den Gekränkten und bat um seine Entlassung.
»Gehen Sie in des Teufels Namen samt Ihren Helfershelfern, und je eher je lieber!« rief der Herzog und verabschiedete seinen alten Mentor in vollem Zorn.
Goethe, der bei seinem guten Gewissen und der baldigen Aufklärung jener Intrige nicht so tief berührt worden war, wie der Herzog, versuchte den hohen, herzlich geliebten Freund zu beruhigen.
Er erinnerte daran, wie er ihn stets vor Saint- Germain gewarnt, und beglückwünschte ihn zu der Krise, welche eine so gesunde Reaktion hervorgerufen habe.
»Wir sind wie schwimmende Töpfe, die sich aneinander stoßen,« überlegte er. »Und dem Menschen in seinem zerbrechlichen Kahn ist eben deshalb das Ruder der Einsicht in die Hand gegeben, damit er nicht der Willkür der Wellen, sondern dem Wollen seiner Überlegung Folge leiste.«
»Ich glaube dir, daß Saint-Germain ein Betrüger und Erzschuft ist,« sagte der Herzog lebhaft. »Wissen möchte ich aber doch, wie er es angefangen hat, mich in den Hörselberg zu führen, und wer seine Venus war? Letztere Frage könntest du mir jetzt beantworten, da keine Gefahr mehr ist, daß er Macht über mich bekommt.«
»Wenn Sie Ihren Frieden mit der Herzogin geschlossen haben, oder wenn sonst eine Wendung eintritt! Und für jene erste Frage wird sich auch wohl noch die Antwort finden,« erwiderte Goethe schelmisch ausweichend, so daß Karl August sich, wenn auch murrend und widerstrebend fügte.
Bei einer späteren Gelegenheit trug Goethe – mit einem heimlichen Lächeln – dem Herzoge die Bitte vor, den Heilgehilfen Johann Bernstein in Ilmenau als Wundarzt für die Bergknappenschaft anzustellen.
Er war mittlerweile in Ilmenau und bei Gretchen gewesen, hatte genaue Einsicht von allen Verhältnissen genommen und hoffte mit ihrer Heirat einen Abschluß und die günstigste Wendung für den Herzog zu finden.
Dieser sah aber den Freund jetzt groß an.
»Was fällt dir ein?« sagte er befremdet. »Warst du es nicht, der mir ernstlich abriet, dergleichen zu tun; mein Geld nicht zu verschwenden? Jetzt habe ich mir die Sache auch überlegt, habe den jungen Menschen neulich abgewiesen, jetzt bleibt es dabei!«
Graf Görtz säumte nicht lange, dem Drängen des Herzogs zu folgen und Weimar zu verlassen. Er siedelte in der nächsten Zeit mit seiner Familie nach Berlin über, wo er später wieder eine Hofstellung annahm.
Die plötzliche Verabschiedung des Grafen Görtz und das, was von der Ursache verlautete, übte einen höchst ungünstigen Einfluß auf die Herzogin Luise. Der Hofmarschall hatte ihr seinen Abschiedsbesuch gemacht, hatte über ungerechte Behandlung, über eine perfide Intrige gegen ihn und seine hohe Gebieterin geklagt und hinzugefügt, sein Respekt, seine Loyalität verbiete ihm mehr zu sagen.
Die so zart empfindende Fürstin, der jede öffentliche Besprechung, jede Vermengung ihres Namens mit einer auffälligen Angelegenheit höchst empfindlich war, hörte, wo es sich um ihre Person handelte, mit feinem Ohr, und so kannte sie bald die Ursache der Verabschiedung ihres Hofmarschalls: er sollte Goethe beschuldigt haben, daß er ihr nachstelle, daß er sich ihr in ungeziemender Weise nahe! Goethe hatte allerdings versucht, ihr Artigkeiten zu erzeigen, hatte das Gespräch mit ihr zu vertiefen, auf ernste Punkte zu führen gesucht. Sie war vielleicht doch nicht zurückhaltend genug gewesen? O, sie konnte an diesem Hof, wo es so wenig Formen und Schranken gab, nicht vorsichtig genug sein! So überlegte sie, und so geschah es, daß die Ränke des Wundermannes die Kluft zwischen dem jungen fürstlichen Ehepaare erweiterten und neue Entfremdung zwischen ihnen herbeiführten.
Mit Christoph Kaufmann, der längere Zeit in Weimar gewohnt hatte, machte der Herzog kurzen Prozeß; er ließ ihm einen Platz in dem Reisewagen zur Verfügung stellen, der behufs Ausbesserung an den Rhein geschickt wurde, Goethe widmete ihm in den matinées den folgenden Vers mit der Überschrift: »Abschiedskarte eines Scheidenden«:
»Ich hab' als Gottes Spürhund frei
Mein Schelmenleben stets getrieben;
Die Gottesspur ist nun vorbei
Und nur der Schelm der ist geblieben.«
Kaufmann ging später als Arzt zur Brüdergemeinde nach Herrnhut.
Graf Saint-Germain verschwand ebenso geheimnisvoll nach dem Mißlingen seines Anschlags aus Weimar, wie er dahin gekommen war; man hörte später, er sei mit dem Landgrafen Karl von Hessen, dem zweiten Sohne des regierenden Herrn, nach Schleswig gegangen, wo sich bald der Mystizismus zur vollen Blüte entfaltete; Schleswig wurde der Sammelplatz aller wundergläubigen Männer der Zeit; der Landgraf nahm am Sektenwesen lebhaften Anteil und verfaßte unter dem Beistande Saint-Germains aufsehenerregende, phantastisch-religiöse Bücher.
Korona würde sich jetzt erleichtert und befreit gefühlt haben, wenn ihr nicht der Graf in einem kurzen, geheimnisvoll gehaltenen Schreiben seine baldige Rückkehr in Aussicht gestellt und ihr die Versicherung gegeben hätte, daß er im Geiste mit ihr sei und Kenntnis von all ihrem Tun und Treiben erhalte.
Dem wiederholten Werben Hildebrand von Einsiedels setzte sie also stets die alte Antwort, daß sie gebunden sei und bleibe, entgegen. Er war bald nach der Verabschiedung des Grafen Görtz zum Hofmarschall der Herzogin Luise ernannt und seine Lebensstellung dadurch noch mehr über die der Künstlerin erhoben.
So mußte das Paar in gezwungener Entsagung und bei ruhiger Überlegung der Ansicht Raum geben, daß eine Heirat nicht ausführbar sei. Sie resignierten also zum zweiten Male; nicht unter dem Einflusse leidenschaftlicher Erregung, sondern nach ruhig-ernster Abwägung aller Verhältnisse; Freunde, treue, innige Freunde aber wollten sie bleiben und hielten einander dies Gelöbnis.
Der Winter kam und das Treiben der Gesellschaft lenkte in die alten Bahnen. Nach Görtz' Entfernung – gleichbedeutend mit dem Sprengen seiner Partei – nahte sich der Kammerherr Siegmund von Seckendorf Goethen in einer nicht mißzuverstehenden Weise. War dieser auch nicht frei von Argwohn gegen den eleganten Kavalier, so schätzte er doch die Begabung des gewandten Mannes, freute sich an seiner Unterhaltung und empfand als große und reine Seele das Bedürfnis, mit jedem in seinem Kreise freundlich zu verkehren.
Eines Tages besuchte Seckendorf Goethe ohne äußeren Anlaß und sagte ihm offen, daß er ein Verlangen trage, sich mit ihm über die frühere und gegenwärtige Stellung zueinander auszusprechen, und daß er wünsche, Goethen freundschaftlich näher zu treten.
Im Tone der Wahrheit fuhr er fort: »Sie haben mich bezwungen, lieber Legationsrat; die kräftige Sprache des Herzens, welche mir aus Ihren Worten und Werken entgegentönt, hat meine Unzufriedenheit, selbst meinen Vorsatz, zu kritisieren, zum Schweigen gebracht. Eh' ich's wußte und wollte, war ich Ihnen gegenüber mitten im Taumel der Empfindung, welche von nun an, da kein Görtz seinen störenden Einfluß geltend macht, die herrschende bleiben soll!«
»Schonen wir des Abwesenden!« entgegnete Goethe mit edler Abwehr jenes schiefen Rechtfertigungsversuchs. Milder fuhr er fort: »Ich bin Ihnen dankbar für Ihr Entgegenkommen und glaube, daß die Spreu der Eitelkeit ein zu mageres Futter ist, um sich darum zu raufen und die gute Natur zu hemmen.«
»Lassen Sie mich Ihnen gestehen, daß ich das Hofleben verwünscht habe!« sprach Seckendorf. »Der Günstlinge wurden immer mehr, da wollte ich denn oft dem lieben Gott die Ehre, die Orden, die Kammerherrenschlüssel und alle diese Misere überlassen! Ferner, daß mich's bitter aufstörte, als der Herzog Sie zum Legationsrat ernannte. Mir schien's wie Ironie, jemandem ein wichtiges Amt zu verleihen, der bisher nur die Aufgabe hatte, den Herzog zu amüsieren, aus dem Zech- und Spielgenossen einen Steuermann des Admiralschiffs zu machen. Daß ich mich frei darüber ausspreche, mag Ihnen meine Sinnesänderung für Sie dartun! Jetzt fühle ich, gegen große Vorzüge anderer gibt es keine wirksamere Hilfe als die, sie zu lieben! Das tolle Treiben hier hatte mich anfänglich beirrt.«
»Wir haben viel getorheitet,« erwiderte Goethe, »aber die Freude will auch ihr Recht. Seien Sie überzeugt, ich weiß ganz genau, daß auf diesem beweglichen Erdball in der wahren Liebe, der Wohltätigkeit und der Wissenschaft die einzige Freude und Ruhe zu finden ist.«
»O, so lenken Sie mit dieser großen Erkenntnis auch Serenissimus dahin.«
»Der Herzog ist ein trefflicher Charakter und wird will's Gott auch ausgären; ich bin für alles voll Hoffnung des Gedeihens.«
»Möchte dies auch mit unserer Freundschaft der Fall sein!«
»Amen!« Und zwei ausgestreckte Hände einten sich zu kräftigem Druck.
In der Wintersaison ging ganz unerwartet ein neuer Stern auf. Es war dies Christel von Laßberg, die sich endlich so weit gekräftigt hatte, um den längst beabsichtigten Tanz- und Anstandsunterricht des tonangebenden Meisters, Adam Aulhorn, zu genießen. Nachdem sie sich allmählich und in aller Stille zu einer zarten Schönheitsblüte entfaltet hatte, war ihre linkische Schüchternheit in bescheidene Anmut, ihre stumme Scheu in anziehende Zurückhaltung verwandelt.
Die Männer ihres Kreises nahten sich ihr nach und nach sämtlich. Vom Herzoge an ward jeder mehr oder weniger angezogen, um sich doch bald wieder mit der Versicherung abzuwenden, man komme nicht weiter mit ihr!
Daß der Blick ihres blauen Auges einen herzbewegenden Schimmer habe, daß sie im Tanzen und Schlittschuhlaufen, in jeder Bewegung ihres schlanken Körpers von der »Biegsamkeit des Schilfrohrs und der Leichtigkeit einer Libelle sei«, wie Meister Aulhorn gern wiederholte, gaben alle Männer zu, und doch waren sie an den Ton gefälligen Entgegenkommens, an den prickelnden Reiz des Reckens und Herausforderns so gewöhnt, daß sie sich mit dieser so in sich geschlossenen Erscheinung nicht dauernd verständigen konnten.
Der Grundton in Christels Wesen war jene »süß leidende Sentimentalität« ihrer Zeit, welche, vom Sturm und Drang brausenden Jugendmutes, der jetzigen lustfunkelnden Gesellschaft verscheucht, keine Geltung mehr und nur noch ein Achselzucken fand. Man war noch überschwenglich in Wort und Tat, wenn es eben paßte, aber lachte doch schon über die Empfindsamkeit schöner Seelen. Christel glich einer verspäteten Frühlingsblume, einem Veilchen, das von greller Sommerglut getroffen, schmerzlich unter derselben leidet.
Sie hatte ihr Tagebuch fortgesetzt, und ein weiteres Stück desselben lautete:
»Im Winter 1777.
Ich glaube, die Menschen haben mich alle bisher für geistesschwach gehalten. Noch jetzt spüre ich etwas wie Erstaunen bei den Leuten, wenn ich mich so ziemlich benehme, wie die anderen. Gehe ich aber ernstlich mit mir zu Rate, so verdiene ich diese überraschten Mienen nicht deshalb, daß ich ihre Komödie zu spielen weiß, sondern, daß ich mich herbeilasse, mitzutun wie sie. Denn recht wahr und schlicht und ganz er selbst kann niemand in der eleganten Welt, der sogenannten guten Gesellschaft, sein! Wie oft muß ich jemand freundlich begrüßen, der mir zuwider ist; wie oft lächeln, wenn ich tief betrübt bin; wie oft darf ich nicht jauchzen, wenn ich's möchte, und mein heißes Empfinden, meine Anbetung für ihn zeigen, darf ich nun und nie! Jedes Wort von seinem Munde, das an mein Ohr tönt, läßt alle meine Nerven erbeben, wie der Lufthauch die Äolsharfe. Ach, und wenn er mich berührt, durchzuckt mich Wonne, und ich möchte vergehen, wie der Tautropfen vor dem Sonnenstrahl!
Wer würde mich darin verstehen? Sie würden mich ›sentimental‹ nennen, eine ›Wertherin‹, wie neulich Auguste sagte. Wie leer aber ist das Leben, welch ein Kreislauf alltäglicher, selbstsüchtiger Unerträglichkeit, wenn man die großen, tiefen Gefühle ausstreicht!
Mein Vater ist mit mir zufrieden; aber darf ich mich freuen über seinen Stolz auf meine äußerlich angelernten Vorzüge? Er schenkt mir mehr neue Kleider, als ich mag, und sagte gestern, als wir von Kanzler von Koppenfels' Soiree kamen: ›Endlich herrscht nur eine Stimme darüber, daß du schöner bist als die Kalb! Ja, die feinste Rasse entwickelt sich langsam. Jetzt gilt's, Christinchen, eine bessere Partie zu machen als die dicke Auguste, dann haben wir endlich die Kalbs glänzend geschlagen!‹
Das also soll mein Glück, der Inhalt meines Lebens sein: Gustchen zu demütigen? O Eitelkeit und Torheit!
Armer Vater, daß ich dir gerade diesen größten Wunsch nicht erfüllen kann! Welche Lüge, welch ein Betrug würde es sein, mit meinem Herzen voll grenzenloser Liebe für ihn, einem anderen Manne vermählt zu werden! Nie, nie wird das geschehen, und wenn Auguste von Kalb mir noch so weit an Eheglück und Ehre vorankommt; mag sie's, ich gönne ihr alles Beste nach ihrem Sinne.
Nur selten überfällt mich noch die ohnmächtige Starrheit, wie in meiner Jugend; ich irre auch nicht mehr in Zerstreutheit ab, wie früher, und bin froh, daß ich endlich sein kann, wie andere Menschen. Bin ich allein, so gebe ich mich getrost meinen süßen Träumereien hin, deren alleiniger Inhalt er ist.
Ich glaube nicht, ich kann es nicht glauben, daß er die Stein liebt; sie sind so verschieden an Jahren und Wesen. Er so feurig, sie so sanft. Er so lebhaft, stürmend, tatkräftig, sie so ruhig, nachdenklich und schwermütig. Er soll viel bei ihr sein; in der Gesellschaft merkt man nicht, daß sie sich nahe stehen. Fort mit Argwohn und Sorge, ich will das Glück genießen, das endlich mir zu teil wird!«