
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
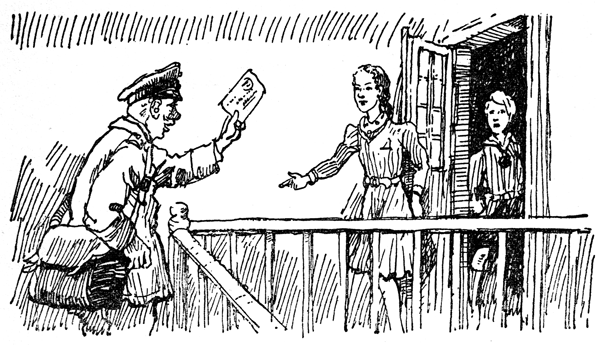
Es war ein Glück, ein seltener Zufall, es war ein unerhörter, ein märchenhafter Glückszufall, dachte Sybille, die mühsam nach irgendeinem Wort suchte, das diesem Ereignis gerecht werden könnte. Einem Ereignis, das gestern hätte eintreten können oder morgen oder irgendwann, vielleicht sogar überhaupt nicht, und nun zu so glücklicher Stunde geschah. An diesem Vormittag, der schulfrei war, und gerade als Sybilles Mutter ausgegangen war, um einzukaufen. Eine Tätigkeit, die jetzt, wo es das meiste doch auf Marken gab, die man vorweisen mußte, die abgeschnitten werden mußten, immer reichlich viel Zeit in Anspruch nahm.
Sybille hätte ihrer Mutter diese Arbeit gern abgenommen, natürlich. Sie hatte sich sogar dazu angeboten, nicht ohne Überwindung, weil sie doch gerade so ein wahnsinnig interessantes Buch las, das ihr Hanni gepumpt hatte. Aber die Mutter hatte nur gelächelt und dann gedankt. »Furchtbar nett, mein Mädel«, hatte sie gesagt, »aber du sollst diesen unverhofften Ferientag einmal richtig genießen.« Und sie war losgezogen, während Sybille teils dankbar, teils mit etwas schlechtem Gewissen zurückblieb. Denn wer weiß: wenn sie ihr Angebot etwas nachdrücklicher, etwas herzlicher vorgebracht hätte, dann wäre die Mutter vielleicht doch und ganz gern darauf eingegangen.
Aber nun war sie froh, daß sie zu Hause geblieben war. Denn wenig später hatte es geklingelt, der Briefbote hatte vor der Tür gestanden, hatte umständlich etwas aus seiner großen Ledertasche mit der weit überhängenden Klappe geholt und gesagt: »Ein Brief für Fräulein Sybille Beise. Ist doch wohl richtig hier, nicht wahr?«
»Ja«, hatte Sybille geantwortet und einen ganz roten Kopf bekommen vor Erregung und Verlegenheit, und sich zugleich schrecklich darüber geärgert, daß sie so rot geworden war. Aber dann hatte sie sich damit getröstet, daß es ziemlich dunkel, so richtig schummerig war hier im Hausflur, da hatte der Briefträger wohl ihr Erröten gar nicht wahrgenommen und auch nicht gesehen, wie ihre Hände zitterten, als sie den Brief in Empfang nahm. »Danke«, hatte sie gehaucht und die Tür leise geschlossen. Und diesen Augenblick, den Türdrücker noch in der einen, den Brief, einen richtigen Feldpostbrief, in der anderen Hand, den würde sie nun wohl niemals vergessen.
Es blieb leider wirklich nur ein Augenblick. Als sie sich umdrehte, da stand Peter, ihr Bruder, neben ihr. »Was gab's denn?« fragte er aufdringlich, mit seiner üblichen Neugier und Wißgelüstigkeit.
»Ach«, sagte Sybille mit gespielter Gleichgültigkeit. »Nur der Postbote ...«
»Für Mutti?« wollte Peter wissen. Es schien ihm im übrigen eine unnötige Frage, denn wer sonst von ihnen dreien bekam schon Post? Nur Mutti schrieb immer Briefe, dahin und dorthin, an alle möglichen Verwandten, die man zum Teil gar nicht kannte, noch nie gesehen hatte, und an den Bruder von Vati, von ihrem lieben, prächtigen Vati, der nun schon so lange tot war und an den man nicht denken konnte, ohne traurig zu werden. »Man muß zusammenhalten, man muß den Zusammenhang in der Familie, in der Sippe pflegen«, das war Muttis Ansicht und Überzeugung, sie sprach oft darüber, und daß die Familie doch eigentlich die Grundlage, die Voraussetzung des Staates, des Volkes sei, eine der Hunderttausende von Zellen, aus deren Gesamtheit sich das Volk bilde. Peter nickte dann ernsthaft, das waren Weisheiten, die er nur halb begriff, aber seine Mutter freute sich, wenn er aufmerkte und ihr Recht gab, und er machte ihr gern eine Freude, besonders, wenn es so leicht und ohne Opfer zu ermöglichen war. Aber innerlich war er nicht ganz derselben Ansicht, er dachte dann an Tante Natalie, die niemand leiden konnte, weil sie so komisch war und eine so spitze Zunge hatte, und an Onkel Herbert, der immer braschte und nie etwas mitbrachte für die Kinder, wenn er einmal zu Besuch kam, dafür aber an allem rummäkelte und die Mutter behandelte, als wäre sie ein kleines Mädchen und wüßte nicht, was sie tun und wie sie sich benehmen müsse.
Immerhin: »Für Mutti?« fragte Peter ein zweites Mal, denn wenn ihn auch die Antwort, die ja nichts weiter sein konnte als ein glattes Ja, sehr gleichgültig ließ, so sollte sich Sybille doch nicht einbilden, sie käme ohne eine solche Antwort davon.
»Nein, für mich«, erwiderte Sybille hochmütig und warf den Kopf in den Nacken, daß die beiden kastanienbraunen, dicken Zöpfe nur so flogen. Die Stunde des Triumphes war gekommen. Wie eine Königin, wie Brunhild, ging sie – nein, schritt sie, Königinnen schreiten, das Gehen überlassen sie den gewöhnlichen Sterblichen – an Peter vorbei in ihr Zimmer.
Peter war kein Seemann, er hielt es mit der Fliegerei und bastelte eben schon seit Wochen an seinem zweiten großen Segelflugzeugmodell. Trotzdem – wenn Sybille auch noch so angab, ihn konnte das nicht erschüttern. »Wichtigkeit!« sagte er patzig, und er legte in dieses Wort die ganze Verachtung, die ein Junge einem Mädel gegenüber zu empfinden verpflichtet ist, auch wenn dieses Mädel, wie hier, gute vier Jahre älter ist. Sie bleibt eben doch nur ein Mädchen.
Sybille überhörte das geflissentlich. Sie verschwand, ehe Peter noch etwas Boshaftes und Anzügliches hinzufügen konnte, und so stapfte er etwas verdrossen hinüber in die Besenkammer, die er sich mit mütterlicher Einwilligung als Werkstätte eingerichtet hatte. Hier war sein ureigenes Reich, hier durfte er sicher sein, daß niemand von den »Weibsleuten«, Sybille nicht und natürlich auch nicht die Mutter, es wagen würden, ihn zu stören. Hier konnte er also ganz unbesorgt seinen Einfällen und Plänen nachgehen – daß er eben ausnahmsweise einmal nicht sägte und hämmerte und klebte, das hatte freilich seinen besonderen Grund. Er konnte nämlich eine traurige Erfahrung, die er während der letzten Geländeübung hatte machen müssen, noch immer nicht verschmerzen. Da hatte man ihn von jedem Spähtruppunternehmen ausgeschlossen, er hatte egal weg gut versteckt in einer Sandkuhle liegen müssen, und als er sich schließlich ein Herz gefaßt und sich wegen der ihm angetanen Zurücksetzung beklagt hatte, da hatte man ihm gesagt: »Spähtrupp? Du? Kakfif ... kommt auf keinen Fall in Frage! Wo dein Haarschopf so leuchtet, daß man ihn auf dreihundert Meter im Dunkeln wahrnimmt. Du würdest ja den andern sofort unsere Stellung verraten!«
Das also war der Grund gewesen, und nun hantierte Peter, glühend vor Eifer, in seinem kleinen Reich, er hatte sich zwei oder drei Strähnen seines weißblonden, seidenweichen Haares abgeschnitten, die lagen nun fein säuberlich in kleinen Glasschalen, und er versuchte, sie mit Farben aus seinem Malkasten, ja sogar mit Tinte zu behandeln, damit sie schwarz wurden oder braun wie Sybilles Zöpfe oder wenigstens doch dunkelblond. Einstweilen freilich war diesen Bemühungen der rechte Erfolg versagt, und besonders die Locke, die er mit schwarzer, garantiert echter Eisengallustinte behandelt hatte, sah, ehrlich gesagt, scheußlich aus. Aber auch die anderen Farben erwiesen sich als unbeständig, vorläufig noch, er legte die gefärbten Locken probeweise ins Wasser, da wurden sie gleich wieder weiß oder gar fuchsig-bunt, und er haderte ernsthaft mit dem Schicksal während dieser Verdunkelungsübung, mit diesem Schicksal, das Sybille unnötigerweise mit so schönem braunem Haar beschenkt hatte, dessen sie gar nicht bedurfte – denn sie würde ja nie so ein Geländespiel mitzumachen brauchen – während er mit lächerlich weißblonden Haaren herumlief und es sich gefallen lassen mußte, daß sogar der Fähnleinführer ihn nur bei seinen Spitznamen Wittkopp rief.
Während dessen saß Sybille in ihrem Stübchen, in dem weißen, bequemen Rohrsessel, sie hielt den nun geöffneten Brief in der Hand und schaute vor sich hin, und es war ihr seltsam zumute. Da schrieb nun ein Soldat, sie hatte ihn nie von Angesicht zu Angesicht gesehen, Ludwig Zelter hieß er, sie hatte diesen Namen nie vordem gehört, nun sagte sie ihn leise vor sich hin. »Ludwig« flüsterte sie, und sie fand, daß es eigentlich ein schöner, ein wohlklingender Name sei. Er schrieb an das Mädchen Sybille Beise, und sie selbst war dieses Mädchen. Sie war vierzehn Jahre alt, sie saß in der fünften Klasse der Mädchenoberschule, in der Obertertia, hätte man früher gesagt, und die Lehrerinnen sagten schon Sie zu ihr und ihren Kameradinnen. Und ein Lehrer aus der Grundschule, dem sie neulich auf der Straße begegnet war, der hatte sie sogar zuerst höflich gegrüßt, ja als erster hatte er die Hand erhoben und getan, als wäre sie eine richtige Dame. Dieser Soldat aber, der schrieb ganz schlicht an sie, ganz einfach. »Liebe Sybille« schrieb er. Und »Du« redete er sie an, und sie nahm es ihm nicht einen Augenblick übel, sie fand es sogar richtig, es klang so warm, so kameradschaftlich, und es würde ihr das Recht geben, ebenfalls Du zu sagen zu ihm, und das war schön. Es war so, als wäre dieser Soldat dann gar nicht mehr so furchtbar weit weg, so viele hundert, ja wohl mehr als tausend Kilometer von ihrer Heimatstadt.
»Liebe Sybille« schrieb er. »Ich habe das Päckchen bekommen, das Du und Deine Schulkameradinnen mir geschickt habt, und ich habe, wenig später, das andere bekommen, das Buch und die Schokolade, und das ist nun nur von Dir. Ich habe mich über beides sehr gefreut, und ich habe Deiner ganzen Klasse meinen Dank gesagt, nun will ich es Dir gegenüber noch besonders tun. Denn Du sagtest ja in Deinem Brief, daß du einem Soldaten, irgendeinem unbekannten Soldaten, gern ab und an eine Freude bereiten, ihm einen Gruß aus Deiner Heimat, die ja, im weitesten Sinne, auch seine Heimat ist, schicken möchtest. Deine Zeilen haben mir doppelt wohlgetan, weil alles ganz so ist, wie du es Dir erhofftest, weil der, auf den Du verfallen bist, wirklich sehr allein steht auf der Welt. Ohne Vater und ohne Mutter und leider auch, da er das schmerzliche Schicksal litt, der einzige zu sein, ohne Geschwister. Da ist es natürlich schön, jemand zu wissen, der fern in der Heimat an ihn denkt – und sei dieser Jemand auch nur ein Mädchen von vierzehn Jahren – so alt ungefähr mußt Du sein nach meiner Berechnung – und demnach ein halbes oder gar ein ganzes Kind noch. Aber warte, ich muß mich berichtigen: ganz so allein bin ich natürlich nun wieder nicht, denn ich bin ja Soldat, ich bin einer aus dem großen, großen Heer, das aufmarschiert ist, um seines Volkes, seines Vaterlandes Recht und Zukunft und Bestand zu verteidigen und zu sichern. Und da bin ich denn eben doch nicht allein, denn wer Soldat ist, der hat Kameraden, und Kameraden sind Menschen, mit denen man durch das Schicksal zu einer ganz seltenen Gemeinschaft zusammengeschmiedet ist, was dem einen Gutes geschieht, das erfreut und beglückt auch den andern, und wenn der eine blutet, so zuckt auch des andern Herz. Kameraden lachen zusammen und sie arbeiten zusammen, sie kämpfen zusammen und vielleicht sterben sie auch einmal zusammen, und manchmal denke ich, obwohl ich, wie gesagt, keine Geschwister habe, sie sind inniger miteinander verbunden als zwei leibliche Brüder. Sie kennen sich so gut, so bis ins letzte Fältchen ihres Wesens hinein, daß jeder die Bewegung des andern, den Gedanken des andern schon errät, noch ehe sie ausgeführt oder gedacht sind. Und so bin ich, in diesem Sinne, nun freilich doch nicht allein – da ist ein kleiner Kreis von andern, jeder hat bislang sein eigenes und persönliches Leben gelebt, aber nun sind wir eins und wir gehören zusammen, und das macht auch das Schwerste noch leicht.
Ich weiß nicht, ob Du das verstehst mit Deinen jungen Jahren, liebe Sybille. Wenn nicht, dann wird es Dir Deine Mutter – sicher hast Du eine gute, sorgende, liebevolle Mutter, das kann ja gar nicht anders sein –, also die wird Dir das vielleicht besser erklären, als ich es vermag. Aber ich meine beinahe, das wird nicht nötig sein. Diese Zeit, in der wir leben, in der wir leben dürfen, diese große Zeit, in der wieder einmal unseres Volkes Zukunft auf der Waage des Ewigen liegt, die macht auch die Jungen reif und anders reif als ihre Alterskameraden und -kameradinnen aus früheren Jahrzehnten. Und selbst ein vierzehnjähriges Mädel wird begreifen, wenn nicht mit dem Verstand, so doch wenigstens mit dem Herzen, was ich hier meine, was ich mit meinen einfachen und vielleicht ungeschickten Worten auszudrücken bemüht bin.
Ich soll Dir von mir und von unserm Leben hier erzählen, so schriebst Du. Nun, da ist nicht viel zu sagen. Wir liegen hier im Westen irgendwo und tun unsern Dienst und warten. Du wirst sagen – oder wenigstens denken –, das ist nicht viel. Aber es ist leider mehr und schwerer, als Du es Dir vorzustellen vermagst. Warten ist immer schwerer als tun, als handeln, und wenn man es seit sieben, acht Monaten hat tun müssen, seit dem Augenblick, als man von Polen hier rüber geworfen wurde, dann ist das sogar allerhand. Dann ist das eine harte Geduldsprobe, die auch den besten mit der Zeit müde machen könnte. Aber das gerade ist es ja, was wir auf keinen Fall werden dürfen: müde, und so haben wir schließlich auch dann etwas zu tun, wenn wir eigentlich gar nichts zu tun haben und wenn wir dienstfrei sind. Wir müssen nämlich dann noch immer und dauernd an uns selbst arbeiten, damit wir eben nicht müde werden. Damit wir ohne Ungeduld des Augenblicks harren, wo man uns ruft, wo man uns braucht.
Du wirst nun vielleicht, Sybille, wissen wollen und genauer wissen wollen, wo ich bin, wo wir liegen, meine Kameraden und ich. Sicher denkst Du es Dir nett, den Ort auf der Karte festzustellen, Dir für Deine Gedanken so einen festen Punkt im Raume suchen zu können. Und nun muß ich Dich zum andern Male enttäuschen. Weil bei einer solchen Frage dem Soldaten die zweite große Aufgabe erwächst, neben dem Wartenkönnen: das Schweigenkönnen. Schwatzhaftigkeit und Redseligkeit in rein militärischen Dingen hat in Kriegs- und Friedenszeiten schon viel Unheil angerichtet, so ist es gut, wenn man es gelernt hat und weiß, daß Schweigen nicht nur eine Tugend des Soldaten ist, sondern eine heilige Pflicht. Irgendwo im Westen stehe ich, einer unter vielen, und das muß Dir genügen. Es wird Dir genügen, denn Du bist doch die Sybille Beise. Du bist das Mädchen, das dem unbekannten Soldaten Ludwig Zelter einen Brief ins Feld geschrieben und ihm damit eine große, große Freude bereitet hat. Für die er hiermit nochmals und herzlich dankt.«
Sybille hatte den Brief, diesen langen Brief, erst verschlungen, und dann hatte sie ihn gelesen, Zeile für Zeile, und beim drittenmal, da hatte sie ihn fast buchstabiert, Wort für Wort. Nun kannte sie ihn beinahe schon auswendig. Sie saß da, auf ihrem leichten Sesselchen, es war kühl in dem kleinen Zimmer, das nach Norden lag und selbst im Sommer kaum je einen Lichtstrahl von der Sonne draußen erhielt, aber sie fror nicht. Ihr war sehr warm, und sie war froh. Und auch stolz. Ja, richtig stolz. Weil dieser Brief der erste richtige Brief war, den sie in ihrem jungen Leben bekommen hatte. Die Zettelchen, die sie und ihre Freundinnen sich gelegentlich unter der Schulbank zuschoben, die zählten ja nicht. Und sonst bekam sie höchstens mal eine Ansichtskarte von einer Tante oder einem sonstigen Verwandten, aus der Sommerfrische, vom Strand etwa oder aus den Alpen, wenn es hoch kam, wohl auch aus Italien. Einen Brief, und noch dazu einen so wunderbaren Brief, den man gar nicht gleich vergessen konnte, den man überhaupt nicht vergessen konnte, den man las wie ein Kapitel aus einem schönen und ergreifenden und ernsten und traurigen Buch, den hatte sie noch nie bekommen.
»Der ist nun ganz für mich allein«, dachte Sybille, und auch das war ein Glück, etwas zu besitzen, was einem ganz allein gehörte, ein ganz persönliches Eigentum zu haben. Sie würde zu keinem, zu niemandem davon sprechen, und sie würde den Brief immer bei sich behalten. Am besten wäre es wohl, sie machte sich dafür ein besonderes Täschchen, sie hatte Geschick zu solchen kleinen Arbeiten, und manchmal plante sie sogar, dies Talent später einmal zu verwerten und Kunstgewerblerin zu werden oder etwas Ähnliches. Sie wußte zwar nicht ganz genau, was sie sich unter diesem Beruf vorstellen sollte, aber daß es etwas Besonderes war und etwas, das ihr Spaß machen würde, das schien ihr sicher. Im übrigen: sie würde nun gleich antworten, am besten heute noch, am besten sofort, es dauerte ja einige Zeit, bis der Brief ankam, auch dieser war acht Tage gelaufen, und so würde sie sich vierzehn Tage freuen können, vierzehn Tage auf den nächsten Brief warten können, und dann immer so weiter. Es würden viele, viele Briefe aus dem einen werden, und da lohnte es sich gewiß, sich so ein Täschchen zu arbeiten.
Während Sybille noch darüber nachdachte, hörte sie die Wohnungstür gehen – das konnte nur die Mutter sein. Sybille sprang auf wie von der Tarantel gestochen, sie fegte aus ihrem Zimmer heraus wie ein Windstoß, und so freudig glühte ihr Gesicht, daß ihre Mutter kopfschüttelnd fragte: »Nanu – Kind? Sybille? Was ist denn mit dir los?«
»Och – nichts«, erwiderte Sybille und tat plötzlich so, als wäre gar nichts besonderes geschehen, als wäre die Welt in nichts verändert. Und erst als sie merkte, daß Peter, der mit zornig gefurchter Stirn aus der Besenkammer herausgekrochen kam – seine Versuche mit der Haarfärberei wollten und wollten nicht ein richtiges, befriedigendes Ergebnis erzielen, und er würde sich damit abfinden müssen, auch beim nächsten Kriegsspiel nur wieder in irgendeiner blöden Sandkaule zu liegen, er würde niemals einen Sonderauftrag erhalten, niemals befördert und ein Führer werden – ja, erst als Sybille merkte, daß ihr Bruder Peter im Augenblick sein ganzes Interesse dem Inhalt des Einkaufsnetzes zuwandte und ihn sachverständig und hoffnungsvoll untersuchte, erst da flüsterte sie ihrer Mutter zu: »Weißt du, Mutti – ich habe vorhin einen Brief bekommen.«
»Einen Brief?« wunderte sich Frau Beise. Allerdings, das war ein erstaunliches Ereignis, denn wann war das je geschehen? »Von wem denn, Kind?« fragte sie, nun selbst ziemlich neugierig geworden.
»Von Zelter«, erwiderte Sybille triumphierend. »Von Ludwig Zelter natürlich!« Und voller Erwartung sah sie ihre Mutter an.
Zelter? Zelter? Frau Beise grübelte angestrengt nach, sie konnte sich unter diesem Namen niemanden vorstellen, und sie sah völlig verwirrt und richtig ein bißchen komisch aus, wie sie sich so abmühte, diese geheimnisvollen Zusammenhänge zu verstehen. Sybille hätte gern gelacht, so drollig erschien ihr das Gesicht der Mutter in diesem Augenblick. Aber der Lachreiz wurde verdrängt von gerechter Empörung darüber, daß ihre Mutter, ihre goldene Mutti, die sie doch sonst immer so gut verstand, diesmal, und gerade wo es so besonders wichtig war, versagte. Völlig versagte, jawohl!
»Aber das ist doch der Soldat, dem ich geschrieben habe«, erklärte sie verletzt. »Ich habe es dir doch erzählt, damals, als unsere Klasse das Paket ins Feld schickte, und daß ich unmittelbar hinterher noch ein besonderes kleines Päckchen, nur von mir, nachgeschickt habe.«
»Ach so ... ja ... natürlich!« Frau Beise atmete auf. Sie hatte den Einfall ihrer Sybille damals sehr nett gefunden. Nun war also die erwartete Antwort eingegangen – sehr hübsch, wirklich. Aber daß das Mädel dadurch gleich so aus Rand und Band kam, wunderte die Mutter doch.
»Du mußt nicht böse sein, Mutti«, sagte Sybille sehr leise, als Frau Beise die Hand nach dem Brief streckte, den das Mädchen wie eine Siegesfahne in der Hand schwenkte. »Aber der Brief ist natürlich ganz allein für mich bestimmt, und ich ...«
»Ach so, ja – natürlich ...« Frau Beise ließ die ausgestreckte Hand wieder sinken. Sie war ein bißchen traurig: da war nun Sybille, ihre Tochter ... seit eh und je hatte sie alle ihre Gedanken, alle ihre Hoffnungen und Pläne und Empfindungen ihrer Mutter anvertraut, die Seele dieses Kindes lag offen wie ein Buch vor der Mutter, sie war eben ein Mädchen und darin anders als Peter, der schon früh so eigenwillig war und seine besonderen Wege ging. Und nun: fing sie nun an, Geheimnisse vor der Mutter zu haben? Begann das so früh? Frau Beise versuchte, an ihre eigene Jugend zu denken, aber sie konnte sich nicht entsinnen, wie das damals mit ihr gewesen war.
Sie lächelte ein wenig – Sybille sollte nicht sehen, daß ihr das nahe gegangen war. »Du hast recht, mein Kind«, sagte sie. »Und es ist ja auch dein Brief.« Und sie wandte sich nach der Küche, um die Vorbereitungen für das Mittagessen zu treffen.
Sybille ging ihr nach. Sie hätte ein bißchen helfen müssen, sie wollte es wohl auch zunächst. Aber dann setzte sie sich statt dessen auf die Küchenbank. Sie nahm den Brief vor und las ihn langsam zum vierten Male.
»Weißt du, Mutti«, meinte sie nach einiger Zeit, zögernd noch und etwas ungewiß, »ich ... also, möchtest du nicht ein Stück aus dem Brief hören? Da steht etwas drin, was eigentlich auch für dich bestimmt ist. Aber natürlich nur, wenn du Lust hast zuzuhören.«
»Aber gern, Kind, sehr gern«, ermunterte Frau Beise ihre Tochter. Und das Lächeln, das jetzt über ihre Lippen huschte, war schon anderer Art, erwartungsvoll und sehr viel zuversichtlicher.
Sybille las langsam und mit den gehörigen Pausen die Stelle vor, die sich auf die Kameradschaft bezog und in der der Soldat Ludwig Zelter auch Sybilles Mutter erwähnte.
Als sie schloß, entstand eine kleine Stille, in die endlich Sybilles Frage hineinplatzte: »Also ... wie findest du das, was Ludwig da schreibt?«
Ludwig sagte sie, jawohl. Der Name sprang ihr glatt und ohne Zögern von den Lippen, es war ihr, als hätte sie ihn seit langem täglich viele Male ausgesprochen, so vertraut erklang er ihr.
»Ich finde es sehr schön«, erwiderte Frau Beise, ohne sich zu besinnen. »Er hat seine Aufgabe, die ihm das Vaterland gestellt hat, sehr richtig verstanden und ist ganz in sie hineingewachsen. Er scheint ein prächtiger Mensch zu sein, dein ... dein Soldat.«
»Ich könnte dir auch noch eine andere Stelle vorlesen«, meinte Sybille und seufzte befriedigt. »Die zum Beispiel, wo er von dem Wartenmüssen schreibt, die ist auch sehr schön. Wenn du Zeit und Lust hast zuzuhören, natürlich nur.«
Ja, Frau Beise hatte Zeit, und sie hatte Lust, sie ließ keinen Zweifel darüber aufkommen. Sie war eine richtige Mutter, und richtige Mütter, die mögen noch soviel zu tun, zu sorgen und zu arbeiten haben, sie haben immer Zeit für ihre Kinder und für deren kleine und große Sorgen und Nöte und Freuden. Immer, jawohl – auch wenn sie schließlich die Nacht zu Hilfe nehmen müssen, um ihre eigenen Aufgaben zu erledigen.
Sybille las also weiter, den letzten Teil des Briefes. Und als sie soweit gekommen war, fand sie, das Bild, das sich ihre Mutter von dem Soldaten Ludwig Zelter machen könnte, würde unvollkommen bleiben, wenn sie nun nicht auch noch den Anfang des Briefes vorlas.
»So«, sagte sie endlich mit einem kleinen Aufatmen, »das wäre nun alles. Und er hat auch eine so ... so charakteristische Handschrift – das schwere Wort machte ihr Mühe, aber nun, da sie es endlich ausgesprochen hatte, war sie fast stolz darauf und fühlte sich verpflichtet, es zu wiederholen –, »eine sehr charakteristische Handschrift, wirklich, du wirst es ebenfalls sagen, Mutti«, und sie reichte der Mutter den Brief hinüber, diesen Brief, den sie bekommen hatte und der doch ganz für sie allein sein sollte, den kein anderer lesen, kein anderer in die Hand nehmen sollte, wie sie es sich noch vor kurzem so fest vorgenommen hatte. Und sie ruhte nicht eher, als bis Frau Beise nun ihrerseits den Brief von Anfang bis zu Ende gelesen und studiert und gebührend gelobt hatte. Erst als das geschehen war, als die Mutter noch einmal eine Menge freundlicher, ja herzlicher Worte über den Soldaten gesagt hatte, war Sybille zufrieden.
»Jetzt will ich dir aber wirklich helfen«, sagte Sybille und machte sich mit Feuereifer über das Gemüse her. Denn wenn ihr der heutige Tag etwas Gutes und Unerwartetes beschert hatte, so war es nur recht und billig, daß sie alles nur mögliche tat, um sich dieses Geschenkes als würdig zu erweisen.