
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Natur hat im Laufe ungezählter Jahrtausende in den verschiedenen Klimaten und Landschaftsformen des Erdballs durch Auslese und Anpassung überall wunderbar abgestimmte Lebensgemeinschaften geschaffen, deren Mitglieder, durch unsichtbare Fäden miteinander verbunden, aufs engste aufeinander angewiesen sind. Deshalb pflegt sich die Ausrottung einer Tierart auch für den Menschen früher oder später zu rächen. Wo man z. B. die angeblich schädlichen Raubvögel völlig vertilgt hat, da vermehren sich Hamster, Kaninchen und das vielartige Mäusegezücht derart ins Ungemessene, daß diese Nager bald zur Landplage werden. Moebius, der den Begriff der Lebensgemeinschaft (Biozönose) zuerst aufstellte, ging dabei von der Austernbank aus: in der Tat kein übles Beispiel, denn vielleicht herrscht nirgends auf Erden so vielgestaltiges Leben, so verwirrende Formenfülle, so bestechende Farbenpracht wie in der lauwarmen Uferzone tropischer Meere. Man könnte aber auch ebensogut unseren deutschen Wald mit all seinen Pflanzen und all seinem Getier als vollendetes Beispiel einer harmonisch ausgeglichenen Lebensgemeinschaft aufstellen, und dabei würden sich noch die verschiedensten Abarten dieser Lebensgemeinschaft widerspiegeln im Auenwald oder Gebirgswald, im Laub- oder Nadelwald, im geschlossenen Forst oder im kleinen Feldgehölz. Solche verschiedenartige Wohnplätze der Lebewesen bezeichnet man wissenschaftlich als Biotope (Abb. 1). Auch dem Laien wird es sofort klar sein, daß der mitteleuropäische Wald in bezug auf die Tierwelt ein ganz anderes Gepräge haben muß als etwa der tropische Regenwald, der keinen Winter kennt und das ganze Jahr über seine Gaben in verschwenderischer Fülle darbietet. So erzeugt unser Wald fast gar keine fleischigen Früchte, und die wenigen, die sich finden, sind nur in einem sehr beschränkten Teile des Jahres vorhanden. Ebenso fehlen im Winter die Blätter der Laubbäume. Ausgesprochene tierische Frucht- und Laubfresser vermöchten also bei uns gar nicht zu leben. Die Tierwelt unserer Forsten wird daher ärmer sein als die der Tropenwälder. Wir sehen also hier sofort die unmittelbare oder wenigstens mittelbare Abhängigkeit der Tiergesellschaft von der Pflanzenwelt. Wo die Pflanze verschwindet, findet auch das Tier keine Wohnstätte mehr. Selbst der kleine schwarze Gletscherfloh, der zu den Springschwänzen gehört und im Schmelzwasser der Eisgrübchen der höchsten Alpengletscher lebt, ein wahres Stiefkind der Natur, braucht doch wenigstens die zerfallenen Reste von Alpenpflanzen, die ihm von noch höheren Felsgraten her mit dem Schmelzwasser als Nahrung zugeführt werden. Auch die Gazelle vermag völlig pflanzenlose Sandstrecken der Wüste nur flüchtig zu durcheilen, der Zugvogel sie nur auf seinen Wanderungen rasch zu überfliegen, und der Löwe ist durchaus nicht der »Wüstenkönig«, zu dem Freiligrath ihn stempeln wollte.
Die Erde allein zieht uns nicht an, sondern das Leben, das sich auf ihr so mannigfach entfaltet. Darin beruht auch der vielbesungene Waldeszauber, dem sich ein unverdorbenes Menschengemüt so gern und mit tiefem Behagen hingibt. Es ist eigentlich grundfalsch, von »Waldeseinsamkeit« zu sprechen. Nein – wie unter den wogenden Wellen des Meeres ein buntes Gewimmel überraschend vielgestaltiger Tiere sich drängt, so auch unter den rauschenden Wipfeln der Waldbäume als eine unerschöpfliche Fundgrube für den Naturfreund, als eine unversiegliche Quelle für den Forscher. Jede alte Eiche oder Kiefer ist dabei wieder eine Lebensgemeinschaft für sich, wimmelnd von allerhand Kleingetier. Aber so mannigfach die tierische Bewohnerschaft des Waldes auch zusammengesetzt sein mag, so ist sie doch keineswegs vom launischen Zufall planlos zusammengewürfelt, sondern in ganz bestimmter Weise abgeschlossen, scharf und planmäßig begrenzt. Und wenn auch zahlreiche Tierarten den deutschen Wald als Lebensherberge ansehen, so muß doch dessen Bewohnerschaft vom vergleichend-wissenschaftlichen Standpunkte aus eigentlich als arm bezeichnet werden. Jedenfalls halten die Wälder der gemäßigten Breiten in dieser Beziehung keinen Vergleich aus mit denen der Tropen. Es fehlt ihnen das lärmende Gaukelvolk der Affen, die kreischenden Flüge bunter Papageien, die schimmernden Elfengestalten der Kolibris; es fehlen die blutdürstigen Großkatzen und die riesigen Dickhäuter, die gleißenden Schlangen und die mit den alten Baumknorren förmlich zu einem Gebilde verschmelzenden Faultiere.
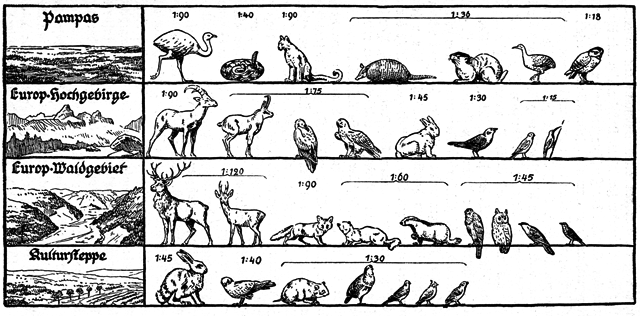
Abb. 1. Biotope und Lebensgemeinschaften.
I. Pampas mit Nandu, Klapperschlange, Puma, Gürteltier, Präriehund, Steißhuhn, Prärieeule,
II. Europ. Hochgebirge mit Steinbock, Gemse, Bartgeier, Steinadler, Alpenhast, Alpendohle, Schneefink, Mauerläufer,
III. Europ. Waldgebiet mit Edelhirsch, Reh, Fuchs, Marder, Dachs, Bussard, Ohreule, Kuckuck, Singdrossel,
IV. Kultursteppe mit Feldhase, Kornweihe, Hamster, Rebhuhn, Feldlerche, Haubenlerche, Sperling.
Dabei wissen wir durch die übereinstimmenden Berichte der Forschungsreisenden, daß eigentlich auch der vielgepriesene Tropenurwald in seinem Inneren erschreckend arm ist, daß sich regeres Tierleben nur an seinen Rändern und auf seinen Lichtungen entfaltet. Sonst herrscht hier noch die Pflanze. Ähnlich auch bei uns. Die Parklandschaft, mag sie nun von der Natur oder künstlich vom Menschen geschaffen sein, ist jedenfalls sehr viel tierreicher als der geschlossene Wald. Wenn wir trotzdem gerade diesen mitsamt seinen Bewohnern so sehr lieben, so ist dies wohl darauf zurückzuführen, daß er Wohn- und Zufluchtstätte ist gerade für unsere edelsten, d. h. höchststehenden Tierarten, die uns natürlich ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Hier begegnen wir noch unserem stolzesten Wild, dem herrlichen Edelhirsch, hier unserem wehrhaftesten, dem ritterlichen Schwarzkittel; hier schleicht der geschmeidige Edelmarder dem munteren Eichhörnchen nach, hier führt der Dachs sein behäbiges Einsiedlerdasein, vollbringt der rote Freibeuter seine Schelmenstreiche, fegt der zierliche Rehbock das werdende Gehörn, probt die lustige Vogelschar ihre Stimmen zum großen Frühlingskonzert. Zwischen Wald und Wald ist dabei freilich ein großer Unterschied. Hirsch und Reh fühlen sich nicht heimisch in einem Wald, der des Unterholzes entbehrt, keine Wiesen umschließt, nicht von Feldflächen begrenzt wird. Das Tier hat eben nicht nur Wohnraum nötig, sondern auch Ernährungsraum, und erst die möglichst glückliche Vereinigung beider verbürgt ihm ein gesichertes Dasein. Je mehr der Mensch den Wald in Betrieb genommen und ihn zum regelrecht bewirtschafteten Forst umgewandelt hat, desto ärmer wird dieser an größeren Säugetieren und Vögeln sein. Bär und Wolf, Wisent und Elch, Luchs und Biber, Adler und Uhu, Schwarzstorch und Kolkrabe – sie alle sind aus unseren nur allzu zahm gewordenen Ländern entweder schon verschwunden oder in winzigen Restbeständen in die entlegensten Winkel zurückgedrängt und dem Aussterben nahe gebracht worden, während sich dafür das vielartige Mäusegezücht breit macht und das böse Heer der waldvernichtenden Kerfe. Dies ist die zweite und ungleich gefährlichere Tat, durch die der Mensch verändernd in das große Gesamtbild des Naturganzen eingegriffen hat. Als größtes und unersättlichstes Raubtier der Welt reißt er hier in kurzsichtiger Habgier Lücken, die sich nie wieder schließen lassen. Reicher als die Säugetiere sind im deutschen Walde die Vögel vertreten, und sie fallen auch mehr auf, weil sie sich nicht so ängstlich dem Auge des Menschen entziehen.
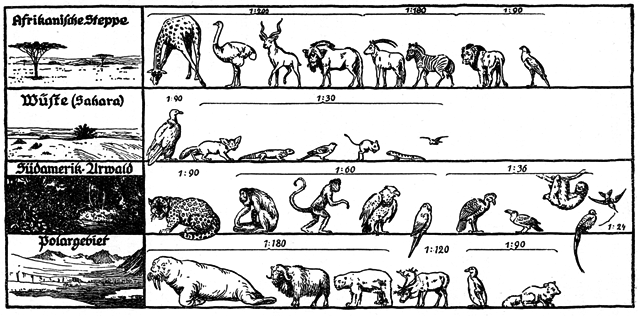
Abb. 2. Biotope und Lebensgemeinschaften
I. Afrikanische Steppe mit Giraffe, Strauß, Kudu, Gnu, Gabelantilope, Zebra, Löwe, Sekretär,
II. Sandwüste mit Geier, Wüstenfuchs, Dornschwanz, Sandflughuhn, Springmaus, Skink, Knackerlerche,
III. Südamerik. Urwald mit Jaguar, Brüllaffe, Spinnenaffe, Harpyie, Arara, Hokkohuhn, Pfefferfresser, Faultier, Quesal, Kolibri,
IV. Polargebiet mit Walroß, Moschusochse, Eisbär, Renntier, Alk, Eisfuchs.
Mag unser Wald in gewissem Sinne auch tierarm sein, so stellt er doch wohl das Schönste dar, das die Natur auf dem weiten Erdball geschaffen, eine abgerundete, durch keinerlei Schroffheiten verzerrte Lebensgemeinschaft in höchster Vollendung (Abb. 2)!