
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Groß und für immer den Weg bestimmend steht nach so viel Erfahrungen am Horizont unseres Denkens der Umriß des Gesetzes, das Münchens Dasein bestimmt. Unentrinnbar ist hier alles eingespannt in einen Rahmen, der das gemeinsame Lebensgesetz festlegt für jeden, der auf diesem Boden Dauer haben will.
In den Wanderungen der Meere, der Berge, der Klimate und der Organismen haben wir das Gemeinsame und sie Leitende erkannt.
Eingeordnet war auch der Mensch in das Gesetz als ein Glied – und nicht einmal als das ausschlaggebende Glied des Ganzen. Riesengroß steigt dadurch und zwingend ein Gedanke empor: als sei hier endlich die von den Jahrhunderten so heiß gesuchte Regelung seiner Stellung zur Welt gefunden: die große und letzte Frage, die im tiefsten Grunde das innerste Problem aller Philosophien und eigentlich auch das ihrer feindlichen Schwester, der Religionen ist. Woher komme ich? Was bin ich? Wo gehe ich hin?
Und sichtbar wird auch schon die letzte und höchste Problemformulierung, die dieses Buch, das nun auf einmal sein Thema nur als Gleichnis seiner letzten Absichten enthüllt, überhaupt anstreben kann. Seine Problemarchitektur wurde so aufgebaut, daß es an einem Experiment selbst die entscheidende Antwort auf seine bedeutsamste Frage geben kann.
Das Leben des Münchner Bodens wurde als notwendige Folge der Geschichte dieses Bodens erkannt. Als Gesetz dieses Lebens wurde eine bestimmte Folge von Wanderungen festgestellt, sowie eine undurchbrechbare Gruppierung der Einwanderer nach der geologischen Struktur des Bodens. Bewiesen ist bisher, daß auch der Mensch, ohne es zu wissen, dem Einwanderungsgesetz unterworfen war (und ist); offen steht nur noch die letzte Frage: Gruppieren sich auch die Menschen nach dem Gesetz des Bodens?
Durchsichtig und zwingend hält hier Logik einen Entscheid von unausdenkbaren Konsequenzen für uns bereit.
Wenn die Identität der Gesetze gilt, dann muß es, wie es in München vier ansässig gewordene und einen »zuwandernden« Typus von Boden, Edaphon, Pflanzen und Tieren gibt, auch fünf Typen von Menschen geben: auf dem Schotterzentrum eine andere Ausprägung, als auf dem Löß, am nördlichen Moorrand eine andere, als auf dem südlichen Alpenrand. Und dazu das fluktuierende Element eines ungeheueren Fremdenverkehrs, der alles das durchdringt und eigentlich nie zur Ruhe kommen läßt.
Da ist die letzte Aufgabe dieser Untersuchungen aufgerichtet wie eine Falle, der wir nicht entrinnen können. Sind diese fünf Typen von Menschen vorhanden und so wohl ausgeprägt, wie auch die anderen Organismen, dann gilt das gleiche Gesetz für alle, dann gibt es nur eine gleiche Regelung für Menschen- und Naturleben, dann ist eine ganze, große Philosophie an einem wundervollen Experiment bewiesen und erhärtet und als Wahrheit ins Leben getreten. Und dieses Werk ist damit zu Ende gebracht.
*
Das Nächste ist also, zu untersuchen: Wer ist es, der heute München bewohnt? Woher stammen diese 660 000 Menschen und ihre Vorfahren, als deren Hände Werk diese wunderbare, unbegreiflich kontrastreiche, ehrwürdige, schwerfällige und zugleich ruhelose, mit Kunstwerken und Intelligenzen erfüllte, zugleich klein- und großstädtische, für alle anziehende Stadt vor uns steht, der man es zu gleicher Zeit nachsagen kann, daß sie ein »Bierdorf« und daß sie eine Weltstadt ist? Und wenn wir ihre Herkunft wissen, dann gilt es zu sehen, wo die einzelnen wohnen, wie sie wohnen, wie sie sich kleiden, welchen Beruf sie erwählten, welches Kulturniveau sie erreichten und welche Sprache sie sprechen. Danach wird sich dann die Antwort auf unsere große Frage von selbst ergeben.
Den rassischen Urbestandteil dieser Münchner Bevölkerung, um mit den Bausteinen selbst zu beginnen, kennen wir schon. Der Homo europaeus mit Neandertaler Einschlag, mit viel Homo alpinus und etwas Homo mediterraneus (Hallstätter) gemischt, das Ganze in keltischer Ausprägung und übersprüht mit Völkerwanderungsgermanen und Römern, so murmelt die Erinnerung.
Zu dieser Urbevölkerung stießen im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Bajuwaren. Längst hat man sich dahin geeinigt, den Bayern einen Jahrhunderte währenden Wohnsitz in Böhmen anzuweisen, den sie, durch den Abzug der römischen Bevölkerung veranlaßt, gegen die Besiedelung Bayerns vertauschten, wobei sie zweifelsohne den schlechteren Tausch machten. Als ursprünglicher Ausgangspunkt der Bayern scheint – Ironie des Weltenganges – das Land zwischen Spree und Havel anzusehen zu sein. Dort saßen die Semnonen, von denen ein Zweig, die Sueven [Sweben, Schwaben] zur Zeit von Caracalla [213 n. Chr.] nach Franken am Limes saßen. Hundert Jahre später hatten sie ihn durchbrochen und zogen als Allemannen] und Schwaben bis an den Bodensee. Aus ihnen zog das Volk der Markomannen schon früher aus und bekämpfte die keltischen Bojer in Böhmen. In den Jahren 166-180 auch die Römer an der Donau. Die Römer wichen bis zum Jahre 488 und nun strömten Markomannen auch über die Donau bis in die Alpen. Jetzt nannten sie sich Bajoarii [Bajuwari] und breiteten sich bis zum Lech und Inn aus, während zwischen Inn und Enns die alten Markomannen sitzen blieben. Dadurch schied sich wieder Altbayern [das frühere Vindelizien] von der Ostmark [dem früheren Noricum], die auch pflanzen- und tiergeographische Provinzen sind, wie sich denn überhaupt in aller Völkerbildung und politischer Geschichte die biologisch-geologischen Gesetze spiegeln. Übrigens steht die bayerische Mundart der gotischen in Wortschatz, Formenbildung und Lautgebung mit am nächsten. Vgl. es = iz [got], enker [bayer.] = igquara [got.], enk = igquis, habts = habats, suchts [ihr suchet) = sokjats. Solche Übereinstimmungen sind namentlich in Nordtiroler Tälern derartig, daß man dort Goten vermuten kann. [Vgl. L. Wilser, Rassen und Völker. 8°. S. 74. Man besitzt ein bestimmtes Datum, an dem dieser Prozeß einen Ruhepunkt fand; das ist das Auftreten des ersten Bayernherzogs Garibald im Jahre 554.
Diese erste Bayernbesiedelung hat dreierlei Spuren hinterlassen: Geschichtsdokumente, wie sie hier im Auszug wiedergegeben sind, Schädel und Waffen und Spuren ihres Ackerbaues, nämlich Hochäcker.
Aus den Völkerwanderungsfunden mit ihren Reihengräbern Solche sind in der Umgebung Münchens und auf dem Stadtterritorium selbst sehr häufig, obwohl gerade sie als die letzten am meisten durch die nachfolgende Kultur zu leiden hatten. Das berühmteste der allemannischen Gräberfelder liegt allerdings erst weiter weg in Schretzheim, BA. Dillingen a. Donau, wo man 344 Gräber aufgedeckt hat, die Bronzegeräte, Saxe, Bernsteinperlen usw. enthalten [vgl. Beiträge zur Anthropologie Bayerns 1904]. Reihengräber liegen auch bei Westerschondorf, dort auch Trichtergruben, ebenso an der Dellinger Höhe. Flachgräber sind aufgedeckt bei Fürstenfeldbruck, Aubing und Gauting, Reihengräber bei Feldafing. Zwei Saxe fanden sich bei Tutzing. Funde der Völkerwanderung sind häufig entlang der Isartalstraße. Bei Puppling sind Karolinger- Reihengräber vorhanden, im Isarbett selbst fanden sich Karolingerlanzen, in der Kiesgrube bei Beigarten Reihengräber. Auf Münchner Gebiet beim Harras Reihengräber, desgleichen in der Tegernseer Landstraße., die bis zur Merowinger- und Karolingerzeit reichen, läßt sich entnehmen, daß die Bayern einfach die bestehenden Siedelungen fortsetzten und die Isarfurt nach wie vor dort benützten, wo sie am gangbarsten war. Sie scheint in ihrer Lagerung wiederholt gewechselt zu haben; dementsprechend wurde die große » Salzstraße« (der Name taucht sehr frühzeitig auf und sollte als der eigentliche Urheber Münchens eigentlich in dessen Straßennamen vertreten sein) immer wieder verlegt und hat bei der rückschreitenden Erosion des Isartales im allgemeinen die Tendenz, nach Süden zu wandern.
Aus den Gräbern dieser Übergangszeit kommt ein Bevolkerungstypus zutage, der sich scharf gegen die Provinzialen Spätroms scheidet. Die Langschädel nehmen auffallend zu und in den Reihengräbern ruht ein Geschlecht, das 88 Prozent Langschädel (42 Prozent reine Dolichokephalen) aufweist, während das heutige Südbayern nurmehr ein Prozent Langschädel besitzt!
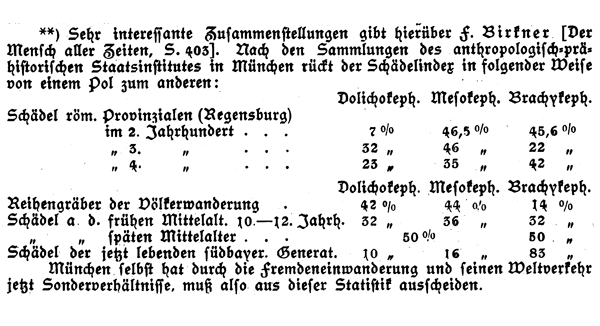
Fußnote aus technischen Gründen als Bild eingefügt. Re. für Gutenberg
Es ist also ein unverkennbarer Umwandlungs- und Aufsaugungsprozeß durch den brachykephalen Homo alpinus im Gange, was sich, wie J. Ranke mit Recht hervorhebt, auch darin zeigt, daß in den heutigen rundköpfigen Münchner Gesichtern eine Menge Züge auf den dolichokephalen Typus hinweisen, wie z. B. die Vorwölbung der Unterstirn, die hervorragenden Augenbrauenbogen oder das tiefere Einsetzen der Nasenwurzel (vgl. Abb. 74).
Der Typus des »Oberlandlers« ist also in Südbayern bodenständig. Die alpine Umwandlung ist eine Adaptation in naturwissenschaftlichem Sinne und würde auch den gesamten Typus »Münchens« bestimmen, wenn nicht die Zuwanderung, die Sonderverhältnisse der Stadt, der Fremdenverkehr in diesen Prozeß immer wieder störend eingreifen würden.
Jedenfalls aber – und daran soll festgehalten werden – war der Münchner der Frühbayernzeit bis zum Dreißigjährigen Krieg, also die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, ein anderer als der heutige, und die beiden Städte: das München des Mittelalters und das der Neuzeit, stehen sich zum mindesten ebenso verschieden einander gegenüber, wie – etwa eine süddeutsche und eine norddeutsche Stadt.
Die einwandernde bayrische Bevölkerung brachte bereits ein bestimmtes Kulturgut, vor allem Viehzucht und Ackerbau, nicht aber den Städtebau mit, und diese charakteristischen Züge gingen auch auf die aus ihnen und den Eingebornen entstandene Mischrasse über. Das ganze bayrische Oberland ist städtefeindlich und hat außer München keine einzige Siedlung hervorgebracht, die über eine Kleinstadt hervorragt. München selbst zählte nach 500jährigem Bestand als Stadt trotz seiner weltverbindenden Lage noch nicht über 20 000 Einwohner. Dagegen wurde schon von Beginn an das Land mit jenem dichten Netz von Einzelsiedelungen, Höfen und Schwaigen (Viehhöfe) übersponnen, das ihm noch heute das Gepräge gibt, und auf das intensivste einer allerdings primitiven Bodenausnützung unterworfen, die in manchem auf eine dichtere Besiedelung hinweist, als sie das Land seit dem menschenfressenden Dreißigjährigen Krieg besitzt.
Spuren dieser sogenannten » Hochäcker« oder Bifange [Bifang, altbajuwarisch, von bifangen = umlegen.] (Abb. 80) sind in ganz Oberbayern, namentlich in der Münchner Umgegend, allenthalben zu treffen Hochäcker, die von anderen Forschern bis in die Hallstatt- und La Tènezeit zurückverlegt werden, sind zum Teil sicher nicht vor der Römerzeit angelegt worden, denn die Römerstraße Helfendorf–Grünwald ist zum Teil von ihnen überackert. Um Schwabing, Feldmoching, Schleißheim, Lohhof, zwischen der Ingolstädter Straße [Schwabinger Landstraße und Kurfürstenstraße, am Nymphenburger Kanal ungewöhnlich lange, bis 2154 m], Fasanengarten, Allach, Moosach, Mittersendling, Kapuzinerhölzl, Marsfeld, Riem, Au, Ramersdorf, Planegg, Solln, Forstenrieder Park, Großhesselohe [großes Gebiet], also in der ganzen Münchner Bannmeile sind sie massenhaft vorhanden, was auf dichte Siedelung schließen läßt. Ebenso zahlreich sind sie um Augsburg vorhanden, dort [Wichtelenholz, im Mergentauer Burgholz, in Baindlkirch, Tinzelbach] auch mit »Erdställen« verbunden. [Vgl. Bayerland 1912.] Zahlreich sind sie auch im Isartal [besonders um Grünwald], dann bei Holzkirchen [Jasberg, Sauerlach], um den Starnberger See; ausgezeichnet erhalten auf der Garchinger Heide bis Neufahrn. Dort sind sie oft aus Kiesgrund geformt, darüber ist bis 30 cm Dammerde gebettet; sie sind hier offenbar mit dem Karst und der Haue bearbeitet und nicht bepflügt. Im Osten Münchens ist der Ebersberger-Anzinger Forst (Abb. 45) ein einziges großes Hochäckergebiet. Ein ähnliches großes liegt auch im Mangfallgebiet, bei Thalham, dann bei Grub, Kreuzstraße.] und gelten meisthin, nach den grundlegenden Untersuchungen von C. Frank, als der Ausdruck einer Gemeinwirtschaft altgermanischer Art, bei der Beete von 400 m Länge und etwa 20 m Breite mit guter Erde fast meterhoch überhäuft, bebaut und dann wieder brach liegen gelassen wurden, um nach einiger Zeit wieder umgepflügt zu werden, da man Düngen dazumal entweder noch nicht kannte oder nicht schätzte.
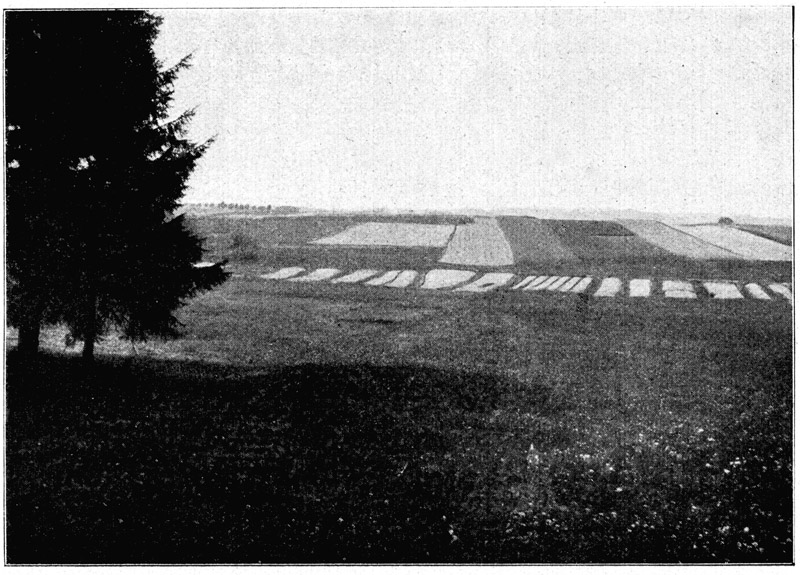
Abb. 80. Hochäckerkultur, wie sie in kleinem Maßstab noch in einzelnen Teilen Frankens und des anschließenden Schwabens, namentlich für Gartenfrüchte, Mohn u. dgl. üblich ist. Original.
Wahrscheinlich kehrte man um das achte Jahrhundert zu der noch heute üblichen Flachbeetackerung zurück, die sicher auch die ursprüngliche der ersten Ackerbauer war, und damit konnte man von den ausgedehnten Hochäckern viel dem natürlichen Waldanflug überlassen, der häufig heute noch darauf grünt.
Neben dieser Ackerbaukultur eignete den »Urbayern« auch eine Fülle wertvoller sonstiger Errungenschaften; sie waren jedenfalls bereits längst über das Kultur-Niveau der Indianer Nordamerikas hinaus, als sie Bayern in Besitz nahmen. Sie waren die Namengeber der Landschaft und haben damit eine treffliche, dem Oberbayern noch heute eignende »Befähigung« bewiesen für Treffsicherheit und Anschaulichkeit. Meisterhaft sind Ortschaften, Orte und Berge in Oberbayern nach ihren ausschlaggebenden Merkmalen benannt, was an sich eine nicht zu unterschätzende logische Meisterleistung ist. Die heute gebräuchlichen Namen stammen großenteils daher und verewigen nun in den Ortschaften großenteils uralte Familien- und Sippennamen. Es steckt z. B. in Schwabing Swapo, der Ahne des Geschlechts der Schwabinger, in Feld- und Ampermoching die Sippe des Mocho, in Schleißheim der Altbayer Sliu, in Garching das Geschlecht der Gowirichs, in Pasing ein Paso, in Aubing ein Ubo usw. Vgl. S. v. Riezler, Die Ortsnamen der Münchner Gegend. [Oberb. Archiv, Bd. 44.] Berge- und Flurbezeichnungen dagegen sind sozusagen eine abgekürzte Beschreibung der Landschaft, wie sie, ebenbürtig dem Genie der großen wissenschaftlichen Nomenklatoren, in dieser Anschaulichkeit und Farbigkeit kaum wieder im deutschen Sprachbezirk vorkommt. Vgl. das S. 163 über die Lohen und Harte Gesagte. Vgl. auch in diesem Sinne Berg am Laim, Grünwald, Gasteig [gacher Steig], Brunntal und Hohenbrunn, Bruck, Grasbrunn, Allach [= Wald am Wasser], Aufkirchen [= Kirche auf der Höhe], Dachau [= Moorau], Forstenried [= Rodung der Forstleute], Farchach [= Bach an der Föhrenheide], Grünsink [= Morastige Gegend], Percha [= Bergbach], Seefeld, Talkirchen, Steinebach. Im Gebirge bedeuten in der Namengebung Wand, Stein, Kogel, Berg, Kopf, Spitz, Horn, Kamp, Joch, Mandl, in Benediktenwand, Brünnstein, Risser Kogel, Wallberg, Hochkopf, Halserspitz, Hörnle, Jägerkamp, Silberkarkopf, Stanser Joch, Rottaler Mandl, ganz genau unterschiedene orographische Besonderheiten, die Ausdrücke Jachenau, Oedkar, Birkkar, Eng, Kotalm, Staffel, in der Not, Hohenwaldeck, Grasmühl, Aufacker, Rohrsee, Schliersee [Schlier = Mergel], Riß, Loch [= Vomper Loch], Neureut gewähren an sich vollständige Anschaulichkeit der hervorragenden Lokalmerkmale. In diesem Sinn ist Namensforschung ein Bestandteil der Geographie von überraschendem Wert.]
Einsam, ungeschlacht und doch wieder dem Kenner des oberbayrischen Landlebens altvertraut, floß das Dasein diesen Menschen des VI. bis X. Jahrhunderts dahin. Lag ihre Hütte im Walde, so war nichts anders gegen das Heute, als daß der Wald, namentlich die Isarauen, noch unwegsamer und ausgedehnter waren, die Isar stärker rauschte, mehr Wasser zu Tale brachte, das Wild sich häufiger zeigte.
Das Wohnhaus jener Zeit war stets eine Blockhütte (die Almhütte hat seinen Typus bewahrt) (Abb. 81). Der First war von einem mächtigen Stamm, der firstsul (= Firstsäule) gehalten. Im Innern fehlte selten die Winchilsul (= Winkelsäule) und ein hallenartiger Gang. Auch die Gréd (= die Altane) war schon da und hatte Säulen (Abb. 82). Um den Hof stand ein Backofen (die heutigen haben noch immer urzeitliche Form), Küche, Badehaus, Skuria (= Scheuer), Scof (= Schupfe), Parch (= Getreidekasten), wenn der Hof groß war. Sonst war es wie jetzt noch auf der Alm. Ein Dach schützte alles; vorn der Mensch, hinten das Vieh. Der Ettiszun (= Zaun aus Weidenflechtwerk) umschloß die gesamte Hofanlage; er ist der Urahn aller Stadtmauern.

Abb. 81. Typus der Blockhütten, in denen vermutlich noch der Nachklang altgermanischer Bauweise erblickt werden darf. Motiv vom Achental in den Kreuther Bergen. Original.
So war die Hütte des Freien, des Barschalken, auch des Herzogs Haus (zu Tagolfing = Daglfing stand das erste) war nicht anders, höchstens aus Stein errichtet. Die Hörigen, d. h. die früheren Landbesitzer, setzten freilich die andere Wohntradition durch, und so, wie sie im Volkstyp die »zugereisten« Langschädel ausmerzten (vgl. S. 242 und Abb. 68), so überwucherte auch ihr Stil allmählich den der Neuankömmlinge. Namentlich in den größeren Orten saßen sie dichtgedrängt, während die Altbayern von je bis heute die Einzelsiedelung vorzogen. Und sofort zerfiel das Leben in den uralten, ebenfalls bis heute bestehenden Gegensatz zwischen Stadt und Land, die sich nichts zu sagen, nichts zu geben hatten. Zwei Stile des Daseins waren damit gegeben: die höher kultivierte Stadt mit anderen Traditionen, auch wenn sie noch nicht die Größe hatte, die von unserem Stadtbegriff unzertrennlich ist, und das flache Land, dessen Lebensstil sich nur an den Grenzen des Städtischen (als vorstädtisch) damit mengte und von da aus eindrang.
Das ist eine wichtige Einsicht, die wir nicht mehr vergessen dürfen. Das Land- bzw. Hofleben hat sich seit tausend und mehr Jahren noch nicht wesentlich geändert.

Abb. 82. Typus des oberbayerischen Bauernhauses als Beispiel des »alpinen Baustiles« im 17. Jahrh. [Der »Bauer in der Au« bei Tegernsee.] Original. (Vgl. hierzu Abb. 81.)
Die Felder waren in Jaucherte geteilt; jedes umfaßte zwei Ausspanne = ein Tagwerk im heutigen Sinn. Jedes Grundstück war mit dem bifank (der heutige Rain) umzogen. Das Besitztum und die Sorge des Bauern waren Korn, Gerste, Haber, Hanf, Flachs, Linsen, Heu, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Federvieh, Bienen und Pferde, die eine große Rolle spielten. Denn man unterschied die auf der Weide gehaltenen Arbeitspferde als Angargnago = Angernager, von den schweren Zugpferden = Vulz (der Schlag der Brauerpferde heute noch), und vom Marack, dem Kriegspferd. Auch der Hund war geschätzt und geliebt (noch immer ein altbayrischer Zug; München ist die Dackelstadt). Darauf deuten schon die vielerlei Unterscheidungen, Houwart = Hofhund, Tribhunt = Treibhund, Leitihunt = Leithund, Suchihunt, Spurihunt = Spürhund, Hapuhunt = Habichtshund, Piparhunt = Biberhund? aus denen die ebenfalls noch immer bestehende Liebe für die Jagd hervorgeht.
Die Tracht war wieder – im römischen Sinn – barbarisch. Man trug enge Leinwandhosen und ein Hemd aus Glanzleinwand mit Schwertgehänge. An den Beinen waren die Schuhe mit leinenen Binden befestigt. Im Winter warf man einen viereckigen Pelzüberwurf um.
Zu den »Landnehmern« gehörten die fünf mächtigen Edelgeschlechter der Huosi, Drozza, Fagana, Hahilinger, Änniona. Der Münchner Boden gehörte zum Huosigau, der vom Staffel- und Kochelsee bis Pfaffenhofen a. Ilm reichte.
Die Religion war der gemeinbekannte Wodanskult, den die Bevölkerung aber überraschend leicht und gutwillig ablegte, vielleicht deshalb, weil – sie ihn behielt. In tausend Vermummungen beherrschen seine Grundvorstellungen, seine Metaphysik und Ethik noch heute Tun, Sitte, Feste und Aberglauben der altbayrischen Landbevölkerung. An Stelle der Eiche verehrt man zu Maria Eich das wundertätige, in die Eiche gewachsene Bild, man brennt noch immer Sonnwendfeuer ab, bringt an den Häusern zum Ornament gewordene »Neidköpfe« an, rechnet auf Weiterleben und Vergeltung nach dem Tode, bringt wächserne und eiserne Opfergaben an die Kultstätten (Maria Eich, Andechs, Maria Elend bei Reutberg u. a.), baute Kapellen und Kirchen an die alten Opferplätze (Heiliger Berg von Andechs!) und dgl. mehr.
So steht ein ganz bestimmter Menschentypus von ausgeprägtem Charakter vor uns, den uns der biedere Johann Turmair, verwelscht als Aventinus, in seiner »Chronika« (Ingolstadt 1554) treffend und lebendig wie folgt charakterisiert:
»Das baierisch volk (gemainlich davon zu reden) ist geistlich, schlecht (= schlicht) und gerecht, gêt, läuft gern kirchferten, hat auch vil kirchfart; legt sich mêhr auf den ackerpau – und das viech dan auf den krieg, denen es nit vast nachläuft; pleibt gern daheim, raist nit fast auß in frembde land; trinkt ser, hat vil Kinder; ist etwas unfreuntlicher und ainmuetiger (= eigensinniger) als die nit vil auß kommen, gern anheims eralten, wenig hantierung treiben, fremde lender und gegent haimsuechen; achten nit der kaufmannschaft, kumen auch die kaufleut nit vast zu inen. – Der gemain man, so auf dem gä und land sitzt, gibt sich auf den ackerpau und das viech, ligt demselbigen allain ob, darf sich nichts ongeschaft der öbrigkeit understên, wird auch in kainen rat genomen oder landschaft ervodert; doch ist er sunst frei, mag auch frei ledig aigen guet haben, dient seinem herren, der sunst kain gewalt über in hat, jerliche guld zins und scharwerk; tuet was er will, sitzt tag und nacht bei dem wein, schreit singt tanzt kart spilt; mag wêr tragen, schweinsspieß und lange messer. Große und überflüssige hochzeit, totenmal und Kirchtag haben ist êrlich und unsträflich, raicht keinem zum nachtail, kumpt kainem zu übel. In nidern Baiern, so sich des rechtpuechs nit braucht, sitzen sie auch an der landschrannen und müessen urtail schepfen, auch über das pluet richten ....«
Dieses Bild ergänzt Doeberl in seiner Entwicklungsgeschichte Bayerns noch durch folgende Züge: »Man findet an ihnen kein feines, zierliches, Liebe erzeugendes Wesen, vielmehr ruhige Sprache, ruhige Außenseite, dabei Neigung zur Rohheit und Gewalttätigkeit wie zum grobsinnlichen Genuß, Verschlossenheit und Argwohn gegen Fremde ... Dafür entdeckt man aber körperliche und geistige Gesundheit, unverwüstliche Kraft und Waffentüchtigkeit, Schlichtheit und Gradheit, feines Naturempfinden und scharfe Beobachtungsgabe ...«
Da haben wir ein wohlgerüttelt Maß von Eigenschaften, die sowohl den Bayern der ersten Jahrhunderte seines neuen Reiches lebendig vor Augen stellen, wie auch noch den Altbayern von heute kennzeichnen.
In dieses Milieu ragte das hallstättisch-keltisch-römische München, von dem alles abgezogen war, was zur militärischen und zur Beamtenkaste gehörte, und alles dageblieben, was an der Scholle hing oder durch Handel und den für einen Treffpunkt von sieben Straßen besonders wichtigen Fremdenverkehr seinen Lebensunterhalt fand. Da der Ort von der Straße lebte, wanderte er auch der durch des Flusses Launen beweglichen Straße nach. Das ist die objektive Gründungsgeschichte Münchens, welche von einer höfischen Geschichtsschreibung in die Legende eines Fürsten umgeformt wurde.
Diese Legende hat die Schulform erhalten, daß bei dem Dorfe Föhring der Bischof von Freising eine Brücke, Zollstätte und Salzniederlage errichtet hatte, um den Verkehr, besonders die Salzfuhren von Reichenhall, an diesen Punkt zu ziehen. Heinrich der Löwe, der Welfe, damals bayrischer Herzog, überfiel aber in einer dunklen Nacht des Frühjahres 1158 mit bewaffneter Hand den Flecken, warf den Ort in Trümmer und die Brücke in den Fluß und verlegte Zollstatt und Brücke eine Stunde höher in seinen Ort, » ad Monachos« (bei den Munichen), wo er auch eine Münzstätte und einen Markt stiftete.
Es ist Zeit, daß diese spartakistische Erzählung der nüchterneren, aber realeren Erkenntnis von der wirtschaftsgeschichtlichen Notwendigkeit einer Straßenverknotung an diesem Punkte weicht, die eine Ortschaft seit der jüngeren Steinzeit nach sich zog, die allmählich den Flußlaunen folgend, sich etwas mehr südlich entwickelte. Wir wissen aus der Zeit vor 1158 von einem Dorf Giesing, von Haidhausen, Föhring, München und Sendling, mit Klosterniederlassungen und Zollstätten, außerdem von Schwaigen und Maierhöfen, die von den Tegernseer Benediktinern errichtet oder erworben und dem Freisinger Bischof unterstellt waren. Daß zwischen diesem und dem raublustigen Welfenherzog Fehden um die Erträgnisse des Salzzolles, der das Haupthandelsgut auf der Salzstraße war, stattfanden, ist historisch; München war aber auch vor ihnen da und wäre ohne sie entstanden als Stadt, als die es erst seit etwa 1294 namhaft wird. Kaiser Ludwig der Bayer galt denn auch stets als der Neuschöpfer der eigentlichen Stadt, Im »Salbuch« der Stadt München von 1444 steht: »Die stat Munichen ist auf die zeit elter dan drew hundert jar alt, als man das zu Freysingen vnd zu Tegernsee jn jren alten püchern vnd briefen geschriben findet vnd bey Kayser Ludwigen von Bayrn am maisten aufkomen vnd die ausser stat bey jm von newen dingen gepawt worden, wann er hat grosse lieb zu der stat gehabt.« die zuerst als lockere, dörfliche Siedelung mit schindelgedeckten Holzhäusern und Pfahlbauten (im Tal) dastand, obschon sie schon seit 1255 Residenz (Ludwig der Strenge war der erste Wittelsbacher, der hier residierte) war, aber immer noch ausschließlich von des Salzhandels Gnaden lebte. Seit 1504 ist es alleinige Residenz des Herzogtums Bayern, nachdem es von Ludwig dem Bayern um mehr als die Hälfte vergrößert wurde.

Abb. 83. Der Kern des Münchner Weichbildes, »das Petersbergl« mit der ehemals zweitürmigen Peterskirche, vom Stadtgraben (auf dem heutigen Viktualienmarkt) aus gesehen im 16. Jahrh., als Beispiel der bodenständigen Münchner Bürgergotik. [Nach dem Sandtnerschen Modell entworfen von Steinlein im Histor. Stadtmuseum. Aus »München und seine Bauten« F. Bruckmann A.-G.] (Vgl. auch Abb. 84.)
In diesen wenigen Sonderdaten erschöpft sich die spezifische Geschichte Münchens, das alle übrigen Ereignisse mit den deutschen Schicksalen teilt, und in wachsendem Maße darin und im europäischen, seit einem Menschenalter im Weltverkehr aufgeht und dadurch in gleicher Progression von ihrer Spezifität verliert.
Als es zum erstenmal als Stadt im modernen Sinn organisiert war, stand es um den Hügel des Petersbergerls, der noch heute durch einige Steintreppen vom Marienplatz und Viktualienmarkt aus markiert ist, sonst aber der Nivellierung der Bauten zum Opfer gefallen ist. Nur das Tal meldet durch Namen und Böschung noch das alte Relief des Bodens.
Dieses »Tal« ist die uralte Salzstraße; ihre Erweiterung: der Marienplatz, auf dem seit 800 Jahren Schicksale ein- und ausgehen und Turniere, Hinrichtungen, Pestprozessionen, Getreidemärkte, Kaiserempfänge und Revolutionen stattfinden, ist der erste Marktplatz der Stadt; St. Peter ist die älteste Kirche, für welche schon 1170 ein Dechant genannt wird. Färbergraben, Hofgraben, Augustiner-, Schäffler-, Schrammergasse und die Terrasse (Niederterrasse vgl. S. 141) gegen die Isar bezeichnen die Stadtmauer Heinrichs des Löwen, die im Straßenzuge heute noch kenntlich ist. Sechs Tore gewähren darein Einlaß, von denen eines, das uralte Burgtor am alten Hof, wenn auch baulich verändert, heute noch steht, das andere als »Talburgtor« mit dem alten Rathaus verschmolzen noch immer die Weltstraße so vieler hundert Generationen überbrückt. Auf dem Petersberg stand auch die erste Burg. Sein Oval ist zweifelsohne die älteste Stadt (»die innere Stadt Petri«), welche noch vor der Ummauerung bestanden hat Vgl. München und seine Bauten, herausgeg. vom Bayer. Architekten- und Ingenieurverein. München. 8°. 1912, S. 30. (Abb. 83).
Um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts beginnt München, das, wie um 1271 gemeldet wird, ein »immenses« Wachstum aufwies, ein Riesenwerk, wie es ein solches zum zweitenmal in seiner Geschichte nicht wiederholt hat. Es vergrößert sich durch einen neuen Mauerring um das sechsfache, bezieht dadurch Dörfer (Altheim), Klosterschwaigen, Kirchen, Herrenhäuser in seine Mauern ein und bildet damit eine ganz neue und jene ansehnliche Stadt, welche bis zu den Napoleonstagen als München galt und der eigentliche Stadtorganismus ist, den man meint, wenn man in den Zeiten bis etwa 1850 von München spricht (vgl. Abb. 87).
Im Nationalmuseum steht das Original der Abbildung von S. 283, Abb. 84 die das Modell Münchens darstellt, wie es 1572 ein kunstfertiger Schreiner (Jak. Sandtner) mit bewunderungswürdigem Geschick und rührender Treue in solchen Einzelheiten angefertigt hat, daß man danach Bilder (von G. Steinlein) des alten Münchens malen konnte, die jetzt das historische Stadtmuseum zieren und von denen einige auf S. 281, 285 und 287 wiedergegeben sind.
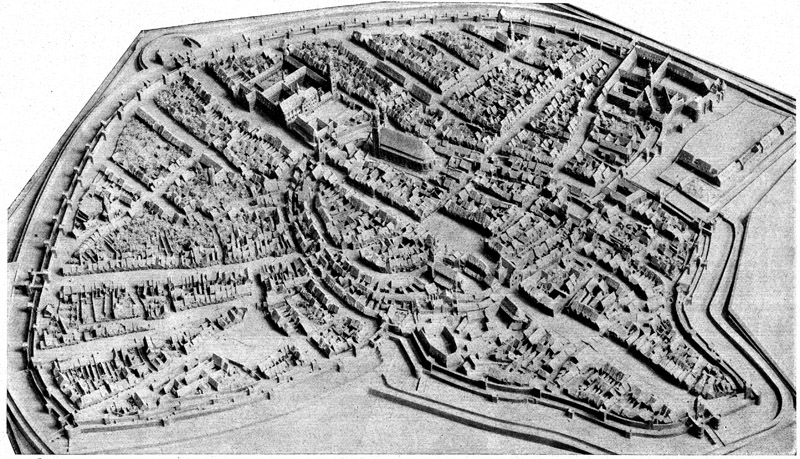
Abb. 84. Modell der Stadt München von Jak. Sandtner aus dem Jahre 1572. [Original im Nationalmuseum zu München. Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Die Stadt ist etwa von der Gegend des heutigen Viktualienmarktes aus gesehen (vgl. Abb. 83).
Deutlich erkennbar ist der Hauptstraßenzug der Salzstraße vom Isartor in gerader Linie über den Hauptplatz zum Neuhausertor, der von der alten alpinen Verkehrsader (vgl. Abb. 79) Sendlinger–Weinstraße gekreuzt wird. Beachtenswert ist auch der erste Stadtkern um die Peterskirche, dem die leoninische Stadterweiterung, welche die Frauenkirche miteinbezieht, folgt. Die Erweiterung bis zur vorliegenden Stadtumwallung erfolgte um 1300 herum.
Dieses Modell ist gleichsam eine lebende Chronik und Fundgrube von unerschöpflicher Reichhaltigkeit, wie sie keine andere Großstadt besitzt. Durch sie hat das Urteil über die organischen Gesetze der Münchner Stadtbauten eine festgefügte Unterlage, und gestattet folgende Schlüsse:
Das alte Gesetz, das in der ersten Anlage durchbrach und die Stadt formte, beherrscht sie das ganze Mittelalter hindurch und diktiert ihr heute noch Leben und Treiben. Die Existenzberechtigung des Organismus München beruht auf der Straßenkreuzung Wien–Paris und Gebirge (später Italien)–Berlin. Das zwingt wie mit eisernem Griff der Stadt ihren Bauplan auf. Sie hat vier Hauptstraßen oder, wenn man will, zwei, deren Kreuzungspunkt der Markt ist. Sie heißen Tal und Kaufringerstraße, Sendlingerstraße, Weinstraße. Und in dem Maße, als sich die Stadt erweitert, setzen sich diese Straßenrichtungen fort, greifen über die Isar bis zur Wiener Straße, heißen Neuhauser-, Bayer- und Landsbergerstraße, und in der anderen Richtung Theatiner-, Ludwig-, Leopold-, Schwabinger Landstraße und Ungererstraße bzw. Lindwurmstraße, Plinganser-, Wolfratshauserstraße. Und zu diesen Straßen gesellen sich als Verlängerungslinien überall die Schienenstränge nach Wien, Freising–Regensburg–Berlin, Stockholm, Starnberg (dem unwegsameren Isartal wurde vom milden Würmtal der Rang abgelaufen)–Partenkirchen–Innsbruck–Italien, Augsburg–Stuttgart–Straßburg–Paris–(London), kurz alles, was an dem Begriff Europa hängt Rußland ist naturgesetzlich, klimatisch, biologisch, geologisch, rassisch, kulturell, politisch Asien; es war und ist nicht Europa und wird es niemals sein. Für Europa bedeutete es immer eine Störung und eine Abbiegung seines Sonderlebens, allerdings auch seine Befruchtung im Sinne des Erdganzen. (vgl. Abb. 40).
In dem Begriff München, wie er von dem soeben umrissenen Zentrum ausstrahlt, verkehrt dieses Europa und findet sich seit der Steinzeit an der Isar zusammen – heute als Fremdenverkehr, der vor dem Weltkrieg die halbe Million im Jahre überstieg und sie demnächst wieder erreichen wird, und aus ihm ausgesiebt als Fremdenkolonie, die in einem Kranz von Villenkolonien und Annexen (Schwabing, Bogenhausen, Gern, Solln, Ludwigshöhe, Harlaching, Pasing, Planegg, Dachau) das eigentliche alte München umgibt und neben ihm her lebt wie eine Stadt neben der Stadt, und das alte Scherzwort bewahrheitet, München bestehe aus zwei Städten, aus München und Schwabing.
Der »Zugroaste«, um die Sache mit einem Kraftwort Alt-Münchner Antipathien auszudrücken, also der Fremde, ist der erste Typus der Münchner Bevölkerung, den man bei 600 000 Einwohnern leicht auf 100 000, also ein Sechstel des gesamten Bevölkerungsbestandes, schätzen kann. Die großen Verschiebungen, die in den Jahren 1914-1919 darin stattgefunden haben, rauben der vorhandenen älteren Zahl den Wert und gestatten nur Schätzungen.
Neben ihm existiert eine ausgesprochene Altstadtbevölkerung, der Städtertyp des Altmünchners, der sich wesentlich von der oberbayrischen Landbevölkerung des Moränengebietes unterscheidet Die Bevölkerung der Hochebene ist eine etwas andere, als jene der Moränenlandschaft. Auf der Hochebene ist man am frühesten zum seßhaften Ackerbau gekommen, während die Moränenlandschaft länger und das Hochgebirge am längsten die Lebensformen des Hirten- und Jägervolkes notwendig machte. Vgl. M. Haushofer, Oberbayern. Bielefeld. 1900. (Monographien zur Erdkunde.) (vgl. Abb. 88).
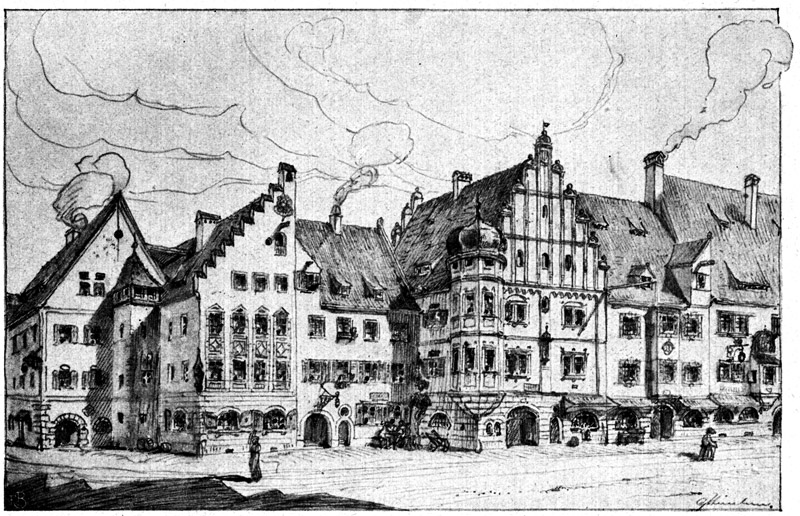
Abb. 85. Partie aus der Neuhauserstraße um 1570 als Beispiel bodenständiger Patrizierhäuser mit den charakteristischen Halbgiebeln und der verloren gegangenen organischen Schönheit Altmünchens. [Aquarell von Steinlein nach dem Sandtnerschen Modell im Histor. Stadtmuseum. Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Ihm, aus dem sich die Patrizier des alten München, die Gollier, Ligsalz, Drächsel, Bart, Ridler, Leupold, Schrenk, Tichtl u. a. rekrutierten, von denen der Lokalchronist der alten Stadt, Franz Trautmann, in seinem Münchner Stadtbüchlein F. Trautmann, Münchner Stadtbüchlein. Drin froh und ernste Kunde aus längst vergangenen Jahren verlautet. München. 8°. 1857. so behaglich zu erzählen weiß, stellte sich von je eine Vorstadtbevölkerung gegenüber, die eigentlich nichts anderes ist, als das proletarisierte Landvolk, das den Bannkreis der Stadt aufgesucht hat. Was man an vergangenen Generationen stets scharf als Auer, Haidhauser, Giesinger vom Münchner schied, und was sich in den Aufstandsbewegungen der Jahre 1848 sowie 1918-1919 zu einem ziemlich einheitlich geschlossenen Typus des Münchner »Proletariats« aus Ost und West (Westend, Neuhausen, Sendling) zusammenschloß, bildet den dritten, räumlich und in seiner Eigenart scharf vom Altmünchner und vom »Fremden« geschiedenen Bevölkerungsbestandteil des Münchner Stadtgebiets (vgl. Abb. 89).
Zu ihnen gesellen sich vom Süden, durch das Isartal vordringend, die Elemente der Moränenbevölkerung vulgo Oberlandler (vgl. Abb. 92) schon im alten München Definition dieses Begriffes im Sinne der weiteren Ausführungen s. S. 282., scharf ausgeprägt in den Tölzer und Lenggrieser Flößern und Fuhr- sowie Botenleuten, die stets dem Südteile der Stadt ihre besondere Farbenfreudigkeit gaben. Aus ihnen, den rasseechten Vertretern des Homo alpinus, sonderte sich durch Adaptation der Moränenmensch und der Münchner Bürger ursprünglich aus, soweit in diesen nicht auch die sattsam erörterten Überbleibsel der Vorgeschichte ihrer Stadt nachleben.
Und als fünfter Typus kommt auf den Landstraßen von Nordwest, auf der Schleißheimer und Dachauer Straße, auf der Schwabinger Landstraße noch immer manch ein Moorbäuerlein in die Stadt, urwüchsig, fremd und voll Eigenart, gleich den Moorblumen und Schmetterlingen draußen im Dachauer und Schleißheimer Moos (vgl. Abb. 90). Das ist der Dachauer, der Vertreter eines, wie jedem Münchner wohlbekannt, ganz scharf geschiedenen, besonderen Menschenschlages, der seine eigene Tracht, seine Berufe, seinen Dialekt, sogar seinen eigenen Humor (Dachauer Bauernkapellen) hat.
Fünf Typen von Menschen: die Altmünchner, die Vorstädter, Oberlandler, Dachauer und die Fremden (der Volkswitz bezeichnet sie treffsicher als »Schwabinger«, was man gerne annehmen kann) beleben das Münchner Stadtgebiet und siedeln in ihm nach eigenen Gesetzen.
Sofort springt die Tatsache in die Augen, daß auch die anderen Organismen auf dem gleichen Territorium, nach demselben Gesetz verteilt, auftraten.
Man schlage S. 170 und 172 auf: war dort nicht mit aller nur wünschenswerten Bestimmtheit nachgewiesen, daß die Moorgewässer eine andere Lebewelt beherbergen, als die westlichen und östlichen, in Lehm gebetteten Vororte der Stadt, und diese wieder eine andere als die Schotterterrasse des eigentlichen Altstadtgebiets? Daß von der Isar und den Alpen her alpine Formen eindringen? Hat nicht die Untersuchung der Flora das gleiche Gesetz bestätigt? Haben nicht unsere Untersuchungen des Edaphons vier Lebensbezirke unterscheiden lassen? Lehmformen, Moorformen, Schotterformen und subalpine Formen? Hat nicht die Schmetterlings-, die Vogel- oder die Molluskenfauna dasselbe Bild vor Augen gestellt? Und ist nicht aus Flora und Fauna uns immer wieder die Einwanderung mit ihren Adventivformen, das »Schwabing« der Natur, das in München angesiedelt wird oder hier durchzieht, ins Gedächtnis geprägt worden? Hat nicht die lokale Ausbildung des geologischen Werdeganges ganz unzweideutig ergeben, daß das Schotterdreieck ein natürlich-geologischer Begriff sei, den von Süden her die Alpen beeinflussen, während es gegen West und Ost nach seinem Gesetz die Lehmdecken auswirkt, nach Norden zu die Quellmoore und damit auf die Jahrtausende hinaus die Sonderung aller »Bevölkerungen« vorschreibt?
Es ist stets, zu allen Zeiten und in allem dasselbe Gesetz, das hier sichtbar wird, genau so wie in den Wanderungen, so auch in der Niederlassung.
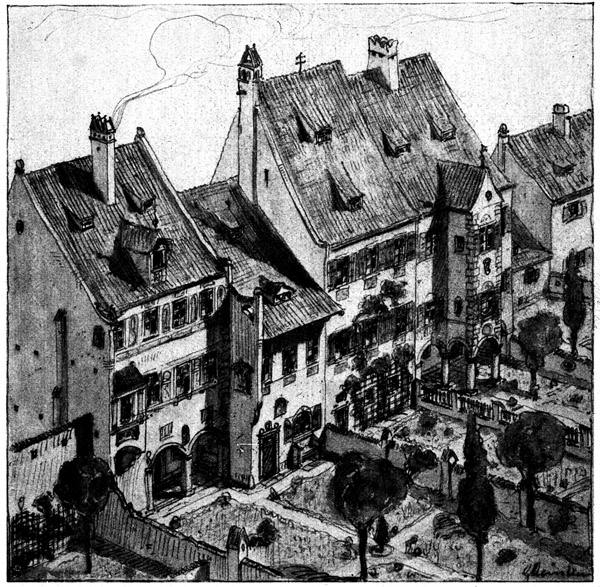
Abb. 86. Münchner Gartenhöfe im Mittelalter. Im Baustil prägen sich neben bodenständigen Elementen hier bereits italienische und Augsburger Einflüsse (die Lauben) aus. Ähnliche Bilder zeigt heute noch Wasserburg am Inn.
[Aquarell von Steinlein nach dem Sandtnerschen Modell im Histor. Stadtmuseum. Aus »München und seine Bauten« F. Bruckmann A.-G.]
Es gibt, so wie es einen natürlichen Begriff »München«, nämlich den des Dreieckes voll fluvioglazialer Schotter, in den Armen des ausgehenden Isartales, bis zum Rande des Moores sich erstreckend, gibt, auch einen » Schottermenschen«, nämlich den alteingesessenen Münchner Bürger. Und wie wunderbar, oder eigentlich wie selbstverständlich: er siedelte stets genau auf seinem natürlichen Lebensgebiet! Im Mittelpunkt des Schotterdreiecks, zwischen Schwabing und Sendling, am Petersbergl, erbaute er seine ersten Siedelungen, und nie haben sie sich über das Schotterdreieck hinausgewagt. Die Grenzgebiete und den »fremden« Boden überließ er stets den ihm fremden Bevölkerungstypen (vgl. Abb. 91).
Den fruchtbaren Lehmboden in Ost und West nahm die Landbevölkerung der Vorstädter ein und blieb auf ihm ein anderer, als der Münchner. Es gibt nicht nur ein Münchner Lehmedaphon, eine Lehmflora, sondern auch einen Lehmmenschen von München (Abb. 89). Der »Stoatrager Kare« von Giesing ist eine seiner modernen Ausprägungen.
Ebenso siedelt im Süden, gegen Isartal und das Gebirge zu, die alpine Art. Von dort dringt das Wesen des Oberlandlers in das Gehaben des Städters ein, von ihm stets gern aufgenommen und assimiliert; wie eine Fruchtbarkeit verbreitende, erfrischende Quelle, oder mit noch zutreffenderer Bildhaftigkeit, wie der leise abendliche Lufthauch von den Alpen, der nächtlich Münchens Atmosphäre durchdringt, reinigt und sie so erquickend, würzig, für den Fremden bereits so merkbar »alpin« gestaltet, so mengt sich dieses Oberlandlerwesen auch in den Bevölkerungstypus der Stadt, in seine Sitten und sein Schaffen.
Stets im Gegensatz zur Stadt und von ihr auch mit gutmütigem Spott als anderer aufgenommen, empfand sich immer der Moormensch, der Dachauer, dessen Siedelungsgebiet genau mit der Moorgrenze zusammenfällt.
Nur wo er, der geborene Bauer, an den Grenzen der naturzerstörenden Stadt nicht mehr hausen mag, dort überließ der Altmünchner den Boden den Fremdlingen in seiner Heimat. Dort erhebt sich Schwabing, das München der Fremden (vgl. Abb. 40), auf einem Boden, in einem Lokalklima, dem man es deutlich anmerkt, daß sie übriggelassen wurden von denen, die sich die besseren Plätze ausgesucht haben.
Und hier ist die Stelle erreicht, wo wir auch in der Kulturgeschichte dieser Stadt den Anschluß an die merkwürdige Tatsache erreicht haben, in die das geologische Studium des Münchner Stadtgebietes ausklang (vgl. S. 140).
Dort wurde als vorläufig unerklärbar festgestellt, daß die Stadtgrenze bis auf Einzelheiten genau mit den geologischen Grenzen der Bodenarten zusammenfällt (vgl. Karte auf S. 139). Jetzt wird uns der Schlüssel zum Verständnis dieser Tatsache in die Hand gedrückt. Die

Abb. 87. Lageplan des alten Münchens im 17. Jahrhundert. Gut erkennbar sind die alluvialen Schotterinseln des Flußtales, denen die Stadt ebenso wie dem Hochrand der Hochterrasse im Westen ausweicht. Sie besiedelte, so lange sie organisch war, peinlich genau nur die Niederterrasse, deren Verlauf der Stadtmauerzug im Osten folgt. Die Isarfurt ist bereits südwärts gewandert (vgl. S. 280). [Aus »München und seine Bauten« F. Bruckmann A.-G.]
Münchner haben ihren Schotterboden eben soweit erworben, als sie ihn selbst besiedeln. Die politische Grenze ist nur der Ausdruck der wirtschaftlichen Interessen. Auch in der Politik prägt sich, allen unbewußt, doch darum nicht weniger gültig, das allgemeine, durch das ganze Sein gehende Gesetz. Sie hängt an demselben Faden, den wir in hundert Verwandlungen, bald in der Astrophysik, bald in der Geologie, Bodenkunde, Biologie, Rassenlehre, Ethnologie, Kulturgeschichte durch dieses ganze Werk spinnen.

Abb. 88. Porträt des Münchner Malers Karl Spitzweg als Typus eines bodenständigen Altmünchners.
(Nach der Spitzwegmonographie von Uhde-Bernays)
Jetzt versteht man alle die Eigentümlichkeiten und Besonderheiten des Grenzverlaufes im Münchner Stadtgebiet (Abb. 40), namentlich, wenn man die sehr komplizierte Geschichte der Eingemeindungen der Vororte in Betracht zieht. Daß Solln wie ein Fremdkörper in der Grenze bei Ludwigshöhe steckt, hat seinen guten Grund darin, daß Solln geologisch (Lehminsel) und in seiner Bevölkerung (Bauern, Fremde und Ziegeleien) wirklich ein Fremdkörper in der Schotterebene ist, weshalb seine Bevölkerung auch andere Interessen hat, denn die Münchner, und daher der Eingemeindung opponiert hat. Das gleiche gilt für Johanneskirchen. Es ist eine Moorbauerngegend mit Moorboden, eingekeilt an der Münchner Stadtgrenze, die, anderswohin gravitierend, ebenso erfolgreich der Einverleibung Widerstand geleistet hat.
Solange München durchaus organisch war, beschränkte es sich nur auf seinen Schotterboden (vgl. Abb. 87). Es ist hierfür höchst vielsagend, daß selbst so innig verbundene und naheliegende Vorstädte, wie die »Lehmorte« Giesing, Haidhausen, Berg am Laim, auch »alpine« Vororte, wie Talkirchen, erst in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, Berg am Laim sogar noch später, eingemeindet wurden. Auch Schwabing wurde noch lange ferngehalten, ebenso die westliche Lehmgegend (Laim), Pasing hält sich noch fern, und sowohl im Norden wie im Westen fällt die politische Grenze mit der natürlichen oft so genau zusammen, daß beide an manchen Stellen um kein Meterdutzend voneinander abweichen.
Die Gemeindepolitik erhält durch diese Tatsachen eine völlig neue Beleuchtung und Orientierung; sie hat gewissermaßen ihr Gesetz und Programm erhalten, genau so, wie die Politik der Terraingesellschaften, denen durch geschicktes Studium der hier vorgetragenen Tatsachen großer materieller Nutzen erwachsen kann.
Das Gesagte bleibt freilich so lange bloße Behauptung, bis nicht der Beweis erbracht ist, daß sich die postulierten fünf Bevölkerungstypen voneinander tatsächlich ebenso spezifisch unterscheiden, wie die Bodenarten oder die ihnen konformen Tier- und Pflanzenvereine. Die bloße Berufung auf das Gemeinbekannte dieser Unterschiede hat nicht genügend Überzeugungskraft.
Worin unterscheiden sich nun Bevölkerungstypen im wesentlichen? Zuerst als anthropologische Typen, wenn auch in dieser Hinsicht natürlich durch die vielen Vermischungen in einer Stadt keine tiefgehenden Unterschiede vorausgesetzt werden können. Um so durchschlagender können aber, namentlich in der älteren, die Vererbung und die Absonderung besser wahrenden Zeit, die Unterschiede in den Berufen, den Trachten, Sitten und dem Dialekt sein. Ein berühmtes und allgemein bekanntes Beispiel hierfür bietet Wien, das in jedem seiner historischen »Gründe« (Wieden, Hernals, Margarethen, Brillantengrund usf.) einen anderen Dialekt und andere Bevölkerungstypen produziert.
Wenn man nach diesen Gesichtspunkten namentlich das München der älteren und der vorigen Generation durchforscht, strömen nun von allen Seiten die Belege für die vorausgesetzte Fünfteilung des Bevölkerungstypus zu. Es kann zwar unmöglich meine Absicht sein, diesen Versuch, die Lebensgesetze einer Stadt einheitlich zu erfassen, zu einer lokalen Kulturgeschichte auszubauen; ich muß das kompetenteren Kennern des Münchner Lebens und Sonderarbeiten auf diesem Gebiet überlassen, kann daher hier, wie in allem noch folgenden nur eine Skizze statt einem ausgeführten Gemälde bieten. Aber auch diese hat bereits völlige Überzeugungskraft, wie ein Blick auf ihr Material beweisen mag.
Ethnologisch ist es geradezu eine Binsenwahrheit, daß der »Schwabinger« aus Norddeutschland stammt. In dem Fremdenzuzug spielt das deutsche Flachland eine stets noch wachsende Rolle, wobei München namentlich für das nordöstliche Deutschland (neuerdings auch für Rußland) mehr Anziehungskraft beweist, als für die Rheinländer. Nicht minder groß ist die Zahl der von Nordost und Ost einströmenden Österreicher, zu denen sich (vor dem Kriege) in wachsender Zahl auch Leute des Südostens (Ungarn, Serben, Bulgaren) gesellten. Besonders stark ist das einströmende alpine Element, das aber mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit den Norden der Stadt vermeidet und sich fast durchgängig in den Südvierteln ansiedelt. Relativ gering ist dagegen gehalten die übrige Zuwanderung; am ehesten erfolgt sie noch aus dem Westen (Schwaben), ganz geringfügig ist die Zahl der Italiener, welche die Alpen überstiegen haben und sich in dem rauhen, grauen Klima der Isarstadt wohl fühlen.
Die Verteilung der fremden Siedelungen läuft demnach in ihren Hauptlinien durchaus kongruent mit der Siedelungsgeschichte der Pflanzenwelt und der übrigen Organismen.
Von den bodenständigen Bevölkerungselementen ist namentlich der Moortypus nennenswert in Körperbau und Physiognomie von den andern unterschieden; er, der unverfälschte » tête carré« der französischen Anthropologen, ist sofort kenntlich am untersetzten, hageren, starken Wuchs, der Vierschrötigkeit, Breitnackigkeit und Ungeschlachtheit (vgl. Abb. 91). An sich ist er ein mehr ins Schwäbische, als ins Oberbayrische schlagender Typus. Ihm gegenüber ist der Oberlandler ein gelenkiger, heiterer, beweglicher, noch geradezu zierlich zu nennender Menschenschlag (vgl. Abb. 92), der echte brachykephale Homo alpinus mit oft schönen Gesichtszügen (der Dachauer ist auffallend häßlich), der besonders in der Umformung zum Münchner dann sich in jener Fülle frischer, anmutiger, feinprofilierter und rassiger Mädchen- und »molleter« Frauengestalten (die Münchnerin ist ein nicht rasch alternder Typus, der seine Reize erst in der Reife entfaltet) ausgestaltet, die der Ruhm Münchens sind. Man hat ebensogut ein Recht, von der hübschen Münchnerin zu sprechen, wie es einen bestimmten Typus »hübsche Wienerin« oder Pariserin gibt. Da in den Türkenkriegen viele Orientalen zwangsweise angesiedelt wurden [Türkengraben, Türkenstraße], wird ein besonders rassiger, namentlich in der Au, in den alten Türkenherbergen häufiger, dunkler Schönheitstyp auf dieses arabische Blut zurückgeführt. Abstoßend häßlich dagegen ist der »Lehmmensch« Münchens (vgl. Abb. 89).
Ein besonders oft wiederkehrender ausgemergelter Typus, dessen sich daher auch die Karikatur bemächtigte, fällt durch sein unregelmäßiges Gesicht auf, dessen Hauptcharaktere der breite, unschöne Mund und die aufgestülpte Nase sind. Anthropologisch mag er besonders durch seine Schmalstirnigkeit, überhaupt durch schlechte Stirnentwicklung Bedenken erregen.
Eine, natürlich in der nivellierenden Neuzeit sich nicht mehr so scharf sondernde, Verteilung der Berufe läßt ebenfalls die vier einheimischen Bevölkerungsarten unterscheiden.
Die Altstadt war von jeher die Stadt der Gewerbe, von denen gewisse, wie die Küchlbäcker (um den Radlsteg), die Metsieder und die Schäffler, Schenkkellner, oder die Bierbrauer ganz bodenständig sind. Bemerkenswert ist die Neigung, die Keller der Brauereien in die wärmeren Lehmgebiete Nockherberg, Giesinger Kellerwirtschaften, Arzberger Keller, Keller an der Theresienhöhe hinaus zu verlegen, was nicht restlos mit dem Wachstum der Stadt erklärbar ist. Vgl. G. Wolf, Ein Jahrhundert München. 8°. 1920. Die gemeinbürgerlichen Gewerbe haben sich wie in jeder alten Stadt ihre eigenen Gassen geschaffen, noch heute an Namen, auch an den Häusern wohl kenntlich (Färbergraben, Sporerstraße, Ledererstraße). Die uralte Salzstraße zog ein besonderes Gewerbe, das des » Salzstößlers«, nach sich, welcher Namen, kennzeichnend genug, bis in unsere Zeit überhaupt die Bezeichnung des kleinen Lebensmittelhändlers (des Wiener Greislers) blieb. Zur Salzstraße gehört auch, daß im alten München das »Tal« durch zahllose Bäcker einen besonders nahrhaften Anstrich bekam. Noch heute sind die großen Einkehrwirtschaften immer noch mehr dort und in der Fortsetzung des Tales jenseits des Marienplatzes (Soller, Schlicker, Metzgerbräu, Augustiner, Pschorr, Franziskaner), als unmittelbar am Bahnhof, dessen Anlage (er steht auf einem Teil der alten Salzstädel) schließlich auch dem Gesetz der Salzstraße gehorchen mußte.
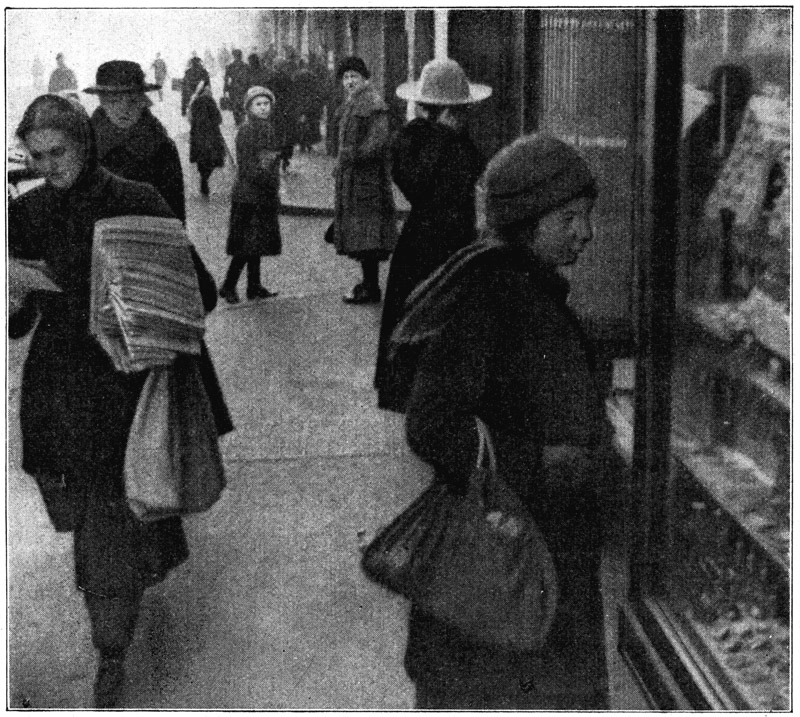
Abb. 89. Mädchen aus den östlichen Vorstädten Münchens (rechts). Typus der Lehmbevölkerung. Das Gedrungene und Bäuerliche ist in scharfem Gegensatz zu der Erscheinung der Zeitungsausträgerin (links) aus dem Zentrum der Stadt (Schotterbevölkerung). Die Wollhauben der beiden, sowie der zwei Mädchen im Mittelgrund gehören zur typischen Wintertracht der kleinbürgerlichen Bevölkerung Münchens. Original.
Aus dem alten Gewerbeleben entwickelten sich dann auch die für die Altstadt spezifischen Gebräuche des Schäfflertanzesund des Metzgersprunges (angeblich eine Pestdämonen vertreibende Kulthandlung), welche den Rathausplatz auch mit Kunstwerken, allerdings nicht hohen Ranges, bereicherten.
Diesem Gewerbeleben gegenüber steht das Lehmgebiet ganz anders da. Es ist die Stadt der Ziegeleien und Gärtnereien (Au, Giesing). Der Ziegelarbeiter, die durch den Münchner Karneval zur Witzblattfigur gewordene Figur des »Steinträgers« (»Baron Mucki von Giesing«) sind die Charaktertypen dieses Bevölkerungsteiles.
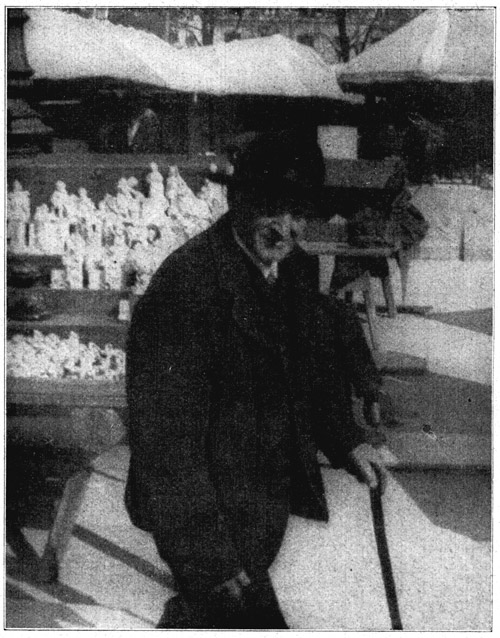
Abb. 90. Dachauer Bauer in halbstädtischem Sonntagsgewand vor den Ständen der Auer Dult. Original.
Das Südviertel der Oberlandler war von je und ist noch immer das Viertel gewisser Berufe, die mit dem Gebirge zusammenhängen. Einst kamen die Flöße von Tölz und Lenggries bis in die Stadt und verpflanzten an ihren »Ländplatz«, beim »Ketterl« und »Grünen Baum« ein Stück urwüchsigen Älplerlebens. Jetzt ist die Flößerlände nach Thalkirchen, eine sogar in ihren Äußerlichkeiten subalpine Vorstadt (der Kirchturm von Thalkirchen gleicht dem von Mittenwald), verlegt, aber von da aus strahlen die damit zusammenhängenden Gewerbe durch das Thalkirchnerstraßenviertel in die Stadt selbst aus. Holzhändler, Dampfsägen, Zimmerleute siedeln sich noch immer mit Vorliebe dort und im Sendlinger Unterfeld an. Das alte Südviertel der Stadt war auch die herkömmliche Wohnung der Fuhrleute und der »Boten« in die Städte und Märkte des Moränengebietes (Brucker-, Murnauer-Bote). Vielleicht hing es auch mit dem leichtlebigen, das Geld locker in der Tasche tragenden Oberlandlertypus zusammen, daß sich die Frauenhäuser des alten Münchens just in der Nähe der Flößerlände, in der Gegend der Magazin- und Erhardstraße befanden.
Die Dachauer waren im alten München niemals heimisch. Und auch jetzt sind sie nur Gäste des Straßenbildes. Sie stellten von je die Zunft der Torfhändler, der Weißsandverkäufer (zum Scheuern der Tische); auch viele der Fuhrleute stammen von den Moorbauern her.

Abb. 91. Dachauer Bäuerin in Sonntagstracht auf dem Kirchgang. Man beachte die Spitzenhaube, den Spenser mit dem Brustfleck, den »Bollnkittel« mit dem Schurz, die gestickten Strümpfe und die ausgeschnittenen »Haferlschuhe«.
Die »Fremden« teilen sich, seitdem es ein ausgesprochenes »Schwabing« gibt, herkömmlicher Weise in die freien Intelligenzberufe. Der Künstler, der Dichter, der Bohémien jeder Gattung und – der Privatier größeren Stiles (der »Drei-Quartl-Privatier«-Typ gehört in den Altmünchner Lebensbezirk), das sind die dem eigentlichen München völlig fremden, aber von ihm mit unglaublicher Gutmütigkeit und Passivität ertragenen Nur in ganz wenigen Fällen protestierte die Münchner Volksseele in fremdenfeindlichem Geiste gegen ihre Gäste. Das war 1848 gegen die Maitresse Ludwig I., Lola Montez, 1867 gegen Richard Wagner, als dem Günstling Ludwig II., und im Frühjahr 1919 gegen die kurze Regierung einer Schwabinger Bohèmeklique. Schwabinger Lebensbetätigungen.
Der Sonderung in diese Berufe und Lebenskreise entsprachen im alten München auch besondere Trachten der vier Menschentypen. München ist sogar die einzige Großstadt im deutschen Kulturgebiet, in der es immer noch in besonderen Trachtenvereinen gepflegte Volkstrachten gibt (vgl. Abb. 92). Es ist ein alltäglicher Anblick, im subalpinen Lebensbereich (vom Marienplatz–Sendlingerstraße, durch das Südviertel bis Thalkirchen) Oberlandler in ihrer Tracht, auch in München ansässige, wenigstens in einzelnen Kleidungsstücken dieser Art zu sehen. In der Dachauerstraße und Neuhauserstraße kann man fast immer Dachauer Bauern in Volkstracht begegnen (Abb. 90), im Tal und natürlich jenseits der Isar den proletarischen Stutzertypus der Lehmbewohner, und alle zusammen auf den Dulten (Jakobidult und Herbstdult in der Au, vgl. Bild auf S. 294), wo sich noch immer jene vielgerühmten, köstlichen Bilder eines echten Volkslebens entfalten, welche die alten Schilderer Münchens mit Stift und Feder so sehr zu rühmen wußten. Das »Oktoberfest« auf der Theresienwiese Ende September kommt hierfür weniger in Betracht, da hier die Landbevölkerung zusammenströmt und so für wenige Tage noch einmal den sonst ziemlich verloren gegangenen Konnex zwischen München und seinem Hinterland herstellt. (G. J. Wolf, 100 Jahre München.)
Nur die Alt-Münchner Bürgertracht ist verloren gegangen; ein Umstand, der für die hier angestrebte Beweisführung ebenfalls von Wert ist, bezeugt er doch die zu beweisende Sonderung in verschiedene wohlumschriebene Bevölkerungsgruppen. Achtet man auf diesen Punkt, so wird man übrigens unschwer entdecken, daß der »Alpinisierungsprozeß«, der sowohl in der Römer-, wie in der Bajuwarenzeit dem Homo alpinus immer wieder das Übergewicht verschaffte, so oft er unterdrückt wurde, wieder in vollem Gange ist. Der Münchner Kleinbürger, der den Bratenrock und Zylinder der Vorväter ablegte, liebt es zusehends, sich etwas von der bequemen und malerischen »Kurzen Wichs« der Oberlandler zuzulegen, und sei es nur der Lodenmantel oder das grüne Hütchen mit dem Gamsbart und Adlerflaum, eine Oberländlerpfeife, oder die Uhrkette mit den »Hirschgrandln«.
Das Städtische historische Museum zeigt uns die alte Tracht in Kostümpuppen, und eine Fülle illuminierter Stiche und Gemälde beweist, daß sie noch um 1830 reichlich zu sehen war und erst in der Zeit des ersten deutsch-französischen Krieges (1870/71) endgültig der modernen »Uniformierung« wich (vgl. die Bilder auf S. 298 und 299).
Besonders gut tritt auf diesen Dokumenten im Bilde auf S. 298 der Unterschied zwischen der städtischen (Bürger-)Tracht und der der Landbevölkerung hervor, welche auch die Vorstädte bewohnte und sich von da aus in das Stadtleben eindrängte (vgl. S. 300).

Abb. 92. Bauernmädchen von Wackersberg im Isartal auf der Heimkehr von der Fronleichnamsprozession in »Oberlandlertracht«. Zu dieser gehört der grüne, mit Goldschnüren umnähte Hut, das weiße oder buntseidene Halstuch, der langärmelige Spenser, der seidene »Fürda« (Schurz) und die wollenen, häufig roten Unterröcke. Die Abzäunung der Wege ist für die Viehzucht des oberen Isartales kennzeichnend. Original des Verfassers.
Für die Alt-Münchener Männertracht war der lange Bratenrock unerläßlich, ebenso die hohe, schwarze Atlaskrawatte. Man trug Kniehosen mit weißen Strümpfen und Schnallenschuhen oder (namentlich seit der Napoleonszeit allgemein) lange Hosen mit Steg. Der dreieckige Hut (Dreimaster) des XVIII. Jahrhunderts wich dann dem breitkrämpigen und farbigen Zylinder. Unerläßlich war auch die farbige Weste mit silbernen, zinnernen oder Glasknöpfen. Übrigens war die Männertracht modisch und bei weitem nicht so spezifisch, wie die der Münchner Bürgerinnen. Vgl. W. Diez, Münchner Trachtenbuch, ges. u. herausg. von Fr. Wolf.
Diese zeigt allerdings Verwandtschaft mit der Salzburger und oberösterreichischen (die Riegelhaube) Sondertrachten bildeten sich z. B. bei der mächtigen Bierbrauerzunft bei den Gesellen [Schäffler] aus., entwickelt aber ihre Sonderzüge dermaßen, daß man von einer » Münchner Tracht« dennoch mit Recht reden kann.

Abb. 93. Münchner Tracht von 1836. Man beachte die Riegelhaube, die »Florschließe« um den Hals. Das Brusttuch und das »Gschnür« mit dem Mieder. Die gepufften Hemdärmel, der Shawl und die gedrehten Locken (Stopsellocken) gehören nicht zur Tracht, sondern zur Biedermeiermode. (Nach Diez, Münchner Trachtenbuch und Alt-Münchner Bilderbuch.)
Ihre Bestandteile sind das Schnürmieder (Bild auf S. 298 Abb. 93) (das »Gschnür«), der gefältelte Rock und die Schürze (»Fürda«), der »Spenser« (Taille), die weißen, gestärkten Unterröcke, das meist bunte Brusttuch und die goldene »Riegelhaube« auf der aufgesteckten Scheitelfrisur. Nicht fehlen durfte bei den Vornehmen die »Florschließe« um den Hals, der reichliche Schmuck, die »Stutzln« (Handhalbschuhe) und die gestickte Perltasche. Mit den weißen Strümpfen und den Schnallenschuhen wurde kein besonderer Luxus getrieben; das verhinderte schon das Münchner Klima mit seinem »ewigen« Regen. Im Winter kam dazu noch ein Pelzmantel.
Wie man sieht, hat sich diese Tracht, entsprechend der Herausentwicklung Münchens aus einer Landstadt, aus dem ländlichen Sonntagskostüm herausgebildet, ist aber ganz wesentlich vom Oberlandler und Dachauer Kostüm unterschieden.
Die Tracht der ländlichen Bevölkerung der Hochebene, die zugleich jener der »Lehmbevölkerung« entspricht, ist auf S. 293 Abb. 89 wiedergegeben.
Von ihr unterscheidet sich der Dachauer Moorbauer, der heute noch zäh an seinem ererbten Kulturgut festhält, durch den nur über die Knie reichenden schweren, faltenreichen Frauenwollrock (sog. Bollnkittel), die bunten, mit farbiger Stickerei geschmückten Strümpfe und die über die Stirn herabfallende Spitzenhaube, oft auch mit langen schwarzen Bändern (vgl. Bild auf S. 295 Abb. 91). Statt dem Schnürmieder wird ein buntgemustertes, kurzes, wulstiges Mieder getragen, von jungen Mädchen an hohen Festtagen (nur mehr selten) auch ein in die Haare eingeflochtenes goldenes Nest.
Am Anfang des XIX. Jahrhunderts war (nach Stieglitz: Garchinger Tracht) bei verheirateten Männern die kurze Lederhose mit schwarzer Weste und langem, meist blauem Tuchrock im Schwange. Dazu blaue Strümpfe, Schnallenschuhe und ein runder, schwarzer Hut mit gelben Schnüren. Jetzt sind lange, unten gebundene Lederhosen, Stiefel oder Halbschuhe üblich (vgl. Bild auf S. 294 Abb. 90), dazu ein kurzer Spenser mit Silberknöpfen (Zwölfer und Vierundzwanziger). Silberknöpfe zieren auch die Weste. Die alte Tracht der Frauen war in Garching ebenfalls »der dickgefaltete Rock, schwarz und rot gestreift, dazu sogenannte Ärmel mit ausgeschnittenem Koller und Brustfleck. Den Kopf deckte eine niedere Pelzhaube, die Füße trugen blaue Strümpfe und »Haferlschuhe«.
Die Unterschiede zur Münchner Bürger- und Vorstadttracht springen in die Augen.

Abb. 94. Münchn. Kostümpuppe d. Biedermeierzeit im Hist. Stadtmuseum zu München. Näh. S. 298. Originalzeichnung von R. Grieß-München.
Wieder anders ist die Oberlandler Tracht, die durch die Schlierseer und Tegernseer Bauerntheater gemeinbekannt geworden ist. Es ist darin um die zweite Hälfte des XIX. Jahrhunderts eine große Wandlung vor sich gegangen; auch die hohen, spitzen, grünen Hüte, die Mann und Frau trugen und die auf allen alten Stichen und Gemälden von Münchner Volkstypen zu sehen sind, wurden abgelegt, und was heute Oberland-Tracht heißt, ist eigentlich die Miesbacher und Lenggrieser Tracht (vgl. Abb. 92). Sie hat mit der Alt-Münchner das mit Silberketten reich beschnürte Mieder gemein, unterscheidet sich jedoch dadurch, daß die Münchnerinnen einen ärmellosen Spenser trugen. Auch sonst noch in vielem Wesentlichen, so durch den Hut, auch die graue Joppe der Männer, das spitze, kleinköpfige »Miesbacher Hütchen« der Mädchen und die langsam verschwindende »Pechhaube« der Frauen. Diese Miesbacher Tracht ist eigentlich nur eine bäurische »Mode«, die etwa um 1820 von Tirol aus dem Duxer Tal als Tracht der Holzarbeiter aufkam. Vgl. Bavaria. 1868. 8°. Vordem gab es eine wirkliche »Isartracht«, die aus einem langflügeligen Rock und Tuchspenser, Hose und Kniestiefeln, dazu einem Tschakohut mit einer Goldquaste bestand.
Die Tracht des Giesinger Proletariats ist heute nichts, denn eine ärmliche Karikatur der modischen Kleidung, die mehr oder minder an dem Schnitt der vorigen Generation festhält und das mit Rudimenten einer Berufskleidung (gestreiftes Trikothemd) vermengt. Ziemlich unerläßlich ist der steife, schwarze Hut, wie denn überhaupt die Beziehungen dieses Kleidungsstiles eigentlich bei den »Pülchern« Wiens zu suchen sind. In historischer Zeit war die Tracht in den Vorstädten mit Lehmboden, soweit es mir gelang, solches zu ermitteln, etwa die gleiche, wie in den tertiären Lehmdistrikten Oberbayerns (Schrobenhausen, Aichach), die heute noch zäh an der althergebrachten Kleidung festhalten. Diese Tracht besteht aus Lederhosen, einem »Leibl«, einem langen schwarzen Rock mit Münzenknöpfen und einem Filz- oder Plüschhut. Die Frauen tragen Kopftuch, bei Festen auch Pelzhaube, und die von den Münchner Marktweibern und Kindern noch immer getragenen Wollhauben; ferner ein buntes Halstuch, sehr kurze Röcke und eine Schürze. Vgl. auch F. Dauhrer im Bayerland 1900.
Dem Unterschied in der Tracht entspricht endlich auch eine ausgesprochen lokale Differenz der Mundart. Das bayrisch-österreichische Wörterbuch unterscheidet bereits einen Alt-Münchner, einen Stadtdialekt, sowie einen »groben Vorstadtdialekt«, der der Sprache unseres Lehmmenschentypus entspricht. Vgl. auch F. Schmeller, Die Mundarten Bayerns, München 1821 und F. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch. 2. Aufl. 1868. Unschwer aber lassen sich auch mundartliche Verschiedenheiten zwischen der Münchner Stadtsprache und der Ausdrucksweise der Oberlandler, sowie der Moorbauern feststellen, sowie man den nichteinheimischen Fremden ohne weiteres daran erkennt – daß er nicht münchnerisch sprechen kann.
Der Münchner Dialekt, verwandt in vielem dem wienerischen und doch wieder beim ersten Wort für den Feinhörigen davon geschieden, ist ebenso reich wie dieser an Provinzialismen und Lokalausdrücken. Um nur einige Illustrationen hierzu zu geben, sei auf folgende Lokalausdrücke hingewiesen: wuiseln und kneren = winseln, das Wiener raunzen, G'waff = Maul, Bierdimpfl = ein in den Bierinteressen aufgehender Spießbürger, Gazl = Maß für Bier, Banzen = Bierfaß, Gspusi = Liebesverhältnis, Rudscherl = ein kleiner Topf, Matschukl = alte Frauensperson, a gmalt's Bauernschüsserl = gesunde, dralle Bauernmagd, Betnoppl = Betschwester, Bellebum = Kopf (Kindersprache), a Bauchwarz'n = Mensch kleiner Statur, Tascherl = neugeborenes weibliches Kind, S'Gmachterl = Penis und Skrotum eines kleinen Knaben, der G'wappelte, G'schwollschädel = der sozial Bevorzugte, das G'schlerf auch G'schwerl = eine alte, schlürfend einhergehende Frau, auch Gesindel, Gewerg'l = Gedränge, zwatzl'n = emsig, kompliziert arbeiten, sich zerznierzl'n = Komparativ des vorigen, Loabitoag = Brotlaibteig, daloabit sei = völlig erschöpft sein (Wiener: damatscht sein), Grantigl = Misanthrop, pfurren = Blasenwerfen des Breies, Schnurfel = klatschsüchtige Person. Was aus seinem Gebiete hier allein in Betracht kommt, sind jene Sonderprägungen gewisser Worte und Ausdrücke, welche er im Munde der vier verschiedenen Bevölkerungstypen annimmt. Am kultiviertesten klingt er natürlich in der inneren Stadt, außerordentlich vergröbert in Giesing und Westend, ungemein breitmäulig und langsam kommen seine Worte aus dem Munde der Moorbauern.
Da diese Lokalstudien durchaus Neuland sind, muß ich mich darauf beschränken, aus eigener Kenntnis heraus und durch Befragen Alt-Münchner Familien nur auf einige hervorstechende dialektische Unterschiede in der Stadt aufmerksam zu machen.
Vor allem bestätigt es sich, daß tatsächlich vier Unterdialekte vorhanden sind, ein Münchner Bürger- und Stadtdialekt (zugleich »die Alt-Münchner Sprache«, einst auch als Schrannendialekt, von der Schranne, dem Mittelpunkt der Stadt und des Markttreibens unterschieden), ein Vorstadtdialekt (auch als Karedialekt bezeichnet) Ihm entspricht im Wienerischen der Lerchenfelder, Hernalser Dialekt, dort allerdings mit noch reicherer Ausbildung und Gliederung.; dazu der Oberlandlerdialekt, in vielem und sehr spezifisch unterschieden, und dazu die Dachauer Bauernsprache, die wieder für sich steht.
Am besten wird der hier zu führende Beweis dadurch angetreten werden, daß man nur vergleichend eine Reihe von Ausdrücken nebeneinander stellt, die in den vier Mundarten different dieselbe Vorstellung bezeichnen.
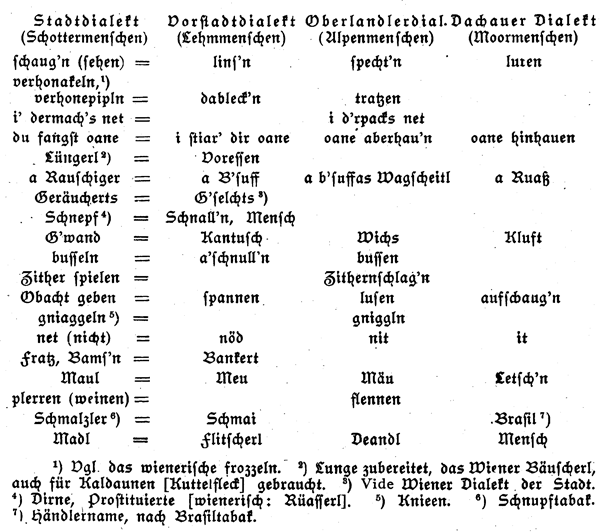
Innerhalb jedes dieser Kreise besteht eine Fülle von kennzeichnenden Sonderausdrücken, die ihm erst das Spezifische geben. So das Alt-Münchner grüabig = als Ausdruck des Behagens für eine richtige gemütliche Stimmung, oder »es himlitzt« = für es wetterleuchtet, oder der schon bei Kobell F. v. Kobell, Zur Charakteristik oberbayerischer und verwandter Dialekt-Poesie. (In Kobell, Schnadahüpfln. München. 8°.) als typischer Ausdruck hervorgehobene »Loamio«, der einen energielosen (faden) Menschen kennzeichnen soll und möglicherweise nicht von anlehnen, sondern in verächtlicher Weise vom Lehmmenschen (Loam), dem einstigen Vorstadtmenschen, abgeleitet sein kann. Ein spezifischer Ausdruck der Alt-Münchner Schranne war auch der etymologisch nicht mehr analysierbare und heute verschollene: Guld'nelfi, als Ausdruck für einen filzigen, bedachten Käufer.
Bedeutend reicher noch an Kraftworten ist natürlich der grobe Dialekt der Vorstadt, der in vielem eine Parallelentwicklung zum Hernalser, also Vorstadtdialekt Wiens, aufweist (Konvergenzerscheinung!) und dadurch diesem in manchem eigentlich nähersteht, als der Münchner Stadtsprache. Die gemeinsten Ausdrücke, wie Fotzn für Mund, Fotzhobel = Mundharmonika u. dgl. haben Wiener und Münchner Vorstadt gemein, wie auch gewisse Trachteneigentümlichkeiten. Andererseits verfügen die »Kares« und »Luckis« mit ihren Damen über eine Fülle unverfälscht münchnerischer Ausdrücke, die keiner anderen Stadt eignen, außer sie steht, wie die bayrische Provinz, im Bannkreise Münchens. Da ist vor allem das »zünfti« das Lieblingswort des sich behaglich fühlenden Auers oder des Bewohners der Schwantaler Höhe (auch Lehm!), das nur überboten wird, wenn eine Sache »zerm« ist. Da sind die »mir w'as gnua« und »mir gang'st«, das »dös glabst« und andere gemeinbekannte Redeblüten, die natürlich auch in die Sprache des Stadtinneren längst einsickerten, ihren Ursprung aber in den Vorstädten des Lehmbodens hatten.
Noch mehr gilt die Vermengung für den Älplerdialekt, der überhaupt im Begriffe steht, alles zu überwuchern (der Alpinisierungsprozeß) und Dialektstudien dadurch sehr erschwert. Man erkennt die eingetretene Wandlung namentlich dann, wenn man den rezenten Stadtdialekt mit seinen Denkmälern der Biedermaierzeit oder der Redeweise alter Personen aus dem Volke vergleicht, wobei zugleich eine zunehmende Verarmung sichtbar wird.
Dem gegenüber hat die Dachauer Mundart niemals die Münchner Redeweise wesentlich beeinflußt. Sie unterscheidet sich von ihr auch mehr durch Lautklang, Tempo und Unbeholfenheit Nach seinem eigenen Ausdruck redet das richtige Dachauer »gscherte Dach« wie »die Frösch«, nur erheblich langsamer., denn durch spezifische Ausdrücke. Sie hat eine andere Färbung, sagt nicht nur, wie in der obigen Tabelle der Vergleichung hervorgehoben wurde, »it« dort, wo der Münchner »net« sagt, sondern auch »i künt« für münchnerisch »i könnt« und »er kimp« für »er kommt«. Besonders typisch ist eine weichere Betonung der Konsonanten, z. B. »a March« statt stadtmünchnerisch »a Markl« (= eine Mark).
Ganz vereinzelt finden sich auch im Münchner Sprachgebrauch italienische Worte, natürlich mehr oder minder verballhornt, die im Wienerischen eine so hervorragende Rolle spielen: Strizzi (auch in München wie Wien für Lump übernommen), Cicisbeo, Karfiol (auch münchnerisch), Fisolen (= Bohnen) (auch münchnerisch), Pofesen (Mehlspeise), Schinakel (= Boot) (auch münchnerisch, gebraucht für große Füße, Bamberletsch (kleines Kind, vgl. Bamsen!). Alte Münchner Bürger sagen noch gelegentlich »Fazinetl« statt Taschentuch. Ein sehr bodenständiger Ausdruck um den Münchner Rathausplatz herum ist »vertralemanschieren« (etwas bis zur Unauffindbarkeit verlegen), was nur eine Verballhornung aus dem Italienischen oder Französischen sein kann. Es ist übrigens auch ziemlich dem Zweifel entrückt, daß »Fotz'n« (= Mund) mit dem italienischen voce zusammenhängt.
Doch genug dieser Beispiele, die sich vom Dialektforscher leicht in ein viergeteiltes Münchner Idiotikon von beträchtlichem Umfang erweitern ließen. Ihre Häufung würde nicht mehr beweisen, als was auch schon durch diese Prolegomena feststeht, daß die vier Münchner Bevölkerungstypen auch ihre spezifischen Sprachen sprechen.
Damit schließt sich der Kreis dessen, was zu beweisen war, vollkommen, namentlich wenn man als letzte und nicht zuletzt maßgebliche Äußerung spezifischer Typen auch noch die Münchner Baugeschichte in Betracht zieht.
Sie, die nichts anderes als erstarrte Lebensäußerung ist, erzählt nochmals – und für unsere Absichten zum letztenmal – die Geschichte dieser Stadt, die Zusammensetzung ihrer Bevölkerung und die der Wellen, in denen sie ihr Fremdenverkehr durchflutet, und sie drückt damit allen hier gegebenen Beweisführungen den Stempel des Endgültigen auf, denn sie verrät uns den Stil, welchen das Gesetz ihres Lebens ihren Bewohnern aufzwang.
An diesem Punkte verknoten sich alle Beweise in einen einzigen letzten. Denn die gesamte Gesetzlichkeit, auf deren Wegen das Geschehen in München wandelte, mußte eine spezifische Münchner Kultur zustande bringen, die ihren Niederschlag natürlich im Baustil kundgeben muß. Sind alle die gegebenen Ableitungen richtig, muß jeder der vier Menschentypen seine eigene Bauweise befolgen, deren Dominante aber eine besondere »Münchner Note« der Architektonik sein muß, solange die »Schotterbevölkerung« in der Stadt herrscht. In dem Maße aber, als der Fremdenverkehr mit der Verbesserung der Verkehrsmittel von ferneren Straßen regelmäßig hereinströmen kann, müssen auch die Wege dieses Verkehrs im Straßenbild der Bauten sichtbar werden. Wer das Gesetz der Wanderungen kennt, wird diese Stileinflüsse vorhersagen können. Er wird erfolgern müssen, daß die bessere Verbindung Augsburgs mit Italien so lange München dem Augsburger Reichtum und dadurch auch Augsburger Stil unterordnen mußte, als der Welthandel diesen Weg einschlug. Die Wage war dadurch so belastet, daß München steigen mußte, als Augsburg sank. Aber das Gesetz forderte auch, daß Münchens Größe dann in den Dienst seines Fremdenverkehrs geriet, daß es französischen und italienischen Stil aufnahm und norddeutsche Gotik imitieren mußte (vgl. Abb. 101). Daß England und der ferne Südost ebensogut in seinem Stadtbild sichtbar wurden, wie die englischen und Balkanfremden auf seinen Straßen. Und es mußte in seinem Baustil genau so zum Stelldichein aller Welt werden, seitdem der Weltverkehr einsetzte, der sich jedes Jahr an der Isar – wir wissen schon, nach welchen Gesetzen – sein Rendezvous geben muß.
Trifft das alles und die durch so viel Reibungen, Befruchtungen und Anregungen einer allgemeinen Vermischung fremder Ideen notwendig erweckte nervöse und kultivierte Reizsamkeit seines geistigen Lebens zu, dann hat die Wirklichkeit die hier vorgetragene Theorie bis zu ihren letzten Ausläufern gerechtfertigt, und dieses Buch endet mit dem Siege seiner Gedanken.
*
Das geographische Gesetz Münchens erzeugte nun mit Notwendigkeit auch den dieser Stadt zukommenden Bau- und Lebensstil (vgl. Abb. 40 und 87).
Die Kreuzung der zwei Straßen entwarf den Stadtplan, legte die vier Hauptstraßenzüge an und schuf von selbst die historischen vier Viertel (Hackenviertel, Anger-, Kreuz- und Graggenauer Viertel von den ältesten Zeiten bis ins XIX. Jahrhundert). »Die Salzstraße gibt dem Organismus das Rückgrat.« Oder besser gesagt, sie ist der die Nahrung aufnehmende Kanal. Denn München war, ist und wird immer sein die Stadt der Fremden, also einst die der Brauereien und der Wirtshäuser (auch jetzt sind relativ mehr Wirtschaften, denn in jeder anderen Stadt vorhanden), jetzt die der Fremdenkarawansereien vom Hofbräu und dem Mathäser bis zu den modernen Pensionen.
Vollkommen gerade, mit vollem Behagen ihrer Wichtigkeit, durchzieht die Salzstraße die Stadt in einer Linie, während die Nord-Südlinie sich in schmale Arme teilt, sogar bricht, als Zeichen, daß sie bei Anlage der Stadt von sekundärer Wichtigkeit war. Sie ging eben anfangs nur vom Isartal nach dem Norden.
In dieser Anlage steckt denn auch das ganze Geheimnis, warum Augsburg so lange reicher (Abb. 98), mächtiger und größer war als München. Die große Verkehrsstraße Venedig–Fernpaß ging gerade nach Augsburg (der Weg Venedig–Kufstein–Rosenheim führte geradenwegs nach Regensburg). München blieb abseits liegen; man reiste, von Italien kommend, nur daran vorbei, wenn man es aufsuchen wollte.
Aus diesem italienischen Handel aber zog Augsburg seinen Reichtum, aus ihm ernährten sich an der großen Heerstraße nach Norden noch viele andere Orte als Post- und Wirtshausstationen, die fast sämtlich sich durch ihr Geld die Reichsstadtrechte erkauften (Füssen, Donauwörth, Nördlingen, Dinkelsbühl, Rothenburg, Würzburg, Frankfurt am Main). Augsburg war das Hauptjuwel in dieser Perlenkette, der erste große, deutsche Umschlagplatz. Und das diktierte Augsburgs Gesetz. Der dem Besucher noch heute in allen Gassen (vgl. Bild auf S. 306) entgegentretende Prachtstil, der sich namentlich im kolossalen Rathaus (es war wohl im XVII. Jahrhundert der großstädtischeste Bau Deutschlands), im Patrizierhaus der Fugger, in den großartigen Wohltätigkeitsstiftungen der »Fuggerei« (Abb. 97) aussprach, war die notwendige
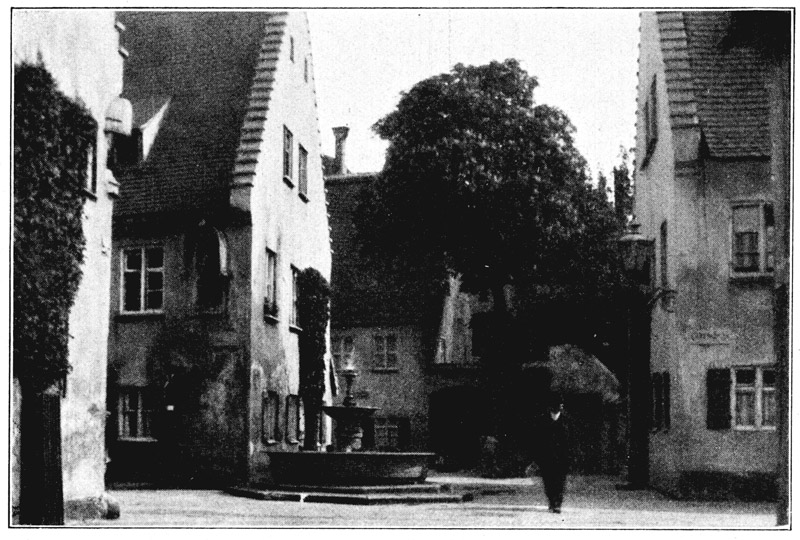
Abb. 97. Die »Fuggerei« in Augsburg, ein in München undenkbares spezifisches Bild »reichsstädtischen Stiles«. Original von Frau Dr. A. Friedrich-München.
Folge des Geschäftsumfanges von Welthandelshäusern, wie die Fugger oder die Welser, deren Einflußsphäre von den ungarischen Kupferbergwerken bis zum südamerikanischen »Welserland« reichte.
Das uralte Gesetz, das den Kaufmann seines Kredites halber zwingt, Pracht zu entfalten, prägte der großen Nord-Südader (heutige Maximiliansstraße), auf der die italienischen Wagenburgen sich stauten, einen Stil auf, der in sich nordische (holländische) Giebelbauten (siehe die Fuggerei Abb. 97], die vollkommen ein holländisches Landstädtchen nachahmt) und südliche Elemente vereinigt. Zu ihnen gehört die in der Renaissance in Italien aufgekommene bunte Bemalung der Häuser, die, in Augsburg übernommen, die ganze dortige Hauptstraße in ein aufgeschlagenes Bilderbuch verwandelte und bis heute traditionell blieb (Fuggerhaus, das wieder hergestellte Weberhaus u. a.). Italienisch war aber auch die Kuppelbekrönung der Kirchen (»welsche Hauben«), die in St. Ulrich und St. Afra, auch in Elias Holls Meisterrathaus vielbewunderte Vorbilder für ganz Oberbayern und Schwaben jedermann vor Augen stellte. Italienisch war auch ein bestimmter (ursprünglich römischer) Gartenstil mit Zierbeeten, Springbrunnen und Statuen, von dem noch kärgliche Reste im Fuggerpalast zu sehen sind (vgl. Abb. 100).

Abb. 98. Typische Gasse der Augsburger Altstadt mit den in München fehlenden vorgekragten Giebelhäusern und Barockerkern. Original von Walter Francé-München, (Vgl. dazu Abb. 102.)
Überwältigend war diese exotische Pracht für die einfachen und armen Kleinstädter, zu denen um 1550, als alles das schon stand, auch die Münchner gehörten. Was lag also näher, als sie, die langgewünschte, sofort zu kopieren, als auch jene zu Geld kamen! Umsomehr, als sich um die Zeit auch für sie der direkte Weg nach Italien und damit der italienische Einfluß erschloß! Das Gesetz der Wanderungen, gültig im ganzen Bereich des Lebens, greift damit auch auf das Feld des geistigen Lebens über, das ja nichts anderes ist, als die Übertragung der Lebensmechanik auf die Elemente des Kulturellen (man schafft Organismen und Welten aus Begriffen, Farben, Steinen, Tönen usw.).
Und italienischer Stil wanderte nach 1492 sowohl auf dem Umweg über Augsburg, wie unmittelbar aus seinem Heimatsland in München ein. Das Datum ist genau bestimmt durch eine uralte Tafel an den Felswänden des Kesselberges (vgl. Abb. 99) bei Kochel, auf der zu lesen, daß die alte Straße nach Mittenwald–Innsbruck–Italien in jenem Jahr auf Anregung eines Münchner Bürgers gebaut worden sei.
Dieses Jahr war ein doppeltes Unglücksdatum für die reichgeputzte Bürgerin Augusta. Erstens wurde Amerika entdeckt und dadurch binnen einem Menschenalter der große Handelsverkehr von Ostindien–Venedig abgezogen. Venedig–Genua–Augsburg und die kleinen Reichsstädtlein verdorrten ohne den Goldstrom auf der »Pfefferstraße«; Spanien dann Holland, England und die Hansa blühten durch die Reichtümer Amerikas auf. Und außerdem erhielt die Rivalin Augsburgs, das Aschenbrödel München, einen noch kürzeren Zugang zu Italien und begann zu florieren als Handelsstadt. Daß dieser Weg merklich der kürzeste und reisetüchtigste war, beweist Goethe, der über München und die Kesselbergstraße nach Italien fuhr, mit einem Herzen so voll Sehnsucht nach dem klassischen Land, daß er keine Meile Umweg einer deutschen Schönheit zuliebe gemacht hätte.
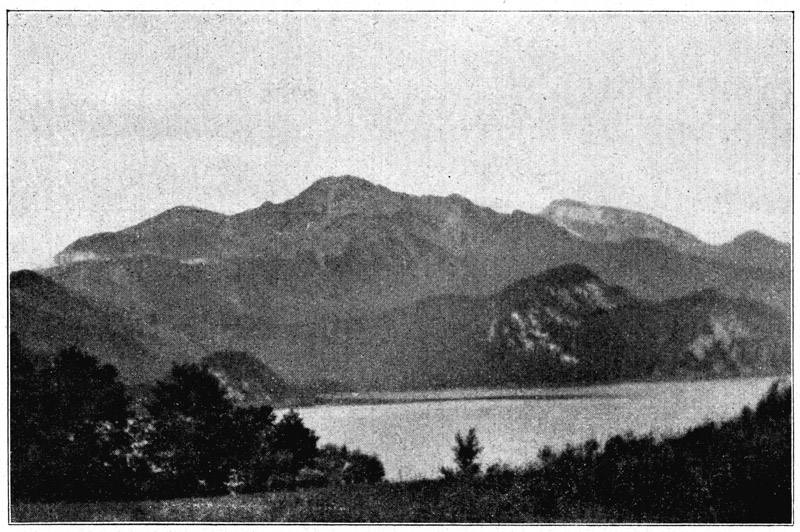
Abb. 99. Das Kesselberggebiet mit Herzogstand und Heimgarten am Kochelsee, das erst im Jahre 1892 überwundene Hindernis des direkten Verkehrs zwischen München und dem Inntal bezw. Italien. Diese Barre (links) bedingte das anfängliche Zurückbleiben hinter Augsburg. Original.
Aber – wie tragisch doch die feinen Fäden der Gesetzmäßigkeiten von den Nornen gesponnen werden! Als Münchens Handelsweg nach Italien geschaffen war, suchte sich der Handel andere Wege. Die Isarstadt nahm nur einen ganz kurzen Anlauf zur Handelsstadt, dann verwelkte diese Blüte, und München blieb Residenz und Landstadt wie vordem.
Aber immerhin genügte dieser Aufschwung, um italienisches Wesen in das Stadtbild einziehen zu lassen. Auch München bemalt jetzt die Häuser. Der »schöne Turm« an der Kaufingerstraße war einst seiner Gemälde wegen »schön«; fast alle Häuser trugen nun, trotz des fassadenfeindlichen Klimas (179 Regentage im Jahr), farbigen Schmuck, von dem ein (allerdings renoviertes) Überbleibsel in der Rosenstraße: das Spöckmaierhaus, ein 400 Jahre altes Gasthaus, oder auch der alte Rathausturm Zeugnis ablegen (vgl. Abb. 100). In der Malerära Münchens nahm man natürlich diese nie völlig verblaßte Tradition, die auch auf die Provinz (Tölz! Rosenheim!) überging, mit Begeisterung auf, und malte unmögliche Architekturen auf die Häuser, wovon die Fürstenhäuser in der Schellingstraße noch jetzt übel genug zeugen. Sogar allerneuestens ging man bei dem Neubau des Königsbaues am Stachus und des neuen Justizgebäudes (Bild S. 309 Abb. 101) einer Gepflogenheit nach, deren Ursprung sicher den Zehntausenden, die täglich einen verwunderten Blick auf den bunten Steinbaukasten in der Prielmayerstraße werfen, nicht mehr inne ist.

Abb. 100. Der Grottenhof in der Münchner Residenz, ein Barockgarten, der die Fuggergärten von Augsburg nachahmt. [Aus »München und seine Bauten«. F. Bruckmann A.-G.]
Auch die »welschen Hauben« machte München nach an seinem Dom zu unserer lieben Frau und schuf sich dadurch ein Stadtwahrzeichen, das so unzertrennlich zur Silhouette der Stadt gehört (vgl. Bild S. 135), wie der Campanile zu dem von Venedig.
Sogar die Fuggergärten von Augsburg machte der reichste Mann von München, nämlich der Kurfürst, der als Herzog seit 1504 ständig in München residierte, nach; wenigstens ist die entzückende Gartenarchitektur des Grottenhofs in der Residenz (Abb. 100) im Geiste ihrer Anlage nichts, als ein Gegenstück zu den Höfen der Fuggerresidenz von anno 1550.
München wäre damals ohne weiteres bereit gewesen, das Erbe der zwar äußerlich erst jetzt zur vollen Prachtentfaltung emporsteigenden Rivalin am Lech, der seinerzeit auch die Straßenkreuzung Existenznotwendigkeit und Glück gebracht hatte, zu übernehmen, vom XV. Jahrhundert an, etwa durch hundert Jahre hindurch erlebte es seine organischeste und daher gesündeste Periode und schuf sich demgemäß seinen, nur auf die Bürgerschaft gestellten eigenen Stil – eben jenen, von dem Sandtners Modell so vollendeten Aufschluß gibt. – Die Zeit von 1450 bis 1550 war seine wahrhaft große Zeit, dann aber begann ein anderer Einfluß übermächtig zu werden, der das bodenständige Eigenleben langsam, aber sicher zum Absterben brachte, und von nun an München ausschließlich zur Stadt der fremden Ideen umgestaltete.
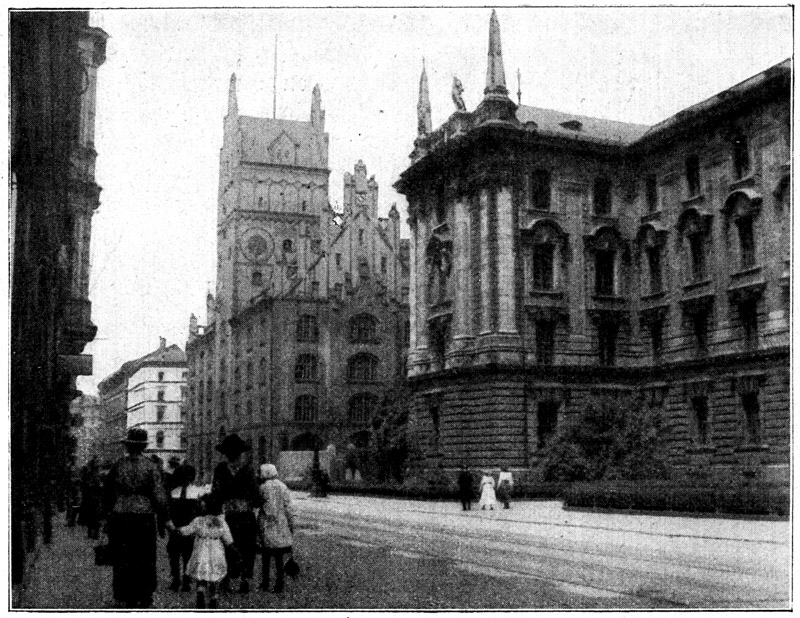
Abb. 101. Blick in die Prielmayerstraße im Münchner Bahnhofviertel mit dem Justizpalast und dem neuen Justizgebäude. Unvermittelt sind hier Bauwerke der Hochrenaissance und eines polychromierten gotisierenden süddeutschen Barocks (»Altmünchner Stil«) in eine nüchterne Umgebung gesetzt, ein beredtes Zeichen großstädtischer Stilanarchie. (Vgl. dazu S. 308) Original von Frau Dr. A. Friedrich-München.
Den historischen Vorgang faßt M. Haushofer unübertrefflich zusammen, wenn er hierüber sagt:
»An die Stelle langjähriger Fehden (die sofort einsetzten, als München den südländischen Handel an sich riß, vgl. hierüber Trautmanns Stadtbüchlein) und Erbfolgekriege traten andere Übel: Steuerdruck und Beamtenwillkür und allmählich auch der Kirchenstreit. Auch in München und anderen altbayrischen Orten begann die Glaubensfrage zu gären. Und als zu Anfang des XVI. Jahrhunderts in Schwaben die unterdrückte Bauernschaft sich empörte, schlug ihr Stürmen bis hart an das bayrische Oberland heran ... Den bayrischen Herzögen fiel es nicht schwer, die Schrecken des Bauernkriegs von ihrem Lande fernzuhalten. Und fast ebenso selbstverständlich, wenn auch nicht ganz so leicht, war die Erhaltung der Glaubenseinheit – mit dem schwersten Opfer, das ein Volk und Staatswesen zu bringen vermag: mit dem Opfer des freien Denkens.

Abb. 102. Überreste des Sandtnerschen München. Alte Häuser mit Halbgiebeln inmitten eines großstädtischen Baublockes in der »Trödlergegend« am Oberanger. (Vgl. dazu Abb. 85) Original.
Durch Kerker, Folter und Scheiterhaufen Vgl. hierüber mein Werk: Die Alpen. Leipzig. 1912. 8°. gelang es, in München und dem bayrischen Oberlande den Geist der Reformation in seinen ersten Keimen zu ersticken. Auch neben ihrer Fürsorge für den Glauben war die Landespolizei in allen Richtungen tätig. Nur eines gelang ihr nicht: das Volk zu freiem, selbständigem Fortschritt zu erziehen. Für Jahrhunderte hinaus ward in dieser Zeit der geistige Aufschwung des Altbayerntums hintangehalten. Statt seiner wirkten die Jesuiten.
Die Folge war, daß trotz aller Liebe der bayrischen Herzoge zu ihrem Volke, trotz aller Untertanentreue des letzteren, die Entwicklung des Volkslebens während der ganzen Reformationszeit eine rückständige blieb.«
Mit intuitiver Sicherheit wird hier der Kernpunkt des Problems der weiteren Entwicklung Münchens bloßgelegt, der in der offiziellen bayrischen Geschichtsschreibung sonst nicht mit solcher Deutlichkeit erkannt werden kann. So wie dieser ganze letzte Abschnitt nichts Neues mehr zu sagen hat, sondern nur gemeinbekannte Dinge als Stütze für das vorgetragene Gesetz verwendet, das all dem sonst nie erklärten Geschehen erst die ursächlichen Zusammenhänge schafft und damit die Erklärung, so ist auch diese Tatsache für uns bloß eine Notwendigkeit, die bereits in der Vorgeschichte Münchens beschlossen lag, als sich herausstellte, daß die Langköpfe der Völkerwanderungszeit wieder von dem alpinen Typus überwuchert werden. Das bedeutete mit völliger Sicherheit einen Kulturwechsel, zu dem nun die historischen Daten beigebracht sind.
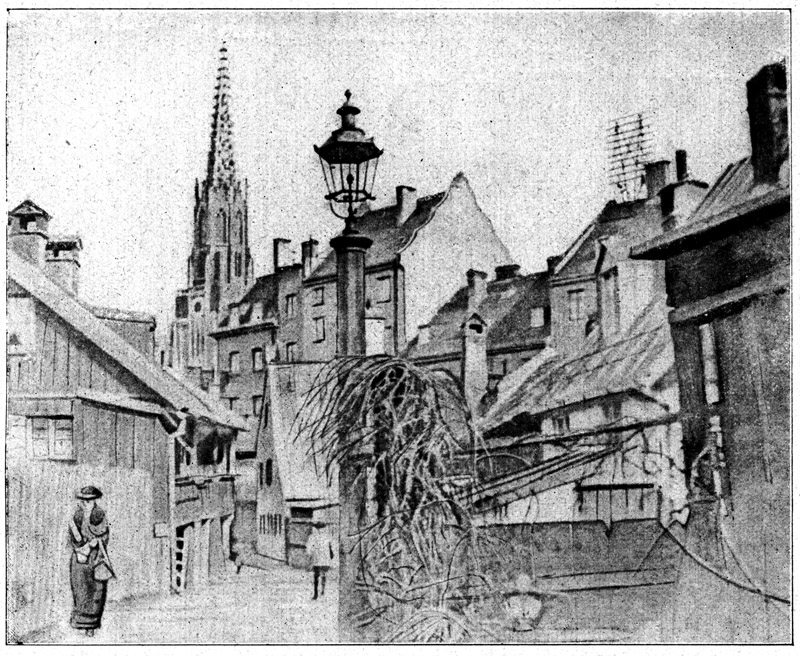
Abb. 104. Alte Holzhäuser mit Altane, eine lokale Ausprägung des alpinen Stils. Motiv aus der Vorstadt Au, wo noch an vielen Stellen ein wunderliches Gemisch kleinstädtischer Idyllen und großstädtischer Nüchternheit besteht. Man ziehe als Vergleich das alpine Bauernhaus (Abb. 82) und die alte Münchner Stadtansicht auf S. 283 heran. Der Turm im Hintergrund gehört zur neuen Auer Kirche. Original.
Das eigentliche bodenständige München war damit tot; der dreißigjährige Krieg mit seinem Leid vollendete nur einen unaufhaltsamen Prozeß des Aussterbens, der das Kleid einer früheren Formengebung zurückließ, wie ein Fossil, das von 1650 an langsam zerfällt und heute nur mehr mit ganz wenigen Spuren Noch stehende Überbleibsel des Sandtnerschen München sind außer den alten Kirchen [von denen aber die Frauenkirche außen mehr plastischen Schmuck und farbige Bemalung besaß] der alte Hof [Bild S. 331], einzelne gotische Häuser in der Burgstraße, das alte Rathaus, die traurigen Reste der Stadttore (das Isartor ist durch üble Renovation ganz verändert, vom Sendlingertor stehen nur Rudimente der Barbakantürme], verschiedene alte Halbgiebelhäuser im Angerviertel [Bild S. 102], der Marstall und das Zeughaus am Jakobsplatz, das Donislhaus am Marienplatz mit seinem hohen Dach (Abb. 105), das Schloß zu Blutenburg, die Kirche zu Pipping, der Münzhof, verschiedene alte Höfe am Rindermarkt Nr. 18 [Gasthaus 3 Rosen] und die Herbergsviertel in der Au [Quellenstraße], [Bild S. 311], St. Paulsplatz und in der »Grube« in Haidhausen, die wenigstens traditionell den alten Stil fortsetzten. die inzwischen neu entstandene Stadt durchsetzt.
Dieses Fossil heißt die Sandtnersche Stadt: das schöne, originelle, gotische München, mit seinem eigenen Stil, von dessen Organik man sich heute kaum einen Begriff machen kann. Einen Versuch dazu stellen die hübschen Steinleinschen Aquarelle dar [vgl. Bilder auf S. 281, 285, 287]).
Dieses alte, bodenständige München allein hat in voller Reinheit die drei Baustile besessen, die als notwendige Lebensform seiner drei Bevölkerungstypen genau so aus diesem Boden wachsen mußten, wie das »Merkmalkleid« einer Pflanzenspezies.
Es handelt sich nur um die drei Stile des »Münchnerischen« kat' exochen, der auf Lehmboden gebauten Vorstadt und der alpinen Vorstadt, da die Moorbevölkerung sich niemals in der Stadt angesiedelt hat und die Fremden damals nur ein durchziehendes, aber noch kein ansässiges Element waren (fehlende Freizügigkeit der Ansiedelung).
Dieses München, dem die Bezeichnung » das organische München« gebührt, war ganz in den Dienst des Salzhandels gestellt. Seine breiten Hauptstraßen waren der Aufnahme der wahren Burgen von Planwagen angepaßt, die zahllosen Stallungen der Wirts- und Bäckerhäuser dem Fremdenverkehr. Der heutige Promenadeplatz war der Stapelort des kostbaren Salzes, wo die ersten, großen Salzstädel standen; rings herum waren die »Salzstößler« angesiedelt, und damit rollt sich gleich ein Übersichtsbild der damals kaum einige tausend Einwohner zählenden Stadt auf, an deren Peripherie sich noch eine Ackerbürgerstadt ansiedelte. Deren Stil konnte nur der alpine Baustil des Vorlandes sein, vorzugsweise Holzbauten (Abb. 82) mit ihren typischen Leg-, Schindel- (urkundlich auch Stroh-)dächern. Im Jahre 1342 werden die Holzdächer durch eine neue Bauordnung verboten, als Zeichen, daß sie bis dahin üblich waren. Auch die für den alpinen Stil typischen Altane waren allenthalben verbreitet. Dazu aus dem Milieu des Landes die hohen, spitzen Giebel (vgl. Abb. 85), die das Stadtbild von Landshut z. B. heute noch beherrschen, und die flachen, nach der Straße zu hinter einer Frontmauer verborgenen Dächer der Inn- und Salzachgegend, deren Beispiele sich in Burghausen und Wasserburg erhalten haben.
Aus diesen Elementen bildete sich dann allmählich im XIV. Jahrhundert der spezifische Münchner Stadtstil mit seiner Variante des Vorstadtstils heraus.
Das Sandtnersche Modell gewährt hierüber reiche Aufklärung. Durchwegs in den gotischen Grundformen bildete sich jetzt allmählich ein neuer Straßen- und Häusertyp heraus, der die Selbständigkeit des germanischen Hauses aufgab, dafür sich mit Kommunemauern mit den Nachbarn zusammenschloß und die Trauflinie längs der Straße verlegte. Um Waren und Vorräte aufzunehmen, blieb aber ein kleiner Dachausbau erhalten, der dann die für Alt-München so charakteristische Form des Halbgiebels bekam (vgl. Bild S. 285). Oft wurden zwei solche Halbgiebel aneinandergelehnt und schufen sich dadurch gegenseitig Festigung. Zum bodenständigen Stil gehörte alsbald auch der farbige Schmuck der Fassaden; dazu kam reiche Gliederung durch Erker (der »alte Hof« bewahrt ein prachtvolles Beispiel), und so erstand aus dem Gewirr älterer Häuser im Stil des Alpenblockhauses, sowie deren Umformung zum vorstädtischen Herbergenstil (vgl. Bilder S. 311) und den Neubauten ein so malerisch schlichtes und entzückendes Gesamtbild einer Stadt, daß man sehr wohl versteht, wie bereits 1433 der englische Ritter Bentradon de la Brocquière, den das »Gesetz der Straßen« auf der Fahrt nach dem Orient natürlich durch München führte, es das hübscheste Städtchen, das er gesehen, nennen konnte. Nach Dr. R. Trautmann in: München und seine Bauten. 8°. 1912. S. 51. Den malerischen Reiz der alten Stadt hoben dann noch viele mittelalterliche Reisende von Ruf hervor. (Vgl. Abb. 86 und 85.)

Abb. 104. Gartenhäuschen im Südviertel Münchens im Alpenstil. Original.
Von alledem ist nur mehr die Anlage der innersten Stadt, manch ein, meist verwahrloster Bau in Händen alter Bürgerfamilien, die sonderbare Welt der »Herbergen« in der Au, welche unter allen deutschen Großstädten ein Unikum bildet, erhalten, und in den südlichen Vorstädten manch nachlebender Zeuge, wie gerne man im »alpinen Stil« da noch wohnen möchte. Kann man es nicht für immer, so richtet man sich wenigstens im Gärtchen das Lusthäuschen im vertrauten und sympathischen Blockhausstil ein (vgl. Bild S. 104).
Dieses alte München nun, das die Dreiteilung seiner Bevölkerung so organisch zum Ausdruck brachte, ist gestorben. Es ist samt seiner bodenständigen Entwicklung verdorrt, erstickt unter der Decke, die das Gesetz seines Fremdenverkehrs ihm überlegte als fremder Geschmack und ortsfremde Idee.
Als um den Marienplatz sich noch die Geschlechterhäuser der Schrenk und Leupold, Gollier und Ligsalz u. v. a. erhoben, die gewaltige Frauenkirche in rund zwanzig Jahren erbaut wurde, die Kette der Planwagen auf der Straße nach Frankfurt, mit dem viele Handelsbeziehungen bestanden, kaum abriß, da hatte das »Schottermünchen« seinen Höhepunkt erreicht, mit seinen Vororten den besiedelbaren Boden seines Schotterdreiecks auch fast ausgefüllt, und von da ab erlebte es, wie unerbittlich Naturgesetze eine Kultur formen. Der Konnex, den seine Herrscher durch die Gegenreformation mit dem Land ultra montes anbahnten, hat die Zugstraße von Süden her künstlich erweitert. Damit kamen die neuen Stile – das München der Fremden beginnt und die Volkstradition verblich langsam und unbeachtet. Was man heute wieder als »Münchner Barock« erneuert und als »bodenständige« Bauweise preist (vgl. Bild S. 327), ist am Zeichentisch ersonnen, im Archiv alten Modellen nachgezeichnet, also eine galvanisierte Leiche. Die alte Stadt hat sich selbst durch ihre Einwanderer zerstört und erst dadurch ihr Lebensgesetz vollendet. Wenn eine Stadt sich stets wandeln muß, so ist es München.
Vor allem brachte der Hof Italiener herein. Wilhelm V. führte die Jesuiten in die biedere Ackerbürger- und Salzstößlerstadt, und mit ihnen die italienischen » muratori«, an der Spitze den Paduaner Friedrich Sustris, der als erstes Denkmal der Herrschaft welscher Gesinnung die Michaelskirche, die größte und monumentalste Kirche der Gegenreformation auf deutschem Boden, errichtete. Es ist geradezu eine Ahnung, die den Fürsten treibt, das gotische, organische München vor seiner Zerstörung noch einmal festhalten zu lassen. 1571 vollendet Sandtner, der Straubinger Drechslermeister, das Modell der Stadt, von der ein Menschenalter früher der Kosmograph Sebastian Münzer schreibt, daß in Deutschland zu »unsern Zeyten kein hübscher Fürstenstatt gefunden wirt« – und 1577 wandert Sustris ein. Diese welsche Ära dauert lange. Noch 1663 und 1714 baut man italienische Kirchen in München; ja man verpflanzt einfach Gesù aus Rom auf die Schotterheide an der Isar, das Unorganischeste, das sich denken läßt ... Und die Fremdenstadt nimmt auch das bereitwillig auf und assimiliert es sich. Und heute zählt die Münchner Gesùkopie zu den Kunstschätzen Münchens als Theatinerkirche und erweckt in den Fremden sehnsüchtige Schauer und ein Lächeln erster Ahnung und der Freude: schon am Eingangstor Italiens zu stehen.

Abb. 105. Blick auf den ältesten Teil der Altstadt vom Frauenturm mit dem in Brabanter, also durchaus ortsfremder, Gotik erbauten neuen Rathaus, dem Marienplatz, der nur mehr ein altes Bürgerhaus (den hochgiebeligen »Donisl«, gerade vor dem Ecktürmchen des Rathauses) besitzt, dem alten Rathausturm (gewesenes Stadttor der ältesten Stadt); daneben der völlig unproportionierte Turm von Heiliggeist und rechts die Peterskirche (vgl. dazu Bild 83), deren Doppelturm nach einem Brand der jetzigen merkwürdigen Turmform gewichen ist. Im Hintergrund dehnt sich die Hochebene des Alpenvorlandes. Original von Frau Dr. A. Friedrich-München.
Der Überschwang, mit dem sich alle fremden Ideen in München durchsetzen – sie können es leicht, da das organische München tot ist – wollte schon damals ganze Stadtteile in welscher Art uniformieren. Die neuentstehenden Adelspaläste sind alle fremd, unmünchnerisch, undeutsch, wie ihre Besitzer. Noch stehen davon das bedrohte Palais Porzia in der Promenadestraße 10 und das Palais Berchem in der Salvatorstraße mit dem Kühbogen (wie traurig naiv sich der »Älpler« den fremden, »hohen Herrn« zurechtlegt) und seinem Belvedereturm. Auf dem Promenadeplatz Nr. 18 steht noch das Maffeihaus, andere Paläste der Zeit und des fremden Stiles sind längst gefallen.
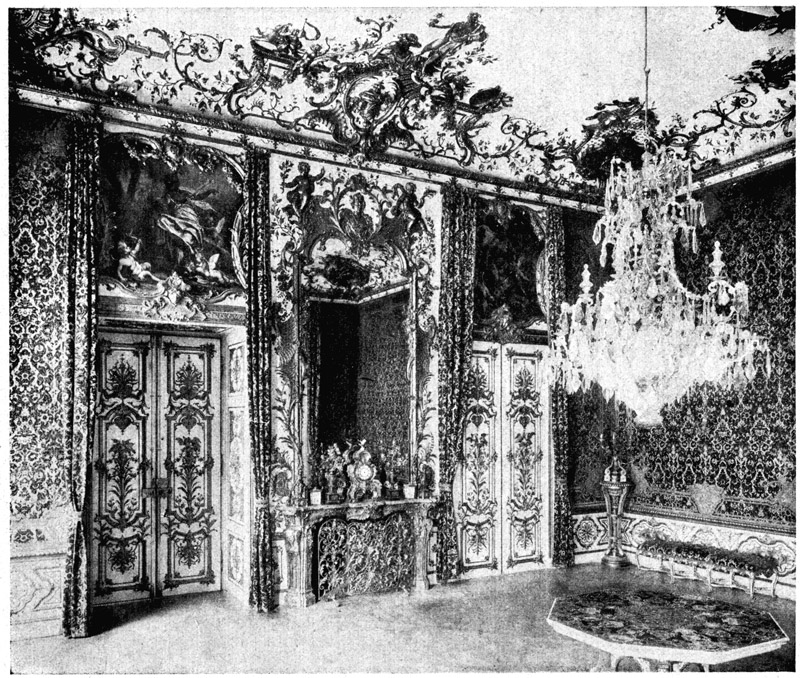
Abb. 106. Rokokodekoration der »Reichen Zimmer« in der Münchner Residenz. (Vgl. S. 318.) (Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Zwischen 1650 und 1700 begann der Fremdenverkehr in Europa andere Wege zu gehen. Die Renaissance war unter dem eisenklirrenden Tritt deutscher Landsknechte zertreten, die Landsknechtsheere hatten sich selbst in dreißig Jahren voll Greueln und Blut aufgerieben. Übrig geblieben war die französische Kultur, und damit fuhren auf der uralten Salzstraße zahllose Kutschen zwischen Wien und Paris. Sofort bekam das München zu spüren. Noch immer hatte inzwischen das zähe, uralte Schottermünchen, das seit Hallstatt so viele Kulturen verdaut hatte, versucht, das Neue aufzunehmen und sich in ihm durchzusetzen, indem es die fremden Ideen vergröberte und dadurch »heimisch« machte. Um 1700 kreuzt sich in den Bauten merkbar der französische mit dem italienischen Einfluß, an Stelle der Palazzi tritt der Schloßstil seit dem Kurfürsten Ferdinand Maria und dessen Frau. Noch sind die Barelli, die Zuccali und Viscardi die Männer, welche alle großen Bauaufgaben in Händen haben, aber mit dem biederen Dachauer, Josef Effner, den der Fürst in Italien und dann in Paris ausbilden läßt, und noch mehr mit François Cuvilliés, den der Kurfürst unter seinen Pagen entdeckt und natürlich sofort wieder nach Paris schickt, beginnt an der alten Salzstraße auch ein Stil der Régence. Wenn in schwankendem Mondlicht das alte Preysingpalais den Kontrast mit seiner Umgebung nicht mehr fühlen läßt, wacht auf einmal dieses Stück nach dem Postglazial versetzten Pariser Frührokoko wieder auf ... Und ein so schönes Rokoko, wie in Schleißheim oder in den »Reichen Zimmern« der Münchner Residenz hat selbst Paris nicht (vgl. Abb. 106).

Abb. 107. Das Asamhaus mit der angrenzenden Johanneskirche in der Sendlingerstraße zu München, eines der wenigen Baudenkmäler des 18. Jahrhunderts, welches »bürgerliches Rokoko« aufweist. Eigentlich ist hierbei nur eine Altmünchner Wohnanlage (man beachte hierfür den Flacherker) in Rokokomanier dekoriert. [Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Effner verleugnet das Moorbauernblut nicht, er vergröbert alles[Siehe Schleißheim, Schloß Fürstenried, Pagoden- und Amalienburg, Kavalierhäuser in Nymphenburg.], auch in Cuvilliés' Bauten [Palais Eichthal, Piosaque de Non (Theatinerstraße 16) und Palais Holnstein (Erzbischöfliches Palais), Nymphenburg, Residenztheater u. a.] kommt immer wieder das Schottermünchen durch. Sogar im Residenztheater, in diesem entzückendsten Theaterbau des deutschen Rokoko, schlägt überall die naive, frische, etwas derbe Münchner Art für den durch, der sich das Feingefühl für den »Gestus der Artung« erworben hat. Ja, dieses Rokoko wird zum Schluß sogar selbständig und münchnerisch, es springt auf das Bürgerhaus über und dringt in die Bauernkunst des flachen Landes ein. Das Asamhaus in der Sendlingerstraße (Abb. 107) ist ein noch sprechender Zeuge dafür, wie daraus ein neuer organischer Typ der bürgerlichen Fassadendekoration werden kann. Und die Dörfer um Tölz und Tegernsee haben die Rokokokunstübung heute noch nicht vergessen und verzieren Bauernhäuser an der Front, um die Fenster bis zum Giebel hinauf noch immer mit den reizendsten Rokokoornamenten.
Es ist rührend, zu sehen, wie die braven Münchner Bürger selbst ihr Rathaus in Jahre 1779 im Stile Louis seize bemalen und sich bemühen, ihren treuherzig gotisch-klotzigen Häusern neue Fassaden anzukleben, immer gehorsam der neuen Parole, welche die Fremden in ihrer Stadt ausgaben. Aber sie werden immer starrer und lässiger, immer teilnahmsloser und um die Wende des XIX. Jahrhunderts erstirbt das letzte selbständige Leben des alten »Schottermünchen«. Von da ab gibt es gar nichts »Münchnerisches« mehr, der Fremdenverkehr hat vollkommen und endgültig die Herrschaft – bis heute.
Jener Fremdenverkehr, der mit der Verbesserung der Post in München immer entlegenere Stile heimisch machte. In diesem Sinne ist es höchst lehrreich, zu sehen, wie das Thurn und Taxissche Relaissystem für München größere Änderungen nach sich zieht, als jedes noch so große, geschichtliche Ereignis. Einen verlorenen Krieg verschmerzt diese Stadt rascher, als eine Störung des Weltverkehrs. Um 1777 erfaßte dieser England. Mit dem Ausgang des Ancien régimes regierte in der Pariser Gesellschaft eine wahre Anglomanie. Natürlich tanzt, baut und kleidet sich daher München englisch.
Das Datum ist deshalb bestimmt, weil damals der Anglomane Karl Theodor zur Regierung gelangte; von und zu seinem Hof reisten die Postkutschen nach Calais und Boulogne, um die Überfahrt nach London zu suchen. Benjamin Thomson, späterer Graf Rumford, saß in einer, auch eines der vielen »landfremden Elemente«, denen München das verdankt, was es ist. Der Gartenarchitekt Sckell, die Ingenieure Baader und Reichenbach u. a. saßen in anderen, und nun zog München englischen, d. h. jenen Stil an, der damals in London Mode war. Es wurde nüchtern, steif, natürlich, klassizistisch, exotisch, blickte auf die ganze Welt und hatte doch keine Ideen. Ins Architektonisch-organisatorische übersetzt, heißt das für München Englischer Garten vulgo die Urbarmachung einer Sumpfau, des alten Hirschangers, im Stile der Gärten von Kew, die da mit so feinem Geschmack imitiert sind, daß sie das Vorbild übertrafen. Darin steht der steifbeinige Rumfordsaal (jetzt zur Polizeiwache degradiert) und der Chinesische Turm (Abb. 108), ebenfalls eine haarsträubende Sünde an jeder Organik der Münchner Natur, aber eine Kopie der Pagode des Chambres von Kew. Weil England Aspirationen auf China hatte, trinken die Münchner seit fast 150 Jahren ihr Bier im Schatten einer Pagode – dieser Witz der Kulturgeschichte beleuchtet greller, denn jede Abhandlung es kann, die glücklich-unglückliche Situation dieser Stadt.

Abb. 108. Der »Chinesische Turm« im Englischen Garten zu München, eine sinnlose Nachahmung des für ein Welthandelsvolk verständlichen »Kew-Garden-Stiles« der Engländer vom Anfang des 19. Jahrhunderts. [Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Zum klassizistischen Maskenkostüm der Stadt gehören die gewesene Angerfrohnveste, die noch stehenden Ungetüme von Kasernen (Türkenkaserne, Schwere Reiterkaserne in der Zweibrückenstraße), der Marstall hinter der Residenz, das ehemalige kleine Volkstheater der Isarvorstadt (heute Volksbibliothek), das Portal des alten Botanischen Gartens und das einzig hübsche von allen: das Königinpalais am Eingang des Englischen Gartens (einst Palais Salabert).
Sie alle stehen etwas unbeholfen, ganz leicht vermünchnert, also vergröbert, in einer pedantischen Formengebung da, die eigentlich die Sprache Palladios ist, dann aber anglisiert, das heißt vernüchtert wurde und nun noch einmal durch Europa wanderte. Überall würde man verwundert auf sie sehen, in München erscheinen sie selbstverständlich.
Die Bürger sahen sie entstehen, aber ahmten sie nicht mehr nach. Wenn sie bauten, setzten sie einfach das fort, was die Väter taten. Nur der Graf Törring-Jettenbach läßt sich in diesem Stil ein Palais beim Karolinenplatz errichten und in der Prannerstraße versucht ein Bürgerhaus, den »neuen Geist« zu atmen. Sonst ist der Rest Stillschweigen; die Münchner Bürgerarchitektur ist seitdem die ödeste, vollkommen formlose Nutzbauerei (vgl. Abb. 104), um Wohnungen vermieten zu können; der Prozeß, den wir hier schon so lange verfolgen, ist beendet.
Nur der Fremdenverkehr zieht immer weitere Kreise und die führenden Geister entfernen sich immer mehr von der auf der Bierbank hockenden Bürgerschaft. Seitdem datiert die unheilvolle, die Katastrophe von 1919 erklärende Diskrepanz zwischen der Bevölkerung und Intelligenz dieser Stadt.
Die führenden Geister können machen, was sie wollen – der »kleine Privatier« will »seine Ruhe haben«.
Und die »Führenden« begannen seit Ludwig I. einen Karneval der Lebensformen, Stile und Künste, wie ihn keine Stadt noch je erlebt hat – und keine je das Recht und die Pflicht hat, ihn zu erleben – nur München.
Halb Europa modelliert jetzt an dem Gesicht dieser Stadt, und seitdem es Eisenbahnen und Weltverkehr gibt, der ganze Erdteil. Es wäre nur die logische Fortsetzung dieser Linie, wenn in der Ära der Luftpost New York–Paris–München–Indien–Japan in Neu-Schwabing birmanische Villen und amerikanische Wolkenkratzer errichtet werden.

Abb. 109. Blick in die Ludwigstraße zu München mit den Baudenkmälern der Ludwigianischen Ära: der St. Ludwigskirche, der Staatsbibliothek (im Stile des Palazzo Pitti), dazu im Hintergrund die Feldherrnhalle, welche die Loggia dei Lanzi zu Florenz kopiert. Beispiel eines architektonischen Mimetismus: Der romantisch-frömmelnde Geschmack des Auftraggebers wiederholt die streng einfachen Formen florentinischer Rustica- und Marmorbauten, in denen der Geist der Geschlechterkämpfe und der Stadt des Savonarola Ausdruck fand. Vgl. aber dazu das auf S. 324 Gesagte.
[Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Ludwig I. blies mit seinen Architekten Klenze und Gärtner die fügsame Stadt auf und stellte in die Wiesen ringsum Tempel, Denkmäler, Palazzi aus dem Erinnerungsbuch seiner Reisen. Er machte aus ihr das Tagebuch seines ästhetischen Lebens und prophezeit ihr, daß keiner Deutschland gesehen habe, der sie nicht sah. Und sie schiebt wirklich erschreckende Zinsbauten als verbindenden Kitt zwischen Pinakotheken und Ludwigsstraße, Glyptothek (Abb. 112) und Bavaria und wird zum Bilderbuch der ganzen Baugeschichte vom Obelisken von Heliopolis, dem Konstantinbogen zu Rom, dem Stadttor zu Athen bis zur Loggia dei Lanzi von Florenz (Abb. 109), nachdem sie bisher schon Versailles, Rom, Kew und London, Augsburg und auch – München gewesen – und eigentlich nichts ist, als der notwendige Ruhepunkt auf einer großen Reise.

Abb. 110. Moderner Warenhausstil. Blick in die Neuhauserstraße mit dem im Hanseatenstil errichteten Kaufhaus Oberpollinger, ein Beweis, welchen architektonischen »Fremdenverkehrsstiles« die Stadt fähig ist. [Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Ludwig I. redet dieser Stadt ein, sie sei Kunststadt, weil er Kunst liebte, und sie ein Museum geworden war. Und wieder einmal beginnt eine Einwanderung von Nord und Nordost, diesmal die der Dichter und Maler und Bildhauer, angezogen von königlichen Aufträgen, Pensionen und Sammlungen und dabehalten von einer billigen, ruhigen, behaglichen Stadt und einer stillen und ernsten Natur und sehr bald von dem – Kunstmarkt, der überall dort entsteht, wo die vielen Reisenden zusammenkommen ... Vergeblich sucht man in der Gesetzmäßigkeit dieser Stadt nach einer anderen Notwendigkeit, die sie zur Kunststadt macht, als diesem Fremdenmarkt, der immer genügen wird, um eine gewisse Art von Kunst, namentlich Kunstgewerbe, am Leben zu erhalten, und der jenen immer Sorge bereiten wird, deren Beruf oder Ehrgeiz es ist, den Ruf Münchens als die herrschende Kunststadt Deutschlands aufrecht zu erhalten und die dabei nur einen, allerdings nicht gering zu schätzenden Bundesgenossen haben: die tausend Anregungen und Reibungen, welche eine solche Buntheit und Vielheit nicht zueinander gehörigen Lebens mit sich bringt.

Abb. 111. Haus in der Liebigstraße als Beispiel der neuen »Münchner Renaissance«, in welcher zahlreiche städtische und Privatgebäude errichtet sind, welche aber nur süddeutsch-historische (namentlich Augsburger, vgl. Bild 98) Bauelemente eklektisch vereinigt, ohne der spezifischen Münchner Kulturtradition Rechnung zu tragen. [Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.]
Zu der klassischen Schwärmerei gesellt sich ein Umschlagen der Stimmungen ins Romantische, dann plötzlich eine »Neugotik«, immer noch etwas englisch, etwas italienisch angehaucht, bald als mit dem Tudorstil kokettierendes Wittelsbacher Palais, oder die an Florentiner Vorbilder erinnernde Bibliothek und Ludwigskirche (Abb. 109), oder die römische Basilika, zuletzt eine ganze Straße des »Ludwigismus« oder der Romreisen, immer aber fremd und gewaltsam auf eine Stadt aufgepfropft, die dadurch nicht befruchtet wurde.
Aber bestand denn nach allem, was erfolgt war, eine andere Möglichkeit, als dieses »Rendezvous der Stile«? Harte Worte über diese Sünden gegen jede Organik sagte schon vor langem ein Engländer (Fergusson) über dieses »klassische« München: »Die leitende Regel der Münchner Bauschule scheint die gewesen zu sein, so gewissenhaft als möglich jedes große, bewundernswerte Gebäude nachzuahmen, einerlei, welchem Lande oder welcher Geschichtsperiode es angehörte und ohne seiner Bestimmung oder dem Platze, den es in der neuen Hauptstadt einnehmen sollte, Rechnung zu tragen. Der König befahl seinen Architekten, die Monumente nachzubilden, die er im Auslande bewundert hatte. Daher kommt es, daß aus München nicht viel mehr geworden ist, als ein schlecht geordnetes Museum magerer Probestückchen von fremden, oft in verkleinertem Maße erzeugten Bauten. Diese ... sind neunmal unter zehnmal zu anderem Gebrauche bestimmt und aus anderem Materiale hergestellt, als die Originale. Wenn dagegen der König bei seinen Architekten darauf gedrungen hätte, nicht nachzubilden, sondern Bauten zu erzeugen, die ihrer Bestimmung und dem deutschen Klima entsprochen hätten, so wäre er vielleicht der Gründer einer Schule geworden, welche seinen Namen für die Nachwelt berühmt gemacht hätte.« [Vgl. A. Heilmeyer, Die Stadt München. 8 0. Leipzig. 1906.] Welcher Stil wäre an diesem Ort der fremden Ideen organischer gewesen, als der, alle Stile darin aufzunehmen? Und so gibt erst unser Gesetz die volle Objektivität, um auch dort die Notwendigkeit einzusehen, wo sich das Gefühl dagegen sträubt.
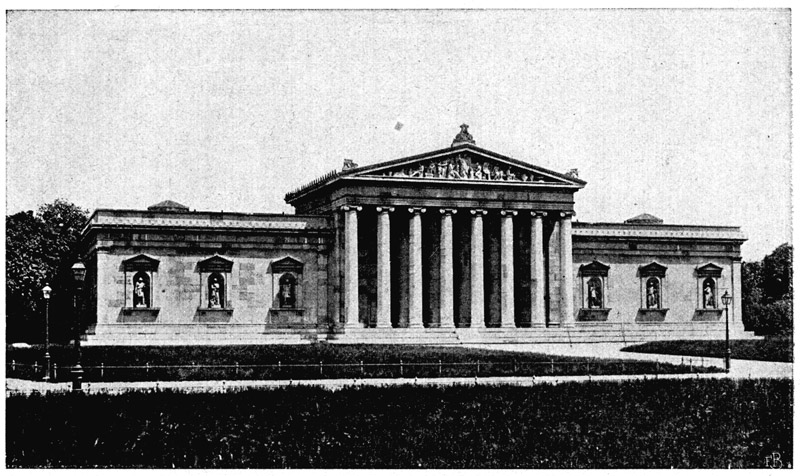
Abb. 112. Die Glyptothek zu München, ein Gebäude im »Münchner Griechenstil«, in Wirklichkeit eine Mischung griechischer und römischer Stilelemente. (Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.)
Alles, was seitdem geschah, ist nichts als die Verlängerung der gleichen Linie und eine neue Bestätigung des Gesetzes, das München zum Repräsentanten von Europa macht. Das ist nicht zuletzt der wahre Zauber, den es auf die Tausende ausübt und immer ausüben wird, mag auch geschehen was will, die von fernher kommen, um sich in seinen Mauern anzusiedeln. Man braucht sich an München nicht hinzugeben, es fordert nichts und bietet alles; man gibt nicht einmal den Zusammenhang mit seiner Heimat ganz auf, mag sie nun in Berlin oder Wien, in Tirol oder Italien, in Amerika oder – Galizien sein. So treibt dieses Bündel von ineinandergeschachtelten Städten mit Notwendigkeit durch jedes Erlebnis und jede Krise von Europa und speichert in sich Repräsentanten von allem, was die Kultur hervorgebracht hat.
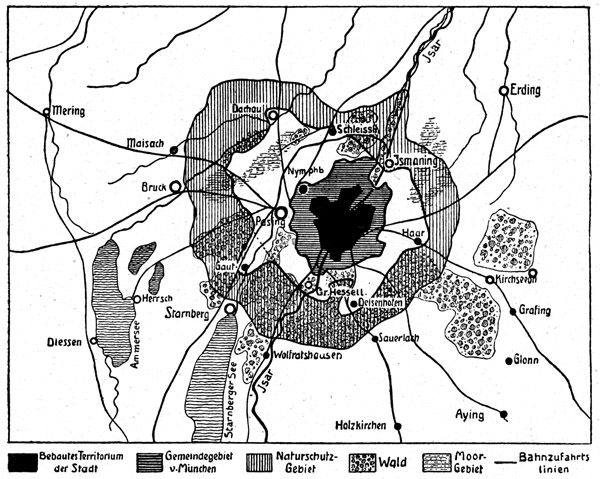
Abb. 113. Entwurf für einen Münchner Naturschutzgürtel, wie er heute immer noch geschaffen werden könnte. Die schraffierte Zone umfaßt die großen, heute fast ungenutzten Forste (Perlacher, Grünwalder, Forstenrieder Park), die Wälder im Isartal, die seitdem schon teilweise Naturschutzgebiet sind, einen Teil des Dachauer Moores, die tertiären Hügel bei Dachau, das Schleißheimer und Erdinger Moor, die Garchinger Heide (bereits Schutzgebiet) und die Isarauen. Sie ließe der Stadt etwa zehnfachen Erweiterungsraum, also Platz für eine Dreimillionenstadt und würde für den Münchner Fremdenverkehr, das einzige natürliche Kapital der Stadt, eine unvergleichliche Anziehungskraft ausüben. Nach Francé, L. d. Waldes. 1909.
Wenn man geistreicher Weise einmal gesagt hat: Der Freischütz – von Weber – das ist Deutschland, so kann man mit noch mehr Recht sagen, – München sei eigentlich die einzige und wahre Weltstadt.
Keine Entgleisung war es daher, als es Ludwigs Nachfolger beikam, einen besonderen Mischstil (den berüchtigt gewordenen Stil der Maximilianstraße) erfinden zu lassen. Jenes Preisausschreiben für einen »einheitlichen, zeitgemäßen Baustil« entsprang einer tiefen und richtigen Sehnsucht, wie denn immer und überall das Gefühl dem Wissen voranleuchtet und schon oft, allerdings mit falschen Mitteln, den Weg vorbereitet, den später die Erkenntnis beschreiten muß.

Abb. 114. Buntbemaltes Haus im »Jugend-Stil« in Schwabing (Ainmillerstraße), ein Beleg des Stilkarnevals der neueren Zinsbautenarchitektur. Original.
Man hat sich nur in der Ausführung vergriffen, aber etwas ganz Notwendiges gewollt, als man in jenen Jahren nach 1849 den Gedanken einer » Organischen Bauweise« faßte, und darunter verstand, das Wesen eines Gebäudes in seiner Erscheinung zum Ausdruck zu bringen. Gerade das ist einer der Hauptgedanken der Philosophie, die aus unserem Gesetz von der Einheit der Natur und Kultur folgt, daß jede Erscheinung nur die »technische Form« einer Funktion sein könne, und darum verweilt unser Blick zum erstenmal seit den Zeiten des »Schottermünchen« mit wirklicher Befriedigung auf den schlichten und echten Werken, welche diese Formensprache ihrer inneren Notwendigkeit reden. Ihre Ahnen sind die prachtvolle Gitterbrücke über die Isar nach Paulischem System, bei Großhesselohe, die schon in der Maximilianszeit unter allgemeiner Verlästerung der Zeitgenossen entstand, auch der in seiner ungeschminkten Nüchternheit als Ingenieurbau noch besser befriedigende Glaspalast von 1854 Man darf ihn allerdings nicht als Bilderausstellung verwenden, sondern nur in seinem ursprünglichen Sinn. Vgl. dazu die absolute Sinnlosigkeit, die dem Maximilianeum sein erschrecklich leeres Gepräge gibt. [Ludwig I. nannte es, mit ihm unbewußter, tieferer Ironie einst die »Wäscheaufhänge«.] als das Maximilianeum, das eine durch und durch architektonisch verlogene Straße, die »Mietshäuser als Scheinpaläste dekoriert«, abschließt, und dessen Schönstes die – Abendsonne ist, die seine Vergoldungen manchmal in Flammen setzt. Ihre letzten und befreiendsten Werke aber sind gewisse, rein organische Bauten der Neuzeit Münchens, die ganz ehrlich nur das sein wollen, was ihre Funktion ist, die neue Anatomie (Abb. 116) an der Pettenkoferstraße, 1905/07 durch Max Littmann erbaut, oder die, ohne ihre Schuld keine Funktionen ausübende Großmarkthalle (1910/11) von Schachner, oder der ganz aus Münchner Natur hervorgegangene, von H. Grässel geschaffene Waldfriedhof (von 1905/07), der ein echtes Erzeugnis der Gesetze ist, nach denen München leben muß (Abb. S. 118).

Abb. 115. Trinksaal in der Löwenbrauerei zu München, eine der großen »Fremdenempfangsstätten« der Stadt, in dessen Architektur und Dekoration sich die völlige »Internationalität« der Fremdenstadt spiegelt. Es sind hier gotische Zimmerdecken, Renaissancesäulen, Leuchter im Stil des modernen Kunstgewerbes, Bauerntische und Stühle, und Barockarchitektur zum Empfang – moderner Menschen bestimmt. (Aus »München und seine Bauten«, F. Bruckmann A.-G.)
Was aber fern von dieser organischen Baugesinnung (die schon in den fünfziger Jahren an einen damals leicht zu verwirklichenden »Naturgürtel« um München Vgl. dazu meine Vorschläge von 1908 in: R. Francé, Bilder aus dem Leben des deutschen Waldes. Stuttgart. 8 0. 15. Aufl. dachte!) (vgl. Abb. 113), zwischen 1851 und heute in München geschaffen wurde, erscheint ebenso planlos und durch zu große Anhäufung quälend, wie das Getriebe und die Menge von Fremden, die ein Ferientag der Hochsommerzeit in den Riesenhallen seines Hauptbahnhofes ausspeit. Emerson sagte einmal in seiner drastisch anschaulichen Weise von solchen Städten, sie seien wie die Vorstellung von Käse oder Ameisen. Je mehr davon, desto unsympathischer. Und doch steckt wieder auch in dieser scheinbaren Unorganik zu tiefinnerst eine Notwendigkeit, welche die Stillosigkeit für den Wissenden zur Befriedigung wandelt.
Wenn Gabriel von Seidl in »München und seine Bauten« sagt, es habe hier nie einen wohlbedachten Bebauungsplan gegeben, so ist das für die Stadt, deren Lebensgesetz auch einen »Fremdenverkehr der Stile« mit sich brachte, nur organisch, wenn an hundert Stellen versucht wurde, eine »zeitgemäße Münchner Renaissance« zu schaffen (namentlich von G. von Seidel, Dazu gehören die neuen Gaststätten: Hofbräu, Augustiner Bauerngirgl, der Gebäudekomplex am Karlstor, das neue Nationalmuseum, die St. Annakirche im Lehel, hierher auch die vielen neuen Schulbauten, das Verkehrsministerium und die so ermüdenden, prächtigen Straßen Schwabings (Elisabethstraße, Franz-Josefstraße, Tengstraße, Hiltenspergerstraße). (Vgl. Abb. 111) so wurde damit doch kein neues München gemacht. Dieses neue München, das ewigjunge und ewigalte, steht längst fertig da in seinem »Fasching der internationalen Häuser«, der sich namentlich in Schwabing, der Fremdenstadt, austobt. Nur dort sind Häuser im naiven Jugendstil (Abb. S. 114) möglich, sogar organisch, neben der reizenden italienischen Idylle der Ursulakirche, die wirklich die Legenden von den Kirchen versetzenden italienischen Engeln zu verwirklichen scheint. Seitdem das »Reich« von 1871 das deutsche Geschäftsleben zu einer Einheit zusammenschloß, hat München auch etwa 30 Geschäftshäuser großen Stils, und wieder ist es einfach eine Lebensnotwendigkeit, daß eines davon italienische Hochrenaissance atmen muß (Bernheimer Haus), das andere eine vermünchnerte Hanseatengotik (Oberpollinger Kaufhaus) (Abb. 110), während die meisten Münchner Renaissance- oder Alttiroler- und nur selten einen schlichten Geschäftshausstil wahren, wie man solche in der Liebherr-, Paul Heyse- ober Weinstraße sieht.
Zum Münchner Karneval der Bauten gehört organisch das neue Münchner Rathaus (vgl. Abb. 105), dieser abgekürzte Reiseführer durch Brüssel, Brabant, Alt-München, Wien und preußische Kasernen (-Höfe!), zu ihm das neue Justizgebäude in prachtvollster Renaissance und, gar nicht vermittelt durch Grün, durch das noch geschmackvollerweise die alten Könige ihren Königsplatz und die Pinakotheken, die Bavaria und das Siegestor, das Maximilianeum von München trennten, dicht daneben die galvanisierte Leiche eines »Altmünchner« Stildenkmals (vgl. Abb. 101) das neueste Justizgebäude, das gleichzeitig fünfzehntes und zwanzigstes Jahrhundert sein will, und zur unmittelbaren Nachbarschaft den reinen Ingenieurbau von Voit und Werder, die Hochrenaissance von Thiersch, die öden Mietskasernen, die »Münchner Renaissance« des Hauptbahnhofes, den Warenhausstil des Kaufhauses Tietz und die Palladiokopie von d'Herigoyen im alten, botanischen Garten hat. (Es reden hier also für den Feinhörigen gleichzeitig die Menschen von 1450, 1812, 1854, 1880, 1897 und 1900 durcheinander. Und nur, weil durch diese Bauten eine Menge flutet, die sich aus ganz Deutschland, ganz Österreich und halb Europa, von Rußland bis England, von Italien bis Schweden zusammensetzt, fließt das doch alles zusammen in ein gemeinsames Lächeln der Bewunderung, des Behagens und einer leisen Ironie, das da sagt: Trotz alledem – es ist doch köstlich und einzig – unser liebes, altes und immerjunges München. ...
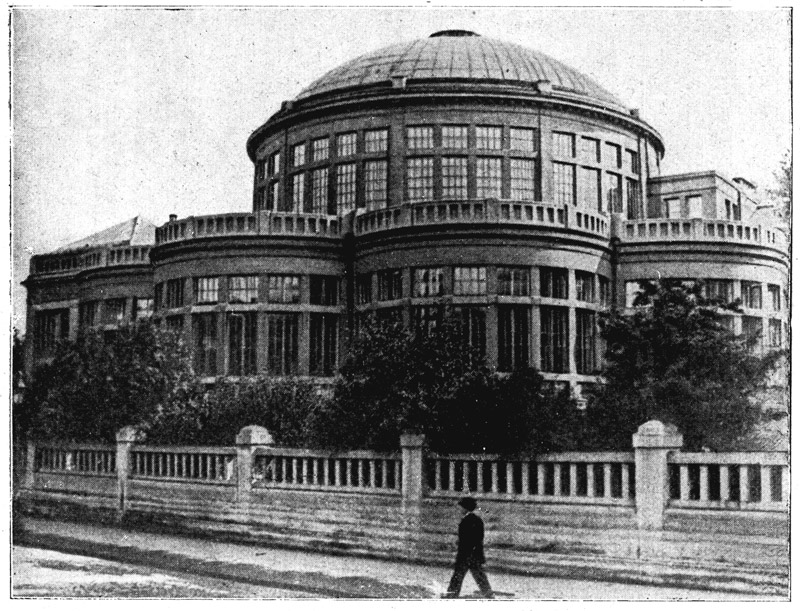
Abb. 116. Die neue Anatomie in der Pettenkoferstraße zu München, ein Muster »organischer Baukunst«, die in den Formen den inneren Zweck des Ganzen auszusprechen verstand. Das Gebäude wirkt sinnvoll und zweckgerecht, wie irgend ein medizinisches Instrument. Original von Frau Dr. A. Friedrich-München.
Die Architektur verewigte das Gesetz dieser merkwürdigen Stadt, die es auf Erden nur einmal gibt. Die fremden überwältigten sie einfach und zerbrachen das Bodenständige an ihr – und gaben ihr ihren besonderen, einzigartigen Stil, in dem sie doch wieder organisch ist. München konnte erst seit dem Weltverkehr groß sein Zur Zeit des Sandtnerschen Modells hatte es etwa 20 000 Einwohner; um 1620 (also 50 Jahre später) waren es erst 22 000 (Augsburg hatte damals etwa 60 000 Einwohner, Nürnberg an 50 000). Während dem 30 jährigen Kriege sank die Zahl bis auf 5000 (Aussterben der alten Bevölkerung) und war erst 1680 wieder auf der früheren Höhe. 1700 sind es 24 000, um 1780, also während der Einführung des Postverkehrs 37 000, um 1800 bereits 40 000. Das rapide Wachstum setzt mit dem europäischen Bahnverkehr ein: 1880 sind es schon 272 000 Einwohner (Augsburg wieder 65 000!), um 1900: 500 000, um 1905: 539 000. Unmittelbar vor dem Kriege 1914/19: 660 000. und wird mit ihm sinken und steigen. (Es hat immer den Charakter eines Tores, durch das alle Zeiten und großen Ideen schreiten und darum das Schicksal dieser Ideen und Zeiten, nicht aber das von Deutschland. Unter allen deutschen Städten wird es am ersten und raschesten die Folgen des großen Umsturzes von 1914 - 1919 überwinden und ihm wird die neue Zeit, welche so viele alte Grenzen zerschlagen hat, die Sicherung einer ungeahnten Blüte bringen. Aber niemals als dem, was sie einst war, sondern als der Stadt der fremden Einflüsse und der fremden Ideen.
Denn das Lebensgesetz dieser Stadt lautet: Keine andere Rolle im Organismus des deutschen Volkes ist ihr beschieden, als die Mittlerin zwischen allen zu sein. Nicht Handel und am allerwenigsten Industrie kann und wird ihre Zukunft bestimmen, sondern einzig allein die Fremdenstadt, die zugleich der Nährboden ist für ihre Kolonie von Künstlern und von Intellektuellen.
*
Die Kette meiner Beweise ist geschlossen, meine Rufgabe vollendet, denn die Lebensgesetze dieser Stadt sind erkannt und auf eine letzte Formel gebracht. Aber es ist viel mehr damit erreicht, als eine Stadt, und sei sie noch so hervorragend und groß, jemals bedeuten kann. Der tausendfältig verwickelte Bau ihres Organismus war für mich nur ein Gleichnis; die Jahre intensiven Mühens, in diesen Organismus einzudringen, hatten für mich leuchtendere Ziele, als er selbst bedeutet, und einen größeren Nutzen, als all der Reichtum einer Weltstadt bieten kann. Eine, die Geschichte und ihre kleinen und großen Welten und Zeiten überdauernde Idee, gültig vom ersten bis zum letzten Tag, und so groß, daß sie die fernsten Sterne in ihren Rahmen einspannt, trat mir aus dieser Arbeit strahlend vor die Seele und war der eigentliche Preis aller Mühen und Qualen, durch die man ein solches Werk schafft.

Abb. 117. Der »Alte Hof« in München, der schönste Rest des vergangenen organischen Münchens.
In tausend Gestaltungen, auf jeder Seite dieses Werkes blickt uns das dunkle, tiefe Auge dieser Idee an, die als einigendes Band von den Sternen des Weltalls zum Erdball, von seiner Geschichte zu dem Fleck Erde leitete, dessen Gesetz wir so beharrlich erkennen wollten, und die nun in buntem Reigen die geologischen Gesetze als Vorbedingungen des Biologischen erkennen ließ, im Bios aber immer wieder den gleichen Zusammenhang, vom Kleinlebewesen des Erdbodens zu Pflanze und Tier, zum Menschen der Urzeit, zum Menschen der Gegenwart, zu den Menschenwerken selbst und mit ihnen hinauf wieder zu den allumfassenden Ideen. Schimmernd, wie ein Stern über den nächtigen Abgründen des Erkennens leitete dieser Gedanke von Erkenntnis zu Erkenntnis bis zur letzten Klarheit über einen einheitlichen Bau der Welt, die Natur und Kultur unter den gleichen Zusammenhang spannt.
Zum erstenmal, seitdem besinnliche Forschung den Dingen des Menschen- und des Naturlebens nachgeht, ist diese Identität der Natur- und Kulturgesetze erwiesen und damit ist, wie mir wohl bewußt, ein Trennungsstrich zwischen allem Wissen vergangener Zeit und einem objektiven, einheitlichen Erkennen des gesamten Weltphänomens gezogen.

Abb. 118. Motiv aus dem Waldfriedhof zu München. Heimische Natur verschmilzt hier organisch mit dem Menschenwerk und die Einheit von Natur und Kultur verklärt den Ausgang alles Münchner Lebens in einer versöhnenden und das Gemüt im tiefsten aufrichtenden Schönheit.
Eine neue Kulturwissenschaft ist damit geschaffen, deren erste Leistung hiermit vorliegt.
Aber viel mehr als das: jene, in namenlosen Schmerzen von der Menschheit gesuchte Harmonie mit dem Unendlichen, um deren Schauen die Edelsten unseres Geschlechtes ihr Herzblut hingaben, endlich liegt sie in greifbarer Nähe, ja sie ist von jedem erreicht, dem die endlose Kette der hier geschmiedeten Beweise aus dem ganzen Bereich der Natur und Kultur die Überzeugung beibrachte, durch sie demütig und zugleich stolz eingeordnet zu sein in den Ning des Seins, der ewig glänzt, weil er sich, geheimnisvoll warum, aber durch ein Gesetz bestimmt, auch ewig dreht. –
*