
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Et vous, dont l’étrange parure
Me retrace l’hiver même au sein de l’été,
Alpes! votre fière structure
Des dons que nous fit la nature,
Doit marquer la stabilité.
Ah! que j’aime vous voir dominer sur les nues,
Quand le soir, à regret quittant ces bords chéris,
Phébus prête au cristal de vos cimes chenues
L’éclat de l’améthyste ou les feus du rubis!
Vous n’offrez aux regards que l’image cruelle
D’un climat triste et rigoureux,
Où l’oeil se perd au loin dans les rochers affreux
Que couvre une glace éternelle.
Mais la paix pour demeure a choisi vos vallons... 1
 ie friedvoll in der Tat, aber wie hoheitsvoll zugleich, grüßen die Alpen herüber nach unserm
Eiß! Es blinken und es blitzen, von der Abendsonne entzündet, die Firnen vom Titlis bis zum Montblanc und über diesen hinaus bis zur Dent d’Oche. Und es malen, wenn an einem Wintermorgen
2
gewaltige Schneestürme über die Hochgipfel dahintoben und in der aufgehenden Sonne die treibenden Schneewolken wie gleißende Flammen züngeln und lecken, die Alpen dem gefesselten Blick einen Weltenbrand vor. Über den dunkeln Zackenrand der weißen Berge wallt rotes Feuer von Osten und erlischt am
2 Wetterhorn vor dem Glast der glühen Kugel. Ein andermal
3
umschlingt, vor Sonnenaufgang, ein feuerrotes Band am Morgenhimmel Alpen und Jura als altes Geschwisterpaar. Dann aber beleuchtet die Königin des Tages das von der machtvoll hehren Schwester und dem ruhevoll ernsten Bruder zu gemeinsamer Pflege
zwüschen ịịchḁ
4
g’noo̥ne
n Wickelkind. Wir meinen das zwischen Alpen und Jura hingebettete schweizerische Mittelland.
ie friedvoll in der Tat, aber wie hoheitsvoll zugleich, grüßen die Alpen herüber nach unserm
Eiß! Es blinken und es blitzen, von der Abendsonne entzündet, die Firnen vom Titlis bis zum Montblanc und über diesen hinaus bis zur Dent d’Oche. Und es malen, wenn an einem Wintermorgen
2
gewaltige Schneestürme über die Hochgipfel dahintoben und in der aufgehenden Sonne die treibenden Schneewolken wie gleißende Flammen züngeln und lecken, die Alpen dem gefesselten Blick einen Weltenbrand vor. Über den dunkeln Zackenrand der weißen Berge wallt rotes Feuer von Osten und erlischt am
2 Wetterhorn vor dem Glast der glühen Kugel. Ein andermal
3
umschlingt, vor Sonnenaufgang, ein feuerrotes Band am Morgenhimmel Alpen und Jura als altes Geschwisterpaar. Dann aber beleuchtet die Königin des Tages das von der machtvoll hehren Schwester und dem ruhevoll ernsten Bruder zu gemeinsamer Pflege
zwüschen ịịchḁ
4
g’noo̥ne
n Wickelkind. Wir meinen das zwischen Alpen und Jura hingebettete schweizerische Mittelland.
Überschauen wir den bernischen Ausschnitt desselben!

Blick auf Erlach und Chasseral von Vinelz
Vom Signal der Rööti, wie der Höhepunkt der Gäschlere n (s̆s̆), des Gästeler, Gästler oder Chasseral geheißen wird, späht der Blick südostwärts. Als Orientierungspunkt dient ihm, wenn der Himmel günstig gelaunt ist, der Münsterturm in Bern. Sein schimmerndes Weißgrau taucht in das Dunkelblau der Aar, die g’strackts gegen Thun hinaufweist, den Schlüssel des Oberlandes. Die verlängerte Linie führt ins Herz des Oberlandes, wo auf Grindelwalds wetterbraune, malerisch verstreute Alpenhäuser und «Schịịrleni» das helmbewehrte Haupt des Finsteraarhorns trutziglich herniederschaut.
3 Zur Linken aber, wie zur Rechten jenes Aarefadens breiten sich die zwei voralpinen Landschaftsgebilde. Aus Lützelflüh und Guggisberg kennen wir ihre wunderlich zerfurchten Bergwellen, auf deren flachen Rücken und sonnigen Gehängen die Hunderte eigenartig bernischer Mittellandhäuser mit Wohnung, Tenn und Stall mit Bühne unter einem Dach wohl abgerundete «Pụre nhööf» und kleine «Ta gw anerg’schickli» beherrschen. Die entferntesten liegen, wie im Oberland, Stunden weit ab vom stattlichen oder winzigen Pfarrdorf und dem Verwaltungssitz der einheitlichen Kirch-, Schul-, Einwohner- und Burgergemeinde. Einige solche sind chlịịni Kantönli.

Blick vom Jolimont auf Erlach und die Petersinsel
Nun verfolgen wir den Aarefaden in seiner wunderlichen Bremgartenschleife, seinem Lauf nach Westen und seiner mit der ihn bereichernden Saane gleichlaufenden Richtung. Da reißt sich plötzlich bei Aarberg der Fluß aus seinem Naturbette los, wirst sein silberig glitzerndes Band nach der Mitte des Bielersee-Ufers und endigt im blitzenden Schaumgewirr des Hagnecksturzes seinen der Natur abgetrotzten Lauf. Wir wissen: das ist Menschenwerk. Der das Seeland weit und breit verödende Drache des mäisterloosige n Wassers mußte sich la̦ n zäige n: hie dü̦ü̦rḁ gäit’s! und muß nun im 4 Sklavendienste der Blitzkraft Wärme bringen, Licht schaffen, Titanenarbeit leisten.
So seit wenigen Jahrzehnten. Aber Jahrmyriaden zuvor vollendete die Natur selber ein unvergleichlich größeres Segenswerk nach verheerenden Katastrophen. Sie ergoß mit dem Aaregletscher über das öde Schwemmgestein des Urmeeres die nährstoffreiche Bodenschicht, auf welcher nun alle die Berghöfe und Weiler, die durch Bodenbestand unterbrochenen und die stattlich geschlossenen Dörfer des bernischen Mittellandes, sowie des Frienisbergs und seiner Umgebung sich hinbreiten. 5
An Machtenfaltung und Machtbereich übertraf aber den Aar-Eisstrom bei weitem der Rhonegletscher. Jenen links und rechts begleitend oder abdrängend, modelte er das Tiefland des Oberaargaus und des Seelandes als nordbernische Seitenstücke und als südliche Fortsetzer der beiden Voralpengelände zu den ausgesprochenen Dorflandschaften.
Die westliche derselben, unser Seeland im engern Sinne, überblicken wir nun schärfer, wenn wir von des Chasserals zackigem und gewundenem Grat stufenweise absteigen nach Präge̥lz, nach dem Twannbärg, nach Schäärne̥lz oder nach der Festi über Ligerz, oder nach dem Pavillon du Genevret (juniperetum, Räckoltere n) über Neuenstadt, und schließlich nach dem Juwel der Bielerinsel.
Dieses am Sonntag von buntem Leben wimmelnde Eiland — einst eine Totenstatt wie Jahrtausende nachher der Schalte nräin mit seinen keltischen Grabhügeln — ist am Werktag der rechte Ort, um uns das erstaunlich hohe Alter westseeländischer Siedelungen zu veranschaulichen.
Wir blicken empor nach der Windsaagi über Twann, wo (nach jüngster Vermutung Sachverständiger) an dem vor rasendem Bärgluft geschützten Reginastäi n der altsteinzeitliche Jäger aus späteiszeitlichem Kalklöß sein Fụ̈ụ̈rli entzündete. Nachdem der Gletscher die Juraseen ausgehobelt, erhoben sich an ihren Ufern die kunstreich gebauten Pfahldörfer. (S. «Twann».)
Hier wie nirgends erwahrt sich die Stetigkeit der Siedelungsorte. 6 Aber wie verschiedenartig umrahmten keltorömische, spätrömische, burgundische, alamanische Ansiedlungen das linke und das rechte Bielerseegestade!

Die Müntschemiergasse von Ins
Di alt Beereschüür = die alti Post
(Nach einem Gemälde von Baumann, um 1830)
Nicht das Volkstum freilich, sondern die Natur sprach hier das erste Wort. Sie lockte aus den zerschlissenen Kreidemantel des Juragehänges 6 den Wịị nbụụr und wies ihm die zutage tretenden Kalksteine an zum Stedtli-artigen Zusammenschmiegen seiner dicht an den See hinangedrängten ein- oder zweigassigen Dörfer, Dörfchen, Weiler.
Rechts des Sees dagegen boten der leicht zugängliche, mächtige Schalte nrăin und der Tschụlimu̦ng ( Jolimont) das Holz zu den Mittellandhäusern ( S. 3) des Chüehbụụr, welchem Wein und Fisch immer kärglicher den Beutel spicken und den Tisch besetzen helfen. Der rechtsufrige Seeanwohner und der Trockenlandbesiedler unterscheiden sich immer weniger in der Hansanlage. Beide setzten auf den leichten Dachstuhl das schmal- wie breitseitig stu̦tzig Straudach, welches hu̦rti g trochnet, darum nid fụụlet, und dessen Temperaturausgleich im Winter warm gi bt un d im Summer chüehl. Nach seinem Bauplan richtet sich auch das polizeilich gebotene Ziegeldach. Nur verteilt sich dessen Last über einen viel größer gewordenen Ökonomieteil.
Denn u̦f d’Bühni, wo nicht uf de n Meerid, wandern jetzt auch des Mooses erschlossene Schätze, und ihrer wartet e n Stall voll Simme ndaalere n, deren Milch blühende Chĕsereie n auf technischer Höhe behält.
Und im Moos und uf dem «guete n Land», wie gablet und zablet das beim pflanze n und bu̦tze n (jäten), häüe n und su̦mmere n! Vierjährige bis achtzigjährige Familienglieder, die tụ̈ụ̈re n Dienste nlöhn ersparend, eilen vielleicht e n Halbstun͜d wịt von einem Acherli oder Mätteli, Riemli und Blätzli, Strumpfban͜d oder Hoose ndreeger zum andern. Ein in seiner Buntheit nirgends sonst gesehener Wechsel von Formen und Farben malt dem Auge eine Flurzerstückelung vor, welche auch nach längst erloschenem Flurzwang noch lebhaft an die Gewanne der altdeusch sippenmäßigen Dorfschaften erinnert. 7
Zu derart zersplittertem kleinbäuerlichem Besitze nah und fern dem geschlossenen Haufendorf tritt ab und zu ein Einzelhof in Gegensatz: die Berggüter des Jolimont (Erlach) und der vordern und hintern Bụdléi (Vinelz), die Talgüter der un͜dere n Bụdléi, des Ried und der Mụụrstụụde n (Ins), der Fägge n (Brüttelen), der Kanalmühli (Treiten). Ein so alter Hof wie der letztgenannte kam freilich mit der frühern Weid- und Holzgemeinde seines Dorfes in Konflikte (s. «Ackerkrume») und macht es verständlich, wie noch ältere Höfe zu eigenen G’mäinli sich anszuwachsen strebten. Der Gu̦u̦rzele n (curticellum, 7 «Höfchen») gelang dies auf die Dauer nicht; ebensowenig der alten Hüttengruppe Äntsche̥rz, welcher sogar eine eigene Kirchgenössigkeit in Gampelen eignete. Das einzig verbliebene Haus gehört nun der Anstalt Tschugg. Zu eigenen Duodezgemeindchen erwuchsen dagegen die alten Höfe Mụlle n, diese Enklave von Erlach, und Gäse̥rz, diese um zwanzig Minuten von Brüttelen entfernte Gruppe der fünf Bauerngüter. Als es deren drei weitere zählte, unterhielt es es äigets Schüeli. Nun bildet es gerne mit Brüttelen eine Wald- und Schuelg’mein, wie von jeher Mullen eine Schulgemeinde mit Tschugg.
Als eigene Dorfgemeinde war bei seiner Gründung Witzwil (s. d.) mit seinen acht Höfen (Linden-, Tannen- usw. Hof) gedacht. Nun ist es Korrektionshaus, wie d’Anstalt z’Eiß und Sant Johannse n für Zwangsarbeit eingerichtet sind. In dem einst gleich reichen und stolzen Kloster Frienisbärg nähren, wie zu Worbe n, Gemeindsverbände ihre wirtschaftlichen Invaliden. Die noch mehr bedauernswerten Fallsüchtigen aber sammelt die Berner Kirche im einstigen Her re nhụụs Tschugg, wie vorher in dem unmöglich gewordenen Her re nbaad z’Brüttele n. In diesem herbergt nun der Staat erziehungsbedürftige junge Mädchen, wie ebensolche Knaben im Schloß Erlach. Dieses stolze Schloß ist eine der vier seeländischen Burgen, welche in ihren Mauern oder deren Nähe geschichtlich bedeutungsreiche Stedtli bargen.
Ohne solchen Rückhalt ist die Hase nburg oberhalb Vinelz in die Versenkung blasser romantischer Erinnerung getaucht.
Ein so vergangenheits- und zukunftsreiches Stück Erde ist das Seeland, aus dessen unerschöpflicher Lebensfülle wir nun in zwei Bänden e n-paar-igi (einige) Einzelbilder herausarbeiten.
1
Aus dem einst berühmten Gedicht
La vue d’Anet (S. 16 der Mittelpartie der — 1756 erstmals erschienenen —
Poésie et opuscules philosophiques)
de feu M. le Prof.
Lerber, membre du Conseil souverain à Berne. MDCCXCII.
2
Wie am 8. Jan 1912.
3
Wie am 8. Febr. 1912.
4
Diese Schreibung rechtfertigen wir unter
«Dach und Fach».
5
Vgl. Dr. Hermann Walsers «Dörfer und Einzelhöfe» mit der Karte S. 39.
6
Vgl.
Hoops 1, 42.
7
Vgl.
Hoops 1, 41 ff. und bei Walser aaO. den Grundplan von Treiten (S. 12)
Seeländisches Leben im Spiegel seeländischen Sprechens. Ist nun freilich, wie man weiß, dieser Spiegel bei der heutigen Abtragungs- und Ausgleichsarbeit an den Mundarten allzumal z’Blätze nwịịs erblindet, brüchig, rissig, verzogen, so ist das nid hurti g in einem Maße der Fall wie hier. Zum intensiv gesteigerten Weltverkehr kommt das Unglück all der Brände, welche wie 1848 in Ins fast alle mundartkundlich wertvollen Dokumente vernichtet haben.
So gäben die Erinnerungen der «ältesten Leute» eines der eng umzirkelten Seelandsdörfer während der kurzen Ausholungsfrist weniger Jahre kein Buch, wo si ch der weert weer (es in die Welt zu setzen). Um so interessereicher wird das Bild sein, in welchem bodenständiges Sprachgut des gesamten Seelandes relieffähige Lebensgebiete einigermaßen 8 widerzuspiegeln vermag. Wir geben darum z. B. in Flurnamen allgemein seeländisches oder doch dem ganzen Amt Erlach eigenes Sprachgut, schreiben das Lebensbild des Generals Weber brüttelerisch und durchsetzen das Kapitel «Witzwil» mit städtisch-erlachischen und gampelerischen Sprachproben, räumen aber immerhin, wie selbstverständlich, in diesem Inser-Buch dem nach Möglichkeit rekonstruierten Eißerisch die Führerrolle ein.

Schloss Erlach
Nach Aberli, ca. 1783
Erleichtert wird uns die Arbeit, wo die dörflich gesonderte Geselligkeit des Seelandes — in welchem keineswegs der Kirchturm, sondern das neuere Schultürmchen und der alte Dorfplatz zur sprachlichen Einheit führt — «gelungene» Ausdrücke von recht lokaler Heertchu̦ft geprägt hat. Solcher Art sind z. B. die Sätze, mit welchen bereits Konfirmanden der nämlichen Kirchgemeinde enan͜dere n d’Reed verantere n, was natürlich der Liebi käi ns Ha̦a̦r schadt. Die Sprachunterschiede werden begreiflicherweise mit der größern Spärlichkeit des Verkehrs noch auffälliger.
So z. B. zwischen Aarberg und Siselen. Ihre Entfernung beträgt fünf Viertelstunden, was zu der wortwitzigen Vertröstung geführt hat: Was säist du, du häigist i n dị’m Leebe n no käi n gueti Stun͜d g’haa n? Lauf nu̦mmḁ n vo n Arbeerg uf Si̦i̦sele n (oder: vo n Biel uf Pieterle n), de nn hesch t e n gŭeti Stun͜d!
«Ga̦ n Si̦i̦sele n sị n se̥ ’gange n, gället!» wiederholt spottend der Aarberger, der, außerhalb des Gebiets der Stammsilbenlängung wohnend, gemäß der eigenen Sprache u ̦f Sịsele n geit, der die 10 inserischen Mĕrtrụ̈ụ̈be̥lli (Johannisbeeren) als Meertrụ̈̆beli pflückt usw. (Vgl. die Lyßer Proben unter «Moorkultur».)

In der Altstadt Erlach
Mit dem Aarberger aber teilt der Siseler, der bis 1803 dem Nidauer Amt als dem un͜dere n G’richt zugeteilt war, das vordere a. 1 Auch er wird also, wenn er den kleinen Wagen nicht bequemer wenden kann, d’s Wäägeli hin͜der ụmmḁ traage n. Den eine Viertelstunde entfernten Kirchgenossen aus Feisterhénne n aber, der als Obergrichtlicher von jeher zum Amt Erlach gehörte, läßt er spottend d’s Wöögeli hin͜der u̦mmḁ trooge n. Dieser a̦ ist überhaupt ländlich erlachisch, klang jedoch im alten Müntschemier so auffällig als enges o, daß der Inser spottete: Der Koori (Karl) isch i n d’Rääbe n go hocke n. D’s Moorei isch i n d’Chuchi go d’Soch moche n. Du̦ het es du̦ acht Chochcheli (Tassen) verschlooge n. Der Votter het bbouget («gebalgt», geschimpft).
Das ä in «Rääbe» hält die Mitte zwischen dem sehr offenen ä der Zürcher, der Oberhasler usw. und dem ganz engen ẹ, welches in der Galser Schẹẹri oder den Galser Schẹẹrine n («les» ciseaux) bis zum Überdruß wiederholt wird. Von diesen, ẹ in Bẹẹr (Zuchteber) unterscheidet der Inser und der Vinelzer den immerhin als e zu schreibenden, wiewohl offenern Laut in Beer (Bär), i ch weer (wäre), Beerg usw.
Waai n me̥r haai m? hää — (hein)? klingt des alten Lüscherzers Einladung zum Geleit nach Hause. Die ländlich Erlachischen außer dem alten Strich zwischen Brüttelen und Siselen sprechen äi, hüten sich aber instinktiv, auch altes î oder in in diese Strömung zu ziehen. Kein echter Inser wird sich «Äißer» statt Eißer nennen und etwa von der «Cheeseräi z’Äiß» statt von der Chĕserei z’Eiß sprechen. Äi reicht auch über den Bieler- (nicht dagegen über den Murten-) See hinüber. Desgleichen (außer in Lüscherz) au statt ou. Der Baum ist der Bạum, die Frau die Frạu; Bäume sind Bäüm. Das Heu ist dem Inser Häü, dem Vinelzer Höü, dem Lüscherzer Häi; der Reif am Faß ist dem Lüscherzer ein Räiff, dem Inser ein Räüff, der Weibel letzterm jedoch der Wäibel.
Man sagt nicht Klee, sondern Klee̥! korrigierte ein Inser, der aber erst recht auch ein Müntschemierer oder ein Gäserzer hätte sein können, als Sprachlehrer. Häit er schoo̥ n z’Moorge n g’haa n? kann der Inser fragen und vom Gampeler zur Antwort bekommen: Nääi n, Halbsti̦i̦fel. Klang dieses oo̥ in alter Sprache erst recht breit als u̦ä oder gar als ŭ̦ää, so war der spöttische Bescheid doppelt angebracht.
11 Junge Inser ersetzen diese fallende Zweigipfligkeit der oo̥, ee̥, öo̥, die man sich übrigens keineswegs etwa als durchgreifend denken darf, durch glatte Länge. Sie unterlassen ebenso, gleich den alten Insern des Oberdorfs und selbst noch Jungen in Kerzers der Riemme n z’zieh n, d. h. in angelegentlicher betonten kurzen Sätzen aus den Stimmausklang (die Kadenz) ein eigenes Schwergewicht zu legen. «Warum düngst du deine Reben, da sie doch keine Trauben mehr versprechen?» U nd de nn d’s Chrụụt? U nd d’Boo̥hnäää!
Dieses «Chrụụt» muß man sich also ebenfalls fallend zweigipflig denken, im Gegensatze zum Chrụ̆t, Zị̆t, wị̆t der glatten Rede in Ins, dem Chrụụd und dem Zụ̈tt der am altertümlichsten sprechenden Lüscherzer und Gäserzer. 2 Das energische «Nehmen» des schließenden Schlaglautes steht abermals im Zwiespalt mit dem baslerisch weichen Daag, Bụụr in Stärkewechseln wie guete n Daag, Pụụre ndochter! Reibelaute klingen auslautend ebenfalls merklich scharf; man ist beinahe versucht, wie Fueß auch Hụụß und wie döörffe n auch er daarff zu schreiben. Im Zusammenhang damit steht die Vokalkürzung vor wirklich gedoppeltem ss und ß: e n Hụ̆ffe n wị̂ße n Haaber. Daß ch die analoge Rolle spielt, liegt nahe. Ebenso die süddeutsche Aussprache des k als ggch außer in inserischen Archaismen wie: das soll der Gü̦ggel bi̦gge n (picken)! Auch die Untertanenschaft und Nachbarschaft des Basler Bistums ist hieran beteiligt. Bloß das alte Dü̦sche̥rz (s̆s̆) und Hălffe̥rmee (Alfermee), das doch seinerzeit seine Zugehörigkeit zur Kirche Sutz in der Kahnfahrt über den See betätigen mußte, spricht noch von Huṇ’gg un d Angge n.
Ein ganz besonderes Augen- oder vielmehr «Ohrenmerk» beansprucht das l. Daß statt seiner im Auslaut das ḷ auch hier eingedrungen ist, versteht sich beinahe von selbst. Doch gibt es neben dem Städter auch schlichte, alte Inser, denen Saḷz oder sogar Souz (wie z. B. in Finsterhennen), Voogeḷ u dgl. buchstäblich im Ohre n weh tuet. Sporadisch hört man dagegen im ältern Seeland für inlautendes ḷ einen ganz leisen Lippenanschlag; so gehen Safnerer nach Soḷotu̦u̦rn, und so baten um 1880 in einer zu Mullen niedergelassenen Familie Tribolet (Löffel) die Kinder um e n chḷäi n Broot. Dieses ḷ fiel auch in Tschugg derart auf, daß es auf dem Wege belustigter Nachahmung einige Zeit als «Endemie» die Sprache beherrschte. 3 Es fehlte natürlich nicht an witzigen Nachahmern dieses «Tschuggerisch» im übrigen Erlachamt, welche als Lippenprobe das Histörchen dichteten: E n Muḷḷer (aus Mullen) ist zum Müḷḷer i n d’Mühḷi gfahre n. Aber der Sack het i n ’men Eggeḷi es 12 Löcheḷi g’haa n, u nd da̦ ist e n chḷäi Wäize\n ụụsa g’rü̦ü̦deḷet. We nn mḁ n dää n g’mahḷe n hätt, es hätt Mähḷ g’gää n, mi hätt ḁ-mene n Chindḷi drụụs es Weggeli chönne n bache n. Wie dieses ḷ, ist nun auch das im Gegenteil ganz eigenartig scharf und spitz klingende l des Insers am Erlöschen. Wir deuten es erinnerungsweise mit Schreibungen wie Vööge̥lli an, was ja nicht zur Verwechslung mit dem andersartigen, breiten ll des Grindelwaldners und Oberhaslers führen darf. In seiner Intensität hat das Inser l etwas, das an die merkwürdige Mischung des l und r in Kerzers erinnern kann.
Führen wir noch an, daß der Twanner ï̦ber de n See ï̦ï̦berḁ luegt, der Gerlafinger aber und gleich ihm der alte Inser uber de n See u̦u̦berḁ (der jüngere Seeländer sagt über), so haben wir den Raum dieser Skizze erschöpft. «Twann» wird sie an gegebener Stelle detaillierter ausbauen.
1
Beschrieben in Sievers Phonetik.
2
Vgl.
Zimm. 3.
3
Gemeindeschreiber Garo in Tschugg
«Seeland» — ein allerdings recht unscharfer Begriff! Dem Namen gemäß ist es ein Gelände, das den Bielersee̥ 1 mit umfaßt, an die Nordostecke des Neue nburgersee stößt und im Süden den Mu̦u̦rte nsee̥ zum unfernen Nachbar hat. Als seine Grenzen lassen sich bestimmen: di alti Aar von Grenchen südwestwärts verfolgt bis zur Mündung der Saane n, und dieser Fluß bis Lạupe n; von hier eine westwärts an die Brue̥ije n gezogene Linie und der Lauf dieses kanalisierten Flusses; nach Norden der Karnaal der Zi̦hl und von der Bernergrenze zwischen Lan͜dero̥ n und Neue nstadt weg erst der an das Juragehänge angelehnte Seeküstenstrich bis Biel, dann der ebensolche Streif am linken Aarufer bis zur Bernergrenze zwischen Längnau und Grenchen.
Diese Grenzen schließen die Ämter Erlach, Nidau und Büre n in sich und schwanken bloß hinsichtlich des zu dem letztem mitgehörenden südöstlichen Juragehänges zwischen physikalischer und politischer Bedeutung. Ebendieses Schwanken läßt die Amtsbezirke Neue nstadt und Biel bald dem Landesteil Seeland, bald dem Landesteil Jura zuerkennen. Die Orte Neuenstadt und Schaffis ( Tschaafiz) liegen ja am Seestrich, wie der bezirksweise zugehörige Desse nbärg auf der hoch 13 darüber gebetteten Juraebene. Nicht anders verhält es sich mit Biel und Bözinge n gegenüber den Höhenorten Magglinge n und Leubringe n. Die natürliche Nordostecke des Seelandes bildet der Zusammenlauf von Aare und Emme östlich von Sóllo̥du̦u̦rn, dessen Umgebung so tief in die Seelandsversumpfung und -entsumpfung verstrickt ist.

Aus Erlach
An der alten und neuen Aare sodann liegt A arbärg als Sitz eines Amtes, dessen westlicher Teil in Land und Volk durchaus seeländisches Gepräge trägt, und dessen gesamter Bezirk wegen der politischen Zusammengehörigkeit gelegentlich ebenfalls in den Betrachtungskreis «Seeland» fällt. (Man denke z. B. an Schüpfe n als das bisherige Zentrum des seeländischen Wagner- und Schmiedemeistervereins.) Entsprechend verhält es sich bei dem Amtsbezirk Lạupe n links und rechts der Saane mit einem historisch so wichtigen Ort wie Gü̦mmene n. 2 Mit Freiburg teilt sich Bern in das ausgesprochen seeländische Gebiet von und um Cheerze̥ rz und teilte es sich bis 1802 in das physikalisch nicht minder seeländische Murte nbiet. Zu diesem gehört das rein freiburgische 14 untere Mi̦ste̥llach (Wistenlach, Vuilly), während der obere Strich am linken Murtenseeufer waadtländisch ist. An den Leiden und Freuden des Seelands beteiligte und beteiligt sich auch der waadtländische Strich der obern Broye über Wịflisburg (Avenches, Aventicum) hinaus bis Bätterlinge n (Peterlingen) oder Báijeere n (Payerne). Das nämliche gilt vom Neuenburgischen links des Zihlkanals. Der bildet nun z’dü̦r chwägg ( S. 27) die Kantonsgrenze, während über die vormalige Zihl die bernischen Gemeinden Gample n und Gals häi n überḁ g’reckt in die neuenburgischen Gemeinden Samm Pleesi (Saint Blaise), Gŭ̦rnạu (Cornaux), Gri̦ssḁch (Cressier), Spängi̦z (Epagnier), Hụ̈ụ̈sere n (Thielle), Waabere n (Wavre).
So wirft, wo der Stoff es unweigerlich mitgibt, unser Buch Streiflichter auf das im weitesten Sinne gefaßte Seeland als einheitliches Naturgebilde. Zumeist jedoch zieht es seine Kreise enger; und als mundartkundliches Werk verlegt es seinen Schwerpunkt nach demjenigen Teil des bernischen Seelandes, in welchem das Bärndütsch nach zwei Seiten hin gegen wältschi (französische) Mundarten sich in höchst interessanter Weise seiner Existenz und seiner Eigenart gewehrt hat, ohne irgendwelchem Chauvinismus zulieb gegen den Strom der Zeit schwimmen zu wollen. Dieser Teil ist das Erlḁchamt. Als südwestliche Bucht des Seelandes i n d’s Wältschlán͜d vorgeschoben, spitzt es sich gegen den Vierländerstein beim Fäälbạum (La Sauge) hin zu, an welchem der Kanton Bern, d’s Frịịbe̥rgpiet, d’s Wa adtland und d’s Neue nburgische n zusammenstoßen. Die ausgedehnteste Kirchgemeinde des Erlacheramtes aber ist Ins; dies ist bedeutend größer als Gample n mit Gals, Vinẹlz mit Lü̦̆sche̥rz (s̆s̆), Si̦i̦sele n mit Feisterhénne n und selbst als Erlḁch mit Mu̦lle n und Schu̦gg (Tschugg). Denn Ins umfaßt die Einwohnergemeinden Eiß, Möntsche nmier, Träite n, Brü̦ttele n und Geese̥ rz. Nicht die Größe ist es indes, welches uns Eiß ( Ins, Anet) als Mittelpunkt der volkskundlichsprachlichen Arbeit dieses Buches wählen ließ. Es ist vielmehr die schon aus der Inhaltsübersicht hervorgehende, erstaunliche Fülle und Mannigfaltigkeit des Stoffes, welche Ins, diese kleine Welt für sich, als den einen Vertreter des Seelandes geradezu aufdrängt. Der andere wird Twann (Band V) sein; vgl. Vorwort S. VIII.
1
Man bemerke ein für allemal unsere stillschweigende Unterscheidung zwischen allgemein seeländischer und speziell inserischer Aussprache von See und See̥, Bärg und Berg, breit und bräit usw. Vgl. übrigens das Vorstehende und das Wortregister.
2
Vgl.
Lüthi, G.
Schwankende Grenzen umschließen, wie das Seeland, auch das einen bernischen Landesteil benennende «Ämme ntaal» mit seinem Gewirre hoher und scharfer Eggen, und das im engsten Sinne so geheißene 15 Mittelland zwischen Frịịbe̥rgpiet und Emmental. Die gleichlautende Benennung für den Strich zwischen Jura und Alpen ist eine schärfere und paßt zudem weit besser als der Name «Hochebene» zu der formenreichen Oberflächengestalt, an welcher auch das Seeland teil hat. Von solchem Reichtum reden schon die bloßen Namen, deren wir hier zunächst ohne irgendwelche geographische Ordnung und unter Verzicht auf Erklärungen 1 eine Anzahl aufführen.
Leiten wir indes die trockene Aufzählung mit einer romantischen Lokalsage ein. Der Wanderer zwischen Vinelz und Lüscherz sieht rechter Hand die Hoofmḁ nsflueh trotzig stu̦tzig nach dem Bielersee fallen. Ihre Zinne erstieg in einer düstern Verzweiflungsstunde auf seinem Leibroß ein Besitzer der nahen obere n Budlei, Hofmann mit Namen, und stürzte sich mit verbundenen Augen samt dem Pferd in die schwindlige Tiefe. An Rittergestalten erinnern auch die Burgflueh und die Schloßflueh über Twann. Die letztere gewährt einen prächtigen Überblick der drei Seen und der Aare bis Solothurn. Über Twann liegt die Trömmelflueh, über Pieterlen die Chilche n- und die westlich davon sich erhebende Westerflueh. Zu Brüttelen gehört die geologisch wichtige Flueh ( S. 43) über den Flüehstụụde n, zu Gals die Flueachere n, zu Ins die San͜dflueh usw. Keltisch-romanisch entsprechen die Formen roc, rocca, roche, Roche, Rochette, 2 Rótschette n (Biel), rotzette, rotze, vielleicht auch der Rotzere nstäi n als Müntschemierer Flur. Wir lassen einige Namensanklänge folgen. Im Tal von Nugerol lag 1283 das «Lechen» Rochten; 3 und Rogget hieß einst ein Ort zwischen der Flueh bei Twann und dem Gut Engelberg. Reben von Engelberg und Rogget kamen 1235 vom Freien Ulrich von Ulsingen an das nidwaldnische Kloster Engelberg. Hinwieder schenkte 1246 oder 1247 Ritter Peter «vom Turm» (der Burg bei Landeron) 4 der Abtei Sankt Johannsen die Rebe «Roggetta vor dem Turm». 5 1267 erhielt das Johanniterhaus Münchenbuchsee die Rebe von Rochet. 6
Gääij (jäh) abfallen kann auch der Räin (Rain), 7 während viele der g’räinetige n Flurstücke wie die Räinacher, die Stellen un͜der de n Räine n, der See- (Vi.), Rịffli- (Tr.), Schụ̈ụ̈r-, Hoge n- (Lü.) und alle die Inser Band-, Häftli-, Zu̦u̦g-, Gịbe̥lli-, Falle n-, Hoh-, Sperr-, Niggiräin und der Schalte nräin ( S. 16) sich nicht steiler abdachen als manch ein ụụfgähnd Acher.
16 Der Name Schalte nrăin gilt heute für den ganzen Höhenzug zwischen Ins und Lüscherz. 8 «Rain» wird für den Blick z. B. von der Mụụrstụụde n nordwärts besonders auffällig erklärt durch die im Sommer sich bunt abhebenden Stufen, welche durch das alljährliche Pflügen der schmalen, langen Ackerstreifen ohne aa nfu̦u̦r che n herausgebildet worden sind. Die sehr stu̦tzige n oder stü̦tzige n Räine (steilen Raine, die Stü̦tz) zwischen jenen Streifen bedeuten nämlich immer noch Marchen. 9 Zugleich stellen sie augenfällig die Stufen dar, welche mehr oder weniger deutlich auch am große n (1742) und chlịịne n Schalle nbärg über Gampelen, am Ri̦mme̥rzberg (Ins), am Stịịgacher (Si.), am Acker der Stịịg ụụf (Gä.) und am Stịịger (Ga.), an den Acheren uf dem Stịịger oder den Stịịgerachere n (Erl.) zu erblicken sind. 10
Bloß an den Berghang ist auch gedacht bei den Ha̦a̦l de n, also der zu «chieren u nd helte n» (Lg.) stellbaren Halde. (Vgl. die neue Hal de nbrügg zu Bern.) Die seeländische Aussprache Hoole n verleitet Ortsfremde, an Hohlweg zu denken. Allein es «haldet»: hoolet an all diesen Stellen i n de n Hoole n und un͜der der Hoole n, an Hoole nacher und Hoole nmatte n, Hoole nreebe n, Hoole nstäi n, an den Erlach-, Pie̥ro-, Du̦u̦rni-, Heer re n-, Münchhoole n oder besser mundartlich: Möönhoole n ( S. 34). Dagegen liegen die Hohlirääbe n zu Tschugg wirklich an einem tief eingeschnittenen Hohlweg. Einen Hohle nwääg hat auch Treiten.
Eine un͜deri Site n gibt es zu Siselen und Finsterhennen.
Der Büel zu Walperswil, der nach alter Deutung auch in «Biel» (vgl. jedoch die ansprechendere Zurückführung aus den keltischen Belenus) wiederkehren soll, erinnert an den Gemeinnamen Bu̦ggel. Ein Synonym dieses buhil, Bühel, Bïel steckt im Hu̦u̦bel (Mehrzahl: Hu̦u̦ble n und Hü̦ü̦ble n): dem u̦ssere n Hubel, dem Mistelacher-, Schloß-, Fägge n-, Baali-, Dählisandhubel.
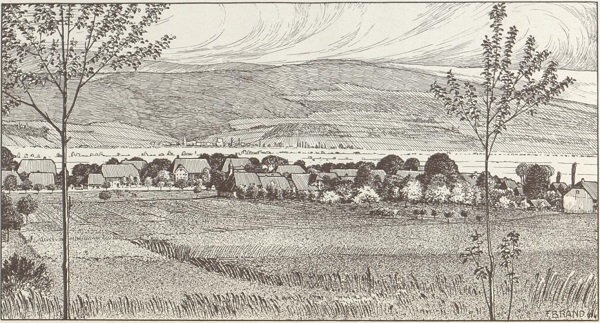
Gals mit Grissachmoos
Der Fägge nhubel und die Fägge nmatte n zu Brüttelen gehören zu dem dortigen Heimwesen die Fägge n, deren Name uns erstmals 1647 11 begegnet. Die Berner Regierung bewilligte dort 1774 einen Einschlag an Wilhelm Heinrich Löffel und 1776 einen solchen an Samuel Hauen. Bekannter 12 ist die Fägge n als Heimat des Generals Weber (s. d.). Was den Namen betrifft, so ist er vielleicht mittelst alter Lautformen wie bi̦gge n (picken), wi̦ggle n und Wi̦ggel (s. u. 18 «Dach und Fach») als verdunkelte und damit die Spielform der Fägge erklärende Mehrzahlform von Fäcke n deutbar, wozu ein Überblick der Hausstätte von der Brüttelenstraße aus nicht übel stimmt. 13 penna aus « pet-sna» ( Walde 573) und fëd-ara, Feder. Es wäre dabei all die ausgebreiteten Flügel eines Vogels gedacht, an welche der Rücken und die Abhänge einer Höhe erinnern können, ähnlich wie bei keltischem penn und lat. pinna, penna in Pennelocus. (Über diesen Namen wird anläßlich der Besprechung von «Chablais» ( Schăbli) im nächsten Kapitel zu reden sein.) An den Kamm ( Chamme n) des Hahns hinwieder: die lat. crista, frz. crête gemahnen Namen wie im Greischi (s̆s̆), die Greutsche n, schwerlich der Gräschiacher. Einen Chanzel hinwieder erblickt die Phantasie in der ersten Umbiegung der Tessenbergstraße über Twann, während das Chänzeli unfern des Brüttelenbades eine herrliche Überschau des gesamten Alpenkranzes gewährt. Ein prosaisches Gegenstück dazu bieten die eingetieften Erlacherreben i n de n Mueßhääfe n und der Faßbode n (Ga. 1811).
Eine eigenartige Namensgruppe eröffnen das Tschü̦ppeli (ein heute zwiefaches Bauerngut) bei Gaicht, der Tschü̦pplisbärg und die Tschü̦ppelirääbe n über Müntschemier. Man denkt bei ihrem Anblick an die «Kuppe» als ursprüngliche Bedeckung des «Kopfs» 14 in Form einer cuppa, coupe. Eine Kuppe im geographischen Sinn ist der Hügel, auf welchem das heute so ansehnliche Dorf Täuffele n sich hinbreitet. (Über den Namen s. «Twann».)
Die Vorstellung eines Höckers ( Hooger) scheint zu liegen in dem heute zum Abstraktum verblaßten «hoch»: höo̥ch, altinserisch hööj, und Höo̥chi, uf der Höo̥chi, Höo̥chiacher, Hŏ chliebi.
Die Begriffe «hoch» und «bergend» vereinigen sich ebenso im Berg, wie «hoch» und «nährend» in «Alp». Als solche diente einst auch der Wistenlacherberg, häufiger der Gäümḁne n. oder Gäümḁ nberg geheißen. Dieser Name erinnert ganz auffällig an den Chaumont alter Urkunden. Hin͜der dem Bärg (Si.) ist eine Partie des Burgwaldes, welcher kurzweg der Bärg heißt. Wir verzeichnen ferner die Chrääije nberg (Br. Ins, Erl., Gals, Mett) und den Bü̦tte nbärg (s. u.), den Gịịrispärg (Si.), den Rimme̥rz- (nach einem Geschlecht Rimi) und den Schalle nbärg (Ga.). Galsbärg heißt heute ein Teil und hieß früher die Gesamtheit des anderwärts und besonders in «Deutsch und Welsch» besprochenen Jolimont, alt volksmäßig: Tschụ́limung, Schụ́limung, alt Souslemont oder auch Suslemont, nun natürlich auch Schólimong. Ein Name wie Mụ́ntel 19 und Mú̦ntääni, der Mu̦ntlig und d’s Mú̦ngerụ̈ụ̈, wie Maus über Gümmenen, 15 wie Chaumont, Tschú̦mun̦g. Der auf diesem Liebling der Neuenburger 1912 errichtete Aussichtsturm mit Scheinwerferstation zieht u. a. das viel besprochene Möntschemier in seinen Bereich. Die vier ältesten Häuser dieser heute sehr ansehnlichen Ortschaft heißen zum Bärg, wie eine Flur in ihrer Nähe vor dem Bärg sich ausdehnt. Drei jener Häuser lagen schon vor Erstellung der Kerzersstraße in deren Linie. Schöne nbärg aber ist angeblich der älteste Name der ganzen Ortschaft. In dieser wohnte 1607 Hans Schönenberg (vgl. den Geschlechtsnamen Guggisberg). Im benachbarten Treiten erscheint 1753 als Burger ein Jakob Schönenberger, und ebendort taucht 1834 das Geschlecht Schöne nberger auf. Bẹllmŭnd (bei Nidau) und der Bélle̥gaarte n ( Bellegarde, Vi., Name einer Höhe mit prächtiger Aussicht) sind parallele Ortsnamen. 16 Der heutige Name Möntsche̥mier, Mü̦ntschemier aber geht durch die Formen Menschenmir (1810), Mintschemir (1718), Münschemier (1549. 1749), Münschenmeier (1644), Müntschenmeier (1605), 17 Mintschenmier (1577), Müntschimier (1563), Müntschenmier (1409), 18 Müntzimier (1396), Muntschimir (1332), Munschimier (1229), Munchimier (um 1225), Munchimir (1221), Munchimur 19 (1185) 20 auf eine Form zurück, welche durch Jahn ebenso als munitio mira gedeutet werden wollte, 21 wie die ungebräuchlich gewordene französische Form Monsmier aus mons mirus.
Unwillkürlich denkt man hier an die Pension Montmirail (oder nach häufigerer Schreibung Mon mirail, 22 mundartlich deutsch «Mu̦mme̥raal») 23 auf einer kleinen Erhöhung nächst dem Schloß Thielle auf der Neuenburgerseite bei der Zihlbrücke als der Kantonsgrenze. Denken wir zugleich an den «Spiegel» 24 (z. B. am Gurten) als einstigen Ausguck zu militärischen Zwecken, sowie den Chapf und das Chapfli( über Twann, so begreifen wir Jahns Vermutung, es möchte jener «Berg», an welchem Müntschemiers vier älteste Häuser lagen, als Beobachtungsposten gedient haben. Jahn erblickte (1850) an ihm künstliche Auftragungen, welche nun freilich durch die starke Ausbeutung des von Fluß und Gletscher aufgetürmten Kieslagers (s. u.) spurlos weggeräumt sind.
20 Bis indessen eine wissenschaftliche Erklärung felsenfest dasteht, möge man sich an dem doppelten etymologischen Späßchen erbauen, welches wenigstens dem deutschen Namen angepaßt ist. Nach einer entvölkernden Pest (oder einem Erdbeben) berieten die wenigen Überbliebenen, was nun zu tun sei. Sie gelangten jedoch zu keinem gedeihlichen Ratschluß und gingen mit der Klage auseinander: O, mier arme n Möntsche n, mier! Später flackerte aber doch etwas Lebensmut erst in diesen jungen Männern, dann in jener Mädchenseele auf; es kam zum Wettbewerb mehrerer Herren der Schöpfung um die einstweilen einzige zukunftsfrohe Spenderin einer mündlich besiegelten Zusage: Mü̦ntschi mier! Nein, Mü̦ntschi mier!
1
Vgl. dagegen
Lf. 3-33;
Gw. 3-18;
Gb. 1-6; 17-28.
2
Jacc. 388.
3
Font. 3, 350.
4
Auf den «Turm» bei Landeron weist noch heule der Flurname Mont de la Tour, sowie le ruisseau de la Tour.
5
S. «Twann».
6
Mül. 463 f. auf Grund der
Font. 2, 155. 283. 678.
7
Vgl.
schwz. Id. 6, 979 ff.
8
Der topographische Atlas nennt ihn in unrichtiger Verallgemeinerung «Großholz».
9
Vgl.
Kluge 362.
10
Vgl. Steige (1196) für Gsteig b. S.
11
Schlaffb. 1, 145.
12
Ebd. 330 f.
13
Vgl. «Fäcke» als umgestelltes mhd.
vëttech (
schwz. Id. 1, 728 f.), urverwandt mit
14
Kluge 258, 272.
15
Scheint direkt auf
mons zurückzugehen wie etwa
fonds auf
fundus; vgl. auch
chenu (
S. 1) aus
canus.
16
Vgl.
Bellaluex,
Bellalui zu
Luex =
lei (Felswand) und die Lore-lei: nach
Jacc. 29; vgl.
Kluge 284.
17
Urb. Mü. 46. Ebd. 43.
18
Ebd. 1.
19
Font. 2, 31.
20
Ebd. 1. 478.
21
Jahn KB.; vgl.
Mül. 368.
22
Dieses «Mummeral» (vgl. Rudolf im Mummerahl 1806) ist die Gründung eines
Tribolet. Sie kam als Château Tribolet an einen Tscharner und 1693 an David Lerber. dann als Montmirail an den Baron General François de Langes de Lubières. Dieser hat, wie man vermutet, den neuen Namen als Erinnerung an sein Heim in Frankreich mitgebracht. Durch die Geschwister von Wattenwyl aus Bern kam die Besitzung 1722 an die mährischen Brüder, und ein Besuch des Grafen von Zinzendorf machte sie zu herrenhutischem Eigentum. Bis zur Stunde ist Montmirail eine stark frequentierte Mädchenpension. Vgl.
Quart. 3, 232 242.
23
S. «Rüstig».
24
Aus
speculum; vgl.
speculari, ausschauen.

|
|
Studie von Anker |
Eine Vereinigung von Erhöhung und Eintiefung in der Höhle zeigt uns die im Keltischen so geheißene Balm. Die romanisierte Form Baume (anderwärts: barme) weist Ligerz auf (s. u.) i n der Boome n; Baumettes dagegen (1228: Balmettes) wurde an den deutschen Namen Fere nbálm getauscht. Deutlicher als dieses «ferne Balm» (?) drückt der ältere Name «Niederbalm» den Gegensatz zu Oberbalm bei Bern aus. 1
Mit planche als langem, schmalem Landstreifen stimmt dem Namen nach die Brütteler Flur im Blantscheli. Die 21 Bräiti bezw. Breiti und die länge n Bräite n haben ihr vergrößertes Ebenbild in der Lengnauer- und Grenchener Wịti mit dem Wịte nbärg und der Verkleinerung d’s Wịteli.
Müntschemier hat ein Blatte nree, welches wir 1703 als «im Platten Ree» gedeutet finden, 2 sowie einen Blatte nreeacher, Gals eine Flur im Blattet. Gemeindeutsches Sprachgut sind alle die Taal, Tüele n und Toole n (1688: Duhlen), Schlu̦pf, Schlund und Hell (so heißen zwei Häuser oben im Dorf Brüttelen), letzteres wortverwandt mit der Flur bi der Höhli (Br.). Eine Höhli reicht vom Treitener Rịffli bis in die dortige Boodele n. In der Mitte mannshoch und mit Nagelfluh überdacht, lockt sie von nah und fern zum dü̦ü̦r chḁschlụ̈̆ffe n Knaben an, welche von Zwäärgge n, Steufmüeterli genannt, zu erzählen wissen. Eigenartiger schon klingt der Schrachche n, in Sache und Wort an den emmentalischen «Chrache» erinnernd: die tief eingerissene, lange und schmale, wilde Schlucht. Als Schrache n wird die tiefe Rinne des Brütteler Badbaches bezeichnet. In Gampelen liegt der Fu̦ntene nschrache n. Der Mettletschrache n (Ins) hinwieder, oder kurz der Mettlet (vgl. «Wald, Wild, Weide, Wiese»), ist vor etwa neunzig Jahren durch einen furchtbaren Wolkenbruch, der Rinder und Schafe von der Waldweide herunterschwemmte, ụụsg’frässe n choo n. Lieblichere Vorstellungen erweckt der Schöne ngrabe n, der an welsche Bellevaux u. dgl. erinnert.
Wird hinwieder das stattliche neue Erlacher Heim im Base̥rt (1461: Paser) etwa als au bas vert gedeutet, so erklären sich dagegen aus einem keltischen Wort: 3 la combe und alle die Gumme n zumal am Jolimont: die Entsche̥rz- (Tsch.), Kali- (Ga.), Rueff- und Mühligumme n (Gals); bemerke ferner: d’Gu̦mmen ab (s. «Twann»), die Hee rre ngumme n, die Gummenachere n, das Gumme nfäll d, die Gumme nflueh, d’s Gu̦mmli (Vi.). Ein entsprechendes Wort ist die Schluechte n, als Einzahl verstanden. 4 Drei solche Schluechte n liegen unterhalb Gaicht übereinander. An der Hofmḁ nsflueh S. 15) liegt die Hofmḁ nsschluechte n. Von der Twannbach- und Tụụbe nlochschlucht sprechen wir S. 28.
Als ganz welscher Twanner Name erscheint uns die Chroos, alt: die Chraus, was schriftfranzösisch la creuse wäre. Es ist als eine vallis corrosa, ein ausgenagtes Tal ( corrodere: ausnagen) gedeutet worden. Die Chroos steigt westlich der Twanner Kirche (s. unsern Härdtraaget 22 im Band «Twann») steil zur Chrooshalde n an und führt in eine kleine Einöde, welche bloß noch durch das bewohnte Chroosschụ̈ụ̈rli belebt wird. Vor zwei Jahrhunderten hausten hier noch gegen acht Familien, deren Hütten aber seither verbrannten oder abgerissen wurden. 1427 finden wir das Gut Kroß verzeichnet.
Deutsch klingt hinwieder «Boden» in Ha̦a̦l de nboode n (Ga.) und, wenn es nicht mit dem Volksmund zum nahen Brüttelen -Bad in Beziehung zu bringen ist: in der Boodele n mit dem Boodele nhölzli, Boodelenacher und Boodele nmöösli (Tr.). Zwischen Deutsch und Welsch schwebt dagegen Noods, 5 Noos 6 (so schon 1225 neben Nos), 1260 Noes, patois Neu. Das Feld Z’lochusse n (1774) gemahnt an das Loch als kurzen und schmalen, aber tiefen Taleinschnitt, wie uns das Reege nloch zu erscheinen pflegt. Das des Insers ist d’s Mu̦ttislóch (nach der Ortschaft Motier im Traverstal) oder d’s Bụ̆driloch (über Boudry) oder d’s Greetisloch: das creux du van (« vent») in der vallis transversa (1214), dem Val (de) Travers, welches der Inser ebenso als Traafe̥rs benennt, wie er von den Wódrụ̈ụ̈bụụre n des Val de Ruz 7 spricht.
1
Weitere Varianten:
barma, boma, borna s. bei
Jacc. 27;
Brid. 46.
2
Handelt es sich um so etwas wie das im
schwz. Id. 5, 906 und in
Gw. 550 verhandelte «Reebrett»?
3
Gam (gebogen) romanisiert als Gambe,
jambe (Kniebug. dann Bein),
jambon usw. Vgl.
Lf. 31 f.;
Gb. 20.
4
Auch Frisch sagt 1741 «die Schluchte».
5
Jacc. 18. 21. 236. 308. 824.
6
Ebd.
7
Auch
Wooderue̥ wird gesprochen, und diese Form erscheint sogar als
d’s Booderuer umgedeutscht.
Die bisher aufgeführten Höhen- und Tiefennamen bewiesen uns die Mannigfaltigkeit der seeländischen Bodengestaltung. Nun suchen wir von dieser selbst ein einheitliches Bild zu gewinnen, um es alsdann vom Standpunkt der Erdgeschichte aus zu verstehen. 1
Wie in früherer Zeit (von 1815 bis 1846) das Erlacheramt auch den Bezirk Neuenstadt-Tessenberg mit umfaßte, also an den Chasseral reichte, so stellt sich einem Überblick etwa vom östlichen Miste̥llacherberg aus der ganze Strich über Ins, Erlach, Neuenstadt, Nods, Chasseral 23 als ein Ganzes dar. Das Blickfeld wird quer geschnitten durch Bergzüge, welche gäng ni̦i̦derer gegen den Beschauer hinrücken. Den Horizont bildet eben di Gästlere n (der Gestler, vgl. «Siedelungszeugen» im Band «Twann») oder der Chasseral mit dem zu 1609 m ansteigenden, höchsten Gipfel der Rööti. Gleichsinnig verläuft mit ihm der Spitze nbärg (1350 m) zwischen dem Plateau von Teß (800 m) und dem Ilfinger-Tälchen (700 m). Im Engpaß des Jorat, welcher sich zum Gelände von Ilfingen erweitert, tritt dem Spitzberg sehr nahe die Seekette mit den Partien des Twannbärg (874 m), Nidauerbärg, Bözingerbärg. Zwischen Twann und Tüscherz hebt sich, von der Seekette durch die Chroos ( S. 21) und die Mulde von Gäicht (Gaicht) getrennt, der Rest eines weitern Bergzuges ab: der Chapf (670 m).
Dem nunmehrigen Jurafuß parallel verläuft, seit dem Eiszeitalter durch den Neuenburger- und Bielersee, die Zihl und Aare scharf von ihm geschieden (s. u.), der stellenweise ertränkte subjurassische Zug. Als La Motte (der Hügel als «Mu̦tte n» 2 ) durchzieht er den Neuenburgersee in seiner ganzen Länge. Dann beherrscht und ziert er als der bis zu 561 m ansteigende Tschụlimung, Jolimont 3 ( S. 18) den Landstrich von Gals bis Erlach und gewährt auf der vollen Höhe des Erlḁchbänkli wie auf der halben Höhe des Fasnḁchtfụ̈ụ̈r den unbeschreiblich anmutigen Blick auf seine niedrigere Fortsetzung.
Diese teilt zunächst als etwa eine Stunde lange Landzunge, welche seit der Tieferlegung des Bielersees um 2,2 m sich in trockenen Sommern angenehm begehbar über Wasser erhebt, die obere Seehälfte der Länge nach in zwei Becken. Fleißige Ligerzer ergänzen durch den tiefgründigen und fruchtbaren Boden dieser Zunge ihr spärliches Pflanzland und risgiere n mutig die Überschwemmung ihrer strotzend grünen Chabis- und Rüebliblätze n in nassen Sommern. Noch viele 24 Strecken sind allerdings gleich den Uferrändern mit Schilf bewachsen. Aber auch die gewähren im Zeitalter der Milchindustrie als Sträüi einen sehr lohnenden Ertrag. Sie verschafften denn auch der Landzunge den Namen i n de n Röhrli, in Lüscherz: d’s Inselrohr. Seit alter Zeit heißt die Strecke auch der Heide nwääg, in Ins: der Häide n-weeg. Vormals galt dieser Name, der auch gewissen Strecken der Römerstraßen erteilt wurde (s. «Siedelungszeugen» im Band «Twann»), hauptsächlich der nordwestlichen Strandzunge der Petersinsel als dem breiten Kiesweg zu deren Ländti. 4
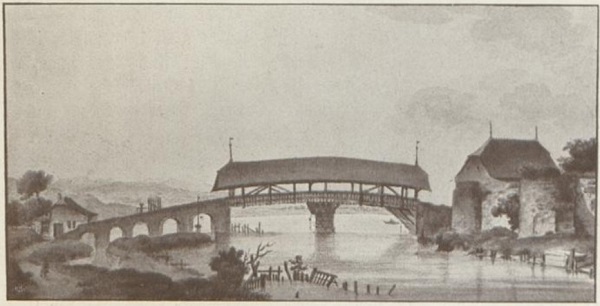
Alte Zihlbrücke und Zihlschlößli
Nach Aberli, ca. 1783
Die Peters- oder Bielerinsel, auf welche wir später ( S. 32) zurückkommen, bildet samt ihrem westlichen Vorbau der chlịịne n oder der «Chü̦neli-(Kaninchen-) Insel» einen Doppelgipfel des subjurassischen Synklinalrückens. Zu 473 m ü. M. ansteigend, erhebt sie sich also 35 m über die nunmehrige durchschnittliche Seespiegelhöhe von 438 m. Am Unterteil des Sees verdeckt und durch die Schụ̈ụ̈ß-Mündung, sowie durch den alten Zịhl-Auslauf abgetragen, setzt sich der Rücken im Chrääije nbärg zwischen Madretsch und Orpund fort und endigt im Bütte nbärg ( S. 28).
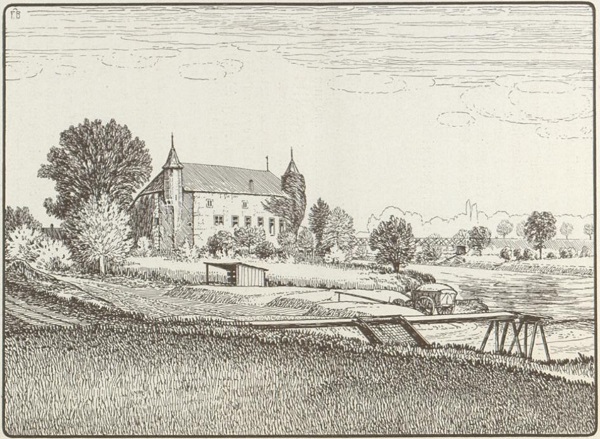
D’s Zihlschlößli, château de Thielle
Diesem subjurassischen und einst am Jolimont und Büttenberg mit dem Jura verwachsenen Zug (s. u.) folgt ein niedrigerer Hügelzug, der nördlich von Lausanne im Mont Jorat anhebt, über das Gelände um Milden ( Moudon) verläuft, im Mistelacherberg immerhin bis zu 611 m ansteigt und sich steil zum Broyekanal absenkt. Nördlich 26 desselben durch Eis und Wasser abgetragen ( S. 28) und durch das (große) Moos ersetzt, erhebt sich der Hügelzug nordöstlich von Eiß im Schalte nrăin bis zu 595 m und dacht sich gegen Lüscherz und Hagneck hin ab. Zwischen Port und Worben verläuft er im Jäißbärg und Stude nbärg, an dessen Südostfuß das römische Petinesca stand.
Ganze Wendung machend, gewahrt jetzt der Beobachter aus dem Wistenlacherberg, wie der bei Milden als schmales Broyetal beginnende und bei Peterlingen plötzlich aus 3,5 km sich ausweitende Niederungszug den Murte nsee̥ in sich faßt und über das Große Moos hin der Grenchener Wịti zustrebt. Über Murten hinausblickend, gewahrt er eine Rundbuckellandschaft, die sich jenseits gegen den Mittellauf der Saane absenkt und zu südwestlichen Fortsetzern Berge wie den Gibloux, zu nordöstlichen Fortsetzern Erhebungen wie den Frienisberg (823 m) und dem Bucheggberg hat.
1
Dies wäre uns völlig unmöglich ohne die anschaulich mündliche und die schriftliche Belehrung durch die Herren
Dr. Eduard Gerber, Seminarlehrer und Museumsabteilungsdirektor in Bern (vgl. das zu
Gb. 28-50 Gesagte) und
Dr. Fritz Antenen von Orpund, Gymnasiallehrer in Biel. In bestem Andenken stehen uns die Exkursionen über den Schaltenrain durch eine Anzahl Lehrer und Pfarrer unter Dr. Gerbers Leitung, und über den Jolimont durch den seeländischen Mittellehrerverein unter Dr. Antenens Führung, anknüpfend an dessen uns im Manuskript zugestelllen Vortrag. Von Dr. Gerber kam uns soeben zu: Jensberg und Brüttelen. Zwei Ausgangspunkte für die Molasse-Stratigraphie des bernischen Mittellandes.
Eclogae geologicae Helvetiae Vol. XII, No 4 (Avril 1913). Die lithographischen Kärtchen dieser Arbeit bringen wir auch hier beigeheftet. An Literatur sei ferner genannt: Dr. Berthold Aeberhardt († 24. Sept. 1912):
Les Gorges de la Suze, (Bienne, 1907) und
Notes sur le quarternaire du Seeland (Genève, 1903.) — Dr. F.
Antenen: Alluvialbildungen am untern Ende des Bielersees (
Ecl. geol. Helv., Jan. 1905). — Dr. Ernst
Baumberger: Die Felsenheide am Bielersee (Basel. 1904) und Über geol. Verh. am linken Ufer des Bielersees (Bern, 1895) =
Baumb. lB. — E.
Baumberger et. H,
Moulin:
La série néocomienne à Valangin (Neuchâtel, 1899) — Dr. Fritz
Nußbaum: Das Endmoränengebiet des Rhonegletschers von Wangen (Bern, 1911) und die Landschaften des bern. Mittellandes (Bern. 1912) =
Nußb. M. —
Probst, die Felsenheide von Pieterlen (Solothurn, 1911). L.
Rollier et E.
Juillerat,
Sur une nouvelle poche sidérolithique à fossiles albiens (Genève, 1902). L.
Schardt und E.
Baumberger: Über die Entstehung der Hauterivientaschen im untern Valangien zwischen Ligerz und Biel (
Ecl. geol. Helv., Aug. 1897). Prof. Dr. Th.
Studer: s. u.
2
Jacc. 299.
3
Um 1605 (
EB. A 327) als
Souslemont gedeutet und ebenso oft: z. B. 1685 und 1718 als Suslemont, 1594: der Berg Sus le mont, 1684: zu oberst am Sulemont.
4
Karl
Irlet
Diese ziemlich parallel sich aneinander legenden Hochlandszonen und Tieflandsgürtel 1 werden in ihrem südwestlich-nordöstlichen Verlaufe von Flüssen durchquert, die dem großen natürlichen und nun auch künstlichen Entwässerungskanal des Seelands zueilen: der Zi̦hl und Aar mit ihren Ausweitungen des Neuenburger- und Bielersees. In diesen drängt sich die Wasserlinie dicht an den Steilabfall des Jura hinan und zwingt ịị ng’chlömmti Weinbaudörfer wie Ligerz und Twann, welche jede Fußbreite des kostbaren Jurakreidemantels (s. u.) z’Reebe n aa ng’setzt häi n, ihre hohen und schmalen Burgunderhụ̈ụ̈ser zu volksmäßig so geheißenen Stedtli in je zwei schmalen Parallelgassen aneinander zu schmiegen.
Bis höchstens zwei Stunden vom Jurafuß entfernen sich Zihl und Aare und der Aare-Zihl-Kanal (s. das Entsumpfungskapitel). Erwähnen wir von ihren Zuflüssen rasch die in Sache oder Name belangreichsten. Zunächst die Orbe (1467: der Orbach). 2 Diese heißt 3 von Chavornay weg la Toile oder la Thielle alt: Tela (12. Jhd.), Teyla (1265), Tayle (1300), oder Tielfluß nebst dem alten Tielgraben (1718.) Vom Ausfluß aus dem Neuenburgersee bis zur Mündung in den Bielersee, früher in die Aare bei Meyenried, hieß der alte Fluß noch 1668 auch Toile 4 und heißt der kanalisierte Fluß Thièle oder Zịhl (1212 Cilae, 1718: Tielfluß oder Tielgraben.) Dem Flußnamen, 5 der sich in und außer der Schweiz vielfach wiederholt, 6 entsprechen 27 Ortsnamen wie Tela (1212), Tele (1311), sowie die Namen Johann, abbas de Tela (1153), 7 Cono de Meriaco, monacos, (Mönch) de Tela (1212), Blaise de Thyelle (1518) 8 Claude von der Zihl (1555) 9 pré apud Telam (1222). Seit 18. Oktober 1895 bildet der Zi̦hlkanal die bernisch-neuenburgische Kantonsgrenze. 10
In der Nähe von Châtel St. Denis entspringt die Broye, Brue̥ije̥, sie durchfließt das Broyemoos und den Murtensee und mündet gegenüber Samm Pleesi ( St-Blaise) in den Neuenburgersee. Besonders die alte Form Brogia 11 (schon im achten Jahrhundert Broia) neben der neuern Brolius 12 (1816) scheint sich mit dem ganz andern Wort bruoch, gebruoch, bruochiach zum Sinn von Moorboden 13 zu vereinigen. An der Bruch, heißt es denn auch 1491, 14 sowie am See soll je ein Marchstein stehen, um ferneren Weidestreit zwischen den Neuenburgischen und Erlachischen zu verhüten. Der Name wiederholt sich 1591 als die Bruch, 15 1649 als der Bruch, 16 1798 17 lautet er die Brüsch. 18
Dagegen bedeutet der Name der ebenfalls dem Murtensee zustrebenden kleinen Glane gleich all den andern Glâne gemäß gallischem glan 19 svw. «Lauterbach», wie Clar-ivue und Cla-ruz, wie Ballaigue (Schönbach, «Schambach») u. a.
Bachtobel, Waldbach, Schlucht bedeutet der keltische Name des Nant, welcher, am gleich geheißenen Wistenlacherdorf vorüber, dem Murtensee zueilt. Nant heißen denn auch zahlreiche Bäche in der Gegend von St. Maurice und in Savoyen, der einstigen «Nantuaten»; bei Viège liegt das Nanztal.
Als «Tränkebach» gedeutet, geht der Bibere nbach in den untern östlichen Teil des Murtensees. Als (Vieh-) Tränki (und als Badeort) wird von Ortskundigen eine Stelle am Oberlauf der Biberen namhaft gemacht, wo diese in den um 1646 erstellten Kanal (s. «Entsumpfung») geleitet war und unterhalb der Kanalmühli, bei Treiten, eine zweite Mühle in Betrieb stand (s. «Mehl» 20 ).
An die Stelle im Ru̦u̦sel (s. u.) erinnert mit dem Namen ein Bach, der dem «Runsholz» oder Rụ̈ụ̈sche̥lz entstammt, aus Ins und Gampelen durch das Moos in die Broye fließt und den Rụ̈ụ̈sche̥lzberg und -bode n durcheilt. Ihm benachbart sind der Mühlli- oder Rötschbach, der Greischi- (s̆s̆ S. 18), Brannte n-, Brüel-, Ri̦mme̥rzbach. Auch die Bachtḁle n sei erwähnt.
28 Durch die vallem Susingum 21 (610) oder das St. Immertal mit seiner so gleichmäßigen Senkung bis zum gääije n Chehr nach der Taubenlochschlucht fließt die (scheußlich als «Scheuß» verschriftdeutschte) Schụ̈ụ̈ß, la Suze 22
Nicht mehr so sanft ist ihr Lauf, wo sie nach der jähen Umbiegung bei Reuchenette ( Rü̦̆tsche̥nett) die Weißensteinkette und die Seekette durchbricht, um, bei Bözingen ebenso plötzlich westwärts gewandt, als Mádrätschschụ̈ụ̈ß bei Nidau und als Bielerschụ̈ụ̈ß bei Biel sich in den See zu ergießen. Der zwischen Bözingen und Mett an der Schüüß gelegene Wiesengrund wird der Heidochs oder Eidochs genannt. Der Name erinnert an die Form des Flußbettes. Wie eine Eidechse aus ihrer Höhle, so schlüpft heute die Schüß, in schönem Bogen nach Westen umbiegend, aus der Taubenlochschlucht heraus.
Vor der Eiszeit erstreckte sich dieser Felsdurchbruch über Bözingen hinaus bis gegen Orpund, weil auch der mit dem Jura zusammenhängende Westflügel des Bü̦ntte nbärg ( S. 24) zu durchbrechen und abzutragen war. Denn die Schüß nagte zuerst die Molasseschichten ihres Bettes aus, um dann auch die Kreide- und Juraschichten anzugreifen.
Die Tụụbe nlochschlucht konnte im Jahre 1889 nach hochherzigen Geld- und Zeitopfern von Bieler Naturfreunden den Zehntausenden allsommerlicher Besucher eröffnet werden. 23
Ihr umdeutender schriftdeutscher Name frischt zunächst mittelst «Schlucht» die verdunkelte Bedeutung von «Loch» auf, 24 welche noch aus dem Emmentaler Rebloch so ersichtlich ist. Zuvor hätte laut alter Deutung «Loch» seinerseits die Dụụbe n als die rinnenartige Eintiefung verdeutlichend aufgefrischt, welche noch an der Faßdaube, Touwe n, frz. douve, aus doga, alttwannerisch Duge, veranschaulicht wird.
Die Mannigfaltigkeit der Reize dieses einstündigen Fußpfades, der eine ganze kleine Welt wilder Romantik und lieblicher Naturspiele vor Augen führt, findet sich in sehr verschiedener Art der Szenerie wieder in der Twannbachschlucht. Diese hat im Jahre 1890 die ebenso mühsame wie uneigennützig auf jeden Taglohn verzichtende Arbeit der Twanner der Welt erschlossen. Ebenfalls ein Querdurchbruch der Seekette, sammelt diese Schlucht die Wasseradern des Desse nbärg. 25 29 Der sendet bei starken Regengüssen in das am Schluchtausgang sich öffnende Bäre nloch oder Wasserholiloch Wasser, welches dann als reißender Bach der Tiefe der Grotte entströmt. Überwältigend ist der Anblick, wenn das gewaltige Gewölbe seinen Schwall entsendet. Kristallhell quillt das Wasser hervor aus dem Schacht, fast die Brücke erreichend, um sich über große Kalkblöcke in den Twannbach zu ergießen. Einen Reiz anderer Art übte dieser seitliche Durchpaß der Kluftspaltenwasser auf die vormaligen Twanner Buebe n. Die häi n (um twannerisch zu sprechen) enan͜dere n chënne n d’Grin͜de n verschla̦a̦ n beim erbittert werdenden Streit, gäb d’Chin͜d us dem Wasserholiloch chämmi, oder aber aus dem Holiloch an anderer Stelle des Twannberggehängs. — Völlig unabhängig von der Wasserführung des Twannbachs, entsendet die Gü̦ü̦rschene n als eigenes System von Kluftspalten heute bloß noch hin und wieder eine gewaltige Wassermasse.
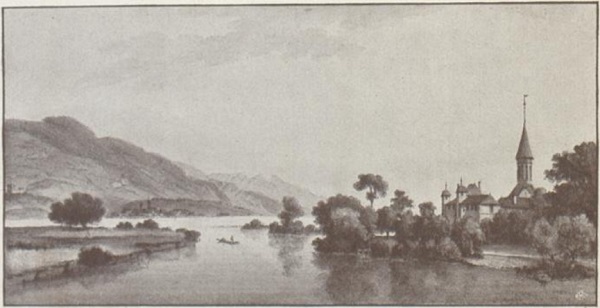
Am St. Johannsen
Nach Aberli. ca. 1783
Den Hintergrund der Holilochgrotte erfüllen schöne Tropfsteingebilde, die wie ein System von Prinzipal- Oorgele npfị̆ffe n von der Decke herunterhängen. Ein großes, taufsteinähnliches Tropfsteinbecken oben auf der Kalksintermasse, das von unten wie eine vorgebaute Kanzel anssieht, sowie die der Grottendecke entlang laufenden Tropfsteinkämme, die an gotisches Maßwerk erinnern, vereinigen sich zum Bild der Häide nchilche n, wie diese Opferstätte aus der ältern Steinzeit etwa genannt wird. Den eigenartigen Eindruck des Gesamtbildes vervollständigen der Chanzel: die scharfe Biegung der Tessenbergstraße ( S. 18); ferner das Eselsloch, in welchem einst eine Einsiedlerin mit 30 ihrem Esel g’hụshaltet haben soll; sodann die enge, höhlenartige Felsspalte des Lapisloch, die Anke nballe n, der Hohle nstäi n.
1
Nußbaum
2
Urb. Mü. 2, 19. 14.
3
Talent heißt der Nebenfluß. Vgl.
Rhv. 1894, 92. 93.
4
Karte von der Weid.
5
Bisher unerklärt.
6
Jacc. 450 f.
7
Font. 2, 22. 99; 4, 488.
8
SJB. A.
9
ABE. 1, 27.
10
Taschb. 1897, 330.
11
Brid. 61.
12
Schwell. 38.
13
Mhd. WB. 1, 270.
14
Gäserz.
15
Schlaffb. 1, 41.
16
Herm.
17
In der helvetischen Staatsverfassung.
18
Vgl. Brụ̈ụ̈sch
Lf. 23 und Brụụch
GW. 656.
19
Jacc. 189.
20
Nach Niklaus-Probst in Müntschemier.
21
Jacc. 448.
22
Wie ahd.
suoßi (süß) zum Begriff «sanft» kommt, lehren frz.
doux und
doucement. Vgl. den Prediger Heinrich Suso (der «Sanfte»). — Mit der bloß westschweizerischen Schüüß dürfen Rüüß und Riin als mit Recht verschriftdeutschte Reuß und Rhein nicht auf gleiche Linie gestellt werden.
23
Vgl.
Aeberhart, les Gorges de la Suze 35f.
24
Vgl
schwz. Id. 3, 1021;
Kluge 293:
Stucke S. 133.
25
Baumb. lB. 41-43; vgl die schönen Einzelschilderungen im «Bund» vom 10., 17., 18. Sept. 1911 von Sch. und von
E.B. (Maler Dr. Geiger auf dem Kapf).
Die Läugene n, welche als Gegenfluß der Schüüß an Längnau vorbei der Aare zufließt, führt mit den Spielformen dieses Dorfnamens: Lengenach (990), Longeaigue (deren etwa 20), Lengnowe (1181), Longieuva (1228), Longa aqua (1260), Lengowa (1281), Leinggowa (1300), Longivue, Longive, Longeau auf aqua (eau) und auf Au. Den letztern Namen, der «wässeriges Eiland» bedeutet, 1 trägt z. B. das obstreiche Zehndergut zu Scheuren. Mit ihm verbindet sich die Nebenform 2 Ei in der Eiau an der untern Saane. (Damit werden andere Auen in der Nähe unterschieden.) Unfern der Scheuren-Au liegt das Dorf Schwadernau, in welchem die kleine Pflaumenart der Schwadernauerli heimisch ist. Ein mit «Au» sinnverwandtes gutdeutsches Wort warid, Werd, Werder, Werde (1228), 3 Werdes (1300) steckt im Namen der Gwerdtmatte n zu Nidau, der (vor 1876 zu Lyß gehörenden) Werdthöfe und der zu Frienisberg gezählten Höfe Ober- und Nieder-Werder. An der Werder-Au aber liegt die oberi Insel, sowie bei den Werdthöfen die wildi Insel 4 (1343).
Hier haben wir also zwei gutdeutsche und eine aus insula entlehnte Form für den gleichen Begriff beisammen. Die Lehnform Insel aber (die wohl auch eine Halbinsel als stark «isolierte» Landstrecke bedeuten kann) 5 wurde bereits 871 herrschend im Namen für eine ganze Anzahl von teilweise zu Gewerbszwecken künstlich unterhaltenen Hervorragungen aus schlimmem Wasserstand. Der Ortschaftskreis Woorbe n, Jäiß (Jens), Merzlige n, Bellmúnd, Wịler und Port trug nämlich die Bezeichnung Inselgau. 6 1382 wurde derselbe durch Anna von Nidau, Gräfin von Kyburg, der Stadt Freiburg verkauft. 7 1388 kam er als ein Teil der Grafschaft Neuenburg-Nidau an Bern und wurde der Vogtei Nidau einverleibt. 8 Kirchlicher Mittelpunkt der genannten Orte war und ist aber das uralte Bürglen (s. im Band «Twann»), und dies lag auf der vorzugsweise als Insel bezeichnten Landerhebung in der Zihl bei Ägerten. Wahrscheinlich hatten die Geistlichen von Bürglen als Besitzer einer Mühle und Walkerei im alten rechtsarmigen Zihlruns mittelst des kleinen Bachs, der vom Ägertenmoos herkommt und bei der alten Brücke in die Zihl ausmündet; eine Strömung um die Insel unterhalten, von welcher 1103 die Rede ist. 9 Noch 1816 ist die Rede 31 von der Insel zwischen der Zihl und dem von ihr abgeleiteten Gensbach als Sitz eines alten Räderwerkes zu Schwadernau. ( S. 30.) Nördlich von Studen 10 gibt es einen Inseleggen, östlich von Scheuren die Oberbürinsel, bei Siselen aber einen I̦i̦selwald und eine I̦i̦selallmend. Eine Zihlinsel bei Orpund wird 1305 erwähnt. Zahlreiche Inseli bedürfen, außer dem zu Nidau, welches das Denkmal Dr. Schneiders trägt, gar keiner solchen Namhaftmachung; wohl aber die der altfranzösischen Form isle ( île) entsprechenden Isla (1319), Isle (1323), Ysel, Yselholz (so hießen 1360 die Inselmatten Berns) 11 als Überleitung zu verdunkelten Namen. Zu solchen gehört die I̦i̦slere n zwischen Ins und Witzwil als in Aussicht genommener neuer Sitz des Weiberstrafhauses. Die Karte verzeichnet dazu das I̦i̦slere ngebiet, die I̦i̦slere ndäile n, den I̦i̦slere nkanal, das I̦i̦slere nhölzli.
Die volksmäßige Umdeutung Ri̦i̦slere n beruht auf falscher Trennung der Wortgruppe i n der I̦i̦slere n. Es scheint hier ein ähnlicher Fall vorzuliegen wie bei Si̦i̦sele n. Nach der Analogie von «Seewil» (1273: Sewile) aus ze Wile, Zewile 12 wäre «Si̦i̦sele n» zu deuten als «z’Iisele n». (Vgl. umgekehrtes Z-erlach und Z-einigen in «Deutsch und Welsch».) Daß alle die alten Sisilli (um 1160), Sisello (1221), Sisellon (1238), Sisellun (1249), Siselo (1253), Sisille (1265), Siselle (1269), Sizellon (1453), Sisel (1523 13 ), Sißelen (1718) auf «Insel» zurückgehen, scheinen alle die zu Siselen gehörenden Iiselacher (Inselacker vor dem Holz), I̦i̦selbụ̈ụ̈nde n und I̦i̦selzälg, das vom Großen Moos umgebene I̦i̦seli von sieben Jucharten Größe und der I̦i̦seliwald zu lehren.
Die Sage von einem einstigen Ursulinerinnenkloster « Sancta Insula» mit der Abkürzung S ancta ist also zur Namenserklärung unnötig. 14
In der Tat hebt sich das langgezogene Dorf von den 442 m des Mooses gleich anfangs um 7 m ab und gewährt mit der von ihm beherrschten Kirche dem Beschauer in der Straßenlücke zwischen Rüntiwald und Pfaffenhölzli den zauberhaften Anblick eines trotzig in sich geschlossenen Burgdorfes. Das Pfarrhaus bietet eine liebliche Fernsicht gegen Morgen, und der bewaldete Berg fällt ziemlich steil nach dem Aarekanal ab.
Was aber z’grächtem eine Insel ist, zeigt in klassischer Weise die heute mit der chlịịne n Insel ( «Chü̦̆neli-Insel») und dem Häide nweeg ( S. 24) zu einer Halbinsel vereinigte größere (36 ha 32 messende) Bielersee-Insel, kürzer gesagt: die Bielerinsel. 15 Diese «Insel mitten im See»: Insula medii lacus (1277) oder in medio lacu (1302); in einem Patois: mi-lé, 16 hieß 1107 insula comitum: Insel der Grafen (von Nidau). Diese errichteten hier das seit 1319 öfters erwähnte «Gotteshaus St. Peter in der Isla», welch letztere daher in weitern Kreisen als St. Petersinsel am bekanntesten ist. Dieser Name stellt sie der St. Johannis-Insel (1649: Isle de S t Jean, 17 (St. Johann Insul) gegenüber, welche als Trägerin des Stifts St. Johannsen zu den alten Überschwemmungszeiten fast regelmäßig zwischen der Zihlmündung und einem ihrer Arme eingeengt lag, bis die Korrektion sie um einen halben Kilometer vom Bielersee entfernt hielt. Trotz dieser Gegenüberstellung zweier erlauchter Apostelnamen hat bloß die Petersinsel sich ihren Ruf und Namen als d’Insel bewahrt. Das dankt sie ihren unaussprechlichen landschaftlichen Reizen und ihrer stimmungsvollen Stille, aus welcher sie allerdings heute mittelst des regelmäßigen Dampferverkehrs namentlich an den herbstlichen Leesersunntige n herausgerissen wird.
An solchen erfreuten sich aber von jeher selbst ganz vornehme Herrschaften. So schrieb am 6. Oktober 1810 der Twanner Abraham Irlet an seinen Sohn in Bern: «Letzten Sonntag war Madame Bonaparte auf der Insel, es war eine Menge Volk, das man glauben sollte, die Insel wollte sinken. Es waren bei 160 Schif daruf gefahren, keiner zrings um den See blieb daheim.» 18
Ruhe und Zuflucht aber suchten vormals auf ihr der Engländer Thomas Pitt, der auch hier begraben sein wollte, 19 und der geistliche Würdenträger Spazier aus Preußen. 20 Wer dächte aber nicht vor allem an den von der Berner Regierung (welche 1530 den Besitz an den Großen Spital [Burgerspital] abtrat) mit einer Frist von zwei Tagen ausgewiesenen Genfer Rousseau! Immerhin hat dieses gehetzte Wild hier doch, dank der Verwendung des edeln Nidauer Landvogts von Graffenried, 21 drei glückliche Spälsommermonde zugebracht. 22
Wie gemahnt die «grüne Einsamkeit» dieser bernischen Insel als Zufluchtsstätte eines von Genfer und Berner Protestanten verfolgten welschen Freiheitskämpfers mit der Feder an das «Rasengrün» der zürcherischen Ufen-Au, wo unter dem Schutz des Reformators Zwingli ein deutscher Freiheitskämpfer mit Schwert und Feder seine Ruhestätte fand!
1
Kluge 26 f.
2
Schwz. Id. 1, 18.
3
Kluge 490.
4
Mül. 569.
5
Wurstemberger 2, 94.
6
Schn. 35.
7
Ebd.
8
Till. 1, 305.
9
Jahn bei
Schn. 35.
10
Schwell. 25.
11
Font. 8, 331. 874.
12
Dr. Singer in Appenzellers «Rapperswil» 16.
13
EB. A 331.
14
Mül. 501-6 gegen
Stauff. 64. Übrigens müßte «
Sancta Insula» etwa zu «Diisele
n» geworden sein, wie St. Alban in Basel das Dalbedoor, Dalbeloch usw. hinterlassen hat, oder wie St. Ursus zum Durs, Dursli geworden ist. Vgl. auch
schwz. Id. 8. 1215, sowie
Vetter 259.
15
Vgl.
L’isle de Rousseau von Wagner und König.
16
Brid. 248.
17
Herm. 227. 283.
18
Aus dem Archiv der Familie Irlet-Feitknecht.
19
Mül. 438.
20
Spazier 146-154.
21
Vgl.
BW. 1912, Nr. 26.
22
Vom 1. August bis 24. Oktober 1765. Vgl. den «fünften Spaziergang» der
Rêveries d’un promeneur solitaire (schön ausgezogen in Jennis und Rossels schweizer. Lit.-Gesch. I. 230 f.). Im Sonnt.-Bl. d. «Bund» 1912, Nr. 26, leitet Hans Brugger mit einem Gedichte Prof. Schmids Abhandlung über Rousseau ein. Vgl. ferner: Morf im SdB. 1888; Eduard Sprenger, Kulturideale (woraus im Schwzrdorf d. B. Volksz. 1913). Über die Petersinsel vgl.
Mül. 431-9.

Marianna Anker: Kurisammis Mueter
Ins
«Die Eingeweide der Erde reden, wo die Geschichte schweigt.» Sie sagen unter anderm dem Landmann, wie «unter seinem Acker ein zweiter liegt», der nach dem erschöpften ersten neues Brot spendet. Nur muß er es der Natur überlassen, mit mächtigern Mitteln, als Bohrmaschine und Pflug sind, die Erdhülle aufzuwühlen. Das riesenmäßigste dieser Mittel, das freilich auch nur mit der Ung’schlachti des Riesen die Elemente ziellos dür ch enan͜dere n rüehrt, ist das Erdbebe n. Das letzte hiesige ist das vom 16. Oktober 1911. An Heftigkeit tritt dasselbe allerdings hinter frühern weit zurück. Besonders hinter dem Beben bei Twann im nämlichen Jahr 1356, das am 18. Oktober) die Katastrophe bei Basel brachte und auch die Hase nburg (s. «Twann») vollends zerstörte. Von einem andern, das am 8. September 1601 besonders zu Nidau gespürt wurde, lesen wir: Den morgen vor 2 uren ist ein gar mächtiger, starker and erschrockenlicher erdbidem gsin, also daß er vil lüth uß dem schlaf erweckt, hat auch eine lange wyl an einandren gwärt. Gott behüt sin kilchen vor leyd und allem übel, Amen, Amen. 1 Am 9. Octobris 1650 spürete man besonders in Aarberg am morgen ein wenig vor den vieren den wyt vmbgehenden Erdbidem. 2 Am 1. November des ungewöhnlich starken Erdbebenjahres 1755 wurden die Quellen am Fuß des Jura auf zehn Meilen Weite getrübt und der Genfersee emporgehoben.
Das Beben von 1356 zog den Felssturz der Rappe nflúeh oberhalb Twann nach sich. Da̦ isch e̥käi ns Bäi n dḁrvoo n choo̥ n. Eine Kapelle, heute durch die Chappele nrääbe n markiert, erinnerte an die Katastrophe. Ähnliche Stellen sind der Ru̦u̦sel auf dem Vingelzberg über Alfermee, sowie der Goldbärg zwischen Vingelz und Biel. Gold wird allerdings hier nicht gegraben, wohl aber bester Kreidekalk. Dem Vordringen des Pickels halfen Gesteinsrisse und die sonderbare Einbettung weicherer und jüngerer Schichten zwischen solidere ältere Kreidebänke (Taschen, S. 37) zur Vorbereitung des Felssturzes vom 6. April 1902. Wie stark die Gegend von jeher solchen Stäi nri̦i̦slete n ausgesetzt war, zeigt eben der Name Goldberg, der wie das Goldeli (eine «Rebe» zu Tschugg 1820), wie Goldau, Goldach, Golderen, manch ein Goolḁte n, 3 Gohlgraben usw. aus altes gall (grober Steinschutt 4 ) 34 zurückgeht. Ein Blick auf das Juragehänge zeigt noch manch solchen unheilbaren, offene n Schade n am ausgestreckten Riesenleib. Die letzten Rutsche vom 11. Februar 1910 und 24. August 1912, welche Neue nstadt bedrohten, schienen ihm das sagenhafte Schicksal von Sarbachen (s. «Wald»), der Roggete n ( S. 15), des Engelberg 5 über Twann zu verheißen. Es blieb jedoch bei der Verheerung von Weinbergen, wie am 11. Juni 1911 im Miste̥llach, wo ein solches verrü̦nne n immerhin empfindlichen Schaden stiftete.
Einen sehr alten Erdrutsch, der nach örtlicher Sage Reben und Häuser mitriß, zeigt über Brüttele n der Schaltenrain. Es ist ein etwa 300 m langes und 100 m breites Trümmerfeld oberhalb der Möön chha̦a̦l de n. Da rollte vom Wị̆ße nrä́in, dessen Kamm sich 25 bis 30 m über das abgestürzte Gebiet erhebt, harte Meermolasse ( S. 39) ab, wahrscheinlich infolge allmählicher Abschwemmung von unten liegendem Mergel. Daher zieht sich nun ein tiefer Graben zwischen dem Trümmerfeld und dem Absturzgebiet hin und dient dem Jäger u̦f Fuchs und Dachse n als ergiebiges Arbeitsfeld. 6
Was hier das abnagende und abschwemmende Wasser vor Zeiten vereinzelt leistete, das verrichtete es in zusammenhängender Riesenarbeit am linken Bielerseegestade zu unschätzbarem Segen für Menschen. Die mehr als 12 m tiefen Sodbrunnen weisen auf eine mächtige Schicht von angeschwemmtem Strandboden, der gleich dem Kreidemantel über ihm den Seewịị n liefert. Auf den Schichtenköpfen der untern Kreide aber, deren Bänke steil gegen den See abfallen, liegen Ligerz, Bi̦pscha̦l, das untere Twann, indes Tü̦sche̥rz (s̆s̆) und Alfermee ( Hä́lffermee) auf dem soliden Kreidegehänge ruhen. Ein alter Geschiebekegel aus dem Twannbach, der durch Seesenkung trocken gelegt wurde, gab das Bett ab für di chlịịn Twann, während das östliche Biel, Bözingen und Mett sich aus einem Delta der Schüß ansiedelten. Auf einem durch Torfmoor überdeckten Pfahlbau-Niederlaß endlich richtete sich unter dem uralten Namen d’s Moos das mittlere Twann «hụụshäblich» ein. 7
1
Pfarrer Niclaus Schöni in Nidau (1598-1611) laut
Taschb. 1900, 271.
2
Dekan,
Forer.
3
Ganz verschieden von den unter «Herr und Knecht» besprochenen.
4
Vgl.
schwz. Id. 2, 216.
5
Mül. 171.
6
Nach Lehrer Blum im «Seeland» 1912, 75.
7
Nach Baumberger.

Studie von Anker
Die derart zutage tretenden Gesteinsschichten des Jura und des einst damit zusammenhängenden Seelandes reden von belangreichen Geschehnissen mehr ruhiger und regulärer Art seit dem Mittelalter der Erde. In dem fast vier Fünftel der Erdoberfläche bedeckenden Meer schwanken ( gịgampfe n oder gampfe n) in ungemessenen Zeiträumen die riesigen 36 Festlandsschollen auf und ab, und jede ihrer Partien tauchte zu ihren Zeiten unter. So im Erdmittelalter die Schweiz. Da wimmelte das Meer von Muscheln, Schnecken, Ammonshörnern, Belemniten, 1 Terebrateln usw. Ihre Überreste finden sich als Versteinerungen oder Steinkerne zahlreich in den weichen Meergle n (Meerschlamm) vor, die mit den soliden Kalkbänken des Jura wechsellagern. Gerade diese Kalkbänke ziehen als weitgespannte Mulde unter unserm Hügelland durch, um sich im Alpengebiet, dessen Hauptfalten sie einst einkleideten, wieder zu erheben. Die Kalke treten längs der Seekette als Felsköpfe und Steilhalden zutage, deren Wasserarmut den Jurabụụre n die bekannte peinliche Not bringt, deren Sommerwärme aber aus den Mittelmeergegenden die reizvolle Felsenheideflora hergelockt hat. Die Ligerzer Mundart benennt aus ihr das Tschụ́tscherlụsi (das Leberblümchen, Anemone hepatica), das Mụụrtrụ̈ụ̈beli (weißes Fettkraut, Sedum album) und besonders den Fluehsalat (ausdauernder Lattich, Lactuca perennis), dessen junge Blätter im Frühling das erste Gemüse liefern. 2
Die obersten, «weißen» Juraschichten (Malm, Korallenkalk) sind als vortreffliches Baumaterial ( Chalchstäi n, Hertstäi n, Sollo̥du̦u̦rnerstäi n) von bekannter Dichtigkeit. Die lockern, leberartigen Kalkmergelschichten, haben ihrerseits den Namen Läber, Läberbärg hervorgerufen.
Aus dem Meer emportauchend, süßte der Jura seine verbliebenen Meerlachen aus mittelst geröllereicher Flüsse und reicher Niederschläge (die heute als Zistärne nwasser so sorglich zu Rate gezogen werden). In diesem Brackwasser schlugen sich die grauen Purbeckkalke nieder, welche gelegentlich Geröll und versteinerte Süßwasserbewohner (Schnecken und Muscheln) einschließen. Interessante Purbeck-Aufschlüsse finden wir bei Vingelz und Tüscherz.
Neuerdings un͜derḁ tunkt, nährte der Jura als zwerghafte Genossen fürchterlicher Rieseneidechsen, 3 Schnägge n und Muschle n aller Gattig, 4 namentlich die wie winzige Schmetterlinge anzusehenden Räbhüendli ( Rynchonella multiformis) der Neßleren und anderer Twanner Rebberge. Diese Kalkschalentiere zogen über die geschaffenen Jurastufen den Kreidemantel. Dieser ist allerdings über dem Bielersee bloß noch ein zerfetztes Gewand. Über der Brunnmühli ist er ganz abgetragen. Zwischen Twannerkirche und Kapfgebäude aber gibt er einen Boden ab für das Rebgelände, welches auch sonst auf diesem Nährboden das bekannte treffliche Gewächs erzeugt.
Ebenso geschätzt sind indes die untern Kreideschichten als Baustoff. Eine derselben, nach dem neuenburgischen Hauterive ( Alte nriff) 37 benannt, aber auch in Grissḁch und Lan͜dero̥ n ausbeutbar, liefert (als oberes Hauterivien) den spatreichen, braungelben Gelbstein, Geel bstäi n ( pierre jaune), geel be n Haustäi n, der auch in Ins reiche Verwendung findet. Auf Schiffen hergeführt, gab er im alten Twann die so eigenartig sich abhebenden Fensterfassungen ab. Aus ihm sind die Twanner- und die Ligerzerkirche gebaut. Vornehmlich aber verdankt die Stadt Neuenburg dieser pierre de Neuchâtel das von Alexander Dumas geprägte Kompliment, sie sei ein in Butter ausgeschnittenes Kleinod. Unanmutig grell hebt sich von diesem Gelb der rote Kunststein der katholischen Kirche ab.
Den vorzüglichsten Baustein, der namentlich im Ru̦u̦sel ausgebeutet wird und bis im Sommer 1912 auch in der Goldberggrube als marbre bâtard ausgebentet wurde, liefert die unterste Kreideschicht als unteres Valangien. Dieses wird nach dem neuenburgischen Valangin ( Valle̥dịịs, -ịs) so geheißen. In 12 «Hauterivientaschen» (z. B. im Holzplatz und i n der Boome n, d. i. La Baume bei Ligerz, sowie in der Chroos und am Goldberg) von weicherer Kreide durchsetzt, bildet dieser weiße bis gelbe Stein die haltbarste und vollständigste Gewandschicht. Sie nimmt freilich am Bielersee bis auf 35 m Dicke ab, um dagegen am Salève bis über 100 m mächtig zu werden. Ans solchem faltsche n Marmor bestehen die Böschungsmauern des Hagneckkanals und teilweise des Nidau-Büren-Kanals, sowie die Mụụre n der Twanner Räbe n. Bei der Burgfluh liefert dieser marbre bâtard Lithographiesteine.
Daneben fällt der Mörtelkalk in Betracht. Die Lamlinger durften laut Verbot von 1576 auf den Twanner und Ligerzer Matten kein Kalch, kein Stein brächen noch brönnen, 5 wogegen 1762 der Ziegler Immer zu St. Johannsen für die Schlösser St. Johannsen und Erlach den Chalch billiger als sonst 6 liefern mußte. Auch er verfügte nämlich, wie noch der Galser Chalchofenacher beweist, über ein « calcifurnum», wie er in all den Chaufour, Chéfour, Chuffort, Tsofor weiter lebt und in den etwa 40 Raffour, Raffornet usw. (zu keltischem ra, Kalk 7 ) seine Parallelen findet. Der Ofe n, Chalchofe n von Ligerz bildet die Grenze gegen Neuenstadt 8 und damit die der vormaligen Herrschaft Berns. Das oberste Ligerzerhaus aber heißt der Chalchhof. «Kalk schwellen» (1671 für Chalch lösche n) und Chalch brönne n für Sack- oder Magerchalch bleiben dort herum in starker Übung.
In der Übergangszeit zwischen Erdmittelalter und Erdneuzeit (im Eocän) entstanden im Gebiet des aus dem Eocänmeer emporragenden Jura festländische Abschwemmungsprodukte in Form einer stark eisenschüssigen 38 Tonerde. Bis zu knapper Abbauwürdigkeit ergiebig findet sich solche in Tälern und Gehängen wie um Delsberg, Oensingen, Olten, Aarau. Eine immerhin 80 cm dicke Schicht bietet die Brunnmühli; schwächer sind die Funde in der Chroos und anderwärts. Es handelt sich um tiefroten, wohl auch rötlichgelben oder grünlichen Bolus, herrührend aus verwittertem, eisenhaltigem, tonigen, Kalkstein, Bei Alfermee gibt es Eisenkörner ( Chrü̦ü̦geli) von Erbsen- bis Nußgröße reichlich aufzulesen. Der Betrieb lohnt sich jedoch so wenig wie bei dem begonnenen Abbruch zu Lengnau. 9 Dagegen deckten hier Wald und Weide und die Hụụpergruebe n die Gemeindeausgaben und machten die Lengnauer Burger g’mäinsstụ̈ụ̈rfrei. 10 Der unverbrönnbar Härt, aus Tonsand bestehend, gleich alt und ähnlich entstanden wie Bolus, lieferte als der weit herum bekannte Hụụper 11 Schmelztiegel und feuerfeste Blö̆chchli besonders für Ofenplattenuntersätze. Die Burgergemeinde hat die Ausbeutung von neuem an die Hand genommen.
1
Frey 211.
2
Baumberger, Feisenheide 6. 8.
3
Dinosaurier, Frey 211.
4
Ebd. 212.
5
Tw. Schlafb. 90
b.
6
Schlafsb. 1, 275.
7
Jacc. 374.
8
Mül. 370.
9
Lg. 144;
Mül. 312.
10
Lg. 117, Nichtburger zahlen allerdings 6,35 % Steuer.
11
Einen Versuch der Wortdeutung s.
schwz. Id. 2, 955.

Studie von Anker
In einer mittlern Periode der Erdneuzeit (im Miocän) versanken anfänglich größere Teile des Jura, so das Basler- und das Delsbergerbecken, unter Meer, um sich von den emporgetauchten Alpen durch starke 39 Flüsse das Hauptmaterial zu der untern Meermolasse zuführen zu lassen. Nach und nach aber tauchten diese Gebiete und das schweizerische Hügelland wieder aus dem Meer empor. Beide wurden durch die Alpenflüsse mit Geröll, Geschiebe und Sand überführt, welche Masse, mächtige Bänke bildend, als untere Süßwassermolasse bezeichnet wird. Im Jura, von dessen südlichem Strich die obern und mittlern Kreidelagen mittlerweile bereits abgeschwemmt waren, überlagerte die bis ins Elsaß hinunterdringende Molasse die unterste Kreide, um aber bis auf kleine Nester z. B. zwischen Tüscherz und Wingreis wieder zu verschwinden. Um so mächtiger wurden ihre Lagen im Seeland, so daß im Laufe der Jahrtausende der erste Seelandsee ụụsg’füllt wurde und verlandete. Schnägge n, deren Hụ̈ụ̈sli man im Ried bei Ins fand, starben aus. Inseln tauchten auf und nährten mit Pflanzenstoffen das schweinähnliche Steinkohlentier (Anthracotherium 1 ). So entstanden die Gesteine der seeländischen Berge. Sie erhielten durch diese untere Süßwassermolasse ihren Unterbau und Grundstock bis nahe an ihren Rücken hinauf. Senkrechte Wände wie am Jolimont über Gampele n zeigen, wie der bunte, tonige Sandmergel die lockeren Sandsteinschichten durchsetzt.
Zu San͜dmutte n (als Quadersteine, Ofenplatten u. dgl.) ist dieser allzu lu̦gg San͜dstäi n unbrauchbar. Es fehlt der kieselige Kitt, der z. B. die Stockernsandsteine so wertvoll macht. Höchstens Material zu Innenmauern 2 läßt sich aus den San͜dflüeh zu Brüttelen, Gampelen, Vinelz, Lüscherz und aus der Fasnḁchtflueh bei Nidau gewinnen. Der Mergel hinwieder nährt, wenn er im Winter zum g’frụ̈ụ̈re n und ụụfg’frụ̈ụ̈re n a n Hü̆ffe n g’läit und im Frühling untergebracht wird, nicht bloß für sich, sondern er bringt auch die andern Düngstoffe zu rascher und nachhaltiger Wirkung. Är isch im Boden n, was ụ̈ụ̈s der Chees im Mage n.
Zwischen Gals und Erlach ladet Gehängelehm als herabgeschwemmtes Produkt der untern Süßwassermolasse (also Alluvium) zur Ausbeutung. Dieser Lätt ist äußerst gut verwendbar für Ofenkacheln und Ziegel. Darum versorgte seinerzeit der Nordostfuß des Jolimont eine ganze Anzahl von Hafnereie n (vgl. «Häuslichkeit») zu Erlḁch und Neue nstadt, sowie von Ziegeleie n ebenda und zu Sant Johannse n. 3 Von allen diesen Unternehmungen hat indessen bloß die zwischen der Chlostermühli und Erlach zu St. Johannsen sich behauptet. Und zwar seit 1626. Vorher stand diese Ziegelei zu Neuenstadt, wohin man den Lehm verschiffte. 4 Der älteste dort gefundene Ziegel, einem 40 Ha̦a̦gge n an der Nase, stammt vom Jahre 1426. 5 Die Erlacher Ziegelei verarbeitet denn auch, eine zweimetrige Lehmschicht bis zur dünnen Rasendecke hinauf ausbeutend, außer im Februar und März täglich 30 m³ Lehm dreier Qualitäten. Sie lieferte bereits 1762 und sicherlich längst vorher (Dach-) Ziegel, Chemistäine n, groo̥ß Ofe nblatte n, Mụụrstäine n, B’setziblättli. 6 |den Vorzugspreisen von 12, 12, 125, 50, 30 statt 14, 14, 175, 100, 33 |Rappen. Schlaffb. 1, 275. Nordöstlich vom Wistenlacherberg, auf Berner Gebiet, 7 lockte eine 5 m tiefe Lehmschicht als toniger Absatz der Verlandung (s. d.) zur Erstellung einer Ziegelei im Kanalhafen, die nur wegen Mangel an geeigneten Transportmitteln nicht gedieh. Dank solchen kommen selbst weniger günstig mit Material ausgestattete Ziegelbrennereien wie zu Fräschelz, Aarberg, Mett, Nidau und die dortige Hafnerei vorzüglich fort. Auf eine uralte Ziegelei scheint das an die Ziegelmatte n (Ga.) grenzende Ziegelmoos zu deuten. Erstere, ein Teil der Ri̦mme̥rzmatte n, hieß bis um 1875 die «Matten zu Zieglen». Beide Fluren bestehen noch heute aus schwerem Lehm. Ohne Ausbeutung blieben wohl zu allen Zeiten das Lätthü̦ü̦beli, der Läinacher (Lehmacker) 8 zwischen sandigen Äckern zu Gampelen und Tschugg, das Läin- und das Läimzälgli (Ga. 1811), die «leimgruben bim wolfenbaum» (1648). 9
Von dem brennbaren blaaue n Lätt unterscheidet der Volksmund den graaublaaue n unter der Torfschicht des großen Mooses. Er gibt den zuverlässigen Baugrund ab für die wuchtigen Anstaltsgebäude, welche man seit einigen Jahrzehnten dank eigener Fundamentierungsweise in der ehemaligen Wildnis tarf stelle n oder abstelle n.
Eine widerwärtige Beigabe zum Brenntorf ist der wịß Lätt, den dagegen der Landmann gern als schmutzige n Lätt aus den frischen Ackerfurchen speckig glänzen sieht. Nur darf das sofortige Zerhacken solcher Fuhre n nicht zu stark an das mühselige täüffhacke n des Rebmanns erinnern, und auch nicht an das Steckenbleiben des Fußes in durchnäßtem Weg und Steg, worüber das Sprüchlein Klage führt:
Gampelen im Lätt,
Wär drinnen ist, dää chläbt.
Als starche n Heert ( terre forte) unterscheidet der Landmann den stark mit Lehm durchsetzten Lättheert oder das Lättgrien vom leichten Kies- und Sandboden.
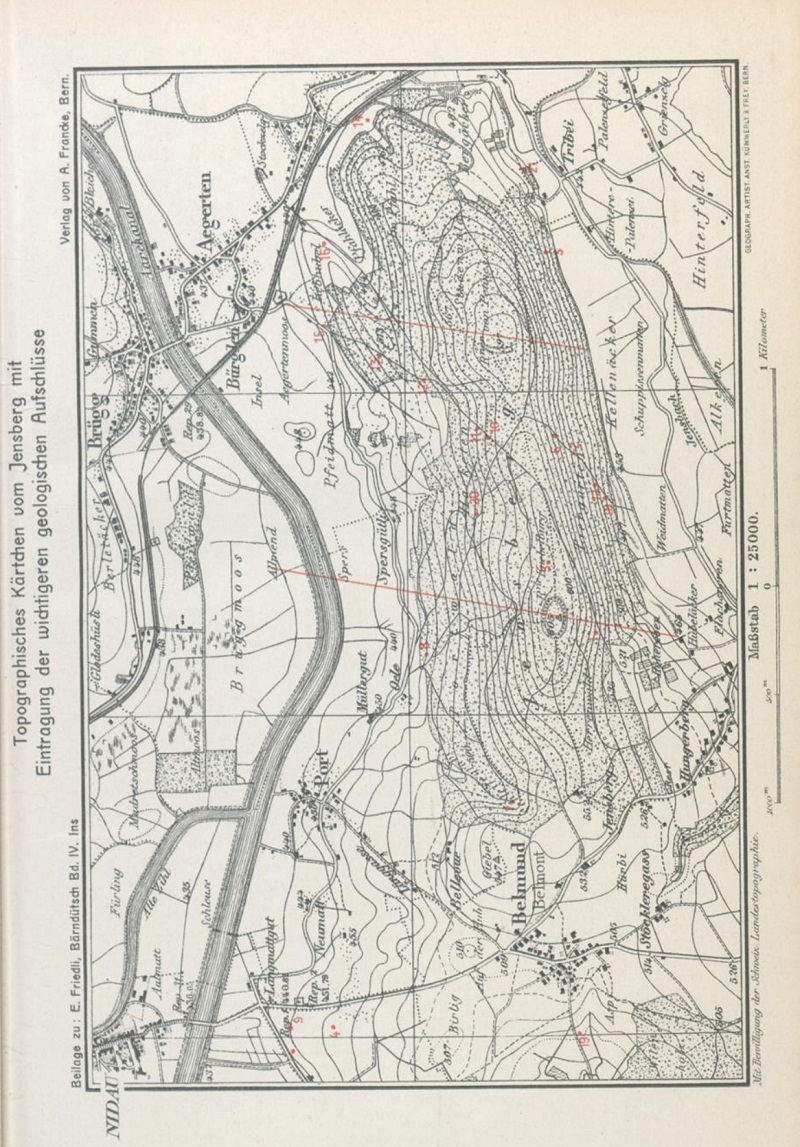
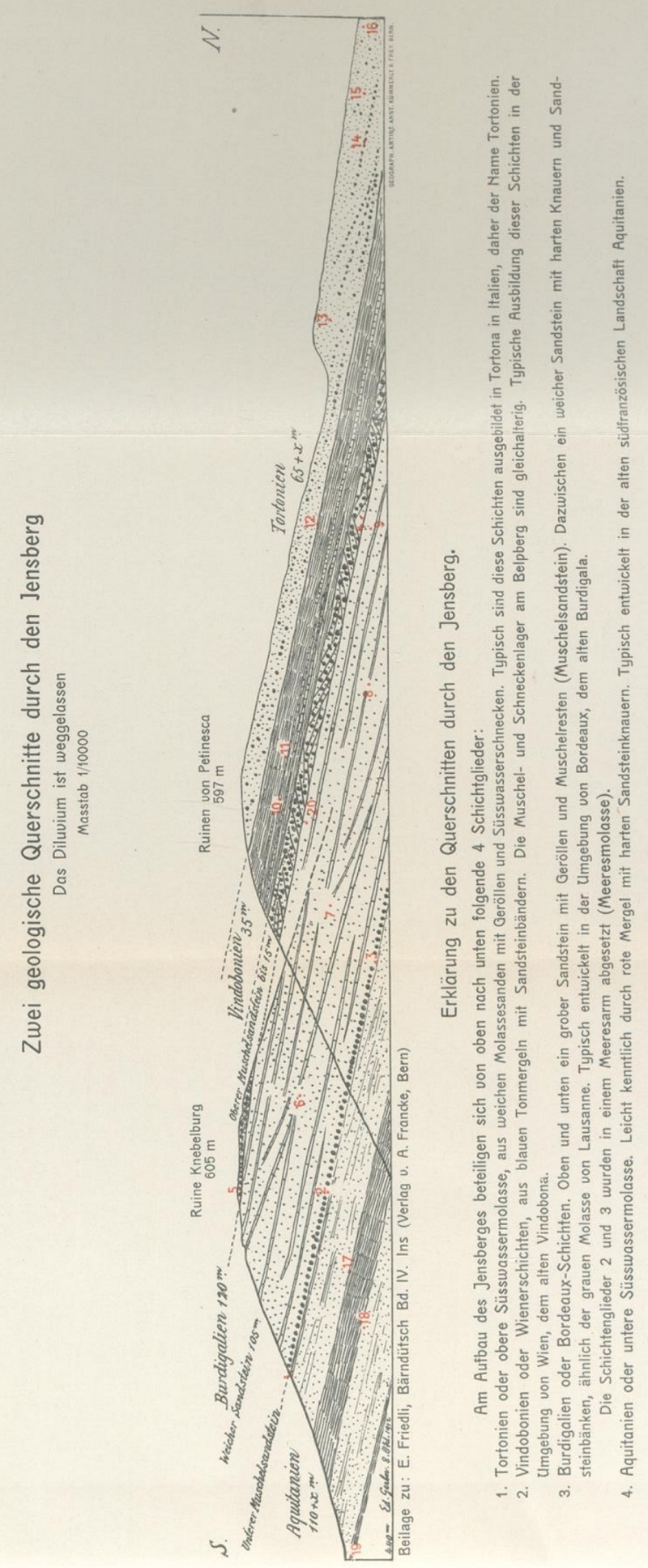
41 Tief unter dem Torf liegt stellenweise Seekreide: See̥chrịịde n als vermeintliche Ausschlemmung von Juragestein durch den Bielersee, durch dessen Untergrund die Masse bis ins große Moos gelangt sei. In Wahrheit ist dieses selbst ihr Erzeuger. Denn die wüehligi Vegetation der Mööser überhaupt setzt den vom Wasser mitgeführten doppeltkohlensauren Kalk besonders ausgiebig in einfach kohlensauren um und läßt solchen nesterweise li̦gge n. Wo die Seekreide allenfalls ausbeutbar ist, liefert sie der Ackerkrume unseres Bezirks, welche speziell im Inserboden bloß 2 bis höchstens 5 % Kalk aufweist, eine wertvolle Bereicherung.
Über den Lehm- und Kalkschichten des großen Mooses liegen nun die Verlandungsprodukte des dritten großen Seelandsees oder des Favre’schen lac de Soleure, worüber das nächste Kapitel « Versumpfung und Entsumpfung» eigens einläßlich handelt.
1
Knochenreste fand man zu Aarwangen.
2
Stauff. 41.
3
Lign. 47.
4
Von einem Neuenstadter Ziegler hören wir noch 1642. (
RM. 1. Apr. Nr. 271.)
5
Ziegeleibesitzer Zbinden.
6
In die Schlösser Erlach und St. Johannsen zu
7
Schn. 79.
8
Vgl.
schwz. Id. 3, 1267.
9
Mit der beim Brüttelenbad vermuteten Porzellanerde (
Stauff. 74) ist es nichts.
Wir kehren, nachdem wir aus technischen Gründen das Alluvium gleich hier erwähnt, zur mittlern Epoche der Erdneuzeit zurück.
In einer spätern Periode dieses Miocän drang von Lyon her ein Meeresarm (das helvetische Meer) in das Gebiet des ältesten Seelandsees ein und griff in schmalen Abzweigungen weiter bis München und bis Wien. Zeugen dieser salzigen Fluten sind Meermuscheln wie Cardium (Herzmuschel) und Tapes, für den Inser aber besonders auffällig die etwa als «Vogelzungen» gedeuteten Haifischzän͜d, 1 |dessen schöne Kollektion Pfarrer Ischer zu Mett im Chräije nblärg daselbst gesammelt anderwärts Wirbel- und Rippenstücke von Schildkröten.
Alpen und Jura ergossen ihre Ströme mit so mächtigen Geschieben nach der Ebene, daß sie an deren Nordostrand ausgedehnte Delta aufhäuften. Vor diesen entfaltete sich ein reiches Tierleben. Da tummelten sich als altertümliche Nashornart Tapire, deren einer im Sandstein des Wistenlacherberges versteinerte Reste hinterließ, 2 ferner die Elefantenart Mastodon mit vier Stoßzähnen, altertümliche Schweinsarten 3 und Hirsche 4 |den marinen Molasseablagerungen von Brüttelen. Von Prof. Dr. Studer in den Abh. d. |paläontologischen Ges. XXII (1895). in den Riesensümpfen. Mitgewälzte und eingekittete Baumstämme und Riesenäste aber halfen den Geschiebemassen d’s Meer ụụsfülle n. Zugleich mit der Senkung des Meeresbodens trat eine Verbreiterung der Meeresarme ein, so daß die Delta ertranken. Zunächst kamen grobe Gerölle den Meeresboden mit einer bis 10 m mächtigen Schicht zu 42 bedecken. Sie bestehen aus rotem Granit, Jaspis (rotem Hornstein), Porphyren und andern Ergußgesteinen, welche durch den kalkigen Zement der spätern Überlagerungen zu der überaus harten Nagelflueh gepreßt wurden. Ihre Heimat aber wird vergeblich in den schweizerischen Alpenketten gesucht. Die bunte Nagelfluh ist fremdländischen Ursprungs (exotisch): sie kommt von der Südseite der Alpen, vermutlich aus der Zone des Canavesischen, nördlich von Turin. 5 Die Geröllieferanten müssen durch Schübe bis ins Gebiet der Stockhornberge 6 geschoben und von dort durch das Flußsystem der «Ursaane» und «Uraare» nach dem Seeland transportiert worden sein. Hier durchsetzten sich die Gerölle mit den Schalen kleiner Lebewesen des Meeres und gestalteten sich zur Muschelnagelfluh. Wie zierlich stellenweise deren Gebilde ausfallen konnten, zeigt die Fassung der nördlichen Kirchentüre zu Ins. Solche Flueh bildet die Rücken des Mistelacherhu̦u̦bel und des Tschụlimung (Jolimont). Sie tritt da und dort zutage in der Nähe des Brüttele nbaad und, was für unsere Gegend besonders wichtig ist, in den Bausteinbrüchen der Flueh bei Brüttelen, sowie in den alten Mühlsteinbrüchen der Mue̥lere n bei Ins. Diese hießen vormals mulera apud Ines (1282), molaria in Hiselgove (S. 30), «Muchöhrle» (1850), «Mucherlen» (1776). 7 |Katasterplan von Ins; vgl. aber Muucheerlen unter « Holzarten». Es gibt eine Staatsmue̥lere n und eine G’mäinsmue̥lere n nahe dem Brüttele nbaadweegli. Die letztere ist wieder eine doppelte: eine oberi und un͜deri (1757) Eißergruebe n. Von der Staatsmuehlern heißt es 1396 und 1397: Meister Nägeli zahlt der Herrschaft Savoyen von jedem gehauenen Mühlstein je nach der Größe 6 bis 17 Schilling. 8 Die Stadt Bern als neue Besitzerin seit 1475 erklärte dann 1492: Der Mühlisteinbruch zu Ins, genannt die Muleren, ist Meiner Gn ädigen Herrn Lächen. Ist verliehen an Hentz Brünoß und Hentzen Gweren, beide von Ins. Sie zahlen von jedem Stein 12 Schilling. Sie sollen aber die Grube nit lassen lähr stahn. Kündungsfrist der Empfaher: ½ Jahr. 9 Der Zins begreift sich aus den Kosten von 200 Franken unseres Geldes für einen Mühlstein, der g’haue n werden mußte und nicht b’broche n werden durfte. Bern handelte auch hier als Erbe der Grafen von Neuenburg.
Ihrer Vermittlung war schon die Erstellung der Sarkophage in einem Erdhügel zu Wileróltige n aus Inserstein zu danken. 10 Graf Rudolf verwilligte 1230 den Mönchen zu Hauterive das Recht, jährlich 43 zwei Mühlsteine aus dem Bruch «am Schaltenrain» zu beziehen. Wenige Jahre später lautete die Erlaubnis auf vier Steine. 11 Aus dem nämlichen Bruch «im Inselgau» ( S. 30) durfte seit 1258 die Abtei Sant Johannse n ihren Bedarf decken. Die Vergünstigung ward 1279 bestätigt. 12 Seit 1351 bezog auch die Gottstatter Klostermühle zu Mett ihre Steine aus Ins. 13 Aber die Platten fanden ihren Absatz selbst in Bern. Zeugen doch davon die Fußmauern des Berner Münsters nördlich vom Haupteingang! An der Rịịff (nahe der Inser Strafanstalt) wurden die Platten auf dem um 1850 fahrbaren Münzgrabe n (s. u.) verschifft, um über Broye und Neuenburgersee auch nach dem Waadtland (La Vaux und La Côte), ja «bis Savoy» und «ins Gruyereland» 14 zu reisen. Auch der Bielersee trug solche Frachten, nachdem die Zufahrt nach Erlach ermöglicht worden. Das geschah 1791. Wenigstens beschloß in diesem Jahr die Regierung: Damit die Mühlisteinen von Inß nicht mehr durch die Gamppelen Straß, sondern durch die Straß von Innß nacher Erlach biß an den See geführt und abgelegt werden könnind, ist die Ins-Erlach Straß zu verbessern. 15

|
|
Studie von Anker |
Die Franzose nstäine n aus der Champagne, welche um 1860 selbst in der Brütteler Mühle Einzug hielten, wie dann erst die Walzen der modernen Mühlenmechanik legten auch diesen Erwerb lahm. Die beiden Besitzer der Eißergruebe n ziehen nun ihr Brot statt aus den Steinen der Grube aus den Schollen ihrer Äcker,
Auch die Brütteler Flueh (546 m) sah früher täglich zwanzig und mehr Zü̦ü̦g talwärts fahren. Der Brütteler-stäi n diente als geschätzter Baustein für Brückenfundamente, Steege ndritte n, Brünne ntröög u. dgl. Nun hat auch hier die Zementindnstrie die Ausbeute auf ein Minimum beschränkt, und die beschwerliche Abfuhr tut dazu ein Übriges. Wie 44 sehr es schad drum isch, zeigt das 1911 aus Brüttelerstein erbaute stolze Brütteler Schulhaus und ein 1912 in die Nähe gestelltes Bauernhaus. Die schöne Wị̆ßi dieses Materials wiegt den Vorteil des Inserstäi ns auf, daß dieser herter ist und geege n Boode n zue, wo er in Wasser zu liegen kommt, gäng herter wi̦i̦rt.
Äine nweeg gewinnen die Besitzer des Brüttelenbruchs aus demselben no ch hü̦̆t zum Taag Brot, indem ein Geschlechtsnachfolger des Peter Küffer (1607 für Chüeffer), ein Hagestolz, im Dienst der Eigentümerfamilie als Stäi ngrüebler, Stäi nhạuer oder Stäi nbrächer und gelegentlicher Petrefaktenlieferant arbeitet. Frühern Vorgängern halfen wenigstens ihre Eheweiber mit dem ysen (1668) oder steckysen ( Heebịịse n) hantieren, um schwere Stücke «vfzebühren» ( ụụchḁ-z’bü̦ü̦re n oder z’lü̦pfe n). Dabei entspann sich gelegentlich (z. B. 1668) Zwiespalt, 16 in welchem durch Werfen von Abfällen: Schi̦i̦fere n, G’schü̦ü̦fer erprobt wurde, auf welcher Seite das stärkere Geschlecht zu suchen sei.
1
Zu sehen im naturhistorischen Museum Bern und im Museum Schwab zu Biel,
2
Favre. (594).
3
Sus antiquus; Chaeromorus sansoniensis.
4
Dicroceras furcatus; das
Aceratherium. Vgl. Die Säugetierreste aus
5
Nach
Argaud
6
Vgl.
Gb. 34 f.
7
Zimm. 2, 8 nach d. Archiv Mü. und altem
8
Taschb. 1901, 14.
9
Kopie im
Schlaffb. 48 f.
10
Jahn KB. 9.
11
Font. 2, 106. 271.
12
Ebd. 2, 468; 3, 247.
13
Ebd. 7, 560.
14
Hermann.
15
Schlaffb. 1, 233. Vgl «Weg und Steg»
16
Chorg.
Über der 10 m dicken Nagelfluhschicht liegt eine ungefähr 60 m mächtige Decke weichen, bläulichen und geel be n Sandsteins. Diesen Bestand zeigt sie noch im Schalte nrä́in, indeß sie im Brüttelerbruch vom Gletscher ( S. 46) fortgeschwemmt ist. Nur nordöstlich von Brüttelen sind noch 20 m Höhe zu sehen dank der Aufschließung durch den S. 34 beschriebenen Bergsturz.
Als oberste Schicht der Meeresmolasse breitet sich über der Weichmolasse Muschelsandstein. In Ins und Brüttelen ist er ebenfalls durch den Gletscher ( S. 46) wegrasiert worden; dagegen zeigt er sich in kleinen, mit Muscheln und Haifischzähnen durchsetzten Geröllen an der Knebelburg des Jensberges, also über dem altrömischen Petinesca.
Das Abfließen des helvetischen Meeres hatte die Bildung eines zweiten Süßwassersees zur Folge. In diesem lagerte sich die obere Süßwassermolasse ab. Sie besteht aus Sandsteinen, wechselnd mit Geröllen, durchsetzt mit Süßwasserschnecken. Am Jäisbärg und Bü̦tte nbärg zeigt das Gestein auch Zimmtblätter, sowie eine Menge kleiner bis 2 cm langer, spitze r Schnägge nhụ̈ụ̈sli.
Durch die nördliche Erdabplattung und daher südwärts gerichteten Landabstluß 1 bewirkt, staute sich während der jüngern Erdneuzeit (im Pliozän) ein durch wiederholten 45 Gegendruck in Falten gelegter Erdgürtel auf, von welchem Alpen und Jura einen kleinen Teil bilden. Falten dieser Art zeigt in immer kleinerm Ausmaß der südöstliche Jura in seinen oben ( S. 22) betrachteten Zügen des Chasseral, Spitzenberg, Seekette, Kapf, Chamblon-Büttenberg. Selbst zwischen Buechibärg und Büren besteht ein Faltengewölbe. Wie also das nordwestliche Mittelland und speziell das Seeland die Faltung des Jura in sich hat ausklingen lassen, so bildet es zugleich den tiefsten Strich des gesamten Mittellandes. Dieses erhebt sich von 500 bis 600 m Meereshöhe in einer mittlern Steigung von 16 ‰, zu den 1200 bis 1400 m am Nordsaume der Alpen. Der hiermit gegebene starke Fall der Alpenflüsse brachte eine besonders tiefgründige Molasse-Aufschüttung des seeländischen Bodens mit sich, die in den höchsten Erhebungen wohl an die 1200 m Mächtigkeit erreicht.
Auf einstige Erhebung von noch mehr als 1200 m deutet schon das Fallen der Meermolasseschichten des Schaltenrain gegen Nordosten um 27°. Das kann nur von einem Gegendruck herrühren, den eine hohe Überwölbung des Jolimont ausübte. Und daß eine solche bestand, lehren die Schichten desselben, welche auf der Südseite gegen Norden, auf der Nordseite gegen Süden einfallen. Die hierdurch angezeigten Luftsättel ergeben Bogen, die auf dem jetzigen Rücken des Jolimont als der einstigen Muldentalsohle anhoben und gegen Süden hin die Talung um Vinelz vielleicht 3-400 m hoch, die entgegengesetzte um Sant Johannse n ebenfalls 3-400 m überwölbten. Daß dem so ist, beweist mit ihrer Schichtenstellung eine dem Schaltenrain vorgelagerte Anhöhe. Sie ist der Rest des Südschenkels einer Molassefalte, deren Nordschenkel in der Südflanke des Jolimont steckt. Genau so liegen die Verhältnisse am Bütte nbärg als dem nordöstlichen Endpunkt einer subjurassischen Mulde (Synklinale), deren Schenkel bis auf ihre heutigen Reste abgetragen worden sind. 2 Wodurch und wie?
1
Tayler bei Berdrow 1912, 91 ff.
2
Nach Dr. Antenen.
Dank der Faltung waren die Alpen im Beginn des Eiszeitalters (das sich hieraus von selber erklärt) gegen 1500 m höher als jetzt, und noch am Nordfuß des Jura erhob sich Basel zu 800 m oder mehr. 1 Nun sind Alpen und Jura imposante Ruinen geworden und werden es noch mehr, indem sie ihren Abschwemmungsschutt der Niederung zuführen.
Von jeher und stetsfort taten und tun dies Flüsse. Wie die vormals ( S. 28) bis Orpúnd vordringende Schnụ̈ụ̈ß in ihrem Unterlauf und in der Schlucht die basse terrasse ablagerte, so überschüttete die Aare mit den Schottern der basse terrasse das Aaretal und die Niederungen zwischen Su̦tz und Lattrige n, zu Möntschemier, Si̦i̦sele n, 46 Walperswịl, Büel, Stụụde n, zu Cheerze̥z, Fräsche̥lz, Challnḁch, Baarge n, Lyß, Bueßwị́l. 2
Der Haupt- Fuehrmḁ war allerdings der Rhonegletscher, welcher in seinem stärksten Vorstoß im Gebiet des Seelandes erst vor 1300 m Höhe Halt machte, also den (1609 m hohen) Chasseral nicht überschritt. Beim letzten Vorstoß, der in unserer Region bloß 970 m erreichte, sandte er einen Hauptarm bis nach Wangen a. A. Bei seinem Rückzug teilte er sich am untern Ende des Sees in verschiedene Lappen, deren einer bis zum Pfarrhans Gottstatt und zum Totenhof Muntel reichte. Er deckte die Bielerseefalte, die Mulden von Teß, Ilfinge n, Gäicht mit tiefem Schutte zu, der sich mit dem unterliegenden Kalkmergel zu dem fruchtbaren Untergrund für Wald, Weide und Rebland mischte. Im Seeland, das sein Zungenbecken ist, legte er eine tausend Meter dicke Eiskappe über den Molassegrund und vernichtete natürlich für lange Zeit alles organische Leben. Auch das von Alpentieren, wie den Murmeli, welche die eisige Kälte als des Eisstroms Vorbote nach dem Seeland hinunter getrieben hatte. (Murmeltierknochenreste fanden sich in einer Griengruebe n z’Stụde n.)

|
|
Studie von Anker |
Das lange Lagern durchweichte das überdeckte Gestein und beförderte das Abschwemmen der weichen Massen, indes die harten als Inselberge stehen blieben. In der Bewegungsrichtung des Gletschers na̦a̦ch t na̦a̦ch ansteigend, brechen sie blötzlig ab. So modellierte der Gletscher den Schalte nrä́in, Tschụ́limung, Mistelacherhubel, Jäißbärg, Bütte nbärg, Bụ̈ụ̈re nbärg zu den scharf umrissenen Aame̥sse n- oder Ome̥sse nhụ̈̆ffe n mit der jetzigen g’streckte n Oval- oder der annähernden Rundform. Namen wie Romont (rotundus mons), oder Rŏtmúnd, wo die Rottmunger wohnen, heben sich mit dieser Bedeutung ab von den Rotenberg (1379), Rougemont (Rötschmund). 3
47 Wie als Meißel, arbeitete aber der Gletscher auch als Schụụfle n und als Hobel. Er höhlte das Becken des Große n Moos und das vielmal größere, aber niemals tiefe des zweitmaligen Seelandsee, von den Gelehrten als Solothurnersee ( lac de Soleure) bezeichnet. Dann aber gliederte er den letztern durch seine Rückzugsmoränen ab. Eine erste solche sperrte bei Solothurn den rasch austrocknenden Wangensee ab, eine zweite das Solothurnerbecken, das ebenfalls in kurzem versandete und verschlammte. Das Absperrungsmaterial bestand bei der letztem Gliederung 1. aus den Moränen zwischen Grenchen und Pieterle n, 2. aus den Moränen bei Längnau und Pieterle n, 3. aus einem Wall, der zwischen Orpún͜d und Saafnere n sich vom Fuß des Bü̦tte nbärg in einem Bogen über Gottstḁtt auf das rechte Ufer des Nidau-Büren-Kanals hinüberzieht und von hier die Anhöhe zwischen Zi̦hlwịịl (-ị́l) und Brügg gewinnt; 4. aus einer letzten Wallmoräne, die sich an den Westabhang des Jäißbärg lehnt und von hier in einem Bogen den Pfeidwald und den Brüggwald gewinnt.
Mittlerweile schob die Aare oberhalb A arbärg ihren Schuttkegel vor. Dieser half einer weitern Rückzugsmoräne bei Wavre, die einer Molasseschwelle aufgelagert ist, den noch verbliebenen Jurasee in die drei heutigen Becken teilen: den Neue nburger-, Bieler-, Murte nsee̥.
Aber allen drei gäit’s a n d’s Leebe n. Das erfuhr und erfährt zunächst der Bielersee. Der streckte anfänglich noch einen schmalen Arm hinder dem Bütte nbärg dü̦ü̦r ch als Pieterlensee. Dieser verlandete aber zu dem heutigen Pieterle nmoos, etwa wie es mit der Tessenbergmulde geschehen ist, deren östlicher Teil den Twannbach speist. Ursache war der Schuttkegel der Schüüß. 4
Ein Hauptbestandteil desselben ist eine 4 bis 5 m dicke Bank von feinzelligem Kalktuff, welchen das fein zerstäubte, harte Flußwasser absetzt. Solcher Duft bei Mett zeugt vom frühern Vorrücken der Schüß. Er findet sich auch am Chilche nhubel zu Pieterle n und bildet, von den Römerquellen abgesetzt, das Tufflager als den Büel, nach welchem die darauf stehende Altstadt von Biel gerne gedeutet wird. Sachverwandt ist der Tropfstäi n im Twanner Holiloch und Wasserholiloch.
Der noch verbliebene Bielersee̥, welcher mit seiner Fläche von 43 km² den Fünftel des Neuenburgersees ausmacht (wie der Murtensee den Achtel), dankt seinen längern Bestand der vom Rhonegletscher ausgehobelten 48 Vertiefung. Die schützt ihn immerhin nicht vor dem Endschicksal, daß sein Oberteil vom Heidenweg aus ganz verlandet, der Unterteil von der Schüß aus völlig verschlammt und versandet. Dann haben seine Anwohner keine Triftig (Gelegenheit) mehr, einem, der «Augen hat und nicht sieht», zuzurufen: Du fin͜dsch nid Wasser im See̥! Und wer eine schwere Verschuldung von sich ablehnt, kann dann nicht mehr mit Fug sagen: Wäre ich wirklich schuldig, es weer nid Wasser im See̥ g’nue g, für ’s abz’wäsche n!
1
Berdrow 1912, 104 nach Lepsius.
2
Aeberhardt, der mitten in diesen Forschungen für immer seinen Hammer niedergelegt hat.
3
Mém. et Doc. 22, 253.
4
Dr. Antenen
Was die Gletscherzeit durch Erstarrung des organischen Naturlebens an scheinbarem Rückschritt mit sich gebracht, holte sie ein durch Erweckung und Erziehung des intelligentesten aller Wesen und durch Schaffung eines trefflichen Nährbodens. Die (gekritzten) Rollkiesel, Lätt und San͜d (vgl. die San͜dachere n) und Mergel der Grundmoränen schufen jene hauptsächlich aus Lättgrien bestehenden Hügelzüge von Eiß, Möntschemier, Treite n, Feisterhénne n, Si̦i̦sele n, Walperts- oder Walbe̥rtswil, Fräsche̥lz, Challnḁch.
Indem hier Naturkräfte den wilde n Heert 1 der an sich unfruchtbaren Molasse mit Pflanzennährstoffen siegreich überschütteten, taten sie im großen, was unsere Strafanstalten mit ihren reichen und billigen Arbeitskräften im kleinen tun. Besonders beim Grien abtecke n heben diese die Humusschicht der Kiesbänke sorgfältig ab und auf, um damit toten Boden z’überfüehre n, z’b’heerte n oder nach einem heimisch gewordenen Ausdruck der Kulturtechnik — z’kulmatiere n ( S. 39). Diese künstliche Nachhülfe ist eine um so wertvollere Arbeit, da gerade um Ins und Müntschemier die Moränendecke zwischen den genannten Zügen sehr dünn geraten ist. 2 |Gutachten über die neue Friedhofanlage von Ins. In Ins verloren ging |leider die von Pfarrer Gottfried Ischer in Mett, der als Theologe und als |Geologe gleich groß gewesen ist, äußerst sorgfältig ausgearbeitete |Monographie des Insergeländes anläßlich der Vorstudien für die Wasserversorgung. So z. B. im Blantscheli (Br.), wo der Rebbauer den Härd bloß e nchlei cha nn obe nfü̦ü̦r chrääberle n und d’Rääben un͜derḁ schaare n.
Wenn nicht der private Landwirt bei ebensolcher Arbeit grad ob sịm Flị̆ß müeßt verlumpe n, so wäre die Überführung aller unserer Niederungen mit Lättgrien ein außerordentlich gedeihliches Werk.
In anderer Art grienig (kiesig) oder san͜dig (1702: sandächtig, in Mụ̈. san͜dochtig, wie dick- und dünnlochtig, schwarz-, wị̆ß-, 49 roo̥tlochtig, usw.), wohl auch mit Blü̦ttersan͜d (Sandkot) durchsetzt, sind große Teile unseres Bezirks dank den Überbleibseln eines alten Gletscherschmelzflusses, der durch die Seelandsfurche zog. Es handelt sich hier um Abrieselungen aus den Schotterzügen von Alpengeröllen, dür chmischlet mit gelben Jurageröllen ( S. 38), wie namentlich die sieben Griengruebe n von Ins sie zeigen. Das ist das S. 45 angezogene Wassergrien.
Solche als Schottergruben ausgebeutete Kiesbankzüge besitzen die Orte Eiß, Müntschemier, Treite n, Si̦i̦sele n, Walpertswil, sowie östlich des Mooses Cheerze̥z, Fräschelz, Challnḁch, Lyß. Seltener und eben darum namengebend lagern solche Kiesbänke an Orten wie Gryon (Grien; vgl. die Gryonne: den Griesbach, la Grosière, von groise, Gries). 3
Was an den genannten Grienchöpf der Bodenkultur verloren geht, holt die vielgestaltige Technik ein, sowohl mittelst Beschotterung der Bahnen, Straßen und Wege ( Stra̦a̦ße ngrien), als im Hochbau. Man denke an die Zimäntwarenfabriken zu Lyß und Müntschemier und an die 1912 neben dem Bahnhof Ins in elektrischen Betrieb gesetzte internationale Betonmasten-Industrie. Die genannten Orte, sowie z. B. Stụụde n, das seinem Grien seine Gemeindesteuerfreiheit verdankt, tragen darum auch zu ihren Kiesbänken Soorg wi zum Zucker. Ins z. B. belegt seine g’mäine n Griengruebe n am Fạuffe̥rzweeg und im Chu̦chche̥lli immer wieder mit Verbot. Dieses Chu̦chche̥lli ist eine Einhöhlung, welche Kindern zum sonntäglichen Haushaltungsspiel dient, von dem in « Dach und Fach» aufgeführten Stäübi-Sammi aber als Wohnung benutzt wurde.
Solche Wertschätzung ist vollauf begründet durch die außerordentliche Herti des Kieses. Der ist so hert, daß er bloß gruebe ngrüen verarbeitet werden kann: frisch, wie der feuchte Erdboden der Grube ihn liefert. Der Ausdruck erinnert an die grüeni Säüffe n: Seife, die noch nicht abgelagert ist und darum unvorteilhaft gekauft wird; an das grüen Fläisch im Gegensatze zum geräucherten und gelagerten; an die grüeni Wunde n, welche immer nicht ansheilen und vernarben will. 4 | Stucke 71) zu grô, engl. grow (wachsen). Die Härte ist kalkhaltigem Wasser zuzuschreiben, das den Boden durchsickerte und die Sandsteinbrocken zu einer Art natürlichen Betons zusammenkittete. Besonders harte Partien heißen Kiesgalle. (Vgl. die «Niere» als fremder und andersfarbiger, harter Einsprengling. 5 ) Solche Chi̦i̦sgalle n, Stäi ngalle n heißt auch Galle n-, Gaale n-, 50 Gallstäi n. (Vgl. den Gallstei nacher, 1786: Galßstein, am Totenhof zu Brüttelen).
Unvermutetes und plötzliches Losbrechen solcher verwachsener Kiespartien von kleinem Geriesel bis zu Kubikmetergröße kann zu Unglücksfällen führen, wie letztmals am 6. November 1910 in einer Inser Steingrube. 6
1
Mhd. der
hërt, des
hërdes. Zur Sache vgl.
Gb. 44.
2
Vgl. das Croquis von Prof. Isidor Bachmann in seinem (einem Chorg. beigelegten)
3
Jacc. s.v.
4
Gr-ünen gehört eben, wie auch Gr-as (
Kluge 183 f.,
5
Schwz. Id. 2, 204.
6
Jahresber. Witzwil 1911, 2.
Wi wenn d’Möntsche n sötti wüsse n, wer ihnen die an sich so eintönige Molasselandschaft zu einem so vielsagenden «Antlitz der Erde» umgeschaffen, wer ihnen den Grund und Boden für ihr Mues u nd Broo̥t vorbereitet, und wer ihnen das Material für eine lohnende Industrie so z’hụ̈̆ffe nswịịs hingesäet, hat der Rhonegletscher da und dort e n Wị̆sịte nchaarte n la̦ n li̦gge n. Die sind, der Größe des Gebers angemessen, ordentlich groß und mehr handfest als handlich geraten. Auch ist ihre Schrift für Uneingeweihte rätselhaft. Kenner jedoch haben sie entziffert und damit die Herkunft festgestellt.
Der Hohle n Stäi n ob Twann, in der Nähe der reichlich mit Findlingen besäeten Twannbachschlucht, ist Montblanc-Granit. Den 270 m³ großen Block hat die Burgergemeinde Twann dem naturhistorischen Museum in Bern einsichtsvoll geschenkt. Montblanc-Granit ist auch der Längstei n über dem Gottstatterhụụs bei Biel.
Der 8 m³ große Block am Jäisbärg über Studen, im Pfahl daselbst, ist ein Granitporphyr. Sprenglöcher weisen auf eine früher beträchtlichere Größe.
Im Namen an die Tụ̈ụ̈felsburg erinnernd (einen künstlich geschaffenen, jäh zu 20 m emporsteigenden Kegel mit abgeflachter Spitze mitten im Wald zwischen Goßliwil und Rütti bei Büren), liegt in schwer auffindbarem Versteck auf dem Jolimont die Tụ̈ụ̈felsburg oder Tụ̈ụ̈felsbu̦u̦rdi. Die Naturforschende Gesellschaft Bern hat sie mittelst Inschrist als ihr Eigentum erklärt. Der Gottseibeiuns hat diese Arkesingneiß-Blöcke, deren größter 315 m³ mißt, aus dem Bagnetal im Wallis hergetragen, um sich eine Burg zu bauen und von dort unbeachtet auf das Tun und Treiben der Erlacher und Tschugger, der Gampeler und Galser aachḁ z’glụ̈ụ̈ßle n.
Unbedeutend erscheinen neben ihm die Inser Findlinge hin͜der Pfar rers Ịị nschlag, sowie an der Müntschemiergasse gegenüber dem «Fisch» (der jetzigen Wirtschaft Heinrich Schwab).
51 Unsere Hauptbetrachtung gilt begreiflich dem 25 bis 27 m³ groß erscheinenden porphyrartigen Walliser Granitblock 1 |für Erhaltung erratischer Blöcke, verfaßt von deren Präsident Dr. Eduard |Gerber, gehört er zu den Arollagneißen. nahe der Straße Eiß-Müntschemier. Die bernische Findlingskommission fand sich bewogen, diesen als rechten Feldstein so vor aller Welt offen auf dem Müntschemierfäll d da liegenden Koloß in besondere Obacht zu nehmen und unter die Aufsicht von Oberlehrer und Major Blum in Müntschemier zu stellen.

|
|
Studie von Anker |
Von jeher war dieser Block: der groo̥ß Stäi n (1648) immerhin vorwiegend ein Gegenstand sinnender Betrachtung, wenn nicht harmlosen Kinderspiels. Auf erstere deutet schon sein Name. Von unbekannt hohem Alter redet der Name Häide nstäi n. 2 So heißt auch ein Findling im Länghólz. Vor ihm hausen kleine grüne Männchen. 3 Flechten und kümmerlich gedeihende Moose benennen manchen erratischen Block als graaue n Stä́i n, Graaue nstäi n. Ein solcher, nach dem vier Häuser bei Feisterhénne n den Namen führen, und an welchen beiderseits die Graaue nstéi nmatte n stoßen, bildet die Grenze zwischen Finsterhennen und Si̦i̦sele n und schied damit vormals zwischen den Grafschaften Erlach und Bargen (Nidau). 4 Unterhalb Magglingen liegt, der Burgergemeinde Biel gehörend, der graau Stei n, wo d’Chin͜d drun͜der fü̦ü̦rḁ g’grabt wärde n. Der graue Stein zu Dotzige n hat zum Nachbarn den mit Gletscherschliffen gezeichneten blaaue n Stei n. Mit der Benennung Zäiche nstäi n ist der Versuch angedeutet, aus den mehr oder weniger regelmäßig scheinenden Ritzen und Vertiefungen einen Sinn zu erschließen. Und der Auffassung der schalenähnlichen Vertiefungen zumal auf dem Scheitel des Blocks als Einmeißelungen für ausgegossene (keltische) Trankopfer gilt die hauptsächliche, ja heute einzige Bezeichnung «Schalenstein». 52 Die inserischen Umformungen dieses Namens: Salle nstä́i n, Sólle nstäi n, Sóllerstäi n reden wohl von verdunkelter Vorstellung der Schale.
Die Opferidee, mit welcher allerdings die der Verhextheit konkurriert, 5 setzt also die Deutung unseres Steins derjenigen der Teufelsbürde strikt entgegen. Drollig jedoch erneuert sich an allen Riesensteinen der mythologische Zug vom Giganten, der in seinen «Siebenmeilenstiefeln» von Berg zu Berg setzte. Är het a n de n Zeefe n ( der Zeefe n ist die Zehe) gäng ḁ lso öppis wi n es Stäinli g’spǘ̦ü̦rt u nd nid g’wüßt, was das o ch isch, bis er entlig der Hoḷzbööde n 6 (Holzschuh) abzooge n un d ụụsgleert het. Du̦ ist du̦ das der Salle nstä́i n gsịị n, wo uf dem Müntschemierfäll d ligt.
Ein anderes dit-on knüpft sich an die starke Isoliertheit solcher Hartsteine, deren Umgebung und Unterlage oft so weit weggewaschen ist, das s es äim isch, si müeßi wagge̥lle n. Das wird denn auch wirklich behauptet vom Waggelistäi n oder Schwungstäi n bei Gäicht, 7 sowie vom Gnepfstein auf dem Pilatus, vom Palet roulant au Vuilly, von der Pierra rauland de Burtigny. 8 Der Zwölfistei n über Biel neigt sich in jeder Quatembernacht (mit der ein Vierteljahr beginnt), wenn’s Zwölfi schla̦a̦t. 9 Die Nachprüfung dagegen trotzig herausfordernd, chehrt si ch der Salle nstäi n allima̦l, wenn er g’chöört (oder g’höört) Mittág lụ̈te n. Ja, er tut das sogar drụ̈ụ̈ Ma̦a̦l, gleich wie der Palet roulant, welcher übrigens seinem Entdecker, dem Sekundarlehrer Jakob Süßtrunk in Murten (1840-1909), 10 |erschien 1910 in Murten (bei Strüby) eine anmutvolle Lebensbeschreibung mit |Süßtrunks sympathischem Bild. den deutschen Namen Süeßtrunkstei n verdankt. Doch, jene Herausforderung ist lauter Schein und Trug. Das erfuhr ein Inserknabe, dem der verfängliche Doppelsinn des «wenn» (das zeitliche quand und das bedingende si) entging. Er lies mit achtungswert gründlichem Forschersinn auf das Müntschemierfeld für ga̦ n z’luege n, göb e̥s de nn so sịịg. Dem Spott seiner Kameraden zuvorkommend, redete er sich daheim aus, jää der Stäi n häig’s nid chönne n g’chööre n, der Luft häig ’s lụ̈te n verweeijt. Hätte auch hier, wie unter der pierre à bot (Krötenstein) zu Perabot, 11 sich e n grooße r Chrott verborgen gehalten, so wäre ein verchlü̦̆pfe n als Erklärung des Nichtbemerkens dankbarer gewesen.
Unser Müntschemiererblock findet aber auch praktische Gründe zu seiner Erhaltung. Wie trefflich orientieren sich an ihm die Besitzer der 53 zerstückelten und zerstreuten Fluren! Da liegen, wie schon 1648 und 1678, 6 Mäß Acker oder ½ Juchart usw. «by Schallenstein», bim Salle nstäi n, hin͜der dem Salle nstäi n, voor am Salle nstäi n.
Und die Kinder aus all den Nachbardörfern am Sonntag Nachmittag! Was wäi n me̥r mache n? Chöömet, mier gange n zum Salle nstäi n! Da thronen wir zu Dutzenden auf dem Pyramidenstumpf, und de nn rü̦tsche n me̥r äi ns hin͜der dem an͜dere n d’Chrinnen abb; das gäit wi n e n Pfịịl! Für Knaben sodann, die schon etwas von Zwingherrenschlössern gehört haben, ist der Stein (wie der «Stein» zu Baden) eine solche Burg. Da jagen sie etwa mit dem losgelösten Vordergestell eines im Felde ruhenden Selbsthalterpflugs eine gute Weile um das Schloß herum. Dann geht’s auf genagelten statt gesattelten Rappen in möglichst lautem Trab die steilen Rinnen, das heißt: d’Schloßsteege n empor, bis die oberste Schale erreicht ist. Die dient als Feldkessel: in ihr wird soldatenmäßig g’chöcherlet,
Den vollsten Reiz des Blocks für die Kinderwelt zeigt seine (freilich nicht allzu feinfühlige) Hereinziehung in das Riti-Rößli-Lied:
Hụ̈ppe
n Hụ̈ppe
n Rösse̥lli!
Z’Bern isch es, Schlösse̥lli,
Z’Sollo̥du̦u̦rn es Glogge
nhụụs,
Luege
n drei Jumpferen ooben ụụs,
Äini spinnt Sịịde
n,
Di an͜deri hächlet
12
Chrịịde
n,
Di dritti tuet der Gatter ụụf.
Schịịn, schịịn, Sunne
n,
Z’Bern über
de
n Brunne
n,
Z’Eiß über
de
n Salle
nstäi
n!
Moorn chunnt ụ̈ụ̈se
r Vatter häi
m,
Bringt mier es Weggli häi
m
U
n dier e
n Schü̦ü̦bel Dräck a
n d’s Bäi
n.
Variante:
...
Di dritti luegt, ob niemmer chöo̥m,
Wohl! da̦ chunnt es Gịịgerli,
Das het ganz dräckigi Höösli aa
n.
D’Frạu wott ihm si nid wäsche
n.
O, di fụụli tonners Chlappertäsche
n!
1
Nach dem für 1909 erschienenen Jahresbericht der bernischen Kommission
2
Vgl.
Gw. 571.
3
Jahn KB., 80.
4
Ebd. 23.
5
Ebd. 22.
6
Interessantes Beispiel vom Vordringen der Mehrzahl- und Einzahlform, wie in der «Strümpf».
7
Ebd. 76.
8
Jacc. 546 nach
J. Olivier, canton de Vaud 333 f.
9
S. Bl. S. 1913, Nr. 9-11, mit drei Abbildungen.
10
Über diesen verdienstvollen Lehrer und Naturforscher
11
Jacc. 338.
12
Spassig sinnlos statt «schnätzlet».
So unfruchtbar die Molasse an sich ist: sie bildet dank der Saugkraft und der Undurchlässigkeit ihres tonigen Sandmergels einen trefflichen Quellenhorizont, während ihr durchlässiger Sandstein als Filter dient. Eine Dür re n-Mátt gibt es in Siselen, wie die Dür re nrääbe n zu Gampelen und Tschugg. Dafür zählt man auch hier nicht wenige Stellen, wo Wasser ụụchḁ sü̦̆chcheret (sickert) oder ụụsḁsooderet. So kommt es in tiefen Lagen zu Gieße n (kleinen ständigen Wasseransammlungen 1 ), 1312 Gissynei, Gesseney, als Dorfname nochmals verdrängt durch den Landschaftsnamen Saanen. Zimm. 2, 145. welche früher auch im Seeland zum ịị nbri̦tsche n und schwelle n: zum Anbringen von Schwel line n für z’wässere n anlockten. Einen Wässerungsstreit zwischen der Gemeinde Siselen und ihrem Bürger Schwab mußte 1704 Bern schlichten.

Aus Ins
In den Ausschwemmungen über dem Molassegrund herrscht also ein gewaltiger Wasserreichtum, der schon aus Stu̦u̦be ntäüffi, jedenfalls 55 aber aus höchstens 5 m Tiefe heraufgelockt werden kann. Stellen, wo es zu eingesteckten Röhren ụụfḁ rạuchnet, laden zur Anbringung eines einfachen Pumpwerks ein. So im Púmpenacher zu Brüttelen, im Geometerdeutsch als «Baum»- oder «Pumpbaumacher» erklärt. Pumpe n ist der gut seeländische Name für Sood. Manch einen Brünnen uf der Witi u̦sse n würde nach älterer Vermutung 2 der jurassische Name Chappate als das caput, das Haupt, den Anfang, den «Ursprung» eines Hausbrunnens hinstellen. Es gibt eine Flur im Tschäppit zwischen Ins und Vinelz, einen Tschäppitacher zu Vinelz und zu Treiten. Zu Gütern umgewandelte Fluren dieses Namens in dem wasserarmen Jura konnten leicht ihre Bezeichnung Tschäppat, Tschäppät (so zu Bözingen) auf den ersten Eigner übertragen.
Heute verdanken der eigenen Wasserversorgig, welche nunmehr im ganzen Seeland nach den Errungenschaften der neusten Technik ins Werk gesetzt ist oder wird, bereits viele Ortschaften d’s Wasser (in Stall und Küche). Im Jahre 1913 sind das an sich wasserarme Si̦i̦sele n, sowie Feisterhenne n, Treite n und Brüttelen am Werk, eine Brütteler Quelle zu gemeinsamer Wasserversorgung heranzuziehen. Im Verlaufe des letzten Jahrzehnts haben die Gemeinden Schu̦gg, Gample n, Gals, Vine̥lz, Lü̦sche̥rz, Müntschemier und das kleine Mụlle n Hydrantenanlagen erstellt. Erlḁch besitzt seine Wasserversorgung schon seit dreißig Jahren (s. u.). Müntschemier het d’s Wasser seit 1910, Eiß si̦t An no Feuf. Das Réserwaar für die Hauswasserversorgung und für die 29 Hydranten von Ins liegt in Herre̥chs-Mátte n unten am Gäichberg. Die Quelle heißt (der Ort) i n der Fŏvarsche n (s̆s̆). In Ortschaften aber wie Ins flossen vor solcher Versorgung und fließen noch jetzt neben ihr stattliche Dorfbrünne n, zu gemeiner Viehtränke und zu polizeilich geordnetem Waschwerk mächtige Wasserstränge in die riesigen Tröög aus Sollo̥duurnerstäi n oder aus Zimänt werfend. Der Brünne n (in Erlach sagt man: der und die Brunne n) 3 ist also auch hier nunmehr der läüffig Brünne n, mit Zurückdrängung des Grundbegriffs der Quelle. Nur alte Flurnamen reden noch im Sinn der Gampeler Fu̦ntene n (woher die Namen Fu̦ntene n-Rääbe n, -Grabe n, -Schrache n) von einem Ha̦a̦l de nbrünnler, einer Brünnelizälg, einer Brünnmatte n, einem Scha̦a̦fbrünnli, einem Bandbrünne n und dem Graafe nbrünne n, einem Acker beim Schụ̈feli- (1662), Galge n- (1662), Schwarz-(1855), Fạufferts- oder Fạuggers- (1701 auch Fauwerts-), Chächs, Ludiß (1663) -Brünne n, Maartis 56 Brünnli, von Reben bei dem Brunnen von Schaffis (1386), vom Schänzlisbrunne n (1533: Schändelsbrunnen) zu Twann, vom Spülbrunnen vor dem obern Tor zu Biel (1361). 4 Der Chlingelz (1648: Klingelz-) Brünne n an der Gampelenstraße rauschte zu Zeiten weit umher vernehmlich. Zumal in stiller Nacht het er förmlich g’chlingelet. In ältern Urkunden wird er als «lebendiger Brunnen» bezeichnet. Auf Tuffgehalt deuten Namen wie bi’m herte n Brünne n (1647: Hertenbrunnen) zu Brüttelen. 5 Um einen «Gutenbrunnen» (vgl. «Muffetan») 6 handelt es sich in vollstem Maße bei Holzmüeterlis Brünnli am Ostrand des Eschenwäldchens bei der Mụụrstụụde n. Der heimelige Name gilt den zwei schweigsamen, menschenscheuen kleinen Frạueli, welche auf dem Weg der Zwergensage in die neolithische Zeit der Mongoleneinwanderung zurückreichen. Von einer einst vollständigen Sage ist bloß noch der Rest erhalten, welcher folgendes erzählt: Nahe dem Haus Jampen am Ende der Möntschemiergasse n war eine Gruppe Eißer mit Hanf räite n (Abziehen des Bastes mit der Hand) beschäftigt. Die beiden Holzmüeterli näherten sich halb neugierig, halb furchtsam. Plötzlich wurde eins der beiden erhascht und zur Kurzweil ins Dorf geführt. Das andere konnte ihm bloß noch Nachrufen: Si e möge n di ch fra̦a̦ge n, wás si wäi n, seeg ämmel ai n Sach nie: für waas der wị̆ß Haaber sịịg. 7

|
|
Vom Brunnen des
|
Jedenfalls also findet, wo noch heute nötig, der Brünne ngreeber oder Brünne nmäister leicht Wasser. (Ein solcher wurde um 1832 in Lüscherz mit jährlich 2 Kronen 10 Batzen bezahlt.) Er bedarf dazu weder des neuen Deinertschen Mikrophons, noch der alten Kunst des Wasserschmeckers, der seine fischbäinigi 8 oder haasligi Ruete n spielen läßt. (Um 1828 lebte in Ins der Wasserschmecker Schmutz, ein geschickter Mann, aber ein Hudel.) 9 Wie gut, wenn auch auf Jurahöhen statt des Zị̆stäärne nwassers «lebendes Wasser» auf solchem sich entdecken ließe!
57 Sicherer ist allerdings die Häufigkeit als der Einzelreichtum der Quellen. Es gibt neben wasserreichen Brunnen auch Brünneli, welche bloß e̥n e̥ren Eerbs groo̥ß chöo̥me n. Daher war 1639 Bern zufrieden, wenn Erlach dem Amtmann wenigstens Erbs groß Schloßbrunnenwasser gewährte. 10 Eine Gutsverschreibung aber forderte 1780, daß der Brunnen eine «zwey lotige Röhre voll Wasser» liefere. Das sollte heißen: ein Röhrchen, in welchem eine Bleikugel von zwei Lot 11 Schwere genau Platz hat. Das gute Schließen der (noch nicht papiernen, nicht einmal ịịsige n oder heertige n, sondern bloß erst) holzige n Dünkel mit eisernem Dünkelring und das fleißige Entfernen der Strange n von Conferva reticularis (barba de fontanna) war hierzu ein strenges Erfordernis.
So stattlich aber die meisten Dorfbrunnen aussehen: des künstlerischen Schmucks entbehren sie wie anderwärts auf dem Lande. Ein Twanner Brunnenstock trägt das Dorfwappen. Damit erinnert er in gewisser Beziehung an die Jaquemars (Jaques et Mars) in Neuenstadt, will sagen: das mit den Figuren der Apostel Jakobus und Markus gezierte Brunnenpaar. Vom Brunnen, welchen der durch sein tragisches Schicksal bekannte, 1749 zu Bern enthauptete Samuel Henzi aus seiner Besitzung in der obere n Budlei zu Vinelz hinstellte, sind bloß noch dislozierte Einzelteile vorhanden.
1
Nach solchen benennt sich Gießenen, 1228
Gissinai, 1285
Gissine,
2
Vgl.
Zimm.
3
Kluge 73;
schwz. Id. 5, 660;
Gb. 307 ff.
4
Font. 8, 389. 630.
5
Schlaffb. 1, 145.
6
Über
Bnunfotan, 1490
Boffetan, 1445
Monfetan aus
Bunfontana (1270),
Bonnefontaine. Stadelmann im Arch. Fbg. 1900, 368 f.
7
Zur Aufhellung vgl.
Gb. 517, Note 65.
8
Eine solche besitzt Karl Irlet.
9
Kal. Ank. — In lustiger Verspottung des Streits zwischen sehr seltener Veranlagung und häufigem Schwindel läßt
Favre 164 mittelst der Haselrute im Moosheuhaufen Mahlzeiten finden.
10
Schlaffb. 1, 138.
11
Vgl.
Kluge 294.
Kleine mineralische Beigaben zum Wasser stempelten auch einige Seelandsquellen zu Gesundbrunnen. So in dem 1301 erstmals verurkundeten Woorbe n 1 samt dem Neúbad. Eine Zeitlang ward auch das Längnauer Bad besucht, bis das benachbarte Bachtele nbad zu Grenchen es verdrängte. Durch Abbrennen dem abrịịße n zuvorgekommen ist am 23. November 1909 das alte, aber längst aufgegebene und schließlich auch nicht mehr bewohnte «Dettlige nbad» bei Aarberg, am Platze des einstigen Frauenklosters Tedligen (s. «Twann»). Es war eins 58 jener Fräßbeedli nach Art des noch bestehenden zu Lụ̈terswịl im Buechibärg.
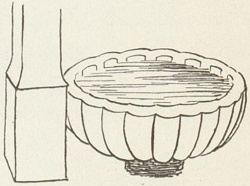
|
|
Vom Brunnen des
|
In mancher Hinsicht ein Prototyp hochmoderner Vergnügungsorte war dagegen das einstige Brüttele nbaad, und zwar derart, daß es uns auch noch in den Chorgerichtsverhandlungen begegnen wird. Noch reden von ihm der Baadwääg, das Baadguet, der Baadbach und (1757) der Baadacher. Der kleine Gehalt des Badbaches an kohlen-, schwefel- und phosphorsauren Mineralien 2 verschaffte ihm zunächst einen gewissen Zulauf aus der Umgebung zum baade n und schräpfe n, wofür 1658 der Baader Hans Wißler, um 1668 der Baader Hans Geißler zur Verfügung stand. Wie die Stadt Erlach ein eigenes Badhaus hatte, so befand sich auch zu Ins eine alte Badanstalt, die durch einen Schräpfer bedient wurde. Im Baadchaste n konnten die kranken des Landgerichts Ins unentgeltlich baden und sich schröpfen lassen. Die Kosten wurden aus dem Ertrag des zugehörigen Waldes, die Baadersboodele n genannt, bestritten. Der seit 1481 auf demselben lastende Bodenzins von einem Schilling wurde später losgekauft. 1850 kam der Wald an die Burgergemeinde. Diese verzichtete aber auf das Bad, das längst nicht mehr besucht worden war, obschon es sich seit dem 18. Jahrhundert bis zum Brand von 1848 im Gemeindehaus befand. 3

Studie von Anker
59 Solche nur zu «offizielle» Unterbringung eines Bades kam dem einigermaßen abgelegenen Brüttelenbad mit seinen Gelegenheiten zu dem so häufig geschilderten «Badeleben der guten alten Zeit» zu statten. Dies um so mehr, da der alles umfassende Tagespreis von 4 bis 5 Franken um 1843 4 ein gewisses high life auch für bescheidene Börsen zuließ.

Das Brüttelenbad als Bad (bis 1877)
Die Lage des Platzes lockte bereits 1652 einen Ludwig Baudritsch, sich vom Berner Rat um 10 b Bodenzins das Brüttelerwasser hinleihen zu lassen. Die «Herbrig zur Losierung der Baderleuten» 5 baute er aber doch nicht, und der im nämlichen Jahr sich meldende Konzessionär Matthys Wäber durfte bloss «by der Pinten Wyn usschenken, doch ohne Ußhenkung eines Schilds.» 6 Das im Gut des Ammann Wäber entspringende Badwasser aber wurde 1654 diesem übergeben, weil Baudritsch «es in schlechten Ehren haltet». 7 1667 durften die Kinder des N. Wäber das unterm 11. Dezember 1652 bestätigte Wirtschaftsrecht von Treiten nach Brüttelen versetzen. Eine «komliche 60 Behausung für die Badegäste unter Aushenkung eines Schilts» 8 ward neuerdings zu bauen bewilligt. Das Badhaus samt Zubehörde kam 1722 an Hauptmann Albrecht Gürtler von Bern, 9 um 1730 an Fürsprech Rudolf Kasthofer von Bern. Dieser ließ 1737 das noch bestehende steinerne Gebäude aus soliden Gewölben aufführen und gab ihm die Scheune bei. Regierungsstatthalter Müller von Nidau erhöhte die Zahl der Zimmer auf zwanzig und die der gewölbten Badchämmerli auf zehn. Auch sonst vergrößerte er beide Gebäude und vermehrte sie durch eine zweite Scheune, durch ein Kaltbadhaus, ein Gebäude für Douchen und zwei Wellenbäder. Schöne Anlagen und Spazierwege, Baum- und Gemüsegärten vollendeten die Einrichtung derart, daß das Kaltwasserbad Brüttelen sich zu einem schönen Erfolg aufschwang. Am 25. Oktober 1818 wurde es versteigert. Um 1860 kaufte Dr. Juillart das Bad und baute es zu einer neuen Kaltwasserheilanstalt um. 1877 verkonkursiert, fiel es an die Erben Müllers zurück. 1886 übernahm der bernisch kirchliche Ausschuß für Liebestätigkeit das verlassene Herrschaftsgut und wandelte es zu einer Anstalt für Epileptische um. Als diese 1890 nach Tschugg versetzt wurde, machte die bernische Regierung ans dem Brüttelenbad eine Erziehungsanstalt für Mädchen.
Das war ein empfehlenswertes Ende des Heer re nbaad, zu welchem dies und jenes Fräßbeedli in charakteristischen Gegensatz tritt oder trat. Denn nicht alle diese vermochten es, durch Aufwart mit Föörnli, Chalbsbra̦a̦tis, Schlụ̈fferli und süeßer Nịịdle n bei der weiblichen Aristokratie der Bụụrsami Tag um Tag Ee̥hr ịị nz’legge n und damit eine erdrückende Konkurrenz auszuschalten oder auszuhalten. Es gehörte und gehört hierzu eine raffiniert schlichte Gediegenheit des Betriebs.
Da gi bt’s käini Menus, wo im Chuchiwältsch dem Hördöpfelstock pomme purée seege n. Dḁrfü̦ü̦r tuet ’nḁ n aber d’Pụ̈ụ̈ri, wo o ch grad Wi̦i̦rti isch, mit dem Mosterli (auch Hördöpfelstungger genannt) sälber stungge n un d uf der Blatten aa nrichte n halb so höo̥ch wi d’s Stockhorn. Käi n chef de cuisine brụụcht i n wị̆ßer Chu̦tten u nd Chappe n si ch cho n z’spienzle n, u nd käi n Chällner tuet i n der schwarze n Chutte n mit länge n Fäcke n umenan͜dere n fäckle n. Portie r isch erst rächt e̥käine r da̦, für in e̥re n Sekunde n en iedere n Gast bis i n di innersti Täüffi vo n der Seel u nd vom Gäldseckel z’dür chluege n. A n sị’m Platz, u nd no ch am Platz vo n sächs andere n isch der Hane̥ß, oder guet eißerisch der Höüß da̦, nid öppḁ der Jean oder der Schang. Der Höüß g’schi̦i̦r rnet d’s Lịịsi u nd spannet’s aa n, wenn öpper am Bahnhof 61 isch z’räiche n. Der Höüß nimmt d’Föörnli oder d’Pfärid 10 us dem Trog fü̦ü̦rḁ u nd nimmt si ụụs. Dem Gü̦ggeli hạut der Höüß, ohni ’s z’martere n, mit dem Handbieli der Chopf ab. U nd d’Schueh putzt der Höüß, daß si glänze n wi n e n Spiegel. De̥rwịịle n rụụmt d’s Röo̥si du̦ssen u nd di̦nne n ụụf u nd bettet u nd wü̦scht. Dḁrna̦a̦ ch gäit es si ch gläitig ga̦ z’wägmache n, steckt es Lạube nneege̥lli oder es Márgrịtli voor ịịhḁ i n d’s gu̦feriert Mänte̥lli u nd gäit ga̦ n säriviere n u nd lạuft mit dene n volle n Blatte n u nd leere n Täller wi d’s Bịịse nwätter. Was cha nn da̦ am Ụụfwaart no ch mangge n? 11
1
Gohl, die Mineralquellen von Worben (1854); Heilquellen 311 f.
2
Nach Pagenstechers Analyse von 1839.
3
Stauff. 73.
4
Prospekt von Besitzer Müller und Badearzt Gyger, mit schönem Bild.
5
RM. 112/189; 20. Febr.
6
RM. 115 bis 163; 11. Dez.
7
RM. 120/53. 184; 30. März und 1. Juli
8
TSB. u./G. UU 248; 20. Febr.
9
Ebd. EEE 683; 15. Sept.
10
S. im Twanner Kapitel «Fisch».
11
Nach Redaktor Rutsch
Ein einziger Blick auf das Kartenbild des Seelandes macht glaubhaft, daß letzteres an hi̦lbe n (milden) Örtlichkeiten nicht allzu reich ist. Allerdings ist sein Gesamtklima so mild, daß in dem 436 m hohen Wi̦tzwị́l das du̦sse n schaffe n fast das ganze Jahr durch möglich ist, und daß in dem von 473 bis 497 m ansteigenden Dorf Eiß eine Pflanze wie die Yucca im Freien der Winter ma g haa n. Auch ist es eine bekannte Rede, e̥s sịịg im Seeland um e̥ne n Chu̦tte n weermer weder z’Beern.
Das ist dem Umstand zu danken, daß die Seen Wärmespeicher sind. Während des Sommers erwärmt sich das Wasser bis zu einer bestimmten Tiefe; im Winter gibt es die Wärme langsamer als die trockene Erde an die Luft ab. So kommt es, daß über dem linken Bielerseeufer die Reben bis auf Schärne̥lz ( Cerniaux, 614 m) gedeihen. Es wird denn auch der Juragewässerkorrektion zugeschrieben, daß der seeländische Weinbau an Sicherheit des Ertrags und daher an Ausdehnung zurückgegangen ist.
In der Tat vollzieht der Wärmezustand des heutigen Seelandes starke Pendelausschläge bis zu recht empfindlichem frische n (es frischet), ja bis zum staare n (erstarren) der Finger, drum auch bis zum recht häufigen Erfrieren der Reben im Vorsommer, und anderseits bis zu fast unerträglicher Hochsommerhitze im Moos. An diesem starken Wechsel beteiligt sich ein reiches Leben im Luftmeer.
Da gibt es alle Abstufungen vom leisesten lü̦ftle n bis zum lufte n, das s mḁ n chụụm meh cha nn sta̦a̦ n, bis zum wüetige n G’walt des Sturms, dessen Toben auch Welsche mit sturma bezeichnen. Der 62 zweimalige Sturmschaden in den Wäldern vor und nach Neujahr 1912 ist noch in aller Erinnerung.
Wie anderwärts, heißt auch hier sowohl der Wind, wie speziell der Westwind: der Luft, und man orientiert sich: lufthalb dem und dem Ort, wie bịịse nhalb, sunne nhalb und beerghalb oder beergsịts, schatte nhalb oder Schattsịte n. Ehemals bezeichnete man die Südrichtung als alpe nhalb, oder (1540) «alpwindshalb» neben «oberwindshalb» 1 die Nordrichtung als gästlere nhalb. Vgl. «berg windts halb» 1573. (Gäserz.) Als Reege nluft indes unterscheidet man den letztern deutlicher vom Nordwestwind als dem Beergluft, dem Südwest- oder Südwind als dem Frịịbe̥rg- oder Murte nluft und vom Nordostwind als der Bịịse n.
Der Frịịbe̥rgluft zieht (bla̦a̦st) nicht häufig, was dem Inser meist auch lieber ist. Im Sommer bringt er gern Gewitter und, wie im Frühling, zudem jenen anhaltenden Regen, der die Pflanzen zu vorschnellem Wachstum anreizt, um sie dann der Erschöpfung preiszugeben. In die Weinberge bringt er obendrein Fäulnis der Beeren. Nimmt er aber, ohne Regen auftretend, den Charakter des Föhn an, so tröchnet er ụụs wie der guggisbergische «Schịịrbiluft», 2 wie der séchard, setschar, setzar des Genfersees. Bloß im Frühherbst ist er willkommen, für d’Trụ̈ụ̈bel mache n z’rịffe n.
Als Freundin der Reben im Vorsommer gilt dagegen die Bịịse n, weil sie durch fu̦rtbla̦a̦se n der feuchtwarmen Nachtdünste dem faltsche n Meltạu das Gedeihen unmöglich macht. Es gilt dies jedoch bloß von der chalte n Bịịse n, welche von Biel her gegen Ins zu bläst, aber freilich auch den See mit ihren Launen nicht verschont. Zumal im Nachwinter kann sie einige Tage lang wild über den See tollen und die kalten Wasser zu hohen, schaumgekrönten Wogen aufpeitschen, die sich donnernd am Ufer und den Dämmen brechen. Aber so lang d’Bịịse n gäit, g’frụ̈ụ̈rt der See̥ ni̦i̦d. Da sie jedoch gleich allen strengen Herren nur kurz regiert, kann das Wasser überraschend schnell ruhig werden und gefrieren: Der Nordwind zieht dem Wasser einen Harnisch an. 3 Von der kalten unterscheidet sich sehr stark die über Kerzers her wehende Beernbịịse n, schwarzi Bịịse n. Gleich der bisa, (als welche auch eine schwarz- und hohlwangige, hohläugige Weibsperson bezeichnet wird) 4 und der vouairai des Genfersees stürmt sie hie und da im Begleit der gefürchteten Gewitter einher. Im Winter aber bringt sie Tauwetter. — In Richtung und Charakter zwischen beiden Bisen die Mitte haltend, bläst ein Nordostwind im Winter oft schneidend 64 kalt, indes er im Frühling Regen bringt, damit die Baumraupen sich rasch entwickeln läßt und Ausfall der Obsternte verschuldet. 5

Studie von Anker
In allen Spielarten aber vermag die Bise Flugsand bei 300 m weit durch offene Fenster in die Stuben zu werfen. Wo sie zum Ersatz der Kellertiefe San͜d aa nschüttet, ist sie freilich eine willkommene Gratisarbeiterin.
Hören wir ein Loblied auf die Bise von einem Stadtberner, 6 der von Müntschemier gegen Erlach wanderte. ... Vom Jura sich es dḁrhaar choo̥ n z’zieh n wi di wildi Jagd. Es het äi’m fast der Aa̦te m verhaa n. D’Teligraafe ndröht häi n g’su̦u̦r ret u nd men’gist g’sunge n wi mit ere n höo̥che n Wịịberstimm, u nd d’Teliffondröht häi n mit eme n täüffe n Paß drịị n ịịchḁ g’oorgelet. Über d’s Moos e nwägg het dä r Luft g’chụttet wi der Tụ̈ụ̈fel. U nd wo n e n Saarbaum uufrächt ’bli̦i̦ben isch, wi äine r, wo öppis uf ihn sälber het, da̦ het er si ch doch müeße n chrümme n, wi vor emen alte n Landvogt. Jä, das ist eebe n d’Bịịse n! E n Chrääij, wo ụụfg’floogen isch, isch grad un͜der äinisch öppḁ zwänz’g oder driß’g Schritt hin͜dertsi ch tri̦i̦be n worte n. Nummḁn ḁ-nere n Leerche n het’s nụ̈ụ̈t ta̦a̦ n; di isch bolzgradụụf g’schosse n u nd het mit eme n lustige Liiri liiri lii di Mụ́sig vo n dene n Dröhte wit ubertönt. Aber mi ch het blötzlich öpper im Äcken ergriffe n, un d um mi ch ummḁ isch es under äinisch ganz schwarz worte n. En unerchannti Wulche n, wo ihre n Schatte n bis uf de n Booden aahḁ g’woorffe n het u nd di ganzi Bräiti z’ringet um ụụsg’füllt, het vorwärts g’jagt, wi d’s wüetig Heer. Wo si isch furt gsi̦i̦ n, isch di ganzi Geege nt wit u nd bbräit ḁ lsóo̥ äi ntönig grüengeel bi vor mer g’leege n, das s ma n zwüsche n de n Matte n un d dem Wald und de n Flüeh fast gar käi n Un͜derschäid g’merkt het. Das cha nn eebe n nummḁ n d’Biise n. Si zieht, ḁlso z’seege n, d’Landschaft us enan͜dere n, währe nd däm der Föhn d’Berge n z’seeme nstooßt u nd d’Farbe n vo n der Landschaft glaariger macht, weder daß si sịị n.
Ein zweiter und für die Westschweiz eigenartiger Hauptsendling des Jura ist der von Nordwesten blasende Beergluft: der jorat oder joran, jorran, dzorran, djoran, djorrein, 7 gelegentlich umgedeutscht: der Jurte n. Unsere Gegend kann ihn vom Chasseral (vo n der Gäschlere n, vom Gästeler) oder vom Chaumont ( Schụ̆mung) her erhalten. So oder so kann er blasen, daß der Welsche sagt: il faut un joran à décorner les boeufs; 8 der Deutsche: es frißt äi’m fast d’Ohren abb. Der weiß drum auch, warum ihm dieses Haus oder jener Garten du côté du joran 9 oder (1498) devers joran (wie devers bize, devers 65 vent) liegt. Tritt aber der Bergluft am Abend auf, so herrscht am ganzen folgenden Tage schönes Wetter. Weht er am Morgen, so ist Regen sicher. Mi soll si ch nu̦mma n d’rụf achte n! oder: Mi soll si ch däm beachte n! Nicht so sicher ist dies beim Wehen über Tag. Zudem gefährdet solches, namentlich bei heiterm Himmel, im Frühling die Blüte und den Fruchtansatz des Obstes, im Vorsommer das Blühen der Reben und im Herbst das vollsaftige Ausreifen der Früchte. Diese springe n ụụf und weerte n stäinig.
Von besonderer Tragweite ist dieser Nordwestwind für die Schifffahrt. Er ist es wegen der Heftigkeit und der überraschenden Unberechenbarkeit, womit dieser Fallwind als Gegenstück und verkleinertes Abbild des Alpenföhns und speziell des in Neuenburg bekannten uber 10 von den steilen Gehängen des Jura zu Tale stürzt. Er gleicht hierin nicht sowohl dem gemilderten jorasson, als vielmehr der überaus heftig von Südost her blasenden vaudairs des Genfersees. 11 Da windspi̦i̦let’s; da wird, wie auf den Juraseen, d’s Wasser i n d’Höo̥hi g’lüpft u nd ’träit, und die Schiffer finden oft kaum Zeit, die Segel einzuziehen.
So konnte es zu Wasserhosen wie am 3. Juni 1912, besonders aber zu jenem fürchterlichen Unglück des 25. Juli 1880 kommen. An diesem prächtigen Sonntag überfiel der Jorat die auf der Heimfahrt begriffenen Fahrgäste des kleinen Bielerseedampfers Neptun zwischen Petersinsel und Engelberg urplötzlich und versenkte siebzehn Personen aus Ligerz, Twann und Biel rettungslos in die Tiefe, indes der nach dem Ufer schwimmende Sekundarlehrer Zigerli der Erschöpfung erlag und nur zwei Gerettete vom Schrecken des Geschehnisses erzählen konnten.
Letzteres ist übrigens nicht ohne Vorgänger. Am 24. August 1609 an Sant Bartholomei märkt sind zu aben um die 8 uren 7 personen, 4 von Twan, darunder ein Vater und 2 sön des gschlächts Perro und 3 von Wingreiß in einem Thuner heimwärtz zu faren vorhabens gsin, welche ein luft ergriffen, und sind die 4 von Twann und 2 von Wingreiß ertrunken, der eine aber, Joseph Rößeli (Rö̆ßelet, Rosselet) gnampt, har sich am Thunerli erwütscht und ist durch den luft an das land triben worden. 12 Schon neun Jahre zuvor ereignete sich ein ähnliches Unglück. Am 20. April 1600 sind zu Gerlafingen 10 personen in ein thuner in gsessen und hand gan Thwan fahren wöllen. Do hat sy ein gächer ( gääije r) bergwind erwütscht, den Weidling ( Wäidlig) umgeschlagen und sind 7 personen ertrunken. 13
1
SJB. A 162.
2
Gb. 57.
3
Sirach 43, 22.
4
Brid. 40.
5
Stauff. 25.
6
Bh. im «Intelligenzblatt»
7
Bull. 3, 14 ff. von Gauchat;
Brid. 117. 207: Neuchâtel 19.
8
Favre. 151.
9
An der Umdeutschung «Jurten» ist auch der Jorat zwischen Lausanne und Milden beteiligt.
10
«Weißwind»,
albaria (aus dem hellbesonnten Süden):
Bull. 2, 64-67.
11
Brid. 402.
12
Schöni im Taschenb. 1900, 275.
13
Ebd. 271.

Suuri Hämmi (Studie von Anker)
Das bewegliche Leben in der Atmosphäre bringt dem Seeland gemäß dem alten Spruche
Morge
nroot
Bringt G’witter vor dem Aabe
nbroot
1
auch nicht seltene Gewitterkatastrophen, welche der strotzenden Vegetation zusetzen, das s e̥s Sün͜d e̥l 2 Schaad isch. So den Hagel am 4. Juni 1910 im Erlacher Amt und ain 19. Juni 1911 im Nidauer und Büren Amt. Hören wir einen Augenzeugen 3 über die unerhörte Heimsuchung der Dörfer Tschu̦gg, Gampelen und Gals am erstgenannten Tage.
Wär no ch a n dém Tag us dene n grüene n Wälder u nd saftige n Matten uf dem Scholimong aachḁ choo̥ n isch dür ch Schụgg dü̦ü̦rḁ geege n Gample n zue u nd di prächtige n Reebe n am Räin g’seh het, un d de nn uf dem Gample nmoos äi n Wäizenacher fast am anderen aa n, u nd witer u̦sse n die Matte n mit dem büürste ndicke n Gras u nd dḁrzwüsche n di Mŏsgeerte n mit de n hööchen Eerbs u nd dene n Bohne n, wo scho n ̣ụuhḁ g’chleeberet sịị n, däm het d’s Heerz im Liib müeße n lache n. U nd vo n allem dĕm isch am Aa̦ben d äm halbi achti nụ̈ụ̈t meh gsi̦ị n! In e̥re n Bräiti von e̥re n guete n Halbstun͜d alls verhaaglet un d i’ n Booden ịịhḁ g’schlaage n. — Wi isch das choo̥ n? Um de n sibnen ummḁ si n dicki, schwarzi Wulche n dahaar choo̥ n vo n dreine n Sịte n: vom Jura hee̥r über Lan͜dero̥ n un d über de n Scholimong, vom Mistelacherberg hee̥r über 67 Witzwil, un d vom groo̥ße Moos hee̥r über Eiß dem Scholimong na̦a̦ ch. Mit dém Zug het’s aa ng’fange n. Un͜der äinist isch es choo̥ n u nd het g’sụụset u nd gru̦mpụụßet u nd g’rumplet und ’bbrätschet u nd ’zwickt ganzi zwänz’g Minute n lang in äi’m furt. Es het nid chönne n hööre n. Dier chönnet e̥ uch dänke n, wi di Lụ̈t dem verbrätsche n vo n allnen ihrne n schöne n Sache n häi n zueg’luegt, we nn si uberhaupt häi n döörffe n luege n. — Wo’s du äntlige n, äntligen isch vorü̦ü̦berḁ gsi̦i̦ n, wi het das ụụsg’see̥h n? Di ganzi Geege nt en e inzegi chalti, tooti Landschaft wi mitts im Winter. Hagelstäine n si n da̦ g’leege n bạumnußgroß u nd häi n der Boode n überdeckt e n Schueh höo̥ch, das s mḁ n no ch z’moornderisch ganzi Hampfele n het chönne n z’seeme nleese n. Käi ns grüens Bletteli niene n, käi n ganze r Halm! U nd d’Bäum g’see̥h n drịị n, wie wen n si n e n Schwarm vo n Häümeeder (oder Häügümper) verfrässe n hätt, oder wi wen n e n Fụ̈ụ̈rsbrunst über si g’gange n weer.
Es bestätigte sich an diesem Unglückstag, wie überhaupt die Moore mit ihrem ansehnlichen Wassergehalt zu den hauptsächlichen Herden des Hagelschlages gehören, und wie insbesondere der Gewitterzug zwischen Neuenburger und Bielersee einerseits und dem Voralpenland anderseits zur Auslösung von Hagel geneigt ist. 4 Hindert doch hier kein hinlänglich dichter und geschlossener Wald wie zum Beispiel zwischen Neuenstadt und Tschaafis oder Schaafis (Schaffis) den Aufstieg heißer Luftströme zu der 8000 m hohen Grenze der untersten Temperaturschicht, wo in der plötzlichen Abkühlung um vielleicht 10° die Graupeln sich bilden! Drum: nu̦mmḁ n gäng der Waldsḁum la̦ n sta̦a̦ n, wie nachhaltig man auch schwenti (Kahlschlag und Rodung übe)!
Der Wassergehalt vom Moos und See zieht o ch d’s Wätter aa n, das s es ganz bränzelig schmeckt und das s es schießt (daß der Blitz einschlägt), ohne daß damit die Gefahr von dem höher gelegenen Eiß abgewendet würde. Gerade in der Umgebung des Kirchenhügels het’s innert fü̦fz’g Ja̦hr sächs Ma̦a̦l ịị n g’schlaage n u nd zwöo̥ Manne n ’troffe n. So am 4. August 1883 den Peter Widmann. Das Fehlen von Blitzableitern auf den Häusern ist daher nicht recht verständlich.
Bei dem beträchtlichen Abstand der plötzlich eintretenden Extreme von häiß u nd chalt ist es begreiflich, daß den Geschossen von Blitz und Hagel der Panzer der winterlichen Eisdecke an gelegentlicher Mächtigkeit entspricht. Sehr erklärlich ist es, daß in den von Binsen eingeschlossenen Uferpartien des Sees das seichte Wasser leicht gefriert und mit seinen prächtigen Eisflächen jeden Kleinen, der nid e n Gfrü̦ü̦rlig isch, 68 anlockt. Nicht so bald dagegen ist der offene See ịị ngfroore n. Am ehesten geschieht dies, wenn bei einer Winterkälte bis auf etwa 17° die Bise den See in seinen Tiefen aufwühlt, zum wochenlangen Rauchen und Dampfen bringt, dann plötzlich eine windstille, sternenhelle Nacht eintritt, und gar etwa im Weedel «das Mondlicht breitet weiße Seide ringsumher». 5 Dann bildet das bis in beträchtliche Tiefe abgekühlte Wasser auf dem Bielersee eine einzige Decke, welche erst «bei aufschließender Witterung» (1703) einbricht. So 1297. 6 So 1599, wo man zu Nüwenstatt holtz und ganze lantfaß mit wyn über den See führte, und wo die gfrüre gwärt hat bis in den mertzen. 7 So gefror auch 1766 der Bielersee derart, daß am 8. März die Effekten des in Twann aufziehenden Pfarrers Hemmann durch achtzehn Knaben auf Schlitten von Nidau her über den See gezogen wurden. 8 1846/47 het ma n schweeri Mistfueder vo n Neuetstadt uf Erlḁch über de n See̥ g’füehrt. Vo n früech im Christmonḁt (Dezember) 1879 bis ụụsgehnds Meerze n 1880 war der See ohne Unterbruch gefroren. 1895 gefror dieser in der Nacht vom 8./9. Februar, um erst zu Ende März aufzutauen. Am 25. Februar fuhren fünf Erlacher mit Schlitten und Pferd nach der Petersinsel und kehrten wohlbehalten auf dem nämlichen Wege zurück. Den Kampf mit dem Ịịsch aber nimmt das Dampfschiff auf, und zwar selbst dann, wenn es auf einer Erlach-Neuenstadt-Fahrt von vier Stunden statt von zehn Minuten eine 5 cm dicke Kruste durchschlagen muß.
Bloß etwa alli hundert Jahr äinisch friert dagegen der Neuenburgersee gänzlich zu. So zu Ende Februar 1830 während einer Woche. Etwas häufiger g’frụ̈ụ̈rt der Teil zwischen dem Einfluß der Brue̥ije n und dem Ausfluß der Zi̦hl. Solche Zịịselplätz lööke n dann allemal Hunderte an zum Schlịịffschueh fahre n und zum zịịferle n oder zịịsle n. Am 25. Januar 1880 gab es Wettschlịịffschuehnet auf dem Bielersee.
Kärglich sind dagegen die Eisspuren zu Lande verteilt, wenn man nicht an die obligaten Ịịschzäpfe n der Dachrinnen und Brunnröhren (die Cheerze n: chandelles, tsandaile, tschandeile, der Ormondtäler) denken will. Um so lieber, aber auch um so verhängnisvoller, streuen Früh- und Spätfröste ihre schimmernden Besuchskarten über die längst ergrünten Fluren hin und verbrönne n unzählige zarte Pflanzen. Die Rebgelände der Wị̆ße nmatte n tragen ihren Namen von dem dort am schnellsten sich ansetzenden Rịff.
69 Wie aber derselbe im Frühling mit tödlicher Sicherheit innert zwei Tagen abg’schweicht wird, so bleibt auch der Schnee̥ selten länger als etwa drei Tage liegen.
Dagegen kann es selbst im Seeland d’s ganz Jahr schneije n, wenn’s im Mäie n schneit. Warum sollte denn nicht auch hier der Satz gelten:
Es isch käi
n Aberelle
n so guet,
Er schneit dem Hirten e
n volle
n Huet.

|
|
Studie von Anker |
Dafür gilt die Vertröstung, Aberelle nschnee u nd Scha̦a̦fmist sịịgi guet für d’Hạuse̥d (Hanfsaat). — Unheimlich genug aber stürmte am Aschermittwoch (3. März) 1824 ein Gụx ( un couss, une coussa), 9 der einem Vater und einer Mutter von je fünf Kindern das Leben kostete. Der Bern-Bot David Neuhaus von Lützelflüh in St. Blaise und Katharina Sterchi von Lützelflüh, die ihre Kinder in Areuse (Traverstal) besuchen wollte, gedachten auf ihrem Weg über Aarberg mit Roß und Wagen in Siselen über Nácht z’blịịbe n. Der (in der Folge bestrafte) Wirt wies sie weg. Die Leutchen fuhren i n chịịdiger Nacht gegen St. Blaise. Aber na̦a̦ch bi’m Salle nstäi n verlor das Pferd bei dem fürchterlichen Schneesturm den Weg und geriet in die Nähe der großen Nußbäüm. Mann und Frau wollten zu Fuß weiter und schliefen ermüdet 70 ein, um nicht wieder zu erwachen. Bei der Beerdigung sah die Frau noch so frisch aus, daß der Arzt eigens bezeugen mußte, si sịg g’stoorbbe n. 10
Es ist nach allem ein Ereignis, wenn der Erlacher zu seiner umfänglichsten Schaufel greifen muß, um ga n Schnee z’schụ̈̆ffele n. Dagegen wird er ab und zu eine Stoogle n vom Schuhabsatz schütteln und durch mauerhohe G’wäächte n da und dort eine Schneestange als Wegweiser ausstecken müssen. Schlittweeg aber für Fuhrwerke und zum schlittle n für die Schuljugend ist daher eine recht seltene Gabe von Wintern wie etwa dem von 1898 und von 1911. Eher kommen Skiläüffer auf ihre Rechnung, wenn sie fleißig den Beerimätter (oder Bä̆ro̥metter) zu Rate ziehen und den Neuschnee der Bergwälder abwarten. Bleiben aber diese fern, so wagen sich lebende Wesen anderer Art auf die sonnenbeschinene Fläche. Winzige Insekten aus der Gruppe der Springschwänze, den Gletscher- und den Wasserflöhn verwandt, kriechen unter dem Laub der Wälder hervor, überdecken in ganzen Schichten die besonnten Halden und machen so aus dem weißen schwarze n Schnee̥. 11
Das Ausbleiben einer lange haftenden und den Boden gründlich durchtränkenden Schneedecke macht sich im Frühling und Sommer als Tröchcheni (1698: Tröckene) fühlbar, wofern nicht der Regen in die Lücke tritt. Der tiefgründige Sand- und Humusboden in und um Ins mag allerdings d’Tröcheni ḁ lsó guet haa n (aushalten), daß z. B. 1865 vollkörnig Gerste ohne jeglichen Regen ausreifte, und der züntroo̥t Waase m zwar wenig, aber sehr gutes Heu und eine Masse Emd ergab.
Für den Weinberg aber ist, wie das nämliche Jahr 1865 und neuerdings 1911 beweist, trocheni Hitz das ideale Wetter bis in den Herbst. Da soll der Neebel dem Winzer d’Trụ̈ụ̈bel saftig mache n und dem Landwirt d’Rüebe n machen ụụfz’g’schwelle n. Umso unwillkommener grụppet besonders der Moosnebel und der (Zihl-) Brüggnebel über Moos und Seen so brịịdick, das s mḁ n chönnt Chuechebịtze n drus hạue n; oder mi chönnt Neegel ịị nschla̦a̦ n u nd d’Überziejer drann ụụfhänke n. Da grị̆fft er d’Lụ̈t aa n u nd hocket ’nen uf d’Brust. Die Schiffsleut des Murtensees aber kann er gelegentlich aus dem Kurs bringen. So am 27. Januar 1911. Da̦ hat mḁ n chụụm zwänz’g Schritt vor äi’m annḁ g’seh n. Di Mannschaft, wo der Schrụụbe ndampfer «Morat» us der Wäärchstatt vo n Neue nburg umm hḁ r het uf de n Murte nsee̥ g’füehrt, het scho n am Na̦ chmittag 71 dä n Ort fast nid g’fun͜de n, wo d’Brue̥ij n i’ n Neue nburgersee lạuft. Di Manne n si n bi zwoo̥ n Stun͜de n a n dem Blätz ummḁn u nd annḁ g’ir ret. Un d iez häi n si am Aa̦be nd no ch sölle n der letz̆t Kurs uf dem Murte nsee̥ mache n. Der Kompaß häin n si langist nụ̈ụ̈t meh ’bbrụụcht g’haa n u nd häi n ieze n nid rächt gwüßt, was dḁrmit mache n. So häi n sie ob dem z’rugg (-fahren) e̥s baar Stazione n verfählt u nd nid e̥mal d’Ländti vo n Murte n g’fun͜de n. Si sị n bis uf Muntelier aachḁ gfahre n u nd häi n bis spa̦a̦t i n d’Nacht ịị nhḁ dür ch dä n Neebel dü̦ü̦r ch g’hoornet. Erst na̦ chdäm si si ch drei Stun͜d häi n verpäätet g’haa n, si n si ummḁ n a n d’s rächt Ort choo̥ n. Unbewußt stärkeres Rudern mit der rechten Hand kann auch beim schiffle n bei Nebel im Bogen herum und damit irre führen.

Studie von Anker
In anderer Weise wird die Lage peinlich, wenn nicht bloß der Nebel aa nfa̦a̦t tröpfle n, sondern die Wulche n ihren Regen ergießen! Es regnet e n Sturm oder es Stürme̥lli, es chunnt es Stü̦ü̦rme̥lli Reege n, oder aber e n Pfleederete n; oder es sü̦ü̦dlet, daß die Niederschläge die Abschleeg (Rinnen) der Straße füllen! Die durstige Erde aber trinkt und tränkt ihre Kinder, die Milliarden Pflanzen und Tiere, wieder für einige Zeit, wenn auch nur vo n der Hand i n d’s Mụụl. Nur der Bịịse nreege n schadet blühenden Pflanzen und besonders Reben. Man sieht es darum ungern, wenn d’Bịịse n chunnt cho n lööke n (den Regen herlockt). An einzelnen Stellen jedoch legt der Boden in der Tiefe geheimnisvolle Vorräte von Wasser an und wird, je nachdem er solche an die Oberfläche abgibt oder zurückbehält, zum 72 Wetterpropheten auf lange Sicht. Ein solcher Offenbarungsort guter und böser Zeiten ist der wohlfeil Brünne n bi’m Bándbrüel (1809) un͜der der Rịff i n der Gruebe n bi der Anstalt (dem Zwangsarbeitshaus) z’Eiß, (wohl zu unterscheiden von der Ryff bei Murten). Lạuft dee r aa n, so gi bt’s e n böo̥si Zi̦t; trochnet er ịị n, so gi bt’s e n gueti. Und zwar fließt er bei trockenstem Wetter oft lang und ausgiebig, bei nassem dagegen nicht. G’loffe n isch er z. B. in dem außerordentlich trockenen Sommer 1911. In den Zeiten des starken einheimischen Getreidebaues beobachteten ihn die Müller aufs genauste, und si richteten nach ihm ihre Käufe ein. Das war jedenfalls g’schịịder als, wie man um 1642 tat, sich von reichen Herbstblüten und Rosen Pestilenz la̦ n z’ brofizeie n.
So bewahrheitet sich der Spruch, daß d’s Wätter si ch lieber zahlt, weder d’Lụ̈̆t.

Motiv vom Bielersee bei Erlach
1
Lg. 179.
2
Das u des eingekürzten «u
nd» mechanisch als herzustellendes eḷ gedeutet.
3
Im «Emmentalerblatt».
4
Vgl. Dr. Maurer und Prof. Heß im Stat. Jahrb. d. Schweiz, 1910.
5
Widmann. Der Heilige 55.
6
Mül. 586.
7
Schöni im Taschenb. 1900, 279.
8
Schlafb. Tw. 30.
9
Favre (595).
Brid. 88.
10
Kal. Ank.; ergänzt durch die Leichenrede des Jakob Füri, Ober-Schullehrer zu Innß, am 6. März. (Im Besitz von Baumeister Füri in Ins.)
11
O. S. im «Bund».