
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Dem wunderschönen Wetter der letzten Wochen war plötzlich andauernde Regenzeit gefolgt, so daß die männlichen Schloßbewohner nur die nötigsten Ausgänge machten und ihre Spazierritte ganz unterließen, während die Damen keinen Fuß vor die Thüre setzten. Damit war auch Seraphinens tägliches Vergnügen vereitelt und sie selbst wieder mit ihren Gedanken an ihr Zimmer gefesselt.
Wohl fand sie anregende Beschäftigung in den täglichen Unterrichtsstunden, die ihr der Ortslehrer sowohl, als der greise Pfarrherr wechselnd erteilten, auch unterhielt sie sich mit ihren Büchern und Handarbeiten, spielte mit Hermann Schach und Domino, oder ließ sich von seinem Aufenthalte im Kadettenhause erzählen. Er mußte bei dieser Gelegenheit zugestehen, daß seine kränkliche Cousine keineswegs so langweilig sei, als er vorausgesetzt hatte, und bat ihr im Geiste manches unliebe Urteil ab, dessen er sich im unbedachten Übermute vermessen hatte.
Über Rita hatte die Gräfin bei den beiden Lehrern ihrer Tochter Erkundigungen eingezogen, aber leider hatten sie die Aufschlüsse, die sie bekam, nur halb befriedigt. Der alte Pfarrer sagte, er habe zwar in der Schule selbst und beim Unterricht nicht eigentlich über Rita zu klagen, doch kenne er sie als ein trotziges, unfreundliches Kind, das keinem guten Worte zugänglich sei und immer für sich allein bleibe, nie mit den andern Dorfkindern verkehre.
Dem gegenüber wendete die gütige Gräfin ein, man habe vielleicht auch auf Seite der andern durch unfreundliches Fernebleiben und Mißtrauen gefehlt, und gerne stimmte Seraphine dieser milden Ansicht ihrer Mutter bei. Soviel man ihr gesagt hatte, lebte die Kleine nur mit den alten Großeltern beisammen, wer weiß, ob diese die richtige Art der Erziehung für sie anwendeten? Ob sie nicht dem Kinde zu viel nachgesehen auf der einen Seite, oder auch ihm verboten hatten mit andern Kindern zu verkehren? Überdies war sie von größtem Mitleide mit Rita beseelt, weil diese keine Eltern hatte.
»Ach, was wäre vielleicht aus mir geworden!« rief sie schmerzlich bewegt aus, »ohne meine gütige, liebe Mutter! Wer kann denn dem Kinde alles Gute möglich machen, alles Richtige lehren, wie sie? Wer kann führen, und tadeln und zurechtweisen, wie eine Mutter? Schon deshalb, weil Rita eine Waise ist, beklage ich sie tief und kann ihr all ihre Fehler verzeihen.«
Der Lehrer mußte zugeben, daß das Mädchen ganz außerordentlich begabt sei, daß sie mit Leichtigkeit das ganze Jahr hindurch die Erste der Schule sein könnte, wenn sie nicht ihr Mutwille immer wieder vom ernsten Lernen abzöge und zu neuen Streichen verleitete. Was sie schon alles angestellt hätte, seit sie zur Schule ging, sei gar nicht aufzuzählen, es ließe sich ein Buch darüber schreiben. – Hermann, der sehr oft bei den Lehrstunden seiner Cousine anwesend war und auch jetzt dieses Gespräch mitangehört hatte, erlaubte sich lachend die Bemerkung: »Die Dorfhexe ist wirklich ein ganz interessantes Mädel, und wollte ich, wir wären zusammen Soldaten gewesen, sie müßte einen vortrefflichen Kameraden abgegeben haben.«
Seine Mutter entsetzte sich über diese Äußerung, die sie da zu hören bekam. »Ich schäme mich für dich deines schlechten Geschmackes, Hermann,« sagte sie verdrießlich und fächelte sich, wie das so ihre Lieblingsgewohnheit war, mit ihrem Taschentuche Kühlung zu und den feinen Duft von Heliotrop.
»So schlecht ist dieser Geschmack nicht,« entgegnete der Lehrer höflich, »wenn gnädige Frau Baronin unsere Rita einmal in der Nähe sehen würden, wären Sie wohl selbst über ihre eigentümliche Schönheit erstaunt.«
»Siehst du, Mama?« rief Hermann belustigt aus, »vivat, es lebe die Dorfhexe!«
»Hermann, wolltest du es nicht besser unterlassen in deinen Ausdrücken die Dorfjungen nachzuahmen, die der armen Kleinen diesen Namen aufgebracht und sie damit gebrandmarkt haben für ihre Lebenszeit?« wendete sich Gräfin Mechtilde sanft verweisend an ihren Neffen.
Beschämt und tief errötend schlug dieser die Augen nieder, vor andern getadelt zu werden und noch dazu aus dem Munde seiner Tante war ihm sehr fatal, er fand auch nicht sogleich eine passende Erwiderung; Seraphine aber hatte mit feinem Takte seine unangenehme Lage erfaßt und freundlich zu ihrer Mutter gesagt: »Ich finde diesen Namen nicht so schlimm, als er vielleicht scheinen mag, besonders wenn man seine Trägerin kennt; denn wenn ihre Augen mutwillig blitzen, ihre lockigen Haare lustig im Winde flattern und die leichte, zierliche Gestalt so rasch dahineilt und kaum den Boden zu berühren scheint, könnte man sie wohl für ein Hexlein halten. Hat sie nicht auch mit meinen Blumengaben förmlich Spuk getrieben und sie mir so schlau und listig nahe zu legen gewußt, daß ich sie täglich finden mußte, ohne die Geberin zu entdecken? Das bringt unter hunderten kaum wieder eins zustande, meinst du nicht?«
»Allerdings, mein Kind, hier muß ich dir zustimmen, und thue es sogar sehr gerne, denn ich glaube wirklich, daß jene Rita unsere Teilnahme verdient. Sie ist ein seltsames Kind, das ist nicht zu leugnen, aber sie scheint doch nicht von Herzen böse zu sein; hätte sie vielleicht das Glück gehabt, von früher Kindheit an eine strenge und tüchtige Erziehung und guten Umgang zu genießen, wer weiß, ob nicht etwas außerordentlich Tüchtiges aus ihr geworden wäre? Man muß niemals einen Menschen allzu rasch beurteilen, noch weniger ihn verdammen, sondern immer und allezeit den Verhältnissen Rechnung tragen, unter denen er aufwuchs und lebte, dann erst mag man die strenge Frage recht aufrichtig gegen das eigene Herz kehren und denken: »Was wäre wohl unter gleichen Umständen aus mir selbst geworden? Konnte ich nicht etwa ein ungleich schlimmeres, oder doch ein weniger brauchbares Geschöpf werden?«
»Gnädigste Gräfin legen hier den Maßstab der Gerechtigkeit an,« sprach der Lehrer im ehrerbietigsten Tone und verbeugte sich gegen die Sprechende.
»Ich nenne ihn den Maßstab meiner teuren Mutter,« versetzte Seraphine, »die von allen Menschen das Beste denkt.«
Und liebkosend neigte sie sich auf die Hand der Gräfin nieder und küßte sie.
»Mein gutes Kind!« sprach diese weich. Zwischen beiden herrschte die innigste, vertraulichste Zuneigung, die man nicht ohne Rührung zu sehen vermochte. Durch den steten Umgang mit Erwachsenen, sowie durch die ernste Richtung, die ihre junge Seele durch Schmerz und Leiden genommen hatte, war Seraphine älter geworden, als sie eigentlich Lebensjahre zählte, die Gräfin hingegen hatte sich wieder so ganz und gar in ihres Kindes Art des Denkens und Fühlens eingelebt, und sozusagen eins mit ihr, gleichen Schritt mit ihr gehalten. Der Gedanke, daß diese beiden so enge Verbundenen einmal geschieden und auseinandergerissen werden sollten, war unfaßlich, und wies ihn Seraphine sowohl, als noch mehr ihre Mutter, wenn immer er in ihrem Herzen aufstieg, angsterfüllt von sich. –
»In nächster Zeit, so Gott will, begeht unsere liebe Seraphine ihre erste Kommunion,« nahm der Pfarrherr das Wort, »wenn nun die gnädigen Herrschaften gestatten wollten, daß die Altersgenossinnen der Komtesse und die braven Mädchen meiner Schule sich an der schönen Feier beteiligen dürften, so ließe sich vielleicht auch in der kleinen Wildkatze das Verlangen wachrufen, bei den Auserkorenen zu sein; an mir soll's wenigstens nicht fehlen, die jungen Seelen recht sehr zu begeistern und auf den hohen Himmelsgast vorzubereiten, und möchte ich kaum daran zweifeln, daß sich bei einem so lebhaften und ungewöhnlichen Gemüte, wie das Ritas, alles in ihr schlummernde Edle und Gute vielleicht urplötzlich nach außen wenden und sie gänzlich zu ihrem schönsten Vorteile umwandeln würde. Ich mußte sie leider bisher noch immer zurückstellen, weil ich sie für noch zu wenig reif und ernst erkannte, nun aber glaube ich, es unter den gegebenen Verhältnissen wagen zu dürfen.« –
»Das ist ein prächtiger Einfall, Hochwürdiger Herr!« rief die Gräfin sichtlich erfreut aus, »und soweit Sie zu irgend einem Vorhaben meiner Zustimmung bedürfen, sei sie Ihnen jetzt schon gewährt.«
»Bist du aber nicht besorgt, meine liebe Cousine, daß der Umgang mit einem so ungebildeten Geschöpf ungünstig auf Seraphine wirken möchte?« wandte die Majorin hochmütig ein.
»Ungünstig, Julie? Auf meine Tochter?« frug die Gräfin erstaunt, »nein, nein, das fürcht' ich nicht, abgesehen davon, daß ich in Ritas Benehmen nichts Unpassendes finden konnte – ich habe sie freilich nur einmal ganz in der Nähe gesehen – bin ich auch gewiß, meine Tochter wird sich nicht so rasch verführen lassen, sich die Unarten Ritas anzugewöhnen, dagegen aber alles versuchen, um mit Wort und Beispiel die junge Gefährtin zum Guten zu ermuntern. Ich denke, es dürfte zu überlegen sein, ob man den beiden Mädchen nicht gemeinsamen Religionsunterricht erteilen sollte? Was halten Sie davon, Hochwürdiger Herr?«
»Das Allerbeste, Allerglücklichste für mein unlenksames Schäflein, gnädigste Frau,« gab dieser hocherfreut entgegen, »ich bin gewiß, daß Rita sich schon um der Ehre willen, am Unterrichte der jungen Komtesse mit teilnehmen zu dürfen, die denkbarst größte Mühe geben wird, sich artig und gesittet zu betragen, ungleichmehr, als sie das in der ihr verhaßten Schule fertig brächte, wo keine neuen Verhältnisse sie umgeben.«
»Ist ihr denn die Schule so verhaßt?« frug Baron Hermann lachend; »das ist kostbar; Geist des Widerspruchs, Mangel an Subordination; die Qualifikation einer Ungezähmten!«
»Sie haßt die Schule, ja,« bestätigte Seraphine, »aber ich weiß auch aus Papas Erzählung, dem sie es selbst gesagt hat, daß sie unendlich lernbegierig sein muß, daß sie das Verlangen hat, recht, recht viel, am liebsten alles nur denkbar Mögliche zu lernen, wenn es sich nur von dem Schulzimmer, den Bänken und den Mitschülern trennen ließe. Sie weiß aber nicht eins ohne das andere zu erreichen und verzichtet deshalb auf die Bereicherung ihres Wissens.«
»Nun wohl, es wird sich ja zeigen, ob und wie weit Rita es verdient, bei den Kommunionkindern in der Schloßkapelle zu erscheinen,« beschloß der Pfarrer die Unterhaltung und empfahl sich.
Diejenige aber, über welche jener menschenfreundliche Entschluß gefaßt worden war, kehrte in eben dieser Stunde auf einsamem Wege wieder vom Kirchhofe nach Hause zurück.
Sie hatte das Grab von Lischens Mutter wieder besucht und mit frischen Blumen geschmückt, denn seitdem sich ihr damals das Kind so herzlich genähert und den häßlichen Spott der Dorfkinder gar nicht beachtet hatte, war sie ihm leidenschaftlich zugethan, und hätte es am liebsten jeden Tag ihrer Zuneigung versichert. Aber Lischen durfte keinen Verkehr mit Rita haben. Sie hatte damals ihrer Schwester all ihre Erlebnisse beim neuen Grabsteine erzählt und auch, welch einen schönen Kranz Rita für die liebe Mutter geflochten hatte; ebenso gestand sie ein, daß sie die große Gießkanne von zu Hause mitgenommen habe, aber nicht im stande gewesen sei, sie vom Brunnen bis zum Grabhügel zu tragen, weil sie für ihre kindlichen Kräfte allzu groß und schwer gewesen sei. Da hätte sich Rita freiwillig angeboten, ihr zu helfen, hätte Wasser geschöpft, den Hügel begossen und die Blümchen erquickt, und das übrige noch den benachbarten Gräbern geschenkt. Darauf seien sie beisammen gesessen, hätten geplaudert, und Rita hätte ihr allerlei hübsche Dinge gesagt, die sie von der Großmutter wußte, ein paarmal aber hätte sie ganz traurig geseufzt: »Wenn ich nur auch mein Mütterchen hier haben könnte auf dem Gottesacker, dann könnte ich doch kommen, sie besuchen und ihr Grab pflegen! Die allerschönsten Blumen wollte ich darauf pflanzen und einen Trauerbaum, der mit seinen Blättern und Zweigen bis tief herunter auf den Boden hinge.«
Aus all dem mußte sich Bertha allerdings selbst sagen, daß Ritas Gemüt unmöglich roh oder böse sein konnte, aber der Schein war nun einmal wider sie, sie war verrufen im ganzen Dorfe, jedes wohlerzogene Kind wich ihr aus, und so kam es, daß sie sich ebenfalls nicht über das allgemeine Vorurteil wegzubringen vermochte und Lieschen ängstlich vor jeder weiteren Berührung mit der allgemein gefürchteten und verachteten »Dorfhexe« zurückhielt. »Grüße sie freundlich, mache es nicht wie die anderen bösen Kinder, die Rita verspotten,« hatte sie die kleine Schwester ermahnt, »bleibe aber ja nicht bei ihr stehen, noch lasse dich je einmal in irgend welchen näheren Verkehr mit ihr ein.«
Lischen sah groß erstaunt zu Bertha auf. Zum erstenmale konnte sie heute nicht klug aus ihr werden, aber sie kannte gegen diese ihre zweite Mutter keinen Widerspruch, sondern fügte sich gehorsam ihren Anordnungen.
Immerhin aber that es ihrem kleinen, dankbaren Herzchen wehe, wenn Rita ihr so wehmütig nachschaute, so lange sie sie sehen konnte; sie hätte ihr dann viel lieber alles gesagt, als so stolz und feindselig geschienen! –
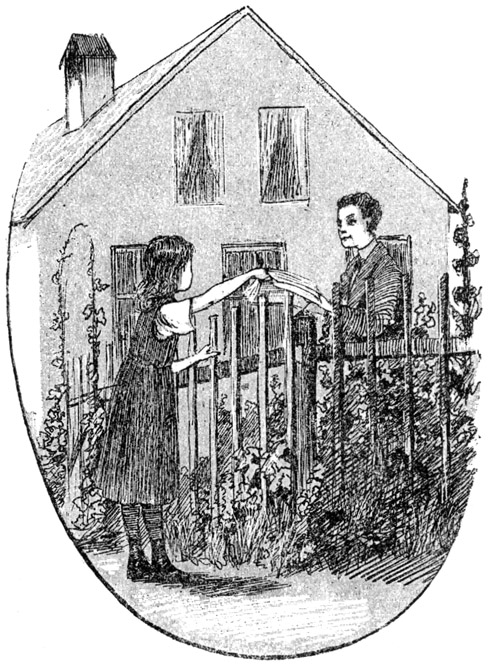
Jetzt kam Rita an dem Häuschen des Anstreichers vorüber; Franz saß im Garten und zeichnete; er sah bleich aus, und der düstere Ausdruck seiner Züge verriet den innerlichen Kampf, den er noch nicht besiegt hatte, u. der wie ein stilles Fieber an ihm zerrte.
»Bst, bst!« machte Rita.
Der Jüngling sah um sich. »Du bist's? Was willst du von mir?«
»Hier hab' ich dir etwas mitgebracht;« und sie hielt ihm ein Päckchen loser Blätter hin, die offenbar zu einem bestimmten Zwecke auseinandergerissen waren.
Er hatte nicht sobald einen flüchtigen Blick darauf geworfen, als er verwundert ausrief: »Eine Künstlergeschichte – wie kommst du dazu?«
»Das ist sehr einfach. Ich hab' sie dir gesammelt, damit du sie lesen könntest; meine Großmutter klebt nämlich an den Abenden Düten für den Krämer, und er liefert ihr das hiezu nötige Papier, geschriebenes und bedrucktes. Gestern hat sie wieder einen solchen Vorrat bekommen und mich beauftragt, daß ich das Papier auseinandersichte und die bedruckten und beschriebenen, sowie die ganz reinen Blätter sortiere. Ich thu' das recht gerne, und habe dabei schon manch' hübsches Geschichtlein und Gedicht gefunden. Diesmal entdeckte ich diese Künstlergeschichte und dachte, es möchte dir eine Freude sein, wenn ich sie dir mitteile. Du mußt sie aber gleich lesen, denn Großmutter braucht sie bald; morgen komm ich wieder hier vorüber und hole sie ab. Leb' wohl, Franz!« – und schon war sie um die Ecke gebogen, eine gute Strecke weit fort.
Kopfschüttelnd sah er ihr nach: »Seltsames Ding, diese Dorfhexe!« sagte er zu sich selbst, »aus lauter Widersprüchen zusammengesetzt! Hier Unfug treibend, dort Freude bringend. Sie weiß um meine geheime Sehnsucht und möchte mir helfen. Das ist doch hübsch von ihr. Sie würde mir auch ergiebig helfen, wenn sie es könnte. Ach, warum müssen denn gerade jene, die uns wirklich freudig irgend ein Opfer bringen, oder einen großen Gefallen thun möchten, es niemals vermögen? Und die Reichen und Mächtigen versagen uns unsere heißen Bitten? Ich will aber nicht ungerecht sein, schon viele strebsame Talente haben großmütige Gönner gefunden und die hohe Ehrenstufe erreicht, von der sie geträumt und die sie angestrebt hatten seit ihren kindlichen Jahren. Will's Gott, so wird auch mir vielleicht noch ein Stern leuchten, der mich an's schöne Ziel führt.«
Im nächsten Augenblicke suchte er einen stillen Winkel im Sommerhäuschen des kleinen Vorgartens auf, unterzog die abgerissenen Blätter, die ihm Rita gesammelt und gebracht hatte, einer eingehenden Prüfung. Bald war er so in seine Lektüre vertieft, daß er die ganze Außenwelt um sich her vergaß.
Er las von einem gewissen Antonio, der im Venetianischen geboren war. Als sein Vater starb, verheiratete sich die Mutter wieder. Der vierzehnjährige Antonio, der seinen verstorbenen Vater leidenschaftlich geliebt hatte, konnte es nicht ertragen, zusehen zu müssen, wie die Mutter jetzt ihre ganze große Liebe und Zärtlichkeit an den fremden Mann verschwendete, der für ihn gar keine Güte kannte und ihm auch noch das Vertrauen und Herz seiner Mutter zu stehlen versuchte! Da entfloh er eines Tages in das benachbarte Städtchen Possagno zu seinem Großvater und beschwor diesen, er möge ihn bei sich aufnehmen.
»Was soll ich denn aus dir machen, Antonio?« hatte der Alte gefragt, und jener gab die begeisterte Antwort: »Ich möchte ein Künstler werden!«
»Oho, so hoch willst du hinaus? Wer schafft uns denn aber das Geld dazu, einfältiger Junge?«
»Die Madonna wird schon Mittel und Wege finden,« gab der Knabe demütig zur Antwort.
»Um Künstler zu werden muß man viel lernen.«
»Ich werde viel lernen, Großvater, ich werde alles lernen.«
»Vor allem zeichnen.«
»O das kann ich schon!« Und er band eine Papierrolle auf, das einzige Gepäck, das er auf seiner Flucht mit sich genommen hatte, und wies dem überraschten alten Manne allerlei Entwürfe und Skizzen vor, die er in seinen freien Stunden angefertigt hatte.
»Und was hast du bis jetzt gethan?«
»Ich bin Maurerlehrling gewesen.«
»So wirst du das vorläufig auch jetzt noch bleiben, Antonio!« beschloß der Großvater die Unterredung, nicht zum Entzücken des Jungen, »ich bin arm und kann dir nicht einen kostbaren Meister bezahlen, schlage dir also vorerst all diese Rosinen aus dem Kopfe; morgen gehst du mit mir zur Arbeit.« Daraufhin gab's keine Widerrede.
Andern Tages hatte der Knabe den Großvater zur Arbeit begleitet, zum Palazzo eines reichen, vornehmen Herrn der hohen venetianischen Aristokratie, dessen beschädigte Gartenmauer der Reparatur bedurfte. Der alte Mann war an dem einen, Antonio beim andern Ende der Mauer aufgestellt, und den Kameraden, die den neuen Eindringling mit mißtrauischen Blicken ansahen, erklärte ersterer, sein Junge würde ihnen hier kein Brot essen, denn er habe ihn nur zu seiner persönlichen Erleichterung mitgebracht und beanspruche keinen Lohn für seine Arbeit. Es schien auch in der That so; am Abende erhielt Antonio nichts für seine Mühe, während aber die andern Mahlzeit hielten, hatte er sich mit etlichen Orangen begnügt und die freie Zeit dazu benützt, aus dem zum Bau bereitliegenden Sandhaufen allerlei plastische Gegenstände herzustellen, um sie sofort wieder zu zerstören. Es war das der Drang des überall schaffenden Genies. – Am dritten Arbeitsmorgen hörte Antonio in der Küche des Palazzos, die in den Parterreräumen desselben gelegen war, und unter deren Fenster er eben arbeitete, lebhaftes Gespräch, als ob viele Leute dort anwesend wären; bald nachher einen Fall, dem ein lauter Aufschrei folgte, ein Lärmen und Toben, ein Hin- und Widerlaufen, dazwischen bittende, klägliche Töne – es mußte etwas zerbrochen sein, was wichtig gewesen, und worüber der oberste Küchenmeister völlig aus der Fassung gekommen war. Wirklich kam nach einiger Zeit einer der herrschaftlichen Diener aus dem Palazzo, der mit dem alten Maurer Antonio, der schon viele Jahre für die Eccellenza arbeitete, wohl bekannt war und ihm erzählte, es sei für heute Abend 7 Uhr großes Diner angesagt, wozu der Küchenvorstand einen Tafelaufsatz aus Marzipan vorbereitet hatte, der an Schönheit und Ausführung seines Gleichen suchte. Er sollte das Prachtstück des Abends bilden und ihm selbst sowohl, als besonders dem Hause und dessen berühmtem Namen alle Ehre machen. Da hätte ein unvorsichtiger Junge vorhin an den Aufsatz gestoßen, dieser sei in's Wanken gekommen, vom Tische heruntergestürzt und liege jetzt in zahllosen Trümmern auf dem Boden.
Dieser unselige Vorgang nun habe allgemeine Verwirrung und Bestürzung, Zorn und Verzweiflung hervorgerufen und die Leidenschaft des Küchenchefs aufs äußerste gesteigert. Der Unglückliche aber, welcher blaß und heulend in einer Ecke steht, fürchtet, entlassen zu werden, während doch jeder, der unsere gnädigste Eccellenza und ihre seltene Großmut und Freigebigkeit kennt, die Ehre und das Glück zu schätzen weiß, ihr dienen zu dürfen.
Der kleine Antonio war während dieser Erzählung ganz nahe gestanden und hatte sich kein Wort derselben entgehen lassen; jetzt, nachdem der Kammerdiener geendet hatte, zupfte er seinen Großvater an seinem kalkbefleckten Arbeitskittel und sagte: »Ich könnte ganz wohl bis heute Abend einen neuen Tafelaufsatz machen.« Der Großvater ließ ihn zornig an: »Knirps du, was unterfängst du dich? Du, ein Maurerjunge, wolltest hier auf die große Tafel, an der nur die Höchsten und Vornehmsten zu sitzen pflegen, ein Kunstwerk liefern? Denn ein solches müßte es sein.«
»Ich möcht' es dennoch wagen, Großvater.«
Der Bedienstete maß den Knaben strengen Blickes. Er fand aber weder kecke Verwegenheit, noch übermütigen Spott im Ausdrucke seines Gesichtes und so sagte er: »Komm mit mir, ich führe dich zur Eccellenza.«
Eccellenza waren in eben diesem Augenblicke in der Küche, um die Lamentation des Küchenoberhauptes mit stummer Resignation über sich ergehen zu lassen; endlich sagte er: »Nun gut, das Unglück ist geschehen, der Ärmste dort hinten soll aus seinem Winkel hervorkommen, es wird ihm den Kopf nicht kosten, weil er jedoch für seine Unachtsamkeit eine Strafe bekommen muß, wird man ihm drei Tage lang kein Dessert vom Tische verabreichen. So, und damit ist's gut.« – Der Küchenmeister sah unzufrieden darein. So etwas hätte eine exemplarische Strafe verdient, und nun gar diese Kleinigkeit! Es war wirklich ärgerlich! Da mochte er gefaßt sein, daß bald wieder etwas passieren würde; Eccellenza waren doch allzu gütig, beinahe schwach! – Wir Menschen sind gar merkwürdig angethan, hat man uns beleidigt oder gekränkt, oder irgendwie empfindlich angegriffen, scheint uns die Strafe für den, der uns geschädigt hat, leicht zu milde oder zu geringe, wir finden im Gegenteile, daß man unter allen Umständen Gerechtigkeit walten lassen müsse, schon im Interesse der guten Sache und um die Besserung des Beleidigers zu erzielen; sind aber wir so unglücklich gewesen, etwas anzustellen, haben wir gethan, was wir hätten unterlassen sollen, dann finden wir die Beurteilung unseres Handelns gar schnelle übereilt, oder viel zu strenge, und wissen gerne für uns die ausgedehnteste Nachsicht geübt. So mißt man immer mit zweierlei Maßen und dürften durchaus nicht, wenn zwei Menschen das nämliche thun, die nämlichen Folgen hieraus für beide erwachsen. –
Eccellenza kehrte sich übrigens nicht an die Billigung oder die üble Laune des Untergebenen, sondern wandte sich nach dem Kammerdiener um, der von dem jungen Antonio gefolgt, seine ehrerbietigste Verbeugung und sodann in kurzen Worten sein Anliegen vorbrachte. Wie war er aber erstaunt, als er erfuhr, was der schlanke, hübsche Junge da vor ihm sich unterfangen wollte! Ja, er hatte ein intelligentes Gesicht, die großen Augen, wie aus schwarzem Diamant geschnitten, blickten ehrlich und zuversichtlich zu dem hohen Herrn auf, von der Stirne wallten dunkle Haare in weichen Locken in den Nacken zurück, die Hände waren ungemein zierlich und wohlgeformt, und wenn der Mund mit den vollen, kirschroten Lippen sich aufthat, so erblickte man zwei Reihen prächtiger, weiß schimmernder Zähne, ein Zeichen gesunder, kräftiger Jugend.
»Bist du toll geworden, mein Junge?« redete der vornehme Herr ihn an, »daß du es wagen willst, mir einen Tafelaufsatz zu liefern? Wirst ihn wohl gar vielleicht aus Sand und Mörtel herstellen, wie?«
»O nein, Eccellenza,« gab Tonio bescheiden zurück, »Sand und Mörtel würden dabei nicht zur Verwendung kommen, aber freilich, genießbar wird mein Aufsatz auch nicht werden.«
»Das thut nichts. Wir hätten wohl auch das verunglückte Tafelstück nicht aufgegessen. Sprich, was brauchst du dazu?«
»Teig, Eccellenza, und ein Kämmerchen, wo ich ungestört arbeiten kann; niemand soll mir helfen, niemand mir dabei zusehen, bis ich fertig bin.«
»Und wenn du deiner Aufgabe nicht gewachsen bist, mein Junge,« sprach der hohe Herr und schaute durchbohrenden Blickes auf den vor ihm stehenden Tonio mit seiner von Kalk beschmutzten Schürze, »wenn du dein Versprechen nicht ein- und uns zum besten hältst, dann kostet es deine Ohren.«
Er erwartete, der Knabe würde bei dieser Drohung erschrecken, dieser aber erwiderte furchtlos: »Eccellenza, ich will mein Bestes thun.« –
Der Chef der Küche wollte nun und nimmer an die Kunst dieses Maurerjungen glauben, und maß ihn mit mißtrauischem Blicke.
»Wie aber, Eccellenza,« sagte er nicht ohne einen gewissen Spott, »wenn dies Kind hier sein Versprechen nicht einhält, womit soll unsere Tafel geschmückt werden? Euer Gnaden verabscheuen es, unter lieben Freunden und Bekannten mit Gold und Silber zu prunken?« –
»Dann helfen wir uns mit Blumen und Früchten,« war die Antwort, »eine geschickte Hand weiß auch hiervon allerhand Schönes aufzubauen, oder meinen Sie nicht, mein Bester?«
Damit wandte er sich, ohne die Entgegnung, die auf unterthänigsten Gehorsam lautete, abzuwarten, zum Gehen, und hatte schon nach wenigen Minuten die Küche verlassen.
Zuvor hatte er noch die nötigen Anweisungen für Antonio gegeben, und wurde dieser in ein kleines, aber helles Zimmerchen neben der Küche gewiesen und nach einiger Zeit mit hinreichendem Vorrat von Backteig versehen. Er ging denn auch alsbald an's Werk, seine Augen glühten im Feuer der Begeisterung, seine Hände langten zuckend nach dem Material, das ihm hier endlich einmal so reichlich zur Verfügung stand, und sein Atem ging schneller vor Freude und Entzücken. Er schien auf keinerlei nennenswerte Schwierigkeit zu stoßen und konnte schon nach Ablauf einiger Stunden dem Küchenmeister zu dessen größter Überraschung sein vollendetes Werk zeigen. Nun wurde es mit aller Vorsicht in die Ofenröhre gebracht und goldgelb gebacken.
Abends war alles in freudigster Erregung. Unter dem Dienst- und Küchenpersonale war wiederum Ruhe und Frieden hergestellt; auch im Speisesaale hatte der liebenswürdige Gastgeber seine Freunde von dem Unglücke unterrichtet, das heute morgens seine frohe Laune fast bedroht hätte, und die Probe eines hübschen Jungen in Aussicht gestellt, der ihm versprach, für den zerbrochenen Kunstbau seines Leibkoches einen Ersatz zu bringen. So sahen denn alle Augen mit Spannung nach der Thüre, bis der Erwartete käme. Und wirklich erschien auch schon nach kurzer Zeit der Oberküchenmeister mit hochrotem Kopfe, sichtliche Befriedigung auf dem feisten, fettglänzenden Gesichte, und trug auf einer Platte, mit einer feinen Serviette zugedeckt, die Arbeit des ihm auf dem Fuße folgenden Knaben. Im Gegensatze zu dem Küchenchef war Antonio leichenblaß und bebte an allen Gliedern. Jetzt, wo es wirklich galt, schien ihn Zuversicht und Selbstvertrauen zu verlassen, und er fürchtete, ein einziges Wort möge ihn aus allen seinen Himmeln herabstürzen in trostlose Verzweiflung.
Nun schritt der Küchenmeister zu seinem gnädigsten Gebieter, beugte vorsichtig ein Knie und bat: »Wollen Euer Gnaden geruhen, von dieser Platte hier die Hülle abzunehmen?« Der alte Herr that, wie jener gebeten, und ein lautes »Ah« der Verwunderung entschlüpfte seinen Lippen sowohl, wie denen aller Anwesenden.
In der goldgelben Farbe des Backteiges zeigte sich den überraschten Gästen ein wunderschöner, mit vortrefflicher Genauigkeit modellierter Löwe. Das war keine Stümperarbeit, das war nicht der schwache Versuch eines Schülers – nein, das war Kunst, wirkliche, geniale Kunst, die sich hier in jeder Linie bekundete. Die ganze Gestalt des königlichen Tieres, sowie seine Haltung, der Kopf, der breite, stolze Nacken, die Mähne, die mächtigen Pranken – alles war formvollendet, alles repräsentierte sich aufs beste.
»Wo hast du dies gelernt, mein Junge?« frug einer der Anwesenden, ein hervorragender Kunstmäcen Venedigs – »wer war dein Meister?« wollte ein anderer wissen – all diesen Fragen gegenüber hatte Antonio, der nun über seinen Erfolg nicht mehr im Unklaren war, nur die einzige Antwort: »Ich habe noch keinen Meister gehabt – ich habe nirgends gelernt.«
»Wo nahmst du das Modell zu diesem Entwurfe hier?«
»Nirgends, es war so in meinem Kopfe.«
»Wer ist dein Vater?«
»Er ist tot.«
»Und deine Mutter?«
»Ich bin beim Großvater.«
»Ist er schon lange hier in der Stadt?«
»Ja Excellenz, er ist Maurer und ich arbeite bei ihm.«
»Als Maurer?« riefen mehrere Stimmen zu gleicher Zeit aus. Antonio nickte traurig.
»Thust du das gerne?«
»O nein, ich möchte Künstler werden!« und er faltete bittend die Hände, als müsse ihm jetzt, in diesem Zimmer hier und in diesem Augenblicke das Glück kommen. –
Die Herren hielten eine kurze Beratung in einer Sprache, die der Knabe nicht verstand; dann nahm ihn der Hausherr bei der Hand und sagte in väterlich gütigem, doch aber ernstem Tone: »Höre was ich dir sage. Wir alle hier wollen zusammensteuern, dich zum Künstler ausbilden zu lassen, mache unsern Glauben in deine Ehrenhaftigkeit und deine Dankbarkeit nicht zu schanden und nütze die Lehrzeit gut. Wenn du dann nach Ablauf derselben wiederkommst und das geworden bist, was wir erhoffen, ein echter und wirklicher Künstler von Gottes Gnaden, dann wollen wir uns herzlich freuen, daß wir dazu beigetragen haben, dir den Lorbeer des Verdienstes um's Haupt zu legen.« –
»Nun aber nenne uns deinen Namen, Knabe,« sagte einer der Gäste und freudestrahlend, seiner Sinne kaum mächtig über die Größe seines unverhofften Glückes antwortete er: »Ich bin Antonio Canova.« –
Canova ist einer der größten Bildner seiner Zeit geworden. Er genoß seine vollständige Ausbildung in Rom und Venedig, und machte schon mit dem ersten größeren Werke seiner Hand, dem Grabdenkmal für Papst Clemens XIII. die Welt von sich reden. Er zählte damals erst 35 Jahre; 1802 verewigte er sich durch die Statue Napoleons I. in Paris; er starb in Venedig im Alter von 65 Jahren. –
So lautete die kleine Geschichte – der Lebenslauf eines Künstlers, den Rita dem Anstreicher Franz heute gebracht hatte. Er hatte die Blätter gleichsam verschlungen und sie ohne Unterbrechung zu Ende gelesen. Alle Leiden, alle Qualen des eigenen Empfindens, sein Hoffen und Fürchten, sein Hangen und Bangen waren damit wieder aufgeweckt worden – ein Feuerbrand war's, den das junge Kind in guter Absicht, doch aber unüberlegt in dieses leidenschaftliche Gemüt geschleudert hatte, und dessen Flammen ihn zu verzehren drohten.
Ob auch in ihm der Genius eines Canova steckte? Ob auch ihn ein Kunstmäcen verstehen würde, der ihm die Fesseln lösen wollte, die ihn hier an das häusliche Handwerk schmiedeten und ihn frei machen für die große, heilige Kunst? –
Schon glänzten die Sterne am nächtlichen Himmel, als Franz noch immer in heftiger Erregung in seinem Gärtchen auf- und abging und dabei seiner Zukunft dachte. Was würde sie ihm wohl bringen? – Was durfte er von ihr erwarten? –