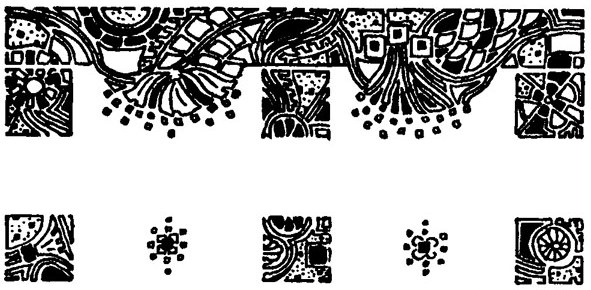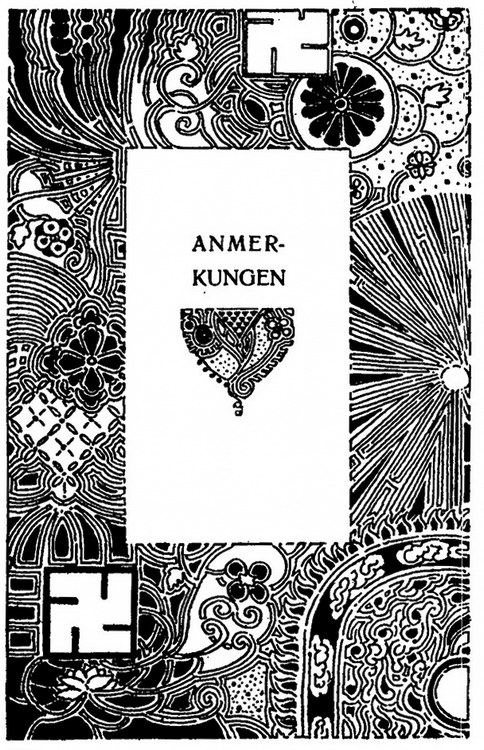|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es ist vielleicht angezeigt, die Leser des Vorhergehenden daran zu erinnern, daß die Worte »Seele«, »Selbst«, »Ego«, »Seelenwanderung«, »Vererbung«, obgleich frei von mir angewendet, einen der buddhistischen Philosophie vollkommen fremden Sinn ausdrücken. »Seele«, in unserer Bedeutung des Wortes, existiert nicht für den Buddhisten. Das »Selbst« ist eine Illusion, oder eigentlich ein Netzwerk von Illusionen. »Seelenwanderung« in dem Sinne des Übergehens der Seele von einem Körper in den andern wird in buddhistischen Texten von zweifelloser Autorität ausdrücklich negiert. Es wird also offenbar sein, daß die wirkliche Analogie, die zwischen der Lehre vom Karma und den wissenschaftlichen Fakten der Erblichkeit besteht, durchaus keine vollständige ist. Karma bedeutet das Fortleben nicht derselben zusammengesetzten Individualität, sondern ihrer Tendenzen, die sich rekombinieren, um eine neue, zusammengesetzte Individualität zu bilden. Das neue Wesen muß nicht notwendig eine menschliche Form annehmen. Das Karma vererbt sich nicht von Eltern auf Kinder; es ist von der Erblichkeitslinie unabhängig, obgleich die physische Beschaffenheit von dem Karma abzuhängen scheint. Das Karmawesen eines Bettlers kann in dem Körper eines Königs wiedererstehen; das eines Königs in dem Körper eines Bettlers; aber die Beschaffenheit jeder der beiden Inkarnationen ist durch den Einfluß des Karma vorherbestimmt gewesen.
Man wird fragen, was denn das geistige Element in jedem Wesen ist, das unverändert bleibt gleichsam der geistige Kern in der Schale des Karma – die Kraft, die das Gute wirkt. Wenn sowohl Seele als Leib gleicherweise zeitlich beschränkte Zusammensetzungen sind, und auch das ebenfalls zeitlich beschränkte Karma die einzige Quelle der Persönlichkeit, was ist dann der Wert oder die Bedeutung der buddhistischen Lehre? Was ist das, was durch das Karma leidet; was ist das, was in der Illusion liegt, – was ist das, was sich entwickelt, – was Nirvana erreicht? Ist es nicht ein »Selbst«? Nicht in unserem Sinne des Wortes. Die Realität dessen, was wir »Selbst« nennen, wird vom Buddhismus negiert. Das, was das Karma bildet und auflöst; das, was zum Guten hinstrebt; das, was Nirvana erreicht, ist nicht unser »Ego« im abendländischen Sinne des Wortes. Also was ist es denn? Es ist das Göttliche in jedem Wesen. Es wird im Japanischen Muga-no-taiga genannt – das Große-Selbst-ohne-Selbstsucht. Es gibt kein anderes wirkliches Selbst. Das in Illusion eingehüllte Selbst heißt Nyorai-zo, (Tathâgatagharba,) der noch ungeborne Buddha, gleichsam im Mutterleibe. Das Unendliche ist in jedem Wesen latent vorhanden. Das ist die Realität. Das andere Selbst ist ein Irrtum, eine Lüge, eine Luftspiegelung. Die Lehre der Vernichtung bezieht sich nur auf die Vernichtung der Illusionen; und jene Sensationen und Gefühle und Gedanken, die bloß dem körperlichen Leben allein gehören, sind die Illusionen, die das zusammengesetzte illusorische Selbst bilden. Durch die völlige Auflösung dieses falschen Selbst offenbart sich, wie durch das Fortziehen von Schleiern, die unendliche Vision. Es gibt keine »Seele«, die unendliche Allseele ist das einzige ewige Prinzip in jedem Wesen; alles übrige ist Traum.
Was bleibt im Nirvana? Nach einer Schule des Buddhismus potentielle Identität bis in die Unendlichkeit, so daß ein Buddha, nachdem er Nirvana erreicht hat, wieder auf die Erde zurückkehren kann. Nach einer anderen Schule eine mehr als potentielle Identität, aber nicht »persönlich« in unserem Sinne. Ein japanischer Freund sagt: »Ich nehme ein Stück Gold und sage, es ist Eins. Aber dies bedeutet den Eindruck, den es auf mein Sehorgan als eine Einheit macht. In Wirklichkeit ist jedes der Atome, aus denen es besteht, nichtsdestoweniger unterscheidbar, unabhängig von jedem anderen Atom. Im Buddhatum sind ebensolche zahllose psychische Atome vereinigt. Sie sind Eins nach ihrer äußeren Beschaffenheit, aber jedes hat sein eigenes unabhängiges Dasein.«
Aber in Japan hat die primitive ursprüngliche Religion so den buddhistischen Volksglauben beeinflußt, daß es nicht unrichtig ist, von der »japanischen Idee des Selbst« zu sprechen. Es ist nur notwendig, die volkstümlichen shintoistischen Ideen gleichzeitig in Betracht zu ziehen. Der Shintoismus gibt uns das einleuchtendste Beispiel für die Vorstellung der Seele. Aber diese Seele ist ein Zusammengesetztes, kein bloßes Bündel von Sensationen, Wahrnehmungen und Willensäußerungen, wie das Karma, sondern eine Anzahl von Seelen, verbunden zu einer geisterhaften Persönlichkeit. Der Geist eines Toten kann in einfacher oder vielfacher Gestalt erscheinen. Er kann seine Elemente auseinanderlösen, von denen jedes einer speziellen, unabhängigen Betätigung fähig bleibt. Eine solche Trennung scheint jedoch nur zeitweilig zu sein, da die verschiedenen Seelen, die das Zusammengesetzte bilden, naturgemäß selbst nach dem Tode zueinander streben und sich nach jeder freiwilligen Trennung wieder vereinigen. Die breiten Massen des japanischen Volkes sind zugleich Buddhisten und Shintoisten; aber die primitiven Auffassungen des Selbst sind sicherlich die mächtigsten und bleiben nach Verschmelzung der beiden Religionen deutlich erkennbar. Wahrscheinlich haben sie dem allgemeinen Verständnis eine natürliche und leichte Erklärung für das Karmaproblem geboten, obgleich ich nicht sagen könnte, in welchem Ausmaß dies der Fall war. Es mag auch bemerkt werden, daß sowohl in der primitiven wie auch in der buddhistischen Glaubensform das Selbst kein von den Eltern auf den Sprößling übertragenes Prinzip ist – kein Erbe, das immer von der physischen Abstammung abhängig ist.
Diese Tatsachen erweisen, wie groß der Unterschied zwischen den orientalischen und unseren eigenen Ideen über die Dinge sind, die in dem vorhergehenden Essay behandelt wurden. Sie werden auch zeigen, daß eine allgemeine Betrachtung der bestehenden seltsamen Analogien zwischen dem Glauben des fernen Ostens und den wissenschaftlichen Gedanken des neunzehnten Jahrhunderts, durch Anwendung der strikten philosophischen Bezeichnungen, die sich auf die Idee des Selbst beziehen, kaum veranschaulicht werden können. Es gibt tatsächlich keine europäischen Worte, die imstande wären die genaue Bedeutung der buddhistischen Bezeichnungen der buddhistischen Ideenwelt wiederzugeben.
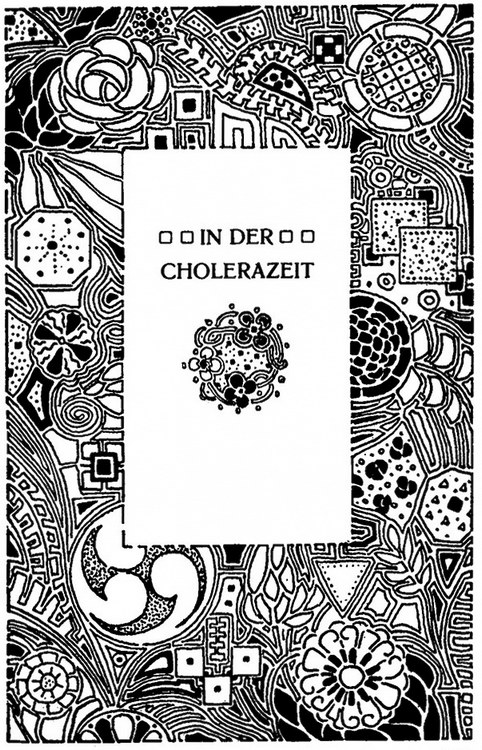
 Chinas Hauptverbündeter in seinem letzten Kriege war blind und taub und wollte und will noch immer nichts von Verhandlungen und Frieden wissen. Er verfolgte die nach Japan zurückkehrenden Truppen, hielt seinen Einzug in das siegreiche Kaiserreich und tötete während der heißen Jahreszeit nahezu dreißigtausend Menschen. Er fährt noch in seinem Mordwerke fort, und unablässig lodern die Scheiterhaufen, auf denen die Leichen verbrannt werden. Manchmal trägt ein Windstoß von dem Hügel hinter der Stadt den Rauch und den Duft in meinen Garten, wie um mich zu mahnen, daß die Kosten der Verbrennung eines Erwachsenen von meiner Größe achtzig Sen betragen, ungefähr einen halben Dollar in amerikanischem Gelde.
Chinas Hauptverbündeter in seinem letzten Kriege war blind und taub und wollte und will noch immer nichts von Verhandlungen und Frieden wissen. Er verfolgte die nach Japan zurückkehrenden Truppen, hielt seinen Einzug in das siegreiche Kaiserreich und tötete während der heißen Jahreszeit nahezu dreißigtausend Menschen. Er fährt noch in seinem Mordwerke fort, und unablässig lodern die Scheiterhaufen, auf denen die Leichen verbrannt werden. Manchmal trägt ein Windstoß von dem Hügel hinter der Stadt den Rauch und den Duft in meinen Garten, wie um mich zu mahnen, daß die Kosten der Verbrennung eines Erwachsenen von meiner Größe achtzig Sen betragen, ungefähr einen halben Dollar in amerikanischem Gelde.
Von dem oberen Balkon meines Hauses überblickt man die ganze Länge einer japanischen Straße mit ihrer Zeile kleiner Verkaufsläden bis zur Bucht hinab. Aus vielen Häusern dieser Straße sah ich, wie man Cholerakranke ins Spital transportierte, den letzten erst heute morgen; es war mein Nachbar, der mir gegenüber einen Porzellanladen inne hatte. Man führte ihn mit Gewalt fort, trotz der Tränen und der Wehrufe seiner Angehörigen. Die Sanitätsvorschriften verbieten es, Cholerafälle zu Hause behandeln zu lassen, aber die Leute suchen ihre Kranken zu verbergen, trotz daraufgesetzter Geldbußen und anderer Strafen, weil die öffentlichen Spitäler überfüllt sind und die Behandlung dort eine barsche ist und die Patienten von allen ihren Lieben gänzlich getrennt bleiben. Aber die Behörde läßt sich nicht oft hintergehen; sie entdeckt bald die unangemeldeten Fälle und kommt mit Tragbahren und Kulis. Dies scheint hart, aber das Sanitätsgesetz muß hart sein. Die Frau meines Nachbars folgte der Bahre weinend und schreiend, bis der Beamte sie zwang, in ihren kleinen, verödeten Laden zurückzukehren. Er ist nun geschlossen und wird wohl nie wieder von seinen Eigentümern geöffnet werden.
Solche Tragödien enden so schnell, wie sie beginnen. Die Hinterbliebenen schaffen, sobald es die Behörden gestatten, ihre Habseligkeiten fort und verschwinden; und das gewohnte Leben der Straße haspelt weiter, bei Tag und bei Nacht, genau so, als ob nichts Besonderes geschehen wäre. Herumziehende Verkäufer mit ihren Bambusstäben und Körben, oder Eimern, oder Kästchen gehen mit ihren gewohnten Rufen an den leeren Häusern vorüber; religiöse Prozessionen, Fragmente von Sutras singend, ziehen vorbei; der blinde Badewärter läßt seinen melancholischen Pfiff ertönen; der Privatschutzmann stößt im Gehen seinen Stab schwer auf den Boden auf; der Junge, der Konfekt verkauft, schlägt auf seine Trommel und singt ein Liebesliedchen, mit einer klagenden, süßen Stimme, wie der eines Mädchens: –
» Du und ich, wir beide zusammen ... lange blieb ich; doch als ich schied, war mir's, als ob erst gekommen ich sei.«
» Du und ich, wir beide zusammen ... Immer noch denk' ich an den Tee; getrockneter oder frischer Tee von Uyi hätte er anderen geschienen; aber für mich war er Gyokorotee, von dem schönen Gelb der Yamubukiblume.«
» Du und ich, wir beide zusammen ... ich bin der Depeschenabsender, du harrst der Botschaft. Ich sende mein Herz, und du empfängst es. Was verschlägt es uns nun, wenn die Post stürzt und die Telegraphendrähte reißen?«

Und die Kinder tummeln sich wie gewöhnlich. Sie haschen sich mit Lachen und Schreien; sie tanzen in Reigen, sie fangen Libellen, binden sie an lange Schnüre und lassen sie flattern; sie singen Refrains von Kriegsliedern, die schildern, wie Chinesen die Köpfe abgeschlagen werden: »Chan, chan bozu no, Kubi wo hane!«
Manchmal holt der Tod eines der Kinder, aber die Überlebenden setzen ihr Spiel fort, und dies ist Weisheit.
Die Leiche eines Kindes verbrennen zu lassen, kostet nur vierundzwanzig Sen. Der Sohn eines meiner Nachbarn wurde vor einigen Tagen verbrannt. Die kleinen Steinchen, mit denen er zu spielen pflegte, liegen noch dort in der Sonne, so wie er sie verlassen hat. ... Wie seltsam ist diese Liebe der Kleinen für Steine! In einer bestimmten Kindheitsperiode sind Steine das Spielzeug aller Kinder, nicht bloß der Kinder der Armen: jedes japanische Kind ohne Unterschied, gleichviel wie reich es an anderen Spielsachen ist, will manchmal mit Steinen spielen. Dem Kindersinn ist ein Stein etwas sehr Wunderbares, und sollte es auch sein, da selbst dem Verständnis eines Mathematikers nichts wunderbarer sein könnte als ein gewöhnlicher Stein. Der kleine Knirps ahnt, daß der Stein weit mehr ist, als er scheint, was eine sehr richtige Ahnung ist; und wenn dumme, erwachsene Leute ihm nicht weismachen würden, daß es töricht sei, sein Herz an ein solches Spielzeug zu hängen, würde er nie dessen überdrüssig werden und immer etwas Neues und Merkwürdiges daran entdecken. Nur ein sehr großer Geist könnte alle Fragen der Kinder über Steine beantworten.
Nach dem Volksglauben spielt jetzt meines Nachbars Söhnchen mit kleinen unirdischen Steinen in dem trockenen Bett des »Stromes der Seelen« – und wundert sich vielleicht, daß sie keine Schatten werfen.
Die wahre Poesie in der Legende des Sai-no Kawara ist die absolute Natürlichkeit ihrer Grundidee, die geisterhafte Fortführung dieses Spiels, welches alle japanischen Kinder mit Steinen spielen.

Der Pfeifenrohrhändler pflegte mit zwei großen Kästchen, die von einem über seine Schulter gelegten Bambusstab herabbaumelten, seine Runde zu machen. Ein Kästchen enthielt Rohre von verschiedener Dicke, Länge und Farbe, ferner auch Werkzeuge, um dieselben in Metallpfeifen einzufügen. In dem anderen lag sein eigenes Kindchen. Manchmal sah ich es über den Rand des Kästchens lugen und die Vorübergehenden anlächeln; manchmal wieder sah ich es sorgsam eingewickelt in der Tiefe des Kästchens schlummern, manchmal wieder mit Spielsachen tändeln. Viele Leute, sagte man mir, pflegten ihm Spielsachen zu schenken. Eine der Spielsachen hatte eine seltsame Ähnlichkeit mit einem Sterbetäfelchen (ihai); und dieses sah ich immer in dem Kästchen, ob nun das Kind schlief oder wachte.
Neulich bemerkte ich, daß der Pfeifenrohrverkäufer sich seines Bambusstabes mit den daranbaumelnden Kästchen entledigt hatte. Er kam die Straße hinauf mit einem kleinen Handwagen, der gerade groß genug war, seine Waren und das Kindchen zu beherbergen, und offenbar für diesen Zweck mit zwei Abteilungen gebaut worden war. Vielleicht war das Kindchen für die frühere primitive Beförderungsart nun zu schwer geworden. Vor dem Karren flatterte eine kleine weiße Fahne, die in Kursivschrift die Inschrift Kissru-rao kae (Pfeifenrohre werden gewechselt) und eine kurze Bitte um »werte Hilfe«, Otasuké wo negaimasu, trug. Das Kind sah frisch und munter aus, und ich bemerkte wieder das tafelförmige Ding, das meine Aufmerksamkeit schon so oft früher auf sich gezogen hatte. Nun war es aufrecht an ein hohes Kästchen im Innern des Wagens, gegenüber dem Bette des Kindes, befestigt. Indem ich den nahenden Wagen beobachtete, überkam mich plötzlich die Überzeugung, daß das Täfelchen wirklich ein »ihai« war: die Sonne schien hell darauf, und der übliche buddhistische Text war unverkennbar. Dies erregte meine Neugier und ich bat Manyemon, dem Pfeifenverkäufer zu sagen, daß wir eine Anzahl von Pfeifen hätten, die neue Rohre brauchten, – was sich auch wirklich so verhielt. Allsogleich fuhr das Wägelchen an unser Tor heran, und ich trat hinzu, um es anzusehen.
Das Kind war gar nicht scheu, selbst vor einem fremden Gesichte. Ein reizender Knabe. Er lallte und lachte und streckte seine Ärmchen aus, er war offenbar an Liebkosungen gewöhnt; und während ich mit ihm spielte, faßte ich das Täfelchen aufmerksam ins Auge. Es war ein Shinshu-ihai, der das »kaimyo« (posthumer Name) einer Frau trug; und Manyemon übersetzte mir die chinesischen Schriftzeichen: Hochgestellt und angesehen in den Gefilden der Vortrefflichkeit, am einunddreißigsten Tage des dritten Monats des achtundzwanzigsten Jahres der Mejiperiode.
Mittlerweile hatte ein Diener die schadhaften Pfeifen geholt, und ich betrachtete das Antlitz des Handwerkers, während er arbeitete. Es war das Gesicht eines Mannes, der das mittlere Alter überschritten hatte, mit jenen sympathischen, müden Linien um den Mund, den Furchen, die unzählige Lächeln eingegraben haben und die so vielen japanischen Gesichtern einen unsagbaren Ausdruck von resignierter Sanftmut geben. Nun begann Manyemon Fragen an ihn zu stellen, und wenn Manyemon Fragen stellt, vermöchte nur ein schlechter Mensch ihm nicht Rede zu stehen. Manchmal ist es mir, als sähe ich um das teure unschuldige Haupt des Greises den Schimmer einer Aureole, – die Aureole des Botsatsu.
Der Pfeifenrohrverkäufer antwortete mit der Erzählung seiner Geschichte. Zwei Monate nach der Geburt ihres Knaben war seine Frau gestorben. In ihrer Todesstunde hatte sie gesagt: »Von dem Tage meines Todes, bis drei volle Jahre vergangen sind, bitte ich dich, das Kind mit meinem Schatten vereinigt zu lassen: laß es nie von meinem »ihai« getrennt sein, so daß ich fortfahren kann, immer für ihn Sorge zu tragen und ihn zu nähren, da du weißt, daß er drei Jahre lang die Mutterbrust haben soll. Diese meine letzte Bitte, flehe ich dich an, nicht zu vergessen.« Aber als die Mutter tot war, konnte der Vater nicht seiner Arbeit nachgehen, wie er es gewohnt war, und gleichzeitig für ein so kleines Kind Sorge tragen, das bei Tag und Nacht unaufhörlich Wartung erforderte; und er war zu arm, um eine Wärterin aufnehmen zu können. So verlegte er sich darauf, Pfeifenrohre feilzubieten, da er auf diese Weise ein wenig Geld verdienen konnte, ohne das Kind auch nur einen Augenblick allein lassen zu müssen. Er hatte nicht Geld genug, um Milch zu kaufen; aber er hatte den Knaben über ein Jahr mit Reisbrei und Ame-syrup aufgepäppelt.
Ich sagte, das Kind sähe sehr kräftig aus, trotzdem es keine Milchnahrung gehabt hätte.
»Das,« sagte Manyemon in einem Tone der Überzeugung, der beinahe an einen Vorwurf grenzte, »kommt daher, weil ihn die tote Mutter säugt; wie sollte es ihm da an Milch fehlen?«
Und der Knabe lächelte sanft, als fühlte er eine geisterhafte Liebkosung.


 Die Tatsache, daß der Ahnenkult, in verschiedenen, unauffälligen Formen in manchen der höchstzivilisierten Länder Europas noch fortbesteht, ist nicht so allgemein bekannt, um die Idee auszuschließen, daß irgend eine nichtarische Rasse, die tatsächlich einen so primitiven Kult übt, auch notwendig auf einer primitiven Stufe des religiösen Denkens verharren muß. Und doch haben Japanforscher dieses übereilte Urteil ausgesprochen, und sich für außerstande erklärt, die Tatsache des wissenschaftlichen Fortschritts und die Erfolge des vorgeschrittenen Erziehungssystems Japans mit dem Fortbestand des Ahnenkults in Einklang zu bringen. Wie können die Glaubenssätze des Shintoismus neben den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft bestehen? Wie können Männer, die sich als wissenschaftliche Spezialisten auszeichnen, den Hausaltar anbeten, oder vor dem Shinto-Tempel ihrer Gemeinde ihre Andacht verrichten? Kann all dies mehr bedeuten, als die vorgeschriebene Beibehaltung konventioneller Formen, nachdem der Glaube erloschen ist? Ist es nicht gewiß, daß mit dem weiteren Fortschritt des Erziehungswesens der Shintoismus, selbst als Zeremoniell, aufhören muß?
Die Tatsache, daß der Ahnenkult, in verschiedenen, unauffälligen Formen in manchen der höchstzivilisierten Länder Europas noch fortbesteht, ist nicht so allgemein bekannt, um die Idee auszuschließen, daß irgend eine nichtarische Rasse, die tatsächlich einen so primitiven Kult übt, auch notwendig auf einer primitiven Stufe des religiösen Denkens verharren muß. Und doch haben Japanforscher dieses übereilte Urteil ausgesprochen, und sich für außerstande erklärt, die Tatsache des wissenschaftlichen Fortschritts und die Erfolge des vorgeschrittenen Erziehungssystems Japans mit dem Fortbestand des Ahnenkults in Einklang zu bringen. Wie können die Glaubenssätze des Shintoismus neben den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft bestehen? Wie können Männer, die sich als wissenschaftliche Spezialisten auszeichnen, den Hausaltar anbeten, oder vor dem Shinto-Tempel ihrer Gemeinde ihre Andacht verrichten? Kann all dies mehr bedeuten, als die vorgeschriebene Beibehaltung konventioneller Formen, nachdem der Glaube erloschen ist? Ist es nicht gewiß, daß mit dem weiteren Fortschritt des Erziehungswesens der Shintoismus, selbst als Zeremoniell, aufhören muß?
Diejenigen, die solche Fragen aufwerfen, scheinen zu vergessen, daß man die gleichen Fragen über das Fortbestehen aller abendländischen Religionen stellen und die gleichen Zweifel über ihre Fortdauer im nächsten Jahrhundert aussprechen könnte. In Wirklichkeit sind die Lehren des Shintoismus nicht weniger mit der modernen Wissenschaft vereinbar als es die Lehren des orthodoxen Christentums sind. Mit vollkommener Unparteilichkeit geprüft, möchte ich sogar zu behaupten wagen, daß sie in mehr als einer Hinsicht weniger unvereinbar damit sind. Sie kommen mit unseren humanen Ideen über Gerechtigkeit weniger in Konflikt; und gleich der buddhistischen Lehre vom Karma bieten sie einige sehr frappante Analogien mit den wissenschaftlich festgestellten Tatsachen der Vererbung – Analogien, welche beweisen, daß der Shintoismus ein Element der Wahrheit enthält, das so tief ist wie nur irgend welche Wahrheitselemente in den größten Religionen der Welt. In der möglichst einfachen Form aufgestellt, ist das dem Shintoismus eigentümliche Wahrheitselement der Glaube, daß die Welt der Lebenden direkt von der Welt der Toten beherrscht wird.
Daß jeder Impuls oder jede Tat eines Menschen das Werk eines Gottes ist, und daß alle Toten Götter werden, ist die Grundidee des Kults. Man muß jedoch festhalten, daß das Wort »Kami«, obgleich mit dem Ausdruck Gottheit, Göttlichkeit oder Gott übersetzt, in Wahrheit nicht die Bedeutung oder den Sinn hat, den der Abendländer mit diesen Worten verbindet; es hat nicht einmal die Bedeutung, die wir aus den Religionen Griechenlands und Roms kennen. Es bedeutet das, was im nicht religiösen Sinn »Oben«, »über uns«, »erhaben« ist. Im religiösen Sinne bedeutet es einen menschlichen Geist, der nach seinem Tode zu übersinnlicher Kraft gelangt ist. Die Toten sind die »Kräfte über uns«, die »Hohen«, die Kamis. Wir haben hier eine Auffassung, die der modernen, spiritualistischen Vorstellung von den Geistern sehr gleicht, – nur daß die shintoistische Idee nicht im wahren Sinne demokratisch ist. Die Kamis sind Geister von sehr verschiedener Würde und Macht, die überirdischen Hierarchien angehören, den Hierarchien der alten japanischen Gesellschaft entsprechend. Obgleich den Lebenden in gewisser Hinsicht überlegen, haben die Lebenden doch die Macht, ihnen Freude oder Mißvergnügen zu verursachen, sie zu ergötzen oder sie zu beleidigen, ja manchmal ihre Lage im Geisterreiche zu verbessern. Weshalb posthume Ehrungen dem Japaner nie Hokuspokus, sondern etwas Wirkliches sind. In diesem Jahre z. B. wurden verschiedene Staatsmänner und Offiziere unmittelbar nach ihrem Tode zu einem höheren Range befördert; und ich las erst jüngst in der offiziellen Zeitung, Seine Majestät habe geruht, dem General-Major Baron Yamane, der kürzlich in Formosa gestorben sei, »posthum den Orden der aufgehenden Sonne zweiter Klasse zu verleihen«. Solche kaiserliche Akte dürfen nicht als bloße Formalitäten angesehen werden, um das Andenken tapferer und patriotischer Männer zu ehren, noch darf man sie dahin auffassen, daß man die Familie des Toten dadurch auszeichnen will. Sie sind ausdrücklich dem Geiste des Shintoismus entsprungen und zeigen das tiefwurzelnde Gefühl des Zusammenhanges zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Welten, welches das besondere religiöse Merkmal Japans unter allen zivilisierten Ländern ist. Für das japanische Empfinden sind die Toten nicht weniger wirklich als die Lebenden. Sie leben das tägliche Leben des Volkes mit und teilen all seine kleinen Freuden und Leiden. Sie sind bei den Familienmahlzeiten zugegen, wachen über das Wohlergehen des Hausstandes, sind Zeuge des Glücks ihrer Nachkommen und freuen sich daran. Sie sind bei den öffentlichen Umzügen anwesend, bei allen heiligen Festen des Shintoglaubens, bei den militärischen Spielen und bei allen eigens für sie veranstalteten Feierlichkeiten. Und man glaubt allgemein, daß sie über die ihnen dargebrachten Gaben und die ihnen erwiesenen Ehren Freude empfinden.
Für den Zweck dieses kleinen Essays genügt es, die Kamis als die Geister der Toten zu betrachten, ohne den Versuch zu machen, diese Kamis von jenen primitiven Gottheiten zu unterscheiden, von denen man glaubt, daß sie das Land erschaffen haben. Mit dieser allgemeinen Erklärung des Begriffs Kami kehren wir zu der großen shintoistischen Idee zurück, daß alle Toten noch auf der Erde weilen und nicht nur die Gedanken und Taten der Menschen durch ihren Einfluß beherrschen, sondern auch die Bedingungen der Natur. »Sie bestimmen,« schrieb Motowori, »den Wechsel der Jahreszeiten, des Windes und des Regens, das Glück und das Unglück der Staaten und der Individuen.« Sie sind, mit einem Worte, die unsichtbaren Gewalten hinter allen Phänomenen.

Die interessanteste Subtheorie dieses alten Spiritualismus ist die, welche die Impulse und Taten der Menschen auf den Einfluß der Toten zurückführt. Diese Hypothese kann kein moderner Denker für irrationell erklären, da sie ihre Bestätigung in der wissenschaftlichen Doktrin der psychologischen Evolution findet, nach der jedes lebende Gehirn eine Struktur ist, die von zahllosen toten Leben aufgebaut wurde – jeder Charakter eine mehr oder weniger schwankende Summe zahlloser vergangener Erfahrungen von Gut und Böse. Wenn wir nicht die psychische Vererbung negieren, können wir auch nicht in Abrede stellen, daß unsere Impulse und Gefühle und die durch die Gefühle entwickelten höheren Fähigkeiten tatsächlich von den Toten gebildet und von den Toten auf uns übertragen worden sind; und daß sogar die allgemeine Richtung unserer geistigen Betätigungen durch die Macht der besonderen auf uns übergegangenen Tendenzen bestimmt worden ist. In diesem Sinne sind die Toten allerdings unsere Kamis; und alle unsere Handlungen sind wirklich von ihnen beeinflußt. Figürlich können wir sagen, daß jeder Intellekt eine Welt von Geistern ist – Geister, die unvergleichlich zahlreicher sind als die anerkannten Millionen der höheren Shinto-Kamis; und daß die geisterhafte Bevölkerung einer einzigen Gehirnzelle die wildesten Phantasien der mittelalterlichen Scholastiker von der Zahl der Engel, die auf einer Nadelspitze stehen können, noch übersteigt. Wissenschaftlich wissen wir, daß in einer einzigen, winzigen lebendigen Zelle das ganze Leben einer Rasse aufgespeichert sein kann, die Summe aller vergangenen Empfindungen während Millionen von Jahren; vielleicht sogar (wer weiß) von Millionen toter Planeten.
Aber die Teufel werden wohl den Engeln in der bloßen Fähigkeit, sich auf einer Nadelspitze zu versammeln, nicht nachstehen? Was sagt uns diese shintoistische Theorie über böse Menschen und böse Taten? Motowori beantwortet diese Frage folgendermaßen: »wann immer irgend etwas in der Welt schlecht geht, muß man es dem Einfluß der bösen Götter, genannt die ›Götter der Verkehrtheit‹ zuschreiben, deren Macht so groß ist, daß die Sonnen-Göttin und der Schöpfer-Gott manchmal unfähig sind, ihnen Einhalt zu tun; noch weniger sind menschliche Wesen imstande, ihrem Einfluß zu widerstehen. Das Glück des Bösen und das Ungemach des Guten, die mit der gewöhnlichen Gerechtigkeit im Widerspruch zu sein scheinen, werden dadurch erklärt.« Alle bösen Handlungen kommen von dem Einfluß böser Gottheiten; und böse Menschen können böse Kamis werden. In diesem einfachsten aller Kulte sind keine Selbstwidersprüche,
Ich betrachte hier nur den reinen Shintoglauben, wie er von den shintoistischen Gelehrten dargelegt wird. Aber es mag angebracht sein, den Leser darauf hinzuweisen, daß in Japan sowohl der Buddhismus wie der Shintoismus nicht bloß miteinander, sondern mit chinesischen Vorstellungen mannigfacher Art verwoben ist. Eis ist sehr zweifelhaft, ob die reinen shintoistischen Ideen in ihrer ursprünglichen Gestalt im Volksglauben noch fortbestehen.
Wir sind uns über die shintoistische Lehre von der vielfachen Seele nicht ganz klar – ob man ursprünglich glaubte, daß die psychische Zusammensetzung durch den Tod aufgelöst wurde. Meine eigene Meinung, das Resultat von Forschungen in verschiedenen Teilen Japans, ist, daß man früher annahm, die vielfache Seele bleibe auch nach dem Tode ein Vielfaches. nichts Kompliziertes oder schwer Verständliches. Es ist nicht ausgemacht, daß alle Menschen, die sich böser Handlungen schuldig gemacht haben, notwendigerweise Götter der Verkehrtheit werden müssen, aus Gründen, die später erörtert werden sollen. Aber alle Menschen, gute und böse, werden Kamis oder Einflüsse. Und alle bösen Handlungen sind die Resultate böser Einflüsse.
Nun, diese Lehre stimmt mit gewissen Tatsachen der Vererbung überein. Unsere besten Fähigkeiten sind sicherlich ein Erbe der besten unserer Vorfahren; unsere bösen Eigenschaften sind auf uns von Naturen vererbt, in denen das Böse, oder das, was wir heute böse nennen, vorherrschte. Das durch die Zivilisation in uns entwickelte ethische Gefühl verlangt, daß wir die uns durch die besten Erfahrungen der Toten hinterlassenen edlen Kräfte steigern und die Macht der ererbten niedrigeren Neigungen vermindern. Wir sind verpflichtet, unsere guten Kamis zu verehren und ihnen zu gehorchen und gegen unsere Götter der Verkehrtheit anzukämpfen. Die Kenntnis der Existenz beider ist so alt wie die menschliche Vernunft. In einer oder der anderen Form ist die Lehre von den guten und den bösen Geistern (als persönlich auf jede Seele einwirkend) den meisten der großen Religionen gemeinsam. Unser eigener mittelalterlicher Glaube entwickelte diese Idee zu einem Grade, der unserer Sprache für alle Zeiten seinen Stempel aufgedrückt hat; und doch stellt der Glaube an Schutzengel und verführerische Dämonen, evolutionistisch angesehen, nur die Entwicklung eines Kults dar, der einst so einfach war wie die Religion der Kamis. Und diese Theorie des mittelalterlichen Glaubens ist ebenfalls voll fruchtbarer Wahrheit. Die weißbeschwingte Gestalt, die Gutes ins rechte Ohr flüsterte, der schwarze Versucher, der Böses in das linke raunte, schreiten freilich nicht neben dem modernen Menschen von heute einher, aber sie weilen in seinem Hirn; und er kennt ihre Stimmen ebensogut und hört ihr Drängen ebenso häufig wie seine Vorfahren im Mittelalter.
Der moderne ethische Einwand gegen den Shintoismus ist, daß sowohl die guten wie die bösen Kamis Verehrung genießen sollen. »Ebenso wie der Mikado die Götter des Himmels und der Erde anbetete, so betete sein Volk zu den guten Göttern, um ihren Segen herabzuflehen, und vollzog Riten zu Ehren der bösen Götter, um ihr Mißfallen abzuwenden. ... Da es ebensowohl böse wie gute Götter gibt, ist es notwendig, sie sich mit Opfern von wohlschmeckenden Speisen, mit Harfen- und Flötenspiel, mit Gesang und Tanz geneigt zu machen, und alles aufzubieten, um sie freundlich zu stimmen.« Doch scheinen im modernen Japan die bösen Kamis wenig Gaben oder Ehren zu erhalten – ungeachtet dieser ausdrücklichen Erklärung, daß man sie sich geneigt machen müsse. Aber es wird nun klar sein, warum die ersten Missionäre diesen Kult als Teufelsanbetung darstellten, obgleich der Teufelsbegriff im abendländischen Sinne in der shintoistischen Phantasie niemals Gestalt angenommen hat. Die sichtliche Schwäche der Doktrin liegt in der Lehre, daß man die bösen Geister nicht bekämpfen solle, eine Lehre, die das römisch-katholische Gefühl im tiefsten abstoßen muß. Aber zwischen den bösen Geistern der christlichen Lehre und des Shintoglaubens ist ein gewaltiger Unterschied. Der böse Kami ist nur der Geist eines bösen Menschen und wird nicht als durchaus böse betrachtet, da es möglich ist, ihn günstig zu stimmen. Die Vorstellung des ungemischten, absoluten Bösen kommt im fernen Osten nicht vor. Das absolut Böse ist sicherlich der menschlichen Natur fremd und deshalb auch bei menschlichen Geistern unmöglich. Die bösen Kamis sind keine Teufel. Sie sind einfach Geister, die die Leidenschaften der Menschen beeinflussen; und nur in diesem Sinne die Gottheiten der Leidenschaften. Der Shintoismus ist von allen Religionen die natürlichste und darum in vieler Hinsicht die rationellste. Er betrachtet die Leidenschaften nicht als unbedingt böse an sich, sondern nur als böse je nach der Ursache, den Bedingungen und dem Grade, in dem man sich ihnen hingibt. Da die Götter Geister sind, sind sie durchaus menschlich und besitzen die verschiedenen guten und bösen Eigenschaften der Menschen in verschiedenem Grade. Die meisten sind gut, und die Summe des Einflusses aller neigt sich mehr dem Guten als dem Bösen zu. Um das Rationelle dieser Anschauung zu würdigen, muß man eine ziemlich hohe Meinung von der Menschheit haben – eine Meinung, wie sie die Verhältnisse im alten Japan wohl gerechtfertigt hätten. Kein Pessimist könnte sich zum reinen Shintoismus bekennen. Die Lehre ist optimistisch; und wer eine hohe Meinung von der Menschheit hat, wird es nicht beklagen, daß die Idee des unversöhnlich Bösen darin nicht vorkommt.
Gerade in der Erkenntnis der Notwendigkeit, die bösen Geister zu beschwichtigen, zeigt sich der ethisch-rationelle Charakter des Shintoismus. Alte Erfahrung und moderne Erkenntnis vereinigen sich, uns vor dem verhängnisvollen Irrtum zu warnen, gewisse Triebe in der menschlichen Natur auszurotten oder lähmen zu wollen – die, wenn man ihnen krankhaft nachgibt oder sie von allen Fesseln befreit, zu Wahnsinn, Verbrechen und zahllosen sozialen Übeln führen. Die animalischen Leidenschaften, die Tiger- und Affen-Impulse sind älter als die menschliche Gesellschaft und fast an jedem Verbrechen mitschuldig, das gegen sie begangen wird. Aber sie können nicht getötet und auch nicht ohne Gefahr ausgehungert werden. Jeder Versuch sie auszurotten, würde auch zugleich, einige der höchsten emotionellen Fähigkeiten zerstören, mit denen sie unzertrennlich verbunden bleiben. Die primitiven Impulse können nicht einmal abgeschwächt werden, es sei denn auf Kosten der intellektuellen und emotionellen Kräfte, die dem menschlichen Leben all seine Schönheit und Zärtlichkeit verleihen, die aber trotzdem in dem uralten Boden der Leidenschaft ihre tiefsten Wurzeln haben. Das höchste in uns hatte seinen Ursprung im niedersten. Die Askese hat durch die Unterdrückung der natürlichen Gefühle Monstrositäten geschaffen. Die irrationell gegen die menschlichen Schwächen gerichteten theologischen Vorschriften haben die sozialen Mißstände nur noch verschärft; und Gesetze gegen den Genuß haben nur Ausschweifungen zur Folge gehabt. Die Geschichte der Moral lehrt uns sehr deutlich, daß unsere bösen Kamis beschwichtigt werden wollen. Die Leidenschaften sind noch immer mächtiger im Menschen als die Vernunft, weil sie unvergleichlich älter sind – weil sie einstmals das einzig wesentliche für die Selbsterhaltung waren – weil sie jene Urschicht des Bewußtseins bildeten, aus dem die edleren Gefühle nach und nach erwachsen sind. Nie darf man dulden, daß sie herrschend werden; aber wehe dem, der sich vermessen wollte, ihre unvordenklichen Rechte zu leugnen!
Aus diesen primitiven, aber wie man jetzt einsehen wird, nicht irrationellen Vorstellungen über die Toten, haben sich moralische Gefühle entwickelt, die der abendländischen Zivilisation fremd sind. Diese sind wohl der Betrachtung wert, da es sich erweisen wird, daß sie sich mit den vorgeschrittensten Konzeptionen der Ethik im Einklang befinden, und namentlich mit jener ungeheueren, wenn auch noch nicht definierten Erweiterung des Pflichtgefühls, die aus dem Verständnis der Evolutionsidee hervorgegangen ist. Ich glaube nicht, daß wir Ursache haben, uns etwas darauf zugute zu tun, daß diese Gefühle in unserem Leben fehlen: ja, ich neige sogar zu der Meinung, daß wir es noch moralisch notwendig finden werden, Gefühle dieser Art bewußt auszubilden. Eine der Überraschungen unserer Zukunft wird sicherlich die Rückkehr zu Anschauungen und Religionen sein, die wir schon vor langer Zeit auf die bloße Annahme hin, daß sie keine Wahrheit enthalten, verworfen haben, Religionen, die noch von jenen, welche sie aus traditioneller Gewohnheit verdammen, barbarisch, heidnisch und mittelalterlich genannt werden. Jahr für Jahr bringen uns die Forschungen der Wissenschaft neue Beweise dafür, daß der Wilde, der Barbar, der Götzenanbeter, der Mönch, alle auf verschiedenen Wegen so nahe zu irgend einem Punkt der ewigen Wahrheit gelangt sind, als nur irgend ein Denker des neunzehnten Jahrhunderts. Wir erkennen jetzt auch, daß die Theorien der Astrologen und Alchymisten nur teilweise, nicht absolut irrig waren. Wir haben sogar Ursache anzunehmen, daß kein Traum von der unsichtbaren Welt jemals geträumt wurde, daß keine Hypothese über das Unsichtbare sich je gebildet hat, von der die Wissenschaft der Zukunft nicht beweisen wird, daß sie einen Keim der Wahrheit enthalten habe.
Unter den moralischen Gefühlen des Shintoismus steht das der liebevollen Dankbarkeit gegen die Vergangenheit obenan, eine Empfindung, die in unserem Gefühlsleben eigentlich kein Gegenstück hat. Wir kennen unsere Vergangenheit besser als die Japaner die ihre. Wir haben Myriaden Bücher, wo alle Vorfälle und Verhältnisse festgehalten und betrachtet werden. Aber man kann in keiner Weise von uns sagen, daß wir für unsere Vergangenheit Liebe und Dankbarkeit empfinden. Kritische Darlegungen ihrer Vorzüge und Fehler; hier und da ein durch ihre Schönheit hervorgerufener, auflodernder Enthusiasmus; viele schonungslose Aufdeckungen ihrer Irrtümer: dies repräsentiert die Summe unserer Gefühle und Gedanken der Vergangenheit gegenüber. Die Haltung der Wissenschaft, die sie ihrer Betrachtung unterzieht, ist naturgemäß kalt; die unserer Kunst oft sehr begeistert; die unserer Religion in den meisten Fällen verdammend. Aber von welchem Standpunkt aus wir sie auch studieren mögen, so ist doch unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich auf das Werk der Toten gerichtet – entweder das sichtbare Werk, bei dessen Anblick unser Herz ein wenig höher schlägt, oder die Resultate ihrer Gedanken und Handlungen in Beziehung auf die Gesellschaft ihrer Zeit. An die vergangene Menschheit als Einheit – an die Millionen längst Begrabener als uns wirklich Verwandte – denken wir entweder gar nicht oder nur mit derselben Neugier, die wir dem Studium erloschener Rassen entgegenbringen. Wir nehmen allerdings Interesse an der Schilderung eines individuellen Lebens, das in der Geschichte große Spuren hinterlassen hat; unsere Gefühle werden durch die Erinnerung an große Feldherren, Staatsmänner, Entdecker, Reformatoren bewegt – aber nur weil das Großartige, was sie vollbrachten, zu unserem eigenen Ehrgeiz, unseren Wünschen, unserem Egoismus spricht, und durchaus nicht zu unseren altruistischen Gefühlen. Über die namenlosen Toten, denen wir am meisten schulden, machen wir uns gar keine Gedanken, wir fühlen ihnen gegenüber keine Liebe, keine Dankbarkeit. Es fällt uns sogar schwer zu glauben, daß die Liebe zu den Ahnen in irgend einer menschlichen Gesellschaft wirklich ein mächtiges, tiefgehendes, lebengestaltendes, religiöses Gefühl sein könne, was es in Japan zweifellos ist. Die Idee an sich ist unserem Denken, Fühlen und Handeln absolut fremd. Zum Teil liegt der Grund natürlich darin, daß bei uns im allgemeinen nicht der Glaube an einen aktiven geistigen Zusammenhang zwischen unseren Vorfahren und uns selbst besteht. Wenn wir irreligiös sind, so glauben wir überhaupt nicht an Geister. Sind wir tief religiös, so denken wir uns die Toten als uns durch ewigen Ratschluß entrückt, als für die Dauer unseres Lebens absolut von uns getrennt. Es ist wahr, daß unter der bäuerlichen Bevölkerung der römisch-katholischen Länder noch der Glaube besteht, daß es den Toten gestattet ist, einmal im Jahre zur Erde zurückzukehren – in der Nacht von Allerseelen. Aber selbst nach diesem Glauben stellt man sich nicht vor, daß sie mit den Lebenden durch ein stärkeres Band als das der Erinnerung verknüpft seien. Und man gedenkt ihrer – wie unsere folkloristischen Sammlungen zeigen – eher mit Furcht als mit Liebe.
In Japan ist das Gefühl, das man für die Toten hegt, von diesem grundverschieden. Es ist ein Gefühl der dankbaren und verehrenden Liebe. Es ist wahrscheinlich das tiefste und machtvollste Gefühl der Rasse, dasjenige, welches hauptsächlich das nationale Leben beherrscht und den Nationalcharakter entwickelt hat. Der Patriotismus gehört dazu. Die kindliche Pietät beruht darauf. Die Liebe zur Familie wurzelt darin. Die Loyalität basiert auf ihm. Der Soldat, der, um seinen Kameraden den Weg durch das Schlachtfeld zu bahnen, ohne Zaudern sein Leben mit dem Rufe: »Teikoku-Banzai!« hinopfert; der Sohn oder die Tochter, die, ohne zu murren, alles Lebensglück für vielleicht unwürdige oder sogar grausame Eltern opfern; der Vasall, der sich eher von Freunden, Familie und Glücksgütern lossagt, als daß er das Wort bricht, das er einst dem jetzt verarmten Herrn gegeben; die Gattin, die sich feierlich in weiße Gewänder hüllt, ein Gebet spricht und mit einem Schwert ihre Kehle durchbohrt, um ein Unrecht zu sühnen, das ihr Gatte Fremden zugefügt hat: all diese gehorchen dem Willen und vernehmen die Zustimmung unsichtbarer Zeugen. Selbst bei den skeptischen Studenten der neuen Generation überlebt dieses Gefühl so manchen gescheiterten Glauben; und man leiht noch häufig den alten Empfindungen Worte wie diese: »Niemals dürfen wir unseren Ahnen Schande bereiten!« – »Es ist unsere Pflicht, unseren Ahnen Ehre zu machen!« In meiner früheren Stellung als Lehrer des Englischen, kam es mehr als einmal vor, daß meine Unkenntnis des wirklichen Sinnes dieser Aussprüche mich bestimmte, sie in den Aufsätzen meiner Schüler umzuändern. Ich legte ihnen zum Beispiel nahe, daß der Ausdruck »Dem Andenken unserer Ahnen Ehre zu machen«, richtiger wäre als der von ihnen geschriebene Satz. Ich erinnere mich sogar, daß ich ihnen eines Tages erklärte, warum wir nicht von den Ahnen genau so sprechen sollten, als wenn es lebende Eltern wären. Vielleicht hatten meine Schüler damals den Argwohn, daß ich mich in ihre Glaubensangelegenheiten mischen wolle. Denn für die Japaner werden die Vorfahren nie zur »bloßen Erinnerung«. Ihre Toten leben.
Wenn in unserem Inneren plötzlich die absolute Überzeugung erwachte, daß unsere Toten noch unter uns weilen, daß sie jede Handlung sehen, jeden unserer Gedanken kennen, jedes unserer Worte vernehmen, imstande Sympathie mit uns oder Unwillen gegen uns zu empfinden, fähig uns zu helfen und beglückt, unsere Hilfe zu empfangen, fähig uns zu lieben und unserer Liebe sehr bedürftig, so ist es ganz gewiß, daß alle unsere Vorstellungen vom Leben und von der Pflicht eine große Umwälzung erfahren würden. Wir müßten unsere Verpflichtung gegen die Vergangenheit feierlich anerkennen. Nun, bei den Menschen des fernen Ostens ist es seit Tausenden von Jahren eine Sache der Überzeugung, daß die Toten stets gegenwärtig sind. Der Orientale spricht täglich zu ihnen; er bemüht sich, ihnen Freude zu machen; und wenn er nicht geradezu ein Berufsverbrecher ist, vergißt er niemals ganz seine Pflicht gegen sie. Niemand, sagt Hirata, der diese Pflicht immer erfüllt, wird jemals gegen die Götter oder gegen seine lebenden Eltern unehrerbietig sein. »Ein solcher Mann wird auch immer treu gegen seine Freunde, und gütig und sanft gegen seine Frau und seine Kinder sein; denn die Quintessenz dieses Kults ist in Wahrheit kindliche Pietät.« Und in diesem Empfinden liegt der Schlüssel zu vielen seltsamen Seiten des japanischen Charakters. Unserer Gefühlswelt viel fremder als der großartige Mut, mit dem sie dem Tode begegnen, oder der Gleichmut, mit dem sie die schwersten Opfer bringen, ist die schlichte tiefe Empfindung des Knaben, der beim Anblick eines nie zuvor gesehenen Shintoaltars, plötzlich seine Augen von Tränen verdunkelt fühlt. In diesem Augenblick wird er sich dessen bewußt, was wir nie gefühlsmäßig fassen: der ungeheueren Schuld der Gegenwart an die Vergangenheit, und der Pflicht, die Toten zu lieben.

Denken wir über unsere Stellung als Schuldner und über die Art, uns in diese Stellung zu finden, ein wenig nach, so wird uns ein frappanter Unterschied zwischen abendländischem und morgenländischem moralischem Gefühl offenbar werden.
Es gibt nichts Erschreckenderes als die bloße Tatsache des Lebensmysteriums, wenn man sich dieser Tatsache zum ersten Male voll bewußt wird. Aus unbekannter Dunkelheit steigen wir einen Augenblick zum Sonnenlicht empor, blicken um uns, freuen uns und leiden, übertragen die Vibration unseres Wesens auf andere Wesen und versinken wieder in Dunkelheit. So steigt eine Welle empor, fängt das Licht auf, gibt ihre Bewegung weiter und sinkt wieder ins Meer zurück. So steigt die Pflanze aus dem Staube empor, entfaltet ihre Blätter dem Licht: und der Luft, blüht, streut Samen aus und kehrt zur Erde zurück. Nur hat die Welle keine Empfindung, die Pflanze kein Bewußtsein. Alles menschliche Leben scheint nicht mehr als eine parabolische Bewegungskurve aus der Erde zurück zur Erde; aber in diesem kurzen Intervall der Umwandlung erkennt es das Universum. Das Erschreckende des Phänomens ist, daß niemand etwas darüber weiß. Kein Sterblicher vermag diese alltäglichste und doch unverständlichste aller Tatsachen – das Leben an sich – zu erklären; aber jeder denkende Sterbliche stand zuweilen unter dem Zwange, in Beziehung auf sein Selbst darüber nachzudenken.
Ich komme aus dem Mysterium; ich sehe Himmel, Land, Männer, Frauen und ihre Werke; und ich weiß, daß ich in das Mysterium zurückkehren muß; und was dies bedeutet, kann mir nicht einmal der größte Philosoph – selbst nicht Herbert Spencer – sagen. Wir sind alle Rätsel für einander, Rätsel für uns selbst; und Raum und Bewegung und Zeit sind Rätsel; und die Materie ist ein Rätsel. Über das vorher und nachher hat weder das neugeborene Kind noch der Tote uns Kunde zu bringen: Das Kind ist stumm; der Totenschädel grinst nur. Die Natur hat keinen Trost für uns. Aus ihrer Gestaltlosigkeit gehen Gestalten hervor, die zur Gestaltlosigkeit zurückkehren. Das ist alles. Die Pflanze wird Erde; die Erde wird Pflanze. Wenn die Pflanze zur Erde wird, was wird dann aus der Vibration, die ihr Leben war? Lebt sie unsichtbar weiter, gleich den Mächten, die auf der gefrorenen Fensterscheibe Blumengeister erblühen lassen?
Innerhalb des Horizonts des unendlichen Rätsels harren zahllose geringere Rätsel, so alt wie die Welt, auf Kommen des Menschen. Ödipus hatte nur das Rätsel einer Sphinx zu lösen; die Menschheit die tausender und abertausender, die alle entlang des Pfades der Zeit zwischen moderndem Gebein kauern, und jede mit einem tieferen, schwereren Rätsel. Nicht alle Rätsel der Sphinxe sind gelöst; Myriaden besäumen den Weg der Zukunft, um noch ungeborene Leben zu verschlingen; aber Millionen fanden ihre Lösung. Wir sind jetzt imstande, ohne fortwährendes Grauen zu leben, durch das relative Wissen, das uns leitet, das Wissen, das wir dem Rachen der Zerstörung entrissen haben.
All unser Wissen ist ererbtes Wissen. Die Toten haben uns die Erinnerung an all das hinterlassen, was sie über sich selbst und die Welt lernen konnten; über die Gesetze des Todes und des Lebens; darüber, welche Dinge man sich aneignen, welche man vermeiden soll; über die Mittel, das Leben weniger schmerzlich zu machen, als es der Wille der Natur war; über Recht und Unrecht, und Kummer und Glück; über den Irrtum der Selbstsucht, die Weisheit der Güte, die Verpflichtung zum Opfer. Sie hinterließen uns Aufklärung über alle ihre Erfahrungen in bezug auf Jahreszeiten, klimatische Verhältnisse, Orte, Sonne, Mond und Sterne, die Bewegungen und die Zusammensetzung des Universums. Sie vererbten uns auch ihre Irrtümer, die lange dem guten Zweck dienten, uns vor größeren zu bewahren. Sie hinterließen uns die Geschichte ihrer Täuschungen und Bestrebungen, ihrer Triumphe und Niederlagen, ihrer Schmerzen und Freuden, ihrer Liebe und ihres Hasses – als Warnung oder Beispiel. Sie rechneten auf unsere Sympathie, weil sie mit den freundlichsten Wünschen und Hoffnungen für uns arbeiteten und unsere Welt schufen. Sie machten das Land urbar; sie rotteten Ungeheuer aus; sie zähmten die Tiere, die uns am nützlichsten sind. »Die Mutter Kullervos erwachte in ihrem Grabe, und aus der Tiefe des Staubs rief sie ihm zu: Ich ließ dir den Hund, an einen Baum gebunden, auf daß du mit ihm auf die Jagd gehen mögest.« (Kalevala, 36. Rune).
Sie veredelten ebenso die nützlichen Bäume und Pflanzen und entdeckten die Fundorte und Kräfte der Metalle. Später schufen sie all das, was wir Zivilisation nennen, und überließen es uns, die Irrtümer zu berichtigen, die sie nicht vermeiden konnten. Die Summe ihrer Arbeit ist unberechenbar; und alles, was sie uns gegeben, sollte uns sicherlich sehr heilig, sehr teuer sein, wenn schon aus keinem anderen Grunde, so wegen des ungeheueren Aufwandes an Mühe und Gedankenarbeit, die sie daran gesetzt haben. Doch welchem Abendländer fällt es ein, täglich gleich den Shintogläubigen zu sagen: »Ihr Vorväter unserer Generationen, unserer Familien, unserer Anverwandten – euch, den Gründern unseres Heims bringen wir unseren freudigen Dank«?
Keinem. Nicht nur, weil wir glauben, daß die Toten uns nicht hören können, sondern weil wir nicht durch Generationen dazu erzogen worden sind, unsere sympathische geistige Vorstellungskraft über einen sehr engen Kreis – den Familienkreis – auszudehnen. Verglichen mit dem orientalischen Familienkreis ist der abendländische ein sehr enger. Heute ist die abendländische Familie beinahe völlig aufgelöst; – sie bedeutet tatsächlich kaum mehr als Mann, Frau und minderjährige Kinder. Die orientalische Familie umfaßt nicht nur Eltern und deren Blutsverwandte, sondern auch die Großeltern mit ihren Verwandten, die Urgroßeltern und alle Toten hinter ihnen. Diese Idee der Familie bildet die sympathische Vorstellungskraft zu einem so hohen Grade aus, daß die Ausdehnung der diesem Vorstellungskreise angehörigen Gefühle, sich wie in Japan auf viele Gruppen und Untergruppen lebender Familien erstrecken kann, und in Zeiten nationaler Gefahr sogar auf die ganze Nation als eine große Familie; ein weit tieferes Gefühl als das, welches wir Patriotismus nennen. Als religiöses Empfinden umfaßt dieses Gefühl die ganze Vergangenheit; das aus Liebe, Loyalität und Dankbarkeit zusammengesetzte Gefühl ist nicht weniger wirklich, wenn auch natürlich vager als das Gefühl für lebende Verwandte. Im Abendlande konnte sich nach der Zerstörung der antiken Gesellschaft kein derartiges Gefühl erhalten. Der Glaube, der die Alten zur Hölle verdammte und das Lob ihrer Werke verbot – die Lehre, die uns dazu erzog, dem Gott der Hebräer für alles zu danken – schuf Denkgewohnheiten und Gewohnheiten der Gedankenlosigkeit, die jedem Gefühl der Dankbarkeit gegen die Vergangenheit feindlich waren. Dann kam mit dem Verfall der Theologie und dem Aufdämmern höherer Erkenntnisse die Lehre, daß die Toten bei ihrem Tun keine Wahl gehabt hatten; sie hatten der Notwendigkeit gehorcht und wir hatten von ihnen notwendigerweise nur die Resultate der Notwendigkeit empfangen. Und heute noch verschließen wir uns der Erkenntnis, daß eben diese Notwendigkeit unsere Sympathien denen, die ihr gehorchten, zuwenden muß, und daß ihre uns hinterlassenen Resultate ebenso ergreifend wie wertvoll sind. Solche Gedanken kommen uns selbst bei den Werken der Lebenden, die uns dienen, nur selten. Wir beurteilen die Kosten einer Sache nur nach dem Wert, den sie für uns selbst hat – was der Produzent an Mühe darauf gewendet hat, daran denken wir nicht: ja, wir würden dem Spott verfallen, wenn wir irgend welche Gewissensskrupel darüber zeigten. Und unsere Gefühllosigkeit gegen die ergreifende Bedeutung des Werkes der Vergangenheit, und gegen die Arbeit der Gegenwart erklärt vollständig die Vergeudung unserer Zivilisation; die zügellose Art, mit der der Luxus die Arbeit von Jahren in dem Vergnügen einer Stunde verbraucht; die Unmenschlichkeit Tausender gedankenloser Reicher, von denen jeder jährlich zur Befriedigung vollkommen unnützer Bedürfnisse, das Arbeitsresultat von hundert menschlichen Leben vergeudet. Die Kannibalen der Zivilisation sind unbewußt viel grausamer als die der wilden Stämme und verbrauchen viel mehr Menschenfleisch. Die tiefere Menschlichkeit – die kosmische Empfindung für die Menschheit – ist wesentlich der Feind alles nutzlosen Luxus und der ausgesprochene Gegner jeder Form der Gesellschaft, die der Befriedigung der Sinne und den Vergnügungen des Egoismus keine Zügel anlegt.
Im fernen Osten hingegen ist seit uralten Zeiten die moralische Pflicht der schlichten Lebensführung gelehrt worden, weil der Ahnenkult jene kosmische Empfindung für die Menschheit entwickelt und ausgebildet hat, an der es uns gebricht, aber die wir uns in späteren Zeiten gewiß werden aneignen müssen, schon um uns selbst vor dem Aussterben zu bewahren. Zwei Aussprüche von Iyeyasu veranschaulichen das orientalische Empfinden. Als dieser größte der japanischen Krieger und Staatsmänner im Grunde der eigentliche Herr des Reiches war, sah man ihn eines Tages damit beschäftigt, ein altes verstaubtes Paar seidener Hakamas oder Beinkleider mit eigenen Händen zu reinigen und zu glätten. »Was ich da tue,« sagte er zu einem Lehnsmann, »geschieht nicht, weil ich an den Wert des Kleidungsstücks an sich denke, sondern daran, welche Mühe notwendig war, um es herzustellen. Es ist das Resultat der Arbeit und Plage einer armen Frau; und darum schätze ich es. Wenn wir bei der Benützung von Dingen nicht an die Zeit und die Mühe denken, die erforderlich waren, um sie hervorzubringen – dann stellt uns dieser Mangel an Rücksicht auf eine Stufe mit den Tieren.« Und in den Tagen seines größten Wohlstandes hören wir von ihm, wie er seine Frau zurechtwies, weil sie ihn zu oft mit neuen Kleidern versehen wollte. »Wenn ich,« wendete er ein, »an die Menge um mich und an die Generationen, die nach mir kommen sollen, denke, empfinde ich es als meine Pflicht, mit den in meinem Besitz befindlichen Gütern sehr sparsam umzugehen.« Dieser Geist der Schlichtheit hat sich in Japan erhalten. Selbst der Kaiser und die Kaiserin fahren fort, in der Zurückgezogenheit ihrer Privatgemächer ebenso einfach zu leben wie ihre Untertanen und widmen den größten Teil ihrer Revenuen der Linderung des öffentlichen Elends.

Durch die Evolutionslehre wird sich schließlich auch im Abendlande die moralische Erkenntnis der Pflicht gegen die Vergangenheit entwickeln, die im fernen Osten der Ahnenkult geschaffen hat. Denn schon heute kann der, der sich die Grundprinzipien der neuen Philosophie angeeignet hat, selbst das gewöhnlichste Produkt der menschlichen Handarbeit nicht betrachten, ohne darin etwas von seiner Evolutionsgeschichte zu erkennen. Das gewöhnlichste Gerät wird ihm nicht als das bloße Produkt der individuellen Geschicklichkeit eines Schreiners, Töpfers oder Schmiedes erscheinen, sondern als das Produkt einer durch Jahrtausende fortgesetzten Erfahrung mit Methoden, Materialien und Formen. Ebensowenig wird es ihm möglich sein, den ungeheueren Aufwand an Zeit und Mühe, den die Entwicklung jedes mechanischen Werkzeugs erfordert hat, zu betrachten, ohne eine Aufwallung der Dankbarkeit zu empfinden. Kommende Generationen müssen der uns vererbten materiellen Errungenschaften der Vergangenheit im Zusammenhang mit der toten Menschheit gedenken.
Aber in der Entwicklung dieses »kosmischen Gefühls« für die Menschheit wird die Erkenntnis unserer psychischen Dankesschuld an die Vergangenheit ein viel mächtigerer Faktor sein als die Erkenntnis unserer materiellen Dankesschuld. Denn wir verdanken den Toten auch unsere immaterielle Welt – die Welt, die in uns lebt – die Welt alles dessen, was in Impulsen, Empfindungen und Gedanken liebenswert ist. Wer sich wissenschaftlich darüber klar geworden ist, was menschliche Güte ist, und um welchen furchtbaren Preis sie errungen wurde, kann in den gewöhnlichsten Phasen der bescheidensten Existenzen jene Schönheit finden, die göttlich ist, und kann fühlen, daß in einem Sinne unsere Toten wirklich Götter sind.
Solange wir die weibliche Seele als etwas Einzelnes ansahen – als ein etwas, das eigens für ein besonderes physisches Wesen geschaffen war – konnte sich uns die Schönheit und das Wunder der Mutterliebe nicht völlig enthüllen. Aber bei tieferer Erkenntnis muß es uns offenbar werden, daß der ererbte Liebesschatz von Myriaden Millionen toter Mütter in einem Leben aufgespeichert ist; daß man nur so die unendliche Süßigkeit der Sprache, die das kleine Kind vernimmt, deuten kann; die unendliche Zärtlichkeit des Liebesblicks, der auf ihm ruht. Beklagenswert der Sterbliche, der dies nie gekannt – und doch, welcher Sterbliche vermöchte die richtigen Worte dafür zu finden! Fürwahr, göttlich ist die Mutterliebe; denn alles, was die menschliche Erkenntnis göttlich nannte, ist in dieser Liebe enthalten. Und jede Frau, die Trägerin und Mittlerin ihres höchsten Ausdrucks ist, ist mehr als die Mutter des Menschen, sie ist die »Mater Dei«.
Es ist hier nicht am Platze, von der Geisterhaftigkeit der ersten Liebe, der Geschlechtsliebe zu sprechen, die Illusion ist – weil die Leidenschaft und die Schönheit der Toten in ihr wieder auferstehen, um zu betören, zu blenden und zu bezaubern. Sie ist sehr, sehr wunderbar; aber sie ist nicht völlig gut, weil sie nicht völlig wahr ist. Der wahre eigenste Zauber der Frau offenbart sich erst später, wenn alle Illusionen schwinden, um eine Wirklichkeit zu enthüllen, die lieblicher ist, als alle Illusionen und die sich hinter ihrem Zauberschleier entfaltet hat. Was ist nun der göttliche Zauber der Frau, die sich uns nun offenbart hat? Nur die Liebe, die Sanftmut, die Treue, die Selbstlosigkeit, die Intuitionen von Millionen begrabener Herzen. Alle erstehen wieder auf; alle pochen wieder in dem frischen warmen Schlage ihres eigenen Herzens.
Gewisse erstaunliche Fähigkeiten, die in dem höchst entwickelten sozialen Leben zutage treten, erzählen uns in anderer Weise die Geschichte der Seelenstruktur, wie sie sich aus toten Leben aufgebaut hat. Wunderbar ist der Mann, der wirklich »allen alles sein kann«, oder die Frau, der es gegeben ist, aus sich zwanzig, fünfzig, hundert verschiedene Frauen zu machen – alles verstehend, alles durchdringend, unbeirrbar in ihrem Urteil über alle anderen; scheinbar keine eigene Individualität habend, sondern nur unzählige Individualitäten; imstande, jeder neuen Persönlichkeit mit einer Seele entgegenzutreten, die genau auf den Ton der fremden Seele gestimmt ist. Solche Charaktere sind selten, aber nicht so selten, daß der Reisende nicht leicht ein oder zwei Verkörperungen derselben in jeder hoch kultivierten Gesellschaft treffen kann, die er zu studieren Gelegenheit hat. Sie sind ausgesprochen »vielfache« Wesen – so offensichtlich vielfach, daß sogar die, welche sich das Ego als Einheit denken, sie als höchst »kompliziert« bezeichnen müssen. Diese Manifestation von vierzig oder fünfzig verschiedenen Charakteren in ein- und derselben Person ist ein so merkwürdiges Phänomen (besonders merkwürdig, weil es gewöhnlich schon in der Jugend hervortritt, lange bevor die Erfahrung es teilweise erklären könnte), daß ich mich nur darüber wundern kann, wie wenige Menschen sich über seine Bedeutung klar werden.
So verhält es sich auch mit einigen Formen des Genies, die man »Intuitionen« benannt hat; hauptsächlich denjenigen, die sich auf die Darstellung der Empfindungen beziehen. Nach der alten Seelentheorie würde ein Shakespeare immer unfaßbar bleiben. Taine versuchte ihn durch den Ausdruck »eine vollkommene Einbildungskraft« zu erklären, und dieser Ausdruck reicht tief in die Wahrheit hinein. Aber was bedeutet eine vollkommene Einbildungskraft? Ungeheure Vielfältigkeit des Seelenlebens, zahllose vergangene Existenzen, die in einer einzigen wieder auferstanden sind. Es gibt keine andere Erklärung dafür ... Nicht in der Welt des reinen Intellekts ist die Geschichte der psychischen Vielfältigkeit am merkwürdigsten, sondern in der Welt, die sich an unsere einfachsten Gefühle wendet, die Gefühle der Liebe, der Ehre, der Sympathie, des Heroismus.
»Aber nach einer solchen Theorie,« könnte ein kritischer Geist einwenden, »ist die Quelle heroischer Impulse auch zugleich die Quelle jener Impulse, die uns herabziehen. Beide kommen von den Toten.« Dies ist wahr. Wir haben Böses sowohl wie Gutes geerbt. Da wir nur Zusammensetzungen sind – in der Entwicklung, im Werden begriffen – müssen wir Unvollkommenheiten erben. Aber das Überleben des geeignetsten unter den Impulsen ist sicherlich durch das moralische Durchschnittsniveau der Menschheit bewiesen, – das Wort der »geeignetste« im ethischen Sinne gebraucht. Trotz alles Elends, Lasters und Verbrechens, die nirgends so furchtbar entwickelt sind, als in unserer eigenen, sogenannten christlichen Zivilisation, muß jedem, der viel gelebt, viel gereist, viel gedacht hat, die Tatsache offenbar sein, daß die überwiegende Masse der Menschheit gut ist, und darum die überwiegende Mehrzahl der uns von der vergangenen Menschheit vererbten Impulse ebenfalls gut sein muß. Auch steht es fest, daß je normaler die sozialen Verhältnisse, desto besser die Menschen sind. Während der ganzen Vergangenheit haben die guten Kamis immer getrachtet, die bösen Kamis zu verhindern, die Oberhand zu bekommen. Und mit der Annahme dieser Wahrheit müssen sich unsere zukünftigen Ideen über Recht und Unrecht ungeheuer erweitern. Geradeso wie jede heroische Tat oder jeder Akt reiner Güte für einen edlen Zweck einen bisher ungeahnten Wert erlangen muß, so muß ein wirkliches Verbrechen weniger als ein Verbrechen gegen das lebende Individuum oder die bestehende Gesellschaft angesehen werden, als gegen die Summe der menschlichen Erfahrung und der ethischen Bestrebungen der Vergangenheit. Wirkliche Güte wird darum höher gepriesen und wirkliches Verbrechen weniger lax beurteilt werden. Und die Lehre des alten Shintoglaubens, daß es keines ethischen Kodex bedürfe – daß die wahre Richtschnur alles menschlichen Verhaltens immer gefunden werden kann, wenn man nur sein Herz befragt – ist eine Lehre, die eine vollkommenere Menschheit, als die heutige zweifellos zu der ihren machen wird.

»Die Evolutionslehre,« wird der Leser vielleicht einwenden, »zeigt allerdings durch ihre Vererbungstheorie, daß die Lebenden in gewissem Sinne wirklich von den Toten beherrscht werden. Aber sie zeigt auch, daß die Toten in uns, nicht außer uns sind. Sie sind ein Teil von uns – es spricht nichts dafür, daß sie irgend eine Existenz außerhalb unserer eigenen haben. Dankbarkeit gegen die Vergangenheit wäre somit Dankbarkeit gegen uns selbst; Liebe zu den Toten wäre Selbstliebe. So daß dieser Versuch einer Analogie ins Absurde führt.«
Nein. Der Ahnenkult mag in seiner primitiven Gestalt nur ein Symbol der Wahrheit sein. Er kann gleichsam ein Fingerzeig, ein Vorläufer der neuen moralischen Pflichten sein, die tiefere Erkenntnis uns unabweislich aufdrängt: die Pflicht der Ehrfurcht und des Gehorsams gegen die vergangenen ethischen Erfahrungen der Menschheit. Aber er kann auch weit mehr bedeuten. Die Tatsachen der Vererbung können immer nur eine halbe Erklärung für die Tatsachen der Psychologie bieten. Eine Pflanze bringt zehn, zwanzig, hundert neue Pflanzen hervor, ohne bei diesem Vorgang ihr eigenes Leben aufzugeben. Ein Tier gebiert viele Junge und lebt doch mit all seinen unverminderten physischen Kräften und geringen Geistesfähigkeiten weiter fort. Kinder werden geboren; und die Eltern überleben sie. Ererbt ist das geistige Leben sicherlich, nicht minder als das physische; aber die reproduktiven Zellen, die wenigst spezialisierten von allen Zellen (bei der Pflanze wie beim Tiere) heben das elterliche Wesen nicht auf, sondern wiederholen es nur. Indem sie sich beständig vervielfältigen, übermittelt eine jede die ganze Erfahrung einer Rasse und läßt doch die ganze Erfahrung der Rasse hinter sich. Hier ist das unerklärliche Wunder: die Selbstvervielfältigung des physischen und psychischen Wesens – Leben um Leben vom elterlichen Leben losgelöst, um dann seinerseits vollkommen und reproduzierend zu werden. Würde das ganze elterliche Leben auf den Sprößling übertragen, dann könnte man sagen, daß das Gesetz der Vererbung die Doktrin des Materialismus unterstützt. Aber gleich den Gottheiten der indischen Legende vervielfältigt sich das Selbst und bleibt doch dasselbe, mit der ungeschwächten Fähigkeit, sich weiter zu vervielfältigen. Der Shintoismus kennt die Lehre, daß die Seelen sich durch Spaltung vervielfältigen; aber die Tatsachen der psychischen Emanation sind unendlich wunderbarer als irgend eine Theorie.
Die großen Religionen haben erkannt, daß die Vererbungstheorie nicht das ganze Problem des Selbst erklären – nicht Aufschluß über das Schicksal des ursprünglichen, bleibenden Selbst geben könne. So haben sie sich allgemein geeinigt, das innere Wesen als unabhängig vom äußeren anzusehen. Die Wissenschaft kann ebensowenig die Fragen, die sie aufgeworfen haben, entscheiden, als sie die Natur des Dings an sich bestimmen kann. Wieder müssen wir vergeblich fragen: Was wird aus den Kräften, die die Vitalität einer toten Pflanze bildeten? Weit schwieriger die Frage, was wird aus den Empfindungen, die das psychische Leben eines toten Menschen gebildet haben? – da niemand die einfachste Empfindung erklären kann. Wir wissen nur, daß während des Lebens bestimmte aktive Kräfte im Pflanzen- oder Menschenkörper sich fortwährend den äußeren Kräften anpaßten; und daß nachdem die inneren Kräfte nicht mehr auf den Druck der äußeren Kräfte reagieren konnten – der Körper, in dem die ersteren aufgespeichert waren, sich in die Elemente auflöste, aus denen er sich aufgebaut hatte. Wir wissen von der Urnatur dieser Elemente ebensowenig, wie von der Urnatur der Kräfte, die sie vereinigt haben. Aber wir haben eher Grund anzunehmen, daß die Urkräfte des Lebens nach der Auflösung der Formen, die sie geschaffen haben, fortbestehen, als zu glauben, daß sie ganz aufhören. Die Theorie der spontanen Entstehung (irrig benannt, denn nur in eingeschränktem Sinne kann das Wort »spontan« auf die Theorie der Anfänge des Erdenlebens angewendet werden) ist eine Theorie, die der Evolutionist annehmen muß und die niemanden erschrecken kann, der sich der Tatsache der Chemie bewußt ist, daß die Materie selbst in der Entwicklung begriffen ist. Die wirkliche Theorie (nicht die Theorie des organischen Lebens, das in einem Aufguß in einer Flasche beginnt, sondern des uranfänglichen Lebens, wie es auf der Oberfläche eines Planeten entsteht) hat ungeheure, ja, unendliche geistige Bedeutung. Sie erfordert den Glauben, daß alle potentiellen Möglichkeiten des Lebens, Denkens und Empfindens von den Nebulosen zum Universum, von System zu System, von Sternen zu Planeten oder Monden und wieder zurück zu zyklonischen Stürmen der Atome gehen; das bedeutet, daß die Urkräfte Sonnenbrände, kosmische Evolutionen und Disintegrationen überdauern. Die Elemente sind nur Entwicklungsresultate.
Es gibt keinen Zufall. Es gibt nur Gesetzmäßigkeit. Jede neue Evolution muß von vorhergehenden Evolutionen beeinflußt sein – ebenso wie jedes individuelle menschliche Leben durch die Erfahrung all der Leben seiner Ahnenkette beeinflußt ist. Müssen nicht sogar die Tendenzen der früheren Formen der Materie von den kommenden Formen der Materie ererbt werden; und müssen nicht die Taten und bedanken der heutigen Menschheit mit dazu beitragen, den Charakter künftiger Welten zu gestalten? Man kann heute nicht mehr behaupten, daß die Träume der Alchymisten Absurditäten waren. Ja, wir können sogar nicht mehr behaupten, daß nicht alle materiellen Phänomene, wie der alte Orient es annahm, durch Seelenpolaritäten bestimmt werden.
Ob unsere Toten fortfahren, auch außer uns ebenso wie in uns zu leben – eine Frage, die wir in unserem jetzigen unentwickelten Zustand relativer Blindheit nicht entscheiden können – eines ist gewiß, daß das Zeugnis der kosmischen Tatsachen mit einem mystischen Glauben des Shintoismus übereinstimmt: dem Glauben, daß alle Dinge von den Toten bestimmt werden – sei's durch Geister von Menschen, sei's durch Geister von Welten. Ebenso wie unser persönliches Leben durch jetzt unsichtbare Leben der Vergangenheit beherrscht wird, so wird zweifellos das Leben unserer Erde und des Systems, dem sie angehört, von Geistern zahlloser Sphären beherrscht: toter Universen – toter Sonnen, Planeten und Monde – als Formen längst in Nacht aufgelöst, aber als Kräfte unsterblich und ewig wirkend.
Zurück zur Sonne fürwahr, können wir gleich dem Shintoisten unsere Abstammung verfolgen; und doch wissen wir, daß selbst da nicht unser Anfang war. Unendlich ferner in der Zeit als eine Million von Sonnenleben war dieser Anfang – wenn man überhaupt sagen kann, daß es je einen Anfang gegeben hat.
Die Lehre der Evolution ist, daß wir eins mit jenem unbekannten Urgrund sind, von dem die Materie und der menschliche Geist nur ewig wechselnde Manifestationen sind. Die Evolution lehrt uns auch, daß jeder von uns eine Vielheit ist, und daß wir doch alle eins miteinander und mit dem Kosmos sind; daß wir die ganze vergangene Menschheit nicht nur in uns selbst erkennen müssen, sondern auch in der Kostbarkeit und Schönheit des Lebens jedes Mitmenschen; daß wir uns am besten in anderen lieben können; daß wir uns selbst am: besten in anderen dienen; daß Formen nur Schleier und Phantome sind; und daß dem formenlosen Unendlichen allein alle menschlichen Empfindungen in Wahrheit angehören, mögen sie von den Lebenden oder von den Toten stammen.


|
Der Wunsch, von dem
(Gedicht von Kimiko.) |
Die Geschichte einer Geisha
 Ihr Name steht auf einer Papierlaterne beim Eingang eines Hauses in der Geishastraße. Bei Nacht gesehen, ist diese Straße eine der seltsamsten in der Welt. Sie ist eng wie ein schmaler Gang, und das dunkelglänzende Holzwerk der fest verschlossenen Hausfassaden, die alle kleine verschiebbare Türen haben mit Papierscheiben, die wie gepreßtes Glas aussehen, erinnern an Schiffskabinen erster Klasse. Obwohl die Gebäude mehrere Stockwerke haben, wird man sie zuerst gar nicht gewahr, insbesondere wenn der Mond nicht scheint; denn nur die Erdgeschoßwohnungen sind bis hinauf zu den ausgespannten Markisen erleuchtet, alles übrige ist dunkel. Das Licht strahlt aus Lampen hinter den Papierscheiben der schmalen Türen und aus Laternen, die an der Außenseite des Hauses hängen, eine an jeder Tür. Man blickt die Straße entlang zwischen zwei Reihen solcher Laternen, die in weiter Ferne zu einer unbeweglichen gelben Lichtmasse zusammenlaufen. Einige der Laternen sind eiförmig, einige zylindrisch, andere wieder vier- oder sechseckig, und alle sind sie mit japanischen Inschriften in schönen Ideogrammen geschmückt.
Ihr Name steht auf einer Papierlaterne beim Eingang eines Hauses in der Geishastraße. Bei Nacht gesehen, ist diese Straße eine der seltsamsten in der Welt. Sie ist eng wie ein schmaler Gang, und das dunkelglänzende Holzwerk der fest verschlossenen Hausfassaden, die alle kleine verschiebbare Türen haben mit Papierscheiben, die wie gepreßtes Glas aussehen, erinnern an Schiffskabinen erster Klasse. Obwohl die Gebäude mehrere Stockwerke haben, wird man sie zuerst gar nicht gewahr, insbesondere wenn der Mond nicht scheint; denn nur die Erdgeschoßwohnungen sind bis hinauf zu den ausgespannten Markisen erleuchtet, alles übrige ist dunkel. Das Licht strahlt aus Lampen hinter den Papierscheiben der schmalen Türen und aus Laternen, die an der Außenseite des Hauses hängen, eine an jeder Tür. Man blickt die Straße entlang zwischen zwei Reihen solcher Laternen, die in weiter Ferne zu einer unbeweglichen gelben Lichtmasse zusammenlaufen. Einige der Laternen sind eiförmig, einige zylindrisch, andere wieder vier- oder sechseckig, und alle sind sie mit japanischen Inschriften in schönen Ideogrammen geschmückt.
Die Straße ist sehr still, – still wie eine Ausstellung nach Schluß der Besuchsstunde. Der Grund dieser Stille ist die Abwesenheit der Hausinsassen, die meistenteils bei Banketten und anderen Festvorstellungen beschäftigt sind, denn ihr Leben ist ausschließlich ein Nachtleben.
Die Inschrift auf der ersten Laterne links, wenn man in südlicher Richtung geht, ist: »Kinoya: uchi O – Kata«; und es bedeutet das goldene Haus, wo Okata wohnt. Die Laterne zur Rechten erzählt vom Hause Nishimuras, einem Mädchen Myutsuru, welcher Name »Der prächtige Storch« bedeutet. Das nächste Haus links ist das Haus der Kajita, und da wohnen Kohana, die Blumenknospe, und Hinako, deren Antlitz so hübsch ist, wie das einer Puppe. Gegenüber liegt das Haus Nagaye, wo Kimika und Kimiko wohnen ... Und diese doppelte Lichterzeile von Namensbezeichnungen erstreckt sich über eine halbe Meile weit.
Die Inschrift auf dem letztgenannten Hause verkündet den Zusammenhang zwischen Kimika und Kimiko, aber sie verkündet uns noch etwas anderes, – denn Kimiko wird Ni-dai-me genannt, ein unübersetzbarer Titel, der besagt, daß sie nur Kimiko No. 2 ist. Die eigentliche Herrin und Meisterin ist Kimika, die zwei Geishas erzogen hat, denen sie beiden denselben Namen Kimiko gegeben hat. Und diese zweimalige Anwendung desselben Namens ist der Beweis, daß die erste Kimiko, Ichi-dai-me, sehr gefeiert gewesen sein mußte. Der Name, den eine unberühmt gebliebene Geisha trägt, geht nie auf ihre Nachfolgerin über.
Solltest du jemals einen guten und zureichenden Grund haben, in das Haus zu kommen, so würdest du nach dem Zurückschieben der Eingangstüre, die beim Öffnen einen Gong in Bewegung setzt, um den Besucher anzukündigen, Gelegenheit haben, Kimika zu sehen – vorausgesetzt, daß ihre kleine Truppe nicht für diesen Abend irgendwo engagiert ist. Du würdest in ihr eine sehr intelligente Person kennen lernen, mit der zu sprechen es wohl der Mühe lohnt. Sie kann, falls es ihr beliebt, die merkwürdigsten Geschichten erzählen – Geschichten aus dem wirklichen Leben, wahre Erzählungen von der menschlichen Natur. Denn die Geishastraße ist voll von Traditionen, tragischen, komischen, melodramatischen. Jedes Haus hat seine besonderen Erinnerungen. Und Kimika kennt sie alle. Einige sind sehr, sehr schrecklich, und einige würden dich zum Lachen reizen, und wieder andere würden dich nachdenklich stimmen. Die Geschichte der ersten Kimiko gehört zu der letzteren Art. Sie gehört nicht zu den ungewöhnlichen, aber ist eine von denen, die dem abendländischen Verständnis am ehesten zugänglich ist.

Es gibt keine Ichi-dai-me Kimiko mehr: sie ist nur eine Erinnerung. Kimika war noch ganz jung, als sie Kimiko ihre Berufsgenossin nannte.
»Ein außerordentliches Mädchen«, sagt Kimika von Kimiko.
Um sich in ihrem Fache einen Namen zu machen, muß eine Geisha entweder hübsch oder klug sein – und die berühmten sind gewöhnlich beides, da sie schon in zartester Jugend unter Berücksichtigung dieser Vorzüge von ihren Erziehern ausgewählt werden. Selbst von der untergeordnetsten Klasse dieser Berufssängerinnen verlangt man, daß sie in ihren jungen Jahren irgend einen Charme besitzen, – sei's auch nur jene beauté du diable, welche das japanische Sprichwort inspirierte, daß selbst der Teufel mit achtzehn Jahren schön sei (oder wie eine andere Version lautet: »Ein Drache mit zwanzig«). Aber Kimiko war mehr als hübsch, sie entsprach vollkommen dem japanischen Schönheitsideal, und dieser Anforderung genügt unter Hunderttausenden von Frauen kaum eine.
Sie war auch mehr als klug – sie war talentvoll. Sie dichtete zierliche Verse, verstand mit dem auserlesensten Geschmack Blumen zu ordnen, die Teezeremonien tadellos auszuführen, hatte großes Geschick im Sticken und der Seidenmosaikarbeit: mit einem Worte sie war vollkommen.
Ihr erstes öffentliches Auftreten machte in der Welt von Kyōto, »où l'on s'amuse« Sensation. Es war offenbar, sie konnte jede ihr beliebige Eroberung machen und an ihrem Glücke war nicht zu zweifeln. Aber niemand konnte auch in Abrede stellen, daß sie für ihren Beruf vollkommen vorgebildet worden war. Man hatte sie gelehrt, sich bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit entsprechend zu benehmen, und was sich ihrem Wissen noch entzog, darüber wußte Kimika genau Bescheid: Die Macht der Schönheit, und die Schwäche der Leidenschaft; den Wert der Verheißung und die Qual der Gleichgültigkeit; und all die Torheit und Schlechtigkeit in dem Herzen der Männer. Demnach machte Kimiko wenig Mißgriffe und vergoß wenig Tränen. Nach und nach wurde sie, – wie Kimika gewünscht hatte, – ein wenig gefährlich. Ungefähr so wie eine Lampe für Nachtschmetterlinge, nicht mehr: sonst würden sie wohl manche auslöschen. Die Aufgabe der Lampe ist, angenehme Dinge sichtbar zu machen: sie will niemandem etwas zuleide tun. Auch Kimiko wollte niemandem etwas zuleide tun, sie war nicht zu gefährlich. Besorgte Eltern kamen zu der Einsicht, daß sie es gar nicht darauf anlegte, sich in respektable Familien einzudrängen, ja sie wollte sich nicht einmal in romantische Abenteuer einlassen. Aber sie war nicht allzu nachsichtig gegen jene Klasse von Jünglingen, die Dokumente mit ihrem eigenen Blut unterzeichnen und einer Tänzerin das Ansinnen stellen, die Spitze ihres kleinen Fingers als Pfand ewiger Treue abzuschneiden ... ihnen spielte sie übermütig genug mit, um sie von ihren Torheiten zu heilen. Gegen einige reiche Anbeter, die ihr um den Preis ihres Besitzes Ländereien und Häuser anboten, war sie weniger mitleidsvoll. Einer unter ihnen war großmütig genug, ihre Freiheit bedingungslos mit einer Summe erkaufen zu wollen, die Kimika zu einer reichen Frau gemacht hätte. Kimiko war ihm sehr dankbar, aber sie blieb eine Geisha. Doch sie motivierte ihre Ablehnung mit so viel Takt, daß sie nicht verletzend wirkte und verstand die Kunst, in den meisten Fällen die Verzweiflung zu heilen. Natürlich gab es auch Ausnahmen. Ein bejahrter Herr, dem das Dasein nicht lebenswert schien, wenn er Kimiko nicht ganz allein besaß, lud sie eines Tages zu einem Bankette ein und forderte sie auf, Wein mit ihm zu trinken. Aber Kimika, gewohnt in den Gesichtszügen zu lesen, schmuggelte behende Tee (der dieselbe Farbe hat) in Kimikos Becher und rettete so das kostbare Leben des Mädchens. Denn einige Minuten später war der Geist des liebeskranken alten Narren allein und wahrscheinlich sehr enttäuscht auf dem Weg nach dem Meido. Totenreich.
Seit diesem Abend wachte Kimika über Kimiko wie eine Wildkatze über ihr Kätzchen.
Das »Kätzchen« wurde eine fashionable Manie, das Gespräch des Tages, eine lokale Berühmtheit.
Es gibt einen ausländischen Prinzen, der sich noch heute ihres Namens erinnert: er sandte ihr Diamanten, die sie nie anlegte. Kostbare Geschenke in Mengen wurden ihr von Leuten zugeschickt, die sich den Luxus gönnen konnten, ihr eine Freude zu machen, denn auch nur einen Tag in ihrer Gunst zu stehen, war der Ehrgeiz der »goldenen Jugend«. Aber sie gestattete niemandem, sich als ausgesprochenen Günstling zu betrachten und wollte von Schwüren ewiger Treue nichts wissen. Auf alle Beteuerungen dieser Art entgegnete sie, daß sie wisse, was ihr zukomme. Selbst respektable Frauen sprachen mild über sie, weil ihr Name nie in irgend einer Familientragödie figuriert hatte. Sie kannte wirklich ihre Stellung. Die Jahre schienen ihr nichts anzuhaben, sie vielmehr noch reizender zu machen. Andere Geishas wurden berühmt, aber keine wurde ihr gleichgestellt. Ein Fabrikant erwarb das alleinige Recht, ihre Photographie als Warenetikette gebrauchen zu dürfen, und diese Etikette trug ihm ein Vermögen ein.
Aber eines Tages verbreitete sich das sensationelle Gerücht, Kimikos sprödes Herz habe sich endlich erweichen lassen. Sie hatte tatsächlich Kimika Lebewohl gesagt und war mit jemandem fortgegangen, der, wie man behauptete, imstande war, ihr die hübschesten Kleider, die sie nur wünschen konnte, zu geben, jemandem, der es sich angelegen sein ließ, ihr eine soziale Stellung zu schaffen und die üble Nachrede über ihre Vergangenheit zum Schweigen zu bringen; jemandem, der bereit war, tausend Tode für sie zu sterben und schon jetzt aus Liebe zu ihr halbtot war. Kimika berichtete, ein Tor habe aus Liebe zu Kimiko einen Selbstmordversuch gemacht, Kimiko habe sich seiner erbarmt und ihn wieder gesund gepflegt, wobei aber auch seine Torheit zu neuem Leben erwachte. Taiko Hideyoshi hat gesagt, es gebe nur zwei Dinge, die er hienieden fürchte: einen Toren und eine finstere Nacht. Kimika hatte immer Furcht vor Toren gehabt, und ein Tor hatte ihr Kimiko entführt. Und mit Tränen, die nicht ganz selbstlos waren, fügte sie hinzu, Kimiko würde nie mehr zurückkehren, denn dies sei ein Fall von gegenseitiger Liebe auf die Dauer von mehreren Leben.
Aber dessenungeachtet behielt Kimika nicht ganz recht. Denn trotz ihres Scharfsinns war sie doch unfähig, Kimikos heimlichste Seele zu erkennen. Hätte sie einen Blick hineintun können, sie würde vor Erstaunen aufgeschrien haben.

Kimiko unterschied sich von anderen Tänzerinnen auch dadurch, daß sie von edler Geburt war. Ehe sie ihren Berufsnamen annahm, hatte sie Ai geheißen, was mit gewöhnlichen Buchstaben geschrieben »Liebe« bedeutet; mit anderen Schriftzeichen geschrieben, bedeutet dasselbe Wort »Leid«. Ais Geschichte ist eine Geschichte von Liebe und Leid zugleich. Sie hatte eine gute Erziehung genossen. Man schickte sie in eine Privatschule, der ein alter Samurai vorstand. Dort hockten die kleinen Mädchen auf ihren Kniekissen vor Schreibpulten, die zwölf Zoll hoch waren, und der Unterricht war unentgeltlich. (Heutzutage, wo Lehrer größere Gehälter beziehen, als andere Beamte, ist der Unterricht nicht so anregend und gediegen wie in früheren Tagen.) Eine Dienerin begleitete das Kind immer aus und in die Schule und trug ihre Bücher, ihr Kniekissen, ihre Schreibhefte und ihr Tischchen.
Dann kam Kimiko in eine öffentliche Elementarschule. Die ersten »modernen Lehrbücher« waren eben erschienen. Sie enthielten japanische Übersetzungen englischer, französischer und deutscher Geschichten über Ehre, Pflicht und Heroismus – eine ausgezeichnete Auswahl, illustriert mit kleinen naiven Abbildungen abendländischer Menschen in Kostümen, die man in dieser Welt nie getragen oder gesehen hatte. Diese kleinen rührenden Kostümbücher sind jetzt Kuriosa geworden, und nun schon lange durch prätentiösere und weniger liebevoll komponierte ersetzt.
Ai lernte mit großer Leichtigkeit. Einmal jährlich, zur Zeit der Prüfungen, kam ein hoher Staatsbeamter in die Schule und sprach mit den Mädchen, als wären sie alle seine eigenen Kinder und fuhr liebevoll über die seideweichen Köpfchen der Kleinen, wenn er die Preise verteilte. Nun ist er ein großer Staatsmann, der sich vom öffentlichen Leben zurückgezogen und Ai wohl vergessen hat. In der Schule unserer Tage geht man nicht so zart mit kleinen Schulmädchen um, und erfreut ihr kleines Herz nicht mit Preisen.
Dann kamen jene umwälzenden Reformen, die Familien von Rang ihrer Stellung beraubten und sie in Armut stürzten. Nun mußte Ai die Schule verlassen. Mancherlei anderer Kummer folgte, und schließlich blieb sie allein und verlassen mit ihrer Mutter und einer jüngeren Schwester hilflos zurück. Die Mutter und Ai konnten nicht viel anderes tun, als weben, und mit dieser Arbeit war es nicht möglich, so viel zu verdienen, um damit ihr Leben zu fristen. Alles, was sie besaßen, Haus und Landbesitz zuerst, dann Stück um Stück, alles übrige, was zur Notdurft des Lebens nicht unbedingt erforderlich war, wie Hausgerät, Schmucksachen, kostbare Kleider, schön gravierte Lackwaren, gingen weit unter dem wirklichen Wert in die Hände derjenigen über, die aus dem Elend der Unglücklichen Vorteil ziehen, und deren Reichtum im Volksmunde Namida-Nokane, – »Das Geld der Tränen«, genannt wird. Die Unterstützung von den Lebenden floß nur spärlich, denn die meisten verwandten Samuraifamilien waren in der gleichen traurigen Lage. Als nun alles erschöpft war und es nichts mehr zu verkaufen gab, – nicht einmal Ais kleine Schulbücher, – suchte man Hilfe bei den Toten.
Man besann sich, daß der Vater von Ais Vater mit seinem kostbaren Schwerte, einem Geschenk eines Daimyo, begraben worden war, und daß die Beschläge der Waffe aus schwerem Gold waren. Man öffnete das Grab, und der große Griff von erlesener Arbeit wurde durch einen ganz gewöhnlichen ersetzt, und die Ornamente der lackierten Scheide wurden abgelöst. Die Klinge aber ließ man an Ort und Stelle, weil der Krieger ihrer bedürfen konnte. Ai sah seine aufgerichtete Gestalt in der Urne aus roter Tonerde, die bei Begräbnissen nach altem Brauch für Samurais von hohem Range als Sarg dient. Nach all den langen Jahren, die er im Grabe gelegen hatte, waren seine Züge noch erkennbar; und als man ihm sein Schwert wieder zurückgab, schien es ihr, als ob er durch ein grimmiges Lächeln seine Zustimmung zu dem Vorgang gäbe.
Aber der Tag kam, an dem Ais Mutter zu schwach wurde, um weiter am Webstuhl zu arbeiten, und das Gold des Toten war erschöpft. Ai sagte: »Mutter, ich weiß, jetzt gibt es nur mehr einen Ausweg; ich muß mich als Tänzerin verkaufen.« Die Mutter weinte und gab keine Antwort. Ais Augen blieben trocken, – sie ging allein aus dem Hause.
Sie erinnerte sich, daß, als in ihres Vaters Hause Bankette stattfanden, bei denen Geishas Wein kredenzten, eine freie Geisha, die man Kimika nannte, sie immer geliebkost hatte.. nun ging sie geradeswegs in das Haus Kimikas.
»Ich möchte, daß du mich kaufst,« sagte Ai beim Eintreten, »und ich möchte eine Menge Geld haben ...« Kimika lächelte über das Kind, streichelte ihre Wange, gab ihr zu essen und ließ sich ihre Geschichte erzählen, die Ai tapfer und ohne eine Träne zu vergießen vortrug.
»Mein Kind,« sagte Kimika, »ich kann dir nicht viel Geld geben, denn ich habe selbst nur sehr wenig. Aber was ich tun kann, ist, dir zu versprechen, deine Mutter zu versorgen, – dies wird besser sein, als ihr eine große Summe für dich einzuhändigen. Denn deine Mutter, mein Kind, war eine große Dame, und weiß deshalb nicht mit Geld umzugehen. Bitte deine Mutter, den Vertrag zu unterzeichnen, der die Bedingung enthält, daß du bis zu deinem vierundzwanzigsten Jahre bei mir bleiben mußt, oder bis zu der Zeit, wo du mir alles zurückzuzahlen imstande sein wirst. Und was ich an Geld augenblicklich entbehren kann, nimm mit nach Hause als freie Gabe.«
So wurde Ai eine Geisha, und Kimika nannte sie Kimiko und hielt ihr Versprechen, die Mutter und die kleine Schwester in allem zu versorgen. Die Mutter starb, ehe Kimiko berühmt wurde; die kleine Schwester wurde in einer Schule untergebracht, – dann trugen sich die schon erwähnten Dinge zu.
Der junge Mann, der aus Liebe zu einer Geisha in den Tod gehen wollte, war eines besseren Loses würdig. Er war der einzige Sohn wohlhabender und angesehener Leute, die bereit waren, jedes Opfer für ihn zu bringen, selbst das, eine Geisha als Schwiegertochter anzuerkennen. Ja, Kimiko war ihnen sogar wegen ihrer Liebe zu ihrem Sohn nicht unwillkommen.
Bevor Kimiko Kimika verließ, wohnte sie noch der Hochzeit ihrer jungen Schwester, Umè, bei, die eben mit der Schule fertig geworden war. Kimiko hatte ihr den Gatten gewählt, wobei ihre große Menschenkenntnis ihr zu statten kam. Ihre Wahl fiel auf einen sehr geraden, ehrlichen altmodischen Kaufmann, einen Mann, dem es nicht möglich gewesen wäre, schlecht zu sein, selbst wenn er sich bemüht hätte. Urne zweifelte nicht an der klugen Wahl ihrer Schwester, und in der Tat wurde die Ehe auch wirklich eine sehr glückliche.

Es war im vierten Monat des Jahres, als Kimiko in das für sie bestimmte neue Heim geführt wurde. Dies war ein Haus ganz danach angetan, alle trüben Dinge des Lebens aus der Erinnerung zu löschen, eine Art Feenpalast in der verzauberten Stille großer schattiger umhegter Gärten. Dort konnte sie das Gefühl eines Wesens haben, das um seiner guten Taten willen, in Horais Reich Elysium. aufgenommen worden ist. Doch der Frühling entschwand, und der Sommer kam – und Kimiko blieb immer noch Kimiko. Dreimal hatte sie, aus unbekannten Gründen, den Hochzeitstag hinausgeschoben.
Und wieder verstrichen einige Monate. Da umdüsterte sich die Stimmung Kimikos, und eines Tages teilte sie ihre Gründe sanftmütig, aber entschlossen mit: »Es ist nun Zeit, daß ich sage, was ich so lange gezögert habe, zu offenbaren. Um der Mutter willen, der ich das Leben danke, und um meiner kleinen Schwester willen, habe ich in der Hölle gelebt. All dies ist ja vorüber; aber das Brandmal ist auf mir – keine Macht der Welt kann mich davon befreien. Eine, wie ich bin, kann nicht in eine ehrenwerte Familie eintreten, kann nicht die Mutter Eures Sohnes werden, kann Euch kein Heim schaffen. Gestattet mir zu sprechen; denn in der Erkenntnis des Bösen bin ich weit, weit bewanderter als Ihr. Nie will ich Eure Frau werden zu Eurer Schmach. Ich bin nur Eure Gespielin, Eure Kameradin, Euer flüchtiger Gast – und dies nicht um irgendwelchen Lohn. Wenn ich nicht mehr bei Euch sein werde, – ja, dieser Tag wird gewiß einmal kommen! – werdet Ihr klarer sehen. Ich werde Euch noch teuer sein, aber nicht in derselben Weise wie jetzt, die nur Betörung ist. Ihr werdet Euch dieser meiner Worte aus meinem tiefen Herzensgrunde erinnern. Man wird Euch irgend eine reizende vornehme Dame erwählen, die die Mutter Eurer Kinder werden wird – ich werde sie vielleicht sehen, aber ich werde niemals Eure Gattin werden, und die Freude einer Mutter bleibt mir ewig verschlossen. Ich war nur deine Torheit, mein Geliebter, eine Illusion, ein Traum, ein Schatten, der über dein Leben huschte.
In späteren Tagen wird es mir vielleicht gegönnt sein, mehr für dich zu sein, aber deine Gattin nun und nimmer. Dringe nicht in mich, – sonst müßte ich dich gleich verlassen ...«
Als der sechste Monat des Jahres anbrach, verschwand eines Tages Kimiko unerwartet und spurlos.

Niemand wußte, wann und wohin sie gegangen war. Selbst die Bewohner des Nachbarhauses hatten ihr Fortgehen nicht bemerkt. Zuerst gab man sich der Hoffnung hin, sie werde bald zurückkehren, denn von all ihren kostbaren und schönen Sachen, ihren Kleidern, ihrem Schmuck, selbst ihren Geschenken, die an sich ein Vermögen repräsentierten, hatte sie nicht das Geringste mitgenommen. Aber Wochen verstrichen, ohne irgend eine Spur eines Lebenszeichens von ihr zu bringen; und man befürchtete, ihr sei irgend etwas Schreckliches zugestoßen. Man leitete Flüsse ab, durchsuchte Brunnen nach ihrer Spur. Brieflich und telegraphisch wurde ihr nachgeforscht. Vertrauenswürdige Diener wurden ausgesandt, sie zu suchen. Prämien wurden auf ihre Entdeckung ausgesetzt, und insbesondere versprach man Kimika goldene Berge, obwohl sie dem Mädchen ohnehin so zugetan war, daß sie nur zu froh gewesen wäre, sie auch ohne jegliche Aussicht auf Gewinn zu finden ... Aber das Geheimnis blieb Geheimnis. Sich an die Behörden zu wenden, wäre vergebens gewesen, – die Flüchtige hatte ja nichts Unrechtes begangen, hatte kein Gesetz verletzt; und der große Polizeiapparat durfte nicht um der leidenschaftlichen Laune eines Jünglings willen in Bewegung gesetzt werden. Monate wurden zu Jahren, aber weder Kimika noch die junge Schwester in Kyoto, noch sonst irgend jemand von den Tausenden, die die schöne Tänzerin gekannt und bewundert hatten, sahen sie jemals wieder.
Aber was Kimiko vorhergesagt hatte, bewahrheitete sich: denn die Zeit trocknet alle Tränen und heilt alle Wunden, und selbst in Japan versucht man nicht zum zweitenmal um desselben Herzeleids willen in den Tod zu gehen. Kimikos Freund beruhigte sich, er wurde gelassener, man wählte ihm ein sehr liebliches Wesen als Gattin, die ihm einen Sohn schenkte.
Und wieder vergingen Jahre, und Glück und Zufriedenheit herrschte in dem Feenpalaste, wo einst Kimiko geweilt hatte.
Eines Tages kam eine wandernde Nonne, wie almosenheischend, vor das Haus. Als das Kind ihren buddhistischen Ruf »Ha-ï, Ha-ï« vernahm, lief es an das Tor. Eine Dienerin, die mit der üblichen Reisspende nachfolgte, sah mit Erstaunen, wie die Nonne das Kind liebkoste und sich flüsternd mit ihm unterhielt. Beim Anblick der Dienerin rief der Kleine eifrig: »Laß mich ihr geben.« Und die Stimme der Nonne hinter dem bergenden Schleier, der von ihrem großen Strohhut herabhing, sagte: »Bitte, lasset das Kind gewähren.«
Das Kind schüttete den Reis in die Schüssel der Nonne, und sie dankte ihm und sagte: »Willst du nun wiederholen, was ich dir vorgesagt habe?« Und das Kind sagte leise: » Vater, eine die du nie in dieser Welt wiedersehen wirst, sagt, daß ihr Herz froh ist, weil sie deinen Sohn gesehen hat.«
Die Nonne lächelte milde, liebkoste dann den Knaben noch einmal und schritt eilends von dannen.
Während die Dienerin sich vor Erstaunen nicht fassen konnte, lief das Kind zu seinem Vater, um ihm die Botschaft zu bringen.
Aber des Vaters Augen gingen über, als er die Botschaft hörte, und er weinte über dem Haupte seines Kindes. Denn er und nur er allein wußte, wer an dem Tore gewesen war. Und er erkannte den verborgenen Sinn des Opfergedankens, der ihr ganzes Leben beherrscht hatte.
Seither sieht man ihn oft in Sinnen versunken, aber niemand erfährt seine Gedanken. Er weiß, daß der Raum zwischen Sonne und Sonne geringer ist als zwischen ihm und der Frau, die ihn liebte.
Er weiß, es wäre vergebens, danach zu forschen, in welcher fernen Stadt, in welchem fantastischen namenlosen Straßengewirr, in welchem weltfremden dunklen, nur den Ärmsten der Armen bekannten Tempel sie der Dunkelheit harrt, die dem Anbruch des unermeßlichen Lichtes vorangeht, wo das Antlitz des Meisters ihr zulächeln wird, wo die Stimme des Meisters in Tönen, die süßer sind als je die eines irdischen Geliebten, zu ihr die Worte spricht: » O, meine Tochter, du bist den rechten Weg gewandelt, du hast die tiefste Wahrheit geglaubt und verstanden – deshalb heiße ich dich willkommen und nehme dich hier auf.«