
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Man kann vom physiologischen Schwachsinne des Weibes Es ist ganz ungehörig, zur Geschlechtsbezeichnung den Ausdruck »Frau« zu verwenden. Frau ist die ehrende Anrede und bedeutet Herrin, Domina, Dame, aber nach unserem Sprachgebrauche darf nur die Verheiratete als Frau bezeichnet werden. Wenn man von einer Frauenfrage, Frauenversorgung usw. spricht, so meint man vorwiegend die Angelegenheiten der Weiber, die nicht Frau sind, denn die Frauen brauchen nicht versorgt zu werden usw., sondern die Ledigen und die Witwen; man drückt sich also falsch aus. Dem Manne steht das Weib gegenüber, und der Plural heißt nicht die Frauen, sondern die Weiber. Wenn die Weiber sich ihres Namens schämen sollten, so ist das schlimm genug, aber kein Grund, die Sprache zu vergewaltigen. in zwei Bedeutungen reden.
Es ist nicht leicht, zu sagen, was Schwachsinn sei. Man kann sagen: das, was zwischen Blödsinn und normalem Verhalten liegt. Indessen die Schwierigkeit liegt in der Abgrenzung des Schwachsinns gegen das normale Verhalten. Für das letztere haben wir nicht einmal ein deutsches Wort, denn Gesundheit ist durchaus nicht der passende Begriff, vollsinnig bezieht sich auf die Sinne, nicht auf den Sinn, scharfsinnig bedeutet eine Entwicklung des Sinnes über die Norm hinaus, geradsinnig geht auf das moralische Verhalten. Im gewöhnlichen Leben haben wir die Gegensätze: gescheit und dumm: gescheit ist einer, der unterscheiden kann, dem Dummen fehlt das kritische Vermögen. In der Tat dürfte zwischen der Dummheit und den leichten Formen des Schwachsinnes kein wesentlicher Unterschied sein. Man wende nicht ein, Dummheit sei gesund, Schwachsinn krankhaft, denn diese Entgegenstellung ist im schlechten Sinne populär und beruht im Grunde auf der ungehörigen Einmischung von Werturteilen. Für die wissenschaftliche Betrachtung kann die landläufige Dummheit gerade so eine krankhafte Abweichung sein wie abnorme Kleinheit oder Schwachsichtigkeit usw. Andererseits gibt es wirklich einen physiologischen Schwachsinn, da das Kind schwachsinnig ist im Vergleiche mit dem Erwachsenen, und da man doch das Altwerden nicht als Krankheit bezeichnen kann (trotzdem senectus ipsa morbus), mit dem Altwerden aber eine Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit früher oder später eintritt. Übrigens braucht auch die Sprache das Wort dumm bei krankhaften Veränderungen: er ist durch das Trinken, oder durch eine hitzige Krankheit dumm geworden. Indessen, auch wenn wir die Dummheit zum Schwachsinne rechnen, die Schwierigkeit ist deshalb nicht beseitigt, weil die Grenze der Dummheit nach oben nicht feststeht. In gewisser Hinsicht ist jeder dumm, der eine in der Musik, der andere in der Mathematik, dieser in den Sprachen, jener in Handel und Wandel, u. s. f. Man müßte demnach partiellen und allgemeinen Schwachsinn unterscheiden. Mit gewissem Recht wird man sagen, ja die besonderen Talente zählen nicht mit, es braucht Einer nur im Durchschnitte gute Fähigkeiten zu haben. Das ist es eben, was bedeutet der Durchschnitt, wie stellt man die Norm fest? Hier wie überall bei der Bestimmung feinerer pathologischer Formen, die mit den groben Angaben der gewöhnlichen Klinik nicht zu erledigen ist, stoßen wir auf den Mangel eines geistigen Kanon. Für die Körperformen haben wir den Kanon und können leicht bestimmen, ob jene Zahl von Centimetern noch normal sei, für die geistigen Fähigkeiten aber fehlt die Regel, hier herrscht die Willkür. Man denke nur an die Verschiedenheit der Gutachten in zweifelhaften Fällen. Es wäre töricht, zu behaupten, die jetzt herrschende Unsicherheit sei notwendig, denn man könne keine Grenzen ziehen, wo in Wirklichkeit keine sind. So schlimm ist die Sache nicht: wenn man sich nur Mühe gibt, so wird es schon gelingen, annähernd einen Kanon aufzustellen und die Unsicherheit, wenn nicht zu beseitigen, so doch einzuschränken. Im allgemeinen und auch in Punkto Schwachsinn dürfte der richtige Weg der sein, daß man nicht mehr vom Menschen schlechtweg spricht, sondern von bestimmten Menschenarten, daß man fragt, was kann man verlangen von diesem Alter, diesem Geschlechte, diesem Volke. Das normale Verhalten des Kindes ist bei dem Erwachsenen pathologisch, das des Weibes bei dem Manne, das des Negers bei dem Europäer. Vergleichung verschiedener Gruppen also ist die Hauptsache, denn nur so kann man erfahren, was von einem Gliede einer bestimmten Gruppe zu erwarten sei, nur so wird man verhüten, daß man einen Menschen dumm oder schwachsinnig nennt, weil er nicht das leistet, was irgend ein beliebiger Mensch leisten kann. Mit anderen Worten: Schwachsinn ist eine Relation, und Schwachsinn schlechtweg kann nur bedeuten: im Vergleiche mit Seinesgleichen. Darf man nicht das Glied der einen Gruppe an dem der anderen messen, so darf man doch die Gruppen selbst einander gegenüberstellen. Ein Eskimo, der nicht bis hundert zählen kann, ist als Eskimo nicht schwachsinnig, aber weil es so ist, ist der Eskimo als solcher schwachsinnig im Vergleiche mit dem Deutschen oder Franzosen. Wie ist es nun mit den Geschlechtern? Das ist wohl von vornherein sicher, daß die männlichen und die weiblichen Geistesfähigkeiten sehr verschieden sind, aber findet ein Ausgleich statt derart, daß die Weiber hier mehr leisten, die Männer dort, oder sind die Weiber im ganzen genommen schwachsinnig im Vergleiche mit den Männern? Das Sprichwort ist der letzteren Meinung, denn es sagt: lange Haare, kurzer Verstand, die moderne Weisheit aber will nichts davon wissen, ihr steht der weibliche Geist zum mindesten dem männlichen gleich. Ein Meer von Tinte ist wegen dieser Dinge verbraucht worden und doch ist von Übereinstimmung und Klarheit keine Rede. Die beste Zusammenfassung, die ich kenne, ist der erste Teil des Buches von Ferrero und Lombroso Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte; von C. Lombroso und G. Ferrero. Deutsch von Kurella. Hamburg 1894., der von dem normalen Weibe handelt. Natürlich kann ich nicht allen einzelnen Angaben der Vff. zustimmen, noch mir alle ihre Konstruktionen aneignen, aber im großen und ganzen ist hier der Beweis der geistigen Inferiorität des Weibes sehr gut geführt. Die Darstellung der Italiener umfaßt 192 Druckseiten und ist doch aphoristisch. Wollte man gründlich verfahren, so entstände ein dickes Buch. Es ist daher begreiflich, daß ich hier nur das Wichtigste andeuten kann.
Immer wird man gut tun, sowohl den direkten wie den indirekten Weg zu beschreiten, d. h. sich nicht nur auf die psychologische, sondern auch auf die anatomische Beobachtung zu beziehen.
Körperlich genommen, ist, abgesehen von den Geschlechtsmerkmalen, das Weib ein Mittelding zwischen Kind und Mann, und geistig ist sie es, wenigstens in vielen Hinsichten, auch. Im einzelnen gibt es freilich Unterschiede. Beim Kinde ist der Kopf relativ größer als beim Manne, beim Weibe ist der Kopf nicht nur absolut, sondern auch relativ kleiner Ich finde nicht selten bei mittelgroßen Weibern einen Kopfumfang von 51 cm. So etwas kommt bei Männern nicht vor, die geistig normal sind, nur bei krankhaft Schwachsinnigen, Idioten. Jene Weiber aber sind in ihrer Art ganz gescheit. (Hat ein geistig annähernd gesunder Mann 51 cm Kopfumfang, so handelt es sich um einen Turmkopf, also um eine abnorme Kopfform.). Ein kleiner Kopf umschließt natürlich auch ein kleines Gehirn, aber hier kann man, ebenso wie gegen Bischoffs Gehirnwägungen, die Ausflucht brauchen, ein kleines Gehirn könne ebenso viel wert sein wie ein großes, da es die für das geistige Leben wichtigen Teile ebensogut enthalten könne. Deshalb sind die vergleichenden Untersuchungen einzelner Gehirnteile wichtiger, wenigstens überzeugender. Hier kommen besonders die Ergebnisse Rüdingers in Betracht, die mir nicht so bekannt zu sein scheinen, wie sie es verdienen. Rüdinger Ein Beitrag zur Anatomie des Sprachenzentrums, Stuttgart, 1882 p. 12 ff., Tafel I. hat an ausgetragenen Neugeborenen nachgewiesen, daß »die ganze Windungsgruppe, welche die Sylvische Spalte umrahmt, beim Mädchen einfacher und mit weniger Krümmung versehen ist, als beim Knaben«, daß »die Reilsche Insel beim Knaben im Durchschnitt in allen ihren Durchmessern etwas größer, konvexer und stärker gefurcht ist, als beim Mädchen«. Er hat an Erwachsenen gezeigt (ibid. p. 32 ff., Tafel IV), daß der weibliche Gyrus frontalis tertius einfacher und kleiner ist als der männliche, besonders jener Abschnitt, der unmittelbar an den Gyrus centralis angrenzt. Die Besichtigung der Tafeln ergibt, daß die Unterschiede sehr beträchtlich sind. Rüdinger Ein Beitrag zur Anatomie der Affenspalte und der Interparietalfurche beim Menschen. Bonn 1882, p. 6. – Die ganzen Erörterungen über Schädel und Gehirn des Weibes sind in dem Werk von Ploss-Bartels (Das Weib, 1. Lieferung der 2. Auflage) recht gut zusammengestellt. Ich hatte das vergessen, als ich den Aufsatz schrieb. hat ferner gezeigt, daß »an den weiblichen Hirnen der ganze mediale Windungszug des Scheitellappens und die innere obere Übergangswindung in ihrer Entwicklung bedeutend zurückbleiben«. Bei geistig niedrig stehenden Männern (z. B. einem Neger) fand er den weiblichen ähnliche Verhältnisse des Scheitellappens, während bei geistig hochstehenden Männern die mächtige Entwicklung des Scheitellappens ein ganz anderes Bild gewährte. Die allereinfachsten Verhältnisse fand Rüdinger bei einer bayerischen Frau, er spricht geradezu von »tierähnlichem Typus«.
Demnach ist es also nachgewiesen, daß für das geistige Leben außerordentlich wichtige Gehirnteile, die Windungen des Stirn- und des Schläfenlappens, beim Weibe schlechter entwickelt sind als beim Manne, und daß dieser Unterschied schon bei der Geburt besteht.
Gleich wie Mann und Weib dieselben Gehirnwindungen haben, nur von verschiedener Größe, so haben auch beide dieselben geistigen Eigenschaften, ein Mehr oder Minder macht den Unterschied, keine Eigenschaft kommt einem Geschlechte ausschließlich zu. Die Sinne scheinen bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich scharf zu sein. Lombroso glaubt gefunden zu haben, daß die Schmerzempfindlichkeit der Haut beim Weibe geringer ist. Angenommen, seine Beobachtungen fänden allgemeine Bestätigung, so würde es sich doch nicht um geringere Sinnesschärfe, sondern um geringere geistige Reaktion auf starke Reize handeln. Auch der Umstand, daß zu feinen Unterscheidungen, z. B. beim Teeprüfen, Wolle sortieren, Männer tauglicher sind, ist wohl so zu verstehen, daß sie kleine Unterschiede der Empfindung besser beurteilen können Neuerdings ist ein Buch erschienen, dessen Titel große Hoffnung erweckt: »Vergleichende Psychologie der Geschlechter von Helene Bradford Thompson« (Deutsch von J. E. Kotscher. Würzburg 1905). Es handelt sich um sogenannte experimentelle Psychologie, und die Verfasserin hat ihre Versuche an 25 Schülern und Studenten (»Männern«) und 25 studierenden Mädchen (»Frauen«) in Chicago angestellt. Sie hat sich redliche Mühe gegeben, und am guten Willen liegt es nicht, wenn man am Schlusse so klug ist wie vorher. Bei solchen Versuchen ist die Fragestellung am schwersten, und sehr oft schlägt trotz aller Exaktheit die Sache fehl, weil man nicht weiß, was man eigentlich gemessen hat. Sehen wir etwas genauer zu. Im 1. Kapitel handelt es sich um »motorische Fähigkeit« (?), und es wird allerhand geprüft. Es ergibt sich, daß Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Präzision der Bewegungen bei »Männern« größer sind, daß aber W in der »Coordination« obsiegt. Mit dem unglücklichen Worte wird gesagt, daß die Mädchen mit dem Sortieren verschiedenfarbiger Karton in verschiedene Kästen leichter zustande kamen. Was, in aller, Welt, kann man daraus erschließen?! Im 2. Kapitel kommen Prüfungen der Empfindlichkeit. Angeblich hat W »ein feineres Empfinden«, aber beim Tastsinne ist die Sache nicht deutlich, bei der Beurteilung gehobener Gewichte und möglicherweise auch in der »Oberflächenempfindung« leistet M mehr. Zweifellos ist, daß W bei Stichen eher Schmerz äußert. Bedenkt man, daß die Anordnung der Versuche dem praktischen Leben zum Teil durchaus nicht entspricht, daß die Unterschiede durchschnittlich recht gering sind, daß andere Beobachter andere Ergebnisse erzielt haben, so wird man überhaupt bedenklich werden. Das Gleiche gilt von den Prüfungen der vier Spezialsinne. Die Reize mit ebenmerklicher Wirkung sollen bei W ein wenig kleiner sein, »das Unterscheidungsvermögen ist im allgemeinen beim Manne besser«. Soweit wie Sinnesempfindungen und ihre Beurteilung in Frage kommen, kann man sich ja das Experimentieren gefallen lassen. Wenn aber damit die Höhe der geistigen Fähigkeiten im engeren Sinne festgestellt werden soll, so muß man recht sehr auf der Hut sein. Im Ernste kann es nur auf das ankommen, was der Mensch im wirklichen Leben leistet, nicht auf Laboratorium-Spiele. Die Ergebnisse der Versuche sind denn auch recht kümmerlich. Die Verfasserin meint, das Gedächtnis und das associative Denken seien bei W besser. In Wahrheit hat sie gefunden, daß die Mädchen sinnlose Silbenreihen etwas leichter auswendig lernen, und daß bei ihnen zwar nicht die Richtigkeit, aber die Fixigkeit des Associierens etwas größer ist. Bedenkt man, daß sich gegen das Lernen sinnloser Silben ein denkender Mensch auch beim besten Willen empört, und daß die sogenannten äußeren Associationen bei Geisteskranken oft reichlicher als bei gesunden kommen, so wird man den Wert jenes Ergebnisses nicht überschätzen. Weiter heißt es, die »Urteilskraft« sei bei M größer. Schön, aber, wenn man für diese Annahme keine anderen Gründe hätte, als die Versuche der Verfasserin, so stände es schlecht damit, denn es hat sich dabei um die Lösung von geometrischen und mechanischen Aufgaben gehandelt, und es ist ganz unzulässig, für diese Dinge allgemeine menschliche Fähigkeiten vorauszusetzen. Das »allgemeine Wissen« ist durch Vorlegung von Schulfragen aus den verschiedenen Fächern geprüft worden, und es hat sich dabei kein wesentlicher Unterschied der Geschlechter ergeben. Ist schon die Überschätzung solcher Schulexamina, die eigentlich nur die Dressur beurteilen lassen, bedenklich, so ist doch das Tollste das, daß die Verfasserin über das Gemütsleben nach der Beantwortung vorgelegter Fragen urteilt. Sie hat z. B. die jungen Leute gefragt, »sind Sie sehr gewissenhaft?«, oder »sind Sie liebevoll?«, und hat in rührender Naivität die Antworten ernst genommen. Mit dieser Methode hat sie herausgekriegt, daß in Beziehung auf Gemütsbewegungen höchstens ganz geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen. Kleine Verschiedenheiten gibt es ja, z. B. »den Frauen macht das Studium mehr Freude, während die Männer demselben mehr Zeit widmen«. Ach!. Andererseits ist die Freude der Weiber an Farben nicht als besserer Farbensinn aufzufassen, sondern durch geistige Beziehungen zu erklären. Anders ist es mit der motorischen Seite, denn an Kraft und Geschicklichkeit steht das Weib tief unter dem Manne. Wegen ihrer Schwäche ist sie vorwiegend auf Arbeiten angewiesen, die eine gewisse Geschicklichkeit erfordern, und dadurch entsteht der Glaube an die geschickten weiblichen Finger. Jedoch sobald wie sich ein Mann einer Weiberarbeit annimmt, als Schneider, als Weber, als Koch usw., so leistet er bessere Arbeit als das Weib. Im Grunde ist ja die Geschicklichkeit eine Leistung der Gehirnrinde wie die Beurteilung der Sinnesempfindungen, und wir werden wieder darauf hingewiesen, die Verschiedenheit der Geschlechter in den eigentlichen geistigen Fähigkeiten zu suchen. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist wohl der, daß der Instinkt beim Weibe eine größere Rolle spielt als beim Manne. Man kann in der Idee eine Reihe bilden, am einen Ende stehen Wesen, die ausschließlich instinktiv handeln, am anderen solche, bei denen jede Handlung auf Reflexion beruht. Im allgemeinen ist der geistigen Entwickelung eigentümlich, daß der Instinkt immer weniger, die Überlegung immer mehr zu bedeuten hat, daß das Gattungswesen mehr und mehr Individuum wird. Wir sprechen dann von Instinkt, wenn eine zweckmäßige Handlung ausgeführt wird, ohne daß der Handelnde weiß, warum; sobald wie gewisse Umstände wiederkehren, arbeitet in uns ein Apparat, und wir vollziehen eine Handlung, als ob eine fremde Vernunft uns dazu antriebe. Wir sprechen aber auch von instinktiver Erkenntnis, wenn wir zu Urteilen gelangen, ohne zu wissen wie. Im Grunde ist keine Handlung und Erkenntnis ohne Instinkt, denn ein Teil des Prozesses fällt immer in das Unbewußte, aber es gibt doch Gradunterschiede. Je mehr Anteil das individuelle Bewußtsein am Erkennen und Handeln hat, um so höher ist das Individuum entwickelt, um so selbständiger ist es. Einen Zwischenzustand zwischen dem rein Instinktiven und dem klar Bewußten nennen wir Gefühl. Aus Gefühl handeln, aus Gefühl etwas für wahr halten, heißt es halb instinktiv tun. Der Instinkt hat große Vorzüge, er ist zuverlässig und macht keine Sorgen; das Gefühl nimmt zur Hälfte an diesen Vorzügen teil. Der Instinkt nun macht das Weib tierähnlich, unselbständig, sicher und heiter. In ihm ruht ihre eigentümliche Kraft, er macht sie bewundernswert und anziehend. Mit dieser Tierähnlichkeit hängen sehr viele weibliche Eigentümlichkeiten zusammen. Zunächst der Mangel eignen Urteils. Was für wahr und gut gilt, das ist den Weibern wahr und gut. Sie sind streng konservativ und hassen das Neue, ausgenommen natürlich die Fälle, in denen das Neue persönlichen Vorteil bringt, oder der Geliebte dafür eingenommen ist. Wie die Tiere seit undenklichen Zeiten immer dasselbe tun, so würde auch das menschliche Geschlecht, wenn es nur Weiber gäbe, in seinem Urzustande geblieben sein. Aller Fortschritt geht vom Manne aus. Deshalb hängt das Weib vielfach wie ein Bleigewicht an ihm; sie verhindert manche Unruhe und vorwitzige Neuerung, sie hemmt aber auch den Edlen, denn sie vermag das Gute vom Bösen nicht zu unterscheiden und unterwirft schlechtweg alles der Sitte und »dem Sagen der Leute«. Der Mangel an Kritik drückt sich auch in der Suggestibilität aus. Der Instinkt herrscht nicht wie beim Tiere fast ganz allein, sondern er ist mit individuellem Denken verbunden, dieses aber ist nicht kräftig genug, allein zu gehen, muß sich auf fremdes Denken stützen, das Voreingenommenheit, Liebe oder Eitelkeit als vertrauenswert erscheinen lassen. So ergibt sich der scheinbare Widerspruch, daß die Weiber, als Hüterinnen alter Sitte, doch jeder Mode nachlaufen, konservativ sind und doch jede Absurdität aufnehmen, wenn geschickt suggeriert wird. Mit der Ablösung vom ursprünglich Instinktiven, mit dem Ichwerden und dem Wachsen des individuellen Denkens wächst zunächst der Egoismus, oder richtiger, das seiner Natur nach egoistische Einzelwesen, das solange, wie es nur seinen Trieben gehorcht, unbewußt auch zum Vorteile der Anderen handelt, wird, wenn es anfängt zu denken, den sozialen Trieben zuwider handeln. Erst eine hohe geistige Entwickelung gibt die Einsicht, daß durch Förderung des allgemeinen Wohles auch das eigene Wohl gefördert wird. Die meisten Weiber bleiben in dem Mittelzustande: Ihre Moral ist durchaus Gefühlsmoral oder unbewußtes Rechttun, die Begriffsmoral ist ihnen unzugänglich, und die Reflexion macht sie nur schlechter. Zu dieser Einseitigkeit kommt die durch ihre natürliche Stellung bedingte Enge des Gesichtskreises. Sie leben in den Kindern und dem Manne, was jenseits der Familie ist, interessiert sie nicht. Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person ist ihnen ein leerer Begriff. Es ist durchaus unrichtig, die Weiber unmoralisch zu nennen, aber sie sind moralisch einseitig oder defekt. Soweit wie ihre Liebe reicht, sofern wie angeschautes Leiden ihr Mitleid erweckt, sind sie oft jeder Aufopferung fähig und beschämen nicht selten den kälteren Mann. Aber sie sind von Herzen ungerecht, sie lachen innerlich über das Gesetz und verletzen es, sobald wie die Furcht oder die Dressur das zulassen. Dazu kommt die Heftigkeit der Affekte, die Unfähigkeit zur Selbstbeherrschung. Eifersucht und verletzte oder unbefriedigte Eitelkeit erregen Stürme, denen kein moralisches Bedenken Stand hält. Wäre das Weib nicht körperlich und geistig schwach, wäre es nicht in der Regel durch die Umstände unschädlich gemacht, so wäre es höchst gefährlich. In den Zeiten politischer Unsicherheit hat man mit Schrecken die Ungerechtigkeit und Grausamkeit der Weiber kennen gelernt, ebenso an den Weibern, die unglücklicherweise zur Herrschaft gekommen sind. Im gewöhnlichen Leben zeigen sich jene beiden Eigenschaften in der Regel nur bei der Tätigkeit der Zunge und beim Schreiben; Beschimpfungen, Verleumdungen, anonyme Briefe. Die Zunge ist das Schwert der Weiber, denn ihre körperliche Schwäche hindert sie, mit der Faust zu fechten, ihre geistige Schwäche läßt sie auf Beweise verzichten, also bleibt nur die Fülle der Wörter. Zanksucht und Schwatzhaftigkeit sind jederzeit mit Recht zu den weiblichen Charakterzügen gezählt worden. Das Schwatzen gewährt dem Weibe unendliches Vergnügen, ist der eigentliche weibliche Sport. Vielleicht läßt sich das verstehen, wenn man an die Übungsspiele der Tiere denkt. Die Katze jagt hinter dem Balle her und übt sich dabei für die Mäusejagd, das Weib übt ihre Zunge während des ganzen Lebens, um zum Redekampfe gerüstet zu sein.
Beilage zu Möbius, Geschlecht und Kopfgrösse
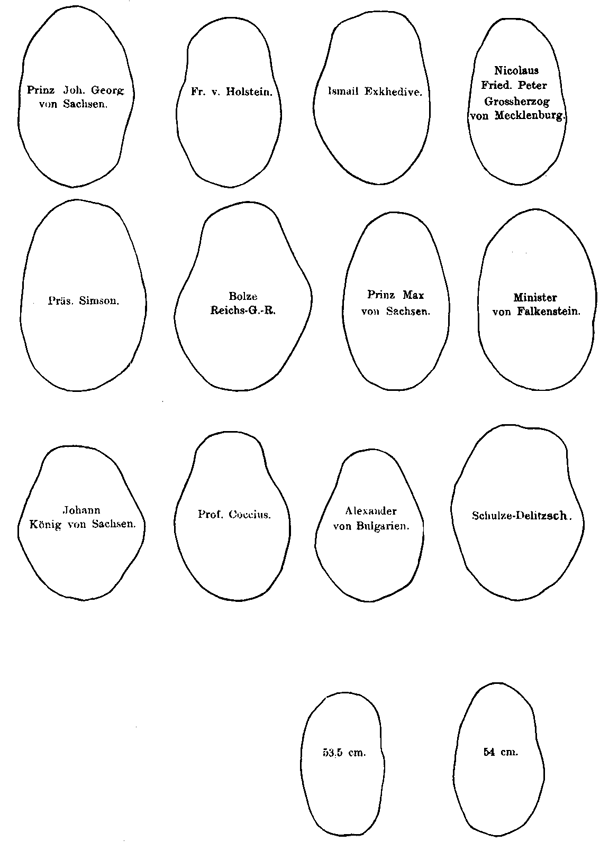
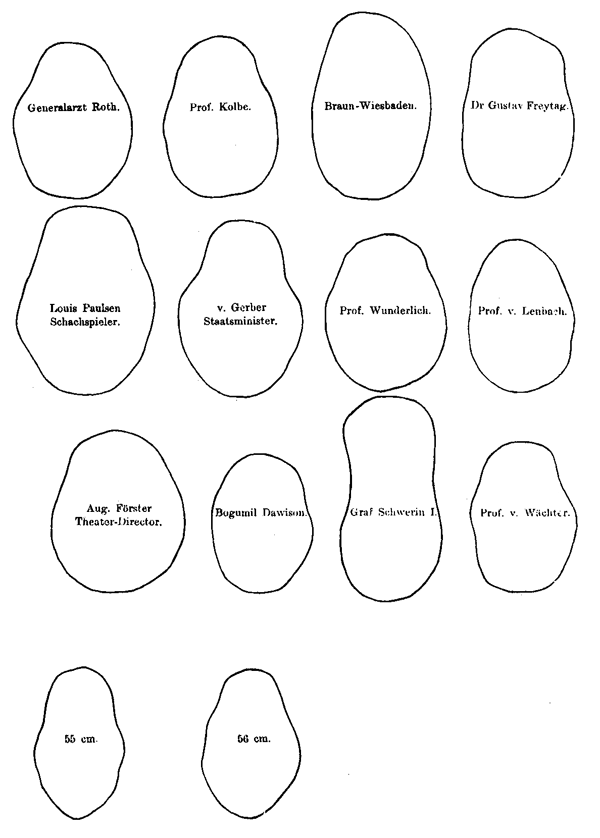
Die jeweils unteren, unbenamsten Köpfe sind weiblich.
Nach dieser allgemeinen Charakteristik wären noch die sog. intellektuellen Fähigkeiten in Betracht zu ziehen. Man wird trennen müssen Aufnehmen und Bewahren der Vorstellungen, also Verständnis und Gedächtnis einerseits, willkürliche Verknüpfung der Vorstellungen, Bildung neuer Urteile andererseits. Verständnis und Gedächtnis sind bei vielen Weibern, soweit wie nicht besondere Talente in Frage kommen, durchaus nicht schlecht. Sie fassen, wenn sie wollen, recht gut auf und merken sich das Gelernte eben so gut wie die Männer. Da nun dazu kommt, daß sie fügsam und geduldig sind, so haben sie wirklich Anlage zum Musterschüler. Überall da, wo die Weiber es sich in den Kopf gesetzt haben, am höheren Unterrichte teilzunehmen, ist nur Eine Stimme darüber, daß sie ausgezeichnete Schülerinnen sind, und je gedankenloser der Lehrer ist, um so befriedigter pflegt er von dem eifrigen Lernen der Schülerinnen, das meist ein Auswendiglernen ist, zu sein. Wenn trotzdem die große Masse des weiblichen Geschlechts außerordentlich wenig lernt und das Gelernte außerordentlich rasch wieder vergißt, so liegt das nicht am Können, sondern am Wollen. Das Durchschnittsweib hat ausschließlich persönliche Interessen, bietet das Lernen nicht einen persönlichen Vorteil in naher Aussicht, so ist es ihr sehr widerwärtig. Interesse an der Sache ist nur ausnahmeweise vorhanden. Das relativ günstige Urteil über die Aufnahmefähigkeit hat nun freilich sein Gegenstück an dem Nachweise der geistigen Sterilität des Weibes. Das Höchste ist, wenn ein Weib sich derart als guter Schüler beweist, daß sie im Sinne des Lehrers die von ihm erlernte Methode handhabt. Dagegen ist das eigentliche »Machen«, das Erfinden, Schaffen neuer Methoden, dem Weibe versagt. Sie kann sozusagen nicht Meister werden, denn Meister ist, wer was erdacht. Es ist ein beliebter Kniff der Männer, die den Weibern ihre Emanzipations-Gelüste eingeflößt haben, und ihrer Nachbeterinnen, zu behaupten, es habe den Weibern nur an Übung gefehlt, sie seien wie die afrikanischen Schwarzen von den muskelstarken Männern zu Sklaven gemacht worden, und in der Sklaverei sei ihr Geist verkümmert. An diese Behauptungen knüpfen sich gewöhnlich darwinistische Schwärmereien, die erworbene Gehirnatrophie habe sich vererbt, und umgekehrt sei zu erwarten, daß, wenn jetzt die Weiber ihr Gehirn übten, die Enkelinnen mit einem großen Gehirn zur Welt kommen würden, Schwärmereien, die höchstens dann einen Sinn haben könnten, wenn es sich um Parthenogenesis handelte. Dreister, als es die »Feministen« tun, kann man der Wahrheit gar nicht ins Gesicht schlagen. Am einfachsten ist es, auf die Gebiete hinzuweisen, die den Weibern jederzeit offen gestanden und auf denen sie sich nach Belieben bewegt haben. Die Musik z. B. ist doch nie männliche Domäne gewesen, im Gegenteile werden mehr Mädchen als Knaben in der Musik unterrichtet. Was ist nun dabei herausgekommen? Die Weiber singen und spielen zum Teile ganz gut, aber damit ist die Sache zu Ende. Wo ist der weibliche Componist, der einen Fortschritt bedeutete? In der Malerei besteht nicht, wie in der Musik, ein Gegensatz zwischen dem schaffenden und dem ausübenden Künstler, alle malen, und ob einer dabei schafft, das ist nicht immer leicht zu sagen. Jedoch sieht man ohne Schwierigkeit, daß die große Mehrzahl der weiblichen Maler der schöpferischen Phantasie ganz entbehrt und über eine mittelmäßige Technik nicht hinauskommt: Blumen, Still-Leben, Portraits Hierher gehören auch die Bemerkungen von Kerschensteiner und Specht, die der Verf. noch besonders zur Verwertung in der 9. Auflage notiert hat. K. nämlich (Die Entwicklung der zeichnerischen Begabung, München 1905) findet, daß die Mädchen in der zeichnerischen Begabung hinter den Knaben zurückstehen, ausgenommen im Zeichnen von Blumen, Ornamenten ... W. Stern hat gefunden, daß Mädchen über ein gesehenes Bild viel schlechter berichten als Knaben.. Ganz selten findet man ein wirkliches Talent, und dann pflegen auch andere Züge den geistigen Hermaphroditismus darzutun. Der Mangel an Vermögen, zu kombinieren, d. h. in der Kunst der Mangel an Phantasie, macht die weibliche Kunstübung im großen und ganzen wertlos. Ähnlich ist es auf andern Feldern. Ich erinnere an die Geburtshülfe, deren Entwicklung die Weiber eher gehemmt als gefördert haben Vergl. die Festrede M. Runges (Männliche und weibliche Frauenheilkunde, Göttingen, 1899), die mir erst nach Abfassung dieses Aufsatzes zugekommen ist. Vergl. auch: H. Schelenz>, Frauen im Reiche Aeskulaps, Leipzig 1900. Dasselbe in der deutschen Aerzte-Zeitung vom 15. Juni 1904.. Auch die Erzählerinnen, die ja z. T. recht anmutig schildern, und die überaus seltenen Dichterinnen bewegen sich auf gebahnten Pfaden, wuchern mit den Münzen, die Männer geprägt haben. Ja selbst die Kochkunst und die Kleiderkunst sind nur von Männern gefördert worden, diese erfinden die neuen Rezepte und die neuen Moden. Alles, was wir um uns sehen, jedes Hausgerät, die Instrumente des täglichen Gebrauches, alles ist von den Männern erfunden worden.
Daß die Wissenschaften im engeren Sinne von den Weibern keine Bereicherung erfahren haben, noch erwarten können, ist demnach begreiflich. Die wenigen weiblichen Gelehrten, deren Namen die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende enthält, waren gute Schüler, nichts weiter. Das gilt freilich von den meisten männlichen Gelehrten auch, aber jene sind die Gipfel, diese bilden die untere Schicht, aus der sich erst die wahren Größen der Wissenschaft erheben. Auch im gewöhnlichen Leben tritt die Unfähigkeit des weiblichen Geistes zur Kombination, das Fehlen selbständigen Denkens einem täglich überraschend entgegen und bildet oft einen schroffen Gegensatz gegen die Leichtigkeit der Aneignung. Dazu kommt der Mangel an Sachlichkeit, der Wünsche zu Gründen und Abneigungen zu Beweisen macht. Andererseits bringt gerade der dem Weibe eigene Realismus, der nur Vorteil oder Nachteil bedenkt, rücksichtslos sein Ziel verfolgt, durch sachliche Erwägungen nicht gehemmt wird, praktische Vorteile und befähigt das Weib, den schwerfälligeren, die Dinge von verschiedenen Seiten und mehr unpersönlich betrachtenden Mann gelegentlich zu besiegen. Nur ist diese weibliche Schlauheit kein Zeichen hoher Geistesgaben, das Weib steht hier dem Manne gegenüber wie ein geschickter Kaufmann einem Künstler oder Gelehrten. Übrigens streicht die weibliche Schlauheit, wenn sie zufällig auf männliche Schlauheit trifft, und diese nicht durch den Geschlechtstrieb gehemmt ist, bald die Segel. Unterstützt wird die Schlauheit durch die Verstellung. Zu dieser wird das Weib durch seine geschlechtliche Rolle gezwungen, sie wird instinktiv geübt, und ihre Vervollkommnung macht einen wesentlichen Teil der weiblichen Bildung aus. Die Aufgabe ist, begehrenswert zu erscheinen, deshalb muß das eigene Begehren verschwiegen werden, und muß alles geschickt verdeckt werden, was der Schätzung der Anderen abträglich sein könnte. Zwischen uns sei Wahrheit, heißt es im Schauspiele, zwischen uns sei Unwahrheit, heißt es im Leben. Das muß so sein, und nichts ist törichter, als dem Weibe das Lügen verbieten zu wollen. Verstellung, d. h. Lügen, ist die natürliche und unentbehrlichste Waffe des Weibes, auf die sie gar nicht verzichten kann. Freilich soll die Waffe nur zur Verteidigung dienen, indessen ist es begreiflich, daß es nicht dabei bleibt, daß ein Verfahren, das einen wichtigen Teil der Lebensführung bildet, auch ohne Not angewendet wird. An sich ist die weibliche Lüge nur in geschlechtlichen Beziehungen gerechtfertigt, die Billigkeit aber fordert, daß sie überhaupt milder beurteilt werde als die männliche Lüge.
Wie die Verstellung und andere bisher betrachtete Eigenschaften, so wird das ganze Wesen des Weibes teleologisch am leichtesten begriffen. Wie muß dieses Wesen beschaffen sein, um die ihm gestellte Aufgabe am besten zu erfüllen? Das menschliche Weib soll nicht nur Kinder gebären, sondern auch diese pflegen, da sie, im Gegensatze zu den Jungen der Tiere, so und so viele Jahre lang hilfebedürftig bleiben. Diese Hilfebedürftigkeit der Kinder macht beim Menschen eine größere Differenzierung der Geschlechter nötig als bei den Tieren. Beschaffung der Nahrung, Verteidigung, überhaupt das Departement des Äußeren hat der Mann allein zu besorgen, denn das Weib muß in erster Linie Mutter sein. Auch in geistiger Beziehung ist alles, was den Mutterberuf erleichtert, dem Weibe zu geben, alles, was ihn erschwert, zu beseitigen. Mütterliche Liebe und Treue will die Natur vom Weibe. Deshalb spielt schon das kleine Mädchen mit Puppen und nimmt sich zärtlich aller Hülfebedürftigen an. Deshalb ist das Weib kindähnlich, heiter, geduldig und schlichten Geistes. Mut braucht die Frau höchstens zur Verteidigung der Kinder, in anderen Beziehungen würde er nur stören und fehlt deshalb. So ist es auch mit anderen männlichen Eigenschaften: Kraft und Drang ins Weite, Phantasie und Verlangen nach Erkenntnis würden das Weib nur unruhig machen und in ihrem Mutterberufe hindern, also gab sie die Natur nur in kleinen Dosen. Ebenso wie ein verständiger Mann sich zur Pflege seiner kleinen Kinder nicht ein gelehrtes Frauenzimmer aussuchen wird, so stellte die ewige Weisheit nicht neben den Mann noch einen Mann mit einem Uterus, sondern das Weib, dem sie alles zu seinem edlen Berufe Nötige gab, dem sie aber die männliche Geisteskraft versagte.
Nach alledem ist der weibliche Schwachsinn nicht nur vorhanden, sondern auch notwendig, er ist nicht nur ein physiologisches Faktum, sondern auch ein physiologisches Postulat. Wollen wir ein Weib, das ganz seinen Mutterberuf erfüllt, so kann es nicht ein männliches Gehirn haben. Ließe es sich machen, daß die weiblichen Fähigkeiten den männlichen gleich entwickelt würden, so würden die Mutterorgane verkümmern, und wir würden einen häßlichen und nutzlosen Zwitter vor uns haben. Jemand hat gesagt, man solle vom Weibe nichts verlangen, als daß es »gesund und dumm« sei. Das ist grob ausgedrückt, aber es liegt in dem Paradoxon eine Wahrheit. Übermäßige Gehirntätigkeit macht das Weib nicht nur verkehrt, sondern auch krank. Wir sehen das leider tagtäglich vor Augen. Soll das Weib das sein, wozu die Natur es bestimmt hat, so darf es nicht mit dem Manne wetteifern. Die modernen Närrinnen sind schlechte Gebärerinnen und schlechte Mütter. In dem Grade, in dem die »Zivilisation« wächst, sinkt die Fruchtbarkeit, je besser die Schulen werden, um so schlechter werden die Wochenbetten, um so geringer wird die Milchabsonderung, kurz, um so untauglicher werden die Weiber. Lombroso, der gern auf das Tierreich verweist, betont, daß im ganzen Tierreiche die Intelligenz im umgekehrten Verhältnisse zur Fruchtbarkeit stehe, daß die weiblichen Ameisen und Bienen nur auf Kosten der Geschlechtlichkeit höhere Intelligenz erwerben, während die allein fortpflanzungsfähige Königin der Bienen ein ganz stupides Geschöpf ist. Nichtsdestoweniger fährt er fort: »Sicherlich wird eine ausgedehntere Anteilnahme am sozialen Leben die Intelligenz des Weibes allmählich heben, und in der Tat zeigen sich bei manchen höher entwickelten Rassen schon die erfreulichen Folgen hiervon«. Entweder ist das »erfreulich« eine bittere Ironie oder eine greuliche Inkonsequenz. Von rechtswegen sollte nur der Teufel oder ein Tor, der an Seelengemeinschaft und ähnliche Albernheiten glaubt, sich über etwas freuen, das die Rasse verdirbt und den Anfang vom Ende bedeutet.
Die Ärzte haben sich vielfach über die Forderung der Weiber, zur Medizin zugelassen zu werden, erregt. Vielleicht ist die Sache nicht so wichtig. Einerseits ist nicht zu leugnen, daß die weiblichen Geistesfähigkeiten zur Erlernung der Medizin ausreichen, und daß gelegentlich weibliche Ärzte, wenn sie gehörig geleitet und beaufsichtigt werden, nützlich sein können (z. B. in mohamedanischer Bevölkerung), andererseits werden sich doch nur recht wenige Mädchen dem Studium zuwenden, immer weniger, je mehr die Sache an »Aktualität« verliert, und diese wenigen werden solche sein, die für ihren weiblichen Beruf sowieso nicht recht tauglich sind. Also wenn auch die Medizin wie die Weiber selbst vom weiblichen Studium nicht viel Nutzen haben werden, es kommt nicht sehr viel darauf an.
Viel wichtiger scheint mir das zu sein, daß die Ärzte sich eine klare Vorstellung von dem weiblichen Gehirn- oder Geisteszustande verschaffen, daß sie die Bedeutung und den Wert des weiblichen Schwachsinnes begreifen, und daß sie alles tun, was in ihren Kräften steht, um im Interesse des menschlichen Geschlechtes die widernatürlichen Bestrebungen der »Feministen« zu bekämpfen. Es handelt sich hier um die Gesundheit des Volkes, die durch die Verkehrtheit der »modernen Frauen« gefährdet wird. Die Natur ist eine strenge Frau und bedroht die Verletzung ihrer Vorschriften mit harten Strafen. Sie hat gewollt, daß das Weib Mutter sei, und hat alle ihre Kräfte auf diesen Zweck gerichtet. Versagt das Weib den Dienst der Gattung, will es sich als Individuum »ausleben«, so wird es mit Siechtum geschlagen. Leider werden zugleich der Mann und die Nachkommenschaft gestraft. Unsere, der Ärzte Pflicht ist es, hier zu raten und zu warnen. Die Zukunft wird von uns Rechenschaft fordern. Sollen wir uns über die Mißhandlung der weiblichen Leber durch übertriebenes Schnüren aufregen, die Mißhandlung des weiblichen Gehirns aber ruhig mit ansehen?
Freilich, auch wenn alles dagegen getan wird, was getan werden kann, wird das Übel doch bestehen bleiben, ja wahrscheinlich zunehmen. Denn es scheint eine Funktion der Zivilisation zu sein. Wie die Stadtbevölkerung mit ihrer vorwiegenden Gehirntätigkeit allmählich unfruchtbar wird und ohne Zufluß vom Lande absterben würde, so scheint die Zivilisation überhaupt die Quellen des Lebens abzugraben und ein Volk wird schließlich so zivilisiert, daß es nicht mehr leben kann und nur durch Barbarenblut wieder aufgefrischt werden kann. Offenbar ist das Urphänomen der Gegensatz zwischen Gehirntätigkeit und Fortpflanzung. Beide Funktionen sind eng verknüpft, aber je mehr die eine das Übergewicht erhält, umsomehr leidet die andere. Die Gehirnmenschen sind nervös, und ihre Nachkommenschaft ist erst recht nervös. Ein wesentliches Kennzeichen dieser Form der Entartung ist die Verwischung der Geschlechtscharaktere: weibische Männer und männische Weiber. Je nervöser die Bevölkerung wird, um so häufiger werden die Mädchen mit Talenten und überhaupt männlichen Geisteseigenschaften. Auch muß man wohl die gekreuzte Vererbung heranziehen; die Tochter schlägt nach dem Vater, und je mehr die Kopfmänner gezüchtet werden, um so häufiger übertragen sie ihre Art auf die Töchter. Besser wird die Sache durch alle Erklärungen nicht, denn erklärlich oder nicht, notwendig oder nicht, immer bleibt die Vermännlichung des Weibes ein Unglück.
Auch das Gesetz sollte auf den physiologischen Schwachsinn des Weibes Rücksicht nehmen. Unsere Gesetze sind im großen und ganzen nur für Männer gemacht; für die Minderjährigen ist gesorgt, das erwachsene Weib aber wird im Strafrechte (um nur von diesem zu reden) dem erwachsenen Manne gleich geachtet, und nicht einmal für einen mildernden Umstand gilt irgendwo weibliches Geschlecht. Mit Unrecht. Zu den bisher angestellten Erwägungen kommt noch das hinzu, daß das Weib während eines beträchtlichen Teiles seines Lebens als abnorm anzusehen ist. Ich brauche vor Ärzten nicht über die Bedeutung der Menstruation und der Schwangerschaft für das geistige Leben zu reden, darauf hinzuweisen, daß beide Zustände, ohne eigentliche Krankheit, das geistige Gleichgewicht stören, die Freiheit des Willens im Sinne des Gesetzes beeinträchtigen Krafft-Ebing u. a. haben wiederholt einschlagende Erörterungen angestellt.. Bedenkt man nun die früher besprochenen Geisteseigentümlichkeiten des Weibes, besonders die Unfähigkeit, Affektstürmen zu widerstehen, und den Mangel an Rechtsinn, so muß man einsehen, daß es eine große Ungerechtigkeit ist, beide Geschlechter mit gleichem Maße zu messen. Nur die durch die Umstände des weiblichen Lebens leicht erklärbare geringe Kriminalität des Weibes läßt die Härte unserer Gesetze nicht empfinden. Je mehr aber das Weib aus dem Schutze des Hauses heraustritt, um so leichter wird sie mit den Gesetzen in Konflikt kommen, und dann wird sie oft härter bestraft werden, als sie es verdient. Um nur einige Beispiele zu nennen, ist es gerecht, die einfache Beleidigung und besonders die Beamtenbeleidigung bei beiden Geschlechtern gleich zu beurteilen? Gilt nicht dasselbe von vielen Bagatell-Diebstählen, die im Grunde Näschereien gleich zu achten sind? Insbesondere wäre noch eins zu beachten. Viele weibliche Personen vermögen bei ihren Aussagen über Vergangenes ganz und gar nicht das, was sie wirklich erlebt haben, zu trennen von dem, was sie erlebt zu haben glauben. Solche Erinnerungstäuschungen kommen ja auch bei Männern vor, sind aber bei Weibern viel häufiger und bewirken falsche Aussagen, bei denen jeder dolus fehlt. Zum Teile aus diesem Grunde wurde auf die Zeugenaussagen von Weibern in alten Zeiten wenig oder nichts gegeben. Die Alten übertrieben es nach der einen Richtung, wir übertreiben es nach der anderen, überschätzen das Weib als Zeugin, behandeln sie zu hart als Angeklagte.
Sehen wir uns genötigt, das normale Weib für schwachsinnig im Vergleiche mit dem Manne zu erklären, so ist damit doch nichts zum Nachteile des Weibes gesagt. Ihre Vorzüge liegen eben anderswo als die Vorzüge des Mannes, und die »Differenzierung« der Geschlechter erscheint uns als eine zweckmäßige Einrichtung der Natur, bei der Mann und Weib nicht schlecht fahren. Betrachtet man aber das Leben des Weibes genauer, so möchte man doch meinen, daß die Natur hart mit ihm verfahren sei. Das Weib ist nämlich nicht nur karger mit Geistesgaben versehen, als der Mann, sondern sie büßt sie auch viel rascher wieder ein. Dies ist die zweite Bedeutung, in der man vom physiologischen Schwachsinne des Weibes reden kann; hier wird das frühzeitig gealterte Weib mit dem frischen oder normalen Weibe verglichen. Es will mir scheinen, als ob bisher die Häufigkeit und Frühzeitigkeit des geistigen Zurückgehens beim Weibe nicht genügend beobachtet worden wäre Nach Matiegka übertrifft von 20 bis zu 60 Jahren das männliche Gehirn das weibliche um 145 g, von 60 bis zu 90 Jahren aber um 173 g.. Auch hier dürfte es am besten sein, die Sache teleologisch zu fassen. Das Weib soll Mutter sein; um es aber zu werden, muß sie erst einen Mann haben, der die Sorge für sie und die Kinder auf sich nimmt. Es mußten daher Einrichtungen getroffen werden, den Mann dazu geneigt zu machen. Schopenhauer sagt: »Mit den Mädchen hat es die Natur auf das, was man im dramaturgischen Sinne einen Knalleffekt nennt, abgesehen, indem sie dieselben, auf wenige Jahre, mit überreichlicher Schönheit, Reiz und Fülle ausstattete, auf Kosten ihrer ganzen übrigen Lebenszeit, damit sie nämlich, während jener Jahre, der Phantasie eines Mannes sich in dem Maße bemächtigen könnten, daß er hingerissen wird, die Sorge für sie auf Zeitlebens, in irgend einer Form, ehrlich zu übernehmen«. Dazu ist hinzuzufügen, daß die Ausstattung der Mädchen nicht nur in körperlichen Eigenschaften besteht, und daß sich der Verlust, den die Frauen relativ früh erleiden, nicht nur auf diese bezieht. Viel mehr, als man gewöhnlich meint, entsprechen Äußeres und Inneres einander. So entsprechen auch dem Aufblühen und dem Verblühen weiblicher Schönheit geistige Veränderungen, die in gleichem Sinne ablaufen. Der Geist der Jungfrau ist erregt, feurig, scharf. Dadurch wird einerseits ihre Kraft, anzuziehen, gesteigert, andererseits wird sie befähigt, bei der geschlechtlichen Auswahl aktiv zu sein, im Liebesspiele und Liebeskampfe dem Gegner ebenbürtig zu sein. Die ganze Bedeutung des weiblichen Lebens hängt davon ab, daß das Mädchen den rechten Mann erhalten; auf diesen Moment, als den Höhepunkt des Lebens, sind alle Kräfte gerichtet, und alle Geistesfähigkeiten werden auf das eine Ziel konzentriert. Der Intellekt ist bekanntlich der Diener des Willens, d. h. unsere Einsicht dient unseren Trieben, wir sind nur dann scharfsinnig, wenn wir unseren Neigungen folgen, das Interesse macht klug. Der eine hat dies Talent, der andere jenes, in dem Fache, das er liebt, ist er tüchtig, in anderen Fächern nicht. Das weibliche Talent nun schlechtweg ist die Anlage für Liebesangelegenheiten, hier treibt der Wille den Intellekt, schärft und spannt ihn. Alle anderen Angelegenheiten gewinnen eigentlich nur dadurch Bedeutung, daß sie zu dem Hauptgeschäfte in Beziehung gesetzt werden. Wenn die Jungfrau dem jungen Manne begegnet, ist sie in der Lage eines Feldherrn, der dem feindlichen Heere entgegenzieht. Jetzt gilts, von wenig Augenblicken kann alles weitere abhängen. Aber auch außer Gefecht (um im Militärischen zu bleiben) ist die Jungfrau einer mobil gemachten Truppe zu vergleichen. Sie trägt die Kriegsgarnitur, sie ist jederzeit auf Posten und schlagfertig. Mit anderen Worten: die geistige Erregung gibt sich in allem Tun kund. Das Mädchen ereifert sich für Dinge, die sie gar nichts angehen, interessiert sich, zum Teile allerdings nur dem Scheine nach, zum Teile aber ernstlich, für alle möglichen Sachen, urteilt, streitet, kurz sie erscheint als geistvoll, und in Liebesangelegenheiten oft als genial. Nun heiratet sie, und nach kurzer Zeit wird sie eine andere. Aus dem feurigen, oft glänzenden Mädchen wird sie eine schlichte harmlose Frau. Natürlich verläuft die Sache nicht immer so, aber doch recht oft. Das Volk hat die Verwandlung in pejus frühzeitig bemerkt und auf seine Weise erläutert. Man nahm an, daß mit der Jungfrauschaft ein Zauber gebrochen werde, daß geheime Kräfte schwinden. Im Nibelungenliede überwindet die Jungfrau Brunhilde jeden Mann; als sie durch Siegfried überwältigt ist, wird sie ein Weib wie andere auch. Ähnliches findet man in den Sagen oft. Im modernen Leben sagt man eher: sie hats nicht mehr nötig, in der Meinung, daß die körperliche und geistige Lebhaftigkeit nur den Zweck gehabt habe, den Mann anzulocken. Auf jeden Fall aber handelt es sich nicht nur um ein Wollen, von dem das Weib Rechenschaft geben könnte. Sie verliert tatsächlich Fähigkeiten, die sie vorher besaß, und könnte auch beim besten Willen das nicht mehr leisten, was sie vorher geleistet hat. Nur darüber kann man zweifelhaft sein, ob das Minus an geistigen Leistungen ausschließlich durch den Wegfall der den Intellekt anspornenden Erregung zu erklären sei.
Auch bei Denen, die sich in den ersten Jahren der Ehe gut gehalten haben, beginnt der Verfall oft nach einigen Wochenbetten. Wie die Schönheit und die körperlichen Kräfte schwinden, so gehen auch die Geistesfähigkeiten zurück, und die Frauen »versimpeln«, wie es populär heißt. Oft wird die Sache nicht bemerkt, oder stört wenigstens nicht, weil die sogenannten Gemütseigenschaften unverändert bleiben, und im gewöhnlichen Leben keine geistigen Anforderungen an die Frau gestellt werden. Der aufmerksame Beobachter aber läßt sich nicht täuschen, und die Tatsächlichkeit dieses Versimpelns wird auch vielfach anerkannt. Die Damen der Emanzipation haben sie oft ingrimmig erwähnt und natürlich darauf zurückgeführt, daß die entwürdigende Beschränkung auf Kinderstube und Küche zum geistigen Schwunde führe. Hier wie anderwärts beruht die Erklärung aus dem »milieu« auf Oberflächlichkeit. Jene Beschränkung würde gar nicht eintreten, wenn besondere geistige Bedürfnisse vorhanden wären. Bei den relativ vielen Frauen, deren Gehirn dauerhaft angelegt ist, tritt sie auch wirklich nicht ein, oder, wenn die Verhältnisse in der Tat nur das Notwendige zulassen, so bleibt die Geistesfrische trotz Kinder und Küche erhalten. Zweifellos fallen nicht Alle der Versimpelung anheim, ein Verhalten, das offenbar in angeborenen Eigenschaften seine Bedingungen hat, wenn es auch nicht immer gelingt, ein näheres Verständnis zu erreichen. Sehen wir von den vielen Schlechtausgestatteten ganz ab, deren geistiges Leben minimal ist, und bei denen auch in der Blütezeit von einem geistigen Blühen nichts zu bemerken ist, so mag man die Weiber einer Truppe vergleichen, die wiederholte Angriffe des Feindes, d. h. der Zeit, zu erdulden hat. Manche fallen schon in der ersten Schlacht, oder werden nach einigen Ehejahren schwach, andere halten sich länger, unterliegen aber allmählich, sei es, daß sie zu überaus schlichten Frauen werden, oder zu wunderlichen alten Jungfern verdorren. Aber auch die Übrigbleibenden haben noch den Hauptansturm ihres Feindes auszuhalten, das Klimakterium. Je höher ein Wesen steht, um so später wird es reif. Schon dadurch, daß die Natur den Mann später reif werden ließ, als das Weib, hat sie ihn bevorzugt und hat gezeigt, daß sie höher mit ihm hinaus wollte. Noch viel größer aber wird die Begünstigung des Mannes dadurch, daß er die einmal erlangten Fähigkeiten fast bis zum Lebensende behalten darf. Das frühreife Weib dagegen hat durchschnittlich nur 30 Jahre, in denen es vollständig ist. Zunächst bedeutet das Klimakterium ja nur das Aufhören der geschlechtlichen Tätigkeit, indessen der Organismus ist Einer, und die verschiedenen Funktionen stehen in Abhängigkeit voneinander. Insbesondere bestehen enge Beziehungen zwischen der geschlechtlichen Tätigkeit und der Gehirntätigkeit. Erwacht jene, so verändert sich diese, und verschwindet jene, so wird sich diese auch verändern. Jene erste Veränderung ist ein beträchtliches Plus, demnach wird die zweite ein Minus sein. Wir haben demnach vom Klimakterium, durch das das Weib ein »altes Weib« wird, eine Abschwächung der Geistesfähigkeiten zu erwarten. Die Erfahrung trügt die Erwartung nicht. Ich schicke hier gleich voraus, daß es Ausnahmen gibt, daß manche alte Frauen durch erstaunliche Frische bis ins hohe Alter hinein erfreuen. Sie sind aber nur die alte Garde, die sich nicht ergibt und auch den Hauptansturm des Feindes, wenigstens in der Hauptsache, abschlägt: Das Gros der Armee unterliegt. Zuerst muß man wieder daran erinnern, daß das Äußere der Spiegel des Inneren ist. Man spottet zwar vielfach über die Physiognomik, und in der Tat sind wir gewöhnlich nicht imstande, unsere physiognomischen Urteile discursiv zu begründen, es handelt sich da um ein instinktives Erkennen, aber nichtsdestoweniger kann man sich auf das verlassen, was das Gesicht sagt. Man betrachte unbefangen das Gros der alten Weiber und denke über das unwillkürlich gebildete Urteil nach. Es ist bekannt, welche Fülle von Spott und mißgünstigen Bemerkungen sich seit undenklichen Zeiten her über die armen alten Weiber in Versen, Sprüchwörtern und anderweitiger Rede, ergossen hat. Sollte das ohne Grund geschehen sein? Man könnte meinen, es sei ein Ausdruck feindseliger Gesinnung, aber wo sollte diese herkommen? Der Mann haßt doch das weibliche Geschlecht nicht, es sei denn, daß er gezwungen ist, mit ihm zu kämpfen. Aber gegen die geschlechtlich nicht mehr tätigen Weiber muß er, von Spezialfällen abgesehen, Gleichgültigkeit oder sogar mit Mitleid gemischtes Wohlwollen empfinden, sie tun ihm nichts mehr, und die Erinnerung an die eigene Mutter sollte jeden zur Milde mahnen. Wenn trotzdem die Volkesstimme von ihnen fast nur Übles zu sagen weiß, und das Sprüchwort an ihnen wenig gute Haare läßt, so müssen wohl ihre eigenen Eigenschaften mit daran schuld sein. Man wirft ihnen vor Aberglauben, Engherzigkeit, Kleinlichkeit, überhaupt Zanksucht, Schwatzhaftigkeit, Klatschsucht, alles Eigenschaften, die auf einen niedrigen Stand der geistigen Fähigkeiten deuten, und eben den erworbenen Schwachsinn des Weibes ausmachen. Gerechterweise muß man freilich hinzufügen, daß das allgemeine Urteil milder ausgefallen wäre, wenn die alten Weiber weniger häßlich wären. Häßlich heißt ja hassenswert, und das Volk haßt tatsächlich das Häßliche, wie man an den für häßlich geltenden Tieren sieht. So schießt die abgünstige Meinung über das Ziel hinaus, wenn sie von boshaften alten Weibern, bösen alten Hexen usw. spricht. Die boshaften alten Weiber haben auch früher nichts getaugt, man hat ihnen die Bosheit nur nicht angekreidet, solange wie sie körperliche Reize hatten. Allerdings tritt durch den Schwachsinn die Bosheit unverhüllter zu Tage und nimmt lächerliche Formen an, aber er erzeugt sie nicht. Der einfache Schwachsinn der Jahre läßt glücklicherweise die wahrhaft guten Eigenschaften des Weibes unverändert, die mütterliche Gesinnung bleibt, und trotz aller Einfältigkeit kann ein altes Weib einen Schatz von Zärtlichkeit in sich bergen.
Nach dieser allgemeinen Übersicht wäre etwa noch genauer zu zeigen, wie sich der erworbene physiologische Schwachsinn des Weibes kundgibt. Es ist schon Anderen aufgefallen, daß die Lernfähigkeit des Weibes, ihre am meisten entwickelte Fähigkeit, relativ früh aufhört. Näheres darüber ist freilich sehr schwer festzustellen. Ein sehr auffallender Zug ist die allmähliche Zunahme der geistigen Myopie. Nur das Nächste wird gesehen, und deshalb wird es überschätzt. Charakteristisch ist die Sparsamkeit am unrechten Orte; große Ausgaben müssen gemacht werden, weil man sich zu kleinen nicht entschließen konnte, und, um Pfennige zu retten, wird die Mark verloren. Verwandt damit ist die Überschätzung der kleinen Angelegenheiten überhaupt; gegenwärtige Bagatellen lassen Vergangenheit und Zukunft vergessen, rauben jede Fassung; Großes und Kleines wird mit derselben Erregung behandelt, und das wahrhaft Wichtige wird um einer Nichtigkeit willen vernachlässigt. Schlimme Erfahrungen pflegen an der Sache nichts zu ändern, und Auseinandersetzungen erzielen zwar theoretische Zustimmung, bessern aber nicht. »Ich bin einmal so«. Die Schwäche der Urteilskraft tritt besonders deshalb hervor, weil mit den Jahren der Instinkt abnimmt. Sie wird oft verdeckt durch die Anlehnung an fremdes Urteil; fehlt aber einmal die Stütze, so erschrickt man über die unglaublichen Mißgriffe bei ganz einfachen Angelegenheiten. Die Suggestibilität nimmt mehr und mehr ab, eintönige Eigensuggestionen herrschen vor und bewirken einen Eigensinn, gegen den Gründe ganz machtlos sind. Weil der Geist steif wird, hat das Bestehende immer mehr Recht, es entwickelt sich »Misoneismus«, und die Reaktionen werden maschinenmäßig. Diese Dinge sind ja dem Alter überhaupt eigen, jedoch beim Weibe beobachtet man sie auffallend früh, und sie erhalten eine eigentümliche Färbung durch die Verbindung mit der weiblichen Redekunst. Wer nicht das Glück gehabt hat, die Besprechungen älterer Damen mit anzuhören, kann sich kaum eine Vorstellung von der Länge und Leere der Gespräche machen. Das schlichteste Thema wird zu unzähligen Variationen verarbeitet, und die scharfen Tempi wiegen vor. Das Bild vom Flusse der Rede hat mannigfache Abwandlungen erfahren: Dachtraufe, plätschernde Wellen usw. am besten ist vielleicht die Vergleichung mit einer leergehenden Mühle.
Die Kenntnis der verschiedenen Formen des physiologischen Schwachsinnes kann auch klinische Bedeutung erlangen, wenn es sich um die Abgrenzung vom pathologischen Schwachsinne handelt, und Der, der nur die vom Manne genommene Norm kennt, ist in Gefahr, bei einem Weibe pathologische Zustände zu diagnostizieren, wo sie nicht vorhanden sind. Die Beurteilung leichten Schwachsinnes gehört zu den schwierigsten Aufgaben, und unsere klinischen Methoden sind nur auf grobe Veränderungen gerichtet. Es ist ersichtlich, daß die Prüfung nach Art der Schulexamina, die über die vorhandenen Kenntnisse orientiert, nicht ausreichen kann. Ebensowenig geben die Methoden, die ein Urteil über die Geschwindigkeit einfacher seelischer Vorgänge gestatten, genügenden Aufschluß. Am wichtigsten wäre es, das Vermögen der Kombination zu prüfen. Rieger Beschreibung der Intelligenz-Störungen infolge einer Hirnverletzung nebst einem Entwurfe zu einer allgemein anwendbaren Methode der Intelligenzprüfung. Verhandl. der physik.-med. Ges. zu Würzburg 1888-99. p. 65-95. hat einige dahin gehende Vorschläge gemacht. Man hat wohl auch leichte Aufgaben nach Art der Rätsel verwendet und ähnliches. Auf jeden Fall wäre es wünschenswert, wenn die nach dieser Richtung gehenden Bestrebungen allgemeine Unterstützung fänden. Aber auch nach Verbesserung der Methoden wird man sich nicht auf die klinische Prüfung allein verlassen können. Diese wird wohl nie erschöpfend sein, Gemütszustände können störend eingreifen, kurz, die Beobachtung des Menschen unter den Verhältnissen des wirklichen Lebens wird unentbehrlich sein. Gerade das Urteil über die geistige Leistungsfähigkeit wird nicht allein auf Stichproben, sondern auf die Lebensgeschichte zu gründen sein.