
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1721.
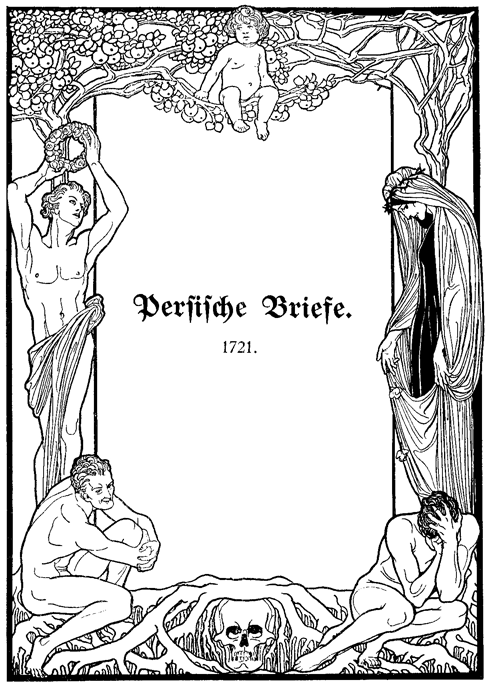
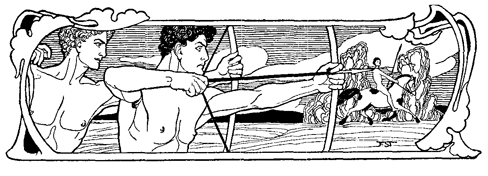
 Wir sind seit einem Monat in Paris und sind in einer ununterbrochenen Unruhe gewesen. Was für Umstände, bis man eine Wohnung hat, bis man die Leute aufgefunden hat, denen man empfohlen ist, und bis man alles Notwendige beieinander hat!
Wir sind seit einem Monat in Paris und sind in einer ununterbrochenen Unruhe gewesen. Was für Umstände, bis man eine Wohnung hat, bis man die Leute aufgefunden hat, denen man empfohlen ist, und bis man alles Notwendige beieinander hat!
Paris ist so groß wie Ispahan, seine Häuser sind so hoch, als wenn lauter Sterngucker darin wohnten. Du kannst Dir vorstellen, daß eine Stadt, die so in die Luft hinaufgebaut ist, wo immer sechs oder sieben Häuser übereinander stehen, außerordentlich stark bevölkert ist, und wenn sich alle Leute auf die Straße begeben, ein schönes Gewirr herrscht.
Vielleicht glaubst Du's mir nicht: aber in dem Monat, den ich nun hier bin, habe ich noch niemand gehen sehen. Es gibt kein Volk auf der Welt, das seine Bewegungsorgane besser ausnützt, als die Franzosen. Sie laufen, sie fliegen! Die langsamen Wagen des Orients, der gleichmäßige Schritt unserer Kamele würde sie in Krämpfe fallen lassen. Ich, der ich für solch langsames Tempo geschaffen bin und der ich oft zu Fuß gehe, ohne meine gewohnte Langsamkeit zu beschleunigen, werde manchmal rasend wie ein Christ. Es mag noch hingehen, daß man mich vom Kopf bis zu den Füßen vollspritzt, aber die Ellenbogenstöße, die ich mit zuverlässiger Regelmäßigkeit bekomme, kann ich den Parisern nicht verzeihen.
Der König von Frankreich ist der mächtigste Fürst von Europa. Er hat keine Goldminen wie sein Nachbar, der König von Spanien, aber seine Reichtümer sind größer, weil er sie aus der Eitelkeit seiner Untertanen zieht, die unerschöpflicher ist als Bergwerke. Man hat es erlebt, daß er Kriege unternahm, ohne andere Hilfsquellen zu besitzen, als den Verkauf von Titeln, und durch eine Wunderwirkung der menschlichen Eitelkeit waren seine Truppen bezahlt, seine Festungen gerüstet, seine Flotten ausgestattet.
Übrigens ist der König ein großer Zauberer. Sogar über den Geist seiner Untertanen übt er seine Herrschaft und zwingt sie zu denken, wie er will. Wenn er nur eine Million in seinem Schatz, zwei aber nötig hat, braucht er ihnen nur zu sagen, daß ein Taler zwei wert sei, und sie glauben es. Wenn er einen schwierigen Krieg zu führen, aber kein Geld hat, braucht er ihnen nur vorzureden, daß Papier Geld sei, und sie sind alsbald davon überzeugt. Er vermag ihnen sogar einzureden, daß er sie von allen Übeln nur durch seine Berührung heilt, so groß ist seine Gewalt über ihre Seelen.
Was ich von diesem Fürsten sage, darf Dich nicht wundern. Es gibt einen zweiten Zauberer, der noch mächtiger ist als er, der über seine Seele dieselbe Macht ausübt, wie er über die der anderen. Dieser Zauberer heißt der Papst: bald redet er ihm vor, daß drei nur eins sei, daß das Brot, das man ißt, kein Brot, und der Wein, den man trinkt, kein Wein sei, und tausend andere derartige Dinge.
Und um sie immer in Atem zu halten und sie die Gewöhnung des blinden Glaubens nicht verlieren zu lassen, gibt er ihnen, um sie in Übung zu halten, von Zeit zu Zeit gewisse neue Glaubensartikel. So schickte er ihnen vor zwei Jahren ein großes Schriftstück, das er Konstitution nannte, und wollte diesen Herrscher und seine Untertanen unter Androhung großer Strafen zwingen, alles, was darin enthalten war, zu glauben. Gegenüber dem Herrscher gelang ihm das. Dieser unterwarf sich und gab damit seinen Untertanen ein Beispiel. Aber einige von diesen empörten sich und sagten, sie wollten nichts von dem Inhalt dieser Schrift glauben. Die Frauen gaben den Anstoß zu dieser Empörung, die den Hof, das Reich und das ganze Land in zwei Lager teilt. Diese Konstitution verbietet den Frauen, ein Buch zu lesen, das nach Auffassung aller Christen ihnen vom Himmel herab gebracht worden, also genau gesprochen ihr Koran ist. Über diese ihrem Geschlecht zugefügte Kränkung waren die Frauen empört und erhoben sich gegen die Konstitution. Sie haben die Männer auf ihre Seite gebracht, die bei dieser Gelegenheit einmal kein Vorrecht vor ihnen haben wollten. Doch muß man zugestehen, daß dieser Mufti (der Papst) gar nicht so unrecht hat, und, beim großen Ali! er muß das aus unseren Gesetzen entnommen haben. Denn da die Frauen ihrer Erschaffung nach eine Stufe unter uns stehen und unsere Propheten uns sagen, daß sie nicht ins Paradies kommen, was sollen sie da auch ein Buch lesen, das nur geschrieben ist, um den Weg nach dem Paradies zu zeigen?
Ich habe vom König ganz wunderbare Dinge erzählen hören, und ich zweifle nicht, daß Du schwanken wirst, sie zu glauben. Man sagt, daß, als er gegen seine Nachbarn Krieg führte, die sich alle gegen ihn verbündet hatten, in seinem Reiche eine Anzahl unsichtbarer Feinde existierte, die ihn umgaben (die Jansenisten). Man fügt hinzu, daß er sie seit dreißig Jahren sucht und daß trotz des unermüdlichen Eifers einiger sein Vertrauen genießender Derwische (der Jesuiten) er noch nicht einen einzigen hat finden können. Sie leben mit ihm, sie sind an seinem Hofe, in seiner Hauptstadt, in seinem Heere, in seinen Gerichtshöfen, und doch sagt man, wird er den Kummer haben, sterben zu müssen, ohne sie entdeckt zu haben. Man möchte sagen, daß sie nur im allgemeinen, nicht im besonderen existieren, sie sind ein Körper, keine Glieder. Ohne Zweifel will der Himmel diesen Fürsten dafür strafen, daß er nicht maßvoll gegen seine von ihm besiegten Feinde gewesen ist; so gibt er ihm unsichtbare, deren Genie und Schicksal dem seinen überlegen ist.
Der Papst ist das Haupt der Christenheit. Er ist ein altes Idol, das man aus Gewohnheit beweihräuchert. Früher war er selbst den Fürsten gefährlich, denn er setzte sie ebenso ab, wie unsere erhabenen Sultane die Könige von Irimetta und Georgien absetzen. Er nennt sich den Erben eines der ersten Christen, der Sankt Peter hieß, und es handelt sich allerdings um eine reiche Erbschaft, denn er hat unendliche Schätze und ein großes Land unter seiner Herrschaft.
Die Bischöfe sind ihm untergeordnete Autoritäten. Unter seiner Aufsicht haben sie zwei sehr verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Wenn sie versammelt sind, machen sie wie er Glaubenssätze. Wenn sie getrennt sind, haben sie kaum eine andere Aufgabe, als von der Erfüllung des Gesetzes Dispens zu erteilen. Denn Du mußt wissen, daß die christliche Religion mit einer unendlichen Menge sehr schwer erfüllbarer Forderungen beladen ist, und da man gemeint hat, daß es weniger leicht ist, seine Pflichten zu erfüllen, als Bischöfe zu haben, die davon Dispens erteilen, so hat man im Interesse des öffentlichen Nutzens diesen letzteren Ausweg ergriffen. Will man daher den Rahmazan (den Fastenmonat) nicht innehalten, will man sich den Formalitäten der Eheschließung nicht unterwerfen, will man ein Gelübde brechen, will man unter Mißachtung der gesetzlichen Einschränkungen heiraten, manchmal sogar wenn man seinen Eid brechen will, so braucht man nur zum Papst oder zum Bischof zu gehen, der dann Dispens erteilt.
Die Bischöfe machen übrigens die Glaubensartikel nicht selbst. Es gibt eine Anzahl von Doktores, meistens Derwische (d. h. Jesuiten), die unter sich tausend neue Fragen über die Religion aufstellen. Man läßt sie streiten, und der Krieg dauert so lange, bis ein Entscheid ihn beendet.
So kann ich Dir auch versichern, daß es nie ein Reich gegeben hat, wo so viel Bürgerkriege getobt haben wie in Christi Reich.
Die, welche irgend eine neue religiöse Auffassung ans Licht bringen, werden zuerst »Ketzer« genannt. Jede Ketzerei hat ihren besonderen Namen, der für ihre Anhänger gleichsam eine Art Parole bildet. Aber man ist nicht so ohne weiteres Ketzer: man braucht sich nur über den Streitpunkt zu einigen und denen, die die Anklage auf Ketzerei erheben, eine Definition zu geben, und, was das auch für eine Definition ist, verständlich oder nicht, so macht sie ihren Mann weiß wie Schnee und man darf dann hingehen und sich »orthodox« nennen.
Was ich Dir sage, stimmt für Frankreich und Deutschland. In Spanien, so habe ich sagen hören, gibt es gewisse Derwische (die Jesuiten), die keinen Spaß verstehen und die einen Menschen wie Stroh verbrennen. Wenn man in die Hände dieser Leute fällt – glücklich der, der immer zu Gott gebetet hat mit kleinen aufgereihten Holzperlen in der Land, der zwei mit zwei Bändern zusammengeknüpfte Tuchstücke (d. h. ein Skapulier, wie die Mönche es trugen) bei sich getragen hat und der manchmal in einer Provinz gewesen ist, die man Galizien nennt (d. h. der eine Wallfahrt zu dem angeblichen Grabe des Apostels Jakobus in Santiago di Compostella gemacht hat). Ohne das ist ein armer Teufel recht in Verlegenheit. Wenn er auch so aufrichtig schwören würde wie ein Heide, daß er rechtgläubig sei, würde man dennoch an seiner Vollwertigkeit zweifeln und ihn als Ketzer verbrennen.
Ich sehe hier Leute, die ohne Aufhören über die Religion disputieren. Aber es scheint, daß sie gleichzeitig darin wetteifern, wer in ihr am lässigsten zu sein vermöge.
Sie – diese Leute – sind nicht allein keine besseren Christen als die anderen, sie sind nicht einmal bessere Bürger, und das geht mir nahe. Denn in welcher Religion man auch leben mag, der Gehorsam gegen die Gesetze, die Liebe zu seinen Mitmenschen, die Liebe gegenüber seinen Verwandten machen immer die Grundlage jeglicher Religion aus.
Muß denn nicht tatsächlich eines jeden religiösen Menschen erste Pflicht sein, der Gottheit, die seine Religion gegründet hat, zu gefallen? Aber das sicherste Mittel, um das zu erreichen, besteht doch zweifellos darin, daß man die Bestimmungen der Gesellschaft und die Pflichten der Humanität erfüllt. Denn gleichviel in welcher Religion man lebt, man muß, sobald man eine gelten läßt, auch annehmen, daß Gott die Menschen liebt, da er eine Religion begründete, um sie glücklich zu machen; man muß ferner annehmen, daß, wenn er die Menschen liebt, man sicher ist, ihm zu gefallen, wenn man sie gleichfalls liebt, d. h. wenn man ihnen gegenüber alle Pflichten der Mildtätigkeit und Menschlichkeit erfüllt und die Gesetze nicht verletzt, unter denen sie leben.
Dadurch kann man Gott viel sicherer gefallen, als wenn man diese oder jene Zeremonie beobachtet. Denn die Zeremonien an sich haben keinen absoluten Wert. Sie sind gut nur insofern, als Gott sie angeordnet hat. Aber das ist eine schwierige Streitfrage, und man kann sich in ihr leicht irren, denn man muß die Zeremonien einer Religion unter denen von zweitausend auswählen.
Ein Mensch betete alle Tage zu Gott: »Herr, ich verstehe nichts von den Streitereien, die man unaufhörlich über dich erhebt. Ich möchte dir gern nach deinem Willen dienen, doch jeder, den ich befrage, verlangt, daß ich es nach seinem tun soll. Wenn ich bete, weiß ich nicht, in welcher Sprache ich es tun soll. Ich weiß auch nicht, welche Haltung ich annehmen soll: der eine sagt, ich müsse stehend zu dir beten, der andere will, daß ich sitzen soll, der dritte verlangt, daß ich kniee. Das ist noch nicht alles. Manche behaupten, daß ich mich alle Morgen mit kaltem Wasser waschen soll; andere behaupten, daß du mich mit Abscheu ansehen wirst, wenn ich mir nicht ein bestimmtes Stückchen Fleisch abschneiden lasse. Neulich begegnete es mir, daß ich in einem Gasthaus ein Kaninchen verzehrte: drei Männer, die sich in der Nähe befanden, jagten mir einen großen Schrecken ein. Sie behaupteten alle drei, daß ich dich schwer gekränkt hätte: der eine – ein Jude – weil dies Tier unrein wäre; der andere – ein Türke – weil es erstickt wäre; der dritte – ein Armenier – weil es kein Fisch wäre. Ein Brahmane, der vorbeikam und den ich zum Richter nahm, sagte mir: ›Die andern haben unrecht. Denn ersichtlich hast du das Tier nicht selbst getötet!‹ ›Doch!‹ erwiderte ich. ›Ach, dann hast du eine verabscheuenswürdige Tat begangen, die Gott dir nie vergeben wird,‹ sagte er mit strengem Ausdruck zu mir. ›Was weißt du, ob nicht deines Vaters Seele in dies Tier übergegangen war?‹ Alle diese Dinge, Herr, bringen mich in unbeschreibliche Verlegenheit. Ich kann nicht den Kopf drehen, ohne in Gefahr zu geraten, dich zu kränken. Und doch möchte ich dir wohlgefallen und dazu das Leben brauchen, das ich von dir habe. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber es scheint mir, daß das beste Mittel, um zu diesem Ziele zu gelangen, ist, als ein guter Bürger innerhalb der Gesellschaft zu leben, in die du mich durch meine Geburt versetzt, und als guter Vater in der Familie, die du mir gegeben hast!«
Ich muß Dir gestehen, ich habe bei den Christen nicht die lebhafte Überzeugung von der Richtigkeit ihrer Religion beobachtet, die sich bei den Muselmanen findet. Es ist ein weiter Weg bei ihnen von dem Bekenntnis zum Glauben, vom Glauben zur inneren Überzeugung, von der Überzeugung zur Ausübung. Die Religion ist ihnen weniger ein Gegenstand der Heiligung, als ein Gegenstand des Wortstreites für jedermann. Die Hofgesellschaft, die Offiziere, sogar Frauen erheben sich gegen die Vertreter der Kirche und verlangen, daß sie ihnen beweisen sollen, was sie doch von vornherein entschlossen sind, nicht zu glauben. Nicht als ob sie sich aus überlegten Gründen entschieden oder die Mühe gegeben hätten, die Wahrheit oder die Irrigkeit der Religion zu prüfen, die sie verwerfen. Es sind Rebellen, die das Joch gedrückt hat und die es abgeschüttelt haben, ehe sie es recht kannten. Folglich sind sie auch in ihrem Unglauben nicht fester, als sie in ihrem Glauben waren. Sie leben in einem Hin und Her zwischen beiden. Einer von ihnen sagte neulich zu mir: »An die Unsterblichkeit der Seele glaube ich halbjahrweise. Meine Meinungen hängen ganz und gar von meinem körperlichen Befinden ab: je nachdem ich mehr oder weniger stark animalische Bedürfnisse habe, oder mein Magen mehr oder weniger gut verdaut, oder die Luft, die ich atme, schwerer oder leichter ist, die Fleischarten, von denen ich mich nähre, leichter oder schwerer sind, je nachdem bin ich Spinozist, Sozianer, Katholik, gottlos oder fromm. Sitzt der Arzt an meinem Bett, so hat mein Beichtiger leichte Arbeit. Ich weiß es zu verhindern, daß die Religion mir unbequem wird, solange ich mich gesund fühle. Aber ich gestatte ihr, mich zu trösten, wenn ich krank bin: wenn ich von der einen Seite nichts mehr zu hoffen habe, so gewinnt mich die Religion durch ihre Verheißungen. Es ist mir dann schon recht, mich ihr hinzugeben und in ihren Hoffnungen zu sterben.«
Schon vor langer Zeit ließen die christlichen Fürsten alle Sklaven ihrer Länder frei, weil, wie sie sagten, das Christentum alle Menschen gleich macht. Allerdings war diese fromme Handlung für sie zugleich von großem materiellen Nutzen: sie beugten dadurch die großen Herren, deren Macht sie das niedere Volk entzogen. Dann haben sie Eroberungen gemacht in Ländern, wo, wie sie einsahen, die Aufrechterhaltung der Sklaverei ihnen Nutzen versprach. Da gaben sie wieder Erlaubnis zum Sklavenhandel und vergaßen die Grundsätze ihrer Religion, die ihnen angeblich so am Herzen lagen. Was soll ich Dir sagen? Wahrheit heute, morgen Irrtum! Warum machen wir's nicht wie die Christen? Wir Perser sind eigentlich recht töricht, Kolonien und Eroberungen unter glücklicheren Himmelsstrichen abzuweisen, weil dort das Wasser angeblich nicht rein genug ist, um uns darin nach den Vorschriften des Korans zu waschen.
Ich danke Gott dem Allmächtigen, der Ali, seinen großen Propheten, gesandt hat, dafür, daß ich mich zu einer Religion bekenne, die sich höher stellt als alle irdischen Interessen und rein ist wie der Himmel, von dem sie kam.
Wenn es einen Gott gibt, mein lieber Rhedi, so muß er notwendigerweise gerecht sein. Denn wenn er das nicht wäre, so würde er das schlechteste und unvollkommenste aller Wesen sein.
Die Gerechtigkeit ist ein auf Übereinkunft beruhendes Verhältnis, das wirklich zwischen zwei Dingen besteht. Dies Verhältnis ist immer dasselbe, von welchem Standpunkte aus man es auch betrachtet, von dem Gottes, dem eines Engels oder schließlich dem eines Menschen.
Allerdings sehen die Menschen diese Verknüpfung der Dinge nicht immer. Oft sogar, wenn sie sie sehen, kümmern sie sich nicht darum, und ihr eigener Vorteil ist immer das, was sie am deutlichsten sehen. Die Gerechtigkeit erhebt wohl ihre Stimme, aber es wird ihr schwer, sich in dem Lärm der Leidenschaften Gehör zu verschaffen.
Die Menschen können Ungerechtigkeiten begehen, weil sie ein Interesse daran haben, sie zu begehen, und ihre eigene Befriedigung der Beglückung anderer vorziehen. Stets handeln sie aus irgend einer Rücksicht auf sich selbst: um der Sache selbst willen allein ist niemand schlecht. Ein Grund, der sie bestimmt, muß vorhanden sein, und der liegt immer in irgend einem selbstsüchtigen Interesse.
Daß aber Gott etwas Ungerechtes tut, ist nicht möglich. Vorausgesetzt, daß er das Gerechte erkennt, muß er es auch notwendigerweise tun. Denn da er für sich keine Bedürfnisse hat und sich selbst genügt, würde er das schlechteste aller Wesen sein, weil er es ohne eine materielle Rücksicht wäre.
Also, wenn es keinen Gott gäbe, müßten wir immer doch die Gerechtigkeit lieben, d. h. alle unsere Kräfte sammeln, um jenem Wesen zu gleichen, von dem wir eine so vornehme Vorstellung haben und das, wenn es existierte, notwendigerweise gerecht sein müßte. Frei von dem Joch der Religion, wie wir es sein würden, dürften wir es nicht von dem der Gerechtigkeit sein.
Das, lieber Rhedi, hat mich auf den Gedanken geführt, daß die Gerechtigkeit ewig ist und nicht von menschlichen Satzungen abhängt. Und wenn sie davon abhinge, so wäre das eine entsetzliche Tatsache, die man sich gar nicht eingestehen dürfte.
Wir sind von Menschen umringt, die stärker sind als wir. Sie können uns auf tausend verschiedene Arten schaden. Dreimal von viermal können sie es ungestraft tun: Welche Beruhigung für uns, zu wissen, daß es im Herzen aller dieser Menschen ein Prinzip gibt, das zu unseren Gunsten eintritt und uns gegen ihre bösen Absichten deckt!
Ohne das müßten wir in einer unaufhörlichen Angst sein. Wir würden an unsern Mitmenschen vorbeigehen wie an wilden Tieren und wir würden uns nicht einen Augenblick unseres Besitzes sicher fühlen, noch unserer Ehre, noch unseres Lebens.
Alle diese Erwägungen bringen mich gegen jene Gelehrten auf, die Gott als ein Wesen hinstellen, das von seiner Macht einen tyrannischen Gebrauch macht; die ihn in einer Weise handeln lassen, in der wir selbst nicht handeln möchten aus Besorgnis, ihn zu kränken; die ihn mit all den Unvollkommenheiten belasten, die er in uns straft, und die ihn in ihren widerspruchsvollen Äußerungen bald als ein böses Wesen darstellen, bald als eins, das das Böse haßt und straft.
Welche Genugtuung für den sich einer Selbstprüfung unterziehenden Menschen, wenn er sein Herz von Gerechtigkeitsliebe erfüllt findet! Diese Freude, so ernst sie ist, muß überwältigend sein. Er sieht sich ebenso hoch über denen, die nicht so sind, wie er über Tigern und Bären steht. Ja, Rhedi, wenn ich gewiß wäre, stets dieser Gerechtigkeit zu folgen, die mir so deutlich vor Augen steht, würde ich mich für den Ersten aller Menschen halten.
Du weißt, Mirza, daß einige Minister von Cha-Soliman den Plan gefaßt hatten, alle Armenier in Persien zu zwingen, entweder das Königreich zu verlassen oder Mohammedaner zu werden, indem sie meinten, daß unser Reich immer befleckt sein würde, solange es diese Ungläubigen in seinem Schoß behalten würde.
Es wäre um die Größe Persiens geschehen gewesen, wenn der blinde Fanatismus bei dieser Gelegenheit die Oberhand behalten hätte.
Man weiß nicht, warum die Sache mißlang. Weder die, welche den Vorschlag gemacht hatten, noch ihre Gegner hatten Gelegenheit, seine Folgen kennen zu lernen. Der Zufall besorgte die Geschäfte der Vernunft und der Politik und rettete das Reich von einer Gefahr, die größer war als irgend der Verlust einer Schlacht oder die Einbuße zweier Städte.
Durch die Proskription der Armenier fürchtete man, an einem Tage alle Großkaufleute und fast alle Handwerker des Reiches zu vernichten. Ich bin sicher, daß der große Cha-Abas es vorgezogen hätte, sich beide Arme abzuschneiden, als solchen Erlaß zu unterzeichnen. Er hätte gemeint, wenn er seine arbeitsamsten Untertanen dem Mogul und den andern indischen Königen zutriebe, diesen die Hälfte seines Reiches zu schenken.
Die Verfolgungen, denen unsere eifrigen Mohammedaner die Parsen ausgesetzt haben, zwangen sie, massenhaft nach Indien auszuwandern, und beraubten Persien dieses Volkes, das so eifrig im Ackerbau und allein imstande war, durch seinen Fleiß die Unfruchtbarkeit unseres Bodens auszugleichen.
Es blieb dem Fanatismus noch ein zweiter Vorstoß auszuführen, nämlich die Industrie zu vernichten, das beste Mittel, um das Reich völlig niederzuwerfen und mit ihm eben dieselbe Religion, der man zur Blüte und Macht verhelfen wollte.
Wenn man ohne vorgefaßte Meinung an die Frage herantreten will, lieber Mirza, so weiß ich nicht, ob es nicht ein Segen ist, wenn in einem Reiche mehrere Religionen vorhanden sind.
Man macht die Beobachtung, daß die Anhänger geduldeter Religionen sich gewöhnlich ihrem Vaterlande nützlicher erweisen als die Anhänger der herrschenden. Denn, von den Ehrenstellen ausgeschlossen, können sie sich nur durch ihren Reichtum auszeichnen und sind somit darauf angewiesen, solchen durch emsige Arbeit zu erwerben und sich in den mühseligsten Erwerbszweigen zu betätigen.
Da übrigens alle Religionen ohne Unterschied sozial wertvolle Vorschriften enthalten, so ist es gut, wenn sie eifrig gepflegt werden. Welch besseres Mittel gibt es nun aber, um diesen Eifer anzustacheln, als wenn die Vielheit der Religionen ihn zum Wetteifer wandelt?
Das sind Rivalen, die sich nichts nachsehen! Die Eifersucht bemächtigt sich jedes einzelnen, jeder ist auf seiner Hut und scheut sich, Dinge zu tun, die seine Partei schädigen und sie der Verachtung oder unerbittlichen Verurteilung der Gegenpartei aussetzen könnten.
So hat man auch beobachtet, daß die Einführung einer neuen Sekte in einem Staat das sicherste Mittel ist, um alle Mißbräuche der alten zu beheben.
Was will die Behauptung besagen, es sei nicht im Interesse eines Fürsten, mehrere Religionen in seinem Lande zu dulden? Wenn sich alle Sekten der Welt darin sammelten, würde ihm das keinen Schaden tun, weil es keine gibt, die nicht den Gehorsam vorschreibt und nicht die Unterwürfigkeit predigt.
Ich gebe zu, daß die Geschichte voll ist von Religionskriegen. Aber man hüte sich, zu glauben, daß die Vielheit der Religionen diese Kriege hervorgerufen habe! Das war vielmehr immer der Geist der Unduldsamkeit, von dem die sich für herrschend haltende erfüllt war. Das war jener Trieb des Proselytentums, den die Juden von den Ägyptern übernommen haben und der von ihnen wie eine Volkskrankheit auf die Mohammedaner und die Christen übergegangen ist. Das war endlich jener Schwindelgeist, dessen Umsichgreifen nur als eine gänzliche Verdunkelung der menschlichen Vernunft betrachtet werden kann.
Denn schließlich, wenn selbst in der Beunruhigung fremder Gewissen keine Unmenschlichkeit läge, wenn selbst keine der zu tausend daraus hervorkeimenden schlechten Folgen einträte, eins kann niemand übersehen, wenn er anders bei gesundem Verstande ist: wer mich zu einem Religionswechsel veranlassen will, tut es sicherlich nicht, weil er selbst einem solchen Versuche nachgeben würde. Er findet es also sonderbar, daß ich nicht etwas tun mag, was er selbst vielleicht für alle Königreiche der Erde nicht tun würde.
Was denkst Du von den Christen, erhabener Derwisch? Glaubst Du, daß es ihnen am jüngsten Tage so gehen wird wie den ungläubigen Türken, die den Juden als Esel dienen werden, um sie im Galopp in die Hölle zu tragen? Ich weiß wohl, daß sie nicht an den Aufenthaltsort der Propheten kommen werden und daß der große Ali nicht für sie erschienen ist. Aber glaubst Du, daß sie, weil sie bedauerlicherweise keine Moscheen im Lande haben, zu ewigen Strafen verurteilt sein werden, daß Gott sie strafen wird, weil sie eine Religion nicht angenommen haben, die er ihnen gar nicht offenbart hat? Ich kann Dir sagen, ich habe diese Christen oft prüfend ausgeforscht, ob sie von dem großen Ali, dem herrlichsten aller Menschen, eine Vorstellung hätten: ich habe gefunden, daß sie nie von ihm haben reden hören.
Sie gleichen nicht jenen Ungläubigen, die unsere Propheten über die Klinge springen ließen, weil sie sich weigerten, an die Wunder des Himmels zu glauben. Sie sind vielmehr wie jene Unglücklichen, die im Dunkel des Götzendienstes dahinlebten, ehe das göttliche Licht das Antlitz unseres großen Propheten erleuchtete.
Übrigens findet man bei genauerer Prüfung auch in ihrer Religion gleichsam Keime unserer Dogmen. Ich habe oft die geheimen Absichten der göttlichen Vorsehung bewundert, die auf diese Weise der allgemeinen Bekehrung zum Islam den Weg bereiten wollte. Ich habe von einem Buche ihrer Gelehrten, »Die triumphierende Vielweiberei« betitelt, reden hören, in dem bewiesen sei, daß den Christen die Vielweiberei anbefohlen ist. Ihre Taufe ist das Abbild unserer vorgeschriebenen Waschungen, und die Christen irren sich nur hinsichtlich der Wirksamkeit, die sie dieser ersten Waschung geben: sie soll nach ihrer Ansicht alle anderen ersetzen. Ihre Priester und ihre Mönche beten wie unsere siebenmal am Tage. Sie hoffen auf ein Paradies, wo sie durch eine Auferstehung des Körpers tausend Freuden genießen werden. Wie wir, haben sie festgesetzte Fasten, Kasteiungen, mit denen sie das göttliche Erbarmen zu erweichen hoffen. Sie verehren die guten Engel und mißtrauen den bösen. Sie haben eine heilige Gläubigkeit für die Wunder, die Gott durch das Werkzeug seiner Diener vollbringt. Sie erkennen wie wir die Unzulänglichkeit ihrer eigenen Verdienste an und daß sie eines Sachwalters vor Gott bedürfen. Überall finde ich den Mohammedanismus, obschon ich Mohammed selbst nicht sehe. Was hilft es: die Wahrheit macht sich doch immer Bahn und durchbricht die Schatten, die sie umhüllen. Ein Tag wird kommen, wo der Ewige auf Erden nur noch Gläubige sehen wird. Die Zeit, die alles verzehrt, wird auch die religiösen Irrtümer vernichten. Alle Menschen werden erstaunt sein, sich unter demselben Banner zusammenzufinden. Alles, auch das Gesetz, wird erfüllet sein, und seine göttlichen Niederschriften werden aufgehoben werden von Erden, um im himmlischen Archiv niedergelegt zu werden.
In allen Religionen ist man in Verlegenheit, wenn es sich darum handelt, eine Vorstellung von den Freuden zu geben, die der Menschen harren, die tugendhaft gelebt haben. Die Bösen schreckt man leicht durch eine lange Aufzählung der Strafen, die ihnen drohen. Aber was die Guten betrifft, weiß man nicht recht, was man ihnen versprechen soll. Es scheint in der Natur der Freuden zu liegen, daß sie von kurzer Dauer sind. Der Einbildungskraft fällt es schwer, sich andere vorzustellen.
Ich habe Beschreibungen vom Paradies gesehen, die allen vernünftigen Leuten den Geschmack daran verderben könnten: die einen lassen diese glückseligen Schatten den ganzen Tag Flöte spielen, andere verdammen sie zu der Qual, in alle Ewigkeit spazieren zu wandeln; andere endlich, die sie da droben von ihren Geliebten hier auf Erden träumen lassen, haben nicht bedacht, daß hundert Millionen Jahre lang genug sind, um ihnen den Gefallen an diesen verliebten Gedanken gründlich zu benehmen.
Ich entsinne mich bei dieser Gelegenheit einer Geschichte, die ein Mann erzählte, der im Lande des Mogul gewesen war. Sie zeigt, daß die indischen Priester in den Vorstellungen, die sie von den Freuden des Paradieses haben, nicht minder unfruchtbar sind, als die andern.
(Es folgt die Geschichte einer jungverwitweten Indierin, die sich nach altgeheiligter Sitte verbrennen lassen will. Ein Bonze bestärkt sie in diesem Beschluß, indem er ihr das Paradies verheißt. Als dessen höchste Freude weiß er aber nur anzuführen, daß sie dort ihren Mann wiederfinden und mit ihm von neuem eine Ehe eingehen wird. Da ruft sie aus: »Was sagst du? Ich soll meinen Mann wiederfinden? Ach, dann verbrenne ich mich nicht! Er war eifersüchtig, grämlich und übrigens so alt, daß, wenn Brahma ihn nicht umgestaltet hat, er meiner nicht bedarf+... Wenn Brahma mir weiter nichts anzubieten hat, verzichte ich auf diese Glückseligkeit.«)
Die Lebemänner unterhalten hier eine Anzahl von Freudenmädchen, und die Frommen eine unendliche Zahl von Derwischen. Diese Derwische tun drei Gelübde: Gehorsam, Armut und Keuschheit. Man sagt, das erste hielten sie am besten. Vom zweiten kann ich Dir verbürgen, daß es nicht gehalten wird. Aber das dritte – das magst Du Dir selbst denken.
Aber so reich diese Derwische auch sind, sie verzichten nicht auf die Bezeichnung als Arme. Eher würde unser ruhmreicher Sultan auf seine stolzen und erhabenen Titel verzichten. Und sie haben recht: dieser Titel »Arme« bewahrt sie davor, arm zu sein.
Die Ärzte und einige dieser Derwische, die man Beichtväter nennt, sind hier immer entweder zu sehr geachtet oder zu sehr mißachtet. Indessen sagt man, daß die Erben sich eher mit den Ärzten als mit den Beichtvätern zu stellen wissen.
Neulich war ich in einem Kloster dieser Derwische. Einer unter ihnen, verehrungswürdig anzuschauen mit seinen weißen Haaren, empfing mich sehr liebenswürdig. Er zeigte mir das ganze Haus. Dann gingen wir in den Garten und hatten da folgende Unterhaltung.
»Mein Vater,« sagte ich zu ihm, »welche Beschäftigung haben Sie in der Gemeinde?«
»Mein Herr,« antwortete er mir, und seine Miene drückte große Befriedigung über meine Frage aus, »ich bin Kasuist.«
»Kasuist? Seit ich in Frankreich bin, habe ich von diesem Amt noch nicht reden hören.«
»Was, Sie wissen nicht, was ein Kasuist ist? Nun, dann will ich Ihnen eine Vorstellung davon geben, die nichts zu wünschen übrig läßt. Es gibt zwei Arten von Sünden: Todsünden, die durchaus vom Paradies ausschließen, und verzeihliche Sünden, die den lieben Gott zwar auch kränken, aber nicht so sehr, daß er uns deshalb die Seligkeit vorenthielte. Nun besteht unsere ganze Kunst darin, diese beiden Sorten Sünde gut zu unterscheiden. Denn mit Ausnahme einiger Wüstlinge wollen alle Christen ins Paradies kommen, doch möchte es jeder auch so billig wie möglich verdienen. Wenn man nun die Todsünden genau kennt, versucht man, sie nicht zu begehen, und erreicht so seinen Zweck. Es gibt nun auch Menschen, die nach einer so großen Vollkommenheit nicht streben, und da sie keinen Ehrgeiz besitzen, so beanspruchen sie auch nicht grade die ersten Plätze. So genügt es ihnen denn auch, wenn sie grade noch ins Paradies kommen. Wenn sie nur drin sind! Ihr Ziel ist, nicht mehr und nicht weniger zu tun! Das sind Leute, die den Himmel grade noch erschnappen und die zum Herrgott sagen: Herr, ich habe die Bedingungen vorschriftsmäßig erfüllt, du kannst nicht umhin, deine Versprechungen zu erfüllen. Da ich nicht mehr getan habe, als du verlangst, erlasse ich dir auch, mehr zu geben, als du mir versprochen hast. Wir sind also sehr notwendige Menschen, mein werter Herr. Doch ist das noch nicht alles. Ich werde Ihnen noch ganz etwas anderes sagen. Nicht die Handlung macht das Verbrechen aus, sondern die Kenntnis dessen, der es begeht. Wer ein Verbrechen begeht, hat so lange ein reines Gewissen, als er glauben kann, daß es keins ist, und da es eine Unzahl zweideutiger Handlungen gibt, so kann ein Kasuist ihnen einen Grad von Güte geben, den sie nicht haben, wenn er sie für gut erklärt, und vorausgesetzt, daß er davon überzeugen kann, daß sie kein Gift enthalten, so nimmt er es ihnen ganz. Damit teile ich Ihnen das Geheimnis eines Gewerbes mit, in dem ich alt geworden bin. Ich zeige Ihnen seine Feinheiten: Allen Dingen kann man eine Wendung geben, selbst denen, die am wenigsten danach aussehen.«
»Mein Vater,« sagte ich, »das ist alles recht schön. Aber wie finden Sie sich mit dem Himmel ab? Wenn der Sophi an seinem Hof einen Mann hätte, der ihm gegenüber so handelte wie Sie gegenüber Ihrem Gott, der seinen Befehlen die Bedingungslosigkeit nähme, der seine Untertanen belehrte, wann sie dieselben befolgen müssen und wann verletzen dürfen, würde er ihn sofort pfählen lassen.«
Damit grüßte ich meinen Derwisch und verließ ihn, ohne seine Antwort abzuwarten.
Die persischen Frauen sind schöner als die französischen, aber die französischen sind hübscher. Es ist unmöglich, die ersteren nicht zu lieben, unmöglich, sich in der Gesellschaft der letzteren nicht wohlzufühlen. Die einen sind zärtlicher und bescheidener, die anderen lustiger und heiterer.
Was den Perserinnen ein so reines Blut gibt, ist das regelmäßige Leben, das sie führen. Sie spielen nicht, noch durchwachen sie die Nächte, sie trinken keinen Wein und setzen sich der Einwirkung der Luft fast niemals aus. Man muß zugeben, daß das Serail mehr in Rücksicht auf die Gesundheit als für Vergnügungen eingerichtet ist. Das Leben ist dort eintönig und nicht aufregend. Alles atmet Unterordnung und Pflichterfüllung. Selbst die Vergnügungen sind dort ernst und die Freuden streng und man genießt sie fast immer nur als Zeichen des Gehorsams und der Abhängigkeit.
Selbst die Männer in Persien haben nicht die Heiterkeit der Franzosen. Man bemerkt an ihnen nicht die geistige Freiheit noch die Selbstzufriedenheit, die ich hier in allen Kreisen finde.
In der Türkei ist es noch schlimmer, wo man Familien finden könnte, in denen seit Gründung des Reiches von Generation zu Generation niemand gelacht hat.
Dieser Ernst der Asiaten kommt von dem geringen Verkehr, den sie untereinander unterhalten. Sie sehen sich nur, wenn sie zeremoniell dazu gezwungen sind. Freundschaft, diese sanfte Herzensbeziehung, ist ihnen fast unbekannt. Sie ziehen sich in ihre Häuser zurück, wo ihrer immer eine Geselligkeit harrt, so daß jede Familie sozusagen isoliert lebt.
Eines Tages, als ich mich mit einem Franzosen darüber unterhielt, sagte er zu mir: »Was mich am meisten an euren Sitten wundert, ist, daß ihr gezwungen seid, mit Sklaven zu leben, deren Herz und Geist immer von dem Bewußtsein ihrer niederen Stellung beherrscht ist. Diese feigen Leute schwächen in euch das Bewußtsein der natürlichen Tugend und sie zerstören es in euch von eurer Kindheit auf durch ihre Einwirkung.
»Denn, seht nur einmal von euren Vorurteilen ab: was kann man von einer Erziehung erwarten, die solch ein Elender gibt, dessen Ehrenstellung darin besteht, eines anderen Frauen zu bewachen, und der auf die niedrigste Stellung, die es in der Menschheit gibt, stolz ist; der verächtlich ist grade wegen seiner Treue, seiner einzigen Tugend, sofern er an ihr nur aus Neid, Eifersucht und Verzweiflung festhält; der darauf brennt, sich an beiden Geschlechtern zu rächen, deren Auswurf er gleichsam ist, und sich darum von dem stärkeren tyrannisieren läßt, wofern er sich nur an dem schwächeren schadlos halten kann; der den ganzen Glanz seiner Stellung nur seiner Mißgestalt und Häßlichkeit verdankt und darum nur geachtet ist, weil er eigentlich keiner Beachtung würdig ist; der schließlich, für immer an die Pforte geschmiedet, ein härterer Hüter ist als Schlösser und Riegel und sich einer fünfzigjährigen Dienstzeit rühmt, während der er unter dem Druck der Eifersucht seines Herrn seine ganze Niedrigkeit hat ausüben können.«
Es ist eine unter Männern oft erörterte Frage, ob es vorteilhafter ist, den Frauen ihre Freiheit zu lassen, oder sie ihnen zu nehmen. Mir scheint gar mancherlei dafür und dawider zu sprechen. Wenn die Europäer sagen, es sei nicht edelmütig, geliebte Wesen unglücklich zu machen, so antworten wir Asiaten, daß es schwächlich ist, wenn der Mann auf eine ihm von der Natur über die Frauen gegebene Macht verzichtet. Sagt man uns, die große Zahl unter Schloß und Riegel gehaltener Frauen sei unbequem, antworten wir, daß zehn Frauen, die gehorchen, bequemer sind als eine ungehorsame. Wenn die Asiaten ihrerseits einwenden, daß die Europäer mit Frauen, die ihnen nicht treu sind, auch nicht glücklich sein können, so antwortet man ihnen, daß diese von ihnen vielgerühmte Treue keinen Schutz gegen den Überdruß gewährt, der immer nach Sättigung des leidenschaftlichen Begehrens eintritt, daß unsere Frauen uns zu ausschließlich gehören, und ein so ruhiger Besitz uns nichts zu wünschen noch zu fürchten übrig läßt; daß ein wenig Koketterie eine Würze ist, die frisch erhält und das Verderben hindert. Da würde vielleicht ein klügerer Mann wie ich um einen Entscheid in Verlegenheit sein. Denn wenn die Asiaten recht tun, nach den ihre Besorgnisse hebenden Vorsichtsmaßregeln zu suchen, so tun die Europäer ebenso recht, sich keine Sorgen zu machen.
»Schließlich«, so sagen sie, »wenn wir als Gatten unglücklich sein sollten, könnten wir uns immer noch als Liebhaber trösten. Damit ein Mann sich mit vollem Recht über die Untreue seiner Frau beklagen könnte, dürfte es im ganzen nur drei Menschen auf der Welt geben, sobald es vier gibt, ist immer ein Ausgleich möglich.«
Eine andere Frage ist, ob ein Naturgesetz die Frauen den Männern unterordnet. »Nein,« sagte mir neulich ein sehr galanter Denker, »die Natur hat niemals ein solches Gesetz gegeben. Die Herrschaft, die wir über sie ausüben, ist eine wahre Tyrannei. Sie haben sie uns ergreifen lassen, weil sie sanfter sind als wir und darum menschlicher und vernünftiger. Diese Vorzüge, die ihnen ohne Zweifel eine Überlegenheit verleihen müßten, wenn wir vernünftig und gerecht gewesen wären, haben sie diese verlieren lassen, weil wir das nicht sind.
»Wenn daher das eine wahr ist, daß wir über die Frauen nur eine tyrannische Macht ausüben, so ist auch das andere wahr, daß sie über uns eine natürliche Macht besitzen, nämlich die der Schönheit, der nichts widersteht. Unsere findet sich nicht in allen Ländern, die der Schönheit ist allgemein. Warum sollten wir denn auch ein Vorrecht vor den Frauen haben? Weil wir die Stärkeren sind? Aber das ist ja dann die reine Ungerechtigkeit! Wir gebrauchen alle erdenklichen Mittel, um ihnen jeden eigenen Antrieb zu nehmen. Die Kräfte würden gleich sein, wenn die Erziehung der beiden Geschlechter die nämliche wäre. Prüfen wir sie in den Gaben, welche die Erziehung nicht geschwächt hat, und wir werden ja sehen, ob wir wirklich so stark sind.«
Neulich hatte ich meinen großen Spaß in einer Gesellschaft, in der ich war. Es befanden sich dort Damen in jedem Alter; eine von achtzig, eine von sechzig und eine von vierzig Jahren, die eine Nichte von zwanzig bis zweiundzwanzig hatte. Ein gewisser, verständlicher Instinkt trieb mich zuerst in die Nähe der jüngsten. Da flüsterte sie mir zu: »Was sagen Sie von meiner Tante, die in ihrem Alter noch nach Liebesabenteuern ausschaut und die Hübsche spielt?« – »Sie tut darin unrecht,« erwiderte ich, »solche Absichten stehen nur Ihnen an.« Einen Augenblick darnach befand ich mich neben ihrer Tante, die zu mir sagte: »Was sagen Sie von jener Frau, die mindestens sechzig Jahre alt ist, und dabei heute mehr als eine Stunde mit ihrem Putz zugebracht hat?« – »Das ist verlorene Mühe,« sagte ich, »man muß Ihre Reize haben, um an so etwas denken zu dürfen.« Dann ging ich zu jener bedauernswerten Sechzigjährigen und beklagte sie in meiner Seele, als sie mir ins Ohr flüsterte: »Gibt es was Lächerlicheres? Sehen Sie nur die achtzigjährige Dame dort mit ihren feuerroten Bändern; sie möchte jung aussehen, und das gelingt ihr auch wirklich, denn das grenzt an Kindlichkeit!«
Lieber Gott! sagte ich zu mir selber, bemerken wir denn Lächerlichkeiten immer nur an anderen? Vielleicht ist es ein Glück, fügte ich hinzu, daß wir in den Schwächen anderer einen Trost finden. Jedoch, einmal im Zuge, beschloß ich, meine belustigende Wanderung einmal umgekehrt zu machen und mit der Ältesten anzufangen: »Gnädige Frau, Sie sehen der Dame, mit der ich eben gesprochen habe, so ähnlich, daß man Sie für Schwestern halten möchte, und ich glaube, Sie sind wohl ungefähr gleich alt?« – »Allerdings,« sagte sie zu mir, »wenn die eine stirbt, wird die andere einen Schreck bekommen dürfen. Ich glaube kaum, daß wir im Alter um zwei Tage verschieden sind.« Sobald ich diese Altersschwache festgelegt hatte, ging ich zu der Sechzigjährigen: »Sie müssen eine Wette entscheiden, gnädige Frau! Ich habe gewettet, daß Sie und jene Dame« – damit zeigte ich auf die Vierzigjährige – »gleichaltrig wären.« »Ich glaube allerdings,« sagte sie, »daß wir kaum ein Halbjahr auseinander sind.« Schön! Weiter! Und nun ging ich zu der Vierzigjährigen. »Gnädigste Frau, sagen Sie mir doch gütigst, ob es ernst zu nehmen ist, wenn Sie das junge Mädchen da am anderen Ende des Tisches Ihre Nichte nennen? Sie sind ebenso jugendlich wie sie; sie hat sogar etwas Verblühtes in den Zügen, das Sie nicht haben, und Ihre lebhaften Farben+...« – »Warten Sie«, sagte sie. »Ich bin allerdings ihre Tante; aber ihre Mutter war mindestens fünfundzwanzig Jahre älter als ich – wir stammten nicht aus derselben Ehe. Ich habe meine verstorbene Schwester sagen hören, daß ihre Tochter und ich im selben Jahre geboren sind.« – »Na, das dachte ich mir, gnädige Frau, und ich hatte also nicht unrecht, mich zu wundern!«
Mein lieber Usbek, die Frauen, die fühlen, wie es mit ihnen und ihren Reizen gleichzeitig zu Ende geht, möchten gern wieder jung sein. Warum sollten sie auch nicht die andern Menschen zu täuschen suchen, da sie sich doch alle Mühe geben, um sich selbst zu täuschen und der trübseligsten aller Vorstellungen zu entgehen?
Die Franzosen sprechen fast niemals von ihren Frauen: sie haben nämlich Furcht, von ihnen vor Leuten zu sprechen, die sie besser kennen, als sie selbst.
Es gibt unter ihnen sehr unglückliche Leute, die niemand tröstet: das sind die eifersüchtigen Gatten. Es gibt welche, die alle Welt haßt: das sind auch die eifersüchtigen Gatten. Es gibt andere, die alle Männer verachten: das sind ebenfalls die eifersüchtigen Gatten.
So gibt es denn auch kein Land, wo ihre Zahl so klein ist, wie in Frankreich. Ihre Ruhe ist nicht etwa in dem Vertrauen begründet, das sie zu ihren Frauen haben: im Gegenteil, auf der schlechten Meinung, die sie von ihnen hegen. Alle weisen Vorsichtsmaßregeln der Asiaten, die Schleier, die sie verstecken, die Gefängnisse, in denen wir sie halten, die Bewachung durch Eunuchen, scheinen ihnen Mittel, welche geeigneter sind, die Erfindsamkeit dieses Geschlechtes zu reizen und zu steigern, als sie zu ermüden. Hier finden sich die Gatten in ihre Lage und betrachten eheliche Untreue als eine unvermeidliche Schickung der Sterne. Ein Gatte, der seine Frau für sich allein beanspruchen wollte, würde als ein Störenfried der öffentlichen Freude angesehen werden, als ein Unsinniger, der sich des Sonnenlichtes unter Ausschluß der übrigen Menschen erfreuen wollte.
Hierzulande ist ein Mann, der seine Frau allein liebt, einer, der nicht Vorzüge genug besitzt, um sich auch noch die Liebe einer zweiten zu erringen; der den gesetzlichen Zwang mißbraucht, um die ihm fehlenden angenehmen Eigenschaften zu ersetzen; der alle seine Vorteile zum Nachteile einer ganzen Gesellschaft ausnützt; der sich aneignet, was ihm nur als Pfand anvertraut ist; der nach Kräften darauf hinarbeitet, eine stillschweigende Abmachung zu umgehen, die das Glück beider Geschlechter ausmacht. Den Titel »Gatte einer hübschen Frau«, den man in Asien so sorgfältig verbergen wird, trägt man hier ohne Besorgnis. Man fühlt sich berechtigt, sich jede beliebige Nebenzerstreuung zu gönnen. Ein Fürst tröstet sich für den Verlust einer Festung durch die Einnahme einer anderen.
Ein Gatte, der im allgemeinen die ehelichen Untreuen seiner Frau duldet, findet keine Mißbilligung. Im Gegenteil: man lobt seine Klugheit. Nur die einzelnen Fälle werfen einen Fleck auf die Ehre.
Nicht als ob es hier keine tugendhaften Frauen gäbe, und man kann sagen, daß sie ausgezeichnet werden durch die allgemeine Achtung. Mein Führer machte mich immer auf sie aufmerksam. Aber sie waren alle so häßlich, daß man ein Heiliger sein müßte, um die Tugend nicht zu hassen.
Nach dem, was ich Dir von den Sitten dieses Landes gesagt habe, kannst Du Dir leicht vorstellen, daß die Franzosen auf Beständigkeit keinen großen Wert legen. Sie meinen, daß es ebenso töricht ist, einer Frau ewige Liebe zu schwören, wie zu behaupten, daß man nie krank werden könne, oder immer glücklich bleiben müsse. Wenn sie einer Frau ewige Liebe zusichern, setzen sie voraus, daß sie ihrerseits verspricht, immer liebenswert zu bleiben, und wenn sie ihr Wort bricht, halten sie sich an das ihre auch nicht länger für gebunden.
Ich finde die Launen der Mode bei den Franzosen erstaunlich. Sie haben schon vergessen, wie sie sich im Sommer trugen, sie wissen noch nicht, wie sie im Winter gehen werden. Aber besonders ist es kaum glaublich, was es einen Mann kostet, seine Frau immer modern zu kleiden.
Was würde mir eine genaue Schilderung ihrer Kleidung nützen und ihres Schmuckes? Eine neue Mode würde mein Werk zerstören, wie das ihrer Arbeiter, und ehe Du meinen Brief erhieltest, wäre alles verändert.
Eine Frau, die Paris verläßt, um ein Halbjahr auf dem Lande zuzubringen, kommt ebenso unmodern zurück, als wenn sie 30 Jahre draußen verschlafen hätte. Der Sohn würde das Bild seiner Mutter nicht wiedererkennen, so fremd würde ihn das Kleid, in dem sie gemalt wurde, anmuten: er müßte denken, daß das Bild irgendeine Indianerin vorstelle, oder daß der Maler irgendeinem seiner phantastischen Einfälle Gestalt gegeben habe.
Manchmal steigt die Haartracht unmerklich hinauf, bis eine Revolution sie plötzlich wieder hinunterdrückt. Es gab eine Zeit, wo ihre gewaltige Höhe das Antlitz einer Dame in die Mitte ihrer Gestalt versetzte; zu einer anderen nahmen die Füße diese Stelle ein: die hohen Hacken bildeten ein Piedestal, das sie in die Luft hob. Wer sollte es glauben: die Baumeister sind oft gezwungen gewesen, die Türen zu erhöhen, zu erniedrigen, zu verbreitern, je nachdem der Schmuck der Frauen eine Veränderung verlangte, und die Gesetze ihrer Kunst haben sich diesen Launen unterwerfen müssen. Manchmal sieht man auf einem Gesicht eine unglaubliche Menge von Schönheitspflästerchen, Fliegen genannt, und der nächste Tag läßt sie alle verschwinden. Ehemals hatten die Frauen eine Taille, heute redet kein Mensch mehr davon. Bei diesem wetterwendischen Volke sind – was auch die Spötter sagen mögen – die Töchter anders gebaut als die Mütter.
Mit den Manieren und der Lebensweise ist es nicht anders wie mit den Moden. Die Franzosen wechseln die Sitten nach dem Lebensalter ihres Königs. Dem Monarchen könnte selbst das Kunststück gelingen, seinem Volke Ernst zu geben, wenn er's unternähme. Der Fürst drückt seines Geistes Stempel dem Hofe auf, der Hof der Stadt, die Stadt den Provinzen. Die Seele des Fürsten ist eine Form, die allen andern Seelen ihre Gestalt gibt.
Die Rolle einer hübschen Frau ist viel schwerer, als man denkt. Es gibt nichts Wichtigeres als die Vorgänge morgens bei ihrer Toilette inmitten ihrer Zofen: ein kommandierender General verwendet nicht mehr Aufmerksamkeit darauf, seinem rechten Flügel oder seiner Reserve einen richtigen Platz anzuweisen, als sie gebraucht, ein Schönheitspflästerchen unterzubringen, das fehlen kann, dessen Erfolg sie aber hofft oder voraussieht.
Welche geistige Qual, welche Aufmerksamkeit, um unaufhörlich die Ansprüche zweier Nebenbuhler auszugleichen, um allen beiden neutral zu erscheinen, während sie sich beiden hingibt, um alle Anlässe zur Klage, die sie ihnen abwechselnd gibt, gütlich zu beseitigen!
Welche Aufgabe, die verschiedenen Vergnügungen in richtige Ordnung und erfreulichen Wechsel zu bringen und allen Zufälligkeiten vorzubeugen, die sie unmöglich machen könnten!
Bei all dem ist ihre höchste Sorge nicht, sich wirklich zu unterhalten, sondern nur den Eindruck zu erwecken, als wenn sie sich amüsierten. Langweile die Damen, soviel du willst, das werden sie dir verzeihen, vorausgesetzt nur, daß man glaubt, sie unterhielten sich ausgezeichnet.
Ich war vor einigen Tagen auf dem Lande zu einem Souper, das von Damen gegeben wurde. Unterwegs sagten sie unaufhörlich: mindestens müssen wir uns recht belustigen!
Unsere Gesellschaft war aber ziemlich ungeschickt zusammengesetzt und es herrschte darum ein ziemlich steifer und langweiliger Ton. Da sagte eine der Damen: »Man muß gestehen, daß wir uns gut unterhalten; es gibt in ganz Paris keine so lustige Gesellschaft wie wir.« Da die Langweile mich überkam, schüttelte mich eine Dame und sagte: »Nun, sind wir nicht in guter Stimmung?« – »Ja,« antwortete ich gähnend, »nächstens, glaube ich, platze ich vor Lachen.« Jedoch behielt die Trübseligkeit trotz aller gegenteiligen Bemerkungen die Oberhand und ich versank von Gähnen zu Gähnen in einen lethargischen Schlaf, der all meinem Vergnügen ein Ende setzte.
Es macht den Eindruck, als wenn hier jedes einzelne Familienmitglied für sich allein verantwortlich sei. Der Gatte hat nur einen Schatten von Autorität über seine Frau, der Vater über seine Kinder, der Herr über seine Diener. Die Justiz mischt sich in alle ihre Streitigkeiten, und du kannst sicher sein, daß sie immer gegen den eifersüchtigen Gatten ist, gegen den gekränkten Vater, gegen den unbequemen Herrn.
Ich ging neulich nach dem Gebäude, wo Recht gesprochen wird. Ehe man hinkommt, muß man durch das Kreuzfeuer einer unendlichen Schar junger Verkäuferinnen hindurch, die einen mit trügerischer Stimme anlocken. Dies Schauspiel ist zuerst ziemlich heiter. Aber es wird düster, sobald man die großen Säle betritt, wo man nur Leute mit noch ernsterem Gesicht als Kleidung sieht. Endlich kommt man an die heilige Stätte, wo alle Familiengeheimnisse ausgekramt und wo die verborgensten Handlungen an das Tageslicht gezerrt werden.
Da erscheint ein bescheidenes Mädchen und trägt alle die Beunruhigungen einer zu lange gewahrten Jungfernschaft vor, ihre Kämpfe und ihren schmerzvollen Widerstand. Sie ist auf ihren Sieg so wenig stolz, daß sie immer mit einer nahen Niederlage droht, und damit ihr Vater ihre Bedürfnisse nicht länger nicht kenne, setzt sie sie dem ganzen Volke auseinander.
Eine schamlose Frau erzählt darauf die Kränkungen, die sie der Ehre ihres Mannes angetan hat, wie ebensoviel Gründe, um von ihm die Scheidung zu erlangen.
Mit gleicher Bescheidenheit kommt eine andere und sagt, daß sie es überdrüssig sei, den Titel einer Frau zu führen, ohne deren Rechte zu genießen. Sie enthüllt die Geheimnisse, die in der Nacht der Ehe verborgen sind. Sie verlangt, daß man ihren Körper den Blicken der geschicktesten Sachverständigen aussetzen soll, und daß ein Richterspruch sie in alle Rechte der Jungfräulichkeit wieder einsetze.
Eine unendliche Schar geraubter oder verführter Mädchen stellen die Männer viel schlechter dar, als sie sind. Die Liebe ist es, von der dieser Gerichtshof wiedertönt. Man hört da von nichts sprechen als von hintergangenen Vätern, betrogenen Töchtern, untreuen Geliebten und bekümmerten Gatten.
Nach dem geltenden Gesetz wird jedes während der Ehe geborene Kind als Kind des Gatten betrachtet; er mag noch so gute Gründe haben, das nicht zu glauben, das Gesetz glaubt es an seiner Statt und überhebt ihn aller Nachprüfung und Bedenken.
Vor diesem Gerichtshof gilt die Majorität der Stimmen als entscheidend. Doch sagt man, die Erfahrung habe gelehrt, daß man besser nach der Minorität gehen würde. Und das ist ziemlich natürlich. Denn es gibt sehr wenige richtig denkende Geister und allgemein weiß man, daß es eine unendliche Zahl von falsch urteilenden gibt.
(Aus einer längeren Untersuchung über die Gründe der angeblichen Entvölkerung der ehemals unter römischer Herrschaft befindlichen Länder.)
Die Ehescheidung war in der heidnischen Religion erlaubt, sie wurde den Christen verboten. Diese Änderung, die anfangs von geringer Tragweite schien, hatte allmählich die schrecklichsten Folgen und solche, an die man nie gedacht hätte.
Auf eine so freie Handlung, an der das Herz so großen Anteil haben soll, legte man den Zwang, die Nötigung, und die Unabänderlichkeit des Geschickes selbst. Für nichts rechnete man die gegenseitige Abscheu, die Launen und die Unverträglichkeit der Charaktere. Das Herz wollte man fesseln, das Veränderlichste und Unbeständigste, was es in der Natur gibt. Man band aneinander ohne jede Möglichkeit noch Aussicht auf Änderung Menschen, die einander nicht mochten und fast immer schlecht zueinander paßten, und man handelte damit nicht anders als jene Tyrannen, die Lebende an Leichname ketteten.
Nichts trug mehr zur wechselseitigen Zuneigung bei als die Leichtigkeit der Ehescheidung. Gatte und Gattin waren geneigter, geduldig die Lasten des Haushaltes zu tragen, da sie wußten, daß es in ihrer Macht stand, ihnen ein Ende zu setzen, und sie bewahrten diese Macht oft ein ganzes Leben hindurch in ihren Händen, ohne sie zu benützen, allein in der Erwägung, daß es ihnen freistände, das zu tun.
Da Deine Tochter ihr siebentes Jahr erreicht hat, habe ich es für angezeigt gehalten, sie in die inneren Gemächer des Serails zu geben und nicht ihr zehntes Jahr abzuwarten, um sie den schwarzen Eunuchen zu übergeben. Man kann ein junges Mädchen nicht früh genug ihrer Kinderfreiheit berauben und ihr eine gottgefällige Erziehung in den heiligen Mauern geben, wo die Scham wohnt.
Denn ich bin nicht der Meinung jener Mütter, die ihre Töchter erst dann einschließen, wenn sie ihnen demnächst einen Mann geben wollen, die sie zum Serail viel mehr verurteilen, als sie ihm weihen, und sie gewaltsam zwingen, ein Leben zu führen, zu dem sie ihnen allmählich Liebe hätten einflößen sollen. Darf man denn alles von der Gewalt der Vernunft und nichts von dem sanften Zwang der Gewohnheit erwarten?
Vergeblich spricht man uns von der Unterordnung, in die die Natur uns Frauen verwiesen habe. Es genügt nicht, wenn wir sie fühlen, wir müssen sie auch anerkennen und üben, damit sie uns in der bedenklichen Zeit aufrecht erhält, wo die Leidenschaften erwachen und uns zur Unabhängigkeit aufreizen.
Wenn wir an euch Männer nur durch das Pflichtgefühl gebunden wären, könnten wir uns manchmal vergessen, wenn nur durch die Neigung, könnte diese einer stärkeren erliegen. Aber wenn uns die Gesetze einem Manne geben, entziehen sie uns allen andern, und halten uns so fern von ihnen, als lägen hunderttausend Meilen zwischen uns.
Die Natur, die zugunsten der Männer überhaupt erfinderisch gewesen ist, hat sich nicht darauf beschränkt, ihnen sinnliches Begehren zu geben. Sie hat gewollt, daß auch wir solches Begehren empfinden und die lebendigen Werkzeuge ihrer Befriedigung sein sollten. Uns hat sie in das Feuer der Leidenschaften versetzt, damit die Männer in Ruhe leben könnten. Wenn sie aus ihrer gewöhnlichen Gefühllosigkeit heraustreten, so hat uns die Natur dazu bestimmt, sie ihnen wieder zurückzugeben, ohne daß wir je selbst den glücklichen Zustand genießen können, den wir ihnen verschaffen.
Indessen, lieber Usbek, bilde Dir nicht ein, daß Deine Lage glücklicher sei, als meine. Ich habe hier tausend Freuden genossen, die Du nicht kennst. Meine Phantasie hat sie mich unaufhörlich in ihrem Wert erkennen lassen: ich habe gelebt, Du hast nur Dich gesehnt.
Selbst in dem Gefängnis, in dem Du mich hältst, bin ich freier als Du. Du kannst Deine Vorkehrungen, um mich zu bewachen, nicht verstärken, ohne daß ich meine Freude an Deinen Besorgnissen habe, und Deine Verdächtigungen, Deine Eifersucht, Dein Liebeskummer sind alles Zeichen Deiner Abhängigkeit.
Fahre nur so fort, teurer Usbek, laß mich Tag und Nacht bewachen, verlaß Dich nicht auf die üblichen Vorsichtsmaßregeln; vermehre mein Glück, indem Du das Deine sicherst, und sei überzeugt, daß ich nichts fürchte außer Gleichgültigkeit von Dir.

Ich besuchte neulich eine große Bibliothek in einem Kloster von Derwischen, die gleichsam ihre verantwortlichen Bewahrer sind, aber die Verpflichtung haben, zu gewissen Stunden jedermann hereinzulassen.
Beim Eintritt erblickte ich einen ernsten, würdigen Herrn, der inmitten einer unendlichen Zahl von Büchern, die ringsherum standen, auf und nieder ging. Ich trat auf ihn zu und bat ihn, mir zu sagen, was das für Bücher wären, die mir unter den andern durch ihren bessern Einband auffielen. »Mein Herr,« sagte er, »ich bewohne hier ein fremdes Land: ich kenne hier niemand. Viele Leute stellen mir ähnliche Fragen. Aber Sie sehen wohl ein, daß ich nicht alle die Bücher lesen werde, um sie zufrieden zu stellen. Ich habe meinen Bibliothekar, der Ihnen Rede stehen wird. Denn er beschäftigt sich Tag und Nacht damit, alles, was Sie da sehen, zu entziffern. Er ist sonst zu nichts nutze und uns eine rechte Last, weil er nicht fürs Kloster arbeitet. Doch ich höre die Refektoriumsstunde schlagen. Solche Leute, die wie ich an der Spitze einer Gemeinde stehen, müssen bei allen Übungen die ersten sein.« Indem er dies sagte, schob mich der Mönch zur Tür hinaus, schloß sie hinter mir und verschwand so eilig vor meinen Augen, als wenn er gestohlen hätte.
Am andern Morgen ging ich wieder nach dieser Bibliothek und fand diesmal einen ganz anderen Mann als das erstemal. Sein Äußeres war sehr schlicht, sein Gesicht geistvoll und sein Benehmen liebenswürdig entgegenkommend. Sobald ich ihm meinen neugierigen Wunsch kundgegeben hatte, war er diensteifrig bereit, ihn zu erfüllen und mich sogar, sofern ich ein Fremder war, zu unterweisen.
»Mein Vater,« sagte ich zu ihm, »was sind das für dicke Bände, die die eine ganze Seite der Bibliothek einnehmen?« – »Das sind die Erklärer der Schrift.« – »Deren gibt es ja eine große Zahl,« fuhr ich fort, »die Heilige Schrift muß früher sehr dunkel gewesen sein, und jetzt sehr klar. Bleiben noch einige Zweifel? Gibt es noch umstrittene Punkte?« – »Ob es welche gibt! Du lieber Gott! Ob es welche gibt,« antwortete er mir, »es gibt fast ebensoviel wie's Zeilen gibt!« – »Ja?« sagte ich, »und was haben denn alle diese Autoren da gemacht? – »Diese Autoren«, antwortete er, »haben in der Schrift nicht gesucht, was man glauben muß, sondern was sie selber glauben. Sie haben sie nicht als ein Buch betrachtet, das die Dogmen enthielt, die man annehmen muß, sondern als ein Werk, das ihren eigenen Meinungen Autorität verleihen könnte. Zu dem Zweck haben sie überall den Sinn verdreht und allen Stellen Gewalt angetan. Die Schrift ist gleichsam ein Land, wo alle Sekten anlanden und plündern; ein Schlachtfeld, wo die sich begegnenden feindlichen Parteien sich sehr viele Schlachten liefern, wo man sich angreift, wo man scharmützelt auf mancherlei Weisen.
»Dicht da neben Ihnen stehen die aszetischen oder Erbauungsbücher. Dann die Bücher über Sittenlehre, die viel nützlicher sind. Die theologischen, die zwiefach unverständlich sind, einmal durch den behandelten Gegenstand, ferner durch die Art seiner Behandlung. Dann die Werke der Mystiker, d. h. der Frommen, die zarten Gemütes sind.« – »O, mein Vater,« sagte ich, »einen Augenblick! Nicht so schnell! Sprechen Sie mir von diesen Mystikern.« – »Mein Herr,« antwortete er, »die fromme Hingabe erhitzt ein Herz, das leicht zur Rührung neigt, so, daß es Dünste in das Gehirn emporsendet, die dies gleichfalls erhitzen, und daraus entstehen Ekstasen und Verzückungen. Dieser Zustand ist das Delirium der Frömmigkeit. Oft vervollkommnet es sich, oder entartet vielmehr zum Quietismus: Sie wissen, daß ein Quietist nichts anders ist als ein Mensch, der zugleich verrückt, fromm und ausschweifend ist.
»Da sehen Sie die Kasuisten, die die Geheimnisse der Nacht an den Tag ziehen, die in ihrer Einbildungskraft alle die Ungeheuer formen, welche der Dämon der Liebe erzeugen kann, die sie sammeln, vergleichen und zum unablässigen Gegenstand ihrer Gedanken machen. Glücklich, wenn das Herz nicht mitzureden beginnt und nicht mitschuldig wird an so viel naiv beschriebenen und in aller Nacktheit dargestellten Verirrungen!
»Sie sehen, lieber Herr, daß ich frei denke und Ihnen frei sage, was ich denke. Ich bin von Natur arglos und besonders mit Ihnen, der Sie ein Fremder sind und die Dinge kennen lernen wollen, und zwar so wie sie wirklich sind. Wenn ich wollte, würde ich von alldem zu Ihnen nur mit Bewunderung sprechen. Ich würde unaufhörlich sagen: Das ist göttlich, das ist bewunderungswürdig! Da liegt ein Wunder drin! Und dann würde von zwei Folgen sicher eine eintreten: entweder würde ich Sie täuschen oder ich würde mich vor Ihrer Seele entehren.«
Weiter kamen wir nicht. Der Derwisch wurde durch eine Angelegenheit unterbrochen, die die Fortsetzung unsrer Unterhaltung auf den nächsten Tag verschob.
Ich kam zur festgesetzten Stunde wieder und mein Mann führte mich grade an die Stelle, wo wir uns gestern getrennt hatten. »Hier«, sagte er, »kommen nun die Grammatiker, die Glossographen und die Kommentatoren.« – »Ehrwürdiger Vater,« unterbrach ich ihn, »können denn alle diese Leute nicht einfach auf den gesunden Menschenverstand verzichten?« – »Ja,« sagte er, »das können sie, und man merkt es sogar nicht einmal. Ihre Werke sind darum nicht schlechter – was sehr bequem für sie ist.« – »Allerdings,« sagte ich, »ich kenne viele Philosophen, die gut tun würden, derartigen Wissenschaften sich zu widmen.«
»Hier«, fuhr er fort, »kommen die Redner, die die Gabe haben, unabhängig von guten Gründen zu überzeugen, und die Mathematiker, die einen Menschen auch gegen seinen Willen überzeugen und ihn mit wahrer Tyrannei überreden.
»Das sind die Bücher der Metaphysik, die so hochwichtige Fragen behandeln und in denen man bei Schritt und Tritt auf das Ewige stößt; die Bücher über Naturwissenschaft, die in dem Haushalt des gewaltigen Weltalls nichts Wunderbareres finden als in der einfachsten Maschine unserer Arbeiter.
»Die medizinischen Bücher, diese Denkmäler der Gebrechlichkeit der Natur und der Macht der Kunst, die erschüttern, selbst wenn sie von den leichtesten Krankheiten handeln, so nahe rücken sie uns den Tod vor Augen; die uns aber in vollkommene Sicherheit wiegen, wenn sie von der Kraft der Heilmittel sprechen, als wenn wir unsterblich geworden wären.
»Dicht daneben stehen die anatomischen Lehrbücher, die viel weniger eine Beschreibung der menschlichen Körperteile enthalten, als die barbarischen Namen, die man ihnen gegeben hat – eine Sache, die weder den Kranken von seiner Krankheit noch den Arzt von seiner Unwissenheit heilt.
»Hier kommt die Alchimie, die bald in Krankenhäusern, bald in Irrenhäusern wohnt, Wohnungen, die ihr beide gleich gut anstehen.
»Das hier sind die Bücher der geheimen Kunde oder vielmehr Unkunde. Dazu gehören die, welche irgend eine Art Teufelswerk enthalten, fluchwürdig nach mancher Leute Meinung, erbarmungswürdig nach der meinen. Dahin gehören auch die Bücher der Astrologie.« – »Was sagen Sie, mein Vater? Die Bücher der Astrologie!« unterbrach ich ihn mit Feuer. »Das sind die, welche wir bei uns in Persien am höchsten schätzen. Sie regeln alle Wandlungen unseres Lebens, sie bestimmen uns in allen Unternehmungen. Die Astrologen sind recht eigentlich unsere Leiter; mehr noch, sie gehören mit zur Staatsregierung.« – »Wenn dem so ist,« sagte er zu mir, »so lebt ihr unter einem härteren Joche, als das der Vernunft ist. Das ist das seltsamste aller Reiche: ich beklage tief jede Familie und mehr noch ein Volk, das sich von den Planeten lenken läßt.« – »Wir bedienen uns«, erwiderte ich, »der Astrologie wie Sie der Algebra. Jede Nation hat ihre Wissenschaft, nach der sie ihre Politik regelt. Alle Astrologen zusammen haben bei uns in Persien nicht so viel Dummheiten begangen, wie ein einziger eurer Algebristen bei euch angerichtet hat. Glauben Sie, daß die zufälligen Stellungen der Sterne nicht eine ebenso verläßliche Regel geben, wie die schönen Berechnungen Ihrer Systemmacher? Wenn man diese Frage in Frankreich und in Persien zur Abstimmung stellte, würde die Astrologie triumphierend daraus hervorgehen, und Ihre Rechenkünstler würden sehr beschämt werden. Welche überwältigenden Folgerungen könnte man nicht daraus gegen sie ziehen!«
Hier wurde unsere Unterhaltung unterbrochen und wir mußten uns trennen.
Bei meinem nächsten Besuch führte mich mein gelehrter Bibliothekar in ein besonderes Zimmer.
»Hier stehen«, sagte er, »die Bücher über moderne Geschichte. Sehen Sie hier zuerst die Geschichtsschreiber der Kirche und der Päpste, Bücher, die ich lese, um mich zu erbauen, die aber manchmal in mir eine ganz gegenteilige Wirkung hervorrufen.
»Da stehen die, welche über den Verfall des gewaltigen Römerreiches geschrieben haben, das sich aus den Trümmern so vieler anderer Reiche bildete und aus dessen eigenen Trümmern so viele neue entstanden. Eine unendliche Zahl barbarischer Völker, die ebenso unbekannt waren wie die von ihnen bewohnten Länder, tauchten plötzlich auf, überschwemmten, verwüsteten, zerstückelten das Römerreich und gründeten all die Reiche, die Sie jetzt in Europa sehen. Diese Völker waren nicht im eigentlichen Sinne barbarisch, da sie frei waren. Doch sind sie es seitdem geworden in dem Maße, wie sie sich einer absoluten Regierung unterwarfen und die süße Freiheit verloren, die der Vernunft, der Menschenwürde und der Natur entspricht.
»Hier sehen Sie die Historiker des Deutschen Kaiserreiches, das nur ein Schatten des ersten Reiches ist. Doch ist es, glaube ich, die einzige auf Erden vorhandene Macht, für welche die Teilung keine Schwächung bedeutet hat; die einzige, so glaube ich ferner, die sich im graden Verhältnis zu ihren Verlusten kräftigt und die, langsam in der Ausnützung ihrer Erfolge, unbezwingbar durch ihre Niederlagen wird.
»Das sind die Geschichtsschreiber Frankreichs. In ihnen liest man, wie sich die Macht der Könige bildet, zweimal stirbt, wieder ersteht und dann mehrere Jahrhunderte hindurch hinsiecht. Dann aber gewinnt sie allmählich an Kraft, wächst nach allen Seiten und erhebt sich zu ihrer letzten Periode – jenen Flüssen vergleichbar, die auf ihrem Lauf ihr Wasser verlieren oder sich unter der Erde verbergen; dann erscheinen sie von neuem, vergrößert durch die Wassermassen ihrer Nebenflüsse, und reißen mit unwiderstehlicher Gewalt alles fort, was sich ihnen in den Weg stellt.
»Dort sehen Sie die spanische Nation. Sie kam aus ihren Bergen, unterwarf die maurischen Fürsten ebenso unmerklich, wie diese sie plötzlich überwältigt hatten. Dann einigen sich die zahlreichen kleinen Königreiche zu einer gewaltigen Monarchie, die fast die einzige auf der Halbinsel wird. Schließlich aber wird sie von ihrer eigenen Größe und einer falschen Wohlhabenheit erdrückt, verliert ihre Kraft und selbst ihr Ansehen und bewahrt nur noch den hochfahrenden Stolz ihrer ursprünglichen Macht.
»Das sind die englischen Geschichtsschreiber, bei denen man die Freiheit immer wieder aus den Gluten der Zwietracht und des Aufstandes neu erstehen sieht – ein Fürst, der auf einem unerschütterlichen Throne nie fest sitzt – eine ungeduldige, aber noch in ihrer Erregung besonnene Nation, die, Herrin über das Meer, es versteht, – eine bis dahin unerhörte Sache – den Welthandel mit der Weltherrschaft zu verbinden.
»Dicht dabei sind die Geschichtsschreiber jener zweiten Beherrscherin der Meere, der Republik Holland, die in Europa so geachtet und in Asien so gefürchtet ist, wo ihre Kaufleute die Könige sich in Scharen vor sich beugen sehen.
»Die Geschichtsschreiber Italiens stellen Ihnen eine Nation vor, die ehemals die Herrin der Welt war, jetzt die Sklavin aller anderen Völker ist, ihre uneinigen und schwachen Fürsten, die kein anderes Kennzeichen der Souveränität besitzen, als eine eitle Politik.
»Hier sind die Historiker der Republiken: der Schweiz, die das Abbild der Freiheit ist; Venedigs, das Hilfsquellen nur in seinen früher gemachten Ersparnissen besitzt; Genuas, das nur stolz durch seine Bauwerke ist.
»Hier sind die nordischen, u. a. die Polens, das von seiner Freiheit und seinem Recht, seine Könige zu wählen, einen so üblen Gebrauch macht, daß es dadurch die benachbarten Völker für den Verlust jener Freiheit und jenes Rechtes trösten zu wollen scheint.«
Daraufhin trennten wir uns bis zum andern Tage.
Am andern Tage führte er mich in ein anderes Zimmer und sprach: »Das hier sind die Dichter, d. h. die Autoren, deren Gewerbe es ist, dem gesunden Menschenverstand Handschellen anzulegen und die Vernunft unter täuschenden Gaukelbildern zu ersticken, wie man früher die Frauen unter ihren Schmuck- und Kleidungsstücken vergrub. Die kennen Sie auch, sie sind nicht selten bei den Orientalen, wo eine glühendere Sonne sogar die Einbildungskraft zu erhitzen scheint.
»Hier sind die epischen Gedichte. Ja, was sind denn epische Gedichte? In Wahrheit, ich weiß nichts davon. Die Kenner sagen, daß man niemals mehr als zwei zustande gebracht hat (die Ilias und Odyssee und die Aeneis) und daß die andern, die man unter diesem Namen gibt, ihn nicht verdienen. Sie sagen außerdem, daß es unmöglich sei, neue zu machen, und das ist noch erstaunlicher.
»Das sind die dramatischen Dichter, die meines Erachtens nach die Dichter im eigentlichen Sinne des Wortes sind, und die Meister der Leidenschaften. Deren gibt's zwei Arten, die Komiker, die uns so behaglich anregen, und die Tragiker, die uns mit solcher Heftigkeit erregen und erschüttern.
»Hier sind die Lyriker, die ich ebenso verachte, wie ich die vorhergehenden achte, die aus ihrer Kunst eine harmonische Übertreibung machen.
»Dann kommen die Verfasser von Idyllen und Eklogen. Diese gefallen sogar den Hofleuten durch die Vorführung eines gewissen, ruhig friedlichen Zustandes, dessen diese sich nicht erfreuen. Sie schildern ihn unter der Maske des Hirtenlebens.
»Hier sind die gefährlichsten von allen Autoren, die wir gesehen haben. Das sind die, welche Epigramme schärfen, eine Art feiner Pfeile, die eine tiefe und den Heilmitteln unzugängliche Wunde erzeugen.
»Sie sehen hier endlich die Romane, deren Verfasser so eine Art Dichter sind, die in gleichem Maße die Sprache des Verstandes wie die des Herzens übertreiben. Sie verbringen ihr Leben damit, die Natur zu suchen, und verfehlen sie immer. Ihre Helden sind ebenso unwahr wie die geflügelten Drachen und Kentauren.«
Da sagte ich zu ihm: »Einige von euren Romanen habe ich gelesen, und wenn Sie die unsern lesen würden, würden Sie ebenso verblüfft sein. Sie sind ebenso unnatürlich und außerdem noch durch unsere Sitten in einer schlimmeren Lage. Denn es kann bei uns zehn Jahre dauern, bis ein Verliebter nur das Gesicht seiner Geliebten zu sehen bekommt. Dennoch sind unsere Romanschreiber gezwungen, ihren Lesern diese langweiligen Vorspiele nicht zu erlassen. Da es nun aber dabei unmöglich ist, eine große Abwechselung in die Ereignisse zu bringen, so nimmt man seine Zuflucht zu einem Mittel, das schlimmer ist als das Übel, das es heilen soll, zu den Wundern. Sie werden es sicherlich nicht billigen, wenn eine Zauberin ein Heer aus den Mauselöchern kriechen läßt, oder ein Held ganz allein eine Stadt von hunderttausend Einwohnern zerstört. So sind indessen unsere Romane; die frostigen, sich ewig wiederholenden Abenteuer ermüden und die übertriebenen Wunder empören uns innerlich.«
Es gibt eine Art Bücher hier, die wir in Persien nicht kennen, die mir hier aber sehr an der Mode scheinen, das sind die Zeitschriften. Sie kommen der Trägheit der Leser schmeichelnd entgegen: man ist entzückt darüber, dreißig Bände in einer Viertelstunde durchfliegen zu können.
In der Mehrzahl der Bücher ist der Autor noch nicht über die üblichen Floskeln der Einleitung hinaus, dann liegen seine Leser schon im Todeskampf. Halbtot bringt er sie erst in seine eigentliche Materie hinein, die inmitten eines Meeres von Worten ertrinkt. Dieser ringt nach der Unsterblichkeit in einem Duodezband, jener in einem Quartband. Ein anderer, der höheren Schwung verspürt, liebäugelt mit einem Folioband. So muß er denn seinen Gegenstand entsprechend dehnen – was er auch ohne Erbarmen tut, indem er die Mühe des armen Lesers für nichts anschlägt, der sich totquält, um wieder auf seinen eigentlichen Kern zu reduzieren, was der Verfasser mit unendlicher Mühe breitgetreten hat.
Ich weiß nicht, was für ein Verdienst darin liegt, solche Bücher zu machen. Das könnte ich auch, wenn ich meine Gesundheit und einen Verleger zugrunde richten wollte.
Das große Unrecht, das die Journalisten begehen, ist, daß sie immer nur von »neuen Büchern« sprechen. Als wenn die Wahrheit je neu wäre! Es scheint mir, daß kein Mensch, bis er nicht alle alten Bücher gelesen hat, ein Recht hat, ihnen die neuen vorzuziehen.
Aber wenn sie es sich zum Gesetz machen, nur von Büchern zu reden, deren Druck noch feucht ist, so legen sie sich auch noch ein zweites auf: recht langweilig zu sein. Sie hüten sich, die Bücher zu kritisieren, aus denen sie Auszüge geben, wie berechtigt das auch wäre: und allerdings, wo ist der Mann, der sich alle Monat zehn bis zwölf Feinde machen möchte?
Die Mehrzahl der Autoren gleicht den Dichtern, die ohne zu klagen eine Tracht Prügel hinnehmen, die aber, so wenig eifersüchtig sie ihren Rücken hüten, so eifersüchtig über ihren Werken wachen und nicht die geringste Kritik vertragen würden. Darum muß man sich in acht nehmen, sie nicht an einer so empfindlichen Stelle zu verletzen, und das wissen die Journalisten wohl. Drum tun sie grade das Gegenteil: Sie beginnen damit, die behandelte Materie zu loben – erste Fadheit! – Von da gehen sie zu dem Lobe des Verfassers über – erzwungenes Lob, denn sie haben mit Leuten zu tun, die von eben gehabter Anstrengung noch ganz außer Atem und bereit sind, sich Geltung zu verschaffen und mit Federstrichen einen armen Journalisten zu zerschmettern.
Man gibt sich hier viel mit den Wissenschaften ab, aber ich weiß nicht, ob man sehr gelehrt ist. Wer als Philosoph an allem zweifelt, wagt als Theologe nichts zu leugnen: solch widerspruchsvoller Mensch ist immer mit sich zufrieden, wofern man nur seine beiden Qualitäten auseinanderhält und gelten läßt.
Die Manie der meisten Franzosen ist, geistreich sein zu wollen, und die Manie derer, die geistreich sein wollen, ist, Bücher zu schreiben.
Doch das ist ein so übler Einfall, wie nur möglich: die Natur scheint weise Vorkehrung getroffen zu haben, daß die Dummheiten der Menschen vergänglich sein sollten, und die Bücher verleihen ihnen Unsterblichkeit. Ein Dummkopf sollte sich damit begnügen, seine Zeitgenossen gelangweilt zu haben: nein! er will auch noch künftigen Geschlechtern beschwerlich fallen; er will, daß seine Dummheit über die Vergessenheit triumphiert, deren er sich grade so gut hätte erfreuen können wie seines Grabes; er will, die Nachwelt soll davon unterrichtet sein, daß er gelebt hat, sie soll wissen auf alle Ewigkeit, daß er ein Dummkopf war.
Von allen Bücherschreibern verachte ich keine mehr als die Kompilatoren, die von allen Seiten her die Fetzen von den Werken anderer zusammentragen und sie zusammenkleistern wie Rasenbatzen auf einem Beet. Sie stehen nicht viel über den Buchdruckergehilfen, die die Typen aufreihen, die, zusammengestellt, auch ein Buch bilden, zu dem sie aber nur die Hand geliehen haben. Ich wünschte, daß man die Originaltexte respektierte, und es scheint mir eine Art Entweihung, einzelne Stücke aus dem Heiligtum, in dem sie sich befinden, herauszuziehen, um sie einer Verachtung auszusetzen, die sie nicht verdienen.
Wenn ein Mensch nichts Neues zu sagen weiß, was hält er nicht den Mund? Was soll man mit diesen Wiederholungen anfangen? »Aber ich will in Altes eine neue Ordnung bringen!« – Jawohl! Du kommst also in meine Bibliothek und stellst die Bücher von unten nach oben und die von oben nach unten – ein schönes Meisterstück!
Ich schreibe Dir das, weil ich über ein eben aus der Hand gelegtes Buch empört bin. Es ist so dick, als wenn es die gesamte Wissenschaft umfaßte, aber es hat mir nur den Kopf schwirren gemacht, ohne mich etwas zu lehren.
O Du weiser Derwisch, dessen wissensdurstiger Geist von so viel Kenntnissen strahlt, höre, was ich Dir sagen will!
Es gibt hier Philosophen, die allerdings noch nicht bis zur Höhe orientalischer Weisheit aufgestiegen sind: sie sind noch nicht bis zu dem leuchtenden Throne emporgetragen worden, sie haben noch nicht die unaussprechlichen Worte gehört, die in der Engel Gesängen erklingen, noch haben sie die furchtbare Gewalt einer sie überwältigenden göttlichen Raserei empfunden – jedoch, sich selbst überlassen, folgen sie schweigend den Spuren der menschlichen Vernunft.
Du kannst nicht ahnen, bis wohin diese Führerin sie geleitet hat. Sie haben das Chaos entwirrt und durch eine einfache Mechanik die Anordnung des göttlichen Bauwerkes erklärt. Der Urheber der Welt hat der Materie Bewegung gegeben: mehr hat es nicht bedurft, um diese wundervolle Mannigfaltigkeit der Wirkungen hervorzurufen, die wir im Weltall schauen.
Mögen die gewöhnlichen Gesetzgeber uns Gesetze vorschlagen, um die menschlichen Gemeinschaften zu ordnen, Gesetze, die ebenso der Veränderung unterworfen sind wie die Seelen derer, die sie geben, und der Völker, die sie beobachten: Diese Männer sprechen uns nur von allgemeingültigen, unveränderlichen, ewigen Gesetzen, die ohne irgend eine Ausnahme wirken mit Regelmäßigkeit und unbegrenzter Zuverlässigkeit in der Unendlichkeit des Raumes.
Und was glaubst Du, göttlicher Mann, daß dies für Gesetze seien? Du bildest Dir vielleicht ein, daß, wenn Du in das Innere der erschaffenen Welt eindringst, Du von der Erhabenheit der Wunder überwältigt werdest; Du verzichtest von vornherein auf ein Verstehen, Du bist gerüstet, um zu bewundern?
Aber Du wirst deine Gedanken bald ändern. Diese Gesetze blenden nicht durch einen falschen Schimmer. Ihre Einfachheit hat sie lange verkennen lassen, und erst nach langem Nachdenken hat man ihre ganze Fruchtbarkeit und ihre ganze Bedeutung erkannt.
Das erste Gesetz ist, daß jeder sich bewegende Körper in einer graden Linie fortstrebt, wofern er nicht durch irgend ein Hindernis von dieser Graden abgelenkt wird. Das zweite ist nur eine Folge vom ersten: jeder Körper, der um einen Mittelpunkt kreist, hat das Bestreben, sich von ihm zu entfernen, weil, je ferner er davon ist, der Weg, den er beschreibt, sich um so mehr der graden Linie nähert.
Das, erhabener Derwisch, ist der Schlüssel zur Natur, das sind die fruchtbaren Prinzipien, aus denen man unendlich weittragende Folgerungen zieht.
Die Folgerungen aus fünf oder sechs Wahrheiten haben ihre Philosophie mit einem Reichtum von Wundern beschenkt und sie so viel überraschende Wundertaten ausführen lassen, wie alles, was man von unsern heiligen Propheten erzählt.
Denn ich bin überzeugt, unter unseren Gelehrten ist keiner, den die Aufgabe nicht in Verlegenheit gesetzt hätte, in einer Wage das Gewicht der ganzen die Erde umhüllenden Luft zu wiegen, oder das Wasser zu messen, das jedes Jahr auf ihre Oberfläche fällt; oder der sich viermal besonnen hätte bei der Frage, wieviel Meilen der Schall in der Stunde zurücklegt, oder welche Zeit ein Sonnenstrahl braucht, um zu uns zu gelangen; wieviel Meilen von hier bis zum Saturn sind; in welcher Kurve der Bug eines Schiffes gekrümmt sein muß, damit es der beste Segler sei.
Vielleicht, wenn ein göttlicher Mann die Werke dieser Philosophen mit hohen und erhabenen Worten geschmückt hätte, wenn er kühne Wendungen und geheimnisvolle Allegorien eingestreut hätte, vielleicht hätte er dann ein schönes Werk geschaffen, das dem heiligen Alkoran nichts nachgegeben hätte.
Du hast mir in einem Deiner Briefe viel von den im Okzident gepflegten Künsten und Wissenschaften gesprochen. Du wirst mich vielleicht als einen Barbaren ansehen, aber ich weiß nicht, ob der daraus gezogene Nutzen die Menschen für die mißbräuchliche Anwendung derselben entschädigt, die man täglich damit treibt.
Ich habe sagen hören, daß allein die Erfindung der Bomben allen europäischen Völkern die Freiheit genommen habe. Da die Fürsten die Wache der festen Plätze nicht mehr den Bürgern überlassen konnten, die sich bei der ersten Bombe ergeben hätten, so hatten sie einen Vorwand, große Massen stehender Truppen zu halten, mit denen sie dann später ihre Untertanen unterdrückt haben.
Du weißt, daß es seit Erfindung des Pulvers keine uneinnehmbare Festung mehr gibt, d. h., lieber Usbek, daß auf Erden keine Zuflucht vor Ungerechtigkeit und Gewalttat zu finden ist.
Ich zittere immer davor, daß es nicht schließlich einmal glückt, ein Geheimmittel zu entdecken, das die Menschen nach verkürztem Verfahren ins Jenseits befördert und Völker und ganze Nationen zerstört.
Du hast die Geschichtschreiber gelesen. Bemerke wohl: fast alle Monarchien wurden nur unter Nichtkenntnis der Künste begründet, zerstört aber, weil man diese allzusehr pflegte. Das alte Perserreich kann uns ein heimisches Beispiel dafür liefern.
Ich bin noch nicht lange in Europa, doch habe ich vernünftige Leute von den durch die Chemie angerichteten Verheerungen reden hören. Das scheint eine vierte Geißel zu sein, welche die Menschen zwar nur einzeln, aber unaufhörlich vernichtet, während Krieg, Pest, Hungersnot sie im großen, aber nur in Zwischenräumen zerstören.
Wozu anders hat uns die Erfindung des Kompaß und die Entdeckung so vieler Völker genützt, als uns ihre Krankheiten, viel mehr als ihre Reichtümer, mitzuteilen. Gold und Silber sind durch eine allgemeine Übereinstimmung dazu bestimmt worden, den Preis aller Waren zu bilden, und zwar aus dem Grunde, daß diese Metalle selten und zu anderem Gebrauch untauglich waren: was lag uns daran, daß sie gemeiner wurden und daß wir, um den Wert einer Ware zu bezeichnen, zwei oder drei Zahlenzeichen statt eines brauchen? Das war nur unbequemer.
Aber andrerseits ist diese Erfindung auch den neu entdeckten Ländern verderblich geworden. Ganze Völker sind vernichtet worden, und die Menschen, die dem Tode entgingen, sind zu einem so harten Sklaventum verurteilt gewesen, daß die Erzählung davon einen Muselman schaudern macht.
Entweder bedenkst Du nicht, was Du sagst, oder Du handelst besser, als Du denkst. Du hast dein Vaterland verlassen, um Dich zu bilden, und Du verachtest alle Bildung. Du kommst, um Deinen Geist zu erweitern, in ein Land, wo man die schönen Künste pflegt, und Du betrachtest sie als verderblich. Soll ich Dir etwas sagen, Rhedi, ich stimme mit Dir mehr überein, als Du mit Dir selbst.
Hast Du wohl über den barbarischen und unglückseligen Zustand nachgedacht, in den uns ein Verlust der schönen Künste stürzen würde? Man braucht sich davon kein Phantasiebild zu machen, man kann es mit eigenen Augen schauen. Es gibt noch Völker auf Erden, bei denen ein einigermaßen gebildeter Affe in Ehren leben könnte. Er würde ungefähr auf der Höhe der anderen Bewohner stehen, man würde weder seinen Geist seltsam, noch seinen Charakter wunderlich finden. Er würde seinen Mann stehen und sich sogar noch durch seine Anmut auszeichnen.
Du sagst, die Begründer großer Reiche hätten fast alle die Künste nicht gekannt. Ich bestreite Dir nicht, daß sich barbarische Völker wie eine Überschwemmung auf der Erde haben ausbreiten können und mit ihren wilden Herrschern die best geregelten Staaten überdecken. Aber, gib acht!, sie haben die Künste selbst erlernt oder sie von den besiegten Völkern ausüben lassen. Ohne das würde ihre Macht vorübergegangen sein wie der Lärm des Donners und das Unwetter.
Du fürchtest, sagst Du, daß man nicht noch eine grausamere Zerstörungsart entdeckt, als die gebräuchliche. Nein! Wenn eine solche verhängnisvolle Erfindung gemacht würde, würde sie bald durch das Völkerrecht außer Wirkung gesetzt werden, und einträchtiglich würden die Völker solche Entdeckung in Vergessenheit begraben. Es liegt nicht im Interesse der Fürsten, auf solche Weise Eroberungen zu machen: sie brauchen Untertanen, nicht Ländermassen.
Du beklagst Dich über die Erfindung des Pulvers und der Kanonen. Du findest es seltsam, daß es keinen uneinnehmbaren Platz mehr gibt, d. h. Du findest es seltsam, daß die Kriege heute schneller zu Ende gehen, als ehemals.
Du mußt beim Lesen der Geschichte bemerkt haben, daß die Schlachten seit Erfindung des Pulvers weniger blutig geworden sind, da es nicht mehr zum Handgemenge kommt.
Und wenn sich ein besonderer Fall einstellt, in dem eine Kunst verderblich wirkt, muß man sie deshalb verwerfen? Meinst Du, Rhedi, daß die Religion, die unser heiliger Prophet vom Himmel gebracht hat, verderblich sei, weil sie eines Tages die ungläubigen Christen vernichten wird?
Du glaubst, daß die Künste die Völker verweichlichen und dadurch den Sturz der Reiche verursachen. Du sprichst von dem Untergange des alten Perserreiches, der durch seine Verweichlichung herbeigeführt wurde. Aber weit gefehlt, daß das ein entscheidendes Beispiel ist! Denn die Griechen, die die Perser so oft besiegt und unterjocht haben, pflegten die Künste mit weit größerer Sorgfalt als jene.
Wenn man sagt, daß die Künste die Menschen verweichlichen, so gilt dies wenigstens nicht von den Leuten, die sie ausüben, da sie niemals untätig sind, und die Untätigkeit ist es ja grade, die von allen Lastern die Lebenslust am meisten schwächt.
Es kann also nur die Rede von denen sein, die die Künste nur genießen. Aber da in einem wohlgeleiteten Lande die, welche die Annehmlichkeit einer Kunst genießen, gezwungen sind, ihrerseits eine andere zu pflegen, wenn sie nicht einer schmählichen Armut verfallen wollen, so folgt daraus, daß Untätigkeit und Weichlichkeit mit den Künsten unvereinbar sind.
Paris ist vielleicht die Stadt der größten und zahlreichsten Sinnesgenüsse, die Stadt, wo man die Vergnügungen am meisten verfeinert hat. Aber es ist zugleich die Stadt, wo man das härteste Leben führt. Damit ein Mensch in behaglichem Genusse lebe, müssen hundert andere unermüdlich arbeiten. Eine Frau hat sich in den Kopf gesetzt, in einer Gesellschaft mit einem bestimmten Schmuck zu erscheinen. Von dem Augenblick an können fünfzig Arbeiter nicht mehr schlafen, nicht mehr ruhig essen und trinken. Sie befiehlt und findet pünktlicheren Gehorsam als unser Herrscher, weil das Interesse der größte Herrscher der Erde ist.
Dieser Eifer für die Arbeit, diese Leidenschaft, sich zu bereichern, geht durch alle Stände, vom Handwerker bis zu den Großen. Niemand ist willig ärmer als der, den er eben noch unmittelbar unter sich sieht. Man sieht in Paris mehr als einen Mann, der genug hätte, um bis zum jüngsten Tage zu leben, und der unaufhörlich arbeitet auf die Gefahr hin, seine Tage zu verkürzen, nur um, wie er sagt, zusammenzuraffen, wovon er leben könne.
Derselbe Geist bemächtigt sich des ganzen Volkes: man sieht nur Arbeit und Gewerbefleiß; wo ist also das verweichlichte Volk, von dem Du so viel redest?
Ich will einmal annehmen, Rhedi, daß man in einem Lande nur die zur Bebauung desselben unumgänglich nötigen Künste duldete, die immerhin schon zahlreich sind, und alle anderen daraus verbannte, die nur dem Genuß oder der Phantasie dienen: das würde, behaupte ich, das unglückseligste auf der ganzen Welt sein.
Wenn die Einwohner den Mut hätten, so viele Dinge zu entbehren, die sie für ihre Bedürfnisse schaffen müssen, würde das Volk von Tag zu Tag zurückgehen und der Staat würde so schwach werden, daß die kleinste Macht ihn würde überwältigen können.
Es würde leicht sein, Dir durch Eingehen auf Einzelheiten nachzuweisen, daß die Privateinnahmen und mithin auch die des Herrschers fast ganz aufhören würden. Es würde zwischen den Bürgern kein Austausch der Leistungen stattfinden. Enden würde der Kreislauf der Reichtümer und die Abstufung der Einkommen, die von der Abhängigkeit herkommt, in der die Künste voneinander stehen. Jeder einzelne würde von seinem Grundbesitz leben und ihm nur grade das abgewinnen, was ihn vorm Hungertode bewahrt. Da das aber manchmal nur ein Zwanzigstel der Staatseinkünfte ausmacht, so würde die Einwohnerzahl dem entsprechend zurückgehen und nur ein Zwanzigstel davon übrig bleiben.
Bedenke auch, wie weit Gewerbefleiß die Einkünfte steigert. Ein Besitz bringt seinem Eigentümer jährlich nur fünf vom Hundert ein. Aber mit Farben, die ein Goldstück wert sind, malt der Maler ein Bild, das ihm hundert Goldstücke einträgt. Von den Goldschmieden, den Wollspinnern und Seidenwebern und allen möglichen andern Arbeitern kann man dasselbe sagen.
Aus alledem muß man schließen, Rhedi, daß, damit ein Fürst mächtig sei, seine Untertanen im Überfluß und Genuß leben müssen. Er muß darauf hinarbeiten, ihnen allerhand Überflüssigkeiten ebensogut zu verschaffen wie das zum Leben Unentbehrliche.

Neulich ging ich mit einem Freunde über den Pont-Neuf. Da traf dieser einen Bekannten, der, wie er mir sagte, Mathematiker war. Und alles in seinem Äußeren stimmte dazu, denn er war tief in Gedanken. Mein Freund mußte ihn lange am Ärmel zupfen und ihn schütteln, um ihn auf die platte Erde zu bringen, so beschäftigte ihn die Berechnung einer Kurve, die ihn vielleicht seit acht Tagen plagte. Sie begrüßten sich mit vielen Liebenswürdigkeiten und tauschten einige literarische Neuigkeiten aus. Diese Gespräche führten sie bis zur Tür eines Cafés, wo ich mit ihnen eintrat.
Ich bemerkte, daß unser Mathematiker dort von jedermann mit eifriger Zuvorkommenheit empfangen wurde, und daß die Kellner ihm viel mehr Aufmerksamkeit widmeten, als zwei Musketieren, die in einer Ecke saßen. Auch ihm merkte man an, daß er sich behaglich fühlte, denn sein Gesicht hellte sich etwas auf, und er begann heiter zu lachen, als wenn er nie mit Mathematik zu tun gehabt hätte.
Aber sein an Regelmäßigkeit gewöhnter Geist vermaß prüfend alles, was in der Unterhaltung gesagt wurde. Er glich dem Manne, der in seinem Garten allen Blumen die Köpfe abhieb, die länger waren als die anderen. Ein Märtyrer seiner Genauigkeit, fühlte er sich von jedem Seitensprung gekränkt, wie ein zu empfindliches Auge von einem zu grellen Lichte geblendet wird. Nichts war für ihn gleichgültig, wenn es eine Wahrheit darstellte. So war denn auch seine Unterhaltung seltsam genug. Er kehrte an dem Tage grade vom Lande zurück mit einem Herren, der seinerseits ein stolzes Schloß und prächtige Gärten gesehen hatte. Er dagegen hatte nur ein Gebäude von 60 Fuß Länge und 30 Fuß Breite gesehen und ein oblonges Boskett von 10 Klaftern. Er hätte gewünscht, die Gesetze der Perspektive wären in dem Garten derartig angewendet worden, daß alle Gänge gleichlang erschienen wären, und er hätte auch eine unfehlbare Methode dazu angeben können. Er schien von einer Sonnenuhr sehr entzückt, die er dort entdeckt hatte, und geriet gegen den mich begleitenden Gelehrten sehr in Hitze, als ihn dieser fragte, ob die Uhr babylonische Stunden anzeigte. Ein Neuigkeitskrämer sprach von der Beschießung des Schlosses von Fontarabia und der Mathematiker gab uns plötzlich die Formel für die von den Bomben beschriebenen Flugbahnen, und, zufrieden, das zu wissen, wollte er von der Wirkung nichts hören. Ein Anwesender beklagte sich, im vergangenen Winter von einer Überschwemmung heimgesucht zu sein. Da sagte der Mathematiker: »Was Sie da mitteilen, ist mir sehr interessant. Ich sehe, daß ich mich in meinen Beobachtungen nicht getäuscht habe, und daß mindestens zwei Zoll mehr Wasser auf der Erdoberfläche gefallen ist, als vergangenes Jahr.«
Einen Augenblick später verließ er das Café und wir folgten ihm. Da er ziemlich rasch ging und nicht vor sich sah, so traf er gradenwegs mit einem andern Manne zusammen. Der Stoß war heftig und jeder prallte zurück im umgekehrten Verhältnis ihrer Massen und Geschwindigkeiten. Als sie sich ein wenig von ihrer Betäubung erholt hatten, führte der andere Mann seine Hand zur Stirne und sagte zu dem Mathematiker: »Ich freue mich, daß Sie gegen mich gerannt sind, denn ich habe Ihnen eine große Neuigkeit mitzuteilen: ich habe eben Horaz der Öffentlichkeit übergeben.« »Wie?« sagte der Mathematiker, »der ist ja schon seit zweitausend Jahren veröffentlicht!« »Sie verstehen mich nicht«, erwiderte der andere, »es handelt sich um eine Übersetzung dieses alten Dichters, die ich veröffentlicht habe; ich beschäftige mich seit zwanzig Jahren damit, Übersetzungen zu machen.«
»Was, werter Herr?« sagte der Mathematiker, »seit zwanzig Jahren haben Sie das Denken aufgegeben? Sie sprechen für die andern und jene denken für Sie?« – »Wie?« sagte der Gelehrte, »meinen Sie, daß ich dem Publikum keinen großen Dienst geleistet habe, indem ich ihm die Lesung guter Schriftsteller ermöglichte?« – »Das will ich nicht grade sagen. Ich schätze die großen Ingenia, die Sie umgestalten, wie nur einer. Aber Sie werden ihnen nie gleichen, denn Sie wird man nie übersetzen. Die Übersetzungen gleichen jenen Kupfermünzen, die wohl denselben Zahlwert haben wie die Goldmünzen und fürs Volk sogar wohl brauchbarer sind. Aber sie bleiben immer minderwertig und von geringem Feingehalt. Sie wollen, wie Sie sagen, die berühmten Toten unter uns wieder zum Leben erwecken, und ich gestehe, daß Sie ihnen auch einen Körper geben. Aber Sie geben ihnen nicht das Leben mit: es fehlt immer der Geist, um ihnen Leben einzuhauchen. Warum bemühen Sie sich nicht um die Aufdeckung der zahlreichen schönen Wahrheiten, die uns eine leichte Rechnung täglich finden läßt?«
Nach dieser kleinen Auseinandersetzung trennten sie sich, wie ich glaube, sehr unzufrieden von einander.

(Stellenweise gekürzt.)
Es gab in Arabien ein Völkchen, das Troglodyten hieß, Nachkommen jener alten Troglodyten, die, wenn man den Geschichtsschreibern glauben will, mehr Tieren als Menschen ähnlich sahen. Diese aber waren nicht so mißgestaltet, auch nicht zottig wie Bären, pfiffen nicht, und hatten zwei Augen. Aber sie waren so böse und wild, daß unter ihnen Recht und Billigkeit nichts galten.
Sie hatten einen stammfremden König, der sie, in der Absicht, ihr bösartiges Wesen zu bessern, streng behandelte. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn, töteten ihn und beseitigten die ganze königliche Familie.
Nachdem der Streich gelungen war, versammelten sie sich, um eine Regierung zu wählen, und nach langem Hinundher setzten sie auch Beamte ein. Aber kaum gewählt, wurden sie ihnen lästig, und sie ermordeten auch diese.
Nunmehr frei, folgte der Stamm seinen wilden Neigungen. Alle kamen überein, daß niemand mehr einem andern zu gehorchen hätte, daß jedermann nur über seine Interessen wachen sollte, ohne sich um die andern zu kümmern.
Dieser allgemeine Beschluß gefiel den einzelnen sehr. Sie sagten: »Was soll ich mich auch tot arbeiten für Leute, die mir gleichgültig sind? Ich will nur an mich denken. Ich werde glücklich leben, was geht's mich an, ob es die übrigen sind? Ich werde mir alle meine Lebensbedürfnisse selbst schaffen, und wenn ich die habe, so kümmert's mich nicht viel, ob alle andern Troglodyten im Elend sitzen.«
Man war in dem Monat, wo gesät wird. Jeder sagte sich: »Ich werde mein Feld bebauen nur, damit es mir das zu meiner Nahrung nötige Getreide liefert. Eine größere Menge würde mir unnütz sein: ich werde mir um nichts und wieder nichts keine Plage machen.«
Die Felder des kleinen Reiches waren nicht gleichartig. Einige lagen in dürren und bergigen Gegenden, andere auf wohlbewässertem Gelände. Dies Jahr war sehr trocken. Infolgedessen versagten die hochgelegenen Äcker und die wohlbewässerten trugen reichliche Frucht. Die Bergbewohner starben in Massen, denn die anderen waren hartherzig genug, ihnen nichts abgeben zu wollen.
Im nächsten Jahre gab es sehr viel Regen und das Verhältnis des Ernteertrages kehrte sich um. Nun jammerte die andere Hälfte des Volkes vor Hunger, fand aber natürlich ihrerseits auch keine Hilfe bei den Genossen.
Einer der ersten Männer hatte eine sehr schöne Frau. Sein Nachbar verliebte sich in sie und entführte sie. Großer Streit erhob sich, und nach mancherlei Gezänk und Schlägen ging man, Entscheidung suchend, zu einem Troglodyten, der zur Zeit der Republik in Ansehen gestanden hatte. Der aber wies sie ab. »Was liegt mir daran,« sagte er, »ob die Frau dir oder dir gehört? Ich muß jetzt meinen Acker pflügen gehen und kann meine Zeit nicht damit verschwenden, eure Streitigkeiten zu schlichten und eure Geschäfte zu besorgen, während ich meine vernachlässige. Laßt mich gefälligst in Ruhe und behelligt mich nicht mit euren Zänkereien.« Daraufhin verließ er sie und ging hin, sein Land zu bebauen. Der Entführer, der der Stärkere war, schwor, daß er lieber sterben, als die Frau zurückgeben würde. Der andere, ganz erfüllt von der Ungerechtigkeit seines Nachbarn und von der Härte des Richters, begab sich verzweifelt auf den Heimweg, als ihm eine junge und schöne Frau begegnete, die vom Brunnen herkam: er hatte keine Frau mehr, diese gefiel ihm und sie gefiel ihm noch besser, als er erfuhr, daß es die Frau des erfolglos als Schiedsrichter angerufenen Mannes sei, der gegen sein Unglück so gleichgültig gewesen war. Er entführte sie und nahm sie mit nach Haus.
Es gab einen Mann, der ein ziemlich fruchtbares Feld besaß, das er mit großem Fleiß bebaute. Zwei seiner Nachbarn taten sich zusammen, verjagten ihn aus seinem Hause und bemächtigten sich seines Feldes. Sie verbündeten sich, ihren neuen Besitz gegen jedermann zu verteidigen. Aber einer von ihnen ward der Teilung bald überdrüssig, tötete den andern und machte sich zum Herren des Ackers. Doch sein Reich dauerte nicht lange. Zwei andere, die stärker waren als er, ermordeten ihn.
Ein anderer Troglodyt, der fast nackt war, sah Wolle, die zu verkaufen war. Er fragte nach dem Preis. Der Verkäufer sagte sich: »Eigentlich dürfte ich für meine Wolle nur so viel Erlös erwarten, um mir zwei Maß Getreide zu kaufen. Aber ich will sie viermal so teuer verkaufen, um acht Maß zu haben.« Der andere mußte sich fügen und den verlangten Preis zahlen. »Jetzt bin ich froh,« sagte der Verkäufer, »nun kann ich Getreide schaffen.« »Wie«, sagte der Käufer, »du brauchst Getreide? Ich habe welches zu verkaufen. Nur wirst du dich etwas über den Preis wundern. Aber du wirst wissen, daß Getreide sehr teuer ist und fast überall Hungersnot herrscht. Gib mir mein Geld wieder und du sollst ein Maß Getreide haben. Anders gebe ich es nicht her und wenn du elendiglich vor Hunger umkommen solltest.«
Indessen verheerte eine grausame Krankheit die Gegend. Ein geschickter Arzt aus einem Nachbarlande kam und heilte durch seine Kunst alle, die sich seinen Händen anvertrauten. Als er aber seinen Lohn einforderte, wiesen ihn alle schnöde ab und er brachte nichts nach Haus als die Ermüdung von seiner langen Reise. Bald aber trat die Krankheit wieder und diesmal viel heftiger auf. Nun gingen sie zu ihm und warteten nicht, bis er kam. Da sprach er zu ihnen: »Hebt euch hinweg, ihr ungerechten Menschen. Ihr habt in eurer Seele ein Gift, das schlimmer ist als das, von dem ihr geheilt sein möchtet. Ihr dürft keinen Raum auf der Erde beanspruchen, weil ihr keine Humanität besitzet und die Gesetze der Billigkeit euch unbekannt sind. Ich würde fürchten, die Götter, die euch strafen wollen, zu kränken, wenn ich mich der Gerechtigkeit ihres Zornes widersetzte.«
Du hast gesehen, mein lieber Mirza, wie die Troglodyten durch ihre eigene Schlechtigkeit zugrunde gingen. Von so vielen Familien blieben nur zwei von dem allgemeinen Unglück verschont. Nun gab es da zwei sehr eigenartige Menschen. Sie besaßen Menschlichkeit, sie wußten, was Gerechtigkeit ist, sie liebten die Tugend. Ebenso eng mit einander verknüpft durch die Gradheit ihres Herzens wie durch die Verderbtheit der anderen, sahen sie die allgemeine Trostlosigkeit, die sie nur insofern heimsuchte, als sie mit den andern Mitleid hatten: Grund genug für eine noch engere Vereinigung. Sie arbeiteten mit gemeinsamem Eifer für den gemeinsamen Nutzen. Sie hatten keine anderen Meinungsverschiedenheiten als solche, wie sie aus einer zarten und feinfühligen Freundschaft zu entstehen pflegen, und im fernsten Winkel ihres Landes, getrennt von ihren ihrer Gesellschaft unwürdigen Volksgenossen, führten sie ein glückliches und ruhiges Leben. Die Erde, gepflegt von diesen tugendreichen Händen, schien von selbst ihre Früchte herzugeben.
Sie liebten ihre Frauen und wurden von ihnen zärtlich geliebt. Ihr ganzes Trachten war, ihre Kinder zur Tugend zu erziehen. Sie hielten ihnen unermüdlich das betrübsame Beispiel ihrer Landsleute vor. Sie prägten ihnen vor allem ein, daß das Glück des einzelnen immer in dem Glück der Allgemeinheit beschlossen ist: sich davon trennen, heißt sich verlieren. Die Tugend zu üben müsse uns leicht fallen, und man dürfe sie nicht als eine mühselige Übung ansehen. Gerechtigkeit gegen den Nächsten aber sei Liebe gegen uns selbst.
Bald hatten sie die Freude tugendhafter Väter, Kinder zu haben, die ihnen ähnlich sind. Das junge Geschlecht, das um sie her aufwuchs, schloß glückliche Ehen: die Zahl nahm zu, die Einigkeit blieb immer dieselbe, und die Tugend, weit entfernt, sich mit der Masse zu schwächen, wurde vielmehr durch eine größere Zahl guter Beispiele gestärkt.
Wer könnte das Glück dieser Troglodyten ausmalen? Ein so gerechtes Volk mußten die Götter lieben. Sobald es die Augen öffnete, um sie zu erkennen, lernte es sie fürchten, und die Religion sänftigte, was die Natur in ihren Sitten etwa zu Rauhes gelassen hatte.
Sie richteten Feste zu Ehren der Götter ein. Die jungen Mädchen, mit Blumen geschmückt, und die jungen Männer feierten sie durch Tänze nach dem Klang einer ländlichen Musik. Man veranstaltete dann Feste, in denen die Freude ebenso wie die Einfachheit herrschte. Bei diesen Gelegenheiten sprachen die Herzen und fanden sich zueinander. Dort verriet sich jungfräuliche Scham in unabsichtlich entschlüpftem Geständnis, und der Väter Zustimmung gab ihm Bestätigung. Dort gefielen sich zärtliche Mütter darin, für ihre Tochter eine Verbindung in Liebe und Treue zu erträumen.
Man besuchte die Tempel, um die Gunst der Götter zu erflehen. Doch galten die Wünsche nicht Reichtümern, noch einem lästigen Überfluß. Derartige Wünsche wären der glücklichen Troglodyten unwürdig gewesen: dergleichen vermochten sie nur für ihre Landsleute zu erflehen. Sie knieten an den Stufen der Altäre nur nieder, um für die Gesundheit ihrer Väter, die Einigkeit ihrer Brüder, die Zärtlichkeit ihrer Frauen, die Liebe und den Gehorsam ihrer Kinder zu beten. Die jungen Mädchen brachten das zarte Opfer ihrer Herzen und erbaten sich keine andere Gnade, als einen Troglodyten glücklich zu machen.
Abends, wenn die Herden die Weiden verließen, und die müden Stiere den Pflug heimwärts brachten, versammelten sie sich. Dann besangen sie die Untaten der ersten Troglodyten und ihre Leiden, das Wiedererstehen der Tugend in einem neuen Volke und sein Glück. Sie feierten die Größe der Götter und wie sie der Menschen aufrichtige Gebete stets erhören, die aber mit ihrem Zorn erreichen, die sie nicht fürchten. Dann beschrieben sie die Freuden eines ländlichen Lebens und das Glück eines Lebens im Schmucke der Unschuld. Früh gaben sie sich einem Schlummer hin, den keine Sorge noch Kummer unterbrach.
( Brief 13 setzt die Schilderung der märchenhaften Glückseligkeit der Troglodyten fort und erzählt, wie sie den Einfall eines Nachbarvolkes in ihr Land dank ihrer außerordentlichen, in ihrer Tugend begründeten Tapferkeit erfolgreich abwehren.)
Da das Volk von Tag zu Tage wuchs, so hielten die Troglodyten es für angezeigt, einen König zu wählen. Sie kamen überein, daß man die Krone dem übertragen müßte, der der Gerechteste wäre, und sie richteten ihre Blicke alle auf einen Greis, der durch sein Alter und eine lang erprobte Tugendhaftigkeit verehrungswürdig war. Er hatte sich nicht zu dieser Versammlung einfinden wollen; er hatte sich in sein Haus zurückgezogen, das Herz von Trauer erfüllt.
Als man ihm Abgeordnete zuschickte, um ihm die auf ihn gefallene Wahl kund zu tun, sagte er: »Gott wolle verhüten, daß ich den Troglodyten das Unrecht antäte, daß man meinen könne, es gäbe keinen Gerechteren unter ihnen als mich. Ihr übertragt mir die Krone, und wenn ihr es durchaus verlangt, werde ich sie wohl annehmen müssen. Aber seid gewiß, ich werde vor Schmerz darüber sterben, daß ich bei meiner Geburt die Troglodyten frei gesehen habe und sie heute unterjocht sehen muß.« Bei diesen Worten begann er Ströme von Tränen zu vergießen. »Unseliger Tag!« sagte er, »und warum habe ich so lange leben müssen?« Dann rief er in strengem Tone aus: »Ich sehe wohl, ihr Troglodyten, wie es steht. Eure Tugend beginnt euch beschwerlich zu fallen. In dem Zustande, in dem ihr euch befindet, müßt ihr tugendhaft sein, ihr mögt wollen oder nicht. Sonst würdet ihr nicht bestehen können und würdet dem unglücklichen Geschick eurer Vorväter verfallen. Aber dies Joch scheint euch zu hart. Ihr zieht es vor, einem Fürsten unterworfen zu sein und seinen Gesetzen zu gehorchen, die weniger streng sind, als eure Sitten. Ihr wißt, daß ihr dann euren Ehrgeiz befriedigen, Reichtümer erwerben und in einer schlaffen Wollust hinleben könnt, und daß ihr, wenn ihr nur nicht in große Vergehungen verfallet, die Tugend nicht mehr brauchen werdet.« Er hielt einen Augenblick inne und seine Tränen flossen reichlicher denn je. »Und was erwartet ihr, daß ich tun soll? Wie soll ich einem Troglodyten etwas befehlen? Wollt ihr, daß er eine tugendhafte Handlung tut, weil ich sie ihm befehle, er, der sie genau so ohne mich tun würde, allein seinem natürlichen Triebe folgend? O ihr Troglodyten! Ich stehe an den Marken meiner Tage, und träge rinnt das Blut in meinen Adern, und bald werde ich zu euren heiligen Vätern versammelt sein: warum wollt ihr, daß ich sie betrübe, und mich genötigt sehe, ihnen zu sagen, daß ich euch unter einem andern Joch als dem der Tugend gelassen habe?«

Ich habe niemals vom öffentlichen Recht reden hören, ohne daß man nicht eine genaue Untersuchung darüber angestellt hätte, welches der Ursprung der menschlichen Gemeinschaft sei. Das scheint mir lächerlich. Wenn die Menschen keine Gemeinschaft bildeten, wenn sie sich sonderten und mieden, dann müßte man nach dem Grund fragen und untersuchen, warum sie sich getrennt halten. Aber von ihrer Geburt an sind sie, alle mit allen, verknüpft. Ein Sohn kommt neben seinem Vater zur Welt und hält sich an ihn: das ist Gemeinschaft und der Ursprung der Gesellschaft.
Das öffentliche Recht ist in Europa bekannter als in Asien. Indessen kann man sagen, daß die Leidenschaften der Fürsten, die Geduld der Völker und die Schmeichelei der Rechtsschriftsteller alle seine Grundsätze entstellt haben.
Dies Recht, so wie es heute ist, ist eine Wissenschaft, die die Fürsten lehrt, bis zu welchem Punkt sie die Gerechtigkeit verletzen können, ohne ihre eigenen Interessen zu schädigen. Welch Unterfangen, lieber Rhedi, wenn man, um ihr Gewissen hart und fühllos zu machen, die Ungerechtigkeit in ein System bringt, ihr Regeln gibt, Grundsätze aus ihr ableitet, und Folgerungen aus ihr zieht!
Die unumschränkte Macht unserer erhabenen Sultane, die kein anderes Gesetz kennt als sich selbst, erzeugt nicht mehr Ungeheuer, als diese unwürdige Kunst, die die unbeugsame Gerechtigkeit zu beugen unternimmt.
Man sollte meinen, Rhedi, daß es zweierlei Gerechtigkeiten gibt, die voneinander ganz verschieden seien. Die eine regelt die Angelegenheiten der einzelnen und herrscht im bürgerlichen Recht. Die andere schlichtet die Streitigkeiten zwischen Volk und Volk und herrscht wie ein Tyrann im öffentlichen Recht – als wenn das öffentliche Recht nicht auch ein bürgerliches Recht wäre, freilich nicht mit dem Anspruch auf Gültigkeit für ein einzelnes Volk, sondern für die ganze Welt!
In einem anderen Briefe werde ich Dir meine Gedanken darüber auseinandersetzen.
Die Beamten sollen Recht sprechen zwischen Bürger und Bürger, jedes Volk soll es sprechen zwischen sich und jedem andern Volke. In dieser zweiten Rechtsprechung kann man keine anderen Grundsätze anwenden als bei der ersten.
Zwischen Volk und Volk bedarf es selten eines dritten, um ein Urteil zu fällen, weil die Gegenstände des Streites fast immer klar und leicht bestimmbar sind. Die Interessen zweier Nationen sind meist so getrennt, daß ein Volk, um das Rechte zu finden, es nur aufrichtig zu lieben braucht; ein Volk kann in eigener Sache kaum blind sein.
Es ist mit den zwischen Privatleuten auftretenden Streitigkeiten anders. Da sie in geselligen Beziehungen leben, sind ihre Interessen so vermengt und vermischt, es gibt deren so mannigfaltige, daß unvermeidlich ein dritter zu entwirren versuchen muß, was die Begehrlichkeit der Parteien verdunkeln möchte.
Es gibt nur zwei Arten von gerechten Kriegen, die einen, die geführt werden, um einen angreifenden Feind zurückzuweisen, die anderen, um einem angegriffenen Bundesgenossen zu helfen.
Keine Gerechtigkeit läge in einem Kriege, der unternommen würde, um private Streitigkeiten des Herrschers auszutragen, vorausgesetzt, daß der Fall nicht so schwer läge, daß er den Tod des Fürsten oder des Volkes verdiente, von denen das Unrecht begangen wäre. Also darf ein Fürst nicht einen Krieg wegen einer ihm verweigerten Ehrenbezeigung anfangen, auch nicht, weil man seinen Gesandten nicht in der gehörigen Weise begegnet ist, oder aus ähnlichen Gründen – so wenig wie ein Privatmann jemanden töten darf, der ihm den ihm gebührenden Vorrang streitig macht. Der Grund liegt darin, daß, da die Kriegserklärung immer ein Akt der Gerechtigkeit sein soll, bei dem die Strafe dem Vergehen entspricht, man immer prüfen muß, ob der, dem man den Krieg erklärt, den Tod verdient. Denn mit jemand Krieg anfangen, heißt, ihn mit dem Tode bestrafen wollen.
Im Staatenrecht ist der strengste Akt der Justiz der Krieg, weil er als Folge die Zerstörung eines Gemeindewesens haben kann.
Repressalien gehören ihrer Strenge nach zur zweiten Stufe.
Ein dritter Akt der Justiz besteht darin, einen fremden Fürsten der Vorteile zu berauben, die er aus unserm Lande ziehen kann, indem wir immer Strafmaß und Vergehen ins richtige Verhältnis setzen.
Der vierte Akt der Justiz, der der häufigste sein darf, besteht in der Kündigung des Bündnisses mit dem Volke, über das man sich zu beklagen hat.
Neulich war ich in einem Hause, wo eine bunt zusammengesetzte Gesellschaft war. Die Leitung der Unterhaltung fand ich von zwei alten Damen beansprucht, die den ganzen Morgen gearbeitet hatten, um sich zu verjüngen. »Man muß gestehen,« sagte die eine, »daß die heutigen Männer sehr anders sind, als die unserer Jugendzeit. Die waren höflich, liebenswürdig, gesellig. Aber die jetzigen finde ich von einer unerträglichen Rücksichtslosigkeit.« »Alles ist verändert,« sagte da ein Herr, der sich vor Gicht kaum bewegen konnte, »die Welt ist nicht mehr dieselbe wie vor vierzig Jahren. Damals war alle Welt gesund, man war beweglich, man war heiter, man dachte nur an Tanz und Lust: jetzt ist alle Welt von einer unerträglichen Trübseligkeit.« Einen Augenblick später kam das Gespräch auf Politik. »Weiß Gott,« sagte ein alter, würdiger Herr. »Man versteht ja heute nicht mehr zu regieren. Nennen Sie mir heutzutage einen Minister wie Colbert! Ich kannte Colbert sehr gut, er gehörte zu meinen Freunden. Er ließ mir immer meine Pension vor allen andern auszahlen. Damals herrschte noch Ordnung in den Finanzen und alle Welt hatte Geld. Heute bin ich am Bettelstab.« »Mein verehrter Herr,« sagte da ein Geistlicher, »Sie sprechen da von der wunderbarsten Zeit unseres unbesiegbaren Monarchen. War ihm ein Opfer zu groß, wenn es galt, Ketzerei zu zerstören?« »Na, und rechnen Sie die Abschaffung der Duelle für nichts?« warf ein anderer ein, der bis dahin geschwiegen hatte. »Die Bemerkung ist sehr begründet,« flüsterte mir jemand ins Ohr. »Dieser Herr ist über das Duellverbot entzückt. Er beobachtet es so genau, daß er vor einem Halbjahr hundert Stockhiebe hinnahm, um es nicht zu verletzen.«
Es scheint mir, Usbek, daß wir beim Beurteilen der Dinge im geheimen immer nur auf unsere ganz besonderen Eigentümlichkeiten Bezug nehmen. Ich bin nicht erstaunt, daß die Neger den Teufel als von blendender Weiße schildern und ihre Götter als kohlschwarz. Man hat sehr richtig bemerkt, daß, wenn die Dreiecke sich einen Gott machten, sie ihm drei Seiten geben würden.
Mein lieber Usbek, wenn ich sehe, wie diese Menschlein, die auf einem Atom, genannt Erde, herumkrabbeln, das im Weltall nur ein Staubkorn ist, sich geradezu als Maß für die Weltleitung hinstellen, so weiß ich nicht, wie ich solche Kleinheit mit solcher Überschätzung zusammenreimen soll.
Die europäischen Gesetze sind erbarmungslos streng gegen die Selbstmörder. Man schlägt sie sozusagen noch einmal tot, man schleift sie durch den Schmutz der Straßen, man behaftet sie mit dem Makel der Ehrlosigkeit, man zieht ihre Güter ein.
Es scheint mir, Ibben, daß diese Gesetze sehr ungerecht sind. Wenn ich von Schmerz, Elend, Verachtung erdrückt werde, warum will man mich hindern, meinen Leiden ein Ende zu setzen, und warum beraubt man mich eines Heilmittels, das in meinen Händen ist?
Warum verlangt man, daß ich für eine Gemeinschaft arbeite, der ich nicht mehr angehören will? Daß ich gegen meinen Willen einen Vertrag halte, der ohne meinen Willen abgeschlossen ist? Die Gesellschaft beruht auf gegenseitigem Vorteil, aber wenn sie mir lästig ist, was hindert mich da, auf sie zu verzichten? Das Leben ist mir als ein Gunstbeweis zuteil geworden, ich kann es also wiedergeben, wenn es das nicht mehr für mich ist: die Ursache verschwindet, die Wirkung muß also auch verschwinden.
Verlangt der Fürst, daß ich sein Untertan sei auch dann noch, wenn ich aus dieser Untertanschaft keinen Vorteil mehr ziehe? Können meine Mitbürger auf dieser ungleichen Verteilung: für sie der Nutzen, für mich die Verzweiflung, bestehen? Kann Gott, der sich dadurch von allen andern Wohltätern zu seinem Nachteil unterscheiden würde, mich dazu verurteilen, Gnadenbeweise anzunehmen, die mich drücken?
Ich bin wohl verpflichtet, den Gesetzen zu gehorchen, solange ich unter ihnen lebe; wenn ich aber nicht mehr unter ihnen lebe, können sie da noch für mich verbindlich sein?
Aber, wird man sagen, du störst die Ordnung der Vorsehung. Gott hat unsere Seele mit dem Körper vereint, du widersetzest dich also seinen Absichten und bist widerspenstig gegen ihn.
Was soll das wohl heißen? Störe ich etwa die Ordnung der Vorsehung, wenn ich die Materie umgestalte, wenn ich einen Würfel aus einer Kugel mache, die die ursprünglichen Gesetze der Bewegung, das heißt die Gesetze der Schöpfung und der Erhaltung, rund gestaltet hatten? Nein, ohne Frage! Ich mache nur Gebrauch von dem Recht, das mir gegeben ist, und in diesem Sinne darf ich nach meinem freien Ermessen die ganze Natur umstürzen, ohne daß man mir sagen darf, ich widersetzte mich der Vorsehung.
Wenn meine Seele nun wirklich vom Körper getrennt sein wird, wird darum im Weltall weniger Ordnung und Regelmäßigkeit herrschen? Glaubt ihr, daß diese neue Zusammenstellung weniger vollkommen und weniger abhängig von den allgemein gültigen Gesetzen sein wird? Daß die Welt etwas dabei verloren hat, und daß die Werke Gottes deshalb weniger groß oder vielmehr weniger unermeßlich sind?
Meint ihr, wenn sich die Stoffe meines Körpers in einen Kornhalm, einen Wurm, ein Rasenstück wandeln, daß dies Werk der Natur ihrer weniger würdig ist, und daß meine Seele, von allen irdischen Anhängseln befreit, weniger erhaben geworden sei?
All diese Gedanken, mein lieber Ibben, haben keine andere Quelle als unsere Überhebung. Wir fühlen unsere Kleinheit nicht, und so sehr sie auch vorhanden sein mag, möchten wir doch im Weltall zählen, eine Figur darin spielen, ein wichtiger Gegenstand darin sein. Wir bilden uns ein, daß die Zerstörung eines so vollkommenen Wesens wie wir die ganze Natur um eine Stufe herabsetzen müßte, und wir begreifen nicht, daß ein Mensch mehr oder weniger in der Welt – was sage ich? alle Menschen zusammen, hundert Millionen Erden wie unsere nur ein kleines und verlorenes Atom bedeuten, dessen Gott nur gewahr wird, weil sein Wissen nicht von einem Maß abhängig ist.

Sobald ein Großer gestorben ist, versammelt man sich in einer Moschee und hält ihm die Leichenrede, d. i. eine Rede zu seinem Lobe, bei der man aber sehr in Verlegenheit sein würde, das Verdienst des Verstorbenen daraus genau zu erkennen.
Ich möchte den Pomp beim Leichenbegängnis beseitigen. Man muß die Menschen bei ihrer Geburt beweinen, nicht bei ihrem Tode! Wozu dienen die Zeremonien und der ganze düstere Aufzug, den man bei einem Sterbenden in seinen letzten Augenblicken veranstaltet, sogar die Tränen seiner Angehörigen und die Schmerzensäußerungen seiner Freunde – wozu dienen sie anders, als für seine eigene Vorstellung. den Verlust zu übertreiben, der ihm bevorsteht?
Wir sind so blind, daß wir nicht wissen, wann wir trauern, wann wir uns freuen sollen. Wir haben fast immer nur falsche Trauer oder falsche Freuden.
Wenn ich den Großmogul sehe, der sich alljährlich auf eine Wage begibt, um sich wie ein Stück Rind wiegen zu lassen, wenn ich sehe, wie seine Völker sich darüber freuen, daß ihr König materiell zugenommen hat. d. h. um ebensoviel unfähiger geworden ist, zu regieren, dann, Ibben, ergreift mich ein tiefes Mitleid mit der menschlichen Verblendung.

Ich habe Leute gesehen, bei denen die Tugend so natürlich war, daß sie sich nicht einmal bemerkbar machte: sie erfüllten ihre Pflicht, ohne sich darunter zu beugen, und taten sie wie aus Instinkt. Weit entfernt, durch viel Gerede auf ihre seltenen Eigenschaften aufmerksam zu machen, schienen sie selbst ihrer gar nicht gewahr zu werden. Solche Leute lieb' ich, nicht solche tugendhaften Menschen, die immer über ihre eigene Tugendhaftigkeit erstaunt zu sein scheinen und die eine gute Handlung wie ein Wunderbegebnis betrachten, dessen Mitteilung Überraschung hervorrufen muß.
Wenn für die, denen der Himmel große Gaben verliehen hat, die Bescheidenheit eine unerläßliche Eigenschaft ist, was soll man von diesen Eintagsfliegen sagen, die einen Stolz zu zeigen wagen, der die größten Menschen verunzieren würde?
Ich sehe allerseits Leute, die unaufhörlich von sich selber reden. Ihre Unterhaltung ist ein Spiegel, in dem ihr aufdringliches Gesicht sich immerwährend zeigt. Sie werden mit Dir von den geringsten Kleinigkeiten reden, die ihnen begegnet sind, und verlangen, daß das Interesse, das sie daran nehmen, sie in Deinen Augen wichtiger erscheinen lasse. Sie haben alles gemacht, alles gesehen, alles gesagt, alles gedacht. Sie sind ein allgemein gültiges Vorbild, ein unerschöpfliches Thema zu Vergleichen, eine Quelle von Beispielen, die nie versiegt. Oh wie fade ist Selbstlob!
Vor einigen Tagen plagte uns ein derartiger Mensch mit Erörterungen über sich, seine Verdienste, seine Talente. Aber da es nirgends in der Welt eine ununterbrochene Bewegung gibt, so hörte er auch einmal zu reden auf und wir konnten das Wort ergreifen.
Und das taten wir. Einer, der ziemlich ärgerlich schien, beklagte sich über die Langweiligkeit der Unterhaltungen: »Was! Immer Narren, die nur sich selbst bespiegeln und alles nur auf sich beziehen.« »Sie haben recht,« begann plötzlich unser Dauerredner wieder. »Man muß es so machen wie ich. Ich lobe mich niemals. Ich bin reich, bin von vornehmer Geburt, weiß mein Geld auszugeben, meine Freunde sagen mir, daß ich geistig etwas vorstelle. Aber von alledem spreche ich niemals. Wenn ich gute Eigenschaften habe, so ist meine Bescheidenheit mir die wertvollste.«
Ich bewunderte diesen unverschämten Gesellen, und während er ganz laut redete, sagte ich ganz leise: »Glücklich, wer eitel genug ist, um von sich niemals Gutes zu reden, der seine Zuhörer fürchtet und sein Verdienst niemals der hochfahrenden Abweisung anderer aussetzt.«
Die Ruhmessucht ist wesentlich nicht verschieden von dem Erhaltungstrieb, den alle Geschöpfe haben. Es kommt uns vor, als wenn wir unser Wesen vergrößerten, wenn wir ihm in dem Gedächtnis der anderen Menschen einen bleibenden Platz verschaffen. Es ist ein neues Leben, das wir so erwerben und das uns ebenso wertvoll wird, wie das vom Himmel empfangene.
Aber wie nicht alle Menschen in gleichem Maße am Leben hangen, so sind sie auch nicht gleichmäßig empfänglich für den Ruhmesgedanken. Diese edle Leidenschaft ist ihnen wohl auch ins Herz gesenkt, aber Phantasie und Erziehung wandeln sie auf tausend verschiedene Weisen.
Besteht dieser Unterschied schon zwischen Mensch und Mensch, so ist er in weit höherem Grade fühlbar zwischen Volk und Volk.
Man kann als Grundsatz aufstellen, daß in jedem Staat das Ruhmverlangen wächst mit der Freiheit der Untertanen und mit ihr abnimmt: der Ruhm ist nie der Genosse des Sklaventums.
Ein sehr vernünftiger Mann sagte mir neulich: »Man ist in Frankreich in vielen Hinsichten freier als in Persien; folglich liebt man hier auch den Ruhm mehr. Diese glückliche Vorstellung läßt jeden Franzosen mit Lust und Liebe tun, was ein Sultan von seinen Untertanen nur erreicht, indem er ihnen unaufhörlich Strafen und Belohnungen vor Augen hält.
»So ist denn auch der Fürst bei uns eifersüchtig auf die Erhaltung der Ehre auch des letzten seiner Untertanen bedacht. Dafür gibt es eigene, hochangesehene Gerichtshöfe. Das ist gleichsam das heiligste Gut der Nation und das einzige, über das der Herrscher nicht frei verfügt, weil er das schon in seinem eigenen Interesse nicht darf. Wenn sich also ein Untertan in seiner Ehre durch den Fürsten selbst für gekränkt hält, sei es durch eine Bevorzugung oder ein Zeichen der Mißachtung, verläßt er sofort den Hof, sein Amt, seinen Dienst und zieht sich ins Privatleben zurück.
»Der Unterschied zwischen den französischen Soldaten und den Euren ist der, daß die einen sich aus ihrer Natur nach feigen Sklaven zusammensetzen, die die Todesfurcht nur aus Furcht vor Strafe überwinden. Das erzeugt aber in der Seele eine neue Art von Furcht, die sie geradezu stumpfsinnig macht. Die anderen dagegen werfen sich den feindlichen Waffen mit Begeisterung entgegen und bannen die Todesfurcht durch eine ihr überlegene Befriedigung.
»Aber das Allerheiligste der Ehre, des guten Rufes und der Tugend scheint in den Republiken errichtet und den Ländern, wo man das Wort Vaterland aussprechen kann. In Rom, in Athen, in Sparta bezahlte die Ehre allein die ausgezeichnetsten Dienste. Ein Kranz von Eichenblättern oder Lorbeer, ein Standbild, eine Lobrede galt als eine gewaltige Belohnung für eine gewonnene Schlacht oder eine eroberte Stadt.
»Dort fand sich ein Mann, der eine gute Tat getan, durch diese Tat schon hinreichend belohnt. Er konnte nicht einen seiner Landsleute anblicken, ohne das frohe Bewußtsein zu haben, sein Wohltäter zu sein: er zählte die Zahl seiner Verdienste nach der seiner Mitbürger. Jeder Mensch ist fähig, einem andern Gutes zu tun, aber den Göttern gleichen heißt es, wenn man zu einer ganzen Gemeinschaft Glück beiträgt.
»Muß nun nicht dieser edle Wetteifer im Herzen der Perser ganz erloschen sein, bei denen Amt und Würde nur von der Laune des Herrschers abhängen? Guter Ruf und Tugend gelten dort als eingebildet, wenn sie nicht von der Gunst des Fürsten begleitet sind, mit der sie entstehen und vergehen. Ein Mann, der die allgemeine Achtung für sich hat, ist doch niemals sicher, am nächsten Tage nicht ehrlos zu sein. Heut ist er noch kommandierender General: vielleicht macht ihn der Fürst morgen zu seinem Leibkoch und er kann nur noch auf den Ruhm hoffen, ein gutes Ragout zu bereiten.«
Aus dieser allgemein verbreiteten Leidenschaft der Franzosen für den Ruhm hat sich in der Seele des einzelnen ein gewisses Etwas herausgebildet, das man Ehrgefühl nennt. Es ist das Kennzeichen eines jeden Standes, doch ist es am ausgesprochensten bei den Mitgliedern des Heeres: das nennt man das Ehrgefühl par excellence. Es wäre schwer, Dir davon eine Vorstellung zu geben, weil wir nichts ganz Entsprechendes haben.
Ehemals gehorchten die Franzosen, besonders die Adligen, kaum anderen Gesetzen, als denen dieses Ehrgefühls. Diese Gesetze regelten ihre ganze Lebensführung, und sie waren so streng, daß man nicht ohne eine Strafe, die grausamer als die Todesstrafe war, ihre kleinste Bestimmung, ich will nicht sagen übertreten, sondern nicht einmal umgehen konnte.
Wenn es sich um Erledigung von Streitigkeiten handelte, so schrieben sie eigentlich nur einen Weg vor, das Duell, das alle Schwierigkeiten beseitigte. Aber das üble dabei war, daß das Urteil oft zwischen anderen Parteien als den eigentlich dabei interessierten ausgetragen wurde.
Vorausgesetzt, daß ein Mann mit einem anderen bekannt war, so mußte er bei einem vorliegenden Streite mit seiner Person für ihn eintreten, als wenn er selber der Gereizte wäre. Er fühlte sich immer durch eine solche Wahl und eine so schmeichelhafte Bevorzugung geehrt: und einer, der nicht vier Goldstücke hingegeben hätte, um einen anderen nebst seiner ganzen Familie vor dem Galgen zu bewahren, erhob keine Schwierigkeit, wenn es sich darum handelte, sein Leben für ihn zu wagen.
Diese Art der Entscheidung war ziemlich schlecht ausgedacht. Denn daraus, daß ein Mann stärker oder geschickter als ein anderer war, folgte noch nicht, daß das Recht auf seiner Seite stand.
Folglich haben die Könige das Duell bei strenger Strafe verboten. Aber vergeblich. Denn die Ehre, die immer noch herrschen will, empört sich dagegen und erkennt keine Gesetze an.
Folglich sind die Franzosen in einer bösen Zwangslage. Denn dieselben Ehrengesetze zwingen einen Ehrenmann, sich zu rächen, wenn er beleidigt ist, und auf der anderen Seite straft ihn die Justiz mit den grausamsten Strafen, wenn er sich rächt. Folgt man den Ehrengesetzen, so stirbt man auf dem Schafott, folgt man den bürgerlichen, so wird man für alle Zeit aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Es gibt also nur die eine grausame Wahl: sterben, oder unwürdig sein, zu leben.
Du fragst mich, ob es in Frankreich auch Juden gibt? Wisse, daß überall, wo es Geld gibt, es auch Juden gibt. Du fragst mich, was sie hier treiben? Genau dasselbe, was sie auch in Persien tun. Nichts gleicht einem asiatischen Juden mehr als ein europäischer.
Sie zeigen bei den Christen wie bei uns ein zähes Festhalten an ihrer Religion, das bis zur Torheit geht.
Die jüdische Religion ist ein alter Stamm, von dem zwei Zweige ausgehen, die die ganze Erde überschatten, ich meine den Mohammedanismus und das Christentum. Oder sie ist vielmehr eine Mutter, die zwei Töchter gezeugt hat, die sie dann mit tausend Wunden bedeckt haben. Denn in religiösen Dingen sind die Nächsten die größten Feinde. Aber wie schlechte Behandlung sie auch von ihnen hat tragen müssen, sie hört nicht auf, sich dessen zu rühmen, daß sie sie in die Welt gesetzt habe. Sie bedient sich beider, um die ganze Welt zu umspannen, während andrerseits ihr verehrungswürdiges Alter alle Zeiten umfaßt.
Die Juden betrachten sich also als die Quelle aller Heiligkeit und den Ursprung jeglicher Religion. Uns betrachten sie dagegen als Ketzer, die das Gesetz umgestoßen haben, oder vielmehr als abtrünnige Juden.
Wenn die Umgestaltung sich unmerklich vollzogen hätte, meinen sie, wären sie auch leicht verführt worden. Aber da sie plötzlich und gewaltsam eingetreten ist, da sie Tag und Stunde beider Geburten angeben können, so rümpfen sie die Nase darüber, daß man unser Alter nachrechnen kann, und halten fest an einer Religion, die so alt ist wie die Welt selbst.
Sie haben sich niemals in Europa einer so ruhigen Zeit erfreut, wie die jetzige für sie ist. Man beginnt unter den Christen den Geist der Unduldsamkeit abzulegen, der früher lebendig war. Man hat in Spanien bei der Vertreibung der Juden schlechte Geschäfte gemacht, wie in Frankreich bei der Beunruhigung derjenigen Christen, deren Glauben etwas von dem des Königs abwich. Man ist dahinter gekommen, daß der Eifer für die Weiterverbreitung einer Religion etwas anderes ist als die Anhänglichkeit, die man für sie haben soll, und daß, um sie zu lieben und zu bewahren, es nicht nötig ist, die zu hassen und zu verfolgen, die sie nicht beobachten.
Es wäre zu wünschen, daß die Muselmanen über diesen Gegenstand ebenso vernünftig dächten wie die Christen, damit man endlich einmal zwischen Ali und Abubekr Frieden machen und Gott die Sorge überlassen könnte, zwischen seinen heiligen Propheten den Entscheid zu treffen. Ich wollte, daß man sie durch Handlungen der Achtung und Anbetung ehrte und nicht durch unbegründete Bevorzugungen, und daß man sich ihre Gunst zu sichern suchte, welchen Platz ihnen auch Gott angewiesen haben möge, zu seiner Rechten oder unter dem Schemel seiner Füße.
Man sagt, daß der Mensch ein geselliges Tier sei. Von dem Gesichtspunkt aus betrachtet ist ein Franzose mehr Mensch als irgend ein anderer: er ist der Mensch par excellence, denn er scheint einzig für die Geselligkeit geschaffen.
Aber ich habe unter den Franzosen Leute bemerkt, die nicht nur gesellig sind, sondern die allgemeine Geselligkeit selbst. Sie vervielfältigen sich nach allen Ecken und Enden, sie bevölkern im gleichen Augenblick die vier Viertel einer Stadt. Hundert Menschen dieser Art machen mehr Wirtschaft als zweitausend Durchschnittsbürger. Sie könnten für die Augen der Fremden ganz allein die Lücken verdecken, die Hunger und Pestilenz gerissen haben. Man fragt in der Philosophie, ob ein Körper gleichzeitig an mehreren Orten sein kann: sie sind ein Beweis für das, was die Philosophen in Frage ziehen.
Sie scheinen immer geschäftig, weil sie das hochwichtige Geschäft haben, jeden, der ihnen zu Gesicht kommt, zu fragen, woher er kommt und wohin er geht.
Man würde vergeblich ihnen die Einbildung auszutreiben versuchen, daß es zum guten Ton gehört, jedem einzelnen der Gesellschaft alltäglich einen Besuch zu machen, ungerechnet die Besuche im großen an den Orten, wo man sich trifft. Aber da diese letzteren viel zu einfach sind, so rechnen sie in ihrem Zeremonial nicht.
Sie nutzen die Türen mit den Schlägen der Türklopfer mehr ab, als es Wind und Wetter tun. Wollte man die Liste aller Portiers nachsehen, würde man seinen Spaß daran haben, wie ihr Name in der Orthographie dieser braven Schweizer mißhandelt wird. Ihr Leben geht auf in Beteiligung an Begräbnissen, Trauerbesuchen und Hochzeitsgratulationen. Hat der König einem seiner Untertanen eine Auszeichnung zuteil werden lassen, so kostet's sie einen Wagen, um zu dem Beglückten zu fahren und ihm ihre Freude auszudrücken. Dann kehren sie so recht ermüdet nach Haus zurück, um sich auszuruhen und am andern Morgen ihre mühsamen Funktionen wieder aufzunehmen.
Einer von ihnen starb neulich an gänzlicher Erschöpfung und man setzte ihm folgende Grabschrift: »Hier ruht, der niemals ruhte. Er ist hinter 135 Begräbnissen hergewandelt. Er hat freudig Anteil genommen an der Geburt von 2680 Kindern. Die Pensionen, wegen deren er seine Freunde, und immer in verschiedenen Ausdrücken, beglückwünscht hat, belaufen sich auf 2 600 000 Livres. Der Weg, den er auf dem Pflaster von Paris zurückgelegt hat, beträgt 9600 Stadien, der auf dem Lande 36. Seine Unterhaltung war sehr unterhaltend: er hatte einen Vorrat von 365 Geschichten. Außerdem besaß er seit seiner frühesten Jugend 118 geistreiche Aussprüche, die den alten Schriftstellern entnommen waren, und die er bei besonders glänzenden Anlässen anwandte. Er starb endlich im 60. Jahre seines Lebens. Ich verstumme, o Wanderer, denn wie wollte ich damit fertig werden. Dir alles zu sagen, was er getan und was er gesehen hat?«
Obgleich die Franzosen viel sprechen, gibt es doch unter ihnen eine Art von schweigsamen Derwischen, die man Karthäuser nennt. Man sagt, daß sie sich beim Eintritt ins Kloster die Zunge abschneiden, und man möchte sehr wünschen, daß die anderen Derwische sich ebenso alles abschneiden möchten, was sie in ihrem Amte nicht weiter verwenden können und sollen.
Übrigens, was mir dabei einfällt: es gibt noch viel schweigsamere Leute als die Karthäuser, die ein ganz außergewöhnliches Talent besitzen. Das sind die Leute, die es verstehen zu reden, ohne etwas zu sagen, und die eine Unterhaltung zwei geschlagene Stunden beleben, ohne daß es möglich wäre, sie zu verstehen, sich ihre Gedanken zu eigenem Gebrauch anzueignen, noch ein Wort zu behalten von dem, was sie gesagt haben.
Diese Sorte Männer wird von den Frauen angebetet, aber doch noch nicht so sehr wie andere, die von der Natur die liebenswürdige Gabe empfangen haben, im rechten Augenblicke zu lächeln – das heißt also alle Augenblicke, und die die Anmut einer heiteren Zustimmung über alles breiten, was die Damen sagen.
Aber auf dem Gipfel der Geistreichigkeit sind sie erst, wenn sie bei allem etwas zu finden wissen und es verstehen, tausend kleine geistreiche Züge auch in den gewöhnlichsten Dingen zu entdecken.
Ich kenne noch andere, die sich auf die Kunst verstehen, leblose Dinge an der Unterhaltung teilnehmen zu lassen, also z. B. ihren gestickten Rock, ihre blonde Perücke, ihre Tabaksdose, ihren Spazierstock, ihre Handschuhe mitreden zu lassen. Es ist empfehlenswert, sich bereits von der Straße aus durch das Gerassel seines Wagens und des heftig aufgeschlagenen Türklopfers bemerklich zu machen: diese Einleitung bereitet auf den Rest der Rede würdig vor, und wenn der Eingang schön ist, macht er alle Dummheiten erträglich, die dann kommen, aber die dann glücklicherweise zu spät kommen.
Ich versichere Dir, daß diese Talentchen, von denen man bei uns nicht viel Aufhebens machen würde, hier denen, die so glücklich sind, sie zu besitzen, sehr zustatten kommen, und daß ein Mensch von gesundem Menschenverstand neben diesen Leuten kaum eine glänzende Rolle spielt.
Der Kaffee ist sehr beliebt in Paris. Es gibt eine große Zahl öffentlicher Lokale, wo man ihn ausschänkt. In einigen dieser Häuser tauscht man die Tagesneuigkeiten aus, in andern spielt man Schach. Eins gibt es, wo man den Kaffee so zubereitet, daß er denen, die ihn trinken, Geist verleiht. Wenigstens gibt es keinen, der nicht beim Verlassen des Lokals viermal so viel zu haben meint, als er beim Betreten desselben besaß.
Aber was mich an diesen Schöngeistern stört, ist, daß sie sich ihrem Vaterlande nicht nützlicher machen und ihren Witz an kindische Dinge verschwenden. So fand ich beispielsweise, als ich nach Paris kam, sie über den kleinlichsten Gegenstand, den man sich denken kann, in erhitztem Streite. Es handelte sich um den Ruf und das Ansehen eines alten griechischen Dichters namens Homer, dessen Geburtsort man seit 2000 Jahren ebensowenig kennt wie sein Todesjahr. Beide Parteien geben zu, daß er ein ausgezeichneter Dichter sei, es handelte sich nur noch um das Mehr oder Weniger, das man ihm zuerkennen müßte. Ein jeder wollte ihn einschätzen, aber unter diesen Verteilern des Nachruhmes wogen die einen besser als die andern – das war der Streit. Er war ziemlich lebhaft, und die herzlich gemeinten Grobheiten und Spöttereien flogen derartig herüber und hinüber, daß die Art des Streites nicht minder meine Bewunderung erregte als der Streitgegenstand. Wenn nun, sagte ich mir im stillen, jemand unbesonnen genug wäre, vor einem dieser Verteidiger des griechischen Dichters den Ruf eines ehrenwerten Mitbürgers anzugreifen, so würde er nicht schlecht ankommen, und ich glaube, daß diese so zarte Besorgnis um den Ruf eines Toten nachdrücklich in Flammen geraten würde, um den der Lebenden zu schützen! Aber, wie dem auch sei, fügte ich hinzu, Gott bewahre mich davor, mir je die Feindschaft eines dieser Zensoren des alten Dichters zuzuziehen, den der zweitausendjährige Aufenthalt im Grabe nicht vor einem so unversöhnlichen Haß hat retten können! Jetzt führen sie schmerzlose Lufthiebe. Aber wie würde es erst sein, wenn ihre Wut durch die Gegenwart eines lebendigen Feindes gereizt würde?
Die, von denen ich eben sprach, streiten sich in der gewöhnlichen Sprache. Man muß sie von einer anderen Art Wortkämpfer unterscheiden, die sich einer barbarischen Sprache bedienen (des sogenannten scholastischen Lateins), die ihre Wut und Hartnäckigkeit noch zu steigern scheint. Es gibt Stadtviertel – (bei der Sorbonne d. h. der Universität) –, wo man dicke, schwarze Haufen solcher Leute sieht. Sie nähren sich von Definitionen und leben von dunklen Prämissen und falschen Folgerungen. Dies Gewerbe, in dem man Hungers sterben müßte, ernährt doch seinen Mann.

Der Schluß des Briefes bezieht sich auf den Streit der Jansenisten. Diese waren eine sich nach dem Bischof von Ypern (1585-1638) nennende Sekte, die in Frankreich festen Fuß gefaßt hatte und sogar in Paris ein Nonnenkloster, Port Royal des Champs, und ein Männerkloster, das berühmte Port Royal, besaß, aus dem unter anderen Pascal und Racine hervorgegangen sind. Sie standen in starkem Widerspruch zu der katholischen Orthodoxie, indem sie über deren Lehren hinweg zu der Einfachheit des Urchristentums zurückkehren wollten, Äußerlichkeiten geringschätzten, ein schlichtes und sittlich reines Leben als einzige Bedingung hinstellten, ja die Erlösung nicht von den guten Werken und der Vermittelung irgend eines Kirchendieners, sondern allein von der inneren Heiligung des Menschen abhängig machten. Das Papsttum nahm ihnen gegenüber keinen konsequenten Standpunkt ein, entschloß sich aber zuletzt doch zu ihrer Verurteilung, die durch zwei Bullen Clemens' XI., die Bulle: Vineam domini, 1705, und die Bulle: Unigenitus, 1713, vollzogen wurde. Beide zusammen nannte man die Konstitution. Sie hat im ganzen 18. Jahrhundert viel Kämpfe hervorgerufen. Da der 24. Brief das von uns fortgelassene fingierte Datum 1712 trägt, so paßt das freilich auf keine der beiden Bullen und es liegt hier also ein übrigens ganz belangloser Gedächtnisfehler Montesquieus vor, der den Brief vielleicht 1720 niederschrieb.
Die Feinde der Jansenisten waren naturgemäß die Jesuiten, denen auch der P. Le Tellier, des Königs Beichtvater, angehörte.
Der Brief richtet sich gegen die 1685 erfolgte Aufhebung des Ediktes von Nantes. Von Heinrich IV. im Jahre 1598 erlassen, gewährte es den Protestanten freie Religionsübung. Seine Aufhebung durch Ludwig XIV. hatte die grausamste Behandlung der Protestanten zur Folge, die zur Auswanderung von etwa 200 000 Réfugiés führte.
Montesquieu spielt hier auf ein Buch Polygamia triumphatrix an, das 1682 erschien und aus Altem und Neuem Testament zu beweisen suchte, daß die Vielweiberei erlaubt, ja geboten sei. Bedeutung hat es nie gehabt.
Montesquieu gebraucht die Worte Algebra und Algebristen hier in einem, übrigens damals allgemein angenommenen, Sinne. John Law, auf den angespielt wird, war solch ein Algebrist, Erfinder eines Systems, das angeblich die Reichtümer des einzelnen wie der Nation mühelos ins Unermeßliche steigern sollte. Uns fehlt heute mit der Sache auch das Wort.
Die damaligen französischen »Zeitschriften« sind nicht mit unseren heutigen zu vergleichen. Es waren halbmonatlich oder monatlich erscheinende Hefte, die von den neuen literarischen Erscheinungen berichteten, besonders Inhaltsangaben der neuen Bücher brachten.
Daß Dichter Prügel bekamen, war etwas ganz Gewöhnliches. Bekannt ist, daß Voltaire für eine solche schmähliche Mißhandlung, die ihm in seinem dreißigsten Lebensjahre widerfuhr, vergeblich Genugtuung zu erlangen versucht hat. Man sagte ihm, daß er, als er unter die Dichter ging, ja gewußt haben müsse, was seiner unter Umständen warte.
Gemeint ist beidemal das Café Procope, das sich gegenüber der Comédie-Française befand, so genannt nach seinem Wirte, einem Sizilianer, der als der erste das neue Getränk in Paris ausschänkte. Dieses Café blieb zwei Jahrhunderte hindurch der Sammelplatz aller bedeutenden Geister von Paris.