
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Episode de la vie d'un artiste. Oe. 4.
Der vielfache Stoff, den diese Symphonie zum Nachdenken bietet, könnte sich in der Folge leicht zu sehr verwickeln, daher ich es vorziehe, sie in einzelnen Theilen, so oft auch einer von dem andern zur Erklärung borgen muß, durchzugehen, nämlich nach den vier Gesichtspunkten, unter denen man ein Musikwerk betrachten kann, d. i. je nach der Form (des Ganzen, der einzelnen Theile, der Periode, der Phrase), je nach der musikalischen Composition (Harmonie, Melodie, Satz, Arbeit, Styl), nach der besondern Idee, die der Künstler darstellen wollte, und nach dem Geiste, der über Form, Stoff und Idee waltet.
Die Form ist das Gefäß des Geistes. Größere Räume fordern, sie zu füllen, größern Geist. Mit dem Namen »Symphonie« bezeichnet man bis jetzt in der Instrumentalmusik die größten Verhältnisse.
Wir sind gewohnt, nach dem Namen, die eine Sache trägt, auf diese selbst zu schließen; wir machen andre Ansprüche auf eine »Phantasie«, andre auf eine »Sonate«.
Bei Talenten zweiten Ranges genügt es, daß sie die hergebrachte Form beherrschen: bei denen ersten Ranges billigen wir, daß sie sie erweitern. Nur das Genie darf frei gebaren.
Nach der neunten Symphonie von Beethoven, dem äußerlich größten vorhandenen Instrumentalwerke, schien Maaß und Ziel erschöpft.
Es sind hier anzuführen: Ferdinand Ries, dessen entschiedene Eigenthümlichkeit nur eine Beethoven'sche verdunkeln konnte. Franz Schubert, der phantastereiche Maler, dessen Pinsel gleich tief vom Mondesstrahle, wie von der Sonnenflamme getränkt war und der uns nach den Beethoven'schen neun Musen vielleicht eine zehnte geboren hätte. Die Symphonie in C war damals noch nicht erschienen. Spohr, dessen zarte Rede in dem großen Gewölbe der Symphonie, wo er sprechen sollte, nicht stark genug wiederhallte. Kalliwoda, der heitere, harmonische Mensch, dessen späteren Symphonieen bei tieferem Grunde der Arbeit die Höhe der Phantasie seiner ersten fehlte. Von Jüngeren kennen und schätzen wir noch L. Maurer, Fr. Schneider, J. Moscheles, C. G. Müller. A. Hesse, F. Lachner und Mendelssohn, den wir geflissentlich zuletzt nennen.
Keiner von den vorigen, die bis auf Franz Schubert noch unter uns leben, hatte an den alten Formen etwas Wesentliches zu verändern gewagt, einzelne Versuche abgerechnet, wie in der neuesten Symphonie von Spohr. Mendelssohn, ein productiv wie reflectiv bedeutender Künstler, mochte einsehen, daß auf diesem Wege nichts zu gewinnen sei, und schlug einen neuen ein, auf dem ihm allerdings Beethoven in seiner großen Leonorenouverture vorgearbeitet hatte. Mit seinen Concertouverturen, in welchen er die Idee der Symphonie in einen kleineren Kreis zusammendrängte, errang er sich Kron' und Scepter über die Instrumentalcomponisten des Tages. Es stand zu fürchten, der Name der Symphonie gehöre von nun an nur noch der Geschichte an.
Das Ausland hatte zu alledem still geschwiegen. Cherubini arbeitete vor langen Jahren an einem Symphoniewerk, soll aber selbst, vielleicht zu früh und bescheiden, sein Unvermögen eingestanden haben. Das ganze übrige Frankreich und Italien schrieb Opern.
Einstweilen sinnt in einem dunkeln Winkel an der Nordküste Frankreichs ein junger Student der Medicin über Neues. Vier Sätze sind ihm zu wenig; er nimmt, wie zu einem Schauspiele, fünf. Erst hielt ich (nicht des letzten Umstandes halber, der gar kein Grund wäre, da die Beethoven'sche neunte Symphonie vier Sätze zählt, sondern aus andern) die Symphonie von Berlioz für eine Folge jener neunten; sie wurde aber schon 1820 im Pariser Conservatoir gespielt, die Beethoven'sche aber erst nach dieser Zeit veröffentlicht, so daß jeder Gedanke an eine Nachbildung zerfällt. Jetzt Muth und an die Symphonie selbst!
Sehen wir die 5 Abtheilungen im Zusammenhang an, so finden wir sie der alten Reihenfolge gemäß bis auf die beiden letzten, die jedoch, zwei Scenen eines Traumes, wiederum ein Ganzes zu bilden scheinen. Die erste Abtheilung fängt mit einem Adagio an, dem ein Allegro folgt, die zweite vertritt die Stelle des Scherzo, die dritte die des Mitteladagio, die beiden letzten geben den Allegroschlußsatz. Auch in den Tonarten hängen sie wohl zusammen; das Einleitungslargo spielt in C moll, das Allegro in C dur, das Scherzo in A dur, das Adagio in F dur, die beiden letzten Abtheilungen in G moll und C dur. Bis hierher geht Alles eben. Geläng' es mir auch, dem Leser, welchen ich Trepp' auf, Trepp' ab durch dieses abenteuerliche Gebäude begleiten möchte, ein Bild von seinen einzelnen Gemächern zu geben.
Die langsame Einleitung zum ersten Allegro unterscheidet sich (ich rede hier immer von den Formen) nur wenig von andern anderer Symphonieen, wenn nicht sogar durch eine gewisse Ordnung, die einem nach häufigerem Nach- und Voreinanderrücken der größeren Perioden auffällt. Es sind eigentlich zwei Variationen über ein Thema mit freien Intermezzis. Das Hauptthema zieht sich bis Tact 2, S. 2. Zwischensatz bis Tact 5, S. 3. Erste Variation bis Tact 6, S. 5. Zwischensatz bis Tact 8, S. 6. Zweite Variation auf der Tenue der Bässe (wenigstens find' ich in dem obligaten Horn die Intervalle des Themas, obgleich nur anklingend) bis Tact 1, S.7. Streben nach dem Allegro zu. Vorläufige Accorde. Wir treten aus der Vorhalle in's Innere. Allegro. Wer beim Einzelnen lange stehen bleiben will, wird nicht nachkommen und sich verirren. Vom Anfangsthema übersehet rasch die ganze Seite bis zum ersten animato S.9. Drei Gedanken waren hier eng einander angefügt: der erste (Berlioz nennt ihn la double idée fixe aus späteren Gründen) geht bis zu den Worten sempre dolce e ardamente, der zweite (aus dem Adagio entlehnte) bis zum ersten sf, bis auf S.9 sich der letzte anschließt bis zum animato. Das Folgende fasse man zusammen bis zum rinforzando der Bässe auf S.10 und übersehe dabei die Stelle vom ritenuto il tempo bis animato auf S.9 nicht. Mit dem rinforzando kommen wir an einen sonderbar beleuchteten Ort (das eigentliche zweite Thema), an dem man einen leisen Rückblick über das Vorhergehende gewinnt. Der erste Theil schließt und wird wiederholt. Von da an scheinen sich die Perioden klarer folgen zu wollen, aber mit dem Vordrängen der Musik dehnen sie sich jetzt kürzer, jetzt länger, so vom Anfange des zweiten Theiles bis zum con fuoco (S.12), von da an bis zum sec (S.13). Stillstand. Ein Horn in ferner Weite. Etwas Wohlbekanntes erklingt bis zum ersten pp (S.14). Jetzt werden die Spuren schwieriger und geheimnißvoller. Zwei Gedanken von 4 Tacten, dann von 9 Tacten. Gänge von je zwei Tacten. Freie Bogen und Wendungen. Das zweite Thema, in immer kleineren Zusammenschiebungen, erscheint nachher vollständig im Glanz bis zum pp (S.16). Dritter Gedanke des ersten Themas in immer tiefer sinkenden Lagen. Finsterniß. Nach und nach beleben sich die Schattenrisse zu Gestalten bis zum disperato (S.17). Die erste Form des Hauptthemas in den schiefsten Brechungen bis S.19. Jetzt das ganze erste Thema in ungeheurer Pracht, bis zum animato (S.20). Völlig phantastische Formen, nur einmal, wie zerbrochen, an die ältern erinnernd. Verschwinden.
Berlioz kann kaum mit größerem Widerwillen den Kopf eines schönen Mörders secirt haben, Er studirte in seiner Jugend Medicin. als ich seinen ersten Satz. Und hab' ich noch dazu meinen Lesern mit der Section etwas genützt? Aber ich wollte dreierlei damit: erstens denen, welchen die Symphonie gänzlich unbekannt ist, zeigen, wie wenig ihnen in der Musik durch eine zergliedernde Kritik überhaupt klar gemacht werden kann, denen, die sie oberflächlich durchgesehen und weil sie nicht gleich wußten, wo aus und ein, sie vielleicht bei Seite legten, ein paar Höhenpunkte andeuten, endlich denen, die sie kennen, ohne sie anerkennen zu wollen, nachweisen, wie trotz der scheinbaren Formlosigkeit diesem Körper, in größeren Verhältnissen gemessen, eine richtig symmetrische Ordnung inwohnt, des inneren Zusammenhangs gar nicht zu erwähnen. Aber an dem Ungewohnten dieser neuen Form, des neuen Ausdrucks liegt wohl zum Theil der Grund zum unglücklichen Mißverständniß. Die Meisten haften beim ersten oder zweiten Anhören zu sehr an den Einzelnheiten und es verhält sich damit, wie mit dem Lesen einer schwierigen Handschrift, über deren Entzifferung einer, der sich bei jedem einzelnen Wort aufhält, ungleich mehr Zeit braucht, als der sie erst im Ganzen überfliegt, um Sinn und Absicht kennen zu lernen. Zudem, wie schon angedeutet, macht nichts so leicht Verdruß und Widerspruch, als eine neue Form, die einen alten Namen trägt. Wollte z. B. Jemand etwas im Fünfviertel-Tact Geschriebenes einen Marsch, oder zwölf an einander gereihte kleine Sätze eine Symphonie nennen, so nimmt er gewiß vorweg gegen sich ein, – indeß untersuche man immer, was an der Sache ist. Je sonderbarer und kunstreicher also ein Werk augenscheinlich aussieht, je vorsichtiger sollte man urtheilen. Und gibt uns nicht die Erfahrung an Beethoven ein Beispiel, dessen, namentlich letzte Werke, sicherlich ebenso ihrer eigenthümlichen Constructionen und Formen, in denen er so unerschöpflich erfand, wie des Geistes halber, den freilich Niemand läugnen konnte, im Anfang unverständlich gefunden wurden? Fassen wir jetzt, ohne uns durch kleine, allerdings oft scharf hervorspringende Ecken stören zu lassen, das ganze erste Allegro in weiteren Bogen zusammen, so stellt sich uns deutlich diese Form hervor:
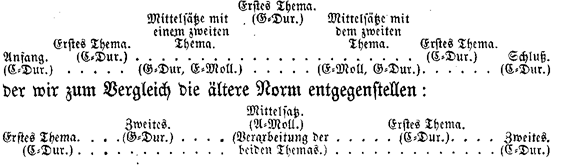
Wir wüßten nicht, was die letzte vor der ersten an Mannichfaltigkeit und Uebereinstimmung voraus haben sollte, wünschen aber beiläufig, eine recht ungeheure Phantasie zu besitzen und dann zu machen, wie es gerade geht. – Es bleibt noch etwas über die Structur der einzelnen Phrase zu sagen. Die neueste Zeit hat wohl kein Werk aufzuweisen, in dem gleiche Tact- und Rhythmus-Verhältnisse mit ungleichen freier vereint und angewandt wären, wie in diesem. Fast nie entspricht der Nachsatz dem Vordersatze, die Antwort der Frage. Es ist dies Berlioz so eigenthümlich, seinem südlichen Charakter so gemäß und uns Nordischen so fremd, daß das unbehagliche Gefühl des ersten Augenblicks und die Klage über Dunkelheit wohl zu entschuldigen und zu erklären ist. Aber mit welch' kecker Hand dies Alles geschieht, dergestalt, daß sich gar nichts dazusetzen oder wegwischen läßt, ohne dem Gedanken seine scharfe Eindringlichkeit, seine Kraft zu nehmen, davon kann man sich nur durch eignes Sehen und Hören überzeugen. Es scheint, die Musik wolle sich wieder zu ihren Uranfängen, wo sie noch nicht das Gesetz der Tactesschwere drückte, hinneigen und sich zur ungebundenen Rede, zu einer höheren poetischen Interpunktion (wie in den griechischen Chören, in der Sprache der Bibel, in der Prosa Jean Paul's) selbstständig erheben. Wir enthalten uns, diesen Gedanken weiter auszuführen, erinnern aber am Schlüsse dieses Abschnittes an die Worte, die vor vielen Jahren der kindliche Dichtergeist Ernst Wagner's vorahnend ausgesprochen. »Wem es vorbehalten ist, in der Musik die Tyrannei des Tactes ganz zu verdecken und unfühlbar zu machen, der wird diese Kunst wenigstens scheinbar frei machen; wer ihr dann Bewußtsein gibt, der wird sie zur Darstellung einer schönen Idee ermächtigen; und von diesem Augenblick an wird sie die erste aller schönen Künste sein.« –
Es würde, wie schon gesagt, zu weit und zu nichts führen, wenn wir, wie die erste, so die anderen Abtheilungen der Symphonie zergliederten. Die zweite spielt in allerhand Windungen, wie der Tanz, den sie darstellen soll: die dritte, wohl überhaupt die schönste, schwingt sich ätherisch wie ein Halbbogen auf und nieder: die beiden letzten haben gar kein Centrum und streben fortwährend dem Ende zu. Immer muß man bei aller äußeren Unförmlichkeit den geistigen Zusammenhang anerkennen und man könnte hier an jenen, obwohl schiefen Ausspruch über Jean Paul denken, den Jemand einen schlechten Logiker und einen großen Philosophen nannte.
Bis jetzt hatten wir es nur mit dem Gewande zu thun: wir kommen nun zu dem Stoff, aus dem es gewirkt, auf die musikalische Composition.
Vorne herein bemerk' ich, daß ich nur nach dem Clavierauszuge urtheilen kann, in welchem jedoch an den entscheidendsten Stellen die Instrumente angezeigt sind. Und wäre das auch nicht, so scheint mir Alles so im Orchestercharakter erfunden und gedacht, jedes Instrument so an Ort und Stelle, ich möchte sagen, in seiner Urtonkraft angewandt, daß ein guter Musiker, versteht sich bis auf die neuen Combinationen und Orchestereffecte, in denen Berlioz so schöpferisch sein soll, sich eine leidliche Partitur fertigen könnte.
Ist mir jemals ein Urtheil ungerecht vorgekommen, so ist es das summarische des Herrn Fétis in den Worten: je vis, qu'il manquait d'idées mélodiques et harmoniques. Möchte er, wie er auch gethan, Berlioz Alles absprechen, als da ist: Phantasie, Erfindung, Originalität, – aber Melodieen- und Harmonieen-Reichthum? Es fällt mir gar nicht ein, gegen jene übrigens glänzend und geistreich geschriebene Recension zu polemisiren, da ich in ihr nicht etwa Persönlichkeit oder Ungerechtigkeit, sondern geradezu Blindheit, völligen Mangel eines Organs für diese Art von Musik erblicke. Brauchte mir doch der Leser nichts zu glauben, was er nicht selbst fände! So oft auch einzelne herausgerissene Notenbeispiele schaden, so will ich doch versuchen, das Einzelne dadurch anschaulicher zu machen.
Was den
harmonischen Werth unserer Symphonie betrifft, so merkt man ihr allerdings den achtzehnjährigen, unbeholfenen Componisten an, der sich nicht viel schiert um rechts und links, und schnurstracks auf die Hauptsache losläuft. Will Berlioz z. B. von G nach Des, so geht er ohne Complimente hinüber (s. Notenbeispiel 1) s. S. 16. Schüttle man mit Recht über solch' Beginnen den Kopf! – aber verständige musikalische Leute, die die Symphonie in Paris gehört, versicherten, es dürfe an jener Stelle gar nicht anders heißen: ja Jemand hat über die Berlioz'sche Musik das merkwürdige Wort fallen lassen:
que cela est fort bien, quoique ce ne soit pas de la musique.
Ist nun das auch etwas in die Luft parlirt, so läßt es sich schon einmal anhören. Zudem finden sich solche krause Stellen nur ausnahmsweise
Vergl. jedoch S. 61 T. 1 zu 2.: ich möchte sogar behaupten, seine Harmonie zeichne sich trotz der mannichfaltigen Combinationen, die er mit wenigem Material herstellt, durch eine gewisse Simplicität, jedenfalls durch eine Kernhaftigkeit und Gedrungenheit aus, wie man sie, freilich viel durchgebildeter, bei Beethoven antrifft. Oder entfernt er sich vielleicht zu sehr von der Haupttonart? Nehme man gleich die erste Abtheilung: erster Satz
S. 1-3 T. 5. lauter C-Moll: hierauf bringt er dieselben Intervalle des ersten Gedankens ganz getreu im Es-Dur
S. 3 T. 6: dann ruht er lange auf As
S. 6 T. 4. und kömmt leicht nach C-Dur. Wie das Allegro aus dem einfachsten C-Dur, G-Dur und E-Moll gebaut, kann man in dem Umrisse nachsehen, den ich oben zeigte. Und so ist's durchweg. Durch die ganze zweite Abtheilung klingt das helle A-Dur scharf durch, in der dritten das idyllische F-Dur mit dem verschwisterten C- und B-Dur, in der vierten G-Moll mit B- und Es-Dur; nur in der letzten geht es trotz des vorherrschenden C-Princips bunt durcheinander, wie es infernalischen Hochzeiten zukommt. Doch stößt man auch oft auf platte und gemeine
S. 2 T. 6. 7, S. 6 T. 1-3, S. 8 T. 1-8, S. 21 letztes System 1-4, in der zweiten Abtheilung S. 35 Syst. 5 T. 1-18. Harmonieen, – auf fehlerhafte, wenigstens nach alten Regeln verbotene
Gleich im Tact 1 S. 1 das H (wahrscheinlich ein Druckfehler), S. 3 T. 2-4, S. 9 T. 8 zu 9, T. 15 -19, S. 10 T. 11-14, S. 20 T. 8-18, S. 37 T. 11-14, 28 zu 29, S. 48 Syst. 5 T. 2-3, S. 57 Syst. 5 T. 3, S. 62 T. 9-14, S. 78 Syst. 5 T. 1-3 und alles folgende, S. 82 Syst. 4 T. 1-2 und alles folgende, S. 83 T. 13-17, S. 86 T. 11-13, S. 87 T. 5-6. – Ich wiederhole, daß ich nur nach dem Clavierauszuge richte: in der Partitur mag Vieles anders aussehen., von denen indeß einige ganz prächtig klingen, – auf unklare und vage
S. 20 T. 3; vielleicht sind die Harmonieen:
6-7 6-6♯ 6♭ – 6♮ 6-6♯
3♯ – 3-3♭– 3 –
Dis, E, F, Fis u. s. w.
S. 62 Syst. 5 T. 1-2, S. 65 Syst. 4 T. 3, wahrscheinlich ein Spaß von Liszt, der das Ausklingen der Becken nachmachen wollte. S. 79 T. 8-10, S. 81 T. 6 u. ff., S. 88 T. 1-3 u. a. m., auf schlecht klingende,
gequälte, verzerrte
S. 2 Syst. 4, S. 5 T. 1, S. 9 T. 15-19, S. 17 von T. 7 an eine ganze Weile fort, S. 30 Syst. 4 T. 6 zu 7, S. 28 T. 12-19, S. 88 T. 1-3 u. a.m.. Die Zeit, die solche Stellen als schön sanctioniren wollte, möge nie über uns kommen. Bei Berlioz hat es jedoch eine besondere Bewandtniß; man probire nur, irgend etwas zu ändern oder zu verbessern, wie es einem irgend geübten Harmoniker Kinderspiel ist, und sehe zu, wie matt sich Alles dagegen ausnimmt! Den ersten Ausbrüchen eines starken Jugendgemüthes wohnt nämlich eine ganz eigenthümliche unverwüstliche Kraft innen; spreche sie sich noch so roh aus, sie wirkt um so mächtiger, je weniger man sie durch Kritik in das Kunstfach hinüber zu ziehen versucht. Man wird sich vergebens bemühen, sie durch Kunst verfeinern oder durch Zwang in Schranken halten zu wollen, sobald sie nicht selbst mit ihren Mitteln besonnener umzugehen und auf eignem Wege Ziel und Richtschnur zu finden gelernt hat. Berlioz will auch gar nicht für artig und elegant gelten; was er haßt, faßt er grimmig bei den Haaren, was er liebt, möchte er vor Innigkeit zerdrücken, – ein paar Grade schwächer oder stärker: seht es einmal einem feurigen Jünglinge nach, den man nicht nach der Krämer-Elle messen soll! Wir wollen aber auch das viele Zarte und Schönoriginelle aufsuchen, das jenem Rohen und Bizarren die Wage hält. So ist der harmonische Bau des ganzen ersten Gesanges
S. 1 von T. 3 an. durchaus, so dessen Wiederholung in Es
S. 3 T. 6.. Von großer Wirkung mag das 14 Tacte lang gehaltene As der Bässe sein
S. 6 T. 4., ebenso der Orgelpunkt, der in den Mittelstimmen liegt
S. 11 T. 10.. Die chromatischen, schwer auf- und absteigenden Sextaccorde
S. 12 T. 13. sagen an und für sich nichts, müssen aber an jener Stelle ungemein imponiren. Die Gänge, wo in den Nachahmungen zwischen Baß (oder Tenor) und Sopran greuliche Octaven und Querstände hindurchklingen
S. 17 T. 7., kann man nicht nach dem Clavierauszuge beurtheilen; sind die Octaven gut verdeckt, so muß es durch Mark und Bein erschüttern. – Der harmonische Grund zur zweiten Abtheilung ist bis auf einige Ausnahmen einfach und weniger tief. Die dritte kann sich an reinem harmonischen Gehalte mit jedem andern symphonischen Meisterwerke messen: hier lebt jeder Ton. In der vierten ist Alles interessant und im bündigsten, kernigsten Styl. Die
fünfte wühlt und wüstet zu kraus; sie ist bis auf einzelne neue Stellen
S. 76 vom Syst. 4 an, S. 80, wo der Ton Es in den Mittelstimmen gegen 29 Tacte lang still hält, S. 81 T. 20, der Orgelpunkt auf der Dominante, S. 82 T. 11, wo ich vergebens die unangenehme Quinte auf Syst. 4 v. T. 1 zu 2 wegzubringen suchte. unschön, grell und widerlich.
So sehr nun auch Berlioz das Einzelne vernachlässigt und es dem Ganzen opfert, so versteht er sich auch auf das kunstreichere, fein gearbeitete Detail recht gut. Er preßt aber seine Themas nicht bis auf den letzten Tropfen aus und verleidet einem, wie Andere so oft, die Lust an einem guten Gedanken durch langweilige thematische Durchführung; er gibt mehr Fingerzeige, daß er strenger ausarbeiten könnte, wenn er wollte, und wo es gerade hinpaßt, – Skizzen in der geistreichen kurzen Weise Beethoven's. Seine schönsten Gedanken sagt er meistens nur einmal und mehr wie im Vorübergehen S. 3 T. 2, S. 14 Syst. 4 T. 6-18, S. 16 Syst. 6 T. 1-8, S. 19 Syst. 5 T. 1-15, S. 40 Syst. 4 T. 1-16. (2).
Das Hauptmotiv zur Symphonie (3), an sich weder bedeutend, noch zur contrapunktischen Arbeit geeignet, gewinnt immer mehr durch die späteren Stellungen. Schon vom Anfange des zweiten Theils wird es interessanter und so immer fort S. 16 Syst. 6 T. 3. (2), bis es sich durch schreiende Accorde zum C-Dur durchwindet S. 19 T. 7.. In der zweiten Abtheilung baut er es Note um Note in einem neuen Rhythmus und mit neuen Harmonieen als Trio ein S. 29 T. 1.. Ziemlich am Schlusse bringt er es noch einmal, aber matt und aufhaltend S. 35 Syst. 5.. In der dritten Abtheilung tritt es vom Orchester unterbrochen recitativisch auf S. 43 letzter Tact.; hier nimmt es den Ausdruck der fürchterlichsten Leidenschaft bis zum schrillen As, wo es wie ohnmächtig niederzustürzen scheint. Später S. 49 T. 3. 13. erscheint es sanft und beruhigt, vom Hauptthema geführt. Im marche du supplice will es noch einmal sprechen, wird aber durch den coup fatal abgeschnitten S. 63 Tact 4.. In der Vision spielt es auf einer gemeinen E- und Es-Clarinette S. 67 T. 1, S. 68 T. 1., welk, entadelt und schmutzig. Berlioz machte das mit Absicht.
Das zweite Thema der ersten Abtheilung quillt wie unmittelbar aus dem ersten heraus S. 10 Syst. 5 T. 3. sie sind so seltsam ineinander verwachsen, daß man den Anfang und Schluß der Periode gar nicht recht bezeichnen kann, bis sich endlich der neue Gedanke loslöst (4), der kurz drauf fast unmerklich wieder im Basse vorkömmt S. 11 T. 5, S. 12 T. 7.. Später greift er ihn noch einmal auf und skizzirt ihn äußerst geistvoll (5); an diesem letzten Beispiele wird die Art seiner Durchführung am deutlichsten. Ebenso zart zeichnet er später einen Gedanken fertig, der ganz vergessen zu sein schien S. 9 T. 19, S. 16 T. 3..
Die Motive der zweiten Abtheilung sind weniger künstlich verflochten; doch nimmt sich das Thema in den Bässen vorzüglich aus S. 31 T. 10, S. 37 T. 1.; fein ist, wie er einen Tact aus demselben Thema ausführt S. 28 T. 10..
In reizenden Gestalten bringt er den eintönigen Hauptgedanken S. 39 T. 4, S. 42 T. 1, S. 47 T. 1. der dritten Abtheilung wieder; Beethoven könnte es kaum fleißiger gearbeitet haben. Der ganze Satz ist voll sinniger Beziehungen; so springt er einmal von C in die große Unterseptime; später benutzt er diesen unbedeutenden Zug sehr gut (6).
In der vierten Abtheilung contrapunktirt er das Hauptthema (7) sehr schön; auch wie er es sorgfältig in Es Dur (8) und G Moll (9) transponirt S. 87 T. 8., verdient ausgezeichnet zu werden.
In der letzten Abtheilung bringt er das Dies irae erst in ganzen, dann in halben, dann in Achtel-Noten S. 71 Syst. 4 T. 7, S. 72 T. 6, ebenda T. 16.; die Glocken schlagen dazu in gewissen Zeiträumen Tonica und Dominante an. Die folgende Doppelfuge (10) (er nennt sie bescheiden nur ein Fugato) ist, wenn auch keine Bach'sche, sonst von schulgerechtem und klarem Baue. Das Dies irae und das Ronde du Sabbat werden gut ineinander verwebt (11). Nur reicht das Thema des letzten nicht ganz aus und die neue Begleitung ist so commod und frivol wie möglich, aus auf- und niederrollenden Terzen gemacht. Von der drittletzten Seite an geht es kopfüber, wie schon öfters bemerkt; das Dies irae fängt noch einmal pp an S. 55 T. 15, S. 57 T. 12, S. 58 T. 5, S. 60 T. 1. 10, und dann in der Umkehrung S. 61 T. 3.. Ohne Partitur kann man die letzten Seiten nur schlecht nennen.
Wenn Herr Fétis behauptet, daß selbst die wärmsten Freunde Berlioz's ihn im Betreff der Melodie nicht in Schutz zu nehmen wagten, so gehöre ich zu Berlioz's Feinden: nur denke man dabei nicht an italienische, die man schon weiß, ehe sie anfängt.
Es ist wahr, die mehrfach erwähnte Hauptmelodie der ganzen Symphonie hat etwas Plattes und Berlioz lobt sie fast zu sehr, wenn er ihr im Programm einen »vornehm-schüchternen Charakter« beilegt ( un certain caractère passioné, mais noble et timide); aber man bedenke, daß er ja gar keinen großen Gedanken hinstellen wollte, sondern eben eine festhängende quälende Idee in der Art, wie man sie oft tagelang nicht aus dem Kopfe bringt; das Eintönige, Irrsinnige kann aber gar nicht besser getroffen werden. Ebenso heißt es in jener Recension, daß die Hauptmelodie zur zweiten Abtheilung gemein und trivial sei; aber Berlioz will uns ja eben (etwa wie Beethoven im letzten Satze der A Dur-Symphonie) in einen Tanzsaal führen, nichts mehr und nichts weniger. Aehnlich verhält es sich mit der Anfangmelodie (12) der dritten Abtheilung, die Herr Fétis, wie ich glaube, dunkel und geschmacklos nennt. Man schwärme nur in den Alpen und sonstigen Hirtengegenden herum und horche den Schalmeien oder Alpenhörnern nach; genau so klingt es. So eigenthümlich und natürlich sind aber alle Melodieen der Symphonie; in einzelnen Episoden streifen sie hingegen das Charakteristische ganz ab und erheben sich zu einer allgemeinen, höheren Schönheit. Was hat man z. B. gleich am ersten Gesange auszusetzen, mit dem die Symphonie beginnt? Ueberschreitet er vielleicht die Grenzen einer Octave um mehr als eine Stufe? Ist es denn nicht genug der Wehmuth? Was an der schmerzlichen Melodie der Hoboe in einem der vorigen Beispiele? Springt sie etwa ungehörig? Aber wer wird auf Alles mit Fingern zeigen! Wollte man Berlioz einen Vorwurf machen, so wär' es der der vernachlässigten Mittelstimmen; dem stellt sich aber ein besonderer Umstand entgegen, wie ich es bei wenigen andern Componisten bemerkt habe. Seine Melodieen zeichnen sich nämlich durch eine solche Intensität fast jedes einzelnen Tones aus, daß sie, wie viele alte Volkslieder, oft gar keine harmonische Begleitung vertragen, oft sogar dadurch an Tonesfülle verlieren würden. Berlioz harmonisirt sie deshalb meist mit liegendem Grundbaß, oder mit den Accorden der umliegenden Ober- und Unterquinten Das erste z. B. S. 19 T. 7, S. 47 T. 1, das zweite in der Hauptmelodie des »Balls«, wo die Grundharmonieen eigentlich A, D, E, A sind, dann im Marsch S. 47 T. 1.. Freilich darf man seine Melodieen nicht mit dem Ohre allein hören; sie werden unverstanden an denen vorübergehen, die sie nicht recht von innen heraus nachzusingen wissen, d. h. nicht mit halber Stimme, sondern mit voller Brust – und dann werden sie einen Sinn annehmen, dessen Bedeutung sich immer tiefer zu gründen scheint, je öfter man sie wiederholt.
Um nichts zu übergehen, mögen hier noch einige Bemerkungen über die Symphonie als Orchesterwerk und über den Clavierauszug von Liszt Raum finden.
Geborner Virtuos auf dem Orchester, fordert er allerdings Ungeheures von dem Einzelnen, wie von der Masse, – mehr als Beethoven, mehr als alle andere. Es sind aber nicht größere mechanische Fertigkeiten, die er von den Instrumentisten verlangt: er will Mitinteresse, Studium, Liebe. Das Individuum soll zurücktreten, um dem Ganzen zu dienen, und dieses sich wiederum dem Willen der Obersten fügen. Mit drei, vier Proben wird noch nichts erreicht sein; als Orchestermusik mag die Symphonie vielleicht die Stelle des Chopin'schen Concerts im Pianofortespiel einnehmen, ohne übrigens beide vergleichen zu wollen. – Seinem Instrumentationsinstincte läßt selbst sein Gegner, Herr Fétis, volle Gerechtigkeit widerfahren; schon oben wurde angeführt, daß sich nach dem bloßen Clavierauszuge die obligaten Instrumente errathen ließen. Der lebhaftesten Phantasie wird es indeß schwer werden, sich einen Begriff von den verschiedenen Combinationen, Contrasten und Effecten zu machen. Freilich verschmäht er auch nichts, was irgend Ton, Klang, Laut und Schall heißt, – so wendet er gedämpfte Pauken an, Harfen, Hörner mit Sordinen, englisch Horn, ja zuletzt Glocken. Florestan meinte sogar, er hoffe sehr, daß er (Berlioz) alle Musiker einmal im Tutti pfeifen lasse, obwohl er ebenso gut Pausen hinschreiben könnte, da man schwerlich vor Lachen den Mund zusammenzuziehen im Stande wäre, – auch sähe er (Florestan) in künftigen Partituren stark nach schlagenden Nachtigallen und zufälligen Gewittern auf. Genug, hier muß man hören. Die Erfahrung wird lehren, ob der Componist Grund zu solchen Ansprüchen hatte und ob der Reinertrag am Genusse mit jenen verhältnißmäßig steige. Ob Berlioz mit wenigen Mitteln etwas ausrichten wird, steht dahin. Begnügen wir uns mit dem, was er uns gegeben.
Der Clavierauszug von Franz Liszt verdiente eine weitläufige Besprechung; wir sparen sie uns, wie einige Ansichten über die symphonistische Behandlung des Pianofortes für die Zukunft auf. Liszt hat ihn mit so viel Fleiß und Begeisterung gearbeitet, daß er wie ein Originalwerk, ein Resumé seiner tiefen Studien, als praktische Clavierschule im Partiturspiel angesehen werden muß. Diese Kunst des Vortrags, so ganz verschieden von dem Detailspiel des Virtuosen, die vielfältige Art des Anschlages, den sie erfordert, der wirksame Gebrauch des Pedals, das deutliche Verflechten der einzelnen Stimmen, das Zusammenfassen der Massen, kurz die Kenntniß der Mittel und der vielen Geheimnisse, die das Pianoforte noch verbirgt, – kann nur Sache eines Meisters und Genies des Vortrags sein, als welches Liszt von Allen ausgezeichnet wird. Dann aber kann sich der Clavierauszug ungescheut neben der Orchesteraufführung selbst hören lassen, wie Liszt ihn auch wirklich als Einleitung zu einer späteren Symphonie von Berlioz ( Mélologue, Fortsetzung dieser phantastischen) vor Kurzem öffentlich in Paris spielte.
Uebersehen wir mit einem Augenblicke noch einmal den Weg, den wir bis jetzt zurücklegten. Nach unserem ersten Plane wollten wir über Form, musikalische Composition, Idee und Geist in einzelnen Absätzen sprechen. Erst sahen wir, wie die Form des Ganzen nicht viel vom Hergebrachten abweiche, wie sich die verschiedenen Abtheilungen meistens in neuen Gestalten bewegen, wie sich Periode und Phrase durch ungewöhnliche Verhältnisse von Anderem unterscheide. Bei der musikalischen Composition machten wir auf seinen harmonischen Styl aufmerksam, auf die geistreiche Art der Detailarbeit, der Beziehungen und Wendungen, auf die Eigenthümlichkeit seiner Melodieen und nebenbei auf die Instrumentation und auf den Clavierauszug. Wir schließen mit einigen Worten über Idee und Geist.
Berlioz selbst hat in einem Programme niedergeschrieben, was er wünscht, daß man sich bei seiner Symphonie denken soll. Wir theilen es in Kürze mit.
Der Componist wollte einige Momente aus dem Leben eines Künstlers durch Musik schildern. Es scheint nöthig, daß der Plan zu einem Instrumentaldrama vorher durch Worte erläutert werde. Man sehe das folgende Programm wie den die Musiksätze einleitenden Text in der Oper an. Erste Abtheilung. Träume, Leiden ( rêveries, passions). Der Componist nimmt an, daß ein junger Musiker, von jener moralischen Krankheit gepeinigt, die ein berühmter Schriftsteller mit dem Ausdrucke: le vague des passions bezeichnet, zum erstenmal ein weibliches Wesen erblickt, das Alles in sich vereint, um ihm das Ideal zu versinnlichen, das ihm seine Phantasie vormalt. Durch eine sonderbare Grille des Zufalls erscheint ihm das geliebte Bild nie anders als in Begleitung eines musikalischen Gedankens, in dem er einen gewissen leidenschaftlichen, vornehm-schüchternen Charakter, den Charakter des Mädchens selbst findet: diese Melodie und dieses Bild verfolgen ihn unausgesetzt wie eine doppelte fixe Idee. Die träumerische Melancholie, die nur von einzelnen leisen Tönen der Freude unterbrochen wird, bis sie sich zur höchsten Liebesraserei steigert, der Schmerz, die Eifersucht, die innige Gluth, die Thränen der ersten Liebe bilden den Inhalt des ersten Satzes. – Zweite Abtheilung. Ein Ball. Der Künstler steht mitten im Getümmel eines Festes in seliger Beschauung der Schönheiten der Natur, aber überall in der Stadt, auf dem Lande verfolgt ihn das geliebte Bild und beunruhigt sein Gemüth. – Dritte. Scene auf dem Lande. Eines Abends hört er den Reigen zweier sich antwortenden Hirten; dieses Zwiegespräch, der Ort, das leise Rauschen der Blätter, ein Schimmer der Hoffnung von Gegenliebe, – alles vereint sich, um seinem Herzen eine ungewöhnliche Ruhe und seinen Gedanken eine freundlichere Richtung zu geben. Er denkt nach, wie er bald nicht mehr allein stehen wird ... Aber wenn sie täuschte! Diesen Wechsel von Hoffnung und Schmerz, Licht und Dunkel drückt das Adagio aus. Am Schluß wiederholt der eine Hirte seinen Reigen, der andere antwortet nicht mehr. In der Ferne Donner ... Einsamkeit – tiefe Stille. – Vierte. Der Gang zum Richtplatz ( marche du supplice). Der Künstler hat die Gewißheit, daß seine Liebe nicht erwiedert wird, und vergiftet sich mit Opium. Das Narkotikum, zu schwach, um ihn zu tödten, versenkt ihn in einen von fürchterlichen Visionen erfüllten Schlaf. Er träumt, daß er sie gemordet habe und daß er zum Tode verurtheilt seiner eigenen Hinrichtung zusieht. Der Zug setzt sich in Bewegung; ein Marsch, bald düster und wild, bald glänzend und feierlich, begleitet ihn; dumpfer Klang der Tritte, roher Lärm der Masse. Am Ende des Marsches erscheint, wie ein letzter Gedanke an die Geliebte, die fixe Idee, aber vom Hiebe des Beiles unterbrochen nur halb. – Fünfte Abtheilung. Traum in einer Sabbathnacht. Er sieht sich inmitten greulicher Fratzen, Hexen, Mißgestalten aller Art, die sich zu seinem Leichenbegängnisse zusammengefunden haben. Klagen, Heulen, Lachen, Wehrufen. Die geliebte Melodie ertönt noch einmal, aber als gemeines, schmutziges Tanzthema: sie ist es, die kömmt. Jauchzendes Gebrüll bei ihrer Ankunft. Teuflische Orgien. Todtenglocken. Das Dies irae parodirt.
So weit das Programm. Ganz Deutschland schenkt es ihm: solche Wegweiser haben immer etwas Unwürdiges und Charlatanmäßiges. Jedenfalls hätten die fünf Hauptüberschriften genügt; die genaueren Umstände, die allerdings der Person des Componisten halber, der die Symphonie selbst durchlebt, interessiren müssen, würden sich schon durch mündliche Tradition fortgepflanzt haben. Mit einem Worte, der zartsinnige, aller Persönlichkeit mehr abholde Deutsche will in seinen Gedanken nicht so grob geleitet sein; schon bei der Pastoralsymphonie beleidigte es ihn, daß ihm Beethoven nicht zutraute, ihren Charakter ohne sein Zuthun zu errathen. Es besitzt der Mensch eine eigene Scheu vor der Arbeitsstätte des Genius: er will gar nichts von den Ursachen, Werkzeugen und Geheimnissen des Schaffens wissen, wie ja auch die Natur eine gewisse Zartheit bekundet, indem sie ihre Wurzeln mit Erde überdeckt. Verschließe sich also der Künstler mit seinen Wehen; wir würden schreckliche Dinge erfahren, wenn wir bei allen Werken bis auf den Grund ihrer Entstehung sehen könnten.
Berlioz schrieb indeß zunächst für seine Franzosen. denen mit ätherischer Bescheidenheit wenig zu imponiren ist. Ich kann sie mir denken, mit dem Zettel in der Hand nachlesend und ihrem Landsmann applaudirend, der Alles so gut getroffen; an der Musik allein liegt ihnen nichts. Ob diese nun in einem, der die Absicht des Componisten nicht kennt, ähnliche Bilder erwecken wird, als er zeichnen wollte, mag ich, der ich das Programm vor dem Hören gelesen, nicht entscheiden. Ist einmal das Auge auf einen Punkt geleitet, so urtheilt das Ohr nicht mehr selbstständig. Fragt man aber, ob die Musik das, was Berlioz in seiner Symphonie von ihr fordert, wirklich leisten könne, so versuche man ihr andere oder entgegengesetzte Bilder unterzulegen. Im Anfange verleidete auch mir das Programm allen Genuß, alle freie Aussicht. Als dieses aber immer mehr in den Hintergrund trat und die eigne Phantasie zu schaffen anfing, fand ich nicht nur Alles, sondern viel mehr und fast überall lebendigen, warmen Ton. Was überhaupt die schwierige Frage, wie weit die Instrumentalmusik in Darstellung von Gedanken und Begebenheiten gehen dürfe, anlangt, so sehen hier Viele zu ängstlich. Man irrt sich gewiß, wenn man glaubt, die Componisten legten sich Feder und Papier in der elenden Absicht zurecht, dies oder jenes auszudrücken, zu schildern, zu malen. Doch schlage man zufällige Einflüsse und Eindrücke von Außen nicht zu gering an. Unbewußt neben der musikalischen Phantasie wirkt oft eine Idee fort, neben dem Ohre das Auge, und dieses, das immer thätige Organ, hält dann mitten unter den Klängen und Tönen gewisse Umrisse fest, die sich mit der vorrückenden Musik zu deutlichen Gestalten verdichten und ausbilden können. Je mehr nun der Musik verwandte Elemente die mit den Tönen erzeugten Gedanken oder Gebilde in sich tragen, von je poetischerem oder plastischerem Ausdrucke die Composition sein, – und je phantastischer oder schärfer der Musiker überhaupt auffaßt, um so mehr sein Werk erheben oder ergreifen wird. Warum könnte nicht einen Beethoven inmitten seiner Phantasieen der Gedanke an Unsterblichkeit überfallen? Warum nicht das Andenken eines großen gefallenen Helden ihn zu einem Werke begeistern? Warum nicht einen Andern die Erinnerung an eine selig verlebte Zeit? Oder wollen wir undankbar sein gegen Shakespeare, daß er aus der Brust eines jungen Tondichters ein seiner würdiges Werk hervorrief, – undankbar gegen die Natur und läugnen, daß wir von ihrer Schönheit und Erhabenheit zu unseren Werken borgten? Italien, die Alpen, das Bild des Meeres, eine Frühlingsdämmerung, – hätte uns die Musik noch nichts von allem diesen erzählt? Ja selbst kleinere, speciellere Bilder können der Musik einen so reizend festen Charakter verleihen, daß man überrascht wird, wie sie solche Züge auszudrücken vermag. So erzählte mir ein Componist, daß sich ihm während des Niederschreibens unaufhörlich das Bild eines Schmetterlings, der auf einem Blatte im Bache mit fortschwimmt, aufgedrungen; dies hatte dem kleinen Stücke die Zartheit und die Naivität gegeben, wie es nur irgend das Bild in der Wirklichkeit besitzen mag. In dieser feinen Genremalerei war namentlich Franz Schubert ein Meister und ich kann nicht unterlassen, aus meiner Erfahrung anzuführen, wie mir einesmals während eines Schubert'schen Marsches der Freund, mit dem ich spielte, auf meine Frage, ob er nicht ganz eigene Gestalten vor sich sähe, zur Antwort gab: »wahrhaftig, ich befand mich in Sevilla, aber vor mehr als hundert Jahren, mitten unter auf- und abspazierenden Dons und Donnen, mit Schleppkleid, Schnabelschuh, Spitzdegen u. s. w.« Merkwürdiger Weise waren wir in unsern Visionen bis auf die Stadt einig. Wolle mir keiner der Leser das geringe Beispiel wegstreichen!
Ob nun in dem Programme zur Berlioz'schen Symphonie viele poetische Momente liegen, lassen wir dahingestellt. Die Hauptsache bleibt, ob die Musik ohne Text und Erläuterung an sich etwas ist, und vorzüglich, ob ihr Geist inwohnt. Vom ersten glaub' ich Einiges nachgewiesen zu haben; das zweite kann wohl Niemand läugnen, auch nicht einmal da, wo Berlioz offenbar fehlte.
Wollte man gegen die ganze Richtung des Zeitgeistes, der ein Dies irae als Burleske duldet, ankämpfen, so müßte man wiederholen, was seit langen Jahren gegen Byron, Heine, Victor Hugo, Grabbe und ähnliche geschrieben und geredet worden. Die Poesie hat sich, auf einige Augenblicke in der Ewigkeit, die Maske der Ironie vorgebunden, um ihr Schmerzensgesicht nicht sehen zu lassen; vielleicht daß die freundliche Hand eines Genius sie einmal abbinden wird.
Noch mancherlei Uebles und Gutes gäb' es hier zu berathen; indeß brechen wir für diesmal ab!
Sollten diese Zeilen etwas beitragen, einmal und vor Allem Berlioz in der Art anzufeuern, daß er das Excentrische seiner Richtung immer mehr mäßige, – sodann seine Symphonie nicht als das Kunstwerk eines Meisters, sondern als eines, das sich durch seine Originalität von allem Daseienden unterscheidet, bekannt zu machen, – endlich deutsche Künstler, denen er im Bunde gegen talentlose Mittelmäßigkeit eine starke Hand gereicht, zu frischerer Thätigkeit anzuregen, so wäre der Zweck ihrer Veröffentlichung erfüllt.





*
C. Löwe, der Frühling, eine Tondichtung in Sonatenform (in G). Werk 47.
Vom Frühling sollte schon an und für sich in jeder Musik etwas zu finden sein; diesmal legt der phantasievolle Sänger ein besonderes Opfer auf seinem Altare nieder. Zwar hätte man von Löwe eher eine Wintersonate erwartet, in der ich schon im Voraus (käme er dem Wunsche nach) den Schnee unter den Wägen höre und die Nachtvögel um den Thurmknopf; aber auch dem Frühling hat er seine Zeichen abgelauscht, wenn auch nicht wie Beethoven, dessen sechste Symphonie sich zu andern idyllischen Compositionen, wie das Leben eines großen Mannes zu dessen Biographieen verhält, so doch wie ein Dichter mit klarem offenem Auge; und das erfreut schon einmal in einer Zeit und in einer Kunst, die sich immer faustischer in sich hinein- und dem frischen Lebensgenusse finstre Mystik vorzieht. Wer also Nachtscenen und Nordlichter erwartet, irrt sich; aber dafür sieht er eine angrünende Wiese, hier und da eine Knospe mit einem Schmetterling. Dies über die Musik als Dichtung. Als Composition selbst kann man sie weder neu noch tief erfunden nennen; Melodieen und Harmonieen schließen sich natürlich, oft simpel aneinander; das Ganze ist vielleicht zu flüchtig empfangen und geboren. Der Componist verstehe uns recht! Beethoven singt in seiner Pastoralsymphonie so einfache Themas, wie sie irgend ein kindlicher Sinn erfinden kann; sicher aber schrieb er nicht Alles auf, was ihm die erste Begeisterung eingab, sondern wählte unter Vielem. Und das ist's, was wir dieser, wie mehren andern Compositionen von Löwe vorwerfen, daß sie mit der leisesten Stimme oft rechte Ansprüche machen und daß uns zugemuthet wird, Gewöhnliches, hundertmal Dagewesenes, weil es ein bedeutender Componist wiederholt, der Güte der Hauptsache halber so mit hin zu nehmen. Wir zweifeln, ob eines von den lebenden Talenten, die Löwen ebenbürtig gegenüberstehen, manches Einzelne in der Sonate hätte drucken lassen. Will man auch Stellen, wie das erste Thema des ersten Satzes, den Anfang des zweiten Theiles desselben Satzes u. m. a., durch die einfache Anlage und durch das Terrain, auf dem das Ganze spielt und gemalt ist, entschuldigen, so muß doch, wie wir schon oft gesagt, in der Malerei so viel Musik enthalten sein, daß diese für sich gilt und das Ohr vom Auge nichts zu entlehnen hat. Daher finden wir den zweiten Satz, als den musikalisch selbstständigsten, am gelungensten und daher z. B. die Einleitung am wenigsten gerathen. –
Wie dem sei, so empfehlen wir die Sonate namentlich Lehrern nachdrücklich, daß sie sie jüngere Schüler spielen lassen, denen die durchweg klare und natürliche Empfindung wohlgefällig und bildend sein muß.
*
Hätte mir Jemand den Titel zugehalten, so würde ich auf eine Componistin gerathen und vielleicht so geurtheilt haben: Wie du heißen magst, Adele – Zuleika, ich liebe dich vorweg, wie alle, die Sonaten schreiben! Hörtest du nur auch immer so auf als du anfängst, so z. B. in der Frühlingssonate, wo einen auf der ersten Seite ordentlich Märzveilchen anduften ... Aber während dein schwärmerisches Auge am Mondhimmel herumschweift oder dein Herz im Jean Paul, so fällt dir das Rosaband ein, das deine Freundin so wohl kleidet; auch verwechselst du noch häufig das »daß« mit dem »das«, so nett deine Handschrift übrigens aussieht, – mit einem Worte, du bist ein gutes siebzehnjähriges Kind mit viel Liebe und Eitelkeit, viel Innigkeit und Eigensinn. Mit Worten, wie »Tonica«, »Dominante« oder gar »Contrapunkt« erschreck' ich dich gar nicht, denn du würdest mir lachend in's Wort fallen und sagen: »ich hab' es nun einmal so gemacht und kann nicht anders«, und man müßte dir dennoch gut sein. Wär' ich aber dein Lehrer und klug, so gäb' ich dir oft von Bach oder Beethoven in die Hände (von Weber, den du so sehr liebst, gar nichts), damit sich Gehör und Gesicht schärfe, damit dein zartes Fühlen festes Ufer bekomme und dein Gedanke Sicherheit und Gestalt. Und dann wüßt' ich nicht, was dir selbst eine »neuste« Zeitschrift für Musik anhaben könnte, das sich nicht auf »lieb und schön« reimte.
Eusebius.
Wie schlau mein Eusebius d'rum herum geht! Warum nicht ganz offen: »der Herr Graf hat sehr viel Talent, aber wenig studirt«.
Florestan.
*
Werk 39.
Man würde erstaunen über den Ernst und die Tiefe, wenn obige Sonate von einem Franzosen oder gar Italiener componirt wäre. Es gibt eben noch keine Weltkunst und ebendaher keine Kritik, die nicht ihren Maaßstab nach dem Standpunkte der Bildung, auf dem die verschiedenen Nationen stehen, und nach deren Charakter richtete. Lachner ist ein Deutscher; ein deutsches geradegehendes Wort wird ihm recht sein.
Wir wissen nicht, ob wir uns freuen oder betrüben sollen, daß wir außer dieser Sonate, vielen Liedern und einer Symphonie, die wir einmal gehört, nichts weiter von Lachner's Compositionen kennen. Er ist einer der schwierigsten Charaktere für die Kritik, nicht deshalb, weil er so dunkeltief dächte, daß ihm gar nicht beizukommen, sondern der Schlangenglätte halber, mit der er überall, will man ihn festhalten, aus der Hand entschlüpft. Hat er etwas Fades gesprochen, so macht er es kurz darauf durch ein herrlich Wort gut; ärgert man sich an einem Spohr'schen oder Franz Schubert'schen Anklange, so kömmt bald etwas ihm allein Gehöriges; hält man jetzt Alles für Trug und Schein, so gibt er sich einen Augenblick später offen und unverhohlen. Man findet in dieser Sonate, was man will; – Melodie, Form, Rhythmus (in dem er jedoch am schwächsten erfindet), Fluß, Klarheit, Leichtigkeit, Correctheit, und dennoch rührt nichts, faßt nichts, dringt nichts tiefer als bis in das Ohr. Wir glaubten, die Schuld läge an unsrer eigenen Stimmung und legten, um den spätern Eindruck mit dem ersten zu vergleichen, die Sonate geflissentlich lange Zeit bei Seite, fragten auch Andere um ihre Meinung; dasselbe Resultat, dieselbe Antwort. Die Sache darf nicht leicht genommen werden. Auf L. sind schöne Hoffnungen gegründet worden. Eine nachsichtige Kritik sah ihm seines Talentes halber Vieles nach. Es wird Zeit, daß er streng über sich wache, um sich nicht noch unklarer in sich hinein zu verwickeln. Es gibt nämlich gewisse Halbgenies, die mit einer ungemeinen Lebhaftigkeit und Empfänglichkeit alles Außerordentliche, sei es Gutes oder Uebles, in sich aufnehmen und wie ihr Eigenthum verarbeiten. Sie haben einen Geniusflügel und einen andern von Wachsfedern. In guter Stunde, in der Erregung trägt wohl jener den andern mit in die Höhe; aber im Normalzustande der Ruhe schleppt der wächserne lahm hinter dem andern her. Oft möchte man solch' hartes Urtheil über ähnliche Charaktere zurücknehmen, – denn es glückt ihnen mancher Wurf; – oft ihnen gänzlich vom Schaffen abrathen, weil sie selbst nicht wissen. wie arg sie sich und Andere täuschen. Sie leben in immerwährender Spannung, in einer steten Krisis, in der man sie auch ruhig lassen und sie sich selbst aus ihr herausarbeiten lassen sollte, weil sie ein Wort des Tadels noch hartnäckiger, ein Wort des Lobes jedoch leicht übermüthig macht. Da sie aber meist Ruhmsucht und nicht genug Gewalt über sich besitzen, der Welt gegenüber mit ihren Werken zurückzuhalten, so kann dieser natürlich das Unausgebildete und Zweideutige ihres Wesens nicht entgehen. Eben deshalb, weil in solchen Charakteren und Compositionen noch kein System und Styl beim Namen genannt werden kann, täuscht man sich auch oft in ihnen und über ihre Zukunft und sagt vielleicht Schlimmeres voraus, als geschieht. Das letzte wünschen wir in Bezug auf L. von ganzem Herzen und begeben uns von selbst aller divinatorischen Kritik. Nehme er dieses Wort, das mehr eine ganze Classe, und Lachnern nur theilweise trifft, als den Ausspruch Vieler an, die über seine künstlerischen Anlagen durchaus einverstanden, das Nebengefühl nicht unterdrücken können, daß von ihm Höheres zu erwarten stände, wenn er den Beifall des großen Haufens dem schwerer wiegenden Lobe seiner Kunstgenossen aufopfern wollte. –
*
Duo zu vier Händen für Pianoforte von W. Taubert.
Werk 11.
Nach öfterm Anhören und Durchspielen des überdem klaren Satzes fühlte ich immer eine Lücke. Es war, als müßte noch etwas kommen oder als wäre etwas vorweg gegangen, was das Spätere erklärte. Formell und an sich ist es abgeschlossen, nicht der Idee nach. Ich weiß nicht, ob eine Sonate damit angelegt war und der Componist beim letzten Satz angefangen hat, wie das wohl geschieht.
Die Menschen sind unleidlich und ungebildet überdies, die gleich ihren Musikschrank umwenden, um Aehnlichkeiten und Reminiscenzen herauszusuchen. Es kann kein Vorwurf sein, daß der Styl des Duo's dem der bekannten, aber tiefer gehenden Onslow'schen Sonate in E moll etwas verwandt scheint, ebenso wenig daß, wie in jener ein Saiteninstrumentcharakter, im vorliegenden Stücke ein noch breiterer Instrumentalcharakter vorherrscht. Wer sein Instrument kennt und studirt hat, wird die Linie treffen. So wird auf der einen Seite der gehaltene Ton der menschlichen Stimme gewissen Instrumenten fremd bleiben, während durch vielseitige Prüfung anderer, die dem eignen Instrument mehr oder weniger verwandt sind, neue Wirkungen sich entdecken. Wenn ich daher gleich in den ersten Tact Pauken, in den zweiten das antwortende Tutti, in die späteren kurzen Achtel Violinunisono's legen kann, so ist der Charakter des Instruments, für welches geschrieben worden, noch nicht verletzt, sondern der Genuß überhaupt vielleicht erhöht. –
Nach den Proben, die der Componist in den vorjährigen Leipziger Winterconcerten von seinem Compositionstalent ablegte, ging ich mit etlichen Erwartungen, zu denen mich jene berechtigten, an das Werk. Ich täuschte mich nicht. Herr Taubert geht im Werke einen kräftigen schätzbaren Bürgerschritt, überschreitet nie Den 4ten Tact auf S. 14 vielleicht ausgenommen. verbotene Wege, ohne Furcht, mit dem Paß in der Tasche. Wir sind alle sehr schlimm. Sitzen wir im Wagen, so beneiden wir den Fußgänger, der langsam genießen und vor jeder Blume so lange stehen bleiben kann, als er will. Gehen wir zu Fuß, so werden wir's recht herzlich satt und nähmen vorlieb mit dem Bock. Ich meine: gewisse Fehler des Einen würden wir dem Andern für Tugenden anrechnen. Gäbe es einen Geistertausch, so würde ich Herrn Taubert etwas vom Blute einiger Hypergenialen, diesen etwas von der Mäßigung und dem Anstande jenes geben. Man mache dieser Ansicht Vorwürfe! Allerdings soll ein Kunstwerk nicht ein Alphabet aller ästhetischen Epitheten geben; aber die Kritik soll die nothwendigen Forderungen (die vermißten, nicht die fehlenden), denen der Künstler nicht nachgekommen ist, nicht verheimlichen. Ich glaube, der echte poetische Schwung wäre eine. Im Werke gehen aber die Flügel nur langsam auf und nieder. Deute der Componist diesen Ausspruch nicht falsch! Von welchen soll Heil und Segen in der Kunst zu erwarten sein, als von denen, die außer dem edlern Streben auch die größere Kraft besitzen, beides in Einklang zu bringen? Gerade die Besseren mögen mit ihren unbedeutenderen Sachen zurückbleiben! Es kann mich erboßen, wenn ich so zusammengeschriebene »Souvenirs« von einem Meister, wie Moscheles, in die Hände bekomme mit componirenden Musikstatisten hinterdrein, die rufen: »Der hat's auch nicht besser gemacht!« Das vorliegende Duo ist freilich besser, als tausend dergleichen, aber der Ansprüche an den Besseren gibt es auch tausend mehr. Gegen Talente soll man nicht höflich sein. Vor Herz oder Czerny ziehe ich den Hut – höchstens mit der Bitte, mich nicht ferner zu incommodiren.
Dies im Ganzen und für den Componisten, der Vielen durch ein vorzügliches Pianoforteconcert, das er der Welt bald vorlegen wolle, werth geworden ist. Wiegt nun unser Werk bei weitem innerlich wie äußerlich leichter, so ist ihm doch Verbreitung zu wünschen. Man kann diese sogar voraus sagen, da es ziemlich handlich, ohne höher fliegende Passagen geschrieben, angenehm, ja sogar schön klingen kann, wenn man es immer mit der vortrefflichen Dilettantin, der es zugeeignet ist, spielen könnte. –
Das Ganze geht in A moll, obwohl es vielleicht eher einen G moll-Charakter aussprechen will. So gesangreich, fast innig, das erste Thema ist, so arm sticht das dritte in E moll dagegen ab. Den Gedanken, dem ersten gezogenen ein zweites in abgeschlossenen Noten als Contrast entgegenzusetzen, müßte man loben, wenn das in E minor bedeutender in der Erfindung und nicht so gar harmonieleer wäre. Das Mißlungene, Unkanonische tritt bei der spätern Verarbeitung um so stärker vor, die mehr gemacht, geschrieben, wenig Genialisches hat. Gut bleibt's immer, daß sich die Armuth hier wenigstens offen zeigt. – Wollt ihr aber wissen, was durch Fleiß, Vorliebe, vor allem durch Genie aus einem einfachen Gedanken gemacht werden kann, so leset in Beethoven und sehet zu, wie er ihn in die Höhe zieht und adelt, und wie sich das anfangs gemeine Wort in seinem Mund endlich wie zu einem hohen Weltenspruch gestaltet. –
Ich wünschte vorhin dem Werk Verbreitung. Ich meine so. Vor allem thut es noth, der jungen anwachsenden Zeit etwas an die Hand zu geben, was sie vor dem schlimmen Einfluß bewahrte, den gewisse niedrigvirtuosische Werke auf jene ausgeübt. Je allgemeiner der Kunstsinn, je besser. Für jede Stufe der Bildung sollen Werke da sein. Beethoven hat sicher nicht gewollt, daß man ihn meint, wenn von Musik die Rede ist. Er hätte das sogar verworfen. Darum für Alle das Rechte und Aechte! Nur für das Heuchlerische, für das Häßliche, das sich in reizende Schleier hüllt, soll die Kunst kein Spiegelbild haben. Wäre der Kampf nur nicht zu unwürdig! – Doch, jenen Vielschreibern, deren Werkzahl sich nach der Bezahlung richtet (es gibt berühmte Namen darunter), jenen Anmaßenden, die sich wie außer dem Gesetz stehend betrachten, endlich jenen armen oder verarmten Heuchlern, die ihre Dürftigkeit noch mit bunten Lumpen herausputzen, muß mit aller Kraft entgegengetreten werden. Sind diese niedergedrückt, so greift die Masse von selbst nach dem Bessern.
*
Großes Septuor für Pianoforte, Violine, Viola, Clarinette, Horn, Violoncell und Contrabaß von I. Moscheles.
Werk 88.
Die Recension wird wenig länger werden, als der Titel, da wir das Werk noch nicht im Ensemble gehört. Das Pianoforte scheint natürlich zu dominiren, wenn auch nicht autokratisch, doch monarchisch, daher wir es verantworten wollen, wenn wir den Genuß, den uns die Clavierstimme und einzelne Blicke in die Instrumentalbegleitung gegeben, auch Anderen versprechen.
Sollten Manche, namentlich in den drei letzten Sätzen, das bewegliche Leben seines früheren Sextettes vermissen, so danke man doch überhaupt dem Himmel, daß wieder einmal ein complicirtes Stück erscheint, welches an sich den ganzen Ernst und Fleiß des Tonsetzers in Anspruch nimmt und diesmal auch das Studium, was es reproducirt erfordert, sicherlich verdient und belohnt. Denn es scheint, als wollten sich die jüngeren Pianofortecomponisten nach und nach außer aller Verbindung mit anderen Instrumenten setzen und ihr Instrument zum unabhängigen Orchester en miniature erheben, – ja nicht einmal Vierhändiges sieht und hört man viel. Sei dem wie ihm wolle, geschieht damit ein Vorschritt der Pianofortemusik oder ein Rückschritt im größern Ganzen, so wollen wir auch an die Freude und den Nutzen denken, den öfteres Zusammenleben und Zusammenstreben immer geschafft hat und fürder schaffen wird. –
Die Schwierigkeiten der Clavierstimme sind weder gewagt, noch durchaus neu, aber wohlerwogen und zum Ganzen gehörig. Die eigenthümliche, gesunde und kernhafte Spielweise dieses Virtuosen fällt einem auf jeder Seite ein.
In der Ausgabe ohne Begleitung – (wie in allen Arrangements überhaupt) – wünschten wir an den Stellen, welche durch die anderen Instrumente gestützt werden und erst durch sie Bedeutung annehmen, eine noch genauere Angabe des Accompagnements, als es schon geschehen ist, nicht damit der Spieler weniger aufzupassen brauche, sondern damit er beim Einzelspiele die Instrumente in der Phantasie gleichsam forttragen könne. Sollen aber beim Fehlen des Accompagnements die Stimmen concentrirt werden, wie auf S. 10 angegeben ist, so dünkt uns, müsse man, was treu copirt auf dem Claviere nicht wirkt, durch andere und neue Mittel zu heben suchen. Wie es aber an der angeführten Stelle gemacht ist, empfindet man eine Lücke und Leere, die sehr leicht ausgefüllt werden konnte. Es ist das nur Nebensache und es kömmt uns nicht bei, einem so denkenden und gewissenhaft arbeitenden Tonsetzer, als welcher Moscheles in seinen größeren Arbeiten dasteht, hiermit etwas zu sagen, was er nicht schon gewußt, als Referent seine Alexandervariationen studirt, nämlich vor mehr als zehn Jahren: aber für andere Componisten bemerken wir es. Denn darin, daß diese z. B. die Tutti's ihrer Concerte so nachlässig und unclaviermäßig arrangiren, Bässe unten, Melodie oben, in der Mitte zwei stumme Octaven, darin liegt die Schuld, wenn sie (die Tutti's) so unverantwortlich gemein als Nebensachen abgethan werden, daß man noch froher ist als der Spieler selbst, wenn er aufhört und mit dem Solo anfängt. Mit der Ausrede aber, daß man sich während der Tutti's erholen müsse, verschont uns gänzlich und wir können Euch als Muster und zur Nachahmung, wie man Componisten und Compositionen zu achten habe, Niemanden mehr empfehlen, als Moscheles selbst, den wir öfters privatim seine Concerte spielen gehört und der mit solcher Kraft und Energie, mit solcher Zartheit in der Nüancirung der verschiedenen Instrumente das Orchester mit den zehn Fingern zusammenhielt und wiedergab, daß wir ihn darin erst recht als Künstler erkannten.
*
Felix Mendelssohn, sechs Lieder ohne Worte für das Pianoforte.
(Zweites Heft.)
Wer hätte nicht einmal in der Dämmerungsstunde am Clavier gesessen (ein Flügel scheint schon zu hoftonmäßig) und mitten im Phantasiren sich unbewußt eine leise Melodie dazu gesungen? Kann man nun zufällig die Begleitung mit der Melodie in den Händen allein verbinden, und ist man hauptsächlich ein Mendelssohn, so entstehen daraus die schönsten Lieder ohne Worte. Leichter hätte man es noch, wenn man geradezu Texte componirte, die Worte wegstriche und so der Welt übergäbe, aber dann ist es nicht das rechte, sondern sogar eine Art Betrug, – man müßte denn damit eine Probe der musikalischen Gefühlsdeutlichkeit anstellen wollen und den Dichter, dessen Worte man verschwiege, veranlassen, der Composition seines Liedes einen neuen Text unterzulegen. Träfe er im letzten Falle mit dem alten zusammen, so wäre dies ein Beweis mehr für die Sicherheit des musikalischen Ausdruckes. Zu unsern Liedern! Klar wie Sonnenlicht sehen sie einen an. Das erste kommt an Lauterkeit und Schönheit der Empfindung dem in E dur im ersten Hefte beinahe gleich; denn dort quillt es noch näher von der ersten Quelle weg. Florestan sagte: »wer solches gesungen, hat noch langes Leben zu erwarten, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode; ich glaube, es ist mir das liebste«. Beim zweiten Lied fällt mir Jägers Abendlied von Goethe ein: »Im Felde schleich' ich still und wild, gespannt mein Feuerrohr u. s. w.«; an zartem duftigem Bau erreicht es das des Dichters. Das dritte scheint mir weniger bedeutend, und fast wie ein Rundgesang in einer Lafontainischen Familienscene; indeß ist es echter unverfälschter Wein, der an der Tafel herumgeht, wenn auch nicht der schwerste und seltenste. Das vierte find' ich äußerst liebenswürdig, ein wenig traurig und in sich gekehrt, aber in der Ferne spricht Hoffnung und Heimath. In der französischen Ausgabe finden sich, wie in allen Stücken so vorzüglich in diesem, bedeutende Abweichungen von der deutschen, die indessen Mendelssohn nicht anzugehören scheinen. – Das nächste trägt etwas Unentschiedenes im Charakter, selbst in Form und Rhythmus, und wirkt demgemäß. Das letzte, eine venetianische Barcarole, schließt weich und leise das Ganze zu. – So wollet euch von Neuem der Gaben dieses edlen Geistes erfreuen! –
*
W. Taubert. An die Geliebte. Acht Minnelieder für das Pianoforte.
Werk 16.
Der Componist gehört zu den Talenten, die, ohne irgend den Kampf und Haß der Parteien zu erregen, sich bei allen, Classikern wie Romantikern, Kennern wie Laien, Achtung und Ansehn erworben haben: zu den gebildeten Conservativen, die wohl mit voller Liebe am Alten hängen, aber auch Empfänglichkeit für neue Erscheinungen und Kraft zu eignen Anschauungen besitzen. Dies letzte offenbart sich namentlich in der obigen Composition von Neuem. Zwar find' ich schon in der reizend schwermüthigen G moll-Etude von Ludwig Berger, dem Lehrer von Mendelssohn und Taubert, ein recht eigentliches Lied ohne Worte, aber Mendelssohn gab dem Genre einen Namen und Taubert führte ihn in noch andrer Weise aus. Nur hätt' ich (so wenig es im Ganzen verschlägt) statt der Ueberschrift »Minnelieder« eine bezeichnendere gewünscht; denn man kann wohl Lieder »ohne« Worte sagen, aber im Begriff Lied (ohne jenen Zusatz) liegt das Mitwirken der Stimme eingeschlossen. Vielleicht würd' ich die Musik einfach »Musik zu Texten von Heine u. s. w.« genannt haben. Denn darin unterscheiden sie sich von den Mendelssohn'schen, daß sie durch Gedichte angeregt sind, während jene vielleicht umgekehrt zum Dichten anregen sollen.
Ich weiß nicht, ob die Musik dem vorgesetzten Gedichte vom Anfang bis Ende folgt, ob der Grundton der ganzen Poesie oder nur der Sinn der angeführten Mottos in der Musik nachgebildet ist; doch vermuth' ich bei den meisten das letzte.
Die Composition an und für sich muß Allen, die Treffliches, Echtes, Musikalisches lieben, von Grund aus empfohlen werden; ja hier und da greift sie wohl mit den Wurzeln noch tiefer, als die verwandten Lieder ohne Worte von M., in denen sich dagegen freilich die Blüthenzweige schlanker, freier und geistiger erheben: dort ist mehr in die Tiefe gebrochen, hier mehr in die Höhe erzogen.
Als schönstes, innigstes gilt mir das, was auch das leichteste ist: »Wenn ich mich lehn' an deine Brust, kommt's über mich wie Himmelslust«. Eine musikalische Uebersetzung des Schlusses desselben Heine'schen Gedichtes: »Doch wenn du sagst: ich liebe dich, da muß ich weinen bitterlich«, möge sich der Componist für die Zukunft zurückgelegt haben.
In Nr. 2 dünkt mir das Accompagnement zu malerisch, äußerlich: jedenfalls sollte bei dem Uebergang nach Dur eine neue beruhigende Figur auftreten.
In Nr. 1 »Der Holdseligen, sonder Wank, sing' ich fröhlichen Minnesang« tritt die Musik gegen das freudige Hinausrufen der liebenden Seele zurück; auch wird es gegen die Mitte hin zu breit, nur am Schluß (von Cmoll nach Asdur) erwärmt es wiederum.
Die übrigen Nummern sind mehr oder minder schöne, immer vom Herzen gehende Sänge; das einzige Nr. 5 würde ich, wenn es wegfiele, nicht vermissen.
Die Texte sind durchweg lyrisch.
*