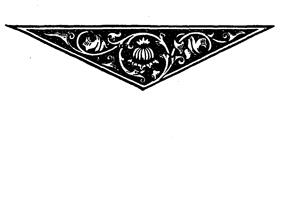|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nach dem Englischen.
![]()
Die letzten drei oder vier Jahre ist es mit Martin Lader gewaltig bergab gegangen. Die Sache war offenkundig; alle Nachbarn redeten davon: die Frauen mit lauter Entrüstung, die Männer halb ärgerlich, halb mitleidig. Schlechte Gesellschaft hatte ihn auf schlechte Wege gebracht, und schade war es um ihn! Keinen bessern Burschen gab es früher, und nie hat ein Schreiner den Hobel geschickter geführt als er. Aber er liebte nun einmal das Wirtshaus und das heillose Trinken. Schlimm, sehr schlimm; es ließ sich nichts dagegen thun, man mußte das Ding gehen lassen, wie es eben ging.
Die Nachbarn schüttelten die Köpfe und schauten Lader traurig nach, wenn er durch die Straßen nach Hause wankte. Sie vermieden es aber wohl, den baumlangen Menschen mit den gebräunten, sehnigen Armen, dessen heftige Gemüthsart durch den übermäßigen Genuß von geistigen Getränken noch erregbarer geworden war, durch irgend eine Bemerkung zu reizen. Ein- oder zweimal hatte man versucht, ihm in milder Weise ein wohlmeinendes Wort zu sagen; da hatten sich jedoch seine Fäuste so drohend geballt, seine Augenbrauen so finster zusammengezogen, und er hatte so barsch die Frage gestellt, ob sie vor ihren eigenen Thüren nichts zu kehren hätten, daß man den wohlgemeinten Versuch nicht wiederholte. Selbstverständlich war Martin Lader schon lange in keine Kirche mehr gegangen, hatte seit Jahr und Tag keine heilige Messe gehört und jetzt zum viertenmal auch zur Osterzeit sich dem Tische des Herrn nicht mehr genaht. So war es gekommen, daß die Leidenschaft von Tag zu Tag ihr Opfer fester umstrickte. Jetzt war er so weit, daß man mit Recht zweifeln konnte, ob es überhaupt jemals besser werden würde. Rasch ging es dem Abgrunde zu. Sein Schritt wurde täglich schwankender und unstäter, seine Hand zitternder, sein Auge trüber, seine Sprache roher und eines Menschen unwürdiger.
Wer hätte das von dem Kinde geahnt, auf dessen Lockenkopf einst voll Hoffnung und Vertrauen die segnende Hand einer sterbenden Mutter geruht hatte? Von dem fröhlichen, talentvollen Knaben, damals der Freude und dem Stolz seiner wackern Lehrer? Von dem prächtigen jungen Manne, dem soliden und seiner vorzüglichen Arbeit wegen gesuchten Schreinermeister, welcher Herz und Hand der ebenso schönen als tugendhaften Marie Miller gewann und das herrliche Mädchen zum Brautaltare und in sein eigenes schuldenfreies Heim führte?
Und jetzt –! Doch wir werden ja hören!
Es war zwei Tage vor dem heiligen Christfest. Der Winter hatte mit aller Schärfe sein eisiges Regiment begonnen. Die Straßen der Fabrikstadt, in welcher Martin Lader wohnte, lagen mit Schnee bedeckt.
Am Fenster einer kleinen, ärmlich eingerichteten Dachkammer saß ein Weib, emsig mit Nähen beschäftigt, und suchte das rasch hinschwindende Tageslicht nach Möglichkeit auszunützen.
Eine Wiege mit einem kleinen Kinde hatte man so nahe als möglich an das schwach glimmende Herdfeuer gerückt, während ein zweites Kind, ein schöner Knabe, mit einigem zerbrochenen Spielzeug zu den Füßen der Mutter saß und mitunter schmerzlich hustend den Lockenkopf an ihre Kniee schmiegte. Martha, das älteste Mädchen, sang dem Wiegenkinde ein Liedchen, und das unschuldige Wesen lachte und patschte vor Freuden mit den kleinen Händchen auf die ärmliche Decke; die Mutter freilich seufzte bitter – nicht laut, daß die Kinder es gehört hätten; aber Gott im Himmel hörte es. Düstere, verzweiflungsvolle Gedanken hatten das arme Weib schon oft bestürmt, und auch jetzt schnitt der Anblick ihrer Kinder wie ein Schwert durch ihr Mutterherz, wie und wann sollte ihr Elend enden? Ja, wer ihr das an ihrem Brauttage vor zehn Jahren prophezeit hätte!
Man klopfte an die Thüre; das weckte die arme Frau aus ihren trüben Träumereien. »Geschwind, Martha,« sagte sie zu dem Mädchen, »schau, wer es ist.«
Das Kind öffnete die Thüre und warf sich mit einem Freudenschrei dem Besuche in die Arme. »O Tante Anna, wie herrlich, daß Ihr zu uns kommt!«
Frau Lader schaute auf und rief ebenfalls voll freudiger Ueberraschung: »Bist du es wirklich, Anna?«
»Wirklich und wahrhaftig,« sagte diese, ihre Schwester herzlich umarmend. »Aber, Marie, bist du krank gewesen? Wie siehst du aus? So bleich und abgehärmt! Man kennt dich ja nicht mehr. Und die Kinder ebenfalls; sie sehen nicht halb so gut aus wie vor einem Jahre.«
»Sie sind in der That nicht ganz wohl – wenigstens mein kleiner Hans hat einen schlimmen Husten. O, es wird sich schon wieder geben. Aber sieh einmal mein Kleines an, du hast es noch nie gesehen.«
»O, der liebe kleine Engel!« rief Anna Miller, Hut und Tuch ablegend und neben die Wiege hinknieend. »Die schönen blauen, unschuldigen Aeuglein! Wem gleicht es?«
»Ich denke, dir,« sagte Frau Lader lächelnd, »wir nannten es auch dir zu Ehren Anna. – Aber seit wann bist du denn zurück?«
»Erst seit heute Mittag. Meine Herrschaft erlaubte mir gerne, dich zu besuchen. Es ist ja auch so lange, daß wir uns nicht mehr sahen, und zudem meinte sie, ich hätte dir etwas Wichtiges mitzutheilen.«
Ein lebhaftes Roth ergoß sich bei diesen letzten Worten über Annas hübsches Antlitz. Frau Lader schaute ihre Schwester prüfend an und konnte sich nicht verhehlen, daß diese zu einer schönen Jungfrau herangeblüht sei, der die einfache, aber sehr geschmackvolle Kleidung trefflich stand.
»Ei, Anna, du bist doch nicht verlobt?« fragte die Schwester, das Erröthen ganz richtig deutend.
»Verlobt und in vierzehn Tagen soll Hochzeit sein. Nun, wirst du mir denn nicht Glück wünschen? Ich dachte, du würdest dich mit mir freuen.«
»O – gewiß, ich hoffe, du wirst glücklich sein, meine Liebe; ja, von Herzen wünsche ich es,« antwortete die Schwester. »Aber die Ehe ist nun einmal eine Lotterie, Anna, und niemand kann mit Sicherheit sagen, ob er einen Gewinn oder eine Niete zieht.«
»Ich denke, mir ist das große Los zugefallen.«
»So denkt jede Braut, und so habe auch ich einst gedacht, aber –.« Frau Lader hielt rasch inne und biß sich auf die Lippe. Es war das erste Mal, daß ein Vorwurf oder eine Klage wider ihren Mann von ihr ausgesprochen wurde, und gerne hätte sie die Andeutung zurückgenommen. Allein es war schon zu spät; die Schwester war aufgesprungen, hatte ihre Hände auf Maries Schultern gelegt und schaute ihr voll in die thränenfeuchten Augen.
»Um Gottes willen,« sagte sie; »sprich dich aus – ist Lader hart gegen dich? Aber nein, sage mir keine Silbe; ich weiß alles! Ich habe letztes Jahr, bevor ich mit meiner Herrschaft nach Frankreich reiste, einiges über deinen Mann munkeln hören und mußte es wohl glauben, nachdem ich ihn einmal vollständig betrunken auf der Straße gesehen hatte. Du hast nur in deinen Briefen nie eine Andeutung gemacht, und ich brachte es nicht über mein Herz, dich zu fragen.«
Anna setzte sich auf einen Schemel, zog die kleine Martha an sich und fragte: »Schlägt euch der Vater oft?«
»O nein, Tante! Die Mutter läßt ihn nicht; aber dann schlägt er manchmal die Mutter.«
Anna entfuhr ein Ausruf der Entrüstung; sie faßte krampfhaft die Hand ihrer Schwester und setzte dann ihr Verhör fort: »Habt ihr immer genug zu essen, Martha?«
»Nicht immer,« sagte das Kind zögernd und mit einem furchtsamen Blicke auf die Mutter. »Die Mutter kann jetzt nicht mehr so viel verdienen, seitdem der Vater die Nähmaschine verkauft hat. – O Mutter, liebe Mutter, weine nicht!«
Frau Lader konnte ihren Thränen nicht länger gebieten; schluchzend verbarg sie das Angesicht in ihren Händen und ließ ihrem Schmerze freien Lauf.
»Er hat die Nähmaschine verkauft!« rief Anna. »Ist es so weit mit ihm gekommen! Und, was sehe ich?« setzte sie nach einem prüfenden Blick auf die ärmliche Ausstattung der Dachkammer bei, »ihr habt ja fast gar kein Hausgeräthe mehr! Hat er auch das alles verkauft?«
Schweigen war die einzige Antwort der Schwester. Da wollte Anna in herben Worten ihrer gerechten Entrüstung Luft machen; aber ein Blick auf das bittere Weh ihrer Schwester hieß sie ihren Unmuth bezwingen. Endlich hob die arme Frau die rothgeweinten Augen und sagte: »Die Sache läßt sich nun einmal nicht länger vertuschen, liebe Anna. Es ist schon lange her, daß sich mein Mann an das Trinken gewöhnte; aber erst in den letzten Monaten ist es so schlimm geworden. Als wir unser Haus verkaufen mußten und hierher zogen, sagte ich den Leuten, der Kaufpreis sei so hoch gewesen und wir wohnten hier näher bei dem Möbelmagazin, in dessen Werkstätte Martin arbeitet. Früher verdiente er ein hübsches Geld mit den herrlichen Schatullen und ähnlichen Luxusgegenständen, die er in den freien Stunden zu Hause fertigte; er ist so überaus geschickt. Das hat nun aufgehört, seitdem er all seine Feierstunden in ›Salomons Keller‹ und im ›Letzten Stüber‹ zubringt. Auch ich verdiente mit Nähen manche Mark. Seitdem aber die Maschine fort ist, kann ich kaum mit etwas Flickarbeit einige Pfennige verdienen. Und doch wäre es so nöthig; denn Lader gibt mir so gut wie nichts von seinem Lohne, und die Kinder leiden bittern Hunger. Höre nur, wie der kleine Hans hustet! Das arme Kind ist nicht warm genug gekleidet – aber wo soll ich Kleider hernehmen? Jetzt geschwind, ich muß diese kleine Arbeit heute noch fertig machen; sonst weiß ich nicht, was wir morgen und am hohen Christfest essen sollen! O es ist mir jetzt recht wohl, daß ich mein Herz einmal ausschütten konnte.« Damit wischte sie sich die Augen und griff emsig zur Nadel. »Nicht wahr, Anna, du nimmst es mir nicht übel; ich muß jetzt arbeiten, solange ich noch sehen kann.«
Anna stand auf, nahm Hut und Tuch, wisperte einige Worte der kleinen Martha zu und sagte dann laut: »Ich habe noch einen Auftrag zu besorgen; in einer halben Stunde wird es dämmern, dann werde ich wieder da sein. Auf Wiedersehen!«
Kaum hatte die Tante die Kammer verlassen, als die kleine Martha das Herdfeuer anfachte und alle Kohlen, welche in dem Becken vorräthig waren, darauf legte.
»Was thust du da, mein Kind?« rief die Mutter, »weißt du nicht, daß das unser ganzer Kohlenvorrath ist?«
»O ja,« sagte das Mädchen lächelnd; »aber Tante Anna gab mir den Auftrag, ein tüchtiges Feuer zu machen.«
»Sie wußte wohl nicht, daß wir so wenig Kohlen haben. Doch es ist jetzt schon zu spät,« seufzte die arme Frau.
»Warum ist Tante fortgegangen?« fragte der kleine Hans sein Schwesterchen, und dieses lispelte ihm ein paar Worte zu, die ein freudiges Lächeln über sein bleiches Gesichtchen zauberten. Frau Lader nähte rasch und schweigend weiter. Sie war zu sehr mit ihrem Elende beschäftigt, als daß der plötzliche Abschied der Schwester ihr aufgefallen wäre. Inzwischen war Martha mit jener Umsicht und mit jenem frühreifen Verständniß, das man oft bei dem ältesten Kinde einer armen Familie antrifft, geschäftig, einen Wasserkessel auf das nun hell lodernde Feuer zu setzen, welches eine gemüthliche Wärme durch den Raum auszustrahlen begann.
Der frühe Winterabend brach herein. Als Frau Lader mit ihrer Arbeit das Fenster verließ, um sie bei dem dürftigen Scheine eines Oellämpchens zu vollenden, öffnete sich die Thüre, und Anna erschien in Begleitung eines Burschen, der einen schweren Korb voll allerlei Düten und Pakete trug.
»Sind die Kohlen schon angekommen, Martha?« fragte sie.
»Nein, aber da kommen sie.« wirklich erschien eben ein anderer Bursche keuchend unter einem schweren Sack Kohlen auf der Treppe. »So, hierhin damit, und da ist Euer Trinkgeld.«
Unter dem Jubel der Kinder und mit vielen muntern Bemerkungen begann nun Anna, die Schätze ihres Korbes auszukramen. Der kleine Hans klatschte in die Hände und tanzte vor Freuden umher, da sich vor seinen gierigen Augen aus all den Düten und Papieren immer mehr »gute Sachen« herausschälten. Anna wollte ihrer Schwester wenigstens auf eine Stunde die traurigen Gedanken verscheuchen und den Kindern einen fröhlichen Abend bereiten.
»Geschwind, Martha,« rief sie, »da ist ein Paket mit Kerzen. Stecke gleich eine an; denn dieses Oellämpchen ist keine genügende Beleuchtung, wenn man Gäste hat und ihnen ein feines Abendessen servirt. Und du, Marie, lege deine Arbeit gleich beiseite und bereite uns einen ausgezeichneten Thee, während Martha und ich die Gedecke legen.«
Ein klein wenig beschämt, aber doch noch viel mehr von der Güte ihrer Schwester gerührt und ob der Freude ihrer Kinder beglückt, trat Frau Lader an den Herd. Und nun begann eine so fröhliche Stunde, wie seit Jahr und Tag keine für die arme Familie auf der Dachkammer geschlagen. Tante Anna hatte nichts vergessen. Da war wohlduftendes, frischgebackenes Brod, süße, goldgelbe Butter, Stücke kalten Bratens und Schinken, Thee, Kaffee, Milchextract. Die hungrigen Kinder hatten lange keine so vortreffliche und reichliche Mahlzeit mehr genossen. Nach dem Thee kam dann noch eine gute Anzahl anderer nützlicher Gegenstände zum Vorschein.
»Da schau, Martha, diese warmen Strümpfe sind für dich, und könntest du dem Mädchen wohl aus diesem Rest Zeug ein Röckchen machen, Marie? – Da ist eine wollene Jacke für Hans und ein Halstuch und eine vorzügliche Flasche gegen den Husten aus der Apotheke; unser kleiner Eduard braucht dasselbe Mittel.«
»Aber, beste Anna,« sagte Frau Lader erröthend, »du hast ja ein ganzes Kapital für uns ausgegeben, wie werde ich dir das jemals vergelten können?«
»Dadurch, daß du stets so glücklich aussiehst, wie jetzt,« antwortete die Schwester lachend. »Du brauchst dich übrigens dieser paar Pfennige wegen nicht zu ängstigen. Ich habe dieser Tage meinen Jahrlohn und obendrein einen Hundert-Markschein erhalten, um damit meine Hochzeitskleider bestreiten zu können. Zudem habe ich mir ein hübsches Sümmchen erspart; man dient bei meiner Dame nicht sieben Jahre, ohne ein schönes Stück Geld zurückzulegen, versichere ich dir. Sie ist so gut, und ich würde sie um alles in der Welt nicht verlassen, wenn es nicht um seinetwillen wäre.«
Dies sagte die Braut mit leuchtenden Augen. Marie erinnerte sich, daß sie in all ihrem Elend auch noch nicht einmal nach dem Namen des Bräutigams ihrer Schwester gefragt hatte. Sie machte also dieses Versäumniß rasch gut und sagte: »Du hast mir ja noch nicht einmal gesagt, wer dein zukünftiger Mann ist. Ist es jemand, den ich kenne?«
»Ja, aber du wirst ihn nicht errathen. – Was sagst du zu Herrn Jakob Roderich?«
»Herr Jakob Roderich!« wiederholte die Schwester staunend. »Du scherzest wohl nur, Anna. Er ist der älteste Sohn, und mein Mann sagt, er sei jetzt schon so gut wie das Haupt der ganzen großen Möbelfabrik, obschon sein Vater noch lebt. Ist es wirklich dein Ernst, Anna?«
»Mein voller Ernst. Ich dachte mir wohl, du würdest staunen,« erwiderte das Mädchen lachend. »Und dein Staunen kann nicht größer sein als meines, da er um meine Hand warb. Die Sache kam so. Ich sah ihn öfter auf dem Schlosse: er kam seit einem Jahre immer in eigener Person, wenn etwas anzufertigen war. Aber obschon er sich stets sehr freundlich gegen mich zeigte, kam mir nie der Gedanke, daß er es auf eine Heirat abgesehen habe – er, der angesehene, wohlhabende junge Mann, und ich, die einfache Kammerjungfer. Da kamen wir vor etwa zwei Monaten aus Frankreich zurück und wohnten auf dem Schlosse bei Hamburg. Graf Sternberg wollte sich hier einige Bibliothekschränke machen lassen, wie er sie bei Roderich gesehen hatte. Er schrieb also an den Möbelfabrikanten, daß er jemanden schicke, der das Maß dazu nehmen und die Zeichnung entwerfen könne. Der junge Roderich kam selber. Da hieß mich meine Dame ihm den Arbeitstisch in ihrem Boudoir zeigen, damit er einen gleichen verfertige, und bei dieser Gelegenheit sprach er sich aus, offen und ehrlich und mit wenig Worten, und seither bin ich glückliche Braut. – Aber jetzt habe ich meine Zeit mehr als verplaudert, und ich muß eilen. Meine Dame hat mir zwar heute freigegeben; allein ich weiß recht wohl, daß sie mich nur ungern vermißt.«
»Das glaube ich gern, Anna. Du bist wie der liebe, helle Sonnenschein. Gott und seine heiligen Engel mögen dich beschützen und schirmen, herzliebste Schwester!«
»Du bist wie die gute Fee im Märchenbuche, Tante Anna,« sagte Martha beim Abschiedskusse. »Du hast uns alle so glücklich gemacht!«
»Wenn mir nur das gelungen ist! Lebt wohl und auf baldiges Wiedersehen!« und fort war die im Gefühle ihrer guten That doppelt glückliche Braut.
*
Schon lange schliefen die Kinder, ganz selig von der ungewohnten Freude, welche ihnen die gute Tante bereitet hatte, und Frau Lader that die letzten Stiche an ihrer Arbeit, als die Thüre roh aufgestoßen wurde und ihr Mann hereinwankte. Marie schauderte unwillkürlich zusammen, als sie ihn erblickte. Sie war freilich seit lange schon an die gräßliche Entstellung gewöhnt, mit welcher die Trunkenheit das menschliche Antlitz entweiht; aber nie hatte sie die Züge ihres Mannes so schauerlich verzerrt gesehen wie diesen Abend. Mit einem Fluche warf er sein Werkzeug in eine Ecke und sank, seiner nicht mächtig, auf den nächsten Stuhl. Da saß er sprachlos, die Arme hingen nieder, als ob sie einem Leichname angehörten, und die Augen glotzten stier vor sich hin. Dieser schreckliche, stiere Blick – er ging wie ein Messer durch das Herz des armen Weibes; dieser Blick in denselben blauen Augen, die einst wie heller Sonnenschein voll Fröhlichkeit und Theilnahme jede Mühe versüßten! War es möglich? Konnte die Leidenschaft sie so entstellen?
Einige Augenblicke wagte Frau Lader nicht, ihren Mann anzureden; endlich sagte sie zitternd: »Um Gottes willen, Martin, was hast du? Ist dir ein Unfall zugestoßen?«
»Ein Unfall – ja, es mag ihm schon ein Unfall zustoßen, und er wird es fühlen, das sage ich!«
»Wer? Von wem redest du?«
»Ich sage dir: sein Leben will ich haben! Abrechnen will ich mit ihm!« Dabei erhob sich der Mann in furchtbarer Aufregung und ballte seine starken Fäuste. »Ja, morden will ich ihn, so wahr ich hier stehe! Ich will es, auf meinen Eid, ich will es!«
»Ach, Martin, Martin! Rede nicht so schrecklich,« flehte sein Weib. »Ums Himmels willen, rede nicht so! Du weißt nicht, was du sagst, Martin; gewiß, du weißt es nicht, du bist müde und hast wieder getrunken –«
»Ja, ich habe wieder getrunken, und ich werde morgen wieder trinken und übermorgen auch, und solang ich will und soviel ich will – hast du mich verstanden? Weshalb sollte ich nicht trinken, wenn es mir einmal Spaß macht? Wer will es mir wehren – das möchte ich wissen! Du nicht mit all deinem Greinen und Heulen, und er auch nicht, der miserable, kaltblütige Schuft. Ich sagte ihm, er werde es bereuen, daß er mich fortgejagt, und so soll er denn, so wahr –«
»Hat der junge Herr Roderich dich entlassen, Martin?« fragte sein Weib, der eine schreckliche Ahnung aufdämmerte.
»Ja!« schrie der Trunkenbold, »er warf mich hinaus wie einen Hund. Er sagte, ich sei ein Schandfleck seiner ehrlichen Werkstatt und drohte, mich der Polizei zu übergeben, wenn ich mich wieder zeigen würde. Ha, den möchte ich sehen, der mir Handschellen anlegen wollte! Aber er muß es mir mit seinem Leben büßen, so wahr ich Martin Lader heiße!«
Die Frau sah wohl, daß diesmal etwas mehr als Trunkenheit aus dem Zorne ihres Mannes spreche; sie wußte auch, daß noch ein Dritter seine Hand im Spiele habe und die Leidenschaft des tief Gefallenen zu diesem Ausbruche reize.
»Du bist wieder in der Gesellschaft von Robert Merzer gewesen, Martin,« sagte sie mit einem Seufzer. »Aber rede jetzt kein Wort mehr davon; du bist heute Abend aufgeregt; morgen wird sich dir alles in einem andern Lichte zeigen. Herr Roderich wird dich ganz gewiß wieder aufnehmen, wenn du nur ein bißchen solider sein willst.«
»Ha, mich wieder aufnehmen!« schrie Lader mit heiserer Stimme. »Und wenn sie auf ihren Knieen zu mir herrutschen, ich gehe ihnen nicht mehr in das verfluchte Loch. Die Pest sollen sie alle kriegen!«
Mit diesem Fluche statt eines Abendgebetes warf sich der Betrunkene in seinen Kleidern auf das Lager und fiel bald in einen schweren Schlaf. Sein unglückliches Weib aber konnte während dieser Nacht keine Ruhe finden. Eine unaussprechliche Angst, der Mann möchte die Drohung vollstrecken, die seine trunkenen Lippen soeben ausgesprochen, quälte sie. Mord! Und wer sollte das Opfer des blutigen Verbrechens sein? Der Bräutigam ihrer lieben, glücklichen Schwester! Der Gedanke war zu schrecklich. Sie kniete nieder und betete mit der ganzen Inbrunst ihres Herzens, daß Gott in seiner Barmherzigkeit die fürchterliche That abwenden wolle. Dann schaute sie wieder auf ihren Mann hin und sah, daß selbst im Schlafe seine Brauen sich finster zusammenzogen und seine Fäuste sich zornig ballten, und sie hörte, wie seine Lippen halbverständliche Drohungen und Flüche lallten. Umsonst suchte sie Ruhe; wenn sie in einen kurzen Schlummer fiel, so fuhr sie alsbald wieder an allen Gliedern zitternd und mit kaltem Schweiße auf der Stirne aus einem beängstigenden Traume empor. Und in all diesen Träumen, so verschieden sie auch waren, verfolgte sie das Schreckbild einer Einrichtung und ein Galgen, der einen breiten, schwarzen Schatten warf. Und der dunkle Schatten kroch in abenteuerlichen Formen rasch über den Boden hin, ihrem Manne nach, welcher umsonst zu fliehen trachtete. Jetzt bedeckte ihn der Schatten, und sie sah ihn nicht mehr –, und fuhr mit einem Angstschrei aus dem Traume auf.
Endlich verscheuchte der Morgen diese düstern Bilder. Marie stand auf, betete inbrünstig, kleidete ihre Kinder, verrichtete auch mit denselben ein eifriges Morgengebet und bereitete das spärliche Frühstück. Der späte Wintertag schaute schon voll durch das Fenster herein, als der Trunkenbold endlich erwachte. Natürlich quälte brennender Durst seine Kehle, seine Augen glühten und unaussprechlicher Kopfschmerz folterte sein Gehirn. Aber das war er seit Monaten gewohnt; einen erquickenden Schlaf kannte er schon längst nicht mehr. Als er das Bewußtsein wieder völlig gewonnen hatte, stand sein treues Weib am Bette und reichte ihm eine Tasse starken Kaffee.
»Was ist das? Kaffee?« brummte er. »Ich mag das schlappe Gewäsch nicht. Geh und hole mir einen Schoppen Bier, wenn du Geld hast.«
»Ich habe kein Geld,« antwortete die Frau entschieden. »Und wenn ich Geld hätte, würde ich doch jetzt keinen Pfennig für dich auf Bier verwenden. Trink diesen Kaffee; er wird dir deinen Kopf klären; ich habe ein ernstes Wort mit dir zu reden.«
Marie war mit dem Muthe der Verzweiflung gewaffnet und fest entschlossen, alles aufzubieten, um ihren mißleiteten Mann in der letzten Stunde noch vom Rande des Verderbens zurückzureißen. Lader starrte sein Weib verwundert an; noch nie hatte das sanfte Wesen in einem so entschiedenen Tone zu ihm gesprochen. Er nahm die Tasse in seine zitternde Hand und begann sie auszuschlürfen. Im anstoßenden Verschlage hustete der kranke Hans und weinte das kleine Kind, welches Martha wiegte und beschwichtigte.
Frau Lader setzte sich neben das Bett zu ihrem Manne und hob mit ernstem Tone an: »Martin, ich hätte dir schon lange einiges gesagt; aber, die Wahrheit zu gestehen, ich wagte es nicht. Du weißt wohl, daß du in letzter Zeit mit mir und den Kindern nicht sonderlich freundlich warst. Ich fürchtete Schläge, wenn ich sprechen würde. Aber heute fürchte ich nicht mehr für mich, sondern einzig für dich, und du mußt mich jetzt anhören, Martin!«
Der Mann sagte ärgerlich: »Nun denn, ins Kuckucks Namen, wozu diese lange Einleitung? Sage, was du zu sagen hast, und nimm dich in acht!«
»Bevor ich dich heiratete,« fuhr die Frau ruhig fort, »hat ein anderer um meine Hand geworben. Ich konnte den Mann nicht ausstehen; er hatte keine Religion und lief in die Wirtshäuser. Der Mann gerieth in heftigen Zorn, als ich ihm einen Korb gab, und verschwor sich, er wolle Unglück über mich und meine Kinder bringen, wenn ich je einen andern eheliche. Ich lachte über diese Drohung und dachte, er werde es bald vergessen haben und ein anderes Mädchen heiraten. Aber er heiratete nicht. Doch während der ersten Jahre unserer Ehe, als wir so glücklich und zufrieden waren – erinnerst du dich nicht mehr, Martin? – vergaß ich den Mann und seine Drohung; er war auch in eine andere Stadt gereist. Da auf einmal kam er zurück.«
»Und?« fragte Martin.
»Und hat sein Drohwort erfüllt. Der Mann ist Robert Merzer.«
Für einen Augenblick schwieg Lader verblüfft. Dann sagte er: »Du schwätzest Blödsinn, Weib! Robert ist der beste meiner Freunde.«
»Robert Merzer ist der größte unserer Feinde,« wiederholte Frau Lader auf das bestimmteste, »wer hat dich – es sind jetzt fast vier Jahre her – daran gewöhnt, jeden Augenblick bald in dieses, bald in jenes Wirtshaus einzukehren? Wer spottete beständig über unsere heilige Religion und suchte es dahin zu bringen, daß du dich deines katholischen Glaubens schämtest, und brachte es wirklich nach und nach dahin, daß du seit Jahr und Tag keine Kirche mehr besuchtest? Wer ist nun seit Monaten jede Nacht in deiner Gesellschaft und gibt nicht Ruhe noch Rast, bis du betrunken bist und bis dein Arbeitslohn, mit dem du die Nahrung und Kleidung deiner armen Kinder bestreiten solltest, durch die Kehle gejagt ist? Wer gab dir den guten Rath, alles, was nicht niet- und nagelfest ist, samt meiner Nähmaschine, mit der ich die Kinder bis dahin vor dem Hunger bewahrte, zu verkaufen und den Erlös ins Wirtshaus zu tragen? Du weißt es so gut wie ich: das alles hat Robert Merzer gethan.«
Martin gab keine Antwort, und seine Frau fuhr alsbald fort: »Dieser Mann war die Ursache all unseres Unheils. Er hat dich wie ein kleines Kind in seiner Hand und mißbraucht dich zu allem nach Lust und Laune. Er hat es auch zuwege gebracht, daß dich Herr Roderich entließ.«
Die Erwähnung dieses Namens entzündete ein unheimliches Feuer in den Augen des Mannes. Mit einem Fluche stellte er die Kaffeetasse hin.
»Gestern Abend war meine Schwester Anna hier. Sie sagte mir, sie sei verlobt und werde sich bald verheiraten, und ich bin überzeugt, du wirst nie mehr solche Reden führen wie diese Nacht, wenn du erfährst, wer ihr Bräutigarn ist.«
»Und wer ist es?«
»Herr Jakob Roderich.«
»Zum Henker mit ihm!« schrie Lader und sprang vom Bette auf. Beschwichtigend ergriff die Frau seinen Arm und sagte: »Denke doch, welches Glück für Anna, eine so vorzügliche Partie! Du selbst sprachst immer mit dem größten Lobe von Roderich, und ich weiß bestimmt, niemand anders als Merzer hat diesen Zorn gegen ihn in deinem Herzen geschürt.«
»Lasse mir Robert aus dem Spiele, Marie. Ich werde zu meinen Freunden wählen, wen ich will. Meinst du denn, ich sei nicht mein eigener Herr und Meister?«
»Nein, leider, das bist du nicht, sobald du getrunken hast! Und deshalb verlange ich von dir das Versprechen, den Umgang mit Merzer aufzugeben. Er hat dich immer tiefer und tiefer ins Elend gebracht, seit du dich mit ihm einließest, und wer weiß, welches der nächste Schritt ist, zu dem er dich verführt, wenn du wieder getrunken hast. Die ganze Nacht träumte ich vom Galgen und sah, wie sein Schatten dich verfolgte. Ich kann nicht sagen, was ich um dich ausgestanden habe.«
»Pah, Träume sind Schäume! Wie kannst du nur so kindisch sein, Marie?« Aber Martin erblaßte doch und verlor seine Zuversicht bei diesen Worten. Er erinnerte sich halb und halb, wie er in seinem trunkenen Zustande die letzte Nacht von Mord geredet.
Das Auge seines Weibes gewahrte den heilsamen Eindruck, den ihre Worte hervorgerufen, und mit der glühenden Ueberzeugung ihres Herzens voll Mutterliebe und Glaubenstreue fuhr sie fort: »Es gibt auch Träume, die Gott zur Warnung schickt, Martin. Laß ihn nicht wahr werden, und damit er nicht wahr werde, meide Merzer! Schau, Martin, es ist heute der Vorabend des heiligen Weihnachtsfestes; laß uns diese Weihnachten besser zubringen als die verflossenen drei! Wir wollen zusammen den Gottesdienst besuchen; wir wollen den Kindern ein ordentliches Mittagsmahl geben und uns im häuslichen Kreise miteinander freuen, wie vormals in unsern glücklichen Tagen. Die armen Kinder sind seit lange kaum halb satt geworden, und der kleine Hans hat einen so bösen Husten; er wird alle Tage elender, ich glaube, wir werden ihn bald verlieren wie unsern Joseph.«
Die zugänglichste Seite des durch die Leidenschaft verdorbenen Herzens Laders war noch seine Anhänglichkeit an die Kinder. Er ging in die kleine Schlafkammer und nahm Hans in seine Arme. Schon seit lange war der Vater dem kranken, reizbaren Kinde nur ein Gegenstand der Furcht. So begann das kranke Kind heftig zu weinen; die Aufregung veranlaßte einen krampfartigen Hustenanfall, welcher dasselbe schrecklich schüttelte und quälte. Der Mann legte den Knaben in die Arme der Mutter und verließ dann, ohne ein Wort zu sagen, hastig das Haus. Voll Angst, aber nicht ohne einen Schimmer von Hoffnung, schaute ihm Frau Lader nach, zur lieben Mutter Gottes betend, daß sie dem verirrten Menschen einen guten Gedanken und einen heilsamen Entschluß eingeben möge.
Was dachte ihr Mann, während er langsam durch die schneebedeckten Straßen ging, des eisigen Windes nicht achtend, der durch seine schlechten Kleider blies? Ein stumpfes Gefühl seines Unrechtes war doch in ihm erwacht, sein Gewissen war nicht ganz erstorben. Die Worte seines Weibes tönten noch in seinen Ohren. Sie hatte die Wahrheit gesagt; keine Silbe konnte er läugnen. Er war in der That ein gefühlloser Mensch – nein, das ist nicht das rechte Wort – , er war geradezu ein brutaler, verkommener Taugenichts geworden. Er hatte sein Weib und seine Kleinen um das tägliche Brod bestohlen; es war zu niederträchtig! Ja, das hatte er gethan, und jetzt fing er doch an, sich vor sich selbst zu schämen.
Martin Lader war in seinen Gedanken eben zu diesem glücklichen Ergebniß gekommen und drehte sich gerade um, in der Absicht, rasch nach Hause zu gehen und sein braves Weib um Verzeihung zu bitten und Besserung zu versprechen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte. Er schaute auf, und da er den Mann erkannte, stieß er die Hand unwillig von sich.
»Ho, ho, was ist los? Mit dem linken Beine aufgestanden? Was ist dir über die Leber gekrochen, Martin?« rief ein kleiner, untersetzter Mann von offenbar großer Muskelkraft. Es lag etwas Verschlagenes, Abstoßendes in dem nur halb geöffneten schwarzen Auge und um die breiten, von schwarzem Stoppelbarte umstandenen Lippen. Der Mann war niemand anders als Robert Merzer.
Zum erstenmal fühlte Lader Widerwillen gegen seinen Zechgesellen. Es fiel ihm auf, daß doch eigentlich das Urbild eines echten Landstreichers vor ihm stehe. Ja, hätte Merzer so ausgesehen, als er ihn zum erstenmal vor Jahren ins Wirtshaus einlud, er hätte ihn voll Verachtung stehen lassen; aber damals arbeitete der Mann noch und kleidete sich anständig. Erst nach und nach war derselbe so herabgekommen und lebte nun – man wußte eigentlich nicht wovon, aber munkelte verschiedenes, wie gesagt, an jenem Morgen wurde er von Lader nicht freundlich aufgenommen; doch das störte ihn wenig; er hing sich ohne viele Umstände an dessen Arm.
»Ich gehe nach Hause, Merzer«, sagte Lader und beschleunigte seine Schritte.
»Das wird nicht halb so pressiren! Geschwind, alter Junge, komm da in die Schenke mit mir und trink einen Schnaps. Es ist ein verflucht kalter Morgen.«
»Ich habe keine Zeit; ich muß heim!«
»Unsinn, Mann! Ein einziges Gläschen, das thut dir gut; höre, nur einen Schluck!«
»Nun denn, meinetwegen – aber nur ein einziges, hörst du, Merzer.«
Es war die alte Schlinge. – Den ganzen Tag harrte Frau Lader voll bitterer Angst zu Hause auf die Rückkunft ihres Mannes.
Es wurde Mittag und Abend und Nacht, und er kam nicht.
*
Es ging auf Mitternacht. Der Schnee fiel in dichten Flocken und bedeckte die Straßen mit einer frischen, weißen Lage. In einem abgelegenen Stadttheile schritten zwei Männer durch enge, menschenleere Gäßchen. Der eine war offenbar völlig betrunken; er hatte sich in den Arm seines Gefährten gehängt und wankte dahin, von Zeit zu Zeit Flüche und Verwünschungen lallend. Der andere hatte seine Augen offen und schaute scharf um sich, als ob er jemanden erwartete. Jetzt nahten Schritte der Stelle, wo die beiden Männer weilten, der eine in fast bewußtlosem Zustande, der andere aber seiner Sinne völlig mächtig. Merzer hatte nicht viel getrunken, während er seinem Gefährten rasch Glas um Glas eingeschenkt hatte; er wußte, daß er zu seinem Vorhaben großer Umsicht und kalter Ueberlegung bedürfte.
Der Fußgänger kam näher, und Merzer zog den Betrunkenen mit sich in den tiefen Schatten eines vorspringenden Pfeilers. Jetzt fiel das Licht einer Gaslaterne auf den näher kommenden Mann; es war der junge Roderich. Arglos und in Gedanken an seine Braut voll froher Hoffnung schritt er daher, nicht ahnend, daß ein Mörder seiner harre.
Jetzt hatte er den Pfeiler erreicht, da stürzte eine dunkle Gestalt aus dem Schatten und warf sich wie ein wildes Thier auf den Wehrlosen. Ein dumpfer, halberstickter Schrei, ein verzweifeltes Ringen, dann ein schwerer Fall – und Robert Merzer leerte die Taschen seines unglücklichen Opfers und floh.
Halb bewußtlos lehnte Lader an der Mauer des Hauses und war Zeuge der verübten Blutthat. Als der Mörder verschwunden war, wankte der Betrunkene mit ungewissen Schritten zu dem Manne hin, der auf dem Boden lag. Was hatte sein Gefährte gethan? Hatte er nicht diesen Fremden erschlagen und ausgeraubt? War derselbe wirklich todt? Lader beugte sich über den wahrscheinlich Ermordeten hin und kehrte dessen bleiches Antlitz dem Lichte der Laterne zu.
Ein Ruf des Entsetzens entrang sich seiner Brust, als er die Züge des Mannes erkannte, dem er in den letzten Stunden so oft den Tod geschworen. Ja, es war kein Zweifel, Jakob Roderich lag regungslos zu seinen Füßen. Lader war durch den plötzlichen Schrecken so weit ernüchtert, daß er, nun genügend bei Sinnen, zitternd den Rock des jungen Mannes aufknöpfte, um zu fühlen, ob das Herz noch schlage; aber mit einem Mark und Bein durchdringenden Schrei zog er plötzlich die Hand zurück – die Kleider Roderichs waren mit Blut getränkt, und ein dunkler Strom färbte den Schnee.
Jetzt nahten Leute; er hörte ihre Stimmen. Da durchzuckte ihn der Gedanke, wenn sie ihn bei der Leiche fänden, so würden sie sagen, er sei der Mörder. Er mußte fliehen, fliehen, so lieb ihm sein Leben war, fort von dieser schrecklichen Stelle, von diesem blutigen Leichname. Fliehen! Das war sein einziger Gedanke, den er in dieser Todesangst noch fassen konnte. Planlos eilte er fort, durch Gassen und Gäßchen, durch Straßen und Plätze, nur fort, fort von dem Schauplatze der Blutthat.
Seine Füße wankten nicht mehr; aber es hing sich doch wie ein Bleigewicht an ihn. In seiner Angst hielt er beinahe sich selber für den Mörder; hatte er dem Manne nicht den Tod geschworen? War er nicht ein Mörder in Gedanken wenigstens, wenn nicht in der That? Das Schuldbewußtsein überwältigte ihn so, daß er fast kraftlos zusammengebrochen wäre. Aber immer wieder peitschte ihn die Furcht vor dem rächenden Arm der Gerechtigkeit voran. Er erinnerte sich an den Traum seines Weibes, und jedes Schattenbild, das die Gaslaternen über den Schnee hin warfen, verwandelte sich in den Schatten des Galgens, der ihn verfolgte.
Lader hemmte seinen verzweifelten Lauf, da er jetzt in eine breite, hellerleuchtete Straße einbog, in welcher viele Leute ruhig und schweigend auf eine Kirche zuschritten. Der Flüchtling schaute sich verwundert um; er fand sich dem Hause gegenüber, das er in den glücklichen Jahren seiner Ehe bewohnt hatte, und da drunten die Kirche – wie oft hatte er in ihr mit seinem Weibe den göttlichen Heiland empfangen!
Die Kirche war offen; er sah die Leute eintreten. Auf einmal kam ihm der Gedanke: es ist ja Weihnachten und Zeit zur Mitternachtmesse! Sofort entschloß er sich, gleichfalls die Kirche zu betreten. Da war er in Sicherheit; wenn die Polizei seine Spur verfolgte, so suchte sie ihn am wenigsten in der Kirche. Die helle Todesangst trieb ihn also wieder in die Kirche, nachdem er jahrelang keinen Fuß in ein Gotteshaus gesetzt hatte. Es war nicht Reue und auch nicht ein frommer Gedanke, der den Verirrten leitete; nur das Gefühl, da werde ich vor meinen Verfolgern sicher sein. Derselbe Instinct trieb ihn auch möglichst weit von den Thüren weg nach den Altären hin, bis er das Ende eines Seitenschiffes erreicht hatte.
Eben begann die heilige Messe. Die freudenreichen Klänge der Weihnachtslieder tönten, von leisem Orgelspiele begleitet, durch die Gewölbe. Der Flüchtling blickte sich erschrocken um. Niemand beachtete ihn, und mit einem Seufzer der Erleichterung kniete er sich hin, gleich den übrigen.
Unmittelbar vor dem Unglücklichen stand die Krippe, eine geschmackvolle Nachahmung des Stalles von Bethlehem. Ueberaus milde und liebevoll kniete die seligste Jungfrau mit dem hl. Joseph neben dem göttlichen Kinde. Wie leuchteten die Augen des Jesusknaben, wie breiteten sich die kleinen Arme aus, als ob er ausriefe: »Kommet alle zu mir, die ihr mit Sünden und mit Elend beladen seid, verzaget nicht! Um euretwillen liege ich hier auf dem Stroh! Wenn ihr nur guten Willens seid, so will ich euch den Frieden bringen.«
Der Anblick drang dem tiefgefallenen Manne zu Herzen; Thränen traten in seine Augen. Die mahnenden Worte, die sein Weib am Morgen zu ihm gesprochen, und die er in der Schenke übertäubt hatte, tönten wieder in seinen Ohren. O wäre er ihnen doch gefolgt! Aber jetzt – konnte nicht noch alles gut werden? In Angst und Verwirrung stammelten seine Lippen seit langer Zeit wiederum ein Gebet, und er wurde ruhiger.
Da auf einmal fiel sein Blick auf seine blutbefleckten Hände; beinahe wäre ihm ein Schrei des Entsetzens entfahren. Blut, das Blut eines gemordeten Menschen an seiner Hand! Und so war er in das Gotteshaus eingetreten und kniete nun mit diesem schrecklichen Male gezeichnet an der Krippe des Heilandes! Namenloses Weh ergriff die Seele des unglücklichen Menschen; es war, als hätten diese rothen Flecken ein Licht in sein sündenvolles Herz geworfen und zeigten ihm die eigene Verworfenheit, in welche ihn seine Trunksucht gestürzt hatte, welche Reihe von Sünden und Lastern bis zu diesem Blutmale!
Seine blinde Furcht war nun verflogen. Er dachte nicht mehr an Flucht, sondern nur daran, ob es ihm vergönnt sein werde, gut zu machen, was er an Weib und Kind gefrevelt hatte, oder ob das Ereigniß dieser Nacht rächend mit ihm die Unschuldigen treffen werde. Als die Messe zu Ende war, verließ er ruhig die Kirche, bereit, die Folgen seines Lebenswandels zu tragen. Rasch ging er seinem Hause zu; es drängte ihn, seiner Frau die Entschlüsse mitzutheilen, welche der teuflische Versucher noch einmal durchkreuzt hatte. Wie oft hatte er im Laufe des Tages die Schenke verlassen und seine Frau aufsuchen wollen, und immer war es Merzer wieder gelungen, den Widerstrebenden festzuhalten! Jetzt dämmerte in seinem Kopfe dunkel der Gedanke, was der Verführer bezweckt habe und wozu er ihn mißbrauchen wollte.
Lader hatte seine Wohnung erreicht und setzte eben den Fuß auf die Haustreppe, als er sich plötzlich von einer eisernen Faust gefaßt fühlte. Er stutzte – ja, er hatte sich nicht getäuscht, er schaute in das Angesicht zweier Polizeisoldaten und sagte mit viel Ruhe: »Ich habe ihn nicht erschlagen.«
»Na, Ihr wißt doch recht wohl, worum es sich handelt,« sagte der eine der Polizisten, indem er seinem Gefährten einen Wink gab. »Kommt jetzt mit uns! Das ist eine saubere Geschichte; erschlagen freilich habt Ihr ihn nicht. Aber das ist wahrlich nicht Eure Schuld; denn Ihr habt das Mögliche gethan und ihm einen tüchtigen Stich versetzt.«
»Er lebt also?« frug Lader eifrig.
»Ja, er lebt, und wenn er mit dem Leben davonkommt, so ist das ein Glück für Euch.«
»Gott sei Dank, daß er nicht todt ist! Gott sei tausendmal gedankt!«
Lader sagte diese Worte mit großer Wärme und hielt dann ohne Widerstand seine kräftigen Arme hin, daß man ihm die Handschellen anlege. Die Polizisten, denen seine Muskelkraft wohl bekannt war, wunderten sich nicht wenig. Der Mann dauerte sie; sie kannten sein braves Weib und seine Kinder.
»Sollen wir Eurer Frau ein Wort sagen?« fragte der eine.
»Nicht jetzt. Sie wird es früh genug erfahren. Laßt uns gehen.«
»Es ist das heillose Trinken, das Euch so weit gebracht hat, Lader!« sagte der andere Polizist, als sie mit dem Gefangenen durch die Straßen gingen.
»Ja, das Trinken! Ihr habt recht, das ist an allem schuld. Gleichwohl habe ich ihn nicht gestochen. Der Gedanke lag mir nahe, und ich war einmal dazu entschlossen, aber gethan hab' ich es nicht.«
»Was hilft läugnen?« sagte der Polizist. »Ihr würdet besser schweigen; man fand ja Euer Messer neben ihm.«
»Mein Messer? Was für ein Messer?« fragte Lader erschrocken.
»Geht, geht, Lader!« sagte der Polizist ungeduldig. »Versucht es nicht, uns einen blauen Dunst vorzumachen. Was für ein Messer! Nun, es hat eine breite, starke Klinge, und auf dem Heft ist Euer Name eingekratzt; Ihr kennt es gut genug!«
»Bei Gott im Himmel! Nie in meinem Leben hatte ich ein solches Messer!«
Die Ruhe, mit welcher der Gefangene diese Worte aussprach, welche die Polizisten als eine handgreifliche Lüge ansahen, ärgerte diese nicht wenig. Sie gaben keine Antwort; schweigend führten sie ihn durch die Straßen.
Das Morgengrauen des gnadenreichen Christfestes traf Lader im Gefängnisse. Sein Bericht über die Blutthat hatte keinen Glauben gefunden; es sprach zu vieles gegen ihn. Ein ebenso starker Schuldbeweis, wie das mit seinem Namen bezeichnete Messer, waren die Blutflecken an seinen Händen und an seinen Kleidern. Er erzählte zwar, wie er diese erhalten habe. Aber wenn seine Aussage die Wahrheit enthielt, weshalb war er denn so sinnlos geflohen? Er konnte keine genügende Erklärung seiner Angst beibringen; das Gefühl der Schuld mußte ihn überwältigt haben. Er solle gestehen und angeben, wo er die goldene Uhr und die Börse Roderichs hingebracht habe; das sei der einzige Weg zu einer Strafmilderung, sagte man dem Gefangenen.
Welche traurige Weihnacht! Die arme Frau des Trinkers hörte am frühen Morgen schon gerüchtweise, was vorgefallen, und bald bestätigte sich die schreckliche Nachricht. Sie zweifelte kaum an der Schuld ihres Mannes; hatte sie doch seinen Racheschwur gehört. Aber ebenso ausgemacht war es ihr, daß Merzer die Hauptschuld trage. Ganz gewiß hatte er auch diese entsetzliche Blutthat geplant und herbeigeführt. Die arme Frau meinte, sie komme von Sinnen. Es drängte sie, den Mann im Gefängnisse aufzusuchen; aber sie konnte die Kinder nicht allein lassen. Der kleine, kranke Hans verlangte beständige Pflege.
Vor dem Abende kam ihre treue Schwester Anna. Frau Lader schrak zurück und bedeckte ihr bleiches abgehärmtes Antlitz mit beiden Händen.
»O sage mir nichts über das Schreckliche, Anna!« stöhnte sie. »Ich kann es nicht tragen, es bringt mich unter den Boden. Es ist gewiß fürchterlich für dich; aber es ist noch viel fürchterlicher für mich, da mein Mann den Streich führte.«
Anna ergriff tröstend die Hände der Schwester und sagte: »Höre, Marie. Ich bin bei meinem Bräutigam gewesen; seine Wunde ist nicht so gefährlich, als man zuerst meinte. Er ist jetzt im stande zu sprechen, und erklärt, er sei ganz sicher, daß nicht Martin Lader ihn gestochen habe. Es sei ein kurzer, untersetzter Bursche, mit einem schwarzen Stoppelbart gewesen.«
»Merzer!« rief Frau Lader, und sank mit gefalteten Händen auf ihre Kniee nieder, um Gott zu danken, daß die Blutschuld nicht auf dem Herzen ihres Mannes laste.
So war denn Martin Lader von der schlimmsten Anklage gereinigt; aber es gelang ihm zunächst nicht, sich von der Theilnahme an dem Verbrechen rein zu waschen. Gleichwohl veranlaßte nach wenigen Tagen ein unerwartetes Ereigniß seine Freilassung. Merzer, den die Polizei auf das eifrigste verfolgte, war in einer benachbarten Stadt ergriffen worden.
Ein heftiges Fieber hatte den fast zu Tode gehetzten Mann daniedergeworfen, und nun machte er in der Meinung, sterben zu müssen, ein volles Geständniß seiner That. Maries Ahnung bestätigte sich; Rache hatte den gewissenlosen Menschen auch zu diesem letzten Verbrechen bewogen, welches darauf berechnet war, Laders Familie in das äußerste Elend zu stürzen. Aber die Todesangst erpreßte dem Bösewicht ein offenes Bekenntniß seiner verworfenen Pläne und Thaten. Alles war nun entdeckt, und Lader wurde den Seinigen wieder geschenkt.
Gleichwohl starb der Bösewicht nicht; unter den Kettengefangenen büßt er gegenwärtig für sein Verbrechen.
Ein Jahr ist seit dieser traurigen Weihnacht verflossen. Die klare Wintersonne zaubert Diamanten an die mit Reif besetzten Zweige der Bäume und auf die Dächer und Straßen weit und breit. Ihre schrägen Strahlen blicken vergnügt in ein wohnliches Zimmer und sehen daselbst eine fröhliche Gesellschaft um einen reich mit Weihnachtsgaben beladenen Tisch versammelt. Da sitzt Martin Lader im Kreise seiner Lieben, und zu den Gästen zählt auch Herr Jakob Roderich und dessen schöne junge Frau. Herr Roderich hatte seinem ersten Aufseher, der seit dem Ereignisse der letzten Weihnacht wieder ein Muster von Fleiß und tadelloser Aufführung geworden, die Einladung zu diesem Familienfeste nicht abschlagen können. Es war das zu gleicher Zeit eine feierliche Erklärung, daß alles vergeben und vergessen sei. Frau Lader war so glücklich und ihre Kinder so voll Freude und Jubel.
»Wer hätte das vor einem Jahre gedacht, Martin?« rief sie ganz überwältigt ihrem Manne zu.
»Ja, da schaute es freilich anders aus,« sagte dieser, und eine Thräne trat in sein Auge. »Das liebe Christkind hat in seiner Barmherzigkeit an uns gehandelt. Wer weiß, ob ich mich jemals wieder zu Gott hingewendet, wenn mich nicht die helle Todesangst in jene Mitternachtsmesse getrieben hätte. Damals faßte ich den Vorsatz, mit einer guten Beichte ein neues Leben zu beginnen, und Gottes Barmherzigkeit sei es gedankt, er gab mir die Gnade, meinen Vorsatz zu halten!«
» Friede den Menschen, die eines guten Willens sind!«