
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Oktober 1894 bis Oktober 1898
Güte und Vornehmheit, die einen Grundzug seines menschlichen Wesens bilden, hatten Strauß vorgespiegelt, an der Stätte seiner Jugend würde diesmal ein künstlerisch befriedigendes Wirken für ihn möglich sein. Die Kräfte, die einem solchen dort entgegenstanden, hatte er nicht in ihrer Natur erkannt, die der seinen grundsätzlich feindlich war; vielleicht bewirkte auch die Sonne des Südens, unter der er die Verhandlungen mit München abschloß, daß er sich die dumpfere Luft des damaligen bayerischen Hoftheaters zu wenig deutlich vorstellen konnte.
Vom 1. Oktober 1894 an war er nun Königlicher Kapellmeister in München, als künftiger Nachfolger des Generalmusikdirektors Hermann Levi, der sich indes trotz seines zuweilen sehr leidenden Zustandes erst 1896 ganz zur Ruhe setzte. Strauß hatte geglaubt, durch eingehende vertragliche Festlegung seiner künstlerischen Befugnisse allem Ungemach vorbeugen zu können; aber diese Hoffnung erfüllte sich nur sehr unvollständig. Die Proben blieben nach seinen Begriffen ebenso mangelhaft wie früher. Levi beschränkte sich in der Oper, wenn er sich besonders angegriffen fühlte, stellenweise auf bloßes Andeuten des Taktes; dadurch auf den guten Willen des Orchesters angewiesen, hielt er die Zügel nicht mehr so straff; Franz Fischer war überhaupt keine Herrschernatur; da hatte es sich eingeschlichen, vieles eben vorzutragen, wie es im Rahmen des künstlerischen Anständigen und zugleich für den Spieler Schonenden blieb. Damals hatte Strauß oft weit ausholende, große und zuweilen sehr lebhafte Bewegungen; in der Folge wurde dann seine Zeichengebung immer schlichter und einfacher. Bei den Wagnerzyklen des Sommers 1895 konnte man seine Art mit der Levis und Fischers vergleichen; das Prügelfinale der Meistersinger z. B. hatte man seit langem, wohl seit Bülow, nicht mehr rein und deutlich gehört; ein gewisser Eindruck von musikalischer Verwirrung war dabei herkömmlich und galt für unvermeidbar. Ebenfalls ein ganz anderes Tonstück als das gewohnte, wunderbar ausdrucksvoll, klar gegliedert und zum erstenmal überhaupt wieder verständlich, wurde durch seine Vortragsausarbeitung das Solissimo des Englischen Horns im dritten Akt des Tristan. Bald nach Beginn seines zweiten Dienstjahrs, am 16. November 1895, tat man ihm den Gefallen, seine Oper aufzuführen, aber dies geschah nur unter allen möglichen, für ihn erschwerenden und beeinträchtigenden Umständen, wozu die Ablehnung der Hauptpartien durch die ersten Kräfte der Oper gehörte. Außerdem war er vorher infolge von Fischers Beurlaubung und Levis Krankheit in der Zeit der Proben zum Guntram maßlos belastet gewesen. Siegfried Wagner fürchtete, man werde dieses Werk, das er als gegensätzlich gegen die Ziele seines Vaters empfand, dessen Einfluß in die Schuhe schieben, und bald darauf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Strauß, der sich als treuer Jünger Wagners fühlte und als Quelle seiner ganzen, im Guntram betätigten Musikdramatik auf die Partituren und Schriften des Meisters hinwies. Die Titelrolle sang Max Mikorey, dem sie im Stil überhaupt ungünstig lag, die Freihild Frau Pauline Strauß, die sie trotz stimmlicher Unpäßlichkeit heldenhaft durchführte. Das Orchester war gegen die Oper eingenommen, spielte aber mit großem Pflichtgefühl; nach dem zweiten und dritten Akt rief man lebhaft den Autor, der den vollen Glauben an sein Werk nicht mehr besaß. Alsbald ging er mit Schillings und Felix vom Rath nach Bozen, sich im Hotel Greif zu erholen, wo er unter dem Druck der Münchener öffentlichen und privaten schroffen Urteile weitgehende Striche ersann. Doch kam es nicht zu einer zweiten Aufführung. In der Folge wurde der Guntram noch 1896 in Dresden geplant, aber durch den Weggang von Anthes vereitelt; Aufführungen fanden noch statt in Prag und Frankfurt, von denen noch die Rede sein wird.
Die mangelnde Eingänglichkeit der Oper gab den Gegnern Anlaß zu ergiebigsten Äußerungen in der Presse. Strauß schrieb Mitte Januar (1896) an Arthur Seidl: Es ist unglaublich, was der Guntram mir Feinde gemacht hat. Ich komme mir schon bald selber wie ein ganz schwerer Verbrecher vor. Ja, ja, alles verzeihen einem die Leute eher, die frechste Lüge selbst, nur nicht, daß man geschrieben hat, wie einem ums Herz ist. Kurz nach dem Anfang des dritten Münchener Jahres, im Herbst 1896, wurde Strauß nach Levis endlich erfolgtem Rücktritt für die restlichen zwei Jahre des Vertrages zum Hofkapellmeister ernannt. Als solcher leitete er im Verein mit dem Intendanten, von Possart, die Neueinstudierungen für den sommerlichen Mozart-Zyklus im Münchener Residenztheater. Nur der Figaro war noch von Levi einstudiert, Don Juan, Entführung, Cosi fan tutte, Zauberflöte von Strauß, der auch alle diese Opern dirigierte. Schon damals fesselte seine eigenartige Begleitung der Seccorezitative im Don Juan. Unter der Intendanz Possarts kam die Oper in München noch stärker an die erste Stelle als bisher, einem Zug der Zeit folgend, der als Zeichen geistigen Rückschritts wohl kaum zu schroff bezeichnet ist. Das Gerücht verstummte nicht, daß man nach einem ersten Kapellmeister suchte, bei dem der Ruhm des Komponisten nicht auf den des Dirigenten drücke. Bülow hatte schon 1893 endgültig abgelehnt; nun sprach man von Weingartner – zu einer Verlängerung des Vertrages waren für Strauß die ganzen Verhältnisse nicht angetan. – Erst viel später, aus Anlaß der durch Felix Mottls plötzlichen Tod erfolgten Störung der Münchener Wagnerfestspiele im Sommer 1911, hatte er dann einmal Gelegenheit, seinem alten Hoftheater zu zeigen, was es mit richtigem Proben auf sich hat. Diese Körperschaft war gewohnt, auch mit einem geradezu schaudernd leichtsinnig bemessenen Mindestmaß von Vorbereitung dank Mottls beispiellosen Augenblicksleistungen noch irgendwie blendend zu wirken; auch Otto Lohse hatte damals für die Götterdämmerung nicht viel über eine Stunde Zeit, sich mit den ungewohnten räumlichen und klanglichen Verhältnissen des Prinzregententheaters, dem verdeckten Orchester und den zusammengewürfelten Solisten einzuarbeiten. Erst auf wiederholtes Ansuchen der Intendanz sprang damals Strauß für eine Tristanvorstellung ein. Er forderte vollgültige Proben, studierte das Vorspiel taktweise nach seiner Auffassung vom Vorwärtsdringen und Zurücksinken der rhythmisch-melodischen Welle um und schuf hier, wie im Liebesduo und der Sterbeszene Tristans, unerhört gewaltige Steigerungen in Zeitmaß und Tonstärke.
Auch in seiner Eigenschaft als Konzertdirigent des Hoforchesters blieben ihm tiefgreifende Unstimmigkeiten nicht erspart. In den ersten beiden Jahren 1894-96 seiner neuen Münchener Stellung leitete er diese Körperschaft auch in deren »Konzerten der Musikalischen Akademie«. Gleich der erste Abend unter seiner Führung, mit Beethovens Siebenter, schlug zündend ein; auch die ruhige Vornehmheit seiner Zeichengebung gefiel. In der Folge brachte er sämtliche Symphonien des Meisters, und schon im zweiten Konzert die Faustsymphonie, ebenfalls mit einem dort bei Lisztschen Werken ungewohnt starken Erfolg. Für Smetana trat er, wie auch anderwärts, mit dessen Zyklus von Tondichtungen: Tabor, Ultava und Sarka ein. Auch seine eigenen Werke, die Vorspiele zum ersten und zweiten Akt des noch unaufgeführten Guntram im Dezember (1894) und der gleich noch zu erwähnende neue »Eulenspiegel« fanden herzlichste Aufnahme. Manche Eigenheiten im damaligen Münchener Musikleben näher zu berühren, ohne gewisse Empfindungen zu verletzen, wird, als richtiger Eiertanz, am besten gar nicht versucht; es genüge zu erwähnen, daß dort das Bier auch zu jener Zeit vorzüglich war, und daß sich Strauß nach dem zweiten Winter durch örtliche Umstände veranlaßt sah, seine glanzvoll bewährte Leitung der Akademiekonzerte niederzulegen, die der aus Rußland zurückgekehrte Max Erdmannsdörfer übernahm. Das Unbequeme, das für so viele in allem Außerordentlichen liegt, war wieder einmal glücklich beseitigt. Außerhalb seiner Heimat wußte man den Dirigenten Strauß schon damals vielfach glänzend zu würdigen. Gleich in dem ersten Münchener Winter, 1894/95, leitete er als Nachfolger Bülows die Konzerte des Philharmonischen Orchesters in Berlin. Diese Tage der Proben und Aufführungen wurden besonders durch den Verkehr mit dem Schriftstellerkreis Mackay, Henckell, den beiden Hart, Bie sehr anregend und in der Folge für sein Liederschaffen bedeutungsvoll. Er ging mit dem Orchester Anfang April auch nach Wien, wo er im großen Musikvereinssaal ein Konzert mit der Siebenten Symphonie und Meistersingervorspiel leitete; noch immer blieb der Boden dort für ihn spröde; Besuch und Beifall waren mäßig. Aber immerhin hatte man ihn durch diese Einladung in die Gastdirigentenreihe Mottl-Weingartner gestellt. Immer zahlreicher wurden in der Folge die Aufforderungen zur Leitung eigener und fremder Werke im Konzertsaal. Schon 1895 dirigierte er in Pesth, im Berliner Wagnerverein, in Leipzig, 1896 in Lüttich, Köln, Düsseldorf, wohin er auch Pfingsten zum Rheinischen Musikfest kam, in Moskau, 1897 in Amsterdam, Barcelona, Brüssel, Hamburg, London, Paris, teilweise unter Mitwirkung seiner Frau, die seine Lieder mit Orchester- oder mit Klavierbegleitung erfolgreich sang. Gegen die Jahrhundertwende hin war längere Zeit hindurch kaum ein Musik- und natürlich auch kein Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins zu denken, ohne daß man sich seiner Mitwirkung zu versichern suchte. In Brüssel glänzte 1896 Milka Ternina mit dem später zu erwähnenden »Gesang der Appollopriesterin« und »Verführung«, mit Orchester, Strauß selbst außerdem mit Macbeth und Eulenspiegel. Ende November 1897 ging er zum erstenmal nach Paris, um ein Colonne-Konzert zu leiten. Während Levi, Mottl, Nikisch dort eingeführte Stücke gebracht hatten, wagte er Eulenspiegel, Tod und Verklärung, und fand herzlichste Aufnahme, ebenso Frau Pauline Strauß, die Lieder von ihm mit Orchester und mit Klavier vortrug.
Während der Reibungen an seinem Wohnort und der glänzend verlaufenen Dirigentenreisen schritt Strauß in dieser zweiten Münchener Dienstzeit tonsetzerisch mit ungeminderter Kraft und Wärme auf der eingeschlagenen Bahn fort. Ja, er fand die reizvolle innere Genugtuung, mit seiner technisch nun jeder Aufgabe gewachsenen Kunst eine Seite seines eigenen Wesens zu verewigen. Am 6. Mai 1895 vollendete er seine Orchesterdichtung Eulenspiegels lustige Streiche. Die Figur dieses Volkshelden hat Strauß auch vorher und nachher beschäftigt. Schon in Weimar hatte er unmittelbar nach Vollendung des Guntram den Textentwurf vom ersten Akt einer komischen Oper des gleichen Stoffes beendet. Vielleicht hatte ihn der unbeholfene Text zu Cyrill Kistlers 1889 aufgeführter Oper desselben Namens angeregt, der ihn beim Lesen sehr erheiterte. Der Eulenspiegel ist ein glänzender Beweis für das urgesunde Wesen von Straußens Begabung. Die rein symphonische Durcharbeitung der Hauptmotive in reich ausgebildeter Vielstimmigkeit bietet dem Leser der Partitur ein Zeugnis des ernsthaften, tiefgründigen Fleißes, den selbst ein Genie der Form bei der scheinbar leicht hingeworfenen Arbeit in der Art eines Orchesterscherzo unbedingt aufwenden mußte. Denn auch die mühelos herbeiströmende Eingebung bedarf zur Festlegung in diesem gewaltigen Klangkörper, der doch immer gleichsam auf den leichtesten Federdruck, wie gewichtlos, ansprechen soll, anhaltender Sammlung und sorgfältigster Einzelmalerei, die auch im Humor die Zügel der Form nicht verliert. Auch hier ist die Wichtigkeit des Programmatischen für den Hörer sehr verschieden. Dem Leiter der Uraufführung, Franz Wüllner, der den Autor um eine kurze Erläuterung bat, schrieb dieser: »Es ist mir unmöglich, ein Programm des ›Eulenspiegel‹ zu geben: was ich mir bei den einzelnen Teilen gedacht habe, würde in Worte gekleidet sich oft seltsam genug ausnehmen, vielleicht sogar Anstoß erregen. Wollen wir daher diesmal die Zuhörer selbst die Nüsse aufknacken lassen, die der Schalk ihnen verabreicht.« Er gibt dann die zwei Hauptmotive und die Stelle des Urteils:

Alle Arten von rein musikalisch geistreichen Motivumwandlungen des »Eulenspiegel« kommen auch bei Haydn schon vor, so bei Motiv 1 und 2:


Wenn man nicht genau weiß, was die zwischen diesen Hauptmotiven plötzlich eingeschobenen neuen »bedeuten«, so bleibt doch der ganze Vorstellungskreis, der zu dem Tonstück anregte, so geschlossen, daß die im Augenblick etwa fehlende volle Bestimmtheit kein großes Übel ist. Die Werke der Wiener Klassiker bieten oft viel größere »Rätsel«, sobald man von dem ruhelosen Wahn getrieben wird, ihre Auflösung besser als der Autor kennen zu müssen. Selbst die unheimlich ahnungsvollen Stellen, in denen den Herrenmenschen Till mitten im Übermut das Vorgefühl einer rächenden Vernichtung durch die verhöhnten Mächte des Herdenmäßigen beschleicht, haben ihre Vorbilder in klassischen Werken, wie z. B. in den plötzlichen Stellen leiser Wehmut im sprühenden Finale von Mozarts Es-dur-Symphonie. Aber damals wollte man noch nicht von all solchem das Warum wissen. – Wenn Strauß dieser Tondichtung auch zunächst nichts Schriftliches mitgab, als den Titel, so schrieb er doch Mauke für seinen »Führer« ein Programm an die dort bezeichneten Stellen der Partitur, das einige Streiche Eulenspiegels, die Zitierung vor Gericht wegen Gotteslästerung, den Tod durch Erhängen und das Weiterleben in der Volkssage andeutet. – Am 5. November (1895) erfolgte die Uraufführung im Kölner Gürzenichkonzert unter Wüllner. Im selben Monat noch spielten es die Hoforchester in Mannheim, Berlin und München.
Während dieser Erfolge seines trotz des tragischen Einschlags fröhlichsten Werkes beschäftigten Strauß in jener Zeit weit ernstere Dinge. Mit stärkstem Anteil nahm er noch in jener Zeit neue Werke der heutigen Lyrik und Gedankendichtung in sich auf; eine Strömung, die neben der durch Ritter angeregten, von Schopenhauers Philosophie beherrschten, herlief. Erst die Bekanntschaft mit Nietzsche, dessen Zarathustra soviel einer wesentlichen Seite seiner eigenen Natur Verwandtes birgt, half dazu, ihn im Lauf der Zeit aus dem Bannkreis des »Erlösungsrummels« herauszuführen – man verzeihe hier die ungezwungene Bezeichnung; die Überhandnahme des Motivs und Worts im ernsten Musikschaffen jener Zeit legt sie allzu nahe. Es ist ungemein bezeichnend für Strauß, daß das erste Werk, in dem er Zarathustra-Nietzsches lebensbejahende, licht- und sonnenfrohe, schreit- und tanzfreudige Geisteshaltung verherrlichte, bei aller feuerverwandt emporstrebenden Gewichtlosigkeit der Gesamtwirkung technisch mit höchster Gewissenhaftigkeit gearbeitet ist und so auch als ein Wunderwerk von eindringendem dauerndem Fleiße für sich einnimmt. Einen großen Teil des folgenden Kalenderjahrs, vom 4. Januar (1896) ab, verbrachte er über der Tondichtung: Also sprach Zarathustra, deren Partitur von 180 sorgsamst ausgearbeiteten Seiten er am 24. August mit einem lebhaften Seufzer der Erleichterung beendet sah. Irgendeine Rücksicht auf die Hörer nahm er hier, einzig seinem inneren Antrieb folgend, so wenig als im Guntram. Als »Tondichtung frei nach Friedrich Nietzsche« bezeichnet Strauß die Partitur, und das Wort »frei« im Titel birgt vielleicht einen kleinen Spott, etwa: wenn ich mich nicht wenigstens durch diese eine Silbe etwas decke, sagt ihr, ich hätte ein Stück Nietzsche einfach in Musik umgesetzt, und täte das nächstens mit Schopenhauer oder Kant. Bei der Seltenheit der Aufführung dieses Werkes sprach wohl die Anforderung mit, in einem Zug eine gute halbe Stunde Musik ohne jeden scherzhaften Programmeinschlag zu hören, dann auch, in jener dienseligen Zeit, der nicht allerorts gern gehörte Name Nietzsche und sein, auf dem Programm manchmal ausgelassener oder durch: »Religion« ersetzter Ausdruck: Hinterweltler. Das sind nämlich Leute, die jenseits, hinter dieser Welt eine bessere als deren eigentlichem Sinn suchen, also ebenso rein anschaulich gedacht, als »Überweltler«; das arme Verhältniswort kann nichts dafür. Aber sicher wird es oft mit »Hinterwäldler«, also anscheinender Bezeichnung der Religiösen als Zurückgebliebener verwechselt. Auch sonst hat das vermeintlich Philosophische an dem Werk viele bis zum heutigen Tag vor ihm bange gemacht, trotzdem es von den Tondichtungen eine der unmittelbar begreiflichsten ist und man fast so wenig ein Programm zu ihm braucht als zur c-moll-Symphonie. »Die große Sehnsucht«, die harten Gegenmotive feindlicher Mächte, »von den Freuden- und Leidenschaften«, Anklänge an den Jenseitsdrang, das Gewichtsbefreiende des Tanzrhythmus – man vergleiche Beethovens Scherzi, das Aufsteigen zu begrifflich unbestimmbaren Höhen des rein Gefühlsmäßigen – das alles ist ja doch der »Inhalt« jedes großangelegten symphonischen Werkes. Manchmal hat man das Gefühl, der Zarathustra sei den Gegnern einfach zu viel und zu ausschließlich Musik gewesen; sie hätten ihn bekämpfen müssen, um überhaupt noch gegen Strauß im Feld zu bleiben. Das war nun dadurch erleichtert, daß die fraglichen Elemente des Programms begrifflich, also für manche zu wenig wirkungmachend schienen. Hätte Strauß ein erzählendes Band der einzelnen Teile bei der Abfassung vorgeschwebt, statt der innerlichen Gefühlsbereiche der Religion, des Wissensdurstes, der Freude usw., etwa das Epos »Bruder Rausch« des Münchener Dichters Wilhelm Hertz, in dem die sich kasteienden und Codices studierenden Mönche zum Bacchanal mit den als fahrende Schüler verkleideten Mägdlein verlockt werden, da hätte man gesehen, »wo und wie«, sich angenehm entrüsten und leichter genießen können. Nietzsches Buch enthält Gefühlsvorgänge einer gewaltigen Natur. Er selbst, der ewig körperlich Gequälte, Gehemmte, Gebundene dichtete sich den Jubelrausch der Freiheit, Beweglichkeit, der rhythmisch ausgelebten, getanzten Gesundheits- und Daseinswonne, der Befreiung von den durch die Überbetonung des Geistigen entstandenen körperlichen Hemmungen. Der nerven- und gemütsüberzartete deutsche Professor, der Philologe, wird gesundheitsmächtiger, reiner, großer, schrankenfreier Mensch; die einzigartige Ausdrucksgewalt dieser Sehnsuchts- und Erfüllungsdichtung reizte den tonsetzerischen Empfindungsdrang eines Strauß. Die Anregung durch die Gedanken- und Willensdichtung Nietzsches übersetzt sich für ihn in die Form der einsätzigen Symphonie mit stark gegensätzlichen Themen, die sich zu melodiös angelegten breiten Satzteilen ausweiten. Das einfache Grundthema, C-dur, in der gleich bedeutend gesteigerten Einleitung, ist ebenso wie die weiteren Geschehnisse reinmusikalischer Art; diesem tritt ein zweites in h-moll, gleichfalls akkordisch entgegen, in dem lange festgehaltenen Gegensatz dieser beiden Tonarten und in ebenso einfacher Form, während das eigentliche Nebenthema im Gegensatz zu beiden chromatisch ist, und in allen Stärkegraden, erst heftig, später gemildert und im kanonischen Wechsel zarter rhythmischer Verkleinerungen erscheint. Die Stelle des langsamen Satzes vertritt neben dem, durch die gottesdienstliche Anführung »credo in unum deum« eingeleitete Religioso ein gesangvolles Mollthema, S. 10 des Auszugs, das vor der letzten Steigerung sehr wirkungsvoll in Dur wiederkehrt. Nach dem Ausklingen dieses Satzes in wie freie Kadenzschritte anmutende, ruhige Gesänge von Klarinette, Baßklarinette und Cello ist der Beginn der Fuge über das Hauptthema, die »die Wissenschaft«, d. h. die versuchte Befriedigung des Wahrheitsdranges in dieser zum Gegenstand hat,
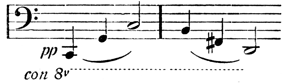
gar nicht, oder höchstens vier Takte lang, bis zum Quinteinsatz der höheren zweiten Stimme, zu verkennen. Auch der das Scherzo vertretende Teil, ein breit und glänzend ausgeführter ausgesprochener Symphoniesatz, wird durch das Hauptthema eingeleitet, das später auch das eigentliche, schon früher anklingende, nun in berauschender rhythmischer und klanglicher Pracht durchgeführte Tanzmotiv als Baß begleitet. Das erste Nebenthema, in h-moll, steigert sich in dem das Finale vertretenden Teil zu einem großartig einsetzenden und fortgeführten Gebilde. In bezug auf das letzte Ausklingen des Werkes wurde oft nachgeschrieben, es schließe im Diskant in H-, im Baß in C-dur, so daß es den jüngsten Konservatoristinnen ordentlich grauste, wenn sie sich das auf dem Klavier zusammengesucht hatten. In Wahrheit handelt es sich um zwei nacheinander folgende Akkorde, die als Unter- und Oberquinte von e-moll nächste Verwandte sind:

Das c des ersten wird nach dem in höchster Höhe erfolgten Verklingen des zweiten im leisesten, tiefsten Pizzikato noch einmal angeschlagen und stellt dadurch äußerlich die Grundtonart des Ganzen, C (-dur) wieder her, gleichzeitig etwa andeutend, daß dieses Baß-C, welches, zu Beginn, an das noch Unentschiedene, Rätselhafte, Unerkennbare gemahnen konnte, trotz des endlichen Geistesflugs in die lichtesten Höhen des H-dur, eben doch fortbesteht. Wie natürlich und einfach sich dies auch aus dem Grundgedanken des Ganzen ergab, der Spruch: »Willst den Dichter du verstehn, mußt in Dichters Lande gehn«, gilt eben auch vom Tondichter. – Die Uraufführung leitete Strauß am 27. November (1896) im Konzert der Frankfurter Museumsgesellschaft, drei Tage später folgte Arthur Nikisch im Berliner Philharmonischen Konzert. Am folgenden Tag schon dirigierte es Strauß selbst wieder im Kölner Gürzenichkonzert. Die vollendetste Darbietung des Werkes war die Schuchs in Dresden.
Nun folgte ein gewisses Nachlassen nach dem großen Ernst. Zwischen dem Zarathustra, der dem zur Anregung dienenden Stoffe nach als die weitausgreifendste seiner Orchesterdichtungen gelten kann, und der noch während dieses Münchener Aufenthalts begonnenen persönlichsten, dem Heldenleben, schiebt sich ein in höherem Maße programmatisches Werk ein, in dem Strauß stellenweise ersichtlich an die Grenzen dessen geht, was der Instrumentalmusik an Eingehen auf stoffliche Beziehungen noch zugemutet werden kann. Am 29. Dezember (1897) vollendete er seinen Don Quixote, Opus 35. Für dieses Werk kommt nun wirklich eine Einzelauslegung in Frage, obgleich es, abgesehn von einigen Besonderheiten, wie den Kampf gegen die Windmühlen und ähnliches, zum großen Teil auch als absolute Musik, nur durch den Titel erläutert, verständlich und wirksam wäre. »Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters« nennt es Strauß. Die Einleitung beginnt gleich mit dem Thema des Helden und schildert mit immer steigender Lebendigkeit in anderen Themen ritterlichen und galanten Charakters das Leben, wie es sich in den Schriften vom Anfang des siebzehnten Jahrhunderts spiegelt. »Don Quixote, mit der Lektüre von Ritterromanen beschäftigt, verliert seinen Verstand – und beschließt, als irrender Ritter in die Welt zu ziehen.« Die Aufstellung der Variationsthemen ist sehr deutlich, indem das ritterliche Motiv »Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt«, stets vom Solovioloncell vorgetragen wird; dann folgt das behäbig plumpe seines Knappen Sancho Pansa, erst von Baßklarinette und Tenortuba, fernerhin stets von der Solobratsche gespielt. Rasch wechselnde Bilder von großem Reiz ziehn vorbei – der Austritt der beiden, mit ihren Themen, der Kampf mit der Windmühle, die blökende Schafherde, die Klangschwelgerei in Don Quixotes Verheißung von dem fantastischen Königreich, in dem Sancho zu hohen Ehren kommen soll, die einsame Wache Don Quixotes in duftiger Sommernacht, ein kurzes, in der Klangwirkung berauschendes Tonstück; die köstliche Tonmalerei der von den ins Wasser gefallenen Helden abrieselnden Tropfen; die für gefährliche Unholde gehaltenen behäbigen Mönchlein, durch zwei Fagotte dargestellt, endlich das ruhig versöhnte Ausklingen, von den ritterlichen Anfangsmotiven leise umspielt. Auch dieses musikpoetisch unendlich feine Werk wird viel zu selten gehört. Wenn es auch mit seinem reichen Inhalt an echten Abenteuern, »Aventiuren«, einen Grenzfall seines Gebiets bedeutet, so gibt es doch, wie jedes von Straußens größeren Werken, vieles, das eben nur dort und nirgends anders zu holen ist. – Die Uraufführung fand unter Wüllner in Köln am 8. März (1898) mit Friedrich Grützmacher als Solocellisten statt. Zehn Tage später dirigierte es Strauß selbst im Frankfurter Museumskonzert mit Hugo Becker, dessen forscher Eigenart es vorzüglich lag und der zu seinem Hausgebrauch eine prickelnde Solokadenz über Don Quixote-Motive daraus schrieb.
Außer den drei Orchesterdichtungen Eulenspiegel, Zarathustra und Don Quixote ist auch die größte, das Heldenleben, noch während dieses vierjährigen Münchener Aufenthalts begonnen. Und noch eine ganze Reihe von Vokalwerken völlig anderer Art und Richtung entstammt jener Zeit, die beweist, welche außerordentliche stilschaffende Macht die Versenkung in ein ihm zusagendes Gedicht über Strauß erlangen konnte. Im Frühjahr 1897 bis zum 7. Mai arbeitete er an den beiden unbegleiteten Gesängen für sechzehnstimmigen gemischten Chor, Werk 34. Sie sind unter anderem auch ein Zeugnis für seine völlige künstlerische Zweckunbewußtheit; er konnte bei den außerordentlichen Anforderungen höchstens auf zwei oder drei deutsche Chorvereine dafür rechnen. Das erste der beiden Stücke, »Der Abend« von Schiller, ist ein Werk von erhabenem Ernst und blühender Form- und Klangdichtung in der Schreibart, die beinahe verrät, daß damals in Straußens Innerstem der alte Brahms noch irgendein verborgenes Plätzchen gehabt haben muß. Es wahrt die dichterische Einheit der Stimmung wie die musikalische von Taktart und Tempo und damit gewisse Grenzen von Notenwerten, da das Gesangsmäßige der Bewegung nicht über Achteltriolen hinauszugehen erlaubt. Das zweite Stück, Hymne von Rückert, ist doppelchörig entworfen. An dem Text: »Jakob, dein verlorner Sohn – Kehrt wieder, o gräme dich nicht!« nimmt der erste, kleine Chor nur so weit Anteil, als er dem wechselnden Inhalt der sechs Strophen des großen die in immer neuen Gefühlswendungen gestalteten Worte zuruft: »O gräme dich nicht, – o hadre du nicht, o sei nicht betrübt.« Die selbständige Führung der Stimmen im gleichzeitigen Weiterspinnen verschiedener Textzeilen mit ihren Sonder-Motiven gibt Gelegenheit zu kontrapunktischer Kunst, die sich zwanglos, sinnvoll und klangschön betätigt. Die Grundtonart F-dur ist ziemlich streng festgehalten. Mit Recht hat man auf die Verwandtschaft mit Lasso und Caldara hingewiesen, deren durch wundersamen Ernst ergreifende Chorlyrik, für Strauß unbewußt, hier in der Tat eine Art von Auferstehung feiert. Als Probe nur einige Stellen aus dem ersten Stück, wie die mit dem echten Straußmotiv im Baß:
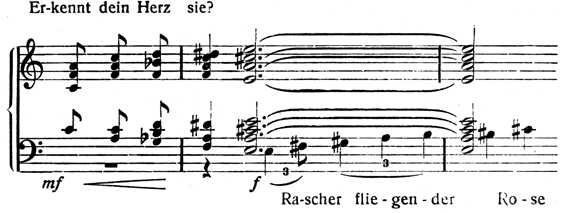
und jene mit den gesättigten, prachtvoll klingenden Akkorden:

Im folgenden Winter, 1897/98, entstanden zu Anfang die Vier Gesänge für eine Singstimme mit Orchester, Werk 33, Stücke von großer Stilhöhe und beispielloser Farbenglut der Begleitung, zugleich größtenteils sehr sangbar. Es sind: Verführung von Mackay für Sopran oder Tenor: »Der Tag, der schwüle, verblaßt«, mit einer glänzenden, von 71 Instrumenten auszuführenden Begleitung. Dann Gesang der Apollopriesterin von Emanuel von Bodmann. Bei dem dritten Stück, dem damals noch Schiller zugeschriebenen Hymnus: »Daß du mein Auge wecktest«, ist bemerkenswert, in welche Gehobenheit die Tonsprache der Dichtung hier gefolgt ist, wie restlos das Ganze den edlen Aufschwung der Geistesartung im Stil nachbildet. Es ist für Bariton oder Mezzosopran geschrieben; die letztere Stimmgattung übertönt aber besser das Orchester und vermag die Gefühlshöhe des Ganzen leichter im Klang festzuhalten. Das letzte Stück, Pilgers Morgenlied von Goethe, ist für Bariton gedacht, und zwar sehr hohen, der das g noch gut im Forte besitzt. »Morgennebel, Lila, hüllen deinen Turm ein.« Dies Abschiedsgedicht an »Lila« malt die Wonnen der ersten Begegnung wie den frohen Trotz des Scheidenden, der, vom Sturm ungebeugt, voll Lebensmut und Lebensfreude die Allgegenwart der Sonne genießt; es wird ebenso wie die drei anderen vom innerlich und äußerlich malenden Orchester getragen, doch ist die Stimmung hier gedanklicher und dadurch weniger zwingend. Das Bachische Heruntersetzen der Tonika nach dem Leitton am Schluß

tritt später bei Strauß öfter auf. Den Sängern fällt es oft schwer.
Bald darauf folgten die Lieder Opus 29,. nach Gedichten Bierbaums, an der Spitze der Traum durch die Dämmerung »Weite Wiesen im Dämmergrau«, eines jener trotz ihres ernsten hohen Werts maßlos beliebten eigentlichen »Straußlieder«. Das keck siegreiche »Schlagende Herzen« gehört zu den treffsicheren Sprechgesängen. In dem innigen »Nachtgang«, einem der klassischen der Moderne, hält Strauß mit zartestem Reiz die Stimmung fest, trotz der am Schluß versagenden dichterischen Form des sonst wertvollen Textes. Von dem folgenden Opus 31 sind die beiden nach Carl Busse am meisten zu rühmen, das ruhig-schön klingende Tenorlied »Blauer Sommer« und das feurig-wirkungssichere Wenn: »Und wärst du mein Weib, Und wärst du mein Kind«, zuerst gedruckt in der Münchener »Jugend« 1896, Heft 4, mit dem einen Halbton höheren Schluß. Das dritte, das Muster eines echt modernen Liedes, »Weißer Jasmin« nach Richard Dehmel, schmückt eine der am wunderbarsten durchgeführten Klavierbegleitungen, die Strauß geschrieben hat.
Das folgende Opus 32 enthält das innige echte Gesangslied nach Henckell: »Ich trage meine Minne«, das Stimmungsmeisterwerk »Sehnsucht«, »Ich ging den Weg entlang, der einsam lag« von Liliencron, das jugendfroh sinnliche »Himmelsboten zu Liebchens Himmelbett« mit der entzückend feinen Begleitung und ihr entsprechend geführten Singstimme. Opus 35 bringt die köstlichen Schlager »Für fünfzehn Pfennige« und »Hat gesagt, bleibt nicht dabei«, diese drei aus des Knaben Wunderhorn. Das letztgenannte hat die Form des Bolero, die in Singstimme und Begleitung mit prickelndem Übermut gehandhabt ist. Opus 37 »meiner geliebten Frau zum 12. April« ist wieder ein besonders glückliches Heft mit Prachtstücken von Begleitung: der glänzenden, im Ausdruck sprühenden zu Liliencrons »Ich liebe dich« (Vier adlige Rosse«), der wie ein Bau aus Edelstein die Singstimme tragenden von Dehmels »Du bist mein Auge«, mit dem wundersüßen, zart-sinnlichen Nachtstück Anton Lindners »Hochzeitlich Land« und von Bodmanns »Herr Lenz zog heute durch die Stadt«, einem köstlichen Schlußlied.
Einen Glanzpunkt in dieser liederreichen Münchener Zeit bedeuten die Fünf Lieder für hohe Stimme, Opus 39. Dieses eingebungsvolle Heft, dessen Erfolg außerordentlich war, enthält Gedichte von Dehmel: Leises Lied: »In einem stillen Garten« mit seinem zarten Maeterlinckschen Helldunkel; Der Arbeitsmann: »Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind, mein Weib!« das in Ludwig Wüllners großstiligem Vortrag von Ende 1901 ab die Runde durch die Konzertsäle machte. Dann »Befreit«, eines seiner herrlichsten Lieder, in dem Strauß, wie er nur selten tut, eine vom Dichter nicht vorgebildete musikalische Form einführt: das ergreifende zweiaktige Motiv, das die zweite Hälfte von jeder der drei Strophen einleitet, erst als Zwischenspiel und in der sofortigen Wiederholung als Begleitung des Gesangs:
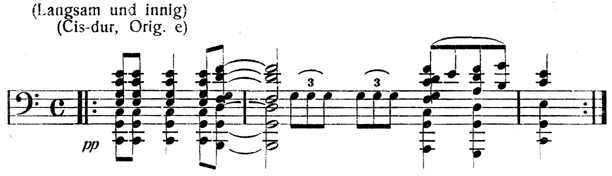
In bezug auf dies Gedicht hat Dehmel im ersten Maiheft der »Musik« 1902 eine »Offenherzige Erklärung« als Antwort auf beständige Anfragen einzelner aus dem »musikliebenden Publikum« veröffentlicht, die es »durch die Vertonung kennen lernten und wissen wollten, was es eigentlich bedeuten« solle. Er habe bei der Niederschrift die Vorstellung gehabt, daß ein Mann mit seiner sterbenden Frau spreche, habe aber nichts dagegen, wenn man sich jede andere Art von Liebesleuten, den weiblichen Teil als sprechend, und in irgendeiner Art von Abschied, dabei denkt. Die Überschrift »Befreit« beziehe sich auf die Stelle: »Wir haben einander befreit vom Leide.« Derlei Gedichte sollen nicht rühren, sondern über die Rührung erheben. Strauß habe es in Musik gesetzt, »die für diesen Text etwas zu weich ist«. Die gefaßte ruhige Feierlichkeit des durchgehenden Motivs spräche gegen diese Auffassung Dehmels von der Vertonung. – Außerdem enthält das Heft das Lied an meinen Sohn: »Der Sturm behorcht mein Vaterhaus« mit der Sturmnacht in der Klavierbegleitung, von deren einer Stelle Strauß auf jener Rundreise mit Ludwig Wüllner 1901 in München hernach selbst äußerte: »Fast hätt' ich's wieder nicht herausgebracht; der Teufel soll das spielen!« Und endlich Bierbaums Jung Hexenlied: »Als Nachts ich überm Gebirge ritt« mit den chromatischen und rhythmischen Knifflichkeiten in Singstimme und Begleitung. – Die Jahre 1894-98 begründeten Straußens außerordentliche Beliebtheit als Lyriker.
Außer alledem verdankt jener letzten Münchener Zeit seine Entstehung noch ein kleines Juwel, das reizvolle Klavier-Melodram Enoch Arden, Werk 38, nach Tennyson. Beachtenswert ist, welch äußerlich lockende Stellen des Textes Strauß hier ohne Musik ließ, und in welcher Weise von den malerischen und den Gefühls-Elementen jene verinnerlicht, diese tiefgehend mitempfunden sind. In den Jahren 1897 und 1898 machte er zur Ausführung dieses Werkes mit seinem Intendanten Ernst von Possart, der den tiefergreifenden Text mit erregender Wirkung vortrug, Reisen durch eine größere Anzahl deutscher Städte.
Während dieser zweiten Münchener Tätigkeit fand Strauß künstlerischen und persönlichen Anschluß an jüngere Schriftsteller, die ihm auch szenische Dichtungen für Musik bieten konnten. Er trat zunächst in Beziehung mit Graf Ferdinand v. Sporck, dann mit Otto Julius Bierbaum und Frank Wedekind. Der hochgesinnte Sporck schrieb ihm ein Opernbuch Eulenspiegel, über das Strauß von einem nur vierzehntägigen verregneten Sommerferienaufenthalt in Marquartstein an Schillings 1896 berichtete: »Freund Sporcks vortreffliches Buch fängt allmählich an, in meinem Kopf und Herzen Widerhall und neue Gedanken zu wecken und ›vielleicht‹ lebensfähig zu werden.« Man kann sich denken, wie sehr Strauß von dem Kern der Eulenspiegelfigur, dem Menschen, der sich mitten unter den ihm fremden Vielzuvielen auslebt, angezogen wurde. Zeitweise hielt er freilich das Opernschaffen überhaupt für aussichtslos, da Wagner alles vorweggenommen, überall seine Riesenhand hingelegt habe. Im gleichen Brief erzählt er: »Denken Sie sich, mein armer Guntram wird vielleicht in Dresden aufgeführt, aus seinem Scheintod zu nochmaligem kurzen Leben erweckt werden.« Bald legte er das Buch Sporcks wieder zur Seite. Wedekind las ihm, etwa 1897, Entwürfe von Ballettpantomimen vor, unter anderen auch den später ausgearbeiteten von dem Floh, der unter den Reifrock einer Dame gerät – doch kam es bei diesen Anregungen über einige Notenentwürfe nicht hinaus. Mit dem bei seiner riesigen Orchesterausdruckstechnik ihm so naheliegenden Gedanken eines ernsten pantomimischen Kunstwerks trug sich Strauß auch sonst öfter und arbeitete einmal selbst eine derartige Szenenfolge aus. Aber er äußerte gelegentlich betreffs der Ausführung solcher Pläne starke Bedenken; die genaue Übereinstimmung von Motiv und Geste könne der Komponist von seiner Seite allein nicht gewährleisten; erst durch Entwerfen und allmähliches Ausproben sei da Einwandfreies zu erreichen. Das aber stand wieder im Gegensatz zur sofortigen Bestimmtheit seiner musikalischen Einfälle. Erst 1913, unter Anregung durch das technisch vorzügliche Russische Ballett, entstand die Pantomime: »Josef-Legende«, während die dem Wesen von Strauß so naheliegende Wirkung der Neubelebung des Gebietes rhythmischer Bewegung durch Dalcroze bisher noch kein Werk von ihm gezeitigt hat.
Mit dem urwüchsigen Bierbaum traten Strauß und seine Gefährten in freundschaftliche Beziehung. Er erhielt von ihm das Lobetanz-Buch, das ihm aber wohl zu spielerisch war, und gab es zuerst an Schillings, dann an Thuille, der es vertonte. Selbst der noch weit marklosere, schon durch die große Zahl der Partien unpraktische Guggeline-Text fand, mit Ausnahme von Strauß selbst, in diesem Kreis Anklang; mit Schmerz sieht man diese wunderfeine Partitur lebensunfähig daliegen. Vergeblich bemühte sich Strauß später in Berlin rastlos um ihre Aufführung und machte endlich den dritten Akt allein in seinem Tonkünstlerkonzert. Thuille hatte eben unter dem ganzen neudeutschen Einfluß das bis zum Kindhaften Genügsame der Dichtung übersehen.
Neben all diesen neuen Beziehungen dauerten die älteren fort, und unzertrennlich vom geistigen Leben Münchens ist der ganze Kampf künstlerischer Meinungsverschiedenheiten, der die späteren Phasen von Straußens Verhältnis zu einigen jener Freunde kennzeichnet. In ihnen tritt die echt deutsche, zum Teil noch echter süddeutsche Denklust zutage, der die Gewohnheit einer allgemeinen Überzeugung selbst über die des täglichen Lebens und des Gemütsbedürfnisses geht. Nur bei zweien von jenen Führern der Zeit seines Werdens blieb Strauß derartiges erspart. Daß Bülow nicht zu diesen gehörte, sahen wir; auch Strauß hatte zuweilen durch die Bitterkeit seines Urteils zu leiden, dessen scharfer Spott sich unversehens auch gegen das Befreundete kehrte. Seine durch die Grausamkeiten des Lebens gesteigerte Reizbarkeit hatte zur Folge, daß das Dasein ihm entgegengesetzt wirkender Gesinnungskreise, wie zum Beispiel der hochkonservativen Berlins, ihm zu leidenschaftlicher Qual ward, eine Art von innerlicher Unfreiheit, die der stets unbedingt sachlich, geradlinig und kerngesund empfindende Strauß nicht recht begriff. Auch die zersetzende Kritik des Meisters an dem einst vergötterten Liszt mußte ihn verletzen. Außer mit dem alten Meyer, den die Italienische Fantasie noch hoch erfreute, blieb das künstlerische Verhältnis dauernd ungetrübt mit Franz Strauß, wohl deshalb, weil es sich im Grunde später umkehrte; der Vater erweiterte durch die Werke des Sohnes, deren Partituren er mit Liebe und Stolz studierte, seine künstlerische Anschauung und lernte von ihm. Zwar rügte er noch, lange gelegentlich allzu ungewohnte Harmonien, vieles Modulieren und gehäufte technische Schwierigkeiten, aber er fühlte den beglückenden Hauch des Neuen, zu ungeahnten Zielen Weisenden. Die technische Verwicklung ging ihm freilich zu weit, und bekannt wurde seine Äußerung in der Hauptprobe zur Feuersnot, die Orchesterbehandlung Richards errege in ihm zuweilen das Gefühl, als ob er »die Hose voll Maikäfer« habe. – Der alte Freund Ritter empfand, wie schon erwähnt, die Dichtung des dritten Guntramaktes wie eine Absage an die Wagnersache und damit als menschliche Entfremdung seines einstigen Lieblings, bei aller Herzlichkeit stand der von Bund und Satzung losgesagte Guntram wie ein Schatten zwischen ihm und Strauß, der dies fühlte, ohne es ändern zu können. Denn Ritter war alt und unbeweglich schroffer als je in seinen Ansichten. Die Liebe zu ihm blieb bei Strauß unverändert; in keinem der vielen Briefe an den väterlichen Freund fehlt in irgendeiner Zusammenstellung das Wort »teuer« in der Anrede. Auch Thuille, der in seiner ersten Stellung als Theorielehrer an der Münchener Musikschule lebenslang verblieb, gehört in die Reihe der führenden Freunde. Die drei Jahre, die er älter war, machten im Knabenalter sehr viel aus; auch zog ihn kein Lateinschulbesuch von der ausschließlichen Pflege der Musik ab. Strauß berichtete ihm, wie eingangs erwähnt, 1877 bis 1879 nach Innsbruck stets über seine tonsetzerische Tätigkeit und nahm Verbesserungen und Ratschläge an; Thuilles Arbeiten, die dieser ihm schickte, zum Teil sogar widmete, studierte er ehrerbietig. Öfter nennt sich Strauß in den Knabenbriefen; an ihn »Dein Dich innig liebender Richard«, und einmal, 1878, schreibt er: »Liebster, bester, schönster, herrlichster Ludwig!« Ja sogar später noch beriet er sich von Berlin aus brieflich mit ihm; als dem »größeren Kontrapunktiker« von beiden, über eine Stelle in der Domestika-Schlußfuge. Aber es kam die Zeit, in der Thuille mit der Entwicklung seines großen Kameraden nicht mehr mitging; er bewunderte zwar die Feuersnot, aber gerade das Heldenleben, das so viele erst rückhaltslos Straußens Banner folgen ließ, stieß ihn merkwürdigerweise ab, und für den großlinigen Freskenstil des Taillefer fand er keinen Blickpunkt. Thuine konnte treue, fast zärtliche Liebe zu einer Person mit der schroffen sachlichen Überzeugung gegen deren Wirken vereinigen – ein echt österreichischer Zug –, er gewöhnte sich allmählich, den Künstler vom Menschen bei Strauß zu trennen, dessen Schaffen doch unmittelbarer Ausdruck seiner Persönlichkeit war. Vielleicht fand auch später manche mit gewohnter Deutlichkeit scharf abmahnende Äußerung Thuilles gegen Kompositionsschüler, die in der äußeren Form da anfangen wollten, wohin sich Strauß schrittweise entwickelt hatte, in gehässiger Weise, als gegen diesen selbst gerichtet, ihren Weg nach Berlin. – Von all jenen mit München eng verbundenen Fachmännern, die Straußens Entwicklung förderten, war im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts mit einer einzigen Ausnahme niemand mehr am Leben. Thuille, Meyer, Franz Strauß, Ritter, Bülow waren dahingegangen, und nur die vornehme Erscheinung seines »Entdeckers« Eugen Spitzweg sah man noch selten in einigen ruhigen Straßen der Stadt, infolge körperlichen Leidens von jedem Verkehr mit der Außenwelt abgeschlossen.
Als Strauß München zum zweitenmal verließ, durfte er trotz aller erduldeten dienstlichen Widerwärtigkeiten mit Genugtuung auf die dortigen Jahre zurückblicken; sie hätten ihn als Tonsetzer vom Eulenspiegel bis zum Entwurf des Heldenlebens geführt und die Grenzen seines vokalen Schaffens in bedeutungsvollster Weise erweitert. Daß die Eigenart keines der Münchener Freunde stark und zugleich musikverwandt genug gewesen war, um neue Betätigung auf dramatischem Gebiet in ihm anzuregen, konnte er nach der Erfahrung mit Guntram nicht bedauern.