
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
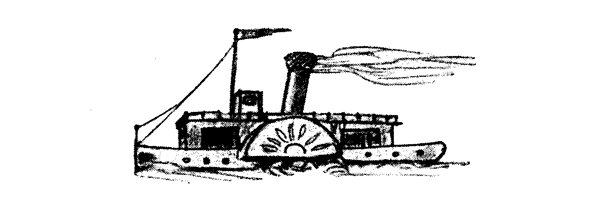
Nach zwei weiteren Reisetagen gelangten sie an die Rabbit Portage. Sie hieß eigentlich »Wa-punse-kah-niimitsch« oder auf deutsch »Platz der Tanzenden Kaninchen«. Der sonderbare Name kam nicht von ungefähr. Vor mehreren Jahren gab es dort unheimlich viel Kaninchen. Diese Tierchen haben die Gewohnheit, mit den Hinterläufen auf den Erdboden zu klopfen, zu »trommeln«. Wenn eine ganze Anzahl sich auf diese Weise im Mondlicht vergnügt, sieht und hört es sich an, als ob die Tierchen tanzten.
In einer kleinen Bucht, in der Nähe der Handelsniederlassung, schlugen sie das Lager auf. Es war ein geschickt gewählter Platz, wo Tschilawii ungefährdet schwimmen und spielen konnte. Nachdem das Zelt stand und ein dicker, federnder Laubteppich den Zeltboden deckte, Feuerholz gesammelt und alles in Ordnung war, ruderte Schapian allein zur Niederlassung hinüber.
Er fand den Händler, der an jenem schicksalhaften Tag in ihrer Hütte gewesen war. Der Mann, noch neu im Lande, konnte nur wenige indianische Worte radebrechen. Schapians Englisch war auch nicht weit her. Der Händler winkte ihn in das kleine Zimmer hinter dem Laden, wo sie ungestört waren, und dort brachten sie es irgendwie fertig, sich gegenseitig verständlich zu machen.
Schapian, der pfeilgerade vor dem Mann stand, erklärte den Fall, so gut er konnte. Er erzählte, wie seit Tschikaniis Weggang alles schief gegangen sei und wie niedergedrückt seine Schwester dahinlebe und wie einsam Tschilawii umherirre und seinen Gefährten suche, und wie grenzenlos unglücklich alle miteinander seien. Der Händler hinter seinem Schreibtisch, er glich mehr einem Richter als einem Kaufmann, lauschte sehr aufmerksam den unbeholfenen Worten. Als Schapian fertig war, sagte der Weiße:
»So, Tschila – – – wer?«
»Tschilawii«, verbesserte Schapian.
»Ach ja«, fuhr der Händler fort und blickte grimmig drein, »so, Tschilalei einsam, wie? Und deine Schwester und du, ihr möchtet Tschik – wie heißt er doch – also Tschinawii wieder haben?«
»Ja«, antwortete Schapian geduldig. »Tschikanii wieder haben.« Der Händler räusperte sich gewaltig und blies durch die Nase, welcher Unsinn! dachte er – so ein Getue um das bißchen Viehzeug. Aber Schapian sprach weiter mit seiner leisen, geduldigen Stimme, wählte die englischen Worte langsam und sorgfältig.
»Ich arbeiten. Ich Holz machen (er meinte Holzfällen) für Winter. Ich arbeiten ganze Sommer für Sie und verkaufen mein Gewehr. Hier, meine Arbeit, hier mein Gewehr – für Tschikanii. Ich gesprochen.« Bei den letzten Worten versagte ihm fast die Stimme, denn sein Gewehr war ihm teuer.

»Ich will dien Gewehr nicht!« schnautze der Händler
»Will dein Gewehr nicht!« fuhr der Kaufmann ihn an. »Hier im Laden hast du's gekauft, und wir, wir kaufen es bestimmt nicht wieder zurück. Das ist kein Leihhaus!« Die scharfen blauen Augen blitzten wirklich sehr wütend. Schapian, der nicht einmal wußte, was ein Leihhaus war, starrte auf seine Mokassin, um die zitternden Lippen zu verbergen. Doch gleich darauf hob er stolz den Kopf und erklärte leise, aber bestimmt:
»Gut. Dann ich arbeiten auch ganze Winter, eine ganze Jahr für Sie. Eine Jahr für Tschikanii!«
Himmel, welch abgründiger Unsinn! dachte der Weiße, War der Junge verrückt? Der gute Mann wußte nichts vom Indianer und seiner Art. Plötzlich fragte er:
»Hast du das Feuer gesehen?«
»Ja«, antwortete Schapian, »ich, Sajo und Tschilawii durch Feuer gekommen. Eine Portage ganz verbrannt. Fast tot gemacht uns.«
»Schwindel« wollte der Händler gerade sagen, überlegte sich's aber noch einmal und räusperte sich. Denn selbst er sah, wie ernst es der junge Indianer meinte. Und dann wurde der Kaufmann richtig traurig, denn er konnte nicht helfen. Tschikanii war nämlich an irgendwelche Stadtleute verkauft worden, die einen Rummelplatz und eine Tierschau unterhielten. Außerdem war ein lebender Biber ein seltenes, wertvolles Tier. Er erklärte dies in seiner groben Art (»herrenmäßig« nannte er's, weil er eben ein Neuling war und dies für den richtigen Umgangston für Indianer hielt). Im Grunde war dieses Rauhbein gar nicht das Ungeheuer, als das er sich aufspielte. Nachdem er mit seiner Erklärung fertig war, fühlte er sich gar nicht wohl in seiner Haut.
»Schau, Junge. Ich kann dir wirklich nicht helfen. Tschikanii ist vor einem Monat verkauft worden, in die Stadt, für fünfzig Dollar.«
Fünfzig Dollar! Schapian erblaßte. Fünfzig Dollar! Ihn schwindelte, so viel Geld hatte er noch nie gesehen. Die Händler geben selten Bargeld für die abgelieferten Pelze, sondern nur Waren, denn die Indianer müssen das Geld doch wieder im Laden lassen; wozu soll man sich damit befassen! Fünfzig Dollar – und seine Arbeitskraft, sein Gewehr abgelehnt! Er hatte nichts mehr zu bieten.
Es war nicht Schapians Art, gleich nachzugeben. Er fuhr zum Lager zurück und berichtete, er wisse, wo Tschikanii sei. Sajo war glücklich und zufrieden, denn Schapian hatte weder von der Hartherzigkeit des Händlers, noch von den fünfzig Dollar erzählt. Warum auch, diese Summe würden sie doch nie und nimmer zusammenbringen. Sajo dachte nun, es sei nichts weiter zu tun, als ein wenig zu warten, ein bißchen Holz zu schlagen, bis sie das Geld für die Reise in die Stadt beieinander hatten (so furchtbar viel konnte das nicht sein!). Und dann mußte man noch etwas dazuverdienen, um Tschikanii loszukaufen. In einem gewissen Sinn hatte das Kind recht, es war wirklich nicht viel zu tun, glücklicherweise wußte sie nicht, wie hoffnungslos alles war.
Schapian trug die ganze Last allein und zermarterte sich den Verstand, um einen Weg zu finden, wie er fünfzig Dollar verdienen könnte. Nach den Eisenbahnkarten hatte er sich gar nicht erkundigt, er wagte es einfach nicht. Im stillen fragte er sich zuweilen, was wohl der Vater zu allem sagen würde. Ruhelos wälzte er sich auf dem Lager und dachte und überlegte. Wenn er nur erst in der Stadt wäre, dann wollte er schon weiter sehen. Es mußte doch auch gute Weiße geben, so hatte er gehört, und nicht alle waren so hart wie der Kaufmann. Schapian würde schon erzählen, wie unglücklich alle drei waren. Vielleicht ließen sie Tschikanii mit Sajo und Tschilawii heimkehren, und er, er würde in der Stadt bleiben, bis Tschikaniis Freiheit abgearbeitet war. Alles zusammen würde vielleicht hundert Dollar kosten. Armer Schapian, hundert Dollar war die höchste Summe, die er sich vorstellen konnte. Er hatte einmal gehört, wie seine Leute einen andern Indianer, der bare hundert Dollar verdient hatte, als »reichen Mann« bezeichnet. Dieser war als Führer und Pfadfinder mit einer amerikanischen Jagdgesellschaft gezogen. Mit den Gitschie Mokoman, den Großen Messern Amerikaner, war leicht zu arbeiten. Sie behandelten den indianischen Führer als Gefährten und nicht als Diener, zahlten hohe Löhne, und wenn die Reise zu Ende war, schenkten sie dem roten Mann, der sie geführt hatte, manchmal Zelte, Decken und Gewehre, ja sogar die ganze Lagerausrüstung. So erzählte man im Indianerdorf daheim. Schapian fuhr auf. Ja, das war ein Gedanke!
Jeden zweiten oder dritten Tag keuchte ein großer, plumper Flußdampfer stromaufwärts und legte bei Rabbit Portage an, ein Fahrzeug, das noch mit Holz geheizt wurde, zwei Decks und große Schaufelräder an den Seiten besaß. Dieser seltsame Kasten fuhr zwischen Rabbit Portage und der Eisenbahnstation hin und her. wie sollte er aber an Bord kommen ohne Geld? Immer Geld, immer das Geld, dachte Schapian und rätselte an der Frage herum, wie viel der Kapitän wohl verlangen würde. Sicher mehr als Schapian besaß, denn er hatte überhaupt nichts. Das große Kanu brachte ab und zu Große Messer mit. Es wäre doch immerhin möglich, daß der eine oder andere einen Führer brauchte. Das wäre eine Arbeit, die er gut verrichten könnte Die landschaftliche Schönheit, sowie die Jagd- und Fischgründe Nord-Kanadas haben, soweit sie zugänglich sind, immer zahlreiche Sportsleute aus den Vereinigten Staaten angezogen. Diese nehmen sich gerne indianische Führer, und manche Indianerdörfer leben von diesem Beruf..
Der neue Plan erfüllte Schapian so sehr, daß er am nächsten Morgen hastig das Frühstück hinunterschlang und dem Handelsposten zustrebte. Er traf aber niemand außer dem Händler. Kurz vor zwölf Uhr – es war die Ankunftszeit des Dampfers – liefen einige Menschen zusammen, und gleich darauf schnaufte das schwerfällige Fahrzeug flußaufwärts, steuerte mit viel Gezisch und Geplätscher in einem großen Halbkreis in den »Hafen«. Befehle wurden gebrüllt, die Schiffsglocke bimmelte grell und eilig, es war ein Pomp, wie man ihn von dem einzigen Dampfboot weit und breit mit Recht erwarten durfte. Tatsächlich, ein ganzes Schock Touristen ging mit großem Lagergepäck an Land. Jeder schleppte so viel Gepäck, daß es nach Schapians Ansicht für vierzig Menschen gereicht hätte. Neugierige Blicke fielen auf den Indianerjungen in seinem Anzug und mit dem pechschwarzen, in Zöpfen geflochtenen, straffen Haar. Für manche war er der erste, echte Indianer. Bemerkungen wurden ausgetauscht, einer zückte sogar eine schwarze Schachtel, und dann knackste etwas.
Schapian schämte sich und wurde ganz verlegen vor all den lärmenden, seltsam gekleideten Menschen mit den roten oder blassen Gesichtern. Er kam sich klein und verlassen vor und wußte plötzlich, daß er nie und nimmer den Mut aufbringen würde, sich einem von ihnen als Führer und Pfadfinder anzubieten. Langsam wandte er sich um und wollte, so schnell er es mit seiner Würde vereinbaren konnte, verschwinden. Da hörte er eine Stimme indianische Worte rufen: »Warte, mein Sohn, warte! Ich möchte dich was fragen.«
Schapian, der unter den Ankommenden kein Indianergesicht entdeckt hatte, blieb stehen und sah einen Mann auf sich zukommen, keinen Indianer, sondern ein großes, kräftiges Blaßgesicht mit hellen, gelben Haaren und blauen Augen – guten Augen, nicht so hart wie die des Händlers. Sein am Hals offenes Hemd war blütenweiß, die aufgekrempelten Hemdärmel ließen ein paar kräftige braune Arme sehen. Und er trug Mokassin!! Zwar trat der Mann, was selbst der erregte Schapian bemerkte, etwas behutsam Die Bezeichnung »Zartfuß« entstand, weil die Neulinge erst lernen mußten, in den leichten, schmiegsamen Mokassin durch die Wildnis zu wandern. auf, als sei er diese Fußbekleidung noch nicht recht gewohnt. Der Fremde kam näher und legte eine Hand auf Schapians Schulter, der plötzlich nicht mehr scheu und schüchtern war und der übrigen Reisegesellschaft nicht länger achtete. Er sah nur das lachende, braungebrannte Gesicht des Mannes, der die Odschibwäsprache so gut und fließend beherrschte.
»Hab keine Angst«, sagte der Mann – Schapian hatte ihm schon den Namen »Gelbes Haar« gegeben.
»Das sind alles gute Menschen, Gitschie Mokoman, Amerikaner. Sie wollten dich nur photographieren.«
Trotzdem schob er Schapian leicht, aber unwiderstehlich vor sich her. »Laß uns in dein Lager gehen und schwatzen. Ich möchte von eurem Abenteuer im Wald hören, und außerdem möchte ich schon lange Gitschie Megwons Kinder kennenlernen. Euren Vater kenne ich gut!«
Schapian fühlte sofort, daß er einen Freund gefunden hatte, einen Menschen, dem er vertrauen konnte. Er führte den neuen Freund auf dem Landweg zum Lager, nicht im Kanu, weil er mal gehört hatte, die ungeschickten Weißen würden ein so kleines Boot immer umwerfen. Später erfuhr er allerdings, daß dieser braungebrannte, junge Mann sehr gut mit Kanu und Paddel umgehen konnte.
Sajo, die inzwischen das Essen gekocht hatte, versteckte sich im Zelt, als sie den Bruder mit einem fremden Menschen kommen sah. Sie hatte außer dem Händler, den sie verabscheute, noch keinen Weißen gesehen. Als sie jedoch den Besucher Odschibwäworte sprechen hörte und sein fröhliches Lachen vernahm, blinzelte sie durch einen Spalt und sah in ein offenes, ehrliches Gesicht, in die besten Augen, die sie, außer Vaters Augen, je erblickt hatte. Sie wurde ertappt und trat aus dem Zelt, setzte sich neben das Feuer und wirtschaftete ungeheuer wichtig mit Pfanne und Teller, weil sie aber gerne in das fröhliche Gesicht blicken wollte, zog sie das Kopftuch tief über die Augen und blinzelte darunter hervor. Und jedesmal erwischte sie Gelbes Haar, so daß Sajo errötete und den Kopf so tief senkte, daß das Tuch ihr ganzes Gesicht beschattete. Sie aßen zusammen. Schapians Hochachtung wuchs immer mehr, als er sah, wie leicht der Weiße auf Indianerart niederkauerte.
Gelbes Haar lobte Sajos Kochkünste und meinte, so gut habe es ihm schon lange nicht mehr geschmeckt. Das war sicher stark übertrieben, denn es gab nur Indianerbrot mit Schweineschmalz statt Butter, ein paar Streifen Dörrfleisch und Tee ohne Zucker.
Nach dem Mahl zündete der Gast eine Zigarette an und rauchte ein Weilchen still vor sich hin. Sajo brachte den Mund nicht mehr zusammen, so seltsam fand sie diese Raucherei. Alle Indianer und ziemlich viele alte Frauen rauchten nur Pfeife. Eine Zigarette war für Sajo etwas völlig Neues. Sie sagte sich aber, das sei eben eine andere merkwürdige Gewohnheit dieses merkwürdigen Mannes, der ihre Sprache so fließend beherrschte und etwas Seltsames an sich hatte. Seltsam, ja, aber nicht unangenehm, ganz und gar nicht unangenehm, flüsterte sie dem Bruder zu.
Gelbes Haar rauchte indessen und erzählte, daß er Missionar sei – bitte, keiner von denen, die sich in alles einmischen und den Indianer samt seinen Sitten und Gebräuchen umkrempeln wollen, fügte er hastig hinzu. Nein, mancher Indianerglaube sei schön und ganz richtig, manches sei allerdings auch weniger schön. Nein, er sei keiner von denen, die sich aufdrängen. Er fühle sich als Bruder des roten Mannes. Ja, und die Indianersprache habe er aus Büchern gelernt und dann sei er mit den Wald-Kriis von einem Lager zum andern gewandert. Er habe auch bei den Soto, den Algonkins und den Odschibwäs Diese Stämme haben dieselbe Sprache gelebt, habe ihre Kinder unterrichtet, Kranke gepflegt und versucht, Gutes zu tun. Weshalb? Oh, weil der Große Geist alle liebe, den roten wie den weißen Mann, und weil er dem Großen Geist dienen wolle. Gute Menschen in der Stadt hätten ihm Geld gegeben, so daß er nie den Indianern zur Last gefallen sei. So, das sei seine Geschichte.
Die beiden jungen Menschen lauschten mit aufgerissenen Augen. So war das? Also haben die andern Menschen den Indianer nicht vergessen! Auch sie hatten immer geglaubt, daß nun, nachdem man ihnen ihr Land genommen hatte, sich keiner mehr um ihr Schicksal kümmere. Diesem Mann da mußten sie glauben; er war bestimmt ihr Bruder, auch wenn seine Haut dort, wo die Sonne nicht hinkam, weiß schimmerte und die Augen nicht schwarz, sondern blau waren wie der Himmel am Mittag.
Auf einmal kam Tschilawii, der sich nach seinem letzten Bad ins Zelt verzogen und dort gesäubert und getrocknet hatte, herausgepurzelt, um nachzusehen, wer da so viel schwatzte. Hunger hatte er auch. Als er den Fremden gewahrte, beschloß er auf der Stelle, den Neuen zu untersuchen. Sein Weg, er wählte immer den kürzesten, führte über das Tischtuch, ein weißes, sauberes Stück Zeltleinen. Unbeirrt und sehr zielbewußt steuerte er mitten durchs Geschirr, trampelte in die Teller, bis er vor dem Besucher stand, und dann setzte er sich auf und betrachtete den Mann. Vielleicht dachte er in seinem kleinen Dickkopf, ein so großer Mensch müsse, sofern man ihn richtig behandele, auch ein großes Stück Indianerbrot haben. Was Tschilawii erblickte, schien ihn herzlich zu freuen, denn er wackelte zuerst mit dem Kopf, dann mit dem ganzen Körper, wie in glücklicheren Zeiten, und ließ sich plötzlich auf den Rücken fallen, mitten zwischen Teller und Schüsseln, und zappelte mit jedem Härchen. Es erhob sich ein herrliches Geklirr und Getöse, ein großes Umschmeißen und Verschütten, bis Sajo, nach dem ersten Schreck, hastig ein großes Stück Brot ergriff und in die kleinen Pfoten drückte. Damit glaubte sie Tschilawii los zu sein. Aber diesmal ließ er sich nicht so leicht bestechen, sondern blieb ruhig mitten in den Ruinen sitzen, nahm das Brot in seine Hände und biß herzhaft herunter, ohne den Fremden aus den pfiffigen Äuglein zu lassen.
Zum erstenmal seit Tschikaniis Weggang hatte er seinen komischen Tanz zum besten gegeben. Für Sajo war das ein gutes Zeichen. Gelbes Haar, der zuerst höchlich verblüfft dreinsah, mußte so furchtbar lachen, daß Sajo ihre Schüchternheit ganz vergaß und hell einstimmte. Es sah wirklich zu lustig aus, so daß selbst Schapian, trotz seines schweren Herzens, ein wenig mitlachte.
Gelbes Haar ließ sich erzählen, wie sie zu dem Biber gekommen waren. Einiges wußte er zwar schon vom Händler. Schapian und Sajo wollten zuerst nicht recht mit der Sprache heraus, aber der Weiße fragte so geschickt, daß er zuletzt doch noch alles erfuhr, alle Sorgen, Hoffnungen und Wünsche und das Erlebnis im Höllenmaul des Feuers.
»Ja, und jetzt muß ich Arbeit finden und Geld verdienen, damit wir in die Stadt fahren und Tschikanii heimholen können«, endete Schapian.
Gelbes Haar wußte nun alles. Still und nachdenklich saß er bei den Lindern. Das Lachen war aus seinen Zügen verschwunden, er wußte: für Schapian gab es keine Arbeit in der Stadt. Doch dieses Wissen behielt er für sich. Seine Hand fuhr leicht über das weiche, seidige Fellchen des Bibers, unwillkürlich sprach der Mann seine Gedanken aus, auf englisch:
»So, das ist Groß-Klein, und Ganz-Klein lebt fern in der Stadt und ist einsam. Und diese Kinder – – nein, nein, das darf nicht sein.«
Sein Blick schweifte zu Sajo hinüber, denn er hatte bemerkt, daß sie das nach hinten gerutschte Kopftuch wieder über die Augen gezogen hatte. Unter dem bergenden Tuch stahlen sich zwei große, schwere Tränen hervor und rollten über die Wangen.
Gelbes Haar stand auf und machte sich zum Gehen fertig. Ehe er die neuen Freunde verließ, sprach er ihnen Mut zu:
»Sehet, ich bin euer Freund und eures Vaters Freund. Morgen komme ich zurück, und dann wollen wir wieder zusammen essen. Vielleicht kann ich die Wolke verscheuchen, die so dunkel und schwer über eurem Pfad liegt. Ich weiß noch nicht, wie; aber ich will nichts unversucht lassen. Es ist meine Aufgabe, den Nebel vom Antlitz der Sonne zerstreuen zu helfen, damit sie uns allen scheinen möge.«
Und dann ging er.
