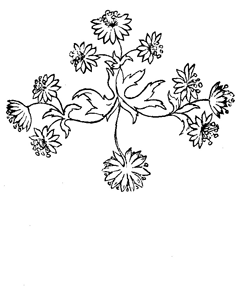|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hans Christian Andersen.
Bildquelle: Projekt Gutenberg-DE

(1869.)
 Es gehört Muth dazu, Talent zu besitzen. Man muss wagen, sich seiner Inspiration anzuvertrauen, man muss überzeugt sein, dass der Einfall, welcher Einem durch das Hirn schiesst, gesund ist, dass die Form, welche Einem als natürlich ansteht, selbst wenn sie neu ist, ein Recht hat, sich geltend zu machen, man muss die Kühnheit gewonnen haben, sich der Beschuldigung auszusetzen, dass man affektirt oder auf Irrwegen sei, ehe man sich seinem Instinkt überlassen und demselben folgen kann, wohin er uns gebieterisch lenkt. Als Armand Carrel seiner Zeit als junger Journalist von seinem Redakteur getadelt ward, der, auf eine Stelle seines Artikels deutend, bemerkte: »So schreibt man nicht«, erwiderte er: »Ich schreibe nicht, wie man schreibt, sondern wie ich schreibe«, und dies ist die allgemeine Formel der Begabung. Sie vertheidigt weder flüchtiges Gesudel, noch willkürliche Erfinderei, aber sie spricht mit Selbstbewusstsein das Recht des Talentes aus, wenn keine
herkömmliche Form und kein vorhandener Stoff den eigentümlichen Bedürfnissen seiner Natur genügen, sich neue Stoffe zu wählen, neue Formen zu bilden, bis es eine Baustätte von solcher Beschaffenheit findet, dass es, ohne Ueberanstrengung einer einzigen seiner Kräfte, sie alle verwenden und sie leicht und frei entfalten kann. Eine solche Baustätte hat der Dichter
Hans Christian Andersen im Märchen gefunden.
Es gehört Muth dazu, Talent zu besitzen. Man muss wagen, sich seiner Inspiration anzuvertrauen, man muss überzeugt sein, dass der Einfall, welcher Einem durch das Hirn schiesst, gesund ist, dass die Form, welche Einem als natürlich ansteht, selbst wenn sie neu ist, ein Recht hat, sich geltend zu machen, man muss die Kühnheit gewonnen haben, sich der Beschuldigung auszusetzen, dass man affektirt oder auf Irrwegen sei, ehe man sich seinem Instinkt überlassen und demselben folgen kann, wohin er uns gebieterisch lenkt. Als Armand Carrel seiner Zeit als junger Journalist von seinem Redakteur getadelt ward, der, auf eine Stelle seines Artikels deutend, bemerkte: »So schreibt man nicht«, erwiderte er: »Ich schreibe nicht, wie man schreibt, sondern wie ich schreibe«, und dies ist die allgemeine Formel der Begabung. Sie vertheidigt weder flüchtiges Gesudel, noch willkürliche Erfinderei, aber sie spricht mit Selbstbewusstsein das Recht des Talentes aus, wenn keine
herkömmliche Form und kein vorhandener Stoff den eigentümlichen Bedürfnissen seiner Natur genügen, sich neue Stoffe zu wählen, neue Formen zu bilden, bis es eine Baustätte von solcher Beschaffenheit findet, dass es, ohne Ueberanstrengung einer einzigen seiner Kräfte, sie alle verwenden und sie leicht und frei entfalten kann. Eine solche Baustätte hat der Dichter
Hans Christian Andersen im Märchen gefunden.
Man trifft in seinen Märchen Anfänge wie diesen: »Man hätte glauben sollen, dass in dem Ententeiche etwas Wichtiges vorgehe, aber es ging Nichts vor! Alle Enten, die ruhig auf dem Wasser lagen – einige standen auf dem Kopfe, denn das konnten sie, – schossen plötzlich ans Land; man konnte in dem nassen Lehm die Spuren ihrer Füsse sehen, und man konnte eine ganze Strecke weit ihr Geschnatter hören«, oder wie folgenden: »Seht! nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr, als jetzt, denn es war ein böser Kobold! Es war einer der allerschlimmsten, es war der Teufel!« Die Konstruktion, die Wortstellung in den einzelnen Sätzen, die ganze Anordnung streitet wider die einfachsten Regeln der Syntax. »So schreibt man nicht.« Das ist wahr; aber so spricht man. Zu erwachsenen Menschen? Nein, aber zu Kindern; und weshalb sollte man nicht befugt sein, die Worte in derselben Ordnung nieder zu schreiben, in welcher man sie zu Kindern spricht? Man vertauscht hier die gewöhnliche Norm mit einer andern; nicht die Regeln der abstrakten Schriftsprache, sondern das Fassungsvermögen des Kindes sind hier das Bestimmende; es ist Methode in dieser Unordnung, wie Methode in den Sprachschnitzern des Kindes ist, wenn es sagt: »Du lügtest«, anstatt »Du logst.« Die angenommene Schriftsprache durch die freie Umgangssprache zu ersetzen, die steifere Ausdrucksweise des Erwachsenen mit derjenigen zu vertauschen, welche das Kind gebraucht und versteht, wird das Ziel des Dichters, sobald er den Entschluss fasst, »Märchen für Kinder« zu erzählen. Er hat die kühne Absicht, sich in einem Druckwerke der mündlichen Rede zu bedienen, er will nicht schreiben, sondern sprechen, und er will gern wie ein Schulkind schreiben, wenn er dadurch nur vermeidet, wie ein Buch zu reden. Das geschriebene Wort ist arm und verlassen, das mündliche hat ein Heer von Verbündeten in dem Zuge des Mundes, welcher den Gegenstand, von dem die Rede ist, nachahmt, in der Handbewegung, welche ihn malt, in der Länge oder Kürze des Tones, seinem scharfen oder milden, ernsten oder drolligen Charakter, im ganzen Mienenspiel und in der ganzen Haltung. Je ursprünglicher das Wesen ist, zu welchem man spricht, desto mehr versteht es durch diese Hilfsmittel. Wer einem Kinde eine Geschichte erzählt, der erzählt unwillkürlich mit vielen Gesten und Gebärden; denn das Kind sieht die Geschichte eben so viel, wie es sie hört, es achtet, fast wie der Hund, mehr auf die zärtliche oder erbitterte Betonung, als darauf, ob die Worte Freundlichkeit oder Zorn ausdrücken. Wer sich schriftlich an das Kind wendet, muss also den wechselnden Tonfall, die plötzlichen Pausen, die beschreibenden Gesten, die Furcht einjagende Miene, das die glückliche Wendung verrathende Lächeln, den Scherz, die Liebkosungen und den Appell, welcher die einschlummernde Aufmerksamkeit weckt, – alles dies muss er in seinen Vortrag zu verweben suchen, und da er nicht die Begebenheit geradezu, dem Kinde vorsingen, malen oder tanzen kann, so muss er das Lied, das Bild und die mimische Bewegung in seine Prosa bannen, dass sie wie gebundene Kräfte darin liegen, und sich erheben, sobald das Buch aufgeschlagen wird. Zum ersten: keine Umschreibungen; Alles wird frisch von der Leber weg gesagt, ja, mehr als gesagt, gebrummt, gesummt und geblasen: »Es kam ein Soldat auf der Landstrasse heran marschirt, eins zwei, eins zwei.« »Und die ausgeschnitzten Trompeter bliesen: Tratteratra! der kleine Junge ist da, tratteratra!« »Hör, sagte der Schneckenvater, wie es auf den Klettenblättern trommelt: rundumdum, rundumdum!« Hier wird, wie in dem »Gänseblümchen«, mit einem »Nun hör einmal!« begonnen, das sofort die Aufmerksamkeit in Beschlag nimmt. Hier wird in der Weise des Kindes gescherzt: »Dann hieb der Soldat der Hexe den Kopf ab. Da lag sie!« Man hört das Lachen des Kindes, das auf diese kurze, nicht sehr gefühlvolle, aber anschauliche Darstellung des Abmuckens folgt. Hier werden so weiche Töne angeschlagen, wie z. B.: »Die Sonne schien auf den Flachs und die Regenwolken begossen ihn; und das war eben so gut für ihn, wie es für kleine Kinder ist, gewaschen zu werden und darauf einen Kuss von ihrer Mutter zu bekommen; sie werden ja viel schöner davon.« Dass an dieser Stelle eine Pause in der Erzählung gemacht wird, um dem Kinde den im Texte gemeldeten Kuss zu geben, ist Etwas, das jede Mutter einräumen wird, und das sich von selbst versteht; der Kuss liegt ja im Buche. Die Rücksicht auf den jungen Leser kann endlich noch weiter getrieben werden, indem der Dichter kraft seiner geschmeidigen Sympathie sich ganz mit dem Kinde identificirt und sich so vollständig in dessen Vorstellungskreis, in dessen Anschauungsweise, ja in dessen rein körperlichen Gesichtspunkt hinein lebt, dass ihm ein Satz wie dieser unter die Feder kommt: »Das grösste grüne Blatt hier zu Lande ist doch jedenfalls das Klettenblatt; hält man eins vor seinen kleinen Leib, so ist es wie ein Schürzchen, und legt man es auf seinen Kopf, so ist es bei Regenwetter fast so gut wie ein Schirm, denn es ist so ausserordentlich gross.« Das sind Worte, die ein Kind, und jedes Kind, verstehen kann. Wie glücklich ist doch ein Dichter wie Andersen! Welcher Schriftsteller hat ein Publikum wie er! Was bedeutet dagegen ein Mann der Wissenschaft, der zumal in einem kleinen Lande für ein Publikum schreibt, das ihn weder liest noch schätzt, und der von vier oder fünf – Rivalen und Gegnern gelesen wird! Ein Dichter ist im Allgemeinen günstiger gestellt, aber wiewohl es ein Glück ist, von Männern gelesen zu werden, und wiewohl es ein beneidenswerthes Loos ist, zu wissen, dass unsre Schriften von zarten Fingern durchblättert werden, die seidene Fäden als Lesezeichen verwenden, so hat doch Keiner sich annähernd eines so frischen und so aufgeweckten Leserkreises zu rühmen, wie Andersen dessen gewiss ist. Seine Märchen gehören zu den Büchern, die wir silbenweise entziffert haben, und die wir heute noch lesen. Es sind einzelne darunter, in welchen die Buchstaben uns immer noch grösser, die Worte gewichtvoller erscheinen, als in den anderen, weil wir sie zum ersten Mal Buchstaben für Buchstaben und Wort für Wort kennen lernten. Und welche Freude muss es für Andersen gewesen sein, in seinen Träumen dies Gewimmel von Kindergesichtern zu Tausenden um seine Lampe zu sehen, diese Menge blühender, rosenwangiger kleiner Krausköpfe, wie im Gewölk eines katholischen Altarbildes, flachshaarige dänische Knaben, zarte englische Babies, schwarzäugige Hindumädchen, – sie vor sich zu sehen, reich und arm, buchstabirend, lesend, aufhorchend, in allen Ländern, in allen Zungen, bald gesund und froh, müde vom Spiele, bald schwächlich, blass, mit durchsichtiger Haut nach einer der unzähligen Krankheiten, von denen die Kinder der Erde heimgesucht werden, und sie begierig diesen Wirrwarr weisser und dunkelbrauner Händchen nach jedem neuen, fertig gewordenen Blatte ausstrecken zu sehen! Ein so gläubiges, so tief aufmerksames, so unermüdliches Publikum hat kein Anderer. Kein Anderer hat auch ein so ehrwürdiges; denn selbst das Alter ist nicht so ehrwürdig und heilig wie die Kindheit. Hier bietet sich uns eine ganze Reihe friedlicher und idyllischer Scenen: da wird laut vorgelesen, und die Kinder lauschen mit Andacht, oder der Kleine sitzt vertieft in seine Lektüre, beide Ellenbogen auf den Tisch gestüzt, und die Mutter liest im Vorübergehen mit über die Schulter des Kindes. Lohnt sich's nicht der Mühe, für einen Hörerkreis wie diesen zu schreiben, und gibt es wohl einen, der eine unbeflecktere und willfährigere Phantasie hätte?
Es gibt keinen, und man braucht nur die Einbildungskraft der Hörer zu studiren, um die des Schriftstellers kennen zu lernen. Der Ausgangspunkt für seine Kunst ist das Spiel des Kindes, das Alles zu Allem macht; deshalb macht die spielende Laune des Künstlers Spielsachen zu natürlichen Geschöpfen, zu übernatürlichen Wesen (Kobolden), zu Helden, und benutzt umgekehrt die ganze Natur und alles Uebernatürliche, Helden, Kobolde und Feen, als Spielzeug, d. h. als künstlerische Mittel, welche bei jedem neuen künstlerischen Zusammenhange umgeprägt und neu gestempelt werden. Der Nerv dieser Kunst ist die Einbildungskraft des Kindes, welche Alles beseelt und zu einem persönlichen Wesen macht; dadurch belebt sie ein Stück Hausrath so gut wie eine Pflanze, eine Blume so gut wie einen Vogel oder eine Katze, und das Thier in derselben Weise wie die Puppe, wie das Portrait, wie die Wolken, die Sonnenstrahlen, die Winde und die Jahreszeiten. Selbst der Hüpfauf aus dem Brustknochen einer Gans wird solchergestalt für das Kind ein lebendes Ganzes, ein denkendes, willensbegabtes Wesen. Das Vorbild einer solchen Poesie ist der Traum des Kindes, in welchem die kindlichen Vorstellungen noch rascher und mit noch kühneren Verwandlungen wechseln, als beim Spiele; deshalb nimmt der Dichter (wie in »Die Blumen der kleinen Ida«, »Ole Lukoie«, »Der kleine Tuck«, »Fliedermütterchen«) gern seine Zuflucht zum Traume als zu seinem Arsenale; deshalb kommen ihm oft, wenn er den Kindestraum sich in den Vorstellungen ergehen lässt, welche das Kindesgemüth erfüllen und ängstigen, seine herrlichsten Inspirationen, z. B. wenn der kleine Hjalmar im Traume hört, wie die schiefen Buchstaben, die auf der Nase liegen, in seinem Schreibbuche jammern. »Seht, so sollet ihr euch halten!« sagte die Vorschrift, »seht, so schräg geneigt, mit einem kräftigen Schwunge!« » Ach, wir möchten gern,« sagten Hjalmar's Buchstaben, »aber wir können's nicht, wir sind so schwach!« »Dann müsst ihr Kinderpulver einnehmen!« sagte Ole Lukoie. »O nein!« riefen sie und da standen sie so schlank, dass es eine Lust war.« So träumt ein Kind, und so malt ein Dichter uns den Traum des Kindes. Aber die Seele dieser Poesie ist doch weder der Traum noch das Spiel, es ist ein eigenes, wieder kindliches, aber zugleich mehr als kindliches Vermögen, nicht blos das Eine für das Andere zu setzen, also Alles zu vertauschen, oder das Eine im Andern leben zu lassen, also Alles zu beleben, sondern, durch das Eine schnell und flüchtig an das Andere erinnert, das Eine im Andern wiederfindend, es zu verallgemeinern, das Bild zum Sinnbilde zu gestalten, den Traum zur Mythe zu erheben, und durch eine künstlerische Verschiebung den einzelnen märchenhaften Zug in den Brennpunkt für das ganze Leben zu verwandeln. Eine solche Phantasie dringt nicht tief in das innerste Wesen der Dinge ein, sie beschäftigt sich mit Kleinigkeiten; sie sieht die groben Fehler, nicht die grossen, sie trifft, aber nicht tief, sie verletzt, aber nicht gefährlich, sie flattert wie ein beschwingter Falter von einem Orte zum andern, an den ungleichartigsten Punkten verweilend, und sie spinnt wie ein kluges Insekt ihr feines Gewebe von vielen verschiedenen Ausgangspunkten her zu einem Ganzen zusammen. Nichts ist ihr zu hoch, nichts zu gering. Was sie erzeugt, ist kein Seelengemälde, keine direkte Menschendarstellung, sondern ein Werk, das mit all seiner künstlerischen Vollkommenheit schon in den unschönen und verwirrenden Arabesken der »Fussreise nach Amager« angedeutet war. Während die Märchendichtung nämlich durch ihren Inhalt an die alten Mythenbildungen erinnert (»Fliedermütterchen«, »Die Schneekönigin«), an die Volkssagen, auf deren Grunde sie sich zuweilen erbaut, an Sprichwörter und Fabeln des Alterthums, ja, an die Parabeln des Neuen Testamentes (der Buchweizen wird gestraft wie der Feigenbaum), während sie solchermaassen stets durch eine Idee zusammen gehalten wird, lässt sie sich betreffs ihrer Form mit den phantastischen pompeianischen Dekorationsmalereien vergleichen, in welchen eigenthümlich stilisirte Pflanzen, lebensvolle Blumen, Tauben, Pfauen und Menschengestalten sich mit einander verschlingen und in einander übergehen. Eine Form, die für jeden Andern ein Umweg zum Ziele, ein Hinderniss und eine Verkleidung sein würde, wird für Andersen eine Maske, unter welcher er sich erst recht frei, recht fröhlich und sicher fühlt, sein kindlicher Genius spielt, wie die bekannten antiken Kindergestalten, mit der Maske, erweckt Lachen, ergötzt und erschreckt hinter derselben. So wird die in all' ihrer Offenherzigkeit maskirte Ausdrucksweise des Märchens der natürliche, ja klassische Tonfall seiner Stimme, welcher äusserst selten sich überschlägt oder detonirt. Das Einzige, was hin und wieder vorkommt, ist, dass man statt der reinen Milch des Märchens einen Schluck Milchwasser erhält, dass der Ton etwas zu empfindsam und süsslich wird (»Der arme Johannes!« »Der arme Vogel!« »Das arme Däumelinchen!«), was übrigens selten bei den, dem Volksmärchen entnommenen Stoffen, wie »Das Feuerzeug«, »Der grosse Klaus und der kleine Klaus« etc., der Fall ist, wo das naiv Lustige, Frische und Harte in der Erzählung, welche ohne die geringste mitleidige oder weinerliche Phrase von Verbrechen und Mordthaten berichtet, Andersen zu Statten kommt und seinen Figuren grössere Derbheit verleiht. Weniger klassisch ist der Ton dagegen in den, den Märchen eingefügten lyrischen Ergüssen, in welchen der Dichter in einer bewegten und pathetischen Prosa einen flüchtig umfassenden Blick über einen grossen Zeitraum der Geschichte wirft (»Der Ehre Dornenpfad«, »Das Schwanennest«). Hier scheint mir ein gewisser Schwung, eine gewisse forcirte Begeisterung in der Stimmung im Missverhältnisse zu dem nicht sehr bedeutenden Gedankeninhalt zu stehen; denn Gedanke und Ausdruck sind wie ein Liebespaar: der Gedanke darf wohl etwas grösser, etwas höher als der Ausdruck sein, wie der Mann grösser als die Frau; im entgegengesetzten Verhältnisse liegt etwas Unschönes. Bis auf die hier angedeuteten wenigen Ausnahmen ist die Erzählungsweise der Märchen in ihrer Art musterhaft.
Lasst uns, um sie gründlich kennen zu lernen, den Dichter bei seiner Arbeit belauschen. Lasst uns durch das Studium seines Verfahrens ein tieferes Verständniss des Resultats gewinnen. Es gibt einen Fall, wo seine Arbeitsmethode sich deutlich beobachten lässt, nämlich wenn er einen Stoff umarbeitet. Wir brauchen dann nicht in unklarer Allgemeinheit zu empfinden und zu loben, wir können Punkt für Punkt, im Vergleich mit einer abweichenden Erzählungsart, scharf und bestimmt angeben, was er auslässt, was er hervorhebt, und so seine eigene unter unseren Augen heranwachsen sehen. Andersen blättert eines Tages in Don Manuel's »Graf Lucanor«, ergötzt sich an der schlichten Weisheit der alten spanischen Geschichten, an ihrer feinen, mittelalterlichen Darstellung, und verweilt bei
»Kapitel VII.
Handelt davon, was einem König mit drei Betrügern
begegnete.
Graf Lucanor sprach eines Tages mit Patronio, seinem Rathgeber, und sagte zu ihm: Es ist ein Mann zu mir gekommen und hat mir von einer sehr wichtigen Sache geredet. Er lässt durchblicken, dass sie im höchsten Grade zu meinem Besten gereichen würde. Aber er sagt, kein Mensch in der Welt dürfe darum wissen, wie hoch ich ihn auch schätzen möge, und er schärft mir so dringend ein, das Geheimniss zu bewahren, dass er sogar sagt, falls ich Jemand dasselbe offenbaren würde, so werde mein ganzes Besitzthum und mein Leben aufs höchste gefährdet sein. Und da ich weiss, dass man Euch Nichts sagen kann, ohne dass Ihr wisst, ob es zum Heile oder in trugvoller Absicht gesagt wird, so bitte ich Euch, mir zu sagen, was Ihr von dieser Sache haltet. Herr Graf, antwortete Patronio, damit Ihr verstehen könnt, was hier nach meinem Dafürhalten zu thun ist, möchte ich Euch bitten, anzuhören, was einem Könige mit drei Betrügern begegnete, die zu ihm kamen. Der Graf frug, wie es sich damit verhielte.«
Diese Einleitung gleicht einem Programm; man erfährt zuerst die nackte Frage, auf welche die nachfolgende Geschichte antworten soll, und man fühlt, dass die Geschichte nur der Frage halber da ist. Es soll uns nicht erlaubt sein, selbst aus der Erzählung die Lehre, welche wir darin finden, zu entnehmen, sie soll mit aller Gewalt auf die Frage nach dem Vertrauen, welches geheimnissvolle Menschen verdienen, hingelenkt werden. Diese Erzählungsweise ist die praktische, nicht die poetische, sie beschränkt allzu stark das Vergnügen, welches der Leser daran findet, selbst die versteckte Moral zu ermitteln. Die Phantasie sieht es freilich gern, dass man ihr die Arbeit leicht macht, sie will sich nicht wirklich anstrengen; aber sie mag nicht, dass man ihrer leichten Thätigkeit vorgreift, sie will, wie alte Leute, die man zum Schein arbeiten lässt, nicht daran erinnert werden, dass ihre Arbeit nur Spiel ist. Die Natur gefällt, wenn sie wie Kunst erscheint, sagt Kant, die Kunst, wenn sie wie Natur erscheint. Weshalb? Weil die verschleierte Absicht gefällt. Aber gleichviel, lasst uns in dem Buche weiter lesen:
»Herr Graf, sagte Patronio, es kamen drei Betrüger zu einem Könige und sagten, sie seien ganz vorzügliche Meister in der Anfertigung von Kleiderstoffen, und sie verstünden namentlich eine Art Zeug zu verfertigen, das Jeder, welcher wirklich der Sohn des Vaters sei, den alle Welt dafür hielte, sehen könne, das aber der, welcher nicht der Sohn seines vermeintlichen Vaters sei, nicht zu sehen vermöge. Dem König gefiel dies sehr, da er dachte, dass er mit Hilfe dieses Zeuges erfahren könne, welche Männer in seinem Reiche die Söhne derer seien, die von rechtswegen ihre Väter sein sollten, und welche nicht, und dass er solchermaassen Vieles in seinem Lande berichtigen könne; denn die Mauren beerben nicht ihren Vater, wenn sie nicht wirklich seine Kinder sind. Deshalb befahl er, ihnen einen Palast einzuräumen, in welchem sie arbeiten könnten.«
Der Anfang ist ergötzlich, es ist Humor in der Geschichte; aber, denkt Andersen, wenn man sie für Dänemark benutzen wollte, so müsste man freilich einen anderen Vorwand wählen, der passender für Kinder und für die bekannte nordische Unschuld wäre. Und dann dieser König, er steht in der Erzählung wie eine Schachfigur da; weshalb kommen die Betrüger gerade zu ihm, was für einen Charakter besitzt er? ist er prunkliebend, ist er eitel? Man sieht ihn nicht vor Augen. Am besten wär's, wenn er ein Narr von König wäre. Man müsste ihn charakterisiren, ihn durch ein Wort, eine Redensart stempeln.
»Und sie sagten zu ihm, er möge sie, um sicher zu sein, dass sie ihn nicht betrügen, in jenen Palast einschliessen lassen, bis das Zeug fertig sei, und das gefiel dem König sehr.« Sie erhalten jetzt Gold, Silber und Seide, verbreiten die Nachricht, dass das Gewebe begonnen sei, veranlassen durch ihr keckes Hinweisen auf Muster und Farben die Sendboten des Königs, das Zeug für vortrefflich zu erklären, und erreichen solchermaassen zuletzt den Besuch des Königs, welcher, da er Nichts sieht, »einen Todesschreck bekommt; denn er glaubt, er sei nicht der Sohn des Königs, den er für seinen Vater gehalten.« Er lobt deshalb das Zeug über die Maassen, und Alle machen es wie er, bis er eines Tages bei Gelegenheit eines Festes die unsichtbaren Kleider anlegt; er reitet durch die Stadt, »und es war gut für ihn, dass es Sommer war«. Niemand sah das Zeug, allein Jeder fürchtete durch das Eingeständniss seines Unvermögens sich ruinirt und entehrt zu sehen. »Dadurch wurde dies Geheimniss bewahrt, und Niemand erkühnte sich, es zu offenbaren, bis ein Neger, welcher das Pferd des Königs wartete und Nichts zu verlieren hatte, zum König ging«, und die Wahrheit an den Tag brachte.
»Wer Dir den Rath gibt: schweige gegen Deinen Freund,
Will ohne Zeugen sicherlich betrügen Dich.«
Eine lächerliche und zugleich eine sehr schlecht bewiesene Moral dieser artigen Geschichte. Andersen vergisst die Moral, beseitigt mit schonender Hand die schwerfällige Lehre, welche die Erzählung nach einer Seite hinbiegt, wo ihr wahrer Mittelpunkt nicht liegt, und erzählt nun mit dramatischer Lebendigkeit, in dialogischer Form, sein treffliches Märchen von dem eitlen Kaiser, von dem man in der Stadt sagte: »Der Kaiser ist in der Garderobe.« Er rückt uns die Erzählung ganz nahe. Es gibt Nichts, dessen Existenz man nicht zu leugnen wagte aus Furcht, für einen Bastard zu gelten; aber es gibt Vieles, über das man sich nicht die Wahrheit zu sagen getraut aus Feigheit, aus Furcht, anders zu handeln, als »alle Welt«, aus Besorgniss, dumm zu erscheinen. Und diese Geschichte ist ewig neu, ohne Ende. Sie hat ihre ernste, allein sie hat auch gerade wegen ihrer Unendlichkeit ihre humoristische Seite: »Aber er hat ja Nichts an!« rief zuletzt das ganze Volk. Und das wurmte den Kaiser, denn es schien ihm, als hätten sie Recht, aber er dachte bei sich: »Nun muss ich die Procession aushalten.« Und so hielt er sich noch straffer, und die Kammerherren gingen hinterher und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.« Andersen erst hat die Erzählung komisch gemacht.
Doch wir können der Erzählungsweise Andersen's noch näher treten; wir sahen ihn ein fremdes Märchen neu darstellen, wir können ihn nun auch seine eigenen Versuche umarbeiten sehen. Im Jahre 1830 veröffentlichte Andersen in einem Gedichtbande »Der Todte, ein Volksmärchen aus Fünen«, – dasselbe, welches er später unter dem Titel »Der Reisekamerad« umarbeitete. Die Erzählung ist in ihrer ersten Gestalt vornehm und würdevoll, sie beginnt folgendermaassen: »Ungefähr eine Meile von Bogensee findet man auf dem Felde in der Nähe von Elvedgaard einen durch seine Grösse merkwürdigen Weissdorn, den man selbst von der jütischen Küste aus sehen kann.« Hier sind hübsche landschaftliche Naturschilderungen, hier ist eine fertige Schriftstellermanier. »Die erste Nacht quartirte er sich in einem Heuschober auf dem Felde ein und schlief dort wie ein persischer Fürst in seinem glänzenden Schlafzimmer.« Ein persischer Fürst! Das ist eine kleinen Kindern fremde Vorstellung. Setzen wir lieber statt dessen: »Die erste Nacht musste er sich in einem Heuschober auf dem Felde schlafen legen, ein anderes Bett hatte er nicht. Aber das sei recht hübsch, meinte er, der König selbst könne es nicht besser haben.« Das ist verständlich. »Der Mond hing wie eine argantische Lampe unter der gewölbten Decke und brannte mit einer steten Flamme.« Klingt der Ton nicht vertraulicher, wenn man sagt: »Der Mond war eine grosse Nachtlampe, hoch oben unter der blauen Decke, und der steckte gewiss nicht die Gardinen in Brand«? Die Geschichte von der Puppenkomödie wird umgeschrieben; es genügt, wenn wir wissen, dass das Stück von einem König und einer Königin handelt; Ahasverus, Esther und Mardochai, die zuerst genannt wurden, sind zu gelehrte Namen für Kinder. Stossen wir auf einen lebensvollen Zug, so behalten wir ihn: »Die Königin kniete ebenfalls nieder und streckte ihre goldene Krone aus, als wollte sie sagen: » Nimm sie! aber schmiere meinen Gemahl und meine Hofleute!« Solch eine Stelle ist eine von denen, wo der Märchenton durch die verfeinerte Form hindurchdringt, wo der Stil, welcher »Du« zum Leser sagt, den, welcher »Sie« sagt, bei Seite schiebt. Hier wimmelt es noch von Schriftsteller-Vergleichen: »Vom Wirth erfuhren unsere Wanderer, dass sie sich im Reiche des Herzkönigs befänden, eines trefflichen Regenten und nahe verwandt mit dem Rautenkönige Silvio, der hinlänglich aus Carlo Gozzi's dramatischem Märchen ›Die drei Pommeranzen‹ bekannt ist.« Die Prinzessin wird mit Turandot verglichen, von Johannes heisst es: »Es war, als hätte er kürzlich den Werther und Siegwart gelesen, er konnte nur lieben und sterben.« Kreischende Misstöne im Märchenstile! Die Worte sind noch nicht dem Sprachschatze des Kindes entnommen, der Ton ist elegant, und die Bezeichnungen sind abstrakt: »Johannes sprach, aber er wusste selbst nicht, was er sagte, denn die Prinzessin lächelte ihn so selig an und reichte ihm ihre weisse Hand zu einem Kusse; seine Lippen brannten, er fühlte sein ganzes Inneres elektrisirt; nichts konnte er von den Erfrischungen geniessen, welche die Pagen ihm anboten, er sah nur sein schönes Traumbild.« Hören wir dies einmal in dem Stile, der uns Allen bekannt ist: »Sie war wunderschön anzuschauen und reichte Johannes die Hand, und er hielt noch viel mehr von ihr, als zuvor. Sie konnte sicher keine böse Hexe sein, wie alle Leute es ihr nachsagten. – Dann begaben sie sich in den Saal, und die kleinen Pagen präsentirten ihnen Eingemachtes und Pfeffernüsse, aber der alte König war so betrübt, er konnte gar nichts essen, und die Pfeffernüsse waren ihm auch zu hart.« In seiner Jugend war Andersen, welcher sich damals Musäus zum Vorbilde nahm, noch nicht so weit gelangt, dass er verstanden hätte, Scherz und Ernst in seinem Vortrage zu verschmelzen, sie fielen auseinander; kaum war das Gefühl ausgesprochen, als sofort die störende Parodie sich einstellte. Johannes sagt einige Worte, in denen er seine Liebe ausspricht, und der Verfasser fügt hinzu: »O, es war so rührend zu hören! Der arme junge Mensch, der sonst so natürlich, so liebenswürdig war, sprach jetzt ganz wie ein Clauren'sches Buch; aber was thut nicht die Liebe?« Auf diesem Punkte, bei dieser pedantischen Frivolität verharrte Andersen noch 1830; allein fünf Jahre später ist sein Verwandlungsprocess beendet, sein Talent hat sich gehäutet, sein Muth ist gewachsen, er wagt seine eigene Sprache zu reden.
Das Bestimmende in dieser Sprechweise war von Anfang an das Kindliche. Um von so jugendlichen Lesern verstanden zu werden, wie die, an welche er sich wandte, musste er die allereinfachsten Worte gebrauchen, auf die allereinfachsten Vorstellungen zurück gehen, alles Abstrakte vermeiden, die indirekte Rede durch die direkte ersetzen, aber indem er solchermaassen das Einfältige sucht, findet er das dichterisch Schöne, und indem er zu dem Kindlichen gelangt, zeigt sich, dass dies Kindliche eben das Poetische ist; denn der allgemein verständliche, naive Ausdruck ist poetischer, als der, welcher an die Industrie, an die Geschichte, an die Literatur erinnert, das konkrete Faktum ist zugleich lebendiger und durchsichtiger, als das, welches als Beweis für einen Satz hingestellt wird, und die Sprache, welche unmittelbar von den Lippen gebildet wird, ist charakteristischer, als die blasse Umschreibung mit einem »dass« Man vergleiche Stellen wie folgende: »Es ist, wie wenn Einer da sässe und ein Stück übte, das er nicht heraus kriegen kann, immer dasselbe Stück. › Ich kriege es doch heraus!‹ sagt er wol, aber er kriegt's doch nicht heraus, wie lange er auch spielt.« – »Die grossen weissen Schnecken, aus denen vornehme Leute in alten Zeiten Fricassée bereiten liessen und, wenn sie es gegessen hatten, sagten: › Hm, wie das schmeckt!‹ – denn sie glaubten nun einmal, dass es vorzüglich gut schmecke – lebten von Klettenblättern.«.
Bei dieser Sprache zu verweilen, sich in ihren Wortschatz, ihre Syntax, ihre Betonung zu vertiefen, ist kein Zeugnis von einem kleinlichen Geiste und geschieht nicht aus Liebe zu den Vokabeln oder zum Idiom. Die Sprache ist allerdings nur die Oberfläche des Dichterwerks; aber indem man seinen Finger auf die Haut legt, fühlt man den klopfenden Puls, welcher den Herzschlag im Inneren angibt. Das Genie gleicht einer Uhr: der sichtbare Zeiger wird von der unsichtbaren Feder gelenkt. Das Genie gleicht einem aufgerollten Knäul: so unauflöslich und verwickelt es erscheint, ist es doch in seinem innern Zusammenhange unzertrennlich Eins. Hat man nur das äusserste Ende des Fadens erfasst, so darf man versuchen, langsam und vorsichtig selbst den verworrensten Faden aus seinem Wickel zu entrollen. Er nimmt keinen Schaden dabei.
Halten wir also den Faden fest, so verstehen wir, wie das Kindliche im Vortrage und Vorstellungskreise der Märchen, die treuherzige Weise, mit der sie das Unwahrscheinlichste berichten, ihnen gerade dichterischen Werth verleiht. Denn was ein Literaturprodukt bedeutungsvoll macht, was ihm Ausbreitung im Raume und dauernde Bedeutung in der Zeit verleiht, das ist die Macht, mit welcher es das im Raume Verbreitete und in der Zeit Dauernde darzustellen vermag. Es erhält sich durch die Kraft, mit welcher es auf eine deutliche und formvollendete Art das Konstante veranschaulicht. Die Schriften, welche die in der Zeit oder im Raume eng begrenzten Stimmungen oder Gefühle festhalten, diejenigen, welche sich um rein lokale Verhältnisse bewegen, oder von einem Modegeschmack getragen werden, der seine Nahrung und sein Bild in ihnen findet, verschwinden mit der Mode, welche sie hervor rief. Ein Gassenhauer, ein Zeitungsartikel, eine Festrede, halten eine Stimmung fest, welche die Stadt oberflächlich acht Tage lang erfüllte, und leben daher selbst ungefähr eben so lange. Oder, um höher hinauf zu steigen: in einem Lande entsteht plötzlich ein gewisser untergeordneter Hang, z. B. die Lust Privatkomödie zu spielen, wie sie zur Zeit »Wilhelm Meister's« in Deutschland oder zwischen 1820 und 1830 in Dänemark epidemisch war. Eine solche Stimmung ist zwar an und für sich nicht bedeutungslos, aber psychologisch betrachtet ist sie durchaus oberflächlich und berührt nicht das tiefere Leben der Seele. Macht man sie nun also zum Gegenstand der Satire, wie es in Dänemark in Rosenkilde's »Der dramatische Schneider« oder in Henrik Hertz's »Herr Burchardt und seine Familie« geschah, so werden diese Werke, welche, ohne die Epidemie unter einen höheren Gesichtspunkt zu stellen, sie nur schildern und lächerlich machen, eben so kurzlebig wie jene sein. Steigen wir jetzt eine Stufe höher, wenden wir uns zu den Werken, welche den psychologischen Zustand eines ganzen Geschlechts, eines ganzen Menschenalters spiegeln. Solche Literaturprodukte sind die gutmüthige Trinkliederpoesie des vorigen Jahrhunderts, die politische Gelegenheitsdichtung des jetzigen. Sie sind historische Dokumente, aber ihr Leben und ihr poetischer Werth stehen in direktem Verhältnisse zu der Tiefe, mit welcher sie sich dem allgemein Menschlichen, dem in der geschichtlichen Strömung Konstanten nähern. Mit grosser und entschiedener Bedeutung treten sodann in dieser Stufenfolge die Werke hervor, in denen ein Volk ein halbes oder ganzes Jahrhundert lang oder während einer ganzen geschichtlichen Periode sich portraitirt gesehen und die Aehnlichkeit anerkannt hat. Solche Werke müssen nothwendigerweise einen Seelenzustand von beträchtlicher Dauer schildern, welcher, eben weil er so dauernd ist, seinen geologischen Platz in den tieferen Schichten der Seele haben muss, da sonst der Wellenschlag der Zeit ihn weit eher fortspülen würde. Diese Werke verkörpern nämlich die ideale Persönlichkeit einer Zeit, d. h. die Persönlichkeit, welche den Menschen jener Zeit als ihr Spiegel- und Musterbild vorschwebt. Es ist diese Persönlichkeit, welche Künstler und Dichter in Stein hauen, malen und schildern, und für welche Musiker und Dichter schaffen. Im griechischen Alterthume waren es der geschmeidige Athlet und der wissbegierige, fraglustige Jüngling, im Mittelalter der Ritter und Mönch, unter Ludwig XIV. der Hofmann, im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts war es Faust. Die Werke, welche solche Gestalten darstellen, drücken also den geistigen Zustand eines ganzen Zeitalters aus, allein die bedeutendsten derselben drücken noch mehr aus, sie spiegeln und verkörpern zugleich den Charakter eines ganzen Volkes, eines ganzen Stammes, einer ganzen Kultur, indem sie die allertiefste, elementarste Schicht der einzelnen Menschenseele und der Gesellschaft erreichen, welche jene in seiner kleinen Welt concentrirt und vertritt. Man könnte solchergestalt die Geschichte einer ganzen Literatur mittelst weniger Namen schreiben, indem man die Gesqhichte ihrer idealen Persönlichkeiten schriebe. Die dänische Literatur in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts liegt z. B. zwischen den beiden Typen: Oehlenschläger's Aladdin und Frater Taciturnus in Kierkegaard's »Stadien auf dem Lebenswege«. Der Erstere ist ihr Ausgangspunkt, der Letztere ihre Vollendung und ihr Abschluss. Da nun der poetische Werth dieser Persönlichkeiten, wie gesagt, auf der Tiefe beruht, mit welcher sie im Volkscharakter oder in der Menschennatur begründet sind, so wird man leicht erkennen, dass z. B. eine Persönlichkeit wie Aladdin, um in ihrer eigentümlichen Schönheit verstanden zu werden, mit der idealen Persönlichkeit verglichen werden muss, welche uns vom Anbeginn der Zeiten her in der Phantasie des dänischen Volkes entgegen leuchtet. Man findet diese Persönlichkeit, indem man eine grosse Anzahl der ältesten mythischen und heroischen Gestalten des Volkes neben einander hält. Sollte ich einen einzelnen Namen angeben, so würde ich Uffe den Schüchternen nennen Uffe der Schüchterne ist nach der Sage der Sohn des Dänenkönigs. Der Vater war zu seiner Zeit ein gewaltiger Krieger, aber nun ist er alt und kraftlos geworden. Der Sohn macht dem Vater die grösste Sorge. Keiner hat ihn je reden hören, er hat nie den Gebrauch der Waffen erlernen wollen, und er interessirt sich für Nichts, sondern geht in phlegmatischer Gleichgültigkeit einher. Aber als die Könige des Sachsenlandes sich weigern, dem alten Vater den gewohnten Tribut zu bezahlen, ihn verhöhnen und ihn zum Zweikampfe fordern, und als der Vater in Verzweiflung die Hände ringt und ausruft: »Hätte ich doch einen Sohn!«, da spricht Uffe zum ersten Mal und fordert die beiden fremden Könige zum Holmgang heraus. Jetzt beeilt man sich, ihm Waffen zu bringen, aber kein Harnisch ist gross genug für seine breite Brust. Macht er eine Bewegung, so platzt derselbe sofort. Endlich muss er sich mit einem zusammengestückten und geborstenen Harnisch begnügen. Eben so geht es mit jedem Schwerte, das man ihm in die Hand gibt. Sie zerspringen alle wie Glas, wenn er sie an einem Baume erprobt. Da lässt der König das alte Schwert Skräpp, welches sein Vater geführt, aus dem Hünengrabe holen und heisst Uffe dasselbe ergreifen, aber es nicht vor dem Kampfe erproben. So ausgerüstet stellt Uffe sich den beiden fremden Königen auf einer Insel in der Eider. Der alte blinde König sitzt am Ufer des Flusses und horcht mit bangem Herzklopfen auf die Schwerthiebe. Wenn sein Sohn fällt, will er sich in die Wellen stürzen und sterben. Da schlug Uffe auf den einen der Sachsenkönige los und hieb ihn quer mittendurch. »Den Ton kenne ich,« sagte der König, »das war Skräpp's Klang!« Und Uffe that noch einen Streich und hieb den andern König der Länge nach mittendurch, so dass er in zwei Hälften zur Erde fiel. »Da klang Skräpp zum andern Mal!« sagte der blinde König. – Und als der alte König starb, bestieg Uffe den Thron und ward ein mächtiger und gefürchteter Herrscher.. An Tugenden wie an Fehlern ist er ein Koloss von einem dänischen Heros. Man sieht leicht, in welchem Grade alle die besten Gestalten Oehlenschläger's, sein ruhiger Thor, sein sorgloser Helge und sein unthäthiger Aladdin, dem Helden nacharten, und man sieht bei dieser Betrachtung, wie tief Aladdin im Volkscharakter wurzelt, während er gleichzeitig ein Zeitideal von ungefähr fünfzigjähriger Dauer ausdrückt. Wie Frater Taciturnus eine Variante des Fausttypus ist, würde ebenfalls leicht zu veranschaulichen sein. Bisweilen ist es also möglich, nachzuweisen, wie die ideale Persönlichkeit ein Zeitalter hindurch sich über die verschiedensten Länder und Völker, über einen ganzen Welttheil erstreckt, und ihren Stempel in einer ganzen Gruppe von Literaturwerken hinterlässt, welche einander wie Abdrücke einer und derselben Geistesform, Abdrücke eines und desselben riesigen Petschafts in den verschiedenartigst gefärbten Oblaten gleichen. So leitet die Persönlichkeit, welche in der dänischen Literatur als »der Verführer Johannes« (in Kierkegaard's »Entweder – Oder«) hervortritt, sich von Byron's Helden, von Jean Paul's Roquairol, von Chateaubriand's René, von Goethe's Werther ab, und wird ganz gleichzeitig in Lermontow's Petschorin (»Der Held unserer Zeitdargestellt. Um eine solche Persönlichkeit zu stürzen, genügen nicht die gewöhnlichen Wellenschläge und Stürme der Zeit, erst die Revolution von 1848 hat sie beseitigt.
Die Gegensätze berühren sich. Auf dieselbe Art, wie eine tief eingreifende, allgemein menschliche Seelenkrankheit sich gleichzeitig über ganz Europa erstreckt und durch ihre Tiefe bewirkt, dass die Werke, welche zuerst als ihre Portraits erschaffen wurden, als ihre Denkmäler stehen bleiben, eben so werden aus demselben Grunde auch diejenigen Werke allgemein europäisch und langlebig, welche das Elementarste in der gesunden Menschennatur: die kindliche Phantasie und das kindliche Gefühl, abspiegeln, und sich folglich auf Thatsachen berufen, die Alle erlebt haben (alle Kinder schliessen Königreiche mit einem Schlüssel zu); sie stellen das Leben dar, welches in der ersten Periode der Menschenseele stattfand, und erreichen also eine Geistesschicht, die bei allen Völkern und in allen Ländern am tiefsten liegt. Das ist die einfache Erklärung der Thatsache, dass Andersen allein unter allen dänischen Dichtern eine europäische, ja mehr als europäische Verbreitung gefunden hat. Mir ist keine andere Erklärung zu Ohren gekommen, es wäre denn die, welche seine Berühmtheit daraus ableiten will, dass er selbst umher gereist sei und für seinen Ruhm gesorgt habe. Ach, wenn Reisen es thäten, so müssten die Reisestipendien für Künstler jeglicher Art, die alljährlich vertheilt werden müssen, Dänemark allmählich einen ganzen Flor europäischer Berühmtheiten schaffen, wie sie ihm bereits Dichter auf Dichter schaffen. Die Dichter sind freilich danach. Aber selbst die übrigen, minder boshaften Erklärungsgründe, welche man anführen könnte, z. B. dass fast er allein unter den grösseren dänischen Dichtern in Prosa geschrieben hat und sich deshalb allein ohne Zwang übersetzen lässt, dass sein Genre so populär oder dass er ein grosses Genie ist, besagen entweder zu wenig oder zu viel. Es gibt in der dänischen Literatur mehr als einen Genius, der grösser als Andersen ist, Viele, die betreffs ihrer Begabung durchaus nicht hinter ihm zurückstehen. Aber es gibt keinen, dessen Schöpfungen so elementar sind. Besass Heiberg, so gut wie er, den Muth, sich eine Kunstart (das Vaudeville) nach seiner Eigenthümlichkeit umzuformen, so hat er doch nicht, wie Jener, das Glück gehabt: eine einzelne Kunstart zu finden, in welcher er sein ganzes Talent offenbaren, all' seine Gaben kombiniren konnte, wie es Andersen im Märchen vermochte, noch Stoffe zu finden, bei welchen die Zeit- und Lokalverhältnisse von so verschwindender Bedeutung sind. Sein bestes Vaudeville, »Die Unzertrennlichen«, würde nur in den wenigen Ländern verstanden werden, wo man, wie in den skandinavischen Ländern, den »Mässigkeitsverein der Seligkeit« (Ibsens Ausdruck für die lange Verlobung) kennt, mit welchem das Vaudeville seinen Spott treibt. Aber wie Muth dazu gehört, Talent zu besitzen, so gehört Glück dazu, Genie zu besitzen, und Andersen hat es weder an dem Glücke noch an dem Muthe gefehlt.
Das Elementare in Andersen's Poesie sicherte ihm einen Leserkreis unter den Gebildeten aller Länder. Es sicherte ihm einen noch erheblicheren unter den Ungebildeten. Das Kindliche ist in seinem Wesen selbst volksthümlich, und der Verbreitung nach aussen entspricht eine Verbreitung nach unten. Wegen der tiefen und betrübenden, aber natürlichen Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Bildungsschichten wirkt die gute Literatur fast nur auf eine einzige Klasse. Wenn in Dänemark eine Reihe Literaturerzeugnisse, wie Ingemann's Romane, eine Ausnahme machen, so geschieht es zumeist durch Eigenschaften, welche sie von den Gebildeten entfernen: durch Unwahrheit der Charakterschilderung und der historischen Farbe. Es verhält sich mit Ingemann's Romanen wie mit Grundtvig's Theorien: will man sie vertheidigen, so kann das nicht geschehen, indem man ihre Wahrheit beweist, sondern indem man rein praktisch den äusseren Nutzen, den sie gestiftet, den Vortheil, den sie der dänischen Sache, der Volksaufklärung, der Frömmigkeit etc. gebracht haben, betont. Ingemann's Romane stehen übrigens in einem bemerkenswerthen Verhältnisse zu Andersen's Märchen. Letztere werden von den jüngeren Kindern, erstere von den älteren gelesen. Die Märchen entsprechen der üppigen Einbildungskraft und dem warmen Mitgefühle des Kindes und des etwas älteren Mädchens, die Romane dem phantastischen Thatendrange des Kindes und besonders des etwas älteren Knaben, dem erwachenden Ritterlichkeitsgefühle, der Eitelkeit, Gefallsucht und Keckheit. Letztere sind für erwachsene Menschen geschrieben; allein der gesunde Sinn der Nation hat sie langsam fallen lassen, bis sie ihr natürliches Publikum bei dem Alter zwischen zehn und zwölf Jahren fanden. Wahrheit ist etwas Relatives. Für den Zwölfjährigen sind diese Bücher eben so voll von Wahrheit, wie für den Zwanzigjährigen von unschuldiger Lüge. Und man muss sie bis zu zwölf Jahren lesen: denn bei zwölf und ein halb ist es schon zu spät, wenn man ein bischen fortgeschritten in der geistigen Entwicklung ist. Mit den Märchen verhält es sich umgekehrt. Von Anfang an für Kinder geschrieben und beständig von diesen gelesen, sind sie rasch zu den Erwachsenen empor gestiegen und von ihnen für echte Kinder des Genius erklärt worden.
Es war also ein glücklicher Griff, der Dichter der Kinder zu werden. Nach langem Umhertasten, nach misslungenen Versuchen, die nothwendigerweise ein falsches und ironisches Licht auf das Selbstgefühl eines Dichters werfen mussten, dessen Stolz seine Berechtigung hauptsächlich in der Anwartschaft auf eine Zukunft trug, die er in sich schlummern fühlte, nach vieljährigem Umherschweifen verirrte Andersen, ein echter Spross Oehlenschläger's, sich auf Oehlenschläger's Spuren und fand sich eines Abends vor einer kleinen unansehnlichen, aber geheimnisvollen Thür stehen, vor der Thür des Märchens. Er berührte sie, sie gab nach, und er sah in der Dunkelheit drinnen das kleine »Feuerzeug« brennen, das seine Aladdinslampe ward. Er schlug Feuer damit, und die Geister der Lampe – die Hunde mit Augen, so gross wie Theetassen, wie Mühlräder, wie der Runde Thurm in Kopenhagen – standen vor ihm und brachten ihm die drei riesigen Kisten mit allen Kupfer-, Silber- und Goldschätzen des Märchens. Das erste Märchen war da, und das »Feuerzeug« zog alle anderen nach sich. Wohl dem, der sein »Feuerzeug« findet!
In welchem Sinne ist nun das Kind Andersen's ideale Gestalt? Es kommt in allen Ländern ein gewisser Zeitpunkt, wo die Literatur plötzlich das gleichsam entdeckt, was lange unbemerkt in der Gesellschaft gelegen hat. So wird in einer Literatur nach und nach der Bürger (in Dänemark von Holberg), der Student, der Bauer u. s. w. entdeckt. Zu Platon's Zeit war das Weib noch nicht entdeckt, man möchte fast sagen, noch nicht erfunden. Das Kind wird zu verschiedener Zeit in den verschiedenen Literaturen entdeckt, in England z. B. weit eher, als in Frankreich. Andersen entdeckt das Kind in Dänemark. Doch hier, wie überall, geschieht die Entdeckung nicht ohne Voraussetzungen und Bedingungen, und hier, wie überall, ist in der dänischen Literatur Oehlenschläger derjenige, dem man den ersten Antrieb, die Grundentdeckung verdankt, welche die fast aller späteren Dichter bedingt. Die Einsetzung des Kindes in seine natürlichen poetischen Rechte ist nur eins der vielen Phänomene der Thronbesteigung der Naivetät, deren Urheber in der dänischen Literatur Oehlenschläger ist. Das achtzehnte Jahrhundert, das seine Stärke im raisonirenden Verstande hat, seinen Feind in der Einbildungskraft, in welcher es nur den Bundesgenossen und Leibeigenen der veralteten Traditionen sieht, seine Königin in der Logik, seinen König in Voltaire, den Gegenstand seiner Poesie und seiner Wissenschaft in dem abstrakten, dem aufgeklärten und gesellschaftlichen Menschen, schickt das Kind, das weder gesellschaftlich, noch aufgeklärt, noch abstrakt ist, aus der Wohnstube hinaus und weit, weit in die Ammenstube hinüber, wo es Märchen, Sagen und Räubergeschichten hören mag, so viel ihm beliebt, wohlgemerkt wenn es als erwachsener Mensch Sorge dafür trägt, all' dies Unwürdige wieder vergessen zu haben. In der Gesellschaft des neunzehnten Jahrhundert (ich ziehe die Scheidelinie nicht scharf auf der Grenze) tritt die Reaktion ein. An die Stelle des gesellschaftlichen Menschen tritt der einzelne, der persönliche Mensch. Man schätzte nur das Bewusstsein, jetzt betet man das Unbewusste an, Schelling's Naturphilosophie löst Fichte's Ich-System ab; man führt Krieg gegen die unfruchtbare Verstandesreflexion, setzt Sage und Märchen wieder in ihre Rechte ein, bringt die Kinderstube und ihre Bewohner wieder zu Ehren, bisweilen sogar allzu sehr. In allen Ländern werden die Volksmärchen gesammelt, und in den meisten Ländern fangen die Dichter an, sie zu bearbeiten. Die sentimentalen deutschen Schriftsteller der Uebergangszeit (Kotzebue und Iffland) bringen die Kinder auf die Bühne, in der Absicht, zu rühren; selbst Oehlenschläger führt Kinder, in seine Stücke ein und muss sich dafür von Heiberg durchhecheln lassen. Was die Gesellschaft betrifft, so hat Rousseau hier Schweigen geboten mit seinen pädagogischen Deklamationen und Theorien, es wird dem Kinde und insbesondere der kindlichen Natur eine Aufmerksamkeit geschenkt, wie niemals zuvor, und die Schwärmerei für die Kinder erziehung (Campe) wird allmählich von der Schwärmerei für den »Naturzustand« des Kindes verdrängt (siehe die Rousseau'sche Tendenz schon in dem Gespräche Götz von Berlichingen's mit seinem kleinen Sohne).
Vom Kinde ist nur ein Schritt zum Thiere. Das Thier ist ein Kind, das nie etwas Anderes als Kind wird. Derselbe Drang, das Leben im Gesellschaftsleben aufgehen zu lassen, welcher das Kind bei Seite geschoben, hatte auch das Thier verbannt. Derselbe Durst nach Naivetät, nach Natur, nach dem Unschuldigen und Unbewussten, welcher die Poesie zum Kinde hinführte, führt sie zum Thiere, und vom Thiere zur ganzen Natur, Rousseau, welcher die Sache des Kindes verficht, verficht zugleich die Sache des Thieres, und zuerst und zuvörderst als sein A und O, als sein »praeterea censeo« die Sache der Natur. Er studirt Botanik, schreibt an Linné, spricht ihm seine Bewunderung und Liebe aus. Die wissenschaftliche Naturbetrachtung bestimmt die sociale, welche wiederum die poetische bestimmt. Bernardin de Saint-Pierre führt durch seine feine Erzählung »Paul und Virginie« die Naturschilderung in die französische Prosa ein, und, was wohl zu beachten ist, zur selben Zeit, wo er die Landschaft entdeckt, führt er zwei Kinder als Helden und Heldin ein. Alexander von Humboldt nimmt auf seinen Reisen in den Tropengegenden »Paul und Virginie« mit, liest dies Buch mit Bewunderung laut seinen Reisegefährten in der Natur vor, welche es beschreibt, und spricht mit Dank von dem, was er Saint-Pierre schuldig sei. Humboldt wirkt auf Oersted, der seinerseits tief auf Andersen wirkt. Die sympathische Naturbetrachtung beeinflusst die wissenschaftliche, welche wiederum die poetische beeinflusst. Chateaubriand schildert in seiner farbigen, glänzenden Weise eine Natur, die mit derjenigen verwandt ist, welche Saint-Pierre in sein friedliches, naturanbetendes Gemüth aufgenommen hatte. Steffens trägt in seinen berühmten Vorlesungen zum ersten Male das natürliche Natursystem (siehe den gedruckten Einleitungskursus) in Dänemark vor. Um das Jahr 1831, also zur selben Zeit, wo Andersen's Märchen entstehen, wird in England (demselben Lande, welches mit der Einführung des Kindes in die Literatur den Anfang gemacht hatte) der erste Verein gegen Thierquälerei gegründet, Filialen werden in Frankreich und Deutschland errichtet, wo solche Vereine in München, Dresden, Berlin und Leipzig entstehen. Kierkegaard spottet in »Entweder – Oder« über die Gründung eines dieser Vereine; er sieht in denselben nur ein Phänomen des in seinen Augen von der Jämmerlichkeit der Persönlichkeiten zeugenden Associationstriebes. Kehren wir nach Dänemark zurück, so bemerken wir, dass die nationale, naturgetreue Landschaftsmalerei ihren entscheidenden Aufschwung gerade zu derselben Zeit nimmt, wo die Märchen gedichtet werden. Skovgaard malt den See, in welchem »das hässliche Entlein« plätschert, und zur selben Zeit wird – wie durch ein Wunder – die grosse Stadt dem Kopenhagener zu enge. Ihn langweilen den langen Sommer hindurch ihre Pflastersteine, die vielen Häuser und Dächer, er will ein grösseres Stück Himmel sehen, er zieht aufs Land, legt Gärten an, lernt Gerste von Roggen unterscheiden, wird Landmann für die Sommermonate. Eine und dieselbe Idee, die wiedergefundene Naturidee, verbreitet ihr Wirken über alle Lebenssphären, wie das Wasser einer hoch liegenden Quelle im Herabfliessen sich in eine ganze Reihe verschiedener Bassins vertheilt. Seltsame und zum Nachdenken anregende Wirkung einer Idee! Im vorigen Jahrhundert gab es nichts Aehnliches. Man kann, wie witzig gesagt worden ist, Voltaire's »Henriade« durchstöbern, ohne einen einzigen Grashalm zu finden; es ist kein Futter für die Pferde darin. Man kann fast sämmtliche Gedichte Baggesen's durchblättern, ohne auf eine Naturschilderung, selbst nur als Staffage, zu stossen. Welch ein Sprung von dieser Poesie zu einer Poesie wie Christian Winther's, in welcher die Menschenfiguren meist nur Staffage sind und die Landschaft fast immer die Hauptsache ist, und wie weit war man damals davon entfernt, von einer Poesie wie derjenigen Andersen's zu träumen, in welcher Thiere und Pflanzen den Menschen ersetzen, ja ihn fast überflüssig machen! Die Fabeln des vorigen Jahrhunderts (z. B, Lessing's Fabeln) sind blose Moral.
Was ist nun in der Pflanze, im Thiere, im Kinde für Andersen so anziehend? Er liebt das Kind, weil sein weiches Herz ihn zu den Kleinen, den Schwachen und Hilflosen hinzieht, von denen man mitleidsvoll, mit zarter Sympathie reden darf, und weil er, wenn er dies Gefühl einem Helden widmet – wie in »Nur ein Geiger«, – dafür verspottet wird (man vgl. Kierkegaard's Kritik) G. Brandes: S. Kierkegaard. Ein literarisches Charakterbild. Leipzig 1879., aber wenn er es einem Kinde weiht, den natürlichen Anhaltspunkt für seine Stimmung findet. Aus demselben echt demokratischen Gefühl für die Geringen und Verlassenen führt Andersen – selbst ein Kind des Volkes – in seinen Märchen, wie Dickens in seinen Romanen, beständig Gestalten aus den ärmeren Klassen, »simple Leute«, aber von echtem Herzensadel, vor: die alte Waschfrau in »Der kleine Tuck« und »Sie taugte Nichts«, das alte Mädchen in »Am Spittelfenster«, den Wächter und seine Frau in »Die alte Strassenlaterne«, den armen Handwerksburschen in »Unter dem Weidenbaum«, den armen Hauslehrer in »Alles am rechten Platze«. Der arme ist wehrlos wie das Kind. Er liebt ferner das Kind, weil er es zu schildern vermag, nicht so sehr direkt psychologisch in Romanform – er ist überhaupt kein direkter Psycholog – wie indirekt, indem er sich mit einem Sprunge in die Welt des Kindes versetzt und thut, als gäbe es gar keine andere. Selten war daher eine Beschuldigung ungerechter, als die Kierkegaard's, da er Andersen vorwarf, dass er keine Kinder zu schildern vermöge. Aber wenn Kierkegaard, der übrigens als Literaturkritiker mit ausserordentlichen Vorzügen grosse Mängel verbindet (namentlich an historischem Ueberblick), bei dieser Gelegenheit bemerkt, dass Andersen in seinen Romanen das Kind beständig, »durch ein Anderes« schildere, so ist dies wahr; es hört auf, wahr zu sein, sobald er im Märchen sich auf den Standpunkt des Kindes versetzt und kein »Anderes« mehr kennt. Als handelnd und redend führt Andersen seltener das Kind in seinen Märchen ein. An öftesten hat er es in der reizenden kleinen Sammlung »Ein Bilderbuch ohne Bilder« gethan, wo er mehr als irgendwo anders das Kind sich mit der ganzen Naivetät seiner Natur aussprechen lässt. In solchen kurzen naiven Aussprüchen eines Kindes, wie den dort angeführten, liegt etwas ausserordentlich Erheiterndes und Ergötzliches. Jeder hat derartige Anekdoten zu erzählen. Ich erinnere mich, wie ich einmal ein kleines Mädchen nach einem Vergnügungslokale mitnahm, um die Tyroler Alpensänger zu hören. Sie hörte ihre Lieder sehr aufmerksam an. Als wir nachher im Garten vor dem Pavillon spazieren gingen, begegneten uns einige der Sänger in ihrem Kostüme. Das kleine Mädchen klammerte sich ängstlich an mich an und frug verwundert: »Dürfen sie frei umhergehen?« Solche kleine Aeusserungen vermag Niemand wie Andersen zu erzählen. Folgenden Aufsatz schrieb kürzlich in Kopenhagen ein zehnjähriges Mädchen über das aufgegebene Thema: Eine unerwartete Freude: »Es lebten in Kopenhagen ein Mann und eine Frau, welche sehr glücklich waren. Sie hatten es gut und hielten viel von einander; aber sie waren so traurig darüber, dass sie keine Kinder hatten. Sie warteten lange, aber sie kriegten keine. Da machte der Mann einmal eine grosse Reise und blieb zehn Jahre lang fort. Als diese Zeit um war, kehrte er heim, ging in sein Haus und wurde sehr froh, denn er fand in der Kinderstube fünf kleine Kinder, einige spielten, andere lagen in der Wiege. Das war eine unerwartete Freude.« – Dieser Aufsatz ist jedoch ein Beispiel derjenigen Art von Naivetät, die Andersen nie behandelt. Die Pointe würde einen französischen Erzähler interessiren, ihn lässt sie wie alles, das auf das Geschlechtliche anspielt, völlig kalt. In den Märchen kommen einzelne dergleichen vor, wie die liebenswürdigen Worte des Kindes in »Das alte Haus«, als dasselbe dem Manne den Zinnsoldaten schenkt, »damit er nicht so schrecklich allein sei«, und ein paar artige Antworten in »Die Blumen der kleinen Ida«. Sonst kommen selten Kinder vor. Die bedeutendsten Kindergestalten sind der kleine Hjalmar, der kleine Tuck, Kay und Gerda, die unglückliche eitle Karen (in »Die rothen Schuhe«, – ein unheimliches, aber gut geschriebenes Märchen), das kleine Mädchen mit dem Schwefelhölzchen und das kleine Mädchen in »Herzeleid«, endlich Ib und Christine, die Kinder in »Unter dem Weidenbaum«. Neben diesen wirklichen Kindern stehen einige ideale, das kleine elfenhafte Däumelinchen und das kleine wilde Räubermädchen, gewiss Andersen's frischeste Kindergestalt, die mit ihrer meisterhaft geschilderten Wildheit einen glücklichen Gegensatz zu den vielen artigen, blonden und zahmen Kindern bildet. Man sieht sie vor sich, wie sie leibt und lebt, phantastisch und wahr, sie und ihr Rennthier, das sie »jeden Abend, den Gott werden lässt, mit ihrem scharfen Messer am Halse kitzelt.«
Wir sahen, wie die Sympathie für die Kindernatur zur Sympathie mit dem Thiere, das zwiefach Kind ist, und zur Sympathie mit den Pflanzen, den Wolken, dem Winde führte, die zwiefach Natur sind. Was Andersen zu den unpersönlichen Wesen hinzieht, ist das Unpersönliche in ihm selbst; was ihn zu den ganz bewusstlosen Wesen hinführt, ist nur die direkte Konsequenz dieser Sympathie. Das Kind, so jung es ist, wird alt geboren; jedes Kind ist eine ganze Generation älter als sein Vater, eine Kultur von Jahrtausenden hat ihren ererbten Stempel dem kleinen vierjährigen Residenzkinde aufgeprägt. Wie viele Kämpfe, wie viel Streben, wie viele Leiden haben das Antlitz eines solchen Kindes verfeinert, die Züge sensibel und altklug gemacht! Anders bei den Thieren. Seht den Schwan, das Huhn, die Katze an, sie fressen, schlafen, leben, träumen ungestört, wie vor Jahrtausenden. Das Kind verräth schon böse Instinkte. Wir, die das Unbewusste, das Naive suchen, wir steigen gern die Leiter hinab, welche zu der Region führt, wo es nicht mehr Schuld und Verbrechen gibt, wo die Verantwortlichkeit aufhört, sammt der Reue, dem unruhigen Streben und der Leidenschaft, wo nichts von alledem sich findet ausser durch eine Unterschiebung, deren wir uns halb bewusst sind, und die der Theilnahme deshalb zur Hälfte ihren Stachel raubt. Ein Dichter, der, wie Andersen, so ungern das Grausame und Rohe in seiner Nacktheit vor Augen sieht, und auf den es so starken Eindruck macht, dass er es nicht zu erzählen wagt, sondern hundertmal in seinen Werken vor einer Frevelthat oder Unthat mit dem mädchenhaften Ausrufe zurückschaudert: »Wir ertragen es nicht, daran zudenken!«, solch ein Dichter fühlt sich beruhigt und heimisch in einer Welt, wo alles, was wie Selbstsucht, Gewaltthat, Rohheit, Nichtswürdigkeit und Verfolgung aussieht, nur in uneigentlichem Sinne so genannt werden kann. Höchst charakteristisch ist es nun, dass fast alle in Andersen's Märchen vorkommende Thiere zahme Thiere, Hausthiere sind. Dies ist erstlich ein Symptom derselben sanften und idyllischen Tendenz, welche bewirkt, dass fast all' seine Kinder so artig sind. Es ist ferner ein Zeugnis für seine Naturtreue, welche zur Folge hat, dass er ungern schildert, was er nicht gründlich kennt. Es ist endlich ein interessantes Phänomen mit Rücksicht auf die Verwendung, welche die Thiere hier finden; denn die Hausthiere sind nicht mehr reine Naturprodukte, sie erinnern theils durch Ideenassociation an vieles Menschliche, und theils haben sie durch den langen menschlichen Umgang und durch die lange Kultur selbst etwas Menschliches erhalten, das in hohem Grade die Verpersönlichung unterstützt und befördert. Diese Katzen und Hühner, diese Enten und Puter, diese Störche und Schwäne, diese Mäuse und jenes unnennbare Insekt, »mit Fräuleinblut im Leibe« bieten dem Märchen viele Anknüpfungspunkte dar. Sie gehen bereits mit dem Menschen um, ihnen fehlt nur eine artikulirte Sprache, und es gibt Menschen mit artikulirter Sprache, die ihrer nicht werth sind und nicht ihre Sprache verdienen. Lasst uns darum den Thieren die Sprache geben und sie unter uns aufnehmen.
Auf der fast ausschliesslichen Beschränkung auf die Hausthiere, beruht ein doppelter Charakterzug dieser Märchen. Zum ersten das bezeichnende Resultat, dass Andersen's Thiere, was sie im übrigen auch sein mögen, niemals viehisch, niemals brutal sind. Von Fehlern haben sie nur den, dumm, bornirt und spiessbürgerlich zu sein. Andersen stellt nicht das Thier im Menschen, sondern den Menschen im Thiere dar. Zum zweiten gibt es gewisse frische Stimmungen, gewisse volle Gefühle, gewisse starke und kühne, begeisterte und gewaltsame Ausbrüche, die man niemals im Hinterhofe der Hausthiere hört. Hier wird viel Schönes, viel Launiges und Ergötzliches gesprochen, aber ein Seitenstück zu der Fabel vom Wolfe und Hunde, vom Wolfe, der am Halse des Hundes die Spur der Kette bemerkte und seine Freiheit dem Schutze des Hundehauses vorzog, findet man hier nicht. Die wilde Nachtigall, in welcher die Poesie personificirt wird, ist ein zahmer und loyaler Vogel: »Ich habe Thränen in den Augen des Kaisers gesehen, das ist mir der reichste Schatz! Die Thränen eines Kaisers haben eine besondere Kraft!« Und nun gar der Schwan, das edle, königliche Thier in dem meisterhaften, schon um der Katze und des Huhns willen nie genug zu bewundernden »Hässlichen jungen Entlein«, – wie endet er? Ach, als ein Hausthier. Dies ist einer der Punkte, wo es Einem schwer fällt, dem grossen Schriftsteller zu verzeihen. O, Dichter! fühlt man sich versucht auszurufen, wenn Du schon einen solchen Gedanken gehabt, ein solches Gedicht empfangen und ausgeführt hast, wie konnte dann Deine Begeisterung, Dein Stolz es über's Herz bringen, den Schwan so enden zu lassen? Lass ihn sterben, wenn es sein muss! Das ist tragisch und gross. Lass ihn seine Schwingen erheben, im Jubel über seine Schönheit und Kraft brausend durch die Luft dahin fliegen, lass ihn sich auf einen einsamen und lieblichen Waldsee hinab senken! Das ist frei und schön; aber nicht dieser Schluss: »In den Garten kamen einige kleine Kinder, die warfen Brot und Korn in das Wasser. ... Die Kinder liefen zu dem Vater und der Mutter, und es wurde Brod und Kuchen in das Wasser geworfen, sie sagten Alle: Der neue ist der schönste! so jung und prächtig! und die alten Schwäne neigten sich vor ihm.« Mögen sie sich neigen, aber möge man nicht vergessen, dass es Etwas gibt, was mehr werth ist, als die Anerkennung aller alten Schwäne und Gänse und Enten, mehr werth, als dass man als Gartenvogel Brotkrumen und Kuchen erhält: das stille Dahingleiten und der freie Flug! –
Andersen zieht den Vogel dem vierfüssigen Thiere vor. Es kommen mehr Vögel, als Säugethiere bei ihm vor, denn der Vogel ist sanfter, der Pflanze näher als dem Thiere. Die Nachtigall ist sein Sinnbild, der Schwan ist sein Ideal, der Storch sein erklärter Liebling. Es ist natürlich, dass der Storch, der merkwürdige Vogel, welcher die Kinder bringt, der Storch, der possirliche Langbein, der reisende, beliebte, stets mit Sehnsucht erwartete und mit Freude begrüsste Vogel, sein liebstes Symbol und Titelbild wird.
Doch den Vögeln zieht er wieder die Pflanzen vor. Von allen organischen Wesen sind die Pflanzen diejenigen, welche am häufigsten im Märchen vorkommen. Denn erst in der Pflanzenwelt herrscht Frieden und Harmonie. Auch die Pflanze gleicht einem Kinde, aber einem Kinde, das beständig schläft. Hier ist keine Unruhe, kein Handeln, kein Leiden und keine Sorge. Hier ist das Leben ein stilles, regelmässiges Wachsthum und der Tod nur ein schmerzloses Verwelken. Hier leidet die leicht erregte, lebhafte Dichtersympathie noch minder. Hier ist nichts, was die feinen Nerven erschüttert und angreift. Hier ist er zu Hause, hier malt er Tausend und eine Nacht hinter einem Klettenblatte. Alle Gefühle können wir hier empfinden, Wehmuth beim Anblick des gefällten Stammes, Kraftfülle beim Anblick der schwellenden Knospen, Beängstigung beim Dufte des starken Jasmins, viele Gedanken können uns zufliessen, wenn wir die Entwicklungsgeschichte des Flachses oder die kurze Ehre des Tannenbaumes am Weihnachtsabend sehen, aber unsere Stimmung ist frei (wie dem Komischen gegenüber), das Bild ist so flüchtig, dass es entschwindet, sobald wir es festzuhalten versuchen. Die Sympathie und Erregung berührt leise unser Gemüth, aber sie erschüttert, sie erhitzt es nicht, und sie schlägt es nicht nieder. Ein Gedicht von der Pflanze befreit zwiefach die Sympathie, welche es in Anspruch nimmt; einmal weil wir wissen, dass das Gedicht nur Dichtung ist, und ferner, weil wir wissen, dass die Pflanze nur ein Bild ist. Nirgends hat der Dichter mit feinerem Sinn den Pflanzen Sprache verliehen, als im »Tannenbaum«, in den »Blumen der kleinen Ida« und in der »Schneekönigin«. Jede Blume erzählt in dem letztgenannten Märchen ihre Geschichte; hören wir, was die Feuerlilie sagte: »Hörst Du die Trommel: bum! bum! Es sind nur zwei Töne, immer: bum! bum! Höre der Frauen Trauergesang! höre den Ruf der Priester! – In ihrem langen rothen Mantel steht das Hindu-Weib auf dem Scheiterhaufen, die Flammen lodern um sie und ihren todten Mann empor; aber das Hindu-Weib denkt an den Lebenden hier im Kreise, an ihn, dessen Augen heisser als die Flammen brennen, an ihn, dessen glühender Blick ihr Herz mehr versengt, als die Flammen, welche bald ihren Körper zu Asche verbrennen. Können die Flammen des Herzens in den Flammen des Scheiterhaufens ersterben?« – »Das verstehe ich ganz und gar nicht,« sagte die kleine Gerda. – »Das ist mein Märchen!« sagte die Feuerlilie.
Noch einen Schritt weiter und die Phantasie des Dichters eignet sich das Leblose an, kolonisirt und annektirt Alles, Grosses und Kleines, ein altes Haus und einen alten Schrank (»Die Hirtin und der Schornsteinfeger «), den Kreisel und das Bällchen, die Stopfnadel und den Halskragen, und die grossen Lebkuchenmänner mit bitteren Mandeln als Herzen. Nachdem sie die Physiognomie des Leblosen erfasst hat, identificirt seine Phantasie sich mit dem formlosen All, segelt mit dem Mond über den Himmel, pfeift und erzählt mit dem Winde, sieht den Schnee, den Schlaf, die Nacht, den Tod und den Traum als Personen.
Das Bestimmende in dieser Phantasie war also die Sympathie mit dem Kindlichen, und durch die Darstellung so tiefliegender elementarer und konstanter Seelenzustände, wie diejenigen des Kindes, werden die Hervorbringungen dieser Phantasie über die Fluthen der Zeit erhoben, über die Grenzen des Landes hinaus verbreitet, und gemeinschaftliches Eigenthum der verschiedenen Klassen der Gesellschaft. Die Zeit ist längst vorüber, wo man das Genie für ein vom Himmel gefallenes Meteor ansah; jetzt weiss man, dass das Genie, wie alles Natürliche, seine Voraussetzungen und seine Bedingungen hat, dass es in einem durchgängigen Abhängigkeitsverhältnisse zu seinem Zeitalter steht als eins der Organe seiner Ideen. Die Sympathie für das Kind ist nur ein Phänomen der Sympathie des neunzehnten Jahrhunderts für das Naive. Die Liebe zum Unbewussten ist ein Phänomen der Liebe zur Natur. In der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der Poesie, in der Kunst waren die Natur und das Kind zum Gegenstande der Verehrung gemacht worden; zwischen Poesie, Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft findet eine Wechselwirkung statt. Ersteht also ein Dichter, dessen Liebe ihn zum Kinde hinzieht, dessen Phantasie vom Thiere, von der Pflanze, von der Natur angelockt wird, so wagt er seinem Triebe zu folgen, so empfängt er Muth, sein Talent zu äussern, indem hunderttausend dumpfe Stimmen rings um ihn her seine Berufung verstärken, indem der Strom, wider den er zu schwimmen glaubt, ihn zu seinem Ziele schaukelt und hinträgt.
Man studirt also seine Kunst, indem man die Ideen studirt, welche ihn inspiriren. Sie in ihrem Entstehen und ihrer Verzweigung, in ihrem abstrakten Wesen und ihrer konkreten Macht zu beobachten, ist daher keine überflüssige Handlung, wenn man die Aufgabe hat, sich in die einzelne Dichterphantasie zu vertiefen. Denn die nackte Idee kann zwar nicht dichten; allein ohne die Idee und ohne die Umgebungen, welche sie in Bewegung setzt, kann der Dichter eben so wenig dichten. Um den glücklichen Dichter steht eine Schaar, die mit weniger Glück in derselben Richtung wie er, arbeitet, und um diese Schaar tummeln sich die Völker als stumme, aber theilnehmende Mitarbeiter. Denn das Genie ist wie ein Brennspiegel, welcher die weit zerstreuten Strahlen sammelt und vereint. Es steht niemals allein. Es ist nur der herrlichste Baum im Walde, nur die höchste Aehre in der Garbe, und man erkennt es erst in seiner wirklichen Bedeutung und in seiner wahren Stellung, wenn man es an seinem Platze gesehen hat.
Es genügt nicht, den Welttheil anzugeben, wo das Genie zu Hause gehört; man kann nicht Dänemark nach einer Karte von Europa bereisen. Man muss zum ersten die Stätte deutlicher bezeichnet sehen; sodann kennt man noch nicht das Genie, weil man, ob auch noch so genau, seine Verbindungen und Umgebungen kennt, so wenig wie man eine Stadt kennt, weil man um ihre Wälle herum schritt. Denn dahttps://www.gaga.net/pgdp/tools/proofers/gfx/bt2.pngs Genie wird zwar theilweise, aber nicht erschöpfend, durch die Zeit erklärt. Was es vorfindet, vereinigt es unter einem neuen Gesetz; selbst ein Produkt, bringt es Produkte hervor, die es allein in der Welt hervor zu bringen vermag. Man braucht nur seine Aufmerksamkeit ein wenig anzustrengen, man braucht nur das Urtheil eines Fremden zu hören, um zu fühlen, wie viel in Andersen's Märchen national, lokal und individuell ist. Ich sprach einmal mit einem jungen Franzosen über Dänemark. »Ich kenne Ihr Land sehr gut,« sagte er. »Ich weiss, dass Ihr König Christian, dass Ihr erster Schriftsteller ein verkanntes Genie ist und Herr Schmidt heisst, dass Herr Ploug der tapferste Kriegsheld Ihres Vaterlandes ist, den kein Schlachtfeld jemals weichen sah, und dass Herr Bille der Gambetta Dänemarks ist. Ich weiss, dass Sie einen Gelehrtenstand haben, der sich durch seine wissenschaftliche Selbständigkeit und seine freie Forschung auszeichnet, und ich kenne Herrn Holst, welchen man bei Ihnen ja den Tyrtäus des Danebrog nennt ...« Da ich sah, dass er orientirt sei, unterbrach ich ihn mit der Frage: »Haben Sie Andersen's Märchen gelesen?« – »Ob ich das habe!« antwortete er, »es ist das einzige dänische Buch, welches ich las.« – »Was halten Sie davon?« frug ich. – »Un peu trop enfantin,« lautete die Antwort. Ich bin überzeugt, wenn man Andersen's Märchen einem fünfjährigen französischen Kinde vorlegte, würde es sie auch »un peu trop enfantins« finden. – Ich habe gesagt, dass die Andersen'sche Kindlichkeit allgemein verständlich sei. Das ist wahr, allein es ist nicht die ganze Wahrheit. Diese Kindlichkeit hat ein entschieden germanisches Gepräge, sie wird am besten in England und Deutschland verstanden, minder gut von den romanischen Nationen, am schwersten von der französischen. In Wirklichkeit ist Andersen daher in Frankreich äusserst wenig bekannt und gelesen. England ist das einzige Land, in welchem man ganze und halbe Romane auf die Darstellung des Seelenlebens kleiner Kinder verwendet (Dickens' »Paul Dombey« und »David Copperfield«, Miss Wetherell's »Die weite, weite Welt«, George Eliot's »Die Mühle am Floss«), und die englische Kindlichkeit ist einzig in ihrer Art; man braucht nur das erste beste, französische illustrirte Kinderbuch aufzuschlagen, um den Unterschied zu merken. Das englische und das französische Kind sind eben so ungleichartig wie eine Eichel und eine Buchecker. In Frankreich wird Andersen schon aus dem Grunde niemals festen Fuss fassen können, weil der Platz besetzt, weil er seit lange von La Fontaine eingenommen ist.
Es gibt zwei Arten von Naivetät. Die eine ist die des Herzens, die andere die des Verstandes, jene offen, frei, einfältig und rührend, diese anscheinend verstellt, neckisch, schlagfertig und fein. Die eine erweckt Thränen, die andere ein Lächeln, die erste hat ihre Schönheit, die andere hat ihren Reiz, die erste kennzeichnet das gute Kind, die andere das enfant terrible, und Andersen ist der Dichter jener, La Fontaine der Dichter dieser Naivetät. Diese letztere Form der Naivetät ist der Ausdruck der Frühreife, welche das treffende Wort spricht, ohne noch recht zu wissen, was sie sagt, und welche daher wie ein Deckmantel aussieht; die andere Naivetät ist die der Unschuld, welche voraussetzt, dass ihr Garten Eden die ganze Welt sei, und welche daher die ganze Welt durch ihre Unschuld beschämt, ohne zu wissen, dass sie es thut, aber mit so treffenden Worten, dass die Naivetät sich wie eine Maske ausnimmt. Vergleicht man daher Andersen's Märchen mit La Fontaine's Fabeln, so findet man eine Grundverschiedenheit in der Lebensanschauung und lernt dadurch die nordische Lebensanschauung in ihrer Begrenzung kennen; denn jede Bestimmung ist eine Begrenzung. Einer der tiefsten Züge in La Fontaine's und der gallischen Lebensanschauung ist der Krieg gegen die Illusion. Das launige Spiel in La Fontaine's Naivetät besteht darin, dass sie, so harmlos sie ist, so gutmüthig und mild sie sich immer beweist, ab und zu ahnen lässt, dass sie nicht albern ist, dass sie sich nicht foppen lässt, dass sie recht wohl all' die Dummheit und Heuchelei, all' das Predigen und all' die Phrasen zu schätzen und zu würdigen weiss, von denen die Menschen sich, wie durch Verabredung, an der Nase oder am Herzen herumführen lassen. Mit einem Lächeln geht sie an all' dem Ernste vorüber, dessen Kern Fäulnis und Hohlheit, an all' der Grösse, die im Grunde nur Frechheit, an all' der Ehrwürdigkeit, deren Wesen Lüge ist. So bringt sie » Alles an seinen rechten Platz«, wie der Titel einer der populärsten Geschichten Andersen's lautet. Der Grundton ihres Ernstes ist eine poetische Begeisterung, und ihr witziger Scherz hat einen Stachel, den sie sorgsam verhehlt. Die französische Satire ist ein Stossdegen mit einem vorläufigen Knopfe. Sie hat in »Tartüffe«, »Candide« und »Figaro« Revolution vor der Revolution gemacht. Das Gelächter ist Frankreichs älteste Marseillaise. – Der tiefste Zug in Andersen's Lebensanschauung ist der, das Herz am höchsten zu setzen, und dieser Zug ist echt dänisch. Selbst gefühlvoll, hebt diese Anschauung bei jeder Gelegenheit die Schönheit und Bedeutung des Gefühls hervor, überspringt den Willen (alle Schicksale des Flachses, in dem Märchen seines Lebens, kommen von aussen), bekämpft die Verstandeskritik als das Böse, als ein Werk des Teufels, als einen Hexenspiegel, versetzt der pedantischen Wissenschaft die trefflichsten und witzigsten Seitenhiebe (»Die Glocke«, »Ein Blatt vom Himmel«), schildert die Sinne als Versucher oder übergeht sie wie unaussprechliche Dinge, verfolgt und denuncirt die Hartherzigkeit, verherrlicht und preist die Herzensgüte, stürzt die Rohheit und Bornirtheit von ihrem Throne, hebt die Unschuld und die Wohlanständigkeit hinauf, und bringt so » Alles an seinen rechten Platz«. Der Grundton ihres Ernstes ist das moralisch-religiöse Gefühl, mit dem Hasse der Genialität gegen die Bornirtheit gepaart, und ihre humoristische Satire ist launig, ruhig, in Uebereinstimmung mit dem idyllischen Geiste des Dichters. Diese Satire sticht nur wie eine Mücke, allein an den weichen Stellen. Welche dieser Anschauungen ist die beste? Eine solche Frage verlohnt keiner Antwort. Ich liebe die Buche, und ich liebe die Birke. Nur weil sie mir einfallen, nicht um mich für das Eine oder Andere zu entscheiden, führe ich die Zeilen Georg Herwegh's an:
Auch mir hat sich das Aug' schon oft genetzt,
Sah ich das Herz misshandelt und zerschlagen
Und von den Rüden des Verstands gehetzt.
Es darf das Herz wohl auch ein Wörtchen sagen,
Doch ward es weislich in die Brust gesetzt,
Dass man's so hoch nicht wie den Kopf soll tragen.
Wie die Lebensanschauungen hier verschieden sind, so auch die poetischen Begabungen. La Fontaine schreibt klare, formvollendete, höchst melodische Verse, deren Poesie eine leichte Schwärmerei und eine sanfte Wehmuth ist. Andersen schreibt eine barocke, unregelmässige, leichtmanierirte Prosa, deren Poesie eine üppig sprudelnde, ganz entzückende Phantastik ist. Diese Phantastik macht Andersen den Franzosen so fremdartig, deren ziemlich graue Poesie ganz und gar der farbigen Blumenpracht entbehrt, die man bei den nordischen Völkern findet, die ihre höchste Schönheit in Shakspeare's »Sommernachtstraum« erreicht, die man überall verspürt, und die Andersen's Märchen ihren feinsten Duft mittheilt. Und wie ihre phantastische Laune nordisch-dänisch ist, so ist ihr idyllischer Grundton insbesondere dänisch. Kein Wunder, dass die ersten und eigenthümlichsten dieser Märchen unter dem Regimente Friedrich's VI. gedichtet wurden; seine Zeit hat ihren Stempel auf dieselben gesetzt, man findet ihn wieder in all' jenen väterlich-patriarchalischen alten Königen, man findet den Geist der Zeit in dem vollständigen Mangel an gesellschaftlicher, geschweige politischer Satire, welchen man in dem Märchen verspürt. Kein Wunder auch, dass Thorvaldsen nicht müde werden konnte, diese Märchen vorlesen zu hören, während er seine Ambe und Terne im Lottospiel besetzte, denn sein dänisches Wesen war naiv und seine Kunst, trotz all' ihrer Grösse, idyllisch wie die Kunst, welche diese Dichtungen erzeugt hat.
Ein Genie, das zu einer Zeit geboren wird, wo Alles seiner Entwicklung entgegen steht, wird entweder zermalmt oder geht zu Grunde wie ein untergeordnetes Talent: ein Andersen, 1705 statt 1805 in Dänemark geboren, wäre ein Unglücklicher, ein ganz Unbedeutender, vielleicht ein Wahnsinniger geworden. Ein Talent, das in einem Zeitalter geboren wird, wo ihm Alles zu Statten kommt, erzeugt klassische, geniale Produkte. Allein dieser ersten Uebereinstimmung zwischen dem Genie und der Zeit (zum Theil auch dem Lande), entspricht eine zweite zwischen den eigenen Kräften des Genies, und eine dritte zwischen dem Genie und seiner Kunstart. Die geniale Natur ist ein organisch zusammenhängendes Ganzes, ihre Schwäche in dem einen Punkte bedingt ihre Stärke in dem andern, die Entwicklung jener Fähigkeit verursacht die Hemmung dieser Fähigkeit, und es ist unmöglich, etwas Einzelnes zu verändern, ohne die ganze Maschinerie zu verändern und zu stören. Man wünscht wol das Eine oder Andere anders, aber man begreift ohne Mühe, dass es so sein muss. Man möchte dem Dichter mehr Persönlichkeit, ein männlicheres Wesen und eine ruhigere Geisteskraft wünschen; aber man versteht leicht, dass das Unpersönliche, Abschlusslose der Individualität, welche man aus dem »Märchen meines Lebens« kennen lernt, im innigsten Zusammenhange mit seiner Art der Begabung steht. Ein zugeknöpfterer Geist könnte die poetischen Eindrücke nicht so empfänglich aufnehmen und empfinden, ein härterer nicht diese Schmiegsamkeit mit seiner strammeren Haltung vereinen, ein für Kritik und Philosophie empfänglicherer nicht so naiv sein. Wie nun die moralischen Eigenschaften die intellektuellen bedingen, so bedingen diese gegenseitig einander. Ein so überströmendes lyrisches Gefühl, eine so exaltirte Sensibilität kann nicht mit der Erfahrung und Methode des Weltmanns bestehen; denn Erfahrung kühlt ab und verhärtet. Eine so leicht voltigirende und vogelmässig hüpfende und fliegende Phantasie lässt sich nicht mit dem logisch abgemessenen Crescendo und Decrescendo der poetischen Handlung vereinen. Eine so wenig kaltblütige Beobachtung kann nicht psychologisch bis ins tiefste Mark dringen, eine so kindliche, so leicht erbebende Hand kann nicht einen Schurken anatomiren. Stellen wir daher eine Begabung, wie diese, verschiedenen bestimmten und bekannten Kunstarten gegenüber, so können wir im voraus entscheiden, wie es sich zu jeder derselben verhalten muss.
Der Roman ist eine Dichtungsart, welche nicht allein Einbildungskraft und Gefühl, sondern den scharfen Verstand und das kalte, ruhige Beobachtungsvermögen des Weltmanns bei dem Geiste erfordert, welcher Ausgezeichnetes darin leisten soll; daraus ergibt sich, dass derselbe nicht ganz für Andersen passt, wiewohl er seinem Talente auch nicht durchaus fern liegt. Die ganze Scenerie, der Naturhintergrund, das Malerische des Kostüms wird ihm gelingen; aber im Psychologischen wird man die Schwäche verspüren. Er wird für und wider seine Personen Partei nehmen, seine Männer werden nicht männlich genug, seine Frauen nicht recht weiblich sein. Ich kenne keinen Dichter, dessen Geist geschlechtsloser ist, dessen Talent weniger ein bestimmtes Geschlecht verräth, als Andersen. Deshalb hat er seine Stärke darin, Kinder darzustellen, bei denen das bewusste Geschlechtsgefühl noch nicht hervorgetreten ist. Das Ganze beruht darauf, dass er das, was er ist, so ausschliesslich ist, kein Gelehrter, kein Denker, kein Bannerträger, kein Kämpfer, wie mehrere der grössten Dichter, sondern ausschliesslich Poet. Ein Poet ist ein Mann, der zugleich Weib ist. Andersen sieht im Manne und im Weibe am kräftigsten das Elementare, das gemeinsam Menschliche, viel weniger das Besondere, das Interessante. Ich übersehe nicht, wie er das tiefe Gefühl einer Mutter in »Die Geschichte einer Mutter« geschildert oder eine Geschichte weiblichen Seelenlebens in »Die kleine Seejungfer« erzählt hat; aber was er hier darstellt, sind nicht die complicirten Seelenzustände des Lebens und des Romans, sondern das Lebenselement; er lässt den ganz einzelnen und reinen Ton klingen, der in den verschlungenen Harmonien und Disharmonien des Lebens weder so rein noch so einzeln vorkommt. Indem sie in das Märchen eintreten, erleiden alle Gefühle eine Vereinfachung, eine Läuterung und Verwandlung. Der Charakter des Mannes liegt dem Kinderdichter am fernsten, und ich entsinne mich nur einer einzigen Stelle in den Märchen, wo man auf eine feine psychologische Charakteristik einer weiblichen Seele stösst; sie steht so unschuldig da, dass man sich fast fragen möchte, ob sie sich nicht selbst geschrieben hat. Man findet sie in einer Geschichte von zwei Porzellanfiguren, »Die Hirtin und der Schornsteinfeger«:
»Hast Du wirklich Muth, mit mir in die weite Welt hinaus zu gehen?« frug der Schornsteinfeger. »Hast Du bedacht, wie gross die ist, und dass wir nie mehr hieher zurückkehren können?« – »Das hab' ich,« sagte sie. Und der Schornsteinfeger sah sie fest an, und dann sagte er: »Mein Weg geht durch den Schornstein! Hast Du wirklich Muth, mit mir durch den Ofen, durch die Trommel sowol wie durch das Rohr zu kriechen? ...« Und er führte sie zu der Ofenthür hin. »Da sieht es ganz schwarz aus!« sagte sie, aber sie ging doch mit ihm durch die Trommel sowol wie durch's Rohr, wo die pechfinstere Nacht herrschte. Nach einer langen und beschwerlichen Wanderung erreichten sie den Schornsteinrand. Der Himmel mit all' seinen Sternen war hoch über und alle Dächer der Stadt tief unter ihnen. Sie sahen weit umher, weit, weit hinaus in die Welt. Die arme Hirtin hatte sich's nie so gedacht; sie lehnte sich mit ihrem kleinen Kopfe an ihren Schornsteinfeger und dann weinte sie, dass das Gold von ihrem Leibgürtel absprang. »Das ist allzu viel!« sagte sie. »Das kann ich nicht ertragen! Die Welt ist gar zu gross! Wäre ich doch wieder auf dem Tischchen unter dem Spiegel! Ich werde niemals froh, ehe ich wieder dort bin! Nun bin ich Dir ja gefolgt! Nun bin ich Dir in die weite Welt hinaus gefolgt, nun kannst Du mich auch wieder zurück begleiten, wenn Du mich wirklich lieb hast!«
Eine tiefere, eine unbarmherziger wahre, eine handgreiflichere Analyse einer gewissen Art von weiblicher Begeisterung und ihrer Thatkraft, wenn es rücksichtslos, kühn und ohne einen Blick nach rückwärts zu handeln gilt, findet man, glaube ich, bei keinem andern dänischen Dichter. Welche Feinheit in der Darstellung: der augenblicklich entschlossene Enthusiasmus, das heroische Ueberwinden des ersten Schauders, Ausdauer, Tapferkeit, Festigkeit bis zu dem Augenblicke, – wo es darauf ankommt, wo die Festigkeit zerbricht und die Sehnsucht nach dem Tischchen unter dem Spiegel erwacht! Mancher dicke Roman wird durch solch' eine Seite in die Höhe geschnellt, und man tröstet sich darüber, dass Andersen kein Meister im Romanfache ist.
Das Drama ist eine Dichtungsart, welche die Fähigkeit erfordert, eine Idee zu differentiiren, sie auf viele Träger zu vertheilen; es erfordert Sinn für die bewusste Handlung, eine logische Kraft, sie zu lenken, einen Blick für die Situation, eine Leidenschaft dafür, sich in das unerschöpfliche Studium des einzelnen, vielseitigen Charakters zu vertiefen und zu versenken; daraus ergibt sich, dass das Drama Andersen ferner liegt, als der Roman, und dass seine Unfähigkeit für das Dramatische mit mathematischer Bestimmtheit in dem Verhältnisse steigt, in welchem die einzelne dramatische Abart dem Märchen und damit seiner Begabung ferner liegt. Die Märchenkomödie gelingt ihm natürlich am besten; aber sie hat auch nicht viel anders von der Komödie, als den Namen. Sie ist eine Mischart, und wenn sie auf die Probe des spanischen Märchens gestellt werden könnte, würde man sie als Bastarden erkennen. Im Situationslustspiele ist er glücklich betreffs der poetischen Ausführung der einzelnen Scenen selbst (»Der König träumt«), aber höchst unglücklich in der Durchführung der Idee im Ganzen (»Die Perle des Glücks«). Das eigentliche Lustspiel passt nicht übel für seine Gaben. Einzelne seiner Märchen sind ja bereits fast Holberg'sche Lustspiele, »Die glückliche Familie« ist eine Holberg'sche Charakterkomödie, und »Es ist ganz gewiss « ein Holberg'sches Intriguenstück. Hier fällt die Charakterzeichnung ihm denn auch leichter, als im ernsten Drama, denn hier wandelt er direkt in Holberg's Spuren, so auffällig stimmt sein Vermögen in einer einzelnen Richtung mit dem jenes grossen Mannes überein. Andersen ist, wie ich schon bemerkt habe, kein direkter Psycholog; er ist mehr Biolog, als besonderer Menschenkenner. Seine Vorliebe ist, den Menschen durch das Thier oder durch die Pflanze zu schildern, ihn sich von seinem Naturgrunde aus entwickeln zu sehen. Alle Kunst enthält eine Antwort auf die Frage: was ist der Mensch? Fragt Andersen, wie er den Menschen definire, und er wird antworten: der Mensch ist ein Schwan, ausgebrütet auf dem Entenhofe der Natur. Dem psychologisch Interessirten, der, ohne dass er einen ganzen zusammengesetzten Charakter zu umfassen vermöchte, einen fein entwickelten Blick für die einzelne Eigenschaft, die charakteristische Eigenthümlichkeit, besitzt, bieten die Thiere, insbesondere die uns wolbekannten, eine grosse Erleichterung. Man ist nämlich gewohnt, sie auf eine einzige Eigenschaft, oder doch nur auf ganz wenige, zu reduciren: die Schnecke ist langsam, die Nachtigall ist der unscheinbare Sänger mit den herrlichen Tönen, der Schmetterling der schöne Flatterhafte. Nichts also hindert, dass ein Dichter mit der Gabe, diese treffenden kleinen Züge darzustellen, in die Spuren Holberg's, des Mannes, welcher »Die Wankelmüthige« u. s. w. geschrieben hat, tritt, wie Andersen es in »Die neue Wochenstube« that. Er zeigt hier übrigens eine seiner vielen Aehnlichkeiten mit Dickens, dessen Komik sich häufig auf einige wenige, in's Unendliche wiederholte Züge beschränkt.
In der Epopöe, die in unsern Tagen zu den unmöglichen Dichtungsformen gehört, und die Alles erfordert, was Andersen gebricht, kann er nur einzelne hübsche Einfälle haben, wie z. B. wenn er in »Ahasverus« den Geist China's in einer drolligen lyrischen Episode charakterisirt, oder wenn er die zwitschernden Schwalben (ganz wie im Märchen) uns Attila's Festsaal schildern lässt. – In der Reisebeschreibung kommt naturgemäss eine grosse Anzahl seiner besten Eigenschaften zum Vorschein. Wie sein Liebling, der Zugvogel; ist er in seinem Elemente, wenn er reist. Er beobachtet wie ein Maler, und er schildert wie ein Schwärmer. Zwei Fehler treten jedoch hier hervor: der eine, dass sein lyrischer Hang zuweilen mit ihm durchgeht, so dass er lobsingt statt zu schildern, oder übertreibt statt zu malen (siehe z. B. die überschwängliche und unwahre Beschreibung von Ragatz und Pfäffers); der andere, dass das untergeordnet Persönliche, das Ichsüchtige, welches erkennen lässt, dass der tieferen Persönlichkeit die Geschlossenheit fehlt, bisweilen in störender Weise sich aufdrängt. Letzteres charakterisirt besonders stark die Art seiner Selbstbiographie. Was man mit Recht dem »Märchen meines Lebens« vorwerfen kann, ist nicht so sehr, dass der Verfasser so durchaus mit seiner Privatperson beschäftigt ist (denn das ist hier ganz natürlich), sondern dass diese Persönlichkeit fast nie mit etwas Grösserem als mit sich selbst beschäftigt ist, niemals in einer Idee aufgeht, sich niemals ganz von dem Ich befreit. Die Revolution von 1848 erscheint in diesem Buche wie ein Niesen; man ist ganz erstaunt, daran erinnert zu werden, dass es noch eine Welt ausserhalb des Verfassers gibt. – In der lyrischen Poesie hat er äusseren Erfolg gehabt; Chamisso hat sogar einzelne Lieder von ihm übersetzt; ich sehe ihn aber ungern seine farbige, naturgetreue und realistische Prosatracht ablegen um sich in den einförmigeren Mantel des Verses zu hüllen. Seine Prosa hat Phantasie, ungebundenes Gefühl, Rhythmik und Melodie – warum also nach Wasser über den Bach gehen? Seine Gedichte zeichnen sich übrigens häufig durch einen friedevollen und kindlichen Geist, ein warmes und mildes Gefühl aus. – Man sieht, dass das Resultat seiner Versuche in den verschiedenen Dichtungsarten ganz direkt, wie das unbekannte X in der Mathematik, aus der Natur seiner Anlagen einerseits und der Natur der Dichtungsart andererseits hervorgeht.
So bleibt denn nur seine eigene Dichtungsart zurück, diejenige, auf welche er kein Patent zu nehmen braucht; denn Niemand wird sie ihm rauben. Zu Andersens Zeiten machte man nach dem Vorbilde Hegels überall den Versuch, alle Dichtungsarten mit ihren Varietäten in ästhetische Systeme zu ordnen, und der dänische Hegelianer Heiberg entwarf denn auch ein reich gegliedertes System, in welchem die Rangordung der Komödie, der Tragödie, des Romans, des Märchens u. s. w. festgestellt und den Kunstarten, die Heiberg selbst pflegte, ein besonders hoher Rang gesichert wurde. Es ist aber gewissermassen schon doctrinär, von allgemeinen Kunstarten zu reden. Jeder Dichter individualisirt seine Dichtungsart vollständig. Die Form, welche er gebraucht hat, vermag kein Anderer zu benutzen. So ist es mit dem Märchen, dessen Theorie Andersen nicht zu schreiben versucht, dessen Platz im Systeme er nicht feststellen gewollt hat, und den bestimmen zu wollen ich mich wohl hüten werde. Es ist überhaupt sonderbar mit der ästhetisch-systematischen Rangordnung, es ergeht Einem mit ihr wie mit der Rangordnung im Staate: je mehr man darüber nachdenkt, desto ketzerischer wird man. Vielleicht kommt es daher, weil denken überhaupt gleichbedeutend mit Ketzer sein ist. Doch, wie jeder Naturtypus, hat das Andersensche Märchen seinen Charakter, und seine Theorie besteht in den Gesetzen, denen es folgt, und die es nicht zu überschreiten vermag, ohne dass eine Missgeburt zum Vorschein kommt. Alles in der Welt hat sein Gesetz, selbst die Dichtungsart, welche die Naturgesetze aufhebt.
Andersen gebraucht irgendwo den Ausdruck, er habe sich nun ungefähr in allen Radien des Märchenkreises versucht. Dieser Ausdruck ist treffend und gut. Die Märchen bilden ein Ganzes, ein in vielfachen Radien ausstrahlendes Gewebe, das dem Beschauer, wie das Spinngewebe in »Aladdin«, zu sagen scheint: »Sieh, wie im schwachen Netz die Fäden sich verschlingen!« Wenn es nicht allzu viel Schulstaub in's Wohnzimmer mitbringen heisst, so will ich den Leser darauf aufmerksam machen, dass er in einem berühmten wissenschaftlichen Werke, in Adolf Zeising's »Aesthetischen Forschungen«, die ganze Reihe ästhetischer Gegensatz-Begriffe mit all' ihren Nuancen (das Schöne, Komische, Tragische, Humoristische, Rührende u. s. w.) in einem grossen Sterne geordnet sehen kann, ganz wie Andersen es sich betreffs seiner Märchen gedacht hat.
Die Phantasieform und Erzählungsweise der Märchen gestattet nämlich die Behandlung der verschiedenartigsten Stoffe in der verschiedenartigsten Tonart. Hier findet man erhabene Erzählungen wie »Die Glocke«, tiefsinnige und weise Märchen wie »Der Schatten«, phantastisch-bizarre wie »Erlenhügel«, lustige, fast muthwillige wie »Der Schweinehirt« oder »Die Springer«, humoristische wie »Die Prinzessin auf der Erbse«, »Eine gute Laune«, »Der Halskragen«, »Das Liebespaar«, und mit einer Schattirung von Wehmuth wie »Der standhafte Zinnsoldat«, herzergreifende Dichtungen wie »Die Geschichte einer Mutter«, unheimlich beklemmende wie »Die rothen Schuhe«, rührende Phantasien wie »Die kleine Seejungfer
«, und gemischte, zugleich grossartige und heitere wie »Die Schneekönigin«. Hier begegnet uns eine Anekdote wie »Herzeleid«, die einem Lächeln durch Thränen gleicht, und eine Inspiration wie »Die Muse des neuen Jahrhunderts«, in welcher man den Flügelschlag der Geschichte, das Herzklopfen und den Pulsschlag des lebendigen Lebens der Gegenwart vernimmt, heftig wie im Fieber, und doch gesund wie in einem glücklichen, begeisterten Momente.
Es gibt keinen einzigen dänischen Dichter, der es in solchem Grade wie Andersen verschmäht hätte, durch die Romantik der Vergangenheit zu wirken; er ist selbst im Märchen, das von der romantischen Schule in Deutschland von Anfang an in so mittelalterlichem Stile behandelt ward, immer voll und ganz in der
Gegenwart. Er wagt, eben so wie Oersted, das Interessante in der Schwärmerei für König Hans und seine Zeit aufzuopfern, und er sagt gerne wie Ovid:
Prisca juvent alios! ego me nunc denique natum
Gratulor. Haec aetas moribus apta meis.
Ars amat. III, 121. Kurz gesagt, hier ist alles, was zwischen dem Epigramm und der Hymne liegt.
Gibt es denn wirklich eine Grenze, welche das Märchen beschränkt, ein Gesetz, welches dasselbe bindet, und wo liegt es? Das Gesetz, des Märchens liegt in der Natur des Märchens, und dessen Natur beruht auf derjenigen der Poesie. Scheint es im ersten Augenblicke, dass nichts der Dichtart verwehrt sei, welche eine Prinzessin eine Erbse durch zwanzig Matratzen und zwanzig Eiderdaunenbetten hindurch verspüren lassen kann, so ist das nur ein Schein. Das Märchen, welches die ungebundene Freiheit der Erfindung mit dem Zwange vereint, den seine Idee oder sein Gedanke ihm auferlegt, muss zwischen zwei Klippen hindurch steuern: zwischen der ideenlosen Ueppigkeit und der trockenen Allegorie; es muss die Mittelstrasse halten zwischen der allzu starken Fülle und der allzu grossen Magerkeit. Das thut Andersen fast immer, aber zuweilen doch nicht. Die aus Volksmärchen entnommenen Stoffe, wie »Der fliegende Koffer«, oder die eigentlichen Feenmärchen, wie »Däumelinchen«, haben für die erwachsenen Leser nicht so viel Anziehendes wie für Kinder, weil das Märchen hier keinen Gedanken verbirgt. Im »Garten des Paradieses« ist alles das meisterhaft, was dem Eintritt in den Garten vorausgeht, allein der Fee des Paradieses selbst scheint es mir schwer etwas Schönes oder Ergötzliches abzugewinnen. Das entgegengesetzte Extrem ist nun, dass man die dürre Absicht, die trockene Lehre durch das Gewebe der Dichtung sieht; dieser Fehler ist, wie es in unserer reflektirenden und bewussten Zeit sich erwarten lässt, weit häufiger. Man empfindet ihn stark, weil das Märchen das Reich des Unbewussten ist. Nicht nur, dass die unbewussten Wesen und Dinge hier das Wort führen, sondern was im Märchen siegt und verherrlicht wird, ist eben das Unbewusste. Und das Märchen hat Recht; denn das Unbewusste ist unser Fond und der Quell unserer Stärke. Deshalb kann der Reisekamerad Unterstützung von dem Todten empfangen, weil er ganz vergessen hat, dass er ihm früher geholfen, und deshalb bekommt selbst Tölpel-Hans, weil er bei all seiner Einfältigkeit naiv ist, die Prinzessin und das halbe Reich. Denn auch die Dummheit hat ihre Genialität und ihr Glück; nur mit den armen Zwischengeschöpfen, den Nureddinsnaturen, weiss das Märchen nichts anzufangen. – Wir wollen einige Beispiele von den Sünden gegen das Unbewusste betrachten. So blickt in dem schönen Märchen »Die Schneekönigin« auf das storendste die unglückliche Absicht hindurch, wo die Schneekönigin fordert, dass Kay mit dem Eisspiele des Verstandes Figuren legen soll, und er nicht im Stande ist, mit demselben das Wort » Ewigkeit« zu legen. So herrscht eine grobe und unpoetische Deutlichkeit in »Die Nachbarfamilien«, so oft die Rosen von der Sperlingsfamilie mit dem abstrakten, für eine Sperlingszunge unaussprechlichen Worte » Das Schöne« benannt werden; man hätte schon ohne diesen Fingerzeig verstanden, dass die Rosen in der Erzählung die Repräsentanten des Schönen sind, und indem man im Märchen auf dies abstrakte Wort stösst, fährt man zurück, als hätte man einen schleimigen Frosch berührt. – Dies Allegorisiren tritt, wie zu erwarten stand, in Erzählungen für Kinder am häufigsten in der Form des Docirens und Moralisirens auf; in einzelnen Märchen, wie »Der Buchweizen«, spielt das pädagogische Element eine übergrosse Rolle. In anderen wie »Der Flachs«, fühlt man am Schlusse allzu stark – wie bei Jean Paul – den Hang, zur Zeit und zur Unzeit die Unsterblichkeitslehre anzubringen. Hier werden besonders in dieser Absicht zuletzt ein paar kleine, ziemlich abgeschmackte »unsichtbare Wesen« erschaffen, welche versichern, dass das Lied niemals aus sei. In einigen Fällen endlich ist die Tendenz mehr persönlich. Eine ganze Reihe von Märchen (Das Entlein, Die Nachtigall, Die Nachbarfamilien, Das Gänseblümchen, Die Schnecke und der Rosenstock, Feder und Dintenfass, Die alte Strassenlaterne) spielen auf Dichterleben und Dichterloos an, und in einzelnen Fällen spürt man – was bei Andersen eine seltene Ausnahme ist, – dass die Erfindung an den Haaren herbeigezogen ward, um die Tendenz hervor zu kehren. Welcher Sinn und welche Natur liegt z. B. darin, dass die Strassenlaterne, nur, wenn sie mit einem Wachslicht, nicht wenn sie mit einem gewöhnlicheren Lichte versehen ist, die schönen und bilderreichen Gesichte sehen lassen kann, welche sie erlebt? Das ist ganz unverständlich, bis man es als Allegorie auf das vermeintliche Bedürfniss des Dichters nach Wohlstand auffasst, um etwas Rechtes zu werden. (»Also das Genie soll dem Schürzenstipendium nachlaufen!« schrieb bereits Kierkegaard bei Gelegenheit von »Nur ein Geiger«.) Unglücklicher noch ist es, dass die Strassenlaterne in umgeschmolzenem Zustande, in ihrem anderen Leben, zu einem Dichter kommt und so ihre Bestimmung erreicht. So stark hat die Tendenz sich selten verrathen.
Die erste Pflicht des Märchens ist, poetisch zu sein; seine zweite ist, märchenhaft zu sein. Darin liegt zum ersten, dass die Ordnung der Märchenwelt ihm heilig sein muss. Was in der Märchensprache als feste Regel gilt, das muss das Märchen respektiren, so gleichgültig es sich übrigens den Gesetzen und Regeln der wirklichen Welt gegenüber verhalten mag. So geht es nicht an, dass das Märchen, wie Andersen »Die Dryade«, die Heldin von ihrem Baume trennt, sie symbolische Reisen nach Paris machen, auf den »bal Mabille« gehen lässt u. s. w.; denn es ist nicht unmöglicher für alle Könige der Erde, das kleinste Blatt an eine Nessel zu setzen, als es für das Märchen ist, eine Dryade von ihrem Baume los zu reissen. Aber in der Märchenform liegt zum zweiten, dass der Rahmen nichts in sich aufnehmen kann, was, um poetisch zu seinem Rechte zu gelangen, eine tiefe psychologische Schilderung, eine ernste dramatische oder romanmässige Entwicklung erforderte. Eine Frau wie jene Maria Grubbe, von deren interessantem Leben Andersen uns in der Geschichte vom »Hühner-Gretchen« eine Skizze gibt, ist zu sehr ein Charakter, als dass es einem Märchendichter möglich sein sollte, ihr Wesen zu schildern oder zu erklären; versucht er es, so empfindet man ein Missverhältnis zwischen dem Gegenstande und der Form. Ihr Leben hat später als historische Grundlage des glänzenden Romans »Frau Maria Grubbe« von J. P. Jacobsen gedient. Man darf sich indess weniger über diese einzelnen Flecken wundern, als vielmehr darüber, dass sie so äusserst selten vorkommen. Ich habe sie auch nur hervorgehoben, weil es interessant ist, durch die Ueberschreitung der Grenze letztere selbst kennen zu lernen, und weil es mir wichtig schien, zu ermitteln, wie das Flügelross des Märchens, bei all seiner Freiheit, den ganzen Kreis zu durchlaufen und zu durchfliegen, doch seinen festen Tüder im Centrum hat.
Seine Schönheit, seine Stärke, seine Flugkraft und Anmuth sieht man nicht, indem man auf seine Schranke achtet, sondern indem man seinen mannigfachen und kühnen Bewegungen innerhalb seines Kreises folgt. Hierauf wollen wir zum Schlusse einen Blick werfen. Die Märchen liegen vor uns wie eine grosse, reiche, blumenbesäete Flur. Lasst uns frei auf derselben umher schweifen, sie nach kreuz und quer durchwandern, bald hie, bald da ein Blümchen pflückend, uns erfreuend an seiner Farbe, seiner Schönheit, an dem Ganzen. Diese kleinen, kurzen Dichtungen stehen ja wirklich in demselben Verhältnisse zu den umfangreicheren Poesien, wie die kleinen Blumen zu den Bäumen des Waldes. Wer an einem schönen Tage zur Frühlingszeit nach einem seeländischen Walde hinaus spaziert, um die Buche in ihrer jungen Pracht mit den braunen Sammtknöpfen in der hellgrünen Seide zu sehen, der wendet, wenn er eine Zeitlang in die Höhe geblickt hat, seine Augen zur Erde hinab, und da zeigt sich, dass der Waldgrund eben so schön wie das Wipfeldach des Waldes ist. Hier wachsen in geringem Abstande buntfarbige Anemonen, weisse und dunkelrothe Maiblumen, gelbe Sternblümchen, rothe und blaue Nelkenwurz, Butterblumen und Steinbrech, Sternkraut, Dotterblumen und Löwenzahn. Nahe bei einander stehen die Knospe, die entfaltete Blume und die, welche schon Samen trägt, die jungfräuliche und die befruchtete Pflanze, die duftlosen und die wolriechenden Blumen, die giftigen und die nützlichen, die heilsamen Kräuter. Häufig ist die Pflanze, welche im Systeme den niedrigsten Platz einnimmt, wie das blüthenlose Farnkraut, für das Auge die schönste. Blumen, welche zusammengesetzt erscheinen, bestehen bei näherer Betrachtung aus ganz wenigen Blättern, und Pflanzen, deren Blüthe eine einzelne scheint, tragen auf ihrer Spitze einen ganzen Flor nur durch den Stengel vereinigter Blumen. So ist's auch mit den Märchen. Die, welche betreffs ihrer Würde am niedrigsten stehen, wie »Die Springer«, enthalten oft eine ganze Lebensphilosophie in kurzem Auszuge, und die, welche als einzeln erscheinen, wie »Die Galoschen des Glücks«, bestehen aus einer lose verbundenen Blüthendolde. Einige stehen in der Knospe, wie »Der Wassertropfen«, andere schiessen in Samen, wie »Das Judenmädchen« oder »Der Stein der Weisen«. Einige bestehen nur aus einem einzigen Punkte, wie »Die Prinzessin auf der Erbse«, andere haben grosse, edle Formen, wie die in Indien besonders beliebte »Geschichte einer Mutter«, welche einer fremden, südländischen Blume, der Kalla, gleicht, die in ihrer erhabenen Einfalt nur aus einem einzigen Blatte besteht.
Ich schlage das Buch aufs geradewohl auf, und mein Auge fällt auf »Erlenhügel«. Welches Leben und welche Laune: »In der Küche waren vollauf Frösche am Spiesse, Schneckenhäute mit Kinderfingerchen darin, und Salate von Pilzsamen, feuchten Mäuseschnauzen und Schierling, ... verrostete Nägel und Kirchenfensterglas gehörten zum Naschwerk.« Glaubt man, die Kinder seien hier vergessen? Keinesweges. »Der alte Erlenkönig liess seine Goldkrone mit gestossenem Schiefer poliren; es war Bank-Erster-Schiefer, und es ist für den Erlenkönig sehr schwer, Bank-Erster-Schiefer zu erhalten!« Glaubt man, hier sei nichts für die Erwachsenen? Noch mehr gefehlt! »O, wie sehne ich mich nach dem alten norwegischen Kobold! Die Knaben, sagt man, sollen etwas unartige, naseweise Jungen sein ... Sie gingen mit blosem Halse und ohne Tragbänder, denn sie waren Kraftmänner.« Welch ein Festgelag! Das Todtenpferd ist unter den Eingeladenen. Glaubt man, Andersen vergässe beim Gelage den Charakter des Gastes? »Nun mussten die Erlenmädchen tanzen, und zwar sowol einfach wie mit Stampfen, und das stand ihnen gut ... Der Tausend! wie sie die Beine ausstrecken konnten, man wusste nicht, was Ende und was Anfang, man wusste nicht, was Arme und was Beine waren; das ging alles durch einander wie Sägespäne; und dann schnurrten sie herum, dass dem Todtenpferde unwohl wurde und es von Tische gehen musste.« Andersen kennt das Nervensystem des Todtenpferdes und gedenkt seines schwachen Magens.
Er hat die echte Gabe, übernatürliche Wesen zu erschaffen, welche in der modernen Zeit so selten ist. Wie tief symbolisch und wie natürlich ist es z. B., dass die kleine Seejungfer, als ihr Schwanz zu »zwei niedlichen Beinen« eingeschrumpft ist, bei jedem Schritte, den sie macht, das Gefühl hat, als ob sie auf scharfe Messer und spitze Nadeln träte. Wie viele arme Frauen treten nicht bei jedem Schritt, den sie thun, auf scharfe Messer, um demjenigen nahe zu sein, den sie lieben, und sind doch noch lange nicht die unglücklichsten! – Welche herrlich gezeichnete Bande, jene Koboldschaar in der »Schneekönigin«, welches treffliche Sinnbild dieser Hexenspiegel, und welche tief empfundene Gestalt diese Königin selbst, die, mitten auf dem öden Schneefelde sitzend, alle kalte Schönheit desselben in sich eingesogen hat. Dies Weib ist gewissermassen verwandt mit der Nacht, einer der eigentümlichsten Gestalten Andersen's. Es ist nicht Thorvaldsen's milde, schlafbringende Nacht, nicht Carstens' ehrwürdige, mütterliche Nacht, sondern die schwarze, unheimliche, schlaflose und grausenvolle: »Draussen mitten im Schnee sass eine Frau in langen, schwarzen Gewändern, und sie sprach: ›Der Tod ist bei Dir in Deiner Stube gewesen, ich sah ihn mit Deinem kleinen Kinde davon eilen, er schreitet schneller als der Wind und bringt niemals zurück, was er genommen hat.› ›Sag mir blos, welchen Weg er gegangen ist!‹ sagte die Mutter; ›sag mir den Weg, und ich werde ihn finden.‹ ›Ich kenne ihn,‹ sagte die Frau in den schwarzen Gewändern; ›aber bevor ich ihn Dir sage, musst Du mir erst alle die Lieder vorsingen, die Du Deinem Kinde vorgesungen hast. Ich liebe diese Lieder, ich habe sie früher gehört; ich bin die Nacht und sah Deine Thränen, als Du sie sangst.‹ ›Ich will sie alle, alle singen!‹ sagte die Mutter; ›aber halte mich nicht auf, damit ich ihn einholen, damit ich mein Kind wiederfinden kann!‹ Aber die Nacht sass stumm und still. Da rang die Mutter ihre Hände, sang und weinte, und es gab viele Lieder, aber noch mehr Thränen.« Die Mutter geht weiter, weint sich die Augen aus, um für diesen Preis über den See zu gelangen, und gibt, um in das Treibhaus des Todes zu kommen, dem »alten grauen Weibe« ihr langes schwarzes Haar und erhält deren weisses dafür. – Wir treffen eine unzählbare Menge von Phantasiegeschöpfen, kleine elfenhafte Gottheiten wie Ole Lukoie (der Sandmann) oder die Kobolde mit den rothen Mützen, und die nordische Dryade, Fliedermütterchen. Man fühlt hier recht Andersen's Stärke, wenn man sie mit der Ohnmacht der zeitgenössischen dänischen Dichter in dieser Hinsicht vergleicht. Was für blasse Gestalten sind nicht Heiberg's Pomona, Asträa oder Fata Morgana! Andersen gibt selbst dem Schatten einen Körper. Was sagt der Schatten? Was sagt er zu seinem Herrn? » Ich bin von Kindesbeinen an in Ihre Fusstapfen getreten.« Das ist wahr. » Wir sind ja von Kind an mit einander aufgewachsen.« Das ist nicht minder wahr. Und als er sich nach seinem Besuche empfiehlt: » Adieu! Hier ist meine Karte, ich wohne auf der Sonnenseite und bin bei Regenwetter stets zu Hause« Hier, wie überall, hat der Dichter seinen treuen Verbündeten in der Sprache, in den Wortspielen, die ihm unter der Feder hervor tanzen, sobald er sie aufs Papier wirft. Man sehe z. B., wie es in »Die alte Strassenlaterne« oder »Der Schneemann« von Wortspielen wimmelt. Man sehe, wie er die Lautsprache der Thiere benutzt, z. B.: »Quak!« sagte die kleine Kröte, und es war gerade, als wenn wir Menschen »Ach!« sagen.. Andersen kennt die Sehnsuchts-Qualen des Schattens, seine Gewohnheiten und seine Wollust: »Ich lief im Mondscheine auf der Strasse umher, ich reckte mich lang an der Mauer hinauf, das kitzelt so angenehm auf dem Rücken.« Dies Märchen vom Schatten, das keineswegs an Chamisso erinnert, ist eine kleine Welt für sich. Ich nehme keinen Anstand, es eins der grössten Meisterwerke in der dänischen Literatur zu nennen. Es ist die Epopöe aller Schatten, aller Menschen aus zweiter Hand, aller unoriginellen, unurspringlichen Geister, aller derjenigen, welche wähnen, dass sie durch die blose Emancipation von ihrem Originale Persönlichkeit, Selbstständigkeit und wirkliches, echtes Menschendasein erlangen. Es ist auch eins der wenigen, wo der Dichter trotz seines weichherzigen Optimismus gewagt hat, die schreckliche Wahrheit in ihrer ganzen Nacktheit hervor treten zu lassen. Der Schatten beschliesst, um sich vor allen Enthüllungen betreffs seiner Vergangenheit zu sichern, dem Menschen das Leben zu nehmen: »›Der arme Schatten!‹ (d. h. der Mensch) sagte die Prinzessin; ›er ist sehr unglücklich, es wäre eine wahre Wohlthat, ihn von dem bischen Leben zu befreien, und wenn ich recht darüber nachdenke, so scheint es mir nöthig zu sein, dass man ihn in aller Stille bei Seite schaffe.‹ ›Das ist allerdings hart, denn er war ein treuer Diener,‹ sagte der Schatten, und er that, als wenn er seufzte. › Du bist ein edler Charakter!‹ sagte die Königstochter.« Dies Märchen ist endlich eins von denen, wo man am leichtesten den Uebergang vom Natürlichen zum Uebernatürlichen beobachten kann: der Schatten reckt und streckt sich solange, »um zu Kräften zu kommen«, bis es ganz natürlich ist, dass er sich zuletzt los reisst.
Wir schlagen das Buch zu und öffnen es an einer anderen Stelle. Da stossen wir auf »Die Springer«. Eine kurze und bündige Belehrung über das Leben. Die Hauptpersonen sind der Floh, der Heuschreck und der Hüpfauf aus dem Gänsebrustknochen; die Königstochter ist der Preis für den besten Sprung. »Merkt's euch Alle,« sagte die Muse des Märchens. »Springt mit Verstand! Es frommt nicht, so hoch zu springen, dass Niemand euch sehen kann; dann behauptet der Pöbel, es sei so gut, als wäret ihr gar nicht gesprungen. Seht nur auf all' die grössten Geister, Denker, Dichter und Männer der Wissenschaft. Für die Menge ist es, als hätten sie gar keinen Sprung gethan, sie ernteten keinen Lohn, ein Körper gehört dazu! Es frommt auch nicht, hoch und gut zu springen, wenn man den Machthabern ins Gesicht springt. Auf die Art macht man fürwahr keine Karriere. Nein, nimmt den Hüpfauf zum Vorbild! Der ist fast apoplektisch, zuerst hat es den Anschein, als könne er gar nicht springen, und viele Bewegungen kann er gewiss auch nicht machen; aber dennoch macht er – mit dem Instinkte der Dummheit, mit der Geschicklichkeit der Trägheit – einen kleinen schiefen Sprung gerade in den Schooss der Prinzessin. Nehmt euch ein Exempel dran, er hat gezeigt, dass er Kopf hat!« Welch' eine Perle von Märchen! und welche Gabe, die Thiere psychologisch zu benutzen! Es lässt sich nämlich nicht leugnen, dass man zuweilen fast in Zweifel ist, was der ganze Einfall, die Thiere reden zu lassen, im Grunde zu bedeuten hat. Eins ist es ja, ob wir Leser uns getroffen fühlen, ein Anderes, ob auch der Charakter des Thieres wirklich getroffen ist, des Thieres, das nicht eine einzige menschliche Eigenschaft hat. Man wird indess leicht einsehen, dass es unmöglich ist von dem Thiere, selbst rein wissenschaftlich, zu reden, ohne ihm Eigenschaften beizulegen, die wir von uns selber her kennen. Wie soll man es z. B. vermeiden, den Wolf grausam zu nennen? Andersen's Geschicklichkeit besteht nun darin, eine poetische, eine schlagende Scheinübereinstimmung zwischen dem Thiere und seiner menschlichen Eigenschaft hervor zu bringen. Ist es nicht richtig, dass die Katze zu Rudy sagt: »Komm nur mit hinaus auf's Dach, kleiner Rudy! Was die Leute vom Herunterfallen reden, ist eitel Einbildung: man fällt nicht, wenn man sich nicht davor fürchtet. Komm nur, setze Deine eine Pfote so, die andere so! fühle vor mit den Vorderpfoten! Musst Augen im Kopfe und geschmeidige Glieder haben! Kommt irgend 'ne Kluft, so springe nur und halte Dich fest, so mach' ich's!« Ist es nicht natürlich, dass die alte Schnecke sagt: »Das hat doch auch gar keine Eile, Aber Du eilst immer so sehr, und der Kleine fängt das nun auch schon an. Kriecht er nicht bereits seit drei Tagen an dem Stengel hinauf! Ich bekomme wirklich Kopfweh, wenn ich zu ihm emporblicke.« Was schildert treffender eine Wochenstube, als die Ausbrütungsgeschichte des jungen Entleins! Was ist wahrscheinlicher, als dass die Sperlinge, wenn sie ihre Nachbarn ausschimpfen wollen, sagen: »Die dickköpfigen Rosen!« Man vergleiche des Gegensatzes halber die Art und Weise, wie Heiberg in »Weihnachtsspässe und Neujahrspossen« den Handschuh, das Busentuch, die Flasche reden lässt, ferner Alfred de Musset's » Le merle blanc« und Taine's »Vie et opinions philosophiques d'un chat« in seinem Werke »Voyage aux Pyrénées«.
Ein Märchen habe ich mir bis zuletzt aufgespart; jetzt suche ich dasselbe hervor, denn es ist gleichsam die Krone des Werkes. Es ist das Märchen von der »Glocke«, in welchem der Dichter der Naivetät und Natur den Höhepunkt seiner Poesie erreicht hat. Wir sahen sein Talent, das Uebermenschliche und das Untermenschliche natürlich zu schildern. In diesem Märchen steht er der Natur selber von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Dasselbe handelt von der unsichtbaren Glocke, welche zu suchen die jungen Konfirmanden ausgingen, – die Jünglinge, bei welchen die Sehnsucht nach dem unsichtbar Lockenden und Reizenden noch frisch war. Der Kaiser hatte versprochen, »dass der, welcher wirklich ausfindig machen könne, woher der Schall komme, den Titel eines ›Weltglöckners‹ haben solle, und das selbst dann, wenn es keine Glocke sei. Nun gingen Viele der guten Versorgung halber nach dem Walde; aber der Einzige, der mit einer Art Erklärung zurückkam, war, so wenig, wie die Andern, tief genug eingedrungen; er sagte jedoch dass der Glockenton von einer sehr grossen Eule in einem hohlen Baume herkomme; es sei eine Art Weisheitseule, die ihren Kopf fortwährend gegen den Baum stosse. Und so wurde er als Weltglöckner angestellt und schrieb jedes Jahr eine kleine Abhandlung über die Eule; man ward dadurch eben so klug, wie man vorher gewesen war.« Die Konfirmanden gehen also auch dieses Jahr hinaus, »und sie hielten einander bei den Händen, denn sie hatten ja noch keine Aemter erhalten«. Allein bald ermüden sie, Einer nach dem Andern, und kehren um, dieser aus dem einen Grunde, jener aus einem anderen Vorwande. Eine ganze Klasse bleibt bei einer kleinen Glocke auf einem idyllischen Häuschen stehen, ohne, wie die wenigen Ausharrenden, zu bedenken, dass eine so kleine Glocke nicht das anziehende Glockenspiel verursachen könne, sondern »dass es ganz andere Töne sein müssten, die ein Menschenherz so rührten«, und sie begeben sich mit ihrer kleinen Hoffnung, ihrer kleinen Sehnsucht zur Ruhe bei dem kleinen Funde, dem kleinen Glücke, der kleinen idyllischen Freude. Ich denke mir, der Leser ist einigen dieser Konfirmanden als Erwachsenen schon begegnet. Zuletzt sind nur noch Zwei übrig, ein Königssohn und ein armer kleiner Knabe in Holzschuhen »und mit einer so kurzen Jacke, dass man recht sehen konnte, wie lange Handgelenke er habe«. Unterwegs trennen sie sich; denn der eine wollte die Glocke zur Rechten, der andere zur Linken suchen. Der Königssohn suchte die Glocke auf dem Wege, der »auf der Seite des Herzens« lag, der arme Knabe suchte sie in der entgegengesetzten Richtung. Wir folgen dem Königssohne, und wir lesen mit Bewunderung, welche mystische Pracht der Dichter der Gegend zu geben weiss, indem er die natürlichen Farben der Blumen verändert und vertauscht. »Aber er ging unverdrossen tiefer und tiefer in den Wald, wo die wunderbarsten Blumen wuchsen; da standen weisse Sternlilien mit blutrothen Staubfäden, himmelblaue Tulpen, die im Winde funkelten, und Apfelbäume, deren Aepfel wie grosse, glänzende Seifenblasen aussahen; denkt nur, wie die Bäume im Sonnenschein strahlen mussten!« Die Sonne geht unter, der Königssohn fürchtet schon, von der Nacht überrascht zu werden; er steigt auf die Felsen hinauf, um die Sonne noch einmal zu sehen, ehe sie ganz am Horizonte versinkt. Man höre den Hymnus des Dichters:
»Und er ergriff Ranken und Wurzeln und kletterte an den nassen Steinen empor, wo die Wasserschlangen sich wanden, wo die Kröte ihn gleichsam anbellte; – aber hinauf kam er, bevor die Sonne, von dieser Höhe gesehen, ganz untergegangen war. O, welche Pracht! Das Meer, das grosse, herrliche Meer, das seine langen Wogen gegen die Küste wälzte, streckte sich vor ihm aus, und die Sonne stand wie ein grosser, glänzender Altar da draussen, wo Meer und Himmel sich begegneten; Alles verschmolz in glühenden Farben; der Wald sang und das Meer sang und sein Herz sang mit. Die ganze Natur war eine grosse, heilige Kirche, worin Bäume und schwebende Wolken die Pfeiler, Blumen und Gras die gewebte Sammetdecke, und der Himmel selbst die grosse Kuppel bildeten; dort oben erloschen die rothen Farben, indem die Sonne verschwand; aber Millionen Sterne wurden angezündet, Millionen Diamantlampen erglänzten, und der Königssohn breitete seine Arme aus gegen den Himmel, gegen das Meer und den Wald – und im selben Augenblicke kam, von dem rechten Seitenwege, der arme Konfirmand mit der kurzärmeligen Jacke und den Holzschuhen; er war hier eben so zeitig angelangt, er war auf seinem Wege dahin gekommen. Und sie liefen einander entgegen und fassten einander an der Hand in der grossen Kirche der Natur und der Poesie. Und über ihnen ertönte die unsichtbare, heilige Glocke; selige Geister umschwebten sie im Tanze zu einem heiligen Hallelujah!«
Das Genie gleicht dem reichen Königssohne, sein aufmerksamer Zuhörer dem armen Knaben; aber Kunst und Wissenschaft begegnen sich, obschon sie sich unterwegs trennen, in der Begeisterung und der Andacht gegenüber dem göttlichen All der Natur.