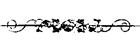|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wenn nach langen Winterstürmen endlich der Frühlingshimmel durch die noch dürftig belaubten Bäume schimmert, muß ich, wo ich auch immer sei, des Erwachens der Natur gedenken, wie sie es in den Felsen und Wäldern meiner kleinen Heimath feiert. Da war unterhalb des alten Hohensteiner Schlosses, an der halbverfallenen Mauer des ehemaligen Bärengartens, ein köstlicher Buchenhain, – schützt ihn, o Dryaden, vor der fällenden Axt, – auf dessen Entwickelungsphasen man von oben, vom Schlosse, herab, mit wahrem Vergnügen schaute. Erst streckten die stolzen hochstämmigen Buchen die Arme ihrer Aeste und Zweige kahl und gleich wie um die Frühlingssonne flehend, zum Himmel empor. Aber kaum hatte sie ihnen einige Tage lang huldvoll gelächelt – welche Verwandlung! Mit tausend und aber tausend zarten grünen Fingerspitzen zeigten sie da schon auf den alles belebenden Feuerball hinauf. Zu ihren Füßen liegt eine dichte braune Laubdecke, im verflossenen Jahre die Zierde des Waldes. Aber auch unter der unscheinbaren Hülle, die an Tod und Verwesung erinnert, schaut Leben aus freundlichen blauen Blumenaugen hervor. Es sind die zahlreichen blauen Leberblumen, welche überall die braune schützende Winterdecke erheben und, ohne erst die Vorboten einiger Blätter nach der Temperatur fragen zu lassen, gleich selbst neugierig hervorschauen, als wollten sie sobald als möglich im Klaren sein, ob da oben auf der Erde auch noch Alles hübsch beim Alten geblieben sei. An den Felsen schweben in einigen Eiszacken die letzten architectonischen Zierrathen vom Palaste seiner Majestät des Winters. Die Thränen, welche diese Uebriggebliebenen ihrer eigenen Zerstörung weihen und welche ihnen die Sonne auspreßt, erfrischen schon überall die grüne, von Felsen und Abhängen herabflatternde Siegesfahne des Lenzes und machen den Sturzbach, der durch das enge Thal braust und die Wurzeln der stolzen Buchen tränkt, noch eins so übermüthig. Wenn aber Pfingsten herannahet, hat der Buchenhain die schönste Verwandlung erfahren. Dann bildet er eine hellgrüne dichte Kuppel, an welcher man die Aeste, die stämmigen Schwibbogen derselben, vor Blätterornamenten kaum noch gewahren kann. Ach, es ist schön, dort auf einem moosbedeckten Felsen zu liegen und das sanfte Zittern in dieser lebendigen Wölbung zu beobachten, zu welchem der bald brausende und schäumende, bald tief gurgelnde Bach den dämonischen Gegensatz bildet. Zu Pfingsten umgiebt sich auch das alte Hohnsteiner Schloß mit einem festlichen Kranze blauen und weißen Flieders, der theils in den Schloßgärten wächst, theils von dort aus seine eigenen Wurzelwege gegangen ist und nun aus Felsenspalten üppig hervorwuchert, seine lieblichen Bouquets über dem Abgrunde wiegend. Nun kommen die Schweizbereiser von Nah und Fern und nicht ohne Interesse betrachten sie die eigenthümliche, ja romantische Lage unseres Bergstädtchens, wenn sie auch dessen verborgene Naturschönheiten nicht kennen lernen, auf die ich später zurückkomme.
Am ersten Pfingstmorgen halten sie oft in ganzen Schaaren, während die Glocken zur Andacht ins Gotteshaus rufen, ihren Einzug ins Städtchen. Bunte Taschentücher wehen wie Fahnen von ihren Stöcken und Schirmen, Blumen und grüne Reiser schmücken Hut und Knopfloch; vom Hockstein herüber, jenseits des Polenzthales unterhalb Hohnstein, tönt lautes Rufen, bisweilen Schießen, um das Echo in den Thälern zu wecken, und am zweiten Feiertage – o Wonnetag für Alt und Jung in Hohnstein! – setzt noch obenein der altherkömmliche Schützenauszug alle Gemüther und Beine in Bewegung.
Der Ernst des ersten Festtages ist abgethan, der letzte Ton der Abendglocken, welche das Fest des heiligen Geistes ausläuteten, ist verklungen und ein anderer, zwar minder heiliger, aber doch auch keineswegs unheiliger Geist, zieht mit Musik und Trommelschall ein. Nein, er ist schon da! Die Königsteiner Musikanten, welche zu meiner Zeit zu den beiden alljährlich abzuhaltenden Scheibenschießen, dem Pfingst- und Augustschießen, nach Hohnstein gerufen wurden, harren schon auf den Schluß des kirchlichen Festtages, um mit einer Art Marcia das Städtchen zu durchziehen und dem vorjährigen Schützenkönige und den Civil- und geistlichen Behörden ein Ständchen zu dringen.
Ein friedlicher Leinweber und Forellenfänger und Händler warf sich damals, als ich so glücklich war, den Tönen dieses Ständchens vom väterlichen Garten aus zu lauschen, in die kriegerische Uniform, verließ den Schützen am Webstuhl, eilte behender, als an andern Tagen an die Abendglocken, denn er war zugleich Küster und Glöckner, seinen vierten oder fünften Beruf, den eines Regimentstambours bei der Schützengilde, auf das Würdevollste zu versehen. Mit einer gebieterischen Bewegung seines Stabes commandirte und verkürzte er die diversen Polkas, Galoppaden und Walzer, die als Ständchenmusik ausgeführt wurden und ließ sich von der staunenden Jugend des Orts herablassend begaffen, die sich gleich einem Cometenschweife an den Kern der Musikbande angeschlossen hatte und kaum mit dem letzten Tone derselben von ihr zu trennen war.
Ganz besondere Hochachtung erregte immer die Handhabung der großen Trommel, und war damals ein musikalischer Posamentier Hohnsteins so freundlich, sein musikalisches Talent für dieses Instrument auszubilden und der Schützengilde die Beschaffung eines Musikanten mehr zu ersparen. Ich erinnere mich deutlich der Ehrfurcht, mit welcher ich zu seiner Kunst aufblickte. Es war für mich immer etwas Wunderbares, daß, je sanfter oder träumerischer das Auge des Mannes blickte, desto energischer seine Donnerschläge auf das Kalb- oder Eselsfell der Trommel ausfielen, womit er die Musikstücke würzte. Ich glaube, er führte sie nicht nach Noten, sondern sein richtiges Gefühl und langjährige Uebung schienen ihm zuzuflüstern, welche Stelle für einen oder für mehrere Schläge die passendste sei.
Am zweiten Pfingstmorgen rasselt gegen 4 oder 5 Uhr schon die Trommel durch das Städtchen und die Schützen, von welchen sich vielleicht Mancher im Traume bereits zum Könige geschossen hat, erwachen zum großen Festtage. Man wirft sich in den militärischen Glanz, wobei die schneeweißen Inexpressibles, welche in der Woche vorher in Grasgärten und auf Wiesen die Weihe einer tüchtigen Sommerbleiche erhalten haben, ein ehrendes Zeugniß für die Sauberkeit und Accuratesse der betreffenden Hausfrauen ablegen. Das Costüm der Schützen besteht zum Theil aus dunkelblauen, zum Theil aus dunkelgrünen Tuchröcken und dreieckigen Hüten mit großen Hahnfederbüschen. Die dunkelblauen haben rothe, die grünen weiße Aufschläge. Böllerschüsse, denen ein anhaltendes Echo folgt, verkünden gegen 1 Uhr des Mittags, daß der Auszug beginnt. Der schräge Marktplatz ist mit Menschen gefüllt, die Schützen stehen in Gruppen und immer mehr eilen auf den Ruf der Trommel herbei. Um den schlichten steinernen Wassertrog in der Mitte des Marktes hat sich ein Knäul von Menschen gebildet, Kinder hocken auf dem Rande des Troges, halten die Händchen oder auch gleich die Münder unter den aus einer hölzernen Röhre hervorsprudelnden Strahl und laben sich, denn das Wetter ist schön und die Hitze groß. Schweizbereisende zögern, den Ort zu verlassen und wünschen, den Verlauf des gemüthlichen Volksfestes kennen zu lernen; vor allen Hausthüren, die der Pfingstsitte gemäß mit zwei Maien geziert sind, stehen weißgekleidete jüngere und ältere Mädchen. Bänder flattern, das Neueste und Beste schmückt die glücklichen Trägerinnen, die sich von Fremden und Einheimischen bewundern lassen und von Bekannten zu Bekannten, von Hausthür zu Hausthür trippeln. Die wohlhabenden Landleute, deren Kutschen vor den zwei Gasthöfen am Marktplatze und der Menge oft sehr im Wege stehen, sind nach Beendigung des Gottesdienstes, zu dem sie am Morgen im Städtchen erschienen waren, dageblieben, um den Schützenauszug mit anzusehen. Ihre bunten Anzüge, blumige Kleiderstoffe, Hauben mit vielen Blumen und leuchtenden Bändern, schimmern im Sonnenglanze und erinnern an die jetzt im schönsten Flore stehenden Wiesen, mit denen ihre Besitzerinnen zu wetteifern scheinen.
Und siehe, es naht der Augenblick, welcher sehnlichst erwartet wurde. Die Schützen stellen sich in Reihe und Glied, die Officiere commandiren, die Musik ertönt, denn der verwandelte Küster und erlöste Glöckner hat den Stab geschwungen, die Sappeurs mit Bärenmützen, Schurzfellen und Beilen haben ihren Platz eingenommen, hüten sich aber wohl, die alten Hohnsteiner Gartenzäune, Planken, Gänseställe und Holzschuppen baufälligster Art zu zerstören, die ihren Beilen Arbeit die Fülle bieten würden. Hierauf begiebt sich eine Deputation von schwarzgekleideten Bürgern mit dem Fahnenträger zum dermaligen bestallten Aufbewahrer der altehrwürdigen Fahne. Mit der Fahne geht es dann zum vorjährigen Schützenkönige: man holt ihn feierlichst ab, er tritt, umgeben von den vorerwähnten Bürgern, in den Zug ein. Die Fahne wird vorausgetragen und flattert lustig im Winde. Er selbst, der Schützenkönig, dem vor einem Jahre »der große Wurf gelungen«, trägt eine aus großen silbernen und vergoldeten Schaustücken und Denkmünzen zusammengesetzte Kette auf seiner schwarzen Kleidung und hat die Verpflichtung, sein königliches Haupt ungeachtet der großen Hitze, unbedeckt zu tragen. Dasselbe thun die ihn begleitenden Herren im Frack. Obgleich der total schräge Markt kein günstiges Terrain für militärische Evolutionen bietet, marschirt man ihn doch einige Male auf und nieder; die Officiere commandiren flott, die Schützen machen ihre Schwenkungen, Kinder schließen sich bisweilen aus dem Stegreife vertraulich an den Vater, Flügelmann, an, Frauen blicken stolz auf den Gatten, der heute martialisch den Säbel schwingt und vergessen um seiner heutigen Schönheit willen, daß er zu Hause bisweilen weniger liebenswürdig etwas Anderes in bedrohlicher Weise zu schwingen pflegt – oder auch über seinem eigenen Haupte etwas wiederum ganz Verschiedenes von sogenannten schönen Händen schwingen läßt. –
Auf krummen, bergigen und engen Straßen erreicht man die Höhe, auf welcher das Schießhaus liegt. Der schräge Vorplatz ist mit Buden zum Würfeln – bedeckt, konnte man zu meiner Zeit nicht sagen, denn es waren nur drei oder vier vorhanden. Auch einige Hökerweiber hatten sich mit bescheidenen materiellen Genüssen eingefunden und boten sie um schweres Geld feil. Hier auf diesem Platze tummelt sich die zartere Jugend und achtet nicht der köstlichen Aussicht auf Berge, Wälder und Felsen, welche sich von diesem Höhepunkte aus dem umherschweifenden Auge bietet. Dicht zu unsern Füßen liegt das Bergstädtchen; seine vielen Schindel- und wenigen Ziegeldächer bunt und kraus, hoch und niedrig, wie es die Lage der Häuser und ihre Höhe bedingt, durcheinander gewürfelt. Nirgends herrscht Regelmäßigkeit, überall Willkür. Der Berg war der tyrannische Baucommissar, dem alle sonst befolgten Regeln zum Opfer fallen mußten.
Ob auch die Hitze oft groß ist, wogt oben im Saale des Schießhauses, das vor ungefähr 8 Jahren einen Neubau erfuhr, doch die tanzlustige Jugend nach dem Takte der Musik rastlos auf und nieder. Auch ältere Männer und Frauen »riskiren heute noch einen« – nämlich einen Tanz, wie man sich auszudrücken pflegt. Dazu wird das übliche Freibier getrunken, ein gutes einfaches Braunbier, welches die Stadt an diesen Festtagen schenkt und wo die sämmtlichen Familien und Gäste der Schützen den braunen Trank aus den länglich-hohen Gläsern mit großem Behagen schlürfen. Da sieht man nun wohl einen solchen guten Schützenvater stehen, das hohe, mit rothgemalter Nummer versehene Glas in der einen Hand, in der andern eine Festtagscigarre und vor ihm harren, wie die Orgelpfeifen aufgepflanzt, die Seinen, an der Spitze die Mutter, auf den Göttertrank, und mit freundlichem Lächeln reicht er ihnen das Glas und spricht ihnen zu, sich ja nicht zu geniren, »denn es koste ja heute nichts«, und sie thun, was sie nur können und trinken wacker, als gälte es den Durst bis zum nächsten Augustschießen zu löschen.
Dieses höchst gemächliche Volksfest dauert gewöhnlich bis den sogenannten dritten Feiertag Abends wo unterdessen der neue König fertig geworden ist, der auf eben dieselbe Weise im Triumphe in die Stadt herein geführt wird, wie man den frühern hinaus auf's Schießhaus führte. Auch am ersten Auszugstage halten die Schützen Abends einen feierlichen Wiedereinzug in die Stadt, wo, von Kühle und Schatten begünstigt, das Vergnügen der Zuschauer und Theilnehmer noch gesteigert wird.
Von vielen Seiten hört man zwar sagen: »Wozu diese Spielerei aus frühern Jahrhunderten beibehalten? Die Bürger brauchen sich nicht mehr im Gebrauche der Waffen zu üben, um die Feinde von den Mauern ihrer Städte zu treiben, wie einst.« – Ganz recht, allein, wenn ein Volksfest seinem einfachen harmlosen Charakter so treu bleibt, wie das Hohnsteiner Scheibenschützenfest bisher that, so läßt sich gegen die Beibehaltung des alten Brauches, der die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft, kaum etwas einwenden. Wer in's Schwarze getroffen hat oder zunächst demselben, hängt die Scheibe als Trophäe in seinem Hausflur auf und Kinder und Kindeskinder erinnern sich gern und freudig des Festtages, wo Vater oder Großvater als »Könige« heimgeführt wurden.
Ich kehre in den Buchenhain unterhalb des Hohnsteiner Schlosses zurück, um von dort aus den Fremdling im Geiste an einen meiner Lieblingsplätze zu führen, welcher keinem Reisenden bekannt wird, und der doch des eigenthümlichen Reizes so viel enthält. Oberhalb meines Standortes thürmen sich die Felsenmassen auf, welche ihrer runden breitgedrückten Form den Namen »Großkäs« zu danken haben, den ihnen der Mund des Volkes seit langen Jahren verliehen hat. Folgt man aber links einem, das vorerwähnte übermüthige Bächlein speisenden, meist nur im Frühjahr vorhandenen kleinen Gewässer, welches aus einer schmalen Thalschlucht herabstürzt, einige Zeit lang aufwärts, und wendet sich dann rechts auf einen allerdings wenig betretenen, zwischen hohen Heidelbeerbüschen und an schroffen Felswänden hinführenden Waldpfad, so erreicht man in kurzer Zeit eine großartige Höhle, wie man sich die Wolfsschlucht im »Freischütz« nicht wildromantischer vorstellen kann. Sie trägt den unpoetischen Namen »Das kalte Loch« – denn der Volksmund sucht meist nur nach treffenden, seltener nach wohlklingenden Benennungen – und ist allerdings nicht ohne einige Schwierigkeiten zu betreten. »Das kalte Loch«, in welchem selbst bei drückender Hitze eine erquickende Kühle, fast Kälte herrscht, bildet den Mittelpunkt einer Felsenbucht, welche sich dem Hocksteine schräg gegenüber befindet. Am Eingange in diese Felsenbucht senkt sich das Terrain jäh abwärts und der Fuß hat kaum Raum genug, um dicht an den hohen Felsenmauern hin den Mittelpunkt derselben zu erreichen. Der Waldpfad verliert sich im Gestrüpp und um zum Ziele zu gelangen, sieht man sich gezwungen, bald ab-, bald aufwärts zwischen Felsblöcken, jungen Fichten und andern Gesträuchen umherzuklettern. Doch wer überwindet nicht gern, wenn er einmal ein Freund verborgener Naturschönheiten ist, eine kleine Schwierigkeit! Endlich steht man vor der großen dunkeln Höhle. Der obere Theil ihres ungeheuren Rachens springt weit vor und bildet ein großes Steindach, unter welchem, wie von Riesenhand durcheinander gewürfelt, Massen von Felsblöcken jeder Form liegen. In der Entfernung scheinen sie klein, aber je mehr man sich ihnen nähert, wachsen sie und steht man neben ihnen, so findet man, daß es Mühe kosten würde, die größten zu erklettern. Der untere Theil des Höhlengrundes senkt sich schräg hinab, als sei er jeden Augenblick bereit, die Felsblöcke aus seinem Schooße in die zu Thal führende Schlucht hinabzuschütteln. Ein mächtiger grauer Staub mit Sand vermischt, in welchem der Fuß versinkt, bedeckt den Boden; denn nie dringt Feuchtigkeit in den Hintergrund der tiefen Höhle. Mit einer graugelblichen, verwitterten Erd- und Flechtenkruste, die sich sehr leicht wie eine Haut ablösen läßt, sind die Felsblöcke bedeckt und oben über den weitklaffenden Oberkiefer der Höhle herab wagt nur im Frühlinge eine kleine Cascade den kecken Sprung in die Schlucht unterhalb, aus welcher dunkle Fichten emporragen und wo köstliche Farrenkräuter im kühlen Schatten der Felsen und Nadelhölzer ihre frischen hellgrünen Palmenfächer üppig ausbreiten. Steht man in der Mitte der Höhle, so erscheint der blaue Himmel wie ein ausgespanntes köstliches Zeltdach, welches die zur Rechten und Linken fortlaufenden Felsenmauern stützen, auf deren zerklüfteter Oberfläche sich kleinere und größere Bäume in gewagten halsbrechenden Stellungen und Lagen, wie sie das ungünstige karge Terrain dort oben gebieten mag, abzeichnen. Aber einmal eingedrungen in die wohlbekannten theuern Regionen der felsigen Heimath, muß ich dich, Fremdling, auch noch an einen zweiten, erst vor wenigen Jahren aufgefundenen einsamen Platz führen, der seinen Namen von der großen Aehnlichkeit zwischen ihm und dem berühmten Kuhstalle in der sächsischen Schweiz erhalten hat, er heißt der »kleine Kuhstall« und ist von Hohnstein aus in einer halben Stunde zu erreichen. Nachdem wir auf einem breiten angenehmen Fahrwege, der nach dem bekannten »Brande« führt, auf der Höhe gegenüber vom Schlosse Hohnstein angelangt sind, betreten wir einen rechts ablenkenden Waldweg, der zu einem Steinbruche leitet. Von hieraus, wo der Fahrweg aufhört, führt ein Waldpfad zwischen Felsenburgen von seltsamen grotesken Formen, denen man die neptunische Bildung deutlich ansieht, zu dem Felsenthore des »kleinen Kuhstalles«, welches wir zwar gebückt durchschreiten müssen, das uns aber auf der andern Seite in seinem Felsenrahmen ein Bild vorführt, wie die sächsische Schweiz deren wenige mehr in so lieblicher Begrenzung und mit so reichem Vordergrunde aufzuweisen hat. Zu unsern Füßen breitet sich eine tiefe weite Schlucht aus; doch hat sie nichts Furchtbares, denn ein schöner Wald erfüllt sie, einige Felsblöcke ragen aus ihm empor und lockige Birken haben, als ob sie nach Auszeichnung strebten, sich keck auf der moosigen Oberfläche aufgepflanzt. Diese weite Schlucht, welche sich wie die Hälfte eines Trichters zur Tiefe senkt, ist oben von noch mehr Laubhölzern umgeben. Eine natürliche Allee von weißstämmigen Birken, kleinen Buchen und Eibischbäumen begränzt sie. Unten im Thale rauscht der Bach, die Polenz, durch frische duftige Wiesen, jenseits erheben sich wieder steile Abhänge mit Felsen wunderlicher Form gekrönt und darüber hinschweifend erblickt das Auge den mächtigen Lilienstein, als sei er gerade zwischen die beiden auslaufenden Thalmauern hineingepflanzt worden und als könne man ihn von hier aus über Schluchten, Thäler und Felsen hinweg, spielend erreichen. Noch andere isolirte Felskegel und bewaldete Berge zeigen sich zu beiden Seiten, aber nur bruchstückweise, denn das begränzte Bild scheint sich zum alleinigen, eines Malers würdigen Vorwurfe, den Lilienstein in seiner ganzen Schönheit genommen zu haben.
Der sonnige Platz vor dem Felsenthore, wo die Natur aus eigenem Antriebe reinliche Steinbänke gebaut hat, ist äußerst anmuthig und von einer hohen Birke zum Theile beschattet. Haidekraut drängt sich überall in prächtigen Büschen hervor, Corallenmoos ziert den rauhen Stein wie mit kleinen Blutstropfen und im Herbste ist hier eine reichliche Ernte an Preiselbeeren zu halten, die den Waldboden roth schimmernd bedecken. Seitwärts vom Felsenthore ist noch ein freundliches Plätzchen durch die Vorsorge des nun verstorbenen wackern Oberförsters Zschachlitz in Hohnstein entstanden. Er, welcher der eigentliche Entdecker des zauberhaft schönen Ortes ist, ließ vom Steinbruche aus, den ich vorhin erwähnte, zuerst den Waldweg dahin bahnen, der vorher nicht existirte; er ließ diejenigen Bäume wegschlagen, welche die liebliche Aussicht hinderten und Felsen sprengen, um eine Art Tisch und mehrere Sitze von weniger natürlicher Form als die Steinbänke herzustellen. Hier versammelten sich früher kleine Gesellschaften von Freunden, kochten auf einem improvisirten Felsenheerde Kaffee, wozu sie das Geräth und Material mitgebracht hatten und verlebten in heiterm Geplauder und im Anschaun der reizenden Natur einen vergnügten Nachmittag. Vor einem Jahre sehnte ich mich, das liebliche Plätzchen wieder zu sehn; es war schön und zauberhaft, einsam wie früher, aber die Bäume, besonders die Birken waren so hoch aufgeschossen, daß ihre Wipfel sich schon hie und da in den Rahmen der Fernsicht drängten.