
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
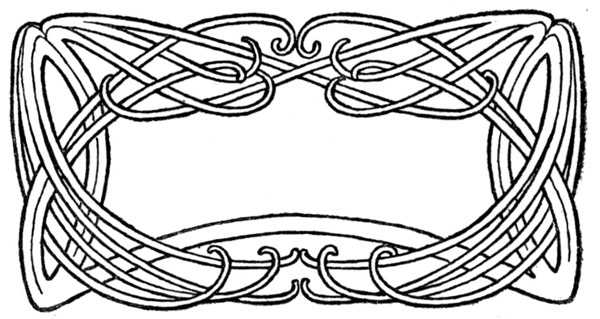
 Ich spreche im Namen derer, die nicht an das Dasein eines einzigen, allmächtigen und unfehlbaren Gottes glauben, der Tag und Nacht über unsere Gedanken, Worte und Thaten wacht, der die Gerechtigkeit auf Erden erhält und sie in einer anderen Welt weiter fortsetzt. Wenn es aber keinen Richter giebt, giebt es dann wenigstens eine Gerechtigkeit über der von den Menschen geübten, die sich nicht nur in ihren Gesetzen und Gerichten, sondern auch in allen, dem jeweiligen Richterspruch nicht unterstehenden sozialen Beziehungen kundgiebt und gewöhnlich nur durch die öffentliche Meinung, das Vertrauen oder Misstrauen, die Billigung oder Missbilligung unserer Mitmenschen geheiligt wird? Lassen sich die dem Menschen oft so unerklärlichen Akte der Moral des Weltalls, die ihn gewissermassen nötigen, an das Dasein eines Weltenrichters zu glauben, auf die soziale Gerechtigkeit zurückführen und durch
sie erklären? Wenn wir unseren Nächsten getäuscht oder bezwungen haben, haben wir damit auch alle Kräfte der Gerechtigkeit getäuscht und bezwungen? Ist die Weltgeschichte das Weltgericht, und haben wir nichts weiter zu fürchten, oder giebt es noch eine tiefere und dem Irrtum minder unterworfene Gerechtigkeit, die zwar weniger sichtbar, aber allgemeiner, mächtiger und durchgreifender ist?
Ich spreche im Namen derer, die nicht an das Dasein eines einzigen, allmächtigen und unfehlbaren Gottes glauben, der Tag und Nacht über unsere Gedanken, Worte und Thaten wacht, der die Gerechtigkeit auf Erden erhält und sie in einer anderen Welt weiter fortsetzt. Wenn es aber keinen Richter giebt, giebt es dann wenigstens eine Gerechtigkeit über der von den Menschen geübten, die sich nicht nur in ihren Gesetzen und Gerichten, sondern auch in allen, dem jeweiligen Richterspruch nicht unterstehenden sozialen Beziehungen kundgiebt und gewöhnlich nur durch die öffentliche Meinung, das Vertrauen oder Misstrauen, die Billigung oder Missbilligung unserer Mitmenschen geheiligt wird? Lassen sich die dem Menschen oft so unerklärlichen Akte der Moral des Weltalls, die ihn gewissermassen nötigen, an das Dasein eines Weltenrichters zu glauben, auf die soziale Gerechtigkeit zurückführen und durch
sie erklären? Wenn wir unseren Nächsten getäuscht oder bezwungen haben, haben wir damit auch alle Kräfte der Gerechtigkeit getäuscht und bezwungen? Ist die Weltgeschichte das Weltgericht, und haben wir nichts weiter zu fürchten, oder giebt es noch eine tiefere und dem Irrtum minder unterworfene Gerechtigkeit, die zwar weniger sichtbar, aber allgemeiner, mächtiger und durchgreifender ist?
Wer wollte leugnen, dass es eine solche giebt, und wer fühlt nicht, dass sie unwiderstehlich ist, dass sie das ganze menschliche Dasein umspannt und von einer Weisheit ist, die sich nie irrt noch irreführen lässt. Aber wo sollen wir diese Gerechtigkeit annehmen, seit wir sie aus dem Himmel vertrieben haben? Wo findet sie sich, wo waltet sie? Es sind dies Fragen, die wir uns nicht oft stellen; und doch sind sie von Belang, denn der Ort, an dem und von dem aus die Gerechtigkeit wirkt, wenn sie uns Strafe und Lohn zumisst, bedingt ihren Charakter und unsere gesamte Moral, und darum ist es vielleicht nicht unnütz, zu prüfen, wie es heute in den Köpfen und Herzen der Menschen um die grosse Idee der allmächtigen, mystischen Gerechtigkeit, die sich seit der geschichtlichen Aera schon so oft gewandelt hat, wirklich bestellt ist. Ist dieses Mysterium nicht ohnehin das höchste und erhebendste, das uns geblieben ist; steht es nicht in enger Beziehung zu den anderen, und werden wir durch seine Schwankungen nicht am tiefsten erschüttert? Möglich, dass die Mehrzahl der Menschen diese Schwankungen und Wandlungen nicht gewahr wird, aber das deutliche Bewusstsein ist in der Entwicklung des menschlichen Denkens keine unerlässliche Bedingung für Alle. Es genügt, wenn Einige sich einer stattgehabten Wandlung bewusst werden, damit die allgemeine Moral deren Wirkungen erfahre.
Die soziale Gerechtigkeit ist hierbei natürlich mit in Betracht zu ziehen, d. h. die Gerechtigkeit, die wir uns im Leben gegenseitig erweisen, aber wir verzichten auf Erörterung der gesetzlichen oder positiven Gerechtigkeit, welche nur die Organisation eines Teiles der sozialen Gerechtigkeit ist. Wir wollen uns in erster Linie mit jener unbestimmten, aber wirksamen, unfasslichen, aber doch unbestreitbaren Gerechtigkeit beschäftigen, die alle Handlungen unseres Lebens begleitet und durchdringt, billigt oder missbilligt, belohnt oder bestraft. Kommt sie von aussen? Giebt es unabhängig vom Menschen, im Weltall oder in den Dingen, ein unbeugsames, wachsames und untrügliches Moralprinzip? Giebt es, mit einem Wort, eine sozusagen mystische Gerechtigkeit? Oder auch: Geht diese Gerechtigkeit vom Menschen aus, ist sie ganz innerlich, auch wenn sie draussen wirkt; oder, um alles in ein anderes Wort zusammenzufassen: Giebt es nur eine psychologische Gerechtigkeit? Ich glaube, in den beiden Ausdrücken: mystische Gerechtigkeit und psychologische Gerechtigkeit sind die verschiedenen Gerechtigkeitsformen, die uns heutzutage noch über der sozialen Gerechtigkeit zu bestehen scheinen, sämtlich inbegriffen.
![]()
 Sobald der Mensch von den bequemen, aber künstlich erleuchteten Pfaden der positiven Religionen abkommt, kann er – so glaube ich – noch so sehr auf Illusionen und Mysterien aus sein; wenn er seine persönliche Erfahrung aufmerksam und aufrichtig befragt, kann er sich beim Anblick des äusseren Unglücks, das blindlings rings um ihn die Guten wie die Bösen schlägt, der Wahrheit nicht lange verschliessen, dass es in der Welt, in der wir leben, eine physische Gerechtigkeit, die moralische Ursachen hat, nicht giebt, mag diese Gerechtigkeit sich nun in Gestalt von Erblichkeit oder Krankheit, in Gestalt atmosphärischer oder geologischer Phänomene oder in irgend einer anderen vorstellbaren Form äussern. Weder der Himmel noch die Erde, weder die Natur noch die Materie, noch der Äther, noch irgend eine der uns bekannten Kräfte – ausser denen, die in uns sind – kümmern sich um die Gerechtigkeit oder stehen in einer Beziehung zu unserer Moral, unserem Denken und Wollen. Zwischen der äusseren Welt und unseren Handlungen giebt es nur einfache Beziehungen von Ursache und Wirkung, die völlig aussermoralisch sind, wenn der Ausdruck erlaubt ist. Wenn ich die und die Unklugheit, den und den Exzess begehe, laufe ich die und die Gefahr und bezahle der Natur die und die Schuld. Und da Exzess und Unbesonnenheit meist einen moralischen – oder besser: unmoralischen – Grund haben, so können wir es nicht lassen, zwischen der unmoralischen Ursache und der uns drohenden Gefahr oder
der zu büssenden Schuld einen Zusammenhang anzusetzen und jenes Vertrauen in die Gerechtigkeit des Weltalls, welche das am tiefsten wurzelnde Vorurteil des menschlichen Herzens ist, aufs Neue zu bestärken. Aber dabei verlieren wir aus den Augen, dass es genau ebenso gekommen wäre, wenn der Exzess oder die Unbesonnenheit einen unschuldigen oder heroischen Grund gehabt hätte. Wenn ich mich bei strenger Kälte ins Wasser werfe, um meinen Nächsten zu retten, oder wenn ich hineinfalle, während ich ihn hineinzuwerfen suche, so werden die Folgen der Erkältung in beiden Fällen die gleichen sein, und keine Macht im Himmel und auf Erden, ausser mir selbst und dem Menschen (wenn er es vermag), wird meine Leiden mehren, weil ich ein Verbrechen begangen, oder mir einen Schmerz abnehmen, weil ich eine tugendhafte That vollbracht habe.
Sobald der Mensch von den bequemen, aber künstlich erleuchteten Pfaden der positiven Religionen abkommt, kann er – so glaube ich – noch so sehr auf Illusionen und Mysterien aus sein; wenn er seine persönliche Erfahrung aufmerksam und aufrichtig befragt, kann er sich beim Anblick des äusseren Unglücks, das blindlings rings um ihn die Guten wie die Bösen schlägt, der Wahrheit nicht lange verschliessen, dass es in der Welt, in der wir leben, eine physische Gerechtigkeit, die moralische Ursachen hat, nicht giebt, mag diese Gerechtigkeit sich nun in Gestalt von Erblichkeit oder Krankheit, in Gestalt atmosphärischer oder geologischer Phänomene oder in irgend einer anderen vorstellbaren Form äussern. Weder der Himmel noch die Erde, weder die Natur noch die Materie, noch der Äther, noch irgend eine der uns bekannten Kräfte – ausser denen, die in uns sind – kümmern sich um die Gerechtigkeit oder stehen in einer Beziehung zu unserer Moral, unserem Denken und Wollen. Zwischen der äusseren Welt und unseren Handlungen giebt es nur einfache Beziehungen von Ursache und Wirkung, die völlig aussermoralisch sind, wenn der Ausdruck erlaubt ist. Wenn ich die und die Unklugheit, den und den Exzess begehe, laufe ich die und die Gefahr und bezahle der Natur die und die Schuld. Und da Exzess und Unbesonnenheit meist einen moralischen – oder besser: unmoralischen – Grund haben, so können wir es nicht lassen, zwischen der unmoralischen Ursache und der uns drohenden Gefahr oder
der zu büssenden Schuld einen Zusammenhang anzusetzen und jenes Vertrauen in die Gerechtigkeit des Weltalls, welche das am tiefsten wurzelnde Vorurteil des menschlichen Herzens ist, aufs Neue zu bestärken. Aber dabei verlieren wir aus den Augen, dass es genau ebenso gekommen wäre, wenn der Exzess oder die Unbesonnenheit einen unschuldigen oder heroischen Grund gehabt hätte. Wenn ich mich bei strenger Kälte ins Wasser werfe, um meinen Nächsten zu retten, oder wenn ich hineinfalle, während ich ihn hineinzuwerfen suche, so werden die Folgen der Erkältung in beiden Fällen die gleichen sein, und keine Macht im Himmel und auf Erden, ausser mir selbst und dem Menschen (wenn er es vermag), wird meine Leiden mehren, weil ich ein Verbrechen begangen, oder mir einen Schmerz abnehmen, weil ich eine tugendhafte That vollbracht habe.
 Nehmen wir eine andere Form dieser physischen Gerechtigkeit: die
Erblichkeit. Auch hier dieselbe Unkenntnis der moralischen Ursachen, dieselbe Gleichgiltigkeit. Das wäre mir in der That eine sonderbare Gerechtigkeit, welche die Sünden des Vaters und Urgrossvaters an Sohn und Urenkel heimsucht! Sie wäre freilich der menschlichen Moral nicht zuwider, der Mensch würde sie ohne weiteres gutheissen, sie würde ihm sogar als natürlich, grossartig, erhebend erscheinen. Sie würde unsere Individualität, unser Gewissen, unsere Verantwortlichkeit und unser Dasein ad infinitum fortsetzen und in dieser Hinsicht in Übereinstimmung mit einer grossen Anzahl
von Thatsachen stehen, die gar nicht zu bestreiten sind und genugsam beweisen, dass wir nicht nur auf uns selbst beschränkte Wesen sind, sondern durch mehr als ein feines und noch wenig bekanntes Band mit allem verknüpft sind, was uns umgiebt, uns im Leben vorausgeht oder nachfolgt.
Nehmen wir eine andere Form dieser physischen Gerechtigkeit: die
Erblichkeit. Auch hier dieselbe Unkenntnis der moralischen Ursachen, dieselbe Gleichgiltigkeit. Das wäre mir in der That eine sonderbare Gerechtigkeit, welche die Sünden des Vaters und Urgrossvaters an Sohn und Urenkel heimsucht! Sie wäre freilich der menschlichen Moral nicht zuwider, der Mensch würde sie ohne weiteres gutheissen, sie würde ihm sogar als natürlich, grossartig, erhebend erscheinen. Sie würde unsere Individualität, unser Gewissen, unsere Verantwortlichkeit und unser Dasein ad infinitum fortsetzen und in dieser Hinsicht in Übereinstimmung mit einer grossen Anzahl
von Thatsachen stehen, die gar nicht zu bestreiten sind und genugsam beweisen, dass wir nicht nur auf uns selbst beschränkte Wesen sind, sondern durch mehr als ein feines und noch wenig bekanntes Band mit allem verknüpft sind, was uns umgiebt, uns im Leben vorausgeht oder nachfolgt.
Dies ist sicher in mancher Beziehung wahr, nur nicht in Hinsicht auf die Gerechtigkeit der physischen Erblichkeit. Die physische Erblichkeit hängt nicht im mindesten von den Beweggründen der Handlungsweise ab, deren Folgen die Nachkommen zu büssen haben. Zwischen dem, was der Vater gesündigt, der seine Gesundheit ruiniert hat, und dem, was der Sohn leidet, besteht ein physisches Band, aber die – vielleicht verbrecherischen, vielleicht heldenmütigen – Motive des Vaters haben keinerlei Einfluss auf die Leiden des Sohnes. Überdies ist das Feld der physischen Erblichkeit ein sehr beschränktes. Ein Vater kann augenscheinlich tausend ruchlose Verbrechen begangen, kann gemordet, elend verraten, die Unschuld verfolgt und Unglückliche ausgeplündert haben, ohne dass diese Verbrechen im Organismus seiner Kinder die geringste Spur zurücklassen müssen. Er hat eben nur dafür zu sorgen gehabt, dass seine Gesundheit keinen Schaden erlitt.
Im Ganzen genommen, scheint die Gerechtigkeit der Erblichkeit fast ausschliesslich zwei Verbrechen zu strafen: Trunksucht und Ausschweifung. Aber der Alkoholismus ist nicht immer ein widerliches und verbrecherisches Laster, sondern bisweilen weit eher eine Schwäche, und in manchen Fällen liesse sich kaum ein Laster denken, das weniger auf bösem Willen und Perversität beruhte. Man kann sich also nicht erklären, warum die Moral des Weltalls ein verhältnismässig leichtes Verbrechen auf so besonders furchtbare und gewissermassen ewige Weise strafen sollte, wo sie doch von dem Vatermörder, dem Giftmischer und Gewaltthätigen gar keine Notiz nimmt. Andererseits bestraft sich die geschlechtliche Ausschweifung oft genug durch ein furchtbares und für die Nachkommenschaft im höchsten Grade verhängnisvolles Leiden, aber auch hier liegt von Seite der Gerechtigkeit der Dinge dieselbe Unkenntnis der moralischen Ursachen, dieselbe Blindheit und Gleichgiltigkeit vor. Der Akt der Ausschweifung kann in moralischer Hinsicht ungeheuerlich sein, er kann durch empörende Machenschaften eingeleitet, mit Missbrauch der Macht, Verzweiflung und Thränen über und über befleckt sein, er kann aber auch der Moral nicht zuwiderlaufen und selbst unschuldig sein – die Gerechtigkeit der Dinge bleibt doch dieselbe. Sie tritt je nach den getroffenen oder nicht getroffenen Vorsichtsmassregeln, je nach der Häufigkeit des Aktes und oft rein zufällig ein oder auch nicht, aber nie im Hinblick auf den Seelenzustand ihres Opfers. Zuletzt liesse sich bei der Ausschweifung derselbe Einwand machen, wie bei der Trunksucht: warum diese besondere und fast ewige Strafe für ein oft unschuldiges Vergehen? Es giebt Akte der Ausschweifung, die in den Augen der hohen und kalten Vernunft, welche man bei einer allmächtigen Gerechtigkeit doch voraussetzen muss, unverhältnismässig weniger schuldig sind, als mancher niedrige Gedanke, manches schlechte Gefühl, das unbemerkt durch unser Herz geht. Schliesslich wäre es – um diesen Gedanken zum Abschluss zu bringen – nicht schwierig, Fälle zu finden oder sich vorzustellen, wo die Kinder und Enkelkinder eines sehr ehrenwerten Mannes an ihrem Fleisch und Geist unnachsichtlich gestraft werden, weil ihr Vater sich in Erfüllung einer von ihm – mit Recht oder Unrecht – als Akt der Busse und Selbstverleugnung, der Aufopferung oder Gewissenhaftigkeit angesehenen Handlung ein unheilbares Leiden zugezogen hat.
 So ist es um die Gerechtigkeit der Natur bestellt, soweit sie die physische Erblichkeit betrifft! Und die moralische Erblichkeit scheint keine anderen Prinzipien zu haben; nur dass hier, wo es sich um Modifikationen des Geistes und Charakters handelt, die ungleich verwickelter, zarter und unfasslicher sind, die Erscheinungen weniger sinnfällig und unanfechtbar scheinen. Die moralische Erblichkeit ist, wenigstens auf pathologischem Gebiete, wo die Erscheinungen charakteristisch genug sind, um etwas Entscheidendes hervorzubringen, nichts als die geistige Form der physischen Erblichkeit; diese ist ihre Voraussetzung und jene ihre Konsequenz, und man findet bei ihr infolgedessen dieselbe Gleichgiltigkeit und Blindheit gegen die Forderungen der Gerechtigkeit. Die moralischen Beweggründe des Alkoholismus und der Ausschweifung mögen noch so unschuldig oder pervers sein, die Nachkommen des Trunkenboldes
oder Wüstlings können doch – an ihrem Geiste wie an ihrem Fleische – in der gleichen Weise gestraft werden. Wenn sie ein körperliches Gebrechen haben, werden sie meistens auch ein geistiges Gebrechen haben. Mögen sie nun Wahnsinnige, Idioten oder Epileptiker sein, mögen sie unbezähmbare verbrecherische Instinkte haben oder nur ihr geistiges Gleichgewicht allzuleicht verlieren, es kommt stets auf dasselbe hinaus: die Seele hat ebenso Schaden genommen wie der Körper, und die grauenhafteste moralische Strafe, die eine überlegene Gerechtigkeit erfinden könnte – wenn man hier auch nur einen Augenblick von Gerechtigkeit reden könnte – ist die Folge einer Handlungsweise, die gewöhnlich weniger Schaden stiftet und fast immer minder pervers ist, als hundert andere Vergehen, die zu bestrafen der Natur nie einfällt. Mehr noch: diese Strafe wird blindlings verhängt und ohne jede Rücksicht auf die vielleicht entschuldbaren, der Moral nicht zuwiderlaufenden oder gar edlen Beweggründe der betreffenden Handlung.
So ist es um die Gerechtigkeit der Natur bestellt, soweit sie die physische Erblichkeit betrifft! Und die moralische Erblichkeit scheint keine anderen Prinzipien zu haben; nur dass hier, wo es sich um Modifikationen des Geistes und Charakters handelt, die ungleich verwickelter, zarter und unfasslicher sind, die Erscheinungen weniger sinnfällig und unanfechtbar scheinen. Die moralische Erblichkeit ist, wenigstens auf pathologischem Gebiete, wo die Erscheinungen charakteristisch genug sind, um etwas Entscheidendes hervorzubringen, nichts als die geistige Form der physischen Erblichkeit; diese ist ihre Voraussetzung und jene ihre Konsequenz, und man findet bei ihr infolgedessen dieselbe Gleichgiltigkeit und Blindheit gegen die Forderungen der Gerechtigkeit. Die moralischen Beweggründe des Alkoholismus und der Ausschweifung mögen noch so unschuldig oder pervers sein, die Nachkommen des Trunkenboldes
oder Wüstlings können doch – an ihrem Geiste wie an ihrem Fleische – in der gleichen Weise gestraft werden. Wenn sie ein körperliches Gebrechen haben, werden sie meistens auch ein geistiges Gebrechen haben. Mögen sie nun Wahnsinnige, Idioten oder Epileptiker sein, mögen sie unbezähmbare verbrecherische Instinkte haben oder nur ihr geistiges Gleichgewicht allzuleicht verlieren, es kommt stets auf dasselbe hinaus: die Seele hat ebenso Schaden genommen wie der Körper, und die grauenhafteste moralische Strafe, die eine überlegene Gerechtigkeit erfinden könnte – wenn man hier auch nur einen Augenblick von Gerechtigkeit reden könnte – ist die Folge einer Handlungsweise, die gewöhnlich weniger Schaden stiftet und fast immer minder pervers ist, als hundert andere Vergehen, die zu bestrafen der Natur nie einfällt. Mehr noch: diese Strafe wird blindlings verhängt und ohne jede Rücksicht auf die vielleicht entschuldbaren, der Moral nicht zuwiderlaufenden oder gar edlen Beweggründe der betreffenden Handlung.
Ist damit indessen gesagt, dass Alkoholismus und Ausschweifung die einzigen Faktoren der moralischen Erblichkeit wären? In keiner Weise; es wäre dies unsinnig. Tausend mehr oder weniger unbekannte Faktoren sprechen dabei mit. Gewisse moralische Eigenschaften vererben sich anscheinend in derselben Weise, wie gewisse physische Eigenschaften. In jeder Rasse finden sich fast ständig bestimmte, wahrscheinlich erworbene Tugenden. Aber inwieweit hängen sie von Vorbild und Nachahmung, vom Milieu oder von der Erblichkeit ab? Das Problem ist derartig kompliziert, die Thatsachen sind oft so widersprechend, dass es unmöglich wird, in dem Gewirr der zahlreichen Ursachen der Spur einer einzelnen nachzugehen. Es ist auch ganz hinreichend, dass sich in den wenigen klaren, sinnfälligen und ausschlaggebenden Fällen, wo man die Erblichkeit als Kundgebung einer verborgenen Gerechtigkeit auffassen könnte, keine Spur von Gerechtigkeit finden lässt. Denn wenn sie sich dort nicht findet, so wird es noch viel schwerer sein, sie wo anders zu finden.
 Wir können also nicht sagen, dass über, um oder unter uns, in unserem Leben oder in unserem anderen Leben, welches das Leben unserer Kinder ist, eine Spur von verborgener Gerechtigkeit zu finden sei. Indessen haben wir, als wir uns dem Dasein anpassten, den Kausalitätsprinzipien, denen wir am öftesten begegneten, die Absichten unserer Moral beigelegt, so dass daraus der Anschein einer wirklichen Gerechtigkeit, welche die meisten unserer Handlungen belohnt oder straft, je nachdem sie sich mit gewissen Gesetzen der Erhaltung der Wesen decken oder nicht, thatsächlich entstanden ist. Es ist klar, dass, wenn ich mein Feld bestelle, die Ernte-Aussichten im nächsten Sommer für mich hundertmal grösser sind, als für meinen Nachbarn, der sein Feld nicht bestellt hat, weil er lieber in Trägheit oder Zerstreuung lebt. Hier wird die Arbeit mit hinreichender Sicherheit belohnt, und darum haben wir die Arbeit zur moralischen Handlung
»an sich« und zu ersten aller Pflichten erhoben, weil sie zur Erhaltung unseres Lebens unerlässlich ist! Man könnte die Beispiele dieser Art beliebig vermehren. Wenn ich meine Kinder gut erziehe, wenn ich gut und gerecht gegen meine Umgebung bin, wenn ich in allen Lebenslagen ehrlich, fleissig, anständig, vernünftig und besonnen bin, so habe ich mehr Aussicht auf kindliche Liebe, Zuneigung, Achtung und Stunden des Glücks, als jemand, der das Gegenteil thut oder ist. Trotzdem darf man nicht aus den Augen verlieren, dass mein Nachbar nicht mehr ernten würde, so fleissig und nüchtern er auch gewöhnlich sein mag, wenn irgend ein hochachtbarer und vielleicht bewundernswerter Grund, wie eine Krankheit, die er sich am Bette seiner Frau oder seines Nachbars zugezogen hat, ihn gehindert hätte, sein Getreide zur rechten Zeit auszusäen. Es würde – mutatis mutandis – dasselbe eintreten, wie in den oben genannten Fällen. Aber diese Fälle, wo ein achtbarer oder gar bewundernswerter Grund die Erfüllung einer Pflicht verbietet, sind selten, und im allgemeinen besteht zwischen Ursache und Wirkung, zwischen dem Gebot des notwendigen Gesetzes und dem Ergebnis der Anstrengung dessen, der ihm gehorcht hat, dank unserer geistigen Elastizität ein hinreichend festes Verhältnis, um den Gedanken der Gerechtigkeit der Dinge in uns aufrecht zu erhalten …
Wir können also nicht sagen, dass über, um oder unter uns, in unserem Leben oder in unserem anderen Leben, welches das Leben unserer Kinder ist, eine Spur von verborgener Gerechtigkeit zu finden sei. Indessen haben wir, als wir uns dem Dasein anpassten, den Kausalitätsprinzipien, denen wir am öftesten begegneten, die Absichten unserer Moral beigelegt, so dass daraus der Anschein einer wirklichen Gerechtigkeit, welche die meisten unserer Handlungen belohnt oder straft, je nachdem sie sich mit gewissen Gesetzen der Erhaltung der Wesen decken oder nicht, thatsächlich entstanden ist. Es ist klar, dass, wenn ich mein Feld bestelle, die Ernte-Aussichten im nächsten Sommer für mich hundertmal grösser sind, als für meinen Nachbarn, der sein Feld nicht bestellt hat, weil er lieber in Trägheit oder Zerstreuung lebt. Hier wird die Arbeit mit hinreichender Sicherheit belohnt, und darum haben wir die Arbeit zur moralischen Handlung
»an sich« und zu ersten aller Pflichten erhoben, weil sie zur Erhaltung unseres Lebens unerlässlich ist! Man könnte die Beispiele dieser Art beliebig vermehren. Wenn ich meine Kinder gut erziehe, wenn ich gut und gerecht gegen meine Umgebung bin, wenn ich in allen Lebenslagen ehrlich, fleissig, anständig, vernünftig und besonnen bin, so habe ich mehr Aussicht auf kindliche Liebe, Zuneigung, Achtung und Stunden des Glücks, als jemand, der das Gegenteil thut oder ist. Trotzdem darf man nicht aus den Augen verlieren, dass mein Nachbar nicht mehr ernten würde, so fleissig und nüchtern er auch gewöhnlich sein mag, wenn irgend ein hochachtbarer und vielleicht bewundernswerter Grund, wie eine Krankheit, die er sich am Bette seiner Frau oder seines Nachbars zugezogen hat, ihn gehindert hätte, sein Getreide zur rechten Zeit auszusäen. Es würde – mutatis mutandis – dasselbe eintreten, wie in den oben genannten Fällen. Aber diese Fälle, wo ein achtbarer oder gar bewundernswerter Grund die Erfüllung einer Pflicht verbietet, sind selten, und im allgemeinen besteht zwischen Ursache und Wirkung, zwischen dem Gebot des notwendigen Gesetzes und dem Ergebnis der Anstrengung dessen, der ihm gehorcht hat, dank unserer geistigen Elastizität ein hinreichend festes Verhältnis, um den Gedanken der Gerechtigkeit der Dinge in uns aufrecht zu erhalten …

 Ist dieser Gedanke, der auch den Ungläubigsten und am wenigsten mystisch Veranlagten tief im Herzen ruht, ein heilsamer? Ist dieser Teil unserer Moral nicht wie ein Insekt auf einem stürzenden Felsen, das während des Falles sich einbildet, der Fels verändere nur deshalb seine Lage, um es zu tragen? Giebt es Irrtümer, Illusionen und Lügen, die man ermutigen soll? Vielleicht hat es solche gegeben, die einen Augenblick wohlthätig waren; – aber als ihre Wohlthätigkeit ein Ende hatte, stand man dann nicht wieder der Wahrheit gegenüber und musste man ihr das Opfer, das man aufgeschoben hatte, dann nicht
doch bringen? War es notwendig, zu warten, bis uns die Illusion oder Lüge, die uns heilsam zu sein schien, verhängnisvoll zu werden begann oder doch wenigstens die notwendige Übereinstimmung zwischen der wohlempfundenen Wirklichkeit und der Art, sie zu deuten, zu nutzen und anzuerkennen, verzögerte? Was waren doch das Gottesgnadentum, die Unfehlbarkeit der Kirche und der Lohn im Jenseits anderes, als Illusionen, die lange auf das Opfer warteten? Was ist damit gewonnen, dass man es nicht gleich brachte? Etwas trügerischer Friede, etliche oft verhängnisvolle Tröstungen, einige unthätige Hoffnungen. Aber man hat viel Zeit verloren, und die Menschheit will endlich die Wahrheit kennen und hat in diesem Suchen nach Wahrheit einen Daseinsgrund entdeckt, der alle übrigen ersetzt. Hat sie also viel Zeit zu verlieren? Es ist klar, dass sie durch nichts mehr
verliert, als durch eine schon entwurzelte Illusion, denn es ist nichts beweglicher und besser geeignet, die Form zu wechseln.
Ist dieser Gedanke, der auch den Ungläubigsten und am wenigsten mystisch Veranlagten tief im Herzen ruht, ein heilsamer? Ist dieser Teil unserer Moral nicht wie ein Insekt auf einem stürzenden Felsen, das während des Falles sich einbildet, der Fels verändere nur deshalb seine Lage, um es zu tragen? Giebt es Irrtümer, Illusionen und Lügen, die man ermutigen soll? Vielleicht hat es solche gegeben, die einen Augenblick wohlthätig waren; – aber als ihre Wohlthätigkeit ein Ende hatte, stand man dann nicht wieder der Wahrheit gegenüber und musste man ihr das Opfer, das man aufgeschoben hatte, dann nicht
doch bringen? War es notwendig, zu warten, bis uns die Illusion oder Lüge, die uns heilsam zu sein schien, verhängnisvoll zu werden begann oder doch wenigstens die notwendige Übereinstimmung zwischen der wohlempfundenen Wirklichkeit und der Art, sie zu deuten, zu nutzen und anzuerkennen, verzögerte? Was waren doch das Gottesgnadentum, die Unfehlbarkeit der Kirche und der Lohn im Jenseits anderes, als Illusionen, die lange auf das Opfer warteten? Was ist damit gewonnen, dass man es nicht gleich brachte? Etwas trügerischer Friede, etliche oft verhängnisvolle Tröstungen, einige unthätige Hoffnungen. Aber man hat viel Zeit verloren, und die Menschheit will endlich die Wahrheit kennen und hat in diesem Suchen nach Wahrheit einen Daseinsgrund entdeckt, der alle übrigen ersetzt. Hat sie also viel Zeit zu verlieren? Es ist klar, dass sie durch nichts mehr
verliert, als durch eine schon entwurzelte Illusion, denn es ist nichts beweglicher und besser geeignet, die Form zu wechseln.
Aber was liegt daran, wird man sagen, ob der Mensch die und die gute That thut, weil er überzeugt ist, dass Gott ihn ansieht, oder weil er sich einbildet, dass dem Weltall eine Art von Gerechtigkeit innewohnt, oder endlich, weil ihm diese That in seinem Gewissen als gut erscheint? Im Gegenteil, daran liegt am allermeisten! Man nehme drei verschiedene Menschen. Der erste, den Gott ansieht, wird mehr als ein Unrecht thun, weil es bisher noch keinen Gott gegeben hat, der nicht vieles Unrechte gewollt hätte. Der zweite wird nicht immer so handeln, wie der dritte, und der dritte ist der wahrhafte Mensch, den der Moralist zu Rate ziehen soll, denn er allein wird die beiden anderen überleben, und es ist für den Moralisten wichtiger, zu verfolgen, wie der Mensch sich im Bereiche der Wahrheit benimmt, d. h. auf seinem natürlichen Wurzelboden, als zu wissen, was er im Banne des Irrtums thut.
 Ich glaube, es wird solchen, die nicht an das Dasein eines höchsten Richters glauben, überflüssig erscheinen, wenn ich den unannehmbaren Gedanken der Gerechtigkeit der Dinge einer ebenso ernsten Prüfung unterziehe. Denn in der Weise aufgefasst, wie sie in Wirklichkeit thatsächlich ist, und gewissermassen als fundamental angesehen, wird sie völlig unannehmbar. Aber im alltäglichen Leben pflegen wir sie
uns nicht auf diese Weise vorzustellen. Wenn wir sehen, wie das Verbrechen zum Unglück führt, wie schlimm erworbener Besitz mit völligem Ruin endigt, wie der Wüstling ins Elend gerät, die Bosheit bestraft wird, die einen Augenblick triumphierende Gewaltthat zum Verhängnis ausschlägt, so verwechseln wir unaufhörlich physische Wirkung und moralische Ursache, und wiewohl wir durchaus nicht an das Dasein eines Richters glauben, leben wir doch schliesslich fast alle – mehr oder weniger bedingungslos – in irgend einem unbestimmten Glauben an die Gerechtigkeit der Dinge. Und wenn wir auch im Zustande der kalten Besinnung und Überlegung inne geworden sind, dass es eine solche Gerechtigkeit nicht giebt, so genügt doch ein Ereignis, das uns näher angeht, zwei oder drei Fälle, wo das Zusammentreffen von Umständen besonders auffällig ist, um diese Überzeugung in unserem Herzen, wo nicht in unserem Geiste, zu stürzen. Unserer Vernunft und Erfahrung zum Trotze weckt ein Nichts den Vorfahren in uns auf, der überzeugt war, dass die Sterne nur darum an ihrem ewigen Platze funkelten, um eine Wunde, die er seinem Feinde auf dem Schlachtfelde beibringen würde, ein Wort, das er im Rate der Führer sprechen würde, eine glückliche List, die er um das Frauengemach spinnen würde, vorherzusagen und zu billigen. Auch wir vergöttern unsere Gefühle je nach der Höhe unseres Interesses, aber da die Götter keine Namen mehr haben, vergöttern wir sie in einer weniger deutlichen und aufrichtigen Weise; das ist der einzige Unterschied! Wenn die Griechen, die ohnmächtig
vor Troja liegen, einer sinnfälligen Hilfe und eines ebenso sinnfälligen Zeichens bedürfen, so rauben sie dem Philoktet die Waffen des Herakles und lassen ihn dann nackt, krank und wehrlos auf einer öden Insel im Stiche; und das nennt sich dann mystische Gerechtigkeit, die über die menschliche erhaben ist, und Göttergebot! Und wir? Wenn uns eine Ungerechtigkeit nützlich scheint, so fordern wir sie im Namen der künftigen Geschlechter, im Namen der Menschheit, des Vaterlandes u. s. w. Ebenso: wenn ein grosses Unglück uns betrifft, giebt es keine Gerechtigkeit, keine Götter mehr; wenn es aber unseren Feind betrifft, so bevölkert sich das All sofort wieder mit unsichtbaren Richtern; und wenn ein unverhofftes und unverhältnismässiges Glück uns zu teil wird, so besassen wir jedenfalls irgendwelche Verdienste, die so verborgen waren, dass wir selbst sie nicht kannten, und wir sind glücklicher darüber, dass sie nun zum Vorschein gekommen sind, als über das Glück selbst, das sie uns zugeführt haben.
Ich glaube, es wird solchen, die nicht an das Dasein eines höchsten Richters glauben, überflüssig erscheinen, wenn ich den unannehmbaren Gedanken der Gerechtigkeit der Dinge einer ebenso ernsten Prüfung unterziehe. Denn in der Weise aufgefasst, wie sie in Wirklichkeit thatsächlich ist, und gewissermassen als fundamental angesehen, wird sie völlig unannehmbar. Aber im alltäglichen Leben pflegen wir sie
uns nicht auf diese Weise vorzustellen. Wenn wir sehen, wie das Verbrechen zum Unglück führt, wie schlimm erworbener Besitz mit völligem Ruin endigt, wie der Wüstling ins Elend gerät, die Bosheit bestraft wird, die einen Augenblick triumphierende Gewaltthat zum Verhängnis ausschlägt, so verwechseln wir unaufhörlich physische Wirkung und moralische Ursache, und wiewohl wir durchaus nicht an das Dasein eines Richters glauben, leben wir doch schliesslich fast alle – mehr oder weniger bedingungslos – in irgend einem unbestimmten Glauben an die Gerechtigkeit der Dinge. Und wenn wir auch im Zustande der kalten Besinnung und Überlegung inne geworden sind, dass es eine solche Gerechtigkeit nicht giebt, so genügt doch ein Ereignis, das uns näher angeht, zwei oder drei Fälle, wo das Zusammentreffen von Umständen besonders auffällig ist, um diese Überzeugung in unserem Herzen, wo nicht in unserem Geiste, zu stürzen. Unserer Vernunft und Erfahrung zum Trotze weckt ein Nichts den Vorfahren in uns auf, der überzeugt war, dass die Sterne nur darum an ihrem ewigen Platze funkelten, um eine Wunde, die er seinem Feinde auf dem Schlachtfelde beibringen würde, ein Wort, das er im Rate der Führer sprechen würde, eine glückliche List, die er um das Frauengemach spinnen würde, vorherzusagen und zu billigen. Auch wir vergöttern unsere Gefühle je nach der Höhe unseres Interesses, aber da die Götter keine Namen mehr haben, vergöttern wir sie in einer weniger deutlichen und aufrichtigen Weise; das ist der einzige Unterschied! Wenn die Griechen, die ohnmächtig
vor Troja liegen, einer sinnfälligen Hilfe und eines ebenso sinnfälligen Zeichens bedürfen, so rauben sie dem Philoktet die Waffen des Herakles und lassen ihn dann nackt, krank und wehrlos auf einer öden Insel im Stiche; und das nennt sich dann mystische Gerechtigkeit, die über die menschliche erhaben ist, und Göttergebot! Und wir? Wenn uns eine Ungerechtigkeit nützlich scheint, so fordern wir sie im Namen der künftigen Geschlechter, im Namen der Menschheit, des Vaterlandes u. s. w. Ebenso: wenn ein grosses Unglück uns betrifft, giebt es keine Gerechtigkeit, keine Götter mehr; wenn es aber unseren Feind betrifft, so bevölkert sich das All sofort wieder mit unsichtbaren Richtern; und wenn ein unverhofftes und unverhältnismässiges Glück uns zu teil wird, so besassen wir jedenfalls irgendwelche Verdienste, die so verborgen waren, dass wir selbst sie nicht kannten, und wir sind glücklicher darüber, dass sie nun zum Vorschein gekommen sind, als über das Glück selbst, das sie uns zugeführt haben.
»Alles belohnt sich,« sagen wir. Ja, im Grunde unseres Herzens und im Bereiche des Menschlichen belohnt sich alles, kraft der Gerechtigkeit, mit der Münze des inneren Glücks und Unglücks. Ausser uns, in der uns umgebenden Welt, belohnt sich gleichfalls alles, aber Glück und Unglück gehen nicht mehr durch dieselben Hände. Hier wird in anderer Weise und aus anderen Gründen, kraft anderer Gesetze gezahlt. Nicht die Gerechtigkeit des Gewissens führt hier den Vorsitz, sondern die Logik der Natur, die unsere Moral nicht kennt. In uns herrscht ein Geist, der nur die Absichten wägt, ausser uns eine Macht, die nur die Thatsachen wägt. Wir bilden uns gern ein, sie handelten im Einvernehmen mit einander. Aber in Wahrheit weiss die Macht, wenn der Geist auch zuweilen nach ihr blickt, ebensowenig von ihm, wie ein Mann, der in Nordeuropa Kohlen wiegt, von einem, der in Südafrika Diamanten wiegt. Wir bringen fortwährend unser Gerechtigkeitsgefühl und diese aussersittliche Logik durcheinander, und dies ist die Quelle unserer meisten Irrtümer.
 Im übrigen stände es uns übel an, wenn wir uns über die Gleichgiltigkeit des Alls beklagen und sie für ungeheuerlich und unbegreiflich erklären wollten. Wir haben kein Recht dazu, uns über eine Ungerechtigkeit aufzuhalten, an der wir selbst einen sehr thätigen Anteil haben. Gewiss findet sich keine Spur von Gerechtigkeit in den Unfällen und Krankheiten, noch in den meisten äusseren Zufällen, die blind den Guten und den Bösen, den Verräter und den Helden, die barmherzige Schwester und die Giftmischerin treffen. Aber wir rechnen mit Vorliebe eine grosse Anzahl von ausschliesslich menschlichen Ungerechtigkeiten, die ungleich häufiger und mörderischer sind, als Stürme, Krankheiten und Feuersbrünste, zu der Rubrik Ungerechtigkeiten des Weltalls. Ich rede nicht einmal vom Kriege, obwohl man mir einwenden könnte, dass er weniger der Natur, als dem Willen der Könige und Völker zuzuschreiben ist; aber die Armut zum Beispiel, die wir immer
noch unter die unverantwortlichen Übel zählen, wie Pest oder Schiffbruch, die Armut mit ihren grässlichen Leiden und ihren erblichen Folgen: wie oft ist sie der Ungerechtigkeit der Elemente zuzuschreiben und wie oft der Ungerechtigkeit unserer sozialen Verhältnisse, die nichts als die Summe aller menschlichen Ungerechtigkeiten sind? Warum suchen wir angesichts eines unverdienten Elends nach einem unerforschlichen Grund oder Richter im Himmel, als ob es sich um einen Blitzschlag handelte? Wissen wir denn nicht, dass wir uns hier auf dem bestbekannten und gewissesten Teil unseres eigensten Bereiches befinden, dass wir es sind, die das Elend organisieren und in moralischer Hinsicht ebenso willkürlich verteilen, wie das Feuer seine Wut und die Krankheit ihre Leiden austeilt? Hat es einen Sinn, sich zu verwundern, dass das Weltmeer dem Seelenzustande seines Opfers keine Rechnung trägt, wenn wir, die wir doch eine Seele haben, d. h. das edelste Organ der Gerechtigkeit, der Unschuld von tausenden Unglücklichen, die unsere Opfer sind, nicht Rechnung tragen? Ist das eine Entschuldigung, wenn wir eine Macht, die ganz in unseren Händen liegt, von allem, was unsere tägliche Sorge ausmacht, ausschliessen, um sie zur Schicksalsmacht zu erheben? Wahrhaftig, wir sind sonderbare Richter und ebenso sonderbare Freier einer idealen Gerechtigkeit! Wir geraten in Zuckungen von einem Ende der Welt bis zum anderen, wenn irgendwo ein Rechtsirrtum stattfindet, aber den Irrtum, der drei Viertel unserer Brüder zum Elend verdammt und der ebenso
menschlich ist, wie der eines Gerichts, schreiben wir, ich weiss nicht, welcher undefinierbaren, unzugänglichen und unversöhnlichen Macht zu! Wenn einem braven Mann aus unserer Nachbarschaft ein Kind geboren wird, das blind, blöde oder missraten ist, so suchen wir, gleichgiltig wo, und wäre es in der Finsternis einer Religion, die wir nicht mehr üben, nach irgend einem Gotte, um seine Wege zu erforschen; aber wenn das Kind in Armut geboren wird, was das Schicksal eines Wesens gewöhnlich nicht minder, als das schwerste Gebrechen, um mehrere Stufen herabdrückt, so fällt es uns nicht ein, eine einzige Frage an den Gott zu stellen, der doch überall ist, wo wir sind, denn er ist ja ein Geschöpf unseres Willens. Bevor wir einen idealen Richter fordern, wäre es nötig, unsere Ideen zu klären, denn dieser Richter wird an den Mängeln dieser Ideen teilhaben. Bevor wir uns über die Gleichgiltigkeit der Natur beschweren und eine Billigkeit in ihr suchen, die sie nicht kennt, wäre es ratsam, aus unseren irdischen Religionen alle Ungerechtigkeiten auszumerzen; und wenn diese Ungerechtigkeiten abgestellt sind, wird es sich finden, dass das Feld, welches den Ungerechtigkeiten des Zufalls eingeräumt war, wahrscheinlich um zwei Drittel kleiner geworden ist, und jedenfalls kleiner, als wenn wir den Sturm vernünftig, den Vulkan besonnen, die Lawine vorsichtig, Frost und Kälte umsichtig, die Krankheit urteilsfähig und das Meer sinnbegabt und wachsam über unsere Tugenden und geheimen Absichten gemacht hätten. Es giebt in der That bei
weitem mehr Arme, als Schiffbrüchige und Opfer äusserer Unglücksfälle, und viel mehr Krankheiten infolge von Armut, als infolge der Launen unseres Organismus oder der Feindseligkeit der Elemente.
Im übrigen stände es uns übel an, wenn wir uns über die Gleichgiltigkeit des Alls beklagen und sie für ungeheuerlich und unbegreiflich erklären wollten. Wir haben kein Recht dazu, uns über eine Ungerechtigkeit aufzuhalten, an der wir selbst einen sehr thätigen Anteil haben. Gewiss findet sich keine Spur von Gerechtigkeit in den Unfällen und Krankheiten, noch in den meisten äusseren Zufällen, die blind den Guten und den Bösen, den Verräter und den Helden, die barmherzige Schwester und die Giftmischerin treffen. Aber wir rechnen mit Vorliebe eine grosse Anzahl von ausschliesslich menschlichen Ungerechtigkeiten, die ungleich häufiger und mörderischer sind, als Stürme, Krankheiten und Feuersbrünste, zu der Rubrik Ungerechtigkeiten des Weltalls. Ich rede nicht einmal vom Kriege, obwohl man mir einwenden könnte, dass er weniger der Natur, als dem Willen der Könige und Völker zuzuschreiben ist; aber die Armut zum Beispiel, die wir immer
noch unter die unverantwortlichen Übel zählen, wie Pest oder Schiffbruch, die Armut mit ihren grässlichen Leiden und ihren erblichen Folgen: wie oft ist sie der Ungerechtigkeit der Elemente zuzuschreiben und wie oft der Ungerechtigkeit unserer sozialen Verhältnisse, die nichts als die Summe aller menschlichen Ungerechtigkeiten sind? Warum suchen wir angesichts eines unverdienten Elends nach einem unerforschlichen Grund oder Richter im Himmel, als ob es sich um einen Blitzschlag handelte? Wissen wir denn nicht, dass wir uns hier auf dem bestbekannten und gewissesten Teil unseres eigensten Bereiches befinden, dass wir es sind, die das Elend organisieren und in moralischer Hinsicht ebenso willkürlich verteilen, wie das Feuer seine Wut und die Krankheit ihre Leiden austeilt? Hat es einen Sinn, sich zu verwundern, dass das Weltmeer dem Seelenzustande seines Opfers keine Rechnung trägt, wenn wir, die wir doch eine Seele haben, d. h. das edelste Organ der Gerechtigkeit, der Unschuld von tausenden Unglücklichen, die unsere Opfer sind, nicht Rechnung tragen? Ist das eine Entschuldigung, wenn wir eine Macht, die ganz in unseren Händen liegt, von allem, was unsere tägliche Sorge ausmacht, ausschliessen, um sie zur Schicksalsmacht zu erheben? Wahrhaftig, wir sind sonderbare Richter und ebenso sonderbare Freier einer idealen Gerechtigkeit! Wir geraten in Zuckungen von einem Ende der Welt bis zum anderen, wenn irgendwo ein Rechtsirrtum stattfindet, aber den Irrtum, der drei Viertel unserer Brüder zum Elend verdammt und der ebenso
menschlich ist, wie der eines Gerichts, schreiben wir, ich weiss nicht, welcher undefinierbaren, unzugänglichen und unversöhnlichen Macht zu! Wenn einem braven Mann aus unserer Nachbarschaft ein Kind geboren wird, das blind, blöde oder missraten ist, so suchen wir, gleichgiltig wo, und wäre es in der Finsternis einer Religion, die wir nicht mehr üben, nach irgend einem Gotte, um seine Wege zu erforschen; aber wenn das Kind in Armut geboren wird, was das Schicksal eines Wesens gewöhnlich nicht minder, als das schwerste Gebrechen, um mehrere Stufen herabdrückt, so fällt es uns nicht ein, eine einzige Frage an den Gott zu stellen, der doch überall ist, wo wir sind, denn er ist ja ein Geschöpf unseres Willens. Bevor wir einen idealen Richter fordern, wäre es nötig, unsere Ideen zu klären, denn dieser Richter wird an den Mängeln dieser Ideen teilhaben. Bevor wir uns über die Gleichgiltigkeit der Natur beschweren und eine Billigkeit in ihr suchen, die sie nicht kennt, wäre es ratsam, aus unseren irdischen Religionen alle Ungerechtigkeiten auszumerzen; und wenn diese Ungerechtigkeiten abgestellt sind, wird es sich finden, dass das Feld, welches den Ungerechtigkeiten des Zufalls eingeräumt war, wahrscheinlich um zwei Drittel kleiner geworden ist, und jedenfalls kleiner, als wenn wir den Sturm vernünftig, den Vulkan besonnen, die Lawine vorsichtig, Frost und Kälte umsichtig, die Krankheit urteilsfähig und das Meer sinnbegabt und wachsam über unsere Tugenden und geheimen Absichten gemacht hätten. Es giebt in der That bei
weitem mehr Arme, als Schiffbrüchige und Opfer äusserer Unglücksfälle, und viel mehr Krankheiten infolge von Armut, als infolge der Launen unseres Organismus oder der Feindseligkeit der Elemente.
 Gleichwohl lieben wir die Gerechtigkeit. Wir leben sicherlich im Schosse einer grossen Ungerechtigkeit, aber man muss uns zu gute halten, dass wir die Gewissheit darüber noch nicht lange haben und erst Mittel und Wege suchen, um sie abzustellen. Sie war so alt; die Gottes- und Schicksalsidee, die Vorstellung von geheimnisvollen Absichten der Natur war so eng mit ihr verknüpft, sie steht noch in so innigem Zusammenhang mit den meisten schädlichen Kräften des Weltalls, dass wir erst seit gestern und ehegestern versuchen, die rein menschlichen Kräfte darin zu isolieren. Und wenn es uns gelingt, sie zu isolieren, wiederzuerkennen und ein für allemal von den anderen zu trennen, auf die wir keinen Einfluss haben, so wird das für die Gerechtigkeit von grösserem Belange sein, als alles, was die Menschheit in ihrem Trachten nach Gerechtigkeit bisher gefunden hat. Denn es ist nicht der menschliche Anteil an der sozialen Ungerechtigkeit, der unser leidenschaftliches Streben nach Billigkeit zu entwaffnen imstande ist, sondern der Anteil, den eine grosse Menge Menschen noch immer Gott, einer Art von Verhängnis und gewissen angeblichen Naturgesetzen zuerkennt.
Gleichwohl lieben wir die Gerechtigkeit. Wir leben sicherlich im Schosse einer grossen Ungerechtigkeit, aber man muss uns zu gute halten, dass wir die Gewissheit darüber noch nicht lange haben und erst Mittel und Wege suchen, um sie abzustellen. Sie war so alt; die Gottes- und Schicksalsidee, die Vorstellung von geheimnisvollen Absichten der Natur war so eng mit ihr verknüpft, sie steht noch in so innigem Zusammenhang mit den meisten schädlichen Kräften des Weltalls, dass wir erst seit gestern und ehegestern versuchen, die rein menschlichen Kräfte darin zu isolieren. Und wenn es uns gelingt, sie zu isolieren, wiederzuerkennen und ein für allemal von den anderen zu trennen, auf die wir keinen Einfluss haben, so wird das für die Gerechtigkeit von grösserem Belange sein, als alles, was die Menschheit in ihrem Trachten nach Gerechtigkeit bisher gefunden hat. Denn es ist nicht der menschliche Anteil an der sozialen Ungerechtigkeit, der unser leidenschaftliches Streben nach Billigkeit zu entwaffnen imstande ist, sondern der Anteil, den eine grosse Menge Menschen noch immer Gott, einer Art von Verhängnis und gewissen angeblichen Naturgesetzen zuerkennt.
![]()
 Dieser passive Anteil nimmt freilich von Tag zu Tag ab. Nicht als ob das Mysterium der Gerechtigkeit im Verschwinden wäre – keineswegs! Es ist sehr selten, dass ein Mysterium verschwindet, gewöhnlich wechselt es nur den Ort. Aber es ist oft sehr wichtig und zu wünschen, dass es gelingt, das Mysterium zum Ortswechsel zu veranlassen. In gewisser Hinsicht beruht der ganze Fortschritt des menschlichen Denkens auf zwei oder drei Ortswechseln dieser Art, darauf, dass man zwei oder drei Mysterien von einem Ort, wo sie Schaden stifteten, nach einem anderen Ort versetzte, wo sie unschädlich wurden und Gutes thun konnten. Bisweilen braucht das Mysterium nicht einmal den Ort zu wechseln: genug, wenn es uns gelingt, ihm einen anderen Namen zu geben. Was man früher »die Götter« nannte, heisst heute »das Leben«. Und wenn das Leben ebenso unerklärlich ist, wie die Götter, so haben wir wenigstens den Vorteil errungen, dass niemand mehr das Recht hat, in seinem Namen zu sprechen oder Schaden zu stiften. Es ist höchst wahrscheinlich nicht das Endziel des menschlichen Denkens, das Mysterium zu zerstören oder zu verringern. Es ist dies anscheinend auch gar nicht möglich. Man kann glauben, dass das Mysterium dieser Welt stets das gleiche bleiben wird, vorausgesetzt, dass das Wesen dieser Welt – wie das des Mysteriums – die Unendlichkeit ist. Aber dem wahrhaft
menschlichen Denken liegt vor allem daran, die Lage der wirklichen und nicht
zu enträtselnden Mysterien festzustellen. Es soll ihnen alles genommen werden, was nicht zu ihnen gehört, alles, was keinen Teil daran hat, alles, was unsere Irrtümer, Befürchtungen und Lügen hinzugedichtet haben. Und in dem Masse, wie die künstlichen Mysterien fallen, sieht man den Ozean des wirklichen Mysteriums sich erweitern; und dieses ist das Mysterium des Lebens, seines Zweckes und Ursprungs, das Mysterium des Gedankens, das Mysterium, das man den »ersten Zufall« oder »das vielleicht unerkennbare Wesen der Welt« genannt hat.
Dieser passive Anteil nimmt freilich von Tag zu Tag ab. Nicht als ob das Mysterium der Gerechtigkeit im Verschwinden wäre – keineswegs! Es ist sehr selten, dass ein Mysterium verschwindet, gewöhnlich wechselt es nur den Ort. Aber es ist oft sehr wichtig und zu wünschen, dass es gelingt, das Mysterium zum Ortswechsel zu veranlassen. In gewisser Hinsicht beruht der ganze Fortschritt des menschlichen Denkens auf zwei oder drei Ortswechseln dieser Art, darauf, dass man zwei oder drei Mysterien von einem Ort, wo sie Schaden stifteten, nach einem anderen Ort versetzte, wo sie unschädlich wurden und Gutes thun konnten. Bisweilen braucht das Mysterium nicht einmal den Ort zu wechseln: genug, wenn es uns gelingt, ihm einen anderen Namen zu geben. Was man früher »die Götter« nannte, heisst heute »das Leben«. Und wenn das Leben ebenso unerklärlich ist, wie die Götter, so haben wir wenigstens den Vorteil errungen, dass niemand mehr das Recht hat, in seinem Namen zu sprechen oder Schaden zu stiften. Es ist höchst wahrscheinlich nicht das Endziel des menschlichen Denkens, das Mysterium zu zerstören oder zu verringern. Es ist dies anscheinend auch gar nicht möglich. Man kann glauben, dass das Mysterium dieser Welt stets das gleiche bleiben wird, vorausgesetzt, dass das Wesen dieser Welt – wie das des Mysteriums – die Unendlichkeit ist. Aber dem wahrhaft
menschlichen Denken liegt vor allem daran, die Lage der wirklichen und nicht
zu enträtselnden Mysterien festzustellen. Es soll ihnen alles genommen werden, was nicht zu ihnen gehört, alles, was keinen Teil daran hat, alles, was unsere Irrtümer, Befürchtungen und Lügen hinzugedichtet haben. Und in dem Masse, wie die künstlichen Mysterien fallen, sieht man den Ozean des wirklichen Mysteriums sich erweitern; und dieses ist das Mysterium des Lebens, seines Zweckes und Ursprungs, das Mysterium des Gedankens, das Mysterium, das man den »ersten Zufall« oder »das vielleicht unerkennbare Wesen der Welt« genannt hat.
 Wo befand sich das Mysterium der Gerechtigkeit? Es erfüllte die Welt. Bald lag es in den Händen der Götter, bald umgab und beherrschte es selbst diese. Man nahm es überall an, ausser im Menschen. Es erfüllte die Himmel, belebte die Felsen, die Luft und die Meere, bevölkerte eine unerreichbare Welt. Jetzt sucht man es endlich in seinen luftigen Schlupfwinkeln auf, bringt seinen Wolkenthron zum Wanken, prüft es und treibt es in die Enge, es verflüchtigt sich – und in dem Augenblicke, wo wir glauben, es sei verschwunden, erscheint es wieder und behauptet sich in unseren Herzen! Und das ist wieder ein Mysterium, das sich den Menschen nähert und in ihm Gestalt gewinnt. Denn wir werden fast immer zur letzten Zuflucht und eigentlichen Wohnstätte der Mysterien, die wir vernichten wollten. In uns finden sie endlich den sicheren Herd, den sie im ersten Jugendtaumel verlassen hatten, um den Weltenraum zu durchstreifen, und in uns müssen
wir sie auch wieder aufnehmen, vereinigen und befragen. Es ist fürwahr ebenso wunderbar, ebenso seltsam und unerklärlich, dass der Mensch in seinem Herzen einen unerschütterlichen Gerechtigkeits-Instinkt hat, wie dass die Götter oder die Kräfte des Weltalls gerecht sein sollten. Es ist ebenso schwierig, das Wesen unseres Gedächtnisses, unseres Willens, unseres Verstandes zu ergründen, wie das der gleichen Eigenschaften bei den unsichtbaren Mächten oder Naturgesetzen; und wenn uns das Unbekannte oder Unerkennbare nötig ist, um unsere Wissbegier zu veredeln, wenn wir des Unendlichen und des Mysteriums bedürfen, um unseren Lebensdrang zu mehren, so verlieren wir keinen Tropfen des Unbekannten oder Unerkennbaren, indem wir den grossen Strom endlich in sein ursprüngliches Bette zurückleiten, noch versperren wir uns einen der Wege zum Unendlichen oder schmälern das anfechtbarste der wirklichen Mysterien um einen Zoll. Was man dem Himmel nimmt, findet man im Menschenherzen wieder. Aber Mysterium gegen Mysterium: ziehen wir stets das gewisse dem zweifelhaften vor, das naheliegende dem fernen, das in uns liegende, das uns gehört, dem, das ausser uns lag und einen höchst verhängnisvollen Einfluss auf uns hatte! Mysterium gegen Mysterium: befragen wir nie mehr die Botschafter, sondern stets den Herrn, der sie sandte, befragen wir nie mehr Die, welche bei den ersten Fragen flohen, sondern unser eigenes Herz, das Antwort und Frage zugleich enthält und sich vielleicht eines Tages der Antwort entsinnen wird …
Wo befand sich das Mysterium der Gerechtigkeit? Es erfüllte die Welt. Bald lag es in den Händen der Götter, bald umgab und beherrschte es selbst diese. Man nahm es überall an, ausser im Menschen. Es erfüllte die Himmel, belebte die Felsen, die Luft und die Meere, bevölkerte eine unerreichbare Welt. Jetzt sucht man es endlich in seinen luftigen Schlupfwinkeln auf, bringt seinen Wolkenthron zum Wanken, prüft es und treibt es in die Enge, es verflüchtigt sich – und in dem Augenblicke, wo wir glauben, es sei verschwunden, erscheint es wieder und behauptet sich in unseren Herzen! Und das ist wieder ein Mysterium, das sich den Menschen nähert und in ihm Gestalt gewinnt. Denn wir werden fast immer zur letzten Zuflucht und eigentlichen Wohnstätte der Mysterien, die wir vernichten wollten. In uns finden sie endlich den sicheren Herd, den sie im ersten Jugendtaumel verlassen hatten, um den Weltenraum zu durchstreifen, und in uns müssen
wir sie auch wieder aufnehmen, vereinigen und befragen. Es ist fürwahr ebenso wunderbar, ebenso seltsam und unerklärlich, dass der Mensch in seinem Herzen einen unerschütterlichen Gerechtigkeits-Instinkt hat, wie dass die Götter oder die Kräfte des Weltalls gerecht sein sollten. Es ist ebenso schwierig, das Wesen unseres Gedächtnisses, unseres Willens, unseres Verstandes zu ergründen, wie das der gleichen Eigenschaften bei den unsichtbaren Mächten oder Naturgesetzen; und wenn uns das Unbekannte oder Unerkennbare nötig ist, um unsere Wissbegier zu veredeln, wenn wir des Unendlichen und des Mysteriums bedürfen, um unseren Lebensdrang zu mehren, so verlieren wir keinen Tropfen des Unbekannten oder Unerkennbaren, indem wir den grossen Strom endlich in sein ursprüngliches Bette zurückleiten, noch versperren wir uns einen der Wege zum Unendlichen oder schmälern das anfechtbarste der wirklichen Mysterien um einen Zoll. Was man dem Himmel nimmt, findet man im Menschenherzen wieder. Aber Mysterium gegen Mysterium: ziehen wir stets das gewisse dem zweifelhaften vor, das naheliegende dem fernen, das in uns liegende, das uns gehört, dem, das ausser uns lag und einen höchst verhängnisvollen Einfluss auf uns hatte! Mysterium gegen Mysterium: befragen wir nie mehr die Botschafter, sondern stets den Herrn, der sie sandte, befragen wir nie mehr Die, welche bei den ersten Fragen flohen, sondern unser eigenes Herz, das Antwort und Frage zugleich enthält und sich vielleicht eines Tages der Antwort entsinnen wird …
 Sobald wir dies erkannt haben, lässt sich auch für manche beunruhigende Frage über die oft sehr gerechte Verteilung von Lohn und Strafe unter den Menschen eine Antwort finden. Es handelt sich dabei nicht nur um innere oder moralische Strafen und Belohnungen, sondern auch um die sichtbaren und rein materiellen. Es hat seinen guten Grund, dass die Menschheit von jeher gemeint hat, die Gerechtigkeit habe alle Dinge auf Erden sozusagen durchtränkt und beseelt. Zur Erklärung dieses Glaubens genügt es nicht, dass sich eine ganz notwendige Anpassung der grossen Moralgesetze an die grossen Gesetze des materiellen Lebens konstatieren lässt. Auf alle Fälle läuft nicht alles auf einen einfachen Kausalzusammenhang zwischen Schuld und Strafe hinaus. Es lässt sich auch oft ein moralisches Element darin entdecken, und wiewohl es nicht durch die Dinge hineingelegt, sondern nur von uns geschaffen ist, so ist es darum doch nicht minder wirklich und mächtig. Wenn es keine physische Gerechtigkeit im eigentlichen Sinne giebt, sondern nur eine ganz innerliche psychologische Gerechtigkeit, von der wir noch zu reden haben werden, so giebt es auch eine psychologische Gerechtigkeit, die in stetem Kontakt mit der Aussenwelt ist, und diese Gerechtigkeit schreiben wir, ich weiss nicht welchem unsichtbaren und allgemeinen Prinzip zu. Wir thun unrecht, der Natur moralische Absichten unterzuschieben und im Banne der Furcht vor Strafe und der Hoffnung auf Lohn zu leben, die sie für
uns bereit hält. Aber damit ist nicht gesagt, dass es – selbst im materiellen Sinne – keinen Lohn für das Gute und keine Strafe für das Böse gäbe. Das giebt es ganz unstreitig, aber Lohn und Strafe kommen von wo anders, als wir wähnen, und solange wir annehmen, dass sie aus einem unerreichbaren Lande kommen, uns überschauen, richten und uns folglich ersparen, uns selbst zu richten, begehen wir den verhängnisvollsten Irrtum; denn keiner hat mehr Einfluss auf unsere Art, uns gegen das Unglück zu schützen und unser berechtigtes Glück zu suchen.
Sobald wir dies erkannt haben, lässt sich auch für manche beunruhigende Frage über die oft sehr gerechte Verteilung von Lohn und Strafe unter den Menschen eine Antwort finden. Es handelt sich dabei nicht nur um innere oder moralische Strafen und Belohnungen, sondern auch um die sichtbaren und rein materiellen. Es hat seinen guten Grund, dass die Menschheit von jeher gemeint hat, die Gerechtigkeit habe alle Dinge auf Erden sozusagen durchtränkt und beseelt. Zur Erklärung dieses Glaubens genügt es nicht, dass sich eine ganz notwendige Anpassung der grossen Moralgesetze an die grossen Gesetze des materiellen Lebens konstatieren lässt. Auf alle Fälle läuft nicht alles auf einen einfachen Kausalzusammenhang zwischen Schuld und Strafe hinaus. Es lässt sich auch oft ein moralisches Element darin entdecken, und wiewohl es nicht durch die Dinge hineingelegt, sondern nur von uns geschaffen ist, so ist es darum doch nicht minder wirklich und mächtig. Wenn es keine physische Gerechtigkeit im eigentlichen Sinne giebt, sondern nur eine ganz innerliche psychologische Gerechtigkeit, von der wir noch zu reden haben werden, so giebt es auch eine psychologische Gerechtigkeit, die in stetem Kontakt mit der Aussenwelt ist, und diese Gerechtigkeit schreiben wir, ich weiss nicht welchem unsichtbaren und allgemeinen Prinzip zu. Wir thun unrecht, der Natur moralische Absichten unterzuschieben und im Banne der Furcht vor Strafe und der Hoffnung auf Lohn zu leben, die sie für
uns bereit hält. Aber damit ist nicht gesagt, dass es – selbst im materiellen Sinne – keinen Lohn für das Gute und keine Strafe für das Böse gäbe. Das giebt es ganz unstreitig, aber Lohn und Strafe kommen von wo anders, als wir wähnen, und solange wir annehmen, dass sie aus einem unerreichbaren Lande kommen, uns überschauen, richten und uns folglich ersparen, uns selbst zu richten, begehen wir den verhängnisvollsten Irrtum; denn keiner hat mehr Einfluss auf unsere Art, uns gegen das Unglück zu schützen und unser berechtigtes Glück zu suchen.
 Die Summe der Gerechtigkeit, die wir trotzdem in der Natur finden, entspringt indessen nicht aus ihr, sondern aus uns allein; wir legen sie unbewusst in die Natur hinein, indem wir uns in die Dinge einmischen, sie beseelen und uns ihrer bedienen. In unserem Leben trifft nicht nur der Blitzstrahl oder ein Krankheitsfall, gleichgültig, welche Gedanken wir hegen, unverhofft zur Rechten oder Linken und ohne ersichtlichen Grund. Es giebt auch andere Fälle, und sie sind viel zahlreicher, wo wir auf die Wesen und Dinge um uns unmittelbar einwirken und sie mit unserer Persönlichkeit durchdringen, wo die Naturkräfte zu Werkzeugen unserer Gedanken werden, und wenn unsere Gedanken ungerecht sind, so missbrauchen sie diese Kräfte, rufen notwendiger Weise die Vergeltung wach und ziehen Unglück und Strafe nach sich. Aber die moralische Reaktion liegt nicht in der Natur, sie entsteht aus unsern
eigenen Gedanken, oder aus denen anderer Menschen. Unser moralischer Zustand bestimmt unser Verhalten gegen die Aussenwelt und verfeindet uns mit ihr, weil wir im Zwist mit uns selbst leben, d. h. mit den Hauptgesetzen unseres Geistes und Herzens. Die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit unserer Absichten hat keinerlei Einfluss auf die Haltung der Natur gegen uns, aber fast immer ist sie von entscheidendem Einfluss auf unsere Haltung gegen die Natur. Hier wie in den Fragen der sozialen Gerechtigkeit schreiben wir dem Weltall oder einem unfassbaren, ewigen Schicksalsprinzip die Rolle zu, die wir selber spielen, und wenn wir sagen, dass der Himmel, die Natur, die Gerechtigkeit oder die Dinge uns strafen, sich empören und rächen, so ist es im Grunde der Mensch, der durch die Dinge hindurch den Menschen straft, die menschliche Natur, die sich empört, und die menschliche Gerechtigkeit, die sich rächt.
Die Summe der Gerechtigkeit, die wir trotzdem in der Natur finden, entspringt indessen nicht aus ihr, sondern aus uns allein; wir legen sie unbewusst in die Natur hinein, indem wir uns in die Dinge einmischen, sie beseelen und uns ihrer bedienen. In unserem Leben trifft nicht nur der Blitzstrahl oder ein Krankheitsfall, gleichgültig, welche Gedanken wir hegen, unverhofft zur Rechten oder Linken und ohne ersichtlichen Grund. Es giebt auch andere Fälle, und sie sind viel zahlreicher, wo wir auf die Wesen und Dinge um uns unmittelbar einwirken und sie mit unserer Persönlichkeit durchdringen, wo die Naturkräfte zu Werkzeugen unserer Gedanken werden, und wenn unsere Gedanken ungerecht sind, so missbrauchen sie diese Kräfte, rufen notwendiger Weise die Vergeltung wach und ziehen Unglück und Strafe nach sich. Aber die moralische Reaktion liegt nicht in der Natur, sie entsteht aus unsern
eigenen Gedanken, oder aus denen anderer Menschen. Unser moralischer Zustand bestimmt unser Verhalten gegen die Aussenwelt und verfeindet uns mit ihr, weil wir im Zwist mit uns selbst leben, d. h. mit den Hauptgesetzen unseres Geistes und Herzens. Die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit unserer Absichten hat keinerlei Einfluss auf die Haltung der Natur gegen uns, aber fast immer ist sie von entscheidendem Einfluss auf unsere Haltung gegen die Natur. Hier wie in den Fragen der sozialen Gerechtigkeit schreiben wir dem Weltall oder einem unfassbaren, ewigen Schicksalsprinzip die Rolle zu, die wir selber spielen, und wenn wir sagen, dass der Himmel, die Natur, die Gerechtigkeit oder die Dinge uns strafen, sich empören und rächen, so ist es im Grunde der Mensch, der durch die Dinge hindurch den Menschen straft, die menschliche Natur, die sich empört, und die menschliche Gerechtigkeit, die sich rächt.
 Ich führte einmal
In der deutschen Ausgabe von »Weisheit und Schicksal«, II. Auflage, S. 42-57. (Siehe auch die Einleitung.) das Beispiel Napoleons und seiner drei schreiendsten und berüchtigtesten Ungerechtigkeiten an, welche seinem Schicksal auch die verhängnisvollsten werden sollten. Es waren dies die Ermordung des Herzogs von Enghien, der ohne Richterspruch und Beweise, durch blossen Machtspruch verurteilt und in den Festungsgräben von Vincennes erschossen wurde. Dieser Mord rief einen fortan unversöhnlichen Hass und ein Rachegelüste gegen den ungerechten Diktator wach, das nicht mehr entwaffnet werden sollte. Zweitens die schändliche Falle von
Bayonne, in die er durch gemeine Ränke die gutmütigen und vertrauensseligen spanischen Bourbonen lockte, und der schreckliche Krieg, den dieser Verrat zur Folge hatte, – ein Krieg, der dreimalhunderttausend Krieger, die ganze Energie und sittliche Kraft Frankreichs, das Prestige, fast alle Garantieen, alle Hingebung und alle glücklichen Aussichten des Kaiserreiches verschlang. Endlich der furchtbare russische Feldzug, der mit dem Untergange seines Sterns in den eisigen Fluten der Beresina endigte.
Ich führte einmal
In der deutschen Ausgabe von »Weisheit und Schicksal«, II. Auflage, S. 42-57. (Siehe auch die Einleitung.) das Beispiel Napoleons und seiner drei schreiendsten und berüchtigtesten Ungerechtigkeiten an, welche seinem Schicksal auch die verhängnisvollsten werden sollten. Es waren dies die Ermordung des Herzogs von Enghien, der ohne Richterspruch und Beweise, durch blossen Machtspruch verurteilt und in den Festungsgräben von Vincennes erschossen wurde. Dieser Mord rief einen fortan unversöhnlichen Hass und ein Rachegelüste gegen den ungerechten Diktator wach, das nicht mehr entwaffnet werden sollte. Zweitens die schändliche Falle von
Bayonne, in die er durch gemeine Ränke die gutmütigen und vertrauensseligen spanischen Bourbonen lockte, und der schreckliche Krieg, den dieser Verrat zur Folge hatte, – ein Krieg, der dreimalhunderttausend Krieger, die ganze Energie und sittliche Kraft Frankreichs, das Prestige, fast alle Garantieen, alle Hingebung und alle glücklichen Aussichten des Kaiserreiches verschlang. Endlich der furchtbare russische Feldzug, der mit dem Untergange seines Sterns in den eisigen Fluten der Beresina endigte.
»Ich weiss wohl«, sagte ich damals, »dass diese ungeheuren Katastrophen auf die verschiedenartigsten Ursachen zurückzuführen sind; indessen, wenn man von allen äusseren Umständen, allen mehr oder minder unvorhergesehenen Zwischenfällen bis zur Veränderung eines Charakters, bis zu Thorheiten und Gewaltthaten, bis zum Grössenwahn und zur Geistesumnachtung Schritt für Schritt zurückgeht: dünkt es uns da nicht, als stünde der schweigende Schatten der verkannten menschlichen Gerechtigkeit an der Quelle des Unglücks? Jener Gerechtigkeit, die alles in allem nichts sehr Übernatürliches und Geheimnisvolles hat, die aus sehr erklärlichen Ansprüchen, aus tausend kleinen sehr realen Thatsachen, unzähligen Irrtümern und Unwahrheiten besteht und keineswegs in einem tragischen Augenblicke, plötzlich und waffenstarrend, wie die antike Göttin, aus der entscheidungsschwangeren Stirne des Schicksals hervorspringt. Nur etwas ist bei alledem geheimnisvoll, das ist das ewige Gegenwärtigsein der menschlichen Gerechtigkeit; aber wir wissen ja, dass die menschliche Natur sehr geheimnisvoll ist. Verharren wir einen Augenblick bei diesem Mysterium. Es ist das gewisseste, das tiefste, das heilsamste. Es ist das einzige, das die menschliche Güte nie lähmen wird. Und wenn wir jenen geduldigen und wachsamen Schatten nicht in jedem Leben in gleichem Maasse vorfinden, wie im Leben Napoleons, wenn die Gerechtigkeit nicht immer so wirksam, so unerbittlich erscheint, wie dort, so verlohnt es sich doch, sie überall aufzudecken, wo sie hervortritt. Und wenn dies zu Zweifeln und Unsicherheit führt, so sind diese doch bessere Ratgeber, als das leichtfertige, faule und blinde Leugnen oder Behaupten, wie wir es uns so häufig erlauben; denn es handelt sich in Fragen dieser Art nicht sowohl darum, etwas zu beweisen, als darauf aufmerksam zu machen, und eine gewisse mutige und ernsthafte Ehrfurcht gegen alles einzuflössen, was in den Thaten der Menschen, in ihrer Gebundenheit an Gesetze, die allgemein zu sein scheinen, und in den Folgen dieser Gesetze noch unaufgeklärt bleibt.«
 Bemühen wir uns, die wahrhaft verhängnisvolle Wirkung des grossen Mysteriums der Gerechtigkeit in uns aufzudecken. Im Gemüte des Menschen, der ein Unrecht begeht, spielt sich ein unvergleichliches Drama ab, und dieses Drama ist um so gefährlicher und verhängnisvoller, je grösser der Mensch ist und je mehr sein Geist umfasst.
Bemühen wir uns, die wahrhaft verhängnisvolle Wirkung des grossen Mysteriums der Gerechtigkeit in uns aufzudecken. Im Gemüte des Menschen, der ein Unrecht begeht, spielt sich ein unvergleichliches Drama ab, und dieses Drama ist um so gefährlicher und verhängnisvoller, je grösser der Mensch ist und je mehr sein Geist umfasst.
Napoleon hat gut reden, dass in solchen stürmischen Augenblicken die Moral eines grossen Daseins nicht so einfach sein kann, wie die des Alltagslebens, dass ein starker und thätiger Wille Rechte hat, die ein schwacher und stockender Wille nicht hat, dass man gewisse Gewissenskrupel mit desto grösserer Berechtigung niederschlagen kann, je weniger dies aus Unwissenheit oder Schwäche geschieht, da ja ihre vorübergehende Unterdrückung, wenn man aus grösserer Höhe auf sie herabsieht, als der Durchschnitt, ein Sieg des Verstandes und der Kraft ist, dass man ein gewaltiges und ruhmvolles Ziel hat und dass es nichts auf sich hat, Böses zu thun, wenn man nur weiss, dass und warum man es thut. Dies alles kann die Grundlagen unserer Natur nicht betrügen. Jede Ungerechtigkeit erschüttert das Vertrauen, das ein Wesen in sich und in sein Schicksal setzt. Es hat zu einer gegebenen Zeit, gewöhnlich in seiner ernstesten Stunde, darauf verzichtet, nur auf sich selbst zu bauen. Das vergisst sein Gedächtnis nicht, und von nun an wird sich dieser Mensch nie mehr ganz wiederfinden. Er hat sein Glück aus dem Gleichgewicht gebracht und wahrscheinlich für immer verscherzt, als er fremden Mächten Einlass gewährte. Er hat das deutliche Gefühl seiner Persönlichkeit und seiner Kraft verloren. Er unterscheidet nicht mehr ganz klar, was er sich selbst verdankt, und was er immerfort den verderblichen Mithelfern entlehnt, die seine Ohnmacht herbeigerufen hat. Er ist nicht mehr der Feldherr, der seinem Soldatenheer gebietet; er ist der Bandenführer, der nur Helfershelfer hat. Er hat seine Menschenwürde aufgegeben, die keinen Ruhm will, zu dem man in seinem Herzen traurig lächelt, wie man einem untreuen Weibe lächelt, das man liebt.
Der wirklich starke Mensch prüft sorgfältig die Anerkennung und die Vorteile, die ihm aus seinen Thaten erwachsen sind, und verwirft stillschweigend alles, was die Grenzlinie überschreitet, die er sich in seinem Gewissen gezogen hat. Er wird um so stärker sein, je enger diese Linie sich an die anschliesst, welche die geheime Wahrheit, die allen Dingen zu Grunde liegt, ebendort gezogen hat. Ein Akt der Ungerechtigkeit ist fast immer ein Eingeständnis unserer Ohnmacht gegenüber dem Schicksal, und es bedarf nicht vieler Geständnisse dieser Art, um dem Feinde den verwundbarsten Fleck unserer Seele zu offenbaren. Eine Ungerechtigkeit begehen, um einen kleinen Ruhm zu ernten, oder sich den Ruhm zu sichern, den man schon besitzt, heisst sich die Unfähigkeit eingestehen, das zu erreichen oder festzuhalten, was man sich wünscht, heisst bekennen, dass man die Rolle, die man sich erwählt hat, nicht ehrlich ausfüllen kann. Aber trotzdem will man sich oben halten, und damit nehmen die Verrechnungen, Täuschungen und Lügen ihren Anfang im Leben …
Endlich, nach zwei oder drei Falschheiten, zwei- oder dreimaligem Verrat, einigen Treulosigkeiten, einer gewissen Zahl von Lügen, schuldigen Unterlassungen und Schwächen, bietet uns unsere Vergangenheit nur noch ein entmutigendes Bild; und wir haben es doch so nötig, dass unsere Vergangenheit uns unterstützt! In ihr allein kennen wir uns wirklich; sie spricht zu uns in unseren Zweifeln: »Da du jenes thatest, kannst du auch dieses thun. In jener Gefahr, in jenem bangen Augenblicke hast du nicht gezagt. Du hast Vertrauen in dich gesetzt und hast gesiegt. Die Umstände sind die gleichen, bewahre deinen Glauben unerschüttert, dein Stern wird treu sein.« Was aber sollen wir antworten, wenn unsere Vergangenheit uns zuraunt: »Es ist dir bisher nur mit Hilfe von Ungerechtigkeit und Lüge gelungen, folglich musst du noch einmal lügen und betrügen.« Niemand lässt seine ermüdeten Augen gern wieder zu einer Lüge, einer Niedrigkeit, einer Treulosigkeit zurückschweifen; und alles Gewesene, das wir nicht fest, klar und befriedigt ins Auge fassen können, beengt den Horizont unserer Zukunft. Nur wenn wir die Vergangenheit weithin zurückverfolgen können, erlangt unser Auge die Kraft, in die Zukunft zu dringen.
 Nein, nicht weil die Dinge gerecht sind, wurde Napoleon für seine drei grossen Rechtsschändungen bestraft und werden wir für die unseren Strafe erleiden, wenn auch weniger auffällig, aber doch nicht minder schmerzvoll. Nicht, weil es, »so weit der Himmel sich dehnt«, eine unwiderstehliche Gerechtigkeit giebt, die sich nicht verführen oder täuschen lässt, sondern weil der Geist und Charakter des Menschen, kurz, sein ganzes moralisches Wesen, nur in der Gerechtigkeit leben und wirken kann. Sobald er sie verlässt, verlässt er sein eigenstes Element und wird gewissermassen auf einen völlig
unbekannten Planeten versetzt, wo der Grund ihm unter den Füssen weicht und alles ihn verwirrt; denn wenn selbst die bescheidenste Vernunft sich in der Gerechtigkeit zu Hause fühlt und alle Folgen einer gerechten Handlung ohne Mühe voraussagen kann, so fühlt sich selbst die tiefste und scharfsichtigste Vernunft in ihrer eigenen Ungerechtigkeit wie in der Fremde, und es gelingt ihr nicht, auch nur den zehnten Teil ihrer Folgen vorherzusehen. Der Genius braucht nur den Versuch zu machen, von dem Gerechtigkeitsgefühl, das im Herzen des schlichten Landmannes liegt, etwas abzuweichen, und er weiss nicht mehr genau, wo er ist; wie wird es also erst sein, wenn er die Schranken seiner eigenen Gerechtigkeit überschreitet! Denn wenn die Gerechtigkeit vom Verstande in grössere Höhe gehoben wird, so setzt sie allem, was sie entdeckt, neue Schranken und verstärkt zugleich die alten, die der Instinkt gesetzt hatte, indem sie sie immer unübersteiglicher macht. Es kommt uns sofort alles aus der Hand, wenn wir die Grenze der einfachen Billigkeit überschreiten; eine Lüge erzeugt hundert, und ein Verrat zahlt sich tausendfach heim. Solange wir in der Gerechtigkeit leben, leben wir voller Zuversicht, denn es giebt Dinge, welche selbst die grössten Verräter nicht mit Verrat besudeln können, aber sobald wir zur Ungerechtigkeit übergehen, müssen wir selbst den Gerechtesten misstrauen, denn es giebt Dinge, bei denen selbst sie nicht treu bleiben können. Unser ganzer moralischer Organismus ist dazu gemacht, in der Gerechtigkeit zu leben, wie unser Körper dazu gemacht ist, in
der Atmosphäre unseres Erdballs zu leben. Alle unsere Fähigkeiten beruhen in viel tieferem Sinne auf ihr, als auf den Gesetzen der Schwerkraft, der Wärme oder des Lichtes, und wenn man sie in Ungerechtigkeit taucht, taucht man sie wirklich ins Unbekannte und Feindselige. Alles in uns ist auf die Gerechtigkeit hin geordnet, alles läuft darauf hinaus, führt uns ihr zu und eilt ihr entgegen, wogegen wir im Grunde der Ungerechtigkeit beständig gegen unsere eigenen Kräfte anringen; und wenn zur Stunde der unausbleiblichen Vergeltung die Dinge, der Himmel, die Welt oder das Unsichtbare sich empören und endlich gerecht erscheinen, indem sie gegen uns Partei ergreifen gegen uns, die wir weinen und bereuen, so bedeutet das nicht, dass sie gerecht wären oder je gewesen wären, sondern, dass wir trotz unserer Thaten selbst in der Ungerechtigkeit gerecht geblieben sind.
Nein, nicht weil die Dinge gerecht sind, wurde Napoleon für seine drei grossen Rechtsschändungen bestraft und werden wir für die unseren Strafe erleiden, wenn auch weniger auffällig, aber doch nicht minder schmerzvoll. Nicht, weil es, »so weit der Himmel sich dehnt«, eine unwiderstehliche Gerechtigkeit giebt, die sich nicht verführen oder täuschen lässt, sondern weil der Geist und Charakter des Menschen, kurz, sein ganzes moralisches Wesen, nur in der Gerechtigkeit leben und wirken kann. Sobald er sie verlässt, verlässt er sein eigenstes Element und wird gewissermassen auf einen völlig
unbekannten Planeten versetzt, wo der Grund ihm unter den Füssen weicht und alles ihn verwirrt; denn wenn selbst die bescheidenste Vernunft sich in der Gerechtigkeit zu Hause fühlt und alle Folgen einer gerechten Handlung ohne Mühe voraussagen kann, so fühlt sich selbst die tiefste und scharfsichtigste Vernunft in ihrer eigenen Ungerechtigkeit wie in der Fremde, und es gelingt ihr nicht, auch nur den zehnten Teil ihrer Folgen vorherzusehen. Der Genius braucht nur den Versuch zu machen, von dem Gerechtigkeitsgefühl, das im Herzen des schlichten Landmannes liegt, etwas abzuweichen, und er weiss nicht mehr genau, wo er ist; wie wird es also erst sein, wenn er die Schranken seiner eigenen Gerechtigkeit überschreitet! Denn wenn die Gerechtigkeit vom Verstande in grössere Höhe gehoben wird, so setzt sie allem, was sie entdeckt, neue Schranken und verstärkt zugleich die alten, die der Instinkt gesetzt hatte, indem sie sie immer unübersteiglicher macht. Es kommt uns sofort alles aus der Hand, wenn wir die Grenze der einfachen Billigkeit überschreiten; eine Lüge erzeugt hundert, und ein Verrat zahlt sich tausendfach heim. Solange wir in der Gerechtigkeit leben, leben wir voller Zuversicht, denn es giebt Dinge, welche selbst die grössten Verräter nicht mit Verrat besudeln können, aber sobald wir zur Ungerechtigkeit übergehen, müssen wir selbst den Gerechtesten misstrauen, denn es giebt Dinge, bei denen selbst sie nicht treu bleiben können. Unser ganzer moralischer Organismus ist dazu gemacht, in der Gerechtigkeit zu leben, wie unser Körper dazu gemacht ist, in
der Atmosphäre unseres Erdballs zu leben. Alle unsere Fähigkeiten beruhen in viel tieferem Sinne auf ihr, als auf den Gesetzen der Schwerkraft, der Wärme oder des Lichtes, und wenn man sie in Ungerechtigkeit taucht, taucht man sie wirklich ins Unbekannte und Feindselige. Alles in uns ist auf die Gerechtigkeit hin geordnet, alles läuft darauf hinaus, führt uns ihr zu und eilt ihr entgegen, wogegen wir im Grunde der Ungerechtigkeit beständig gegen unsere eigenen Kräfte anringen; und wenn zur Stunde der unausbleiblichen Vergeltung die Dinge, der Himmel, die Welt oder das Unsichtbare sich empören und endlich gerecht erscheinen, indem sie gegen uns Partei ergreifen gegen uns, die wir weinen und bereuen, so bedeutet das nicht, dass sie gerecht wären oder je gewesen wären, sondern, dass wir trotz unserer Thaten selbst in der Ungerechtigkeit gerecht geblieben sind.
 Wir sagen, die Natur wüsste nichts von unserer Moral, und wenn unsere Moral uns geböte, unsern Nächsten zu töten und ihm möglichst viel Böses zu thun, so würde sie uns darin unterstützen, wie sie uns jetzt hilft, ihm beizustehen und ihn so glücklich zu machen, wie wir können. Es würde oft scheinen, als belohnte sie uns für das Böse, das wir ihm angethan haben, wie es jetzt oft scheint, als belohnte sie uns dafür, dass wir ihn gerettet haben. Ist aber darum schon die Schlussfolgerung erlaubt, dass die Natur keine Moral hat, – das Wort Moral im beschränktesten Sinne gefasst, den es haben kann,
d. h. als logische und unbeugsame Unterordnung der Mittel zur Verrichtung einer allgemeinen Aufgabe? Man darf diese Frage nicht zu vorschnell lösen wollen. Wir kennen das Ziel der Natur durchaus nicht, und wenn sie ein solches hat, so kennen wir den Grad ihres Bewusstseins nicht und wissen überhaupt nicht, ob sie eines hat. Alles, was wir feststellen können, ist nicht, ob und was sie denkt, sondern, was sie thut und wie sie es thut. Und wir werden alsdann inne, dass zwischen unserer Moral und ihrer Art zu handeln derselbe Widerspruch besteht, wie zwischen unserm Instinkt, den wir von ihr haben, und unserm Bewusstsein, das wir im letzten Grunde auch von ihr haben; doch haben wir es uns selbst gebildet und im Dienste der höchsten menschlichen Moral den Wünschen unseres Instinktes immer entschlossener entgegen gesetzt. Wenn wir nur diesem Gehör gäben, so würden wir genau so handeln, wie die Natur, die in den unentschuldbarsten Kriegen, den offenkundigsten Akten der Barbarei und der Rechtsschändung immer dem Stärksten Recht giebt und anscheinend nur auf den Triumph des Unbedenklichsten und Bestbewaffneten ausgeht. Wir würden auf nichts als auf unsere Macht bedacht sein und auf Rechte und Leiden, auf Unschuld und Schönheit, auf moralische oder geistige Überlegenheit unserer Opfer keine Rücksicht nehmen. Aber warum hat sie uns dann ein Gewissen gegeben, das uns dies verbietet, und ein Gerechtigkeitsgefühl, das uns verhindert, dasselbe zu wollen, wie sie? Haben wir es uns selbst gegeben? Können wir etwas,
das in der Natur nicht vorhanden ist, aus uns selbst entwickeln, und können wir eine Kraft, die sich gegen ihre Kraft auflehnt, in so ungewöhnlichem Masse steigern? Und
wenn wir dies können, erlaubt die Natur es ohne Grund,
dass wir es können? Warum in uns, und nirgends wo anders, diese beiden unvereinbaren Tendenzen, die abwechselnd die Oberhand gewinnen, aber nie aufhören, in der Menschenbrust zu kämpfen? Wäre die eine vielleicht zu gefährlich ohne die andere? Würde sie vielleicht über das Ziel hinausschiessen, und würde der Wille zur Macht ohne das Gerechtigkeitsgefühl vielleicht zur Vernichtung führen, ebenso wie das Gerechtigkeitsgefühl ohne den Willen zur Macht die tote Unbeweglichkeit zur Folge haben könnte? Aber welche von beiden Tendenzen ist die natürlichere und notwendigere, welche ist die engste, und welche ist die weiteste, welche ist zeitlich, und welche ist ewig? Wer wird uns sagen, welche wir bekämpfen müssen, und welche wir ermutigen sollen? Sollen wir uns nach einem unstreitig allgemeineren Gesetze richten oder ein augenscheinliches Ausnahmegesetz in unserem Busen bestärken? Giebt es Verhältnisse, unter denen wir das Recht haben, auf das unbestreitbare Ideal des Lebens zuzusteuern? Ist es unsere Pflicht, der Moral der Art oder Rasse zu folgen, die unabweislich scheint und einen Teil der dunklen und unbekannten Absichten der Natur sichtbar darstellt? Oder ist es vielmehr unerlässlich, in sich eine individuelle Moral zu entwickeln, die von derjenigen der Art abweicht?
Wir sagen, die Natur wüsste nichts von unserer Moral, und wenn unsere Moral uns geböte, unsern Nächsten zu töten und ihm möglichst viel Böses zu thun, so würde sie uns darin unterstützen, wie sie uns jetzt hilft, ihm beizustehen und ihn so glücklich zu machen, wie wir können. Es würde oft scheinen, als belohnte sie uns für das Böse, das wir ihm angethan haben, wie es jetzt oft scheint, als belohnte sie uns dafür, dass wir ihn gerettet haben. Ist aber darum schon die Schlussfolgerung erlaubt, dass die Natur keine Moral hat, – das Wort Moral im beschränktesten Sinne gefasst, den es haben kann,
d. h. als logische und unbeugsame Unterordnung der Mittel zur Verrichtung einer allgemeinen Aufgabe? Man darf diese Frage nicht zu vorschnell lösen wollen. Wir kennen das Ziel der Natur durchaus nicht, und wenn sie ein solches hat, so kennen wir den Grad ihres Bewusstseins nicht und wissen überhaupt nicht, ob sie eines hat. Alles, was wir feststellen können, ist nicht, ob und was sie denkt, sondern, was sie thut und wie sie es thut. Und wir werden alsdann inne, dass zwischen unserer Moral und ihrer Art zu handeln derselbe Widerspruch besteht, wie zwischen unserm Instinkt, den wir von ihr haben, und unserm Bewusstsein, das wir im letzten Grunde auch von ihr haben; doch haben wir es uns selbst gebildet und im Dienste der höchsten menschlichen Moral den Wünschen unseres Instinktes immer entschlossener entgegen gesetzt. Wenn wir nur diesem Gehör gäben, so würden wir genau so handeln, wie die Natur, die in den unentschuldbarsten Kriegen, den offenkundigsten Akten der Barbarei und der Rechtsschändung immer dem Stärksten Recht giebt und anscheinend nur auf den Triumph des Unbedenklichsten und Bestbewaffneten ausgeht. Wir würden auf nichts als auf unsere Macht bedacht sein und auf Rechte und Leiden, auf Unschuld und Schönheit, auf moralische oder geistige Überlegenheit unserer Opfer keine Rücksicht nehmen. Aber warum hat sie uns dann ein Gewissen gegeben, das uns dies verbietet, und ein Gerechtigkeitsgefühl, das uns verhindert, dasselbe zu wollen, wie sie? Haben wir es uns selbst gegeben? Können wir etwas,
das in der Natur nicht vorhanden ist, aus uns selbst entwickeln, und können wir eine Kraft, die sich gegen ihre Kraft auflehnt, in so ungewöhnlichem Masse steigern? Und
wenn wir dies können, erlaubt die Natur es ohne Grund,
dass wir es können? Warum in uns, und nirgends wo anders, diese beiden unvereinbaren Tendenzen, die abwechselnd die Oberhand gewinnen, aber nie aufhören, in der Menschenbrust zu kämpfen? Wäre die eine vielleicht zu gefährlich ohne die andere? Würde sie vielleicht über das Ziel hinausschiessen, und würde der Wille zur Macht ohne das Gerechtigkeitsgefühl vielleicht zur Vernichtung führen, ebenso wie das Gerechtigkeitsgefühl ohne den Willen zur Macht die tote Unbeweglichkeit zur Folge haben könnte? Aber welche von beiden Tendenzen ist die natürlichere und notwendigere, welche ist die engste, und welche ist die weiteste, welche ist zeitlich, und welche ist ewig? Wer wird uns sagen, welche wir bekämpfen müssen, und welche wir ermutigen sollen? Sollen wir uns nach einem unstreitig allgemeineren Gesetze richten oder ein augenscheinliches Ausnahmegesetz in unserem Busen bestärken? Giebt es Verhältnisse, unter denen wir das Recht haben, auf das unbestreitbare Ideal des Lebens zuzusteuern? Ist es unsere Pflicht, der Moral der Art oder Rasse zu folgen, die unabweislich scheint und einen Teil der dunklen und unbekannten Absichten der Natur sichtbar darstellt? Oder ist es vielmehr unerlässlich, in sich eine individuelle Moral zu entwickeln, die von derjenigen der Art abweicht?
![]()
 Alles in allem ist dies die wissenschaftlich vielleicht unlösbare Frage, auf welcher die Entwickelungsethik beruht, noch einmal, nur in anderer Form. Die Entwickelungsethik geht, ohne dass sie dies auszusprechen wagte, von der
Gerechtigkeit der Natur aus, die jedes Individuum die guten oder schlimmen Folgen seiner eigenen Natur und seiner eigenen Handlungen tragen lässt. Und andererseits ist sie gezwungen, die von ihr nur mit innerem Widerstreben so genannte
Gleichgiltigkeit oder
Ungerechtigkeit der Natur zu beschwören, wenn sie gewisse, an sich ungerechte, aber dem Wachstum der Art förderliche Handlungen rechtfertigen muss. Es handelt sich also um zwei unbekannte Ziele – das der Natur und das der Menschheit – Ziele, die sich in unserem Geiste nicht vereinen lassen. Im Grunde bilden alle diese Fragen nur eine, und sie ist für uns die ernsteste in der gegenwärtigen Moral. Es gewinnt gerade jetzt den Anschein, als erlangte die Art ein vielleicht vorzeitiges und verhängnisvolles Bewusstsein – nicht ihrer Rechte, denn das Problem ist noch in der Schwebe, wohl aber gewisser aussermoralischer Eigenschaften der Geschichte.
Alles in allem ist dies die wissenschaftlich vielleicht unlösbare Frage, auf welcher die Entwickelungsethik beruht, noch einmal, nur in anderer Form. Die Entwickelungsethik geht, ohne dass sie dies auszusprechen wagte, von der
Gerechtigkeit der Natur aus, die jedes Individuum die guten oder schlimmen Folgen seiner eigenen Natur und seiner eigenen Handlungen tragen lässt. Und andererseits ist sie gezwungen, die von ihr nur mit innerem Widerstreben so genannte
Gleichgiltigkeit oder
Ungerechtigkeit der Natur zu beschwören, wenn sie gewisse, an sich ungerechte, aber dem Wachstum der Art förderliche Handlungen rechtfertigen muss. Es handelt sich also um zwei unbekannte Ziele – das der Natur und das der Menschheit – Ziele, die sich in unserem Geiste nicht vereinen lassen. Im Grunde bilden alle diese Fragen nur eine, und sie ist für uns die ernsteste in der gegenwärtigen Moral. Es gewinnt gerade jetzt den Anschein, als erlangte die Art ein vielleicht vorzeitiges und verhängnisvolles Bewusstsein – nicht ihrer Rechte, denn das Problem ist noch in der Schwebe, wohl aber gewisser aussermoralischer Eigenschaften der Geschichte.
Dieses beunruhigende Bewusstsein scheint sich auch in unserm individuellen Leben allmählich bemerkbar zu machen. Zweimal haben wir im Laufe eines Jahres, oder doch fast eines Jahres, die Frage auftauchen und an Umfang gewinnen sehen, einmal bei Gelegenheit der Vertreibung der Spanier aus Amerika (wenn sie hier auch nicht ganz klar lag, denn Spanien hat schon zu lange Schuld auf Schuld gehäuft, und das Problem ist hier also verschoben worden), das andere Mal, als ein Unschuldiger den angeblichen Interessen des Vaterlandes geopfert wurde. Die Sache ist freilich nicht neu. Der Mensch hat stets versucht, sein Unrecht zu rechtfertigen, und wenn die menschliche Gerechtigkeit ihm keinen Vorwand und keine Entschuldigung bot, so beschwor er den Willen der Götter als oberstes Gesetz über sein eigenes Recht und Unrecht. Aber die heute gebrauchten Ausreden oder Entschuldigungen bedrohen unsere Moral weit gefährlicher, vorausgesetzt, dass ein Naturgesetz oder eine Eigenschaft der Natur beschworen wird, die wirklicher, unanfechtbarer und allgemeiner ist, als der Wille eines vergänglichen Volksgottes.
Soll die Kraft oder die Gerechtigkeit den Sieg erringen, oder wohnt der Kraft eine unbekannte Gerechtigkeit inne, in der unsere menschliche Gerechtigkeit aufgehen kann, oder endlich ist unser Gerechtigkeitsgefühl, das der blinden Kraft zu widerstreben scheint, im Grunde genommen doch nur ein letzter Ausfluss dieser Kraft, geht es auf dasselbe Ziel aus, und sehen wir nur nicht, dass es in ihr seinen Ursprung hat? Um hierauf zu antworten, müsste man selbst nicht ein Teil dieses Mysteriums sein, das aufgeklärt werden soll. Man müsste es aus einer höheren Welt betrachten können, man müsste das Weltenziel und die Geschicke der Menschheit kennen. Inzwischen geben wir dadurch, dass wir der Natur Recht geben, dem Gerechtigkeitsinstinkt, den sie in uns gelegt hat und der darum folglich auch zur Natur gehört, jedenfalls Unrecht; und wenn wir diesen Instinkt bejahen, so müssen wir diese Bejahung aus dem in Frage stehenden Gegenstand schöpfen.
 Das ist nicht zu leugnen, aber ebenso wahr ist es, dass der Mensch von alters her die Angewohnheit hat und sich vergeblich müht, die Welt in einen abstrakten Begriff einzukerkern. Es ist sehr gefahrvoll, im Unbekannten und Unerkennbaren mit einer scheinbaren Logik zu operieren, und hier scheinen unsere Bedenken sogar aus einer nicht minder gewagten Abstraktion herzurühren. Wir sagen uns oft mit lauter Stimme, noch öfter mit leiser, dass wir Kinder der Natur sind und uns folglich nach ihren Gesetzen zu richten, ihrem Vorbild in allen Dingen nachzueifern haben. Nun aber kümmert sich die Natur nicht im mindesten um Gerechtigkeit; sie hat ein ganz anderes Ziel, nämlich die Erhaltung, die unaufhörliche Erneuerung und das Wachstum des Lebens, folglich … Wir sprechen diese Folgerung noch nicht aus, oder wenigstens wagt sie sich in unserer Moral noch nicht öffentlich zu zeigen; aber wenn sie bis auf diesen Tag nur geringe Störungen in dem kleinen Kreise unserer Familie, unserer Verwandten, Freunde und unmittelbaren Nächsten hervorgerufen hat, so beginnt sie nachgerade auf das ungeheure, trostlose Gebiet überzuschlagen, auf das wir unsere unbekannten, unsichtbaren, namenlosen Nächsten verweisen. Sie liegt schon vielen Handlungen
zu Grunde, sie bemächtigt sich unserer Politik, unserer Industrie, unseres Handels und fast alles dessen, was wir thun, sobald wir den engen Umkreis des häuslichen Herdes verlassen, der für die meisten Menschen der einzige Ort ist, wo noch ein bischen wahre Gerechtigkeit, ein wenig Wohlwollen und Liebe herrscht. Soziale Gesetze, wirtschaftliche Gesetze, Entwickelung, Auslese, Kampf ums Dasein, Konkurrenz – sie nimmt tausend Formen an, um Böses zu thun. Und doch ist nichts unberechtigter, als diese Folgerung, denn ohne dass man die obige Schlussfolgerung umzudrehen brauchte, was auch sehr seinen Sinn hätte, und zu sagen, dass in der Natur eine gewisse Gerechtigkeit herrschen muss, da wir, ihre Kinder, gerecht sind, so genügt es doch, sie so zu nehmen, wie sie ist, und darauf hinzuweisen, dass nichts geheimnisvoller und anfechtbarer ist, als zum mindesten eine der beiden Voraussetzungen. Wir haben weiter oben gesehen, dass die Natur in Bezug auf uns nicht gerecht zu sein scheint, aber wir wissen durchaus nicht, ob sie nicht in Bezug auf sich selbst gerecht ist. Daraus, dass sie sich um die Sittlichkeit oder Unsittlichkeit unserer Handlungen nicht kümmert, folgt doch noch nicht, dass sie überhaupt keine Moral hat und dass unsere Moral die einzig mögliche ist. Wir können zugeben, dass die Natur auf unsere guten und schlechten Absichten nicht achtet, aber wir dürfen daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass sie jeder Moralität und Billigkeit bar ist; das hiesse ja implicite behaupten, dass es keine Geheimnisse, keine Mysterien
mehr giebt und dass wir Gesetze, Ursprung und Ziel des Weltganzen kennen. Sie handelt nicht, wie wir, aber ich wiederhole es, wir wissen durchaus nicht, warum sie anders handelt, und wir haben nicht das Recht, jemanden nachzuahmen, der uns etwas Grausames und Ungerechtes zu thun scheint, solange wir die – vielleicht tiefen und heilsamen – Gründe, um deren willen er es thut, nicht gründlich kennen. Wo will die Natur hinaus? Wonach trachten die Welten im Schosse der Ewigkeit? Wo fängt das Bewusstsein an, und kann es keine andere Form haben, als die, welche es in uns annimmt? Von wo ab sind die physikalischen Gesetze auch Moralgesetze? Ist das Leben bewusstlos? Kennen wir alle Eigenschaften der Materie, und wird sie einzig und allein in unserem Gehirn zum Geiste? Und was ist schliesslich die Gerechtigkeit, aus einer anderen Höhe gesehen? Bildet die Absicht notwendigerweise den Mittelpunkt ihres Systems, oder giebt es auch Fälle, wo die Absicht gar nicht mitzählt? Auf diese Fragen und auf eine Menge noch anderer müssten wir eine Antwort wissen, bevor wir entscheiden könnten, ob die Natur in Fällen, die ihren Grössenverhältnissen entsprechen, gerecht oder ungerecht ist. Sie verfügt über eine Zukunft in Raum und Zeit, von der wir uns keinen Begriff machen können, und hierin äussert sich vielleicht eine Gerechtigkeit, die ihrer Dauer, ihrer Ausdehnung und ihrem Ziel entspricht, ganz wie unser Gerechtigkeitsinstinkt der Dauer und dem engen Kreise unseres Lebens entspricht. Sie thut Jahrhunderte hindurch vielleicht etwas Böses, das sie in
Jahrhunderten wieder gut macht, aber wir haben nur einige Tage vor uns und sind darum nicht befähigt, etwas nachzumachen, was wir weder mit dem Blick umspannen, noch verfolgen oder begreifen können. Es gehen uns alle Vorbedingungen ab, aus denen heraus wir sie beurteilen könnten, sobald wir in die nächste Zukunft blicken. Wir brauchen gar nicht erst im fremden Weltraum zu suchen, wir brauchen uns nur an das winzige Pünktchen zu halten, das wir im Weltall sind, und wir wissen doch z. B. nichts über unser etwaiges Leben nach dem Tode und vergessen über unserm gegenwärtigen Bewusstsein, dass uns nichts zu der Annahme berechtigt, es gäbe kein mehr oder weniger bewusstes und verantwortliches Nachleben; wobei dieses Nachleben keineswegs von den Entscheidungen eines äusseren Willens abhängig gedacht zu werden braucht. Es wäre tollkühn, zu behaupten, dass von den Errungenschaften unseres Hirns, vom Streben unseres guten Willens weder in uns noch in anderen etwas übrig bleibt. Es ist möglich – und ernste Erfahrungen scheinen dies zwar nicht zu beweisen, aber doch zu gestatten, dass wir diese Annahme unter die wissenschaftlichen Möglichkeiten rechnen, – es ist möglich, dass ein Teil unserer Persönlichkeit oder unserer Nervenkraft sich nicht auflöst. Eröffnet sich hier nicht eine sehr weite Zukunft für die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung, die schliesslich immer zu einer Gerechtigkeit führen, wenn sie der menschlichen Seele bewusst werden und Jahrhunderte vor sich haben? Vergessen wir nicht, dass die Natur,
die wir ungerecht nennen, doch zum mindesten logisch ist, und dass es uns, wenn wir uns auch entschlössen, ungerecht zu werden, doch recht schwierig sein dürfte, es zu sein, denn wir müssten logisch bleiben, und wenn die Logik erst mit unseren Gedanken, Gefühlen, Leidenschaften und Absichten verquickt ist, – wer wollte sie dann noch von der Gerechtigkeit unterscheiden?
Das ist nicht zu leugnen, aber ebenso wahr ist es, dass der Mensch von alters her die Angewohnheit hat und sich vergeblich müht, die Welt in einen abstrakten Begriff einzukerkern. Es ist sehr gefahrvoll, im Unbekannten und Unerkennbaren mit einer scheinbaren Logik zu operieren, und hier scheinen unsere Bedenken sogar aus einer nicht minder gewagten Abstraktion herzurühren. Wir sagen uns oft mit lauter Stimme, noch öfter mit leiser, dass wir Kinder der Natur sind und uns folglich nach ihren Gesetzen zu richten, ihrem Vorbild in allen Dingen nachzueifern haben. Nun aber kümmert sich die Natur nicht im mindesten um Gerechtigkeit; sie hat ein ganz anderes Ziel, nämlich die Erhaltung, die unaufhörliche Erneuerung und das Wachstum des Lebens, folglich … Wir sprechen diese Folgerung noch nicht aus, oder wenigstens wagt sie sich in unserer Moral noch nicht öffentlich zu zeigen; aber wenn sie bis auf diesen Tag nur geringe Störungen in dem kleinen Kreise unserer Familie, unserer Verwandten, Freunde und unmittelbaren Nächsten hervorgerufen hat, so beginnt sie nachgerade auf das ungeheure, trostlose Gebiet überzuschlagen, auf das wir unsere unbekannten, unsichtbaren, namenlosen Nächsten verweisen. Sie liegt schon vielen Handlungen
zu Grunde, sie bemächtigt sich unserer Politik, unserer Industrie, unseres Handels und fast alles dessen, was wir thun, sobald wir den engen Umkreis des häuslichen Herdes verlassen, der für die meisten Menschen der einzige Ort ist, wo noch ein bischen wahre Gerechtigkeit, ein wenig Wohlwollen und Liebe herrscht. Soziale Gesetze, wirtschaftliche Gesetze, Entwickelung, Auslese, Kampf ums Dasein, Konkurrenz – sie nimmt tausend Formen an, um Böses zu thun. Und doch ist nichts unberechtigter, als diese Folgerung, denn ohne dass man die obige Schlussfolgerung umzudrehen brauchte, was auch sehr seinen Sinn hätte, und zu sagen, dass in der Natur eine gewisse Gerechtigkeit herrschen muss, da wir, ihre Kinder, gerecht sind, so genügt es doch, sie so zu nehmen, wie sie ist, und darauf hinzuweisen, dass nichts geheimnisvoller und anfechtbarer ist, als zum mindesten eine der beiden Voraussetzungen. Wir haben weiter oben gesehen, dass die Natur in Bezug auf uns nicht gerecht zu sein scheint, aber wir wissen durchaus nicht, ob sie nicht in Bezug auf sich selbst gerecht ist. Daraus, dass sie sich um die Sittlichkeit oder Unsittlichkeit unserer Handlungen nicht kümmert, folgt doch noch nicht, dass sie überhaupt keine Moral hat und dass unsere Moral die einzig mögliche ist. Wir können zugeben, dass die Natur auf unsere guten und schlechten Absichten nicht achtet, aber wir dürfen daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass sie jeder Moralität und Billigkeit bar ist; das hiesse ja implicite behaupten, dass es keine Geheimnisse, keine Mysterien
mehr giebt und dass wir Gesetze, Ursprung und Ziel des Weltganzen kennen. Sie handelt nicht, wie wir, aber ich wiederhole es, wir wissen durchaus nicht, warum sie anders handelt, und wir haben nicht das Recht, jemanden nachzuahmen, der uns etwas Grausames und Ungerechtes zu thun scheint, solange wir die – vielleicht tiefen und heilsamen – Gründe, um deren willen er es thut, nicht gründlich kennen. Wo will die Natur hinaus? Wonach trachten die Welten im Schosse der Ewigkeit? Wo fängt das Bewusstsein an, und kann es keine andere Form haben, als die, welche es in uns annimmt? Von wo ab sind die physikalischen Gesetze auch Moralgesetze? Ist das Leben bewusstlos? Kennen wir alle Eigenschaften der Materie, und wird sie einzig und allein in unserem Gehirn zum Geiste? Und was ist schliesslich die Gerechtigkeit, aus einer anderen Höhe gesehen? Bildet die Absicht notwendigerweise den Mittelpunkt ihres Systems, oder giebt es auch Fälle, wo die Absicht gar nicht mitzählt? Auf diese Fragen und auf eine Menge noch anderer müssten wir eine Antwort wissen, bevor wir entscheiden könnten, ob die Natur in Fällen, die ihren Grössenverhältnissen entsprechen, gerecht oder ungerecht ist. Sie verfügt über eine Zukunft in Raum und Zeit, von der wir uns keinen Begriff machen können, und hierin äussert sich vielleicht eine Gerechtigkeit, die ihrer Dauer, ihrer Ausdehnung und ihrem Ziel entspricht, ganz wie unser Gerechtigkeitsinstinkt der Dauer und dem engen Kreise unseres Lebens entspricht. Sie thut Jahrhunderte hindurch vielleicht etwas Böses, das sie in
Jahrhunderten wieder gut macht, aber wir haben nur einige Tage vor uns und sind darum nicht befähigt, etwas nachzumachen, was wir weder mit dem Blick umspannen, noch verfolgen oder begreifen können. Es gehen uns alle Vorbedingungen ab, aus denen heraus wir sie beurteilen könnten, sobald wir in die nächste Zukunft blicken. Wir brauchen gar nicht erst im fremden Weltraum zu suchen, wir brauchen uns nur an das winzige Pünktchen zu halten, das wir im Weltall sind, und wir wissen doch z. B. nichts über unser etwaiges Leben nach dem Tode und vergessen über unserm gegenwärtigen Bewusstsein, dass uns nichts zu der Annahme berechtigt, es gäbe kein mehr oder weniger bewusstes und verantwortliches Nachleben; wobei dieses Nachleben keineswegs von den Entscheidungen eines äusseren Willens abhängig gedacht zu werden braucht. Es wäre tollkühn, zu behaupten, dass von den Errungenschaften unseres Hirns, vom Streben unseres guten Willens weder in uns noch in anderen etwas übrig bleibt. Es ist möglich – und ernste Erfahrungen scheinen dies zwar nicht zu beweisen, aber doch zu gestatten, dass wir diese Annahme unter die wissenschaftlichen Möglichkeiten rechnen, – es ist möglich, dass ein Teil unserer Persönlichkeit oder unserer Nervenkraft sich nicht auflöst. Eröffnet sich hier nicht eine sehr weite Zukunft für die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung, die schliesslich immer zu einer Gerechtigkeit führen, wenn sie der menschlichen Seele bewusst werden und Jahrhunderte vor sich haben? Vergessen wir nicht, dass die Natur,
die wir ungerecht nennen, doch zum mindesten logisch ist, und dass es uns, wenn wir uns auch entschlössen, ungerecht zu werden, doch recht schwierig sein dürfte, es zu sein, denn wir müssten logisch bleiben, und wenn die Logik erst mit unseren Gedanken, Gefühlen, Leidenschaften und Absichten verquickt ist, – wer wollte sie dann noch von der Gerechtigkeit unterscheiden?
 Ziehen wir keine zu hastigen Schlussfolgerungen, es sind noch zu viele Punkte unsicher. Indem wir die sogenannte Ungerechtigkeit der Natur nachzuahmen suchen, laufen wir Gefahr, nur unsere eigene Ungerechtigkeit nachzuahmen und zu begünstigen. Wenn wir sagen, die Natur sei nicht gerecht, so heisst das im ganzen genommen nicht viel mehr, als dass wir uns über ihre mangelnde Aufmerksamkeit gegen unsere kleinen Tugenden, unsere kleinen Absichten und Heldenthaten beklagen, und wir fühlen uns weniger in unserem Verlangen nach Gerechtigkeit, als in unserer Eitelkeit verletzt. Aber daraus, dass unsere Moral zu der Unendlichkeit der Welt und ihren weltenweiten Zielen in keinem Verhältnis steht, folgt noch nicht, dass wir sie aufgeben müssten, denn sie ist unserm Wuchs und unseren begrenzten Schicksalen angemessen.
Ziehen wir keine zu hastigen Schlussfolgerungen, es sind noch zu viele Punkte unsicher. Indem wir die sogenannte Ungerechtigkeit der Natur nachzuahmen suchen, laufen wir Gefahr, nur unsere eigene Ungerechtigkeit nachzuahmen und zu begünstigen. Wenn wir sagen, die Natur sei nicht gerecht, so heisst das im ganzen genommen nicht viel mehr, als dass wir uns über ihre mangelnde Aufmerksamkeit gegen unsere kleinen Tugenden, unsere kleinen Absichten und Heldenthaten beklagen, und wir fühlen uns weniger in unserem Verlangen nach Gerechtigkeit, als in unserer Eitelkeit verletzt. Aber daraus, dass unsere Moral zu der Unendlichkeit der Welt und ihren weltenweiten Zielen in keinem Verhältnis steht, folgt noch nicht, dass wir sie aufgeben müssten, denn sie ist unserm Wuchs und unseren begrenzten Schicksalen angemessen.
Ausserdem, wenn es auch feststünde, dass die Natur in jedem Belange ungerecht ist, so stände doch noch die andere, gänzlich unerörterte Frage offen: ob es dem Menschen geboten ist, es der Natur in ihrer Ungerechtigkeit nachzuthun? Hier wollen wir lieber auf uns selbst hören, als auf eine so ungeheure Stimme, von deren Worten wir keines erfassen, und von denen wir nicht einmal wissen, ob es Worte sind. Unsere Vernunft und unser Instinkt sagen uns, dass wir berechtigt sind, dem Rate der Natur zu folgen, aber sie sagen uns auch, dass wir ihr durchaus nicht folgen müssen, wenn er einem anderen, ebenso tiefen Instinkte zuwiderläuft, und dies ist der Instinkt für Recht und Unrecht. Und wenn die Instinkte, wie man sagt, der Wahrheit der Natur näher stehen und wegen ihrer Stärke Berücksichtigung verdienen, so ist er vielleicht auch der mächtigste, denn er hat bis auf diesen Tag gegen alle andern anzukämpfen gehabt und ist doch nicht erstickt worden. Es wäre nicht angebracht, ihn zu verleugnen. Wir Menschen sollen auf menschlichem Grund und Boden und in menschlicher Weise gerecht sein und bleiben. Wir sehen weder klar genug, noch weit genug, um in einem anderen Kreise gerecht zu sein. Wagen wir uns nicht in einen Abgrund hinein, aus dem die Völker und Rassen vielleicht hervorgegangen sind, in den der Mensch als solcher aber nie eindringen sollte. Die Ungerechtigkeit der Natur hebt sich in der Gerechtigkeit für die Gattung auf, sie hat Zeit zu warten und diese Ungerechtigkeit entspricht ihren Grössenverhältnissen. Uns aber geht das alles über den Kopf, und wir zählen nur kurze Tage. Lassen wir die Kraft im Weltall regieren und die Gerechtigkeit in unserem Herzen. Wenn die Rasse unbezwinglich und in ihrer Ungerechtigkeit vielleicht gerecht ist, wenn die Menge selbst Rechte zu haben scheint, die der Einzelmensch nicht hat, und wenn sie bisweilen grosse unvermeidliche und heilsame Verbrechen begeht, so hat doch jedes Individuum in der Rasse, jeder einzelne in der Masse die Pflicht, im Umkreise seines gesamten Bewusstseins, das er in sich zu erzeugen und zu erhalten vermag, gerecht zu bleiben. Dieser Pflicht dürfen wir erst dann Valet sagen, wenn wir alle Gründe der grossen scheinbaren Ungerechtigkeit kennen, denn die, welche man uns angiebt, die Erhaltung der Art, die Auslese und Wiedergeburt der Stärksten, Geschicktesten und »am besten Angepassten«, reichen nicht aus, um einen so furchtbaren Wandel eintreten zu lassen. Gewiss soll jeder von uns danach trachten, der Stärkste und Geschickteste zu sein und sich den Notwendigkeiten des Lebens am besten anzupassen, wenn er sie nicht ändern kann, aber er soll auch darauf sehen, dass die Eigenschaften, die ihm zum Siege verhelfen, seine moralische und geistige Kraft bekunden und ihn wahrhaft glücklich machen, denn der Geschickteste, Stärkste und am besten Angepasste ist bis auf diesen Tag der Menschlichste, Redlichste und Gerechteste.
 In mir ist mehr, lautet eine schöne Inschrift auf den Balken und Kaminsimsen eines alten, von Fremden viel besuchten Patrizierhauses in Brügge, das am Ende einer jener sanften und schwermütigen Grachten in tiefer Verlassenheit und Leblosigkeit schlummert, wie auf einem Bilde. »In mir ist mehr, alle Moralgesetze,
alle Mysterien des Verstandes sind in mir«, so kann die Menschheit sagen. Wohl möglich, dass es über und unter uns noch viele andre giebt, aber wenn wir von ihnen allen doch nichts wissen sollen, so sind sie für uns so gut wie nicht vorhanden, und wenn wir eines Tages erführen, dass sie da sind, so geschähe dies nur darum, weil sie ohne unser Wissen schon in uns waren und uns schon gehörten. »In mir ist mehr« – vielleicht haben wir auch das Recht, fortzufahren: »Und ich habe nichts von dem zu fürchten, was in mir ist.«
In mir ist mehr, lautet eine schöne Inschrift auf den Balken und Kaminsimsen eines alten, von Fremden viel besuchten Patrizierhauses in Brügge, das am Ende einer jener sanften und schwermütigen Grachten in tiefer Verlassenheit und Leblosigkeit schlummert, wie auf einem Bilde. »In mir ist mehr, alle Moralgesetze,
alle Mysterien des Verstandes sind in mir«, so kann die Menschheit sagen. Wohl möglich, dass es über und unter uns noch viele andre giebt, aber wenn wir von ihnen allen doch nichts wissen sollen, so sind sie für uns so gut wie nicht vorhanden, und wenn wir eines Tages erführen, dass sie da sind, so geschähe dies nur darum, weil sie ohne unser Wissen schon in uns waren und uns schon gehörten. »In mir ist mehr« – vielleicht haben wir auch das Recht, fortzufahren: »Und ich habe nichts von dem zu fürchten, was in mir ist.«
Jedenfalls liegt in uns das ganze fruchtbare und bewohnte Gebiet des grossen Mysteriums der Gerechtigkeit. Die anderen sind zu unsicher und für unser Menschenleben jedenfalls öde und unfruchtbar. Gewiss hat die Menschheit nützliche Illusionen in ihnen gefunden, wenngleich diese nicht immer harmlos waren; doch wenn man auch nicht behaupten darf, dass alle Illusionen zum Abbruch reif sind, so darf doch nichtsdestoweniger kein zu offenkundiges Missverhältnis zwischen ihnen und unserer Weltauffassung bestehen. Heute wollen wir vor allen Dingen die Illusion der Wahrheit. Sie ist vielleicht nicht die letzte, noch auch die beste oder einzig mögliche, aber es ist die, welche uns im Augenblicke als die edelste und notwendigste erscheint. Begnügen wir uns also damit, die wunderbare Gerechtigkeits- und Wahrheitsliebe im Menschenherzen festzustellen. Wenn wir unsere Bewunderung dergestalt auf das unwiderleglichste Gebiet beschränken, werden wir vielleicht eines Tages wissen, was diese Liebe ist, oder vielmehr diese Leidenschaft, die das unverkennbarste Zeichen der Menschlichkeit ist, aber jedenfalls werden wir erfahren, – und das ist die Hauptsache, – auf welche Weise sie vergrössert und geläutert werden kann. Wenn wir die Gerechtigkeit unermüdlich in dem einzigen Tempel walten sehen, wo sie wirklich waltet, nämlich in unserm Herzensgrunde, wenn wir sie in allen unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen gegenwärtig finden, so werden wir unschwer erkennen, wodurch sie verdunkelt und geklärt, getäuscht und geleitet, geschwächt und genährt, angegriffen und verteidigt wird.
 Ist die Gerechtigkeit ein Selbstverteidigungs- und Erhaltungstrieb der Menschheit? Ist sie die reinste Blüte unserer Vernunft, oder geht sie aus einer Anzahl von Gefühlskräften hervor, die so oft gegen die Vernunft Recht haben und im Grunde auch nichts anderes sind, als eine unbewusste und höhere Vernunft, welche die bewusste Vernunft fast immer mit Staunen anerkennt, wenn sie an die Punkte kommt, an denen diese guten Gefühle längst sahen, was sie noch nicht sah? Wovon hängt sie mehr ab, von unserem Charakter oder von unserem Verstande? Das sind keine müssigen Fragen, wenn es sich darum handelt, was zu thun ist, um seine ganze Kraft und Begeisterung in den Dienst dieser Gerechtigkeitsliebe zu stellen, welche das Zentraljuwel der menschlichen Seele bildet. Alle Menschen lieben die Gerechtigkeit, aber es lieben sie nicht alle mit derselben feurigen, ungestümen und ausschliesslichen
Liebe. Es haben nicht alle dieselben Bedenken, dasselbe Zartgefühl, noch dieselbe Gewissheit. Man findet Wesen von sehr entwickeltem Verstande, deren Gefühl für das Rechte ungleich weniger zart und sicher ist, als bei manchen Wesen von sehr mittelmässigem Verstande, und jener wenig bekannte und kaum näher zu bestimmende Teil unseres Wesens, den man Charakter nennt, ist von grossem Einfluss darauf. Aber es ist schwer zu bewerten, was ein einfach rechtschaffener Charakter an mehr oder minder unbewusstem Verstande voraussetzt. Überdies kommt es vor allem darauf an, wie und auf welche Weise die Gerechtigkeitsliebe sich in uns mehren und läutern lässt; und eines steht in dieser Hinsicht fest: unser Charakter beginnt sich dem unmittelbaren Einfluss unseres guten Willens zu entziehen, wogegen unser Verstand ihm zum grossen Teil unterworfen ist. Wir veredeln den Teil unserer Gerechtigkeitsliebe, der vom Charakter abhängt, also dadurch, dass wir ihn durch unseren Verstand hindurchgehen lassen, denn in dem Masse, wie der Verstand sich erhebt und läutert, gelangt er auch zur Beherrschung, Läuterung und Umwandlung unserer Gefühle, Leidenschaften und Instinkte.
Ist die Gerechtigkeit ein Selbstverteidigungs- und Erhaltungstrieb der Menschheit? Ist sie die reinste Blüte unserer Vernunft, oder geht sie aus einer Anzahl von Gefühlskräften hervor, die so oft gegen die Vernunft Recht haben und im Grunde auch nichts anderes sind, als eine unbewusste und höhere Vernunft, welche die bewusste Vernunft fast immer mit Staunen anerkennt, wenn sie an die Punkte kommt, an denen diese guten Gefühle längst sahen, was sie noch nicht sah? Wovon hängt sie mehr ab, von unserem Charakter oder von unserem Verstande? Das sind keine müssigen Fragen, wenn es sich darum handelt, was zu thun ist, um seine ganze Kraft und Begeisterung in den Dienst dieser Gerechtigkeitsliebe zu stellen, welche das Zentraljuwel der menschlichen Seele bildet. Alle Menschen lieben die Gerechtigkeit, aber es lieben sie nicht alle mit derselben feurigen, ungestümen und ausschliesslichen
Liebe. Es haben nicht alle dieselben Bedenken, dasselbe Zartgefühl, noch dieselbe Gewissheit. Man findet Wesen von sehr entwickeltem Verstande, deren Gefühl für das Rechte ungleich weniger zart und sicher ist, als bei manchen Wesen von sehr mittelmässigem Verstande, und jener wenig bekannte und kaum näher zu bestimmende Teil unseres Wesens, den man Charakter nennt, ist von grossem Einfluss darauf. Aber es ist schwer zu bewerten, was ein einfach rechtschaffener Charakter an mehr oder minder unbewusstem Verstande voraussetzt. Überdies kommt es vor allem darauf an, wie und auf welche Weise die Gerechtigkeitsliebe sich in uns mehren und läutern lässt; und eines steht in dieser Hinsicht fest: unser Charakter beginnt sich dem unmittelbaren Einfluss unseres guten Willens zu entziehen, wogegen unser Verstand ihm zum grossen Teil unterworfen ist. Wir veredeln den Teil unserer Gerechtigkeitsliebe, der vom Charakter abhängt, also dadurch, dass wir ihn durch unseren Verstand hindurchgehen lassen, denn in dem Masse, wie der Verstand sich erhebt und läutert, gelangt er auch zur Beherrschung, Läuterung und Umwandlung unserer Gefühle, Leidenschaften und Instinkte.
Aber suchen wir diese Liebe nicht mehr in einer Art von übermenschlicher und oft unmenschlicher Unendlichkeit anzunehmen und ergründen zu wollen. Sie würde weder der Schönheit noch der Grösse teilhaftig werden, die dieses Unendliche haben kann, sie würde nur unbestimmt, unzusammenhängend und unthätig sein wie jenes; wenn wir dagegen lernen, sie in uns zu finden und zu behorchen, in uns, wo sie wirklich vorhanden ist, wenn wir sehen, wie sie sich alle Errungenschaften unseres Geistes, alle Freuden und Leiden unseres Herzens zu Nutze macht, so werden wir bald heraus haben, was geschehen muss, um sie zu mehren und zu läutern.
 Wenn unsere Aufgabe derart beschränkt ist, bleibt sie immer noch langwierig, schwierig und geheimnisvoll genug. Wie sollen wir es anfangen, die Gerechtigkeit in uns zu mehren und zu läutern? Wir wissen ungefähr, welchem Ideal wir entgegenzustreben haben, aber wie ungewiss, veränderlich und trügerisch ist dieses Ideal noch! Es erleidet Einbusse und Verzerrungen durch alles, was wir von der Welt nicht wissen, nicht wahrnehmen, was wir nur unvollkommen sehen, was wir nicht tief genug ergründen. Kein Ideal wird von heimtückischeren Gefahren bedroht, keines hängt von ungewöhnlicheren Ausserachtlassungen und ebenso unwahrscheinlichen Irrtümern ab. Und darum sollten wir auch keines mit mehr Besorgnis, mit pietätvollerer und leidenschaftlicherer Wissbegier, mit mehr Vorsicht und mehr Sorgfalt umgeben. Was uns heute untadelig gerecht scheint, ist wahrscheinlich nur ein geringer Bruchteil dessen, was uns gerecht erscheinen würde, wenn wir auf einer anderen Stufe ständen. Es genügt, zu vergleichen, was wir gestern thaten und was wir heute thun; und was wir heute thun, wird uns voller Vergehen gegen Billigkeit, Mitleid und Liebe erscheinen, wenn es uns gegeben ist,
uns noch mehr zu erheben und es mit dem zu vergleichen, was wir morgen thun werden. Es findet ein Ereignis statt, ein Gedanke klärt sich, eine Pflicht gegen uns selbst tritt deutlich hervor, eine unverhoffte Beziehung macht sich geltend: und der ganze Organismus unserer inneren Gerechtigkeit gerät ins Wanken und formt sich um. Wir mögen noch so wenig vorwärts kommen: es wäre uns unmöglich, noch einmal inmitten vieler Trübsale zu leben, deren unfreiwillige Ursache wir gewesen sind, oder unter gewissen Entmutigungen, die wir unwissentlich ausgesäet haben, und doch schien es uns, als sie um uns entstanden, dass wir Recht thäten, und wir vermeinten nicht, dass wir Unrecht hätten. Desgleichen sind wir heute mit unserem guten Willen zufrieden, wir sagen uns, dass durch unsere Schuld niemand weint und leidet, wir sind der Überzeugung, dass wir kein Lächeln ersticken, kein glückliches Flüstern unterdrücken, keine Minute des Friedens und der Liebe schmälern, und wir sehen vielleicht nicht die grenzenlose Ungerechtigkeit zu unserer Rechten oder Linken, die drei Viertel des Lebens bedeckt.
Wenn unsere Aufgabe derart beschränkt ist, bleibt sie immer noch langwierig, schwierig und geheimnisvoll genug. Wie sollen wir es anfangen, die Gerechtigkeit in uns zu mehren und zu läutern? Wir wissen ungefähr, welchem Ideal wir entgegenzustreben haben, aber wie ungewiss, veränderlich und trügerisch ist dieses Ideal noch! Es erleidet Einbusse und Verzerrungen durch alles, was wir von der Welt nicht wissen, nicht wahrnehmen, was wir nur unvollkommen sehen, was wir nicht tief genug ergründen. Kein Ideal wird von heimtückischeren Gefahren bedroht, keines hängt von ungewöhnlicheren Ausserachtlassungen und ebenso unwahrscheinlichen Irrtümern ab. Und darum sollten wir auch keines mit mehr Besorgnis, mit pietätvollerer und leidenschaftlicherer Wissbegier, mit mehr Vorsicht und mehr Sorgfalt umgeben. Was uns heute untadelig gerecht scheint, ist wahrscheinlich nur ein geringer Bruchteil dessen, was uns gerecht erscheinen würde, wenn wir auf einer anderen Stufe ständen. Es genügt, zu vergleichen, was wir gestern thaten und was wir heute thun; und was wir heute thun, wird uns voller Vergehen gegen Billigkeit, Mitleid und Liebe erscheinen, wenn es uns gegeben ist,
uns noch mehr zu erheben und es mit dem zu vergleichen, was wir morgen thun werden. Es findet ein Ereignis statt, ein Gedanke klärt sich, eine Pflicht gegen uns selbst tritt deutlich hervor, eine unverhoffte Beziehung macht sich geltend: und der ganze Organismus unserer inneren Gerechtigkeit gerät ins Wanken und formt sich um. Wir mögen noch so wenig vorwärts kommen: es wäre uns unmöglich, noch einmal inmitten vieler Trübsale zu leben, deren unfreiwillige Ursache wir gewesen sind, oder unter gewissen Entmutigungen, die wir unwissentlich ausgesäet haben, und doch schien es uns, als sie um uns entstanden, dass wir Recht thäten, und wir vermeinten nicht, dass wir Unrecht hätten. Desgleichen sind wir heute mit unserem guten Willen zufrieden, wir sagen uns, dass durch unsere Schuld niemand weint und leidet, wir sind der Überzeugung, dass wir kein Lächeln ersticken, kein glückliches Flüstern unterdrücken, keine Minute des Friedens und der Liebe schmälern, und wir sehen vielleicht nicht die grenzenlose Ungerechtigkeit zu unserer Rechten oder Linken, die drei Viertel des Lebens bedeckt.
 Ich las heute morgen den dritten Band der prachtvollen Übersetzung von »Tausend und eine Nacht«, die Dr. Mardrus uns geschenkt hat. Hätte ich die Odyssee, die Bibel, den Xenophon oder Plutarch gelesen, so hätte ich aus diesen grossen untergegangenen Kulturen die gleiche Lehre schöpfen können. Ich las also eine der schönsten Erzählungen der Sultanin
Scheherezade, in der sich das bewundernswerteste, klarste, eigenwüchsigste, unabhängigste, reichste, blühendste, verfeinerteste, geistvollste, schönheits-, glücks- und liebestrunkenste und in gewisser Hinsicht auch der Wahrheit am nächsten kommende und wahrscheinlichste Leben abschilderte, das die Menschheit je gesehen hat. Seine moralische Kultur ist in mehr als einem Belange ebenso vollkommen, wie die materielle. Gerechtigkeitsgedanken von solcher Zartheit und Weisheitsregeln von solcher Tiefe, wie sie unsere gröbere, weniger glückliche und weniger aufmerksame Gesellschaft nie mehr denkt oder aufstellt, tragen hie und da dieses unbeschreibliche Glücksgebäude, wie Lichtsäulen, die das Licht tragen. Und doch ruht dieses ganze Paradies von Glückseligkeit, in dem das moralische Leben so gesund, so anmutig ernst, so edel und thatkräftig ist, wo die reinste und frömmste Gerechtigkeit alle Zerstreuungen einer glückseligen Menschheit zügelt, auf einer derartigen Ungerechtigkeit, ringsum herrscht eine so ungeheure, so tiefe und schauerliche Unbilligkeit, durch die selbst der unseligste Mensch von heute sich weigern würde hindurchzuschreiten, um die edelsteinschimmernde Schwelle zu erreichen, die daraus emportaucht. Aber keiner von den Bewohnern der Zauberwohnung ahnt sie. Es scheint, als träten sie nie an die Fenster, oder wenn sie sie zufällig öffnen, wenn sie zwischen zwei Festgelagen das sie umgebende Elend sehen und beklagen, so haben sie doch keine Augen für eine andre, ungleich ungeheuerlichere und empörendere Ungerechtigkeit, als die Armut ist: ich meine die Sklaverei,
namentlich die Knechtschaft der Frau, die, so hoch sie stehen mag und selbst in dem Augenblick, wo sie mit guten und gerechten Männern spricht und ihnen die Augen über ihre zartesten und edelsten Pflichten öffnet, immer nur ein Spielzeug ist, das man kauft, wieder verkauft und in einer Anwandlung von Trunkenheit, Prahlerei oder Dankbarkeit an irgend einen widerlichen und barbarischen Gebieter verschenkt.
Ich las heute morgen den dritten Band der prachtvollen Übersetzung von »Tausend und eine Nacht«, die Dr. Mardrus uns geschenkt hat. Hätte ich die Odyssee, die Bibel, den Xenophon oder Plutarch gelesen, so hätte ich aus diesen grossen untergegangenen Kulturen die gleiche Lehre schöpfen können. Ich las also eine der schönsten Erzählungen der Sultanin
Scheherezade, in der sich das bewundernswerteste, klarste, eigenwüchsigste, unabhängigste, reichste, blühendste, verfeinerteste, geistvollste, schönheits-, glücks- und liebestrunkenste und in gewisser Hinsicht auch der Wahrheit am nächsten kommende und wahrscheinlichste Leben abschilderte, das die Menschheit je gesehen hat. Seine moralische Kultur ist in mehr als einem Belange ebenso vollkommen, wie die materielle. Gerechtigkeitsgedanken von solcher Zartheit und Weisheitsregeln von solcher Tiefe, wie sie unsere gröbere, weniger glückliche und weniger aufmerksame Gesellschaft nie mehr denkt oder aufstellt, tragen hie und da dieses unbeschreibliche Glücksgebäude, wie Lichtsäulen, die das Licht tragen. Und doch ruht dieses ganze Paradies von Glückseligkeit, in dem das moralische Leben so gesund, so anmutig ernst, so edel und thatkräftig ist, wo die reinste und frömmste Gerechtigkeit alle Zerstreuungen einer glückseligen Menschheit zügelt, auf einer derartigen Ungerechtigkeit, ringsum herrscht eine so ungeheure, so tiefe und schauerliche Unbilligkeit, durch die selbst der unseligste Mensch von heute sich weigern würde hindurchzuschreiten, um die edelsteinschimmernde Schwelle zu erreichen, die daraus emportaucht. Aber keiner von den Bewohnern der Zauberwohnung ahnt sie. Es scheint, als träten sie nie an die Fenster, oder wenn sie sie zufällig öffnen, wenn sie zwischen zwei Festgelagen das sie umgebende Elend sehen und beklagen, so haben sie doch keine Augen für eine andre, ungleich ungeheuerlichere und empörendere Ungerechtigkeit, als die Armut ist: ich meine die Sklaverei,
namentlich die Knechtschaft der Frau, die, so hoch sie stehen mag und selbst in dem Augenblick, wo sie mit guten und gerechten Männern spricht und ihnen die Augen über ihre zartesten und edelsten Pflichten öffnet, immer nur ein Spielzeug ist, das man kauft, wieder verkauft und in einer Anwandlung von Trunkenheit, Prahlerei oder Dankbarkeit an irgend einen widerlichen und barbarischen Gebieter verschenkt.
 Man erzählt, sagt Nozhatu, die schöne Sklavin, die hinter einem Vorhang von Perlen und Seide mit dem Prinzen Scharkan und den Weisen des Reiches spricht, »man erzählt auch, dass der Khalif Omar eines Nachts mit dem ehrwürdigen Aslam Abu-Zeid spazieren ging. Und er sah in der Ferne ein Feuer brennen und ging darauf zu, denn er glaubte, seine Gegenwart möchte dort nützlich sein, und sah ein armes Weib, das unter einem Kochtopfe Feuer anzündete, und daneben lagen zwei kleine schmächtige Kinder, die kläglich seufzten. Und Omar sprach: »Frieden sei mit Dir, o Weib! Was schaffst Du da allein in Nacht und Kälte?« Und das Weib antwortete: »Herr, ich koche ein wenig Wasser, um es meinen Kindern zu trinken zu geben, denn sie sterben vor Hunger und Kälte; aber eines Tages wird Allah vom Khalifen Omar Rechenschaft über das Elend fordern, darinnen wir leben.« Und der Khalif, der verkleidet war, ward durch dieses Wort tief gerührt und sagte: »Aber glaubst Du denn, oh Weib, dass Omar Dein Elend kennt, wenn er es
nicht lindert?« Sie antwortete: »Warum ist Omar denn Khalif, wenn er vom Elend seines Volkes und eines jeden seiner Unterthanen so gar nichts weiss?« Da schwieg der Khalif und sagte zum Aslam Abu-Zeid: »Schnell, gehen wir!« Und er ging sehr schnell, bis er zum Haushalter seines Palastes kam, und ging in die Vorratsräume und zog einen Sack Mehl unter den Mehlsäcken hervor und einen Krug voll Hammelfett, und sprach zu Abu-Zeid: »Hilf mir das auf meinen Rücken laden, oh Abu-Zeid.« Aber Abu-Zeid wehrte ihm und sprach: »Lass es mich selbst auf meinem Rücken tragen, oh Emir der Gläubigen!« Er antwortete ruhig: »Aber würdest Du denn auch die Last meiner Sünde tragen, oh Abu-Zeid, am Tage der Auferstehung?« Und er nötigte Abu-Zeid, ihm den Sack mit Mehl und den Krug mit Hammelfett auf den Rücken zu laden. Und der Khalif ging schnell, trotzdem er also beladen war, bis er zu der armen Frau kam; und er nahm von dem Mehl und dem Fett und that es in den Tiegel über dem Feuer und bereitete dieses Mahl mit seinen eigenen Händen, und bückte sich selber über das Feuer, um es anzublasen, und da er einen sehr grossen Bart hatte, drang der Holzqualm durch die Haare seines Bartes. Und als das Mahl bereitet war, bot Omar es dem Weib und den kleinen Kindern dar, welche davon assen, bis sie satt waren, und Omar kühlte es, indem er darauf blies. Dann liess Omar ihnen den Sack mit Mehl und den Krug voller Fett, und als er ging, sprach er zu Abu-Zeid: »Oh Abu-Zeid, jetzt, wo ich das Feuer gesehen habe, hat sein Licht mich erleuchtet.«
Man erzählt, sagt Nozhatu, die schöne Sklavin, die hinter einem Vorhang von Perlen und Seide mit dem Prinzen Scharkan und den Weisen des Reiches spricht, »man erzählt auch, dass der Khalif Omar eines Nachts mit dem ehrwürdigen Aslam Abu-Zeid spazieren ging. Und er sah in der Ferne ein Feuer brennen und ging darauf zu, denn er glaubte, seine Gegenwart möchte dort nützlich sein, und sah ein armes Weib, das unter einem Kochtopfe Feuer anzündete, und daneben lagen zwei kleine schmächtige Kinder, die kläglich seufzten. Und Omar sprach: »Frieden sei mit Dir, o Weib! Was schaffst Du da allein in Nacht und Kälte?« Und das Weib antwortete: »Herr, ich koche ein wenig Wasser, um es meinen Kindern zu trinken zu geben, denn sie sterben vor Hunger und Kälte; aber eines Tages wird Allah vom Khalifen Omar Rechenschaft über das Elend fordern, darinnen wir leben.« Und der Khalif, der verkleidet war, ward durch dieses Wort tief gerührt und sagte: »Aber glaubst Du denn, oh Weib, dass Omar Dein Elend kennt, wenn er es
nicht lindert?« Sie antwortete: »Warum ist Omar denn Khalif, wenn er vom Elend seines Volkes und eines jeden seiner Unterthanen so gar nichts weiss?« Da schwieg der Khalif und sagte zum Aslam Abu-Zeid: »Schnell, gehen wir!« Und er ging sehr schnell, bis er zum Haushalter seines Palastes kam, und ging in die Vorratsräume und zog einen Sack Mehl unter den Mehlsäcken hervor und einen Krug voll Hammelfett, und sprach zu Abu-Zeid: »Hilf mir das auf meinen Rücken laden, oh Abu-Zeid.« Aber Abu-Zeid wehrte ihm und sprach: »Lass es mich selbst auf meinem Rücken tragen, oh Emir der Gläubigen!« Er antwortete ruhig: »Aber würdest Du denn auch die Last meiner Sünde tragen, oh Abu-Zeid, am Tage der Auferstehung?« Und er nötigte Abu-Zeid, ihm den Sack mit Mehl und den Krug mit Hammelfett auf den Rücken zu laden. Und der Khalif ging schnell, trotzdem er also beladen war, bis er zu der armen Frau kam; und er nahm von dem Mehl und dem Fett und that es in den Tiegel über dem Feuer und bereitete dieses Mahl mit seinen eigenen Händen, und bückte sich selber über das Feuer, um es anzublasen, und da er einen sehr grossen Bart hatte, drang der Holzqualm durch die Haare seines Bartes. Und als das Mahl bereitet war, bot Omar es dem Weib und den kleinen Kindern dar, welche davon assen, bis sie satt waren, und Omar kühlte es, indem er darauf blies. Dann liess Omar ihnen den Sack mit Mehl und den Krug voller Fett, und als er ging, sprach er zu Abu-Zeid: »Oh Abu-Zeid, jetzt, wo ich das Feuer gesehen habe, hat sein Licht mich erleuchtet.«
»Aber, oh König,« sagt etwas weiter eine der fünf gedankenvollen Jungfrauen zu einem sehr weisen König, dem man sie verkaufen will, »aber, oh König, wisse, dass die schönste That die selbstloseste ist. In Israel sollen zwei Brüder gewesen sein, und einer der Brüder sagte eines Tages zum anderen: »Welches ist die schrecklichste That, die Du je gethan hast?« Da antwortete jener: »Es ist diese. Als ich eines Tages an einem Hühnerhof vorbeikam, streckte ich die Hand aus und ergriff eins der Hühner. Und als ich es erwürgt hatte, warf ich es wieder in den Hühnerhof. Das ist das schrecklichste Ereignis meines Lebens. Aber Du, oh mein Bruder, was hast Du Sonderliches gethan?« Der Bruder antwortete: »Ich richtete ein Gebet an Allah und bat ihn um eine Gunst. Denn das Gebet ist nur dann schön, wenn es ein einfacher Aufschwung der Seele gen Himmel ist.«
»Lerne Dich selbst erkennen,« fährt eine ihrer Gefährtinnen fort, die Gefangene und Sklavin ist, wie sie. »Lerne Dich selbst erkennen, und dann erst handle! Und dann erst handle nach allen Deinen Wünschen, aber gieb acht, dass Du Deinen Nachbarn nicht verletzest!«
 Unsere heutige Moral hätte dieser letzten Formel nichts hinzuzufügen und besitzt keine erschöpfendere Vorschrift. Höchstens könnte sie den Begriff des »Nachbarn« erweitern, erhöhen und verallgemeinern, und ebenso den Sinn des Wortes »verletzen« verfeinern, gewissenhafter und eindrucksvoller machen. Aber
dieses Buch, in dem sich diese Worte finden, ist bei allen diesen höchsten Blüten der Weisheit doch ein Denkmal von Schrecken, Blut, Thränen, Bedrückung und Sklaverei. Und die, welche sie aussprechen, sind Sklavinnen. Ein Händler kauft sie, ich weiss nicht wo, und verkauft sie wieder an ein altes Weib, das sie in Dichtkunst, Philosophie und aller Weisheit des Morgenlands unterweist oder unterweisen lässt, damit sie eines Tages würdige Gaben für einen König sein können. Und wenn diese Erziehung vollendet ist und die Schönheit und Weisheit dieser Opfer die Bewunderung Aller erregt, die ihnen nahe kommen, so bietet die geschäftige und weitblickende Alte sie wirklich einem sehr gerechten und sehr weisen König an. Und wenn der sehr gerechte und sehr weise König ihnen die Jungfräulichkeit genommen hat und nach anderer Liebe verlangt, so schenkt er sie wahrscheinlich (ich habe den Verlauf der Erzählung nicht mehr genau in der Erinnerung, aber es ist dies das unveränderliche Schicksal aller Frauen in diesen wundervollen Sagen) seinen Vezieren, und diese Veziere tauschen sie gegen ein Balsamgefäss oder einen kostbaren Gürtel ein, wenn sie sie nicht gar verschenken, damit sie den Begierden und Lüsten eines mächtigen Beschützers oder eines widerwärtigen, aber gefürchteten Rivalen dienen. Und sie, die ihr Gewissen befragen und in dem der Anderen lesen, sie, die den grössten und schönsten Fragen der Moral und Gerechtigkeit der Völker und Individuen nachhängen, sie werfen keinen einzigen Blick auf ihr eigenes Loos und ahnen keinen Augenblick
etwas von der unerhörten Ungerechtigkeit, deren Opfer sie sind. Und alle, die sie hören, lieben, bewundern und verstehen, ahnen es eben so wenig. Und wir, die wir uns darüber wundern und auch über Gerechtigkeit, Güte, Mitleid und Liebe nachdenken, wir können nicht wissen, ob unsere sozialen Verhältnisse den Nachlebenden nicht einst ein ebenso unerquickliches Schauspiel bieten werden.
Unsere heutige Moral hätte dieser letzten Formel nichts hinzuzufügen und besitzt keine erschöpfendere Vorschrift. Höchstens könnte sie den Begriff des »Nachbarn« erweitern, erhöhen und verallgemeinern, und ebenso den Sinn des Wortes »verletzen« verfeinern, gewissenhafter und eindrucksvoller machen. Aber
dieses Buch, in dem sich diese Worte finden, ist bei allen diesen höchsten Blüten der Weisheit doch ein Denkmal von Schrecken, Blut, Thränen, Bedrückung und Sklaverei. Und die, welche sie aussprechen, sind Sklavinnen. Ein Händler kauft sie, ich weiss nicht wo, und verkauft sie wieder an ein altes Weib, das sie in Dichtkunst, Philosophie und aller Weisheit des Morgenlands unterweist oder unterweisen lässt, damit sie eines Tages würdige Gaben für einen König sein können. Und wenn diese Erziehung vollendet ist und die Schönheit und Weisheit dieser Opfer die Bewunderung Aller erregt, die ihnen nahe kommen, so bietet die geschäftige und weitblickende Alte sie wirklich einem sehr gerechten und sehr weisen König an. Und wenn der sehr gerechte und sehr weise König ihnen die Jungfräulichkeit genommen hat und nach anderer Liebe verlangt, so schenkt er sie wahrscheinlich (ich habe den Verlauf der Erzählung nicht mehr genau in der Erinnerung, aber es ist dies das unveränderliche Schicksal aller Frauen in diesen wundervollen Sagen) seinen Vezieren, und diese Veziere tauschen sie gegen ein Balsamgefäss oder einen kostbaren Gürtel ein, wenn sie sie nicht gar verschenken, damit sie den Begierden und Lüsten eines mächtigen Beschützers oder eines widerwärtigen, aber gefürchteten Rivalen dienen. Und sie, die ihr Gewissen befragen und in dem der Anderen lesen, sie, die den grössten und schönsten Fragen der Moral und Gerechtigkeit der Völker und Individuen nachhängen, sie werfen keinen einzigen Blick auf ihr eigenes Loos und ahnen keinen Augenblick
etwas von der unerhörten Ungerechtigkeit, deren Opfer sie sind. Und alle, die sie hören, lieben, bewundern und verstehen, ahnen es eben so wenig. Und wir, die wir uns darüber wundern und auch über Gerechtigkeit, Güte, Mitleid und Liebe nachdenken, wir können nicht wissen, ob unsere sozialen Verhältnisse den Nachlebenden nicht einst ein ebenso unerquickliches Schauspiel bieten werden.
 Es wird uns schwer, uns vorzustellen, was die ideale Gerechtigkeit ist und sein muss, denn alle unsere Gedanken, die sich zu ihr erheben, finden in der Ungerechtigkeit, in der wir leben, ein Bleigewicht. Wir kennen die Gesetze und die neuen Beziehungen nicht, die sich offenbaren werden, wenn es keine Ungleichheit und kein Unglück mehr giebt, das den Menschen zur Last fällt, und nach dem Prinzip der Entwicklungsethik jeder »die guten oder schlimmen Resultate seiner eigenen Natur und der sich aus ihr ergebenden Konsequenzen« sammeln wird. Gegenwärtig ist es nicht so, und man kann sagen, dass »der Zusammenhang zwischen der Lebensführung und ihren Folgen« (nach der Spencer'schen Formel) für die Gesamtheit der Menschen und auf materiellem Gebiet sich nur auf lächerliche, willkürliche und ungerechte Weise kundgiebt. Ist es nicht eine Vermessenheit zu hoffen, dass unsere Gedanken gerecht seien, wenn der Körper eines jeden tief in der Ungerechtigkeit steckt? Und da ist keiner, der nicht darin steckte, um daran zu leiden oder seinen Vorteil daraus zu ziehen, keiner, dessen Bemühungen
nicht zu viel oder zu wenig erreichen, keiner, der nicht privilegiert oder zurückgesetzt ist. Wir können versuchen, unsern Geist von dieser eingefleischten Ungerechtigkeit loszumachen, diesem allzu hartnäckigen Überreste der »untermenschlichen Moral«, welche die primitive »Herde« nötig hat. Aber es ist verkehrt zu glauben, dass er dieselbe Kraft, Unabhängigkeit und Hellsichtigkeit haben, dass er zu denselben Ergebnissen kommen wird, wie wenn diese Ungerechtigkeit nicht wäre. Es ist immer nur ein sehr kleiner, sehr furchtsamer und unsicherer Teil des menschlichen Denkens, dem es gelingt, sich über die Realität hinauszuschwingen. Das menschliche Denken vermag viel, es hat mit der Zeit zu erstaunlichen Verbesserungen in Dingen der Art oder Rasse geführt, die vordem unabänderlich schienen. Aber sobald es über eine geplante oder erhoffte Umwandlung nachdenkt, unterliegt es doch immer wieder dem Einfluss und der Art zu sehen, zu fühlen und zu denken, dessen, was es eben ändern möchte. Es ist weit mehr befähigt, das, was war, zu erklären, zu beurteilen und in Verbindung zu bringen, als das, was zwar schon vorhanden, aber noch unsichtbar ist, zu fördern, zu nähren und aufzudecken, und es ist selten, dass es die Zukunft voraussieht oder etwas sehr Heilsames, Mögliches und Dauerndes hervorbringt, wenn es sich in das noch Ungeborene hineinwagt. Darum trägt es auch den Stempel des sozialen Zustandes, in dem wir leben. Es giebt zu viel Ungerechtigkeit ringsum, als dass wir uns eine hinreichende Vorstellung von der Gerechtigkeit machen und mit
der nötigen Aufrichtigkeit, Freiheit und Friedfertigkeit an sie denken könnten. Um sie erfolgreich zu erforschen und erfolgreich von ihr zu sprechen, müsste sie das sein, was sie sein könnte: eine untadelige, wahre und sichtbare Macht. Aber wir müssen bis heute damit vorlieb nehmen, ihren unbewussten, geheimen und gewissermassen unfühlbaren Wirkungen nachzuspüren. Wir betrachten die Gerechtigkeit thatsächlich vom Gestade der menschlichen Ungerechtigkeit aus, und der Anblick des hohen Meeres unter dem endlosen und unverletzlichen Himmelsgewölbe eines makellosen Gewissens ist uns noch unbekannt. Zum mindesten müssten die Menschen in ihrem eigensten Bereich ihr Möglichstes gethan haben, um das Recht zu erlangen, weiter zu gehen und anderen Dingen nachzuforschen; und ihre Gedanken würden wahrscheinlich klarer sein, wenn ihr Gewissen ruhiger wäre.
Es wird uns schwer, uns vorzustellen, was die ideale Gerechtigkeit ist und sein muss, denn alle unsere Gedanken, die sich zu ihr erheben, finden in der Ungerechtigkeit, in der wir leben, ein Bleigewicht. Wir kennen die Gesetze und die neuen Beziehungen nicht, die sich offenbaren werden, wenn es keine Ungleichheit und kein Unglück mehr giebt, das den Menschen zur Last fällt, und nach dem Prinzip der Entwicklungsethik jeder »die guten oder schlimmen Resultate seiner eigenen Natur und der sich aus ihr ergebenden Konsequenzen« sammeln wird. Gegenwärtig ist es nicht so, und man kann sagen, dass »der Zusammenhang zwischen der Lebensführung und ihren Folgen« (nach der Spencer'schen Formel) für die Gesamtheit der Menschen und auf materiellem Gebiet sich nur auf lächerliche, willkürliche und ungerechte Weise kundgiebt. Ist es nicht eine Vermessenheit zu hoffen, dass unsere Gedanken gerecht seien, wenn der Körper eines jeden tief in der Ungerechtigkeit steckt? Und da ist keiner, der nicht darin steckte, um daran zu leiden oder seinen Vorteil daraus zu ziehen, keiner, dessen Bemühungen
nicht zu viel oder zu wenig erreichen, keiner, der nicht privilegiert oder zurückgesetzt ist. Wir können versuchen, unsern Geist von dieser eingefleischten Ungerechtigkeit loszumachen, diesem allzu hartnäckigen Überreste der »untermenschlichen Moral«, welche die primitive »Herde« nötig hat. Aber es ist verkehrt zu glauben, dass er dieselbe Kraft, Unabhängigkeit und Hellsichtigkeit haben, dass er zu denselben Ergebnissen kommen wird, wie wenn diese Ungerechtigkeit nicht wäre. Es ist immer nur ein sehr kleiner, sehr furchtsamer und unsicherer Teil des menschlichen Denkens, dem es gelingt, sich über die Realität hinauszuschwingen. Das menschliche Denken vermag viel, es hat mit der Zeit zu erstaunlichen Verbesserungen in Dingen der Art oder Rasse geführt, die vordem unabänderlich schienen. Aber sobald es über eine geplante oder erhoffte Umwandlung nachdenkt, unterliegt es doch immer wieder dem Einfluss und der Art zu sehen, zu fühlen und zu denken, dessen, was es eben ändern möchte. Es ist weit mehr befähigt, das, was war, zu erklären, zu beurteilen und in Verbindung zu bringen, als das, was zwar schon vorhanden, aber noch unsichtbar ist, zu fördern, zu nähren und aufzudecken, und es ist selten, dass es die Zukunft voraussieht oder etwas sehr Heilsames, Mögliches und Dauerndes hervorbringt, wenn es sich in das noch Ungeborene hineinwagt. Darum trägt es auch den Stempel des sozialen Zustandes, in dem wir leben. Es giebt zu viel Ungerechtigkeit ringsum, als dass wir uns eine hinreichende Vorstellung von der Gerechtigkeit machen und mit
der nötigen Aufrichtigkeit, Freiheit und Friedfertigkeit an sie denken könnten. Um sie erfolgreich zu erforschen und erfolgreich von ihr zu sprechen, müsste sie das sein, was sie sein könnte: eine untadelige, wahre und sichtbare Macht. Aber wir müssen bis heute damit vorlieb nehmen, ihren unbewussten, geheimen und gewissermassen unfühlbaren Wirkungen nachzuspüren. Wir betrachten die Gerechtigkeit thatsächlich vom Gestade der menschlichen Ungerechtigkeit aus, und der Anblick des hohen Meeres unter dem endlosen und unverletzlichen Himmelsgewölbe eines makellosen Gewissens ist uns noch unbekannt. Zum mindesten müssten die Menschen in ihrem eigensten Bereich ihr Möglichstes gethan haben, um das Recht zu erlangen, weiter zu gehen und anderen Dingen nachzuforschen; und ihre Gedanken würden wahrscheinlich klarer sein, wenn ihr Gewissen ruhiger wäre.
 Und dann lähmt ein grosser Vorwurf unseren Eifer, besser zu werden, mehr zu verzeihen, zu lieben und zu verstehen. Was nützt es, wenn wir unser Gewissen läutern, unsere Gedanken adeln und uns bemühen, unserer Umgebung das Leben leichter und annehmlicher zu machen: das alles ist nach aussen hin fast wirkungslos, das kommt nicht einmal über unsere Schwelle hinaus, und sobald wir die Wohnung unseres Innersten verlassen, merken wir, dass wir nichts gethan haben, dass sich auch garnichts thun lässt, und dass wir wohl oder übel an der
grossen namenlosen Ungerechtigkeit teilhaben. Ist es nicht zum Lachen, die zartesten und edelsten Probleme des Gewissens bei sich zu lösen, den Schatten eines herben Gedankens furchtsam fernzuhalten, sich in seinen vier Wänden zu jeder Tagesstunde edel, einfach, treu, redlich, mitleidig und makellos zu benehmen, und in dem nämlichen Augenblicke, ohne dass es möglich wäre, das Gegenteil zu thun, alles Mitleid, alle Billigkeit und alle Liebe zu vergessen, sobald wir auf die Strasse gehen oder andere Menschen treffen, als die, deren Gesicht uns vertraut geworden ist? Wohin kommt alle Würde und Redlichkeit bei diesem doppelten Leben, das diesseits unserer Schwelle weise, menschlich, hochstehend, besonnen, und jenseits gleichgiltig, instinktiv und erbarmungslos ist? Wir brauchen nur weniger zu frieren, besser gekleidet und genährt zu sein, als der vorübergehende Arbeiter, wir brauchen uns nur irgend etwas nicht unbedingt Nötiges gekauft zu haben – es kommt im Grunde genommen doch auf dasselbe hinaus, wie der primitive Gewaltakt des Starken, der den Schwachen ohne Bedenken ausplündert. Wir geniessen nicht einen Vorteil, der nicht, wenn man näher zusieht, das Ergebnis eines – vielleicht sehr alten – Missbrauches der Macht, einer unbekannten Gewaltthat, einer vergessenen List ist, die wir wieder erneuern, indem wir uns zu Tische setzen, müssig durch die Stadt spazieren und uns des Abends in ein Bett legen, das unsere Hände nicht gemacht haben. Und was ist schliesslich der Umstand, dass wir besser und mitleidiger sind, dass wir milder und brüderlicher
über das Unrecht urteilen, dem die Andern zum Opfer fallen, was ist das schliesslich anders, als die reifste Frucht der grossen Ungerechtigkeit?
Und dann lähmt ein grosser Vorwurf unseren Eifer, besser zu werden, mehr zu verzeihen, zu lieben und zu verstehen. Was nützt es, wenn wir unser Gewissen läutern, unsere Gedanken adeln und uns bemühen, unserer Umgebung das Leben leichter und annehmlicher zu machen: das alles ist nach aussen hin fast wirkungslos, das kommt nicht einmal über unsere Schwelle hinaus, und sobald wir die Wohnung unseres Innersten verlassen, merken wir, dass wir nichts gethan haben, dass sich auch garnichts thun lässt, und dass wir wohl oder übel an der
grossen namenlosen Ungerechtigkeit teilhaben. Ist es nicht zum Lachen, die zartesten und edelsten Probleme des Gewissens bei sich zu lösen, den Schatten eines herben Gedankens furchtsam fernzuhalten, sich in seinen vier Wänden zu jeder Tagesstunde edel, einfach, treu, redlich, mitleidig und makellos zu benehmen, und in dem nämlichen Augenblicke, ohne dass es möglich wäre, das Gegenteil zu thun, alles Mitleid, alle Billigkeit und alle Liebe zu vergessen, sobald wir auf die Strasse gehen oder andere Menschen treffen, als die, deren Gesicht uns vertraut geworden ist? Wohin kommt alle Würde und Redlichkeit bei diesem doppelten Leben, das diesseits unserer Schwelle weise, menschlich, hochstehend, besonnen, und jenseits gleichgiltig, instinktiv und erbarmungslos ist? Wir brauchen nur weniger zu frieren, besser gekleidet und genährt zu sein, als der vorübergehende Arbeiter, wir brauchen uns nur irgend etwas nicht unbedingt Nötiges gekauft zu haben – es kommt im Grunde genommen doch auf dasselbe hinaus, wie der primitive Gewaltakt des Starken, der den Schwachen ohne Bedenken ausplündert. Wir geniessen nicht einen Vorteil, der nicht, wenn man näher zusieht, das Ergebnis eines – vielleicht sehr alten – Missbrauches der Macht, einer unbekannten Gewaltthat, einer vergessenen List ist, die wir wieder erneuern, indem wir uns zu Tische setzen, müssig durch die Stadt spazieren und uns des Abends in ein Bett legen, das unsere Hände nicht gemacht haben. Und was ist schliesslich der Umstand, dass wir besser und mitleidiger sind, dass wir milder und brüderlicher
über das Unrecht urteilen, dem die Andern zum Opfer fallen, was ist das schliesslich anders, als die reifste Frucht der grossen Ungerechtigkeit?
 Ich weiss wohl, man darf diese Bedenken nicht zu weit treiben; es würde dies nur zu höchst nutzlosen Entrüstungen führen, die der Gattung, deren mächtige und gesegnete Langsamkeit man achten muss, vielleicht verhängnisvoll werden könnten. Oder es führte wieder zu irgend welchen mystischen und thatlosen Verzichtleistungen, die den offenkundigsten und unveränderlichsten Willensregungen des Lebens feindlich sind. Es giebt hier Gesetze, die man für unabänderlich erklärt, aber man thut dies schon mit weniger Gewissheit. Insofern hat die Stellung des Weisen und Gerechten sich gewiss geändert. Mark Aurel, dessen Seele in ihrem Mitgefühl wahrscheinlich edler, in ihrer Eindrucksfähigkeit vielleicht weiser, in ihrer Gewissenhaftigkeit vielleicht reiner gewesen ist und nach Gerechtigkeit mehr gedürstet hat, als je eine, fragt sich nicht, was ausserhalb des wunderbaren kleinen Lichtkreises geschieht, in den seine Tugend, sein Gewissen, sein Mitleid und seine göttliche Sanftmut seine Anverwandten, Freunde und Diener hüllen. Ringsum, das weiss er gut genug, herrscht die bodenlose Ungerechtigkeit. Aber diese Ungerechtigkeit kümmert ihn nicht. Sie ist das notwendige, geheimnisvolle und geheiligte Meer, das ungeheure Wirkungsbereich der Götter, des Verhängnisses und der unbekannten, unverantwortlichen, unbeugsamen und unerschütterlichen höheren Gesetze.
Sie entmutigt ihn durchaus nicht, im Gegenteil giebt sie ihm Sicherheit, Selbstbesinnung und Erhebung, wie eine Flamme höher strebt, wenn sie sich nicht zu sehr ins Breite dehnt, oder wenn sie ganz allein in der Nacht aufflammt und die Finsternis sie doppelt leuchten lässt. Es ist ihm nicht gegeben, an dem Schicksalsschluss zu rütteln, dass die grosse Mehrzahl in Niedrigkeit, Elend und Knechtschaft leben soll. Er unterwirft sich ihm nicht ohne Schwermut, aber voller Vertrauen auf unvordenkliche und unwiderrufliche Gesetze, und das ist gleichfalls ein Akt des Mitleids und der Tugend. Er schliesst sich in sich selbst ein und wird grösser, menschlicher und gerechter in einem unbeweglichen und lichtlosen leeren Raume. Und von Jahrhundert zu Jahrhundert haben die Weisen und Guten denselben eng begrenzten und verschlossenen Eifer gehegt. Mehr als ein unerschütterliches Gesetz hat seinen Namen gewechselt, aber seine unendliche Macht ist die gleiche geblieben, und sie sehen es mit derselben entsagenden und beruhigten Schwermut an. Aber was sollen wir thun? Wir wissen, dass es keine notwendige Ungerechtigkeit mehr giebt. Wir sind in das Gebiet der Gottheit, des Schicksals und der unbekannten Gesetze eingedrungen. Vielleicht verbleiben ihnen Krankheit, Unfall, Sturm, Blitz und die meisten Mysterien des Todes; wir sind so weit noch nicht vorgedrungen, aber so viel ist gewiss: Armut, aussichtslose Arbeit, Elend, Hunger und Knechtschaft sind ihnen entrissen. Wir sind ihre Urheber, ihre Erhalter und ihre Verteiler. Sie sind unsre persönlichen,
furchtbaren, wohl begründeten Plagen, und die Leute werden immer seltener, die ernstlich glauben, dass eine übermenschliche Macht sie hervorruft. Das heilige und unbefahrbare Meer, das die Zufluchtsstätte des in sich gekehrten Denkers und Gerechten von ehedem umschloss und rechtfertigte, besteht nur noch in unseren Erinnerungen. Heute würde Mark Aurel nicht mehr mit derselben Heiterkeit sagen: »Sie suchen Zufluchtsorte, ländliche Hütten, Meeresgestade, Berge: und auch Du überlässest Dich gewöhnlich dem heftigen Verlangen nach gleichen Gütern. Aber so handeln nur Unwissende und Ungeschickte, denn Du kannst Dich zu jeglicher Stunde, wo Du willst, in Dich selbst zurückziehen. Nirgends findet der Mensch eine ruhigere, durch weltliche Sorgen weniger gestörte Zufluchtsstätte, als in seiner Seele, besonders, wenn man jene Dinge in sich hat, deren Betrachtung genügt, um uns sofort jene völlige Ruhe zu schenken, die mir nichts andres als eine vollkommene Ordnung unserer Seele zu sein scheint.«
Ich weiss wohl, man darf diese Bedenken nicht zu weit treiben; es würde dies nur zu höchst nutzlosen Entrüstungen führen, die der Gattung, deren mächtige und gesegnete Langsamkeit man achten muss, vielleicht verhängnisvoll werden könnten. Oder es führte wieder zu irgend welchen mystischen und thatlosen Verzichtleistungen, die den offenkundigsten und unveränderlichsten Willensregungen des Lebens feindlich sind. Es giebt hier Gesetze, die man für unabänderlich erklärt, aber man thut dies schon mit weniger Gewissheit. Insofern hat die Stellung des Weisen und Gerechten sich gewiss geändert. Mark Aurel, dessen Seele in ihrem Mitgefühl wahrscheinlich edler, in ihrer Eindrucksfähigkeit vielleicht weiser, in ihrer Gewissenhaftigkeit vielleicht reiner gewesen ist und nach Gerechtigkeit mehr gedürstet hat, als je eine, fragt sich nicht, was ausserhalb des wunderbaren kleinen Lichtkreises geschieht, in den seine Tugend, sein Gewissen, sein Mitleid und seine göttliche Sanftmut seine Anverwandten, Freunde und Diener hüllen. Ringsum, das weiss er gut genug, herrscht die bodenlose Ungerechtigkeit. Aber diese Ungerechtigkeit kümmert ihn nicht. Sie ist das notwendige, geheimnisvolle und geheiligte Meer, das ungeheure Wirkungsbereich der Götter, des Verhängnisses und der unbekannten, unverantwortlichen, unbeugsamen und unerschütterlichen höheren Gesetze.
Sie entmutigt ihn durchaus nicht, im Gegenteil giebt sie ihm Sicherheit, Selbstbesinnung und Erhebung, wie eine Flamme höher strebt, wenn sie sich nicht zu sehr ins Breite dehnt, oder wenn sie ganz allein in der Nacht aufflammt und die Finsternis sie doppelt leuchten lässt. Es ist ihm nicht gegeben, an dem Schicksalsschluss zu rütteln, dass die grosse Mehrzahl in Niedrigkeit, Elend und Knechtschaft leben soll. Er unterwirft sich ihm nicht ohne Schwermut, aber voller Vertrauen auf unvordenkliche und unwiderrufliche Gesetze, und das ist gleichfalls ein Akt des Mitleids und der Tugend. Er schliesst sich in sich selbst ein und wird grösser, menschlicher und gerechter in einem unbeweglichen und lichtlosen leeren Raume. Und von Jahrhundert zu Jahrhundert haben die Weisen und Guten denselben eng begrenzten und verschlossenen Eifer gehegt. Mehr als ein unerschütterliches Gesetz hat seinen Namen gewechselt, aber seine unendliche Macht ist die gleiche geblieben, und sie sehen es mit derselben entsagenden und beruhigten Schwermut an. Aber was sollen wir thun? Wir wissen, dass es keine notwendige Ungerechtigkeit mehr giebt. Wir sind in das Gebiet der Gottheit, des Schicksals und der unbekannten Gesetze eingedrungen. Vielleicht verbleiben ihnen Krankheit, Unfall, Sturm, Blitz und die meisten Mysterien des Todes; wir sind so weit noch nicht vorgedrungen, aber so viel ist gewiss: Armut, aussichtslose Arbeit, Elend, Hunger und Knechtschaft sind ihnen entrissen. Wir sind ihre Urheber, ihre Erhalter und ihre Verteiler. Sie sind unsre persönlichen,
furchtbaren, wohl begründeten Plagen, und die Leute werden immer seltener, die ernstlich glauben, dass eine übermenschliche Macht sie hervorruft. Das heilige und unbefahrbare Meer, das die Zufluchtsstätte des in sich gekehrten Denkers und Gerechten von ehedem umschloss und rechtfertigte, besteht nur noch in unseren Erinnerungen. Heute würde Mark Aurel nicht mehr mit derselben Heiterkeit sagen: »Sie suchen Zufluchtsorte, ländliche Hütten, Meeresgestade, Berge: und auch Du überlässest Dich gewöhnlich dem heftigen Verlangen nach gleichen Gütern. Aber so handeln nur Unwissende und Ungeschickte, denn Du kannst Dich zu jeglicher Stunde, wo Du willst, in Dich selbst zurückziehen. Nirgends findet der Mensch eine ruhigere, durch weltliche Sorgen weniger gestörte Zufluchtsstätte, als in seiner Seele, besonders, wenn man jene Dinge in sich hat, deren Betrachtung genügt, um uns sofort jene völlige Ruhe zu schenken, die mir nichts andres als eine vollkommene Ordnung unserer Seele zu sein scheint.«
Heute handelt es sich um mehr, als um die Ordnung der Seele, oder besser, es handelt sich darum, alle die Dinge darin zu ordnen, die sich in Mark Aurels Tagen noch nicht in ihr befanden, – d. h. dreiviertel des menschlichen Unglücks – und die aus unantastbaren, unerforschlichen, unbeweglichen Schicksalsschlüssen zu wirklichen, erklärlichen, dringenden Menschenfragen geworden sind.

 Damit soll nicht gesagt sein, dass man dieses Verlangen nach »Ordnung«, das die alten Weisen hatten, aufgeben solle. Wir haben die absolute »Ordnung«, die sie in ihrer entschuldbaren Selbstsucht fanden, nicht mehr zu gewärtigen, aber wir können auf eine bedingte und vorläufige Ordnung wohl hoffen. Mit dieser »Ordnung« ist das letzte Wort in der Moral noch nicht gesprochen, aber es ist darum nicht minder unerlässlich, gegen sich selbst wie gegen seine Anverwandten, Freunde, Nachbarn und Knechte so gerecht wie möglich zu sein. Denn von der Stunde an, wo
wir gegen diese und in unserm Gewissen vollkommen gerecht sind, werden wir erkennen, dass wir gegen die, welche nicht unsere Verwandten, Freunde, Nachbaren und Knechte sind, sehr ungerecht handeln, wenn anders wir das Recht besitzen, Knechte zu haben. Wie wir aber in praxi gerechter gegen sie sein sollen, das wissen wir noch nicht, wofern wir unsre Zuflucht nicht zu jenen heroischen Entsagungen nehmen wollen, die zu wenig einstimmig sind, als dass sie etwas zu stande brächten, und auch wohl gegen die tiefsten Gesetze der Natur verstossen, welche die Entsagung in allen ihren Formen, ausgenommen die der Mutterliebe, verwirft.
Damit soll nicht gesagt sein, dass man dieses Verlangen nach »Ordnung«, das die alten Weisen hatten, aufgeben solle. Wir haben die absolute »Ordnung«, die sie in ihrer entschuldbaren Selbstsucht fanden, nicht mehr zu gewärtigen, aber wir können auf eine bedingte und vorläufige Ordnung wohl hoffen. Mit dieser »Ordnung« ist das letzte Wort in der Moral noch nicht gesprochen, aber es ist darum nicht minder unerlässlich, gegen sich selbst wie gegen seine Anverwandten, Freunde, Nachbarn und Knechte so gerecht wie möglich zu sein. Denn von der Stunde an, wo
wir gegen diese und in unserm Gewissen vollkommen gerecht sind, werden wir erkennen, dass wir gegen die, welche nicht unsere Verwandten, Freunde, Nachbaren und Knechte sind, sehr ungerecht handeln, wenn anders wir das Recht besitzen, Knechte zu haben. Wie wir aber in praxi gerechter gegen sie sein sollen, das wissen wir noch nicht, wofern wir unsre Zuflucht nicht zu jenen heroischen Entsagungen nehmen wollen, die zu wenig einstimmig sind, als dass sie etwas zu stande brächten, und auch wohl gegen die tiefsten Gesetze der Natur verstossen, welche die Entsagung in allen ihren Formen, ausgenommen die der Mutterliebe, verwirft.
Diese praktische Gerechtigkeit ist also das Geheimnis der Gattung. Die Gattung hat mehrere solcher Geheimnisse, die sie eines nach dem andern offenbart, und dies in den wahrhaft kritischen Augenblicken der Geschichte; und die Massregeln, mit denen sie unüberwindliche Schwierigkeiten beseitigt, sind fast immer unerwartet und von erstaunlicher Einfachheit. Vielleicht ist die Stunde gekommen, wo sie wieder spricht. Hoffen wir es, ohne unsere Hoffnung zu übertreiben, denn wir dürfen nicht ausser acht lassen, dass es noch weithin ist, bis die Menschheit aus der Periode der »geopferten Geschlechter« heraus kommt. Die Geschichte kennt bisher keine anderen, und es ist möglich, dass alle Geschlechter sich bis an das Ende der Zeiten für geopfert halten werden. Nichtsdestoweniger lässt sich nicht leugnen, dass die Opfer, so ungerecht, unnütz und unzählig sie auch noch sein mögen, doch immer weniger unmenschlich und unvermeidlich werden, dass sie unter Gesetzen stattfinden, die immer besser bekannt werden und sich immer mehr denen nähern, die eine höhere Vernunft annehmen könnte, ohne erbarmungslos zu sein.
 Aber das muss man sagen: die »Ideen« der Gattung sind von einer majestätischen und Furcht einflössenden Langsamkeit. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis die Menschen es aufgaben, sich zu fliehen oder anzugreifen, wenn sie sich am Eingang ihrer Höhlen trafen, bis sie erkannten, dass es in ihrem Interesse lag, sich einander zu nähern, sich zusammenzuthun und gemeinsam gegen die ungeheuren Feinde der Aussenwelt zu verteidigen. Ausserdem sind die »Ideen« der Gattung oft sehr verschieden von denen, die der weiseste Einzelmensch haben könnte. Sie scheinen unabhängig aus sich selbst heraus zu
wachsen und stützen sich oft auf Thatsachen, deren Spur man in der bewussten Vernunft ihrer Entstehungsepoche nicht vorfindet; und es ist für den Moralisten oder Soziologen nichts so niederdrückend und beunruhigend, als sich sagen zu müssen, dass all sein heisses Bemühen, all sein Denken, all seine Vernunftschlüsse vielleicht nicht im stande sind, die Entscheidungen der grossen, namenlosen Masse, die ihrem unerkennbaren Ziele Schritt für Schritt entgegengeht, nur um eine Stunde zu beschleunigen oder um ein Haar zu verändern …
Aber das muss man sagen: die »Ideen« der Gattung sind von einer majestätischen und Furcht einflössenden Langsamkeit. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis die Menschen es aufgaben, sich zu fliehen oder anzugreifen, wenn sie sich am Eingang ihrer Höhlen trafen, bis sie erkannten, dass es in ihrem Interesse lag, sich einander zu nähern, sich zusammenzuthun und gemeinsam gegen die ungeheuren Feinde der Aussenwelt zu verteidigen. Ausserdem sind die »Ideen« der Gattung oft sehr verschieden von denen, die der weiseste Einzelmensch haben könnte. Sie scheinen unabhängig aus sich selbst heraus zu
wachsen und stützen sich oft auf Thatsachen, deren Spur man in der bewussten Vernunft ihrer Entstehungsepoche nicht vorfindet; und es ist für den Moralisten oder Soziologen nichts so niederdrückend und beunruhigend, als sich sagen zu müssen, dass all sein heisses Bemühen, all sein Denken, all seine Vernunftschlüsse vielleicht nicht im stande sind, die Entscheidungen der grossen, namenlosen Masse, die ihrem unerkennbaren Ziele Schritt für Schritt entgegengeht, nur um eine Stunde zu beschleunigen oder um ein Haar zu verändern …
 Es ist lange her, so lange, dass die Wissenschaft es sofort bestätigt hat, als sie aus dem Erdinnern, den Gletschern und Höhlen hervorkam und sich nicht mehr Geologie, sondern Geschichte der Menschheit nannte, es ist lange her, dass die Menschheit eine Krise durchmachte, die der, welcher sie jetzt entgegengeht, oder in der sie sich schon befindet, in manchen Stücken gleich ist, nur mit dem Unterschiede, dass sie ganz anders tragisch, unlösbar und verhängnisvoll erschien. Man kann sogar sagen, die Menschheit hat bisher keine gefährlichere und entscheidendere Stunde durchlebt, keine Periode, wo sie ihrem Untergange so nahe war; und wenn wir heute noch leben, so danken wir das augenscheinlich dem unverhofften Ausweg, der die Rasse in dem Augenblick rettete, wo die Plage, die just durch den menschlichen Verstand und alles Beste und Unwiderstehlichste im menschlichen Gerechtigkeitsgefühl grossgezogen war, das heroische Gleichgewicht
zwischen der Lebenslust und der Möglichkeit zu leben auf immer zu vernichten begann.
Es ist lange her, so lange, dass die Wissenschaft es sofort bestätigt hat, als sie aus dem Erdinnern, den Gletschern und Höhlen hervorkam und sich nicht mehr Geologie, sondern Geschichte der Menschheit nannte, es ist lange her, dass die Menschheit eine Krise durchmachte, die der, welcher sie jetzt entgegengeht, oder in der sie sich schon befindet, in manchen Stücken gleich ist, nur mit dem Unterschiede, dass sie ganz anders tragisch, unlösbar und verhängnisvoll erschien. Man kann sogar sagen, die Menschheit hat bisher keine gefährlichere und entscheidendere Stunde durchlebt, keine Periode, wo sie ihrem Untergange so nahe war; und wenn wir heute noch leben, so danken wir das augenscheinlich dem unverhofften Ausweg, der die Rasse in dem Augenblick rettete, wo die Plage, die just durch den menschlichen Verstand und alles Beste und Unwiderstehlichste im menschlichen Gerechtigkeitsgefühl grossgezogen war, das heroische Gleichgewicht
zwischen der Lebenslust und der Möglichkeit zu leben auf immer zu vernichten begann.
Ich meine die Gewaltthaten, den Raub und Todschlag, die in den ersten menschlichen Gesellschaftsbildungen mit Notwendigkeit entstanden. Sie waren wahrscheinlich grauenhaft und mussten den Bestand der Rasse ernstlich in Frage stellen, denn das Bedürfnis nach Gerechtigkeit nimmt zuerst die furchtbare und sozusagen epidemische Gestalt der Rache an. Es ist klar, dass die Rache, sich selbst überlassen, und mit jedem Falle sich vervielfältigend, die Rache als die Folge von Rache an der Rache, wo nicht die ganze Menschheit, so doch alles, was Energie, Stolz und Gerechtigkeitsgefühl unter den ersten Menschen besass, verschlungen hätte. Nun aber tritt bei fast allen barbarischen Völkern, ebenso wie bei den meisten wilden Stämmen, wo sich dies heute noch beobachten lässt, ein gewisser Augenblick ein – und dies ist gewöhnlich der Augenblick, wo die Waffen des Stammes wahrhaft mörderisch werden – wo die Rache meistenteils bei einer sonderbaren Sitte stehen bleibt, die man »das Wergeld« oder den »Preis des Totschlages« genannt hat, und welche dem Schuldigen erlaubt, sich aus der Rache der Freunde und Verwandten des Opfers freizukaufen, indem er eine zunächst willkürliche, später genau festgesetzte Entschädigung zahlt.
Wenn man es recht besieht, so ist in der ganz heroischen, ganz dem ersten Impuls hingegebenen Geschichte der jugendlichen Völker nichts sonderbarer und unerwarteter, als die etwas geschäftsmässige, etwas zu langmütige Erfindung dieser fast allgemeinen Sitte. Soll man sie der Vorsorglichkeit der Führer zuschreiben? Aber man findet sie auch dort wieder, wo von Autorität eigentlich noch keine Rede ist. Ist sie den Greisen, Denkern, Weisen der ersten menschlichen Gesellschaften zuzuschreiben? Das ist ebenso unwahrscheinlich. Es ist dies ein Gedanke, der zugleich niedriger und höher ist, als ein Gedanke, den ein einzelnes Genie, ein Prophet, in barbarischen Zeitaltern hätte fassen können. Der Weise, der Prophet, das Genie, namentlich das wild wachsende Genie, sind viel eher geneigt, die grossmütigen und heroischen Hänge des Stammes und der Zeit, der sie angehören, noch zu übertrumpfen. Dieses furchtsame und fast hinterlistige Zaudern vor einer natürlichen und fast geheiligten Rache, dieses recht hässliche Markten mit Freundschaft, Treue und Liebe, hätten ihnen eher widerstehen müssen. Und ist es andererseits wohl wahrscheinlich, dass sie sich hoch genug über die unmittelbarsten Pflichten stellen konnten, um die edleren und unstreitigeren Pflichten zu erblicken, jenes höhere Interesse des Stammes und der Rasse, jenen geheimnisvollen Lebenswillen, den die Weisesten der Weisen auch heute noch erst nach einem tiefen und schmerzhaften Kampfe, nach einem Siege über ihre Einzelvernunft und über ihr Herz, zu erblicken und zu rechtfertigen pflegen?
Nein, nicht das menschliche Denken hat diese Lösung gefunden, im Gegenteil war es die Unbewusstheit der Masse, die sich gegen Gedanken wehren musste, die zu individuell, zu rein menschlich waren, als dass sie sich den unabweislichen Forderungen des Lebens auf dieser Erde hätten anpassen lassen. Die Gattung ist ausserordentlich gefügig und ausdauernd. So lange und so weit sie kann, trägt sie die Bürde, die ihr die Vernunft, das Trachten nach dem Besten, die Einbildungskraft, die Leidenschaften, Laster, Tugenden und Gefühle auferlegen, die den Menschen eigen sind. Aber in dem Augenblick, wo diese Bürde wirklich verhängnisvoll und verderblich wird, schüttelt sie sie gleichgiltig ab. Sie fragt nicht nach den Mitteln, sie wählt das nächstliegende, praktischeste, einfachste und ist anscheinend überzeugt, dass ihre Idee die gerechteste und beste ist. Nun aber hat sie nur eine Idee: zu leben, und diese Idee überwindet im ganzen genommen allen Heroismus und alle noch so bewundernswerten Träume, welche die abgeschüttelte Bürde vielleicht in sich schloss.
Geben wir es nur zu: in der Geschichte der menschlichen Vernunft sind die Gedanken, die sich am höchsten erheben, nicht immer die gerechtesten oder grössten. Es ist mit den Gedanken der Menschen ein wenig so, wie mit den Wasserstrahlen, die nur darum so hoch springen, weil sie eingeschlossen sind und aus einem sehr engen Mundloch ausströmen. Wenn das Wasser aus dem Mundloch hervorspringt, so kann man glauben, es stiege himmelan und verachtete den grossen, unbeweglichen und endlosen Wasserspiegel, der sich unter ihm dehnt. Und doch ist man im Irrtum; der grosse Wasserspiegel hat Recht. Er erfüllt ruhig, in anscheinender Unbeweglichkeit und unthätigem Schweigen, die ungeheure normale Aufgabe des wichtigsten Elementes auf unserer Erde, und der Wasserstrahl ist nur eine sonderbare Ausnahmeerscheinung und fällt bald wieder zurück zu der allgemeinen Aufgabe. Er hat nicht etwa Unrecht, dass er sich erhebt, er gehorcht auch einem tiefen Naturgesetz, aber er hätte Unrecht, wenn er glaubte, dass er grösser ist, als der grosse Wasserspiegel, weil er sich einen Augenblick über seine Fläche erhebt. Das, was er gesehen hat, kehrt unmittelbar wieder zu dem zurück, was er zu übersehen vermeint hat. Für uns ist die Gattung der grosse Wasserspiegel, der immer recht hat, selbst vom Standpunkte des höheren Menschen aus, den sie bisweilen über sich hinauszuheben scheint. Sie umfasst den weitesten Begriff, der alle anderen enthält und Zeit und Raum ins Unendliche umspannt. Und erkennen wir nicht von Tag zu Tag klarer, dass der weiteste Begriff auf jedem beliebigen Gebiete zuletzt doch der vernünftigste, weiseste, gerechteste und auch der schönste ist?
 Man fragt sich bisweilen, ob es nicht besser wäre, wenn die Geschicke der Menschheit von den höheren Menschen, den grossen Weisen, geleitet würden, als durch den Instinkt der Gattung, der stets so langsam und oft so grausam ist.
Man fragt sich bisweilen, ob es nicht besser wäre, wenn die Geschicke der Menschheit von den höheren Menschen, den grossen Weisen, geleitet würden, als durch den Instinkt der Gattung, der stets so langsam und oft so grausam ist.
Ich glaube, man kann heute auf die Frage nicht ebenso antworten, wie man es früher gethan hätte. Es wäre ganz gewiss sehr gefährlich gewesen, wenn man die Geschicke der Gattung einem Platon, Mark Aurel, Shakespeare oder Montesquieu anvertraut hätte. In den schlimmsten Stunden der französischen Revolution lag das Schicksal des Volkes einen Augenblick in den Händen von wirklichen Weisen und recht guten Philosophen, denn Robespierre und St.-Just waren weise, tugendhaft, voll edler Gedanken und lauterer Absichten. Aber es ist ausser Zweifel, dass die Eigenschaften des Genies, des Denkers und Philosophen, mit einem Wort, des grossen Weisen, sich von Grund aus geändert haben. Er ist nicht mehr spekulativ, utopistisch oder ausschliesslich intuitiv. In der Politik wie in der Philosophie und Litteratur und in allen Wissenschaften ist er mehr und mehr beobachtend und immer weniger intuitiv geworden. Er folgt, er sieht, er forscht, er versucht zu organisieren, was ist, statt dass er vorangeht, errät und zu schaffen sucht, was noch nicht ist oder nie sein wird. Und darum ist er heute vielleicht mehr geeignet, ein Machtwort zu reden, und es wäre vielleicht weniger gefährlich, wenn er unmittelbar ins Leben eingriffe. Gewiss wird man ihm nicht mehr freie Hand lassen, als früher, vielleicht sogar weniger, denn da er umsichtiger und durch seine beschränkten Gewissheiten weniger verblendet ist, wird er weniger verwegen, weniger diktatorisch und unbedingt sein. Es ist trotzdem möglich, dass er in natürlichem Einklänge mit dem »Genius der Art«, den zu beobachten er sich begnügt, nach und nach an Einfluss gewinnen wird, sodass es im letzten Grunde auch hier die Art ist, die Recht behält und entscheidet, denn sie leitet den, der sie beobachtet, und folgt, indem sie diesem Leiter folgt, im Grunde nur ihrem eignen unbewussten und gestaltlosen Willen, den er in Form und Bewusstsein umsetzt.
 Inzwischen, bis die Art den neuen, notwendigen Ausweg findet, – und sie wird ihn ohne Mühe finden, wenn die Gefahr ernst genug wird – scheint es fast, als ob sie ihn schon gefunden hätte und als ob er zu dieser Stunde bereits einen Teil unseres Geschickes umwandelte, ohne dass wir von seinem Vorhandensein etwas ahnen. Inzwischen, und während wir in der Aussenwelt wirken, als ob das Heil unserer Brüder einzig und allein von unserem Wirken abhinge, ist es uns ganz wie den alten Weisen verstattet, zuweilen in uns selbst zu gehen. Vielleicht finden wir in unserem Innern auch »eines jener Dinge, deren Betrachtung genügt«, um uns augenblicklich, wenn auch nicht die vollkommene Ruhe, so doch eine unzerstörbare Hoffnung zu schenken. Wenn die Natur uns nicht gerecht erscheint, wenn uns nichts zu der Behauptung berechtigt, dass eine höhere Macht, oder die Vernunft des Weltalls, hier oder in einer anderen Welt und nach den Gesetzen unseres Gewissens, oder nach anderen Gesetzen, die wir eines Tages gutheissen werden, Lohn und Strafe austeilt, wenn ferner zwischen Mensch und Mensch, d. h. in den Beziehungen zu unsresgleichen, die Gerechtigkeit immer noch unvollkommen, den Irrtümern des Verstandes, den Ränken unseres persönlichen Interesses unterworfen ist und noch tief in den schlechten Gewohnheiten eines »untermenschlichen«
sozialen Zustandes steckt, so ist es doch gewiss, dass jeder einzelne von uns auf dem Grunde seines inneren Lebens ein Bild dieser unsichtbaren, unzerstörbaren und unfehlbaren Gerechtigkeit bewahrt, die wir im Himmel, im Weltall und in der menschlichen Gesellschaft vergeblich gesucht haben. Sie entzieht sich freilich den Blicken der andren Menschen und oft selbst unserem eigenen Bewusstsein, aber darum, weil sie verborgen und unantastbar ist, bleibt ihr Wirken doch nicht minder tief menschlich und von Grund aus wirklich. Anscheinend prüft und hört sie alles, was wir denken, sagen und in der äusseren Welt anstreben, und wenn dem allem etwas guter Wille und Aufrichtigkeit zu Grunde liegt, so wandelt sie es in eine Summe sittlicher Kräfte um, die unser Innenleben erleuchten und erweitern und uns helfen, noch besser zu denken, zu sagen und anzustreben, was in Zukunft sein wird. Sie vergrössert und verringert unsere Reichtümer nicht, sie wendet weder Krankheit noch Blitz ab, sie verlängert das Leben eines angebeteten Wesens nicht; aber wenn wir gelernt haben, zu lieben und nachzudenken, mit anderen Worten, wenn wir unsere Pflicht gegen den Geist ebenso gethan haben, wie gegen das Herz, so unterhält sie auf dem Grunde unseres Geistes und unseres Herzens eine Einsicht und eine vielleicht nicht mehr in Illusionen lebende, aber edle und unerschöpfliche Zufriedenheit und eine Würde des Daseins, die hinreichend sind, unser Leben zu fristen, wenn die Schätze verloren sind, Krankheit oder Blitz getroffen haben und das angebetete
Wesen auf immer aus unseren Armen entschwunden ist.
Inzwischen, bis die Art den neuen, notwendigen Ausweg findet, – und sie wird ihn ohne Mühe finden, wenn die Gefahr ernst genug wird – scheint es fast, als ob sie ihn schon gefunden hätte und als ob er zu dieser Stunde bereits einen Teil unseres Geschickes umwandelte, ohne dass wir von seinem Vorhandensein etwas ahnen. Inzwischen, und während wir in der Aussenwelt wirken, als ob das Heil unserer Brüder einzig und allein von unserem Wirken abhinge, ist es uns ganz wie den alten Weisen verstattet, zuweilen in uns selbst zu gehen. Vielleicht finden wir in unserem Innern auch »eines jener Dinge, deren Betrachtung genügt«, um uns augenblicklich, wenn auch nicht die vollkommene Ruhe, so doch eine unzerstörbare Hoffnung zu schenken. Wenn die Natur uns nicht gerecht erscheint, wenn uns nichts zu der Behauptung berechtigt, dass eine höhere Macht, oder die Vernunft des Weltalls, hier oder in einer anderen Welt und nach den Gesetzen unseres Gewissens, oder nach anderen Gesetzen, die wir eines Tages gutheissen werden, Lohn und Strafe austeilt, wenn ferner zwischen Mensch und Mensch, d. h. in den Beziehungen zu unsresgleichen, die Gerechtigkeit immer noch unvollkommen, den Irrtümern des Verstandes, den Ränken unseres persönlichen Interesses unterworfen ist und noch tief in den schlechten Gewohnheiten eines »untermenschlichen«
sozialen Zustandes steckt, so ist es doch gewiss, dass jeder einzelne von uns auf dem Grunde seines inneren Lebens ein Bild dieser unsichtbaren, unzerstörbaren und unfehlbaren Gerechtigkeit bewahrt, die wir im Himmel, im Weltall und in der menschlichen Gesellschaft vergeblich gesucht haben. Sie entzieht sich freilich den Blicken der andren Menschen und oft selbst unserem eigenen Bewusstsein, aber darum, weil sie verborgen und unantastbar ist, bleibt ihr Wirken doch nicht minder tief menschlich und von Grund aus wirklich. Anscheinend prüft und hört sie alles, was wir denken, sagen und in der äusseren Welt anstreben, und wenn dem allem etwas guter Wille und Aufrichtigkeit zu Grunde liegt, so wandelt sie es in eine Summe sittlicher Kräfte um, die unser Innenleben erleuchten und erweitern und uns helfen, noch besser zu denken, zu sagen und anzustreben, was in Zukunft sein wird. Sie vergrössert und verringert unsere Reichtümer nicht, sie wendet weder Krankheit noch Blitz ab, sie verlängert das Leben eines angebeteten Wesens nicht; aber wenn wir gelernt haben, zu lieben und nachzudenken, mit anderen Worten, wenn wir unsere Pflicht gegen den Geist ebenso gethan haben, wie gegen das Herz, so unterhält sie auf dem Grunde unseres Geistes und unseres Herzens eine Einsicht und eine vielleicht nicht mehr in Illusionen lebende, aber edle und unerschöpfliche Zufriedenheit und eine Würde des Daseins, die hinreichend sind, unser Leben zu fristen, wenn die Schätze verloren sind, Krankheit oder Blitz getroffen haben und das angebetete
Wesen auf immer aus unseren Armen entschwunden ist.
Ein guter Gedanke, eine gute That geben unserem Herzen den Lohn, den es mangels eines Weltenrichters und einer sittlichen Weltordnung von den Dingen der Aussenwelt nicht zu erwarten hatte. Das Glück, das sie aus der Aussenwelt nicht hervorzaubern konnte, bemüht sie sich, in uns selbst hervorzurufen, und sie erfüllt die Seele um so mehr, je mehr es ihr an äusseren Zuflüssen fehlt. Sie schafft einer wachsenden Einsicht und Liebe, einem wachsenden Frieden Raum. Sie vermag nichts auf die Naturgesetze, aber alles auf die Gesetze, die das glückliche Gleichgewicht eines menschlichen Gewissens bedingen. Und dies trifft für alle Stufen des Gedankens wie für alle Stufen der That zu. Der Arbeiter, der sein bescheidenes Dasein als Familienvater in redlicher Weise lebt und seiner Arbeitspflicht in derselben Weise genügt, und ein Mensch, der in moralischem Heroismus ausharrt, stehen gewiss in grossem Abstand von einander. Und doch leben und handeln sie auf demselben Plan, und beide stehen auf demselben redlichen, ernsten und tröstlichen Boden. Gewiss hat das, was wir sagen und thun, grossen Einfluss auf unser materielles Glück, aber selbst das materielle Glück geniesst der Mensch doch nur mit seinen geistigen Organen dauernd und gründlich. Und darum hat unser Denken noch mehr Belang. Aber worauf es bei der Art und Weise, wie wir die Freuden und Leiden des Lebens aufzunehmen wissen, noch mehr ankommt, das ist der Charakter, die Geistesverfassung, der moralische Zustand, den unser Denken, Thun und Sagen in uns hervorgerufen hat. Hier zeigt sich eine wunderbare Gerechtigkeit, und der Einklang zwischen dem dauernden guten Willen des Herzens und Geistes und dem inneren Glück unserer moralischen Wesenheit ist umso notwendiger und vollkommener, als dieses Glück nichts anders ist, als das Antlitz des guten Gedankens und Gefühls, das uns selbst entgegenstrahlt. Hier findet sich thatsächlich jenes geistige und moralische Band zwischen Ursache und Wirkung, das wir in der Aussenwelt vergeblich gesucht haben, und in den moralischen Dingen giebt es wirklich eine Gerechtigkeit, die über das im Grunde unseres Bewusstseins lebende Gute und Böse herrscht, wie wir es in den physischen Dingen so sehr gewünscht hatten. Und entspringt dieser unser Wunsch nicht überhaupt aus ihr, und ist diese Gerechtigkeit in unserem Herzen nicht doppelt mächtig und lebendig, weil es uns so schwer fällt, uns zu überzeugen, dass sie im All nicht vorhanden ist?
 Wir haben recht lange von der Gerechtigkeit gesprochen, aber ist sie nicht das grosse moralische Mysterium des Menschen, und trachtet sie nicht danach, die meisten geistigen Mysterien, die sein Geschick einst lenkten, zu ersetzen? Sie ist an Stelle mehr als eines Gottes, mehr als einer namenlosen Macht getreten. Sie ist der Stern, der sich im Nebelmeer unserer Instinkte und unseres unbegreiflichen Lebens bildet. Sie ist nicht des Rätsels Lösung, und wenn
wir besser wissen werden, was sie ist, und wenn sie auf Erden wahrhaft regieren wird, so werden wir darum nicht besser wissen, was wir sind und woher wir kommen, noch wohin wir gehen, aber sie ist des Rätsels erstes Gebot, und wenn man ihm Folge leistet, können wir freieren Geistes und ruhigeren Herzens auf die Ergründung seines Geheimnisses ausgehen.
Wir haben recht lange von der Gerechtigkeit gesprochen, aber ist sie nicht das grosse moralische Mysterium des Menschen, und trachtet sie nicht danach, die meisten geistigen Mysterien, die sein Geschick einst lenkten, zu ersetzen? Sie ist an Stelle mehr als eines Gottes, mehr als einer namenlosen Macht getreten. Sie ist der Stern, der sich im Nebelmeer unserer Instinkte und unseres unbegreiflichen Lebens bildet. Sie ist nicht des Rätsels Lösung, und wenn
wir besser wissen werden, was sie ist, und wenn sie auf Erden wahrhaft regieren wird, so werden wir darum nicht besser wissen, was wir sind und woher wir kommen, noch wohin wir gehen, aber sie ist des Rätsels erstes Gebot, und wenn man ihm Folge leistet, können wir freieren Geistes und ruhigeren Herzens auf die Ergründung seines Geheimnisses ausgehen.
Endlich ist sie der Inbegriff aller menschlichen Tugenden, die sie durch ihr blosses, wohlmeinendes Lächeln läutert und adelt und dadurch berechtigt, in unserem moralischen Leben einen Platz einzunehmen. Denn alle Tugend, die ihren hellen und festen Blick nicht ertragen kann, ist unnütz, voller Heuchelei, und nichts weniger als wohlthätig. Man findet sie somit im Mittelpunkte jedes Ideals wieder. Sie bildet das Zentrum der Liebe, der Wahrheit, wie der Schönheitsliebe. Sie ist Güte, Mitleid, Liebe, Grossmut und Heldentum zugleich, denn Güte, Mitleid, Liebe, Grossmut und Heldentum sind Gerechtigkeitsakte eines Jeden, der sich hoch genug erhoben hat, um nicht nur das Recht und Unrecht zu seinen Füssen und in dem engen Kreise seiner zufälligen Verpflichtungen zu sehen und zu suchen, wohl aber über Jahre und nachbarliche Schicksale hinweg, jenseits all der Dinge, die er thun muss, die er liebt, sucht, trifft, billigt und missbilligt, hinweg über das, was er hofft und fürchtet, jenseits der Irrtümer und selbst Verbrechen der Menschen, seiner Brüder.
![]()