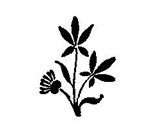|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Auf Crosby Ranch hatten in diesem Jahre einschneidende Veränderungen stattgefunden.
Seit der Geburt des Töchterchens war Bernhard wie umgewandelt, jetzt führte er das Regiment und mit einer Umsicht, die allgemeines Staunen erregte. Bis jetzt hatte er seinen Besitz noch gar nicht gekannt; er griff alte Gerüchte von ergiebigen Petroleumquellen auf seinem Grund und Boden, die in der Gegend kursierten, wieder auf, ließ Fachmänner zur Unterstützung kommen, bohrte unverdrossen, trotz erheblicher Kosten und anfänglich schlechter Aussichten, – bis eines Tages eine Quelle floß, welche täglich fünfzig Faß lieferte, und wenige Wochen darauf eine zweite gleich ergiebige. Er packte die Sache gründlich an, errichtete eine Raffinerie an der nächsten Bahnstation und verband sie durch ein Röhrennetz mit den Quellen. Der Gewinn war binnen kurzem ein ungeheurer, Crosby Ranch stieg um das Drei- bis Vierfache im Wert. Das hob ihn, jetzt arbeitete er mit selbstverdientem Geld. Brennereien wurden gebaut, Dampfmühlen; an der erstaunten Bessy war es jetzt, den übermäßigen Tateneifer einzudämmen, welcher ihren Gatten aufzureiben drohte.
Keine Spur mehr von dem geheimnisvollen Brüten, von dem unmännlichen Wesen war an ihm zu entdecken; es war eben nichts als eine momentane Gemütskrankheit gewesen, die nun glücklich überstanden war. Bessy schämte sich der sonderbaren Gedanken, die ihr damals im Wochenbett aufgestiegen waren, und doch kehrten sie trotz allen Sträubens immer wieder.
Bernhard lachte jetzt seiner blöden Gewissensbisse, seiner früheren Untätigkeit. Das Glück hob ihn empor, erfüllte ihn mit Selbstvertrauen, Mannesstolz. Sein Haus blühte, das Kind blühte, Bessy war glücklich. Im zweiten Jahre kam ein Sohn, ein Erbe; das Vermögen war verzehnfacht, und da sollte er sich noch ein Gewissen machen wegen diesem Scherz von 50 000 Dollar? Einen Scherz nannte er's jetzt.
Henry Smidt war tot ohne Zweifel, für ihn, den lebenstrotzenden, tatendurstigen Mann. Er pries jetzt seine Zurückhaltung in jener Stunde, da er nahe daran gewesen, sein und seiner Familie Glück auf's Spiel zu setzen, einer Marotte zuliebe. Seine Befürchtung, in Bessy hätten seine damaligen unvorsichtigen Aeußerungen einen leisen Verdacht zurückgelassen, war auch unbegründet, sie hing mit innigerer Liebe an ihm wie je; ja, wenn sie je solchen Verdacht gehegt, so hatte es jetzt den Anschein, als fühle sie die Verpflichtung, an ihrem Gatten etwas gut zu machen.
Die Sonne des Glücks schien aus Crosby Ranch, und, wie es immer geschieht, die ganze Umgegend suchte sich an ihren Strahlen zu wärmen. Das Haus Bernhards war der Sammelpunkt der ganzen Nachbarschaft und jedem gastlich geöffnet. Auch die politischen und gesellschaftlichen Ehren blieben unter diesen Umständen nicht aus, er wurde zum Countydeputierten gewählt, bei allen Festlichkeiten und Veranstaltungen der Landschaft, selbst Pèorias, in das Komitee oder gar zum Präsidenten gewählt. Bernhard Weltz war ein klangvoller Name in den industriellen Kreisen des Staates, der einen großen Aufschwung versprach.
Unter diesen Umständen konnte es Henry Smidt, oder vielmehr Müller, wie er sich jetzt nannte, nicht schwer fallen, in Davenport Näheres über Crosby Ranch zu erfahren. Obwohl man dort mehr von Petrolia sprach, wie der kleine Ort jetzt genannt wurde, welcher sich bei der Raffinerie bildete, so kannten doch viele Leute den Zusammenhang beider Namen.
Der glückliche Besitzer hieß Bernhard Weltz, war ein Deutscher, vor einigen Jahren erst in die Gegend gekommen, verheiratet, – zwei Kinder, – ein tüchtiger, ehrenwerter Mann.
So weit stimmten alle eingezogenen Erkundigungen des ersten Tages, nur in einem Punkte gingen sie erheblich auseinander, nämlich welcher Teil der beiden Eheleute der eigentlich Besitzende war oder noch sei. Die einen behaupteten, Weltz sei als reicher Mann, der sein Geld in den Goldgruben Kaliforniens gewonnen, in die Gegend gekommen, habe Crosby Ranch von einem gewissen, erst vor einem Jahre verstorbenen Taylor, dessen Sohn hier in der Stadt herumlungere und den Rest seines Vermögens vertrinke, gekauft und ein armes Mädchen vom Lande geheiratet. Die andern behaupteten, bestimmt zu wissen, daß aller Besitz der Frau und den Kindern gehöre, dem Mann aber gar nichts. Was aber für Henry das Schlimmste und Auffallendste war, beide Parteien kannten den Familiennamen der Frau Weltz nicht, der ihn doch am meisten interessierte; es war ihm unwahrscheinlich, daß es Bessy Crosby sei, deren Schicksal doch auch hier bekannt sein mußte. Uebrigens reagierte man hier nicht im geringsten auf seine vorsichtigen Anspielungen betreffs des gewaltsamen Todes des alten Crosby, man schien gar nichts davon zu wissen. Ebenso gut konnte man aber auch von Bessy hier nichts wissen, obwohl sie die vielbeneidete Frau Weltz war. In diesem Lande wechselten ja die Ereignisse so rasch, wie ihre Augenzeugen. Diese Erfahrung gab Henry seine volle Zuversicht wieder; wo die Tat vergessen, war es auch der Täter.
Ein Mann nur war hier, der unbedingt Bescheid wußte, eben dieser Taylor, von dessen verstorbenem Vater der jetzige Besitzer Crosby Ranch gekauft hatte; aber dieser Mensch hatte ihn öfters in Pèoria gesehen, als er noch in Crosbys Dienst stand; er würde möglicher Weise in ihm Henry Smidt, den Mörder, erkennen.
Jener war zwar ein Säufer, solche Leute haben kein Gedächtnis, und er, Smidt, hatte sich sehr verändert; gerade die Unwahrscheinlichkeit seines Hierseins kam ihm zu gute.
Er erkundigte sich nach dem Lokal, in welchem der Trunkenbold gewöhnlich verkehrte, mehr in der Absicht, dasselbe sorgsam zu meiden, als es aufzusuchen. Eine obskure Kneipe wurde ihm genannt.
Er beschloß bereits selbst nach Petrolia zu fahren, dort würde er leicht das Nähere erfahren, und es war ja eine neue Niederlassung, eine ihm fremde Bevölkerung. Den Abend, bevor er sein Vorhaben ausführen wollte, schlenderte er, von einer inneren Unruhe getrieben, in den Straßen umher. Dieser Bernhard Weltz beschäftigte ihn, und unwillkürlich nahm er immer die Gestalt des Maschinisten von der ›Columbia‹ an. Ohne daß er es wollte, stand er plötzlich vor der Stammkneipe Taylors. Laute Stimmen drangen heraus, der Ton eines Banjo.
Rasch entschlossen trat er ein. Auf den ersten Blick erkannte er Patrik Taylor unter der Schar trunkener Männer an der Bar, er ragte über alle hinaus mit seinen breiten Schultern und war auch der trunkenste von allen. Sein Aeußeres verriet die größte Verkommenheit, sein Blick war so gläsern, so trübe, daß Henry ihn nicht fürchten zu müssen glaubte; er setzte sich abwartend an einen Tisch.
Das Gespräch der Männer drehte sich um nichts, rohe Scherze, blödes Lachen. Patrik schimpfte auf irgend jemand, mit dem er unlängst Streit gehabt. Plötzlich blickte er gerade zu Henry hinüber mit dem stieren Blick eines Trunkenen, der absichtslos etwas Beobachtendes, Erstauntes hat. Henry kannte das, und doch stieg ihm das Blut zu Herzen. Der Augenblick war eine Ewigkeit.
Taylor kehrte sich gleichgültig wieder ab. Er hatte ihn nicht erkannt.
Diesem Trunkenbold hatte der alte Crosby sein Kind Bessy zur Gattin bestimmt, als er eines reichen Mannes Sohn war; ihm, Henry Smidt, dem damals noch ehrlichen Arbeiter, hatte er sie verweigert, ihn verhöhnt und einen Unverschämten genannt. Der Haß, der ihn damals die Hand zum Schlage erheben ließ, erfaßte ihn wieder, er fühlte jetzt gar keine Reue über seine Tat, er war kein Mörder, er war ehrlich in seinen Augen wie vordem.
Der Gedanke ließ ihn alle Scheu vergessen.
Er trat an die Bar mitten unter die Männer, begehrte einen Drink und mischte sich ins Gespräch. Taylor verzog keine Miene, er beobachtete ihn genau, nicht die leiseste Erinnerung dämmerte auf in diesem geschwächten, dampfenden Gehirn.
Geschickt lenkte Smidt das Gespräch auf Petrolia, die neue Niederlassung; er habe morgen dort ein Geschäft.
»Muß ein tüchtiger Mann sein, dieser Mister Weltz?«
»Tüchtig? Ein unverschämtes Glück hat er,« brannte Patrik los. »Es ist zu dumm! Kommt daher, abgerissen wie ein Tramp, mit einem Haufen Geld in der Tasche, weiß der Teufel, wo er's her hatte; sauber ist die Geschichte nicht, wenn man den Kerl so gesehen hat –«
»Sie haben ihn gesehen? – So abgerissen? – Wo denn?« fragte Henry, der seinen Mann gefunden hatte.
»Na, wo werd' ich denn? In Pèoria bei William. Er kam gerade von Osten, wie ein Tramp, wie ein Schuft –«
Das Gesicht Taylors wurde rot vor Wut, er gedachte seiner Schläge von damals.
»Warum kam er denn wie ein Tramp mit einem Haufen Geld in der Tasche?« fragte Henry weiter, völligen Gleichmut heuchelnd.
»Das ist's ja, darum sage ich, daß die Geschichte nicht sauber ist. Er schwätzte später den Leuten was vor von einem Schiffbruch oder so etwas! – Faule Fische, wir kennen das.«
»Von einem Schiffbruch? Wann war denn das?«
Henry gab sich alle Mühe, an diesem Zufall nicht hängen zu bleiben, sich sein Urteil dadurch nicht verwirren zu lassen.
»Wann? Ja wann?«
»Vor etwa vier Jahren, so was muß es gewesen sein, daß er sich ankaufte,« meinte einer aus der Gesellschaft.
Patrik achtete nicht darauf, er lachte, den Kopf schüttelnd, in boshaftem Aerger.
»Es ist zu dumm – zu dumm, wie der Kerl zu Crosby Ranch kam. Keine Ahnung hatte er davon, keinen Dunst, von gar nichts, den hellsten Unsinn schwätzte er daher. Na, das muß ich erzählen. Es war an demselben Abend bei William, er hatte kaum hereingeschmeckt, da rede ich – Crosby Ranch gehörte damals uns, gehörte noch uns, wenn mein Vater kein – na, ich spucke darauf –«
Er goß einen Whisky in seine Kehle.
»Da red' ich so zufällig von Bessy Crosby, der Tochter des Crosby, von dem die Ranch den Namen hat; der Alte wurde von seinem Knecht erschossen und ausgeraubt, von der Geschichte habt Ihr ja schon gehört.«
»Der ganze Kaufpreis der Ranch ging flöten, den dein Vater in Pèoria dem Crosby ausbezahlt hat. Ist's nicht so?« bemerkte ein anderer. »Hat man den Knecht erwischt?«
»Ah was! Wen erwischt man denn bei uns? Aber laß mich doch auserzählen; es ist ja zu dumm! Tüchtig heißt's dann, ein tüchtiger Mann! – Also, ich red' von der Bessy Crosby, die mein Vater aus Barmherzigkeit als Wirtschafterin angenommen nach der Geschichte. Ein Teufelsweib, frech und unverschämt. – Der Alte war ganz vernarrt in sie – na, ich hab' sie nicht mögen, und so ließ ich halt meinen Schleim aus über sie, – was sagt' ich denn nur gleich? – Na, Ihr kennt mich ja, was werd' ich denn gesagt haben –«
Lachend nannte man eine Reihe roher Ausdrücke, die man aus seinem Munde gewohnt war.
»Racker, Patrik. Ich wette, du sagtest Racker!« rief einer.
»Der hat's!« polterte Patrik heraus.
»Racker, ja, Racker nannte ich sie. – Also gut, da fällt dem Burschen, dem Weltz ein, sich als Gentleman aufzuspielen und das Mädchen zu verteidigen, ohne daß er sie kannte. Na, da könnt ihr euch denken, was es absetzte! Eine Prügelei, sage ich Euch, eine Prügelei, wie ich keine feinere mehr gesehen; natürlich verbläute ich ihn ordentlich, hatte aber das Pech, über einen Stuhl zu stolpern, der an der offenen Türe stand, so daß ich geradenwegs auf die Straße hinausfiel.«
Alles lachte über die Renommage, die Wahrheit ahnend.
»Und wem falle ich vor die Füße?« fuhr Taylor fort, »der Bessy Crosby, welche gerade angeritten kommt. Ich drückte mich, der Bursche hatte sein Teil. Das Dämchen glaubt natürlich, ich sei der Besiegte, freut sich im voraus darüber, wird ganz toll, wie sie von Williams hört, daß der andere ihretwegen die Schläge eingesteckt, lockt ihn den nächsten Tag nach Crosby Ranch, und der Mensch kauft die Farm, ohne sie anzusehen, aufs Geratewohl, weil er sieht, daß dem Mädel viel daran liegt, daß sie ein Auge auf ihn geworfen, – das ist der tüchtige, gescheite Herr Weltz!« wandte er sich an Henry.
Dieser beugte sich auffallend weit über die Bar, so daß man von seinem Gesicht nichts sah. Plötzlich erhob er sich jedoch, er war so bleich, daß es allen Umstehenden auffiel. Er sah Patrik scharf an, auch dieser faßte ihn für seinen Zustand auffallend ins Auge.
»Und was ist aus dem Mädchen geworden?« fragte Henry, den Blick Patriks ruhig aushaltend, welcher allmählich wieder stumpf wurde wie zuvor.
»Seine Frau,« war die kurze Antwort.
Es trat eine kleine Pause ein. Henrys Hand zitterte heftig, als er das Glas zum Munde führte.
Die Umstehenden schien die Sache auch zu interessieren.
»Und Mister Weltz heiratete also dieses Mädchen, arm, ohne einen Cent Vermögen? Oder erbte sie noch etwas?« fragte er weiter.
»Ohne einen Cent, dafür stehe ich ein. Es müßte denn der, der den Alten umgebracht und das Geld gestohlen – wie heißt er denn nur – Henry, Henry – fällt mir nicht mehr ein – den Raub wieder zurückschicken, wie sich die Närrin eine Zeitlang eingebildet hat. – Wird so dumm sein!«
»Hat sie sich das wirklich eingebildet?«
Henrys Gesicht färbte sich plötzlich rot.
»Fest eingebildet,« bestätigte Patrik.
»Na, möglich wär's ja, alles kommt vor, – aber Grund muß sie doch gehabt haben, so Gutes von dem Menschen zu erwarten?«
»Hat sie auch, hat sie auch! Er war närrisch in sie verliebt, der – wie heißt er doch – nun der Henry halt,« erwiderte Patrik, »und das vergißt ja ein Weib nicht.«
»Sie kannten ihn wohl, den Mörder?«
Henry wandte sich bei diesen Worten vollständig gegen Patrik, so daß dieser ihm voll in das Gesicht sah.
Wieder war es, als ob Patrik plötzlich nüchtern würde, sein Auge gewann wenigstens einen bestimmten, nachdenkenden Ausdruck.
»Ja, ich kannte ihn, das heißt nicht persönlich, so vom Sehen, ein Milchgesicht, in Ihrer Größe; man hätt's ihm gar nicht zugetraut.«
Henry brach das Gespräch ab, eine Runde bestellend, er brauchte keine Angst mehr zu haben, von Patrik wurde er nicht erkannt.
So viel war gewiß, das Geld hatte Bessy nicht erhalten, sein Testament war nicht vollstreckt. Es gab also nur zwei Möglichkeiten: Der Unbekannte lag mit samt dem anvertrauten Gelde auf dem Meeresgrunde, er hatte seiner Kraft zu viel zugetraut oder – er war ein Schurke, eben dieser Bernhard Weltz, er hatte von dem Gelde Crosby Ranch gekauft und dann der armen Bessy die Wohltat erwiesen, sie zu heiraten. –
Mitten unter dem Gläsergeklirr, dem wüsten Lachen und Schreien um ihn herum, dem drückenden Dunst der Kneipe stieg die Wahrheit sonnenklar vor ihm auf. Sie liebte diesen Mann vielleicht gar nicht, aber er bot ihr, der Magd Taylors, dieses rohen Burschen, die alte Heimat wieder, sie mußte ihn heiraten, den Schurken. – Was war dagegen Smidts Tat, im Jähzorn, im Haß begangen? – Und durch diese Tat, die sein Leben vergiftet, hatte er jenem Unbekannten, zu dem er ein so blödes Vertrauen gefaßt, Bessy, für die er gestorben wäre, Reichtum und Ehren verschafft.
Er lachte wie verzweifelt auf über diesen Hohn des Schicksals, so daß ihn alles erstaunt ansah. Er müsse noch immer lachen über die tolle Idee Bessys, daß ihr der Mörder das Geld zurückschicke, redete er sich aus.
Er stürzte ein Glas Whisky nach dem anderen hinunter, er schrie und lachte mit, die Gesellschaft behagte ihm, in seinem Innern gährten wilder Haß und Rache gegen den Mann, der das Vermächtnis eines Sterbenden veruntreut, sich damit Bessy erkauft und ihn um deren Verzeihung betrogen hatte, indem er den Fluch, den Schimpf eines Raubmörders auf ihm ruhen ließ. Ein himmelschreiendes Verbrechen, tausendmal gemeiner als jeder Mord, jeder Raub, und dieser Mann war der reiche, glückliche, von jedermann geachtete Weltz, und er, Henry Smidt, war ein flüchtiger, ehrloser Mörder.
Der Whisky schürte die Glut, er war nahe daran, alles zu bekennen, denn selbst diesen Leuten, meinte er, müßte seine Schuld verschwindend erscheinen gegen die jenes anderen. Die ganze Welt würde sich empören darüber, die Sache gehörte vor Richter Lynch. An der Spitze dieser Leute nach Crosby Ranch ziehen, jenen herauszerren aus dem Hause, ihm öffentlich seine Schandtat vorhalten und ihn dann aufknüpfen an dem nächsten Baume, das hätte sein Rachebedürfnis befriedigt; gern wollte er dann selbst daneben hängen.
Es flammte vor seinen Augen, blutige Flecken tanzten in der dicken Luft. – –
Er erwachte am andern Morgen auf einer Bank in dem leeren Lokal. Umgestürzte Flaschen, Gläser standen vor ihm auf dem Tische, eine Gasflamme brannte noch, sich mühsam durchkämpfend durch den übernächtigen Qualm. Sein Kopf schmerzte, die Glieder waren wie zerschlagen, er schämte sich seines Zustandes.
Der Wirt, der hinter der Bar beschäftigt war, lachte.
»Na, das war eine lange Sitzung, die Gentlemen lassen sich Ihnen empfehlen,« sagte er, »und sich bedanken.«
Henry verstand ihn, er war jetzt wieder völlig nüchtern, er bezahlte dem grinsenden Wirt die stattliche Reihe Whiskys und Cocktails, ging auf die Bahn und nahm ein Billet für die Stadt Illinois.
Bei nüchterner Betrachtung stiegen in ihm doch wieder starke Bedenken auf betreffs der Identität seines Unbekannten und des jetzigen Besitzers von Crosby Ranch. Die Annahme war eigentlich doch eine sehr abenteuerliche, willkürliche. In der ganzen Erzählung Patriks, dessen Glaubwürdigkeit außerdem eine sehr fragliche war, schienen eigentlich nur zwei Momente verdächtig, der Schiffbruch, von welchem dieser Weltz erzählt haben sollte, und die Uebereinstimmung der Zeit. Das konnte aber doch Zufall sein, der Verdacht lag mehr in seinem instinktiven Gefühl, er hatte sich schon früher in England hie und da die Sache so zusammengereimt.
Es handelte sich jetzt um zielbewußtes Handeln in jedem möglichen Fall.
War dieser Weltz nicht der Unbekannte, und das war vernünftigerweise vor der Hand anzunehmen, dann handelte es sich für ihn, Smidt, nur darum, sich vor Bessy betreffs der fünfzigtausend Dollar zu rechtfertigen, und er war entschlossen, es zu tun auf Gefahr seiner Festnahme. War jener aber wirklich sein Mann, was dann? Ihn töten! – Verdient hätte er es. Bessy zur Witwe machen? Er hatte zwei Kinder, – wieder Blut! Nein, das wollte er nicht. – Vor ihn hintreten, Rechenschaft fordern von ihm! Das war gefährlich, ein Schurke wie der war zu allem fähig, er wird ihn zu beseitigen wissen oder ihn ausliefern. Man wird kurzen Prozeß machen, seinen Worten nicht glauben, jener ist ja mächtig durch seinen Reichtum, der hierzulande alles vermag. Wenn er auch das nicht tut, so wird er doch Zeit gewinnen, seiner Frau gegenüber den Reumütigen, Ehrlichen zu spielen, der aus freien Stücken, nur von seinem Gewissen getrieben, ihr das verspätete Geständnis seiner Schuld macht, und sie wird ihm alles vergeben, ihn lieben wie zuvor und seine Schlechtigkeit nicht erkennen. Er wird ihn nur gewaltsam heilen von seinen Gewissenswunden, an denen er jetzt noch leiden muß, und das wäre eine schlechte Rache.
Von ihm, Henry Smidt selbst, muß Bessy alles erfahren, das ganze falsche Spiel, das mit ihr getrieben wurde, überraschen muß er sie, wie ein Gespenst vor sie hintreten und ihren Gatten des furchtbaren Frevels anklagen. – Dann wirkt die Rache, dann muß sie jenen hassen, verachten. Smidt, der Verachtete, Geschändete, muß schuldlos erscheinen gegen jenen abgefeimten Schurken,– und dieser Augenblick soll ihn entschädigen für jahrelange Qual.
Es ging gegen Abend, als er auf der Station Petrolia ankam, in dem regen Treiben der kleinen Arbeiterkolonie blieb er völlig unbeachtet; er wagte es sogar, nach dem Herrn des Werkes zu fragen.
Neue Bohrversuche würden gemacht, ganz in der Nähe, man verspreche sich großen Erfolg davon, Mister Weltz werde die Nacht im Camp der Arbeiter zubringen, lautete die Auskunft.
Die Erwartung ließ ihn alle Vorsicht vergessen, er ersuchte den Arbeiter, ihn an den Ort zu begleiten, er habe notwendig mit dem Herrn heute noch zu sprechen.
Es war eine Viertelstunde zu gehen. Auf einer bewaldeten Anhöhe brannte ein mächtiges Feuer, dunkle Gestalten bewegten sich darum, dort war der Bohrplatz.
Henry entließ den Führer, er fand jetzt schon selbst den Weg. – Die kurzen Stöße einer Dampfmaschine drangen stoßweise zu ihm. –
Er lief querfeldein gerade auf das Feuer zu, ein wilder Drang erfaßte ihn, die Wahrheit zu erfahren. Der dichte Wald ringsumher gestattete eine unbemerkte Annäherung. Von Stamm zu Stamm, durch dichtes Gestrüpp schlich er sich heran. Schon unterschied er einzelne Gestalten, Gesichter, die Maschine stieß glühend roten Dampf aus, eine riesige Bohrstange, von einem Gerüste umgeben, bewegte sich auf und ab. Ein großer Mann erteilte Befehle, das mußte der Herr sein, Smidt verlor ihn nicht aus den Augen, – noch einige Schritte bis hinter den Stamm einer mächtigen Buche, so konnte er alles genau beobachten; alles war mit der Arbeit beschäftigt, Entdeckung war nicht zu fürchten. Der Mann kehrte ihm den Rücken. Die Gestalt stimmte, das Bild des Unbekannten, wie er es mit brechendem Auge damals geschaut, trat klar vor ihn, als sei es gestern gewesen. Er hörte auch seine milden, tröstenden Worte, sie klangen ihm ins Ohr. ›Sprechen Sie, wenn Sie noch etwas auf dem Herzen haben, es wird Sie erleichtern.‹ Und er darauf: ›Wenn Sie es nicht tun, sind Sie der Mitmörder!‹
Der Mann hatte ihm so festes Vertrauen eingeflößt. – Nein, es war undenkbar, es gab keine so schlechten Menschen.
Jetzt wandte jener sich halb um, – der Atem stockte Smidt; der Mann trug keinen Vollbart, doch den kann man ja abnehmen lassen, – nur keinen Irrtum, das wäre entsetzlich. Plötzlich wandte sich der Mann ihm ganz zu. Er atmete erleichtert auf, es war nicht der Unbekannte und doch Mister Weltz, dem ganzen Benehmen nach. Jener arme Teufel lag am tiefsten Meeresgrund, und er lauerte da auf ihn, wie auf ein Stück Wild. Schon wollte er sich beschämt zurückziehen, da knackten die Aeste ihm dicht zur Seite. Er drückte sich an den Stamm, eine Todesangst kam über ihn. Ein Reiter näherte sich dem Feuer, der Mann, welchen er für Mister Weltz gehalten, zog schon von weitem den Hut.
Henry bohrte sein Auge in das Waldesdunkel, welches den Reiter noch deckte, – jetzt trat das Pferd in den Lichtschein, – er unterdrückte mühsam einen Schrei, – der Unbekannte, der Todesgenosse von der ›Columbia‹, er war's, kein Zweifel, der Herr von Petrolia, der Gatte Bessys, Bernhard Weltz!
»Alles geht gut, Sir, kein Zweifel, wir sind am rechten Platz,« begrüßte ihn der andere, wohl der Ingenieur, welcher die Bohrung leitete. »Bis morgen Abend sind wir so weit, ich gratuliere im voraus, Mister Weltz. Sie können beruhigt nach Hause reiten.«
Weltz drückte ihm herzlich die Hand und gab seiner Freude über das rasche Gelingen beredten Ausdruck; übrigens werde er trotzdem die Nacht über hier bleiben, er wolle sich die Freude nicht nehmen lassen, als erster die Quelle fließen zu sehen, auf die er so große Hoffnung setze.
Henry hatte die Hand an seinem Revolver. Das kürzeste wär's eigentlich, dachte er, solchem Schuft ist das Leben doch das Teuerste, – und dann fassen sie mich und Bessy erfährt nie, was sie erfahren muß. Noch einen Blick voll Haß warf er auf seinen Feind, dann schlich er vorsichtig wieder zurück in das Dickicht. Er bleibt bei der Maschine, Bessy ist allein, besser treffe ich's nie mehr. Wühle nur nach kostbarem Oel, unterdes unterwühl' ich dein Haus, dein Glück, das du mir gestohlen!
Der Weg von hier nach Crosby Ranch war ihm wohlbekannt, er fand ihn auch im Dunkeln. In zwei Stunden konnte er die Farm erreichen, jetzt war es acht Uhr, – wenn es nur nicht zu spät wurde und Bessy schon zur Ruhe gegangen war. – Er wird sich als Boten ihres Gatten ausgeben, um Einlaß zu bekommen, er wird ihn erzwingen, wenn es sein muß. Er hatte jetzt nur noch den einen Gedanken, davor schwand jede Furcht vor Entdeckung.
Er eilte mitten durch die Felder, durch feuchte Wiesen, über steile Abhänge hinab, instinktiv fand er den Weg. Sie wird sich entsetzen vor seinem Anblick, um Hilfe rufen, ihn gar nicht zu Worte kommen lassen. – Nein, das wird sie nicht tun. Wie sagte doch Patrik, sie glaubt nicht daran, daß er ein Dieb sei, ob auch alle Welt sie darum verlachte? Wem man so vertraut, den kann man nicht hassen, vor dem muß man sogar einmal Achtung empfunden haben, – mehr vielleicht! Es war kein bloßer Scherz, den sie damals mit ihm getrieben, – er war nur zu ungestüm gewesen, er hatte ihr keine Zeit gelassen. Es hätte alles anders kommen können.
Wie Blitze zuckten die Gedanken in ihm auf und nieder, während er durch die Nacht dahineilte.
Dann überkam es ihn plötzlich, als müsse er ihr Glück schonen, als dürfe er ihr, nachdem er ihr den Vater geraubt, nicht noch den Gatten rauben, den Vater ihrer Kinder. – Wie ein vernichtender Blitz brach er in ihr Haus. Was, Gatte? Einen Schurken stellte er bloß, wie es diesem gebührte, und es war sein Recht, sein heiliges Recht. Abgehetzt, beschmutzt, atemlos trat er in den Hof von Crosby Ranch. Im ersten Stock brannte ein Licht, die Herrin war noch auf.
Es war ihm, als täte er einen Sprung ins Wasser, als er an der Glocke zog. Zur Vorsicht nahm er ein Stück Papier in die Hand. Ein Weib öffnete vorsichtig, – Loo, die war noch nicht auf dem Hof zu seiner Zeit. Im Hausflur schlug ein Hund an, Henry kannte seine Stimme, es war der alte Swift, einst sein bester Freund.
»Ich soll eine Botschaft ausrichten von Mister Weltz,« brachte er atemlos hervor, »es ist eilig.«
Loo hatte offenbar Mißtrauen, sie leuchtete ihm ins Gesicht, das war bleich, verstört, gar nicht Vertrauen erweckend.
»Geben Sie, ich werde es besorgen,« sagte sie, nach dem Papier in seiner Hand langend.
»Muß es selbst bestellen, ausdrücklicher Befehl, halten Sie mich nicht auf.«
Sie zögerte, der Hund drängte bellend hinter ihr zur halbgeöffneten Türe, plötzlich hörte er auf zu bellen und begann zu winseln, wie er tat, wenn sein Herr kam.
»Lassen Sie den Swift nur heraus, Missis, wir sind ja alte Bekannte,« sagte Henry, die günstige Gelegenheit benutzend.
Loo gewann Vertrauen und öffnete ganz.
Swift sprang winselnd, vor Freude heulend dem fremden Mann an die Schultern.
»Na, jetzt darf ich doch?« sagte dieser, sich zu einem lustigen Tone zwingend, indem er mit Mühe das zärtliche Tier abwehrte, das seinen früheren Pfleger sofort erkannt hatte.
Loo entschuldigte jetzt ihre Aengstlichkeit und ließ ihn unbeanstandet hinein. Swift war zuverlässig; wen er so bewillkommte, der konnte nichts böses beabsichtigen.
Henry kannte das Haus, er wankte die Treppe hinauf. Er hatte alles vergessen, was er sagen wollte, und doch hatte er jahrelang an diesen Augenblick gedacht. Ja, warum schrieb er nicht an sie und gab jetzt einfach den Brief ab? Erreichte er nicht dasselbe damit? Trieb ihn nicht noch etwas anderes hierher als die Rache? Eine Hoffnung? – vielleicht sprach er gar nichts und stürzte ihr zu Füßen und bat um nichts, als um Verzeihung für seine Bluttat. Sehen mußte er sie, was daraus werden sollte, wußte er selbst nicht mehr. Er klopfte an die Türe, aus der ein Lichtstrahl sich Bahn brach. Ein Fenster wurde geschlossen – sie sah wohl nach dem Hund, – ein helles, erstauntes ›Herein!‹ ertönte.
Henry atmete tief auf, zog den Hut, fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, wie um seinen Zügen Ruhe zu geben, dann öffnete er die Türe.
Bessy stand noch am Fenster und blickte ihn groß an. Am Tisch saß ein kleines Kind, Kitty, mit einem Spielzeug. Das verwirrte ihn, er brachte kein Wort heraus und reichte ihr, sie starr anblickend, halb bewußtlos, das leere Blatt hin, das er in der Hand hielt.
Sie ergriff es, sah, daß es unbeschrieben war. »Was wollen Sie damit?« sagte sie in energischem, drohenden Tone und trat vor ihr Kind.
Das gab ihm die Besinnung wieder.
»Kennen Sie mich nicht mehr?« fragte er, langsam in den Schein der Lampe vortretend. Bessy strich sich über die Stirne, sie beugte sich mit forschendem Blick weit vor. Da zuckte es in ihrem Antlitz auf, ein gellender Schrei, wie abwehrend streckte sie die Hände gegen ihn aus.
»Henry Smidt!«
Dann faßte sie ihr Kind und floh damit an das Fenster.
Henry lachte bitter; er hatte jetzt die Gewißheit, daß Weltz nie von seinem Vermächtnis auf der ›Kolumbia‹ mit ihr gesprochen.
»Ah so, Sie fürchten sich, Missis, vor dem Mörder, dem Raubmörder; Sie meinen, ich könnte noch ein Gelüste haben. Nein, fürchten Sie sich nicht, aber entfernen Sie das Kind und jedermann, ich habe mit Ihnen zu sprechen.«
In seinen Worten lag etwas, das Bessy die Furcht benahm, wenn sie auch vor der unheilverkündenden Erscheinung dieses Mannes zitterte. Sie führte das weinende Kind in das Nebenzimmer; in diesem Augenblick fragte sie sich, was will er hier? – und die längst verscheuchten Gedanken tauchten wieder in ihr auf – Henry Smidt ist der Unbekannte, mit dem Bernhard Schiffbruch gelitten – dann wie Wetterleuchten, die Wahrheit! Zu weiterem hatte sie keine Zeit, sie stand schon wieder vor Henry.
»Nachdem ich Sie erkannt, ist es mir um so unbegreiflicher, was Sie mit mir zu reden haben; Sie wissen natürlich, daß ich allein zu Hause bin, – ein trauriger Mut!« sagte sie.
Keine Spur einer milden, zum Vergeben geneigten Gesinnung sprach aus diesen Worten, nur starrer Stolz, Verachtung. Alle Bedenken, die Henry noch eben gehabt, ob er den glücklichen Frieden, der sie hier umgab, stören dürfe, schwanden bei diesen Worten dahin.
»Ich sagte Ihnen schon,« entgegnete er, »Sie haben nichts zu fürchten, Missis, ich bin kein Raubmörder.«
Bessy zuckte zusammen. Er log nicht, das war ihr klar, doch wo wollte er hinaus? – ›Vorsicht!‹ sagte sie sich selbst und schwieg.
Es entstand eine qualvolle Pause.
»Glaubten Sie nach dieser unglückseligen Tat, daß ich Ihren Vater um des Geldes willen niederschoß? Antworten Sie.«
Es war ihr plötzlich, als habe er ein Recht zu dieser Frage.
»Nein,« antwortete sie, jedes Wort fürchtend, das über ihre bebenden Lippen kam, »damals nicht.«
»Damals nicht! Aber als das bewußte Geld ausblieb, das Sie zurückerwarteten, da glaubten Sie es doch, nicht wahr? Sie dachten nicht, daß ein natürlicher, zwingender Grund vorliegen könnte, daß mich der Tod überrascht, daß am Ende ein anderer das Geld, das ich ihm für Sie übergeben, gestohlen haben könne –«
Sein Auge loderte ihr entgegen, sie mußte sich auf die Lehne des Stuhles stützen.
»O ja, auch daran dachte ich,« sagte sie, sich mit plötzlicher Energie emporrichtend.
Henry stutzte, am Ende irrte er sich doch und tat ihrem Gatten Unrecht. Spielte dieses Weib nur mit ihm?
»Es hat dieses Geld aber wirklich ein anderer gestohlen. Wie ich richtig gedacht!« brach er plötzlich los. »Ein Schurke, dem ich es sterbend auf den Trümmern der gescheiterten ›Columbia‹, auf welcher wir zusammen nach England fuhren, übergeben habe, als dem einzigen Menschen, der mir noch übrig blieb, für Sie übergeben mit einem offenen Bekenntnis meiner Schuld, mit der Bitte um Ihre Verzeihung für den Toten –«
Bessy bewegte sich nicht; über den Stuhl gebeugt, starrte sie, ohne einen Zug ihres Gesichtes zu verändern, auf ihn.
»Dieser beispiellose Schurke,« fuhr Henry fort, durch ihre scheinbare Ruhe in Zorn versetzt, »hat das Geld, das mit dem Blute Ihres Vaters besudelt war, unterschlagen, hat ein tausendmal scheußlicheres Verbrechen begangen, als ich, der Mörder aus Haß, aus Rache. –«
Der Schmerz um das verscherzte Glück wühlte seine Seele auf, er fühlte, wie es wieder dunkel vor seinen Augen ward, das marmorbleiche, regungslose Antlitz Bessys blickte wie aus weiter Ferne auf ihn.
Noch einmal raffte er sich auf.
»Und dieser Schurke –«
Er trat dicht vor die regungslose Frau.
»Ist mein Mann, so wollen Sie sagen, nicht wahr?« ergänzte sie, – »Mister Bernhard Weltz!«
Das Lächeln, das jetzt auf den bleichen Lippen erschien, war grauenhaft, verzerrt, aber es war ein Lächeln, und Henry starrte sprachlos darauf hin.
»Sie irren sich aber,« fuhr Bessy fort, sich gerade aufrichtend, »das heißt, Sie irren sich nicht in dem Mann, sondern nur in dem Schurken, den Sie ihn voreilig nannten. Mister Weltz ist Ihr Unglücksgefährte von der ›Columbia‹, er hat mir von den schrecklichen Stunden, die er mit Ihnen dort verlebt, ausführlich erzählt. – Wie er Sie getröstet, Ihnen Mut zugesprochen, wie Sie immer noch auf Rettung hofften, Schiffe zu sehen, Signale zu hören glaubten, – sehen Sie, ich weiß alles genau. Er hat sich sogar die größten Gewissensbisse darüber gemacht, Sie zu früh verlassen zu haben, ohne sich von ihrem Tode überzeugt zu haben; ein förmliches Gemütsleiden entstand daraus, und diesen Mann beschuldigen Sie eines Verbrechens, das in meinen Augen, wie in denen der ganzen Welt das empörendste, niederträchtigste wäre, das man sich nur denken kann? Wollten Sie vielleicht, daß ich aus Dankbarkeit für Ihre ehrliche Tat Lärm geschlagen hätte, die Gerichte auf Sie gehetzt hätte, für die Sie spurlos verschwunden waren? Sie haben meinen Vater getötet in der Leidenschaft, wohl zum Aeußersten gereizt, ich selbst fühle mich nicht frei von aller Schuld, ich weiß alles, ich hatte nicht nur keinen Grund, sondern auch kein Recht, mich an Ihnen zu rächen, zu Ihrer Verfolgung beizutragen. – Jetzt dringen Sie wie ein Räuber bei Nacht in mein Haus mit solcher Beschuldigung. Wie kommen Sie dazu?«
Henry war auf den Sessel gesunken, er konnte seinen Blick nicht wenden von diesen unbeweglichen Zügen. Sie hatte recht, wie kam er dazu? Ja, wie kam er denn dazu? Wie konnte er wissen, daß ihr Mann ihr das Geld nicht gebracht? Weil die Leute nichts davon wußten? Hatte er ihm denn aufgetragen, es öffentlich bekannt zu geben? Lag ihm denn damals etwas daran? Nein, nur vor Bessy wollte er gerechtfertigt sein, – daß er daran nicht gedacht hatte! Der Neid, die Eifersucht war es, die ihm den schrecklichen Verdacht eingeflößt hatte. – Oder war dieses Gesicht da vor ihm nur eine Maske? Und doch wußte sie so genau, wie alles zugegangen. –
»Ihr Mann hat Ihnen also die fünfzigtausend Dollar damals gebracht?« fragte er, noch immer zweifelnd.
Bessy zögerte einen verhängnisvollen Augenblick mit der Antwort; es war ihm, als verließe sie ihre Ruhe. –
»Er hat sie mir gebracht in Ihrem Auftrage,« erwiderte sie dann klar und fest.
»Und Sie heirateten ihn aus Dankbarkeit, als Ihren Wohltäter?«
»Darauf bin ich Ihnen keine Antwort schuldig. Ich denke, Sie wissen jetzt genug; Sie werden begreifen, daß mich Ihr plötzliches Erscheinen tief ergriffen hat, und darauf Rücksicht nehmen.«
Bessy wankte und stützte sich auf den Tisch. Henry durchschaute sie in diesem Augenblick. ›Sie will den Gatten retten, die Ehre ihres Hauses, es ist doch so‹ – sprach es in seinem Innern, und der Gedanke, daß der Elende straflos ausgehen sollte, fesselte ihn an diesen Ort, an dem er nichts mehr zu suchen hatte. Sie liebte ihn, kein Zweifel; er wollte erfahren, ob sie ihn auch jetzt noch liebte, ehe er ging.
»Ich bin Ihnen nur noch eine Erklärung darüber schuldig,« begann er, »wie ich zu dem Verdachte kam, dann belästige ich Sie nicht länger. Ich fürchtete, mein Gefährte von der ›Columbia‹ habe seine Botschaft nicht ausrichten können, weil er tot, ertrunken sei. Ich kam hierher, um mich für diesen Fall bei Ihnen zu rechtfertigen, da vernehme ich, daß ein reicher Mann Sie als armes Mädchen geheiratet und Crosby Ranch gekauft habe, – Mister Weltz. Ich erkannte vor einer Stunde in diesem Mister Weltz meinen Gefährten; mußte da nicht der entsetzliche Verdacht in mir aufsteigen? Der Mann will Ihnen das Geld bringen, sieht Sie, liebt Sie, – o, ich begreife das. – Der Wunsch steigt in ihm auf, Sie zu besitzen, beherrscht ihn ganz, er vergißt den Unglücklichen, dem er sein heiliges Wort gegeben, benutzt die Lage, kauft Crosby Ranch und wirbt als Besitzer ihrer ehemaligen Heimat um ihre Hand. Konnte es nicht so sein?«
Bessy horchte sichtlich gespannt, sie lächelte spöttisch.
»Gewiß,« sagte sie dann, »Sie geben sogar der Sache eine viel entschuldbarere Wendung, als ich ihr geben würde. – Der Mann könnte schon, ehe er mich gesehen hatte, ehe er mich liebte, hierher gekommen sein mit der festen Absicht, diesen Betrug zu begehen, und ich wäre einem gemeinen, vorberechneten Plan zum Opfer gefallen; so könnte es sogar gewesen sein,« – ihr Auge funkelte gefährlich in dem blassen Gesicht, ihr Körper zuckte in heftiger Erregung, – »wenn es überhaupt gewesen wäre,« setzte sie dann lächelnd hinzu.
Henry triumphierte in seinem Innern, sie dachte schlimmer über diesen Fall, als er selbst, – sie haßte jetzt ihren Gatten, – er war gerächt. In dem Augenblick ertönten Hufschläge im Hofe, Bessy konnte ihr Entsetzen nicht verbergen.
»Mein Mann! Fliehen Sie –«
Henry bewegte sich nicht, ein spöttischer Zug erschien in seinem Antlitz.
»Fliehen? Warum?«
»Sie haben recht, bleiben Sie,« erwiderte die Frau entschlossen.
»Er muß sich ja freuen, mich zu sehen, es wird sein zartes Gewissen beruhigen, und solche Stunden ketten zusammen,« bemerkte Henry.
»Bessy noch auf?« klang die Stimme des Herrn unten im Flur.
»Der Bote von Ihnen, Mister, ist noch bei ihr,« hörte man Loo erwidern.
Die beiden horchten atemlos, sie waren beide nicht mehr imstande, ihr Interesse an jedem Worte, das unten gesprochen wurde, zu verbergen.
»Von mir ein Bote? Ich sandte keinen Boten. Woher denn? So rede doch!«
»Weiß nicht, Herr, kenn' ihn nicht, aber Swift kennt ihn. Ein Mann mit einem Brief, – an Missis, sagte er.«
»Wie kannst du nur um diese Zeit einen fremden Menschen hereinlassen?«
»Er ist nicht fremd, Sir, Swift –«
»Was kümmert dich das? Ich sagte dir doch, – was alles passieren könnte! Wann kam er denn?«
»Vor einer halben Stunde.«
»Und ist noch oben? Ist Kitty bei der Mama?«
»Missis schickte die Kleine zu Bett.«
»Na, das ist aber –«
Eilige Schritte kommen die Treppe herauf.
»Ich muß ihm ja wie ein Gespenst erscheinen, er wird erschrecken. Wollen Sie ihn nicht lieber vorbereiten?« unterbrach flüsternd Henry die schwüle Stille. Bessy blickte unwillkürlich auf die Türe in das Nebenzimmer, sie schwankte noch, da tönten die Schritte vor der Tür.
»Bleiben Sie, – Mister Smidt,« sagte sie auffallend laut.
Henry durchschaute ihre Absicht.
Das Geräusch der Tritte verstummte für einen Augenblick, dann wurde die Tür plötzlich weit aufgerissen.
Weltz trat ein, er konnte Henry noch nicht sehen, die geöffnete Tür verdeckte seine Gestalt.
Der durchdringende Blick Bessys, der zugleich warnend und drohend auf ihm ruhte, bannte ihn einen Augenblick auf die Schwelle. Ein unerklärliches Grauen packte ihn, sie hob langsam den Arm.
»Der Mann von der ›Columbia‹ ist hier, dich zu besuchen,« sagte sie.
Wie ein Wild, mitten durchs Herz geschossen, oft noch einen Augenblick regungslos stehen bleibt in Todesstarre, so Bernhard. Er fühlte ein kaltes Rieseln im Blut, die Haare aus seinem Haupte sträubten sich. Sie wußte alles! Er hätte sich ihr zu Füßen gestürzt in seiner Verzweiflung, aber dieser furchtbar rätselhafte Blick hielt ihn gebannt.
Da trat Henry hervor, in seinem Auge Haß und Hohn.
»Das ist eine Ueberraschung, Mister Weltz, aber nur eine freudige jedenfalls. Die Gewissensbisse, die Sie sich meinetwegen unnötig gemacht, sind ja nun überstanden.«
»Gewiß, – aber Sie werden begreifen, – wenn man so voneinander geschieden –«
»Wenn man so voneinander geschieden, – o, ich begreife sehr wohl,« unterbrach ihn Henry, mit Mühe sich zügelnd.
»Dann, – dann findet man sich nicht gleich zurecht,« stotterte Bernhard mit einem scheuen Blick auf Bessy.
»Du wirst dich noch weniger zurechtfinden,« begann diese jetzt, »wenn du hörst, daß dieser Mann nicht gekommen ist, um dir zu danken für das, was du für ihn getan, sondern um dich ganz ungerechtfertigterweise,« – sie betonte das Wort scharf, – »des gemeinsten Verbrechens anzuklagen, was ich mir denken kann, eines Verbrechens gegen das in meinen Augen selbst der Mord meines Vaters, in wilder Leidenschaft begangen, nichts ist. Er klagt dich an, das Vermächtnis, welches er sterbend in deine Hände gelegt, – du weißt ja, worin es bestand, – unterschlagen und mich schmählich betrogen zu haben.«
Bernhard fühlte den Boden unter sich weichen, und zugleich erkannte er, daß alles darauf ankam, jetzt die Besinnung nicht zu verlieren. Er spannte gewaltsam die zitternden, nachgebenden Muskeln und rang mit dem Dunkel, das sich um seine Augen zu legen begann.
Dämonisch klang die Anklage, die Schlechtigkeit seiner Tat wuchs ins Ungeheuerliche in ihrem Munde, und aus dem Dunkel, das ihn umgab, hob sich, ihn blendend, verzehrend wie eine Sonne, in die er nicht blicken konnte, die Seelengröße seines Weibes, die, in ihrem Heiligsten sich betrogen sehend, im Innersten empört, ihn noch zu retten versuchte für die Welt, für sein Haus, für die Kinder, – vielleicht, – das war der einzige Strahl, der die Finsternis durchzuckte, – für sich selbst!
»Und du hast ihm gesagt, daß er mir unrecht getan, daß ich das Geld, an dem das Blut deines Vaters klebte, dir überbrachte, mit der Bitte des Sterbenden um Verzeihung, hast ihm gesagt, wie er nur an die Möglichkeit einer solchen Schandtat denken könne, ein Wort, in solcher Stunde gegeben, zu brechen, dieses Sündengeld zu behalten und damit dich, der es gehört, zu betrügen, damit sich in dein Herz zu stehlen. Alles wohlbedacht, wohlerwogen, nicht im Sturme der Leidenschaft, – ein solcher Schurkenstreich, – das hast du ihm gesagt, nicht wahr, Bessy?«
»Das habe ich ihm gesagt,« erwiderte sie mit bebender Stimme.
Bernhard suchte eine Erleichterung in dieser Selbstverurteilung, er mußte um jeden Preis sich wieder hinaufringen können zu diesem Weib, das jetzt so hoch über ihm stand; – das war der erste Versuch.
Man konnte aus dem erschütterten, schmerzlichen Tone, mit welchem er die Worte sprach, ebenso gut bittere Kränkung, ein schwer verletztes Gemüt heraushören, und wäre Henry seiner Sache nicht so sicher gewesen, er hätte leicht irre werden können, so aber hörte er daraus dasselbe wie Bessy, – das volle Bekenntnis der Schuld, die vernichtende Selbstanklage. Doch das war keine Sühne, und er fühlte die Wirkung dieser zerknirschten Worte auf Bessy. – Er erkannte sie in ihrem zuckenden Antlitz, in ihrem sich feuchtenden Auge; das Mitleid regte sich in ihr. Er hatte vorhin sich viel zu früh gefreut, denn sie haßte Bernhard nicht, sie liebte ihn noch immer, und wenn er, Henry, das Zimmer verläßt, so wird es eine rührende Szene geben, Tränen, Schluchzen, Schwüre. Er selbst wird diesem Manne verholfen haben zu dem, was dieser zu feig war selbst zu erringen, Vergebung, Vergessen, Ruhe, und er, Henry, wird weiterziehen, ungeliebt, einsam, geächtet, das Brandmal des Mordes ewig auf der Stirne.
Was hindert ihn denn, diesen beiden die Masken gewaltsam abzureißen, seine Beschuldigungen von neuem zu erheben?
Schon trat er, dazu entschlossen, herausfordernd vor Bernhard, schon schwebte das Wort auf seinen Lippen, das damals sein letztes gewesen, als Todesnacht ihn umfing: ›Mitmörder‹.
Da trat Bessy dazwischen mit einem flehenden, beschwörenden Blick, der ihn verstummen ließ. Sie reichte ihm die Hand, er ergriff sie zögernd. »Ich danke Ihnen.«
Das Wort kam aus ihrer tiefsten Seele. Wie ein Himmelsstrahl senkte es sich in seine wunde, haßerfüllte Brust, besänftigend, tröstend. Bernhard verstand seinen ganzen Inhalt, er sah die Blicke, die Hände, die sich vereinigten über dem Abgrund, in den er stürzte; er ahnte, welchem Gefühl in der Brust dieses Mannes er allein die Schonung zu danken hatte. Die Schlangen der Eifersucht erwachten wieder aus ihrem Schlaf und doch sprach er es für sich mit, dieses ›ich danke‹, und er hätte alles gegeben, wenn er auch diese Hand hätte ergreifen können, die er zu seiner Qual in der seines Weibes, wie es ihm schien, unendlich lange liegen sah.
Das entsetzliche Spiel war aus, keiner hatte den Mut, es weiterzuführen.
»Nachdem Sie jetzt wissen, was Sie, wie ich wohl begreife, wissen mußten,« sagte sich ausraffend Bernhard, »rate ich Ihnen dringend, die Gegend zu meiden. Wenn man Sie erkennt, – und man wird Sie erkennen –«
»Unnötige Sorge, Mister Weltz, ich verlasse die Gegend nicht und werde Ihnen doch nicht mehr lästig fallen. Ich habe den Mut, den allerdings nicht jeder hat, – mich selbst den Gerichten zu stellen!«
Das war Henrys letzte Rache; ein bitterer, verächtlicher Zug, der auf Bessys Antlitz erschien, verschärfte sie. »Verzeihung, Missis, für das, was ich Ihnen getan, ich werde es sühnen.«
Sie reichte ihm noch einmal die Hand.
»Sie haben es schon gesühnt.«
Noch einmal blieb Henry dicht vor Bernhard stehen, als warte er auf etwas, – dann eilte er hinaus. Bernhard fühlte eine Schwäche, er mußte sich setzen.
Bessy stand aufrecht, regungslos auf den Kamin gestützt. Ohne daß er aufsah, fühlte er ihren Blick auf sich ruhen, er sah nur vor sich die Spitze ihres kleinen Fußes auf dem Teppich nervös sich auf und ab bewegen. Unten winselte und heulte Swift seinem Freunde nach, dann wurde es ganz still, auch der Fuß hörte auf, sich zu bewegen. Er wäre dankbar gewesen für ein vernichtendes Wort, für den bittersten Vorwurf, für ihren Zorn und ihre Verachtung, nur ihre Stimme hören, nur nicht dieses das ganze Zimmer zum Ersticken füllende Schweigen, das er doch nicht brechen konnte, wortlos dem Ungeheuren gegenüber, was sich soeben ereignet.
»Du scheinst Glück gehabt zu haben mit der Quelle, daß du heute noch gekommen bist.«
Bernhard hob erstaunt das Haupt. Sprach das Bessy? So sehr er aufatmete beim Klang der Stimme, diese Frage, – jetzt, – ängstigte ihn.
»Ueberraschendes Glück,« erwiderte er, »nicht tiefer als 100 Fuß und sehr reich; ich dachte erst morgen, – doch das ist jetzt alles gleich,« setzte er, das Haupt senkend, in schwerem Tone hinzu.
»Gerade jetzt ist es nicht gleich,« erwiderte sie mit kaltem Nachdruck, – »es wird dich entschädigen für andere Verluste, du bist ja ein sehr praktisch denkender Mann und wirst damit den Ausfall decken, so gut es eben geht.«
Er verstand sie. Jetzt tat sie ihm unrecht, das stärkte ihn, er erhob sich aus seiner schwächlichen, furchtsamen Verfassung.
»Du hast jetzt das Recht, mich als Ehrlosen zu behandeln, mich zu beschimpfen, den Fehler –«
»Fehler?« unterbrach ihn Bessy.
»Recht! Nenn' es Verbrechen, Schurkenstreich, – also den Schurkenstreich, den ich begangen, als Grundlage meines ganzen Handelns dir gegenüber zu nehmen, die drei Jahre unserer glücklichen Ehe als Fortsetzung desselben. Meine Liebe zu dir war Heuchelei, ich hätte das Geld am liebsten für mich allein behalten, ich heiratete dich nur, um mein Gewissen zu beruhigen, die glühenden Bekenntnisse, die seligen Stunden, alles war Lüge, infolge dessen habe ich ja eigentlich jetzt nichts verloren, die Enthüllungen dieser Stunde waren für mich nur peinlich, wie es für Schurken der Moment ihrer Entlarvung ist. Aber sie ist vorüber, ich schüttle sie ab, vergesse sie und lebe ruhig in dem Besitz dessen weiter, was ich glücklich durch meine Schurkerei erreicht. Der Verlust deiner Liebe, deiner Achtung verschmerzt sich, die erste verlangte ich ja gar nicht, die zweite kann ein Mann wie ich ja entbehren, – das ist das Bild, das du dir jetzt von mir machst, nicht wahr?«
»Nein, – das ist es nicht,« erwiderte sie mit geröteten Wangen. »Wie schlecht verstehst du dich doch auf ein Frauenherz! Gewiß liebtest du mich, ich bin überzeugt davon, das ist's ja, – o Gott –« Sie rang mit ihren Tränen. »Wenn ich mir dieses Bild von dir machte, wäre es ja leicht zu tragen, ich wäre einfach eine Betrogene, wie tausend andere, würde verachten und vergessen, aber nein, du liebtest mich, und doch war ich dir nicht zu gut für diesen Betrug, doch fandest du nicht den Mut, mir alles zu gestehen. Darin liegt für mich aller Schmerz, – daraus sehe ich, wie es gekommen wäre, wenn du mich nicht geliebt hättest, wenn ich dir gleichgültig gewesen wäre, als wir uns begegneten. Du hättest dasselbe getan, deinen gewissenlosen Plan doch ausgeführt, mich zum Weibe genommen. Ich wäre das Opfer eines vorbedachten Betruges geworden, darin liegt die untilgbare Schuld, die mich vor dir schaudern macht, ganz abgesehen von dem Verbrechen an Henry Smidt, von dem Umstande, daß, wie du selbst sagtest, das Blut meines Vaters an deinem Raub klebte; daran will ich gar nicht denken im Uebermaß dessen, was du an mir getan.«
Die Wahrheit dieser Vorwürfe erdrückte Bernhard fast. Das alles hatte er sich ja selbst schon tausendmal gesagt.
Er wankte auf Bessy zu, fiel auf die Kniee und weinte bitterlich.
»Verzeih'! Vergib!«
»Vergib! – Was hilft das Vergeben? Ein Weib, das liebt, muß achten können.«
»Das liebt!«
Bernhard rief es laut, wie aus Höllenglut Erlöste aufschreien mögen zum Zeichen des Heils. »Das liebt! – Und ein Weib, das liebt, kann alles vergeben, selbst ein Verbrechen, – so sagtest du einst selbst.«
Bessy war tief bewegt, sie überließ ihm ihre Hand: »Vergeben, Bernhard? O, wie leicht wäre mir das! Aber achten, – achten, – dazu verhilf mir, oder ich verzweifle.«
Bernhard erhob sich. Die Achtung erwarb er sich hier auf den Knieen nicht zurück; ihre Liebe hatte er nie verloren, aber auch diese schien ihm jetzt wertlos, ein dürrer Ast ohne jene.
Er glaubte den einzigen Weg vor sich zu sehen, den er gehen müsse, obwohl er kein Ende sah, kein Ziel – »Dazu wird vor allem nötig sein,« sagte er nicht ohne eine gewisse herbe Bitterkeit, »daß ich den Ausfall, von dem du eben gesprochen, nicht decke, so gut es geht – – scheiden wir, Bessy! Ich gebe dir wenigstens als redlicher Verwalter verzehnfacht zurück, was ich dir genommen, und nehme nichts mit als die Hoffnung, daß die Liebe, die du trotz allem nicht verloren, dir wieder zur Achtung verhilft.«
Bessy starrte gedankenvoll vor sich hin, einen Ausweg suchend.
Bernhard stimmte der Gedanke der Trennung weich. Er ergriff ihre Hand, er zog sie sanft an sich, sie ließ es apathisch geschehen.
»Bin ich fort,« seine Stimme klang jetzt kosend, »so wirst du nicht mehr durch meinen Anblick stets nur an das Schreckliche erinnert, dann, Bessy, – glaube mir, – wirst du allmählich milder urteilen, du wirst Schmerz empfinden, – o ja, das wirst du, – bitteren Schmerz. Du wirst der Stunden gedenken, die keine Täuschung waren; die Kinder werden dich nach dem Vater fragen, du wirst nicht sagen können: ›er ist gestorben‹, du wirst nicht sagen: ›schweigt von ihm, er ist ein Schurke‹, sondern: ›er kommt wieder, – bald kommt er wieder!‹ und wirst dabei meiner gedenken, nicht wie man eines Verachteten denkt. – Und eines Tages wird er wirklich wiederkommen, wird vor dich hintreten, eine Frage im Blick, und du wirst diese Frage bejahen, ihm an die Brust sinken und weinen, und alles wird wieder gut sein!«
Bessy nickte träumerisch mit dem Haupte, während Träne um Träne die bleichen Wangen herabrollte; sie verfolgte sichtlich in ihren Gedanken den Weg Bernhards.
»Das wär's,« flüsterte sie, »ja, das wär's! Aber die Kinder, dein Name, die Ehre des Hauses! Der Gedanke allein gab mir ja die übermenschliche Kraft zu dem falschen Spiel, das ich mit diesem Unglücklichen eben gespielt. Es soll nicht über die Schwelle dieses Zimmers kommen, was zwischen uns liegt.«
Ihr Gesicht gewann jetzt einen energischen, trotzigen Ausdruck. – »Nein, es soll nicht, ich will es nicht.«
Sie erhob sich jäh, seine Hand abschüttelnd. »Wir bleiben beide und tragen unser Schicksal. Den Weg, den du angibst, können wir auch so gehen; man kann unter einem Dache wohnen und doch getrennt sein von einander. Der gemeinsame Ort macht's nicht aus, vielleicht ringe ich mich durch, – auch ich hoffe es, – und kann deine Frage bejahen, mit der du einst hintrittst vor mich.«
Sie hatte sich während ihrer Worte langsam der Türe, die in das Nebenzimmer führte, zugewandt.
»Bis dahin leb' wohl, Bernhard.«
Er starrte lange auf die sich noch bewegenden Falten der Portière, hinter der sein Weib verschwunden war.
Sie hatte recht, der Ort machte es nicht aus, dieses Stück Tuch rauschte wie ein endloses Meer zwischen ihnen, – aber am fernen Horizont flimmerte ein heller Stern, – die Hoffnung.
*
Die Kunde von der Selbstanzeige des Mörders Crosbys, welcher schon längst als verschollen galt, erregte allgemeines Aufsehen; das war hierzulande noch nicht vorgekommen.
War man seinerzeit im höchsten Grade erbittert über die Tat und bereit gewesen, den Mörder, falls man ihn zu fassen bekäme, ohne weiteres Urteil an den nächsten besten Baum aufzuknüpfen, so hatte Henry Smidt jetzt alle Sympathieen des heißblütigen, leicht beweglichen Volkes für sich, das nichts höher schätzt, als den persönlichen Mut. Die Gerichte, welche erfahrungsgemäß von seiten irgend welcher Heißsporne einen Befreiungsversuch oder wenigstens ostensive Kundgebungen der Volksstimmung zu befürchten hatten, beeilten sich mit der Verhandlung.
Als aber in derselben der allgemein geachtete Mister Weltz als Zeuge auftrat und beschwor, daß Henry Smidt die Summe von fünfzigtausend Dollar, welche der alte Crosby bei sich getragen, an seine Gattin Bessy zurückbezahlt habe, demnach überhaupt kein Mord, sondern höchstens ein Totschlag infolge eines heftigen Streites, der sich zwischen beiden Männern entsponnen, vorliege, da fehlte nicht viel, daß man den Angeklagten mit Gewalt befreit hätte.
Man murrte laut, als das Urteil verkündet wurde, – zwei Jahre Gefängnis.
Nach der Verhandlung verlangte Mister Weltz den Delinquenten zu sprechen, bevor dieser in das Gefängnis abgeführt wurde. Er blieb über eine Stunde in der Zelle und verließ sie mit strammerer Haltung, als er sie betreten.
*
Drei Wochen waren vergangen seit jenem verhängnisvollen Abend, ein oberflächlicher Beobachter konnte nicht ahnen, was sich damals auf Crosby Ranch ereignet hatte. Die fast ständige Anwesenheit des Herrn in Petrolia war bei der immer wachsenden Ausdehnung des Unternehmens sehr begreiflich erschienen. Kam er Tags über nach Hause, so verkehrte er scheinbar wie früher mit Bessy, nur war sie nie allein mit ihm, die kleine Kitty war stets bei ihr, und das Gespräch drehte sich nur mehr um geschäftlich notwendige Dinge. Anfangs beunruhigte ihn ihr Blick, er glaubte etwas Beobachtendes, Prüfendes darin zu sehen, dann merkte er, daß dies reine Einbildung war, daß im Gegenteil eine apathische Ruhe darin lag, welche auf die Dauer viel qualvoller für ihn sein mußte.
Kleine Aufmerksamkeiten, welche er ihr anfangs zu erweisen versuchte, wies sie in einer fast mitleidigen Art ab, daß er sich dieses kindischen Verfahrens schämte.
Als er von der Gerichtsverhandlung über Smidt zurückkehrte, kam sie ihm zum erstenmal in einer sichtlichen Bewegung entgegen, schon faßte er Hoffnung.
»Ich war bei ihm, er hat alles vergeben.«
Er sah sie fest an bei diesen Worten, als wollte er jetzt schon die entscheidende Frage an sie stellen. Es war ja eine bittere Stunde für ihn gewesen, in der er viel gebüßt. Sie erriet seine Absicht, und wieder erschien das mitleidige, schwache Lächeln auf ihrer Lippe.
»Wie lautet das Urteil?« fragte sie.
»Zwei Jahre Gefängnis. Ich habe für ihn getan, was ich tun konnte.«
»Zwei Jahre,« sagte sie, nachdenklich mit dem Haupte nickend. »Und doch hat er recht getan, es hätte ihn nimmer ruhen lassen, – ohne Sühne keine Ruhe!« – Dann ging sie wieder und sprach nie mehr über diesen Gegenstand.
War ihm das auch als Maß bestimmt von Bessy, zur Sühne – zwei Jahre? Wollte sie ihn nicht glücklich, frei sehen von der Fessel, die sie ihm auferlegt, bevor jener frei war? – Warum quälte sie ihn nutzlos, wenn sie ihn doch liebte? Er war oft daran, die Fesseln gewaltsam zu zerbrechen, ihr Vorwürfe zu machen, dann sah er wieder ihre tränennassen Augen, eine tiefe Trauer in ihrem ganzen Wesen, – sie litt mit ihm, es war kein Eigensinn, keine andern schlimmen Hintergedanken lebten hinter dieser Stirne. Eben, weil sie ihn liebte, kämpfte sie jede weichere Empfindung nieder, die sie verleiten konnte, zu früh ihm die Hand zu bieten. Das entwaffnete ihn.
So war ihre Zurückhaltung keine erzwungene, sondern eine von selbst sich ergebende, sie konnte mit ihm augenblicklich nicht so innig verkehren, wie bisher, ohne selbst zu heucheln. Aber sie war überzeugt, daß mit der Zeit es so kommen würde, wie er gesagt; daß sie milder urteilen, sein Bild sich wieder klären, das Vertrauen und mit ihm die Achtung wiederkehren werde. Sie war auch überzeugt, daß dieser Prozeß sich rascher vollziehen würde in seiner Abwesenheit, durch eine zeitliche Trennung; doch dafür hatte sie nicht so heldenhaft mit Smidt gekämpft, es mußte auch so gehen, – nur Zeit bedurfte es, und jede Uebereilung war gefährlich, die giftige Wunde mußte allmählich, aber völlig ausgebrannt werden, sonst fraß sich der Giftstoff immer wieder durch und richtete neues Unheil an. Die volle Energie des Arztes gehörte dazu, und sie verfügte darüber.
Nach einigen Monaten schon sah sie die sichere Heilung vor sich. Die Art und Weise, wie Bernhard die Buße hinnahm, als eine wohlverdiente, sein ständiges, stilles Werben ließen sie immer mehr erkennen, daß er sie da nicht betrogen, wo sie einen Betrug nimmer hätte ertragen können, in seiner Liebe, und damit fiel alles andere immer mehr in sich zusammen. Sie kannte sich selbst nicht, ihre ganze Entrüstung, ihr ganzer Schmerz galt weniger der häßlichen Tat, als der Furcht und der weiblichen Scham, in ihrer Liebe betrogen zu sein. Sie sah den Augenblick immer näher rücken, wo sie die Frage Bernhards bejahen könne, ja in der letzten Zeit wartete sie nur mehr auf einen Anlaß von seiner Seite, doch der blieb auffallenderweise aus, nicht einmal den Blick schenkte er ihr, den aufzufangen sie schon bereit war. Sei es, daß er eine neue Abweisung befürchtete, sei es, daß der Stolz sich in ihm regte, – sie hoffte mehr das letztere, und in einer echt weiblichen Schwäche freute sie sich auf den Augenblick, wo die Liebe, die mächtig nach Erlösung in ihm rang, jenen überwinden werde; das schien ihr auch die Feuerprobe zu sein.
Bernhard konnten die seelischen Wandlungen Bessys nicht entgehen, er wartete zu brennend darauf. Er fühlte jetzt stärker als je, daß ohne sie sein Leben keinen Inhalt habe, ebenso erkannte er aber auch die Notwendigkeit des operativen Vorganges, der sich so schmerzlich für ihn vollzog. Es war unmöglich für beide Teile, über diesen verhängnisvollen Abend mit einem kühnen Sprung hinwegzusetzen, er konnte nur allmählich überbrückt werden.
Einen Tag hatte er sich zur Grenze gesetzt, den vierten Geburtstag Kittys. Er hatte sich alles schon ausgedacht. Um die zehnte Stunde, nachts, vor vier Jahren, da war in Bessy zum erstenmal die Wahrheit aufgedämmert, und da hatte er den kostbaren Augenblick des Geständnisses verscherzt. Um dieselbe Stunde wollte er jetzt vor sie hintreten, in demselben Raum, den er seit einem halben Jahre nicht mehr betreten, mit Kitty im Arm. Die Stunde wird wieder auftauchen aus der Vergangenheit und wird ihm jetzt bringen, was er damals versäumt, Erlösung für immer.
Auch Bessy erwartete, ahnte etwas.
»Uebermorgen sind es vier Jahre« sagte er mit einem Ausdruck in einem Tone, der sie alles erraten ließ.
Wieder saß sie wie damals in der Wohnstube beim Schein der Lampe, wieder toste draußen der Wintersturm.
Bernhard war nach Tisch fortgeritten, er war den ganzen Tag auffallend erregt gewesen, freudig, erwartungsvoll, wie es ihr schien, und als er fortritt, rief er ihr noch hinauf: ›Auf Wiedersehen, heute abend!‹ Das war schon lange nicht mehr vorgekommen; sie konnte es nicht übers Herz bringen, sie mußte ihm zuwinken.
Wie sie so nachdachte, kam es ihr vor, als währe dieser Zustand schon jahrelang, als sei undenkliche Zeit verstrichen seit dem letzten Kuß, dem letzten warmen Händedruck von ihm. Sie ging im Geiste zurück bis zu dem Tag, wo sie ihn zum erstenmal gesehen bei William in Pèoria, wo er sie gegen diesen rohen Irländer so ritterlich in Schutz genommen hatte. Damals kannte er sie noch gar nicht, aber sein unglückseliger Plan stand in ihm schon fest, er sah in dem Trunkenbolde den Beleidiger seiner künftigen Frau. Sie hatte auf ihn im ersten Augenblick einen starken Eindruck gemacht, vielleicht auch nur als das Wesen, mit dem sich seine Phantasie schon tagelang beschäftigt, das geopfert werden mußte.
Dann begann der Kampf in seinem Innern, mit seinem Gewissen. War es das Verlangen nach dem Besitz des Geldes, nach einer gesicherten Existenz, oder die Furcht, sie nicht gewinnen zu können als armer Mensch, welche ihn unterliegen ließ? – das war die Hauptfrage! Bevor er sie kennen gelernt, war es unbedingt das erstere, darüber war kein Zweifel, aber dann, – dann? – Was kümmerte sie am Ende das Vorher! Dann war es die Furcht einer ängstlichen Liebe, sein den Stempel der Wahrheit tragendes Liebesbekenntnis, als sie zusammen nach Pèoria zurückfuhren, die Mühe, die er sich gab, das ihm augenblicklich verhaßte Geld ihr aufzudrängen, zeugten dafür.
Warum gestand er ihr das nicht alles vor vier Jahren? Sie ahnte ja damals schon alles und war bereit, ihm rückhaltlos zu vergeben, – die Eifersucht, der Haß gegen diesen Smidt banden ihm die Zunge, auf den Totgeglaubten noch war er eifersüchtig. Er fürchtete, dem vom Verdachte des Raubes an ihrem Vater Gereinigten werde sie ein Andenken bewahren, das ihm peinlich sein müßte, – aber aus was entspringt Eifersucht, als aus Liebe?
Das lange zurückgedrängte Gefühl brach sich plötzlich Bahn und vernichtete alle Schlüsse des ruhig überlegenden Verstandes. Das liebende, sich sehnende Weib erwachte in ihr, da mußte der Richter schweigen.
Sie sah auf die Uhr, – acht Uhr! Noch zwei Stunden, er wird keine Minute versäumen.
Gott! wenn sie sich irrte, wenn er nicht käme, – wenn er auch diese Stunden verstreichen ließ, – wenn –
Eine unendliche Bangigkeit befiel sie, – sie eilte an das Fenster. Was das für eine sonderbare Helle war dort über dem Walde, in der Richtung gegen Petrolia? Zwar sah man dort oft so einen hellen Schein, die Lohen der Raffinerie, aber doch nur in einer klaren Nacht, und nicht so dunkel gefärbt, so drohend emporwallend wie heute. – Sie wollte Loo rufen, doch kam diese von selbst hereingestürzt.
»Haben Sie schon gesehen, Missis, – Feuer!« Bessy schrie auf, ein entsetzlicher Gedanke kam über sie. Sie konnte die Füße nicht fortbewegen und starrte in die sich hebende und senkende Glut, die immer intensiver wurde. Plötzlich schlug eine breite Flammenzunge empor, den dunklen Wald beleuchtend, ein dumpfer Knall machte die Fenster erzittern.
»Petrolia steht in Flammen!« kreischte Loo.
»Mein Pferd! Um Gottes willen, mein Pferd!«
Sie eilte aus dem Zimmer, hinaus in Sturm und Schnee.
»Mein Pferd! Mein Pferd!« gellte ihr Ruf.
Ein Knecht führte es vor, sie schwang sich hinauf, wie sie war, im dünnen Hauskleide; vergeblich eilte Loo um einen Ueberwurf, bat der Knecht, sie möge doch nicht allein reiten. Sie antwortete nicht, riß ihm die Zügel aus der Hand und jagte in die Nacht hinaus, welche die jetzt wild aufschießende Lohe erhellte. Ueber schneebedeckte Felder, über gefrorene Bäche, geradeaus dem Brande zu.
Ein Waldstrich trennte sie noch davon, er glühte wie Morgenrot, – da lag Petrolia, ein Feuermeer.
Die Raffinerie stand in Flammen, eben neigte sich ein Kamin und stürzte prasselnd in den Schlund der Feuerwogen. Mitten aus diesen heraus flogen mit dem Knall eines schweren Geschützes feurige Bomben in weiten Bogen.
Der letzte Kessel war zerplatzt; zischenden weißen Dampf auswerfend, ergoß sich ein feuriger Strom die Anhöhe herab in den grell beleuchteten Fluß, das befreite, brennende Oel.
Die Fabrik schien ihrem Schicksal überlassen, der Platz vor ihr war leer; hinter ihr, wo ein zweiter Feuerherd sich zu befinden schien, tönte wilder Lärm, Kommandorufe, Aufschreie, Gekreisch; die Arbeiterhäuser standen in Flammen. Dort, wo die Not am größten, die Hilfe am notwendigsten, mußte auch er sein. Dorthin eilte sie, mitten durch rauchende Trümmer, Qualm und Funkenregen. Aus Holz zusammengefügt, waren die meisten Häuser schon eingestürzt. Händeringende Frauen, schreiende Kinder drängten sich im Widerschein der Flammen um zusammengeworfenen Hausrat. Das größte Haus, – Bessy hatte es oft besucht, es war das Lazarett – stand noch, bereits bog und blähte sich das glühende Pappdach. Hier herrschte das ärgste Gedränge, ein ratloses Helfen, Flüchten, Hin- und Herrennen, Flehen. Ein Weib rannte, fast entblößt, schreiend gegen die Türe, aus der schwarzer Rauch und hie und da eine rote Flamme leckte.
Ein Mann ereilte sie noch zu rechter Zeit und riß sie zurück.
»Laßt, laßt mich zu Bob – er kann ja nicht – sein Fuß – o Bob!« –
Aus den Trümmern drangen unverständliche, halberstickte Rufe, ein Fenster brach klirrend zusammen, wohl von innen aufgestoßen.
Bessy sprengte mitten unter die Leute.
»Wo ist Mister Weltz?« rief sie mit von Rauch halberstickter Stimme.
Einen Augenblick starrte alles, das Entsetzliche selbst vergessend, auf die Reiterin.
»Den Bob holt er!« rief eine Stimme, »mit dem lahmen Bein! – Ins Haus – Hurra für Mister Weltz!«
Alles stimmte ein.
Da geschah etwas Ueberraschendes.
Die Reiterin sprang vom Pferde und eilte gegen die Tür des brennenden Hauses. Niemand dachte daran, sie zurückzuhalten. Zwei Männer stürzten eben heraus, weit vorgebeugt, die Arme vor dem Gesicht, taumelnd.
»Es geht nicht, die Höll' ist los dadrin!« schrieen sie, und gleichsam zur Bestätigung dieser Worte barst knatternd das Dach und gab den Flammen Raum.
»Weltz?« schrie Bessy den beiden fragend zu. Sie deuteten stumm zurück auf das Haus. Sie stürzte vorwärts gegen den qualmenden Eingang, da schoß eine Feuergarbe ihr entgegen. Sie taumelte zurück, sie sah die brennende Treppe und auf ihr eine dunkle Gestalt mit einer Last im Arm, wankend, sinkend, einen Mann – Bernhard.
»Bernhard!«
Sie stürmte vor, trotz der warnenden Zurufe von allen Seiten.
Er vernahm den Ruf. Er gab ihm noch einmal die Kraft zum atmen, vorwärts zu eilen. Da bewegte sich im dunklen Rauch vor ihm eine taumelnde Gestalt. Jetzt umfaßte sie ihn, zerrte ihn gegen den Ausgang; als die frische Luft ihn umfing, stürzte er zu Boden, samt dem lahmen Bob.
Das Haus sank mit dumpfem Krachen in sich selbst zusammen.
In dem Flackerscheine der jetzt frei sich tummelnden Flammen sah Bernhard das geschwärzte Antlitz Bessys über sich gebeugt. Er bedurfte keiner Frage, keiner Antwort mehr.
Er fühlte sich aufgehoben, er hörte seinen Namen von allen Seiten rufen. Das Gesicht Bessys verließ ihn nicht, es schien jetzt über ihm zu schweben, von glorienhaften Flammen umzuckt, – der Friede, die Sühne, die Liebe.
Dann war es ihm, als ob er auf den Klippen liege, vom Meer umrauscht, über ihm schwebte ein schneeweißer Vogel, – er stieg höher, immer höher am feurigen Firmament, bis er in einer finsteren Rauchwolke verschwand und mit ihm alles.
*
Bernhard Weltz konnte die Leitung seiner ausgedehnten Besitzungen nicht mehr führen, obwohl sich Petrolia rasch wieder aus den Trümmern erhob. Sein rechter Arm war verkrümmt, unbrauchbar, das Antlitz von einer breiten Brandnarbe entstellt, – doch zögerte er ein volles Jahr lang mit der Wahl eines geeigneten Verwalters, so sehr Bessy ihn auch drängte. Endlich fragte er sie doch eines Tages, ob sie bereit sei, den neuen Direktor von Petrolia zu empfangen.
Sie bejahte es, überrascht von der auffallenden Vorbereitung, die sonst nicht seine Art war. Henry Smidt trat ein am Arme Bernhards, der seine Tat gesühnt hatte.
Die letzte Klippe war umsegelt, vor ihnen lag spiegelglatte, wonnige See, vom Morgenrot einer glücklichen Zukunft durchglüht.