
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich möchte hier noch besonders des guten Michel gedenken, dieses einzig gearteten Mannes, dem ich wie so viele in warmer Anhänglichkeit zugetan war und der schon ein Jahr später auf dem Cristallogletscher sein Leben verlieren sollte, von dem Gipfel des Berges zurückkehrend, brach einer seiner beiden Touristen auf einer Schneebrücke des bekannten Gletscherschrundes ein und riß ihn so unglücklich mit sich, daß ihm am unteren Spaltenrand der Schädel zertrümmert wurde und er sofort verschied.
1848 zu Sexten geboren, war Michel 1872 nach Schluderbach gekommen und in die Dienste Ploners getreten. Anfänglich verrichtete er die gewöhnlichen Arbeiten eines Knechts, etablierte sich aber bald als Führer. Es war dies um die Mitte der siebziger Jahre, wo sich ein gewisser Stillstand im Alpinismus bemerkbar machte. Die großen Berge der Schweiz und Tirols waren bezwungen. Es gab hier kaum mehr etwas Epochemachendes zu tun und doch lechzten die »Jungen« nach neuen Taten. So wandten sich die Blicke den Dolomiten zu. Wohl war auch hier schon vieles geschehen. Grohmann insbesondere hatte die Mehrzahl der großen Gipfel in den sechziger Jahren erstiegen, wie Monte Cristallo, Sorapiß, Antelao, Tofana, Große Zinne, Dreischusterspitze und andere, daneben aber starrte noch ein ganzes Heer von bisher unbeachteten Zacken und Türmen jungfräulich in die Lüfte, unbedeutend an Höhe zwar und nicht zu vergleichen mit den gewaltigen Riesen des ewigen Schnees, dafür aber auch um so steiler und unnahbarer. Auf sie lenkte sich jetzt das Interesse. War es möglich, an diesen glatten Steilwänden und zerklüfteten Zacken hinaufzukommen? War es nicht waghalsige Vermessenheit, war es überhaupt lohnend? Furcht freilich kannte die junge Generation nicht, aber wagte sie sich nicht an Unerreichbares? Da kamen plötzlich die Nachrichten von Michels Erfolgen Schlag auf Schlag: der Zwölfer, der Elfer und die westliche Zinne sind gefallen, der Einser, die Grohmannspitze und jetzt gar die gefürchtete Kleine Zinne und die Croda da Lago! Kein Zweifel, es war möglich, ja mehr noch, es zeigte sich, daß ein guter Kletterer überhaupt überall hinkam und daß die Ersteigung solcher Felsen ein ganz eigen faszinierendes Vergnügen bot. Dies der Welt zum Bewußtsein gebracht und dem Alpinismus durch die Einführung der Dolomitkletterei schwierigster Art die Krone aufgesetzt zu haben, ist das Verdienst Michels. Darin liegt seine Bedeutung, denn er hat alle diese Touren selbständig ausgedacht und durchgeführt. Darum war er auch mehr als nur ein Führer: ein Alpinist von epochemachender Bedeutung. Entbehren freilich konnte er die Touristen nicht, aber es ist ein schöner Zug von ihm, daß er mit seinen »Erstlingstouristen« sehr wählerisch war und ich bin weit entfernt, die Verdienste dieser hervorragenden Alpinisten schmälern zu wollen. Man denke sich nur einmal zurück in jene Zeit der Spannung, der Ungewißheit und des Zweifels! War es da eine Kleinigkeit, den neugefundenen Wegen des verwegenen Mannes zu folgen, des unbestritten ersten Kletterers seiner Zeit?
Betrachten wir ihn bei der Arbeit, so springt vor allem seine geradezu unglaubliche Kletterfertigkeit in die Augen. Als ich mich einst mit ihm über die Art und Weise des Kletterns unterhielt, meinte er, er klettere in der Hauptsache mit den Händen und gebrauche die Beine nur nebenher bei besonders schwierigen Stellen. »Schauen's, i komm mit de Finger allein aufi!« Sprach's und zog sich an einer senkrechten Felswand mit den Händen ein gutes Stück weit in die Höhe, während die Beine frei in der Luft hingen. Ebenso kam er auch wieder herunter. »Ja, guter Michel, der Fels war dir untertan. Keiner konnte dir etwas anhaben, er war dein Element, in dem du sicher herrschtest, und im Fels hätte dich das tragische Schicksal, welches dir die trügerische Gletscherspalte bereitete, gewiß nicht ereilt.«
Großartig war sein Verständnis für das Gebirge überhaupt, für seine Eigenheit, seine Zugänglichkeit, seine Gefahren, so daß er sich überall ohne weiteres zurechtfand. Dazu war seine Tatkraft eine ganz ungewöhnliche, wie unbeugsam und gebieterisch war er im Augenblick der Gefahr und erstickte jeden Widerstand im Keim! Ebensowenig duldete er eine ungerechtfertigte Umkehr. »Nauf hat er müssen und wann i ihn hätt' dertragen müssen!«
Als Mensch war Michel eine goldklare Natur.
Von Statur mittelgroß, breitschulterig und muskulös, blitzten in seinem gebräunten, von rötlichem Vollbart umrahmten Gesicht ein Paar blauer Augen, denen man die Gutmütigkeit und Herzensgüte, gepaart mit harmloser Schelmigkeit ansah, und wenn er, was bei seiner wohltuenden Fröhlichkeit so oft der Fall war, seinen Mund lächelnd öffnete, blinkten zwei wahre Perlenreihen von Zähnen einem entgegen, um die ihn wohl ein jeder beneidet hat.
Sein harmlos bescheidenes, durch und durch natürliches Wesen gewann ihm sofort aller Herzen, und kaum je ist ein Führer auch persönlich so beliebt gewesen wie er. Kam es doch vor, daß Touristen, die sich auf größere Besteigungen nicht einlassen wollten, ihm für einen Spaziergang den Tarif des Monte Cristallo anboten, um nur seine Gesellschaft zu haben. Seine Mäßigkeit war eine geradezu spartanische. Nie nahm er geistige Getränke zu sich, und es war ihm ein großer Kummer, daß sein Bruder, das »Gamsmannl«, in dieser Beziehung des Guten oft zu viel tat. Aber wenn's darauf ankam, wußte er sich auf drastische Weise zu helfen. Vor jeder größeren Tour, die er mit ihm unternahm, sperrte er ihn den ganzen Tag ein, brachte ihm persönlich das Essen und – Wasser, soviel er trinken wollte. Nachher allerdings, wenn das Unternehmen glücklich vollbracht war, hatte er auch ein Einsehen und – sperrte ihn wieder ein, aber jetzt mit einigen Flaschen Tiroler. Mit dem Lesen und Schreiben stand er angesichts seiner in den Bergen als »Geisbue« verbrachten Jugend auf etwas gespanntem Fuße. Doch sein Humor half ihm darüber hinweg: »Geh, schauen's doch amol, was do staht, san's so guet, i bin so kurzsichtig.« Bezüglich des Heiratens, zu dem er von allen Damen immer wieder angehalten wurde, meinte er: »Jo, sellen is nit so einfach! Wissen's, mei Frau mueß jung, schön, reich und tugendsam sein. Na, bis zum Herbst denk' i, werden mir's z'sammen hoben.« Der Bund der Herzen war nämlich im stillen schon geschlossen, aber der Tod bereitet ihm ein jähes Ende.
Eine besondere Freundschaft verband ihn mit dem alten Ploner. Die beiden waren Jagdfreunde, und insbesondere war die »Gamsjagd« ihre höchste Passion. Darüber »dischkerierten« sie beinahe täglich, und daß dabei das Jägerlatein eine große Rolle spielte, verstand sich von selbst. Es war eine Wonne, die beiden erzählen zu hören, und ich möchte dem Leser einige ihrer Geschichten nicht vorenthalten. Kommt z. B. der Michel einmal mit einem Bekannten von der Jagd zurück, deren Mißerfolg er durch folgendes Abenteuer zu verbergen sucht: »Weißt ka Gams ham mer nit g'sehen und do sitzen wir halt z'sammen hoch oben und vespern. A schön's Stück Speck ham mer g'habt, dös liegt grad zwischen uns drin. Auf amol wird's dunkel, a Mordsadler kimmt g'flogen und stoßt auf den Speck mitten zwischen uns. Wir aber nit faul, ham uns einfach z'sammen g'wälzt und ham den Adler in der Mitten verdruckt.« Und als Ploner nach dem Adler fragte, »tut er fuchsteufelswild«, daß ihm der »derfallen« sei. »Drunten is er g'legen und i hab ihn nimmer kriegt.« Erfolgreicher war die Jagd bei folgendem heiteren Stücklein, das Ploner erzählte. »Amol war i und der Michel ins Birkental eini gangen auf die Gamsen, und weil wir schon a weil umanand g'laufen waren, setz'n wir uns nieder, a bissel weg vom Bach, hab'n ausg'rast't und was verspeist. Auf amol derschaut der Michel a Gams – scho a sakrischer Bock war's – auf der Wand grad über uns. Die Gams hot bald a bissel g'äst, bald hat's runterg'schaut nach uns, neugierig, wie's a so san, wann's kan Jäger wittern. ›Daifel, Daifel!‹ sagt der Michel, jetzt wie ankimmen? Sieht der Bock uns weglauf'n, reißt er sicher aus, und ins Bachbett, wo mer sich anschleich'n könnt, laßt er uns nit. No i hab mi halt a bissel b'sunnen, nocher sag i: Michel, hab i g'sagt, jetzt du bleibst sitz'n, derrührst di nit und wartst grad, was i mach! I aber bin langsam aufg'standen, hab' mi immer am Boden buckt, grad als wenn i Holz aufklaub'n und z'sammtragen tät, zum Michel 'nüber. Dös hab' i so a Zeitlang trieb'n, no sag' i: Michel, hab' i g'sagt, jetzt nimm i di auf'n Rucken mit samt deiner Büchs und schmeiß di ins Bachbett eini, wie a Holzbündl, nachher merkt die Gams nix. So hab'n wir die Sach' g'macht, und der Bock, der a so 'was wohl schon oft g'sehen hat, hat ganz ruhig zueg'schaut und g'halten. I hab' mir weiter am Boden z'schaff'n g'macht und hab wieder Holz aufklaubt, und der Michel hat sich dervon g'schlich'n im Bach, hat sich an die Gams anbirscht, die immer wieder bloß nach mir g'schaut hat, und wie's g'schnellt hat, do hat er's a troff'n g'habt und derwuschen hab'n wir 'n Bock! Do hat ma's halt wieder dersehn, daß ma bloß praktisch sein mueß auf der Jagd.«
Freilich, manchmal ging auch der alte Ploner trotz all seiner Schlauheit ein, wie dies z. B. bei den beiden ersten Besteigungen der höchsten Cadinspitze der Fall war.
»Wie i amol beim Jag'n g'wesen bin da droben und nix g'schossen hab', da denk' i, jetzt gehst amol auf den Cadinspitz aufi. Der gucket so alleweil auf Schluderbach abi, als ob er b'stiegen sein möcht'. I bin au ohne weiteres aufi kommen, aber wie i wieder zurückkomm' nach Schluderbach auf'n Abend, do heißt's, morgen kommt der Grohmann. Jesses, sag' i, der Grohmann! Bist du a Kerl, daß d' heut da aufi bist, allein und ohne Touristen. So hat jo die ganz Besteigung kan Wert nit, und der Grohmann geht sicher nimmer aufi! Dös darf nit sei, dös is ganz was anders, wann der Grohmann z'erst droben war. Der mueß nauf, nochher hat die G'schicht an Ansehen. No hab' i aber auf'm Gipfel a Steinmannl g'macht mit einer Karten drin, die alles verroten hätt'. Dös hat also wieder 'runter müssen, sell war g'wiß. Was bleibt mir also übrig, als wieder aufi z'gehn, und zwar glei in der Nacht, und dös war ka Kleinigkeit. Drob'n, i ha mi kaum z'recht g'fund'n in der Dunkelheit, schmeiß' i s' Mannl wieder um und nimm mei Karten weg, daß er jo nix merkt. Nochher aber, auf'm Heimweg, hab' i erst recht schaff'n müssen, damit er die Spur nit sieht in der Schneerinnen. Denn meine Tritt, hab'n natürlich nit bleib'n dürfen, die hätten jo alles verroten. I steig' also 'n ganzen Weg rückwärts abi, und vermach 'n Weg mit de Händ', daß 's a so aussieht, als wär' a Gams aufi gangen oder so was. Jesses, war dös a G'schäft, und d' Händ hob' i derfroren, daß 's a wahrs Elend g'wesen is. Wie i no endlich wieder z' Haus bin kommen auf'n Morgen, richtig is der Grohmann au schon do, und wie mir z'sammensitzen und dischkerieren, so sag' i: Herr Grohmann, i wüßt' an schönen Berg für Ihnen, dös wär' so was für Sie, der is no nie b'stiegen worden. So, sagt er, dös is mir glei' recht, i möcht' schon aufi, was ist's denn für aner? Jo, schaun's do droben der höchste Cadinspitz, a schöner Berg, sag' i Ihnen! Was, die Cadinspitz? sagt er, was hab' i auf der Cadinspitz verloren, na, Ploner, do gang i g'wiß nit aufi, dös fallet mir scho gar nit ei. Und richtig, unten is er blieben und weiter gangen und all dös G'schäft is umsonst g'wesen.«
Auch Michel hat eine ähnliche ›Erstbesteigung‹ der Rotwand vom Osten her gemacht, die mir folgendermaßen erzählt wurde.
»Dös schwere Tragen, wissen's, dös hat der Michel ganz auf'm Strich g'habt. Wann er erst g'merkt hat, daß 's viel zum Trag'n gibt, nochher war's mit der guet'n Laun aus. Kommt do amol a Tourist nach Schluderbach, um auf die Groß Zinnen z'gehn, der hot schon an Mordsranzen g'habt. Wie den der Michel sieht, ist's glei nix g'wesen, da macht er an Ausflucht und sagt, er hätt' schon a Tour mit an anderen Fremden, auf'n Cristallo. No, domals war jo a no 's Gamsmannl do, und do ist der Tourist halt mit dem gangen. Auf'n andern Abend find't aber der Michel niemand, und wie er hört, daß der Fremde a no auf d' Rotwand will, do möcht' er doch mit und frogt'n, ob er 'n net mitnehmet. Aber der sagt: Na, heut san's nit mit mir auf die Große Zinnen gang'n, also brauchen's morgen a nit auf die Rotwand. Da is der Michel schon fuchsteufelswild worden, dös können's Ihnen denk'n, und sagt zu mir: Ploner, sagt er, die zwa will i scho krieg'n.
Am andern Tag auf'n Abend kommt 's Gamsmannl mit sei'm Touristen ganz verstört wieder an. Jesses Ploner, sagt er, i weiß nit, was dös is. Wie mir do aufi kommen, am Grat unterm Gipfel, do steht a weißer Kerl do mit einer fürchterlich langen Nasen und an Stecken hat er in der Hand g'habt, als wollt' er auf jeden dreinhauen, der vorbei will. Mir san ganz starr g'wesen, was dös do droben is. No zum Schluß han mer schon g'merkt, daß es a Schneemann war, aber schau, Ploner, wie kann denn der do aufi kommen sein? Sell weiß i scho g'wiß, daß heut' ka anderer aufi gangen is, und von früher kann der Kerl doch a nit sein, do hätt 'n ja die Sonnen derschmolzen g'habt.«
Na, der alte Ploner und der neben ihm sitzende Michel wußten schon die Erklärung zu diesem rätselhaften Phänomen. Michel hatte den Berg an demselben Morgen direkt von Osten her bestiegen, den Schneemann auf den Grat gesetzt, ihm seinen Bergstock in die Hand gedrückt und war dann sofort wieder denselben Weg heruntergekommen. Aber gesagt haben sie natürlich nichts, und noch lange mußte das Gamsmannl von den weißen Geistern hören, die ihm den Zugang zu den Gipfeln versperren, »Hascht wieder so an weißen Kerl derwuschen do droben!«
Hören wir nun zum Schluß noch den jungen Ploner über ein Haupterlebnis in Michels Leben, seine im Jahre 1881 in Gesellschaft der beiden Ploner nach Wien unternommene Reise.
»Anfangs wie mir auf der Eisenbahn g'fahren san, do ist's dem Michel gar nit wohl g'wesen und die Fahrt is ihm viel zu lang vorkommen. Daifel, sagt er immer wieder, do kommen wir jo gar nimmer heim, wann mir nur a wieder zeitig heimkommen, jetzt is grad die schönste Zeit für die Gamsen.
Wie wir nu san auf Wien kommen, auf'n andern Morgen in der Frueh, do hab'n uns die Leut' am Bahnhof erwartet, wissen's, a ganze Abordnung im Staat. Der Michel aber, der is no halb verschlafen g'wesen und hat nit aufpaßt, und wie er die große steinerne Stieg'n runter will, rutscht er aus mit seine g'nagelte Stiefel und fallt die ganze Stieg'n abi. Do is er g'legen. Dös war der Empfang. Den Spektakel können's sich denken, und die Fraid! Erst haben's g'schaut, ob's nix tun hat, nachher aber schreien's alle: Jesses, a Seil bringen, bringet a Seil, daß mir den berühmten Tiroler Führer dran anhängen, sonst derfallet er no in Wien.
Nochher san mir ausquartiert worden, jeder bei'n andern Herrn. Unter Tags hab'n wir uns dann die Stadt allein ang'sehn und auf'n Abend san die Herrn mit uns 'gangen. Die Hauptschwierigkeit is g'wesen, daß wir uns z'recht g'funden ham unter Tags, und do hat aner immer 'n andern überboten, wer sich leichter ausfind't. Der Vater, wissen's, der schon a paar mol in Wien g'wesen is, der hat se immer am besten auskennen wollen, und der Michel als berühmter Bergführer natürlich hat seine Kenntnis au an Tag leg'n wollen. Der hat sich immer an die Statuen auf den Brücken g'halten, weil dös so nette Mädel waren, und da sagt er oft, halt, Schaffer, sagt er, i mein, an der san mir heut scho amal vorbeikommen, aber dös is natürlich immer wieder an andere g'wesen. I selber bin hinten drein gangen und hab nix sagen dürfen. Aber wie's amol ganz verkehrt san gangen und i was g'sagt hab', do san beide über mi her g'fallen, da hat's g'heißen: Halt's Maul, du verstehst nix, du bist ka Führer.
Ang'sehn haben wir uns natürlich alles; was aber den Michel am meisten int'ressiert hat, dös war die Menagerie in Schönbrunn. Die Gamsen freili, die ham ihm gar nit g'fallen, do hat er nit traut. Was, dös sollen Gamsen sei, das san kane Gamsen, dös muß i wissen, die san nit echt. Und die Affen natürlich, die ham mir uns a anguckt in dem runden Käfig, dös war amal int'ressant. Der Vater hat gar nimmer fort wollen, der schaut immer so eini, ganz nah, was die Kerle do drin für Faxen machen; auf amol springt so an Aff derher und packt 'm sein Hut mit der Pratzen, und weg war er. Der Vater is dog'standen wie an Ölbild vor Schrecken. Denn wissen's, a nagelneuer Hut is 's g'wesen mit an Gamsbart drauf. Dös können's Ihna denken, daß der Vater kan schlechten Gamsbart mit auf Wien g'nommen hat. Daifel, schreit da der Michel, der schöne Gamsbart, is ka Büchsen do, wann i no a Büchsen hätt', i derschießet den Kerl, den elendigen, wahrhaftig; Daifel, der schöne Gamsbart! Und der Vater, wissen's, is immer no traurig dog'standen. Die Affen aber natürlich, die ham a Mordsgaudi g'habt. Z'erst ham's nit recht traut und san alle drum rum g'standen, und der ane, der Spitzbue, hat jedem andern den Gamsbart unter d' Nasen g'halten, zum Schmecken. Nochher sind alle umanand g'sprungen wie närrisch vor Fraid, und wie alle dran g'schmeckt haben, ham's ang'fangen, den Gamsbart z' zerreißen. Daifel, is der Michel wütig g'wesen. Und der Spektakel! D' Leut' ham g'lacht und g'schrien vor Fraid, 's ist a ganze Ansammlung rumg'standen und ham g'sogt: do kriegen mir amol an Tiroler, an echten, mit samt sei'm Gamsbart. Schließlich auf dös G'schrei is dann a Wärter kommen und hat dem Affen den Hut wieder abg'jagt. Der hat aber dem Affen schon kurios zuesetzen müssen, bis er n' g'habt hat. Den Hut haben m'r jo schließlich wieder kriegt, aber der Gamsbart natürlich, der war fertig. Und der Aff hat uns ganz traurig nachg'schaut wie m'r gangen san. Der wird wohl denkt haben: So drei find' i nimmer!
Auf'n Abend do sind m'r dann mit den Herrn in a Vergnügungshalle gangen, do is Scheiben g'schosse worden, und wie dös der Michel sieht, natürlich do hat er 'n ganzen Abend nix wie g'schossen. Und in dem andern Saal do is tanzt worden, mit schöne Damen, und do hat der Vater a tanzen wollen und hat aner auf'n Schlepp treten und is hing'fallen, mitten in den Saal nei, daß alles z'sammeng'lacht hat. Jesses, hab' i mi g'schämt. Und weil so a Spektakel g'wesen is, do haben die Herrn zum Michel g'sagt, er soll die Wachtel machen, wissen's, dös hat der Michel famos verstanden, alle Vögel hat er nochmachen können. No, dös hat dem natürlich eing'leucht't, und do hat er sei Sacktücherl z'sammeng'macht, als ob er a Käfig drin hätt', und is durch den Saal gangen und hat d' Wachtel g'macht. Do is natürlich alles z'sammg'sprungen, was dös is, und alle ham gemeint, der hat a richtige Wachtel in sei'm Tucherl.
Ins Theater san mir a gangen. Die Herrn ham uns Karten b'sorgt, an gueten Platz, hoch droben, und da ham m'r natürlich unsere schönsten Lodenröck ang'habt. Haben do dem Michel die Mädle g'fallen! Wissen's, 's war so a Ballett. Dös Glas hat er nimmer von de Augen bracht und hat's dem Vater um d' Welt nit geben. Daifel, hat er immer g'schrien, dös is a schöne. Schau doch, jetzt kommt wieder a ganzer Haufe Mädle raus, ganz laut, und i hab' immer sagen müssen: Michel, do darfst nit so schreien, jetzt bist nit auf'm Cristallo. Und a Hitz hat er g'habt, wissen's, daß er schier derschmolzen is. Ja, wenn i halt 'n Rock auszieh'n könnt, sagt er, du i mein', i probier's. Na, sag i, Michel, dös gaht nit, und doch hat er's partu tun wollen, bis sich der Vater ins Mittel g'legt hat, sonst hätten's uns ja außig'jagt. Sein Huet aber, den hat er fest in der Hand g'halten, wissen's wegen dem Gamsbart, daß 'm der nit dervonkimmt, wie dem Vater.
So san mir schließlich ganz damisch worden vor lauter Schauen. Und wie mir wieder ham san kommen auf Toblach in der Nacht, da ham mir in der klanen Hütten am Toblacher See g'schlofen, auf'm Stroh, und die ganz Nacht durch hat der Michel immer so an Muketz tue, vor Aufregung, wissen's. Und g'wußt ham m'r gar nix mehr von Wien, weil m'r z'viel g'sehen ham.«

Das alles ist mir heute noch wie ein Traum. Nicht bloß ein Frühlingstraum von Lenz und Liebe mit Knospen- und Blütenpracht und ahnungsvollen Schauern unter sternenbesätem Himmel. Mit seinem Wirbel der widersprechendsten Dinge ist es mir auch wie ein wildverworrenes Alpdrücken, eine höhnische Groteske mit phantastischen Erlebnissen aller Art, ein Traum, aus dem es kein Erwachen zu geben schien und den ich doch wachend träumte.
Wenn mich meine Wanderungen in dem Drang nach Erleben unwillkürlich immer wieder der Höhe zuführten, so war mein sonstiges Leben bis dahin ziemlich eben verlaufen. In meinem Beruf hatte ich Aussicht auf eine ganz erfolgreiche Laufbahn, meine Garnison war unterhaltsam und gefiel mir, die Knappheit meiner Mittel kümmerte mich nicht, und von großen seelischen Erschütterungen war ich verschont geblieben. Auch in Herzensangelegenheiten, die wohl da und dort etwas aufgeflackert waren, aber nie wirklich intensive Formen angenommen hatten. Es war da etwas, das mich abhielt, mich innerlich zu sehr zu binden. Im Gebirge, ja, da konnte ich mich ganz und gar hingeben, da blieb ich, wer ich war, aber bei den Menschen war das etwas anderes. Da liebte ich doch meine Freiheit zu sehr. Auch meine Studien hatten mich schließlich ganz auf den Weg des Verstandes geführt. Ich war ein Anhänger Epiktets geworden, der bekanntlich rät, sein Herz an nichts zu sehr zu hängen, weil es dann auch keine Enttäuschungen gebe. Und warum sollte das nicht richtig sein! Predigen nicht auch alle andern weisen Mäßigung und Gleichmut?
Und nun wurde ich plötzlich in einen Wirbel der Gefühle hineingerissen, der mich in alle Höhen und durch alle Tiefen führte. Die uralte und doch ewig neue Geschichte natürlich von dem Herzzerbrechen. Was bedeutete das für mich? War es ein Schicksal oder eine gütige Fügung?
Doch betrachten wir uns erst den Verlauf der Krankheit!
Es war bei einem großen Ball in der Residenz. »Sie stand neben einem der vielen Pfeiler des weiten, prächtig beleuchteten Saales, eine hochelegante, stattlich volle Erscheinung von fremdländischem, beinahe südlich feurigem Typus. Eine hochstehende Feder in dem brünetten Haar erhöhte noch den hoheitsvollen, unnahbaren Eindruck, der eigentümlich von einer gewissen Weichheit abstach. Fragend schweiften die großen, dunkeln Augen über das bunte Menschengewirre vor ihr hinweg. Niemand kannte die Fremde oder wagte sich an sie heran. Scheu, wenn auch mit neugierigen Blicken ging man an ihr vorbei, und ich hatte die größte Mühe, bis ich ihr endlich vorgestellt werden konnte. Ich tanzte den ganzen Abend nur mit ihr. Einmal, weil ich das auf Bällen immer so machte und dann interessierte sie mich. Sie gab sich sehr liebenswürdig und zuvorkommend. Augenscheinlich war sie froh, jemand zu haben, der sich ihrer annahm. So unterhielten wir uns vortrefflich, und ich nahm mir vor, diese Sache zu pflegen.
Bei meinem ersten Besuche wurde ich etwas ernüchtert, wenn auch nicht gerade enttäuscht. Der blendende Glanz des Ballsaals war verflogen und das leicht gepuderte Gesicht erschien mir älter als am Abend zuvor. Überhaupt hatte sie ihre »Tage«. Nicht bloß äußerlich, auch in ihrem stark exotischen, oft launischen Wesen, das in der braven Stadt ziemliches Aufsehen erregte. Daß sie sich daraus nichts machte, gefiel mir. Auch ihre Mutter kümmerte sich nicht darum und war froh, wenn sie einige Unterhaltung hatte. Im übrigen fanden wir bald etwas, das uns zusagte. Der schneereiche Winter und die bergige Umgebung der Stadt brachten es ganz von selbst mit sich, daß wir auf das damals allerdings noch recht ungewöhnliche Rodeln verfielen. Das war etwas Romantisches, und wir konnten uns dabei nähertreten. So zogen wir beinahe jeden Abend mit unserem Doppelschlitten auf die benachbarten Höhen hinaus und unterhielten uns glänzend bei unserem Sport. Sie war dabei ein vortrefflicher, unternehmungslustiger Kamerad, der auf alles einging und nie Schwierigkeiten machte, wenn wir genug gerodelt hatten, brauten wir uns in dem schneelastschweren Wald einen Grog, aßen Süßigkeiten, tanzten um das Feuer herum, um die Füße zu wärmen und traten meist erst lang nach Mitternacht Hand in Hand den Heimweg durch die verschneiten Gassen an.
Soweit war der Traum also nicht übel, und wenn er plötzlich eine andere Gestalt annahm, uns blutig angrinste, so waren wir daran nur selbst schuld, wir hatten eben beide zu harte Köpfe. Der Gefährtin ging nämlich die Fahrt nie schnell genug, und ich wiederum war nicht geneigt, den Bedächtigen zu spielen, vor irgend etwas zurückzuschrecken. So schraubten wir uns gegenseitig, bis die Katastrophe eintrat, unser Schlitten an einer scharfen Kurve, die dazu noch über eine Bahnlinie hinwegführte, zerschmetterte und wir in eine eiserne Barriere hineingeschleudert wurden, die zum Glück nicht ganz vorgezogen war. Ich selbst kam mit einigen zerschundenen Gliedern davon, während sie mit einer langen klaffenden Wunde über der Stirn am Boden lag. Im übrigen blieb sie sich treu. Als sie wieder zu sich kam, war ihre erste Frage, ob ihre Augenbrauen, auf die sie besonders stolz war, nicht verletzt seien. Nachdem ich verneinen konnte, machte sie sich uns der Sache weiter nicht viel und nahm auch die sieben Nadeln, die sie kostete, nicht tragisch.
Bei den Krankenbesuchen, die ich nun machte, kam dann meine eigene Krankheit vollends zum Ausbruch. Mitleid für ihre Schmerzen, die sie mit ruhiger Gelassenheit ertrug, spielte dabei ebenso eine Rolle, wie Bewunderung für ihre Schneid, von der ich sie im übrigen doch einigermaßen kuriert hatte. Auch etwas Stolz über diese letztere Tatsache war wohl dabei. Kurz und gut, die Große Passion brach rettungslos bei mir aus und steigerte sich rasch ins Unermeßliche. Bald war dann auch sie ganz im Bann, und so träumten wir den großen Traum, demgegenüber es eigentlich gar keine Wirklichkeit mehr gibt. Ich sehe uns großen Kindern gleich durch Wald und Frühlingsflur streifen oder hoch zu Roß dahinreiten, sehe uns an den Ufern jenes kleinen Sees sitzen, an Bachesrand unter mächtigen Tannen Blumen pflücken, sonnenfroh, wie in einem Mysterium, und umgaukelt von Zukunftsplänen aller Art. Dazwischen freilich mischte sich das drohende Gespenst einer Trennung, die notwendig war, um die Einwilligung des Vaters von jenseits des Ozeans zu holen. Endlich der Höhepunkt, der zugleich den Abschied mildern sollte: die Reise nach der Schweiz, nach Engelberg und dem Vierwaldstädter See. Was soll ich weiter darüber sagen! Wie sollte ich jene Mondnacht in dem einsam treibenden Kahn auf dem feenhaft beleuchteten See mit seinen stillen, lauen Wassern und dem Schilf am Ufer vergessen, zwischen den es uns weltenfern hineintrieb, während dort die stolze Front der Stadt in magischem Feuerwerk erstrahlte!
Als dann die Trennungsstunde schlug, war ich wie betäubt und scheute mich vor dem Erwachen. So kam es, da ich noch reichlich Zeit vor mir hatte, zu jenem Zwischenspiel in dem Traum, das mich jäh in eine ganz andere Welt versetzte und mit seinen drohenden Gefahren und Abenteuern heute noch wie eine phantastisch höhnische Groteske anmutet, deren grimmer Humor mir nur ganz allmählich zum Bewußtsein kam. Also es trieb mich nach dem Süden. Dort in Nizza hatte die Geliebte einst geweilt, da wollte auch ich jetzt hin, um weiter an den Plätzen träumen zu können, die sie für mich mit einem so romantischen Schimmer umgeben hatte. Auch die Seealpen, durch die ich dabei wandern konnte, lockten, wenngleich ich zum eigentlichen Bergsteigen nicht in der Stimmung war. Daß ich auf dieser Wanderung als Offizier allerhand Unangenehmes erleben kannte, dachte ich mir ja auch schon so ungefähr. Ich kam da durch ein befestigtes Grenzgebiet, in dem der Spionageverdacht gewiß seine Blüten trieb. Aber gar so schlimm würde das ja wohl nicht sein und was konnte mich denn besser über die Sentimentalität der nächsten Zeit hinwegbringen, als Abenteuer? Doch die Dinge waren wesentlich schlimmer, als ich dachte. Die zahlreichen militärischen Wegeanlagen und Grenzstellungen waren von Truppen besetzt, und unter den wenigen seßhaften Sommerfrischlern fiel jeder wandernde Tourist bedenklich auf. So hatten die überall herumstreifenden Carabinieri und Gendarmen ein leichtes Spiel, um ihren Argwohn zu befriedigen und eventuell einen guten Fang zu tun, der dann auf Nachsicht gewiß nicht rechnen konnte. Sprach man doch auch überall davon, daß in Frankreich einmal Festgenommene, abgesehen von ihrer Verurteilung, durch unverdauliche Gefängniskost rasch und sicher zugrunde gerichtet würden, während in Italien die Behandlung Verdächtiger mindestens ebenso rücksichtslos sei. Nun zunächst wenigstens blieb ich in meinem Traum befangen, und die Reise ließ sich recht gut an.
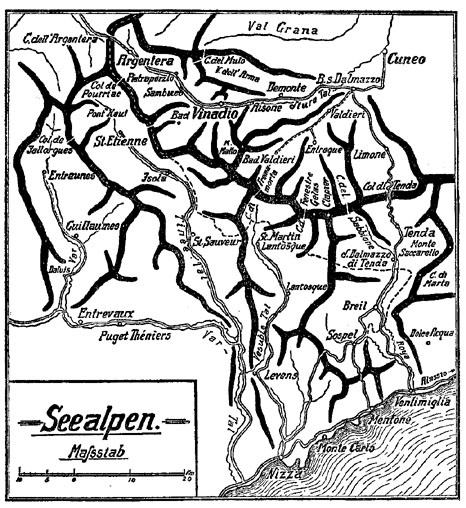
Ich zog von Cuneo über den Colle delle Fenestre nach St. Martin Lantasque, erfreute mich an der romantischen italienischen Landschaft und den malerischen Gestalten, holte mir Trauben von den Weinlauben herunter und lebte bei manchem Fiasko der Erinnerung. Auch der Spaziergang durch das wilde Trümmertal des Passes mit dem großartigen Blick auf die Firnfelder der Cima dei Gelas und des Mont Clapier, der einen so gewaltigen Kontrast zu dem Blick über die grünen Vorberge mit ihrer südlichen Pracht bis zum Mittelmeer bildete, gefiel mir höchlichst.
In St. Martin Lantosque, einem hübsch gelegenen Städtchen mit malerischen Mauern, das voll von Nizzaer Sommergästen war, erregte ich einiges Aufsehen. Augenscheinlich amüsierte man sich über den »langen, spleenigen Engländer«, der schwer bepackt durch die Lande zog, anstatt sich bequem an einem hübschen Plätzchen niederzulassen. Auf einem Umweg nach meinem Ziel kam ich dann über hübsche aussichtsreiche Vorberge und in interessantem Wechsel durch das schluchtenreiche Tinee Hochtal nach St. Etienne, wo der Traum eine drohendere Gestalt anzunehmen begann. Am Abend trat ein Gendarm bei mir ein und ersuchte mich, mit ihm auf sein Bureau zu kommen.
Ein Gendarm! Nun, ich war auf meiner Hut, als sich folgendes Verhör abspielte.
»Monsieur, wir sind hier an der Grenze und müssen uns über alles auf dem laufenden halten. Also, was wollen Sie eigentlich hier?«
»Was werde ich weiter wollen! Wandern! Die Seealpen interessieren mich,«
»Sie sind wohl ein Engländer?«
Da der Mann das so kategorisch annahm, so bejahte ich eben.
»Und ihre Papiere?«
Ich hielt Ihm einige Briefe hin, die ich aus England erhalten hatte, dazu meine allerdings gut deutsche Alpenvereinskarte, die er augenscheinlich nicht verstand und mir nach einigem Betrachten zurückgab.
»Wo wohnen Sie denn in England?«
Jetzt konnte nur Unverfrorenheit helfen.
»In London.«
»In welcher Straße?«
»9 Cecil Street Strand.« Da hatte ich nämlich seinerzeit tatsächlich gewohnt.
»Sie sind wohl Mitglied des Alpine Club?«
»Allerdings!«
»Wer ist denn der Präsident des Alpine Club?«
Also auch das noch!
»John Ball,« erwiderte ich, einen Namen der mir gerade einfiel.
»Das ist aber merkwürdig. Ich kenne den Präsidenten von Nizza her, und der heißt ganz anders.«
»Das mag wohl sein!« Und ohne weiteres besinnen: »Der Alpine Club hat jedes Jahr einen neuen Präsidenten und der gegenwärtige heißt John Ball.«
Das leuchtete dem Mann ein, und er gab sich endlich zufrieden. Als ich dann aber etwas erleichtert auf mein Zimmer kam, zeigte sich, daß mein Gepäck inzwischen durchsucht worden war. Das war gut, denn ich hatte meinen photographischen Apparat in meiner Rocktasche gehabt und sonst nichts Kompromittierendes bei mir. Da ich nun fürchtete, bälder oder später auch noch selbst einer Untersuchung unterzogen zu werden, ließ ich bei dem Ausflug, den ich andern Tags unternahm, den Apparat in meinem Tornister zu Hause, in der Annahme, daß jetzt wenigstens mein Gepäck sicher sei. Doch ich hatte nicht mit der Gründlichkeit dieser Leute gerechnet, und als ich wieder zurückkam, stand mein Gendarm auch schon erregt vor der Tür. »Aber Sie photographieren ja?«
Das kam nun allerdings etwas überraschend, und da ein Leugnen unmöglich war, so zuckte ich nur gleichgültig mit den Achseln.
»Selbstverständlich photographiere ich, jedermann photographiert doch jetzt im Gebirge.«
»Ja, was nehmen Sie denn auf?«
»Was mir gerade in den weg Kommt: Bäume, Menschen, Kühe, Ochsen, wie es sich eben gibt.«
»Also petites scènes?« Und nach einer Pause: »Da könnten Sie ja auch mich photographieren?«
Einen Augenblick lang zögerte ich. Mein Eindruck war, daß der Mann mich hinhalten wolle, um erst Instruktionen bei seiner Behörde einzuholen. Dann erklärte ich mich mit dem größten Vergnügen dazu bereit, aber heute abend sei das Licht schon zu schlecht und morgen gehe ich nach den Quellen des Var. Wenn ich von da zurückkomme, so werde ich gerne so viel Aufnahmen von ihm machen, als er haben wolle. Damit schien er sich zufrieden zu geben.
Andern Tags zog ich in aller Frühe los. Meine Absicht war, über den Col de Jallorgues nach Süden zu wandern in Richtung auf mein vorgenommenes Ziel. Dabei kam für den Fall einer weiteren Verwicklung mit der Gendarmerie die Eigenart des Gebirges allerdings recht ungünstig in Betracht. Alle Täler liefen in sogenannte »Clus« aus, meilenlange, senkrechte Felsschluchten, in denen ein Ausweichen nach der Seite völlig unmöglich war, so daß man mich leicht anhalten konnte, wenn ich telegraphisch signalisiert wurde.
Zunächst ließ sich alles gut an. Das Dörfchen lag noch in tiefem Schlaf, und ich begegnete keinem Menschen. Aber bald hatte ich das unbestimmte Gefühl, daß etwas nicht stimme, und mehr und mehr kam mir der Gedanke, ob es nicht besser sei, über den naheliegenden Col de Pourriac nach Italien zurückzukehren, das ich in wenigen Stunden erreichen konnte, während ich sonst mindestens einige Tage lang in Frankreich bleiben mußte. So kam ich noch unschlüssig bei Pont Haut an, wo die Wege sich trennten und eine »Clus« nach links zum Col de Jallorgues führte. Einen Augenblick lang kämpften Sentimentalität und Vernunft, Träumerei und Wirklichkeit miteinander, dann siegte die erstere, und ich machte entschlossen linksum in die Schlucht hinein, froh, daß ich nun wenigstens wußte, was ich wollte.
Die Freude sollte nicht lange dauern. Als ich ein kurzes Stück weit gegangen war und mich zufällig umsah, bemerkte ich zwei Gendarmen hinter mir, die sich sofort platt auf den Boden warfen, augenscheinlich, um nicht gesehen zu werden. Kein Zweifel, ich wurde verfolgt. Nun, auf meine Beine konnte ich mich ja verlassen, wenn nur der verdammte Telegraph nicht gewesen wäre! Günstig war auch mein angebliches Ziel. Die famosen Quellen des Var waren nämlich nur so eine Art geographischer Begriff, beinah wie die Quellen des Nil. Man konnte da lange suchen, bis man mich fand. Immerhin war meine Phantasie stark erregt, wie das folgende Erlebnis zeigt.
Als ich mich mit Riesenschritten der Paßhöhe näherte, erblickte ich auf einem benachbarten kleinen Gipfel eine Gestalt, die sich scheinbar riesengroß vom Horizont abhob und als sie mich sah, in weiten Sätzen auf mich zusprang. Nun waren ja die Gendarmen schon weit hinter mir und längst nicht mehr zu sehen, aber ich hatte das Gefühl, daß ich umstellt sei und die Schlinge nun zugezogen werde. Was tun? In finsterer Wut und entschlossen zu allem, blieb ich stehen, bis schließlich zu meiner nicht geringen Überraschung ein kleiner Hirtenjunge vor mir stand, dessen Gestalt meine überhitzte Phantasie im Verein mit der Horizontperspektive beinahe ins Übermenschliche vergrößert hatte und der sich nur harmlos freute, in dieser gottverlassenen Gegend einen Menschen zu sehen.
Von Guillaumes, wo ich die Nacht verbrachte, indem ich mich, Müdigkeit vorschützend, sofort ins Bett legte, fuhr ich im Wagen weiter. Wagenreisende werden ja immer weniger belästigt, als gemeine Fußgänger. Die Schwierigkeit bestand jetzt darin, die Schlucht zu passieren, in der der obere Var das Gebirge durchströmt, hier nun nahm die Sache geradezu die Form einer Groteske an. Als ich einige Zeit gefahren war, kam uns ein Fuhrwerk mit einem Insassen entgegen, die beiden Kutscher besprachen sich und mein Rosselenker meinte, ob ich den Wagen nicht tauschen wolle, man erspare sich so unnötige Arbeit. Mir war natürlich nichts lieber als das. Zweifellos hatte man mich in Guillaumes als Fremden erkannt, der neue Kutscher aber sollte nichts davon merken. Ich nickte also nur zustimmend und stieg in den andern Wagen, entschlossen, meine Rolle schweigend bzw. scheinbar schlafend durchzuführen. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde lang gefahren waren, kamen wir in der Gegend von Daluis an den Eingang der erwähnten Clus, wo auch richtig ein Gendarm wartete und den Wagen halten ließ. Das Herz pochte mir nicht wenig, aber da ich scheinbar fest schlief, so wandte er sich an den Kutscher und fragte ihn, woher ich komme, wohin ich gehe, und vor allem, ob ich kein Ausländer sei? Mit einer geradezu herzerfrischenden Kutschergrobheit erklärte nun aber mein Rosselenker, der Gendarm habe mich doch hereinfahren sehen! Ich sei aus Entrevaux, er kenne mich ganz genau, und wisse schon, was er zu tun habe. Damit ließ uns der bestürzte Gendarm passieren, und ich stellte vergnüglich Betrachtungen über den Wert einer richtig angebrachten Grobheit an. Höflichkeit macht es eben doch nicht immer!
Beim Ausgang aus der Schlucht, wo wiederum ein Gendarm wartete, ging es dann ähnlich, und die Unterredung endete mit dem ebenso weisen wie grob vorgebrachten Schluß meines Kutschers: Wen man hereingelassen habe, den müsse man auch wieder herauslassen.
In Entrevaux übergab mich mein vortrefflicher Rosselenker wie ein Gepäckstück einem nach Nizza fahrenden Omnibus, auf dessen Verdeck bald auch eine Gesellschaft Betrunkener kam, die mich in patriotischer Begeisterung nicht nur auf die hoch oben an den Talhängen liegenden Befestigungen aufmerksam machten, sondern auch noch in eine Talsperre führten. Die Wache ließ das ohne weiteres zu und ein Posten erklärte uns alles eingehend, so daß ich mich wenigstens durch ein Trinkgeld erkenntlich zeigte, denn was ich da sah, war wirklich hochinteressant. Bei der Vesubieschlucht verließ ich dann unser Fuhrwerk. Ich begann doch allmählich das Erwachen zu fürchten und es schien mir geraten, das Weite zu suchen. So kletterte ich durch die steilen Felsen hinauf nach Levens, wo ich mir einen Wagen bestellte, um nordwärts der Grenze zuzufahren. In dem Gärtchen der dortigen Osteria blickte ich dann noch einmal mit fiebernden Augen über die malerischen Vorberge hinweg, an den Reben, Kastanien und Nußbäumen vorbei bis hinunter nach Nizza mit seinem weißschimmernden Häusermeer, hinter dem sich die blauen Wogen bis zum weiten Horizont ausbreiteten, und machte mir meine Gedanken. Welcher Wechsel in wenigen Tagen! Ich kam mir vor wie ein Geächteter, der hinausblickte ins gelobte Tand, das er nie betreten würde.
Ob ich auch nur noch die Grenze glücklich erreichte? Ich sehe mich in dem kleinen Wirtshaus sitzen, das unmittelbar neben einer das Tal sperrenden Befestigung lag, durch die mein Kutscher mich mitten hindurch geführt hatte, ohne daß er zu bewegen gewesen wäre, weiter zu fahren. Es war mir eine recht unangenehme Nachbarschaft, und ich beeilte mich mit dem Nachtessen, um möglichst rasch und ungesehen auf mein Zimmer zu kommen. Ich hatte aber die Rechnung ohne die Gendarmen gemacht, die augenscheinlich die benachbarte Befestigung bewachen sollten. Eben wollte ich mich zurückziehen, als einer eintrat und sich an den Nebentisch setzte. Angesichts meiner so gänzlich überfranzösischen Länge und der Wahrscheinlichkeit, daß mein Signalement ausgegeben war, wagte ich nicht, aufzustehen, vertiefte mich also in das auf dem Tisch liegende Lokalblättchen, indem ich gleichzeitig durch gebücktes Sitzen meine Größe nicht zu verraten suchte. Ich mußte den Kerl eben »aushungern«, und ewig würde er ja doch wohl nicht bleiben. Aber meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Bald kam ein zweiter Uniformierter von der Sorte und dann auch noch ein dritter, so daß ich mich immer mehr hinter mein Zeitungsblättchen drückte. Den andern freilich schien inzwischen recht wohl zu sein. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, begannen sie Karten zu spielen. So verging Stunde um Stunde, während ich gebückt dasaß und mein Wurstblättchen von vorn und hinten studierte, das zu allem hin auch noch grausige Angaben über den Fang eines Spions machte, dem man nun entsprechend beikommen werde. Und dabei saßen die drei Kerle stundenlang neben mir, ohne sich um ihr Festungswerk zu kümmern. Ich war einfach empört, warum taten sie nicht ihre Schuldigkeit, wie es sich gehörte? Endlich gegen 1 Uhr nachts besprachen sie eine Patrouille, standen auf und gingen, ohne sich nach mir umzusehen. Der folgende Morgen brachte mich dann vollends glücklich nach der Grenze, die ich mit einem weiten Satz übersprang. Ich beschloß, mich jetzt eben in Italien umzusehen, und Frankreich lief mir ja nicht weg. Freilich, wenn ich geglaubt hatte, nun meine Ruhe zu finden, so war das eine Täuschung. Schon bei dem wild romantisch gelegenen Bad Valdieri wimmelte es von Alpini, die hier ihr Lager aufgeschlagen hatten, und ein Verhör, dem mich zwei Carabinieri unterzogen, ließ mich erkennen, daß auch hier der Boden leicht zu heiß werden konnte. Immerhin ließ man mich nach einem kurzen Verhör weiterziehen, und ich erreichte über Entraque und den Colle del Sabbione in dem prächtigen kleinen Bad San Dalmazzo di Tenda endlich einen Ort, der mir Ruhe vor der ewigen Verdachtsschnüffelei bot. Wie freute ich mich, in dem anheimelnden früheren Klostersaal wieder harmlos unter Menschen sein und mich bei Trauben und Asti von dem aufregenden Traum erholen zu können! Auch einige interessante photographische Ausflüge in die benachbarten Berge konnte ich machen, aber lange hielt es mein unruhiger Geist doch nicht aus, und so begann die Komödie von neuem.
Um die Seealpen nach etwas näher kennen zu lernen, überschritt ich den Col di Tenda und wendete mich dem Colle dell'Argentera zu, auf Seitenwegen über den Colle del Mulo, um der Hitze im unteren Sturatal zu entgehen. Als ich dabei in Demonte an übenden Soldaten vorbeikam, schickten sie mir sofort einen Unteroffizier nach, der mich den ganzen Tag über begleitete. Nun, der Mann war gesprächig und höflich, warum also nicht! Auf der Paßhöhe, wo sich ein befestigtes Lager befand, führte er mich in die Offiziersmesse, und nach anfänglicher Zurückhaltung erwiesen sich die dortigen Offiziere als ganz umgänglich. Soweit schien also alles in Ordnung zu sein. Ich zog ruhig weiter nach Sambucco, wo mich mein Unteroffizier verließ, um nach Demonte zurückzukehren, allerdings etwas erstaunt, daß ich nicht mit ihm, sondern der verdächtigen Grenze zuging. Ich legte dem weiter keine Bedeutung bei und fand auch in Pietraporzio bei einer Wirtin, deren Mann verreist war, ein ganz ordentliches Quartier. Da, mitten in der Nacht, wurde ich plötzlich durch ein lautes Klopfen geweckt. Der von seiner Reise zurückgekehrte Wirt trat ein und hielt erregte Reden über verdächtige Telegramme, Deserteure und Spione. Das sei kein Reisegebiet hier, seine Frau habe unrecht getan, mich aufzunehmen, er wolle wissen, wer ich sei und was ich hier treibe. Schließlich mußte ich mich in das Fremdenbuch eintragen und konnte mir meine Gedanken über dieses im Hemd ausgestandene Verhör machen. Da mich diese Sache immerhin etwas stutzig machte, so beschloß ich, wieder einen Wagen zu nehmen. Diesmal freilich mit weniger gutem Erfolg. Schon am Dorfrand warteten zwei Carabinieri, die mich nicht bloß ausfragten, sondern auch einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen. Das war mir wegen meines photographischen Apparates doch etwas peinlich, denn die beiden waren augenscheinlich nicht so leicht zu befriedigen, wie der Gendarm von St. Etienne. Sie besichtigten meinen Tornister auf das gründlichste, wendeten meine Hosen», Brust- und Westentaschen um und ließen nur die Rocktasche ungeschoren, in der sich mein Apparat unter dem Taschentuch befand. Als sie somit nichts Verdächtiges fanden und in Erfahrung gebracht hatten, daß ich nach Argentera gehe, entließen sie mich endlich unter weisen Sprüchen. Das Klügste dünkte mir jetzt, den Stiel umzudrehen und selbst angriffsweise vorzugehen. Nach einiger Zeit schickte ich also meinen Wagen wieder zurück, ging etwas abseits von der Straße und vergrub in einem großen Trümmerfeld meinen photographischen Apparat unter Steinen. Dann begab ich mich auf die nächste Gendarmeriestation, erzählte, was geschehen und begehrte entrüstet auf. Ich sei ein harmloser deutscher Reisender und verbitte mir derartige Schikanen. Aber der Mann zuckte nur mit den Achseln, meinte, das sei nun einmal hier so und – mein Apparat war weg.
Auch der Verdacht war jetzt rege, was ich bald merken sollte. In Argentera, einem kleinen Luftkurort, konnte ich mich zwar mit einigen Gästen, darunter einem Turiner Professor, anfreunden, im Laufe des Abends setzte sich aber auch eine Persönlichkeit an den Tisch, die sich später als Gendarmerieleutnant entpuppte und mich auszufragen suchte. Als er schließlich wissen wollte, wo ich morgen hingehe, kam mir der Professor zur Hilfe und schlug vor, mit ihm und seinen Freunden nach der Paßhöhe zu gehen, was mir durchaus gelegen kam. Während der nächsten Tage wiederholte sich das, so daß ich Gelegenheit hatte, die recht hübsche Gegend genau kennen zu lernen. Im übrigen suchte auch mein Professor mich auf die Probe zu stellen, ob ich wirklich ein Deutscher sei oder nicht. So richtete er eines Abends die verfängliche Frage an mich, welches Geschlecht denn das Wort Band habe, ob man das oder der Band sage. Auf meine Erwiderung, daß es selbstverständlich das und niemals der Band heiß«, meinte er, man sage doch auch zum Beispiel: dies ist der erste Band von Goethes Schriften, und ich brauchte einige Zeit, um ihm klar zu machen, daß dies ein vollständig anderer Begriff sei. Da meine diesbezügliche Beweisführung ihm doch nicht so ganz einleuchtete, so sang er bald darauf mit der ganzen Gesellschaft die italienische Nationalhymne und forderte mich dann auf, die deutsche zum besten zu geben. Das konnte ich nun natürlich vortrefflich und schmetterte mein Lied mit solcher Wucht in das Lokal hinein, daß jeder nationale Zweifel vergehen mußte.
Als ich so nach einigen Tagen den Verdacht verscheucht zu haben wähnte, auch alles Sehenswürdige gesehen hatte, mußte ich doch allmählich wieder an meinen photographischen Apparat denken und entschloß mich zum Weggang. Meinem besorgten Gendarmerieleutnant erklärte ich auf seine übliche Frage, daß ich nach Bad Vinadio gehen werde. Dies war ihm augenscheinlich gar nicht recht, er schüttelte bedenklich den Kopf und meinte, ich solle unter keinen Umständen von der Straße heruntergehen, da ich sonst recht üble Unannehmlichkeiten haben würde, gleichgültig, ab ich nun ein Deutscher sei oder nicht. Angesichts der Sachlage mit meiner Kamera war mir diese Warnung allerdings etwas störend, aber ich hoffte, mir schon auf irgendeine Weise helfen zu Können.
Zunächst zog ich unmenschlich früh los und kam auch völlig ungestört bis in die Gegend, wo sich mein Apparat befand. Dort vergewisserte ich mich, ob niemand in der Nähe sei und ging dann direkt auf den vermeintlichen Platz zu. Aber die Sache war nicht so einfach. Ich hatte mein Versteck zu gut gewählt und mußte geraume Zeit suchen, bis ich den Apparat endlich fand. Und gerade als ich ihn in die Tasche gesteckt hatte, kamen zwei Carabinieri um die Ecke. Wenn ich jetzt keine gute Ausrede fand, saß ich in der Falle. Nun, ich habe sie gefunden. Als die beiden atemlos anstürmten, trafen sie mich bei einer Beschäftigung, die ich mit gutem Grund unmöglich mitten auf der Straße vornehmen konnte. Der Beweis meiner Unschuld war mir geglückt.
Im übrigen wurde ich die Carabinieri nun nicht mehr los. In Bad Vinadio war am Abend auch mein Gendarmerieleutnant wieder da, diesmal in voller Uniform, und auf dem Marsch nach Bad Valdieri schlossen sich mir zwei Carabinieri an, die mich den ganzen Tag über begleiteten. Da sie mir den Weg zeigten und ganz nette Leute waren, so war mir diese vorsorgliche Eskorte durchaus nicht unangenehm, wir unterhielten uns vortrefflich, kochten Polenta und schlossen eine Art Kameradschaft, bei der ich manches Interessante über ihr Leben und Treiben erfuhr. Im Bad Valdieri war auch schon mein Leutnant wieder und empfing mich sehr erregt. Der Col di Tenda sei befestigt, ich solle mir ja nicht einfallen lassen, in dieser Richtung weiterzugehen. Da ich schon dort gewesen, hatte ich das ja auch weiter nicht nötig und wurde deutlich. Es sei mir allmählich zu dumm, mich so beaufsichtigen zu lassen, und ich werde morgen überhaupt weggehen. Als ich dann nach Borgo san Dalmazza trottete, begegnete ich unterwegs ganzen 24 Karabinieri, immer je zweien, die mich mit den liebevollsten Blicken musterten, augenscheinlich um sich mein Signalement einzuprägen. Ich kam mir vor wie in einer Operette.
Alassio ist ein hübsch gelegenes kleines Seebad an der italienischen Riviera, wo es recht unterhaltsam zugeht. Mein Hotel war unmittelbar am Meeresstrand gelegen und nur durch eine schmale Strecke schönsten weißen Sandes vom Wasser getrennt. Was Wunder, daß man da gewissermaßen als Babender lebte! Das heißt, man zog morgens seinen Badeanzug an, Männlein wie Weiblein, frühstückte im Sand lagernd, badete und lungerte halb nackt den ganzen Tag auf dem Strande herum, alles bunt durcheinander. Erst des Abends zog man sich dann richtig an, zu Diner und Tanz. Die Ausflüge in die rebenreiche Gegend mit ihren Zypressen und Oliven und sonstiger üppiger Vegetation waren zwar recht heiß, aber von einer eigenartigen Schönheit, insbesondere auch durch den beständigen Blick auf das Meer. Sehr malerisch waren auch die wie angeklebt an den Bergen hängenden Ortschaften, wegen der Erdbebengefahr waren alle Häuser zusammengebaut, so daß jede Ortschaft gewissermaßen aus einem einzigen Bauwerk bestand. Durch was für merkwürdige enge Gassen man da kam! Mir schien, als rede das römische Altertum aus diesen uralten Steinhäusern.
Nach einiger Zeit siegte dann die Sehnsucht nach Nizza wieder. Ich mußte da nun einmal hin. Es geschah auf Umwegen durch die Berge, und es fehlte auch hier nicht an interessanten nächtlichen Abenteuern. Nach dem Überschreiten der Grenze stieß ich u. a. auch auf einen italienischen Deserteur, der sein Gewehr und Seitengewehr wegwarf, um alsbald einem Fremdenlegionärswerber in die Hände zu fallen, der ihn betrunken machte und in die afrikanische Sklaverei wegschleppte. Mir selbst wurde mein Geldbeutel in den Spielsälen von Monte Carlo erleichtert, doch fand ich auch hier noch rechtzeitig den Weg ins Freie. Nur unsagbar dumm kam ich mir vor.
Und nun endlich Nizza, das Hauptziel meiner Sehnsucht! Brauche ich zu sagen, daß es meinen Erwartungen Keineswegs entsprach? Träume und Wirklichkeiten sind nun einmal verschiedene Dinge. Schwierigkeiten hatte ich im übrigen keine mehr, und eine eingehende Visitation an der Grenze verlief ebenso glatt, wie der erneute Marsch über den Col di Tenda. Auch die Carabinieri hängen eben nur die Leute, die sie fangen.
Damit war das Zwischenspiel zu Ende.
Bei meiner Rückkehr gab es eine unerwartete Überraschung. Die Geliebte war geblieben. Sie verstand es auch jetzt, die Abreise immer wieder hinzuziehen und setzte es durch, daß wir noch ein volles Jahr des Zusammenseins hatten. So begann der Traum von neuem; glühender und verzehrender als je. Freilich, auch nicht ohne Schatten. Ich fühlte mehr und mehr, daß es der in so ganz anderen Verhältnissen Aufgewachsenen schwer fallen würde, sich bei uns zurechtzufinden, daß in ihrem Innersten etwas Absprechendes, Verneinendes, auch Realistisches lebte, das nicht so recht zu mir paßte. Aber da war auch meine merkwürdige idealistische Art, auf das einmal gesteckte Ziel weiterzustürmen, blind und in der phantastischen Zuversicht, die vermeintliche Höhe doch noch zu erreichen. Und wohl oder übel folgte die Geliebte dem Gewaltmenschen, der ihr keine andere Wahl ließ und immer wieder jeden Gedanken in Anspruch nahm.
Endlich schlug dann die nicht mehr aufschiebbare Trennungsstunde. Es war ein Abschied unter vielen Tränen und Beteuerungen ihrerseits.
Dann der Niedergang.
Wieder dauerte es ein Jahr, bis es ganz aus war, ein Jahr verzweifeltsten Kampfes und aufreibendster Selbstquälerei. Langsam und ganz allmählich stürzte das Luftgebilde zusammen, das sich meine Phantasie in glühendem Sehnen aufgebaut hatte, das ich immer wieder festzuhalten versuchte. Aber wer kann eine Frau festhalten, die Tausende von Meilen entfernt ist und die so gänzlich verschiedenen heimatlichen Eindrücke wieder in sich aufnimmt! Als dann schließlich der Zusammenbruch erfolgte, war ich völlig zerfallen mit der Welt und mir selbst und hatte nur noch ein Bedürfnis, allein zu sein, die in mir gärenden, sich krampfhaft aufbäumenden Kräfte besinnungslos zu betätigen, einfach niederzuhetzen. In dieser Stimmung erinnerte ich mich meiner Berge wieder, und so kam es 1890 zu meiner Weihnachtsreise ins Engadin, bei der ich den Tod zwar nicht gerade aufsuchte, aber doch gegen ein Weiterleben so gut wie gleichgültig war. Es war die Katharsis des Traumes.
An einem grimmig kalten Dezembermorgen langte ich in Davos an und fuhr sofort mit der Post nach dem Flüela weiter, allein in einem der fünf Schlitten, von denen nur der vorderste und hinterste geleitet wurden. Zu sehen war dabei nur wenig, um so mehr gab die Einsamkeit zu denken. Gegen Mittag wurde das Hospiz erreicht, das unermeßlich einsam in dem tiefen Schnee dalag. Das paßte mir. Ich stieg aus und blieb, meinen Träumen nachhängend.

Schwarzhorn mit Wegwärterhaus.
Andern Tags brach ich gegen 4 Uhr morgens auf, um das Schwarzhorn (3150 m) zu besteigen, einen Allerweltsberg, der im Sommer bequem in 3 Stunden erreicht wird. Es war ein klarer Sternenhimmel und der Marsch auf der Straße zunächst ganz bequem. Dann aber sank ich bald bis unter die Arme in den weichen Schnee und wurde mir der Mühseligkeiten, die mir bevorstanden, bewußt. Wunderbar war der Sonnenaufgang in der monotonen eisigen Einsamkeit. Kaum je habe ich den Lichtball so groß, so feurig über den kalten weiten Schneeflächen gesehen, die er mit einem eigen duftigen Schimmer rötete, ohne sie doch erwärmen zu können. Lange sah ich mir das Schauspiel an. Gewiß, die Welt war schön, aber auch kalt und tot, und ihre Schönheit erschien mir wie grimmer Hohn. Gleichgültig setzte ich mich hin und verzehrte das Stückchen Brot, das ich mitgenommen. Der Weitermarsch war ein ununterbrochener Kampf, es wurde 11 Uhr, bis ich endlich den Kamm erreichte, der von Süden zum Gipfel führt, aber ich war entschlossen, nicht nachzugeben, und immer ingrimmiger schrie ich in meinen Gedanken das Bergesungetüm an: ich will doch sehen, wer stärker ist, du oder ich!
Unmittelbar vor dem Gipfel hatte ich eine eigenartige Sinnestäuschung, von weither hatte ich dort oben einen Steinwall, zwei in die Luft ragende Balken und eine Fahne gesehen, und während der ganzen Zeit den Eindruck gehabt, als ob sich da ein mächtiges Bauwerk befinde. Auch jetzt nach erschien es mir so groß und so entfernt wie nur je. Da, nach wenigen Dutzend Schritten zeigte es sich, daß ich oben war und ein kleines Mäuerlein vor mir hatte, in dem zwei Stecken mit einem Taschentuch steckten. War das nicht genau so wie im Leben? Man sieht in seinem Wahn allerhand Schlösser in der Ferne, und wenn man hinkommt, sind's elende Stecken und Mäuerlein. Um die Aussicht kümmerte ich mich wenig, sah's doch dort draußen ebenso eisig und öde aus wie in meinem Innern. Wohl aber freute ich mich grimmig, meinen Willen durchgesetzt zu haben. Ich glaube, ich wäre weitergestiegen, auch wenn der Berg in den Himmel hineingeragt hätte. Im übrigen war es 3 Uhr nachmittags vorbei und recht gut, daß mein Gipfelchen das nicht mehr zuließ. Beim Rückweg konnte ich meist rutschen, und so war der Sattel bald wieder erreicht. Sollte ich nun den alten Weg wieder zurück zum Hospiz? Pah, warum nicht einfach geradeaus, wo es doch so gleichgültig war, wo ich hinkam! Ich rutschte also auf den Gletscher hinunter, um dann die Schneewaterei von neuem Zu beginnen. Aber ich hatte ohne meine erschöpften Kräfte gerechnet. Die Arbeit war fürchterlich, und immer hoffnungsloser versank ich in den haustiefen Schneemassen. Bald brach dann auch die Nacht ein. Um wenigstens einigermaßen die Richtung einzuhalten, nahm ich einen entfernt gelegenen Felsblock zum Ziel und kämpfte mich darauf zu. Eine Zeitlang in verzweifelter Hast und mit Aufbietung der äußersten Kräfte. Aber der Block schien sich immer weiter zu entfernen, und es wurde mir immer verschwommener vor den Augen, bis ich zusammenbrach. Ich raffte mich auf, kämpfte und kämpfte und blieb schließlich liegen. Ein Gefühl völliger Gleichgültigkeit kam über mich, und der Gedanke, so ruhig dazuliegen, hatte geradezu etwas Anheimelndes. Auch wenn es zum Sterben kommen sollte. War der Tod denn nicht ein Glück? Nicht nur jetzt, sondern überhaupt! So mochte wohl eine halbe Stunde vergangen sein, als ich Durst verspürte und den ausgetrockneten Mund mit etwas Schnee erfrischte. Das belebte mich sofort merkwürdig. Kein Zweifel, der Schwächezustand war nur meinem mißhandelten Magen zuzuschreiben, der seit Sonnenaufgang nichts mehr bekommen hatte. Auch mein Trotz war erwacht. Mochte mir die Welt dort unten bieten oder versagen, was sie wollte: jedenfalls ließ ich mich nicht von ihr klein kriegen! War nicht auch ich eine Welt für mich, so gut wie die andere? was brauchte ich mich überhaupt um sie zu kümmern! Was war denn diese weiche, träumerische Sehnsuchtstorheit, als eine dumme Schwäche! Also ich ertrotze mir jetzt meinen weg und kam auch schließlich bei meinem Felsblock an. Freilich war damit nur wenig gewonnen, denn der Weg war noch unabsehbar weit. Bis um den Hals im Schnee kämpfte ich mich also weiter, brach nach dem Überschreiten des Gletschers hin und wieder in den eisigen Bach unter mir ein und erreichte endlich gegen 9 Uhr abends den Talrand. Wie trotzig habe ich da hinuntergeschaut! Hätte ich gewußt, wie es hinter mir aussah, so wäre ich wohl weniger zuversichtlich gewesen. Aber man stürmt ja gottlob immer blind ins Leben hinein und merkt in seiner göttlichen Sorglosigkeit erst nachher, wie es hätte kommen können.
Also ich setzte mich auf den steilen Hang und rutschte los, in die dunkle Tiefe hinein. Es ging nur zu gut. Schon nach wenigen Schritten lösten sich gewaltige Schneemassen hinter mir und drückten mit ungeheurer Kraft nach, die Geschwindigkeit wurde immer rasender, und ich merkte bald, daß ich eine regelrechte Lawine losgelöst hatte. Nun verstand ich mich ja auf das Abfahren, hielt meine Beine hoch in der Luft, um nicht verschüttet zu werden, und solange es sich nur um die wellenartigen Bewegungen der Lawine selbst handelte, ging das ja soweit ganz gut. Auch um die Felsen und Abgründe, die bald rechts, bald links aus der Dunkelheit auftauchten, kam ich glücklich herum, wurde aber schließlich über einige Absätze in die Luft hinausgeschleudert, bis die Lawine zum Halten kam, in der ich bis um die Ohren begraben war.
Nun kam ein neues Bedenken. Während der sausenden Fahrt in dunkler Nacht hatte ich unmöglich sehen können, ob ich schon über die schräg am Hang entlang führende Paßstraße hinweggekommen war. War dies der Fall, so standen die Dinge schlimmer als je. Ich mußte dann dort unten bälder oder später doch liegen bleiben, denn ansteigen konnte ich nicht mehr. Aber wieder war das Glück mir hold. Nach kurzem Marsch befand ich mich auf der Straße und kam bald darauf um 10 Uhr nachts an ein Wegwärterhaus, dessen Insassen mich freundlich aufnahmen. Wie habe ich da ausgesehen! Der ganze Mensch ein einziger Eisklumpen. Wohl gaben mir die Leute Schokolade und halfen mir, mich von dem Eis befreien, aber das konnte nur oberflächlich geschehen, und auf der Ofenbank, wo ich zu schlafen versuchte, taute ich nur ganz allmählich auf, so daß es mich jammervoll fror. Ich werde an diese Silvesternacht denken!
Als ich Tags darauf meinem braven Straßenwärter zeigte, wo ich abgefahren war, schlug er nur sprachlos die Hände über dem Kopf zusammen. Es war die lawinengefährlichste Stelle des ganzen Tales.
Der folgende Abend war wieder völlig traumhaft, als ich, ohne eine Ahnung von den Verhältnissen zu haben, im Culm-Hotel in St. Moritz, den Pickel in der Hand, mit genagelten Stiefeln und verschneiten Kleidern, Eiszapfen an Bart und Augenbrauen in einen elektrisch beleuchteten Saal geführt wurde, in dem einige hundert Personen, die Herren im Frack, die Damen in Gesellschaftstoilette, dinierten. Ich kam mir vor wie in einem Märchen.
Tags darauf machte ich den vergeblichen Versuch, den Piz Albula zu besteigen. Da die Post lange bis an den Fuß des Berges brauchte, so war die Sache von Anfang an aussichtslos, und um 2 Uhr nachmittags kehrte ich auf dem in Schnee und Eis erstarrten Schlußgrat wieder um. Das Schwarzhorn hatte mich doch etwas gewitzigt. Sogar so, daß ich zu der nun beabsichtigten Tour über die Diavolezza einen Führer nahm. Er war großartig, Johann Groß. Wie mancher wäre schon umgekehrt bei dem Marsch von den Berninahäusern zur Paßhöhe, wo man wieder einmal im Schnee versinken konnte. Aber wie mir Groß später sagte, hätte er niemals nachgegeben, schon der andern Führer wegen, die ihn nicht allein mit mir hatten gehen lassen wollen. Obgleich es schon 2 Uhr nachmittags war, so erklärte er sich auch mit dem Abstieg auf der Morteratschseite einverstanden, nur eines sei notwendig, daß der Gletscher noch vor Einbruch der Nacht überschritten werde. So stürmten wir den Hang hinunter, dann aber kam eine steile Moräne, deren angewehte Schneemassen beinahe unüberwindlich waren und uns alle Kraft aus den Gliedern sogen. Es wurde 4 Uhr, bis wir die Höhe der Isola Pers erreichten, und schon begann die Dämmerung einzubrechen. Wir versuchten jetzt wenigstens noch bei Tag den Einstieg auf den Morteratschgletscher zu finden, aber auch dazu reichte es nicht mehr. Der Schnee wurde immer tiefer, die Ermattung immer größer, vierzehn Stunden schon hatte der Marsch gedauert, und was noch kam, war gar nicht abzusehen.
Es war ein feierlich ernster Moment, als wir uns bei dem trüben Schein unserer Laterne in der grimmen Kälte halb tot hinsetzten und den Dingen ihren Lauf ließen. Tief unter uns lag der wild zerklüftete Gletscher in dem bläulichgrauen Scheine der Nacht, mit seinen zahllosen Spalten, einem Untier gleich, das grinsend auf seine Opfer wartete. Darüber stiegen die dunkeln Gebirgsmassen in gespenstige Nebel hinein. Eis ringsum, nichts als fahles, kaltes Eis! Dazu eine tiefe Stille. Nur hin und wieder hörte man das dröhnende Getöse abstürzender Gletschermassen und einen leisen klagenden Wind.
Unsere Lage war keine einfache. Ohne ein Wort zu sagen, saß Groß da und starrte vor sich hin, während ich eine Art grimmer Freude empfand. Wenn ich am Schwarzhorn in meinem Lebensüberdruß den Dingen eine Zeitlang ihren Lauf gelassen hatte, so war das jetzt anders. In wildem Trotz freute ich mich auf den Kampf, den der nächtliche Gang über den Gletscher dort unten bringen mußte, und eine fatalistische Gewißheit sagte mir, daß mir nichts zustoßen könne.
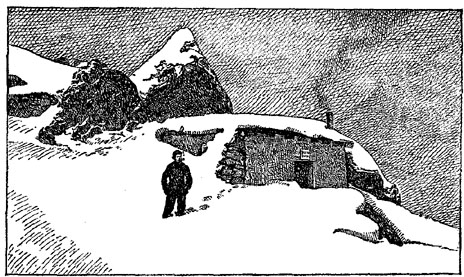
Bovalhütte.
Es war der großartigste, wildeste Marsch, den ich je gemacht habe. An dem Gletscherrand angekommen, hoben sich die zerklüfteten, fahlen Eismassen scheinbar haushoch in die dunkle Nacht hinein, und tückisch grinsten neben ihnen die halbverschneiten, breiten Spalten. Daß da nirgends ein sicherer Boden war, war klar. Aber wir machten keine Umstände. Groß ließ mich voraus. Er meinte, er bringe mich besser aus einer Spalte heraus, als ich ihn. Ohne Besinnen hackte ich mich in die Höhe. Dann versuchten wir eine Zeitlang, uns im Zickzack durch das nur schwer erkennbare Gewirr hindurchzuwinden. Aber in der rabenschwarzen Finsternis konnten wir uns so nur verirren und kamen niemals ans Ziel. Also gerade drauf los! Wo ich mit dem sondierenden Pickel eine Spalte vermutete, wurde einfach gesprungen, gleichgültig wo und wie ich jenseits landete. Es war ein Sprung nach dem andern in das dunkle Nichts hinein, oft von beinahe übernatürlicher Weite und immer wieder rief Groß: »Jesses, Jesses, ich hab halt zu viel Courage!«
3½ Stunden dauerte es, bis wir uns durch das Labyrinth der phantastischen Eisgestalten und trügerischen Klüfte zum jenseitigen Gletscherrand hindurchgekämpft hatten, und erst nach einer weiteren Stunde tiefsten Schneewatens erreichten wir die ersehnte Bovalhütte. Wir waren 19 Stunden unterwegs gewesen und hatten 5 Stunden zu dem letzten Teil des Marsches gebraucht, den man sonst in 1 Stunde zurücklegt. Eine kalte Nacht folgte, aber als wir am andern Morgen nach Pontresina hinunterstiegen, war mir, als komme ich in eine neue Welt hinein.
Wenn mir in Herz und Ohren
Der Menschen Jammer gellt,
Wenn ich mich selbst verloren
Im Kampfgewühl der Welt,
Wenn an der Freude Särgen
Die Wehmut mich beschlich,
Dann zieh ich nach den Bergen
Und droben find' ich mich.
R. Baumbach
Droben find' ich mich! Vergessen machen können die Berge natürlich nicht, aber sie können mildern, läutern, heben, bis zu einem gewissen Grad auch neue Wege weisen. Schon der Kampf mit ihnen betäubt und lenkt ab, die überschießende Energie erhält neue Ziele, und man wird sich seiner Kraft wieder bewußt. Auch der Verkehr mit dem All und seinen Wundern stärkt und versöhnt. Was haben die Leiden eines kleinen Menschleins in dieser unermeßlichen Schöpfung zu sagen, die mit so riesenhaften Maßstäben rechnet!
Und dieser ganze, wildverworrene Traum soll Leben heißen! War es nicht Wahnwitz, sich so zu verlieren, immer verzweifelter um ein vermeintliches Glück zu kämpfen, von dem man doch fühlt, wie es langsam und sicher verschwindet? Wo blieb denn da meine gepriesene Philosophie, mit der ich mich so sehr abgemüht, die mich über all das hatte stellen, vor Enttäuschungen hatte bewahren sollen? Wenn ich so scheiterte!
Aber war das denn ein Scheitern? War es nicht gerade höchstes intensivstes Leben? Was bedeutete denn demgegenüber das bischen Dasein vorher mit all seinen Kleinigkeiten und Nichtigkeiten? Alltag, trauriger Alltag! Während hier das Blut wirklich durch die Adern geströmt war, alle Sinne sich gespannt hatten, der ganze Mensch ein anderer war, höher, gehobener!
Wohl hatte ich ja manches dabei ausgestanden und dieses Gehobensein teuer bezahlt. Aber hatte nicht auch das sein Gutes, bedeutete es nicht einen weiten Fortschritt gegenüber dem früheren Verstandesleben? Ja, alter Epiktet, wie sehr hast du das Leben verkannt, während mir eine neue, ahnungsvolle Welt sich aufgetan, die des Fühlens und Mitempfindens! Die wohl nicht auf so festen Füßen steht, wie der einseitige, kurze Verstand sich das einbildet in seinem dünkelhaften Wahn, die aber darum auch viel tiefer geht, noch ganz andere Zusammenhänge bloßlegt und darum auch so unermeßlich viel umfassender ist. Nein, es war Zeit gewesen, daß ich einmal tüchtig geschüttelt wurde, und es sollte nicht umsonst geschehen sein. Ich konnte jetzt weiter schreiten. Freilich, das Ziel zeigte sich nur ganz allmählich und auf Umwegen.
Doch kehren wir wieder zu meiner Reise zurück! Ich hatte zunächst einige hübsche sportsreiche Tage in St. Moritz, während deren ich auch meinen Humor wiederfand. Eine prächtige Rodelfahrt über den Julier und ein Spaziergang durch die verschneite Via Mala folgten, und zum Schluß kam eine Schlittschuhfahrt auf dem Züricher See, der spiegelglatt gefroren war. Ich war im dichten Nebel zunächst 8 Kilometer weit am rechten Seeufer entlang gefahren und hatte dann den See neben der Dampfschiffbahn durchquert, die eine breite Schollenspur zurückgelassen hatte. Dann wurde ich gewarnt, noch niemand sei den See weiter hinuntergefahren, dessen unterer Teil noch offen sei. Nun, das mußte sich ja zeigen. Eine Zeitlang ging es gut, dann kamen Risse, ein beständiges Krachen begleitete mich, und nur eine rasend schnelle Fahrt konnte mich vor dem Einbrechen schützen, weiter, nur weiter! Schließlich tauchte eine dunkle Fläche aus dem Nebel vor mir auf. Sie ließ den offenen See erkennen, und es war jetzt wirklich die höchste Zeit, in weitem Bogen durch das Schilf ans Land zu fahren, nachdem die Fahrt mich 18 Kilometer weit gebracht hatte.
Als ich dann wieder nach Hause kam, trat auch bald in meinen äußeren Verhältnissen eine bedeutsame Veränderung ein, indem ich auf ein Jahr nach Berlin kam. Es war eine recht arbeitsame, für mein ganzes Berufsleben sehr erfolgreiche, daneben aber auch ziemlich wilde Zeit, so eine Art zweiter Sturm- und Drangperiode. Im übrigen konnte auch darin ein Rückschlag nicht ausbleiben, und so sah mich das folgende Weihnachtsfest wiederum in den Bergen, und zwar zum drittenmal in der Hohen Tatra.
Es war eine Art zahmer Wiederholung der Engadiner Reise, die erst zum Schluß wieder gewaltsamere Formen annahm. Zunächst wollte ich der Erinnerung an die schönen früheren Tatrazeiten leben und begab mich für nahezu eine Woche zu meinem Waldhüter am Czorbersee, der mich recht gastfreundlich aufnahm, mir sogar für ein Villenzimmer sorgte, das kurz zuvor ein Gemsen jagender Erzherzog bewohnt hatte. Ganz frisch war das Bett ja allerdings nicht mehr, aber immerhin besser als dasjenige, das mir seinerzeit in Neumarkt angeboten worden war. Auch wußte ich immerhin die Ehre eines solchen erzherzoglichen Lagers zu würdigen, zumal mir noch in späterem Einvernehmen mit dem Besitzer einige Flaschen feurigen Ungarweins kredenzt wurden. So zog ich also Tag für Tag hinaus in die prächtigen verschneiten Wälder, kletterte auf die Patriaspitze, Bastei und Osterva, besuchte den Poppersee mit der abgebrannten Ruine der Majlathütte, lauerte den zahlreichen Gemsen auf, die sich einmal sogar mit dem Stativapparat photographieren ließen, während mein Erzherzog keine einzige erlegt hatte, und genoß überaus prächtige Blicke auf die winterliche Gebirgslandschaft. Da möchte ich eines merkwürdigen Naturschauspiels gedenken. Ich war an einem nächtlichen Morgen schon ziemlich hoch gestiegen. Es begann zu dämmern, die Sterne verblaßten, und die sich senkenden Nebel bildeten ein dickes Wolkenmeer über der Ebene, während sich dort das eisige Gebirge mächtig erhob. Langsam erwachte die frierende Landschaft. Es war die Zeit des Erwartens. Da brachen plötzlich rote Streifen durch das Wolkenmeer unter mir hindurch und zerteilten die Nebel. Ich dachte erst, es sei der Wiederschein der Sonne, aber dann wurde mir klar, daß es der Feuerball selbst war, der unterhalb des Wolkenhorizonts aufgegangen. Sonnenaufgang in der Tiefe! Wie hoch oben man sich da vorkam in der eisigen Winterwelt!
Auch der beträchtlichen Abende in der einsamen Villa unter den mächtigen, verschneiten Tannen möchte ich gedenken, die insbesondere am Weihnachtsfest so viel Gelegenheit zu Gedanken aller Art wie zur Selbsteinkehr boten.
O Winterwaldnacht, stumm und hehr
Mit deinen eisumglänzten Zweigen,
Lautlos und pfadlos, schneelastschwer –
Wie ist das groß, dein stolzes Schweigen!

Lomnitzerspitze
Mit einemmal kam dann die alte Energie wieder zum Durchbruch und die Sehnsucht nach oben. Ich ging nach Schmecks, suchte Horway auf, und wir erstiegen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Lomnitzer- und Eistalerspitze (2634 bzw. 2630 m), beides erste Winterbesteigungen, die nicht geringe Arbeit verlangten.

Auf dem Gipfel der Lomnitzerspitze
Bei der Lomnitzerspitze kamen wir zunächst verhältnismäßig leicht auf den Südkamm, dann aber begann eine bedenkliche Kletterei, die wir nur im Vertrauen auf unsere gegenseitige Zuverlässigkeit wagen konnten, bei der wir aber mit einer herrlichen Aussicht belohnt wurden. Anders bei der Eistalerspitze, hier schien sich alles gegen uns verschworen zu haben: Der weiche, tiefe Schnee, ein furchtbarer Sturm und Schneetreiben, das oft den Himmel völlig verfinsterte, und schwierigste, vereiste Felsen. Zum Schluß noch die Überwindung des vereisten »Steinernen Rosses« im tollsten Wintersturm und Schneegestöber. Wir brauchten eine gute Stunde, um die etwa 100 Fuß lange Strecke, einen tief verschneiten Felsgrat mit Zacken und Scharten rittlings zu überschreiten. Aber wir ließen nicht nach, obgleich wir auf dem Gipfel in dem grausigen Unwetter kaum die Augen öffnen und die Hand vor dem Gesicht sehen konnten. Grimmig, mit halberfrorenen Gliedern kämpften wir uns dann wieder zurück und hatten endlich noch eine aufregende Rutschpartie, die wieder einmal besser endete, als wir es verdienten. Und doch war die Tour schön gewesen, so wenig wir gesehen außer tobendem Sturm, treibenden Nebeln, gespenstigen Felsgestalten und wirbelnden Schneemassen. Auch in den Bergen hat das heroische eben seine eigene Anziehungskraft und ist oft mehr wert, als die reizvollste Romantik.
Als dann im Frühjahr meine Berliner Zeit zu Ende war, setzte ich mich auf mein Rößlein und ritt südwärts, bis ich die telegraphische Nachricht erhielt, daß ich wohlbestallter Kompagniechef in der mir sehr genehmen Hauptstadt geworden war.
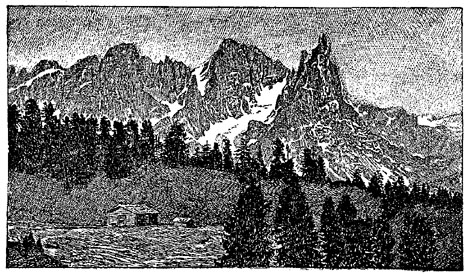
Die Paladolomiten vom Lusiapaß.
Schon bei meiner ersten Winterreise in die hohe Tatra im Jahre 1884 hatte ich es lebhaft bedauert, daß ich die einzigen Eindrücke der großartigen Winterlandschaft nicht auf irgendeine Weise festhalten konnte, sie sich auch allmählich wieder verflüchtigen mußten in der vergeßlichen Erinnerung, wie so manches andere Schöne und Eigenartige. Das brachte mich auf den Gedanken, mich der Lichtbildkunst in die Arme zu werfen, die gerade damals durch die Erfindung der Trockenplatten einen Aufschwung nahm und auch Aufnahmen außerhalb des Ateliers ermöglichte. So einfach wie heutzutage war das nun allerdings nicht. Amateurphotographen gab es eigentlich überhaupt noch keine, und die Schwierigkeiten waren gerade bei der Hochgebirgsphotographie enorme. Aber das reizte nur, und ich freute mich höchlichst, daß hier Erfindungsgabe und Bastelei noch etwas leisten konnten. Was ich dabei alles durchzumachen hatte, läßt sich kaum beschreiben, aber meine Begeisterung wuchs ins Grenzenlose. Erst habe ich mich mit dem unerträglichen Gewicht zahlreicher Glasplatten so lange abgeschleppt, bis ich einen Plattfuß weg hatte, dann arbeitete ich mich durch Negativpavier, Strippingfilms und Gelatinefilms hindurch, die, abgesehen von allerhand Unvollkommenheiten jedes Jahr wieder eine andere Empfindlichkeit hatten und konstruierte mir zahlreiche Apparate, was man sich heute fertig im Laden kauft, das mußte man alles erst erfinden, konstruieren und unter vielen Umständen und Kosten herstellen lassen, um dann nach der nächsten Reise, die neue Gesichtspunkte brachte, wieder von vorne anzufangen. Viel unterhaltsame Anregung erhielt ich mit der Zeit auch in einem selbstgegründeten Amateurklub, der bald eine Anzahl Mitglieder zählte und in dem einer den anderen in Geschick, Erfahrung und praktischen Erfindungen zu überbieten suchte. Und dann dieser Eifer draußen bei der Aufnahme! Ich kann wohl sagen, daß es auf der ganzen Welt nichts gab, das mich abgehalten hätte, eine stimmungsvolle Hochgebirgsphotographie zu machen. Ich habe oft tagelang unter den schwierigsten Verhältnissen auf ein Bild gewartet, das ich in entsprechender Beleuchtung haben wollte. Mit der Zeit vervollkommnete ich mich dann auch. Das Hauptergebnis dieser ganzen Tätigkeit lag aber weniger in den verschiedenen tausend Negativen, die ich mir allmählich ansammelte, als darin, daß ich sehen lernte. Zunächst allerdings nur photographisch. Das mag ja nun manchem wenig genug dünken, zumal der Photograph nur mit Schwarz und Weiß arbeitet und ihm, damals wenigstens, die Farbenpracht fehlte. Einen künstlerischen Vorteil hatte das aber doch: die Konzentration. Wie oft kann man beobachten, daß der Maler in seinem Farbenrausch recht »genial« ist, das heißt, sich mit einer »Farbensymphonie« begnügt, bei der die dargestellten Dinge, so hübsch sie an sich gemalt sein mögen, einfach auseinanderfalten, so daß man die »Studie« unmöglich als ein »Bild« ansprechen kann. Demgegenüber muß sich der Photograph in der Komposition von Linien, Licht und Schatten ganz anders konzentrieren. Nun kann es mir natürlich nicht einfallen, die Photographie als Kunst neben die Malerei stellen, sie überhaupt als Kunst im strengen Sinne, zu der sie höchstens einige Ansätze zeigt, ausgeben zu wollen. Wohl aber kann sie das Kunstempfinden fördern und in ihrer ganzen Auffassung künstlerisch sehen lehren. Jawohl Auffassung, denn eine solche hat auch die Photographie. Zwei Photographen werden von demselben Gegenstand niemals dasselbe Bild machen, ein jeder hat seine charakteristische Eigenart, und der Kenner kann z. B. die bekannteren Hochgebirgslichtbildner in der Wahl ihrer Gegenstände, dem Arrangement, der ganzen Auffassung und der Technik der Ausführung ohne weiteres erkennen und voneinander unterscheiden. Auch die Photographie ermöglicht es eben, daß in alledem der Geist und das Wesen ihres Urhebers zum Ausdruck kommen.
Wenn ich somit äußerlich einen Anhalt hatte, einigermaßen künstlerische Wege zu gehen, so kamen dem auch die bei meinem Liebestraum gemachten Erfahrungen entgegen, die mich für Gefühlswerte empfänglicher gemacht hatten. Endlich fand ich dabei einen Ersatz für mein aufgegebenes Studium. Die Tatsache, »daß wir nichts wissen können«, machte mich empfänglicher für die Welt, die sich nicht mit dem Verstand abgibt, die mit ihrem Ahnen noch viel tiefere Zusammenhänge erschließt, Werte, Erlebnisse und Offenbarungen schafft, als es das bißchen Gehirn in seiner logischen Einseitigkeit und Kausalitätsbeschränkung je vermag. »So ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen!« Also der Boden war jetzt für das künstlerische Empfinden geebnet. Meine Kunst aber wurde nicht etwa die Photographie, sondern der Alpinismus.
Der Alpinismus als Kunst!
Leonhard hat einst in einer Schrift, »Zur Stellung und Würdigung des Alpinismus«, gestützt auf Kant, nachgewiesen, daß der Alpinismus seiner wahren Natur nach ästhetischer Art und als eine besondere Kunstgattung anzusehen sei. Er geht sogar noch weiter und erklärt, daß zwei Umstände ihn über alle anderen Künste erheben. Einmal weil er sich an den Urquell jeder Kunst, die Natur wende, die stets der Jungbrunnen ist, aus dem der wahre Künstler schöpft, die ihn gegen alle Verirrungen immer wieder schützt. Ferner zeichne er sich dadurch aus, daß bei ihm jeder einzelne ein schaffender Künstler sei. »Hier gibt es keine nur rezeptiven Kunstfreunde, hier ist der ästhetische Genuß eines jeden einzelnen eigenstes Werk, durch eigene Kraft und Arbeit erworben und errungen. Der Bergsteiger teilt die ästhetischen Empfindungen eines Komponisten, der sein eigenes Werk hört. Was jede andere Kunst immer nur einzelnen Bevorzugten gewährt, das bietet der Alpinismus allen seinen Jüngern.«
Es verlohnt sich, etwas näher darauf einzugehen.
Wenn die Kunst das Ahnen des Unendlichen, das Herausfühlen des Ewigen aus den Dingen ist, so kann der Alpinist sich dieses Gefühl allerdings in besonderem Maße verschaffen, wenn er das nur will und sein Herz dafür empfänglich ist. Daß die Natur an sich schon eine beruhigende, befreiende und läuternde Kraft hat, unsere Seele erhebt, wer wollte es bestreiten! Wieviel mehr und intensiver aber ist das für den Empfänglichen beim Hochgebirge der Fall, in dieser geheimnisvollen Welt des Erhabenen, die unwillkürlich Ehrfurcht und heilige Schauer erweckt! Es ist gewiß nicht nur ein Zufall, daß den Naturvölkern die Berge als Heiligtümer erschienen, daß Moses und Elias auf den Höhen die Gottheit, also das Ewige, suchten, daß der Erlöser selbst hinaufging auf einen Berg, um zu beten. Die Stille dort oben, die Weite und Größe, ebenso wie das Walten unerhörter Mächte lösen Gefühle in uns aus, die weit über Menschenwitz und Verstand gehen. Mag man nun Panteist sein oder nicht, mag man glauben, daß die Welt die Gottheit selbst ist, oder daß diese sie von außen her umfaßt und durchdringt, Tatsache ist, daß ein jeder, dem Übersinnlichen auch nur halbwegs zugängliche Mensch dort oben »das Gefühl eines geheimnisvollen Empfangens« verspürt, ein Anklingen von Kräften, die er auch in sich selbst als die höchsten und edelsten empfindet, mit einem Wort; etwas vom Zusammenhang dieser Welt und ihrer Größe.
Am präzisesten gibt Falke diesem Gefühl in seinem Jungfraubuch Ausdruck. »Die Berge zeigen uns den Takt der Weltenuhr, den langsamen, erhabenen Rhythmus des Anorganischen, der jenseits aller Lust und Qual eines fühlenden Herzens, tief unter dem wechselvollen Traum eitler Menschenwünsche in unbeirrbarer Gesetzmäßigkeit vor sich geht. Das ist es, was beim Anblick der Berge so unbegreiflich beruhigend wirkt. – Die übermächtige Natur läßt uns leise in ihr Sinnen hineingleiten, man fühlt den schmerzlosen Untergrund des Unbewußten, dem wir entstammen und zu dem wir einst wieder zurückkehren. Eine tiefe Sehnsucht ergreift uns, unsern nervösen Herzschlag am Busen der Allmutter wieder mit dem ihrigen in Einklang zu bringen.«
Byron sind deshalb »hohe Berge ein Gefühl«.
»Auf Felsen sitzen, über Fluten träumen,
Still sich ergehn auf schatt'gem Waldespfad,
In nie von Menschen noch beherrschten Räumen,
Die selten, nie ein Sterblicher betrat,
Erklimmen einsam des Gebirges Grat,
Am Abgrund stehn, am schäum'gen Wasserbad,
Das ist nicht Einsamkeit, das heißt sich tauchen
In die Natur, die Seel in ihre Seele hauchen.«
Sind solche Weihestunden, ein solches Heimfinden zum All nun Kunst oder nicht, oder sagen wir wenigstens Kunstgefühl? Mag man darüber denken, wie man will; ich kann nur sagen, daß ich sie so empfinden lernte und glücklich bin, daß meine Seele im Gebirge in solche Berührung mit dem Übersinnlichen kommt, in ein Ahnen unfaßbarer und unbegreifbarer Zusammenhänge, wie es sonst nur der Religion und Kunst eigen ist, ein Ahnen, das mir oft genug eine Offenbarung und ein lebendiges Erlebnis bedeutete. Ich muß nun allerdings sagen, daß ich es meist mehr als Religion, denn als Kunst empfand. Doch was hat da der Name zu sagen!
»Nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott,
Gefühl ist alles, umnebelnd Himmelsglut.«
Jedenfalls halte ich dieses Gefühl für das weitaus Höchste, was der Alpinismus zu geben hat.
Man hat viel darüber geschrieben und alles Mögliche daraus abgeleitet, daß der Alpinismus ein Sport sei. Gewiß kann er auch das sein, und kein Verständiger wird zum Beispiel einen jungen Alpinisten tadeln, der das Klettern als Sport betreibt. Es ist eine Lust, ja mehr noch ein Glück, einen gesunden, kräftigen und leistungsfähigen Körper zu haben. Es ist auch eine Lust, ihn im Wettkampf in geregelten Normen zu üben. Die Hauptsache ist das aber nicht, höchstens ein Mittel zur Erreichung höherer Ziele, und man könnte zum Beispiel ebensogut sagen, der Alpinismus sei die Grundlage für geologische, geographische oder andere Studien, die ja im übrigen auch ihre Gefühlswerte haben Können. Kehren wir also wieder zur Hauptsache zurück, daß sich nämlich das Sehen zum ahnungsvollen, künstlerischen Schauen und Empfinden erweitert. Es ist dies ein Schritt, dem eine bedeutsame seelische Tätigkeit innewohnt. Bekanntlich sieht der Bergbewohner nur, das heißt er beobachtet eine Unmasse von Detail, das dem Flachländer meist völlig entgeht, das er aber nicht innerlich verarbeitet. Nach Rosegger »erfaßt er nur die einzelnen Objekte und setzt sie zu seinem Leben wesentlich unter dem Gesichtspunkt des persönlichen Nutzens oder Schadens in Beziehung. Ebenso beschäftigt sich auch die Volkspoesie nur mit den praktischen Seiten der Berge. Der Hirt besingt die grünen Matten, der Holzhauer den dunkeln Wald, der Gemsjäger den schroffen Felsenschrund. Die Schönheit an sich entwickelt sich erst in der Gegensätzlichkeit. Dem Gebirgskind wird's bekanntlich erst im Flachland bewußt, wie sehr es die Berge liebt.«
Anders beim Schauen, wo es darauf ankommt, die Stimmungsimpressionen der Landschaft aufzusuchen, sie seelisch und gefühlsmäßig auszulösen, zu vertiefen, in ihrem Ewigkeitszusammenhang und ihren Harmonien zu ahnen. Dies ist um so schwieriger, als die Natur nicht wie der Künstler auf ein ästhetisches Ziel hinarbeitet und das Nebeneinander ihres Reichtums unbegrenzt ist. Sie läßt alles unbestimmt, es wohnt ihr keine künstlerische Absicht inne, und eigentlich können wir auch keine solche aus ihr herauslesen. Tun wir das doch, und als Künstler sollen und wollen wir es, so legen wir in Wahrheit Ewigkeitsgefühle in sie hinein, die wir dem eigenen Innern entnehmen. »Ich mache diese wunderbare Reise, um mich selbst an den Dingen kennen zu lernen,« sagt Goethe. Wie weit das oft geht, zeigt unter anderem Lammer, dem unablässig »seine Verwandtschaft mit den tausend Einzelerscheinungen«, z. B. ganz bestimmten Blumen, zum Bewußtsein kommt. »Jener flüchtige Sonnenblitz im wallenden Nebelrauch, der das einsame Hüttchen oder jenen Serac so wunderseltsam verklärt, läßt neue oder wieder uralte heimatliche Gefühle in mir aufklingen, jene Lawine spricht zu mir in verständlichster Sprache, nur kann ich alle diese Dinge, die ich sehr individuell und klar empfinde, nicht entsprechend ausdrücken.« Also:
»Mit Worten läßt sich's erschildern nicht
Und nicht mit Farben ermalen;
Mich dünkt so purpurgetempert und licht
Muß das heilige Land erstrahlen.«
Scheffel.
Die Frage, wie wir sehen sollen, beantwortet sich danach: mit offenem Herzen sollen wir aufnehmen, was am meisten in uns anklingt, sollen der innern Stimme liebevoll folgen, wenn sie sich ihr ahnungsvolles Gebäude aufbaut, sollen uns mit dem »unendlich beseligenden Unterton« begnügen, daß wir uns in diesen Stimmungen eins mit der Größe dort draußen fühlen, vernunftgemäß begreifen und fassen können und sollen wir es nicht. Wollen wir das doch, so eröffnen sich sofort wieder die Abgründe des Verstandes, der sich zu solchen Höhen nicht emporschwingen kann und alles Große zu sich herunterzerrt, dem sich die ewig verschlossene Pforte am allerwenigsten öffnet. Und wenn der eine meint, »daß eine Welt, die so viel Schönheit berge, nicht ohne einen großen Plan sein könne,« so betont der andere »die harte Brutalität und Erbarmungslosigkeit, mit der die Natur gerade dort oben alles Leben zertritt«, die »göttliche Zwecklosigkeit der Alpenwüste«.
Was nun mich betrifft, so waren mir die Berge jetzt bald nicht mehr bloß Gegner, mit denen ich kämpfte. Sie wurden mir Freunde, einzelne so sehr, daß ich immer wieder zu ihnen zurückkehrte, immer neue und tiefere Anregung von ihnen erhielt. Was mich anzog, war vor allem Größe, Kühnheit und Wildheit, kurz das eigentlich Hochgebirgsmäßige und Alpine. Ebenso liebte ich Wolken und Sturm. Der Blick in zerfetzte Nebelgebilde, die in mächtigen Kesseln lagern und an den steilen, zerrissenen Hängen hinaufragen, war mir stets eine Wonne, und eine schwere, dunkle Gewitterwolke, die einen Berg umarmte, ihn bald frei ließ, bald ganz einhüllte, sagte mir außerordentlich viel.
Auch die Bedeutung des äußeren Aufputzes lernte ich schätzen. Gibt es doch viele Berge, welche erst durch seinen Reichtum, durch wechselvolle Schnee- und Eismassen und ihre merkwürdigen, der Schwerkraft scheinbar oft völlig hohnsprechenden Gebilde, durch abenteuerliche Felsformen und eindrucksvolle Steilwände ihren wahren Schönheitscharakter erhalten, wenn zum Beispiel die Jungfrau wohl eine in ihrer Art schöne pyramidale Gipfelform zeigt, so sind es doch erst die prächtigen vorgelagerten Silberhörner mit ihrer abenteuerlichen Gletscherzerklüftung, die den Berg zu einem so wunderbar erhabenen, wechselreichen Gebilde machen.
Überhaupt das Detail! Zacken, Klüfte, Grate, Seracs, Spalten, Wächten und was es sonst noch gibt! Ich muß sagen, daß sie mir meist mehr bedeuteten, als die Berge selbst, hauchen doch diese riesenhaften Kleinigkeiten dem Ganzen erst wirklich Leben und Charakter ein und lassen uns seine ungeheuerliche Größe fühlen, umwoben von ihrem romantischen Schimmer, welche kaum faßbaren Wunder erlebt man da z. B. bei einer Besteigung des Matterhorns auf der Südseite, auf dem zerklüfteten Grat des Cimone oder den ungeheuren Gipfelblöcken des Crozzon! Die Details sind mir auch lieber, als der Fernblick vom Gipfel, der wohl eine unermeßliche Weite im Herzen eröffnet, ein Entrücktsein aus der Welt, mit seiner verflachenden Ballonperspektive auf die Dauer aber leicht monoton und verwirrend wirkt. Wenn nicht ein Wolkenmeer mit seinen hervorstehenden Inselzacken seine abgeklärte Ruhe darüber breitet, oder Sturmwolken und Schneegestöber ihm dramatisches Leben einhauchen. Besonders viel sagt mir auch der Blick vom Vorland auf das ferne Gebirge, das mit seinem eisigen Zackengewirre über der grünen Ebene so märchenhaft anmutet, beinahe wie ein besseres, unerreichbares Jenseits, dem unsere ganze Menschensehnsucht entgegenpocht.
Nicht vergessen möchte ich endlich die heldenhafte Geschichte, die oft einem Berg die Wucht eines historischen Hintergrundes und mit ihren heißen Bemühungen, Hoffnungen, Enttäuschungen und Schicksalsschlägen so manche kalte Örtlichkeit mit dem Zauber der Menschlichkeit umwebt und erwärmt.
Einige sportliche Einschränkungen mußten bei dieser Art künstlerisch-photographischen Alpinismus, der ich mich mehr und mehr ergab, naturgemäß in den Kauf genommen werden. Das Betrachten und Sinnieren hält ja an sich schon auf, das photographieren natürlich noch viel mehr. Auch brachte die Tatsache, daß ich meist zwei Apparate, darunter einen größten Formats mit mir führte, es mit sich, daß ich meist mit Führern gehen mußte. In gewissem Sinne bedauerte ich das manchmal und empfand es als seelisch störend und die Unternehmungslust hemmend, aber die lebhafte, präzise Erinnerung, die meine Photographien in Stimmung und Erleben immer wieder in mir erwecken, sind mir doch wesentlich mehr wert, als manches vielleicht verpatzte Abenteuer oder gar dieser oder jener nicht bestiegene Gipfel. »Man mueß nit überall g'wesen sein!« sagte mein Freund Stabeler einmal sehr treffend. Im übrigen sorgten mein Naturell und Temperament schon dafür, daß es auch in Zukunft nicht gar zu zahm zuging. Es entwickelte sich vielmehr eine Mischung von Unternehmungslust und Naturschwärmerei, bei der alles zu seinem Rechte kam, die mein ganzes Wesen vertiefte und mich jedenfalls so befriedigte, wie ich es andern nur wünschen kann.
| Rosetta | Pala | Ball | Saß Maor |
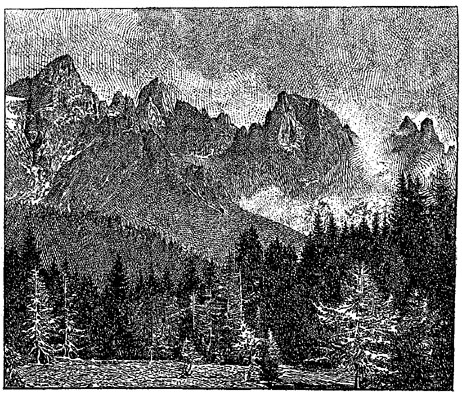
Die südliche Palagruppe.
Es war ein Zufall, der mich 1892 in das Gebiet der Pala-Dolomiten führte. Ich hatte eine Photographie des Timone della Pala in die Hände bekommen, die mich so entzückte, daß ich beschloß, mir diesen Berg, der es mir beim ersten Blick angetan hatte, näher anzusehen. Dieser Entschluß war vor allem in photographischer Hinsicht ein äußerst glücklicher und hat mir sehr viel Anregung gegeben. Wenn die Dolomiten an sich schon vortreffliche und verhältnismäßig leicht zu meisternde Objekte der Lichtbildnerei sind, so zeigt die Palagruppe mit ihren vielgestaltigen Felsen, den häufigen malerischen Wolkenbildungen, die ihnen ein so eigenes Leben einhauchen, und dem südlichen Charakter der ganzen Landschaft besonders pittoreske Formen. Es war eine Lust, sich da seine Bilder zu suchen, oder vielmehr dieselben drängten sich mir in einer Weise auf, wie ich es kaum irgendwo gefunden habe. Auch sonst traf ich es recht gut in dem komfortabeln Hotel von San Martino di Castrozza, wo ich eine recht sympathische Gesellschaft vorfand. Auf meinen Touren ging ich teils allein, teils in Begleitung des trefflichen Michele Bettega, eines Prachtkerls und erstklassigen Führers, der mit leidenschaftlicher südlicher Lebhaftigkeit die größte Harmlosigkeit und Gutmütigkeit verband. Ich habe dabei vor allem mehrmals den Timone bestiegen, die Vezzana, Pala di San Martino und später den hochinteressanten Saß Maor, mich auch vergeblich an der Cima di Ball abgemüht, wo ich mich bei einer Alleinkletterei gründlich verstieg. Zu erwähnen ist dabei weiter nicht viel, und ich möchte nur auf einige der Eindrücke eingehen, die besonders hafteten.
Da wurde vor allem der Cimone della Pala geradezu eine Wunderwelt für mich. Man hat den Berg auch das Matterhorn der Dolomiten genannt, und wenn man ihn vom Rollepaß aus betrachtet, so ist eine gewisse Ähnlichkeit unverkennbar. Nur ist der ganze Aufbau ein spitzerer, mehr nadelartiger, und die Blöcke, aus denen er von Zyklopenhänden zusammengesetzt zu sein scheint, geben ihm wohl einen größeren Reichtum, nehmen ihm aber auch die Wucht des aus einem Gusse aufgebauten Zermatter Riesen; es herrscht nicht jene eherne Ruhe über ihm, aber er ist dafür lebendiger. Ich will dabei nicht weiter davon reden, daß man in dem zweiten mächtigen Block rechts unterhalb des Gipfels ein regelrechtes Bärengesicht erkennen kann, denn ich gehöre nicht zu den Leuten, die überall Gesichter sehen und wurde erst später von anderer Seite darauf aufmerksam gemacht. Mir war das Leben interessanter, das die prachtvolle Wolkenbildung der von Süden anrückenden Nebelbank dem Berg verlieh, als ich ihn zum erstenmal sah. Wie das huschte und hin und her wogte, ihn bald geisterhaft verdeckte, bald in seiner ganzen Wucht und Größe aus den grünen Matten hervortreten ließ! Ein Schauspiel ohnegleichen! Ich rannte wie ein Verrückter, bebenden Herzens, ob ich noch rechtzeitig einen geeigneten Standpunkt für eine Aufnahme finden würde. Ich hätte mich nicht so zu beeilen brauchen, denn wie sich bald herausstellte, ist diese Wolkenbildung eine charakteristische Eigentümlichkeit des Berges, die sich beinahe täglich wiederholt, und schon 22 Jahre vorher schrieb der erste Besteiger: »Ich hatte einen der schönsten Anblicke, die ich je gesehen. Der höhere Teil des Berges war allein sichtbar und umgeben von einem Kranz von Nebeln, der ihm das herrlichste Aussehen gab, das man sich nur denken kann.«
Wie ganz anders nun nimmt sich der Berg von dem Gipfel der benachbarten Rosetta aus! Sollte man glauben, es mit demselben Berg zu tun zu haben? Eine riesenhafte Felswand erhebt sich hier wiederum aus den Nebeln, die so ganz anders geartet ist, als die spitze Nadel vom Rollepaß. Der Berg bietet uns hier seine Breitseite dar, und der Vergleich der beiden Bilder läßt erkennen, wie scharf der Grad dort oben sein muß, der so senkrecht zu beiden Seiten abfällt. Man beachte auch die gigantische Linienführung, in welcher die Riesenwand nach links, dem Rollepatz zu abfällt. Wieder ein ander Bild! Wir haben unsern Berg von dem ihn umgebenden Hochplateau aus vor Augen. Hebt er sich da nicht wie eine luftige Burg mit Zacken und Türmen und vorgelagerten trotzigen Bastionen in die Lüfte, oder wie ein riesenhaftes verwunschenes Zauberschloß, dessen Umgebung zu Stein erstarrt ist? Wie klein erscheint daneben das Menschenbauwerk der Rosettahütte an seinem Fuß, welche riesenhafte Bewohner kann man sich dort hinaufdenken!
Ich möchte hier noch etwas näher auf die Bedeutung der Größenverhältnisse eingehen. Wenn der Alpinismus das Ahnen des Unendlichen fördert, so hat er noch den Vorzug, daß er uns dieses Unendliche gewissermaßen greifbar vor Augen stellt und uns damit einen Größenmaßstab gibt, den wir sonst nirgends finden. Wohl herrschen am gestirnten Himmel noch ganz andere Größenverhältnisse, aber Leßlie Stephen hat recht, wenn er von den zehnstelligen Zahlen der Astronomen sagt: »Du meine Güte, auf ein paar Nullen mehr oder weniger kommt's da gar nicht mehr an, man versteht sie ja doch nicht.« Die Größenverhältnisse des Gebirges aber sind dem Alpinisten noch faßbar und verständlich. Sie geben ihm einen Maßstab, der die Seele für das Unermeßliche vorbereitet und empfänglich macht und »lehren ihn damit eine Sprache, welche sich dem gewöhnlichen Menschen nur zum Teil offenbart«.

Cimone della Pala vom Rollepaß
Vergleichen wir zu diesem Zweck die beiden Bilder des Cimone vom Plateau, welche genau an derselben Stelle aufgenommen sind. Wie reckt sich da bei dem Fernrohrbild die mächtige Wand in die Höhe, wie heben sich die Zacken und Türme heraus, wie türmt sich Abgrund über Abgrund! Und das alles nur auf dem Bilde! Betrachten wir nun auch gleich den Gipfel, der sich auf den beiden ersten Bildern kaum als ein Punkt darstellt, so können wir doch vielleicht das Gefühl der ungeheuerlichen Größenverhältnisse bekommen, können verstehen, wie ergreifend sie auf das Gemüt wirken müssen. Auch das Detail des Bildes »Einstieg am Drahtseil«, das in der Scharte zur Rechten des Gipfelblocks aufgenommen ist, läßt uns bei vergleichender Betrachtung die packende Vielgestaltigkeit der ungeheuerlichen Formen dort oben ahnen.
Daß die Besteigung des Berges, welche senkrecht an dem Turm zur Rechten empor und dann über den Grat zum Gipfel führt, eine überaus interessante und wechselvolle ist, ergibt sich aus dem Vorstehenden. Sie bringt nicht nur großartige Klettereien auf gutem Gestein, herrliche Details und Ausblicke aller Art mit sich, sondern hatte für mich auch einige geradezu ideale Eindrücke. So wird mir die Morgendämmerung auf dem Travignolopaß ewig unvergeßlich sein. Noch während der Nacht waren wir in einer felsumbrandeten Schneerinne angestiegen. Mühsam, noch halb verschlafen, immer die steile Firnwand unmittelbar vor uns, hatten wir der Umgebung kaum geachtet. Die Dämmerung war eingetreten, ohne daß wir es bemerkten. Da mit einem Schlag auf der Paßhöhe eröffnete sich eine Welt zu unseren Füßen, so weit das Auge reichte, wie ein bleiernes Meer lagen die wogenden Morgennebel über den Tälern, darüber die Berge, Inseln gleich, und überall Sonne und Leben. Wie fühlten wir uns da gehoben auf unserer luftigen Höhe, wie beseeligt in dieser anderen, schöneren Welt. Ja, ja, ihr Schläfer dort unten, reckt und streckt nur eure Glieder, bis ihr euch endlich zum Aufstehen bequemt und redet klug! Wir hier oben wissen es besser.
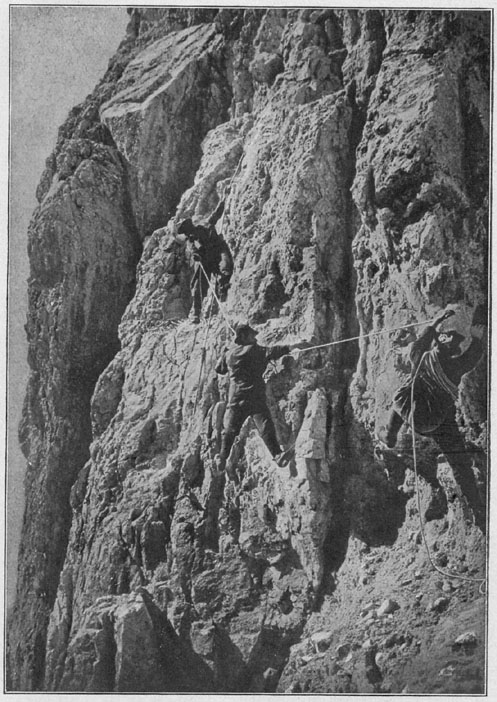
Cimone della Pala. Der Einstieg am Drahtseil.
Und dann dieser herrliche Grat! Wohl eine halbe Stunde lang geht es da auf der scharfen Höhe entlang, über Zacken und Türme, in Risse hinein, an Blöcken hinauf, nicht geringer als der das Ganze krönende Gipfelblick. Dabei immer die ungeheuerlichen Abgründe zu beiden Seiten. Überaus merkwürdig war mir auch, als ich, vom Gipfel der Vezzana nach dem Berge hinüberblickend, ein Brockengespenst dort drüben sah. Wohl merkte ich bald an den Bewegungen, daß es meine eigene ins Riesenhafte vergrößerte Wenigkeit war, die sich dort drüben zu schaffen machte, aber beinahe übernatürlich kam mir die Sache doch vor.
Hochinteressant war auch die Besteigung der einst viel belagerten Pala di San Martino. Freilich um den Berg zu verstehen, müssen wir versuchen, unserem Bilde wenigstens einigermaßen die Größe der Wirklichkeit einzuhauchen. Dann erst fühlen wir die grandiose Wucht dieses viel gerippten Felsens, bei dessen Ersteigung wir uns aus den ungeheuerlichen Abgründen emporarbeiten, die ihn im Halbkreis umgeben und das Gefühl trostlosester Verlassenheit erwecken, mit dem wir ebenso kämpfen müssen, wie mit dem schwer ersteigbaren Gestein. Auch der Blick von dem Gipfel ist überaus merkwürdig und schreckhaft. Da er das umgebende Plateau nur wenig überragt und der Fernblick deshalb beschränkt ist, wirken die Abgründe des Kessels ringsum geradezu wie eine Hölle.
Bei der Besteigung des Saß-Maor-Doppelgipfels ist es vor allem die prächtige Turmgestalt der Cima della Madonna, die die Aufmerksamkeit fesselt. Auch sonst ist sie charakteristisch. Man vergleiche die Seitenwände des Turmes mit dem pyramidalen Gipfel, während sie in ihrem gleichförmig senkrechten Abfall einen massig düstern, nach unten weisenden Eindruck macht, zeigt schon die kleine Gipfelpyramide den Drang nach oben. –
Zur Abwechslung nun noch ein amüsantes kleines Abenteuer, das ich in der Rosettahütte hatte. Ich befand mich da an einem Abend mit Michele, als wir draußen Stimmen hörten und zu unserem Erstaunen drei italienische Weiber, darunter ein recht hübsches junges Mädel, vorfanden, die mächtige Körbe trugen und es sich in dem kleinen Anbau bequem machten.
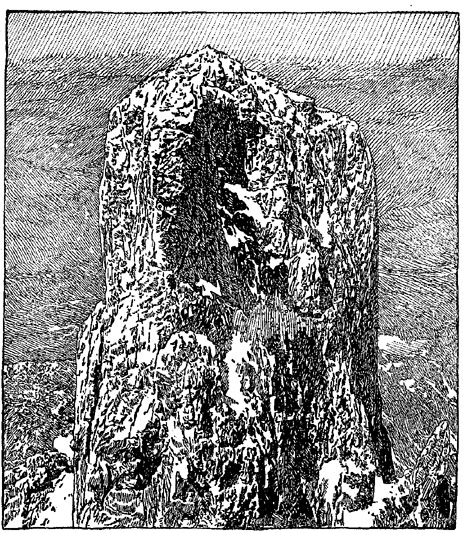
Cima della Madonna.
»Sie sind wohl Schmugglerinen?« fragte ich.
» Si Signore,« war die ohne jedes Zögern abgegebene Antwort.
»Haben sie keine Furcht, daß ich sie anzeige?«
» O no! Die Touristen tun uns nichts.«
Ungeheuer war das Gepäck, das sie trugen. Volle 80 Pfund wog jeder der drei mit Kaffee, Zucker, Salz, Tabak usw. gefüllten Körbe. Es war die reine Viktualienhandlung.
»Gehört das alles Ihnen?«
» O no, wenn wir so reich wären! Wir tragen das nur und bekommen dafür 3 Lire pro Person. Wir sind gewöhnlich zwei Tage unterwegs.«
Michele hatte inzwischen die Jüngste der drei mit sichtlichem Wohlgefallen betrachtet und bat mich, die Gesellschaft in die Hütte hereinzulassen, was denn auch geschah. Da wurde es denn bald recht vergnüglich. Man kochte Polenta, sang italienische Lieder, und Michele, der Schwerenöter, wurde immer galanter. Die Alte freilich verstand darin keinen Spaß und war eine grimmige Wächterin, so daß er den Polentastecken mehrere Male gehörig auf den allzu neugierigen Fingern zu verspüren hatte. Vor dem Schlafengehen erstaunte ich dann nicht wenig, als Rosenkränze hervorgeholt wurden und ein Betgemurmel anfing, das nicht mehr aufhören wollte, bis es mir schließlich doch zu viel wurde.
»Betrügen Sie lieber nicht, das ist gescheiter, als hier so demonstrativ drauflos zu beten.«
Aber da kam ich schön an. Erregt fuhr die Alte auf und kreischte mich an: Sie seien keine Betrüger, sie seien ehrliche Leute, die alles bar bezahlt haben.
»Sie betrügen den Staat.«
»Das ist keine Sünde!« erwiderte sie erregt.
Nun, wer kann gegen solche Logik aufkommen!
Schon am frühesten Morgen waren die drei dann wieder verschwunden.
Die Dolomiten hatten mir es so angetan, daß ich mich schon an Weihnachten wieder unter ihnen befand. Die Reise galt den Ampezzaner Dolomiten und wurde wohl meine ereignisreichste Wintertour. Wir folgen dabei am besten meinem Tagebuch.
Hei, wie das wild ist hier oben und schaurig! Eine völlige Polarlandschaft. Eis, nichts als Eis und nackter Fels, der sich gegen die kalte Umarmung wehrt, wie klein und verlassen die Hütte dasteht! Und doch hält sie den Elementen stand. Menschenwerk, kleines trauriges Menschenwerk, aber Sinn liegt drin und Verstand und ein gutes Stück Trotz. Seht nur her ihr unförmigen Kolosse, hier stehe ich, ein Hüttlein, klein und unscheinbar! Aber was könnt ihr ungeschlachten Riesen mir anhaben? Hier in meinem Innern ruht die Macht und die Kraft und der Sieg über euch alle, versucht es nur, euch aufzulehnen! Man wird den Fuß auf eure Häupter setzen, und ihr habt es zu erdulden. Der Tod ist euer Los und ewiges dumpfes Schweigen.
Wir sind heut spät weggekommen von Sexten, mit den üblichen Sprüchen. »Sie gelt, schauen's zue, daß nix passiert! wissen's im Winter san die Berge halt wieder ganz anders als im Sommer.« Und wie entsetzt die Leute heraussahen aus den kleinen Fenstern, als ging's direkt ins Jenseits! Leb wohl, du nettes eingeschneites Dörfchen mit den behaglich rauchenden Kaminen! Lebt wohl, ihr verschneiten Tannen und Wälder! Wir wollen höher hinaus. Wie kalt es ist! Der harte Schnee knirscht ordentlich unter den Füßen, ein eisiger Duft liegt über dem Tal, und der Bach hat sich in eine Dunstwolke gehüllt, die langsam in die Höhe dampft.
Anfangs kommen wir rüstig vorwärts, dann aber verschwindet der Weg. Immer tiefer sinkt der Fuß in den Schnee, und immer schwerer drückt die Last auf dem Rücken. Da sind mir endlich! Wer wir? Mein Freund Michele Bettega, Johann Watschinger aus Sexten und meine Wenigkeit. Michele habe ich extra aus San Martino kommen lassen. Ich weiß, was ich an ihm habe. Nun, auch Watschinger ist ein stämmiger Gesell, der seinen Mann schon stellen wird. Auch spricht er nur Deutsch, Michele aber nur Italienisch. Jetzt bin ich der alleinige Dolmetscher ihrer Gefühle und damit unumschränkter Herr.
Wie unsagbar gewaltig und eisig die Drei Zinnen auf unser Hüttlein herabsehen! Nun um so gemütlicher ist es hier drinnen an dem flackernden Feuer. Was für ein spaßiger Kauz dieser Michele ist! Er hat sich Polenta gekocht und macht jetzt eine große Kugel daraus. Er verzehrt sie mit Hochgenuß zusammen mit einem Peitschenstecken. Steinhart ist dieses Stück Wurst, das er sich auch noch am Feuer geröstet hat, und schwarz wie die Nacht, wie die Polentakugel in seiner Hand. Wohl bekomm's!
Was wir wohl morgen unternehmen werden? Ich werde mich hüten, meine Pläne auszukramen. Sonst gibt's ja doch nur Schwierigkeiten.
Draußen ist die Nacht wunderbar. Der Mond scheint über die weiten Schneefelder hinweg, die Wolken ziehen, und stumm stehen dort die riesenhaften Zinnen. Wie drohende Wächter.
Dreizinnenhütte, 28. Dezember.
Wir haben uns auf die Große Zinne geeinigt. Sie konnte schließlich bezwungen werden. Im stillen ist mir ja auch die Kleine durch den Kopf gegangen, aber wie sollte das möglich sein, jetzt zur Winterszeit!
Wir sind um 7 Uhr aufgebrochen, zwischen Tag und Dunkel. Langsam verschwinden die Sterne, ein goldener Schein legt sich über die Schneeriesen und die Felsen flimmern. Man meint, es sei Tag, aber es ist eine Täuschung. Immer heller wird's und heller, die eisigen Hänge glühen, und der düstere Himmel wird blau. Da plötzlich ein Flämmlein an der höchsten Spitze der Zinnen! Es ist Sonnenlicht. Wie eine Welle schreitet es herab, an den eisigen Hängen, und eh' wir's uns versehen, ist es Tag. Und doch ist es nicht jene strahlende Sonne, die den Erdball belebt. Kalt starrt ihr das Leichentuch entgegen, eisig, wohin sie blickt, und sie vermag es nicht zu durchdringen, noch zu erwärmen. So setzt sie teilnahmslos ihren Weg fort, ein feurig roter Ball in der frostigen Umarmung der Atmosphäre.
Wir haben den Fuß der Kleinen Zinne umgangen und wenden uns dem Sattel zu, der sie von der Großen trennt. Bald führt dann eine Schneerinne nach links in die Höhe und wir sinken bis um die Hüften ein. Dann kommt eine Kletterei durch enge, beinahe senkrechte Kamine. Sie ist recht schlimm, denn eine fürchterliche Kälte herrscht da drinnen. Haufenweise ist der Schnee aufgestaut und mannshohe Zapfen hängen von den steilen Wänden herab, ein geradezu arktisches Bild. Ob wir wohl hinaufkommen durch jenes finstre Loch, das so eng ist, daß man schon im Sommer hindurchkriechen muß? Ganze Lasten von Schnee wälzen wir in die Tiefe und doch umfängt uns völlig die eisige Umarmung. Aber wir ringen uns durch, schweißtriefend trotz aller Kälte.
Endlich erreichen wir ein kleines Plateau, und die Sonne scheint uns wieder. Hurra! Und da ist ja die Kleine Zinne, meine geliebte Kleine Zinne! Einen Stein könnte man hinüberwerfen, so nah steht sie da. Welch mächtiger, ungeheuerlicher Turm! Und wir sind schon höher und sehen über den Berg hinweg. Dazu diese Polarlandschaft ringsum! Es ist einfach überwältigend! – Wie wär's, wenn ich es nun doch mit der Kleinen Zinne versuchte? Immer wieder schießt mir der Gedanke durch den Kopf und läßt mich nicht mehr los, wie eine alte Liebe. Doch vorwärts, sonst frieren wir noch an! Hurra, wir sind oben! Unter einem Stein ist das Ersteigerbuch in einer Blechkapsel. Heraus damit! »Morgen wird die Kleine Zinne bestiegen!« Dies meine Inschrift. Es war das erste, an was ich dort oben dachte.
Wie gewaltig dieser Gipfel ist! Mächtige Felsblöcke türmen sich übereinander auf, und tief verschneite Schluchten ziehen sich durch das morsche Gestein, wie wir da herumkletterten, bis wir endlich wieder Abschied nahmen!
Da ist ja die Kleine Zinne wieder, unnahbar steil! Und da will ich hinauf, in dieser fürchterlichen Kälte? Die Hände werden mir wegfrieren. Nein, das ist ja ganz ausgeschlossen! Und droben steht es jetzt in dem Buch, schwarz auf weiß. Man wird mich auslachen als Renommisten.
Beim Heimweg zur Hütte gingen wir direkt über die Scharte zwischen den beiden Bergen. Eine steile, vereiste Rinne führte von da hinab. Der Sturz meines Begleiters in den Cadinen fiel mir ein, als ich so zagend auf der Höhe stand und nicht recht wußte, wie die Sache angreifen. Ach was, ein tüchtiger Satz und den Pickel fest eingestemmt! Eins, zwei, drei, es geht wie der Sturmwind.
Wenn ich nur das dumme Zeug nicht in das Buch dort oben geschrieben hätte! Es war so unnötig. Diese Blamage, wenn nichts draus wird! Aber halt! Schließlich gehe ich eben wieder hinauf und reiße die Seite heraus.
Da sitzen wir in der Küche am Feuer um den großen Kessel herum und wärmen uns seelenvergnügt. Er wird mir unvergeßlich bleiben, dieser Wintertag an der Kleinen Zinne.
Wieder bin ich bangend dort oben gestanden in der Nische unter dem Gipfel, und habe hinaufgeblickt in der schmalen senkrechten Schlucht, die noch überwunden werden mußte. Diesmal bei einer Kälte von 20 Grad. Wir hatten wahrlich schon genug zu tun gehabt, um bis dahin zu gelangen, an dem eisigen Gestein herauf. Und jetzt soll die Hauptsache erst losgehen!
Michele hat den Berg noch nie bestiegen, wie wird er's angreifen, wird es gelingen? – Aber was ist denn das? Er zieht sich Rock und Stiefel aus, bei dieser Kälte! Nun ja, er will unbehindert sein, und die Strümpfe kleben besser an den Felsen als die ungelenken, vereisten Stiefel. Er fängt zu klettern an, und es herrscht Todesstille, langsam schiebt und zieht und windet er sich in die Höhe. Oft versagen die eisigglatten Griffe und Tritte ganz, und er muß sich gewaltsam zu beiden Seiten der engen Felsschlucht anstemmen. Jetzt kommt er an die schwierige Stelle unter dem überhängenden Block. Wenn er da den Halt verliert, dann ist's sicher aus mit ihm. Wie er sich abmüht und vorsichtig das glatte Gestein abtastet! Aber es geht ja, Hurra, er ist oben auf dem Block! Jetzt bin also ich an die Reihe. Es ist natürlich unermeßlich viel leichter als für ihn und ein paarmal baumele ich eben am Seil. Was hat das weiter zu sagen!
So stehen wir also wieder beisammen auf dem Block, zitternd vor Kälte. Die senkrechte Rinne, die vollends hinaufführt ist stark vereist und dem Gestein nicht zu trauen, aber die Gipfelkrankheit hat uns mächtig erfaßt, die große Passion, bei der es kein Besinnen gibt, und ehe wir's uns versehen, sind wir auf dem kleinen, schneebedeckten Plateau. Triumphierend blicke ich hinaus über die weite Schneelandschaft mit ihren phantastischen Zackengebilden ringsum, warum soll ich mich darüber nicht freuen! – Aber was macht denn Michele, ist er verrückt geworden? Wie ein Besessener stampft er die Füße in den Schnee, schlägt sich die Arme um den Leib herum und flucht, wie nur ein Italiener fluchen kann! Freilich, es ist so eine Sache, im Dezember 2881 m hoch zu sein, ohne Rock und Stiefel! Es ist ja nicht nett von mir, aber ich habe geheult vor Lachen. Dieser wilde, halbnackte Kerl mit dem langen, fliegenden Haar, dem struppigen, schwarzen Vollbart, den lodernden Augen und rasenden Gesten hier oben in der eisigen Bergeseinsamkeit! Wie ein tobender Berggeist kam er mir vor.
Und nun sitzen wir hier behaglich ums Feuer, nachdem wir allerdings noch manches ausgestanden. Ein bekannter Bergsteiger sagte einmal, am schwersten sei ihm bei der Besteigung der Zinnen der Rückweg nach Misurina geworden. So ging's auch uns. Je weiter wir herunter kamen in das Tal, um so tiefer wurde der Schnee, so daß wir uns schließlich beinahe die Seele herausgekeucht haben. Nun jetzt geht's ja wieder besser.
»Hallo, noch eine Flasche Asti! – Und jetzt noch eine! – Und noch eine! Wir haben's verdient.«
Da stand er wieder, kalt und abweisend, mein Turm in den Cadinen, der Kleine Popena, und ich bin auch diesmal nicht hinaufgekommen. Der Schnee war aber auch zu tief. Und dazu dieser verdammte Asti!
Mich schaudert, wenn ich an mein Bett denke! Wie das gestern ausgefroren war in dem unheizbaren Zimmer! Wie ein Wurm habe ich mich darin gekrümmt und vor Kälte geschnattert.
Das Glück war mir wieder hold, der Monte Cristallo lag zu unseren Füßen. Aber welche Mühen hat es gekostet!
Um 3 Uhr sind wir von Misurina weggegangen, in stockdunkler Nacht beim Scheine der Laterne. Um 4 Uhr glaubten wir nach Tre Croci zu kommen. Es wurde beinahe 6 Uhr. Sollte man es glauben, den ganzen Weg mußten wir Stufen hauen. Auf der ebenen Landstraße! Sie war mit blankem Eis bedeckt, das schräg abfiel. Man rutschte da beständig, und nachdem wir unsre Knochen erst einige Male tüchtig angeschlagen hatten, auch in dem tiefen Schnee daneben nicht vorwärts kamen, hieben wir eben Stufen.
Und welcher Marsch die weite Schutthalde hinauf zum Cristalljoch! Stunde um Stunde verrann, Flasche um Flasche wurde getrunken, und das Joch war so weit wie nur je. Erst um 9 Uhr erreichten wir das Große Band, wo wir vergeblich Wasser zu finden hofften, denn unser Wein war längst dahin.
Was soll ich über den Weitermarsch sagen! Die Hände im Schnee, die Füße im Schnee und brennender Durst bei 20 Grad Kälte, so kletterten wir in die Höhe, ohne übrigens den Humor zu verlieren. Nein, wer am 31. Dezember so hoch hinaus will, der muß auch etwas ertragen können, das ist klar. Und was haben wir nicht alles gesehen an riesenhaften Klüften und Felsen, alles im Schnee, mit überall herabhängenden, ich möchte sagen übernatürlich großen Eiszapfen.
Gegen 2 Uhr nachmittags kamen wir auf den Gipfel und konnten hinabblicken auf den tiefverschneiten Gletscher mit seinen grinsenden Spalten in dem ewigen Halbdunkel, das jetzt dort unten herrscht. Unwillkürlich mußte ich an den guten Michel denken, der in so einem trügerischen Riß sein Leben verlor.
Der Abstieg brachte nichts Neues. Todmüde kamen wir bei Tre Croci an und tranken in langen Zügen das Eiswasser aus dem Bach. Dann zogen wir müde die Straße hinunter nach Cortina, während sich vor uns im milden Abendsonnenglanz die herrlich gezackte Tofana erhob, die unser nächstes Ziel sein sollte.
Draußen vor dem Dorf schießen sie jetzt mit Böllern und freuen sich, daß ein neues Jahr beginnt. Nun ja, mir ist's auch wohler, als damals im Wegwärterhaus am Schwarzhorn, und auch der brave Papa Verzi vom Croce Bianca sorgt geradezu rührend für mich.
Der Rasttag ist vorüber. Draußen schneit und stürmt es, daß man verzweifeln möchte.
Mit Michele bin ich heute nach Lorca hinuntergefahren, um ihm ein Stück weit das Geleit zu geben, denn er geht wieder nach Hause. Während der ganzen Fahrt haben wir kaum die Hände vor dem Gesicht gesehen, so stark war das Schneetreiben. Jetzt sitze ich wieder da, und die Zeit verstreicht tatenlos. Aber ich gebe nicht nach, obgleich jedermann sagt, daß es wochenlang so fortstürmen könne.
Nun ist es doch geglückt! Als gestern früh ein Stückchen blauen Himmels zu sehen war, hielt ich es nicht länger aus und zog mit dem trotzigen Antonio Dimai nach der Tofanahütte. Es war ein prächtiger Spaziergang durch den verschneiten Tannenwald und so recht weihnachtsmäßig. Dazu dieser südliche Glanz, der über den pittoresken Bergen lagert und der nordisch kalte Schnee! So etwas trifft man nur in den winterlichen Dolomiten. Die Hütte war prächtig gelegen, in einer verschneiten Felsschlucht mit himmelhohen, gezackten Wänden, in der überall riesenhafte Blöcke herumlagen. Nur an einer schmalen Stelle sah man hinaus auf das weite Bergland und hinunter auf die verschneiten Tannen. Die Besteigung war in der Hauptsache mühsam und lawinengefährlich. Einmal dachte ich sogar ans Umkehren, aber Antonio sah mich nur finster an, und so kämpften wir uns weiter bis zum Gipfel, wo Antonio mitten im Schneesturm sein rotes Taschentuch stolz an den dort befindlichen Stecken band. Beim Abstieg konnten wir eine Zeitlang wie auf einem wogenden Wellenmeere abrutschen, das die rollenden Schneemassen bildeten, und hatten manchen herrlichen Blick über die weite verschneite Landschaft. Den Abschluß bildete eine sausende Fahrt im Hörnerschlitten. Antonio verstand sich darauf, wie kein zweiter.

Michele Bettega
Ein hübscher Marsch über Schluderbach nach Toblach beendete die ereignisreiche Tour, auf die ich jetzt noch mit besonderer Genugtuung zurückblicke.
Auch ein unwiderstehliches Sehnen ließ sie in mir zurück, und so sah mich der Sommer 1893 wieder in den Ampezzaner Dolomiten, diesmal im Zeichen des höchsten photographischen Fanatismus.
Der Leser kennt meine Vorliebe für den Süden. Es gab nichts Schöneres für mich, als aus den Schnee- und Eisregionen hinunterzuziehen in Italiens lachende Gefilde mit ihrer herrlichen Vegetation, ihren malerischen Gestalten und romantischen Bauwerken, aus denen die Jahrhunderte reden. Der Wechsel ist so groß und ergreifend, daß er mit magischer Gewalt packt und gefangen nimmt. In düsterm Träumen sind wir dagestanden in dem ewigen Schnee, bestrebt, die Rätsel dieser Schöpfung zu ergründen und einzudringen in ihr eigen wild Geheimnis. Wir waren überwältigt von der eisigen Pracht, die unserem klopfenden Herzen so ferne steht, haben uns hinaufgerungen im Kampf mit uns selbst, germanische Naturen, die in unermüdlichem Drang das Unendliche zu greifen suchen. Wie ganz anders sind wir dann dort unten! Wir pflücken die Kastanien von den Bäumen, trinken fröhlich süßen Wein, freuen uns an dem blauen Himmel und den beweglichen bunten Menschen, liegen am Ufer eines Sees und blicken hinweg über die grüne Flut, ohne quälende Gedanken, jeder Sorge los und ledig. Dolce far niente. Was wollen wir weiter! Was kümmern uns die Rätsel dieser Welt! Weg mit dir, du törichtes Grübeln! Dolce far niente!
Diesmal ist mir's gerade umgekehrt ergangen. Ich kam aus dem schönen Italien froh und heiter. Die südliche Sonne hatte mich beschienen und erwärmt. Ich war wieder einmal aufgetaut. Jetzt stehe ich dort oben auf den Schneefeldern des Monte Pelmo. Weg sind die weichen Lüfte, kein auch nach so ärmliches Pflänzchen ist zu sehen. Nur Fels und Eis starren mir entgegen und ringsum tobt wilder Sturm. Was will ich da oben, was? – Was aber soll ich unten? Was geb' ich für ein ausgeträumtes Leben, das tatenlos verstreicht? Folgt nicht Erwachen stets dem Traum, zerstört die rauhe Wirklichkeit nicht stets den Wahn? Nichts tun, ist auch nichts! Du hast genug geträumt, also vorwärts, weiter! Da nur liegt des Gebens wahre Lust und Wonne, wo sie erkämpft wird und erstritten!
Wenn nur die Sache nicht gar so niederträchtig angefangen hätte!
Ich war des Abends in San Vito eingetroffen. Ein herrlicher Tag lag hinter mir voll fesselndster Eindrücke, und noch umfing mich Italiens Zauber.
Wir machten uns früh auf die Beine. Der Weg war weit, denn noch am selben Abend gedachten wir in Cortina zu sein. Stumm schritt ich hinter den beiden Führern drein, im dunkeln Wald beim Schein der Laterne. Wie wohl das Wetter werden wird? Unsinn, wie soll es weiter werden, wir sind ja noch in Italien! Da muß es doch schön sein! Aber es regnet ja, wahrhaftig es regnet. So eine Gemeinheit! Also warten wir unter einer Tanne! Eine halbe Stunde ist vergangen, eine Stunde. Ich schnattere vor Kälte. Es ist hell geworden und naß sind wir ja doch, also weiter! Wenn wir nur erst bei der Hütte wären! Endlich erscheint sie, Gott sei Dank! »Venezia« ist sie »getauft«, und wahrlich, an Lagunen hat mich ihre Umgebung erinnert. Einen Schlüssel haben wir auch nicht, den hat es zu der frühen Jahreszeit in San Vito noch nicht gegeben, und das Vertrauen auf meinen Vereinsschlüssel erweist sich als trügerisch. Da stehen wir also in dem strömenden Regen. Der Versuch, durch die wohlverschlossenen Läden zu gelangen, mißglückt, und selbst vom Dach her gelingt es nicht, in die jungfräuliche Feste einzudringen. Lasciate ogni speranza! Ein offener Nebenraum ist ja allerdings da, aber wie sieht der aus! Acht Fuß breit, acht Fuß lang, ein lehmiger Fußboden und als Einrichtung zwischen unmenschlich vielem Dreck eine hölzerne Bank. Voilà! O, Photograph, was bist du für ein Esel! Als Bergsteiger, Mensch und Tourist würde mich keine Macht der Erde abhalten, weiter zu steigen oder zurückzugehen, aber als Photograph heißt's einfach ausharren. Zunächst wird also in dem Schmutzloch ein Feuer angezündet, an dem wir uns zu trocknen suchen.
»Wie steht's denn mit dem Wetter?«
»Es gießt.«
»So laß es gießen!«
Also kochen wir uns eine Suppe, die kann nie schaden.
»Wieviel Uhr ist's denn?«
»Acht Uhr.« Morgens, wohlverstanden!
»Und das Wetter?«
»Es gießt.«
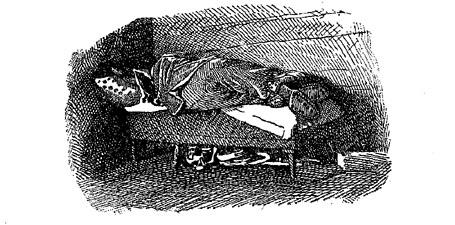
Allmählich kommt ein solcher Rauch in das Lokal, daß man kaum atmen und die Augen öffnen kann. Also Tür auf! Aber der Zug, der jetzt hereinkommt, ist in den nassen Kleidern unerträglich und der Blick da hinaus in das Regenwetter entsetzlich. Ganze Bäche strömen von dem Dach herunter, gerade an der Tür. Es ist nicht mit anzusehen. Tür zu! Lieber Rauch und Dunkelheit, als solchen Anblick.
»Wieviel Uhr ist's denn jetzt?«
»Halb neun Uhr.«
Die beiden Führer sind hinausgegangen, um Strauchwerk für das Nachtlager zu holen, von einer Besteigung kann ja heute doch keine Rede mehr sein. Ich habe mich auf die Bank gelegt und sinniere, wie hübsch wäre es, wenn man dort oben herumphotographieren könnte! Jedermann hat mir den Pelmo als einen so interessanten Berg geschildert. Besonders auch das Große Band. Es ist da eine Stelle mit einem Loch, durch das man liegend hindurchkriechen muß. Welcher Genuß für meinen Apparat! – Aber was ist denn das für ein Kerl, der da hereinkommt, den kenn' ich ja gar nicht. Augenscheinlich ein Vagabund, groß, ruppig, finster. »He, was wollen Sie?« Keine Antwort. Der Kerl kommt drohend auf mich zu. »Oho, mit dir werde ich schon noch fertig!« – Verdammt, er hat mich gepackt, drückt mich zu Boden und würgt mich, wenn ich nur die Arme frei hätte, ah! – Nun, gar so schlimm war die Sache schließlich doch nicht, ich habe nur geträumt auf der steinharten Bank und wische mir jetzt den Schweiß von der triefenden Stirne. Noch zwölf solche Stunden, bis wir zu »Bett« gehen. Ich werde daran denken.
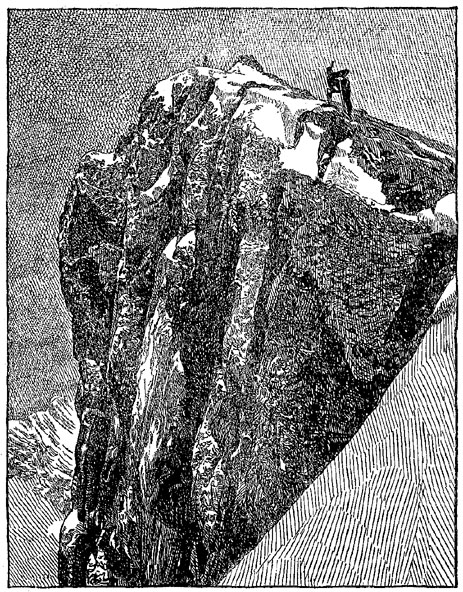
Gipfel des Monte Pelmo.
Am folgenden Morgen war das Wetter einigermaßen passabel, also los!
Am Monte Pelmo ist alles großartig, gewaltig, imponierend. Man trifft da keine zierlichen Nadeln und Zacken, die das Bild beleben. Alles ist nur ungeheure Masse, bedrückend und doch erhebend, wenn man sich erst als Herr über sie fühlt. Mochte es jetzt wehen und stürmen, ich setzte meinen Fuß auf den mächtigen Gipfel und hatte die trotzig stolze Siegerfreude inmitten tobender Wolken, die immer wieder neue Ausblicke eröffneten.
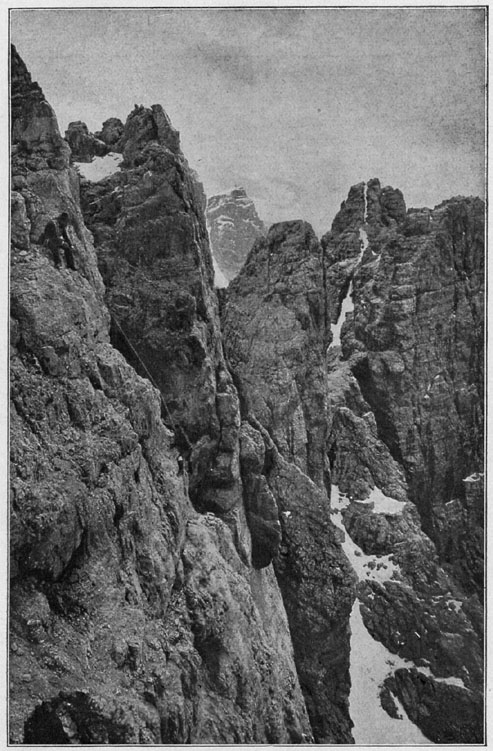
An der Westwand der Croda da Lago
Auch an diesem Berg hatte ich einen Tag Regenwetter für meine photographischen Gelüste auszuhalten. Allerdings war's diesmal weniger langweilig, denn wir befanden uns bei Hirten auf der Federa Alp, deren Leben und Treiben mich interessierte und dann, wie wurde ich belohnt! Schon an dem prächtigen Lago da Lago, diesem einzig schönen See! Auch so wechselvoll ist die Tour. Von dem in halber Höhe des Berges befindlichen Großen Band steigt man erst die steile Ostwand zu einer Scharte hinauf, aus der sich der doppeltgezackte Gipfel erhebt. In halber Höhe des Gipfelblockes geht es dann schräg hinüber zu der ungeheueren Westwand, auf der sich die gewaltigsten Ausblicke eröffnen. Welch grandiose, bedrückende Felsenwildnis! Und wie kann man da klettern! Mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen hatte, zeigt folgendes Erlebnis, das doch ziemlich bedenklich war: Um den Gipfelblock aufzunehmen, war ich von der Scharte nach links in die Höhe gestiegen, während die Führer jenseits die eigentliche Besteigung ausführten.
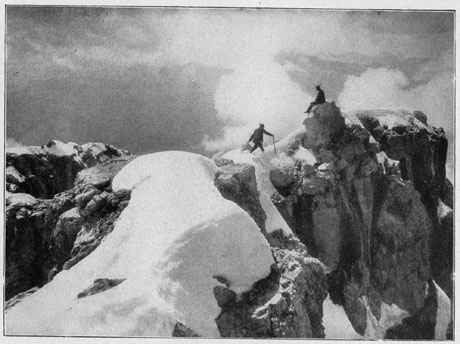
Sarapißgipfel.
Daß ich mich da auf völlig unbetretenem Boden befand, bewiesen bald die ungeheuren Felsmassen, die bei jedem Schritt losbröckelten und dröhnend in die Tiefe stürzten. Nun ich war vorsichtig und kam schließlich auch zu einem Band, wo ich meine Aufnahmen machen zu können wähnte. Also heraus mit dem Stativ! Da ich schrecklich wenig Raum hatte, setzte ich mich hin, stellte den Apparat auf, so gut es ging und, den Kopf unter dem schwarzen Tuch, sah ich durch die Mattscheibe. Da plötzlich ertönt drüben ein entsetztes Geschrei: »Santo Dio, passen's auf!« Der ganze Block, auf dem ich saß, war langsam und ohne daß ich es gleich bemerkte, ins Rutschen gekommen, und schon donnerten die Felsblöcke in die Tiefe, daß es dröhnend von allen Seiten widerhallte. Ich aber hatte noch immer das schwarze Tuch um den Kopf.
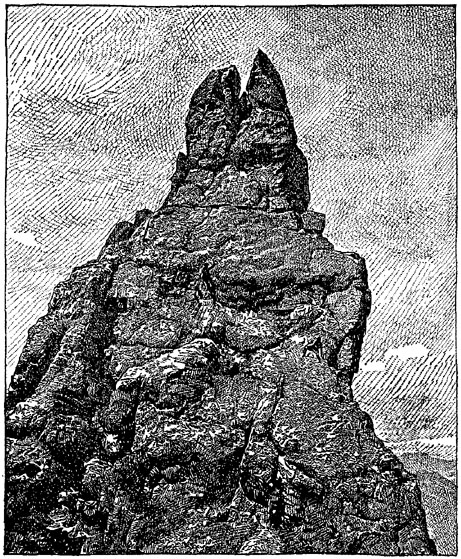
Gipfel der Croda da Lago
»Erst das Roß und dann der Reiter!« Oder ins Photographische übersetzt: Erst der Apparat und dann der Photograph. Das waren so etwa meine Gedanken, als ich das Stativ mit der linken Hand an einem Bein packte. Dann warf ich mich auf den Rücken nach der Wand zu und erwischte mit der Rechten nach eine Felskante, welche hielt. Da hingen wir. Mein Tornister freilich, der neben mir gelegen, war in der Tiefe verschwunden.
Daß ich meine Aufnahme jetzt erst recht machte, war klar. Und nicht bloß die eine! Denn so eine Gelegenheit, wie dort oben, findet man selten. Auch meinen Tornister bekam ich wieder. Als wir nach der Besteigung den Berg umgingen, fanden wir ihn an seinem Fuße behaglich daliegen. Daß ein leichter, leerer Tornister rund 1000 Fuß tief fallen kann, ohne sich unterwegs an den Riemen zu verfangen, ist ein genügendes Zeichen für die Steilheit und Glätte dieser Westwand, die der Leser im übrigen auch auf unsrem Bilde beurteilen kann. Die Fallstelle befindet sich da etwa zwischen den beiden Kletterern, an der jenseitigen dunkeln Wand.
Bei dem nun folgenden Marsch nach der Dreizinnenhütte kam ich auch wieder an den Cadinen und damit an meinem Turm, dem Kleinen Popena vorbei, nach dem mein Sehnen seit der Schluderbacher Zeit schon so oft gestanden. Daß er diesmal fallen würde, war keine Frage, denn ich hatte zwei vortreffliche Führer bei mir. Auf diese Weise war das freilich auch keine besondere Leistung, und als wir am Fuße des Berges eine kurze Rast hielten, begann ich mich doch zu schämen. Allein hatte ich damals hinauf wollen und mußte das von Rechts wegen auch jetzt tun, ohne daß die andern es merkten. Ich erklärte also, daß ich erst rekognoszieren wolle und verschwand hinter der nächsten Ecke. Dann ging es rasch auf meinem alten »Weg« in die Höhe. Er kam mir sehr viel leichter vor als damals. Ich hatte inzwischen etwas gelernt in der edlen Kletterkunst und triumphierte schon, denn die Stelle, an der ich einst umgekehrt, war passiert, und ich befand mich nur noch wenige Dutzend Meter unter dem Gipfel. Da kam plötzlich ein Halt! Der steile Fels wurde so brüchig, daß die größten Steinlawinen sich loslösten und ich nicht mehr weiterkam. Machtlos hing ich an der Wand und machte mir deprimierte Gedanken, während die Führer rasch nahten. Aber sollte es wirklich allein nicht gehen? Ach was! Ein rascher Ruck, ein Hagel polternder Blöcke, und ich hatte weiter oben wieder festen Fuß gefaßt. Es ging doch, und ich konnte die beiden triumphierend auf dem Gipfel begrüßen.
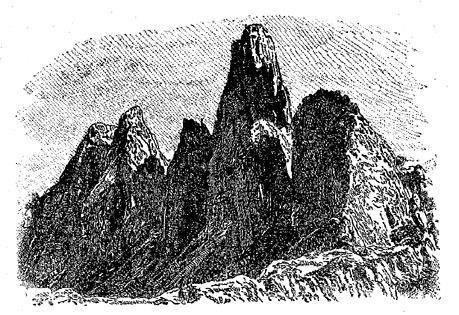
Der Kleine Popena.
Dann wurde ein Steinmann gebaut, wie die Alpen noch selten einen gesehen. Man ist nun einmal ein Kindskopf da oben, und das ist auch gut so. Jugendlichkeit kann nie etwas schaden, nur Blasiertheit ist dumm. Bei meiner Tour an Weihnachten hatte ich in Erfahrung gebracht, daß Jeanne Imink, eine bekannte Bergsteigerin, die Croda da Lago schon im Winter bestiegen hatte. Ich hatte die Dame auf der Rückreise in München besucht, und wir hatten uns verabredet, in diesem Sommer einige photographische Klettertouren zusammen zu machen.
Unser jetziges Zusammentreffen in der Dreizinnenhütte erfolgte zunächst unter nicht gerade günstigen Verhältnissen. Die Hütte war von lautem Volk völlig überfüllt, und der Abend verlief deshalb ziemlich ungemütlich. Um so interessanter war's am folgenden Tag, der wieder einmal der Kleinen Zinne gewidmet war. Meine liebenswürdige Begleiterin ergab sich da humorvoll in ihr Schicksal, meinem photographischen Fanatismus verfallen zu sein, der sich erst nach 36 Stativaufnahmen größten Formats zufrieden gab, nachdem wirklich nichts mehr zu photographieren war.
Doch hören wir sie selbst darüber!
»Zu einer Bergpartie hatte er mich aufgefordert, und was war es? Eine zwölfstündige photographische Aufnahme ohne Unterbrechung. Was sind die Alpen, was ist die Welt überhaupt für ihn, als ein großes Atelier, eine Versuchswerkstätte, wo alles man noch photographieren kann!
Es war meine erste Tour in diesem Jahre, und für den Anfang doch gerade keine Kleinigkeit.
Wir waren behaglich zu dem Bande angestiegen, und Wundt folgte langsam. Bis hierher war er ganz normal und nichts fiel mir auf an ihm. Jetzt aber erfaßte ihn plötzlich eine eigene Nervosität. Ohne ein Wort zu sagen, stürmte er voraus. Was er wohl vor hatte? Doch keine Unvorsichtigkeit, denn an solchen Felsen war wahrlich nicht zu spaßen. Da, gerade als ich eine schmale Stelle, die unangenehmste von allen passierte, wo der jäh abstürzende Fels eine Wölbung nach außen bildet, rief es halt. Und wahrhaftig, dort an der senkrechten Wand stand er und wollte photographieren. Kaum einen Fuß breit war der Vorsprung, auf dem er sich befand, und der brave Führer der auch nicht viel besser postiert war, hatte alle Mühe ihn zu halten. Doch das kümmerte ihn wenig. Im Nu hatte er das dreibeinige Ungetüm aufgeschlagen und ein schwarzes Tuch über den Kopf gezogen. Die linke Hand höher! Noch Höher! So! – Den linken Fuß vor!‹ Und das alles im Kommandotone, als ob man an den senkrechten Felsen exerzieren könnte! Dabei drehte und wendete er sich mühevoll hin und her, um den Apparat nicht zu erschüttern oder gar hinunter zu werfen. Doch er beginnt. ›So, jetzt bitte recht freundlich!‹ Auch das noch! Ich mußte laut lachen trotz aller Schwierigkeiten meiner Lage. Aber die Prozedur war jetzt wenigstens ausgestanden und ich hatte wieder meine Freiheit. Ich triumphierte zu früh. Kaum war ich einige Schritte gegangen, als schon wieder von hoch oben sein ›Halt!‹ ertönte, Wieder hatte ich mich an weiß Gott was für ungeheuerlichen Stellen zu postieren, die Hand vor, den Fuß zurückzunehmen und ›recht freundlich‹ zu sein. So ging es weiter, Stunde für Stunde, ohne Unterbrechung.
Auf der ›Kanzel‹ verließ er uns und ging hinüber zu dem südlichen Vorgipfel, während wir am Hauptgipfel anstiegen. Es war wirklich halsbrecherisch, wie er da herumkletterte, um einen guten Standpunkt zu bekommen. Die größten Felsblöcke lösten sich los von dem völlig morschen Gestein, und wir verzweifelten beinahe um ihn. Aber uns konnte er wenigstens nichts mehr anhaben, denn er war wohl über 100 Schritte entfernt, Weit gefehlt! Jetzt ging es erst recht los. Zunächst wurden wir mehrere Male in der ›Nische‹ aufgenommen, und als wir dann durch den Kamin ansteigen wollten, kam wieder das unerbittliche ›Halt!‹ Es sei noch nicht Zeit, die Beleuchtung müsse erst günstiger werden. Dann aber war er unersättlich, und einmal wäre mir beinahe ein Unfall zugestoßen. Gerade an der schwierigsten Stelle im Kamin, unter dem bekannten Block, konnte ich es ihm gar nicht recht machen. Da mit einem Male brach der Fels, auf dem ich stand, ab und polterte in die Tiefe. Ich hing frei in der Luft. Es hat mir einen starken Ruck gegeben, aber der Führer hielt das Seil gut und – die Photographiererei ging erst recht los. In welchen unmöglichen Stellungen hat er mich noch aufgenommen, ohne Ende zu finden!
Nie in meinem Leben lasse ich mich wieder photographieren!«
Nun, den Abend verbrachten wir recht vergnüglich in dem Misurina Hotel und hatten Tags darauf eine idyllische Kahnfahrt auf dem herrlichen See, so recht behaglich, bummelig, schwärmerisch. Stundenlang sahen wir in das grüne Wasser hinein und über die Wälder hinweg hinauf zu den Zinnen, zu meinen geliebten Cadinen und hinüber zu der Mauer des Sorapiß, die sich so ungeheuerlich wuchtig über dem Val d'Ansiei erhebt. Dolce far niente!
Zwei Stunden bin ich gelegen
An deinem schattigen Bord,
Nimm meinen Wandersegen,
Bevor ich ziehe fort:
Daß dich des Himmels Güte
vor malenden Backfischlein
Und angelnden Briten behüte
Und Wirten mit saurem Wein.
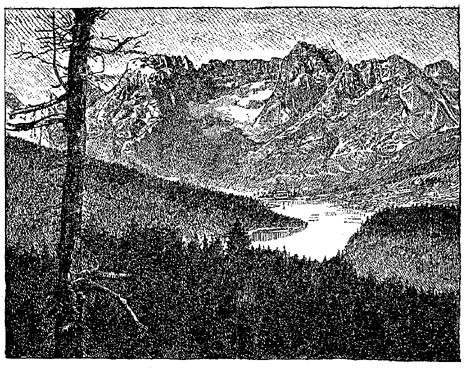
Misurinasee mit Sorapiß.
Unser nächstes Ziel war der Sorapiß, an dessen steiler Nordwand Jeanne Imink gerade hinauf wollte, eine Route, welche nur einmal zuvor gemacht worden war. Ein behaglicher Spaziergang führte uns durch den schönen Wald zu der prächtig gelegenen Pfalzgauhütte. Über dem benachbarten kleinen See neben dem Gletscher erhebt sich die Mauer unseres Berges im Halbkreis so hoch in die Lüfte, daß man es kaum begreifen kann, und dort schweift der Blick über die Wälder hinweg zu unsern wohlbekannten Gipfeln, dem Monte Cristallo, Piz Popena und den Cadinen. In der Hütte selbst war es urbehaglich. Das Proviantdepot enthielt alles, was das Herz nur wünschen konnte, und Damen verstehen nun einmal die edle Kochkunst ganz anders, als wir Männer. Was Wunder, daß ich mich da im Laufe des gemütlichen Abends verleiten ließ, die verschiedentlichen Bierflaschen zu leeren, die sich vom Vorjahr her noch im Proviantdepot vorfanden! Sie sollten sich fürchterlich rächen.
Wir gingen sehr früh weg am andern Morgen; denn die Tour war außergewöhnlich lang. Sie führte uns zuerst über den Gletscher in eine riesenhafte Schlucht, wie ich noch selten eine gesehen. In ihr ging es über zyklopische Blöcke und durch höhlenartige Risse, bis wir die offene Felswand erreichten, an der es wohl 6 Stunden lang in die Höhe ging. Das alles hätte ganz schön sein können, wenn nur das alte Bier vom Abend zuvor nicht gewesen wäre!
Nach mehrstündigem Klettern kam die Pièce de resistance Wir befanden uns auf einem breiten Bande, vor dem sich eine senkrechte, völlig glatte Mauer etwa 4 m hoch erhob. Es gab nur ein Mittel, um da hinaufzukommen. Ein Führer stellte sich auf die Schulter des andern und dann hoben wir die ganze »Maschine« in die Höhe, bis der oberste einen Griff erwischte und sich daran hinaufziehen konnte. Das weitere war Tierquälerei. Wie die Säcke wurden wir einzeln aufgehißt. Das Hängen muß eine Kleinigkeit dagegen sein, denn ich wenigstens habe die vom Seil verursachten Striemen noch acht Tage lang gespürt.
Endlich haben wir den Kamm erreicht, und nur noch eine Schlucht trennt uns von dem eigentlichen Gipfel. Aber das ist ja gar kein Gipfel, sondern geradezu ein Meer von Felskämmen, die sich in wirrem Durcheinander nach allen Richtungen hinaus erstrecken! Die Nebel huschen darüber hinweg, bald hier, bald dort, lassen sie verschwinden und wieder auftauchen, ein gewaltiges, wild ursprüngliches Bild. Wie lange sind wir da gesessen und haben uns gefreut an dieser schönen Welt mit den grünen Tälern und freundlichen Dörfchen dort unten, den gewaltigen Felsen und huschenden Nebeln ringsum! Jetzt zu des Lebens ganzem Ernst, zu der schwerwiegenden Frage, an der man nun einmal nicht vorbeikommt! Wie heißt es da doch?

»Hier ruht in Gott N. N. 26 Jahre lebte er als Mensch und 37 Jahre als Ehemann.«
Ja, alter Junggeselle, wenn es erst so weit ist und Hymens Fesseln winken, dann wird der Mensch abgestreift, um sich in jenes merkwürdige Zwischenwesen zu verwandeln, das aus lauter Rücksichten zusammengesetzt ist, stets fragend nach der Gattin schielt, die schreienden Kinder auf den Knien schaukelt, keinen Zug ertragen kann und höchstens noch in unbewachten Stunden wehmütig die Melodie vor sich hinsummt: »Schön ist die Jugend, sie kehrt nicht mehr!«
Und dazu sollte es nun auch mit mir kommen?
Was würden da schon meine Freunde sagen? Nun ja, meinetwegen! Aber würde ich mich darein finden können, war das überhaupt denkbar, nach solchen 36 Junggesellenjahren? Konnte ich denn meine Freiheit und Ungebundenheit missen, jene herrliche Rastlosigkeit, die mich immer so schön weiter trieb, und vor allem die Bergsteigerei, die mir doch nun einmal über alles ging? Wohl wußte ich ja, daß »sie« eine große Verehrerin meiner geliebten Berge war und schon versuchen würde, mir dort hinauf zu folgen. Aber würde sie das auch können, nachdem sie bis dahin so gut wie keine Touren gemacht? Würde nicht sofort das und jenes Bedenken oder Hindernis auftauchen und uns bald genug ein unerbittliches »Halt!« entgegenrufen? Was vermag denn der Einzelne gegen die Macht der Verhältnisse, an denen er sich höchstens den Kopf einrennt. Und dann war's eben auch um mich geschehen: »36 Jahre lebte er als Mensch und ...« Brrrrr!
Aber alter Freund, sagte es da auch leise in mir, wie kommst du denn dazu, es plötzlich mit der Angst zu haben? Du, ein Bergsteiger, der vor nichts zurückzuschrecken wähnte! Und wozu bist du denn der große Philosoph, der die Wandlungen dieses kleinen Erdendaseins mit olympisch gelassener Ruhe hinzunehmen vorgibt, wenn du so vor einem Schicksal zitterst, dem man doch nicht entgeht? –
So faßte ich denn den Mut des Unvermeidlichen, und dieser gab mir jenen unverwüstlichen Optimismus, der zu allem nur milde lächelt, jene unverfrorenste Zuversicht, an der alle Schwierigkeiten abgleiten, die bedingungslos auf ihr Glück baut, das ja bekanntlich auch dazu gehört auf dieser unvollkommenen Welt. Also mit einem Wort, ich war gefaßt auf alles, was konnte mir jetzt noch passieren? – wie war das doch damals bei meiner ersten Tatrareise, wo ich das Wandern lernte?
»Nun hab' ich mein' Sach' auf nichts gestellt,
Und mein gehört die ganze Welt.«
Sollte es bei der Ehe nicht ebenso sein, wie beim Wandern?
Doch hören wir nun, wie es mir erging!
Es war diesmal mehr als blinder Liebeswahn oder gar schwächliche Verliebtheit. Zeit meines Lebens war ich für eine nette Kameradschaft zwischen Mann und Frau gewesen, für das, was man damals »Emanzipation« nannte, für Emanzipation von der »gutbürgerlichen« Anschauung, daß das brave Gretchen immer nur die Augen niederschlagen müsse, um ihre Sittsamkeit zu zeigen, daß dreimal an einem Abend zusammen tanzen soviel wie eine Verlobung bedeute, daß die Frau für die Haushaltung und die Kinder da sei und sich nicht in andere Dinge zu mischen habe usw. Ich hatte auch schon manche nette Kameradschaft mit jungen Damen gehabt, hatte dieselbe nie mißbraucht und war durch meine exotische Sache immerhin etwas gewitzigt. Also unsere Beziehungen bauten sich auf einem kameradschaftlichen Verhältnis auf, woraus sich dann ganz allmählich die tiefere Neigung entwickelte.
Wir kannten uns schon über ein Jahr, und ich wußte genau, daß wir in allem prächtig zusammen stimmten, in unserer Zuneigung, unserer Unternehmungslust, in einem gesunden, natürlichen Wesen, das sich nicht in überirdischen Phantastereien erging. So erklärte ich mich denn eines Tages und nahm glücklich das Jawort entgegen. Soweit war alles in schönster Ordnung. Aber freilich: »Das Heiraten, sellen is nit so einfach!« hatte einst der gute Michel Innerkofler gesagt, und das Drum und Dran will überwunden sein, zumal es mir wahrlich nicht leicht gemacht wurde.
Betrachten wir also zunächst meine Nöte, in dieser Hinsicht.
Meine Braut war Engländerin und befand sich in Deutschland, um Musik zu treiben und Deutsch zu lernen. Ihr Vater wohnte in einem kleinen Städtchen in der Nähe von London, und sie hatte zwei Brüder und fünf Schwestern. Das war alles, was ich über ihre äußeren Verhältnisse wußte. Genügte es zum Heiraten? Also ich packte Weihnachten 1893 mein Köfferlein und fuhr englandwärts, wo »sie« sich seit einiger Zeit wieder befand.
Ich kam einen Tag früher an, als ich mich angesagt. Das hatte sich im letzten Augenblick so gemacht. Da stand ich also auf dem kleinen, unansehnlichen Bahnhof, nicht ohne Beklemmungen, denn in der Nähe nehmen sich die Dinge doch immer wieder anders aus, als aus der Ferne.
Zögernd gab ich mein Billett ab und fragte den Schaffner, wo Mr. Walters wohne?
»Welcher Mr. Walters?«
Die Frage war nicht gerade ermunternd.
»Nun, der mit den vielen Töchtern.«
Er wußte nun Bescheid, beschrieb mir den Weg, und so zog ich denn nachdenklich los. Vor allem betrachtete ich mir eingehend die einzelnen Häuser, nicht ohne dann und wann einen Stoßseufzer von mir zu geben, »Hm, wär' nicht übel, wenn er da wohnen würde!« Oder: »Hoffentlich geht dieser Kelch vorüber!« Schließlich, ganz in der Nähe, bekam ich vor einem recht wenig einladend aussehenden Haus beinahe Herzklopfen – um dann um so angenehmer enttäuscht zu werden. Kein Zweifel, jene stattliche Villa dort in dem großen Park war das gesuchte Heim.
Ja, ja, alter Junggeselle, Glück gehört eben auch dazu!
Als ich meinem Schwiegervater später die Sache erzählte, meinte er humorvoll, das Haus gegenüber, vor dem ich einen solchen Schrecken bekommen hatte, wäre gar nicht so übel gewesen. Man lasse sich da leicht durch die Außenfront täuschen, die gar nichts besage. Noch besser freilich wäre es gewesen, wenn ich ein Haus weiter, zu dem nächsten Nachbar, einem großen Londoner Bankier, gegangen wäre.
Nun, ich war durchaus zufrieden, wie es war, und fühlte mich bei der Braut und den vielen hübschen Schwägerinnen bald recht heimisch, zumal auch das Weihnachtsfest ganz nach deutscher Art abgehalten wurde und sich unsern Wünschen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten in den Weg stellten.
Wenn sich somit die Dinge hier über Erwarten gut anließen, so lagen sie bei meinen lieben Freunden und Bekannten schwieriger. Als ich nach Hause zurückgekehrt, bei einer kleinen Gesellschaft, die ich meinen Kameraden und ihren Frauen gab, mit meiner Verlobung herausrückte, lächelten sie nur milde und hielten die Sache für einen schlechten Witz. Wie sollte ein Mann wie ich dazu kommen, sich zu binden, wie sollte ein Mädchen einen solchen Freiheitsfanatiker nehmen! Nein, das glaubte man einfach nicht und lachte mich aus. Als dann die gedruckten Verlobungsanzeigen erschienen, war allerdings nichts mehr zu machen, und nun schwelgte alles in reiner Schadenfreude, daß ich doch noch gefangen worden sei und jetzt natürlich mehr als jeder andere unter den Pantoffel kommen werde.
»Und mit der Kraxelei ist's selbstverständlich auch aus! Ja, ja, so geht's!«
Als ich dann den mitleidig Lächelnden erklärte, daß gar nichts aus sei, wir vielmehr unsere Hochzeitsreise in's Gebirge machen würden, brach der Sturm von neuem los. Solche unverantwortliche Torheiten gäbe es nicht in der Ehe. Da müsse ich auch an meine Frau denken, und könne nicht einfach dort oben herumtoben wie bisher. Als ich auch dem standhaft Trotz bot, folgte ein bezeichnendes Schweigen. Na ja, dachte man augenscheinlich, er heiratet eben eine von jenen Bergsteigerinnen, so ein Mannweib, das überhaupt für nichts Feineres Gefühl hat.
Da ich nun in dieser Sache doch Partei bin, so möchte ich die Schilderung der Erscheinung und des Auftretens meiner Frau einem bekannten italienischen Schriftsteller überlassen, den wir einige Jahre später zufällig in Breuil trafen und der seine Eindrücke darüber veröffentlichte.
Edmondo de Amicis, der Verfasser von »Herz«, schrieb damals: »Nach allem, was man von ihr hörte, wurde sie mit Spannung erwartet, besonders von denen, die sie noch nicht kannten. Wir dachten, sie sei eine männliche, kriegerisch stolze Frau, ihrem riesenhaften Mann im Aussehen wie in der Konstitution gleich. Aber für uns alle war ihr Erscheinen eine angenehme Enttäuschung. Sie war groß, aber zart und schlank. Ein kleiner, blonder Kopf, den niedlichen Hals etwas vorgebeugt, zarte Züge, lebhafte milde Augen, ein süßes Lächeln, wie von einem träumerischen jungen Mädchen und eine wohlklingende, diesem Lächeln ganz entsprechende, kindliche Stimme. Dabei war sie außerordentlich einfach in ihrem Wesen und in ihrer Art zu sprechen eher Mädchen als Frau, graziös, beinahe schüchtern. Es machte einen merkwürdigen Eindruck, wie sie mit ihrer süßen Stimme von ihren Touren und den dabei ausgestandenen Mühen erzählte. Es war, als höre man eine junge Nonne kriegerische Melodien singen. Sie war allen sympathisch, sogar einigen Damen, die jedermann kritisierten. Am Tag nach ihrer Ankunft machte sie eine kleine Tour, und da man wußte, daß sie in Männerkleidung gehen würde, waren einige Neugierige auf der Lauer. Aber alle mußten zugeben, daß sie äußerst gewandt, ohne Ostentation, ganz der Würde und Liebenswürdigkeit ihres Geschlechtes entsprechend auftrat, so daß es niemand einfallen konnte, einen Scherz über sie zu machen.«
Also auch in dieser Hinsicht mußte ich meine »guten Freunde« enttäuschen.
Nun muß ich ja allerdings gestehen, auch jetzt noch erschien mir der Schritt in die Ehe so tiefgreifend, bedeutete eine solche Wendung ins Unbekannte, daß der Junggeselle in mir noch einmal mit elementarer Wucht hervorbrach und ich das unüberwindlich Bedürfnis hatte, ein letztes Mal meine Freiheit zu feiern, mich zum Abschied gründlich auszutoben. So kam es zu meiner Ostertour ins Berner Oberland, die einen völlig winterlichen Charakter trug und bei der ich meinen Zweck auch in hervorragender Weise erreichte.
Zunächst ging es hinauf zur Schwarzegghütte, wo ich mehrere Tage im tiefsten Hochgebirgswinter zubrachte.
Was wollte ich da? Nichts, als wieder einmal Mensch sein, Nur-Mensch, wollte kraxeln, am Feuer sitzen, Erbswurst essen, nasse Strümpfe bekommen, frieren, mit einem Wort mich noch einmal so recht unvernünftig jung und frei fühlen.

Eingang des Grindelwalder Eismeers.
Das alles habe ich aufs gründlichste genossen. Denn wenn auch angesichts der frühjahrlichen Lawinenverhältnisse von einer größeren Besteigung keine Rede sein konnte, so bot sich doch auf dem tief verschneiten Eismeer mit seinen Tausenden von Spalten, seinen großartigen Gletscherstürzen und Eisbrücken eine geradezu ideale Gelegenheit zu Klettereien, und ich kam in Situationen genug, wie sie bei ber schwierigsten Besteigung nicht schlimmer sein können. Dazu sternenklare Mondnächte über den fahlen Gletschern kaltes Dämmerlicht, heller Sonnenschein unter dem stahlblauen Himmel, schwere Wetterwolken und tobendes Schneetreiben, alles in der ungeheuerlichen Polarwelt des Grindelwalder Eismeers! Herz, was willst du noch mehr?! Interessant war auch der trotzige Ulrich Almer, einer meiner beiden Führer. Ein kleines, unscheinbares Männlein von unverwüstlicher Energie, war er eine jener Naturen, die sich überhaupt über nichts wundern, denen gar nichts befremdend vorkommt, mag es nun sein, was es will, also kurz gesagt, das richtige Vorbild für einen zukünftigen Ehemann. Drei Tage lang zogen wir dort oben herum, ziel- und planlos, kreuz und quer, über alles hinweg und freuten uns des Abends am Feuer unseres Tuns.
Zum Abschied kam dann noch ein Marsch über die Strahlegg nach dem Grimselhospiz. Da war zunächst ein prächtiges Nachtbild. Sternenklarer Himmel und vom Mond beschienener Schnee, dessen phosphoreszierendes Leuchten der wilden Landschaft ein eigen merkwürdiges, geisterhaftes Leben gab. Dazu die riesenhaften Bergkolosse, wie Schreckhorn, Finsteraarhorn, Eiger, an deren weiten, fahlen Steilhängen die rabenschwarzen Schatten in phantastischen Formen emporkrochen.
Jenseits der Paßhöhe dann ein kleines Abenteuer, indem der hinten befindliche Führer beim Abstieg in einen Bergschrund fiel. Ich war nicht wenig erschrocken, aber Almer in seiner kurzen Art nahm überhaupt keine Notiz davon.
»Der wird schon wieder herauskommen!«
Und richtig, bald erschien auch ein Arm, ein Kopf und schließlich der ganze Mensch an der Oberfläche, worauf Almer auch sofort und ohne ein Wort zu verlieren die pfeilschnelle Abfahrt an dem steilen Hang begann.
Ein entsetzlich mühevoller Tag folgte und eine dunkle Nacht, die die sich mehrenden Gletscherspalten kaum erkennen ließ. Auch jetzt war Almer prächtig. Fröhlich und ohne nur einen Schritt auszuweichen, übersprang er alles, was ihm in den weg kam, als ob es nichts Schöneres geben könne.
Endlich ein Nachtlager in einer aus rohen Blöcken gezimmerten Alphütte. Wir räumten erst den fußtief angewehten Schnee, unter dem sich etwas Heu befand, auf die Seite und versuchten zu schlafen. Aber das Heu bestand aus feuchten, moderigen Klumpen, und bald standen wir wieder auf, frierend und zähneklappernd, daß es zum Erbarmen war. Wohl fanden wir nun etwas Holz, mit dem ein kleines Feuer angezündet wurde, aber bald war es verbrannt, und unsere verzweifelten Versuche mit den Pickeln den schweren Stämmen Brennmaterial zu entreißen, waren so gut wie fruchtlos. Das flackernde Feuerlein brannte vollends ab, und schnatternd vor Kälte standen wir im Dunkeln.

Eiskletterei.
»Also legen Sie sich eben wieder hin,« meinte Almer, »Wir werden Sie schon anwärmen.« Das geschah, die beiden nahmen mich in die Mitte und drückten aus Leibeskräften von der Seite her. Dabei wurde ich doch einigermaßen warm und schlief den Schlaf des Gerechten bis um 7 Uhr morgens, während die andern schon längst aufgestanden waren und wie rasend auf und ab tobten, um sich zu erwärmen.
In dem einsamen, tief verschneiten Grimselhospiz wurde uns dann wieder am Feuer bei ungeheuren Mengen heißen Grogs geradezu mollig wohl, und wir zogen fröhlich das Tal hinab durch die weihnachtlich verschneite Landschaft mit ihren schneelastschweren Tannen und den herrlichen Bergeshöhen darüber, bis es bei Meiringen hinaus in den Frühling ging.
Damit hielt ich mich reif für die Ehe, ein Urteil, das ich im übrigen dem Leser überlassen möchte.
Nun die Vorbereitungen zur Hochzeitsreise!
Daß dieselbe ins Gebirge führen sollte, habe ich schon gesagt und war eigentlich selbstverständlich. Ebenso natürlich war wohl auch mein Wunsch, etwas Rechtes zu unternehmen. Man macht nun einmal nur eine Hochzeitsreise, und dann mußte ich doch auch meinen »guten Freunden« mit etwas Besonderem aufwarten.
Was aber sollte das sein?
Ich selbst war mir für meine Person darüber durchaus im klaren. Der Leser weiß, daß das Matterhorn es mir schon auf meiner zweiten Alpenreise angetan hatte, als es auf der Riffelalp so plötzlich und unerwartet in seiner ganzen Größe aus den Nebeln vor mich getreten war. Es war ein erstes Durchschauertsein von höheren Mächten gewesen, das haftete und immer noch in mir nachzitterte. Später hatte Whympers Buch mich zum eigentlichen Bergsteigertum angefeuert, meine Begeisterung für den Riesen noch gesteigert und durch das Interesse für seine Geschichte vertieft, die mir wie eine Tragödie allergrößten Stils erschien. Da war vor allem das dämonische Locken dieses Berges der Berge, der einen jeden in seinen Bann zwang und doch so mit seinen geheimnisvollen Schauern erfüllte, daß auch das neue, scheinbar keinen Halt kennende Geschlecht endgültig vor ihm zurückzuschrecken begann. So wurde er als Inbegriff der Unzugänglichkeit des Gebirgs die letzte sagenhafte Heimstätte jener phantastischen Gestalten, Riesen, Zwerge und Drachen, mit denen vergangene Jahrhunderte die Naturgewalten poesievoll verklärt hatten. Er fiel dann doch, aber nur, um diesen entscheidenden Triumph der neuen, zur Höhe strebenden Zeit in die größte Alpenkatastrophe zu verwandeln, die als ein furchtbares Memento in alle Zukunft hineinleuchtet, daß menschliche Kraft und Unternehmungslust ihre Grenzen haben und es noch höhere Mächte gibt, die wohl einmal außer acht gelassen, aber nie mißachtet werden können. Dazu kam das menschliche Interesse, das ich wie ein jeder für den Hauptträger dieser Tragödie, Edward Whymper, jenen Bergsteigerheros empfand, der bei aller Kühnheit so schwärmerisch veranlagt war, daß er von seinem Berg nicht lassen konnte, einem »törichten Verliebten« gleich, »der den Gegenstand seiner Neigung auch dann noch umkreist, wenn er einen Korb bekommen«; der immer und immer wieder nach dem Höchsten griff und trotz aller Widrigkeiten auch in der größten Niedergeschlagenheit nicht verzagte. Endlich diese überwältigenden Eindrücke dort oben, von denen er so packend zu berichten, die er mit dem ganzen Glanz der Poesie der Tat zu verklären wußte!
Wenn mich somit mein ganzes Herz nach dem Berge hinzog, so kam dazu noch, daß auch ich schon einmal dem Locken der Sphinx gefolgt und höhnisch von ihr abgewiesen worden war.
Es war gelegentlich meines Zermatter Aufenthalts 1886 nach der Pariser Reise gewesen. Angesichts der frühen Jahreszeit hatte der Berg nicht bestiegen werden können, und erst ganz zum Schluß meines Urlaubs zeigte er ein einigermaßen zugänglicheres Aussehen. Wenn alles klappte, so hatte ich gerade noch Zeit zu der Besteigung, aber auch keinen Tag länger. Ich versuchte es also auf gut Glück. Es wird mir unvergeßlich bleiben, wie ich noch in dunkler Nacht jene geheimnisvolle »Schranke«, die den Berg umgibt, überschritt und in die phantastischen Felsregionen dort oben eindrang. Tiefer Schnee bedeckte die weiten Hänge, und die Mühe war groß. Immerhin kamen wir, wenn auch langsam, vorwärts und erreichten schließlich den unteren Teil der »Schulter«. Ein steiles Firnfeld zog sich vor uns in die Höhe, und unmittelbar darüber erhob sich drohend der mächtige Gipfelblock. Zuversichtlich sah ich hinauf. Sei's um einige Stunden, und er war besiegt. So dachte ich wenigstens. Da begannen meine Führer, zwei im übrigen recht minderwertige Leute, zu streiken. Es sei schon spät, der Schnee schlecht usw. Ich war wie vom Donner gerührt. Aber was half es, daß ich mich vom Seil losband und allein weiterzugehen versuchte! Die beiden hatten keinen Ehrgeiz.
Es war ein trauriger Rückzug, und der Berg trieb geradezu Hohn mit mir. In der Hütte waren schon mehrere Partien versammelt, um ihn nach dem schönen Sommertag zu besteigen, was denn auch gelang, so daß ich sie am andern Morgen von Zermatt aus noch auf dem Gipfel beobachten kannte und unter dem Achselzucken der Umstehenden weggehen mußte. Daß ich dem Berg das nicht vergaß, war klar, und gerade die Hochzeitsreise erschien mir als eine besonders günstige Gelegenheit, um mich zu rächen.
Nun war es gewiß ein günstiges Zusammentreffen, daß sich auch meine Braut im Banne des großen Berges befand. Sie schreibt darüber:
»Es war meine Mutter, die mir die Liebe zu den Bergen ins Herz pflanzte. Obgleich selbst keine gute Fußgängerin, liebte sie doch nichts mehr, als den Aufenthalt in den Alpen. Nicht an den viel begangenen fashionablen Mittelpunkten. Nein, sie pflegte nach hochgelegenen kleinen Plätzen zu gehen, wo sie den Bergen nahe war und sie in ihrer ewigen Schönheit und Eigenart genießen konnte. Zum erstenmal nahm sie mich 1889 mit sich nach der Riffelalp bei Zermatt, wo wir mehrere Wochen blieben.
Nie werde ich den Eindruck vergessen, den da das Matterhorn auf mich machte, wir waren in strömendem Regen angekommen, ohne etwas zu sehen. Beim Erwachen am andern Morgen traute ich meinen Augen nicht, als der Berg über und über mit frischem Schnee bedeckt, einem wunderherrlichen Bilde gleich, durch den Rahmen meines Fensters hereinsah. Es kam da zu einer Liebe auf den ersten Blick. Rasch zog ich mich an und rannte hinunter zum Teleskop, um eine nähere Bekanntschaft mit der Schönheit zu machen. Als ich dann ein paar Tage später eine Partie auf dem Berg entdeckte, kannte meine Erregung keine Grenzen, wie großartig mußte es sein, diese scheinbar unersteiglichen Felsen zu erklettern, auf dem herrlichen Gipfel zu stehen, nur noch den Himmel über sich und die ganze kleine, unbedeutende Welt zu Füßen! Es wurde der Traum meiner Jugend, und Bergsteiger waren richtige Helden für mich. Damals freilich konnte keine Rede von einer Verwirklichung meines Traumes sein. Wohl aber engagierte meine Mutter für mich und meine Schwester einen Führer, der uns erst auf Edelweißspaziergänge nahm und schließlich auch hinauf auf das Breithorn und den Furggengrat. Ein andermal waren wir in Beatenberg und Mürren im Berner Oberland, ohne jedoch Touren machen zu können und 1892 in Partenkirchen, wo ich mit meiner Schwester die Zugspitze und Dreitorspitze bestieg. Daß dabei das Matterhorn noch immer in meinem Herzen lebte und nach alledem, was mir mein Bräutigam darüber erzählte, erst recht das Ziel meiner Sehnsucht war, brauche ich wohl kaum zu sagen.«
Wenn somit meine Braut bezüglich des ersten und hauptsächlichsten Zieles unserer Reise durchaus mit mir übereinstimmte und fröhlich das Unternehmen wagen wollte, so war der Entschluß dazu angesichts ihrer mangelnden Übung doch recht schwer für mich. Denn eines stand fest: wenn ich mich überhaupt mit dem Berg einließ, dann konnte ich mich mit der Besteigung auf der üblichen Zermatter Route nicht begnügen. Bekanntlich hat der Riese ein doppeltes Gesicht. Wohl hat ihm sein grandioser Anblick von dem vielbesuchten Zermatt aus den Ruhm des Berges der Berge verschafft und erhält ihm denselben dauernd, aber seine Besteigung ist hier verhältnismäßig einfach, streckenweise auch monoton. Demgegenüber zeigt die weniger eindrucksvolle, aber vielgestaltigere Südseite im einzelnen eine Großartigkeit und Abwechslung, die nicht mehr übertroffen werden kann. Dort haben auch die großen Kämpfe um die Bezwingung des Berges stattgefunden, die ihn zum klassischen Boden des Alpinismus gemacht haben. Wer ihn also wirklich kennen lernen will, dem kann die Zermatter Route nicht genügen, und mein Plan ging deshalb dahin, ihn von Süden nach Norden zu überschreiten. Freilich, diese alpine Tour par exellence ist nicht bloß recht schwierig und außerordentlich lang, sondern auch durch die bekannten Wetterlaunen des Berges mit seinen plötzlichen, aus heiterem Himmel kommenden Gewittern stark verrufen. Wer aber an ungünstiger Stelle von einem dieser häufigen, unvorherzusehenden Stürme überrascht wird, kämpft um sein Leben, und schon mancher ist dabei zu Grund gegangen. Sollte ich aber darum mein Vorhaben aufgeben, das unsern beiderseitigen innersten Wünschen entsprach? Nun erklärte allerdings meine Braut bezüglich der zu überwindenden Schwierigkeiten ruhig: »Ich liebte meinen Bräutigam und hatte ein unbegrenztes Vertrauen zu ihm. Er würde alles schon recht machen.« Aber durfte ich mich damit zufrieden geben? Genügte das Vertrauen der Liebe, um das Wagnis einer solchen Tour zu rechtfertigen? Und doch lockte die große Sphinx mit unwiderstehlicher Gewalt. Da verfiel ich in meiner Bedrängnis auf einen Ausweg. In der Überzeugung, daß eine erfahrene Besteigerin meiner jungen Frau doch manchen guten und nützlichen Rat geben, sie auf das und jenes aufmerksam machen, ihr in allerhand Kleinigkeiten helfen könne, machte ich den Vorschlag, Jeanne Immink zu dieser Tour einzuladen. Das geschah denn auch und wurde beiderseits fröhlich angenommen.
Daß auch dieser Entschluß lebhaft kritisiert wurde, konnte natürlich nicht ausbleiben, und wenn einer meiner ganz klugen Freunde meinte, diese Hochzeitsreise mit zwei Frauen sei ihm ein »psychologisches Rätsel«, so gab er damit nur der allgemeinen Überzeugung Ausdruck.
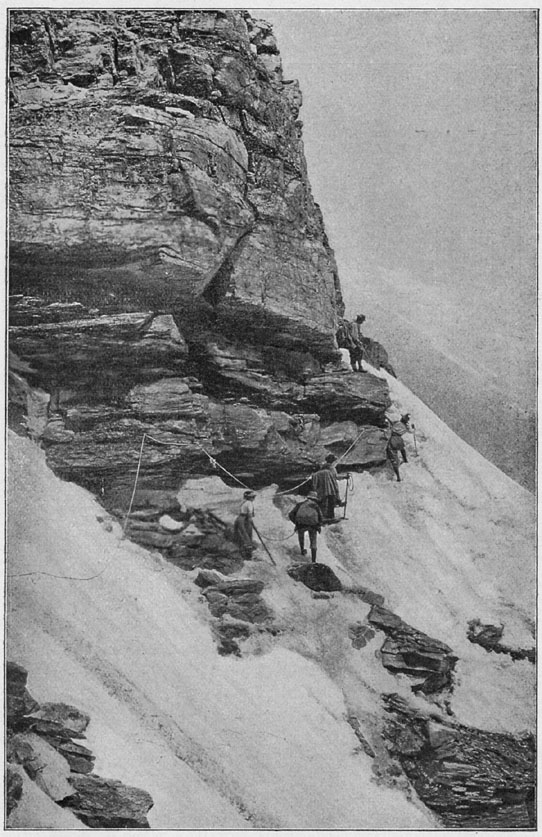
An den Felsen der Tête de Lion.
Nun schien allerdings ein widriges Geschick alle unsere Pläne zunichte machen zu wollen. Kurz vor der Hochzeit erhielt ich die Nachricht, daß sich meine Braut beim Tennis den Fuß verstaucht habe und überhaupt nicht auftreten könne, was nun? Wohl rannte ich von einem Doktor zum andern, natürlich nur um ein Achselzucken und Kopfschütteln zu erhalten. So richtete ich mich im stillen auf eine ruhmlose Badekur ein und machte mir meine Gedanken über das eheliche Leben. Doch es kam anders. Schon nach 8 Tagen war die Fußgeschwulst verschwunden, und bald dachte kein Mensch mehr daran.
Nun die Hochzeit! Fröhlich fuhr ich den Rhein hinunter und dann über den Kanal, um mir die Braut zu holen. Aber wenn man 36 Jahre seine Freiheit so genossen hat, wie ich, dann ist so eine Zeremonie doch immerhin eine etwas nachdenkliche Sache. Als sich an jenem denkwürdigen Vormittag in dem schwiegerelterlichen Haus unter allen Vorbereitungen so gar niemand um mich kümmerte und ich mir so völlig überflüssig vorkam, war mir doch nicht so recht wohl. Ja, ja, das Heiraten, sellen is nit so einfach! Da nahm sich mein vortrefflicher Schwager, der augenscheinlich mit mir fühlte, meiner an und schlug mir einen Spazierritt vor. Das vertreibe »trübe Gedanken« am besten. So galoppierten wir denn durch die benachbarten Downs, daß es eine wahre Freude war, und ließen uns verleiten, auch noch eine weitere Schleife zu reiten. Ganz durchbrennen konnte ich ja allerdings nicht mehr, nachdem England nun einmal eine Insel war, ja, ich bekam sogar keinen kleinen Schreck, als ich plötzlich bemerkte, daß wir uns verspätet hatten und nur mit knapper Not rechtzeitig zur Trauung kommen konnten. Alter Freund, sagte ich vorwurfsvoll zu mir, jetzt ist die Sache nicht mehr so einfach, jetzt bist du eben gebunden und hast deine Pflichten. Basta! So stürmten wir denn in richtiger Steeplechase geradewegs auf unser Ziel los. Aber wir hatten die Rechnung ohne den Besitzer des »Privatwegs« gemacht, auf dem wir uns befanden. Derselbe hielt uns an, erklärte, daß wir uns auf verbotenem Grund befänden und mit ihm zum Rathaus zu gehen hätten, um festgestellt und bestraft zu werden. Wohl parlamentierte mein Schwager hin und her mit dem Mann, ohne jedoch zum Ziel zu gelangen, bis ich dem Grimmen erklärte, daß ich in einer halben Stunde heiraten und da sozusagen doch auch dabei sein müsse. Da sah mich der Mann lange nachdenklich an und ließ uns ziehen. Augenscheinlich hielt er mich für gestraft genug. So kam es, daß ich doch noch rechtzeitig getraut wurde. Wer kann seinem Schicksal entgehen!
Über die Hochzeitsreise wurden nicht mehr viele Worte verloren. Meine Schwiegermutter ergab sich angstvoll in das Unvermeidliche und verlangte nur tägliche Telegramme, mein Schwiegervater aber meinte klugerweise: »Das wird eine schöne Erinnerung für das ganze Leben sein.«
Drei Tage darauf waren wir in Zermatt, wo uns Jeanne Immink am Bahnhof mit den Führern erwartete.

Italienischer Matterhorngipfel.
Daß meine junge Frau zu der Matterhorntour erst einiger Übung bedurfte, war klar, und ich hatte das auch in Aussicht genommen, aber ich muß gestehen, daß ich es recht ungeschickt anfing. Mein nächster Plan ging nämlich dahin, den Monte Rosa zu besteigen, der zwar höher ist als das Matterhorn, aber durch die auf einem seiner Gipfel befindliche Capanna Margherita eine vorteilhafte Einteilung der zu leistenden Arbeit ermöglichte. Dort oben gedachte ich eine Nacht zuzubringen und dann über den Hauptgipfel abzusteigen. An sich war das durchaus keine schwierige Tour, die keinerlei Gefahr bot, aber sie führte in zu große Höhen und war wegen des tiefen und weichen Schnees zu mühsam. Nicht etwa für meine Frau, sondern – so hat die Ehe nun einmal ihre Überraschungen – für mich. Doch greifen wir nicht vor.
Wir hatten zunächst einen schönen und warmen Abend an den Plattjefelsen am Fuß unseres Berges, wo ein Zelt für uns aufgeschlagen war, da eine Hütte hier damals noch nicht bestand. Bis spät in die Nacht hinein lungerten wir gemütlich herum, freuten uns der großartigen Ausblicke und träumten fröhlich von den Dingen, die da kommen sollten. Weniger angenehm war allerdings das enge Zelt mit seinem steinharten Boden, in dem von Schlafen kaum die Rede sein konnte. Daß am andern Morgen Föhnwetter herrschte, der Schnee sehr weich war und die Führer schlechtes Wetter prophezeiten, kümmerte mich wenig: So schnell gab ich den einmal gefaßten Plan, der dazu noch in Zermatt bekannt geworden war, nicht auf. Nun kamen wir ja auch nach gut zwölfstündigem Marsch in unserer 4559 m hohen Hütte an, aber das Waten in dem tiefen Schnee und die noch gänzlich ungewohnte Höhenluft bewirkten, daß ich schließlich – zum einzigen Male in meinem Leben – bergkrank wurde und mich nur mühsam zu dem sturmumtobten Asyl hinaufschleppen konnte, wo ich die Nacht in völliger Apathie verbrachte. Es war mir dabei nur ein geringer Trost, daß dann auch die andern, einschließlich Führer, von der Krankheit befallen wurden. Am andern Morgen, wo der wütende Sturm noch immer die Hütte umbrauste, gab es nur eine Rettung: so rasch wie möglich wieder hinunter! Mit Aufbietung aller Kräfte stürmten wir den Hang hinab, um in der tieferen, zuträglicheren Luft allmählich wieder in eine normale Verfassung zu kommen.
Dieser erste, gründliche Mißerfolg war natürlich wenig aufmunternd, wenn ich mir auch aus dem eigenen Versagen weiter nicht viel machte und meinen bergsteigerischen Ruf schon wiederherzustellen gedachte, so waren doch Frau Mauds Begeisterung und Selbstvertrauen einigermaßen ins Wanken gekommen und mußten erst wieder gehoben werden, ehe ich an unsere große Unternehmung denken konnte.
Das nächste Mal fing ich die Suche geschickter an. Wir machten zunächst den prächtigen Spaziergang zu der am Fuß unseres Berges großartig gelegenen Schweizer Matterhornhütte, wo wir die Nacht zubrachten, um tags darauf ein Stück weit an den verhältnismäßig leichten Felsen emporzuklettern. Das gefiel Frau Maud schon wesentlich besser. Sie schreibt darüber: »Ich freute mich riesig über das abenteuerliche Leben und Treiben in der Hütte. Der Spaß, uns unser Essen selbst zu kochen, die Vorbereitungen für den folgenden Tag, die Schwierigkeiten, die es machte, daß man für nichts Platz hatte und schließlich alles in den Rucksack warf, das Strohlager, der pfeifende Wind draußen während der Nacht, das alles erschien mir höchst interessant und unterhaltsam. Je abenteuerlicher, um so besser! Und wie freute ich mich über die Kletterei! Das war doch ganz etwas anderes als die Schneewaterei am Monte Rasa. Auch fand ich dabei nicht die geringste Schwierigkeit, und es machte mir die größte Freude, daß mein Mann mit mir zufrieden war. Es war mein Stolz, überall mit ihm gehen zu können, wohin er wollte.«
Ebenso erfrischend war dann auch der herrliche Spaziergang über das Gebirge nach Breuil mit seinen Ausblicken auf die großartige Eiswelt ringsum und dem abwechslungsreichen Marsch hinunter nach den italienischen Gefilden.
Nachdem wir so glücklich an dem Südfuß unseres Berges angelangt waren, beschloß ich zunächst einmal zu der halbwegs unter dem Gipfel gelegenen italienischen Matterhornhütte zu gehen. Dabei bekam Frau Maud gründliche Gelegenheit zu Klettereien aller Art und Schwierigkeit, wir konnten uns auf dem »klassischen Boden des Alpinismus« umsehen und dann vielleicht die Überschreitung des Riesen kurz entschlossen wagen.
Der Marsch da hinauf führt erst nach dem Fuß der Tête de Lion, einem Vorberg, an dessen Felsen es wagrecht zu dem Col de Lion hinübergeht, worauf dann der eigentliche Berg betreten wird. Er ist geradezu fabelhaft abwechslungsreich und von denkbarster Großartigkeit und Wildheit. Man kann sich kaum etwas Gewaltigeres vorstellen, als wenn bei jener bekannten Ecke am Fuße der Tête de Lion sich so plötzlich und unerwartet der Blick auf die ungeheuren Felsen des Riesen mit ihren unermeßlichen Steilwänden, ihren phantastischen Blöcken, Türmen, Zacken und schwindelnden Graten eröffnet, eine finstere Welt für sich, die die ganzen Schauer des Unbegreiflichen, Unfaßbaren und Unerhörten auf die Seele des Eindringlings wirft. Es gibt kaum etwas Mächtigeres, als das schmale Felsentor des Col de Lion mit seinem reizvollen, fensterartigen Durchblick auf die fernen Schneeberge. Dann das Betreten des Berges selbst, ein weihevoller Moment, den man nicht mehr vergißt; die schwierigen Felsen darüber, die einem nach Tyndall »das Blut in den Adern erstarren machen« und endlich der verblüffende Anblick der beiden, scheinbar an den senkrechten Felsen klebenden Hütten des »Großen Turmes«, die ein so trotziges und doch zugleich anheimelndes Wahrzeichen menschlichen Unternehmungsgeistes in dieser ungeheuerlichen Öde bilden. Ich muß sagen, so groß auch meine Erwartungen gewesen, sie wurden von der Wirklichkeit weit übertroffen und mein ganzes Sein im Tiefsten und Innersten ergriffen. Das alles war mir wie eine Offenbarung.
Wie aber erging es Frau Maud? Sie nahm die Sache merkwürdig leicht.
»Die Tour machte mir einen großartigen Spaß. Erst freuten mich die hübschen Blumen auf den schönen Wiesen, und dann war es mir ein Genuß, immer höher zu kommen, immer mehr auf die Welt dort unten hinabzublicken. Die Freude an der nun folgenden Kletterei war wohl zum großen Teil eine rein physische. Das Gefühl der Kraft: ich kann es, eiferte mich an. Dazu kam das Vergnügen, Schwierigkeiten zu überwinden, und meinem Mann zu zeigen, daß er sich nicht in mir getäuscht habe, daß ich ihm auch in seinen Bergen ein ebenso guter Kamerad sein könne, wie im Tale. Auch kargte er bald nicht mit seiner Bewunderung, was mir große Freude machte und ein mächtiger Ansporn war, der mir mehr half als alle Übung. Im übrigen kam mir unsere Auffassung vom Sport zugut. Wir waren dazu erzogen, uns zu zwingen, gegen Schwierigkeiten anzukämpfen, eine einmal angefangene Sache unter allen Umständen zu Ende zu führen, kurz, ich sah die Tour durchaus nicht bloß als ein Vergnügen an. An den Blick in die Tiefe gewöhnte ich mich rasch. Von den zahlreichen an dem Berge verankerten Seilen machte ich so wenig als möglich Gebrauch und war entsetzlich ärgerlich, daß mir an der schwierigen Stelle im ›Kamin‹ schließlich doch geholfen werden mußte.«
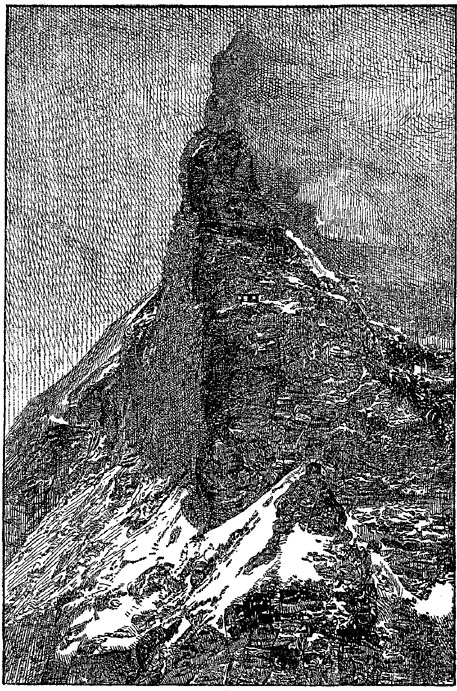
Der »Große Turm« mit den beiden Hütten.
Nachdem so alles über Erwarten gut gegangen, war es doppelt schön, nun auch unsere eigenartige, so ganz von der Welt abgeschlossene Lage zu genießen und die grandiosen Eindrücke dort oben in Ruhe auf uns einwirken zu lassen, wo alles geradezu ins Unermeßliche gesteigert ist. So kletterten wir einen vollen Tag lang an den Felsen des Berges herum, hinauf zu der alten Hütte, auf den »Großen Turm« und besahen uns die Stelle, wo Whympers Rivale Carrel seinen Namen in den Fels gemeißelt hatte, als Zeichen, daß der Berg ihm und sonst niemand gehöre. Weiterhin überschritten wir das heikle »Leichentuch«, erkletterten das Seil, das Tyndall einst zurückgelassen, tummelten uns auf dem schwindelnden »Hahnenkamm« mit seinen, jedem Schwergewicht scheinbar spottenden Blöcken und besuchten die an der »Crawatte« gelegene oberste Hütte, die einst mit so geräuschvoller Begeisterung erbaut worden war und nun nur noch an die Vergänglichkeit der Zeiten erinnert. Wie hat uns das alles interessiert, wie haben wir geschwelgt in den maßlos großartigen Ausblicken, wie hat uns das romantische Leben in der kleinen Hütte gefreut und angeheimelt! Wir hätten wochenlang da oben bleiben können, umwoben von dem Geist des mächtigen Riesen, der uns so ganz mit seinen Rätseln und Schauern erfüllte. Auch noch anderes, Persönliches kam für mich hinzu, um diesen Tag zu einem so unvergeßlichen zu machen: ein Stolz, ein Jubel über Frau Maud, die mit solchem Interesse meinen Erzählungen folgte, alle Anstrengung und Gefahr mit solcher Selbstverständlichkeit auf sich nahm und immer wieder neues, tieferes Leben in mir weckte. Ja, alter Junggeselle von damals, wie klein begannst du mir allmählich vorzukommen!
Der Entschluß zu der eigentlichen Besteigung des Berges wurde mir am andern Morgen durch mehr als zweifelhaftes Wetter recht schwer gemacht, aber ich wagte ihn. Allerdings nicht, ohne einen Träger hinüber nach dem auf der anderen Seite des Berges befindlichen Schwarzseehotel zu schicken, um unser Unternehmen dort mitzuteilen. Meine Besorgnisse waren auch nicht ungerechtfertigt; wir sollten die ganze Wildheit und Tücke des dämonischen Berges zu spüren bekommen.
Zunächst ging alles gut. Durch huschende Nebel, die all die riesenhaften Details und Ausblicke noch vergrößerten, stiegen wir hinauf zu dem Pic Tyndall, einem mächtigen Vorsprung der Bergeskante, von dem aus ein scharfer Grat zu dem letzten Gipfelblock hinüberführt. Der Blick von da ist wohl einer der großartigsten der ganzen Alpenwelt. Obgleich man sich schon in einer Höhe von 4200 m befindet, erhebt sich der Riese scheinbar so hoch und mächtig wie nur je in die Lüfte. Ich muß gestehen, daß sein Anblick mich in meinem Vorhaben doch etwas stutzig machte, zumal die Nebel bis zu uns heraufdrangen, und das Wetter jeden Augenblick umschlagen konnte. Immerhin wurde der Weitermarsch gewagt und mit allseitigem Beifall aufgenommen. Frau Maud insbesondere erklärte mir später, sie habe schrecklich Angst gehabt, ich werde sagen, die Sache sei zu schwer für sie, und umkehren.
Der Marsch über den Tyndallgrat hat einen ganz merkwürdigen Reiz. Man geht da eine halbe Stunde lang wie auf des Messers Schneide, teils über Firn, teils auf Fels, und die Abgründe zu beiden Seiten sind so ungeheuerlich, daß sie jeglicher Vorstellung spotten. Pikant ist auch die »Enjambée«, eine Schlucht im Grat mit einem Felszacken darin, über die man in zwei weiten Sätzen hinwegspringt. Der Anstieg zum Gipfel war sehr steil, und insbesondere die Ersteigung der »Echelle Jordan«, einer ziemlich brüchigen und schiefen Strickleiter, die an dem ausgebauchten Fels hängt, eine recht kitzlige Sache. Dann aber ging es trotz aller Schwierigkeiten rasch an dem riesenhaften Block in die Höhe, bis wir den italienischen Gipfel erreichten, glücklich, triumphierend, erwartungsvoll und – in dickem Nebel, der sich plötzlich von oben herab senkte.
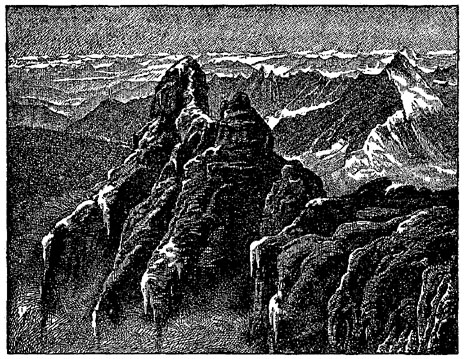
Rückblick auf den Tyndallgrat.
Da waren wir also an dem ersehnten Ziel, die Sphinx aber hatte sich verschleiert und wir sahen nichts. Auch dem herrlichen Übergang auf dem scharfen Grat zu dem Schweizer Gipfel war ein großer Teil seines Reizes genommen, wenngleich die trotzigen Details riesenhaft hervortraten. Dort warteten wir dann wohl eine Stunde lang vergebens auf Aussicht, bis wir schließlich wohl oder übel und natürlich schwer enttäuscht den Abstieg antreten mußten; denn noch lag ein weiter und schwieriger Weg vor bzw. unter uns.

Auf dem Gipfelgrat des Matterhorns. (Nach Boppa.)
Er hat sich als ein solcher erwiesen.
Nach einem kurzen Steilabstieg über Schnee und gefrorenes Geröll kamen wir an jenen senkrecht abstürzenden Felsgrat, den man als die Kante des einem Haus ähnelnden Gipfelblockes bezeichnen kann. Es ist der schwierigste Teil des ganzen Weges, an dem zahlreiche Seile und klirrende Ketten herabhängen. Er ist so steil und nach allen Seiten zu frei gelegen, daß wir froh an den Nebeln waren, die uns den Blick in die Tiefe verbargen.
Dann wurde die »Schulter« erreicht, ein scharf gezackter Felsgrat, der zu jenem steilen Schneefeld hinunterführt, auf dem ich einst hatte umkehren müssen. Unerreichbar war damals der mächtige Gipfelblock vor mir gestanden, und mit Sehnsucht und Groll im Herzen hatte ich den Rückweg antreten müssen. Jetzt kam ich siegreich von oben herab, aber der ersehnte Gipfel war mir so fremd wie nur je. Hatte der grimme Berggeist mich wieder verspotten wollen?
Da plötzlich wurde ich in meinen Träumen jäh unterbrochen. Ein helles Leuchten, nur wenige Schritte entfernt, ein fürchterlicher Krach, und betäubender Donner rollt drohend an den weiten Felswänden entlang. Der Blitz hat in nächster Nähe eingeschlagen, und ein Gewitter entladet sich, wie es schrecklicher nicht gedacht werden kann. Wie erstarrt vor Schreck stehen wir da und hören in dem Toben des Unwetters nur noch das Sausen unserer Pickel und das Knistern der Haare in der von Elektrizität geschwängerten Luft.
»Vorwärts, vorwärts!« schreien die Führer, und in wilder Hast, halb springend, halb rutschend, geht es an dem steilen Firnhang hinab. Blitz auf Blitz schlägt rings um uns ein, furchtbar dröhnt der Donner, der wütende Sturm peitscht uns den stromweise herabstürzenden Regen und Hagel ins Gesicht, und es ist, als habe sich die ganze Natur gegen uns verschworen. Wilde Szenen spielen sich ab. Wir haben die Felsen unterhalb des Firnfeldes erreicht, und die ringsum einschlagenden Blitze treiben uns bald hierhin, bald dorthin. Beständig werden durch das allzu hastige Klettern Blöcke losgelöst. »Achtung, Achtung!« ertönt es immer wieder; ein Sprung auf die Seite, und prasselnd donnert das Gestein vorbei, hinunter in die unermeßliche Tiefe. Jetzt erst wird es klar, welche Abgründe sich unter uns befinden. Dazu diese beständigen Blitze in nächster Nähe, dieses grausige Knistern der Pickel und Haare, das man trotz Wetter und Sturm selbst noch von den anderen her hört. Nur gut, daß wir wenigstens den schwierigsten Teil des Weges schon hinter uns haben! Wir wären dort oben niemals weiter gekommen.
Aber wenn wir gehofft hatten, daß das Gewitter sich nur auf die oberen Teile des Berges beschränke, so daß wir durch rasches Vorwärtsstürmen aus ihm herauskommen würden, so erwies sich das als trügerisch. Vier volle Stunden waren wir der Wucht des Unwetters preisgegeben, kämpften uns weiter durch Regen, Sturm und Blitze. Erst nachdem wir die verfallene obere Hütte hinter uns hatten, klärte sich der Himmel einigermaßen auf, und man sah tief unten die bewohnten Regionen.
»Hallo, die Sonne!«
Hallo, hallo! tönt es von unten herauf. Man konnte Gestalten erkennen, und eine ganze Karawane von Führern rückte an, um uns zu helfen, was wir jetzt allerdings nicht mehr nötig hatten. Bald war dann die untere Hütte erreicht, ein prasselndes Feuer und ein wärmender Grog erwarteten uns, und kurze Zeit darauf saßen wir in geborgten Kleidern beim fröhlichen Mahl um die Tafel des Schwarzseehotels. Und welchen Spaß machte es mir Tags darauf in Zermatt, wo »die beiden Frauen auf der Matterhornhochzeitsreise« die Sensation des Tages bildeten, Frau Maud mit ihren 21 Jahren im weißen Mädchenkleid zu zeigen, das sie doppelt jung und kindlich erscheinen ließ. Sie hatte sich glänzend gehalten und war den schwierigsten Lagen durchaus gewachsen gewesen. Auch Jeanne Imminks, die nun ihre Aufgabe für erfüllt hielt, sei noch einmal dankbar gedacht. Als »zweite Frau« hatte sie sich der »Rivalin« getreulich angenommen, war ihr mit Rat und Tat zur Seite gestanden und hatte uneigennützig ihr redlich Teil zum Gelingen beigetragen. Kein Zweifel, es war ein glücklicher Gedanke gewesen, sie mitzunehmen.
Wie aber stand es nun eigentlich mit unserer Unternehmung? Wohl hatten wir den Riesen trotz allen Wütens besiegt. Aber war das denn ein Sieg? Nachdem wir nichts dort oben gesehen hatten! Sollten wir uns damit begnügen, gewissermaßen auf halbem Wege stehen bleiben? Nein, die Sphinx mußte uns alles zeigen! Und sie zeigte es. Zwar wurden wir bei unserem nächsten Versuch schnöde zurückgetrieben und mußten in strömendem Gewitter Schutz in der Schweizer Hütte suchen, aber wenige Tage darauf standen wir doch wieder oben. Bei herrlichstem Wetter waren wir über die Schweizer Seite hinaufgestiegen, hatten die prächtig gelegene Ruine der alten obern Hütte, die darüber aufragenden mächtigen Türme bewundert und fröhlich den schwindelnden Aufstieg an der Kante des Gipfelblockes gemacht, um jetzt frei hinausschauen zu können über die Lande, soweit das Auge reichte.
So hatten wir also voll gewonnen, uns zu einem jener Momente hindurchgerungen, die man nicht vergißt, die dem ganzen Leben ihre Weihe geben. Wer wird es Frau Maud verdenken, wenn sie darüber jubelte und sagt: »Mir war als lebe die Seele des Matterhorns in mir auf, diese Verkörperung von königlichem Trotz und stolzer Größe, die nichts neben sich duldet. Wohl hatte ich zunächst ein unbeschreibliches Gefühl der Einsamkeit, als sei ich mitten in der Luft gefesselt über dieser äußersten Welt; denn die Flanken des Berges sind so steil, daß man nur eine ganz kurze Strecke an ihnen hinuntersieht. Aber dieses Gefühl der Einsamkeit machte bald dem trotzigen Stolz Platz, den einsamen König besiegt zu haben. Ich fühlte mich selbst als Königin über alle Lande dort unten. Vielleicht erscheint das als Anmaßung, aber das Gefühl war zwingend und unauslöschlich; ohne es eigentlich zu wollen, hatte ich die Idee des Berges in mich aufgenommen.«
Nun, auch ich fühlte mich als König und mußte an ein anderes Wort der tapfern Gefährtin denken, das den Jubel über unsere gelungene Tat, wie über die Schönheit dort draußen noch verdoppelte, mich dankbar an die nicht weniger große Welt in dem eigenen Innern erinnerte: »Ich liebte meinen Mann. Das ließ mich alles wagen und siegreich durchführen.«
Nachdem ich Frau Maud so die düstere Felsenwelt des grimmen Matterhorns gezeigt, sollte sie nun auch in die strahlende Eisespracht der Schneeberge eingeführt werden. Daß es sich dabei nur um die zweite wahrhaft große Schönheit der Schweiz, die Jungfrau, handeln konnte, war für uns von Anfang an klar. Also hinüber ins Berner Oberland!
Was dieses Gebirge bedeutet, weiß ein jeder, der auch nur einmal die Nordschweiz betreten hat. Bis zum Bodensee, dem Schwarzwald und den Vogesen leuchten die Alpen hinaus in die Lande, ein schneeweißer Wall von Bergen, eine unermeßliche Anzahl von Spitzen und Zacken, die in ihrer Vielheit das Auge verwirren. Ein Bild aber prägt sich dem Beschauer sofort unauslöschlich ein: der Blick auf das Berner Oberland. Stolz hebt es sich aus dem übrigen Volk von Bergen heraus, und seine zahlreichen Gipfel dominieren das Zackengewirre durch überragende Höhe und packende Eigenart. Kein Zweifel, das Berner Oberland ist die Perle unter den Nordalpen. Aber so mächtig sich auch seine Gipfel, ein Finsteraarhorn, Schreckhorn, Wetterhorn, erheben, sie treten doch zurück hinter dem Dreigestirn der Jungfrau mit ihren beiden Genossen, Mönch und Eiger, das alles andere stolz beherrscht. Und was wir aus der Ferne bewundern, das gewinnt noch an Macht und Größe, bis auf der Wengernalp der Höhepunkt erreicht ist. »Eine Welt voll Pracht und Herrlichkeit« erhebt sich vor uns, so großartig in ihrem Aufbau, so vielseitig in ihren Formen, so herrlich in ihrem glitzernden Strahlen, wie man es sonst nirgends sieht. Dazu der Kontrast zu den lieblichen Regionen grüner Weiden und hochstämmiger Wälder hier unten! Tausendfach glitzern dort die Schneekristalle an den herrlichen Firnwänden, an denen die Sonne tiefste Schatten wirft, und klar hebt sich das grünliche Eis von den dunkeln Felsen ab. Das alles liegt unmittelbar vor uns, beinahe zum Greifen nahe, und doch befinden wir uns auf grüner, blumenbesäter Flur, wir haben bekannten Boden unter den Füßen, und es dünkt uns, als blickten mir in eine Ewigkeit hinein.
In ihrer Vielgestaltigkeit macht die Jungfrau mehr den Eindruck eines Gebirgsstockes, als den eines einzelnen Berges. Eine Reihe herrlicher Vorgipfel, die Silberhörner und das Schneehorn, umgeben die Spitze, mächtige, von schroffen Felsen durchsetzte Gletscherströme ziehen sich in wilder Zerklüftung an den steilen Wänden herab, gezackte Kämme wechseln mit weiten Schneefeldern und abgelegenen Schluchten, und nur die edle Form der alles überragenden Gipfelpyramide gewährt einen Ruhepunkt in dem wechselvollen Bilde, das etwas so geheimnisvoll Unnahbares an sich hat.
Dieses Geheimnis zu lüften, die Vielgestaltigkeit des Berges zu ergründen und zu genießen, war unser Ziel. Da die vorgerückte Jahreszeit eine Besteigung von der Wengeralp her wegen zu großer Ausaperung (Trockenheit) der Gletscher verbot, so beschlossen wir, zunächst wenigstens auf das hier gelegene Schneehorn (3415 m) zu gehen, einen Vorberg zwar nur, der aber keineswegs leicht zu ersteigen war und ebenso instruktive wie intime Einblicke in die Welt dort oben versprach.
Den ersten eigenartigen Eindruck hatten wir dabei in der netten, kleinen Guggihütte, wo es umgekehrt war, als drüben auf der Wengeralp, und man von dem wilden Kessel des Jungfraujochs mit seinen Felswänden und Gletscherströmen hinüberblickte nach den Wäldern und Matten, hinaus in die fröhlich grüne Landschaft mit ihren Bergen, Tälern und Seen. Sonnenuntergang! Die Firne um uns erstrahlen noch einmal in hellem Glanz, die Schatten kriechen aus den Tälern empor, leichte Dünste erheben sich, und die Wolkenwand am fernen Horizont beginnt, sich zu vergolden. Wir hören das Geläute der Herden auf der Alp, die sich langsam in die friedliche Dunkelheit des Abends hüllt, bis endlich die Sonne auch an den eisigen Schneegipfeln verschwindet, um dem glühenden Rot der weiten Eisflächen Platz zu machen, das sich ganz allmählich in dem kalten Grau der Nacht verliert. Nacheinander kommen die Sterne an dem dunkeln Himmel hervor, der Mond beginnt seinen Lauf, und die unendliche Stille der Hochgebirgsnacht hält ihren Einzug.
Die Tour des andern Tages stand angesichts ihrer Länge und der schwierigen Eisverhältnisse von Anfang an unter dem etwas bedrückenden Gedanken, daß sich sehr leicht ein Freilager auf dem Gletscher als notwendig erweisen konnte, eine Möglichkeit, auf die Lauener, unser Lokalführer, dem auch die beiden mitgenommenen Zermatter Führer beistimmten, immer wieder hinwies.
Wir brachen noch in dunkler Nacht auf und hatten das geisterhafte Schauspiel eines Gletschermarsches beim Mondenschein. Es ist ungeheuerlich, welche Zerklüftung der Guggigletscher, den wir seiner ganzen Länge nach zu durchschreiten hatten, zeigt. Ein Chaos von Eistrümmern, zwischen denen der kleine Mensch geradezu verschwand, erhob sich in abenteuerlichen Formen ringsum, und die in der Dunkelheit besonders lebhafte Phantasie gestaltete alles doppelt eigenartig aus. Es war ein langer Marsch durch das nicht endenwollende Labyrinth, hinauf und hinab, herüber und hinüber, bis wir endlich das höher gelegene Gletscherplateau erreichten. Nach einiger Zeit sollte dann ein seitlich von oben herabkommender Eisstrom zur Rechten erstiegen werden. Es war eine steile Wand, und darüber hing, scheinbar frei in der Luft, eine zerklüftete Masse von Eistrümmern, in der man ein beständiges Poltern und Dröhnen hörte. Zerfall und Zerstörung trieben da ihr ewiges Werk und bedrohten den Eindringling. »Der Marsch da hinauf würde ebenso sein, wie ein Spaziergang vor einer Batterie Kanonen, die jeden Augenblick zu schießen anfangen können.« Ein bekannter Bergsteiger hatte einst diesen aufmunternden Ausspruch getan, der uns im übrigen natürlich nicht von unserem Vorhaben abhielt.
Bald waren wir in einer Linie übereinander eingefädelt, und während der vorausgehende Führer mit Wucht die Stufen schlug, warteten wir, den Blick auf die glatte Wand gerichtet, bis die Reihe an uns kam, einen Schritt vorwärts zu tun. Die losgeschlagenen Eisteile flogen uns um die Ohren, die Füße wurden kalt von dem langen Stehen, das Gesicht glühte im Sonnenbrand, und das beständige unheimliche Krachen und Poltern über uns gab Gelegenheit zu allerhand betrachtlichen Gedanken. Wenn die dort abbröckelnden Eisblöcke hier herunterkamen, so waren wir rettungslos verloren; denn ausweichen konnten wir unmöglich an der glatten Wand. Dabei fiel mir ein Abenteuer ein, das sich einst hier zugetragen. Abstürzende Eisteile hatten eine Partie getroffen und ins Rutschen gebracht, so daß zwei Mann in einer Spalte frei am Seil hingen, der dritte mit dem Kopf voraus so unglücklich an dem Spaltenrand lag, daß er sich nicht zu rühren vermochte. Das Schicksal aller hing von dem obenstehenden Führer ab, dem es gelungen war, festen Fuß zu fassen. Helfen aber konnte er nicht, und gab er auch nur einen Schritt nach, so war alles vorüber. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wie lange er es aushalten würde; denn den Gedanken des Seildurchschneidens wies der Brave ohne weiteres von sich. Verzweifelt stand er da und hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, als merkwürdigerweise eine zweite Partie, von der man keine Ahnung gehabt hatte, in diese sonst so völlig verlassene Gegend kam und der gefährlichen Lage ein Ende machte. Also: nur nicht nachlassen!
Wir selbst erreichten schließlich glücklich den über uns befindlichen Eisbruch, und wenn wir bis dahin in beständiger Furcht vor abstürzenden Trümmern geschwebt hatten, so zeigte sich jetzt, daß diese Gefahr mehr eine eingebildete, als eine wirkliche gewesen war. Es lagen da so ungeheure Spalten, daß sie völlig genügten, um alle von oben herabkommenden Trümmer in sich aufzunehmen. Wie nun aber darüber hinwegkommen? Nun fanden wir ja nach langem Suchen eine »Schneebrücke«, die in kühn geschwungenem Bogen nach jenseits hinüberführte, und unter entsprechenden Vorsichtsmaßregeln überschritten werden konnte, aber viel war damit freilich nicht gewonnen, wir befanden uns jetzt in einem Labyrinth von haushohen Eistrümmern, die, völlig unterminiert, beständig in sich zusammenbrachen. Es gab da nur eine Möglichkeit: auf gut Glück so rasch wie möglich hindurch! Es war eine arktische Wildnis von unheimlicher Pracht, in der senkrechte, blaugrün schimmernde Wände kaum ein kleines Stückchen Himmel freiließen. Mannshohe Eiszapfen hingen herab, und überall zeigten sich Spalten, Risse und Trümmer. So vergingen bange zehn Minuten, die wir wehrlos dem Schicksal anvertrauten, aber es war uns hold, und wir erreichten glücklich das unter dem Jungfraujoch gelegene Firnplateau.
Der weitere Weg führte beinahe eben nach den Felsen unseres Berges, die uns nur noch wenig überragten. Er war jetzt durchaus unschwierig – wenn es nur gelang, eine riesige Spalte zu überschreiten, welche sich über das ganze Plateau hinwegzog.
»Es ist zu spät für den Guggigletscher im August,« meinte Lauener zum hundertsten Male, und auch die beiden Zermatter schüttelten bedenklich die Köpfe, zumal es schon 11 Uhr war. Nun, auch diesmal half uns das Glück in Gestalt eines Vorsprungs in der Tiefe der Spalte, der es schließlich doch ermöglichte, nach jenseits hinüber zu kommen. Damit war das Schneehorn gewonnen. Nur ein banger Augenblick kam noch, als wir uns auf den Felsen unter der ungeheuren, überhängenden Gipfelwächte mit ihren mächtigen Eiszapfen befanden. Bei ihrem Durchschlagen mußten wir darauf gefaßt sein, daß die ganze Geschichte über uns abbrach und wir den Anprall der abstürzenden Lawine auszuhalten hatten. Doch nichts dergleichen passierte. Bald war ein Loch durch den Schnee gehauen, und vorsichtig kroch einer nach dem anderen durch das eisige Tor. Dann ging es rasch auf den Gipfel.
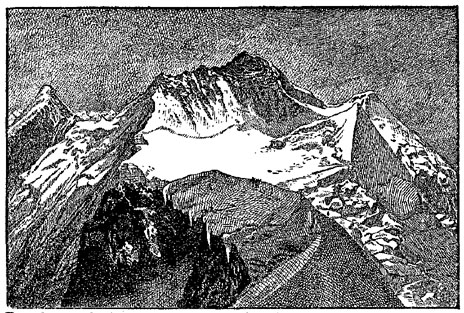
Jungfrau mit Schneehorn und Silberhörnern.
Und nun das Lüften des Geheimnisses, denn als ein solches erschien mir die Gestaltung des Berges mehr und mehr. Es kam mir vor, wie ein weihevolles Entschleiern, als wir mit einem Male das abgelegene, eiserfüllte Hochtal unmittelbar vor uns sahen, das sich am Fuß der Gipfelpyramide nach der »Silberlücke« zieht und die schneeweißen Silberhörner, diesen eisigen Busen der Jungfrau von ihr trennt; eine Welt für sich, ein von den Schauern der Einsamkeit und Unnahbarkeit umgebenes, glitzerndes und strahlendes Heiligtum, vor dem wir in staunender Verehrung den Atem anhielten.
Wahrlich, es war Lohn genug für unsere Mühe!
Gehen wir, um die geheimnisvoll riesenhafte Gestaltung unseres Berges ganz kennen zu lernen, in Gedanken noch einen Schritt weiter, hinauf nach der höchsten Spitze unseres Bildes! welche Überraschung steht uns da bevor! Wiederum erhebt sich in klassischer Ruhe und Einfachheit in urgewaltiger Block aus dem weiten Firnfeld. Er ist der eigentliche, von der Wengernalp überhaupt nicht sichtbare und auch sonst vielfach verdeckte Gipfel. Jetzt erst ist das Geheimnis der Jungfrau ganz entschleiert.

Jungfraugipfel vom Vorgipfel.
Beim Abstieg verwandelte sich unsere Furcht vor einem Gletscherbiwak in eine Humoreske. Trotz aller Schwierigkeiten kamen wir rascher vorwärts, als wir gedacht, und schon um 6 Uhr abends erreichten wir die Hütte wieder. Was aber hatten wir jetzt noch hier verloren! Wie verlockend winkte dort drüben das komfortable Scheidegghotel! Also weiter! Gegen Abend wurde es erreicht, und wonnig reckten und streckten wir die müden Glieder. Welcher Genuß, es sich jetzt bequem zu machen und alle die wohlverdienten Annehmlichkeiten der Zivilisation behaglich durchzukosten!
Doch der Mensch denkt und der Wirt lenkt, oder anders ausgedrückt: man glaubt zu reisen und man wird gereist. Wir hatten gestern die große Sünde begangen und den Proviant von unserem Hotel in Lauterbrunnen mitgebracht, das Anerbieten des Scheideggwirts, uns damit zu versehen, ausgeschlagen. Jetzt gab es auch keinen Platz mehr für uns. Keinen Platz für eine Dame nach einer solchen Tour! Ich wetterte und tobte, stieß aber auf ein gleichgültiges Achselzucken, wie das nur Kellnerseelen eigen ist. So blieb schließlich nichts übrig, als weiterzugehen, und zwar dann auch gleich ganz hinunter nach Lauterbrunnen zu unserem Gepäck.
Zunächst ließ sich die Sache nicht übel an. Was gibt es denn Schöneres für ein junges Liebespaar, als eine Mondscheinpromenade in solcher Landschaft! Arm in Arm zogen wir behaglich über die prächtige Wengernalp hinab, bewunderten die Berge, lauschten dem Summen der Käfer und beobachteten das Einbrechen der Nacht mit ihrer stillen Schönheit, wie man das in diesem Fall so zu tun pflegt. Bald machte sich dann aber der prosaische Hunger geltend, die müden Beine kamen allmählich in ein rascheres Tempo, immer mehr zog sich die Gesellschaft auseinander, und schließlich wurde der Marsch zum Wettlauf.
Wer gewann?
Die schöne Leserin wird gewiß triumphieren, wenn sie hört, daß ich total geschlagen wurde. Schon in Wengen hatte ich das Rennen längst aufgegeben. Nun gibt es auf der ganzen Welt keinen miserableren Weg, als den von da hinunter nach Lauterbrunnen, der damals wenigstens eine Art ausgetrocknetes Bachbett mit darin herumliegenden zahlreichen Steinen war, Dinge, die nach einem 16stündigen Marsch den Humor in stockdunkler Nacht nicht gerade erhöhen. Und die Laterne befand sich natürlich vorne bei Frau Maud. So zog ich denn mit wachsendem Grimm diese Via Dolorosa weiter, ohne daß die Lichter des infamen Dorfes da unten näher kommen wollten. Wie würde sich das Wiedersehen gestalten? Ich war in schrecklicher Laune, aber als mir Frau Maud auf der Schwelle des Hotels in einem frischen, weißen Kleid heiter entgegentrat und erklärte, sie habe ein herrliches Bad genommen, da machte ich eben gute Miene zum bösen Spiel und erwiderte: »Mit dir mache ich noch einmal eine Hochzeitsreise!« Dann nahm ich auch ein Bad, aber ein innerliches.
Da wir nun gerade beim Baden sind, so möchte ich ein unterhaltsames kleines Ereignis erwähnen, das sich anderen Tages in unserem Hotel, einem aus Holz gebauten Schweizerhaus zutrug. Fröhlich saßen die Gäste bei der Suppe um den Tisch, als plötzlich ein strömender Regen von der Decke herabkam und alles entsetzt auseinanderstob. Ich hatte in meinem darüber befindlichen Schlafzimmer ein Bad zu nehmen versucht und die Wanne glücklich umgeworfen, so daß man jetzt dort unten das Mittagessen mit aufgespannten Regenschirmen beenden mußte. Nun, angesichts meines Kostüms war ich wenigstens vor der tobenden Wirtin sicher.
»Und dieses Mann habe ich verheiratet!« meinte Frau Maud, die damals das Deutsch noch etwas gebrochen sprach.
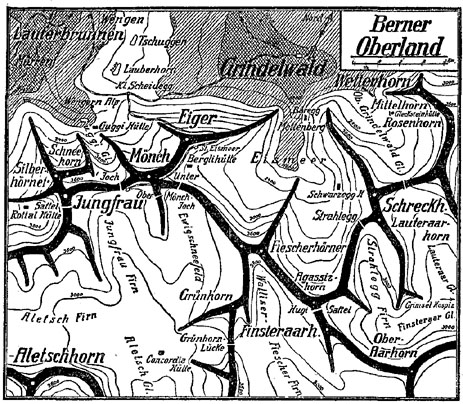
Auch im Westen, gegen den in das Lauterbrunner Tal mündenden Rottalkessel, ist der Abfall unseres Berges ein tiefer und steiler, wenn auch weniger gestaltenreich als auf der Nordseite. Im Süden dagegen ragt er kaum aus dem Hochplateau des Jungfraufirns hervor, das sich in dem Aletschgletscher nur ganz allmählich in das Rhonetal hinabsenkt. Die Besteigung, welche zum erstenmal schon 1812 gemacht wurde, ist denn auch von hier aus eine verhältnismäßig einfache, wenngleich das steile Eisfeld über dem Rottalsattel und der Schrund unterhalb desselben schon verschiedene Opfer gefordert haben.
Da ich den Berg schon 1884 von Grindelwald her über das Mönchjoch erstiegen hatte, beschlossen wir, ihn jetzt von dem Rottal aus anzugreifen und über den Jungfraufirn nach Grindelwald abzusteigen, eine Tour, die eine Fülle von Abwechslung und eisiger Pracht versprach.
Zunächst fing die Sache recht stattlich an. Stolz fuhren wir in einem uns zur Verfügung gestellten Vierspänner das schöne Lauterbrunner Tal hinauf, bewunderten fröhlich die glitzernden Schneeriesen über uns ebenso, wie die von den hohen Felswänden auf die blumenbesäten Wiesen herabströmenden Silberfäden der Staubbäche, und bemitleideten die zahlreichen Fußgänger, die sich im Schweiß ihres Angesichtes auf der staubigen Landstraße abmühten. Da war so ein flotter Vierspänner doch etwas ganz anderes! Hochwichtig kamen sich auch die Führer vor. Die Pickel in der Hand, die Seile um den Leib geschlungen und in dem Gefühl, daß es sich bei uns um etwas Rechtes handle, saßen sie ernst und würdevoll auf den weichen Polstern.
Etwas anders sah die Sache freilich aus, als wir uns dann ebenfalls zu Fuß und schwerstbepackt in die höhern Regionen hinaufarbeiten mußten. Erbarmungslos brannte die Sonne auf den steilen Hang herab, eine unerträgliche Schwüle hing über dem Tal mit seinen monotonen Hängen, und es ist nicht zu verwundern, wenn »manch gräßlicher Fluch schwitzender Touristen an diesen steilen Wänden klebt«. Nach fünfstündigem Keuchen änderte sich dann mit dem Betreten des hochgelegenen Rottalkessels die monotone Szenerie, wir kamen in eine Trümmerwüste von Felsblöcken und konnten über den zerklüfteten Gletscher hinweg an dem mauerähnlichen Firnwall hinaufblicken, der so hoch in die Lüfte steigt, daß man sich wie in einen engen Raum eingeschlossen fühlt. Eine bedrückende Einsamkeit herrscht auf diesem »Tanzplatz der Rottalherren«, die hier als wildes Heer mit Hussa und Hallo ihr Unwesen treiben sollen, und nur der herrliche Blick nach den schmucken Gestalten des Breithorns, Tschingelhorns, Gspaltenhorns und der Blümlisalp bringt Leben in das schauerlich öde Bild.
Es ist nicht gerade erfreulich, wenn man, wie wir, am späten Nachmittag in eine schon nahezu vollbesetzte Hütte kommt und ihre Insassen um fünf Köpfe vermehrt. Wer auf einer langen Eisenbahnfahrt sich zum Schlafen niedergelegt hat, um dann plötzlich von einem Mitreisenden überrascht zu werden, der »gleiches Recht für alle« verlangt, der kennt die Gefühle, mit denen man bei solcher Gelegenheit empfangen wird. Nun, unter uns Touristen herrschte bald die schönste Harmonie. Dagegen konnten wir bei den Führern eine Erregung beobachten, die die Stimmung der Zeit charakterisiert. Den Gegenstand dieser Erregung bildeten nämlich zwei Studenten, die die damals noch ganz unerhörte Absicht hatten, die Jungfrau führerlos zu besteigen. Das fehlte gerade noch, daß jetzt auch die großen Schweizer Berge von diesen Führerlosen heimgesucht wurden! »Erst darf man ihnen den Weg zeigen und schöne Stufen schlagen, damit sie dann mit ihren Heldentaten prahlen können und die Berge in Mißkredit bringen.« Auch ihr Verhalten hier unten wurde einer scharfen Aufsicht unterzogen. »Ich bin der Obmann der Hütte,« wetterte einer der Führer, »und dafür verantwortlich, daß sie gut im Stand bleibt, wie das bei den Führerlosen zugeht, weiß man. Da wird nichts geputzt und gewaschen. Ich werde ihnen aber morgen genau auf die Finger sehen und beim Kochen kommen wir zuerst. Die können sehen, wie sie sich ihren Kaffee machen!«
Nun, die beiden Attentäter haben sich nicht übel gerächt. Schon um 1 Uhr morgens standen sie leise auf, legten ihre Decken zusammen, aßen etwas Brot und gedörrtes Obst, um dann geräuschlos zu verschwinden. Kaum war das geschehen, da stürmten auch schon die Führer herein, um nachzusehen, ob auch alles wieder ordnungsmäßig instand gesetzt sei, und als sie mit dem besten Willen nichts aussetzen konnten, ließ ihnen der Gedanke, daß die beiden nun voraus waren, keine Ruhe mehr.
»Stehen Sie auf! Wenn wir sie nicht fangen, dann können wir heute die Besteigung nicht machen. Da muß alles zusammen bleiben, sonst gibt's Steinfall. Bei diesen Leuten ist man ja so wie so nicht sicher davor. Wir Führer sind verantwortlich, daß nichts passiert,« usw.
Alles protestierte. Es sei ein Unsinn, so bald wegzugehen. Vergebens. In aller Eile mußte der Kaffee getrunken werden, und um 2 Uhr begann das Wettrennen draußen in der stockdunkeln Nacht. Es war ein entsetzlicher Marsch über das Trümmerfeld, bei dem man jeden Augenblick Arme und Beine brechen konnte. Doch das alles war jetzt gleichgültig, »wenn wir sie nicht einholen, müssen wir umkehren.« Damit wurde jeder Widerspruch kategorisch abgetan. Aber so einfach war die Sache nicht. Schon flackerte die feindliche Laterne hoch oben in den Felsen und bewegte sich munter weiter. Durch einfaches Nachrennen war da nichts zu erreichen. So kam es zu lauten Auseinandersetzungen, von denen das ganze Tal widerhallte. Was Wunder, daß nun auch die Touristen nervös wurden! »wenn Sie nicht halten, dann schieße ich mit dem Revolver«, rief einer. Das half. Die Attentäter warteten, um endlich den Führern den Vortritt zu lassen, was diese würdevoll unter entsprechenden Bemerkungen taten. Allmählich brach dann ein trüber Tag an, der nichts Gutes erwarten ließ, so daß ich es für geraten fand, einen ruhmlosen Rückzug zu befehlen. Es war ein harter Schlag für meine Führer, daß sie nicht bloß die anderen Partien, sondern auch die verhaßten Führerlosen wieder vorlassen mußten. Auch mir war ja offengestanden nicht so recht behaglich zumute, wenn nun die andern doch hinaufkamen! Jeder Sonnenstrahl wurde ärgerlich empfunden und machte mich wieder schwankend. Als dann aber gerade beim Betreten der Hütte um 7 Uhr morgens schwere Tropfen fielen und die »Rottalherren« in einem orkanartigen Wolkenbruch ihren Tanz begannen, da kam ich mir entsetzlich klug vor und legte mich am wärmenden Feuer vergnüglich wieder zum Schlafen nieder.
Im Laufe des Vormittags hielten dann auch die andern Partien bei strömendem Regen wieder ihren Einzug, nur die beiden Führerlosen ließen sich nicht blicken. Stunde um Stunde verrann, und man mußte sich unwillkürlich auf ein Unglück gefaßt machen. »Es ist die alte Geschichte,« meinten die Führer, »wenn den Leuten etwas passiert, dann können wir sie wieder herausreißen. Man hätte sie einfach zur Umkehr zwingen sollen.« Schließlich kamen sie dann doch, nachdem sie stundenlang unter einem Felsblock Schutz gesucht hatten. Alles in allem hatten sie sich als recht respektable Bergsteiger gezeigt, vor denen man nur den Hut abziehen konnte.
Ein langer und langweiliger Nachmittag folgte; denn alle andern Partien waren zu Tal gezogen.
Betrachten wir die Jungfrau aus der Gegend des obersten Lauterbrunner Tales von der Mutthornhütte aus, so sehen wir zur Rechten unseres Bildes in das zum Teil mit Wolken bedeckte Rottal hinein. Das darüber befindliche breite Bergmassiv zeigt drei Zacken, den eigentlichen Gipfel in der Mitte, rechts das wesentlich niedrigere Rottalhorn mit dem dazwischen liegenden Rottalsattel, zur Linken den etwas höheren Vorgipfel, welchen wir vom Schneehorn aus gesehen haben. Zwischen diesem Vorgipfel und dem Hauptgipfel fällt ein breites Schneefeld ein ziemliches Stück weit verhältnismäßig flach ab, bis dann steilere Felswände kommen, darunter eine Art keilförmiger Klotz, welcher den Anstieg vom Rottal aus vermittelt.
Unsere Tour am andern Morgen stand im Zeichen von Frau Mauds Geburtstag, der in Grindelwald seinen festlichen Abschluß finden sollte. Das Wetter war zweifelhaft. Sonne, Wind und Nebel kämpften lange miteinander, bis sie schließlich einen Pakt schlossen, dahingehend, daß den Wolken die Täler, die Gipfel aber der Sonne gehören sollten. Der Marsch führte über ein breites, steiles Trümmerfeld, das mit seinen morschen Felsen, tief eingerissenen Schluchten und massigen Türmen eher einer Ruine als einer stolzen Jungfrau glich. Die Kletterei war nicht gerade schwierig, aber interessant, da sie meist schräg an dem Hang hinaufführte und manche Abwechslung bot. So kamen wir rasch vorwärts und erreichten nach einer hübschen Schlußkletterei durch eine wilde, kaminartige Schlucht schon um 8 Uhr das hochgelegene Schneefeld, welches den Gipfel auf der Nordseite umgibt.
Eigentlich hätten wir nun, dem üblichen Gebrauch entsprechend, direkt zum Gipfel ansteigen sollen. Ich zog es aber vor, erst zu dem zur Linken befindlichen Vorgipfel hinüberzugehen, von dem aus man zu dem Schneehorn hinabsehen und den letzten Gipfelblock, dessen Anblick wir ja schon kennen, in seiner ganzen Wucht bewundern konnte. Solche kleine »Umwege«, die oft ein ganz neues Licht auf die Umgebung werfen, möchte ich überhaupt empfehlen. Bald darauf war dann auch die Spitze erstiegen.
Es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn man einen solchen Hochgipfel betritt. Das Bewußtsein, den Riesen bezwungen, allen Schwierigkeiten getrotzt zu haben, sich so hoch über der Erde dort unten in den luftigen Himmelsregionen zu befinden, ergreift einen unweigerlich, so oft man es auch schon erlebt hat. Alle Blasiertheit, diese Krankheit der Täler, fällt weg vor der Leistung und dem Ergriffensein über die Erhabenheit dieser Welt. Man wird da immer wieder jung, mag man auch nach so viele Jahre im Rucksack haben.
Aus Firnschnee bestehend, hat der Jungfraugipfel eine beständig sich ändernde Form. Meist ist er ein scharfer, nur wenige Meter langer Firngrat, auf dem man rittlings sitzen muß. Wir selbst hatten es heute besser und konnten auf bequem hergerichteten Plätzen die Blicke frei über das grandiose Panorama hinausschweifen lassen.
Einen Hauptreiz verleihen der Jungfrauaussicht der Mönch und Eiger. Nur wenige Kilometer entfernt, bilden diese mächtigen Bergesgestalten einen überaus packenden Vordergrund, der in der Morgensonne besonders plastisch hervortritt. Das Auge findet hier einen Ruhepunkt, zu dem es immer wieder bewundernd zurückkehrt, und jenes ruhelose Hin- und Herirren an den zahllosen Zacken am Horizont, das Bergpanoramen meist charakterisiert, fällt weg. Das Dreigestirn des Berner Oberlands gehört eben auch hier oben zusammen und gibt dem Gebirge ebenso wie vom Tal aus sein Gepräge.
Mächtig ergreifend ist ferner der Kontrast zwischen der grünen Landschaft im Norden und den eisigen Gefilden im Süden. Während wir dort auf die lachenden Fluren mit ihren Wäldern, Wiesen, Seen und Ortschaften hinabblicken, starren uns hier die Riesen des Gebirges, Aletschhorn, Finsteraarhorn, Schreckhorn und wie sie alle heißen, entgegen. Dahinter die ganze Kette der Zentralalpen in Schnee und Eis gepanzert. Dort heimelt uns das Leben an, wir fühlen uns als Kinder dieser grünen Erde mit ihren Freuden und Leiden, hier blicken wir in die unheimliche Pracht der starren Unendlichkeit hinein, winzige Atome und doch Träger von weltbeherrschenden, ewigen Ideen.
Der Abstieg zum Rottalsattel führt über einen außerordentlich steilen Eishang hinab und war um so schwieriger, als wir, das heißt der vorausgehende Führer, unsere Stufen erst zu schlagen hatten. Notdürftig in den kleinen Tritten stehend und den Blick in die gähnende Tiefe vor uns, mußten wir beständig überlegen, wie der nächste weite Schritt wohl am besten zu machen sei. Einige Zeit war so vergangen, als man eine Partie von unten heraufkommen sah. Sie schien sehr eifrig zu sein, und es wäre doch ungerecht gewesen, ihren Ruhm durch weiteres Stufenschlagen unsererseits zu kürzen. Es wurde also haltgemacht, und wir wandten unsere Aufmerksamkeit wieder der Umgebung zu. Merkwürdig, wie sie sich durch den jetzt höheren Sonnenstand verändert und alle Plastik verloren hatte! Überall weite Eisflächen in jener monotonen Helligkeit, die das Auge blendet und jede malerische Wirkung ausschließt. Also Morgenstunde usw.! Inzwischen war die berganstrebende Partie herangekommen, und wir mußten uns, immer zu zweien in einer Stufe stehend, in gegenseitiger Umarmung aneinander vorbeischieben, was Frau Maud als eine besondere Geburtstagshuldigung hinnahm.
Der Rottalsattel ist ein schmaler, vereister Paß, dessen mächtige überhängende Schneewächten heute schon von der Anstiegpartie durchschlagen waren. Auch der darunter liegende Bergschrund machte keine besondern Schwierigkeiten, und bald befanden wir uns nach einer solennen Rutschpartie am Fuße unseres Berges auf dem weiten Jungfraufirn. Damit schlug die Stunde des Abschieds von unsern Walliser Führern, welche sich jetzt über den Aletschgletscher wieder nach Hause begaben. Da sie die ganze Hochzeitsreise mitgemacht hatten, so bedeutete das immerhin einen Abschnitt in unserer kurzen Ehe, und während ich prosaisch mit Franken und Rappen rechnete, ließ es sich Frau Maud nicht nehmen, den beiden Stück für Stück unseres schönen Proviants in die Rucksäcke zu stecken, damit sie in der Konkordiahütte doch auch liebevoll an uns denken konnten, wenn wir drunten in Grindelwald festlich Geburtstag feierten. Freilich, diese Gutmütigkeit sollte sich bitter rächen.
Unser weiterer Weg führte vom Jungfraufirn über das Ewigschneefeld an dem Mönch vorbei und dann gegenüber dem Eiger, wo sich die Berglihütte befindet, in den Kessel des Eismeers hinab. Es war ein langer Marsch. Endlos dehnten sich die weiten Schneegefilde vor uns aus, mit geradezu fürchterlicher Glut brannte die Sonne herab und versengte die welke Haut, und das Waten in dem tiefen Schnee wurde immer entsetzlicher. So wurde es 4 Uhr nachmittags, bis wir endlich halbtot vor der Berglihütte anlangten, wo eine kurze Rast beschlossen wurde.
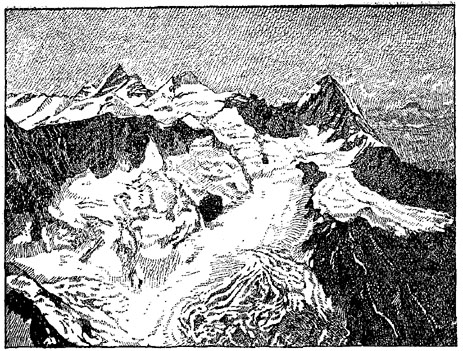
Eismeerkessel mit Jungfrau, Mönch und Eiger.
Es sah recht wohlig in dem kleinen Stübchen aus. Erleichtert warfen wir die Rucksäcke beiseite, reckten und streckten die müden Glieder, und ohne viel zu reden, legte man sich der Reihe nach aufs Ohr. Welche Wonne! – Sehr lange dauerte der Genuß freilich nicht. Der an den Kleidern hängende Schnee fing zu schmelzen an, das schweißige Hemd wurde kalt, und das Schneewasser in den Stiefeln trug auch nicht gerade zur Erhöhung der Behaglichkeit bei. Bald war also eins nach dem andern wieder aufgestanden, man begann den Schnee von den Kleidern abzuschütteln und die Stiefel auszuziehen, um das Wasser heraustropfen zu lassen.
Und nach Grindelwald waren es noch gute sechs Stunden! Dabei brodelte es dort unten in der Tiefe wie in einem Hexenkessel und regnete augenscheinlich in Strömen. Nein, es war klar, da kamen wir heute nicht mehr hinunter!
»Aber wie steht's dann mit dem Geburtstagsessen?«
Teufel, ja, das Essen! Jetzt schnabulierten die Walliser drüben in der Konkordiahütte ihr lukullisches Mahl, während wir unsere Magen noch 18 Stunden lang knurren lassen sollten!
»Drehen wir mal die Taschen um! Da findet sich immer noch etwas.«
Eine Bergsteigertasche! Wer hat nicht schon in ein so unerschöpfliches Reservoir mit bangem Schaudern hineingegriffen, was alles an seinen Fingern hängen bleiben würde! Doch jetzt war keine Zeit für Sentimentalitäten. Es wurde also alles umgedreht und der Inhalt auf den Tisch geschüttet, aber freilich, es kam herzlich wenig Brauchbares zutage: der Inhalt der Lanolinbüchsen und sonstigen Pomadentöpfe, welche Frau Maud zum Vorschein brachte, konnte ebensowenig als Suppe Verwendung finden, wie unsere Talglichterstumpfen, Seifenstücke, Zigarren, Opiumtabletten und andere Luxusartikel. Schon begannen die Gemüter, sich zusehends zu verdüstern, als Lauener bedächtig an seinen Rucksack ging. Natürlich, der war von Frau Mauds freigebiger Hand verschont geblieben; da mußten sich ja ganze Schätze drin befinden. Mit atemloser Spannung sahen wir der Entleerung des wertvollen Stücks entgegen. Zunächst kamen allerdings nur Dinge wie Strümpfe usw. zum Vorschein, dann aber wurde die Sache bald geradezu großartig. Triumphierend zog der Brave einige Brotstücke hervor, an denen das »Weiche« allerdings stark durchnäßt war, dazu eine Tafel Erbssuppe und schließlich gar ein Stück Schokolade. Es war entzückend. Als dann Frau Maud auch noch eine ganze Ladung Pfefferminz aus einem der entlegensten Winkel ihrer Taschen zutage förderte, herrschte eitel Freude, und liebevoll wurde das Festmahl zubereitet. Erbssuppe mit geröstetem Brot, Pfefferminzwasser aus Schnee und Schokolade, was konnte man sich Herrlicheres denken! Bald dröhnte die Hütte von dem Hoch wider, das auf das Geburtstagskind ausgebracht wurde, und auch draußen schien die ganze Natur bei der Feier mitwirken zu wollen: der Regen platschte auf das Dach, und der Donner dröhnte, daß es nur so eine Art hatte, wahrend uns immer wohliger da drinnen wurde und wir bis in die tiefe Nacht hinein uns fröhlich unterhielten.
Prächtig war dann am andern Morgen der Marsch hinunter durch den Eismeerkessel, dieses wohl gewaltigste Amphitheater Europas, dessen ursprüngliche Pracht mit den wilden Ausblicken auf Felsen, Gletscherstürze und Spalten noch durch sogenanntes schlechtes Wetter erhöht wurde. Drunten über der mächtigen Ausgangspforte, die sich der leibhaftige Gottseibeiuns in höchst eigener Person geschaffen haben soll, lagerte eine dichte Wolkenschicht, während hier oben ein erbitterter Kampf der Element stattfand. Ruhelos zogen die Nebel hin und her, dazwischen warf die Sonne greifbar dicke Strahlenbündel auf die weiten Eisflächen, und über diesem urweltlichen Gebrodel erhob sich das gewaltige Schreckhorn zu seiner riesenhaften Höhe, ein unvergeßliches Bild.
Allmählich stiegen wir dann in den strömenden Regen hinunter und waren nach mehrstündigem nassen Marsche froh, die bekannte Leiter zu erreichen, die von dem Gletscher an den Felsen hinauf zum Bäreggwirtshaus und damit in die bewohnten Regionen führt. Erst aber mußten wir dem Besitzer der Leiter einen Franken pro Person berappen, ehe wir wieder zu den Segnungen der Zivilisation zugelassen wurden. Waren sie das wirklich wert? Dann stürmten wir weiter nach Grindelwald, und es gab da etwas anderes als Schneewasser mit Pfefferminz, so bekömmlich dasselbe auch sein mag.
Einige richtige Hochzeitsreisetage folgten in Interlaken, wo man in dem Strudel von Leuten aller Art bei Konzerten, Rößleinspiel und Feuerwerk das genus homo sapiens in Seide und Pomade, bei Flirt und Gigerltum in seiner ganzen zivilisatorischen Größe bewundern und sich seine Gedanken darüber machen konnte, wo es eigentlich schöner sei, droben oder hier unten. Na, zur Abwechslung ...
Dann ging's über den Brünig nach Engelberg, um den Urirotstock, dieses Wahrzeichen des Vierwaldstätter Sees zu besteigen. Es war eine lange und recht nasse Tour. Anfangs konnten wir aus der Ferne noch einmal das Berner Oberland bewundern, dessen verschneite Gipfel sich wie Gestalten einer anderen Welt aus dem grünen Land erhoben. Auch auf dem Gipfel gab es einen großartigen Wolkenausblick. Dann aber brach einer jener Gebirgsregen herein, gegen die überhaupt nichts aufkommt, so daß wir schließlich herzlich froh waren, in einem kleinen Bergwirtshaus Schutz zu finden, und den Abend in geborgten Kleidern zubrachten. Ein gemütvolles Familienbild, wie wir so um den Tisch saßen! Ich ohne Hemd in meinem unzuknöpfbaren Rock, dessen Ärmel gerade noch über die Ellbogen reichten und in Beinkleidern, die wirklich keine Gefahr liefen, abgetreten zu werden, während die schlanke Frau Maud in den faltenreichen Gewändern der rundlichen Wirtin völlig verschwand. Auch bei der Fahrt über den Vierwaldstätter See am andern Tag regnete es unaufhörlich. Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter. Also nach Hause!

Schreckhorn von der Berglihütte
Nun waren wir also zu Hause! Wie ein Wirbel waren die Ereignisse dieser denkwürdigen Hochzeitsreise an uns vorbeigestürmt, und wir hatten fröhlich den Augenblick genossen. Jetzt aber zeigte sich bald auch die tiefere Bedeutung unseres Tuns.
Zunächst hatte mein Schwiegervater wahrlich Recht gehabt, als er sagte: »Diese Reise wird eine Erinnerung fürs ganze Leben sein.« Nun sind ja andere Hochzeitsreisen gewiß auch schöne Erinnerungen, aber diese war zugleich eine Tat gewesen, von seiten meiner Frau sogar eine Reihe von Taten, und wiegen die nicht schwerer, als alles beschauliche Glück und mühelose Genießen? Schon der Entschluß war ein großer und geeignet, uns in unseren Beziehungen zueinander zu heben, Kleinigkeiten nicht aufkommen zu lassen. Außerdem waren wir aufs engste aufeinander angewiesen gewesen, hatten gelernt, daß wir uns aufeinander verlassen konnten, hatten unendlich vieles erlebt, und wenn allemal die Gefahr gekommen war, dann hatten die Augen aufgeblitzt, und wir hatten uns nicht klein finden lassen. Wie hätten wir da nicht ein unerschütterliches Vertrauen zueinander gewinnen sollen! Wir hatten uns in diesen Wochen besser kennen und schätzen gelernt, als manche oft in jahrzentelangem Zusammensein, wir hatten gelernt, die großen Gesichtspunkte hoch zu halten, immer wieder den hohen Zielen zuzustreben, sie nicht über den Kleinigkeiten zu vergessen, hatten gelernt uns und die Dinge so zu nehmen, wie sie waren. So war eine im Sturm erprobte Kameradschaft entstanden, in der wir wußten, was mir aneinander hatten, die sich stetig erweiterte und vertiefte, an der nicht von Tag zu Tag etwas abbröckelte, wie damals bei der » grande passion«. Dazu die unvergängliche Feiertagsstimmung, die wir von dort oben mit uns heruntergenommen in den Alltag, die auch nicht mehr vergehen konnte, wie hätten sich jene überwältigenden Augenblicke verwischen sollen! Der grandiose Tag auf der Südseite des Matterhorns, das Wüten des Sturmes in seiner unheimlichen Pracht und Größe, das schließlich doch erzwungene Gipfelglück, das Entschleiern des Jungfraugeheimnisses auf dem Schneehorn, der Ausblick von dem Gipfel der strahlenden Eiskönigin und Dutzende andere, wo die von ihren Fesseln befreite Seele sich hinausgeschwungen in den Äther, sich eins gefühlt hatte mit dem unendlichen All! Und das alles Hand in Hand mit dem andern, mitfühlend, mitahnend, sich so ganz verstehend! War das nicht lebendig gewordene Poesie, ein höheres Leben, das seine Weihe über die ganze Zukunft werfen mußte? Was wollte es da besagen, daß wir allerhand Mühen und Beschwerden auf uns genommen hatten, die jetzt doch nur dazu dienten, alles noch mehr zu verklären! was bedeuteten z.B. jene 21 Nächte, die wir in Hütten oder im Zelt, zum Teil recht unbequem, verbracht hatten! Nein, diese viel kritisierte Hochzeitsreise war das allein Richtige gewesen, und ich habe nicht wenig Lust, jedem jungen Ehepaar zu raten, es uns nachzumachen.
Nun werden die Bedächtigen natürlich einwenden, das sei eben eine Ausnahme gewesen, und nicht jede Frau könne ihre Hochzeitsreise in die Berge machen, auch wenn sie Lust dazu hätte. Ich möchte deshalb hier etwas näher auf die Eignung der Frau zum Bergsteigen eingehen, eine Frage, der sich Frau Maud eingehend angenommen hat und in der sie auch an die Öffentlichkeit getreten ist. Als Resultat einer Rundfrage bei den bekannten Bergsteigerinnen konnte sie zu Anfang des Jahrhunderts feststellen, daß alle bedeutenderen Gipfel der Alpen schon von Frauen erstiegen waren. Dabei wird dem Manne allerdings die größere Kraft, Entschlossenheit, Umsicht und Fachkenntnis zugesprochen, die die Elite der Erstbezwinger schwieriger Gipfel zu Leistungen befähigt haben, die Frauen wohl nicht erreichen können. Auf der andern Seite wird bei der Frau die vielfach größere Geschicklichkeit, Ausdauer und Zähigkeit gegenüber dem Durchschnittstouristen hervorgehoben. »Mancher Mann vermag ein Kind nicht so lange auf dem Arm zu tragen, ohne zu ermüden, als eine viel schwächere, zartere Frau dies gewöhnt ist.« Unbestreitbar ist ferner ihre größere Enthaltsamkeit im Alkoholgenuß und in dem den Lungen schädlichen Rauchen. Auch hören wir, daß den Damen bei Unbequemlichkeiten der Humor nicht so leicht ausgehe, sie schlechtes und ungenügendes Essen leichter ertragen usw.

Also die Eignung des sogenannten schwachen Geschlechts zum Bergsteigen wurde schon damals einwandfrei nachgewiesen.
Daß nur eine Frau, welche über einen normalen, wirklich gesunden Organismus verfügt, Bergsteigerin werden soll, leuchtet ein, aber der Grund für mangelnde Fähigkeit liegt meist weniger an einer ungesunden Veranlagung, als in verweichlichender Lebensweise, dem Mangel an Abhärtung, der geringen Bedeutung, die man dem Turnen beilegt, und oft auch an dem unsinnigen Schnüren von zarter Jugend auf. Daß demgegenüber das Bergsteigen innerhalb vernünftiger Grenzen nur zuträglich wirke, wird allgemein betont und von verschiedenen Damen darauf hingewiesen, daß, obgleich sie früher manchen Sport getrieben haben, sie doch nie so kräftig und gesund gewesen seien, als nachdem sie Bergsteigerinnen wurden. »Ich halte es für sehr zuträglich, nervöse Mädchen oder Frauen in die Berge zu schicken. Es würde sich dabei ein recht prosaischer, aber gesunder Appetit mit nachfolgendem erquickendem Schlaf einstellen, und als neuer Mensch würde so ein leidend gewesenes, armes Ding zurückkehren. Allgemeines Bergsteigen der Damen würde einen erfolgreichen Feldzug gegen die Bleichsucht bedeuten, und die Schwächlichen würden dabei kräftig, die Rundlichen schlank werden.«
Besonders betont werden die seelischen Einflüsse des Bergsteigens. »Wir huldigen ihm, weil wir dadurch hoch über das Niveau des alltäglichen materiellen Lebens gehoben werden und uns einen idealen Zug des Geistes zu bewahren vermögen.« »Gerade diejenigen Eigenschaften, die die Erziehung der Frau meist vernachlässigt, werden beim Bergsteigen entwickelt: Beobachtung, Vorsicht, Geistesgegenwart, Geduld, Selbstbeherrschung, Entschlossenheit und Ausdauer.« Auch auf die Kameradschaft mit dem Gatten wird hingewiesen. Endlich schrieb die Witwe eines in den Alpen verunglückten Bergsteigers: »Obgleich mir von den Bergen das tiefste Leid zugefügt wurde, so vermag dies doch nicht einen Schatten auf all das Glück zu werfen, das mir an der Seite meines Mannes von den Bergen geboten wurde. Nie in meinem Leben werde ich die unaussprechlich erhabenen Augenblicke vergessen, wo wir uns so ganz und gar eins mit der Natur fühlten. Zu ihr flüchtete ich auch in meinem höchsten Leid und fand in den Bergen Trost und Kraft, mein Schicksal zu ertragen.«
Auch im einzelnen geben die Damen recht verständige Ratschläge, indem sie vor zu frühzeitigem Steigen, vor Rekords, zu scharfem Tempo und sonstigen jugendlichen Übertreibungen warnen, gleichzeitig aber konstatieren, daß oft Sechzigjährige noch recht gute Bergsteigerinnen sein können.
Daß wir selbst unseren Idealen treu blieben und fest zu unseren Bergen hielten, versteht sich wohl von selbst. Wenn immer möglich, zogen wir hinauf. Freilich, das Leben mit seinen wachsenden Berufsanforderungen und zu Anfang auch die Ehe mit ihren Konsequenzen brachten dann und wann unumgängliche Einschränkungen mit sich, aber das alles konnte höchstens stören, nicht verhindern. Im allgemeinen wurde ich ja dabei mit der Zeit allerdings ruhiger, welchen Einfluß ich der Ehe gern einräume. Wohl machten wir da und dort noch verwegene Seitensprünge oder arrangierten ein romantisches Freilager in unserem Zelt, das uns nie verließ, in der Hauptsache aber zogen wir gesittet und nach den Regeln der Kunst auf unsere Berge, um unsere Aufmerksamkeit dem zuzuwenden, was es zu sehen gab, es intensiv und verständnisvoll zu genießen, was mir, wie schon früher ausgeführt, immer mehr als die Hauptsache erschien. Und wie schön waren diese Weihemomente gar jetzt, wo wir uns von Jahr zu Jahr mehr verstanden, von Jahr zu Jahr auf eine längere Kette reizvoller Erinnerungen zurückblicken konnten, die uns im Verein mit dem Planen neuer Touren so viele Alltagsstunden verschönten.
In bezug auf die Wahl der Gebiete wurde ich allmählich verwöhnt. Angesichts meiner wachsenden Gebundenheit in der Zeit konnte es sich für mich nicht darum handeln, ganze Gebirgsteile systematisch zu durchforschen, was ja auch seine Reize hat. Auch die Photographie, die besonders packende Gegenstände verlangt, hielt mich davon ab. Mein Streben war vielmehr darauf gerichtet, Frau Maud die Hauptschönheiten der bedeutendsten Gebirgsteile zu zeigen. So wurden wir in gewissem Sinne alpine Feinschmecker, die nur das Beste und Schönste vorwegnahmen, was ich gerne und durchaus unreumütig gestehe; denn der Alpinismus war mir eben ein Genuß und eine Erholung, und ich sehe nicht ein, weshalb ich da nicht aus dem Vollen schöpfen sollte.
Wie sehr Frau Maud Alpinistin geworden war, zeigte sich sofort nach unserer Rückkehr von der Hochzeitsreise. Wir hatten nur wenige Tage Zeit, um unser neues Heim zu genießen. Dann rief mich der Dienst, und während ich zum Krieg im Frieden hinauszog, nahm Frau Maud gräßliche Rache dafür, daß ich die Hochzeitsreise mit zwei Frauen gemacht hatte, indem sie dieselbe jetzt allein fortsetzte. Zu ihrer Entschuldigung muß allerdings gesagt werden, daß sie sich dabei redlich Mühe gab, um den Vorsprung, den ich in der Lichtbildkunst vor ihr voraus hatte, nachzuholen. Sie nahm sich dieselben Führer, die wir zusammen gehabt hatten und ging nach allen den Stellen, an denen meine photographische Kunst aus irgendeinem Grunde versagt hatte. So brachte sie eine ganze Reihe prächtiger Bilder nach Hause, die mir von höchstem Interesse waren. Wie unterhaltsam und so gar nicht haushaltungsmäßig gestalteten sich dann die langen Winterabende in der Dunkelkammer, wo aus den weißen Platten eine schöne Erinnerung nach der andern ans Licht gezaubert und unsere ganze Reise in dem dunkeln, rot erleuchteten Zimmerchen noch einmal durchlebt wurde!
Im Sommer 1895 freilich, der auch meine Versetzung nach Berlin brachte, waren die Verhältnisse doch stärker als wir, und Frau Maud mußte mich zweimal allein wegschicken. Ich hatte dabei noch eine Rechnung mit dem Matterhorn auszugleichen, dessen photographische Ausbeute mir nicht genügte, da ich eine Monographie über den Berg schreiben wollte. Weiterhin wandte ich mich dem Berner Oberland zu, das unser nächstes gemeinschaftliches Ausflugsgebiet werden sollte, und in den folgenden Jahren zogen wir über das Engadin, die Ortler, und Ötztaleralpen nach dem Osten, um Frau Maud auch meine geliebten Dolomiten zu zeigen.
Daß das Berner Oberland die Perle der schweizerischen Nordalpen ist, wurde schon früher erwähnt. Manchen ist es das vornehmste Gebiet der Alpen überhaupt. In gewissem Sinn nicht mit Unrecht. Es ist der klassische Boden alpiner Eis- und Firnpracht, der in seinem unerhörten, wechselvollen Gestaltenreichtum zuerst die Pioniere der großen alpinen Zeitepoche anzog und an Abwechslung und Kontrasten wohl unerreicht ist. Es gibt kaum ein Gebirge, wo sich die eisigen Firne so wuchtig, abenteuerlich und malerisch aus einer ausgesucht schönen und herrlich grünen Tallandschaft erheben.
Für mich selbst kam, da ich nun einmal ein alpiner Genießer war, nur der zentrale Gebirgsteil zwischen Lauterbrunner und Aaretal in Betracht, der, in dem Finsteraarhorn kulminierend, im Norden neben dem Schreckhorn, Mönch und Eiger die Jungfrau und das Wetterhorn als stolze Eckpfeiler trägt und die gewaltigen Kessel des obern und untern Grindelwalder Gletschers umschließt, im Süden aber in dem Aletschgletscher und Fiescherfirn sich langsam und weniger malerisch nach dem Rhonetal zu hinabsenkt.
Mein diesjähriges Ziel war das Wetterhorn (3703 m), dessen prächtig massive und doch so graziöse Gestalt, ein glitzernder Firnzacken über ungeheuren Felsen und dem darunter befindlichen fröhlich grünen Land den Glanzpunkt des schönen Grindelwald bildet. Ich machte die Besteigung auf dem gewöhnlichen Wege von Grindelwald über den obern Grindelwaldgletscher und die Glecksteinhütte und stieg dann nach jenseits in das Rosenlauital ab. Sie verlief in Gesellschaft Ulrich Kaufmanns, eines prächtig trotzigen alten Kumpans ohne besondere Abenteuer, und hat bleibende Eindrücke in mir zurückgelassen.

Grindelwald mit Wetterhorn.
Da war die mächtige trümmerreiche Felswand, die sich von dem Gletscher in allerhand riesenhaften Formen breit bis unmittelbar unter den Gipfel hinaufzieht, eine düstere Welt für sich, die merkwürdig zu der glitzernden Firnenpracht des gegenüberliegenden Schreckhorns abstach. Da war der schneeverwehte Gipfel, auf dem wir rittlings sitzend einen Ausblick von einfach ungeheuerlicher Pracht und Großartigkeit hatten. Man sehe sich nur diese riesenhafte Gestalt des Eiger an, der sich so scharf aus dem grünen Land zur Rechten erhebt, den schneeweißen Mönch mit seiner dachförmigen Kante, hinter der noch die Jungfrau hervorlugt, die nach Süden ziehenden Schneehänge und darunter den abgrundtiefen, gewaltigen Eismeerkessel! Da waren die ungeheuren Felsen beim Abstieg und das schöne, romantische Rosenlauital mit seinem edelgeformten Wellhorn! Gewiß, es gibt nur wenige Touren von solcher Schönheit!
Bei meiner Rückkehr beschenkte mich dann Frau Maud mit einem Töchterlein, das in Erinnerung an die Hochzeitsreise den Beinamen »Matterl« erhielt.
Ein überaus arbeitsreicher Winter folgte, denn der Große Generalstab versteht in diesem Punkt keinen Spaß, und auch in dem folgenden Jahr, das wiederum dem Berner Oberland gewidmet war, hatten wir nur acht Tage zu unserer Verfügung. Acht kurze Tage, von denen dazu noch mindestens zwei für Hin- und Rückreise wegfielen, was wollte das besagen, dazu noch in dem regenreichen Sommer 1896! Sie verflogen mit Sturmeseile, und ehe wir es uns versahen, saßen wir wieder zu Hause. Es war wie ein kurzer Traum, und doch bedeutete er eine Welt von Ewigkeitserinnerungen.
Unser erstes Ziel war das Schreckhorn (4080 m), dessen Anblick mir seit unserem Abstieg von der Berglihütte nicht mehr aus dem Kopf gegangen war.
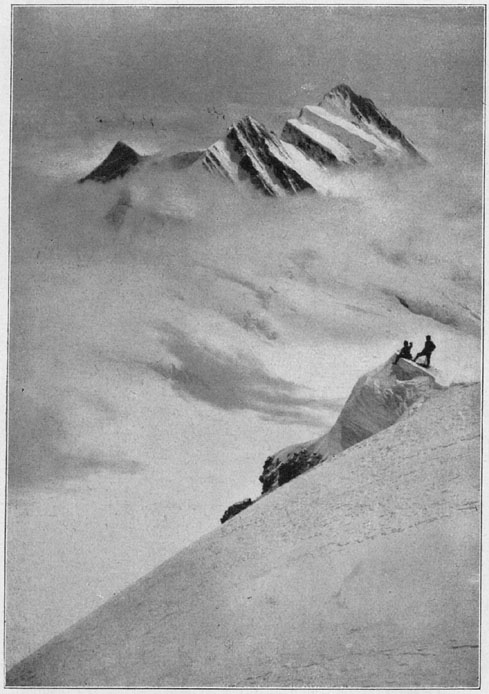
Finsteraarhorn vom Mönch.
Es ist etwas Geheimnisvolles um diesen Berg, auch wenn man von seinem bezeichnenden Namen absieht. Im Innern des Gebirgs gelegen, tritt er nicht so hervor wie die Jungfrau oder das Wetterhorn, und keine grünen Matten umsäumen seinen Fuß. Dafür ist aber auch alles wilder ursprünglicher. Die Kessel, die ihn zu beiden Seiten umgeben, sind so mächtig und großartig, wie nur irgendein Alpenzirkus. Dazu kommt, daß die Besteigung lange vergeblich versucht wurde und wegen Steinfalls und Lawinengefahr, wovon mehrere Unglücksfälle erzählen, berüchtigt ist. Auch die Sage hat sich des Berges mit seinen beiden »Täubchen« auf dem Gipfel bemächtigt, die verdammte Seelen sein sollen, und es ist nicht gerade verwunderlich, wenn eine junge Dame, die einst unmittelbar unter dem Gipfel biwakieren mußte, sich allerhand poetische Gedanken über die Sturmgeräusche machte, die sie dort oben zu hören bekam. »Noch immer schweben mir die tausend und abertausend von Strahlenglorie umflossenen Gestirne vor. Aber unheimliche, gedehnte Laute schreckten mich aus dem Verkehr mit den höheren Welten auf. Uh, uh, uh, drang es aus der Tiefe ganz schauerlich empor. War es ein Chor von Nachteulen, uns hilflosen Menschenkindern das nahe Unheil verkündend? Bald änderte sich der Ton, und ich vernahm wie Geheul eines hungernden Wolfes. Dann durchflog es die Lüfte in schrillem Pfiff, und darauf erfolgte Gewinsel und ersterbendes Gestöhn. Vielleicht ein armes gejagtes Tier, das der wilde Jäger verfolgt und getroffen? Zuletzt glaubte ich gar noch, das Seufzen und Jammern rühre von einer abgeschiedenen Seele her, welche auf einsamer Klippe für begangene Missetat zu büßen hat.«
Uns selbst sah ein Sommerabend in der Schwarzegghütte, wo wir den prächtig wilden Eismeerkessel in allen Stadien des Sonnenuntergangs bei stürmisch düsterm Himmel bewundern konnten, während jenseits der schmalen Lücke zwischen Eiger und Mettenberg die grüne Landschaft in friedlichem Abendrot erstrahlte.
Bald nach dem Abmarsch am andern Morgen sandte uns das Schreckhorn seinen Morgengruß in Gestalt einer Steinkanonade herab, die mitten zwischen unsere Gesellschaft hineinprasselte, so daß der Schnee ringsum nur so aufspritzte. Wie das Leben in die noch Schlaftrunkenen brachte! Wie besessen stoben wir auseinander, bis wir endlich in Sicherheit waren. Es war nichts passiert. Nur Stabeler, unser Leibführer, hatte einen Stein auf seinen Rucksack bekommen, aber es war dafür gesorgt, daß da nichts hindurchging, und nach einem kräftigen Schluck konnte man ihn darüber belehren, wie gut und nützlich es sei, die Rucksäcke entsprechend voll zu beladen.
Über den endlosen Anstieg an der breiten Kesselwand hinauf zum Grat ist nicht viel zu sagen, während hier sonst eine Hauptschwierigkeit darin besteht, eine gefahrfreie, nach den Verhältnissen stets sich ändernde Route zu finden, stiegen wir angesichts des außerordentlich tiefen Schnees gerade in die Höhe, was allerdings einige Lawinengefahr bedeutete. Dann folgte eine hochinteressante Kletterei auf dem scharfen Felsgrat, an dem »Elliotwändle« vorbei, wo jener verwegene Tourist, der sich nie anseilte, einst abstürzte, und mit dem Erreichen des Vorgipfels kam dann der Triumph des Tages.
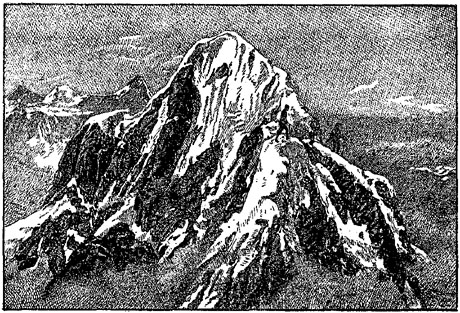 Schreckhorngipfel
Schreckhorngipfel
Man kann sich kaum einen Begriff von dem Gipfelblock machen, der sich so ungeheuerlich wild aus den Abgründen und der blendenden Firnenpracht ringsum erhebt, ein Koloß von unerreicht packender Eigenart. Dazu dieser Marsch da hinüber, der in seiner schaurigen Pikanterie allein schon die Anstrengungen einer Hochtour wert ist!
Die Pracht der Aussicht liegt ausschließlich in ihrer grandiosen Wildheit, in der Eisesstarre der Gletscherwelt ringsum, die sich zu allen Seiten in phantastischen Formen aus den ungeheuren Tiefen erhebt, was will da das bißchen grüne Land besagen, das sich zwischen Eiger und Wetterhörnern schüchtern hervorwagt! Man mag sich einen Ausschnitt aus dem Rundblick nehmen, wo man will, im Nordosten bei den edelgeformten Pyramiden der Wetterhörner, im Osten bei dem türmereichen Lauteraarhorn, dem ausgedehnten Strahleggfirn, im Süden bei dem alles überragenden Finsteraarhorn, im Westen bei dem Tiefblick auf das Eismeer und hinüber zu Jungfrau, Mönch und Eiger: überall dieselbe starre, abgründliche Eisespracht, überall das bebende Gefühl der Einsamkeit, Kleinheit und Verlassenheit und – das stolze Sichdarübererheben!
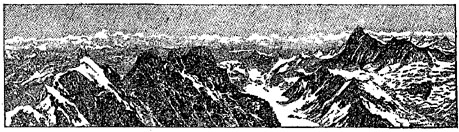
Lauteraarhorn und Finsteraarhorn vom Schreckhorn.
Und das alles stürmt gleichzeitig auf uns ein, gräbt sich ein im tiefsten Innern in ewigen Schauern.
Nach einer solennen Rutschpartie beim Abstieg und einem fröhlichen Abend in der Hütte zogen wir andern Tags durch den prächtigen Eismeerkessel zu der uns wohlbekannten Berglihütte, um unsere Aufmerksamkeit dem Mönch zuzuwenden.
Zunächst schien uns das Glück nicht gerade hold zu sein. Wir trafen eine völlig überfüllte Hütte vor und waren froh, als wir nach Mitternacht annehmen konnten, daß es Morgen sei. Kein einziger Stern leuchtete an dem rabenschwarzen Himmel, als wir, im ganzen vier Partien, in dem tiefen Schnee zum Unteren Mönchjoch hinaufwateten. Ein heftiger Wind wirbelte die Flocken hoch auf und hüllte die verschneiten, schattenhaften Menschengestalten wie in Wolken ein. Man konnte glauben, es handle sich um eine Polarexpedition in der ewigen Winternacht. Nach einigen Schwierigkeiten an dem Schrund des Untern Mönchjochs trat dann allmählich die Dämmerung ein, und ein stürmischer Tag brach an. Ohne Unterbrechung tobte der Sturm, dicke Wolken jagten hin und her, und es schneite und hagelte durcheinander, als gehe es an das jüngste Gericht. Was Wunder, daß wir da den Rückzug antraten!
Andern Tags sah es draußen allerdings nicht viel besser aus, und wir mußten die Besteigung eben erzwingen.
Es war ein merkwürdiges Wetter, als wir den Grat vom Obern Mönchjoch anstiegen. Die Nebel, die uns einhüllten, verflüchteten sich dann und wann, so daß der massige Berg mit seinen scharfen Kanten und langgestreckten Schatten hin und wieder aus dem huschenden Gewölk hervortrat, ein eigener und in seinem beständigen Wechsel beinahe geisterhafter Anblick. Auf dem breiten Gipfelplateau kamen wir dann wieder in dicke Nebel, und Stunde um Stunde verrann in trostlosem Warten. Da, als wir schon alle Hoffnung aufgegeben hatten, zeigte sich plötzlich ein dunkler Fleck in dem einförmigen Grau und verdichtete sich zu einem zackigen Felsen in dem sich senkenden Wolkenmeer, während darüber der klare Himmel zum Vorschein kam. »Das ist ja der Gipfel der Jungfrau!« Laut jubelten wir es hinaus in grenzenloser Freude und noch größerer Erwartung, was wohl sich noch dort drüben enthüllen würde? Aber unsere Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Bleischwer und unbeweglich lagerte die Wolkenwand über der Erde, und der starke Westwind war eher unheilkündend, als glückverheißend. Mehrfach schien es sogar, als sollte der stolze Bau dort drüben wieder von den Nebeln verschlungen werden.
Eine bange, erwartungsvolle halbe Stunde verstrich so, als plötzlich ein frischer Windstoß in die Wolkenklumpen hineinfegte und ein tiefes Loch riß. Der luftige Sturmgott siegte, die graue Nebelwand wich, immer mehr trat der herrliche felsgezackte Berg hervor, immer höher hob er sich in die Lüfte, immer tiefer öffneten sich die Abgründe zu beiden Seiten, bis schließlich das ganze herrliche Gebilde im Sonnenglanz über den Wolken erstrahlte, ein märchenhafter Anblick von geradezu dramatischer Bewegung.
Wie aber stand es mit den andern Größen des Gebirgs? Wohl hüllten sie sich noch in dicke Nebel ein, aber der Bann war gebrochen, und eine nach der andern wagte sich aus der grauen Hülle hervor, eine schöner als die andere: Schreckhorn, Finsteraarhorn, Aletschhorn, Eiger, und wie sie alle heißen.

Jungfrau vom Mönch.
Unsagbar dankbare Erinnerungen durchzogen mich beim Anblick dieser einzigartigen Wandelbilder. Also dort drüben, über dem dicken Wolkenmeer waren wir auf dem mächtigen Schreckhorn gestanden, hatten den Fuß auf die sagenhaften »Täubchen« gesetzt und waren durch diese brodelnde Urwelt bis hier herauf gedrungen! Und dort war mein Finsteraarhorn, mit seinen charakteristischen Stufen, das ich vor 10 Jahren bezwungen, wie stolz war ich damals gewesen, auf diesem höchsten Gipfel des Berner Oberlands zu stehen, der an Wildheit der Aussicht beinahe noch das Schreckhorn überbietet! Wie hatte es mir imponiert, als ich, auf dem Schlußgrat sitzend, einen Stein nach jenseits in die Tiefe fallen ließ, um zu sehen, wie lange er wohl brauchte, um diese mächtigste Felswand der Schweiz hinunterzufallen. Ich habe sehr langsam dazu gezählt: eins, zwei, drei, und doch bin ich auf einundzwanzig gekommen, bis ich ihn zum erstenmal aufschlagen hörte. Dann wieder der Blick dort hinüber zur Jungfrau mit ihrer Erinnerung an die Hochzeitsreise! War das nicht wieder so eine Weihestunde, die das ganze Leben verklärte?
Auch beim Abstieg, der erst nach Stunden angetreten wurde, hatten wir mächtig Glück. Bei der Berglihütte waren wir im Zweifel, ob wir eine kurze Rast machen sollten. Schließlich hatte sich die Aussicht auf einen warmen Tee, den uns Frau Maud anbot, doch als zu verlockend erwiesen, und wir waren eingetreten, um bald darauf das furchtbare Donnern einer Lawine zu hören, die unmittelbar neben dem Berglifelsen herabstürzte: Eine gespenstige Wolke von hochaufwirbelndem Schneestaub langsam vorausschreitend, dahinter polternde Trümmer, deren Dröhnen laut von den weiten Wänden ringsum widerhallte, und lange noch, als das Ungeheuer friedlich dort unten auf dem Gletscher lag, leise nachrieselnder Schnee. Wir aber sahen uns schweigend an. Unser Weg, der dort im Zickzack an dem steilen Hang hinunterführe, war von den Schneemassen tief bedeckt, und jeder, der sich da befunden hätte, wäre ebenso von ihnen begraben worden, wie das einige Jahre später einer Partie von zwei Touristen und fünf Führern passierte, von denen fünf das Leben verloren, darunter der berühmte Alexander Burgener. Wir selbst stürmten später in wilder Hast über die gefahrvolle Stelle hinweg, dann ging es in ein trostloses Regenwetter hinein, das den ganzen Tag über unten geherrscht hatte. Doch was bedeutete das uns, die wir trotz der kurzen Spanne Zeit lebenslange Erinnerungen mit uns trugen! Fröhlich zogen wir wieder in den Alltag hinein, und Frau Maud beschenkte mich nach einem Vierteljahr mit meinem ersten Jungen, Max, der zur Erinnerung an diese ereignisreiche Tour den Beinamen »Schreckerle« erhielt.
In späteren Jahren zogen wir noch einmal zum Jungfraujoch hinauf, um über die dort zu erbauende Station der Jungfraubahn ein Bild zu gewinnen. Man mag über diese Bahn denken wie man will, jedenfalls gewährt sie einer Menge Menschen, die sonst nie in das richtige Hochgebirge kommen würden, einen intimen Einblick in dasselbe – falls sie sich nämlich auf den Nordhang des Jochs hinauswagen. Auch der Ausblick von der Station Eismeer ist im hohen Grade lohnend durch die Intimität des Blicks auf die riesenhafte Gletscherwelt.
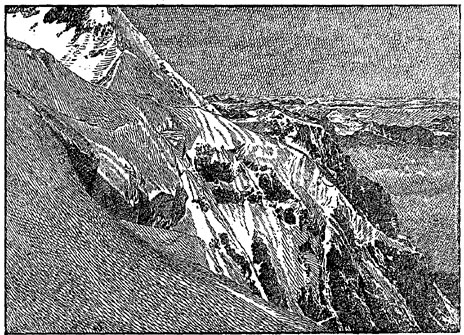
Nordhang des Jungfraujochs.
Wenn Firnenglanz und Gestaltenreichtum die Schönheit der Höhen des Berner Oberlandes ausmachen, so ist Eleganz und Abwechslung die Eigenart des Fremdenlebens in Interlaken mit seinen beiden herrlichen Seen. Im übrigen muß gesagt werden, daß für den, der diese Eleganz nicht oder nur ausnahmsweise liebt, sich zahlreiche hübsch gelegene Punkte in der Umgebung abseits von der großen Heerstraße befinden, die sich durch außergewöhnliche Billigkeit und Reellität auszeichnen.

Meint man nicht, man stehe vor einem norwegischen Fjord, wenn man diese Seenreihe vor sich sieht, mit den steilen Hängen, den Schneefeldern und massigen Bergen darüber? Aber während das düstere Grau des Nordlands auch düstere Gedanken erweckt, herrscht hier eine märchenhafte Farbenpracht und Vielseitigkeit, in der Wälder, Wiesen, glitzernde Seen und Gletscher mit dem blauen Himmel sich zu überbieten suchen. Dazu die zahlreichen Ortschaften mit ihren schmucken Häusern, die überall hervorlugen, und die sonstigen unzähligen malerischen Kleinigkeiten! »Vor allem aber ist das Licht, das aparte, reine, kindliche Licht das Geheimnis dieses merkwürdigen Tales.« Auch die Trennung der Gewässer in mehrere Seen bringt gegenüber der Fjordlandschaft eine größere Abwechslung mit sich, zumal diese Seen durch Talbarrieren voneinander getrennt sind, die der Landschaft den Charakter des Mittelgebirgs inmitten der schneebedeckten Riesen geben, welch unvergleichliche Fülle von Spaziergängen jeder Art bis hinauf zur Hochgebirgswanderung gibt es da!
Alles in allem ist das Engadin eine sehr vornehme Landschaft, die bekanntlich ein recht verwöhntes Publikum anzieht und als das eleganteste Viertel der Alpen gilt, das sich nur noch mit den großen Badeorten der Riviera vergleichen läßt. Man fährt da im Wagen hinauf zum Malojapaß, wo »die Verblüffung des abrupt in die Tiefe stürzenden Bergells wie ein plötzlich in die Hölle gefallenes Stück Engadin neben dessen Schönheitstraum steht,« rudert auf den Seen, bummelt im schönen Fex-, Roseg- oder Morteratschtal, fährt hinauf zu Muottas Muraigl, besteigt auch den Piz Languard, Corvatsch oder gar den Piz Morteratsch, alles Aussichtsberge erster Klasse, überschreitet die Diavolezza und führt im übrigen ein luxuriöses Hotelleben mit all seinen interessanten Pikanterien, während im Winter der intensivste und exklusivste Sport getrieben wird, zu dem nur Geldbeutel erster Klasse zugelassen sind.
Vornehm ist auch die Berninagruppe, das hauptsächlichste Gebirge des Ober-Engadins. Als ein mächtiger, von West nach Ost ziehender Eiswall, von dem die Seitenarme des Piz Corvatsch, Piz Bernina und der Diavolezza nach Norden ins Berninatal abfallen, hebt es sich in ruhiger Pracht in den Himmel hinein. Wir sehen da keine scharf ausgeprägte Gipfelbildung, und nur wenig erheben sich die Spitzen über die Kämme. Dafür herrscht aber eine um so vielgestaltigere Entwicklung der überaus großartigen Gletscherwelt. Je mehr wir in das Gebirge eindringen, um so mehr müssen wir über den Reichtum der eisigen Gletscherformen staunen. Nirgends sehen wir jene monotonen Firnhänge, welche in den Schneeregionen so oft das Auge ermüden. Überall sind den Firnen phantastische Eisgebilde vorgelagert, zackige Grate ziehen sich an ihnen herab, durchbrechen die gewaltigen Formen und erregen das Entzücken des Bergsteigers immer von neuem. Das vor allem bewirkt es, daß man das Gebirge um so mehr lieben lernt, je mehr man sich mit ihm vertraut macht.

Piz Bernina und Piz Morteratsch von der Diavolezza.
Auch uns ging es so im Jahre 1898, obgleich wir nur wenige Tage zur Verfügung hatten. Es machte mir dabei zunächst ein besonderes Vergnügen, über die Diavolezza zu gehen, bei welchem Spaziergang ich die Erinnerung an meine Wintertour auffrischen, sie Frau Maud erzählen und über die Wechselfälle des Lebens nachdenken konnte. Wie sich die Dinge ändern können! Man hält es oft für ganz unmöglich, und doch folgt dem Winter immer wieder der Frühling und Sommer.
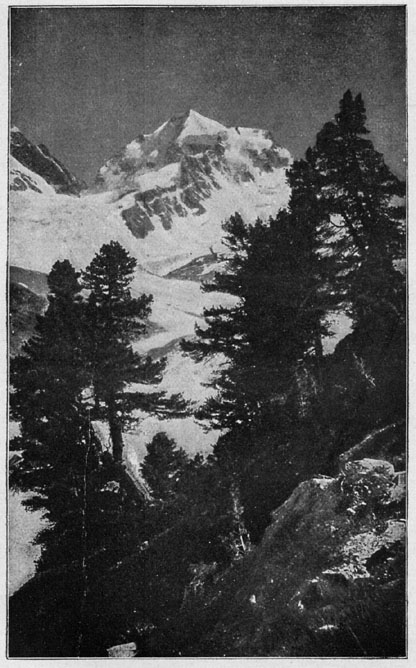
Piz Roseg.
Die nächste Besteigung galt dem Kulminationspunkt der Gruppe, Piz Bernina (4052 m). Von der Diavolezza gesehen, ähnelt dieser Berg der Jungfrau von der Wengernalp, ohne im übrigen ihren Gestaltenreichtum zu erreichen. Die vornehm einfache Engadiner Ruhe tritt da mehr hervor, als bei der Perle des Oberlands. Die Tour charakterisierte sich im allgemeinen als eine mühsame Schneewaterei, bei der die zerklüfteten Eismassen des »Labyrinths«, der Sonnenaufgang an dem Felskoloß der schönen Crast' Agüzza und der herrliche Gipfel des Berges als erhebende Glanzpunkte hervortraten. Es ist ein messerscharfer Firngrat, wie man nur selten einen findet, der sich dort oben im Zickzack hin- und herzieht und mit seinen plastischen Schatten und reizvollen Lichtern auf engstem Raum eine Welt voll eigen eisiger Pracht über den Abgründen bildet. Auch die Aussicht ist überaus großartig, vor allem nach Süden auf den majestätischen Monte della Disgrazia, den schönen Unglücksberg. Der Abstieg an dem steilen Hang war infolge des inzwischen durch die Sonne gelockerten Schnees, der kein Stufenschlagen erlaubte, recht heikel.
Der Piz Morteratsch (3754 m), dem dann ein Besuch abgestattet wurde, hat als Aussichtsberg vor seinen schon erwähnten Genossen den Vorteil voraus, daß er sich mitten im Gebirge befindet und sein Ausblick instruktiver und großartiger ist. Auch ist seine Besteigung nicht so ganz bedeutungslos, wie ein Abenteuer zeigt, das drei Touristen und zwei Führern begegnete, die von einer losgelösten Lawine über 300 Meter weit in die Tiefe gerissen, in Spalten geworfen und wieder herausgeschleudert wurden, ohne daß im übrigen jemand erhebliche Verletzungen erlitt.
Wir selbst nahmen uns alle Zeit zu der interessanten Tour und bewunderten den mächtigen Gipfelblock mit seinen beiden wächtengekrönten Kuppen, seinen prächtig glitzernden Schneeflächen und den langgestreckten Felsenschatten nach Gebühr. Auf dem Gipfel zeigte sich uns eine wunderbar wilde Aussicht. Da war vor allem der nahe Piz Bernina mit seinem mächtigen Turm und der berüchtigten Scharte, daneben der breite Monte Scersen, von dessen Überschreitung Güßfeld eine so abenteuerlich plastische Schilderung gegeben hat, und endlich mein Lieblingsberg in der Gruppe, der interessante Piz Roseg. Wohl eine Stunde lang hielten wir uns auf dem breiten Firnplateau in jener wohltuenden, unendlichen Ruhe auf. welche das Gemüt für die Schönheit und Größe des Hochgebirgs so empfänglich macht.
Bernina, Scersen und Roseg vom Piz Morteratsch.
Prächtig war auch die Besteigung des Piz Roseg (3943 m), dieses bergsteigerischen Glanzpunktes der Gruppe. Ganz in dem Gebirge versteckt, zeigt dieser dreigegipfelte Berg die packendste Eigenart. Nach jeder Seite hin hat er ein anderes Aussehen, ist bald scharf und spitzig, bald breit und klotzig, immer aber stolz und unnahbar.
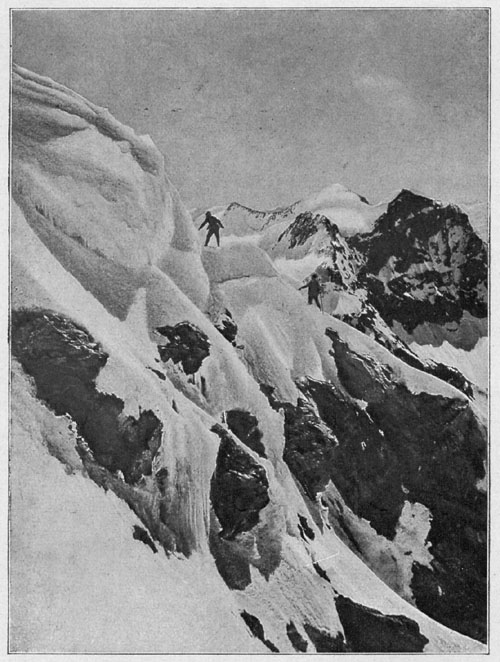
Unter dem Gipfel des Piz Roseg.
Für die anfängliche Schneestampferei bei der Besteigung brachte der Grat die Belohnung. Wie das elektrisierte, dieser prächtige Gipfel mit seinem scharf ansteigenden Firngrat und dem höllenartigen dunkeln Felskessel darunter, den gezackten Kämmen und dem brodelnden Nebelmeer mit seinen Felseninseln, das sich so weit, weit hinaus unter dem blauen, farbenfrohen Himmel erstreckte! Dann der Marsch zu der Scharte mit dem Blick auf die Größen des Gebirgs: Piz Zupo, Crast' Agüzza, Piz Argient mit seinem Steilabfall und dem zackigen kleinen Piz Roseg vor dem Nebelmeer dort unten!
Der steile Anstieg zum Gipfel war etwas heikel, da in dem dünnen, die Felsen verdeckenden Eis keine richtigen Stufen geschlagen werden konnten. Noch prickelnder war der Gang über den wächtengekrönten Schlußgrat mit seinen eigentümlichen Firnbildungen und langgestreckten Schatten. Aber so unsicher wir uns auch auf dem trügerischen Boden fühlten, der Reiz dieser eigentümlichen Gipfellandschaft, in der man sich über dieser Erde wähnte, wurde dadurch nur noch größer.
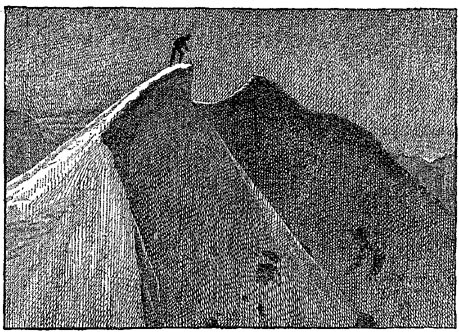
Gipfelkamm des Piz Roseg.
Auf dem Gipfel stiegen wir des Sturmes wegen etwas nach jenseits hinab, wo wir in einer Eisnische Schutz fanden und in Ruhe die Wunder ringsum betrachten konnten, während die Führer neugierig herumkletterten. Welch merkwürdige Polarpracht wir da vor uns hatten, alles so ganz anders, als hier unten! Eindrucksvoll, ergreifend, zum Nachdenken stimmend; bedrückend und im Gefühl des Sieges doch erhebend, wieder einer jener Momente, die man nicht vergißt, die die kleinen Fesseln des Alltags nicht mehr kennen, die Gefahr milde belächeln und einem mehr geben, als man je verlieren kann.

Ortlergruppe.
Wo immer die Ortlergruppe das übrige Volk von Bergen weit überragend am Horizont erscheint, wenden sich ihr die Blicke wie einem besondern Edelstein bewundernd zu. Es ist vor allem das Dreigestirn von Ortler, Zebru und Königsspitze, das unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, und man kann ruhig sagen, daß es kaum irgendwo eine so stolze Reihe von Schwesterbergen gibt, wie diese; denn neben dem massigen Ortler kommt die schlanke Pyramide der Königsspitze in ihrer edlen Form doppelt prächtig zur Geltung, und wenn auch der Zebru zwischen den beiden weniger hervortritt, so bildet er doch die Vermittlung zu der heiligen Dreizahl, die den Wechsel in der Einheit bedeutet. Dazu kommt, daß die Gruppe neben ihrer überragenden Höhe eine solche Menge packendster Berggestalten und einen so seltenen Reichtum der Eisformen zeigt, daß sie als die Herrscherin der Ostalpen gilt, an die sich höchstens noch die Glocknergruppe heranwagen kann.

Alt-Sulden.
Rein geographisch kann man die Grundform des Gebirgs mit einem Kreuz vergleichen, dessen Arme von dem Mittelpunkt Cevedale-Suldenspitze im allgemeinen nach den vier Himmelsrichtungen auseinandergehen. Der touristische Schwerpunkt liegt in Tirol, wo der Westkamm die Hauptgipfel der Gruppe überhaupt trägt, während der Laafer Kamm von leicht erreichbaren Aussichtsbergen geradezu besät ist. Demgegenüber kann der italienische Südkamm trotz seiner imponierenden, aber einfacheren Gesamtgestaltung nicht aufkommen, und die nach Osten verlaufenden Marteller Alpen mit dem gleichnamigen Tal haben nur als Zugangsweg Bedeutung.
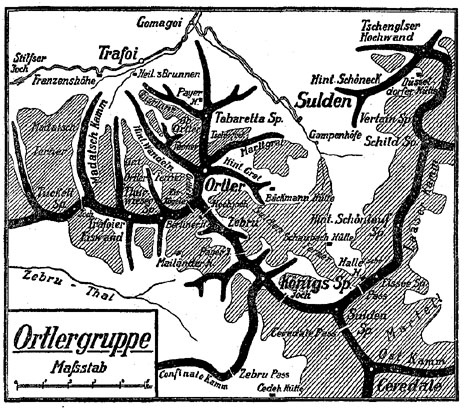
In touristischer Beziehung war die Gruppe damals wenigstens das genaue Gegenteil des eleganten Engadins, tirolerisch gemütlich, und es ist nicht uninteressant, sich die Entwicklung von Sulden, dieses Hauptzentrums des Gebirgs, etwas näher anzusehen. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bestand der Ort aus einem kleinen, malerischen Kirchlein, dem Vidum des Kuraten und ein paar zerstreut herumliegenden Bauernhäusern. Hier herrschte als Seelenhirte der Kurat Eller mit seinen drei Schwestern Katharine, Magdalene und Philomene, denen sich später, wie das so geht, noch ein Schwager hinzugesellte. Ein echter Menschenfreund von humaner Gesinnung und praktischem Blick, nahm Eller die wenigen Gäste, die sich in das entlegene Tal verirrten, in patriarchalischer Weise auf und bewirtete sie in seiner Familie. Es waren im ganzen nur vier im Jahre 1863, aber ihre Zahl wuchs und wuchs, Schutzhütten wurden auf den Bergen ringsum erbaut, Wege angelegt, und so konnte es nicht ausbleiben, daß bei Eller allmählich ein Gasthaus entstand, in dem sich die drei Schwestern in die Verpflegungsgeschäfte teilten, während der vielbeschäftigte Schwager den Dienst des Bureaus, des Auskunftsmenschen, Führervermittlers und alles dessen übernahm, was eben sonst noch dazu gehört. Der würdige Kurat aber schwebte über dem Ganzen, und vor allem machte es ihm ein Vergnügen, bei den Mahlzeiten zu präsidieren. Am oberen Ende der Tafel sitzend, sprach er sein Gebet, das man stehend mit anzuhören hatte, ehe die Schwestern mit ihren dampfenden Schüsseln anrückten und die Andacht der jungen Bergsteiger rasch und energisch ablenkten, während der Mahlzeit unterhielt er sich mit seinen Nachbarn und gab Ratschläge und Winke aller Art. Vor allem aber wandte er seine Aufmerksamkeit dem Essen zu. Die kleinen Äuglein leuchteten ordentlich aus dem etwas derben Gesicht mit der langen, breiten Nase und der stark herunterhängenden Unterlippe, wenn seiner soliden Hausmannskost gehörig zugesprochen und kräftig eingehauen wurde, was ja meist der Fall war, verfinsterte sich aber zu offenem Groll, wenn es je einmal einem nicht schmeckte. Er konnte da geradezu grob werden, denn »zum Bergsteigen gehört ein guter Hunger«. So hat sich mancher, darunter auch einst ich, um geringes Geld bei ihm herausgefüttert und zu neuen Taten gestärkt. Da nun die Zahl der Sommergäste schon 1888 auf rund 1000 im Jahre angeschwollen war, so vergrößerte sich das Hotel schließlich bis über die Straße hinweg, und da, der ganzen Sachlage entsprechend, von Gesellschaftsräumen keine Rede war, so lebte man tagsüber fröhlich und ungezwungen gewissermaßen auf der Landstraße.
Interessant ist es auch in dem Fremdenbuch zu blättern, das ein amüsantes Dokument für die Psychologie des Gebirgsreisenden bildet.
Zunächst sehen wir da Leute aller Art aus aller Herren Länder friedlich um den Tisch des Kuraten herumsitzen: aus Moskau, Halle, Paris, San Franzisko, Graz, London, Wien und Berlin; Erbprinzen, Dienstmädchen, Studiosi, neben Kommerzienräten von schwerem Klang, Senatoren und Handlungsbeflissenen, alles bunt durcheinander; denn im Gebirge hören ja alle Unterschiede auf. Freilich, so ganz verschwinden sie doch nicht, und dann und wann vertraut einer seine heimischen Würden mehr als nötig dem Fremdenbuch an. Wir finden da den Regierungsrat und Oberbürgermeister, den Oberstabs- und Regimentsarzt, den Anstaltsgeistlichen, den Bürgerschuldirektor – muß es gerade eine Bürgerschule sein? – die Generalswitwe und die Metzgermeisterstochter aus München.

Daß die Ergüsse in dem Fremdenbuch vielfach poetischer Art sind, ist nun einmal eine menschliche Schwäche, die besonders bei dem Job des braven Kuraten verzeihlich erscheint. Auch die begeisterten Erzählungen der zahlreichen Erlebnisse von sternenhellen Nächten, überwältigender Rundsicht, grausigen Schneestürmen usw. wird man mit Interesse lesen. Spaßhaft ist ferner die gegenseitige genaue Kontrolle der Bergsteiger, ob sie ihre Gipfel auch wirklich erreicht haben, am merkwürdigsten aber erscheint die Spezies der Zeit-, Baro- und Klinometerfexen, deren Stil folgendermaßen lauft: »Ab 1 Uhr 30 morgens /Vidum/. An Königsjoch 6 Uhr 20. Schneehänge unter der Bergkluft mittlere Neigung von 36 Grad, zum Joch ziehende Wand 51 Grad Klinometer. Rast von 30 Minuten. Temperatur Max.: 9-½ Min.: -4 Grad Celsius, 1 Fuß ob Felsen. Ab 7 Uhr 10 Schnee sehr locker. Spitze 9 Uhr 3. Nebelstürme gegen Nordwest. Aneroid: 46 12,25/10 bei – 7 Grad Celsius. Ab 10 Uhr 10.« Da wendet sich der Naturfreund wirklich mit Grausen.
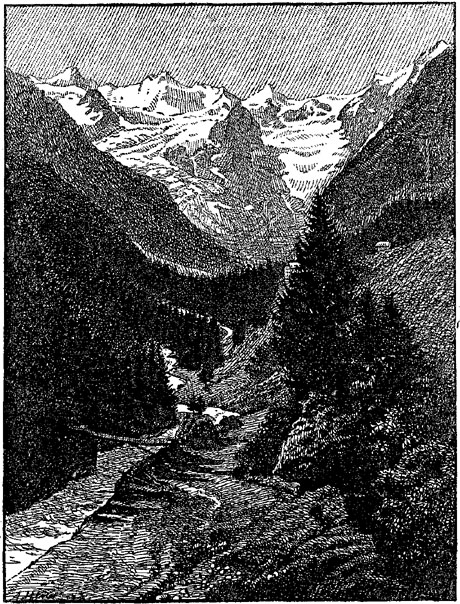
Trafoier Tal.
Alles in allem können wir aber trotz mancher Schwäche im einzelnen nicht umhin, die Unsumme von Kraft, Begeisterung, und gesundem Sinn zu bewundern, welche dem Gebirge entgegengebracht wird, und auch der Skeptiker muß zugeben, daß hinter dieser Bergfreudigkeit doch mehr steckt, als bloßes Fexentum, Renommisterei und sonstige Schwächen: die unwillkürliche Rückkehr des nervösen Städters zu einer großartigen Natur, zu fröhlichem Tatendrang, gesunder Bewegung und ungekünsteltem Wesen, das dem zu Blasiertheit neigenden modernen Menschen besonders nottut.
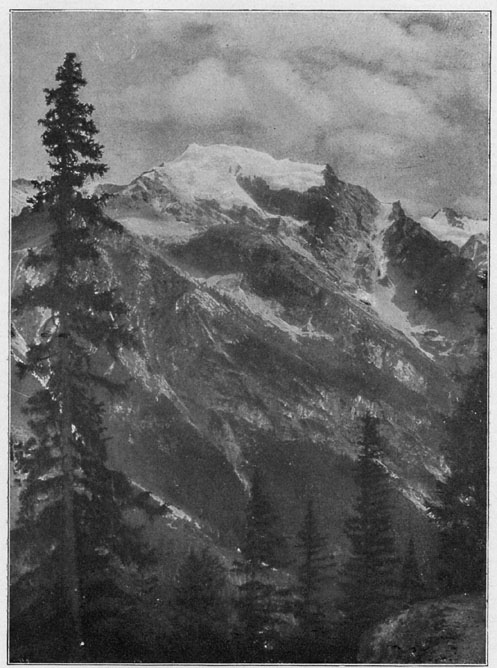
Ortler.
Wenn die Natur um Sulden einen vorwiegend wilden und großartigen Charakter zeigt, so ist in dem an der Stilfserjochstraße gelegenen, waldumgebenen Trafoi alles romantisch, lieblich und idyllisch, und man kann sich kaum einen prächtigeren, harmonischeren Blick denken, als den herrlichen Talabschluß des gletscherreichen Gebirgs über dem tannenbeschatteten Bache mit seinen friedlichen Wiesen. Da ist alles stilvollste Hochgebirgsgröße und vornehme Ruhe.
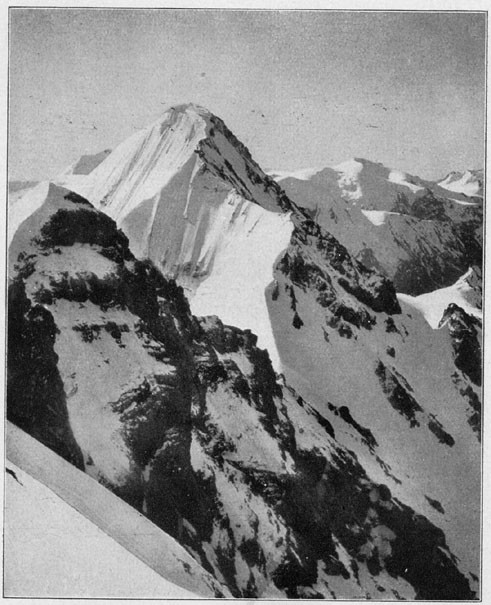
Könisspitze vom Zebru.
Was nun die Besteigungen betrifft, so sind die Aussichtsberge des Nordkammes: Schöntaufspitze, Vertainspitze, Tschengelser Hochwand, Schöneck, und wie sie alle heißen, von Sulden ausnahmlos bequem zu erreichen, und es ist durch Hütten dafür gesorgt, daß neben dem Genuß der Aussicht auch der leibliche Mensch nicht zu kurz kommt.
Der Ortler ist mit seinen 3902 m Höhe eher als ein Bergmassiv, denn als Berg anzusprechen. Im Gegensatz zu der schlanken Königsspitze ist da alles Wucht und Masse. Ein weiter Gletscher, der obere Ortlerferner, bedeckt die ausgedehnte Felsmasse und ist von einem kleinen Firntrapez gekrönt, nach dem der Berg seinen Namen erhalten hat; denn »Ortle« bedeutet Spitzlein. Lucus a non lucendo, ein Gebirgsstock erhält von einem Spitzlein den Namen.
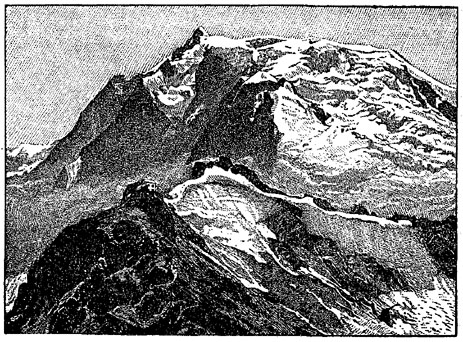
Ortler vom Tabarettakamm.
Die übliche Besteigung erfolgt über den nach Norden verlaufenden Tabarettakamm, der von Trafoi oder Sulden auf gebahntem Pfad erreicht wird. Einer Ritterburg ähnlich thront da die stattliche Payerhütte. Der Anstieg von hier aus dauert 3 Stunden und führt zunächst immer etwas unterhalb des Kammes entlang, bis man hinter dem Tschirfeck an den bekannten Bergschrund kommt, der auf das obere Gletscherplateau und dann zur Spitze führt, wenn die Besteigung an sich schon unschwierig ist, so kommt dazu noch, daß meist ganze Scharen von Touristen hintereinander da hinaufziehen und dafür sorgen, daß der Weg genügend ausgetreten ist. Das hat den Fexen Veranlassung gegeben, dieser Route den poetischen Namen »Kuhweg« zu geben, die prozessionsartige Wanderung aber »Ortlerschlange« zu nennen. Im übrigen ist der Ortler ein Berg der Probleme, an dem immer wieder neue Routen gesucht werden, da dem Fexen die von allen Seiten hinaufführenden »Wege« über Marltgrat, Hinterer Grat, Hintere Wandeln, Schückrinne und wie sie alle heißen, natürlich nicht genügen.
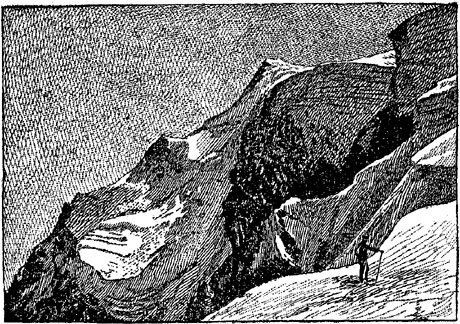
Ortlergipfel vom Tschirfeck.
Wesentlich schwieriger als der Ortler ist die Königsspitze. Schon das Königsjoch ist wegen seines lockeren Gesteins unangenehm, und dann folgt eine lange Eiskletterei an steiler Wand, die insbesondere im Abstieg nicht jedermanns Sache ist. Dagegen stellt sich die Besteigung des Cevedale von der prächtig gelegenen Halleschen Hütte aus als eine unschwierige Schneewanderung dar, wenn man nicht das Pech hat, in eine Spalte zu fallen. Bei allen diesen Bergen ist der Rundblick ein überaus großartiger und gewährt vielfach prächtige Einblicke in eine herrliche Eiswelt.
Ich selbst war im ganzen viermal in der Ortlergruppe. Das erstemal 1887, als ich mit begeistertem Herzen und völlig leerem Geldbeutel von Schluderbach kam. Ein vergnüglicher Engländer, den ich unterwegs kennen gelernt hatte, begleitete mich. Er war ein spaßiger Kauz. Daß er schon drei Frauen geheiratet hatte, bewies seine Begeisterung für diese Welt, die sich auch sonst bei jeder Gelegenheit ganz im Gegensatz zu seinen Landsleuten kundtat.
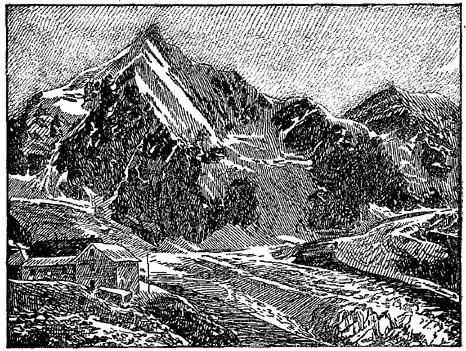
Königsspitze mit Schaubachhütte.
Also wir zogen zusammen gen Sulden und stiegen zu der damals noch unbewirtschafteten Schaubachhütte hinauf, nachdem ich mich bei Eller entsprechend satt gegessen und für einige Tage verproviantiert hatte. Diese Eile war geboten, denn mein Barvorrat betrug nur noch wenige Kreuzer, und von dem sehnlich erwarteten Geldbrief zeigte sich natürlich nicht die geringste Spur. Ist schon jemals ein Geldbrief für einen Leutnant rechtzeitig eingetroffen? Nun bei Papa Eller hatte es ja mit der Bezahlung keine Eile, und mit dem Proviant war schon einige Tage dort oben auszukommen. So bestiegen wir zunächst den Cevedale trotz dickstem Nebel, und Tags darauf die Königsspitze, diesmal bei schönerem Wetter. Auch in meinem Innern folgte da auf die trübe Stimmung froher Sonnenschein. Die prächtige Tour brachte nämlich meinen Engländer in solche Begeisterung, daß er, auf dem Gipfel angekommen, mir strahlenden Auges die Hand drückte und mit einem für einen Briten kaum faßbaren Feuer erklärte, daß wir jetzt Freunde seien. Was konnte ich da anderes tun, als nach gut deutschem Jugendgebrauch nicht bloß einzuwilligen, sondern ihn auch um hundert Gulden anzupumpen? Und wahrlich, das Unglaubliche geschah. Ohne eine Miene zu verziehen, zog der Mann den Beutel aus der Tasche und drückte mir den blauen Lappen in die Hand. So etwas bringen nur die Berge fertig. Nun der Gentleman hatte seine Begeisterung ja auch nicht zu bereuen; denn wenn auch mein Geldbrief natürlich heutigen Tags noch nicht in Sulden angekommen ist, so wußte ich doch, was ich der Königsspitze schuldig war und ließ mich nicht schlecht finden. Wenn man im übrigen nach dem umstehenden Bilde meint, der Geist unseres Berges habe mit seinem verbissenen Gesicht keine gute Miene zu diesem Spiel gemacht, so ist das eine Täuschung, denn elf Jahre später, als ich wieder eine Aufnahme von ihm machte, konnte ich feststellen, daß er noch mit demselben grimmen Blick in das Suldental hinabsah. Beide Aufnahmen gleichen sich vollkommen.
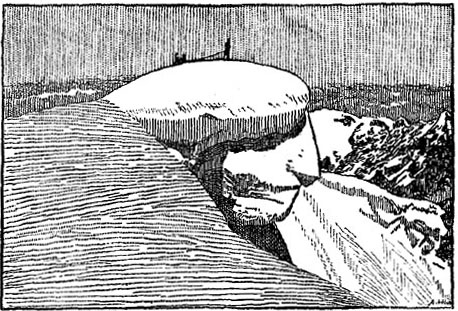
Der Gipfel der Königsspitze.
Bei meiner zweiten Wanderung, 1897, mit Frau Maud hatten wir zunächst eine hübsche Zeit in dem schönen Trafoi, wo wir uns von der Alltagsarbeit erholten, am Ortler herumstiegen und es neben einigen unterhaltsamen Klettereien bei den heiligen drei Brunnen zu einer führerlosen Expedition in dem westlichen Teil der Gruppe kam, die ein ziemlich bedenkliches Abenteuer mit sich brachte.
Wir hatten in der Gegend von Franzenshöhe den langgestreckten, recht schwierigen Gletschersturz des Madatschferners überschritten und, am rechtsseitigen Gletscherrand entlang gehend, das Tuckettjoch erstiegen, wo wir einen prächtigen Blick über die herrlichen Eisgefilde des Zebrutals bis hinüber zur Königsspitze hatten. Denselben Weg ging es dann wieder zurück. »Wir schritten«, so schreibt Frau Maud, »in Gedanken versunken über eine nahezu ebene, scheinbar harte Firnfläche, als mein Mann plötzlich mit einem Bein einbrach. Gleich darauf sank er auch mit dem andern in die sich öffnende schmale Spalte, und hätte er nicht die Geistesgegenwart gehabt, im Fallen den Pickel quer darüber zu legen, so wäre es wohl um ihn geschehen gewesen, denn die tückische Kluft, in der er jetzt hing, war nahezu bis zum Rand mit eisigem Wasser gefüllt.
Ich war zu Tod erschrocken, aber mein Mann machte sich zunächst nichts daraus. Seinen Anweisungen entspechend hielt ich mich bereit, ihn aus der eisigen Umarmung herauszuziehen, aber er mußte sich erst von dem um die Schulter geschlungenen Seil loswinden, was ziemlich lange dauerte. Endlich konnte ich ziehen, aus Leibeskräften natürlich, während mein Mann gewaltsame Anstrengungen machte, um sich aus dem ihm bis an den Hals reichenden Eiswasser in die Höhe zu arbeiten. Vergeblich! Die Kluft ging auf beiden Zeiten schräg auseinander, so daß er, auch durch den schweren Tornister behindert, keinerlei Halt mit den Füßen bekam, während ich selbst mich der Spalte nicht zu sehr nähern durfte, um nicht ebenfalls einzubrechen.
Drei-, vier-, fünfmal machten wir verzweifelte Versuche, und immer mehr schwanden ihm die Kräfte, während ich nicht imstande war, ihn aus eigener Kraft herauszuziehen. Es war entsetzlich. Da plötzlich kam er doch höher. Er hatte sich gedreht, es gelang ihm, die Steigeisen, welche er glücklicherweise anhatte, nach rückwärts in das Eis zu hauen und sich so weit in die Höhe zu schieben, daß er mit den Armen oben Halt bekam und sich vollends ans Tageslicht arbeiten konnte.
Meine Gefühle waren unbeschreiblich. Lange lagen wir zu Tode erschöpft auf dem Eis, bis wir uns endlich wieder aufrafften, wie nun aber weiter? Ich erklärte, keinen Schritt mehr über diese tückische Fläche zu tun, und so versuchten wir, uns einen Weg quer über den Gletschersturz hinweg zu bahnen. Zweimal durchschritten wir ihn unter unsäglichen Schwierigkeiten bis an den jenseitigen Rand, aber die Eiswände fielen dort senkrecht in die Tiefe, und es war keine Möglichkeit, auf festen Baden zu gelangen. Schließlich blieb nichts übrig, als doch den alten Weg zu versuchen und über jene entsetzliche Stelle hinwegzugehen. Dabei ereignete sich nicht das Geringste, und es gelang uns, wenn auch unter vielen Mühen, den Gletschersturz nun glücklich zu durchschreiten.
Daß wir unter solchen Verhältnissen zu dem Entschluß kamen, nicht mehr zu zweien über einen unbekannten Gletscher zu gehen, wird man wohl verstehen.«
Ein Jahr später waren wir vom Glück mehr begünstigt. Allerdings hatten wir dabei den vortrefflichen Stabeler mit uns, der schon dafür sorgte, daß keine Dummheiten gemacht wurden. Wir hatten, vom Engadin kommend, von der Cedehhütte aus die Königsspitze bestiegen und waren von hier über den herrlichen Suldengletscher, wohl einen der schönsten der ganzen Ostalpen, hinunter nach Sulden gegangen. Unser ursprünglicher Plan, das steile Hochjoch von hier aus zu machen, wurde durch das Wetter verhindert, und so zogen wir auf dem allerdings weiten, aber um so schöneren Umweg über die Hallesche Hütte und den Zebrupaß zu der Mailänderhütte, was insbesondere prächtige Blicke auf die nach allen Seiten gleich stolze Königsspitze gewährte. Weniger erfreut waren wir von dem Zustand der Mailänderhütte, der, auch wenn man von den dreibeinigen Stühlen, Tischen und gebirgsähnlichen Matratzen absah, ein mehr als italienisch schmutziger war, so daß wir Stunden brauchten, um auch nur einigermaßen Ordnung zu schaffen. Stabeler folgte dabei gehorsam, wenn auch etwas verdutzt, den strengen Weisungen von Frau Maud und erwies sich als äußerst geschickt in der Bändigung des rauchenden Kamins sowie in der Wiederherstellung der altersschwachen Stühle und Tische. Nur in einem Punkt setzte er ihr ernsthaften Widerstand entgegen: da wir keine Seife und Putztücher hatten, so dürfe der Tisch unter keinen Umständen gewaschen werden, er werde sonst nur noch schmutziger!!!
Nun zu den Bergen! Ich muß sagen, daß die westliche Ortlergruppe für mich geradezu eine Art von Heiligtum ist. Schon der Umstand, daß dieses Gebirge dem großen Touristenschwarm so gut wie unbekannt bleibt, spricht dafür, und wenn auch der Wanderer, der die Stilfserjochstraße hinaufzieht, gewiß den herrlichen Firnkamm des westlichen Gebirgarmes bewundert, der sich so hoch über ihm erhebt, so gibt er sich doch nur dem Gesamteindruck dieser mächtigen Wand hin, ohne zu ahnen was alles da verborgen liegt. Sehen wir uns also einmal näher dort oben um!
Es war eine sternenklare Nacht, als wir die Mailänderhütte verließen, und schon nach wenigen Schritten standen wir auf dem weiten Zebrugletscher. Zu unserer Linken erhoben sich wild zerklüftete Felsen: die breite, drohende Südostwand der Thurwieserspitze, bei deren düsterem Anblick wir nicht ahnten, welche Überraschung der Berg uns noch bereiten würde. Rechts vor uns erglänzten die Firnwände von Zebru und Königsspitze im Mondlicht, und über dem tiefen Tal hinter uns hingen die phantastischen Wolkennebel, alles ein Bild gewaltigster Ursprünglichkeit. In tiefem Schweigen zogen wir über den Gletscher, dessen Spalten in der Dunkelheit drohender aussahen, als sie es in Wirklichkeit waren. Nach etwa zwei Stunden verflachte sich dann der Hang zu einem breiten Firnsattel, der messerscharf abgeschnitten und völlig abrupt, ganz außerordentlich steil nach jenseits auf den Suldenferner abstürzte. Das Hochjoch war erreicht. Die Spuren einer früheren Besteigung führten jenseits herauf, und es konnte einem schwindlig werden, wenn man an dieser steilen Leiter hinabsah. Mehr noch interessierte uns der Blick in die Fernen, wo der neue Tag seinen strahlenden Einzug hielt. Die weiten Schneefelder wurden heller, die schattenhaften Umrisse der Berge verschärften sich, und an den sich rötenden Dolomitenzacken am Horizont, die einer so ganz andern Welt anzugehören schienen, vollzog sich das ewig neue Wunder des Sonnenaufgangs.
Die nun folgende Besteigung des Zebru (3735m), ein Anstieg an steiler Firnwand mit dem schließlichen Durchschlagen einer Wächte, bedeutete uns eine kurze, angenehme Unterhaltung. Der Lohn aber, den wir dafür ernteten, war darum nicht geringer, denn der Ausblick von diesem vierthöchsten Gipfel des Gebirgs ist von einer selten großartigen Pracht, wenn nicht der schönste in dem ganzen Gebiet überhaupt. Er hat zunächst den Vorzug, daß man mitten zwischen Ortler und Königsspitze steht und sie in nächster Nähe bewundern kann, während die breite Masse des Ortlers mit seinen weiten Eisfeldern, scharfen Graten und ungeheuren Steilhängen durch ihre Einfachheit und Wucht gigantisch wirbt, sucht die stolze Pyramide der Königsspitze mit den kühn geschwungenen Graten und gipfelgekrönten Wächten ihresgleichen an gewaltiger Pracht und Gestaltung. Als dritte Größe gesellt sich dem die Thurwieserspitze zu, die jetzt als ein regelmäßig geformter, schlanker Felsgipfel in den Himmel hineinragt.
Zwischen diesen drei Riesen nun schweift der Blick über die Abgründe und Eisfelder hinweg nach dem zackigen Horizont, der mit der stolzen Berninagruppe, den monotonen Eisgefilden der Ötztaler Alpen und den so ganz anders gearteten Dolomiten und südlichen Bergen der Adamello- und Presanellagruppe eine so bizarre Verschiedenheit aufweist. Dazu noch als Vordergrund der herrlich gezackte, wächtengekrönte Grat des Berges selbst, der mit seinen merkwürdigen Details die eisigen Schönheiten und Gefahren der Höhen so drastisch zum Ausdruck bringt.
Nur ungern trennten wir uns und zogen den steilen Firnhang wieder hinab, um der Thurwieserspitze (3641 m) unsern Besuch abzustatten, die uns nun ihre Überraschung bereitete. Denn eine Überraschung war ihr Anblick in der Tat, wie man sie manchmal bei Menschen erlebt, denen nur wenig zuzutrauen man sich angewöhnt hat, und die nun plötzlich bei irgendeiner entscheidenden Gelegenheit sich zu einer Kraft und Größe entwickeln, die man nie bei ihnen gesucht hätte.
Wir kennen den Berg bisher nur als einen düstern Felsen, der, obwohl groß und wuchtig, neben einem Ortler nicht recht aufkommen konnte. Da sahen wir die schmale zum Gipfel führende Firnlinie sich plötzlich zu einer eisigen Steilwand verbreitern, deren glitzernde Helligkeit und Wucht alle Vorstellung überbot. Man kann sich aus unserem Bild nur schwer einen Begriff von der grandiosen Eisespracht machen, die sich da dem Auge bietet, und man muß schon die zwei kleinen Menschenpunkte zur Vergleichung heranziehen, die sich halbwegs zum Gipfel über dem Grat zur Linken, der Anstiegsroute, befinden. Einigermaßen ergeben sich daraus die riesenhaften Größenverhältnisse. Und unmittelbar daneben steht, nur wenig aus dem herrlichen Kamm herausragend, die Trafoier Eiswand mit ihren hängenden Gletschern, glitzernden Rinnen und dem prächtigen Gipfelkamm; ein Bild von merkwürdigster Eigenart und Größe, die wir den beiden Bergen vorher entfernt nicht zugetraut hatten.
Daß die Besteigung der Thurwieserspitze und der Blick von ihrem gezackten Wächtengrat nicht wenig dazu beitrugen, uns den Tag zu einem unvergeßlichen zu machen, wird man mir wohl glauben. Am folgenden Morgen bestieg Frau Maud mit Stabeler den Ortler über den Hochjochgrat, während ich mit dem uns begleitenden Freund über den Cevedale nach Sulden ging, wo wir uns wieder trafen und die Gattin gar manches von ihren Erlebnissen auf dem unheimlichen Grat mit seinen düstern Felsen, steilen Firnhängen und prächtigen Wächten zu erzählen wußte.
Acht Jahre vergingen, ohne daß ich die Eindrücke von dort oben vergessen hätte. Es war eine Mischung von Dankbarkeit und Sehnen, die immer wieder mahnte und uns schließlich noch einmal dort hinauftrieb. Durch die Erbauung der Hochjochhütte war die Sache auch leichter und bequemer geworden, wir stiegen diesmal über den zerklüfteten interessanten Unteren Ortler Ferner an, wobei sich manche packende Eiskletterei abseits vom Wege bot und zum Teil auch der vom Ortler kommende Steinfall für die nötige Pikanterie sorgte. In der prächtig eingerichteten, unmittelbar am Loch gelegenen Berliner Hütte verbrachten wir zunächst einen stimmungsvollen Abend um das flackernde Feuer, während draußen der tobende Sturm sich vergeblich abmühte, das ganze Bauwerk in die Lüfte hinauszufegen.

Berliner Hochjochhütte.
Am andern Morgen war Nebeltreiben und Schneegestöber, und nachdem wir uns an steiler Firnwand über den Bergschrund hinaufgekämpft hatten, mußten wir wegen Blitzgefahr die Zebrubesteigung vorzeitig abbrechen. Als unsere Pickel immer unheimlicher surrten, kam es zu einer wilden Jagd an dem Hang hinunter, und wir hatten gerade schwer keuchend unser Asyl wieder erreicht, als ein fürchterliches Donnerwetter losbrach, das den ganzen Tag über anhielt. Bergsteigerlos. Am andern Morgen ging's wieder hinauf zum Zebru. Wieder kämpften die Wettergeister miteinander, und dasselbe Los schien uns vorbehalten zu sein, wie gestern. Da plötzlich huschten am Ortler die Nebel auseinander, Sonnenstrahlen kämpften sich zwischen den Riesen hindurch und fluteten an den Firnhängen hinab, deren Kamm sich scharf aus dem brodelnden Kessel des Suldenferners heraushob. Licht, Licht, Licht! Jubelnd begrüßten wir den herrlichen Anblick und sahen gespannt dem geisterhaften Schauspiel von wandernden Schatten und fliehenden Nebeln zu, beglückt von seiner tief ergreifenden, elementaren Pracht. Freilich es währte nur kurz; denn bald hatte die siegreiche Sonne die weiten Schneeflächen in ein einziges monotones Licht getaucht, und der Zauber des Geheimnisvollen war dahin, – um sofort an anderer Stelle sein Spiel neu zu beginnen. Auf dem vor uns liegenden Zebrugipfel, der bis dahin in Schatten gehüllt war, regte es sich. Ein glitzernder Lichtfleck erschien, da und dort setzten sich schüchterne Sonnenstrählchen auf die Schneevorsprünge, und lange Schatten streckten sich. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis begann auch hier. Immer plastischer traten die mächtigen und doch so graziösen Formen des Gipfels hervor, und der Kamm bekam Leben bis zu der wolkenumspielten Spitze. Immer mächtiger hob sich das Firnbecken zur Linken mit seinen Abgründen und Löchern aus der Schneemasse ab, und die Felsen zur Rechten verdunkelten sich zusehends in dem greller werdenden Licht. Man konnte kaum Augen genug haben, um das alles zu sehen. Die Sonne hatte gesiegt, und lange noch kletterten wir auf dem prächtigen Grat mit seinen Abgründen und herrlichen Fernblicken hoch über den brodelnden Tiefen herum, mitten im Licht. Sonnenkinder!
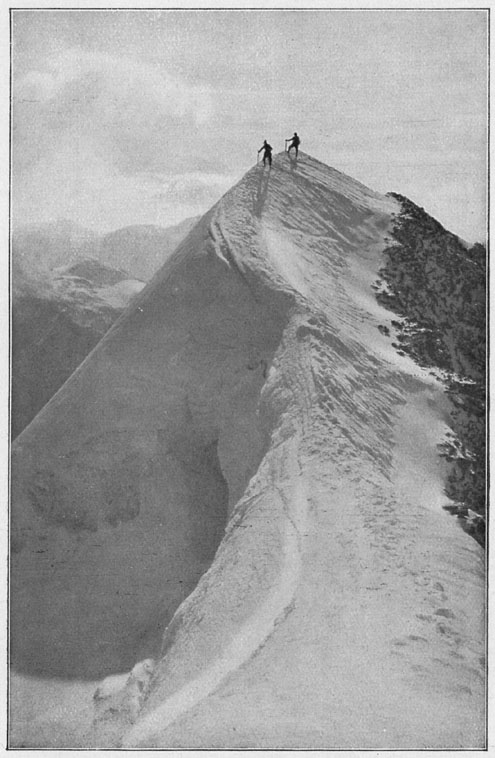
Auf dem Gipfel des Zebru.
Am dritten Tag war wieder schlechtes Wetter, und von einer Überschreitung des Hochjochgrats konnte keine Rede sein. Gar zu toll trieb der eiskalte Sturm die Wolken durcheinander. Immerhin kämpften wir uns ein gut Stück weit hinauf, auf eisiger Firnschneide, an steilen Hängen entlang über Felsen und Zacken, bis uns der Sturm zur Umkehr zwang. Wohl durchschauerte es uns Mark und Knochen, und einmal sogar waren wir genötigt, unterhalb der Wächte zu gehen, um nicht einfach weggefegt zu werden, aber prächtig war's doch. Das Heroische in uns war geweckt, und dann sieht man eben mit andern Augen, als sie der gewöhnliche Beschauer hat. Rein bergsteigerisch wären diese drei Tage völlig verfehlt gewesen, aber trotz oder gerade wegen des »schlechten Wetters« bildeten sie unvergeßliche Ewigkeitsmomente.

Thurwieserspitze und Trafoier-Eiswand vom Eiskögele.
Wie, wenn an einem düstern Wintertag, wo das Leben unter dem weißen Leichentuch erstarrt ist und die kalten Stürme über das öde Land hinwegbrausen, wie, wenn sich da plötzlich der Himmel klären, der Schnee dahinschmelzen würde, unter dem lachenden Sonnenschein Blumen und Gräser hervorkämen, die Bäume sich belaubten, Früchte trügen und der Sommer mit einem Schlag seinen Einzug hielte? Ein märchenhafter, phantastischer Traum, würde man sagen, und doch wäre es nichts anderes, als was ich 1898 mit Frau Maud bei unserem Zug von der Ortlergruppe nach den Dolomiten erlebte.
Da waren zunächst die Eisgefilde der Ötztaler Alpen. Dem Zentralkamm des Gebirges angehörend, zeigen sie eine durch Höhe und Ausdehnung so bedeutende Erhebung, wie man sie in Europa sonst nicht vorfindet und damit eine entsprechend beträchtliche Gletscherentwicklung. Auch sind die Kämme nur wenig durchbrochen, und die Gipfel meist keine so ausgesprochene Individualitäten wie die der Ortlergruppe. »Der Ausdruck tiefen Ernstes, stolzer, ruhiger Majestät zeichnet deshalb diesen Teil der Alpen vielleicht mehr aus als jeden andern.« Die weiten, nur wenig zerklüfteten Eisgefilde, die der Landschaft ihren polarartigen Charakter geben, erwecken in uns das Gefühl der Unendlichkeit, und unsere Aufmerksamkeit ist von der Höhe in die Weite gelenkt. Unverwandt starren wir hinaus in diese eisige Ferne. Es ist der Winter, der sich in die Seele senkt, sie mit seinen Schauern erfüllt. Bei uns kamen dazu noch winterliche Wetterunbilden und für mich ein allerdings selbstverschuldeter Umstand, der mich dieselben doppelt schwer empfinden ließ.
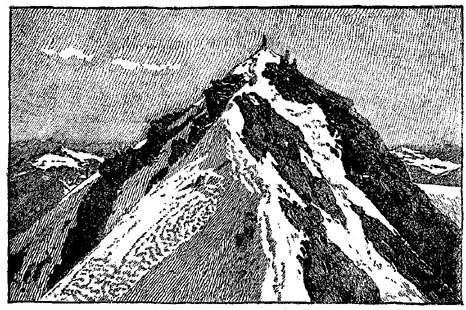
Gipfel der Weißkugel.
Nach einer Besteigung der stolzen Weißkugel in Vent angekommen, hatte ich es mir nicht versagen können, ein Bad zu nehmen, obgleich als Wanne nur ein im Keller befindlicher Brunnentrog aufzutreiben war, durch den ein mehr als eisiges Wasser lief. Die Folgen dieses übertriebenen Reinlichkeitsbedürfnisses machten sich denn auch bei der Tags darauf unternommenen Besteigung der schönen Wildspitze in einem Zahngeschwür geltend, das seine Spuren in einer mehr und mehr anschwellenden Wange zeigte. Noch am selben Abend erreichten wir in strömendem, kaltem Regen die Samoarhütte, wo der Winter seinen endgültigen Einzug zu halten schien, wir sahen da am andern Morgen in ein Mittelding zwischen Regen und Schneesturm hinein, das in nichts mehr an den August erinnerte und uns den Weitermarsch antreten ließ, obgleich wir weder den Weg kannten, noch eine brauchbare Karte hatten und anstatt des Seiles eine Waschleine benützen mußten. Auf dem Niederjochferner herrschte ein solides Schneegestöber, der Nebel war so dick, daß man kaum einige Schritte weit sehen konnte, und wir hatten die größten Schwierigkeiten, um uns auch nur einigermaßen zu orientieren. So erreichten wir nach mehrstündigem Marsch einen sich quer vorlegenden Felskamm. Daß es der Hauptgebirgskamm war, konnte angenommen werden, wo aber befand sich das gesuchte Niederjoch? Nach einigem Suchen kamen wir an eine Art von Sattel, durch den der Sturm wütend herüber tobte, so daß meine geschwollene Backe allmählich riesenhafte Dimensionen annahm. Also auf gut Glück weiter, in den Sommer des Etschtals! Und beide, Glück und Sommer lächelten uns. In dem Tal, in das wir uns schließlich hinunterfanden, machte das Schneegestöber zwar einem gründlichen Gebirgsregen Platz, dann aber marschierten wir rasch in den prächtigsten Sonnenschein hinein, während dort hinten in den Bergen nach wie vor das schwere, dunkle Gewölk hing, wie ein zauberhaftes Wandelbild huschten dann bei der sich anschließenden Postfahrt die üppig grünen Fluren des herrlichen Vintschgaus an uns vorbei, und in dem schönen Bozen konnten wir, in lauer Sommernacht im Freien sitzend, den Klängen einer Regimentskapelle lauschen, während das Ötztaler Wintererlebnis mit seiner geschwollenen Backe, seinen Nebeln und eisigen Schneestürmen nur noch wie ein längst vergessener schwerer Traum erschien.
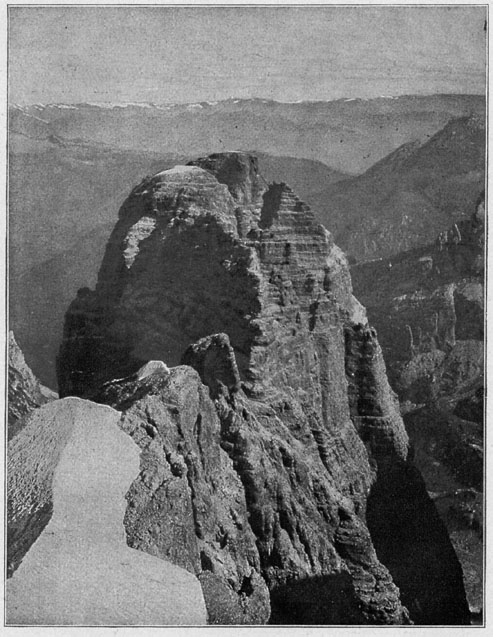
Der Trozzon von der Cima Tosa.
Ja, dieses Bozen! Welche Lust in den malerischen, altersgrauen Straßen unter den Bogengängen zu wandeln! Dazu diese urechten, kernigen Tirolergestalten mit ihren bunten Trachten, der Obstmarkt mit seinen Trauben, Orangen, Datteln und den lachenden deutschen Äpfeln, die beinahe so groß wie die Kinderköpfe sind, das famose Batzenhäusl mit seinem Terlaner und die rebenbegrenzten Höhen mit ihren Burgen!
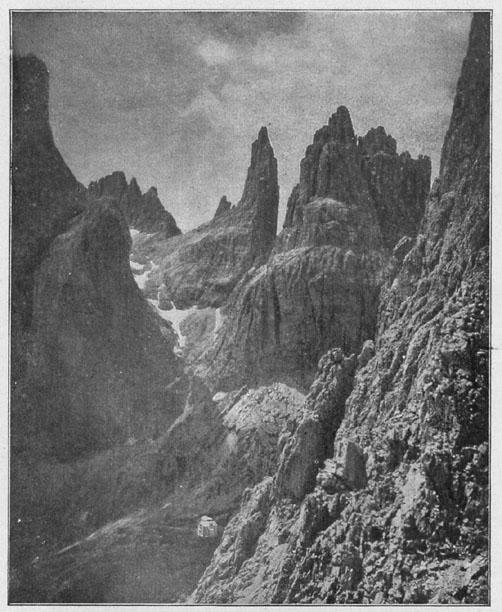
Vajolettürme mit Rosengartl.
Und dann, alles überragend, der phantastische Rosengarten König Laurins! In grellem Weiß flimmern die vielgestaltigen Zacken und riesenhaften Mauerkolosse über den grünen Wäldern und Wiesen an dem tiefblauen Himmel, bis die Sonne ihr Haupt neigt und sie in feurigstem Purpur erglühen läßt. Diesem rosigen Licht verdankt das Gebirge wohl seinen Namen. Daß sich auch die Sage dieses märchenhaften Anblicks bemächtigt hat, ist nur natürlich. Ich möchte aber bezweifeln, ob der Verfasser des mittelalterlichen Spielmannslieds sich je dort oben befunden hat. Höchstens König Laurins »Heerstraße«, die das Gebirge entlang führen sollte, erinnert durch ein breites, weithin sichtbares Schuttband einigermaßen an die tatsächlichen Verhältnisse, während sonst auch nicht die entfernteste Anspielung an sie vorhanden ist.
Die Sage beschäftigt sich mit dem Raub der schönen Similde von Steiermark durch den im Innern des Gebirgs hausenden Zwergkönig Laurin, der mit Hilfe einer Tarnkappe und magischer Ringe eine übernatürliche Kraft besaß und seine Rosen in dem »Gartl« behütete.
»Ein Gärtlein hat er geziert und gepflegt,
Drin prangen die duftendsten Rosen,
Mit seidenem Faden ist es umhegt,
Dort will ich nun küssen und kosen,
Verschlossen sind die Pforten von Gold,
Und wer den Faden zerreißen wollt,
Dem sagt der Kleine gar üblen Gruß,
Die rechte Hand und den linken Fuß
Muß er zum Pfande ihm geben – – «
Unter allerhand Fährlichkeiten bezwang der von Simildes Bruder zu Hilfe geholte Dietrich von Bern den Zwergkönig, zog in sein unterirdisches Zauberschloß ein und wußte nach einer kurzen, heimtückischen Gefangennahme sich und die Seinen mit Similde wieder zu befreien. Damit ging der Rosengarten in Trümmer, und nur noch das Abendrot läßt seine einstige Schönheit ahnen.
Sie ist in anderer Weise für uns Moderne auferstanden. Schon das allmählich ansteigende Vorgelände mit seinen herrlichen Almen und Wäldern, die rechts von der gezackten Mauer des Latemar, links von dem massigen, aussichtsreichen Schlern eingerahmt sind, gewähren eine Überfülle lieblich großartiger Landschaftsbilder, die von Jahr zu Jahr häufiger aufgesucht werden. Noch mehr aber ist der Sinn für die Schönheit des Gebirges selbst erwacht, dessen Zackengewirre schon von außen unser Herz ergötzt und uns um so mehr erhebt, je tiefer wir in dasselbe eindringen. Seine beiden, vielgegipfelten, von Norden nach Süden verlaufenden Parallelketten umschließen im Norden den mächtigen Grasleitenkessel, im Süden das Vajolettal, ein wildes, von den phantastischen Kolossen überragtes Schutt- und Trümmerkar, das tiefer unten die herrlichsten, südlichen Bilder zeigt. Den Glanzpunkt des Gebirgs aber bildet das sagenumwobene »Gartl«. Wir sehen auf unserem vom Grasleitenpaß aufgenommenen Bild die alles überragende Rosengartenspitze mit ihrem halbkreisförmigen Gipfelgrat. Ihr vorgelagert sind die wesentlich niedrigeren, hier massig aussehenden Vajolettürme, während rechts die Laurinswand steil in das Vorgelände abstürzt. Zwischen diesen drei Bergen schimmert das kleine Schneefeld des »Gartls«« hervor, wahrlich, ein prächtiger Anblick!
Noch phantastischer macht sich der Eingang des »Gartls« von oberhalb der inzwischen erbauten Vajolethütte, wo der Winklerturm sich von dem Vajolethauptturm getrennt hat und als riesenhafter Wächter neben der Laurinswand steht. Dringen wir nun erst dort oben ein und klettern abseits von dem gebahnten Pfad herum, so zeigen sich uns, abgesehen von dem bekannten Anblick der drei südlichen Vajolettürme, Bilder phantastischster Art, wie wir sie kaum je wiederfinden. Es ist, als habe die Dolomitenwelt in ihrer ganzen Pracht und Großartigkeit sich auf engstem Raum wiederholen wollen. Das »Gartl« ist deshalb nicht bloß das Herz des Rosengartens, sondern der Dolomiten überhaupt.
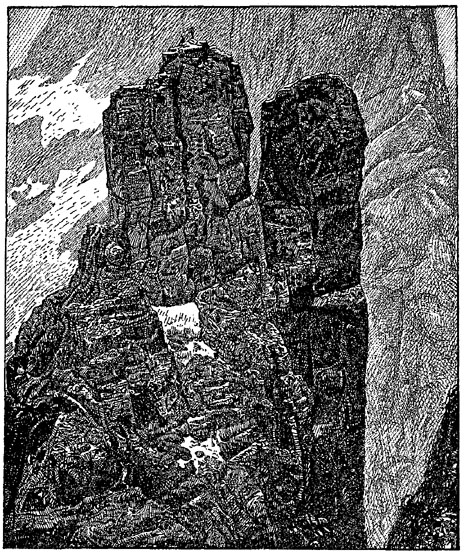
Stabeler- und Delagoturm von Norden.
Was nun uns selbst betrifft, so bestiegen wir in der kurzen, uns zur Verfügung stehenden Zeit die beiden Hauptgipfel der schönen Gruppe, den Kesselkogel (3001 m) und die Rosengartenspitze (2981 m). Weiterhin ließ es sich Frau Maud nicht nehmen, in Gesellschaft unseres zufällig anwesenden Freundes Stabeler dessen Turm zu besteigen, von welcher Kletterei sie gar manches zu erzählen wußte, während ich mich in unverantwortlicher Faulheit damit begnügte, am obern Gartlrand liegend, ihr zuzusehen und hin und wieder den Blick von den phantastischen Dolomitengestalten hinaus über das grüne Vorland bis zu dem schneebedeckten Horizont schweifen zu lassen und dort alte Bekannte zu grüßen.
Nun zu der Königin der Dolomiten, der stolzen Marmolata!. Sie ist ein überaus mächtiges Gebilde von packendster Eigenart, während im Süden eine ungeheure Mauer sich glatt und abrupt aus dem grünen Land erhebt, die dem modernen Kletterer die verwegensten Kunststücke ermöglicht, steigt im Norden ein weiter Gletscher ganz allmählich zu dem Gipfel an. Fels und Eis stoßen so zu einem an Massigkeit alles überragenden Gebilde zusammen, das in majestätischer Ruhe über der weiten Landschaft thront, sich glitzernd und strahlend, wie andern Regionen angehörig, aus derselben abhebt. Es gehört wahrlich keine besondere Phantasie dazu, um in diesem Berg die »Königin der Dolomiten« zu sehen und von ihrem »silbernen Hermelin« zu sprechen.
Inmitten ihres Reiches thronend, zeigt die Marmolata einen Rundblick, der an Großartigkeit, weite, malerischer Pracht und instruktiver Bedeutung gleich hervorragend ist. Beinahe die ganze Dolomitenwelt ist da in ihrer packenden Eigenart vor uns ausgebreitet. Dem Zackengewirre der Rosengartengruppe im Westen gesellen sich im Nordwesten die Riesen der Grödner Alpen zu: Langkofel, Fünffingerspitze, Grohmannspitze, Innerkoflerturm, Zahnkofel; gewaltige Dolomitblöcke, deren riesenhaften Aufbau wir ja zum Teil schon früher im Wintergewand bewundern konnten. Daneben im Norden wieder ein ganz anderes Bild: die breite Sellagruppe mit dem weiten, mauerumgürteten Gletscherplateau, zu dem sich wilde Felsschluchten als die alleinigen Zugänge hinaufschlängeln. Im Nordosten lugen die südlichen Ampezzaner Dolomiten, vor allem der mächtige Pelmo hervor, im Osten erhebt sich die breite Wand der Civetta in ihrer ganzen Größe, und weiter rechts strecken die Gipfel der Palagruppe ihre Zacken in den Himmel hinein. Und das alles in dem weiten, südlichen, grünen Land mit seinen Tälern und welligen Höhen, aus denen sich die Felskolosse wie verirrte Sendboten aus einer andern Welt phantastisch abheben.
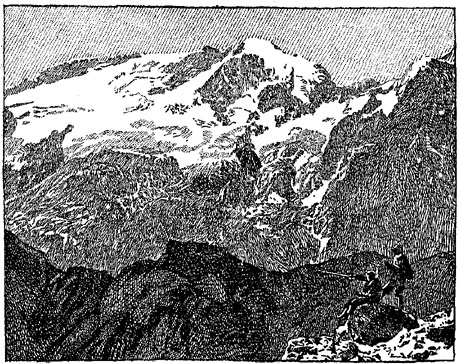
Marmolata von Norden.
Wir selbst erreichten den Fuß des Berges 1898 durch das südlich schöne Fassatal, von dem aus wir in das Contrintal anstiegen. Der Marsch da hinauf ist wohl einer der schönsten Dolomitenspaziergänge, bei dem sich liebliche Anmut mit gewaltiger Hochgebirgsgröße in seltener Art vereinigen. Das auf waldbedeckter Alm gelegene Contrinhaus ist ein höchst behagliches Heim oder besser gesagt eine idyllische Sommerfrische, die bei leichtester Zugänglichkeit die stattliche Höhe von 2100 m erreicht und außerdem noch einige Mineralquellen in der Nähe aufweisen kann. Es war so schön da, daß wir uns erst nach einem Bummeltag, der der Besteigung der aussichtsreichen Ombrettaspitze (3009 m) gewidmet war, zu dem Gang auf die Marmolata (3344 m) entschließen konnten. Ein wilder Sturm tobte dort oben, hoch wirbelte der Schnee in der Luft und unablässig fegten die Wolken über den eisigen Kamm hinweg. Und doch, was man unter sich sah, war südliche Pracht. Nord und Süd lagen im Kampf miteinander und zauberten eine unerschöpfliche Fülle märchenhafter Bilder hervor.

Montblanc vom Tol du Géant.
Unter dem ergreifenden Gegensatz von Ernst und Anmut stand auch der Abstieg. Hier die lange Gletscherwanderung, dort der schöne Fedajapaß mit seinen Wäldern, Wiesen, dem spiegelklaren See und den gewaltigen Felsen ringsum neben dem strahlenden Hermelinmantel der Dolomitenkönigin.
Weiter!
Wieder ein ganz anderes Bild zeigte uns die westlich der Etsch, isoliert von der übrigen Dolomitenwelt gelegene Brentagruppe. Wenn uns bei der Rosengartengruppe Vielseitigkeit, Reichtum und Schlankheit der Formen anzieht, so ist hier alles massig und riesenhaft. Eine ungeheure, nur durch wenige hochgelegene Scharten getrennte Mauer verläuft da zwischen dem Val Nambino und dem Molvenosee in nordsüdlicher Richtung, an Wucht der Blöcke und Mächtigkeit der Wände so riesenhaft, daß die andern Dolomitengruppen beinahe zierlich neben ihr erscheinen. Kaum irgendwo fühlt man sich so beengt, und es bedarf einer gewissen Anstrengung, um sich solch düsterer Eigenart zu freuen. Um so lieblicher ist demgegenüber die herrliche Umgebung: auf der einen Seite der idyllische Molvenosee mit italienisch heiterem Anstrich, auf der andern das schöne Madonna di Campiglio mit seinen germanischen Wäldern und seinem Reichtum an bequemen Wegen und Spaziergängen, die das alte Klosterhotel zu einer der schönsten Sommerfrischen Tirols machen.
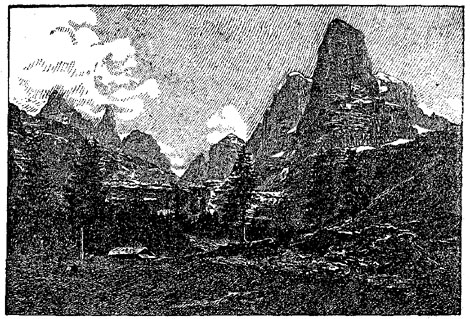
Der Crozzon vom Val Brenta Alta.
Und nun die Berge!
Gewiß, auch unter ihnen gibt es manches Alltagsvolk, am dem wir achtlos vorüberziehen. Es kommt und geht, ohne daß wir uns um dasselbe kümmern, und nicht einmal für die Namen interessieren wir uns. Andere wieder erfreuen unser Herz, sind uns sympathisch, gute Freunde, an die wir gerne zurückdenken. Einige wenige gibt es auch, die anspruchsvoller sind. Sie lassen sich nicht ignorieren und begnügen sich nicht mit unserer Freundschaft. Nein, sie zwingen uns, sie zu beachten, ziehen uns an mit dämonischer Gewalt und lassen uns nicht mehr los. Immer wieder müssen unsere Blicke sich ihnen zuwenden, und eine mit Trotz gemischte Sehnsucht ergreift uns, dort oben zu stehen, wir müssen hinauf. Nicht bloß einmal, sondern wieder und wieder.
Ein solcher Berg war für mich wie für manchen andern der Crozzon di Brenta.
Es ist ein eigenartiges Gebilde, das ganz aus dem Rahmen des Gewöhnlichen, Alltäglichen herausfällt. Ein Ausläufer der höheren Cima Tosa (3176 m), die ihn mit dem Strahlenglanze ihres hochgelegenen Firnfeldes umkränzt, kann er genau genommen nicht einmal als ein selbständiger Berg angesehen werden, sondern nur als ein Teil jener, mit der er aufs engste verbunden ist. Aber der Hauptberg bildet doch nur den stimmungsvollen Hintergrund des Kolosses, der ihn zu überragen scheint und alles für sich beansprucht, als Herrscher seiner Umgebung. Was nun ist das Packende an diesem Gebilde? Wohl zeigt es Erhabenheit, Stolz, Hoheit und Ebenmaß der Form, was aber in Wahrheit so dämonisch anzieht, ist der ungeheuerliche Trotz, der über dem Berge lagert, der vollendete Ausdruck der schrankenlosen Wildheit der Hochgebirgsnatur. Es gibt keinen zweiten Turm in den Dolomiten, keinen Grat, der in so gewaltigen zyklopischen Formen aufgebaut ist. Dieser letztere Umstand insbesondere macht die an sich schon so eigenartige Besteigung so merkwürdig anziehend. Man betrachte sich nur diese drei Gipfelblöcke von dem Firnfeld der Cima Tosa, an denen es immer wieder hinauf- und hinuntergeht, bis man endlich den letzten, 53 m unter dem Tosagipfel liegenden Koloß erreicht hat. Welche herrlichen Klettereien gibt es da in nie dagewesener Abwechslung!
Wir selbst bestiegen den Berg neben verschiedenen andern Größen der Gruppe zweimal, 1897 und 1898. Das eine Mal kamen wir von Trafoi, bei welcher Gelegenheit wir das schöne, zwischen Adamello- und Presanellagruppe gelegene Val di Genova durchstreiften, das andere Mal kamen wir vom Molvenosee und hatten dabei ein unterhaltsames Biwak, das allerdings nicht ganz ungestört verlief. Am Fuße des Gebirgs an einem prächtigen Wald angekommen, fanden wir eine solche Menge von Erdbeeren vor, daß Frau Maud erklärte, hier bleiben und die Nacht zubringen zu wollen. Es ließ sich dies um so eher machen, als am Waldrand ein kleines Zelt aus Rinde vorhanden war, das wohl einem Hirten gehörte und gegebenenfalls Schutz bot. Zunächst nun ließ sich die Sache vortrefflich an. Wir pflückten Unmengen von Beeren, die uns nach dem selbstgekochten Mahl vortrefflich mundeten und saßen bis gegen Mitternacht um ein mächtiges Feuer, dessen Flammen sich außerordentlich malerisch von den Tannen und dem Felsgebirge dort oben abhoben. Da plötzlich kam ein fürchterliches Gewitter, das uns schleunigst Schutz in unserem Hirtenzelt suchen ließ. Aber wir kamen vom Regen in die Traufe. »Steter Tropfen höhlt den Stein«, und es gibt nichts Schrecklicheres als das beständige Heruntertropfen von Wasser auf dieselbe Körperstelle. Wohl versuchten wir uns durch Hinundherwälzen dagegen zu schützen, aber der Raum da drinnen war viel zu eng und außerdem machte sich bald auch von unten her ein mindestens ebenso schlimmer Feind bemerkbar, der, in einer Überzahl von Tausenden auftretend, uns schließlich zu völliger Verzweiflung brachte. Nun ein Bad in dem Bach am andern Morgen erfrischte und reinigte uns wieder einigermaßen, und die Besteigung des herrlichen Crozzon, der Marsch durch das gewaltige Felsentor der Bocca di Brenta hinunter zum schönen Gardasee ließ uns die Leiden dieses nächtlichen Biwakskampfes bald wieder vergessen.