
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Philister war auf dem Marsch. Der Ahnherr aller Reisenörgler hatte seine Musterkarte abgegeben. Das Flohzählen war sozusagen ins Bürgertum gekommen, die traurige Kunst, Nebensächlichkeiten zu wehleidiger Wichtigkeit zu verhelfen und das Große zu verkleinern, zu ersticken. Es war da und wollte wachsen.
Das hinderte nicht, daß – ganz nebenbei – Eisenbahnen erfunden wurden und der Telegraph. Man legte noch nicht viel Wert darauf. Daß der Telegraph einmal eine Sache sein könnte, derer sich jeder «Schneider und Schuster» bedienen würde, hielt man für einen Witz. Von der Eisenbahn, die noch mit sechsunddreißig Kilometer die Stunde fuhr, war man überzeugt, daß sie als «wald- und flurschädigend» bald wieder verschwinden würde. Das Collegium warnte vor dem Teufelsspuk, der die Gehirne zusammenwürfeln würde und das Augenlicht zerstören. Die Geistlichen warnten ihre «Schäflein» vor dem «feurigen Drachen» und rieten, sich ihm fernzuhalten. Friedrich Wilhelm IV. allerdings sah weiter, er sagte: «Diesen Karren, der durch die Welt rollt, hält kein Menschenarm mehr auf.»
Amüsant malt der Spötter SAPHIR in ahnungslos richtiger Prophezeiung die möglichen Folgen aus, die die neuen Eisenbahnen im Empfindungsleben des Bürgers auswirken würden. Als Stevenson seine erste «Reisemaschine» erfunden und vereinzelt auf kurzen Strecken die ersten Eisenbahnzüge «blitzschnell» dahinrollten, schrieb Saphir in seinen «humoristischen Vorlesungen»:
«Die Erfindung der Eisenbahnen, meine lieben Leser und Leserinnen, ist doch im Grunde nichts, als eine Verkleinerung der lieben Erde. Die Welt wird ganz klein werden; man wird viel schneller die ganze Erde wirklich bereisen, als man Büschings Erdbeschreibung lesen wird. In den Schulen wird die Stunde ‹Geographie› nicht gelesen, sondern gereist werden; der Professor wird sich mit seinen Zöglingen auf die Eisenbahn setzen, und alle Tage jenen Teil bereisen, der gerade doziert werden soll.
Der Mensch wird zum Briefe werden. Bevor man sich Zeit nehmen wird, erst eine Feder zu schneiden, zu schreiben und zu siegeln, wird man sich selbst auf die Eisenbahn legen, und es wird nicht lange dauern, so wird man uns von den Eisenbahnen die frankierten Menschen ins Haus bringen; wir werden den Menschen lesen, und ihn retour schicken ...
Durch die Errichtung der Eisenbahn wird die ganze Romanschriftstellerei hoffentlich aufhören, denn aus was bestehen die Romane? Aus der Zwickmühle: Trennung und Wiedersehen. Durch die Eisenbahn werden wir ganz um alle Abschiedstränen kommen, und die Romane werden ganz mager werden. Eine solche Romanschriftstellerin: wenn Anton sich in Leipzig von seiner Amalie losriß und nach Hamburg ging, weinte er einen halben Band, anderthalb Bände schrieb Amalie an Anton, anderthalb Bände schrieb Anton an Amalie, und die vier Bände sind voll. Wenn einmal zwischen Leipzig und Hamburg eine Eisenbahn sein wird, warum werden Anton und Amalie solche Narren sein und werden sich vier Bände Briefe schreiben? – Anton und Amalie setzen sich im ersten Bande Seite 67 auf die Eisenbahn und Seite 68 sind schon Anton und Amalie am Ende des vierten Bandes ...
Ein reicher Mann wird seinen Sohn, zur Ausbildung, eine Reise durch Europa machen lassen, eine solche Reise dauerte sonst zwei Jahre, jetzt wird der Sohn nach vier Wochen von seiner Reise durch Europa zurückkommen, er wird sich auf diese Reise mehr einbilden als ausbilden. Wenn man ihn fragen wird, ‹was haben Sie denn z. B. in Holland gesehen?› so wird er sagen: ‹Entschuldigen Sie, Holland habe ich gerade verschlafen!›»
Wirklichkeit, die sehr bald heranrücken sollte, war noch ein fröhlicher Witz der Phantasie.
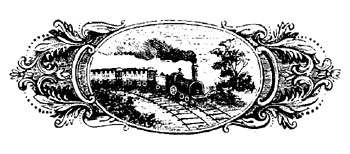
Bevor man schlafend und table-d'hote-speisend durch die Länder rasen sollte, hatte man noch Zeit, dem Biedermeier eines der schönsten Dinge zu schenken: den Walzer.
Das war in Österreich. Nirgendwo anders hätte der Walzer geboren werden können. Es bleibt eine nachdenkliche Sache, daß das Land, wo die spießbürgerliche Bequemlichkeit, das Sichnichtaufregenwollen und eine unbeirrbare Gemütlichkeit bis zu höchstem Grade gesteigert, eiserne Nationaleigenschaften wurden, die Wiege der Musik ist. Wir stehen hier vor der Rätselfrage: Wo endet der Bürger und wo fängt der Spießbürger an?
Österreich wimmelte damals von Aristokraten, und wer keinen Adelstitel durch Geburt erhalten hatte, dem wurde er vom Oberkellner seines Kaffeehauses verliehen. Kein Kellner bediente einen Gast, den er nicht mit einem «von» titulierte.
Alle die wichtigen «Staatsaktionen» drinnen wie draußen brachten dem österreichischen Durchschnittsbürger keine erheblichen Dissonanzen. Davor schützte ihn sein ausgeprägter Sinn fürs Privatleben. Gewiß, das Theater war sein Himmelreich, aber in den tragischen wie den heitersten Stücken denkt er an das Privatleben der Darsteller. Er kennt dessen Einzelheiten so genau wie seine eigenen, man nennt am Familientisch wie im Kaffeehaus die Helden der Bühne mit Vornamen. Der Patriotismus zeigt sich auf ähnliche Weise. Die Achtung vor dem Königshaus zeigt sich auch am stärksten durch eifrige Neugier und Wißbegierde für jene Stunden, die nicht mit Audienzen ausgefüllt sind, für jene Räume, in denen die Privatpassionen «regierten».
Aus Musik, Gesang und Liebe, von jedem ein viertel Hupf, schuf sich von selbst der Walzer; alles Lebensgenießerische der nächsten Generation liegt schon in seinem Tempo.
Er begann, das Gravitätische aus der Welt zu drehen, der Walzer brachte sie Herz an Herz. Er galt darum für «unzüchtig». Es war verpönt, ihn zu tanzen. Aber plötzlich gehörte er doch zum «guten Ton». Er mußte gelernt und gekonnt sein von den Töchtern und den Söhnen des Bürgerstandes aller Länder. Die jungen Mädchen erhielten Lehrstunden von Tanzmeistern, wenn sie auch zunächst nur mit einer Holzpuppe üben durften, die eigens dazu erfunden wurde und die in sparsamen Familien sogar einfach durch einen umwickelten Besen ersetzt wurde. Wäre bürgerliche Lebenslust denkbar ohne den Wiener Walzer?
1801 war LANNER geboren worden, der diese Tonepoche zum Erklingen bringen sollte. Als Sohn eines Handschuhmachers, ohne besonderen musikalischen Unterricht, hatte er es plötzlich fertiggebracht, erstaunlich gut Violine spielen zu können. Kaum erwachsen, stellte er ein Streichquartett zusammen aus gleichaltrigen Musikfreunden. Bald tanzte ganz Wien seine Walzer. Er brachte es bis zum «Kapellmeister des Bürgerregiments». Als solcher starb er plötzlich im gleichen Monat, dem launenhaften April, in dem er geboren worden, erst zweiundvierzigjährig. Aber er hatte in dieser Zeit eine Melodik aus Lebenslust, Gemütlichkeit und sanfter Sehnsucht erfunden und ins Schweben gebracht. Zweihundert Walzer überlebten ihn für alle Ewigkeit.
Und doch war er nur ein Pionier gewesen. Er selbst hatte seinem Rivalen und Überholer die Laufbahn geebnet.
Das war JOHANN STRAUSS, dessen Musikerweg auf einem Platz in Lanners kleinem Orchester begann. Lanner hatte den Rhythmus gefunden, Strauß erfand dazu das ganze Geheimnis schwebender, wiegender Macht des Dreivierteltakts.
Johann Strauß, der Ältere, und wieder dessen Rivale, den er sich selbst in die Welt gesetzt hatte, sein Sohn Johann Strauß, der Jüngere, brachten das ganze Jahrhundert in sanftes Schweben. Ihre Walzer sind in Musik gesetzter Champagner. Das Leben wurde leichter, seitdem sie durch das Dasein hatten wandern müssen.
Sieht man näher zu, erfährt man, daß diese Walzerkönige ihre Weisen, «den Schwung der Lieb und Seligkeit» auch nicht vom Himmel geholt haben. Beider Leben ist merkwürdig bunt durchsetzt von Bürgerlust und Bürgerleid. Sie walzten durch alle Phasen unruhiger familiärer Herzensangelegenheiten. Sie drehten sich bis ans Ende um und durch die verschiedensten Variationen der Verliebtheit und der Ehe. Ihre seligen Walzer entstanden inmitten verzwicktester Unruhe des Alltags.
«Vater Strauß» hatte es sehr eilig gehabt, sich seinen Rivalen und Überflügler in die Welt zu setzen. Das «Buberl» war schon unterwegs, als Hochzeit gefeiert wurde. Als es zur Welt kam, spielte ihm der Vater seinen neuesten Walzer gleich an der Wiege vor, den «Freudenrausch-Walzer», der dem Säugling gewidmet wurde. Dabei verlangte Vater Strauß, daß der Sohn nie Musiker werden sollte. Damals noch nicht etwa aus Furcht vor Rivalität, nur aus reiner Vaterliebe. Denn dieser musikalische Freudengeber war zeitlebens unbefriedigt geblieben in seinem Beruf, er hatte ein Beethoven sein mögen oder ein Wagner.
Die eheliche Liebe hatte vielleicht zu heftig gelodert, sie war jedenfalls sehr rasch ausgebrannt auf seiten des feurigen Johann.
Mit dem Ruhm draußen wuchs die Eifersucht im Haushalt. Immer seltener kam der «Walzerkönig» nach Haus, besonders, seit er die junge blonde «Milli», die schöne geschickte «marchande des modes», nicht nur kennen- und liebengelernt, sondern schon einquartiert hatte in das eigene «Nestl».
Eines Morgens war das Ende der Ehe da.
Strauß, wieder einmal heimgekehrt von Triumphen und Ehrungen bei hoch und niedrig draußen in der Welt, fand es kahl bei sich, eng und fremd. Er war auf dieser Reise zum erstenmal von seiner «Milli» begleitet gewesen. Er glaubte nun zu wissen, daß er nur bei ihr neue Weisen finden könne.
Die böse Eheszene, die kommen mußte, kam. Der Weg «zum Advokaten» wurde frei.
Merkwürdigerweise war die ahnungslose Ursache zu diesem schweren Lebenseinschnitt Johann Strauß, der Jüngere, gewesen. Der war gerade aus dem «K. K. Polytechnischen Institut» hinausexpediert worden, weil er im Unterricht ein paar selbstgefundene Walzertöne ausprobiert hatte. Das hatte den unzufriedenen, gereizten «Vater Strauß» zum Rasen gebracht. «Mutter Strauß» nahm ihres Buben Partei. Die Eifersucht auf die «Milli» war plötzlich zu Wort gekommen. Und so war das Letzte, unwiderruflich Trennende hinausgeschrien worden.
Neben der Herzensnot galt es nun für die verlassene Familie des «Walzerkönigs» auch der materiellen Not zu parieren.
Der «Thronfolger» wußte Rat. Wenige Wochen später hatte auch er sich zum Kapellmeister gemacht. Er hatte sich fünfzehn gewandte Leute von der «Musikantenbörse» geholt. Er übte mit ihnen Walzer ein – und zwar: eigene Weisen.
Bald kündete ein Plakat den Wienern auf allen Ankündigungstafeln an:
EINLADUNG ZUR SOIREE DANSANTE
welche Dienstag, 15. Oktober 1844 selbst bey ungünstiger Witterung in Dommayers Casino in Hietzing stattfinden wird. JOHANN STRAUSS (SOHN) wird die Ehre haben, zum ersten Male sein eigenes Orchesterpersonale zu dirigieren und nebst verschiedenen Ouvertüren und Opernpiecen, auch mehrere seiner eigenen Compositionen vorzutragen. Der Gunst und Huld des hochverehrten Publikums empfiehlt sich ergebenst
Johann Strauß jun.
Eintrittskarten zu 30 Kreuzer C. M. sind in der k. k. Hofmusikalienhandlung des Pietro Mechetti u. Cie. in Stierböcks Kaffeehaus in der Jägerzeile, in Gabesams und Ruth's Kaffeehaus in Mariahilf zu bekommen. Eintrittspreis an der Kasse 50 Kreuzer C. M.
Anfang 6 Uhr.
Dieses Debüt schildert Fritz Lang in seinem Roman «Johann Strauß, der Walzerkönig» heiter und anschaulich auf folgende Weise:
«Um fünf Uhr nachmittag herrschte in der Mariahilfer und Schönbrunner Straße Festtagsgetriebe. Vornehme Kaleschen und Zeiselwagen sausten über das Pflaster.
In Hietzing ‹Am Platz› stauten sich die Wagen und Menschenmassen. Solche Tage hatte das Kasino Dommayer noch nie erlebt. Mit Mühe und Not erzwang man sich den Zugang zur Gartenpforte. Polizisten wetterten, wenn sich ungeduldige Dränger der Ellenbogentechnik bedienten, um vorwärtszukommen, Frauen und Mädchen quietschten, Ehegatten räsonierten, – und Papa Dommayer bangte um sein teures Leben. Wer aber in dem niedlichen Saale mit den schlanken Säulen, dem zart behandelten Stukkoplafond und den prächtigen Kronleuchtern ein Plätzchen ergattert hatte, seufzte erleichtert auf und frohlockte.
Bald gelang es den Kellnern nicht mehr, durch die dichten Reihen zu dringen. Man schwitzte, schimpfte über die schlechte Lüftung, verdammte das schlechte Arrangement dieser SOIREE DANSANTE , sprach dem Dommayer die Fähigkeiten eines Wirtes ab, ärgerte sich grün und blau über die Verspätung, und blieb trotzdem – bumfest sitzen. Und immer neue Menschenmassen wälzten sich heran und drängten sich im und um das Kasino. Manche waren froh, ein Plätzchen im Garten zu erobern, von welchem man durch die Scheiben der hohen Glastüren in den Saal blicken konnte.
Die Musikanten stimmten ihre Instrumente, und das Gesurre erstarb. Nun mußte der heiß Ersehnte sich bald dem Volke zeigen, das, von heftigem Fieber geschüttelt, erwartungsvoll harrte.
Da plötzlich ein geheimes Raunen und Wispeln, – dann ein Beifallsorkan. Jung-Strauß war auf dem Podium erschienen. Sein Antlitz bedeckte Leichenblässe, und die Augen irrten unstet im Saale umher. Auch ihn, den mutigen Stürmer, schüttelte eine lästige Krankheit – das Lampenfieber. Tausend Blicke vergruben sich in ihn. Er fühlte dieses Seelenzuströmen, das wurde ihm unerträglich; und so klopfte er denn auf seine Geige, und das Spiel begann.
Die Ouvertüre zur ‹Stummen von Portici› gefiel, aber sie regte nicht sonderlich auf. In der kleinen Besetzung verlor sich manche Wirkung.
Niemand fällte ein Urteil; man wartete nur in bangem Schweigen des großen Ereignisses, der Sensation des Abends – des ersten Strauß-Walzers.
Endlich setzte der junge Held die Geige zu seinen ‹Gunstwerbern› an.
Drei Takte – und man wußte alles. Mit eingehaltenem Atem lauschten die verklärt dreinblickenden Männlein und Weiblein, als dürfte ihnen ein neuer Messias ein seelenstärkendes Evangelium verkünden. In diesen Tönen zitterte die Seele Jung-Wiens, jauchzte und jubilierte das frohe Wienergemüt.
Als der Walzer verklungen war, durchbrausten Beifallsstürme den Saal. Man erhob sich und schwenkte Tücher, die entfernt Sitzenden sprangen auf die Stühle, Tische wurden erklettert, alles schrie und johlte.
Der gefeierte Thronfolger machte nicht viel Verbeugungen, sondern befahl seinen Musikern, rasch entschlossen, ein Dakapo. Die Blässe aus seinem Antlitz war verschwunden, – der junge Geiger glühte.
Straußens zweiter Walzer ‹Sinngedichte› erhöhte noch die Stimmung im Saale. Fünfmal mußte er diese Komposition wiederholen. Ein wahrer Taumel hatte die Zuhörer ergriffen, man wußte nicht mehr aus und ein mit der Freud'.
Einige nicht zu befriedigende Enthusiasten riefen noch immer ‹da capo, da capo!› Ihr Eifer zündete die Gemäßigteren an, man wollte noch eine Wiederholung des Walzers erzwingen.
Strauß hob die Geige, das Spiel begann von neuem. Aber was jetzt durch den Saal rauschte, waren nicht die ‹Sinngedichte› des jungen Meisters, sondern die majestätischen ‹Loreley-Rheinklänge› von Vater Strauß. Hatte vorher der so plötzlich zu Ansehen gekommene Dirigent den Beweis seiner Künstlerschaft erbracht, so bekundete er durch diese Tat seinen vornehmen Herzenstakt und die rührende Verehrung für den großen Vater.
Frauen schluchzten auf, waren gerührt.
Die Wiener schätzten diesen Walzer ganz besonders; vielleicht zählte er zu des Walzerkönigs beliebtesten Schöpfungen. Als Jung-Strauß geendigt, ging das Toben von neuem los ...»
Am andern Tag standen im «Wanderer» die prophetischen Worte: «Gute Nacht, Lanner! Guten Abend, Vater Strauß! Guten Morgen, Strauß-Sohn!»
Der neue Ruhm war da, ein Ruhm, der kaum seinesgleichen hatte.
«Strauß persönlich» wurde das Schlagwort der Lebenslustigen in Wien.
«Seine Abende waren voll besetzt. Auf dem Spielplan der Woche las man:
Montag: Dommayer.
Dienstag: Volksgarten.
Mittwoch: Grüner Zeisig.
Donnerstag: Valentins ‹Blaue Flasche› in Lerchenfeld.
Freitag: Engländers Restauration in Währing.
Samstag: Sperl.
Sonntag: Ungers Kasino, Hernals.»
Im Privatleben schwebte man nicht immer in diesen seligen Rhythmen, obwohl es doch selbsterfundene waren.
Der Tod des alten Vaters Strauß schnitt hinein.
Die guten Wiener begannen sich wieder einmal allzu eifrig um die Familienangelegenheiten ihrer Lieblinge zu kümmern.
Strauß, der Jüngere, glaubte sich genötigt, in der «Wiener Zeitung» eine intime, sehr bürgerliche Auseinandersetzung erscheinen zu lassen, durchwirkt mit ein bißchen Pathos, was das ganze noch bürgerlicher machte.
In diesem Manifest bittet Johann Strauß (der Sohn), der nicht nur seine Zeitgenossen, sondern bis heute alle Lebenden so überreich beschenkte, eigentlich um Entschuldigung dafür, daß er der gewesen, der er war. Nur der Not ums tägliche Brot schiebt er zu, nur der Sorge für den Unterhalt von Mutter und Geschwistern, die ohne Ernährer in die Welt blicken, daß er es wagt, den Spuren des bewunderten Vaters zu folgen. Er bittet um «Huld und Nachsicht des geehrten Publikums» und hofft, sich dieser «nicht unwert zu zeigen».
Soviel Untertänigkeit war damals nötig, soviel ernste Entschuldigung, um die Menschheit mit dem reichsten, einmaligen Geschenk des Frohsinns bereichern zu dürfen.
«Schlürft alle das Glück des Augenblicks – man lebt nur einmal.» Es geigt sich leichter, als es sich lebt. Dreimal versuchte sich Johann Strauß, der schwarzgelockte, buntbefrackte, leidenschaftlich Umschwärmte, in der Ehe. Viel Eh', viel Weh. Die erste Gattin war zehn Jahre älter als Meister Strauß, die zweite dreißig Jahre jünger, die dritte erst wurde die treue Gefährtin. In der ersten Ehe wurde die «Fledermaus» komponiert, in der letzten der «Zigeunerbaron». Triumph nicht nur in Wien und Berlin, auch in London, Paris und Petersburg. Des Maestros Diener war genötigt, den treuen Pudel kahlzuscheren, um alle Verehrerinnen mit Locken versehen zu können und sich damit ein kleines Sparguthaben zu sichern. – Den Gipfel der Begeisterung erreichte die Bürgersfrau Enzenberger aus Mariahilf: sie hatte nur sterben wollen, wenn der Johann Strauß an ihrem Grabe spielte. In ihrem Testament stand:
«Nach der Einsegnung meines Leichnams im Trauerhause wünsche ich, daß Herr Musikdirektor Johann Strauß mit seiner Kapelle einen seiner schönsten Walzer spielt. Die Auswahl ist ihm überlassen. Herr Strauß erhält dafür zehn, jeder Musiker einen Dukaten.»
Dieser letzte Wunsch wurde erfüllt. Johann Strauß spielte der Walzerseligen als letzten Gruß seinen bezaubernden Walzer «Abschiedsgrüße».
