
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Jede Biographie Vincents van Gogh, der später immer nur mit seinem Vornamen signierte, weil die Franzosen das Wort »van Gogh« nicht richtig aussprechen konnten, nennt zuerst jenes kleine Dorf Groot-Zundert, im holländischen Brabant und nahe der belgischen Grenze gelegen, wo der Vater Landpastor war und Vincent als ältester Sohn am 30. März 1853 das Licht der Welt erblickte. Unter den fünf Geschwistern, die nach ihm geboren wurden, hat nur der um vier Jahre jüngere Theo das Leben seines Bruders entscheidend bestimmt, während die übrigen in seinen Briefen wohl von Fall zu Fall erwähnt werden, aber im ganzen doch im Schatten bleiben. Auch das Bild der Eltern verblaßt ein wenig, obwohl wärmere Töne oftmals nicht fehlen. Dagegen haftet die Kindheitserinnerung an das Elternhaus und das heimatliche Dorf, das zwischen Kornfeldern und Tannengebüsch in die Heide eingebettet liegt, unverrückbar in seinem Gedächtnis, und noch auf dem Krankenbett in Arles steht ihm der Ort seiner Jugend vor Augen: »Ich habe jedes Zimmer des Hauses wiedergesehen, jeden Fußweg, jede Pflanze im Garten, die Umgebung, die Felder, die Nachbarn, den Kirchhof, die Kirche, unseren Gemüsegarten bis auf das Elsternnest auf der hohen Akazie auf dem Friedhof«, schreibt er dem Bruder. Die Familie van Gogh verkörpert bestes Kleinbürgertum. Unter den Vorfahren gibt es Ratsherren, Goldschmiede, einen Bildhauer und mehrere Theologen. Auch Vincents gleichnamiger Großvater war Pastor und von dessen sechs Söhnen ging einer, Johannes, zur Marine, wo er bis zum Range eines Vize-Admirals aufstieg und in Amsterdam Direktor der Marinewerft wurde, während drei andere sich dem Kunsthandel widmeten. Der älteste, Hendrik Vincent, unter den Brüdern Ohm Heim genannt, hatte sich in Brüssel niedergelassen, der zweite, Cornelis Marinus, Onkel Cor geheißen, gründete in Amsterdam die bekannte Firma C. M. van Gogh, und der dritte, Vincent, der Patenonkel unseres Künstlers, besaß einen kleinen Laden mit Farbmaterial im Haag, der sich nach und nach zu einer angesehenen Kunsthandlung entwickelte, die von der bekannten Pariser Kunstfirma Goupil & Co. übernommen wurde, bei der Onkel Vincent als Teilhaber eintrat. Später setzte er sich in Prinsenhaage zur Ruhe, wo er in seinem Hause eine stattliche Gemäldesammlung besaß. Die Zweigfirma von Goupil & Co. im Haag aber führte ein Herr Tersteeg, der Vincents Lehrchef wurde. Vincent blieb im ganzen sechs Jahre bei der Firma Goupil im Haag, in London und Paris, während Theo mit 15 Jahren als Lehrling in das Brüsseler Zweiggeschäft eintrat und von dort nach Paris ging, um im Stammhaus von Goupil eine leitende Stellung zu übernehmen, die er bis zu seinem Tode innegehabt hat. Dieser Posten machte es ihm möglich, den älteren Bruder finanziell zu unterstützen, aber entscheidender noch war für Vincents Entwicklung Theos unbedingter Glaube an die Berufung des Bruders und jene enge geistige Verbundenheit mit ihm, die allen seelischen Belastungen standgehalten hat und ihn zu dem einzigen Vertrauten machte, dem sich Vincent in seinen Briefen restlos offenbarte.
Es wird berichtet, daß Vincent ein sehr eigenwilliges Kind war, aber eine ausgesprochene Liebe zur Natur und zu den Tieren besaß. Nur wenige Jahre hat er in der Dorfschule in Groot-Zundert zugebracht. Dann kam eine Erzieherin für die Kinder ins Pfarrhaus. Mit 12 Jahren gaben ihn die Eltern in das Pensionat eines Herrn Provily in Zevenbergen, von wo der Sechzehnjährige 1869 ins Elternhaus zurückkehrte. Seine äußere Erscheinung in dieser Zeit hat eine seiner Schwestern wie folgt beschrieben: »Eher breit von Gestalt als lang, den Rücken leicht gebogen durch die schlechte Gewohnheit, den Kopf hängen zu lassen, das rotblonde Haar kurz geschnitten unter einem Strohhut, der ein seltsames Gesicht beschattet: gar kein Jungengesicht, die Stirn schon leicht gerunzelt, die Augenbrauen über der weitausgebauten Stirn in tiefem Nachdenken zusammengezogen, klein und tiefliegend die Augen, bald blau, bald wieder grünlich, je nach den wechselnden Eindrücken. Bei so unschönem, ungelenkigem Äußeren hatte er doch etwas Merkwürdiges durch den unverkennbaren Ausdruck innerlicher Tiefe.« Noch im gleichen Jahr trat Vincent, dem Rat seines Patenonkels folgend, bei Herrn Tersteeg im Haag als Lehrling ein, ein »strebsamer, fleißiger Jüngling«, der sich allgemeiner Beliebtheit erfreut. Hier besucht ihn 1872 Bruder Theo, der noch auf der Schule ist und erst ein halbes Jahr später seine Lehre in Brüssel beginnt, und nach dieser Begegnung der Brüder setzt der Briefwechsel ein, der dann von Vincents Seite aus London fortgeführt wird, wohin er nach Beendigung seiner Lehrjahre im Sommer 1872 übersiedelt, um in der dortigen Filiale von Goupil & Co. unter der Leitung eines Herrn Obach weiterzuarbeiten. Auf der Reise nach England hat er einige Tage in Paris unterbrochen und reichlich »all das Schöne genossen, das er in der Ausstellung und im Louvre und Luxembourg gesehen hat«. Diese frühen Eindrücke in Paris haben ihm auch die erste Vorstellung von der zeitgenössischen Kunst vermittelt, über die fortan ohne Unterbrechung von den Brüdern diskutiert wird.
Vincents Aufenthalt in London umfaßt die Zeit von Juni 1873 bis Mai 1875. Seine erste Unterkunft findet er bei zwei älteren Damen in einer Londoner Vorstadt, aber bereits im August übersiedelt er zu einer Beamtenwitwe, Mrs. Loyer, die mit ihrer Tochter Ursula eine Kleinkinderbewahranstalt unterhält, und in dieser Umgebung verbringt der nunmehr Zwanzigjährige das vielleicht glücklichste Jahr seines Lebens, innerlich beschwingt durch die Liebe zu der Tochter seiner Wirtin und erfüllt von den Eindrücken der Stadt und dem Leben am Fluß, die er auf flüchtigen und ungelenken Zeichnungen festzuhalten versucht. Aber diese erste tiefe Liebe zu jener Ursula endet im Sommer 1874 mit einer schweren Enttäuschung, als Vincent erfährt, daß die heimlich Geliebte bereits verlobt ist, und es kommt zu jener schweren Erschütterung, die den Menschen von Grund auf verändert. »Als er im Sommer während der Ferien nach Hause kam, war er abgemagert, still und niedergeschlagen, doch zeichnete er ziemlich viel«, heißt es in einem Brief der Mutter. Mit seiner Schwester Anna, die in London eine Stellung findet, kehrt er an die Themse zurück, wohnt jetzt möbliert und ist meist allein. Er grübelt viel über Religion und Christentum und ist auf dem besten Weg, ein Sonderling zu werden, so sehr ihn auch die zeitgenössische Kunst immer wieder beschäftigt. Auch ein zweiter kurzer Aufenthalt in Paris, wohin ihn der Onkel Vincent im Oktober 1874 mitnimmt, vermag ihn nicht aus seiner Depression zu lösen. Von dort kehrt er im Dezember nach London und in sein möbliertes Zimmer zurück, um sich nun vollends von der Welt abzuschließen. Im Mai 1875, bevor er London verläßt, um eine Stellung bei Goupil & Co. in Paris anzutreten, schreibt er u. a. an Theo: »Ich hoffe und glaube, daß ich nicht bin, was mancher im Augenblick von mir denkt.« Und darunter ein Zitat aus Renan: »Pour agir dans le monde, il faut mourir à soi-même: le peuple qui se fait le missionnaire d'une pensée religieuse n'a plus d'autre patrie que cette pensée. L'homme n'est pas ici-bas seulement pour être heureux ...«
Seine Tätigkeit in der Pariser Firma dauert von Mai 1875 bis März 1876 und endet mit einem völligen Fiasko, da die Herren Goupil ihren ungebärdigen Mitarbeiter, der in seinem künstlerischen Urteil dem Publikum keinerlei Konzessionen zugestehen will, am 1. April kurzerhand entlassen. Seine Laufbahn als Kunsthändler ist damit abgeschlossen. Sein Widerwillen gegen das Metier wird bleiben. Das Jahr in Paris hat ihm kein Glück gebracht. Seine religiösen Spekulationen haben sich in dieser Zeit noch verstärkt. In seinem Zimmer auf Montmartre pflegt er mit einem englischen Freunde jeden Morgen und Abend in der Bibel zu lesen und anschließend zu meditieren. Das Pastorenblut in ihm gibt keine Ruhe. Die Trennung von Goupil aber zwingt zu letzten Entscheidungen. Onkel Vincent ist über seinen Neffen tief enttäuscht. Die Eltern sind ratlos. Bruder Theo rät wahrscheinlich schon jetzt zur Laufbahn als Künstler, denn der erst dreiundzwanzigjährige Vincent ist jung genug, um einen neuen Beruf zu ergreifen. Aber diesen selbst zieht es nach England zurück, wo er irgendeine Tätigkeit als Lehrer oder Seelsorger zu finden hofft. Auf eine Anzeige hin erhält er eine Anstellung bei einem Mr. Stokes in Ramsgate, der eine Knabenschule unterhält, in der Vincent als Hilfslehrer wirken soll. Schon im Juli übersiedelt die Schule aus der kleinen englischen Hafenstadt nach Isleworth. Doch ist Vincents Tätigkeit hier nur von kurzer Dauer, denn er glaubt, als Hilfsprediger bei einem Methodistenpfarrer namens Jones mehr Befriedigung zu finden. Aber die innere Not zehrt weiter an ihm, obwohl der Gedanke, in der Kirche und durch die Kirche zu wirken, ihn immer stärker gefangennimmt. »Es ist zuweilen, als berauschte er sich geradezu an dem Wohllaut und dem sanftströmenden Klang der englischen Bibeltexte und Kirchengesänge, an dem romantischen Zauber eines kleinen Kirchleins und dem Hauche der frommen Lieblichkeit des englischen Gottesdienstes.« Bis Ende November bleibt er bei Mr. Jones, mit dem er auch in der Folge freundschaftliche Beziehungen unterhält. Der Gedanke an das kommende Weihnachtsfest aber scheint seine Sehnsucht nach der Heimat verstärkt zu haben. Sein Abschied von England wird diesmal endgültig sein. Der Vater ist inzwischen als Pastor mit seiner Familie nach Etten übersiedelt, und hier fällt die neue Entscheidung für Vincent, der sich dem Rat der Eltern nicht verschließt. Noch einmal greift Onkel Vincent ein und besorgt dem Neffen eine Anstellung in der Buchhandlung Blusse & Braam in Dordrecht, die dieser von Januar bis April innehat, ohne dabei Befriedigung zu finden. Ein kurzes Intermezzo, dieser erfolglose Versuch, im Buchhandel Fuß zu fassen. Anfang April ist Vincent wieder in Etten. »Er wird stumpfsinnig vor Frömmigkeit«, schreibt eine der Schwestern an Theo. Und damit ist der seelische Zustand angedeutet, aus dem heraus Vincent nun den Entschluß faßt, Theologie zu studieren, und zwar in Amsterdam, wo Onkel Jan, bei dem er auf der Marinewerft wohnen soll, Vize-Admiral ist, und Onkel Stricker, Schwager des Vaters, ihm einen guten Lehrer für alte Sprachen besorgen wird. Außerdem ist Onkel Cornelis Kunsthändler in Amsterdam, so daß Vincent durch ihn Gelegenheit hat, auch seine Beziehungen zur zeitgenössischen Kunst zu vertiefen. Volle sieben Jahre soll das Studium dauern, und Vincent wird ein schweres Leben haben.
Amsterdam umschließt indes nur die Zeit von Mai 1877 bis Mai 1878. Unermüdlich sitzt Vincent über seinen Büchern und büffelt wie ein Schulknabe die lateinische und griechische Grammatik. Von seinem Dachfenster aus beobachtet er die Arbeiter auf der Werft, die früh ans Werk gehen und müde heimkehren, sieht viel Armut auch in den Straßen der Stadt. Wie eine graue Mauer stehen die sieben Jahre vor ihm, und die Erkenntnis, daß er nicht zum Studium geboren, nie ein Mann der Wissenschaft werden wird, wächst von Tag zu Tag, umdüstert seine Stimmung, lähmt seine Kräfte. Er selbst hat dies Jahr in Amsterdam später als das schwerste seines Lebens bezeichnet, weil er die Aussichtslosigkeit bald erkannte und dennoch Trotz genug besaß, den Kampf fortzusetzen. Schließlich aber überzeugt ihn der Lehrer selbst von der Zwecklosigkeit seines Bemühens. Es wird auch ohne Theologie gehen, aber das Pastorenblut in ihm verlangt sein Recht. Als Missionar in Belgien den Ärmsten Trost und Belehrung bringen, das wäre eine Aufgabe. In Brüssel gibt es eine Missionarschule, die nur drei Monate Vorbereitung verlangt. Der Vater bringt ihn nach Brüssel, um ihn den Leitern der Schule vorzustellen. Ende August ist Vincent einer von den drei Schülern, die nun für den Missionsberuf ausgebildet werden, aber als die Zeit verstrichen, bekommt er keine Anstellung. Der Sohn sei schwach und abgemagert, schlafe nicht und befinde sich in einem überspannten Zustand, schreibt einer von den Vorstehern an den Vater, der gebeten wird, seinen Sohn abzuholen, und gleich nach Brüssel reist, um die Dinge vielleicht noch zum Guten zu wenden. Aber Vincent ist bereits entschlossen, auf eigene Faust sein Glück als Missionar zu versuchen, und geht im November nach dem Borinage, zunächst nach Paturages bei Mons, wo er den Kindern der Bergarbeiter Unterricht gibt, Kranke tröstet und Bibelstunden abhält. Von hier übersiedelt er Anfang 1879 nach Wasmes, wo er für sechs Monate eine bescheidene Anstellung erhält. Er gibt den Bergleuten ein Beispiel von praktischer Nächstenliebe, von Aufopferung und Selbsterniedrigung, ganz so, wie er den Sinn wirklicher christlicher Caritas versteht, verschenkt alles, was er besitzt, Geld, Kleider und Bett, aber dem Kirchenrat von Wasmes ist dieser Eifer zuviel. Wieder muß der Vater eingreifen, um seine Entlassung zu verhindern. Ein Grubenunglück mit nachfolgendem Ausstand spannt seine Hilfsbereitschaft aufs höchste an, dennoch ist der Vorstand nicht zufrieden mit ihm, weil er sich seinen Wünschen nicht füge. Und wieder kommt die Entlassung, als die sechs Monate abgelaufen sind. Zu Fuß wandert Vincent nach Brüssel, um den Pfarrer Pietersen, einen Freund seines Vaters, um Rat zu fragen, der in seinen Mußestunden malt und ein kleines Atelier im Hause eingerichtet hat. Dem bringt er seine ersten Zeichnungen mit, und dies ist ein Augenblick von tieferer Bedeutung, weil er Zukünftiges andeutet, das sein Schicksal entscheiden wird. Aber Vincent entschließt sich zur Rückkehr in das Land der schwarzen Erde. Er will nun, da eine feste Anstellung für ihn ausgeschlossen ist, auf eigene Kosten im Borinage bleiben, aber irgendwie ist der innere Bruch bereits spürbar. Als er im August auf Wunsch der Eltern noch einmal nach Etten kommt, ist er verschlossener denn je. »Er liest den ganzen Tag Dickens und spricht nur, wenn man ihn etwas fragt – über seine Zukunft kein Wort«, klagt die Mutter. Ja, diese Zukunft ist dunkler denn je. Nochmals Rückkehr ins Borinage.

1. Selbstbildnis. 1887

Diesmal ist es der kleine Ort Cuesmes, wo er bei dem Bergmann Decray Wohnung findet. Aber sein Leben wird unstet, die Freude an der Arbeit ist verblaßt, sein Glaube schwankt. Oft ist er tagelang ohne Geld, obwohl ihn die Eltern und auch Bruder Theo, der in Kürze in eine neue Position zu Goupil nach Paris übersiedelt, unterstützen, soweit es in ihren schwachen Kräften steht. Aber je mehr das Pastorenblut verebbt, um so stärker regt sich der Künstler in ihm. In seiner Freizeit zeichnet er viel von dem, was er in seiner Umgebung sieht. Indes der Winter ist schwer, und oft fehlt es am Notwendigsten. Ein Fußmarsch nach Courrières, wo Jules Breton malt, bringt ihn zwar an die Schwelle des Hauses, in dem der verehrte Meister wohnt, aber ihm fehlt der Mut, anzuklopfen, und so macht er unverrichteter Sache kehrt. Er schläft des Nachts unter freiem Himmel, da die zehn Francs, die er auf die Wanderung mitgenommen, längst draufgegangen sind. Ein Stück Brot kann er zuweilen gegen eine kleine Zeichnung tauschen. Von Breton hatte er Rat erhofft, nun geht das Elend weiter. Auch ein kurzer Urlaub im Frühjahr 1880 im Elternhaus in Etten bringt keine Wendung. Einen Augenblick denkt Vincent daran, nochmals nach England zu gehen, aber bald schon kehrt er nach Cuesmes in sein ärmliches Kämmerchen zurück. Seine caritative Arbeit nimmt zwar ihren Fortgang, aber mit jedem Tag nehmen die inneren Hemmungen zu. Im Sommer schildert er in einem langen Brief dem Bruder seine seelische Not. Da heißt es an einer Stelle: »Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, fähig und dazu bestimmt, mehr oder weniger unsinnige Dinge zu tun, die ich dann mehr oder weniger zu bereuen habe ... Aber auf dem Weg, auf dem ich mich befinde, muß ich fortfahren, denn wenn ich nichts tue, wenn ich nicht studiere, wenn ich nicht mehr suche, dann bin ich verloren, dann wehe mir!« Und weiter: »Du mußt also nicht denken, daß ich dies oder jenes verleugne. Ich bin eine Art Gläubiger in meinem Unglauben. Und obwohl ich mich verändert habe, bin ich derselbe, und mein Kummer ist kein anderer als dieser: wozu könnte ich tauglich sein, könnte ich nicht helfen und in irgendeiner Weise nützlich sein, wie könnte ich mehr wissen und diesen oder jenen Gegenstand ergründen? – – – Aus diesem Grunde ist man nicht ohne Melancholie und fühlt eine Leere, da, wo Freundschaft und erhabene Zuneigungen sein könnten, man fühlt eine schreckliche Entmutigung selbst die moralische Energie zernagen. Und das Verhängnis scheint den Instinkten der Liebe Schranken setzen zu können, wo eine Flut von Ekel in einem aufsteigt. Und dann sagt man sich: mein Gott, bis wann?« Und so geht es weiter in den Reflexionen über sich, über Gott, über die Menschen. Es steht schlecht um seine Angelegenheiten. Zweifel und Hilflosigkeit werden aufgewogen durch die Überzeugung von der eigenen Berufung zu tätiger Nächstenliebe und durch seinen Glauben an ein von Gott bestimmtes Schicksal: »Derjenige, der lange wie ein Spielball auf stürmischer See umhergetrieben wurde, erreicht endlich seine Bestimmung. Derjenige, welcher zu nichts nütze schien, unfähig, irgendeinen Posten auszufüllen, irgendeine Funktion, findet zum Schluß eine solche und zeigt sich, tätig und tatkräftig, ganz anders, als er anfangs erschienen war.« Und dieser Satz mag uns fortan gegenwärtig bleiben, weil er auf Vincents Schicksal zutrifft, der schon einige Wochen später dem Bruder gesteht, daß er im Begriff sei, große Zeichnungen nach Millet zu »schmieren«, und ihm die ersten selbstentworfenen Skizzen schickt. Die innere Erlösung ist durch die Kunst gekommen. Das kleine Zimmer, in dem er mit den Kindern des Bergmanns schlafen muß, wird sein erstes Atelier. Im Oktober zieht er nach Brüssel, wo er bis April 1881 verweilen wird. Hier findet er in seinem jüngeren Kollegen namens Rappard einen Freund, und diese Freundschaft wird fünf Jahre dauern, bis sie durch ein Mißverständnis in die Brüche geht. Vincent ist unermüdlich bei der Arbeit, studiert auf eigene Faust Anatomie, beobachtet in den Museen und sucht im Gegenüber mit der großen Kunst die Spannweite seines eigenen Könnens zu finden. Er zeichnet viel nach dem lebenden Modell, nimmt bei einem armen Maler Unterricht in der Perspektive und hofft, bald Illustrationen für Zeitungen und Bücher machen zu können. Rappard hat ihm erlaubt, in seinem Atelier zu arbeiten, und als der Freund Ende April Brüssel verläßt, scheint damit für Vincent der äußere Anlaß gegeben, die Stadt ebenfalls zu verlassen. Wieder denkt er daran, nach England zu gehen, auch ein Aufenthalt an einem kleinen Ort an der holländischen Küste wird erwogen. Als er aber hört, daß Bruder Theo nach Etten zu Besuch kommt, kehrt er auch ins Elternhaus zurück, wie er an den Bruder schreibt, für »ein paar Tage« und um noch einige Skizzen in der Heide zu machen. Aus dem vermeintlichen Abstecher wurde ein Aufenthalt von rund acht Monaten, von Mai bis Dezember 1881. Es scheint, daß die Eltern mit dahin gewirkt haben, daß Vincent den Sommer über bei ihnen bleiben soll. In der Heide bei Etten, bei den Webern und Landleuten findet er die Modelle für seine Arbeit, und da er selbst im Vollgefühl seines künstlerischen Vermögens sichtlich an innerer Zuversicht gewinnt, reist er eines Tages nach dem Haag, um dem berühmten Maler Mauve, der sein sehr viel älterer Vetter ist, seine Zeichnungen zu zeigen. Dessen Ermunterung, auf dem eingeschlagenen Wege fortzufahren und viel nach dem lebenden Modell zu zeichnen, gibt ihm neuen Mut. Die innere Harmonie seines Lebens scheint zum erstenmal vollkommen wiederhergestellt. Da tritt wieder eine Frau in seinen Weg, eine Nichte seines Vaters aus Amsterdam, die Witwe ist und mit ihrem kleinen Söhnchen zu Besuch ins Pfarrhaus kommt. Vincent, nunmehr 28 Jahre alt, glaubt an ein neues Glück – so wie damals, als er in London der Tochter seiner Wirtin seine Liebe gestand. Doch auch diesmal bleibt die Enttäuschung nicht aus. Wieder hört er ein Nein, ja schlimmer noch, ein »nein, niemals, nimmermehr«, das ihn noch lange verfolgen wird und noch in Jahr und Tag in seinen Briefen an Theo wie eine der bösesten Erinnerungen seines Lebens mehrmals hervorbricht. Mit Trotz und Verbissenheit glaubt er dennoch das Schicksal meistern zu können. Als er nach Amsterdam fährt, um eine letzte Aussprache mit der geliebten Frau zu erzwingen, findet er verschlossene Türen, und im Herzen zutiefst getroffen, kehrt er nach Etten zurück. Seine innere Ruhe hat ihn verlassen, äußerlich täuscht er seinem Bruder zwar noch eine gewisse Überlegenheit gegenüber der ihm gewordenen Absage vor, und als ihm Mauve einen Malkasten schickt, scheint er glücklich, endlich auch zur Malerei zu kommen. »Ich bin doch so froh über meinen Malkasten«, schreibt er dem Bruder, »und es ist besser, daß ich den erst jetzt in die Hände bekomme, nachdem ich mindestens ein Jahr ausschließlich gezeichnet habe, als wenn ich sogleich damit begonnen hätte.« Aber die bittere Enttäuschung seiner Liebe zehrt an ihm, das Verhältnis zu den Eltern wird immer gespannter. Nach einem heftigen Wortwechsel mit dem Vater kehrt Vincent Ende Dezember Etten den Rücken und übersiedelt nach dem Haag. Die Hoffnung auf Mauve wird ihm den Entschluß erleichtert haben. Und in der Tat fehlt es im Anfang von dieser Seite nicht an Ermunterung und Belehrung. Fast zwei Jahre währt dieser Aufenthalt im Haag, von Ende Dezember 1881 bis September 1883. Und wieder wird sein Leben eingespannt sein in einen Ring tragischen Geschehens, das voll der Erschütterungen ist und zuletzt in einen schweren Konflikt ausmündet, aus dem ihn nur Selbstbesinnung retten wird. Versöhnend wirkt in diesem Ablauf einer irregeleiteten Liebe zu einer Frau, die längst schon zu den Gestrandeten zählt, nur jenes Übermaß an christlicher Caritas, das menschlich alles entschuldigt. Der durch unglückliche Liebe schwer Enttäuschte begegnet jener anderen vom Leben Gezeichneten, die ihm das Schicksal in den Weg wirft, und gewährt ihr zuerst aus reinem Mitgefühl mit einer geschlagenen Kreatur Gottes Aufnahme, bis sich immer stärker dann die Überzeugung bei ihm durchsetzt, daß ihm hier ein Auftrag zuteil geworden ist, den er allen Vorurteilen der menschlichen Gesellschaft zum Trotz erfüllen wird. Was wissen die anderen von wirklicher Nächstenliebe? Auf den Kanzeln wird sie zwar gepredigt, aber er, der Pastorssohn, wird den Beweis erbringen. Hat er nicht im Borinage schon einmal ein Beispiel gegeben? Mögen die anderen die Nase über ihn rümpfen. Seine Mission ist zu helfen, Tränen zu trocknen, die keimende Frucht mit Wärme zu umgeben. Vincent der Missionar – – –. Aber am Wege stehen viele Kreuzesstationen und in der Tat entfremdet ihn dieses Zusammenleben mit einer verlassenen schwangeren Frau, die schon ein Kind hat, und deren pockennarbiges Gesicht vom Leben gezeichnet ist, vollends der Welt, stößt sie alle zurück, die ihm anfangs noch, wie Mauve und Herr Tersteeg, Wohlwollen bezeugt haben, und wirft ihn so sehr in die Einsamkeit, daß selbst Theo an seinem Bruder zu zweifeln beginnt. Die selbstgewählte Armut, in der er nun auch das Letzte mit der Unglücklichen teilt, ist im Menschlichen nicht einmal so versöhnend, wie die nimmermüde Sorge um die Kranke, die ihrer Niederkunft in Leiden entgegensieht. Das Bild dieser unglücklichen Christine, die Vincent in seinen Briefen meistens »Siene« nennt, ist uns in jener Zeichnung erhalten, der er den Titel »Sorrow« gab. Eine dem Leben nachgezeichnete Studie von Elend und Zerfall, die mehr sagt, als Worte umschreiben können. Er hat den Plan, die Unglückliche zu heiraten, zwar nicht unter dem Segen des Priesters, »denn die Kirche ist von selbst außer Frage. Weder ich noch sie wollen etwas damit zu tun haben«. Und als der Knabe geboren ist, überkommt ihn ein Glücksgefühl, als wenn der Kleine sein eigenes Kind wäre. Diese Freude an dem Neugeborenen, den er fortan mit seiner ganzen Sorge umtreut, ist mehr als rührend. Ein ferner Sonnenstrahl ist durch ihn in sein Elendsdasein gekommen, und auch seine künstlerische Arbeit erhält durch ihn neuen Auftrieb. Sein Trotz dem Leben gegenüber aber wächst in dem Maße, wie sich die Umwelt von dem Verfemten zurückzieht. Christine selbst und die Arbeiter aus der Nachbarschaft stehen ihm Modell, und je mehr er von diesen mit dem Zimmermannsbleistift in seinen Studien festhält, umso freier wird er dem Objekt gegenüber, »weil ich will«, so schreibt er an Theo, »daß die Schönheit nicht aus meinem Material, sondern aus mir selbst komme ... Ich fühle, daß meine Arbeit im Herzen des Volkes liegt«. Auch die Landschaft zieht ihn von neuem in ihren Bann. »Ich bin eifrig in die Landschaft vertieft«, heißt es in einem Brief an den Bruder, »im übrigen müssen die Figuren die Hauptsache bleiben ... Es ist im Malen etwas Unendliches. Ich kann es Dir nicht so erklären, aber gerade um eine Stimmung auszudrücken, ist es ganz herrlich. In den Farben sind verborgene Dinge von Harmonie und Kontrast, Dinge, die durch sich selber wirken, und die man durch kein anderes Medium ausdrücken kann.« Und ein wenig weiter heißt es: »Das Studienmachen betrachte ich als das Säen, und das Bildermachen ist das Ernten.« Oft ist Vincent draußen am Meeresstrand von Scheveningen, damals noch ein Fischerdorf, wo er viel aquarelliert und zeichnet, nicht nur die Landschaft mit den Dünen, sondern auch das Volk der Seeleute und Fischer, die mit ihren Pinken vom Fang zurückkehren. »Sodann malte ich«, so schreibt er an Theo, »noch eine Studie von einer Marine, nichts als ein Stückchen Land, See und Luft. Grau und einsam; zuweilen habe ich ein Bedürfnis nach dieser Ruhe – wo nichts ist, als die graue See mit einem einsamen Seevogel und keine andere Stimme ertönt als das Rauschen der Wellen.« Auch in der kleinen Kirche in der Geest zeichnet er zuweilen. Dorthin gehen die Armenhausleute, – »man nennt sie hier sehr bezeichnend Waisenmänner und Waisenfrauen«, zum Gottesdienst. In einem Brief an den Bruder zeichnet er eine kleine Skizze mit den Frauen in der Kirchenbank und bemerkt dazu: »Solche Sachen sind jedoch schwierig und werden gleich mit dem erstenmale nicht gelingen. Das Gelingen ist manchmal das Endresultat einer ganzen Serie mißglückter Versuche ... Denn etwas Großes wird nicht durch ein nur impulsives Handeln, sondern durch das Zusammenwirken vieler kleiner Dinge hervorgebracht, die man sich zu einem Ganzen hat vereinigen lassen. – – – Wie kommt man ans Ziel? Es ist ein Sichdurcharbeiten durch eine unsichtbare Wand, die zwischen dem, was man fühlt, und dem, was man kann, zu stehen scheint. Wie muß man durch diese Wand hindurchzukommen versuchen, da ein Dagegenschlagen nichts hilft. Man muß meiner Ansicht nach diese Wand unterwühlen und durchfeilen, langsam und mit Geduld ... Das Große ist nicht etwas Zufälliges, sondern muß recht sehr gewollt sein ... Beim Malen oder Zeichnen muß man die Kraft anspannen, und mag es nun auch einigermaßen so sein, daß etwas von Natur aus in uns sein muß (aber das hast auch Du, und ich habe es auch, wir verdanken das vielleicht unseren Jugendjahren in Brabant und seiner Umgebung ...), so ist es im wesentlichen doch erst später, daß sich das künstlerische Empfinden entwickelt und durch Arbeiten reift.«

2. Die Erdäpfelesser April 1885. Delft, H. Tutein Nolthenius

Einmal überfällt ihn in dieser Zeit die Vorahnung des eigenen Schicksals, wenn er an Theo schreibt: »Ich fühle eine Kraft in mir, die sich entwickeln muß, ein Feuer, das ich nicht verlöschen darf, sondern schüren muß, obgleich ich nicht weiß, zu welchem Ende es mich führen wird, und ich mich über ein düsteres nicht wundern würde. Was soll man in einer Zeit wie dieser wünschen? – – – – Unter manchen Umständen ist es besser, der Besiegte als der Sieger zu sein, besser Prometheus, als Jupiter.« In dem nächsten Brief berichtet er dem Bruder, daß er zu lithographieren begonnen, und er schickt Theo seine erste Probe in der Hoffnung, daß er auf diesem Wege vielleicht zu Verdienst kommen könnte. Aber das äußere Elend geht weiter. Wie ein grauer Schatten legt sich die innere Vereinsamung über seine Seele. Trotzdem, ist er nicht reich? »Wie gut kann es einem Menschen tun, wenn er trübe gestimmt, am öden Strand spazierengeht und auf das graugrüne Meer mit den langen weißen Wellenstreifen sieht. Hat man jedoch Verlangen nach etwas Großem, Unendlichen, nach etwas, worin man Gott sehen kann, dann braucht man es nicht weit zu suchen, mich dünkt, ich sah etwas – tiefer als den Ozean, unendlicher als den Ozean, im Ausdruck der Augen eines kleinen Kindchens, wenn es morgens wach wird und kräht oder lacht, weil es die Sonne in seine kleine Wiege scheinen sieht ...«
Wieder einmal ist Theo bei ihm gewesen und hat ihm das Unmögliche seines Zustandes vor Augen geführt. Danach wird die Frau lange nicht mehr in den Briefen an den Bruder erwähnt, und es scheint, daß Vincent langsam zur Besinnung kommt. Christine selbst hat Rückfälle, kann die Verbindung mit der Mutter und ihrem verwahrlosten Bruder nicht lösen, die ihrerseits alles tun, um das Verhältnis mit dem Maler zu stören, der nicht genug Geld zahlen kann. Schließlich ist Vincent selbst davon überzeugt, daß ihm nur noch die endgültige Trennung die innere Freiheit zurückgeben kann. Er bemüht sich um eine Stellung für die Frau, und als der Moment des Abschieds wirklich kommt, drückt er ihr die wenigen Gulden in die Hand, die ihm noch geblieben sind, und wieder übermannt ihn die Sorge um das ungewisse Schicksal dieser drei Menschen und der Abschied von dem kleinen Jungen will ihm schier das Herz erdrücken.
Im Dezember 1883 übersiedelt er nach Drenthe in die Heide, wo die Torfbauern in Erdhütten wohnen. Das Land ist unwirtlich, aber trotzdem von großer malerischer Schönheit. Wir sehen Vincent bei der Arbeit, aber neben ihm steht immer das Bild »Sorrow«, d. h., die Sorge um die verlassene Frau im Haag und ihre beiden Kinder. Dieser Schatten will nicht weichen, er überfällt ihn mit Melancholie und Reue, und in solchen düsteren Augenblicken denkt er sogar daran, als Freiwilliger nach Ostindien zu gehen. Aber die stille Heide, die er aus seinem Fenster sieht, beruhigt ihn wieder, »stimmt zu neuem Glauben, Ausharren und ruhigem Arbeiten«. Er fährt mit einer Trekschuit durch die Moorkanäle, und sein Malerauge sieht die Bilder, die Th. Rousseau in Barbizon, Jan van Goyen und Ph. de Koninck vordem gemalt haben. »Flache Ebenen oder Streifen, verschieden in der Farbe, die schmäler und schmäler werden, in dem Maße, als sie sich dem Horizont nähern. Hier und da setzen eine Plaggenhütte oder ein kleines Bauerngehöft oder ein paar magere Birken, Pappeln oder Eichen einen Akzent darauf; überall sind Torfstapel, und alle Augenblicke fährt man an einem Schiff vorbei, das mit Torf oder Schilf aus den Mooren beladen ist ... Heute Abend war die Heide ungemein schön. Die Luft war von einem unaussprechlich feinen Lila-Weiß – kleine Schäfchenwolken ... dann am Horizont ein leuchtender roter Streifen, darunter die erstaunlich dunkle Fläche der braunen Heide, und gegen den rotblitzenden Streifen eine Menge niedriger Dächer von kleinen Hütten.« In diesen Wochen, wo auch Theo schwere menschliche Enttäuschungen erlebt haben muß, ist Vincent stark genug, dem Bruder Trost zu spenden. Er soll Maler werden, wie er selbst, dem ekligen Kunsthandel entsagen, und fast scheint dieser Traum von den im gleichen Ringen vereinten Brüdern nahe Wirklichkeit. »Auf, mein Junge, komm mit in die Heide, um zu malen, oder auf das Kartoffelfeld, geh einmal mit hinter dem Pflug und dem Schafhirten ... laß dich einmal durchwehen von dem Sturm, der über die Heide geht. Brich aus ...«, heißt es in einem Brief. Und dann schildert er von einem Ausflug nach Zweeloo »wo Liebermann lange gewesen ist«, eine Fahrt durch die Heide in einer offenen Karre, die er mit seinem Wirt früh um drei angetreten und die noch viel interessanter war, als die im Trekschuit. Um sechs Uhr sind sie in Zweeloo. »Die Wohnungen liegen hier sehr breit zwischen Eichen von einer prachtvollen Bronze. Im Moos Töne von Grüngold, im Boden von rötlichen, bläulichen oder gelblichen, dunkeln Lila-Graus, Töne von unaussprechlicher Reinheit in dem Grün der kleinen Kornfelder, Töne von Schwarz in den nassen Stämmen, die sich von dem goldenen Regen der schwirrenden, wimmelnden Herbstblätter abheben, welche in losen Perücken, so als wären sie darauf geblasen, still, und die Luft schimmert zwischen ihnen hindurch, an Pappeln, Birken, Linden und Apfelbäumen hängen. Die Luft gleichmäßig hell, leuchtend, mit Weiß, doch einem Lila-Weiß, das nicht zu ergründen ist, einem Weiß, in dem man Rot, Blau, Gelb flimmern sieht, das alles reflektiert und das man überall über sich fühlt, das dunstig ist und sich mit dem dünnen Nebel unten vereint; alles zusammen bringt eine Skala feiner Graus hervor.« So sieht ein Malerauge die Landschaft, so sieht sie das Auge van Goghs. So arm an äußeren Erlebnissen auch diese wenigen Monate in Drenthe sind, so reich ist die Aufnahmebereitschaft des Künstlers. Und gerade die Briefe aus dieser Zeit gehören mit zum Schönsten, was aus Vincents Feder auf uns gekommen ist. Aber Drenthe blieb nur eine kurze Episode, ein Zwischenspiel ohne dramatische Akzente.
Die nächste Station heißt Nuenen, wohin der Vater inzwischen versetzt wurde und wo Vincent nun zwei volle Jahre vom Dezember 1883 bis November 1885 verleben wird. Der heraufkommende Winter hat ihn aus dem Moor nach Hause getrieben, die physischen Kräfte begannen zu erlahmen. Wieder gibt es eine kurze Schilderung des Heimgekehrten aus der Feder der Schwester, die folgendermaßen lautet: »Nachlässig gekleidet, im blauen Kittel flämischer Bauern, das Haar kurz, der Bart rostbraun und struppig, die Augen zuweilen entzündet und rot vom Anstarren irgendeines Gegenstandes in der Sonne, den Hut mit der weichen Krempe tief in die Augen gedrückt.«
Zwei Jahre aber sind eine lange Zeit für einen, dessen Dasein arm an äußeren Erlebnissen ist. In der Weite der Ebene von Drenthe war ihm ein Licht aufgegangen, die unendliche Ferne hatte sein Herz geweitet, der Zauber der Landschaft seinem Malerauge einen Reichtum erschlossen, von dem er noch lange zehren wird. Im Elternhaus ist der Raum eng, die Luft drückend. Man richtet dem Heimgekehrten die Mangelstube als Atelier ein. Aber für Vincent bleibt dies Leben »eine entsetzliche Wirklichkeit und wir selbst gehen«, so schreibt er an Theo, »bis ins Unendliche; was ist, ist, und unsere Auffassung, schwer oder minder schwer, nimmt nichts davon und fügt nichts hinzu zum Wesen der Dinge. So denke ich darüber zum Beispiel nachts, wenn ich wache, oder so denke ich im Sturm auf der Heide, abends in trauriger Dämmerung ... es ist verdammt elend, Bruder!« Und der nächste Brief beginnt mit diesen Worten:
»Ich fühle instinktiv, wie Vater und Mutter über mich denken. Es besteht eine ähnliche Scheu davor, mich ins Haus zu nehmen, wie wenn man einen großen zottigen Hund im Hause haben sollte.« Vincent fährt für ein paar Tage nach dem Haag hinüber, um die Sachen und Studien zu holen, die er damals zurückließ. Und bei dieser Gelegenheit sieht er auch die Frau wieder, »die sich gut gehalten hat dadurch, daß sie arbeitete, um ihren und ihrer Kinder Unterhalt zu bestreiten. Und das bei großer körperlicher Schwäche ... Ich habe sie ermutigt und versucht, sie zu trösten und zu stärken für den Weg, auf dem sie sich nun befindet ... Mein Herz wird jedoch stark zu ihr hingezogen mit demselben innigen Mitleiden wie früher ...« Damit schließt der Vorhang dieses grausame Zwischenspiel, an das Vincent so viel Herzblut geopfert hatte. Mitte Januar erleidet die Mutter beim Aussteigen aus dem Zug in Helmond einen schweren Unfall, der sie lange ans Krankenbett fesselt. In dieser Zeit ist Vincent rührend um sie bemüht, und seine Erfahrungen als Krankenpfleger im Borinage kommen ihm sehr zustatten. Die Stimmung im Haus hat sich sichtlich gebessert, Vincent wird vorläufig in Nuenen bleiben. Er macht nun täglich Studien nach den Webern, aber auch die kleine Kirche des Ortes ist ein willkommenes Motiv für den Maler. Im Mai findet er ein größeres Atelier, zwei Zimmer, ein großes und ein kleines, beim Küster der katholischen Kirche, wo er fortan arbeitet. Und bald kommt auch Freund Rappard für zehn Tage zu Besuch, mit dem er allerhand Streifzüge unternimmt »zu den Webern und zu allerlei schönen Motiven draußen«. In dieser Zeit beschäftigt sich Vincent viel mit der Technik der Malerei. Er entdeckt die Gesetze der Farbe, die »unaussprechlich kraftvoll sind, gerade, weil es keine Zufälligkeiten sind«. Das dörfliche Leben hat ihn sichtlich beruhigt. Bei der Mutter trifft er die Bekannten des Pfarrhauses und unter diesen drei Schwestern, die nebenan wohnen. Die Jüngste derselben, zwar bedeutend älter als Vincent, »weder schön noch begabt, aber von lebhaftem Geist und ein Herz voll zarten Gefühls«, hat auf den Maler starken Eindruck gemacht, und es kommt zu einer engen Freundschaft, aber zu keinem intimen Verhältnis, wie die Klatschbasen erzählen. Denn Vincent schreibt ausdrücklich an den Bruder: »Ich habe sie, da ich vieles voraussah, immer respektiert in einem gewissen Punkte, der sie im sozialen Leben entehren würde.« Indes scheint er an eine Ehe gedacht zu haben, der sich die Geschwister heftig widersetzen. Nach einer erregten Aussprache mit diesen »ist etwas geschehen«, so schreibt er dem Bruder, »wovon die meisten Leute hier nichts wissen oder vermuten ... Fräulein X hat Gift genommen in einem Augenblick der Verzweiflung, als sie mit ihrer Familie gebrochen hatte. Und als man schlecht über sie und mich redete«. Die Kranke wird zwar gerettet und nach Utrecht ins Hospital geschafft. Aber das Dorf hat nun seinen Skandal und Vincent ist das Opfer. Er wird von allen gemieden, die vordem im Pfarrhaus verkehrten. Und auch die Eltern werden in Mitleidenschaft gezogen. Dieser Zwischenfall war eine neue, schwere Belastung für alle Beteiligten. Wenn das Fräulein auch nach einem halben Jahr genesen nach Nuenen zurückkehrt, Vincents Beziehungen sind gelöst, aber seine eigene Melancholie hat neue Nahrung erhalten, und das Verhältnis zu den Eltern wird immer gespannter. Sein einziger Verkehr sind seine Modelle, die Bauern und Weber, in deren Hütten er zeichnet und malt, und einige Bekannte im benachbarten Eindhoven, die er beim Malen beaufsichtigt, wie den Lohgerber Kressemakers, der ihn sogar im Herbst 85 zu einer gemeinsamen Fahrt nach Amsterdam einladen wird, um das Rijks-Museum zu besuchen, wo sich Vincent von Rembrandts »Judenbraut« kaum losreißen kann. Aber dieses kleine Zwischenspiel eilt den Ereignissen weit voraus. Der Winter 1884-85 ist besonders trübe. »Kaum hat ein Jahr für mich düsterer und in trüberer Stimmung angefangen«, schreibt er zu Neujahr an Theo. Und wie eine allzu harte Bestätigung dieser Worte stirbt Ende Mai der Vater, der nach einem anstrengenden Marsch durch die Heide tot auf der Schwelle seines Hauses niedersinkt. Vincent übersiedelt nun ins Atelier und verschließt sich noch tiefer in seine Arbeit. Er nennt sich selbst einen Bauernmaler, aber zwischendurch malt er auch die ersten Stilleben. Und ebenso wird eine Serie von Lithographien in Angriff genommen. In dieser Zeit hat er die »Kartoffelesser« vollendet, die er dem Bruder zuschicken will. »Obgleich ich das eigentliche Bild in verhältnismäßig kurzer Zeit gemalt haben werde, und zwar größtenteils aus dem Kopfe, hat es mich mit dem Malen der Studienköpfe und Hände doch einen ganzen Winter gekostet«, so schreibt er an Theo, dem er in der gleichen Kiste auch noch einen »Bauernfriedhof« zuschickt. Wie ein Besessener ist Vincent in diesen Monaten bei der Arbeit. »Aber das Malen wird nun für mich so anregend und berauschend wie die Jagd«, heißt es in einem Brief an den Bruder. Und dieser selbst zweifelt nicht mehr an dem Genie des anderen. Doch die äußeren Umstände entwickeln sich von Tag zu Tag unerfreulicher und als gar der katholische Geistliche anfängt, die Leute gegen den Maler aufzuhetzen und ihnen das Modellstehen zu untersagen, hat dieser Nuenen gründlich satt. Er denkt einen Moment daran, nach Drenthe zurückzukehren, aber dann entschließt er sich für Antwerpen, wo er auf Verbindung mit Kunsthändlern hofft und vor allem Akt studieren will. Er packt eine ganze Menge Bilder ein, dazu vierzig kleine Rahmen für Studienköpfe, Zeichenmaterial und Pappe. Vielleicht gelingt es ihm, einige Schüler zu bekommen und damit Geld zu verdienen.
Ende November 1885 trifft er in der Stadt an der Schelde ein, wo er bis Ende Februar 1886 verweilen wird. Holland gehört endgültig der Vergangenheit an. Vincent wird seine Heimat nicht mehr wiedersehen. Nachdem er länger als zwei Jahre auf dem Lande gelebt, empfindet er nun die Großstadt wie eine Art Jungbrunnen; »denn wenn es eine Stadt gibt, die Paris gleicht, dann ist es viel mehr Antwerpen als Brüssel«. Und in dieser Stadt, in der einmal Rubens residierte, die über ihren flämischen Körper ein Kleid von französischer Grazie legte, treffen sich die Kaufleute aller Länder, und das Leben ist so bunt und schillernd, wie das Landleben in Brabant eintönig und langweilig war. Da gibt es Kirchen, die Wunderwerke von Rubens und Van Dyck bergen, ein Museum mit köstlichen niederländischen Primitiven, ein Hafenviertel mit Schänken und Dirnen, das immer voller Bewegung ist, und am Abend die Cafés-Concerts und Bals-populairs, auf denen wunderbare Modelle zu finden sind. Herrgott, wie gut tut es Vincent, wieder einmal die Stadt zu sehen. Die Bauern und das Land in Ehren, aber dies Nebeneinander der Gegensätze, das hat er so noch nicht erlebt. Das rüttelt auf, das trifft sein Malerauge von einer neuen Seite. Ja, wenn man nur Geld genug hätte, um sich Modelle zu halten. Wenn die verdammten Kunsthändler, denen er Bilder in Kommission gibt, endlich etwas verkaufen wollten! Aber leider ist der Kunsthandel schlafmützig und sehr Provinz. Und die kleinen Mädchen aus den Cafés-chantants denken nicht daran, sich von dem ungeschlachten Vincent malen zu lassen, obwohl es doch einmal vorkommt, und denken noch weniger daran, sich ein Porträt zu bestellen. In seinem Zimmerchen in der Rue des Images – wie verheißungsvoll das klingt und unten wohnt sogar ein Farbenhändler – hängt er japanische Holzschnitte an die Wände, wie überhaupt die ganze Stadt voll von »Japonaiseries« ist. Immer ist etwas Erregendes in den Straßen, zumal bei den Docks, wo die flämischen Matrosen mit übertrieben gesunden Gesichtern und mit breiten Schultern Muscheln essen und Bier trinken, und am hellichten Tag einer von dieser Sorte »von den Frauenzimmern aus einem Hurenkasten geworfen und von einem wütenden Kerl und einem Schwarm von Weibern verfolgt wird«. Bei den Anlegestellen außerhalb der Stadt liegen die Harwich- und Havre-Boote und geradeaus, der See entgegen, dehnt sich »die Unendlichkeit flachen, halbüberschwemmten Wiesenlandes ... das Wasser im Vordergrund grau, die Luft nebelig und kaltgrau, still wie die Wüste«. Aber dann erst so ein Frauenzimmer, das prachtvoll von Gesundheit ist, und daneben andere, die wie heimtückische Hyänen sind, oder wieder andere, die von Pocken zerrissene Gesichter zeigen, die eine Farbe haben, wie »gekochte Krabben«. – Was machts, Vincent sitzt mit ihnen beisammen, denn sie halten ihn für einen Matrosen. Ja, diese Stadt ist interessant für einen Maler, und auch sein Zimmerchen ist erträglich. Dort kann er sogar arbeiten, wenn draußen der Regen niederprasselt. Seine Schaffensfreude ist ungewöhnlich. Er fühlt seine Kraft und stellt fest, daß sich die eigenen Arbeiten neben denen der anderen wohl sehen lassen können. Aber die Modelle kosten Geld. Und um sie zu bezahlen, ist trocken Brot oft die einzige Nahrung am Tage. Wenn er aber bei der Kunstakademie ankäme, könnte er umsonst nach Modell arbeiten, und auch das Zeichnen nach der Antike und nach den Gipsen würde ihm nicht schaden. In der Tat wird er als Schüler angenommen, und am Abend kann er außerdem in einem Klub nach dem Leben Akt zeichnen, was oft bis in die Nacht hinein fortgesetzt wird. Zwischendurch malt er Landschaften an der Schelde und auch vom »Steen« hat er ein Bild gemacht. Aber lieber malt er Figuren, denn auch die Händler sagen, daß Frauenköpfe und Frauenfiguren am ehesten verkäuflich seien. Immer ist Vincent darauf aus, Geld zu verdienen, denn was Theo ihm schickt, reicht kaum für die Notdurft des ärmlichen Lebens. Die körperlichen Kräfte sind längst seiner Arbeitswut nicht mehr gewachsen. Und auch in der Zeichenklasse der Akademie ist es zu Auseinandersetzungen mit dem Lehrer gekommen, der ein braver Akademiker ist und den Funken in Vincent offenbar nicht spürt. Das viele Fasten hat schließlich noch das Gebiß in Mitleidenschaft gezogen, und die Rechnung für den Zahnarzt ist eine besonders schmerzliche Belastung. In diesem Zustand physischer Erschlaffung taucht zum erstenmal der Gedanke an Paris auf, wo man im Atelier Cormon Akt zeichnen könnte. Aber Theo meint, Vincent solle lieber zur Erholung nach Nuenen gehen und könne bei der Gelegenheit der Mutter beim Umzug nach Breda helfen, ein Vorschlag, der auf Vincents Seite heftigen Widerspruch findet. Nein, nur Paris kann die Losung sein. Dort ist der Bruder, der an ihn glaubt, dort ist die neue Kunst, die man Impressionismus nennt. Dort allein ist das Leben, sind die Museen, in denen man am Beispiel der großen Meister die eigenen Kräfte messen kann. Und immer nachdrücklicher beschwört er den Bruder, ihn nach Paris zu lassen, spätestens zum 31. März, wo das Semester in der Akademie schließt. Theo vertröstet auf den Sommer, wo er eine größere Wohnung beziehen will, in der dann für beide genügend Raum wäre. Vincent aber hat sich längst in die Idee »Paris« verbissen. Antwerpen ist für ihn ausgeschöpft. Es war eine Durchgangsstation, die den eigenen Glauben an die Berufung als Künstler wesentlich gestärkt hat. Paris soll nun die Erfüllung bringen. Ja, »der Glaube besteht, aber«, so schreibt er, »man fühlt instinktiv, daß enorm viel sich ändert und alles sich ändern wird. Wir sind im letzten Viertel eines Jahrhunderts, das wieder mit einer gewaltigen Revolution enden wird. Aber angenommen auch, wir sehen am Ende unseres Lebens beide noch den Anfang davon, die besseren Zeiten klarer Luft und der Auffrischung der ganzen Gesellschaft nach diesem großen Sturme werden wir sicherlich nicht erleben. Doch ist es schon etwas, nicht betrogen zu werden von dem Falschen seiner Zeit, nämlich insofern nicht betrogen, als man das Ungesund-Dumpfige und Gedrückte der Stunden, die dem Unwetter vorausgehen, empfindet und sagt, wir stecken in Bedrängnis, die zukünftigen Geschlechter aber werden freier atmen können«. Ist Vincent ein Prophet? Fühlt er in diesem Augenblick die gewitterschwüle Fin-de-siècle-Stimmung, die sich nur in einer furchtbaren Explosion entladen kann? Die innere Unruhe wächst von Tag zu Tag. Da der Bruder sich aber seinem Drängen verschließt, muß er ihn vor eine vollendete Tatsache stellen. Dem Hauswirt und Farbenhändler hinterläßt er als Pfand seiner Schulden die ganze künstlerische Ernte dieser drei arbeitsreichen Monate, die fortan verschollen bleibt. Er selbst aber ist Ende Februar in Paris, und seine Ankunft meldet er dem Bruder durch einen Zettel ins Geschäft und bittet ihn zu einer ersten Zusammenkunft im Salon carré des Louvre.
Vincent wird volle zwei Jahre in Paris sein (von Ende Februar 1886 bis Ende Februar 1888), und Bruder Theo wird es bitter schwer mit ihm haben. Der Briefwechsel zwischen den Brüdern hat vorläufig ein Ende. Diese vielseitige Quelle für die Lebensschicksale des Künstlers ist vorerst versiegt. An ihre Stelle treten die Briefe, die Theo an die Mutter und Geschwister schreibt und Reminiszenzen aus dem späteren Briefwechsel mit Theo. Auch die Briefe mit dem um 15 Jahre jüngeren Maler Emile Bernard, der bald Vincents Freund werden wird, enthalten Erinnerungen an die gemeinsamen Pariser Jahre. Paris aber bringt die große Wende in der Kunst des Malers. Mit neuen Augen sieht er nun die Stadt, die das Herz Frankreichs, ja der damaligen Welt ist, für Vincent zwar längst keine Unbekannte mehr, aber doch neu im Erleben seiner 33 Jahre, großartig als Zentrum der europäischen Kunst, wundervoll als gewachsene Architektur und eingetaucht in jene einzigartige Atmosphäre silbrigen Lichtes, das die Impressionisten neu entdeckt haben und das die eigentliche Quelle einer neuen Kunst ist. Ein Licht, das auch Vincents Palette aufhellen, seinem Pinsel eine wundersame Geschmeidigkeit geben wird. Hier lebt der Künstler frei von allen Fesseln der Gesellschaft, so wie es Murger in seiner unsterblichen »Bohème« geschildert, und bald wird auf der Butte von Montmartre eine neue Künstlerrepublik entstehen, die in der kleinen Place de Tertre ihren Mittelpunkt hat. Zu ihren Füßen breitet sich diese einzigartige Stadt mit den stolzen Boulevards, den engen Gassen, dem Silberband des Flusses und den hundert und mehr Kirchen, von denen Notre-Dame auf der Insel der Cité ein Kleinod der Gotik ist und St. Germain l'Auxerrois neben dem Louvre die Erinnerung an die Pariser Bluthochzeit wachhält. Und nicht zu vergessen die öffentlichen Sammlungen, vornehmlich Louvre und Luxembourg, in denen Vincent bald heimisch sein wird. Wie schön wäre es zu denken, Bruder Theo hätte diese zwei Jahre nicht in Paris, sondern in Brüssel oder Marseille verbracht, und der Briefwechsel hätte keine Unterbrechung erfahren. Wie hätte Vincent erst über die Meisterwerke dieser Museen geschrieben, so wie er seine Eindrücke von den Bildern im Haag, in Amsterdam, Brüssel und Antwerpen dem Bruder mitteilte, unsterbliche Urteile, die die Kunstgeschichte immer noch zu wenig kennt!
Aber die Brüder werden nun Zeit haben, sich mündlich alles zu gestehen, was sie auf dem Herzen haben. Und Theos Geduld wird oft auf eine harte Probe gestellt sein. Denn auch jetzt ist Vincent in seinem künstlerischen Urteil zu keiner Konzession bereit. Und was die Schroffheit seines Wesens anbelangt, so hat die äußere Not des Lebens sie mehr noch verhärtet als gemildert. Aber Paris ist unendlich wie die Ebenen seiner Heimat, die sich in das Meer verlieren. Und das Getriebe in dieser Stadt ist so bunt und erregend, daß man es niemals ausschöpfen kann. Wenn man etwa auf Montmartre wohnt mit dem Blick auf Moulin de la galette, den sie später aus den Fenstern ihrer Wohnung in der Rue Lepic haben werden, und man nebenan in dem kleinen Restaurant bei Madame Bataille zu Mittag ißt, hat man beinahe das Gefühl, auf einem Dorfe zu leben. Und erst die Motive für einen Maler hier oben! Aber man kann auch den Schritt hinunterlenken in das brausende Meer der Weltstadt, die trotzdem so viel Heimlichkeit in Winkeln und engen Gassen verborgen hält, daß man sich oft wie verzaubert vorkommt. Und dann der Spaziergang am Fluß, drüben am anderen Ufer, wo die kleinen Bouquinisten hausen und man bei den Antiquaren in den offenen Bücherständen herrliche Schätze finden kann. Und erst das Leben am Abend! Da ist kein Vergleich mehr mit Antwerpen. Das war doch nur Provinz. Paris aber ist Weltstadt, mondän, schillernd in allen Schattierungen, Tummelplatz für arm und reich und ein gesegnetes Mekka für einen ausgehungerten und so oft enttäuschten Erdenbürger wie Vincent.
Ja, diese ersten Monate in der Lichtstadt sind voll des neuen Erlebens. Vorerst hausen die Brüder noch zusammen in der Rue Laval, wo Theo wohnt und es bald unerträglich eng wird. Vincent ist sogleich bei Cormon eingetreten, wo er eifrig Akt zeichnet, aber als dann im Juni die größere Wohnung in der Rue Lepic 54 im dritten Stock bezogen wird, – sie hat drei große Räume, eine Kammer, in der Vincent schläft, und eine kleine Küche – erhält er in dem hintersten Zimmer gleich neben seiner kleinen Kammer ein eigenes Atelier, und der Unterricht bei Cormon ist damit zu Ende. Er hat genug gelernt und kann jetzt aus dem Vollen schaffen. Aus seinem Atelier hat er den Blick auf die Mühle, die das Wahrzeichen von Montmartre ist, und die wird eines seiner ersten Bilder. Und auch sonst ist an dankbaren Motiven in der Umgegend kein Mangel. Auch Stilleben werden gemalt. Es gibt Bekannte, die ihm jede Woche Blumen zum Malen schicken, und die sind herrlich, um die Leuchtkraft seiner Farben immer von neuem zu erproben. Der Körper hat sich gottlob erholt. »Der Arzt sagt«, so schreibt Theo der Mutter, »er sei nun wieder in Ordnung. Du würdest Vincent nicht wiedererkennen. Er macht tüchtige Fortschritte in der Arbeit und fängt an, Erfolg zu haben. Er ist auch viel aufgeschlossener als früher und sehr beliebt.« Also ist auch die lange Einsamkeit endlich überwunden. Es gibt zudem Bekannte genug unter den Künstlern, die sich Impressionisten nennen und eine kleine Gruppe von Gleichstrebenden bilden. Manet freilich ist schon drei Jahre tot, aber sein Geist ist lebendig geblieben. Dafür steht Monet, 13 Jahre älter als Vincent, auf dem Gipfel seines Schaffens. Neben ihm arbeiten Pissarro, den Brüdern besonders nahestehend und oft zu Besuch in der Rue Lepic, Sisley, Signac, und vor allem Seurat, dessen heitere Farbigkeit auf Vincent tiefen Eindruck hinterläßt. Auch Degas, der ein großartiger Bildnismaler ist und das Leben der Ballettratten und auf den Rennplätzen meisterlich mit seinen bunten Stiften festzuhalten weiß, gehört in diesen Kreis. Ihm wesensverwandt ist der geistvolle Toulouse-Lautrec, den Vincent bei Cormon kennenlernt, damals noch ein Anfänger, da er erst 22 Jahre alt ist. Renoir und Cézanne aber weilen meist im Süden. Der besondere Zauber ihrer Werke wird Vincent erst aufgehen, wenn er selbst die provençalische Erde erlebt. Endlich wäre noch Raffaelli zu nennen, ein Stern zweiter Größe, aber damals merkwürdig überschaut. Wie köstlich aber ist es, sich künstlerisch eins zu wissen mit dieser Gemeinschaft junger Kräfte, und wie unendlich weit liegen jetzt die bis dahin verehrten Vorbilder eines Millet und Corot und der anderen Landschafter von Barbizon in der Erinnerung zurück. Drüben auf der Rive gauche gibt es den alten Farbenhändler, den sie Père Tanguy nennen und den auch Vincent malen wird. Er stellt die Bilder dieser Jungen in dem Schaufenster seines Ladens in der Rue Clauzel aus, tauscht auch gelegentlich Bilder und Gemälde gegen Ware und hält sich deshalb für eine Art Mäcen, während die geschäftstüchtige Frau solcher Handel keineswegs freut. Bei Goupil hat Vincent eines Tages auch Gauguin kennengelernt, den er als den unbedingt Größeren verehrt, vielleicht geblendet von der Romantik seines Lebens und dem Hauch von Exotik, der über seinen Bildern liegt. Bruder Theo aber sieht in den Impressionisten das kommende große Geschäft und hat seine Chefs überreden können, einen neuen Salon für diese junge Kunst auf dem Boulevard einzurichten, aber vorerst bleiben die materiellen Erfolge aus, und es braucht ungeheure Nervenkraft, um trotzdem die persönliche Überzeugung durchzusehen. Vincent, der Ungebärdige, hämmert ununterbrochen auf den Bruder ein, endlose Diskussionen setzen am Abend in der Wohnung ein und gehen oft bis in die Nacht. Der arme Theo erträgt das alles mit einer rührenden Geduld, aber auch seine Gesundheit ist keineswegs robust und seine Nerven können diese neue Belastung schwer ertragen. Wenn erst der Winter vorbei wäre! Wenn Vincent wenigstens in eine eigene Wohnung ziehen wollte! Immer nur von Geschäften reden, immer nur diese endlosen Tiraden der Künstler, – und auch des eigenen Bruders – anhören zu müssen! Nicht Frau und Kind zu haben zur Erheiterung nach den Mühen des Tages. Das kapselt die Seele ein. »Du kannst Dir nicht vorstellen, wie groß die Einsamkeit in einer großen Stadt ist«, schreibt er der Schwester. »Bei mir zu Hause ist es unerträglich, niemand will mich mehr besuchen, da es immer zu Zwistigkeiten kommt. Unordentlich ist er (Vincent) auch, so daß unser Haushalt nichts weniger als reizvoll ist. – – – – Es ist, als wohnten zwei Menschen in ihm – der eine wunderbar begabt, fein und zart, der andere selbstsüchtig und hartherzig. – – Es ist schade, daß er sein eigener Feind ist; denn nicht nur anderen, auch sich selbst macht er das Leben schwer.« Aber trotzdem läßt er vom Bruder nicht. Er wird weiter den Wetterwendischen ertragen, denn »daß er ein Künstler ist, steht fest«, und so wird er auch in der Folge so handeln wie bisher. Das starke Gefühl unbedingten Glaubens und alter Verbundenheit mit dem Bruder wird alle Hemmungen überwinden. Mit dem Frühjahr 1887 bessert sich die Stimmung, auch Theos schwankende Gesundheit holt auf. Vincent kann jetzt wieder viel draußen malen. In Asnières wohnt der junge Freund Bernard, in dessen Atelier er zuweilen malt, und hier entstehen jene Landschaften an den Ufern der Seine, die wie ein erster Aufstieg zum Licht sind. Die große Einfachheit der Dinge überwältigt ihn, und das silbrige Flimmern über dem Fluß gibt den Farben einen Glanz von innen, der völlig neu ist. Wie zart, wie licht ist jetzt die Palette geworden, wie großartig versteht es der Maler, von einer neuen sinnlichen Freude erfüllt, die Akzente zu setzen, das Nebensächliche auszulassen und die Kontraste in eine einzige Harmonie zu betten. Das haben sie von den Japanern gelernt, die in Paris die große Mode sind, die der Händler Bing auszuwerten weiß, mit dem auch Vincent in Beziehung steht. Der Winter aber wird besonders fruchtbar für die Bildnismalerei. Der Père Tanguy wird gemalt vor einem Hintergrund japanischer Bilder, mehrere Selbstbildnisse entstehen, darunter das an der Staffelei, in einer großartigen Spachteltechnik hingesetzt, die bereits über den Impressionismus der anderen weit hinausgeht. Wunderbare Stilleben wachsen nebenher, als schönstes das in Gelb, auf das Vincent mit roten Buchstaben die Widmung schreibt »à mon frère Theo«. Längst haben ihn die Kameraden als vollwertig anerkannt und gelegentlich Studien mit ihm getauscht, aber daß ihm dennoch der geschäftliche Erfolg versagt bleibt, mag mit dazu beigetragen haben, daß seine Stimmung sich von neuem verdüstert, seine Gereiztheit immer mehr zunimmt. Wie Theo später nach dem tragischen Zwischenfall in Arles seiner Braut gesteht, als man den Plan erwog, Vincent nach Paris zurückzuholen oder zur Erholung nach Holland zu schicken, hat es damals eine Menge Unannehmlichkeiten gegeben, weil es Vincent verwehrt war, Dinge zu malen, die ihn besonders gelockt hatten. »Die Modelle wollten ihm nicht posieren, das Arbeiten auf den Straßen wurde ihm verboten und bei seiner Reizbarkeit kam es infolgedessen beständig zu Szenen, die ihn derart irritierten, daß er schließlich ganz unnahbar wurde und Paris ihm im höchsten Grade verleidet war.« Er beginnt zu trinken und übermäßig zu rauchen, und auch das schafft kein Gegengewicht gegenüber den langen Jahren der Sorge und Entbehrung, die seine Gesundheit untergraben haben. »Er fühlt ein entschiedenes Bedürfnis, in milderer Luft zu leben und so wird er erst nach Arles gehen, um sich ein wenig zu orientieren, dann wahrscheinlich nach Marseille«, schreibt Theo Anfang 1888. Am letzten Tag in Paris besucht ihn noch der Freund Bernard und der erzählt, wie Vincent das Atelier herrichtet, »de telle sorte que mon frère me croie encore ici« – Arles – Marseille –: Bruder Theo hat ihm nicht nur die eigene Arbeit ans Herz gelegt, sondern ihm auch bestimmte Aufträge für sein Geschäft mit auf den Weg gegeben. Sie wollen gemeinsam für die Sache des Impressionismus arbeiten, denn diese Kunst hat die Zukunft und Vincents Werk wird dabei ein starkes Aktivum sein.
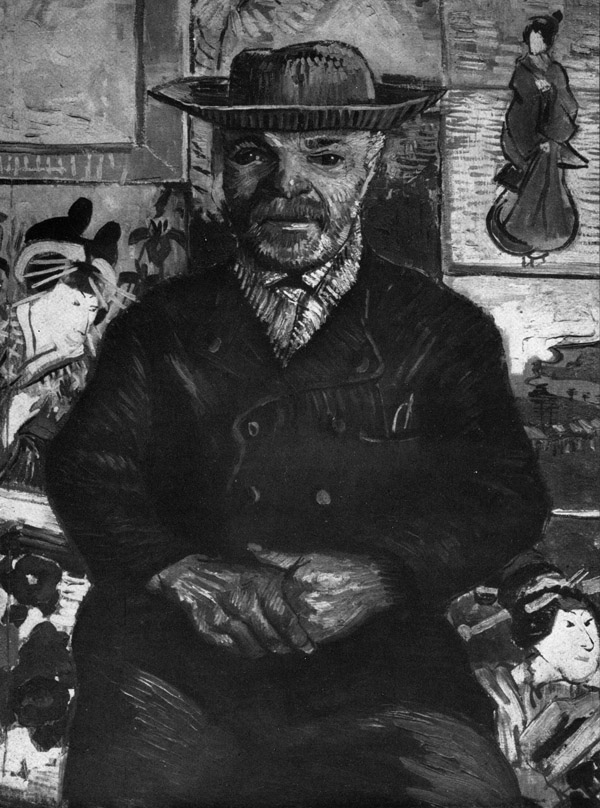
3. Der Farbenhändler Pere Tanguy. 1887. Paris, Musee Rodin
Das Jahr in Arles von Februar 1888 bis Mai 1889, leitet die letzte Epoche im Leben des Künstlers ein, die voll der dramatischen Spannungen ist. Als Vincent in der kleinen Stadt des Südens eintrifft, liegt noch tiefer Schnee über der Landschaft, die ihn seltsam an die Winterbilder erinnert, die die Japaner machen. Er nimmt zunächst Quartier in dem kleinen Restaurant Carrel, das er nach einigen Wochen mit einem Gasthof vertauscht, und schon sehr bald erreicht ihn ein Brief von Gauguin, dem es in der Bretagne nicht gut geht und der dort von allen Mitteln entblößt ist. Man muß ihm helfen, Bruder Theo soll ihm Bilder abkaufen und Gauguin selbst könnte eigentlich zu ihm nach Arles kommen. Denn das Zusammensein mit einem Gleichstrebenden gibt innerlich Auftrieb und würde auch das Leben verbilligen, wenn sie zusammen wohnen und einen gemeinsamen Haushalt führen. Diese Idee wird Vincent nicht mehr loslassen, und im Frühjahr mietet er ein Häuschen an der Place Lamartine, d. h. den rechten Flügel eines Gebäudes, der vier Zimmer enthält, von denen zwei eigentlich nur Kammern sind. »Das Haus ist gelb gestrichen und im Innern kalkweiß mit voller Sonne. Ich habe es für 15 Frcs. monatlich. Mein Wunsch wäre jetzt, ein Zimmer zu möblieren, und zwar im ersten Stock, um dort schlafen zu können. Das soll hier mein Atelier sein, mein Standquartier für die ganze Zeit meines Aufenthaltes hier im Süden. Auf diese Weise bin ich unabhängig von den Schikanen der Gasthöfe, die mich verstimmen und einen zu Grunde richten können.« So schreibt er im Mai an Theo unter Beigabe einer flüchtigen Skizze, die das Gebäude im ganzen und den von ihm gemieteten Flügel zeigt: »Dummerweise läßt sich der Möbelhändler in Arles auf kein Abzahlungsgeschäft ein. So wird man vorerst warten müssen. Aber der eine Raum im Parterre läßt sich wenigstens als Atelier benutzen. Wir kennen dies Wohnhaus des Künstlers aus einem herrlichen Bild, das er im Herbst malen wird. Und Arles selbst: Jeder Winkel dieser Stadt wird uns nun aus seinen Bildern vertraut. Die Zugbrücke über dem Kanal mit den Wäscherinnen davor, ein Motiv, das er mehrfach in den wechselnden Stimmungen des Tages behandelt hat, einmal eingetaucht in den hellen Sonnenglast des provençalischen Frühlings, dann unter grauem Regenhimmel mit dem Kerzenbündel der Zypressen an der Seite. Ferner der Weg mit den alten römischen Sarkophagen an den Seiten, der Stadtpark, der Eisenbahnviadukt und der Aufgang zur Eisenbahnbrücke. Der Blick auf die Stadt, die Obstgärten, der Weg mit dem wandelnden Liebespaar, die Wäscherinnen am Fluß und schließlich der Garten im Spital, den er bald nach seiner Ankunft malt, nicht ahnend, daß er selbst am Jahresende einer von den Kranken sein wird, die von der oberen Galerie hinunterschauen. Aber die Stadt ist nicht so, wie er sie sich gedacht hat, sie hat nicht »die südliche Heiterkeit, von der Daudet spricht, im Gegenteil, eine abgeschmackte Süßlichkeit, eine schmutzige Gleichgültigkeit, aber das tut nichts, das Land ist schön«. Ja wahrhaftig, das ist nicht zuviel gesagt. Sobald der Frühling die Bäume mit Blüten übergießt, malt er die Obstgärten, die Bäume mit ihrer Pracht, nicht einmal, immer wieder in immer neuen Variationen. Aber leider ist das Wetter mitunter so, daß er nur im Atelier arbeiten kann. Er hat eine Studie auf der Staffelei mit »Farben wie auf Glasfenstern und eine Zeichnung in festen Linien«. In solchen Augenblicken kommt ihm Flauberts Ausspruch zum Bewußtsein, »daß Talent große Geduld ist und Originalität nichts als eine Anstrengung des Willens und intensive Beobachtung«. Die Umwelt mutet ihn seltsam fremd an: »Die Menschen hier, die Zuaven, die Frauenhäuser, die entzückenden kleinen Arlesierinnen, die zur ersten Kommunion gehen, der Priester im Chorhemd, dick und bedrohlich wie ein Nashorn, die Absinthtrinker«. – Die Arbeitswut steigert sich in dem Maße, wie der provençalische Frühling von der Natur Besitz ergreift. Immer mehr blühende Bäume, die Aprikosen von zartem Rosa, Pflaumenbäume von hellem Gelb mit tausend schwarzen Zweigen, und erst die roten Pfirsichbäume! Zehn Bilder werden es mindestens sein mit diesen Motiven, und nachher kommen möglicherweise Stierkämpfe dran. Dann die Sternennächte! Solch eine sternenhelle Nacht mit Zypressen oder vielleicht mit einem reifen Getreidefeld zu malen! »Es gibt hier sehr schöne Nächte. Ich habe ein unausgesetztes Arbeitsfieber«, schreibt er. Aber manchmal und leider nur zu oft gibt es auch den Mistral, der meist vormittags von der Rhône heraufkommt und oft mehrere Tage stürmt. Vincent hat draußen viel unter dem Wind zu leiden und er muß die Staffelei an Stäben festbinden, daß sie ihm nicht weggeblasen wird. Aber der Sturm bringt auch Effekte, die er bisher nirgends gesehen hat. »In dieser Helligkeit ist sehr viel Gelb mit Blau und Lila.« Ja, dieser Süden ist so ganz anders, und der Maler, der ihn bezwingt, das muß »ein Farbiger sein, wie es ihn noch nie gab, noch nie«. Vincent hat viele neue Studien gemalt. Darunter wieder eine Brücke und den Rand einer Landstraße. Solche Motive gibt es auch in Holland, aber »der Unterschied liegt in der Farbe. Überall gibt es hier einen Ton wie Schwefel, die Sonne steigt einem zu Kopf«. Aber die Einsamkeit, das Bedürfnis nach Freundschaft – die inneren Erschütterungen durch Trauer und Enttäuschung, »das untergräbt uns viel mehr als die Ausschweifungen, uns, die glückliche Besitzer schwacher Herzen sind«. Armer Vincent, immer überkommt dich die Melancholie – immer bist du vollgefüllt vom inneren Leid, nennst deinen Zustand »vom Tod getroffen sein und von der Unsterblichkeit«. Aber dein Glaube an das, was kommen wird, ist riesengroß, könnte Berge versetzen. Denn »es gibt Dinge, die man in die Zukunft hinaus spürt und die wirklich eintreffen. Diese Sache ist größer als wir und von längerer Dauer als unser Leben – – wir spüren bitter wirklich, wie wenig wir sind und daß wir, um ein Glied in der Kette der Künstler zu sein, einen harten Preis zahlen mit unserem Blut, unserer Jugend, unserer Freiheit, deren wir niemals froh wurden. – – – In der Zukunft wird es eine Kunst geben, die muß so schön sein, so jung, ebenso wirklich wie wahr, daß, wenn wir dafür unsere Jugend weggeben, wir dann nur an Freude gewinnen können«. Aber die Arbeitswut am Tage läßt solche Reflexionen nicht aufkommen – denn die Briefe an Theo sind immer abends im Café geschrieben – und im Gegenüber der Natur ist das Hirn angespannt in Beobachtung und das Herz erfüllt vom Wunder der eigenen Schöpfung. Draußen vor Arles, alpenwärts, dehnt sich die Ebene der Crau und der Camargue, die viel weißen Kies und vereinzelte Felsblöcke hat, zwischen denen Bündel von Zypressen stehen, und dahinter erhebt sich – auf einem Fußmarsch von einer knappen Stunde zu erreichen – der Montmajour mit den Ruinen einer Abtei und alten Felsengräbern, wohin Vincent am Abend gern hinauswandert. »Ich sah da einen roten Sonnenuntergang, der schickte die Strahlen in die Stämme und das Blätterwerk der Fichten, die in dem Steingeröll wachsen. Er färbte in einem orange Feuer die Stämme und das Blätterwerk, während die anderen Fichten im Hintergrund sich preußischblau abzeichneten auf einem zarten blaugrünen Himmel, ganz himmelblau. Das war bezaubernd – das ist es, was ich machen möchte.« Auch am Mittelländischen Meer ist Vincent endlich gewesen in Saintes-Maries, und angesichts des Meeres empfindet er wieder, wie wichtig es ist, im Süden zu bleiben. »Man darf Afrika nicht fern von sich haben, um die Farbe bis zum äußersten zu treiben.« In einer Stunde hat er eine Zeichnung mit Schiffen gemacht, so »wie der Japaner rasch, sehr rasch, wie der Blitz« –, und zwei Seestücke und ein Blick von der kleinen Stadt werden außer einigen Zeichnungen noch von Saintes-Maries aus an Theo gehen, der die ganze künstlerische Ernte dieser Monate in seinem Pariser Heim verwahrt. Schon sind es 30 Bilder – darunter auch Stilleben, die Vincent an Regentagen zu Hause malt – bald werden es 50 sein, und so wird man vorbereitet sein, wenn der Tag kommt, an dem sich der Impressionismus mit einem Schlage in Paris durchsetzen wird. Ihn betreut Theo, der auch schon die Monet-Ausstellung arrangierte. Es gilt also in die Scheuern zu sammeln. In der Provence ist jetzt bereits Erntezeit. Vincent hat schwere Tage hinter sich. Die Sonne brennt heiß vom Himmel. Man sieht Vincent vor seiner Staffelei auf den violetten Erdschollen stehen, umflossen vom Licht, entzündet von der Hitze des Mittags. Ein Besessener, der nicht Ruhe gibt, bis er nicht das heiße Licht bezwungen oder selbst ein Opfer wurde, überwältigt von dem Urstrom jener magischen Kraft, die seine Nerven peitscht, sein Gehirn ausdörrt, den Pulsschlag seines Herzens auf immer höhere Touren treibt. Erst wenn der rote Ball im Westen glühend versinkt und der Tag in jähem Wechsel der Nacht weichen muß, sinkt der Arm des Malers kraftlos herab, verrinnen die letzten Perlen auf der zerfurchten Stirn, steht er müde wie ein knorriger Stamm, den Blick zum dunklen Abendhimmel emporgehoben, an dem die Sterne greifbar nahe hängen. Vincent malt diese Getreidefelder in der Ernte und danach einen Säer mit grünem und gelbem Himmel, der Boden violett und orange, und seine Erregungen sind manchmal so stark, »man fühlt nicht, daß man arbeitet. Mitunter kommen die Striche Schlag auf Schlag und sie folgen sich wie Worte in einem Gespräch ...«
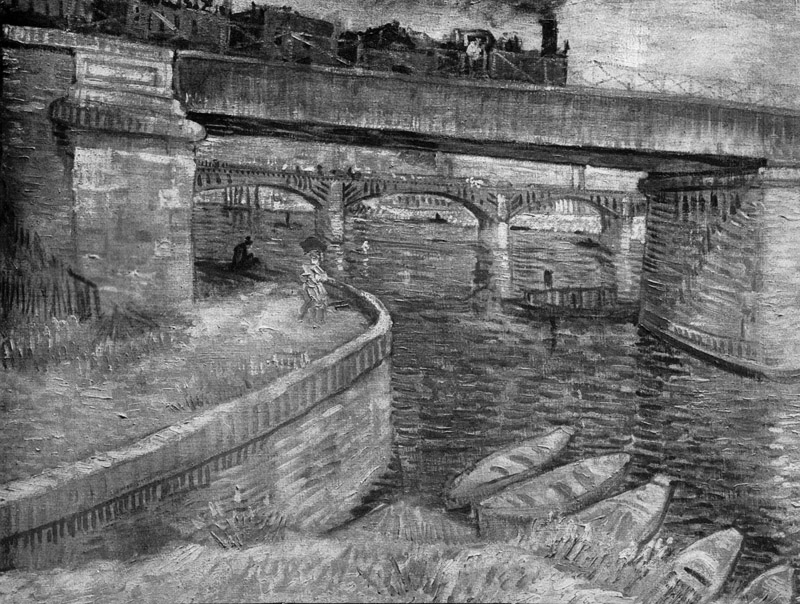
4. Pont de Chatou. 1887. Paris, L. Reinach-Goujon
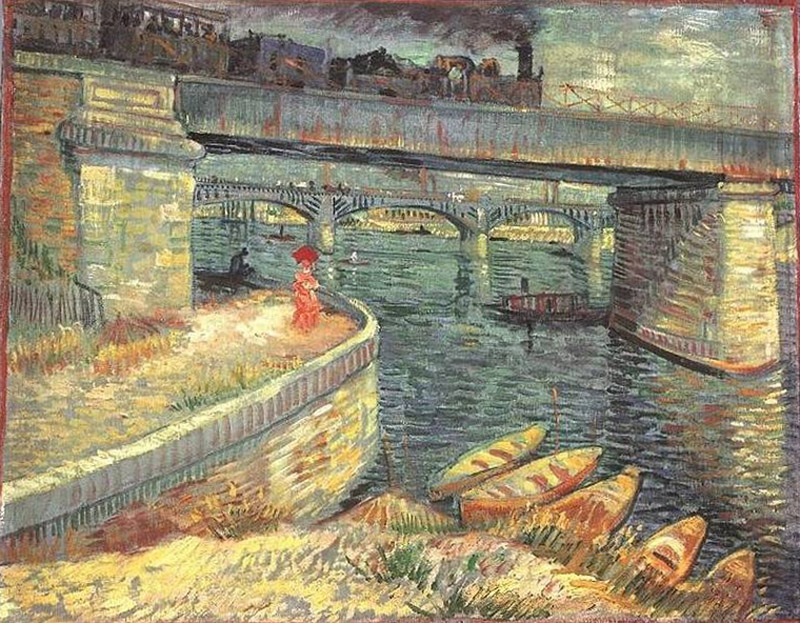
Immer noch wohnt er in dem kleinen Gasthof, und es wird noch einige Zeit dauern, bis er sich Möbel für sein Schlafzimmer im gelben Haus anschaffen kann. Was Theo schickt, geht zum großen Teil für Farben und Leinwand drauf, und auch diese werden immer vom Bruder in Paris bestellt. Ach wenn er nur einmal aus dem Vollen schöpfen oder wenigstens diese ewigen Alltagssorgen loswerden könnte! Er malt zwischendurch auch Porträts, hat Freundschaft mit dem Zuavenunterleutnant Milliet geschlossen, dem er Zeichenunterricht gibt, und der ihm dafür Modell sitzt, und bald kommt auch der Briefträger Roulin an die Reihe, der den feinen Sokrateskopf hat, im übrigen aber ein stiller Säufer ist, was ihn nicht abhalten wird, sich Vincent gegenüber in den Stunden der Not als wirklicher Freund zu bewähren. Wenn es nur mehr solche Roulins gäbe! Später wird Vincent auch die Frau des Trefflichen malen, und dieses Bild ist die berühmte »Berçeuse« van Goghs geworden, und auch den Sohn malt er, jenen herrlich frischen Jungen, der für seinen Vater die Briefe an Theo schreibt, als Vincent im Hospital liegt. Auch mit einem Künstler ist Vincent vorübergehend befreundet, »der große Träume träumt, der arbeitet, wie die Nachtigall singt«, und auch den wird er malen, wie er ähnlich einen Bauern malt, den er in die volle Glut der Ernte hineinsetzt. Ja, er ist endlich glücklich, zu spüren, wie die alten Kräfte wiederkehren, und er ist »mit dem Eifer beim Malen, mit dem ein Marseiller die Bouillabaisse ißt«. Drei große Stilleben nach Sonnenblumen sind auch bereits im Entstehen, die nach und nach ein Dutzend werden sollen, und das Ganze wird eine Sinfonie in Blau und Gelb sein. Diese Sonnenblumen aber werden das Atelier in seinem Hause schmücken, in dem er mit Gauguin zusammen malen wird. Aber der läßt sich Zeit. Offenbar fehlt ihm die Entschlußkraft, so daß Vincent bereits überlegt, ob er nicht seinerseits in die Bretagne übersiedeln soll. In dieser Zeit des Zuwartens aber entstehen noch jene beiden Bilder, um die ein so seltsames Fluidum ausgebreitet liegt, daß man unbedingt Vincent selbst hierzu hören muß. So manchen Abend hat er in jenem Nachtcafé zugebracht, das er nun für seinen Wirt malen wird, um damit seine Schulden abzugelten. Drei Nächte malt er an diesem Bild, und zweimal berichtet er darüber ausführlich an seinen Bruder: »In meinem Caféhausbild versuchte ich auszudrücken, daß das Café ein Ort ist, wo man verrückt werden und Verbrechen begehen kann. Ich versuchte es durch die Gegensätze von zartem Rosa, Blutrot und dunkelroter Weinfarbe, durch ein süßes Grün à la Louis XV. und Veroneser Grün, das mit Gelbgrün und hartem Blaugrün kontrastiert. Dies alles drückt eine Atmosphäre von glühender Unterwelt aus, ein bleiches Leiden. Dies alles drückt die Finsternis aus, die über einen Schlummernden Gewalt hat. Dies alles unter einem Schein japanischer Heiterkeit, in der Gutmütigkeit eines Tartarin«. Vincent hat auch den Wirt nicht vergessen, der im weißen Gewand neben dem Billard steht, auch nicht die schlafenden Gauner am Caféhaustisch und das Liebespaar hinter dem Ofen, und die Suggestion des Schweigens, die über das Bild gebreitet ist, läßt unwillkürlich an Strindberg und Edvard Munch denken. Ähnlich das Bild mit dem Schlafzimmer, das bald nach dem Nachtcafé entsteht.

5. Feldweg bei Arles. Mai 1888. Glarus, Frau J. Schuler-Ganzoni
Monate hat es gedauert, bis Vincent endlich sein Schlafzimmer hat einrichten können. Der Möbelkauf hat schweres Kopfzerbrechen bereitet, aber Freund Roulin wußte Rat. Gegen den 20. September kann Vincent den Gasthof verlassen, und alsbald wird ihm dies bäuerliche Schlafgemach zum Bild, über das er dem Bruder schreibt: »Ich hatte eine ganz neue Idee im Kopf und hier schicke ich Dir eine Zeichnung davon. Diesmal ist es ganz einfach mein Schlafzimmer. Nur die Farbe muß hier die Sache machen und durch ihre Vereinfachung dem Dinge einen größeren Stil und die allgemeine Suggestion der Ruhe und des Schlafes geben. Der Eindruck des Bildes muß den Kopf oder vielmehr die Phantasie beruhigen. Die Wände sind von einem hellen Violett, der Boden hat rote Fließen, das Holzbett ist gelb wie frische Butter, der Vorhang, die Decke und die Kopfkissen sind zitronengelb und grün und ganz hell. Die Bettüberzüge scharlachrot und das Fenster grün. Der Waschtisch ist orangefarben, die Waschkanne blau. Die Türen lila, und das ist alles. Sonst ist nichts in diesem Zimmer. Die viereckigen Möbel müssen eine unerschütterliche Ruhe ausdrücken. Porträts hängen an der Wand, ein Spiegel, ein Handtuchhalter und einige Kleider. Der Rahmen wird weiß sein, weil es sonst nichts Weißes in diesem Bilde gibt. Das gleicht die erzwungene Ruhe, die ich hervorbringen mußte, aus«. Nun aber steht das Haus wirklich für Gauguin bereit, denn auch für ihn sind die Möbel angeschafft worden, so daß in Zukunft das gelbe Haus an der Place Lamartine noch manchem Künstler aus dem Norden eine Zufluchtsstätte sein könnte. »Denn alle wahren Koloristen sollten nach dem Süden kommen, um zu sehen, daß es noch eine andere Farbenskala gibt als die des Nordens.« Gauguin soll an der Spitze eines Bundes von Impressionisten stehen, den Theo leiten wird. Voraussetzung ist das gemeinsame Atelier in Arles. Der Süden ist das, was Gauguin braucht, der ja schon auf Martinique gewesen ist. Er kann dem Bruder die Ausgaben mit Bildern bezahlen und wird noch genug dabei übrig behalten. Immer wieder bricht der Gedanke, an der Seite eines Kameraden zu schaffen, mit unbedingter Überzeugung durch, und entfernt mag Vincent dabei an die langen Winterabende denken, denn er hat sein Leben allzusehr in der Einsamkeit verbracht, und mit Vater Roulin kann man zwar ein Gläschen leeren, aber die Fragen der Kunst interessieren ihn nicht, und Milliet ist längst wieder in Afrika. Aber dennoch: Mitunter hat Vincent Bedenken. Er will keinerlei Druck auf Gauguin ausüben. Freund Bernard, der ebenfalls in Pont Aven malt, macht in dieser Zeit den Mittler, aber sobald Vincent die Gewißheit hat, daß Gauguin wirklich kommt, wird alles im Haus hergerichtet, ein Kochherd angeschafft und Gas gelegt. Am 20. Oktober meldet Vincent dem Bruder, daß Gauguin in Arles eingetroffen ist. Theo hatte für ihn noch das große Bild »Die Bretonin« um 500 Frcs. verkaufen können, und das erleichtert noch einige kleinere Anschaffungen für die gemeinsame Wohnung, die Gauguin später zurückerstattet werden sollen. Vincent aber, dem bisher jeder geschäftliche Erfolg versagt geblieben ist, hat sich gerade in der letzten Zeit sehr übernommen und zuweilen das Gefühl gehabt, krank zu werden, aber Gauguins Ankunft bringt ihm zunächst Entspannung, denn nun wird er auch das Essen nicht mehr zu vernachlässigen brauchen. Anfangs scheint die Harmonie vollkommen trotz der äußeren und inneren Gegensätze zwischen den beiden. Dem sehr viel robusteren und um fünf Jahre älteren Gauguin steht der äußerst sensible und sehr nervöse Vincent gegenüber und die ganz auf das Reale eingestellte, durchaus egozentrische Natur jenes »Exoten«, der der Sohn eines bretonischen Vaters und einer kreolischen Mutter war und bereits ein abenteuerliches Leben hinter sich hatte, will nur schwer zu dem faustischen Charakter eines Vincent passen, der, frei von jedem Egoismus, im Wesenskern eine geradezu beispielhafte Menschlichkeit verschließt. Der Glaube an das Gute in der Welt, der Glaube an Gott, erst im streng christlich-dogmatischen, dann in einem höheren kosmisch bedingten Sinne hat in Vincents Leben allen Erschütterungen standgehalten. Die äußere Schroffheit seines Wesens, die selbst der Bruder oft nicht ertragen konnte, war immer nur Abwehr und meist Ausfluß jener hochgradigen Nervosität, die ein Leben voll der Not und Enttäuschungen zur Folge hatte. In den ersten Wochen ihres Zusammenseins scheint zunächst alles gut zu gehen. Eine gesteigerte Arbeitsfreudigkeit setzt ein, und Vincent ist über jede Anerkennung des anderen glücklich. Wenn die Sonne scheint, ziehen sie mit ihrem Malgerät hinaus in die Landschaft, wo Vincent u. a. das Bild »eines ganz purpurnen und gelben Weinbergs mit blauen und violetten Gestalten und einer gelben Sonne« malt, während Gauguin Winzerinnen komponiert und an einer nackten Frau auf einem Heuhaufen mit Schweinen arbeitet, ein Bild, »das sehr schön und sehr stilvoll zu werden verspricht«. Todmüde kommen sie abends nach Haus, gehen dann noch ins Café und früh zu Bett. Aber inzwischen sind die schönen Herbsttage zu Ende. Man arbeitet viel im Atelier, manchmal sogar aus dem Kopf, was Gauguin angeregt hat, und mitunter ein Stilleben, wie den Holzstuhl aus dem Schlafzimmer mit gelbem Strohsitz, der auf den roten Fließen steht oder »Gauguins Sessel, rot und grün, Nachtlicht, Mauer und Fußboden auch rot-grün, auf dem Sitz zwei Romane und eine Kerze«. Gauguin scheint sein Magenleiden auch loszuwerden. Er ist ein Teufelskerl und hat große Erfolge bei den Arlesierinnen, was Vincent einigermaßen begreiflich findet. Überhaupt immer wieder Gauguin. Wie stolz ist der Einsame nicht auf diese neue Freundschaft. Wie strömt es über vor Bewunderung in den Briefen an Theo und wie dankbar wird jede Anerkennung vermerkt. »Gauguin hat auch beinahe sein ›Nachtcafé‹ beendet« – heißt es einmal. »Er ist als Freund sehr interessant. Ich muß Dir noch sagen, daß er es ausgezeichnet versteht, die Küche zu besorgen ...« Und im nächsten Brief: »Das ist ein ganz großer Künstler und außerordentlicher Freund.« Anfang Dezember heißt es: »Es tut mir ungemein wohl, einen so intelligenten Kameraden wie Gauguin zu haben und seine Arbeiten zu sehen ... Ich glaube bestimmt, man wird mit Gauguin immer befreundet bleiben ... Es wäre wundervoll, wenn es ihm gelänge, ein Atelier in den Tropen zu gründen«. In diesen Tagen sind die beiden nach Montpellier gefahren, das ein berühmtes Museum hat, in dem es die vom Maler Bruyas gestiftete Sammlung mit französischen Bildern gibt, darunter Meisterwerke von Poussin, David, Ingres, Delacroix, Corot, Th. Rousseau, Courbet u. a. Am Abend nach der Heimkehr hat man heftig über die Kunst debattiert, denn Vincent schreibt am nächsten Tage an Theo: »Gauguin und ich, wir reden viel von Delacroix und Rembrandt usw. Unser Zwiegespräch ist mitunter von einem außerordentlichen elektrischen Fluidum belebt, mitunter stehen wir davon auf mit müdem Kopf und wie eine elektrische Batterie nach der Entladung ... Gauguin sagte mir diesen Morgen, als ich ihn frug, wie er sich fühle, er fühle seine alte Natur wiederkehren, und das machte mir viel Freude«. Und dann noch ein letzter Brief an den Bruder, bevor es zur Katastrophe kommt. Hatte sich das elektrische Fluidum beim abendlichen Disput allzu gewaltsam entladen, hatte Gauguin daraufhin seine Koffer gepackt? Vincent schreibt: »Ich glaube, Gauguin war etwas unzufrieden mit dieser kleinen Stadt Arles, mit dem kleinen gelben Haus, worin wir arbeiten, und vor allem mit mir. Es gibt für ihn wie für mich wirklich noch große Schwierigkeiten zu überwinden, aber diese Schwierigkeiten liegen viel eher in uns als anderswo. Im ganzen glaube ich, daß er einmal plötzlich abreist oder sich plötzlich entschließt, hierzubleiben. Ich sagte ihm, er solle, ehe er das ausführe, nachdenken und seine Rechnung machen. Gauguin ist ein sehr starker, sehr schöpferischer Mensch; aber gerade darum muß er in Frieden bleiben. Wird er ihn anderswo finden, wenn er ihn hier nicht findet? Ich erwarte, daß er sich in vollkommener Heiterkeit entschließt«. Dies ist der letzte Brief Vincents an den Bruder aus dem Jahr 1888. Die nächste kurze Mitteilung auf dem Briefbogen des Hospitals wird das Datum vom 2. Januar 1889 tragen. Was aber hatte sich inzwischen ereignet? Auch Gauguin soll das Wort haben, und man wird mit erschreckender Deutlichkeit erkennen, wie wenig das kühle Ressentiment dieses Bretonen mit dem warmen Gefühl echter Freundschaft, das Vincent empfindet, gemein hat. Daß der andere offenbar sehr mit den Nerven herunter ist, hat Gauguin gleich nach seiner Ankunft erkannt, denn er schreibt an Theo: »Ihr Bruder ist in der Tat ein wenig erregt, aber ich hoffe, ihn nach und nach zu beruhigen«. Aber dem Freund Bernard in der Bretagne gesteht er u. a.: »Vincent und ich, wir stimmen kaum zusammen, am wenigsten in puncto Malerei. Er bewundert Daudet, Daubigny, Ziem und den großen Rousseau, lauter Leute, deren Namen ich nicht hören kann. Dafür achtet er Ingres, Raffael, Degas gering, die ich bewundere. Er schätzt meine Bilder sehr, aber wenn ich sie male, kritisiert er dieses und jenes. Er ist Romantiker und ich bin ein primitiver Mensch«. In Vincent ist ein Vulkan, aber auch Gauguin hat eine kochende Seele. Solche Gegensätze sind auf die Dauer nicht auszugleichen, und wenn Gauguin seinen Kameraden einen Romantiker nennt, so trifft dieses Wort bestimmt daneben. Ihm, dem gefühlskalten »Primitiven«, war jene Flamme echter Humanität, die in Vincent brannte, überhaupt unverständlich. In der zweiten Dezemberhälfte, wohl in der Zeit, als Vincent den letzten Brief vor der Katastrophe an den Bruder schrieb, teilt Gauguin seinerseits Theo mit, daß er die Absicht habe, nach Paris zurückzukehren, und er bittet um Übersendung eines Teilbetrages aus dem Erlös der verkauften Bilder. Vincent und er könnten nicht Seite an Seite leben infolge der Unberechenbarkeit der Stimmung, und jeder von ihnen habe die Ruhe für die Arbeit nötig. Ein paar Tage später aber nimmt Gauguin diesen Brief zurück und bittet ihn als einen schlechten Traum zu betrachten. Dann am Tage vor Weihnachten das Telegramm von Gauguin, Theo müsse sofort nach Arles kommen, und anstatt mit der jungen Braut nach Holland zu reisen, fährt der treue Bruder südwärts, wo er Vincent in einem schlimmen Zustand im Hospital wiedersieht.

6. Zugbrücke mit Wäscherinnen. Frühjahr 1888. Amsterdam, Rijksmuseum

Über die Ereignisse jener Nacht vom 23. auf den 24. Dezember liegt noch immer ein gewisser Schleier gebreitet, nicht zuletzt auch, weil man zu wenig von der Rolle weiß, die Gauguin dabei gespielt hat, der seinerseits nur allzusehr bemüht war, jede Schuld abzustreiten. Dennoch möchten wir glauben, daß sich der Vorgang etwa so abgespielt haben dürfte: Vincent und Gauguin sitzen am Abend im Atelier zusammen, rauchen und trinken, und wie so oft kommt das Gespräch auf die Kunst. Die Uhr zeigt schon nach Mitternacht. Der Alkohol hat die Köpfe umnebelt, das Gespräch wird immer erregter. Vincents apodiktische Urteile reizen den anderen zum Widerspruch. Anzunehmen sogar, daß er Vincent bewußt herausfordert. Der verliert die Selbstbeherrschung, wirft Gauguin ein Glas an den Kopf, geht mit dem Rasiermesser auf ihn los. Gauguin schüttelt den Rasenden ab und verläßt den Raum. Vincent, in einem Augenblick ernüchtert und zutiefst getroffen von dem Bruch der Freundschaft, stürzt hinaus in die Nacht, hin zum Stadtpark, auf den die kleine Straße mündet, wo die Bordelle liegen. Das unselige Rasiermesser fühlt er in der Tasche seines Überrocks. Soll er ein Ende machen und wo? Drüben in einem der Häuschen ist noch Licht. Nicht zum erstenmal tritt er über die Schwelle bei der »Mère Chose« und die kleine Arlesierin ist wirklich noch auf. Aber wieder fühlt er das Messer in seiner Hand – wozu noch leben? Es hämmert furchtbar in seinem Hirn. Lieber also ein rasches Ende. In einem unbewachten Moment zückt er das Messer, will die Schlagader am Hals treffen. Der Hieb geht zu hoch, aber vom rechten Ohr fällt ein Stück herab. Große Aufregung im Bordell und in der Gasse. Man holt die Polizei, bringt den Blutüberströmten, notdürftig verbunden, nach Haus und schafft ihn ins Bett. Inzwischen hat man den braven Roulin geweckt, der sofort zur Place Lamartine eilt und Vincents Überführung ins Hospital veranlaßt. Die andere immer wiederholte Version, nach der sich Vincent noch im Atelier sein Ohr abgeschnitten und es dann im Bordell abgegeben habe, ist völlig unwahrscheinlich. Schon der starke Blutverlust – eine Arterie war angeschlagen, wie Vincent selbst später berichtet – hätte den Weg von seiner Wohnung zum Stadtpark unmöglich gemacht, und der Blutüberströmte würde wohl kaum in jenem Hause Einlaß gefunden haben. Die Aufregung, die dort entstand, erklärt sich nur durch den Vorgang, so wie er oben geschildert wurde. Einige Wochen später besucht Vincent jenes Haus noch einmal, wahrscheinlich, um den Vorfall in jener Nacht zu entschuldigen. »Gestern wollte ich das Mädchen wiedersehen«, so schreibt er am 3. Februar an den Bruder, »zu der ich in meiner Verirrung gegangen bin. (Man lese klar und deutlich »zu der ich – – – gegangen bin«, nicht »bei der ich mein Ohr abgegeben habe«!!) Man sagte mir da Dinge, die aber hierzulande nicht erstaunlich sind. Auch sie hat an Ähnlichem gelitten. Sie war leidend, fiel ohnmächtig zusammen, aber dann wurde sie wieder ruhig. Sonst sagt man Gutes von ihr.« Ist aber die Ohnmacht des Mädchens anders zu verstehen als durch den Schrecken, den sie in jener Nacht erlebte? Die Ärzte haben Vincents Krankheit für einen Ausbruch von Epilepsie erklärt. Zunächst, um den Kranken zu beruhigen, der dieses Wort begierig aufgreift. Leider besteht diese Diagnose zu Recht, dann aber wäre der Ausbruch dieser Krankheit möglicherweise sogar im Hause der besagten »Mère Chose« und in unmittelbarer Beziehung zu jenem Akt der Selbstverstümmelung eben die Folge jener hochgradigen Überreiztheit der Nerven, die Gauguin zur Entladung brachte, und jenem ersten totalen physischen Zusammenbruch werden noch viele schwere Nervenkrisen folgen, die beinahe regelmäßig wiederkehren und fortan wie ein schwarzer Schatten über Vincents Leben stehen. Dieser ist sich jetzt und in der Folge über seinen Zustand völlig im klaren. Er spricht öfters von seiner »Gehirnkrankheit«, aber er ist auch weit davon entfernt, Gauguin von jeder Schuld freizusprechen. Schon am 17. Januar schreibt er in einem Brief an Theo: »Nehmen wir an, ich sei ganz außer Fassung gewesen, warum verhielt sich dann dieser berühmte Kamerad nicht ruhiger?« Überhaupt Gauguin, und immer wieder Gauguin: Vincent wird trotz allem diese Liebe zu dem Anderen nie mehr ganz los, mag sie auch oft von Bitternis durchtränkt sein und ihm einmal sogar ein hartes, sehr hartes Urteil über Charakter und Vergangenheit dieses Mannes abnötigen. Gauguin hat es nicht für nötig gehalten, den Freund im Hospital aufzusuchen, ihm die Hand entgegenzustrecken. Er wird mit Theo nach Paris zurückreisen, während Vincent, kaum genesen, zur Feder greift: »Mein lieber Freund Gauguin! Ich nutze meinen ersten Weggang vom Spital, um Ihnen zwei ganz ernste und innige Worte der Freundschaft zu schreiben. Ich habe viel im Spital an Sie gedacht, selbst im höchsten Fieber und in der größten Schwäche – – – – – Stehen Sie davon ab, bis Sie es reiflich überlegt haben, über unser kleines armes gelbes Haus etwas Schlechtes zu sagen – –« Im stillen hofft Vincent sogar, daß Gauguin nach Arles zurückkehren werde. Und er ist glücklich, als sich jener eines der herrlichen Sonnenblumenstilleben als Tauschobjekt ausbittet, für das Vincent seinerseits gern das Porträt haben möchte, das Gauguin von ihm gemalt hat.
An dieser Stelle aber muß kurz jene Darstellung beleuchtet werden, die Gauguin selbst sehr viel später über jene Vorgänge zu Papier gebracht hat, und die wörtlich auch von Robert Burnett in sein Buch »The Life of Paul Gauguin« (London 1936) übernommen worden sind. Dabei ist anzumerken, daß die öffentliche Meinung, zumal nach Vincents frühem Tod, Gauguin einen großen Teil der Schuld an den Ereignissen in Arles zugeschoben hat. Zugegeben, daß solche Verdächtigungen Gauguin sehr viel Verdruß bereitet haben, aber so wie er die Vorgänge beschreibt, können sie sich unmöglich abgespielt haben. Jedem unbefangenen Leser teilt sich vielmehr der Eindruck mit, daß dieser Versuch der Entlastung von Schuld weit über alle Wahrscheinlichkeit hinausgeht und sich darum ins Gegenteil verkehrt. Im wesentlichen gibt Gauguin folgende Schilderung:
1. Szene. Es ist der Abend des 22. Dezember, also der Tag, der der eigentlichen Katastrophe vorausgeht. Gauguin und Vincent sitzen im Café. Vincent hat ein Glas Absinth bestellt. Plötzlich wirft er dieses seinem Freunde an den Kopf, ohne ihn indes zu treffen. Gauguin nimmt darauf Vincent unter den Arm, verläßt mit ihm das Café, bringt ihn nach Hause, und wenige Minuten danach liegt Vincent in seinem Bett und schläft. Am nächsten Morgen bittet Vincent den Freund um Verzeihung. Gauguin vergibt ihm für diesmal, bedeutet ihm aber, daß er vorkommendenfalls nicht mehr Herr seiner selbst sein könnte und ihn erwürgen würde. Deshalb wolle er Theo seine Rückkehr ankündigen.
2. Szene. Am nächsten Abend nach einem eiligen Nachtmahl macht Gauguin einen Spaziergang auf der Place Lamartine. Plötzlich hört er hinter sich die kurzen, abgehackten Schritte, und er dreht sich in dem Moment um, als Vincent im Begriff ist, sich mit einem offenen Rasiermesser auf ihn zu stürzen. Aber Gauguins furchtbarer Blick gebietet ihm Einhalt, und mit gesenktem Kopf rennt Vincent zurück ins Haus. Gauguin hat oft sein Gewissen befragt, warum er damals den Freund nicht entwaffnet oder wenigstens beruhigt habe. Aber er hat sich dieserhalb keine Vorwürfe gemacht. Das zu tun, sei den anderen überlassen. Er ist Vincent nicht gefolgt, hat vielmehr ein gutes Hotel in Arles aufgesucht, ist zu Bett gegangen, konnte aber erst gegen drei Uhr in der Frühe einschlafen und ist gegen 7.30 Uhr aufgewacht. Als er zum gelben Haus kommt, findet er den Platz voll von Menschen. Vor dem Hause mehrere Polizisten und den Polizeikommissar.
3. Szene. Vincent ist an jenem Abend nach Hause gegangen und hat sich unmittelbar darauf ein Ohr dicht am Kopf abgeschnitten. Er muß eine bestimmte Zeit gebraucht haben, um die Gewalt des Blutes zu stillen. Denn am nächsten Tage findet man überall Blutspuren auf den Fließen des Ateliers, und auch die Treppe, die nach oben in die Schlafzimmer führt, ist durch Blut beschmutzt. Als er aber in der Verfassung ist, hinauszugehen, den Kopf vollkommen eingewickelt unter einer Baskenmühe, eilt er stracks in ein Haus, wo man Eroberungen machen kann. Und dort übergibt er dem Mädchen das sauber gereinigte und in einem Umschlag verpackte Ohr mit den Worten: »Hier hast du eine Erinnerung an mich!« Dann rennt er zurück nach Hause, legt sich zu Bett, um zu schlafen. Vorsichtshalber aber hat er die Läden geschlossen und die Lampe auf einen Tisch neben das Fenster gestellt. Zehn Minuten später ist die Straße (wo die lieben Damen wohnen) in voller Bewegung, und das Vorkommnis wird heftig diskutiert.
4. Szene. Der arme Gauguin aber wird an jenem Morgen, als er sich der Schwelle seines Hauses nähert, sogleich von dem Polizeikommissar heftig angefahren, was er seinem Freunde angetan, der tot sei! Sie gehen zusammen hinauf, treten ans Bett von Vincent, der unter seinen Kissen wie ein Hund zusammengekrümmt daliegt, aber gottlob atmet. Gauguin bittet den Kommissar, Vincent vorsichtig zu wecken, und wenn er nach ihm fragen sollte, möge er sagen, er sei nach Paris abgereist, »mein Anblick könnte ihm gefährlich sein«. Also tut jener kluge Kommissar und schickt darauf nach einem Doktor und Wagen.
So ungefähr stellt Gauguin die Ereignisse dar, was er noch weiter erzählt, macht die Situation nicht wahrscheinlicher. Und nicht nur die Ärzte werden über diesen einzigen Vincent, der mit verletzter Schlagader blutüberströmt den Amourösen spielt, den Kopf schütteln, sondern vor allem bei Gauguin eine bedenkliche Gedächtnisschwäche oder wenigstens ein mageres Talent zum Flunkern feststellen. Bleibt schließlich noch die Frage, wie dieses Märchen von dem Ohr als Angebinde hat entstehen können.
Es ist anzunehmen, daß Theo die näheren Umstände wohl gekannt hat. Aber es ist auch durchaus zu verstehen, daß er selbst seiner Braut das Motiv jener unseligen Tat, in der wir immer nur einen Selbstmordversuch erkennen können, verschwiegen hat. Infolgedessen mußte die Selbstverstümmelung anders erklärt werden. Von Theo liegt über die Vorgänge jener Nacht keinerlei direktes Zeugnis vor. Aber die Schwägerin hat in ihrer Van-Gogh-Biographie an dem im Bordell abgegebenen Ohr festgehalten, und vielleicht glaubte sie damit dem Andenken ihres Schwagers einen Dienst zu erweisen, indem sie ihn von jenem Odium entlastete, das nach den Anschauungen der damaligen Zeit die religiösen Empfindungen verletzt haben würde. Kehren wir nunmehr zu Vincent selbst zurück.
Am 7. Januar kann der kaum Genesene das Spital erstmalig verlassen, wo sich der brave Dr. Rey ernstlich um ihn bemühte und er auch des öfteren den Besuch des protestantischen Pfarrers Salles erhielt, der ihm fortan als Freund zur Seite steht. Beide berichten über den Zustand des Kranken dem Bruder in Paris, und in Kürze wird Vincent den Dr. Rey malen. Auch Roulin hat oft am Bett des Kranken gesessen, und seine Briefe an Theo, die einer seiner beiden Jungen schreiben muß, sind Dokumente echter Freundschaft. »L'ami Vincent est complètement guéri«, schreibt er bereits am 3. Januar nach Paris. Und wenige Tage später bringt er den Freund ins gelbe Haus zurück. Er wird Vincent fortan betreuen wie eine Löwenmutter ihr Junges. Aber Roulin ist nur einer und kann die Meute der anderen nicht im Zaum halten. Diese umkreist das gelbe Haus mit jener neugierigen Wollust, die jeden Augenblick einen neuen Zwischenfall erwartet, ja die Kinder klettern sogar an den Fensterkreuzen hoch, um einen Blick ins Innere des Häuschens zu erhaschen. Vincent ist bei sich selbst eingeschlossen. Er leidet unter einer entsetzlichen Schlaflosigkeit und spritzt abends eine starke Kampferdosis in Kopfkissen und Matratze. Und sehr bald schon kommt der Augenblick, wo er sich von neuem der Obhut des Spitals anvertraut. Hat er Angst vor einem neuen Anfall? Vom 7. bis 18. Februar ist er noch einmal im Spital. Dann aber versucht er, allein in der Arbeit Vergessen zu finden. Er hat ein neues Stilleben begonnen nach einem Stuhl aus weißem Holz mit einer Pfeife und einem Tabaksbeutel darauf. Er malt nochmals Frau Roulin, die berühmte »Berçeuse«, die in mehreren Fassungen existiert, malt ebenfalls das Porträt von Madame Ginoux, die sogenannte »Arlesienne«, für die die Frau des Besitzers jenes kleinen Cafés Modell steht, in dem Vincent am Abend so oft mit seinem Freunde Roulin gesessen hat, und einen Augenblick überkommt ihn sogar das Gefühl, daß jedermann gut zu ihm sei. Aber er täuscht sich in diesem einen Punkte bedenklich, denn bald nachdem er zum zweitenmal aus dem Spital nach Hause zurückgekehrt ist, werden die Einwohner zu Akteuren einer nichtswürdigen Handlung, die Vincent an den Rand der Verzweiflung bringen sollte. Man sieht die Leute an den Ecken beisammenstehen und die Köpfe zusammenstecken, wenn der Maler sein Haus verläßt oder in dasselbe zurückkehrt. Unwillkürlich empfindet man jene seltsam muffige und fiebrige Atmosphäre der Kleinstadt, die auf die Menschen abfärbt, die teils gutmütig, teils bösartig sind und sich gern am Skandal mästen, so wie die Hyäne am toten Wild. Am Heiligabend war diese kleine Stadt erfüllt gewesen von dem, was sich in der Nacht vorher am Stadtpark zugetragen. Von Mund zu Mund lief die Geschichte von dem Maler, der plötzlich verrückt geworden sei, und aus dem abgeschnittenen Ohr ist sicher sehr bald schon ein Blutbad im Bordell geworden. Ein gefährlicher Mensch also, jener Künstler, vor dem man sich in acht zu nehmen hat. War er nicht immer schon ein Sonderling, der verworrene Bilder malte und tagelang in der prallen Sonnenglut stand, wenn jeder andere sich im Schatten seines Hauses vor der Hitze verschloß? Das tuschelt und raunt zwischen den vier Wänden, auf Gassen und Plätzen, das weist mit den Fingern auf den armen nervenzerrütteten Kranken, der mit dem schweren Verband um den Kopf über die Straße geht. So einer ist gefährlich, und man darf ihn nicht frei, herumgehen lassen. Also macht man eine Petition an den Bürgermeister, daß dieser Maler sofort interniert werden müsse. Und im Handumdrehen haben 81 dieser »Menschenfresser«, wie sie Vincent später nennt, das Gesuch unterzeichnet. Die Polizei kommt am 26. Februar ins gelbe Haus und schleppt den Widerstrebenden von neuem ins Hospital, wo er diesmal, da Dr. Rey krank ist, in der Tobsuchtszelle eingeschlossen wird und dort viele Tage verbringen muß, bevor man ihn endlich Mitte März wieder wie einen gewöhnlichen Kranken behandelt. Die Erinnerung an die Tobsuchtszelle im Hospital von Arles, wo er vergebens an den Gitterstäben des Fensters rüttelt, durch die er ins freie Land hinaussieht, wird noch lange auf ihm lasten, und nie wird Vincent verstehen, daß es in Arles so viele Menschen gab, »die feige genug waren, gegen einen einzelnen vorzugehen«. Ende März kommt Signac zu Besuch, und sie gehen zusammen ins gelbe Haus, das von der Polizei geschlossen worden war, sehen die Bilder durch, und Vincent schenkt dem Kollegen zur Erinnerung ein Stilleben, »das die guten Gendarmen der Stadt Arles gereizt hatte, weil es zwei geräucherte Heringe darstellt, die der Spitzname der Gendarmen sind«. – »Ach wenn man mich doch nicht in den Dreck geschleift hätte«, gesteht er dem Bruder, aber schon denkt er wieder an neue Bilder, und die Gewißheit, daß die Nachbarn selbst nicht unter jenen Denunzianten gewesen sind, bestärkt ihn in dem Glauben, daß er auch Freunde in der Stadt hat. Oh, der namenlosen Ängste, die er in den vergangenen drei Monaten auszuhalten hatte! Erst langsam beginnt sich der Schleier zu lüften, der über der Zeit und dem Schicksal gebreitet liegt. Anfang April kommt Roulin, der inzwischen nach Marseille versetzt wurde, zu Besuch, und mit ihm beratschlagt Vincent, was er unternehmen soll. Alles das aber ist nicht so wichtig wie die Malerei, der er sich im Hospital erneut widmen darf. »Ein Pfirsichgarten am Rande einer Straße mit den Alpen im Hintergrund« steht schon auf der Staffelei. Und vierzehn Tage später sind bereits sechs neue Frühlingsstudien, darunter zwei große Gärten, in Arbeit. In diesen Tagen hat Bruder Theo seine Braut aus Holland heimgeführt und ist mit ihr in eine neue Pariser Wohnung übergesiedelt. Und diese Tatsache gibt Vincent sichtbarlich einen neuen Auftrieb und in Gedanken ist er fortan bei Bruder und Schwägerin mit einer beinahe väterlichen Besorgtheit, die selten der guten Ratschläge ermangelt. Als aber gar dem Paare nach Jahresfrist ein Sohn geboren wird, der Onkel Vincents Namen tragen soll, überkommt ihn das gleiche Glücksgefühl wie damals an jenem fernen Tag, als die arme Christine einem Jungen das Leben gab. Diesen seinen einzigen Neffen wird Vincent einmal zärtlich in die Arme schließen, aber bis dahin ist noch lange Zeit. Vorerst fühlt er sich im Hospital geborgen. Aber wie lange noch? Soll er eine neue Wohnung nehmen, wie der Pfarrer ihm rät, da ihm das gelbe Haus endgültig verleidet ist? Nein! »Noch einmal mit diesem Malerleben wie bisher anfangen, im Atelier isoliert sein von früh an und ohne eine Möglichkeit, sich zu zerstreuen, als in ein Café und in ein Restaurant zu gehen, mit all der Kritik der Nachbarn usw., ich kann das nicht mehr aushalten«, gesteht er dem Bruder am 20. April, und in diesem Brief äußert er den Wunsch, in das Irrenhaus von St. Remy zu gehen, von dem ihm Herr Salles erzählt hat. Nur heraus aus dieser unseligen kleinen Stadt, am liebsten würde er in die Fremdenlegion eintreten und sich für fünf Jahre nach Afrika verpflichten, wohin möglicherweise auch der so viel jüngere Emile Bernard geht, der nächstens zum Militär einrücken muß. Aber auch das ist erst möglich, nachdem man einigermaßen wieder gesund geworden ist. Wenn man nur außerhalb der Anstalt malen kann. Herr Salles ist von St. Remy diesbezüglich mit keinen guten Nachrichten zurückgekehrt. Also doch lieber in Arles bleiben und in jenem Nachtcafé wohnen, wo er seine Möbel untergestellt hat? Die Leute in der Stadt scheinen sich beruhigt zu haben, denn Vincent malt wieder im Stadtgarten, »ohne anders behindert zu sein als durch die Neugierde der Vorübergehenden«, ja er arbeitet mit mehr Eifer denn je. Eine große Kiste mit Bildern geht an den Bruder ab, die die ganze Ernte an Gemälden aus den letzten Monaten enthält, rund zwanzig Stück, darunter das »Nachtcafé«, das »Schlafzimmer«, der grüne und der rote »Weinberg«, die »Sonnenblumen« u. a. m. Theo hat sich inzwischen endgültig für St. Remy entschieden. Vielleicht, daß man sich danach in einigen Monaten in Paris wiedersieht. Mit dieser Aussicht schließt Vincent seinen letzten Brief aus Arles vom 3. Mai, der nächste, fünf Tage später geschrieben, meldet bereits die Ankunft in St. Remy, wohin Herr Salles den Freund begleitet hat, um ihn persönlich dem Direktor und leitenden Arzt des Irrenhauses, Dr. Peyron, zu übergeben. St. Remy, etwa 10 km nordöstlich von Arles, ist ein Landstädtchen mit kaum mehr als sechstausend Einwohnern, und in seiner Nähe liegt das alte Kloster, in dem sich seit langem eben jene Anstalt befindet, die wir bald aus Vincents Bildern kennenlernen werden. Hier also wird Vincent vom 8. Mai 1889 bis zum 15. Mai 1890 wohnen.
Schwer zu sagen, ob St. Remy der richtige Platz für einen gemütskranken Maler war oder nicht. Der Künstler hat hier ein Werk geschaffen, das einen weiteren Schritt auf dem Weg der Vollendung bedeutet und an Vereinfachung der malerischen Form einen einzigen Höhepunkt darstellt. Die äußere Vereinsamung zwingt zur inneren Einkehr. Vincents Zustand schwankt zwischen schweren Depressionen und einer Arbeitsfreude, die fast schon Besessenheit ist. Im Anfang stößt ihn die Gesellschaft der Irren, mit denen er nun zusammenleben muß, keineswegs ab. Er findet es interessant, das Leben der Verrückten einmal aus der Nähe kennenzulernen. Unter diesen Kranken gibt es viel wahre Freundschaft. »Und wenn einer in eine Krise verfällt, dann achten die anderen auf ihn und kommen dazwischen, damit er sich nichts antue«. Auch an das beständige Schreien und »furchtbare Heulen wie von Tieren in einer Menagerie« hat er sich bald gewöhnt. An Regentagen freilich ist es schlimm. Dann hocken alle in einem großen Saal beisammen, der »wie ein Wartesaal Dritter Klasse in einer schlafenden Stadt« ist und das um so mehr, als es einige irrsinnige Personen gibt, die »immer einen Hut tragen, eine Brille und einen Stock und tun, als wenn sie auf der Reise wären, beinahe wie in einem Seebad, und die glauben, hier durchzufahren«. Das Essen freilich ist so lala und »schmeckt ein wenig nach Schimmel wie in einer Pariser Kneipe oder einem Pensionat«, und fast immer gibt es »Kohl, Bohnen, Linsen und anderes Futter«, das sich die Kranken in den Mund stopfen, für die es leider keine Zerstreuung gibt außer einem Kegelspiel und einem Damenbrett. Das Milieu also berührt Vincent an sich wenig, und es klingt durchaus glaubhaft, wenn er seinem Bruder wenige Wochen nach der Übersiedlung in die Irrenanstalt ausdrücklich versichert, daß er sich in St. Remy sehr wohl fühle und vorläufig keinen Grund sehe, nach Paris in eine Pension zu gehen oder sonstwohin. Freilich ist er auch keiner von den gewöhnlichen Kranken. Er hat ein hübsches Zimmer für sich mit sehr schönen alten Vorhängen, die vielleicht aus einer reichen heruntergekommenen Familie stammen, und einem alten, wenn auch abgenutzten Sessel, und durch das außen vergitterte Fenster sieht er »durch einen Zaun ein viereckiges Kornfeld – und darüber jeden Morgen, wie die Sonne in ihrer Glorie aufgeht«. Außerdem hat man ihm von den ungefähr dreißig Zimmern, die leer stehen, eines als Atelier eingeräumt, und hier wird er in den kommenden Monaten, vor allem aber während des Winters, herrliche Dinge malen, wenn er draußen nicht mehr arbeiten kann. Es ist also keineswegs so, daß Vincent in St. Remy eine Art freiwilliger Gefangenschaft erlebt oder gänzlich von der Außenwelt abgeschnitten ist, wie immer wieder behauptet wurde. Im Gegenteil, Dr. Peyron ermuntert ihn ständig zur Arbeit, und Vincent streift bald überall in der näheren und weiteren Umgebung umher auf der Suche nach Motiven. Ja, er wird sogar im Juli bereits wieder nach Arles fahren, um die Freunde dort wiederzusehen, was ihn besonders erfrischt, und um die zurückgelassenen Bilder nach St. Remy zu holen. Herrn Salles freilich muß er diesmal verfehlen, da er auf einer längeren Ferienreise ist, und auch den lieben Dr. Rey hat er leider nicht angetroffen. Dafür aber konnte er den Tag mit den früheren Nachbarn, seiner alten Aufwartefrau und einigen anderen Bekannten verbringen. »Und das war für mich etwas ungeheuer Gutes, gewisse Menschen wiederzusehen, die zu mir damals gut und nachsichtig waren«, schreibt er an Theo. Im November wird er sogar zwei Tage in Arles bleiben, auch Herrn Salles wiedersehen, die Miete für die eingestellten Möbel begleichen und einige Farben einkaufen, obwohl diese sonst mitsamt der vielen Leinwand immer durch den Bruder in Paris bestellt werden (Père Tanguy gehört noch immer zu den Lieferanten). Aber da Vincent offenbar auch an eine Rückkehr nach Arles denkt, scheint es ihm gut, »sich von Zeit zu Zeit dort zu zeigen, damit die Geschichte mit den Leuten nicht noch einmal vorkommt. Niemand hat jetzt etwas gegen mich. Im Gegenteil, sie waren sehr liebenswürdig und luden mich sogar zum Essen ein ...«, heißt es in einem Brief an den Bruder, und es ist anzunehmen, daß er diese zweite Reise nach Arles ohne Begleitung aus der Anstalt unternahm. Aber es gibt auch Tage, wo er unter einer grauenvollen Melancholie leidet und an sein Zimmer gefesselt ist. Da legt sich die unheimliche Stimmung dieses Hauses wie ein schwerer Alpdruck auf seine Seele und in solchen Stunden verfolgen ihn sogar religiöse Wahnideen und der Trübsinn überkommt ihn mit immer größerer Gewalt. Einmal – im September – ist er lange nicht vor die Tür gekommen (offenbar nach einem neuen Anfall), und in solchen Tagen denkt er ernsthaft an einen Weggang von St. Remy, zumal ihm Theo bereits von Pissarro geschrieben hat, der in Auvers wohnt und vielleicht bereit wäre, ihn bei sich aufzunehmen und der Pflege eines gewissen Dr. Gachet anzuvertrauen, der ein alter Freund der Impressionisten ist und sich in seinen Mußestunden selbst künstlerisch betätigt. Aber dieser Gedanke wird vorerst nur obenhin gestreift und es werden noch Winter und Frühling dahingehen, bevor er in die Tat umgesetzt wird. An Verkehr mit Menschen fehlt es Vincent vollkommen. Herr Peyron ist zwar gut zu ihm, aber er ist offenbar ohne jene Aufgeschlossenheit, die ihm einmal Dr. Rey entgegengebracht hat; auch scheint er die Kranken am liebsten sich selbst zu überlassen, denn Vincent spricht ihn nur selten, dafür aber berichtet der Arzt regelmäßig an Theo, den er Ende September in Paris aufsucht. Zuweilen geht Vincent auch ins »Dorf« – so nennt er die kleine Stadt –, aber beim ersten Ausgang dorthin, damals offenbar in Begleitung eines Wärters oder einer der vielen Krankenschwestern, »bewirkte schon der Anblick der Menschen und der Dinge, daß ich einer Ohnmacht nahekam und mich sehr schlecht befand«, schreibt er Anfang Juni an den Bruder, aber dieses Erschrecken vor der Realität verliert sich, und je mehr ihn die Arbeit gefangennimmt, umso stärker holen auch die seelischen Energien in ihm auf. Hätte er nur den lieben alten Roulin in der Nähe, der ihn damals wie ein Vater betreute, der so »kindlich weise und feinfühlig gläubig« ist, der für ihn jene »stille Gewichtigkeit und Zärtlichkeit hatte, wie sie vielleicht ein alter Soldat für einen jungen besitzt«. Aber es gibt keinen Roulin in St. Remy und der Oberwärter, dessen Bild er in Kürze malen wird, und ebenso das seiner Frau, hat zwar einen interessanten Kopf, der etwas von Andacht widerspiegelt, aber er ist wohl einer von denen, die das Leben und das ungeheure Sterben und Leiden, das er während zweier Choleraepidemien im Marseiller Spital sah, abgestumpft hat. So ist Vincent im ganzen wieder einmal der namenlosen Einsamkeit preisgegeben, und oft überfällt ihn dumpfe Mutlosigkeit, die er nur durch Arbeit bezwingen kann. Freilich, die Natur da draußen ist herrlich und der Gesang der vom guten Sokrates so geliebten Zikaden an den heißen Sommertagen kann ihn zutiefst erschüttern. Er erinnert ihn an das Zirpen der Heimchen am Ofen der holländischen Bauern, und er meint in diesem Zusammenhang zu seinem Bruder: »Mein Lieber, vergessen wir nicht, daß die kleinen Rührungen die großen Kapitäne unseres Lebens sind und wir ihnen, ohne es zu wissen, folgen.« Ja, wenn er die Natur nicht hätte, diese wunderbare Landschaft mit den Kornfeldern, den Olivenbäumen und Zypressen, die »in den Linien und Verhältnissen so schön sind wie ein ägyptischer Obelisk« und die blaue Kette der Berge in der Ferne! Diese Bilder rufen zur Arbeit und Vincent »pflügt wirklich wie ein Besessener«. Er ist ja in den Süden gegangen, um ein anderes Licht zu sehen, er wollte eine stärkere Sonne sehen, »weil die Farben des Prismas im nordischen Nebel verschleiert sind«, aber diesen Süden sieht er dennoch ganz mit seinen »nordischen Augen«.

7. Heuhaufen bei Arles. Juni 1888. Amsterdam, Rijksmuseum
Anfangs malt Vincent vor allem in seinem Atelier Blumenstilleben, dann draußen den Garten der Anstalt, aber schon im Juni beginnt er mit den Landschaften, zunächst die, die er vom Fenster seines Schlafzimmers aus mit dem Blick umgreifen kann, eine »Landschaft von äußerster Einfachheit mit einer großen weißgrauen Wolke, die in das Himmelsblau untertaucht«, dann aber locken ihn die Umgebung, die Olivenbäume und vor allem die Zypressen. Gegen Ende Juni hat er bereits 12 Bilder auf der Staffelei stehen, und bald werden es wieder 30, ja 50 und mehr sein. Auch die Bilder aus Arles werden zwischendurch neubearbeitet oder nochmals gemalt, wie die »Postkutsche von Tarascon«, die eine Erinnerung an Daudets berühmten »Tartarin« ist, den Vincent besonders liebt, ferner der »Weinberg«, die »Ernte«, das »Rote Wirtshaus« und wohl zum dritten- oder viertenmal das »Nachtcafé«, das er selbst das charakteristischste seiner Bilder nennt. Im September, als er nach einer neuen schweren Krisis in seinem Zimmer eingeschlossen ist und Herr Peyron ihm das Malen draußen verboten hat, wird er zwei Selbstbildnisse in Angriff nehmen »aus Ermangelung eines anderen Modells. Das eine ist blau-violett, der bleiche Kopf mit gelben Haaren«, das andere in Dreivierteldrehung auf hellem Grund. In diesen Wochen überkommt ihn besonders stark das Gefühl völliger Verlassenheit. »Man muß hier Schluß machen«, schreibt er im Oktober an Theo, »ich kann nicht mehr zwei Dinge auf einmal, arbeiten und mir tausendfach Mühe geben, mit diesen komischen Kranken zu leben; das bringt einen auf den Hund. Ich gebe mir umsonst Mühe, hinunterzugehen. Nun sind es zwei Monate, daß ich nicht an der Luft war.« Inzwischen ist Dr. Peyron bei Theo in Paris gewesen, und da eine neue Krise zunächst nicht zu befürchten ist und auch kaum vor Winter wiederkehren dürfte, kann Vincent seine Arbeit im Freien wieder aufnehmen. Offenbar hat ihm der Bruder Hoffnung auf eine Pariser Anstalt gemacht und auch wieder an Vater Pissarro erinnert, und das hat seine Arbeitswut von neuem angefeuert. Denn schon sehr bald kündigt er dem Bruder eine weitere Kiste mit Bildern an, ein Porträt und acht Landschaften, darunter die »Mondnacht mit dem Heuschober«, das »grüne Kornfeld«, »Olivenbäume« und »Steinbruch«. Und die nächste umfangreichere Sendung folgt bereits in wenigen Wochen, und darin befinden sich u. a. der »Mäher«, das »Kornfeld mit Zypressen«, der »Mondaufgang« und vier oder fünf kleinere Bilder, die Vincent der Mutter und Schwester in Holland verehrt, an die er gerade in dieser Zeit immer mit besonderer Zärtlichkeit denkt. Auch ein kleines Selbstporträt ist für die Mutter bestimmt. Solange draußen die wundervollen Herbsttage sind, gibt es für ihn keine Ruhe von der Arbeit, und wenn das Wetter einmal weniger gut ist, dann malt er den Park und das Irrenhaus, das er so rekonstruiert, daß alle Bitternis auf diesem Bilde schweigt. Ähnlich hat er auf einem »Alpenbild« die Fernsicht des Gebirges ganz in die Nähe gerückt, diese Alpen »des guten Tartarin«, die der Bruder bisher nur im Hintergrund der Bilder vorüberziehen sah, und auch eine wilde Schlucht, ganz in Violett getaucht, steht auf der Staffelei. Aber leider sind die Tage schon recht kurz, und die Abende sind »sterbend öde. Mein Gott, die Aussicht auf den Winter macht nicht froh«. Aber auch die Kälte wird ihn nicht abhalten, im Freien zu malen. Eine Regenstimmung gibt neue malerische Effekte, und die großen Pinien am Abend künden von einer Melodie, die beinahe nordisch anmutet. Ja, Vincent hat längst seinen eigenen Stil gefunden. »Das Gesamte einer Landschaft zu fühlen, so wie es Cézanne konnte«, das ist nach seiner Meinung der springende Punkt. Und die Provence strömt einen ähnlichen Erdgeruch aus wie die ferne Heimat. Was im Norden die Weide ist, dieser Raum, »der vollkommen den Charakter des Landes enthält«, das sind drunten im Süden die Zypressen und Oliven. Auch in ihnen wird man die Erde fühlen, und das Bild mit den Frauen, die die Oliven pflücken, die er im Atelier nach einer Studie malt, die er draußen gemacht hat, wird alle Musik der Farben zu einer Melodie zusammenstimmen: das Violett des Erdbodens, der sich in der Ferne ins Ockergelbe verliert, die bronzenen Stämme der Oliven mit dem graugrünen Blätterwerk, das verklingende Rosa des Himmels, das auch die drei Gestalten aufsaugt, wahrhaftig, solche Bilder kann man sogar aus der Erinnerung malen, die die Zeit verschönt hat, und wenn man erst ein halbes Dutzend Studien nach Olivenbäumen gemacht hat. Auch der gelbe Maulbeerbaum gegen den blauen Himmel strömt diesen Erdgeruch aus, und vielleicht hat Vincent gerade an diese Bilder gedacht, als er dem Bruder gegenüber bemerkt: »Wenn man dauern will, muß man so anspruchslos wie ein Bauer arbeiten.« In den gleichen Spätherbsttagen hat er auch ein Bild vom Ort gemalt, den sogenannten »Boulevard von St. Remy« mit den ungeheuren nackten Platanenstämmen vor den Häusern, den Sandhaufen und Steinen am Wege, den Arbeiter ausbessern. Selbst der Novembermistral kann ihn von der Arbeit im Freien nicht abhalten. Gegen Abend, wenn der Wind nachzulassen beginnt und die Sonne im Westen versinkt, gibt es »wundervolle Effekte, einen zitronenbleichen Himmel gegen die verzweifelten Pinien; ihre Umrisse geben Wirkungen von wunderbarer schwarzer Härte. Ein anderes Mal ist der Himmel rot, ein anderes Mal ist er äußerst fein getönt, neutral, eine bleiche Zitronenfarbe, aber durch zartes Lila neutralisiert«. Wie reich doch dies Land ist an malerischen Stimmungen und Motiven. Ein Malerauge kann sich nicht satt trinken an diesem strömenden Quell der verzauberten Natur, und es gibt nicht Farben und Leinwand genug, um all das im Bilde festzuhalten. Aber plötzlich versagen die physischen Kräfte, mitten in der Arbeit überkommt ihn gegen Ende Dezember ein neuer Anfall und wieder ist Vincent für einige Wochen an sein Zimmer gefesselt. Aber selbst in dieser Zeit kommen ihm noch eine Menge neuer Gedanken für Bilder. »Ah, während meiner Krankheit fiel nasser Schnee«, so schreibt er an Theo, »ich stand nachts auf, um die Landschaft zu betrachten. Niemals erschien mir die Landschaft so rührend und sensitiv.« Gegen Ende des Jahres geht wieder eine Kiste mit Bildern an den Bruder, die die ganze künstlerische Ernte der letzten Monate enthält, darunter zwei Kopien nach Millets »Die Grabenden« und »Die Abendstunde«. Die hat Vincent in den Tagen gemalt, als er draußen nicht arbeiten konnte, angeregt von den Reproduktionen, die ihm der Bruder gesandt hat. Aber diese Bilder sind keine Kopien im üblichen Sinn, sondern Neuformungen, eingetaucht in die Musik eigenartiger Farbakkorde ohne den sonst geübten »dicken Auftrag, in einer vereinfachten Technik, bei der eine getuschte Zeichnung die Grundlage bildet, die dann von Farbflecken und farbigen Schraffierungen überzogen wird, was dem Ganzen eine besondere Atmosphäre gibt«. Ja, dies Kopieren wird für Vincent eine durchaus schöpferische Arbeit sein, die er als persönliche Interpretation eines Kunstwerkes empfindet, so wie ein Musiker etwa Beethoven in der ihm eigenen persönlichen Deutung spielt. Auch die »Fähigkeit für die Figur«, die er sonst leider nicht mehr üben kann, weil ihm die Modelle fehlen, erhält durch diese Arbeit neuen Auftrieb; im übrigen aber sind diese Kopien mehr Erinnerungen oder gar Improvisationen in Farben, die ganz aus dem persönlichen Gefühl erwachsen, »gleichgültig, ob sie richtig sind«. Und nach Millet wird er die Pietà von Delacroix malen als eine wundervolle Symphonie von Blau und Gelb, danach die »Trinker« von Daumier und das »Bagno« von Doré und schließlich im Frühjahr, noch kurz vor seinem Weggang von St. Remy, nach der Radierung von Rembrandt »Die Auferstehung des Lazarus« und von Delacroix den »Barmherzigen Samariter«. Diese Bilder nach den Werken der von ihm so heiß geliebten Meister können zwar die Flamme nicht dämpfen, die sein Herz verzehrt, aber sie tragen ihr Teil dazu bei, jene völlige Mutlosigkeit zu mildern, die ihn nur zu oft überkommt. Immer deutlicher wächst in ihm die Erkenntnis, daß er nicht mehr lange in dieser Umgebung bleiben kann, und als er zu Beginn des neuen Jahres den Besuch von Herrn Salles erhält, schärft er diesem wiederholt ein, niemals mehr diese Anstalt zu empfehlen. Wieder denkt er an seinen Freund Roulin in Marseille, dem er zwei Landschaften als Geschenk übermittelt, mit Olivenbäumen die eine, die andere »ein Kornfeld mit lila Bergen im Hintergrund und einem schwarzen Baum«, und es ist kein Zweifel, daß der getreue Postbote diese unverhoffte Gabe in dankbarer Rührung entgegengenommen hat. Auch Dr. Peyron hat er ein Bild verehrt, eine Ansicht mit einer großen Pinie davor, und dies beweist zur Genüge, daß er seinem Arzt gegenüber eine gewisse Dankbarkeit empfindet.
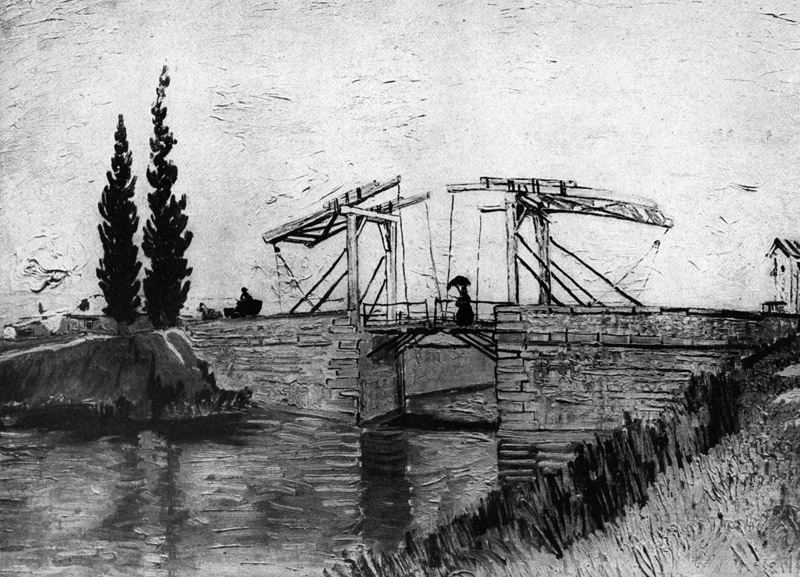
8. Zugbrücke bei Arles. Frühjahr 1888. Köln,Wallraf-Richartz-Museum
Das neue Jahr hat für Vincent glückverheißend begonnen. Theo ist im Januar Vater eben jenes Jungen geworden, der den Namen seines Onkels tragen wird. Nicht nur der Bruder, auch die Schwägerin Jo als glückliche Mutter haben Vincent die freudige Nachricht übermittelt, und zum erstenmal hat in diesen Tagen auch die Öffentlichkeit von dem Schaffen des Malers Notiz genommen. Der angesehene Kritiker Albert Aurier hat im »Mercure de France« Vincents Schaffen beleuchtet, der zwar das Lob übertrieben findet, aber doch sichtlich davon berührt ist. Dem Neffen wird er alsbald ein Bild malen, das über seinem Bett hängen soll, und der Artikel von Aurier ermutigt ihn noch mehr, »von der Wirklichkeit wegzugehen und eine gewisse Farbenmusik zu schaffen«, die die Wahrheit trotzdem nicht verleugnet. Ja, ein Wunder ist geschehen: Theo meldet ihm im Februar den ersten Verkauf eines Bildes in Brüssel um den Preis von 400 frcs., und von diesem Gelde möchte Vincent nach Paris fahren, um den Bruder wiederzusehen, wie er der Mutter gesteht, und er bemerkt ausdrücklich: »Ich muß dem Arzt hier so dankbar sein, denn ich gehe viel ruhiger aus dem Süden weg, als ich ankam.« Oh, diese Sehnsucht nach den Lieben in Paris und im fernen Holland. Sie verzehrt ihn in den Stunden besonders stark, wenn Melancholie sein Gemüt beschattet. Er weiß in solchen Augenblicken nicht mehr, was er tun und denken soll, nur, daß er nicht länger mehr in der Anstalt bleiben kann, wird ihm von Tag zu Tag mehr bewußt. Der Kummer frißt an seiner Seele, der Trübsinn ist so stark, daß ihm oft sogar der Mut fehlt, die Briefe zu lesen, die er von Hause bekommt. Nur die Arbeit vermag ihn noch aufrecht zu halten. Inzwischen hat der Frühling von neuem Besitz von der Landschaft genommen, die Bäume stehen in Blüte. Er malt zwei blühende Äste, eine Arbeit, woran er »am geduldigsten saß«, und wenn er draußen vor seiner Staffelei steht, »gehen die Pinselstriche wie mit der Maschine«. Im Park malt er zwei Bilder von frischem Gras. »Darin liegt die äußerste Einfachheit. Ein Kiefernstamm violett-rosa, das Gras mit weißen Blumen und Löwenzahn, ein kleiner Rosenbaum und andere Baumstämme im Hintergrund.« Auch neue Stilleben hat der Frühling angeregt. Ein Bild mit Rosen auf hellgrünem Hintergrund und zwei Irissträuße, der eine gegen einen rosanen, der andere vor einem grellgelben Fond. Das sind die letzten Bilder aus St. Remy, und da sie gut einen Monat trocknen müssen, wird der Wärter sie später nach Auvers schicken.
Mitte Mai ist es endlich soweit. Theo hat an Herrn Peyron geschrieben und sich auch mit Dr. Gachet verständigt. Vincent hat jede Begleitung auf der Reise abgelehnt. So froh ihn die Aussicht auf die neue Freiheit macht, die Abkehr vom Süden weckt dennoch Trauer. Denn seine Arbeit hat dort unten »auch mehr Kraft gewonnen und es wäre undankbar, wenn ich über den Süden übel redete, ich gestehe, ich bin sehr traurig, mich davon abzukehren«, gesteht er Theo in seinem vorletzten Brief aus St; Remy, und am 14. Mai schreibt er wörtlich: »Als ich diesen Morgen meinen Koffer aufgab, sah ich die Felder wieder. Sie waren nach dem Regen frisch und voll Blumen. Welche Dinge hätte ich hier noch machen können – – – – Ich fühle mich kräftig genug, um in Paris meinen großen Wunsch zu erfüllen, eine gelbe Buchhandlung (Gasbeleuchtungseffekt) zu machen. Das geht mir schon lange im Kopf herum. Du wirst sehen, den ersten Tag nach meiner Ankunft bin ich wieder an der Arbeit ...« Und in einem PS zu diesem Brief: »Alles geht gut, und man wird in Freude auseinandergehen.«
Das Jahr im Irrenhaus von St. Remy aber bedeutet in Vincents Werk den Höhepunkt. In der völligen Abgeschiedenheit von der Welt hat sich des Künstlers Blick noch mehr nach innen gekehrt. Die Glut seiner Farben, der flackernde Strich seines Pinsels haben ein Äußerstes erreicht. Im scheinbar Endlichen der Dinge spiegeln seine Bilder das Unendliche wider. In den züngelnden Zypressen rollt jener kosmische Donner, der das Geheimnis der Schöpfung aufreißt und die Natur zu einem Gleichnis der Ewigkeit macht. Selbst das Milieu, in dem Vincent zu leben gezwungen ist, jene makabre Stimmung des Hauses, die dumpfe Verlassenheit und oft auch aufwühlende Turbulenz einer Stätte, die Grauen verbreitet, kann die Flamme nicht löschen, die in der Seele des Künstlers lodert. So erleben wir den Kampf des gänzlich Einsamen, in dem sich die Kraft des Nordens am Zauber des Südens entzündet, wie den Aufbruch eines Titanen, der Antäus gleich, diesem Boden verhaftet ist, der mitgerissen vom magischen Strom dieser Erde, aufgewühlt vom Licht der heißen Sonne sich selbst vergißt, um das Wunder zu bannen, das sich in Farben vor ihm auftut. Wie Flammen züngeln die Pinselstriche auf der Leinwand. Flammen sind die Zypressen und Berge, und mit der Flammenschrift seiner gemarterten Seele schreibt Vincent das ewig unvergängliche Lied einer Landschaft, einer in Farbe übersetzten Vision der Jahreszeiten.
Am 17. Mai in der Frühe ist Vincent wohlbehalten in Paris angekommen. Theo, der in der Cité Pigalle wohnt, hat den Bruder an der Gare de Lyon abgeholt und ihn in der Droschke nach Hause gebracht. Fröhlich winken die beiden der oben am Fenster harrenden Jo zu. Glückliche Begegnung mit der Schwägerin, stumme Ergriffenheit Vincents vor der Wiege, in der der kleine vier Monate alte Erdenbürger schläft, kritisches Betrachten seiner Bilder, die überall an den Wänden hängen, und der Unzahl von Zeichnungen, die auf dem Boden ausgebreitet werden. Aber über St. Remy wird nicht mehr gesprochen. Es gibt viel Besuch im Haus, aber Vincent drängt nach Auvers. Bereits am 21. ist er in jenem kleinen Dorf an der Oise, das eine Stunde Bahnfahrt entfernt nordwestlich von Paris gelegen ist. Wir kennen das Dorf mit den Strohdächern der Bauernhäuser und dem ländlichen Gasthof, in dem Vincent wohnt, aus vielen Bildern dieser letzten zwei Monate. So die Mairie mit den Wimpeln der bunten Tricolore, die Vincent am Nationalfeiertag, den 14. Juli, malen wird; das alte Schloß am Rande des Dorfes mit dem weiten Wiesenland davor, überschattet von den Zweigen eines knorrigen Stammes und einer mächtigen Baumgruppe weiter links, dann den Garten Daubignys mit dem rosa getünchten Haus im Hintergrund und seinem bläulichen Ziegeldach, rechts davon die alte Dorfkirche mit dem Steildach und dem viereckigen Turm (Vincent selbst nennt dieses Bild, das eines seiner letzten sein wird, »eine meiner stärksten Arbeiten«) – weiter die von einem schmalen Häuserkranz begrenzte Wegstiege in Auvers, die als mächtige Diagonale auf die Dorfstraße mündet, die von einigen Gestalten belebt ist; und endlich die von welligen Wiesen und niedrigen Hügeln belebte Landschaft, über der sich der blaue Himmelsdom mit weißen Geisterwolken wölbt, oder jenes gelbe Getreidefeld, aus dem die schwarzen Raben gegen einen schweren dunkelblauen Himmel aufsteigen, in dem ein paar mit Spachtel gehämmerte helle Kreise vom Scheiden des Tages künden, Vision einer Landschaft, die nahen Tod kündet und Vincents letztes Bild sein wird.
Auch in Auvers entstehen noch einige köstliche Stilleben, wie jene Feldblumensträuße aus Disteln, Ähren und Blättern, ganz in Rot getaucht der eine, der andere grün und ein dritter vorwiegend gelb untermalt. Unter den Porträts dieser Zeit allen voran das des Dr. Gachet, »dessen Gesicht den schmerzlichen Ausdruck unserer Zeit hat«, der im blauen Frack vor einem kobaltblauen Hintergrund, die Reisemütze auf dem rothaarigen Kopf, die Rechte auf die rotgemusterte Tischdecke aufstützt, vor sich zwei Bücher in gelbem Umschlag und eine Digitalis mit purpurnen Blüten im Glas. Dann das Bild von Fräulein Gachet, die vor dem Klavier sitzt, und das Porträt eines jungen Mädchens von sechzehn Jahren, blau gegen blau gemalt. Das ist die Tochter der Wirtsleute, bei denen Vincent wohnt. Der ist oft in dem Hause jenes Dr. Gachet zu Gast, das auf einem Hügel gelegen, etwas von jener halbdunklen Verwunschenheit hat, wie sie uns in alten Ritterromanen begegnet. Ein Sonderling ist dieser Doktor, halb Gelehrter, halb Künstler, der sich in seinem mit Antiquitäten und Bildern vollgestopften Haus mit den niedrigen Fenstern ein Atelier eingerichtet hat, in dem auch eine Presse steht, auf der er Radierungen druckt. Der wird Vincents letzter und bester Freund, ein Arzt, wie ihn der Kranke braucht, ein Philosoph, der an den Erfahrungen seines Lebens früh gealtert ist, und einer der Ersten, der Vincents künstlerische Größe voll erkannt hat. Der redet seinem Freunde sogar ein, daß nur der Süden die schlimme Krankheit verursacht habe und daß die Rückkehr in den Norden ihn bald gesund machen wird. Immer wieder lädt er Vincent zum Essen bei sich ein, ermuntert ihn auch, in seinem Atelier zu malen, und ist von jedem Bild, das Vincent malt, ehrlich begeistert. Als endlich auch die letzten Bilder aus St. Remy eintreffen, wird Dr. Gachet sie als erster bewundern, um sogleich eine zweite Fassung der Pietà nach Delacroix von ihm zu erbitten. Aber leider ist der Arzt kein Hexenmeister, immerhin, Vincents Arbeitsfreude ist von neuem erwacht und das schreckliche »Angstdrücken« scheint überwunden zu sein. Welch ein glücklicher Tag, als Anfang Juni Theo mit den Seinen nach Auvers kommt. »Dieser Sonntag«, so gesteht Vincent dem Bruder, »hinterließ mir eine sehr schöne Erinnerung«, und beim Scheiden hat man verabredet, daß Vincent bald noch einmal nach Paris kommen soll, um einige Bekannte wiederzusehen und erneut Umschau unter seinen Bildern zu halten. Aber auch diesmal bringt ihm Paris kein Glück. Die Besuche des Kritikers Aurier und selbst des lustigen Toulouse-Lautrec ermüden ihn sehr, und als er nach wenigen Tagen schon nach Auvers zurückkehrt, stürzt er sich zwar sofort von neuem in die Arbeit, »aber der Pinsel fiel mir fast aus den Händen«, schreibt er am 25. Juli an Theo. Vorher heißt es: »Mein Leben wurde bei der Wurzel angeschlagen, und mein Schritt ist schwankend«. Und am Schluß seines letzten Briefes an den Bruder vom 27. Juli stehen die Worte: »Nun, meine Arbeit gehört Dir. Ich setzte dafür mein Leben ein, und meine Vernunft ging dabei zur Hälfte drauf.« Am Abend dieses Tages leiht sich Vincent von Bekannten einen Revolver, angeblich, um auf dem Felde draußen Raben zu erlegen, lehnt sich an einen Baumstamm und schießt sich in die Brust. Hatte ihn doch die Melancholie überwältigt, fühlte er das Herannahen eines neuen Anfalls? Dr. Gachet nimmt den Schwerverletzten in seine Pflege, benachrichtigt Theo, der sogleich nach Auvers fährt. Der findet Vincent noch bei Bewußtsein. »Ich wünschte, ich könnte nun heimgehen«, gesteht er dem Bruder, bevor ihn am 29. Juli in der Frühe der Tod überwältigt. »O Mutter, er war so ganz mein Bruder«, schreibt Theo. Acht Freunde kommen aus Paris und anderen Orten mit Kränzen und Blumen, schmücken das Zimmer, in dem der Entschlafene ruht, mit seinen Bildern, und der treue Dr. Gachet legt einen Strauß Sonnenblumen auf den Sarg, »weil Vincent sie so sehr geliebt hat«. Auf dem kleinen Friedhof von Auvers, der mitten in den Getreidefeldern liegt, sieht man das Grab von Vincent und Theo, der seinem Bruder sechs Monate später im Tode gefolgt ist: Ein ewiges Gleichnis brüderlicher Treue.