
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

10. Segelboote bei Saintes-Martes. Rohrfederzeichnung. Juni 1888. Berlin. Nationalgalerie
London, 20. Juli 1873
... Die englische Kunst zog mich im Anfang nicht sehr an; man muß sich daran gewöhnen. Es gibt hier jedoch tüchtige Maler, unter anderen Millais, der den Hugenotten, Ophelia etc. gemalt hat, wovon Du die Gravuren wohl kennen wirst, das ist alles sehr schön. Dann Boughton, von dem Du die »zur Kirche gehenden Puritaner« in unserer »Galerie photographique« kennst; von ihm habe ich sehr schöne Sachen gesehen. Ferner unter den alten Malern Constable, ein Landschaftsmaler, der etwa vor 80 Jahren lebte. Er ist herrlich und hat etwas von Diaz und Daubigny; und Reynolds und Gainsborough, die vor allem sehr, sehr schöne Frauenportraits gemalt haben; und dann Turner, nach dem Du viele Gravuren gesehen haben wirst. –
Es wohnen einzelne französische Maler hier, unter anderen Tissot, nach dem verschiedene Photographien in unserer »Galerie photographique« sind, Otto Weber und Heilbuth. Der letztere malt augenblicklich herrlich schöne Bilder in der Art des Jak. von Linder.
Du mußt mir gelegentlich einmal schreiben, ob es Photographien nach Wouters gibt, außer Hugo van der Goes und Maria von Burgund, und ob Du Photographien kennst nach Bildern von Lagey und de Braekeleer. Das ist nicht der alte Braekeleer, den ich meine, sondern wie ich glaube, ein Sohn von ihm, der auf der letzten Ausstellung in Brüssel 3 prächtige Bilder hatte, betitelt: »Anvers«, »l'école« und »l'Atlas«.
Es geht mir gut hier, ich gehe viel spazieren; es ist hier, wo ich wohne, eine stille, angenehme und frische Gegend; ich habe das wirklich gut getroffen.
Dennoch denke ich manchmal mit Wehmut an die herrlichen Sonntage in Scheveningen etc., habe aber deshalb nicht getrauert.
Du wirst sicher gehört haben, daß A. zu Hause und nicht wohl ist, ein schlechter Anfang ihrer Ferien; wir wollen jedoch hoffen, daß sie nun bereits wieder besser ist.
Vielen Dank für das, was Du mir über Bilder geschrieben hast. Wenn Du jemals was von Lagey siehst, von de Braekeleer, Wouters, Marie Tissot, George Saal, Jundt, Ziem und Mauve, so mußt Du mir das vor allen Dingen schreiben; das sind Maler, von denen ich sehr viel halte und von denen Du wahrscheinlich einmal was sehen wirst.
Anbei eine Kopie jenes Verses von dem bewußten Maler, »der da fraß in der Herberge, wo er einquartiert war«, dessen Du Dich wohl erinnern wirst.
Das ist echt Brabant, ich liebe diese Verse. Lies schrieb sie mir ab den letzten Abend, den ich zu Hause war.
Wie gerne möchte ich Dich einmal hier haben; welch herrliche Tage haben wir im Haag zusammen verlebt, ich denke noch so oft an den Spaziergang auf dem Ryswykschen Weg, wo wir nach dem Regen an der Mühle Milch getrunken haben. – Wenn die Bilder, die wir noch von Euch haben, zurück gehen, schicke ich Dir ein Bild dieser Mühle, von Weißenbruch, Du erinnerst Dich vielleicht wohl, »de vrolyke Weis« ist sein Spitzname: »prrrachtig zal ik maar eens zeggen«. –
Dieser Ryswyksche Weg hat für mich Erinnerungen, die vielleicht die herrlichsten sind, die ich habe. Wenn wir uns einmal wieder sprechen, kommen wir vielleicht darauf zurück. Und nun, lieber Kerl, laß es Dir gut gehen, denke von Zeit zu Zeit einmal an mich und schreibe mir bald einmal; es ist eine Auffrischung für mich, wenn ich einen Brief bekomme.
Vincent

11. Der Briefträger Roulin. August 1888. Vormals Berlin, Dr. I. Freudenberg
London, Januar 1874
Lieber Theo!
Vielen Dank für Deinen Brief.
Von Herzen wünsche ich Dir ein sehr gutes neues Jahr. Ich weiß, daß es Dir im Geschäft gut geht; denn ich hörte es von Herrn Tersteeg. Aus Deinem Brief sah ich, daß Du Herz hast für die Kunst, und das ist ein gutes Ding, mein Kerl. Ich bin froh, daß Du was von Millet, Jacques, Schreyer, Lambinet, Frans Hals etc. hältst; denn wie Mauve sagt: »Das ist das Wahre«.
Ja, das Bild von Millet »l'angelus du soir«, das ist das Wahre, das ist reich, das ist Poesie. Wie gerne möchte ich mal wieder mit Dir über Kunst sprechen, so müssen wir uns nun nur oft darüber schreiben; finde schön, soviel Du nur kannst, die meisten finden nicht genug schön.
Ich setze hierher die Namen von einzelnen Malern, von denen ich besonders viel halte.
Scheffer, Delaroche, Hébert, Hamon, Leys, Tissot, Lagey, Boughton, Millais, Thys Maris, de Groux, de Braekeleer jr., Millet, Jules Breton, Teyen-Perrin, Eugène Feyen, Brion Junot, George Saal, Israels, Knaus, Vautier, Jourdan, Rochussen, Meissonier, Madrazzo, Ziem, Boudin, Gérome, Fromentin, Décamps, Bonnington, Diaz, Th. Rousseau, Troyon, Dupré, Corot, Paul Huet, Jacques, Daubigny, Bernier, Emilie Breton, Chena, César de Cocq, Mlle. Collart, Bodmer, Koekkoek, Schelfhout, Weißenbruch und last not least Maris und Mauve.
Doch könnte ich so fortfahren, wer weiß, wie lange, und dann kommen noch alle die Alten, und ich bin überzeugt, daß ich noch verschiedene der besten Neueren übergangen habe.
Bleibe nur immer dabei, viel spazieren zu gehen und viel von der Natur zu halten, das ist die wahre Manier, um die Kunst mehr und mehr zu begreifen.
Die Maler begreifen die Natur und haben sie lieb und lehren uns sehen.
Und dann gibt es noch Maler, die nichts anderes als Gutes machen, die nichts Schlechtes machen können, ebenso wie es auch einfache Menschen gibt, die nichts tun können, ohne daß es gut ist.
Mir geht es hier gut, ich habe ein herrliches Heim und es ist mir ein großer Genuß, London und die englische Lebensweise sowie die Engländer selbst zu besehen, und dann habe ich die Natur und die Kunst und die Poesie, und wenn mir das nicht genügt, was sollte mir dann genügen! Dennoch vergesse ich Holland und vor allem den Haag und Brabant nicht.
Im Geschäft haben wir sehr viel zu tun, wir sind mit der Inventur beschäftigt, die jedoch in 5 Tagen erledigt sein wird, wir kommen also besser davon als Ihr im Haag.
Ich hoffe, daß Du fröhliche Weihnachtstage gehabt hast wie ich. Nun, mein Kerl, laß es Dir gut gehen und schreibe mir bald; ich habe Dir hier geschrieben, was mir so gerade in die Feder kam, ich hoffe, daß Du daraus klug werden kannst. A Dieu, grüße alle im Geschäft und wenn sonst Jemand anders nach mir fragt, besonders auch alle bei Tante F. und H.
Vincent
London, 31. Juli 1874
Lieber Theo! Ich freue mich, daß Du Michelet gelesen hast, und daß Du ihn so gut verstehst. Solch ein Buch lehrt einen wenigstens einsehen, daß weit mehr in der Liebe steckt, als die Leute meistens dahinter suchen. Dies Buch ist für mich eine Offenbarung gewesen und zugleich ein Evangelium.
»Il n'y a pas de vieille femme!«
Das heißt nicht, daß es nicht alte Frauen gäbe, sondern, daß eine Frau nicht alt wird, solange sie liebt und wiedergeliebt wird.
Und dann solch ein Kapitel wie les aspirations de l'automne, wie reich ist das!
Daß eine Frau ein ganz anderes Wesen ist als ein Mann, und ein Wesen, das wir noch nicht kennen, wenigstens nur sehr oberflächlich, wie Du sagst, – ja, das glaube ich sicher.
Und daß ein Mann und ein Weib eins werden können, ein einziges Ganzes mit zwei Hälften, das glaube ich auch.
Anna hält sich tapfer, wir machen herrliche Spaziergänge zusammen; es ist hier so schön, wenn man nur ein gutes und einfältiges Auge hat ohne viel Balken darin. Aber wenn man das hat, dann ist es überall schön. Vater ist durchaus nicht besser, wenn Mutter auch sagt, daß es so sei.
Gestern erhielten wir einen Brief mit allerlei Plänen (ob wir nicht dieses und jenes probieren wollten), die unausführbar sind und sicher nutzlos sein würden, und zum Schluß sagte Vater doch, daß er es uns überließe etc. etc. Ziemlich seltsam und unangenehm. Theo, aber was tun!
Es ist wie es ist, und was soll ein Mensch dabei tun, wie Jung Jochen sagte.
Das Bild von Thys Maris, welches Herr Tersteeg gekauft hat, muß schön sein, ich habe bereits davon gehört und habe selbst eines ganz in derselben Art gekauft und verkauft.
Meine Lust zum Zeichnen hat hier in England wieder aufgehört, aber vielleicht bekomme ich den einen oder anderen Tag wieder einen Einfall.
Ich lese nun wieder viel.
Wahrscheinlich gehen wir zum 1. Januar 1875 in einen anderen, größeren Laden. Herr Obach ist augenblicklich in Paris, um zu beschließen, ob wir das dortige Geschäft übernehmen sollen, oder nicht.
Sage dies im Augenblick noch zu niemandem.
Laß es Dir gut gehen und schreibe bald wieder.
Anna hat ziemlich viel Vergnügen an Bildern und sieht recht gut, findet z. B. Boughton, Maris und Jacques bereits schön. Das beginnt also schon. Entre nous, ich denke, wir werden schwer was für sie finden; man sagt überall, sie sei zu jung und man verlangt auch Deutsch; aber wie es auch sei, sie hat sicher mehr Aussicht hier als in Holland.
A Dieu
Vincent
Du kannst Dir denken, daß ich es herrlich finde, mit Anna hier zu sein. Sage Herrn T., daß die Bilder in gutem Zustand angekommen sind, und daß ich ihm schleunigst schreiben werde.

12. Sonnenblumen. August 1888. München, Staatagalerie
London, 25 Bedfordstreet, Strand. 6. April 1875
Lieber Theo! Vielen Dank für Deinen Brief. Ich habe doch »Meeresstille« von Heine in Dein Büchelchen geschrieben? Vor einiger Zeit sah ich ein Bild von Thys Maris, welches mich daran erinnerte.
Eine alte holländische Stadt mit Reihen braunroter Häuser mit weißen Treppengiebeln und hohen Vortreppen, grauen Dächern und weißen oder gelben Türen, Fensterrahmen und Dachleisten; Grachten mit Schiffen und eine große, weiße Aufziehbrücke, unter welcher gerade eine Schute, mit einem Manne am Steuer, passiert. Das Häuschen des Brückenwächters, den man durch das Fenster in seinem Kontor sitzen sieht.
Etwas weiter eine steinerne Brücke über die Gracht, über welche Leute und eine Karre mit weißen Pferden gehen.
Und überall Bewegung; ein Arbeiter mit seiner Schubkarre, ein Mann, welcher gegen das Geländer lehnt und ins Wasser sieht, Frauen in Schwarz mit weißen Mützen.
Im Vordergrund ein Kai mit Pflastersteinen und einem schwarzen Geländer.
In der Ferne ragt ein Turm über den Häusern auf. Eine grauweiße Luft über allem.
Es ist ein kleines Bild, in Hochformat.
Der Gegenstand ist beinahe derselbe wie der große J. Maris, Amsterdam, den Du wahrscheinlich kennst; allein dies ist Talent und das andere Genie.
Ich habe wieder einiges für Dich abgeschrieben, was ich gelegentlich schicke.
Denke an »La Falaise« und wenn Du vielleicht noch etwas anderes weißt. Das von Victor Hugo ist schön. A Dieu, grüße Vater von mir, wenn Du ihn siehst.
Vincent
Paris, 31. Mai 1875
Lieber Theo! Vielen Dank für Deinen Brief heute morgen. Gestern habe ich die Ausstellung von Corot gesehen. Da war unter anderem ein Bild »Le jardin des oliviers«, ich bin froh, daß er das gemalt hat.
Rechts eine Gruppe Olivenbäume, dunkel gegen die dämmerig blaue Luft, im Hintergrund Hügel mit Gesträuch und ein paar großen Bäumen bewachsen, darüber ein Abendstern. Im Salon sind drei Corots, sehr schön. Von dem schönsten, kurz vor seinem Tode gemalten, »Les bucheronnes«, wird wahrscheinlich ein Holzschnitt in L'Illustration oder Monde illustré kommen.
Wie Du Dir denken kannst, habe ich in den Louvre und Luxembourg gesehen.
Die Ruysdaels im Louvre sind prachtvoll, vor allem le buisson, l'estacade und le coup de soleil.
Ich wünschte, daß Du den kleinen Rembrandt da einmal sähest, die Jünger von Emmaus und die zwei Pendants, die Philosophen.
Letzthin habe ich Jules Breton gesehen mit seiner Frau und zwei Töchtern. Seine Figur läßt mich an J. Maris denken, er hat jedoch dunkles Haar.
Ich schicke Dir gelegentlich ein Buch von ihm, »Les champs et la mer«, in dem alle seine Gedichte stehen. Er hat ein schönes Bild im Salon »Le saint Jean«, Bauernmädels, die an einem Sommerabend um das Johannisfeuer tanzen, im Hintergrund das Dorf mit der Kirche, darüber der Mond.
Donnez, donnez, oh jeunes filles,
En chantant vos chansons d'amour
Demain pour sourire aux faucilles
Vous sortirez au petit jour.
Es sind jetzt drei Bilder von ihm im Luxembourg. Une procession dans les blés, Les glaneuses und Seule.
A Dieu.

13. Provencalische Landschaft. Rohrfederzeichnung. Sommer 1888.
Paris, 6. Juli 1875
Lieber Theo! Dank für Deine Zeilen; ja mein Junge, ich dachte es wohl. Du mußt mir mal schreiben, wie es mit Deinem Englisch steht, hast Du darin noch was getan? Wenn nicht, so ist es auch kein so großes Unglück. Ich habe ein Zimmerchen auf Montmartre gemietet, an dem Du Deine Freude haben wirst; es ist zwar klein, sieht aber auf ein Gärtchen mit Epheu und wildem Wein. Ich will Dir sagen, welche Bilder ich an der Wand habe: Ruysdael – Gebüsch und Bleiche; Rembrandt – Bibellesen (Eine große, altholländische Stube, abends eine Kerze auf dem Tisch; eine junge Mutter an der Wiege ihres Kindes liest die Bibel; eine alte Frau sitzt zuhörend dabei. Es ist etwas, das einen denken macht: »Wahrlich ich sage Euch, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen«. Es ist ein alter Kupferstich, so groß wie das Gebüsch, superb.) Philip de Champaigne: Portrait d'une dame, Corot: soir, dito: dito, Bodmer: Fontainebleau, Bonnington: une route, Troyon: le matin, Jules Dupré: le soir (la traite), Maris: blanchisseuse, dito: un baptême, Millet: les heures de la journée (Holzschnitt 4 Frcs.), Van der Maaten: enterrement dans les blés, Daubigny: l'aurore (coq chantant), Charlet: L'hospitalité (Farm von Kiefern umgeben, Winter, im Schnee; ein Bauer und ein Soldat vor der Türe), Ed. Frère: couturières, dito: un tonnelier.
Nun mein Junge, halte Dich gut; Du weißt es, langmütig und sanftmütig, soweit es möglich ist. Laß uns vor allen Dingen gute Freunde bleiben.
A Dieu.
Vincent
Paris, 4. Dezember 1875
Lieber Theo! Einige Worte in Eile, weil morgen St. Nicolas. Das ist doch ein hübscher Tag in Holland; ich möchte es wohl noch mal sehen. Es ist Zeit, daß es Weihnachten wird, findest Du das nicht auch, wir werden eine Menge zu besprechen haben. Es ist schade, daß Anna nicht auch kommen kann. Ich hoffe so sehr, daß sie dann dort auch gute Tage haben möge; das Christfest in England ist sehr eigenartig und es wird Anna ihre Umgebung noch mehr lieb gewinnen lassen, wenn sie das Fest dort feiert und mithilft, es dort im Hause schön zu machen. Mein werter Engländer (Gladwell heißt er) geht auch für ein paar Tage nach Hause. Du kannst Dir denken, wie er danach verlangt, er ist noch nie vom Hause weggewesen. Schreibe mir bald wieder einmal.
Ist es bei Euch auch so kalt wie hier, Gladwell und ich haben es des Morgens und Abends gut bei unserem Öfchen.
Ich bin wieder aufs Pfeifenrauchen verfallen und es schmeckt mir manchmal wieder wie von alters her.
Grüße alle, die nach mir fragen. Herzlich drücke ich Dir in Gedanken die Hand und bin stets
Dein Dich liebender Bruder Vincent

14. Bauerngarten in Arles. Federzeichnung. August 1888.
Paris, 10. Januar 1876
Lieber Theo! Seit wir uns sahen, schrieb ich Dir noch nicht, es fiel in dieser Zeit etwas vor, was mir nicht ganz unerwartet kam.
Als ich Herrn Boussod wiedersah, fragte ich, ob der Herr es gut fände, daß ich auch dieses Jahr wieder im Hause tätig wäre, und daß er doch nicht viel Ernstliches an mir auszusehen habe. Letzteres war aber wohl der Fall, und er nahm mir förmlich die Worte aus dem Munde und meinte, ich könne am 1. April gehen, dem Schöpfer dankend für das, was ich in ihrem Hause gelernt hätte.
Ist ein Apfel reif, macht ein gelindes Windchen ihn vom Baume fallen, so ist es auch hier; ich habe wohl Dinge getan, die in gewissem Sinne sehr verkehrt waren und habe darum nur wenig zu sagen.
Und nun, mein Junge, was ich beginnen muß, ist mir vorläufig noch ziemlich dunkel, aber wir wollen Hoffnung und Mut zu behalten suchen. Sei so gut, diesen Brief Herrn Tersteeg lesen zu lassen, er darf es wohl wissen, aber es ist, glaube ich, besser, daß Du im Augenblick sonst zu keinem Menschen darüber sprichst und nur tust, als ob nichts im Gange wäre.
Schreibe bald einmal wieder und sei versichert, daß ich stets bin
Dein Dich liebender Bruder Vincent
Paris, 28. März 1876
Lieber Theo! Noch ein einziges Wörtlein, wahrscheinlich das letzte, welches ich Dir hier in Paris schreiben werde. Freitag abend gehe ich wahrscheinlich von hier fort, um Sonnabendmorgen zur selben Zeit wie Weihnachten zu Hause zu sein.
Gestern sah ich etwa 6 Bilder von Michel, wie wünschte ich, daß Du dabei gewesen wärest; Hohlwege durch Sandboden, die zu einer Mühle hinliefen; oder ein Mann, der über die Heide nach Hause geht, mit einer grauen Luft darüber. So einfach und schön; mich dünkt, die Emmaus-Jünger sahen die Natur wie Michel, ich denke immer an sie, wenn ich eines seiner Bilder sehe.
Zugleich sah ich ein Bild von Jules Dupré, und zwar ein sehr großes.
So weit man sehen konnte, schwarzer, morastiger Boden. Auf dem zweiten Plan ein Fluß und auf dem Vordergrund ein Tümpel, daneben drei Pferde. In beiden spiegelt sich die Bank weißer und grauer Wolken, hinter denen die Sonne untergegangen ist; am Horizont etwas Graurot und Purpur, der obere Himmel zart blau.
Es war bei Durand-Ruel, wo ich diese Bilder sah; es sind dort wohl 25 Radierungen nach Millet und ebensoviele nach Michel und nach Dupré und nach Corot und allen anderen Künstlern zu bekommen für 1 fr. das Stück. Das ist verführerisch; einigen nach Millet konnte ich nicht widerstehen, ich kaufte die drei letzten, die von »l'angelus du soir« zu kriegen waren, und mein Bruder erhält natürlich bei Gelegenheit eine davon.
Schreibe mir bald einmal. Grüße bei Roos, sowie Herrn und Frau Tersteeg und alle, die nach mir fragen sollten, und in Gedanken ein Händedruck von
Deinem Dich stets liebenden Bruder Vincent
Ramsgate, 17. April 1876
Bester Vater und Mutter! Die Telegramme habt Ihr sicher schon empfangen, aber Ihr werdet wohl noch mehr Einzelheiten wissen wollen. In der Bahn schrieb ich noch das eine und andere und schicke Euch das; dann könnt Ihr sehen, wie es mir auf der Reise ging!
Freitag.
Wir wollen heute beieinander bleiben. – Was wird besser sein, die Freude des Wiedersehens, oder die Wehmut des Abschieds?
Oft schon nahmen wir Abschied von einander, wohl aber war diesmal mehr Schmerz darin als früher, von beiden Seiten, mehr Mut auch, durch das festere Vertrauen auf Glück und das Bedürfnis danach. Und war es nicht, als ob die Natur mit uns Weh empfände. Es war so grau und mehr oder weniger unfreundlich.
Nun schaue ich über die ausgedehnten Weiden hin und alles ist so stille und die Sonne geht unter hinter grauen Wolken und gießt eine goldene Flut über das Land.
Diese ersten Stunden nach dem Abschied, die Ihr in der Kirche zubringt und ich an der Station und im Zuge, wie verlangen wir da nach einander und wie denken wir an die anderen, an Theo und Anna, an die anderen Schwestern und an das Brüderchen.
Da gerade kommen wir an Zevenbergen vorbei und ich dachte an den Tag, als Ihr mich dorthin brachtet in Pension, und ich vor der Tür bei Herrn Provily stand und Eurem Wagen nachschaute auf dem nassen Weg. Und dann jener Abend, als Vater mich zum ersten Male besuchen kam. Und das erste Nachhausekommen zu Weihnachten.
Sonnabend und Sonntag.
Wie viel habe ich auf dem Boot an Anna gedacht. Alles dort erinnerte mich an unsere gemeinsame Reise.
Das Wetter war klar und besonders auf der Maas war es schön, und auch der Blick auf die Dünen, die weiß in der Sonne glänzten, von der See aus gesehen. Das letzte, was man von Holland sah, war ein graues Türmchen.
Bis Sonnenuntergang blieb ich auf Deck, aber dann wurde es kalt und unfreundlich.
Am nächsten Morgen in der Bahn von Harwich nach London war es schön, in der Morgendämmerung die schwarzen Äcker und grünen Wiesen mit Schafen und Lämmern und hier und da einer Dornenhecke und einzelnen großen Eichen, mit grau bemoosten Stämmen und dunklen Ästen zu sehen.
In der dämmernden blauen Luft blinkten noch einzelne Sterne und eine Bank grauer Wolken lag am Horizont. Schon bevor die Sonne aufging, hörte ich eine Lerche.
Als wir an die letzte Station vor London kamen, ging die Sonne auf. Die Bank grauer Wolken war verschwunden und da war die Sonne so einfach und groß wie nur möglich, eine echte Ostersonne.
Das Gras glitzerte von Tau und Nachtfrost. Dennoch hatte ich das graue Wetter, als wir Abschied nahmen, lieber.
Sonnabend Mittag blieb ich auf Deck, bis die Sonne untergegangen war. Soweit man sehen konnte, war das Wasser tief dunkelblau mit ziemlich hohen Wellen mit weißen Kämmen. Die Küste war bereits außer Sicht, die Luft war hellblau, starr und ohne ein Wölkchen.
Und die Sonne ging unter und warf einen Streifen blendenden Lichtes über das Wasser.
Wohl war es ein großartiger und majestätischer Anblick, aber dennoch, einfachere, stillere Dinge treffen uns viel tiefer.
Von London ging zwei Stunden später ein Zug nach Ramsgate. Das ist noch ungefähr 4 1/2 Stunden Eisenbahnfahrt. Es ist ein schöner Weg; unter anderem kamen wir durch eine Gegend, die hügelig ist. Unten sind die Hügel mit magerem Gras und oben mit Eichengebüsch bewachsen. Es hat viel von unseren Dünen. Inmitten der Hügel lag ein Dorf, die graue Kirche mit Efeu bewachsen, ebenso die meisten Häuser. Die Obstgärten standen in Blüte und die Luft war hellblau mit grauen und weißen Wolken. Wir kamen auch an Canterbury vorbei, einer Stadt, wo noch viel mittelalterliche Gebäude stehen. Vor allem ist eine prachtvolle Kirche dort, umgeben von alten Ulmen.
Schon oft hatte ich auf Bildern etwas von dieser Stadt gesehen.
Ihr könnt Euch wohl denken, daß ich schon lange vorher dasaß und aus dem Fenster ausguckte nach Ramsgate. Gegen ein Uhr kam ich zu Mr. Stokes. Dieser war von Haus abwesend, aber er kommt heute abend zurück. Während seiner Abwesenheit wurde er vertreten durch seinen Sohn (23 Jahre alt, denke ich), Schulmeister in London.
Mrs. Stokes sah ich mittags zu Tisch.
Es sind 24 Jungen dort von zehn bis vierzehn Jahren. Die Schule ist also nicht groß, das Fenster sieht auf die See hinaus.
Es war ein lustiger Anblick, diese 24 Jungen essen zu sehen. Nach dem Essen gingen wir spazieren, an die See; es ist sehr schön dort. Die Häuser an der See sind meist in einfachem gotischen Stil gebaut, aus gelben Steinen, und haben Gärten voll Zedern und anderer dunkler, immergrüner Sträucher.
Der Hafen ist voller Schiffe und eingefaßt mit steinernen Deichen, auf denen man spazieren gehen kann. Und weiterhin sieht man die See in ihrem natürlichen Zustand, und das ist schön.
Gestern war alles grau.
Abends gingen wir mit den Jungen zur Kirche. Auf der Mauer der Kirche stand geschrieben: »Siehe, ich bin bei Euch bis an der Welt Ende.«
Um acht gehen die Jungen zu Bett und um sechs Uhr stehen sie auf. Es ist noch ein Lehrer da von siebzehn Jahren. Dieser, vier Jungen und ich schlafen in einem anderen Hause ganz nahebei, wo ich ein kleines Zimmerchen habe, – da wäre übrigens Platz für einige Drucke an den Wänden.
Und nun genug für heute. Was haben wir gute Tage gehabt. Dank, Dank für alles! Viele Grüße für alle und in Gedanken ein Händedruck von
Eurem Euch liebenden Vincent
Ramsgate, 31. Mai 1876
Lieber Theo! Bravo, daß Du am 21. Mai in Etten gewesen bist, glücklich waren also vier von den sechs zu Hause. Vater schrieb mir ausführlich, wie alles an jenem Tage gewesen war. Ich danke auch für Deinen letzten Brief.
Habe ich Dir schon geschrieben von dem Sturm, den ich kürzlich sah? Die See war gelblich, überall hoch auf dem Strand. Am Horizont ein Streifen Licht und darüber die unsagbar großen dunkelgrauen Wolken, aus denen man den Regen in schrägen Streifen niederfallen sah. Der Wind fegte den Staub des weißen Pfades in die See und bewegte die blühenden Rotdornbüsche und den Goldlack, die auf den Felsen wachsen. Rechts Felder jungen grünen Korns, in der Ferne die Stadt, die mit ihren Türmen, Mühlen, Schieferdächern und gotischen Häusern und unten dem Hafen zwischen zwei in die See hinausragenden Dämmen aussah wie die Städte, welche Albrecht Dürer wohl radierte. – Auch habe ich letzten Sonntag nachts die See gesehen, alles war dunkelgrau, nur am Horizont begann der Tag schon anzubrechen. Es war noch sehr früh, dennoch sang die Lerche bereits. Und die Nachtigallen in den Gärten an der See. In der Ferne das Licht des Leuchtturmes, das Wachtschiff etc. Diese selbe Nacht sah ich aus meinen Fenstern nach den Dächern der Häuser, die man von dort aus sieht, und nach den Gipfeln der dunkel gegen den Nachthimmel stehenden Ulmen. Über diesen Dächern ein einzelner Stern, aber ein großer, schöner, freundlicher.
Und ich dachte an uns alle und ich dachte an meine bereits verflogenen Jahre und an uns zu Hause, und die Worte und das Gefühl kamen in mir auf: »Behüte mich, zu sein ein Sohn, der Schande macht. Gib mir Deinen Segen, nicht weil ich ihn verdiene, aber um meiner Mutter willen. Du bist die Liebe, bedecke alle Dinge.« –
Einliegend eine kleine Zeichnung von dem Blick aus dem Fenster der Schule, durch welches die Jungen ihren Eltern nachsehen können, wenn diese sie besucht haben und wieder zur Station zurückgehen. Mancher wird den Blick aus jenem Fenster nie vergessen. Du hättest es diese Woche, als wir regnerische Tage hatten, einmal sehen sollen, besonders in der Dämmerung, wenn die Laternen angezündet werden und das Licht davon sich in der nassen Straße spiegelt. In jenen Tagen war Mr. Stokes manchmal nicht bei Laune und wenn die Jungen nach seiner Meinung zu viel Lärm machten, so passierte es wohl, daß sie abends ihr Brot und Tee nicht bekamen.
Dann hättest Du sie sehen sollen aus jenem Fenster gucken; es war etwas Melancholisches darin. Sie haben so wenig anderes als ihr Essen und Trinken, worauf sie hoffen, und um von dem einen Tag zum andern zu kommen. Ach ich möchte, daß Du sie einmal über das dunkle Treppchen und den kleinen Gang hindurch zu Tisch gehen sähest. – Danach scheint jedoch die Sonne wieder freundlich. –
Vincent
Isleworth, 5. Juli 1876
Lieber Theo! Es könnten wohl einmal Tage kommen, an denen ich mit einer gewissen Wehmut zurückdenken werde an die »Fleischtöpfe Ägyptens« und an frühere Anstellungen, – z. B. an das Mehr-Geld-Verdienen und in mancher Hinsicht mehr In-Ansehen-Stehen in der Welt – das sehe ich voraus. – Wohl ist Überfluß an »Brot« in den Häusern, wohin ich fortan auf dem Wege, den ich begann, kommen werde, aber kein Überfluß an Geld.
Und doch sehe ich so deutlich Licht in der Ferne, und wenn das Licht dann und wann verschwindet, dann ist das meist meine eigene Schuld.
Es ist sehr die Frage, ob ich es weit bringen werde in diesem Beruf, ob die sechs Jahre, zugebracht im Hause von Messrs. Goupil & Co., in denen ich mich für diese Stellung hätte vorbereiten müssen, mir nicht zeitlebens sozusagen schwer im Magen liegen werden.
Ich glaube jedoch, daß ich in keinem Fall mehr zurückkehren kann, selbst wenn ein Teil meines Ichs (später, jetzt ist das noch nicht der Fall) das wünschen sollte.
Es ist mir in diesen Tagen, als ob es keinen anderen Beruf mehr auf der Welt gäbe als den eines Schulmeisters oder Predigers, mit allem, was dazwischen liegt, als Missionar, London-missionary etc. London-missionary ist wohl ein eigenartiger Beruf, glaube ich, man muß umhergehen unter den Arbeitern und Armen, um die Bibel zu verbreiten, und wenn man einige Erfahrung hat, mit ihnen reden; Fremde, die Arbeit suchen, oder andere Personen, die sich in irgendeiner Verlegenheit befinden, aufspüren und ihnen zu helfen suchen.
Vergangene Woche bin ich ein paarmal in London gewesen, um zu untersuchen, ob die Möglichkeit besteht, das zu werden. Dadurch, daß ich verschiedene Sprachen spreche und besonders in Paris und London noch ziemlich viel mit Menschen ärmerer Klasse und Fremden verkehrt habe, und selbst auch ein Fremder bin, würde ich mich wohl dazu eignen und mehr und mehr dazu geeignet werden können.
Man muß dazu aber mindestens 24 Jahre alt sein und in jedem Fall habe ich also noch ein Jahr vor mir. Mr. Stokes sagt bestimmt, daß er mir kein Gehalt geben kann, da er genügend andere bekommen kann gegen Kost und Logis, und das ist auch so. – Aber wird das durchzuführen sein? Ich fürchte nicht, es wird sich bald genug entscheiden.
Aber, mein Junge, wie dem auch sei, dies meine ich Dir noch einmal sagen zu können, daß die paar Monate mich so an diese Lebenssphäre, halb Schulmeister und halb Prediger, gebunden haben, sowohl durch die damit verknüpften Freuden als auch durch die Dornen, welche mich gestochen haben, daß ich nicht mehr zurück kann.
Also vorwärts! Daß sich sehr eigenartige Schwierigkeiten schon jetzt zeigen und man andere in der Ferne sieht, und daß man hier in einem anderen Element ist als im Geschäft von Messrs. Goupil & Co., das versichere ich Dir.
Bekomme ich die kleine Gravüre, Christus als Tröster und Spender, die Du mir versprochen hast?
Schreibe bald einmal, wenn Du einen Augenblick finden kannst, doch schicke Deinen Brief an Vater und Mutter, da meine Adresse sich möglicherweise bald ändert und sie zu Hause sie wissen werden.
Vorige Woche bin ich in Hampton Court gewesen, um die prachtvollen Gärten und langen Alleen von Kastanien und Linden zu sehen, in denen Scharen von Krähen, Saatkrähen oder Nebelkrähen, ihre Nester haben, sowie um das Schloß und die Bilder zu sehen. –
Da sind unter anderem viele Porträts von Holbein, die sehr schön sind, und zwei schöne Rembrandts (Portrait einer Frau und das eines Rabbi), sowie schöne italienische Portraits von Bellini, Titian, ein Bild von Leonardo da Vinci, Kartons von Mantegna, ein schönes Bild von S. Ruysdael, Früchte von Cuyp etc. etc.
Ich hätte gewünscht, Du wärest dabei gewesen, es war erfreulich, mal wieder Bilder zu sehen.
Und unwillkürlich dachte ich an die Menschen, die auch da in Hampton Court gelebt haben. An Karl I. und seine Frau (sie war es, welche sagte: »Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir fait reine, mais reine malheureuse«, und an deren Grab Bossuet aus der Überfülle seines Herzens sprach. (Hast Du Bossuet's Oraisons funèbres? Darin findest Du die Leichenrede, es gibt eine sehr billige Ausgabe, ich meine zu 50 Centimes) und auch an Lord und Lady Russell, die sicher oft dort gewesen sein werden (Guizot beschreibt ihr Leben in »L'amour dans le mariage«, lies das einmal, wenn Du es kriegen kannst).
Hierbei ein Federchen von einer der Nebelkrähen dort.
Schreibe bald einmal, wenn Du kannst, ich verlange danach und glaube mir, nach einem Händedruck in Gedanken, daß ich stets bin
Dein Dich liebender Bruder Vincent
Trotzdem ich das Gefühl habe, daß ich zu kurz komme und daß in vieler Hinsicht das für diese Stellung Geforderte mir mangelt, habe ich zu gleicher Zeit doch auch so ein Gefühl von Dankbarkeit, von Hoffnung und wie von Erlösung und Freiheit aus allerlei Fesseln, und der Gedanke an Gott bleibt in mir trotz allen Gebrechen, die ich an mir beobachtete, doch stärker und bleibt mir gegenwärtig.
Isleworth, 3. Oktober 1876
Nachschrift
... Mr. Jones hat mir versprochen, daß ich nicht mehr so viel zu unterrichten brauche, sondern daß ich in Zukunft in seiner Gemeinde arbeiten darf, die Menschen besuchen, mit ihnen reden usw. Gebe Gott, daß Segen darauf ruhe.
Jetzt will ich Dir noch von meinem Spaziergang nach London erzählen, mittags um 12 Uhr ging ich hier fort und zwischen 5 und 6 Uhr war ich an meinem Bestimmungsort.
Als ich in den Stadtteil kam, wo die meisten Bilderläden sind, in der Gegend des Strands, traf ich viele Bekannte; es war gerade Tischzeit, also waren viele unterwegs, die aus den Geschäften oder zurück gingen. Zuerst traf ich einen jungen Pfarrer, der hier einmal predigte und mit dem ich dann bekannt wurde, danach einen Angestellten von Mr. Wallis und dann einen der Herren Wallis selber, und dann begegneten mir Mr. Reid und Mr. Richardson, das sind doch schon alte Freunde. Im vorigen Jahr um diese Zeit war Mr. Richardson in Paris, und wir spazierten zusammen zum Père Lachaise. Danach gingen wir zu den Wisselingh, wo ich die Skizzen für zwei Kirchenfenster sah.
In der Mitte des neuen Fensters das Portrait einer alten Dame, o solch ein edles Gesicht, mit den Worten: »Dein Wille geschehe« darüber, in dem anderen Fenster das Portrait ihrer Tochter mit den Worten: »Der Glaube ist eine Zuversicht in die Dinge, die man hofft, und ein Beweis dessen, was man nicht sieht.« Dort in dem Geschäft der Messrs. Goupil & Co. sah ich schöne Bilder und Zeichnungen, es ist solch ein großer Genuß, durch die Kunst immer wieder an Holland erinnert zu werden. In der City ging ich noch zu Mr. Gladwell und zur St.–Pauls–Kirche. Und von der City zum anderen Ende von London, dort besuchte ich einen Jungen, der seinerzeit wegen Krankheit aus Mr. Stokes Schule fortgegangen war; ich fand ihn wieder viel besser, auf der Straße. Dann dorthin, wo ich das Geld für Mr. Jones einkassieren mußte. Die Vorstädte von London haben eine eigenartige Schönheit, zwischen den kleinen Häuschen und Gärten sind offene, mit Gras bewachsene Plätze, meistens mit einer Kirche oder Schule oder einem Armenhaus zwischen den Bäumen und Sträuchern in der Mitte, und es kann dort so schön sein, wenn die Sonne rot untergeht in dem durchsichtigen Abendnebel. Gestern abend war es so, und ich hätte gewünscht, daß Du die Londoner Straßen einmal gesehen hättest, als es zu dämmern begann und die Laternen angezündet wurden und alles nach Hause ging, man konnte an allem merken, daß Sonnabend–Abend war, und in all dem Gewühl war Friede, man fühlte so recht das Bedürfnis nach Ruhe und die Freude über den bevorstehenden Sonntag. O diese Sonntage, und was dort alles getan und gearbeitet wird an diesen Sonntagen, es ist eine solche Erholung für die armen Stadtteile und unruhigen Straßen.
In der City war es dunkel, aber es war ein schöner Spaziergang, an der langen Reihe von Kirchen vorbei, die hier stehen. Nahe beim Strand fand ich einen Omnibus, der mich ein ganzes Stück weiterbrachte, es war schon ziemlich spät. Ich kam an der kleinen Kirche von Mr. Jones vorbei und sah in der Ferne noch eine andere, in welcher so spät noch Licht brannte, ich ging darauf zu und fand, daß es eine sehr schöne kleine katholische Kirche war, wo ein paar Frauen beteten. Dann kam ich in den dunklen Park, von dem ich Dir schon schrieb, und von dort aus sah ich in der Ferne die Lichter von Isleworth und die Kirche mit dem Epheu und den Kirchhof mit den Trauerweiden an der Seite der Themse. Morgen hoffe ich zum zweiten Male etwas Geld in meinem neuen Wirkungskreise zu bekommen, um davon ein Paar neue Stiefel und einen neuen Hut zu kaufen. Und dann, so Gott will, können wir »uns wieder auf den Weg machen.«
In den Straßen von London verkauft man überall wohlriechende Veilchen, die blühen hier zweimal im Jahre. Ich kaufte welche für Mrs. Jones, um mich für die Pfeife, die ich hier und da rauche, besonders abends spät auf dem Spielplan, erkenntlich zu zeigen. Aber der Tabak ist hier ziemlich trübselig ...
A Dieu,
Dein Dich sehr liebender Bruder Vincent
Isleworth, 25. November 1876
Lieber Theo! ...
Vorigen Sonntag war ich abends in einem Dorf an der Themse, Petersham, morgens war ich in der Sonntagsschule in Turnham green, und ging von da nach Sonnenuntergang nach Richmond und von da nach Petersham. Es wurde sehr schnell dunkel, und ich wußte den Weg nicht gut, es war ein entsetzlich morastiger Weg über eine Art Damm oder Anhöhe, an den Abhängen mit knorrigen Rüstern und Sträuchern bewachsen. Endlich sah ich unten am Abhang ein Licht in einem Häuschen und kletterte und baggerte darauf zu, und da wies man mir dann den Weg. Aber, Junge, da war ein schönes hölzernes Kirchlein mit freundlichem Licht am Ende dieses dunklen Weges. Ich las Apostelgeschichte 4. V. 14-16 und Ap.–G. 11, V. 5-17, Petrus im Gefängnis, und dann erzählte ich noch einmal die Geschichte von Johannes und Theogenes. In der Kirche war ein Harmonium, welches von einem der jungen Mädchen aus einem Pensionat, das anwesend war, gespielt wurde.
Morgens war es so schön auf dem Wege nach Turnham green; die Kastanien und die helle blaue Luft und die Morgensonne spiegelten sich im Wasser der Themse, das Gras war leuchtend grün und überall in der Runde läuteten die Kirchenglocken. Tags zuvor hatte ich einen weiten Marsch nach London gehabt, um vier Uhr morgens ging ich hier fort und war um halb sieben im Hydepark, da lag der Nebel auf dem Rasen und die Blätter fielen von den Bäumen.
In der Ferne sah man die Lichter der Laternen schimmern, die noch nicht ausgelöscht waren, und die Türme von Westminster Abbey und das House of Parliament, und die Sonne ging rot auf im Morgennebel. Von da ging's nach White Chapel, jenem armen Teile Londons, dann nach Clapham, um Mrs. Loyer noch einmal zu besuchen, die am vorhergehenden Tage ihren Geburtstag gehabt hatte.
Auch war ich noch eben bei Mr. Obach, um seine Frau und Kinder wieder einmal zu sehen. Dann von da nach Lewisham, wo ich um halb vier Uhr bei der Familie Gladwell anlangte. Es war gerade drei Monate her, seit ich an jenem Sonnabend, an dem ihr Töchterchen begraben wurde, dort gewesen war.
Ich war etwa drei Stunden bei ihnen und mannigfach waren die Gedanken, die in uns aufkamen, zu viel, um zu erzählen. Von dort schrieb ich noch an Harry nach Paris. Ich hoffe, daß Du ihm noch einmal begegnest; es kann leicht geschehen, daß Du auch noch mal nach Paris kommst. Abends halb elf war ich wieder hier, ich legte einen Teil des Weges mit der underground railway zurück. Glücklicherweise hatte ich etwas Geld erhalten für Mr. Jones.
In Petersham sagte ich der Gemeinde, daß sie schlechtes Englisch hören würden, aber daß ich beim Sprechen an den Mann im Gleichnis dächte, der da sagte: »Habe Geduld mit mir und ich werde Dir alles bezahlen.« Gott helfe mir.
A Dieu. Stets Dein Dich liebender Bruder Vincent
Amsterdam, 30. Mai 1877
Lieber Theo! Vielen Dank für Deinen heutigen Brief, ich habe noch einiges zu tun und schreibe daher in Eile. Ich habe Onkel Jan Deinen Brief gegeben, empfange seine herzlichsten Grüße und er dankt Dir für Dein Schreiben.
Es war da ein Wort in Deinem Brief, das mich sehr frappierte: »Ich möchte von allem fort, und ich bin die Ursache von allem und bereite anderen nur Verdruß, ich allein habe dieses Elend über mich selbst und andere gebracht«.
Das war ein Ausspruch, der mich frappierte, weil dasselbe Gefühl, ganz dasselbe, nicht mehr und nicht weniger auch in meinem Gewissen spricht. Wenn ich an die Vergangenheit denke, wenn ich an die Zukunft denke, an beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten, an viele und mühsame Arbeit, zu der ich keine Lust habe, daß ich z. B. das böse Ich gerne umgehen möchte, wenn ich denke an die Augen so vieler, die auf mich gerichtet sind, – die wissen werden, woran es liegt, wenn ich nicht bestehe –, die mir keine alltäglichen Vorwürfe machen werden, aber die, weil erprobt und geübt in dem, was gut und edel und sozusagen Feingold ist, durch den Ausdruck ihres Gesichtes sagen werden: »Wir haben Dir geholfen, und sind Dir ein Licht gewesen, wir haben an Dir getan, was wir konnten. Hast Du aufrichtig gewollt, was ist nun unser Lohn und die Frucht unserer Arbeit?« Siehe, wenn ich an das alles denke und an noch so vieles mehr von allerlei Art – zu viel, um es aufzuzählen –, an all die Mühseligkeiten und Sorgen, die nicht weniger werden bei fortschreitendem Leben, an Leiden, an Enttäuschungen, an die Gefahr des Mißlingens, an Schande obendrein, siehe, dann ist auch mir das Verlangen nicht fremd: »Ich möchte wohl von allem fort wollen!«
Und doch – ich fahre fort – aber mit Vorsicht und in der Hoffnung, daß es mir gelingen möge, all diese Dinge zu bekämpfen, so daß ich eine Antwort haben werde auf die Vorwürfe, die drohen, im Vertrauen, daß trotz aller Dinge, die gegen mich scheinen, ich das Ziel, das ich begehre, erreichen werde und, so Gott will, Gnade finden in den Augen derer, die ich lieb habe und in den Augen derer, die nach mir kommen werden.
Es steht geschrieben: Richte auf die schlaffen Hände und die trägen Knie, und als die Jünger die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen hatten, da wurde ihnen gesagt: »Fahret hinaus auf die Höhe und werfet das Netz noch einmal aus!« Mein Kopf ist manchmal dumpf und oft glüht er und mein Gedanke ist wirr – wie ich diese schwierigen und ausführlichen Studien hinein kriegen muß, ich weiß es nicht –; nun sich nach den so bewegten Jahren noch an einfaches, geregeltes Arbeiten zu gewöhnen und auszuharren, ist nicht immer leicht. Und doch fahre ich fort; wenn wir müde sind, ist es nicht darum, weil wir schon eine Strecke gegangen sind, und wenn es wahr ist, daß der Mensch einen Streit zu führen hat auf Erden, ist dann nicht das Gefühl der Ermüdung und das Glühen des Kopfes das Zeichen, daß wir gestritten haben? Wenn man an einem mühsamen Werke arbeitet und für eine gute Sache strebt, dann kämpft man einen guten Streit, dessen Lohn es sicher schon ist, daß man vor vielem Leid bewahrt worden ist. Und Gott sieht die Anstrengung und den Kummer und kann helfen trotz allem.
Der Glaube an Gott steht bei mir fest, er ist keine Einbildung, kein eitler Wahn, sondern er ist, er ist wahrhaftig: es ist ein Gott, der lebt und Er ist mit unseren Eltern und sein Auge ist auch über uns und ich bin sicher, daß er seine Absicht auch mit uns hat und wir gleichsam uns selbst nicht ganz angehören – und dieser Gott ist kein anderer als Christus, von dem wir in unserer Bibel lesen und dessen Wort und Leben auch tief in Deinem Herzen ist. Hätte ich nur früher mit all meiner Kraft darauf hingewirkt, ja, das würde besser für mich gewesen sein, doch auch nun wird Er eine starke Hilfe sein und es steht in seiner Macht, uns das Leben erträglich zu machen, uns vor dem Bösen zu bewahren, alle Dinge mitwirken zu lassen zum Guten und unserem Ende Frieden zu schenken.
Böses ist in der Welt und in uns selbst, schreckliche Dinge, und man braucht nicht weit im Leben zu sein, um vieles zu scheuen und das Bedürfnis einer festen Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben zu empfinden, um zu wissen, daß man ohne den Glauben an einen Gott nicht leben kann, es nicht aushalten kann. – Aber mit diesem Glauben kann man lange ausharren ...
Dein Dich innig liebender Bruder Vincent
Amsterdam, 18. September 1877
Lieber Theo! ...
Wieviel Empfinden muß doch jemand wie Vater, der selbst so manches Mal des Nachts mit einer Laterne versehen, weite Wege macht, z. B. zu einem Kranken oder Sterbenden, um mit ihm über Ihn, dessen Wort auch in der Nacht des Leidens und der Todesangst noch ein Licht ist, zu sprechen, für Radierungen von Rembrandt haben, wie z. B. die Flucht nach Ägypten bei Nacht, oder die Beerdigung Jesu. Die Sammlung im Trippenhuis ist prachtvoll, ich sah diesmal vieles, das ich früher nie gefunden hatte, man erzählte mir dort auch von Zeichnungen Rembrandts bei Fodor. Wenn Du es für gut hältst, dann sprich einmal mit Herrn Tersteeg darüber und schreibe vorher ein Wort, wann Du kommst, dann arbeite ich im voraus, um frei zu sein und zu Deiner Verfügung stehen zu können, wenn Du kommst. Ich kann nichts Derartiges, z. B. auch keine Bilder sehen, ohne an Dich und an alle zu Hause zu denken!
Ich sitze im übrigen bis über die Ohren in der Arbeit; denn es wird mir klar, was ich eigentlich wissen muß und was diejenigen wissen, denen ich gerne nachfolgen möchte, und wovon sie beseelt werden. »Forsche in der Schrift«, heißt es nicht umsonst, dieses Wort ist ein guter Wegweiser, und ich möchte wohl ein solcher Schriftkundiger werden, der aus seinem Schatze alte und neue Dinge hervorbringen kann. Vater schrieb, daß Du in Antwerpen gewesen bist, ich bin begierig zu hören, was Du da gesehen hast; vor langer Zeit sah ich dort die alten Bilder im Museum, besonders eines schönen Portraits von Rembrandt erinnere ich mich noch, es wäre herrlich, wenn man alles deutlich in der Erinnerung behalten könnte; aber es geht damit ebenso wie mit der Aussicht auf einen langen Weg, in der Ferne scheinen die Dinge kleiner und wie in einem Nebel.
An einem Abend brannte es hier auf dem Wasser, es war ein Kahn mit Arak oder etwas dergleichen. Ich war mit Onkel auf der Wattenaer, es bestand verhältnismäßig wenig Gefahr, da es gelungen war, die brennende Schute zwischen den anderen Schiffen herauszuholen, und da man sie an einen Pfahl festgelegt hatte. Als die Flamme höher wurde, sah man die Buitenkant, die schwarze Reihe von Menschen, die da als Zuschauer standen, und die kleinen Boote, die um die Glut hin und her fuhren, erschienen ebenfalls schwarz, ebenso das Wasser, in dem die Flamme sich spiegelte; ich weiß nicht, ob Du Photographien nach Ingel kennst, die seinerzeit in der Galerie photographique waren, nun jedoch vernichtet sind, »La nuit de Noël«, »La conflagration« und andere – etwas Derartiges war es.
Es beginnt bereits zu dämmern, »blessed twilight« nannte Dickens es, und er hatte recht. »Blessed twilight«, wenn zwei oder drei in Einmütigkeit beieinander sind und als Schriftkundige aus ihrem Schatze alte und neue Dinge hervorbringen. »Blessed twilight«, wenn zwei oder drei versammelt sind in Seinem Namen und Er selbst mitten unter ihnen weilt. Und selig der, der um diese Dinge weiß und auch danach handelt.
Rembrandt wußte darum, denn aus dem reichen Schatze seines Herzens hat er, neben anderen, die Zeichnung in Sepia, Kohle und Tusche etc., die im Britischen Museum ist: das Haus zu Bethanien, hervorgebracht. In diesem Zimmer herrscht die Dämmerung, die Gestalt des Herrn, edel und eindrucksvoll, hebt sich, als ein strenges Dunkel, von dem Fenster ab, durch das die Abenddämmerung hereinsinkt. Zu Jesu Füßen sitzt Maria, die das gute Teil erwählt hat, das ihr nicht genommen werden soll, und Martha ist in dem Zimmer beschäftigt mit diesem und jenem –, wenn ich mich recht erinnere, damit, das Feuer zu schüren oder etwas Derartigem.
Diese Zeichnung hoffe ich nicht zu vergessen, so wenig wie das, was sie mir zu sagen schien: »Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben«.
Solche Dinge sagt die Dämmerung dem, der Ohren hat, sie zu hören, und ein Herz, um sie zu verstehen und Glauben an Gott zu haben, »blessed twilight«!
Dein Dich innig liebender Bruder Vincent
Amsterdam, 30. Oktober 1877
Lieber Theo! ...
Latein und Griechisch zu studieren, mein Junge, ist schwer, schwer, aber ich fühle mich doch sehr glücklich dabei und beschäftige mich mit Dingen, nach denen ich verlangt habe. Ich darf des Abends nicht so spät aufsitzen, Onkel hat es mir strengstens verboten, doch bleibt das Wort, das unter der Radierung von Rembrandt steht, mir im Gedächtnis: »In medio noctis vim suam lux exerit« – (in der Mitte der Nacht verbreitet das Licht seine Kraft) –, und ich sorge dafür, daß die ganze Nacht eine kleine Gasflamme brennen bleibt, und liege oft, in medio noctis, es anschauend, da, meinen Plan für die Arbeit des kommenden Tages überdenkend, und in Gedanken, wie ich es mit dem Studieren so gut wie möglich anfangen kann. Ich hoffe im Winter des Morgens früh das Feuer anzuzünden; die Wintermorgen haben etwas Eigenartiges, wie es Frère in seinem Arbeiter »Un tonnelier« malte, – die Radierung hängt, glaube ich, in Deinem Zimmer.
Du kennst wohl die Holzschnitte von Swain, das ist ein tüchtiger Mann; sein Atelier liegt in einem so interessanten Teile Londons, nicht weit von dem Teile des Strand, wo die Bureaux der Illustrated papers sind, the London News, Graphic etc., nicht weit von Booksellers row, dort, wo es voll ist von allen möglichen Bücherständen und Läden, in denen man alles sieht, von den Radierungen Rembrandts bis zur Household edition von Dickens und Chandos Classics; alles hat dort einen grünen Ton, besonders bei nebligem Wetter – so im Herbst oder an den dunklen Tagen vor Weihnachten, und das ist dort eine Gegend, die einen unwillkürlich an Ephesus erinnert, wie es so merkwürdig einfach in der Apostelgeschichte beschrieben wird; so sind auch in Paris die Bücherläden so interessant, unter anderem im Faubourg St. Germain. Wie unsagbar froh, mein Junge, werde ich sein, wenn ich mein Examen bestehe, und wenn ich die Schwierigkeiten überwinde, so wird es in Einfalt des Herzens geschehen, aber auch mit Gebet zu Gott; denn ich bete so oft inbrünstig zu Ihm um die Weisheit, deren ich bedarf. Montagabend war ich bei Onkel Cor und sah Tante und die ganze Familie, alle lassen herzlich grüßen; ich sah bei Onkel noch das Buch durch, l'oeuvre gravé de Ch. Daubigny.
Ich ging von da zu Onkel Stricker und hatte ein langes Gespräch mit ihm und Tante, Mendes hatte nämlich vor einigen Tagen dort einen Besuch gemacht und hatte glücklicherweise keinen schlechten Rapport erstattet; Onkel frug mich jedoch, ob das Lernen nicht anstrengend sei, und ich habe ihm bekannt, daß es sehr mühsam sei und ich mein Bestes täte, um stark zu bleiben und mich auf alle mögliche Weise wach zu halten; doch gab er mir guten Mut. Aber nun noch diese schreckliche Algebra und Geometrie – enfin, wir werden sehen – nach Weihnachten muß ich auch darin Stunde nehmen, es geht nicht anders ...
Dein Dich innig liebender Bruder Vincent
November 1878 – September 1880
Laeken, 15. November 1878
Lieber Theo! ...
Die kleine Zeichnung »au charbonnage« ist wahrlich nicht viel Besonderes, aber ich machte sie unwillkürlich, weil man hier so viele Leute sieht, die in den Kohlen arbeiten und die ein ganz eigenartiges Völkchen sind. Dieses Häuschen steht nicht weit vom Kanalweg, es ist ein kleines Mietshaus, angebaut an die große Werkstätte, wohin die Arbeiter zur Frühstückspause kommen, um ihr Brot zu essen und ein Glas Bier zu trinken.
Schon seinerzeit in England habe ich mich um eine Stelle als Missionar unter den Bergleuten in den Kohlenminen beworben; damals schlug man meine Bitte in den Wind und sagte: ich müsse mindestens 25 Jahre alt sein. Du weißt wohl, daß eine der Wurzeln oder Grundwahrheiten des Evangeliums nicht allein, sondern sogar der ganzen Bibel dies ist: »Licht, welches in der Finsternis aufgeht«. Durch Finsternis zum Licht. Nun wohl, manche haben ein ausgesprochenes Bedürfnis danach, manche werden Ohren dafür haben. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diejenigen, die in der Finsternis, im Schoße der Erde, arbeiten, wie die Bergleute in der schwarzen Kohlengrube, durch das Wort des Evangeliums sehr ergriffen werden und ihm auch glauben. Nun gibt es im Süden von Belgien, im Hennegau, etwa in der Nähe Mons bis an die französische Grenze, ja noch weiter darüber hinaus, eine Gegend, Le Borinage genannt, wo eine eigentümliche Bevölkerung von Arbeitern, die in den zahlreichen Steinkohlenminen tätig sind, lebt. Folgendes fand ich unter anderem in einem geographischen Büchelchen über sie: »Die Borins, Bewohner des Borinage, einer Gegend westlich von Mons, beschäftigen sich nur mit der Kohlengewinnung. Es ist ein imposantes Schauspiel, diese Kohlenminen von 300 m Tiefe zu sehen, in die hernieder tagaus, tagein eine Arbeiterbevölkerung steigt, die unserer Achtung und unserer Sympathien wohl würdig ist. Der Kohlenarbeiter ist ein besonderer Typus des Borinage. Der Tag existiert für ihn nicht, und mit Ausnahme des Sonntags genießt er kaum die Strahlen der Sonne. Er arbeitet mühsam beim Scheine einer bleichen und matten Lampe unter einer engen Galerie; den Körper gebogen, und manchmal gezwungen zu kriechen, arbeitet er, um dem Innern der Erde dieses Mineral zu entreißen, dessen großen Nutzen wir alle kennen; er arbeitet inmitten von Gefahren, die beständig wiederkehren. Aber der belgische Bergmann hat einen glücklichen Charakter, er ist an ein derartiges Leben gewöhnt, und wenn er in die Grube steigt, die kleine Lampe auf dem Hut, die ihn in der Finsternis leiten soll, so vertraut er sich seinem Gotte an, der seine Arbeit sieht und ihn beschirmt, ihn, sein Weib und seine Kinder«.
Das Borinage liegt also südlich von Lessines, wo man die Steinbrüche findet. Ich wünschte sehr, dorthin als Prediger des Evangeliums zu gehen. Die von den Herren de Jong und Pfarrer Pietersen ausgedungenen drei Monate Vorbereitungszeit sind beinahe verstrichen. Paulus ist, bevor er als Prediger auftrat, seine großen Missionsreisen und seine eigentliche Arbeit unter den Heiden begann, drei Jahre in Arabien gewesen. Könnte ich einmal drei Jahre etwa, in einer ähnlichen Gegend, in Ruhe, stets lehrend und beobachtend, so tätig sein, so würde ich nicht von dort zurückkehren, ohne daß ich etwas zu sagen hätte, das in der Tat der Mühe wert sein würde, gehört zu werden; ich sage das freimütig, jedoch in aller Demut. Wenn Gott es will und mir das Leben läßt, dann werde ich ungefähr mit meinem 30. Jahre fertig sein und mit einer eigenartigen Ausbildung und Erfahrung beginnen können und meiner Sache dann viel mehr Meister und reifer zur Arbeit sein. Ich schreibe Dir dies nochmals, obwohl wir bereits darüber sprachen. Es gibt in dem Borinage schon verschiedene kleine protestantische Gemeinden, sicher wohl auch Schulen; möchte man mir doch dort ein Plätzchen anweisen, damit ich da als Missionar in der von uns besprochenen Weise tätig sein könnte, indem ich den Armen, also denen, die dessen bedürfen, und für die es so ganz besonders geeignet ist, das Evangelium predigte, während ich in der Woche meine Zeit dem Unterrichte widmen würde.
Du bist gewiß einmal in St. Gilles gewesen. Ich habe nach dieser Seite hin auch einmal einen Ausflug gemacht; bei l'ancienne barrière, wo der Weg nach Mont St. Jean beginnt, liegt auch noch der Alsemberg. Hier liegt rechts der Kirchhof von St. Gilles, voller Zedern und Epheu, von wo aus man über die Stadt hinsehen kann. Wenn man weiter geht, kommt man nach Forest. Die Gegend ist dort sehr malerisch, alle Häuser stehen ähnlich den Hütten und Dünen, die Bosboom so tüchtig gemalt hat, auf den Höhen. Man sieht die Leute dort alle mögliche Landarbeit verrichten, Korn säen, Kartoffeln ausbuddeln, Rüben waschen, und alles ist dort malerisch, ja selbst das Reisigsuchen, und es hat wohl etwas von Montmartre.
Es gibt alte, mit Epheu oder wildem Wein bewachsene Häuser und nette Herbergen. Unter den Häusern fiel mir z. B. das eines Senffabrikanten namens Verhisten auf, sein Besitztum war ein vollkommener Vorwurf für ein Bild, etwa von Thys Maris. Hier und da sind kleine Steinbrüche, zu denen Hohlwege mit tief eingefahrenen Wagenspuren führen, und wo man die kleinen weißen Pferde mit roten Quasten und die Fuhrleute mit blauen Kitteln sieht; auch der Schäfer fehlt nicht, ebensowenig wie die Frauen, die, in Schwarz und mit weißen Mützen, an die von de Groux erinnern.
Es gibt hier einige von jenen Orten, wie übrigens, Gott sei Dank, überall, an denen man sich mehr zu Hause fühlt als anderswo und wo man ein eigentümlich in sich versunkenes Gefühl, wie von Heimweh, bekommt, in dem wohl etwas bitter Wehmütiges liegt, das jedoch den Geist in uns stärkt und aufrüttelt, uns, wir wissen selbst nicht wie und warum, neue Kraft und Lust zur Arbeit gibt und uns erfreut. Ich wanderte an jenem Tage noch weiter, beinahe bis nach Forest, und schlug noch einen Seitenweg nach einem alten, mit Epheu bewachsenen Kirchlein ein. Ich sah dort viele Linden, die noch mehr ineinander gewachsen und, sozusagen noch gotischer waren als die, die wir im Park und an der Seite des Hohlweges, der zum Kirchlein führt, sahen; verrenkte Stümpfe und Baumwurzeln, so abenteuerlich, wie Albrecht Dürer sie in »Ritter, Tod und Teufel« stach.
Hast Du jemals ein Bild von Carlo Dolci, »Der Olivengarten«, oder vielmehr die Photographie danach, gesehen? Ich sah sie unlängst, es ist etwas Rembrandteskes darin. Die große, wuchtige Radierung desselben Gegenstandes, nach Rembrandt, das Gegenstück zu der anderen »Das Lesen der Bibel«, mit den zwei Frauen und dem Weg, kennst Du wohl. Seitdem Du mir sagtest, daß Vater Corots Schilderung desselben Gegenstandes gesehen hat, kommt es mir wieder vor den Geist; ich sah das Bild auf der Ausstellung seiner Werke kurz nach seinem Tode, wo es mich sehr frappierte ...
Dein Dich liebender Bruder Vincent
Petites Wasmes, 26. Dezember 1878
Lieber Theo! ...
Was mich betrifft, so begreifst Du wohl, daß es hier in dem Borinage keine Bilder gibt, daß man selbst im allgemeinen ganz und gar nicht weiß, was ein Bild ist, und so versteht es sich von selbst, daß ich, seit meiner Abreise aus Brüssel, auf dem Gebiete der Kunst ganz und gar nichts gesehen habe. Aber das schließt nicht aus, daß es hier ein sehr eigenartiges und malerisches Land ist, alles spricht sozusagen und ist voller Charakter. Während dieser Tage, während der dunklen Tage vor Weihnachten, lag Schnee, und alles erinnerte da an mittelalterliche Bilder, etwa an die des Bauern-Brueghel, und an die so vieler anderer, die den eigenartigen Effekt von Rot und Grün, Schwarz und Weiß überzeugend auszudrücken gewußt haben. Immer wieder erinnert das, was man hier sieht, an Arbeiten etwa von Thys Maris oder von Albrecht Dürer.
Es gibt hier Hohlwege, bewachsen mit Dornengestrüpp und alten verrenkten Bäumen mit abenteuerlichen Wurzeln, die vollkommen jenem Weg auf dem Dürerschen Kupferstich »Ritter, Tod und Teufel« gleichen. So war es z. B. dieser Tage ein eigenartiger Anblick bei dem weißen Schnee, abends gegen die Dämmerstunde, die Arbeiter aus den Bergwerken kommen zu sehen. Diese Leute sind ganz schwarz, wenn sie aus den Minen wieder an das Tageslicht kommen, wie die Schornsteinfeger sehen sie aus. Ihre Wohnungen, die längs dieser Hohlwege, im Busch und an den Abhängen des Hügels verstreut liegen, sind meistens klein, ja eigentlich muß man sie Hütten nennen. Hier und da sieht man noch bemooste Dächer, und freundlich scheint des Abends das Licht durch die Fenster mit den kleinen Scheiben.
Wie bei uns in Brabant das Krüppelholz und die Eichensträucher und in Holland die Kopfweiden, so sieht man hier um die Gärten, Felder und Äcker die schwarzen Dornenhecken. Zusammen mit dem Schnee macht das in diesen Tagen den Eindruck von Buchstabenschrift auf weißem Papier, es sieht wie die Seiten des Evangeliums aus.
Bereits verschiedene Male habe ich hier gesprochen, zuweilen in einem ziemlich großen, eigens für religiöse Zusammenkünfte eingerichteten Raume, bei anderen Zusammenkünften, die man des Abends abzuhalten pflegt und die man am besten Bibelstunde nennen kann, in den Arbeiterwohnungen. Ich sprach unter anderem über das Gleichnis vom Senfkorn, vom unfruchtbaren Feigenbaum und von den Blindgeborenen, zu Weihnachten natürlich über den Stall von Bethlehem und über »Friede auf Erden.«
Möge es mit Gottes Segen dazu kommen, daß ich hier fest angestellt werde, ich möchte es von Herzen wünschen!
Überall in der Runde sieht man hier die großen Schornsteine und die grauenhaften Berge von Steinkohlen am Eingang der Gruben, die sogenannten Charbonnages. Du hast ja die Zeichnung von Bosboom »Chaudfontaine« – sie gibt den Charakter des hiesigen Landes gut wieder, nur ist hier alles Steinkohle, während es im Norden des Hennegaues mehr Steinbrüche und in Chaudfontaine mehr Eisen gibt ...
Dein Dich innig liebender Bruder Vincent
Wasmes, Juni 1879
Lieber Theo! ...
Vor einigen Tagen hatten wir hier ein gehöriges Gewitter gegen 11 Uhr abends. Ganz nahe hierbei ist eine Stelle, von wo aus man einen großen Teil des Borinage weithin unter sich sehen kann. Die Schornsteine, die Berge von Steinkohlen, die kleinen Arbeiterwohnungen und über Tag die Rührigkeit der kleinen schwarzen Gestalten, wie in einem Ameisenhaufen; ganz in der Ferne dunkle Tannenwälder, davor kleine weiße Arbeiterhäuser, und in weiter Ferne ein paar kleine Kirchtürme und eine alte Mühle. Meistens hängt eine Art Nebel über dem Ganzen, oder die dahinziehenden Wolkenschatten bringen auch seltsame Effekte von Licht und Dunkel hervor, die an die Bilder von Rembrandt, Michel oder Ruysdael erinnern. Während des Gewitters in der stockfinsteren Nacht war es ein eigentümlicher Effekt, wenn beim Schein der Blitze dann und wann für einen Augenblick alles sichtbar wurde. Ganz in der Nähe, alleinstehend und abgesondert auf freiem Felde, die großen düsteren Gebäude der Grube Marcasse, die einen in jener Nacht daran denken ließen, daß sich so der Koloß der Arche Noahs in dem gewaltigen Platzregen und der Finsternis der Sintflut beim Lichte eines Blitzstrahles ausgenommen haben mochte. Angeregt durch den Eindruck dieses Gewitters gab ich heute abend in einer Bibelstunde die Beschreibung eines Schiffbruches.
Ich lese augenblicklich viel in Onkel Toms Hütte. Es ist noch so viel Sklaverei in der Welt, und in diesem wunderbar schönen Buche wird diese so sehr gewichtige Sache mit einer Weisheit, mit einer Liebe und einem Eifer und Interesse für das wahrhafte Wohlergehen armer Unterdrückter besprochen, daß man unwillkürlich immer wieder darauf zurückkommt und jedesmal mehr darin findet. Ich kenne noch keine bessere Definition für das Wort Kunst, als diese: »L'art c'est l'homme ajouté à la nature qu'il dégage«. Die Natur, die Wirklichkeit, die Wahrheit – doch mit einer Bedeutsamkeit, mit einer Auffassung, mit einem Charakter, die der Künstler darin hervorhebt und denen er Ausdruck verleiht. Ein Bild von Mauve, von Maris oder von Israels sagt mehr als die Natur selbst. Ebenso ist es mit den Büchern, und in Onkel Toms Hütte ganz besonders werden durch den Künstler die Dinge in ein neues Licht gerückt, und somit sind in diesem Buche, obwohl es, vor Jahren geschrieben, schon ein altes Buch zu werden beginnt, alle Dinge neu geworden. Es ist so fein gefühlt, so durchdacht, so meisterhaft; es ist mit so viel Liebe, mit so viel Ernst und so aufrichtig geschrieben. Es ist so demütig und einfach, aber zugleich so wahrhaft erhaben, so edel und so vornehm ...
Stets Dein Dich liebender Bruder Vincent
Cuesmes, ohne Datum (wohl Dezember 1879)
Mein lieber Theo! ...
Eine der Ursachen nun, warum ich seit Jahren ohne Stellung bin, ist ganz einfach die, daß ich andere Ideen habe als die Herren, welche die Stellen den Individuen, die wie sie denken, geben. Das ist nicht eine einfache Toilettenfrage, wie man mir heuchlerischerweise vorgeworfen hat, es ist eine ernstere Frage als das, ich versichere Dich.
Warum sage ich Dir das alles? Nicht um mich zu beklagen, auch nicht, um mich wegen dessen zu entschuldigen, worin ich mehr oder weniger Unrecht haben könnte, sondern ganz einfach, um Dir folgendes zu sagen: Während Deines letzten Besuches im vorigen Sommer, als wir bei dem verlassenen Graben, den man die Hese nennt, zusammen spazieren gingen, hast Du mich daran erinnert, daß wir seinerzeit auch zusammen spazieren gingen längs des alten Kanals mit der alten Mühle von Ryswyk, und damals sagtest Du, waren wir einig über sehr viele Dinge, aber, fügtest Du hinzu, seitdem hast Du Dich sehr verändert, Du bist nicht mehr derselbe. Nun wohl, das ist nicht ganz so, denn, was sich geändert hat ist dies, daß damals mein Leben weniger schwierig und meine Zukunft scheinbar weniger düster war, aber was das Innere angeht, meine Art zu sehen und zu denken, das hat sich nicht geändert; wenn in der Tat eine Änderung vorhanden wäre, dann ist es die, daß ich jetzt viel ernsthafter denke, glaube und liebe, was ich damals auch schon dachte, glaubte und liebte.
Es wäre daher ein Mißverständnis, wenn Du dabei beharren würdest zu glauben, daß ich jetzt z. B. weniger begeistert wäre für Rembrandt, Millet oder Delacroix oder wen und was es auch sei, im Gegenteil. Es gibt mancherlei Dinge, welche man glauben und lieben muß, es ist etwas von Rembrandt in Shakespeare, von Correggio in Michelet und von Delacroix in Victor Hugo; und dann ist etwas von Rembrandt im Evangelium oder etwas vom Evangelium in Rembrandt, wie man will, das kommt mehr oder weniger auf dasselbe hinaus – vorausgesetzt, daß man die Sache richtig auffaßt, ohne sie in üblem Sinne verdrehen zu wollen, und wenn man den Doppelsinnigkeiten dieser Vergleiche, die nicht die Prätention haben, die Verdienste der einzelnen Persönlichkeiten vermindern zu wollen, Rechnung trägt. Wenn Du es nun einem Menschen verzeihen kannst, die Bilder zu erforschen, dann gib auch zu, daß die Liebe zu den Büchern ebenso heilig ist wie die zu Rembrandt, ja ich glaube sogar, daß sich die beiden ergänzen.
Ich liebe das Männerportrait von Fabritius, das wir eines Tages, als wir zusammen spazieren gingen, im Haarlemer Museum lange betrachtet haben, außerordentlich. Gut, aber ich liebe ebenso sehr den Richard Cartone von Dickens in seinem »Paris und London von 1793«, und ich könnte Dir auch in anderen Büchern andere außerordentlich ergreifende Gestalten von mehr oder weniger frappierender Ähnlichkeit zeigen. Und ich glaube, daß Kent in Shakespeares König Lear eine ebenso edle und distinguierte Persönlichkeit ist wie irgendeine Figur von Thomas de Keyser, obwohl Kent und König Lear lange vorher gelebt haben sollen. Mein Gott, wie schön ist Shakespeare, um nicht mehr zu sagen! Wer ist geheimnisvoll wie er? Sein Wort und seine Art wiegen jeden von fieberhafter Erregung zitternden Pinsel auf. Doch muß man zu lesen lernen, wie man sehen und hören lernen muß. Du mußt also nicht denken, daß ich dies oder jenes verleugne, ich bin eine Art Gläubiger in meinem Unglauben, und obwohl ich mich verändert habe, bin ich derselbe, und mein Kummer ist kein anderer als dieser: wozu könnte ich tauglich sein, könnte ich nicht helfen und in irgendeiner Weise nützlich sein, wie könnte ich mehr wissen und diesen oder jenen Gegenstand ergründen? Siehst Du, das quält mich beständig und dann fühlt man sich gefangen in Bedrängnis, ausgeschlossen, teilnehmen zu können an diesem oder jenem Werk, und so manche notwendige Dinge sind unerreichbar; aus diesem Grunde ist man nicht ohne Melancholie und fühlt eine Leere, da, wo Freundschaft und erhabene und ernste Zuneigungen sein könnten, man fühlt eine schreckliche Entmutigung selbst die moralische Energie zernagen, und das Verhängnis scheint den Instinkten der Liebe Schranken setzen zu können, wo eine Flut von Ekel in einem aufsteigt. Und dann sagt man sich: »Mein Gott, bis wann?« Was willst Du, was im Innern vor sich geht, das zeigt sich auch nach außen hin. Mancher hat ein großes Feuer in seiner Seele, und niemand kommt jemals, sich daran zu wärmen, und die Vorübergehenden gewahren nur ein klein wenig Rauch oben über dem Schornstein und sie gehen ihres Weges von dannen. Nun, was beginnen, diese Glut im Innern unterhalten, sein Salz in sich verschließen, geduldig warten, gleichviel mit wieviel Ungeduld, die Stunde erwarten, da es irgend jemandem beliebt, sich dort niederzulassen, und da bleiben wird, was weiß ich? Wer an Gott glaubt, möge die Stunde erwarten, welche früher oder später kommen wird.
Für den Augenblick nun steht es sehr schlecht um alle meine Angelegenheiten, wie es scheint, und das ist schon seit einer nicht unbeträchtlichen Zeit so gewesen, und es kann sogar bleiben, während einer Zukunft von weniger langer Dauer; aber es kann auch sein, daß, nachdem alles verkehrt zu gehen schien, dann alles besser gehen wird. Ich rechne nicht darauf, vielleicht wird es auch nicht geschehen, aber für den Fall, daß irgendeine Wendung zum Besseren einträte, würde ich das schon wie einen Gewinn ansehen, ich wäre zufrieden und würde sagen: endlich, es war also doch etwas. Aber, wirst Du sagen, du bist dennoch ein elendes Geschöpf, weil du unmögliche Ideen über Religion hast und kindische Gewissensskrupel.
Wenn ich deren unmögliche und kindische habe, könnte ich doch davon befreit werden, ich wünschte nichts sehnlicher ...
Ganz der Deinige, Vincent
Cuesmes, 24. September 1880
Lieber Theo! ...
Ich habe diesen Winter einige Werke von Victor Hugo ein wenig studiert, wie »Le dernier jour d'un condamné« und ein sehr schönes Buch über Shakespeare. Ich habe das Studium dieses Dichters schon seit längerer Zeit begonnen, das ist so schön wie Rembrandt. Shakespeare verhält sich zu Charles Dickens oder Victor Hugo wie Ruysdael zu Daubigny und Rembrandt zu Millet.
Was Du in Deinem Briefe über Barbizon sagst, ist sehr wahr, und ich werde Dir das eine oder andere erzählen, das Dir dartun wird, daß dies auch meine Art zu sehen ist. Ich habe Barbizon nicht gesehen, aber wenn ich auch nicht dies gesehen habe, so habe ich vorigen Winter doch Courrières gesehen. Ich hatte eine Fußtour, hauptsächlich ins Pas de Calais, nicht den Kanal, sondern das Departement, unternommen. Ich hatte diese Fußreise dorthin unternommen in der Hoffnung, dort vielleicht, wenn möglich, irgendwelche Arbeit zu finden; ich hätte alles angenommen.
Übrigens war es ein wenig unwillkürlich, was ich – ich könnte nicht genau erklären, warum – da tat. Du mußt Courrières sehen, hatte ich mir gesagt. Ich hatte nur zehn Franks in der Tasche, und da ich anfangs die Bahn benutzt hatte, war ich bald am Ende dieser Hilfsquelle, und da ich eine Woche unterwegs war, habe ich mich ziemlich mühselig durchgeschlagen.
Jedenfalls habe ich Courrières gesehen und die Außenseite des Ateliers von Herrn Jules Breton. Das Äußere dieses Ateliers hat mich ein wenig enttäuscht, da es ganz neu und erst kürzlich in Ziegeln gebaut ist, von einer methodischen Regelmäßigkeit und einem ungastlichen Anblick, kalt und langweilig ist.
Wenn ich das Innere hätte sehen können, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr an die Außenseite gedacht, ja, ich bin dessen sogar sicher, aber das Innere konnte ich nun einmal nicht erblicken; denn ich wagte es nicht, mich vorzustellen.
In Courrières habe ich übrigens nach Spuren von Jules Breton oder irgendwelchen sonstigen Künstlern gesucht, doch alles, was ich entdeckte, war sein Portrait bei einem Photographen, und dann in einem dunklen Winkel der alten Kirche eine Kopie von Titians Grablegung, welche in der Dunkelheit sehr schön und von meisterhaftem Ton zu sein schien. War sie von ihm? Ich weiß es nicht, da ich keine Signatur erkennen konnte.
Von einem lebenden Künstler jedoch keine Spur, nur ein Café, genannt »Des beaux arts«, gleichfalls in neuen Ziegeln, ungastlich, kalt und abscheulich, das mit einer Art Fresken oder Wandmalereien geschmückt war, Episoden aus dem Leben des berühmten Ritters Don Quijote. Diese Fresken, es sei im Vertrauen gesagt, schienen mir damals ein ziemlich schlechter Trost und einigermaßen mittelmäßig.
Ich weiß nicht, von wem sie sind.
Aber ich habe immerhin die Landschaft von Courrières gesehen, die Schober, die braune Scholle oder Mergelerde, ungefähr von der Farbe des Kaffees, mit weißlichen Flecken da wo der Mergel hervortritt, was für uns, die wir an schwärzliche Terrains gewöhnt sind, etwas ziemlich Außergewöhnliches schien.
Der französische Himmel schien mir übrigens ganz erheblich feiner und klarer, als der räucherige und neblige Himmel des Borinage.
Da waren außerdem etliche Gehöfte und Schuppen, welche noch, Gott sei Lob und Dank, ihre bemoosten Strohdächer bewahrt hatten; ich sah auch die Scharen von Raben, berühmt durch die Bilder Daubignys und Millets; um nicht zuerst, wie es sich schickte, die charakteristischen und malerischen Figuren der verschiedenen Arbeiter zu erwähnen, wie Gräber, Holzhauer, Knechte mit ihrem Gespann und die Silhouette einer Frau mit weißer Mütze. Selbst dort in Courrières war eine Kohlenmine oder Grube, ich sah die Förderung in die Abenddämmerung hineinragen, doch waren keine Arbeiterinnen in Männerkleidern da wie in dem Borinage, nur Bergleute, müde und elend, von Kohlenstaub geschwärzt, mit Arbeitslampen ausstaffiert, und einer mit einem alten Soldatenmantel. Obwohl dieser Marsch mich fast darniedergeworfen hätte und ich von Müdigkeit erschöpft zurückkehrte, die Füße durchgelaufen, und in einem ziemlich melancholischen Zustande, so bedaure ich ihn doch nicht; denn ich habe interessante Dinge gesehen, und man lernt mit anderen Augen sehen in den rauhen Prüfungen des Elends.
Ich habe unterwegs hier und da ein Stück Brot durch Tausch gegen einige Zeichnungen, welche ich in meiner Reisetasche hatte, verdient. Als aber meine zehn Franks zu Ende waren, habe ich die letzten Nächte im freien Felde biwakieren müssen, einmal in einem leeren Wagen, morgens ganz weiß von Reif, ein ziemlich schlechtes Notlager, einmal in einem Reisighaufen, und ein anderes Mal in einem angebrochenen Kornschober, wo es mir gelang, eine etwas komfortablere Nische herzurichten; zudem vermehrte ein feiner Regen nicht gerade die Behaglichkeit.
Und dennoch fühlte ich gerade in diesem starken Elend meine Energie zurückkehren, und ich sagte mir: Wie dem auch sei, ich werde wieder in die Höhe kommen, ich werde meinen Stift, den ich in meiner großen Ermutigung im Stiche gelassen habe, wieder aufnehmen, und ich werde mich wieder ans Zeichnen begeben, und seitdem hat, wie mir scheint, sich alles für mich geändert und nun bin ich unterwegs, und mein Stift ist ein wenig fügsamer geworden und scheint es von Tag zu Tag mehr zu werden.
Das zu lange und zu große Elend hatte mich dermaßen entmutigt, daß ich nichts mehr tun konnte.
Ich habe noch etwas anderes während dieses Ausfluges gesehen, nämlich die Dörfer der Weber.
Die Bergleute und die Weber sind noch ein von den anderen Arbeitern und Handwerkern etwas verschiedener Menschenschlag, ich fühle eine große Sympathie für sie und ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich sie eines Tages zeichnen könnte, damit diese noch unbekannten Typen eines Tages ans Tageslicht gezogen würden. Der Arbeiter der Kohlengruben ist ein Mensch von der Tiefe eines Abgrundes, »de profundis«, der Weber dahingegen hat ein träumerisches Aussehen, fast nachdenklich, beinahe somnambul. Nun lebe ich schon beinahe zwei Jahre bei ihnen und habe ihren originellen Charakter ein wenig kennen gelernt, wenigstens den der Kohlenbergleute. Und mehr und mehr finde ich etwas Rührendes und selbst Erschütterndes in diesen armen und niedrigen Arbeitern, in diesen, sozusagen, Letzten und Verachtetsten von allen, die man sich für gewöhnlich, vielleicht infolge einer lebhaften Phantasie, aber sehr zu Unrecht, als eine Rasse von Übeltätern und Räubern vorstellt. Bösewichter, Trunkenbolde und Räuber gibt es hier wie überall, doch ist das nicht der wahre Typus.
In Deinem Brief hast Du andeutungsweise davon gesprochen, ich solle früher oder später nach Paris oder seiner Umgebung kommen, wenn es möglich wäre und ich Lust dazu hätte. Gewiß wäre es mein größter und brennender Wunsch, sei es nach Paris, Barbizon oder sonstwohin zu kommen. Aber wie könnte ich es; denn ich verdiene nicht einen Sou, und obwohl ich angestrengt arbeite, werde ich noch einige Zeit nötig haben, um so weit zu kommen, daß man an dergleichen, wie nach Paris gehen, denken kann ...
Mai bis Dezember 1881
Etten, August 1881
Lieber Theo! ...
Bei Mauve war ich einen Mittag und einen Abend und sah viel Schönes in seinem Atelier. Meine eigenen Zeichnungen interessierten Mauve sehr. Er hat mir viele Winke gegeben, worüber ich froh bin, und ich habe mit ihm verabredet, daß ich in verhältnismäßig kurzer Zeit, wenn ich wieder einige Studien habe, von neuem zu ihm kommen soll.
Er hat mich eine ganze Menge von seinen Studien sehen lassen und sie mir erklärt, keine Skizzen zu Zeichnungen oder Entwürfe für Bilder, sondern wirkliche Studienblätter, scheinbar unbedeutend. Er will mich ans Malen kriegen. – Mit de Bock habe ich auf angenehme Weise Bekanntschaft gemacht; ich war in seinem Atelier. Er hat ein großes Dünenbild, in dem viel Gutes ist, in Arbeit. Aber der Kerl muß meiner Meinung nach Figuren zeichnen, um noch ganz andere Dinge zu liefern. Ich glaube, daß er ein echtes Malertemperament hat und noch nicht sein letztes Wort gesprochen hat. Er schwärmt für Millet und Corot; aber gaben die beiden sich Mühe für Figuren, ja oder nein? Die Figuren von Corot sind wohl nicht so bekannt wie seine Landschaften, aber das schließt nicht aus, daß er sie doch gemacht hat.
Übrigens ist bei Corot jeder Baumstamm mit einer Andacht und einer Liebe gezeichnet und modelliert, als gelte es einer Gestalt. Und ein Baumstamm von Corot ist noch ganz etwas anderes als einer von de Bock. Eine der schönsten Sachen von de Bock ist, fand ich, eine Kopie nach Corot. Sie wird zwar nicht leicht für einen echten durchgehen, aber sie war doch sehr gewissenhaft gemacht, gewissenhafter als mancher falsche Corot, dessen Unterschied von einem echten wenig in die Augen springt.
Dann habe ich mit ihm das Panorama von Mesdag gesehen, das ist eine Arbeit, vor der man allen Respekt haben muß. Ich habe dabei an ein Wort von Burger-Thoré, ich glaube über die Anatomie von Rembrandt, gedacht: »Le seul défaut de ce tableau est, de ne pas avoir de défaut.«
Die drei Zeichnungen von Mesdag auf der Ausstellung hatten vielleicht mehr défauts, aber sie erweckten sofort Sympathie; wenigstens ging es mir so ...
t. à t. Vincent
Etten, Dezember 1881
Lieber Theo! Manchmal wirfst Du vielleicht ein Buch fort, weil es zu realistisch ist, also habe Mitleid und Geduld mit diesem Briefe und lies ihn auf jeden Fall einmal durch, wenn er auch schrecklich ist.
Wie ich Dir bereits aus dem Haag schrieb, habe ich einiges mit Dir zu besprechen, nun ich wieder zurück bin. Nicht ohne Erregung denke ich an meine Reise dorthin zurück. Als ich zu Mauve kam, klopfte mir das Herz wohl etwas; denn ich dachte bei mir: wird auch er versuchen, mich mit freundlichen Redensarten abzuspeisen, oder werde ich hier etwas anderes finden. Was mir jedoch bei ihm widerfuhr, war dies, daß er mich auf alle mögliche Weise praktisch und herzlich zurechtwies und animierte. Nicht, als ob er immer alles gut gefunden hätte, was ich tat oder sagte, im Gegenteil. Aber wenn er mir sagte, dieses oder jenes taugt nichts, dann fügte er zugleich hinzu: »Aber probiere es einmal auf diese oder jene Art«, und das ist etwas ganz anderes als wie Bemerkungen machen, nur damit man etwas aussetzen kann. Sagt Dir jemand, Du bist krank, so hilft das nicht viel, sagt aber jemand, tue dies oder jenes und Du wirst gesund werden, und sein Rat ist kein Betrug, siehe, so ist dies das Wahre, und das hilft dann auch. Nun bin ich von ihm zurückgekehrt mit einigen gemalten Studien und ein paar Aquarellen. Natürlich sind das keine Meisterwerke, aber dennoch bin ich davon überzeugt, daß etwas Gesundes und Wirkliches darin ist, wenigstens mehr als in dem, was ich bisher gemalt habe. Und so denke ich denn, daß ich nun einen Anfang gemacht habe, etwas Ernstes zu leisten, und da ich nun über ein paar technische Mittel mehr verfügen kann, nämlich über Farbe und Pinsel, so sind die Dinge sozusagen wieder ganz neu. – Doch nun müssen wir das praktisch zur Ausführung bringen, und da ist es das erste, daß ich einen Raum finden muß, groß genug, um einen gehörigen Abstand beobachten zu können. Mauve sagte mir sofort, als er meine Studien sah: »Du sitzest Deinem Modell zu nahe.«
Dadurch wird es in vielen Fällen so gut wie unmöglich, die nötigen Maße für die Proportionen richtig zu nehmen, und das ist doch sicherlich eine der ersten Sachen, auf die ich achten muß. Nun muß ich sehen, irgendwo einen großen Raum zu mieten, sei es ein Zimmer oder ein Schuppen, das wird so außerordentlich teuer nicht sein. Ein Arbeiterhäuschen kostet hierzulande 30 Gulden Miete per Jahr, danach vermute ich, ein Raum, der doppelt so groß ist wie die Arbeiterwohnungen, vielleicht 60 Gulden.
Das ist nicht unerreichbar. Ich habe bereits einen Schuppen gesehen, an den jedoch etwas allzuviele Unannehmlichkeiten gebunden sind, namentlich zur Zeit des Winters. Zwar würde ich, wenn es etwas milderes Wetter ist, dort arbeiten können, und schließlich sind, glaube ich, hier in Brabant, nicht allein in Etten, sondern auch wohl noch in anderen Dörfern, wenn sich hier Hindernisse einstellen sollten, Modelle zu finden. Gleichviel, obwohl ich sehr viel von Brabant halte, ich habe Empfinden auch für andere Figuren als die Brabanter Bauerntypen.
So fand ich Scheveningen wieder unsagbar schön, ich bin jedoch nun einmal hier und es stellt sich einem hier vermutlich billiger. Ich habe jedoch mit Mauve fest verabredet, daß ich mein möglichstes tun werde, um ein gutes Atelier zu finden, und außerdem muß ich nun bessere Farben und besseres Papier benutzen.
Gleichwohl ist für Studien und Skizzen das Papier Ingres ausgezeichnet und es kommt einen viel billiger, Skizzenbücher in allerlei Formaten selbst davon zu machen, als die fertigen Skizzenbücher zu kaufen. Ich habe noch einigen Vorrat Papier Ingres, doch, wenn Du die Studien zurückschickst und Du dann wieder etwas von derselben Sorte mitschicken kannst, so wirst Du mir einen großen Gefallen tun; aber kein ganz weißes, sondern von der Farbe des ungebleichten Leinens, keine kalten Töne.
Theo, was für ein großes Ding ist doch Ton und Farbe, und wer nicht lernt, Gefühl dafür zu haben, wie weit wird der vom Leben abbleiben! Mauve hat mich so viele Dinge verstehen gelehrt, die ich früher gar nicht sah, und was er mir gesagt hat, werde ich Dir gelegentlich mitzuteilen versuchen; denn es könnte vielleicht doch einiges dabei sein, was auch Du nicht gut siehst. Enfin, wir werden wohl noch einmal über künstlerische Fragen miteinander reden, hoffe ich.
Du kannst Dir nicht denken, welch ein Gefühl der Erleichterung ich zu empfinden beginne, wenn ich daran denke, was mir Mauve auch bezüglich des Verdienens gesagt hat. Denke nur, wie ich mich Jahre lang durchgeschlagen habe, immer in einer Art von fausse position. Und nun, nun kommt ein Schimmer echten Lichtes.
Ich möchte wohl, daß Du die beiden Aquarelle, die ich mitgebracht habe, einmal sähest; denn Du würdest sehen, daß sie nicht wie andere Aquarelle sind. Es mögen noch viel Unvollkommenheiten darin sein, que soit, ich will gerne der erste sein zu sagen, daß ich sogar noch sehr unzufrieden damit bin, aber dennoch ist es etwas anderes, als ich bisher gemacht habe und es sieht frischer und gesünder aus. Das schließt jedoch nicht aus, daß es noch viel frischer und gesünder werden muß, doch nicht auf einmal kann man, was man will, das kommt nach und nach.
Nun habe ich die paar Studien jedoch selbst nötig, um das, was ich hier machen werde, damit zu vergleichen; denn sie müssen mindestens so auf der Höhe sein wie das, was ich bei Mauve machte.
Aber obschon Mauve mir sagt, daß, wenn ich noch ein paar Monate hier weiter gearbeitet hätte und dann z. B. im März noch einmal bei ihm gewesen wäre, ich wirklich verkäufliche Zeichnungen machen könnte, so befinde ich mich doch noch in einer sehr schwierigen Periode. Die Ausgaben für Modell und Atelier, Zeichen- und Malgerät mehren sich, und ein Verdienst ist noch nicht vorhanden.
Wohl hat Vater gesagt, daß ich wegen der unvermeidlichen Kosten nicht bange zu sein brauche, und Vater ist sehr guter Dinge über das, was Mauve ihm selbst gesagt hat sowie über die Studien und Zeichnungen, welche ich mitbrachte, aber ich finde es doch bitter elend, daß Vater dadurch Schaden leiden soll.
Wir hoffen natürlich, daß sich später alles finden wird, aber dennoch liegt es mir schwer auf dem Herzen. Seitdem ich hier bin, hat Vater wirklich nichts an mir verdient und mehr als einmal eine Hose oder einen Rock gekauft, die ich lieber nicht gehabt hätte, obschon ich es wohl nötig hatte; doch darf Vater nicht dadurch geschädigt werden, um so mehr, als bewußter Rock oder Hose nicht passen und nur halb oder gar nicht zweckmäßig sind ...

15. Nachtcafe in Arles. September 1888. Winterthur. Sammlung Hahnloser

Etten, ohne Datum (wohl Ende Dezember 1881)
Lieber Theo! Da Vater und Mutter schreiben, füge ich eine Zeile bei, doch hoffe ich, Dir binnen kurzem ausführlicher zu schreiben, da Mauve, der dieser Tage nach Prinsenhage und hierher kommt, dann dagewesen sein wird. Du mußt wissen, Theo, daß Mauve mir einen Malkasten mit Farben, Pinseln, Palette, Spachtel, Öl, Terpentin, kurz allem Nötigen geschickt hat, so daß es also entschieden ist, daß ich ans Malen soll; ich bin froh, daß es dazu gekommen ist. In letzter Zeit habe ich ziemlich viel gezeichnet, besonders Figurenstudien. Wenn Du die nun sähest, würdest Du wohl merken, auf welchem Wege ich bin.
Ich bin natürlich sehr begierig zu hören, was Mauve mir nun weiter sagen wird.
Ich habe dieser Tage auch einmal Kinder gezeichnet, was mir sehr gut gefallen hat.
Draußen ist es jetzt prachtvoll von Farbe und Ton, und wenn ich im Malen erst einmal weiter bin, werde ich wohl einmal dazu kommen, etwas davon wiederzugeben; doch wir müssen bei der Sache bleiben, und nun ich einmal am Figurenzeichnen bin, setze ich das fort, bis ich etwas weiter bin, und wenn ich draußen arbeite, dann werde ich Baumstudien machen, doch die Bäume so betrachten, als wenn sie eigentlich Figuren wären. Ich meine, man muß sie vor allen Dingen im Hinblick auf Kontur, Proportion und wie sie ineinander sitzen, betrachten. Das ist das erste, womit man zu tun hat, danach kommt das Modellieren, die Farbe und die Umgebung, und gerade über diese Frage muß ich einmal mit Dir reden.
Aber Theo, ich bin doch so froh über meinen Malkasten, und es ist besser, dünkt mich, daß ich den erst jetzt in die Hände bekomme, nachdem ich mindestens ein Jahr ausschließlich gezeichnet habe, als wenn ich sogleich damit begonnen hätte. Mich dünkt, darin wirst Du wohl einig mit mir sein.
Nun habe ich in meinem vorigen Brief vergessen, Dir zu sagen, daß ich es so ausgezeichnet finde, daß Du einmal nach London gehst. Weniger gerne würde ich Dich für immer dorthin ziehen sehen, doch nun ist es sehr gut, daß Du es einmal kennen lernst. Auf die Dauer würdest Du Dich dort aber doch nicht wohl fühlen, glaube ich, mir wird es wenigstens, je länger desto klarer, daß ich, was mich betrifft, dort doch eigentlich nicht in meinem Element war.
Hier in Holland fühle ich mich doch viel mehr zu Hause, ja ich glaube, daß ich wieder durch und durch Holländer werde, und findest Du nicht, daß dies eigentlich das Vernünftigste ist? Ich denke, ich werde wieder ganz und gar Holländer werden, sowohl im Charakter, wie in der Art des Zeichnens und Malens. Gleichwohl glaube ich, daß es mir wohl noch zustatten kommen wird, daß ich eine Zeitlang im Auslande gewesen bin und da das eine und andere gesehen habe, was zu kennen nicht überflüssig ist. Wenn Du nach London kommst, hätte ich sehr gerne, daß Du meine alten Kameraden, George Read und Richardson, herzlich von mir grüßest .......

16. Das gelbe Haus. Vincents Wohnung in Arles. September 1888. Laren, V. W. van Gogh

Den Haag, 2. Mai 1882
Lieber Theo! .......
Nun habe ich zwei größere Zeichnungen fertig. Erstens »Sorrow«, doch in größerem Format, die Figur allein, ohne Umgebung. Die Stellung ist jedoch einigermaßen verändert, das Haar hängt nicht nach hinten auf den Rücken, sondern nach vorn, zum Teil in einer Flechte. Dadurch werden das Schultergelenk, der Nacken und der Rücken sichtbar; und die Gestalt ist mit mehr Sorgfalt gezeichnet.
Die andere, »Les racines« – einige Baumwurzeln in einem Sandboden. Nun habe ich danach getrachtet, in die Landschaft dieselbe Empfindung zu legen wie in die Figur; das gleichsam krampfhafte und leidenschaftliche Sicheinwurzeln in die Erde und ein dabei doch Halblosgelöstsein durch die Stürme.
Ich wollte sowohl in dem weißen, schlanken Frauenkörper wie in diesen schwarzen, knorrigen Wurzeln mit ihren Auswüchsen etwas vom Streit des Lebens ausdrücken. Oder vielmehr, weil ich getrachtet habe, der Natur, die ich vor mir hatte, getreu zu sein, ist, ohne daß ich dabei philosophiert hätte, fast unwillkürlich in beiden Fällen etwas von diesem großen Streit hineingekommen. Wenigstens kam es mir so vor, als ob einiges Empfinden darinnen wäre, ich könnte mich jedoch irren, enfin, Du mußt einmal sehen.
Findest Du etwas darin, dann eignen sie sich vielleicht für Deine neue Wohnung, und dann habe ich sie für Deinen Geburtstag gemacht, zu dem ich Dir noch gratuliere. Aber da sie ziemlich groß sind, ein ganzer Ingresbogen, weiß ich nicht, ob ich sie sofort schicken soll. Sag' einmal, würde T. es wohl anmaßend und eingebildet finden, wenn ich ihn bäte, sie als Beilage mit in eine Kiste zu stecken?
Obwohl »Les racines« nur eine Bleistiftzeichnung ist, so habe ich darin doch mit dem Bleistift hingesetzt und wieder fortgenommen, wie man es beim Malen tut. Was den Schreinerbleistift betrifft, so urteile ich folgendermaßen. Womit werden die alten Meister wohl gezeichnet haben? Sicherlich nicht mit Faber B, BB, BBB, Bc, Be, sondern mit einem rohen Stück Graphit. Das Werkzeug, dessen Michelangelo und Dürer sich bedienten, hatte vielleicht viel von einem Zimmermannsbleistift. Doch ich bin nicht dabei gewesen und weiß es nicht, dies aber weiß ich wohl, daß man es mit einem Zimmermannsbleistift zu einer ganz anderen Kraft bringen kann als mit diesen feinen Faberstiften etc. Ich habe den Graphit lieber in seiner natürlichen Form als so außerordentlich fein gesägt wie in diesen teuren Fabern. Das Glänzen geht durch Fixieren mit Milch fort. Wenn man draußen sitzt und mit Conté-Kreide arbeitet, dann weiß man bei dem grellen Licht nicht recht, was man tut, und dann merkt man, daß es zu schwarz geworden ist, aber Graphit ist eher grau als schwarz, man kann dann aber immer noch ein paar Oktaven zulegen, dadurch, daß man aufs neue mit der Feder daran arbeitet, so daß die stärkste Kraft des Graphits durch das Repoussoir der Feder wieder hell wird. Holzkohle ist ausgezeichnet, doch, wenn man darauf herumarbeitet, geht die Frische vielleicht verloren, und um die Finesse darin zu behalten, muß man an Ort und Stelle fixieren. Auch für die Landschaft sehe ich Zeichner wie Ruysdael z. B., van Goyen und Calame, und unter den Modernen z. B. Roelofs, viel Gebrauch davon machen. Doch wenn jemand, zum Draußenarbeiten, eine gute Feder mit zugehörigem Tintenfaß erfände, dann kämen vielleicht mehr Federzeichnungen in die Welt. Mit Holzkohle, die in Öl gelegen hat, kann man Vorzügliches erreichen, das habe ich bei Weißenbruch gesehen; das Öl fixiert und das Schwarz wird wärmer und tiefer. Aber ich denke, es ist besser, ich tue so etwas über ein Jahr als jetzt, weil ich will, daß die Schönheit nicht aus meinem Material, sondern aus mir komme. Bin ich noch etwas weiter, dann ziehe ich dann und wann einmal einen schönen Anzug an, das heißt, ich arbeite mit einem dankbaren Zeichenmaterial, und da ich dann selbst auch etwas hinzutun kann, entsteht etwas von zwiefältigem Wert, das die Erwartungen übertrifft. Aber zuerst, vor allem Erfolg, der Kampf mit den Dingen in der Natur corps à corps ......
t. à t. Vincent
Den Haag, 11. Mai 1882
Lieber Theo! ......
Ich habe Dir über meinen Plan, die Wohnung hier nebenan zu nehmen, geschrieben – sie ist passender als diese, die, scheint es, umgeblasen werden kann etc. etc. Du weißt jedoch recht gut, daß ich nicht hochfahrend um dieses oder jenes bitte.
Ich hoffe nur, daß Du für mich auch weiter bleiben wirst, was Du warst, ich denke mich durch das, was ich tat, nicht entehrt oder erniedrigt zu haben, obwohl manche es vielleicht finden werden. Ich fühle, daß meine Arbeit im Herzen des Volkes liegt, daß ich mich auf bescheidenen Bahnen halten muß, daß ich tief in das Leben eindringen und durch viele Sorgen und Mühe vorwärts kommen muß.
Ich kann mir keinen anderen Weg denken und verlange nicht, ohne Mühe oder Sorge zu sein, solange ich nur arbeiten und bei solchen, wie Du es bist, auch fernerhin ein wenig Sympathie vermuten darf.
Es geht mir mit dem Leben wie mit dem Zeichnen, man muß manchmal schnell und entschlossen handeln, die Sache mit Energie angreifen und dafür sorgen, daß die großen Linien blitzschnell dastehen.
Da kommt kein Zaudern, kein Zweifeln zustatten, und die Hand darf nicht zittern, das Auge nicht hin und her blicken, sondern muß fest auf das gerichtet bleiben, was man vor sich hat, und man muß sich darin vertiefen, daß in kurzer Zeit auf dem Papier oder der Leinwand, wo vorher nichts war, etwas gestaltet ist, so daß man später selbst kaum weiß, wie man es darauf geschmiert hat. Die Zeit des Überlegens und Nachdenkens muß dem entschlossenen Handeln vorausgehen. Beim Tun selbst ist wenig Raum für Nachdenken oder Überlegen.
Schnelles Handeln ist Männerarbeit, und man muß, bevor man dazu imstande ist, etwas erlebt haben. Es gelingt dem Steuermann manchmal, einen Sturmwind, statt daß er sich von ihm in die Tiefe reißen läßt, zu benützen, um vorwärts zu kommen.
Was ich Dir noch einmal sagen wollte, ist folgendes: große Pläne für die Zukunft habe ich nicht, und mag auch für einen Augenblick die Lust nach einem Leben frei von Sorgen und nach Glück in mir aufkommen, so kehre ich doch stets mit Liebe zur Mühe, zur Sorge, zu einem mühseligen Leben zurück und denke: »Es ist besser so, ich, lerne mehr dabei, ich bin deshalb auch um nichts weniger, nicht auf diesem Wege geht man unter.«
Ich bin voll von meiner Arbeit, und ich habe das Vertrauen, daß es mir bei einigem guten Willen von solchen wie Du, wie Mauve und T., obgleich wir diesen Winter Zwietracht hatten, gelingen wird, genug zu verdienen, um davon zu leben, nicht im Überfluß, sondern gemäß dem: »Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen.«
Christine ist mir kein Klotz am Bein oder eine Last, sondern eine Hilfe. Wenn sie allein wäre, ginge sie möglicherweise zugrunde; eine Frau darf nicht allein sein in einer Gesellschaft und einer Zeit wie der, in welcher wir leben, die die Schwachen nicht schont, sondern unter die Füße tritt und mit Rädern darüber hinfährt, wenn ein schwaches Geschöpf gefallen ist.
Deshalb, weil ich so viele Schwache zertreten sehe, zweifle ich sehr an der Echtheit von vielem, was man Fortschritt und Bildung nennt. Ich glaube wohl an Bildung, selbst in dieser Zeit, doch allein an jene Art, die auf wirkliche Menschenliebe gegründet ist. Was Menschenleben kostet, finde ich barbarisch, und das respektiere ich nicht.
Enfin, genug davon. Wäre es möglich, daß ich die Wohnung hier nebenan mietete, könnte es sein, daß ich ein festes Wochengeld hätte, dann würde ich das herrlich finden. Wenn nicht, dann werde ich den Mut nicht verlieren und noch warten. Aber wenn ersteres geschehen könnte, dann würde es recht günstig für mich sein und Kräfte für meine Arbeit frei machen, die sonst durch Sorgen absorbiert werden.
Du wirst sehen, es ist allerlei in der Mappe.
Was Dir am besten vorkommt, halte Dir zurück, dann kannst Du es im gegebenen Augenblick sehen lassen, das übrige bekomme ich gelegentlich wohl einmal zurück. Wenn ich dächte, daß Du bald kommen wirst, dann behielte ich diese Dinge, bis Du kämest. Nun ist es jedoch möglicherweise gut, daß Du einiges beisammen siehst – Du kannst, hoffe ich, daraus ersehen, daß ich von Deinem Gelde nicht als Rentner lebe. Bei oberflächlicher Betrachtung könntest Du die Sache mit Christine vielleicht in einem ganz anderen Lichte sehen, als sie in Wirklichkeit ist.
Aber nun, nach dem, was ich Dir in diesem und dem vorhergehenden Briefe gesagt habe, wird es Dir weniger unbegreiflich vorkommen.
Ich wünsche sehr, daß diejenigen, die es gut mit mir meinen, begriffen, daß mein Tun und Lassen aus einem tiefen Gefühl und Liebesbedürfnis entspringt, daß Leichtsinn, Hochmut und Gleichgültigkeit nicht die Triebfeder sind, die die Maschine treiben, und daß, wenn ich diesen Schritt tue, dies ein Beweis dafür ist, daß ich meine Wurzeln bescheiden am Wege schlage. Ich glaube nicht, daß ich wohl daran täte, mich in einem höheren Stande zu versuchen oder viel an meinem Charakter zu ändern. Ich muß noch vieles erleben, noch viel hinzulernen, bevor ich reif sein werde; doch das ist eine Frage der Zeit und des Weiterarbeitens .......
t. à t. Vincent
Den Haag, Sonntagmorgen (wohl Mitte Juli 1882)
Lieber Theo! ......
Ich kann Dir gar nicht sagen, wie herrlich mir die Geräumigkeit des Ateliers ist, ich merke denn auch sofort den Einfluß davon, nun ich im Gange bin. Wir wollen sie lehren, von meinen Zeichnungen zu sagen: » Es sind nur die alten.«
Ich bin doch nicht zu meinem Vergnügen krank gewesen. Du mußt Dir also nur vorstellen, wie ich morgens schon um 4 Uhr an meinem Bodenfenster sitze, damit beschäftigt, mit meinem Perspektivrahmen die Wiesen und den Zimmerplatz zu studieren, wenn man die Öfen im Hofe anzündet, um Kaffee zu kochen, und der erste Arbeiter auf die Werft geschlendert kommt.
Über die roten Ziegeldächer kommt ein Flug weißer Tauben, zwischen den schwarzen rauchenden Schornsteinen hindurch. Aber dahinter eine Unendlichkeit feinen, zarten Grüns, Meilen und Meilen flachen Wiesenlandes und eine graue Luft, so still, so friedsam wie von Corot oder van Goyen.
Der Blick über die Firsten der Dächer, die Dachrinnen, in denen das Gras wächst, morgens ganz früh, und die ersten Zeichen des erwachenden Lebens – der Vogel, welcher fliegt, der Schornstein, der dort raucht, und das Figürchen ganz unten in der Tiefe, welches dahinschlendert –, das ist nun also das Sujet meines Aquarells. Ich hoffe, daß es Dir gefallen wird.
Ob es mir in Zukunft gut gehen wird, hängt, dünkt mich, mehr als von etwas anderem von meiner Arbeit ab.
Wenn ich nur auf den Beinen bleibe, wohlan, dann kämpfe ich meinen Kampf in der Stille auf diese Weise und keine andere, so also, daß ich aus meinem Fensterchen ganz lustig nach den Dingen der Natur schaue und sie getreu und mit Liebe zeichne.
Was den Rest betrifft, so werde ich, für den Fall etwaiger Belästigungen, einfach eine defensive Haltung annehmen, aber im übrigen habe ich das Zeichnen zu lieb, als daß ich Lust hätte, mich durch dergleichen, was es auch sei, davon abbringen zu lassen. Die sonderbaren Effekte der Perspektive intrigieren mich mehr als menschliche Intrigen.
Wenn es so stünde, daß T. besser begriffe, daß es mit meinem Malen ein ganz anderer Fall ist als mit den übrigen Dingen, dann würde ich nicht einen solchen Lärm schlagen.
Aber nun habe ich, in seinen Augen, Mauve betrogen und enttäuscht. Ferner denkt er, daß ich alles nur um des Geldes willen tue, welches ich von Dir bekomme. Ich finde das eine wie das andere absurd, zu absurd, um noch ferner etwas darauf zu geben. Mauve wird später wohl selbst begreifen, daß er sich in mir nicht betrogen hat und daß ich auch durchaus nicht widerwillig war. Er selbst allein brachte mich zu gewissenhafterem Zeichnen, bevor und ehe ich etwas anderes tat. Aber dann verstanden wir einander nicht richtig, wiederum wegen T.'s, der dahinter steckte.
Betreffs Deines Briefes will ich doch noch einmal sagen, daß ich nichts dafür kann, wenn Du von Siens Kind nichts wußtest; denn als ich Dir von ihr erzählte, habe ich ganz gewiß davon geschrieben, aber Du hast wahrscheinlich an das Kind gedacht, welches damals noch nicht zu den Bewohnern der Außenwelt gehörte.
Ich sprach schon mit einem Worte von der Humanität, wie sie manchmal in einem Menschen stecken kann, wie z. B. in Mme. François in Zolas Buch. Humanitären Plänen oder Ideen, so als ob ich nun einem jeden gegenüber in dieser Weise handeln zu können vermeinte, gelobe ich mich jedoch nicht, aber ich schäme mich nicht zu sagen, obwohl ich sehr gut weiß, daß das Wort Humanität schlecht angeschrieben steht, daß ich stets das Bedürfnis hatte und auch behalten werde, irgendein Geschöpf zu lieben. Ich habe einmal einen armseligen verbrannten Minenarbeiter verpflegt, sechs Wochen oder zwei Monate lang, ich habe mein Essen einen ganzen Winter mit einem alten Manne geteilt, ich weiß nicht, was noch mehr – und nun Sien. Aber ich glaube bis heute noch nicht, daß so etwas verrückt oder schlecht ist, ich finde vielmehr, es ist etwas so Natürliches und Selbstverständliches, daß ich nicht begreife, wie die Menschen für gewöhnlich so gleichgültig gegeneinander sein können. Ich füge noch hinzu, daß, wenn ich übel daran täte, Du auch schlecht handeltest, mir so getreu zu helfen – aber daß so etwas schlecht sein sollte, das ist doch einfach absurd. Ich glaube immer, daß das »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« keine Übertreibung ist, sondern der normale Zustand. Enfin. Und Du weißt, daß ich meine Kräfte bis aufs äußerste anspannen werde, um dafür zu sorgen, daß ich es bald zum Verkaufen bringe, um keinen Mißbrauch von Deiner Güte zu machen ...
t. à t. Vincent

17. Cafe-Terrasse am Abend. September 1888. Amsterdam. Rijksmuseum

Den Haag, 31. Juli 1882
Lieber Theo! Ein Wort, um Dir noch einmal guten Tag zu sagen, ehe Du selbst kommst. Ferner, um Dir den richtigen Empfang Deines Schreibens nebst dem Einliegenden zu bestätigen und um Dir herzlichst dafür zu danken.
Es war mir sehr willkommen; denn ich bin eifrig im Gange und habe wieder das eine und andere nötig.
Über das Schwarz in der Natur sind wir, soweit ich begreife, natürlich ganz einig. Absolutes Schwarz kommt eigentlich nicht vor. Es ist jedoch in beinahe allen Farben vorhanden, ebenso wie das Weiß, und bildet die unendlichen, in Ton und Kraft verschiedenen Variationen von Grau, so daß man also in der Natur nichts anderes als diese Töne oder Kraftunterschiede sieht.
Es gibt nur drei Grundfarben, Rot, Gelb, Blau. Die zusammengesetzten sind Bronze, Grün, Violett.
Daraus entstehen durch Beimischung von Schwarz und etwas Weiß die unendlichen Variationen von Grau: Rotgrau, Gelbgrau, Blaugrau, Orangegrau, Violettgrau.
Es ist z. B. unmöglich, zu sagen, wie viele verschiedene Grüngraus es gibt, es variiert ins Unendliche.
Die ganze Chemie der Farben ist nicht komplizierter als diese wenigen einfachen Grundprinzipien es sind, und ein guter Begriff davon ist mehr wert als siebzig verschiedene Farbtöne, da man mit den drei Hauptfarben und Weiß und Schwarz mehr als siebzig Töne herstellen kann. Ein Kolorist ist derjenige, der beim Sehen einer Farbe in der Natur diese ganz munter zu analysieren versteht und z. B. sagen kann: »das Grüngrau ist Gelb mit Schwarz und beinahe ohne Blau etc.«, und der, kurzum, die verschiedenen Graus der Natur auf der Palette herzustellen weiß. Um nun draußen Notizen oder um eine kleine Skizze zu machen, ist, ebenso wie für die weitere Ausführung, ein stark entwickeltes Gefühl für die Kontur absolutes Erfordernis.
Das nun wird einem, glaube ich, nicht von selbst, sondern erstens durch Beobachtung, sodann durch hartnäckiges Arbeiten und Suchen zuteil, und schließlich muß entschieden das Studium von Anatomie und Perspektive hinzukommen. Ich habe neben mir eine Landschaftsstudie von Roelofs, eine Federskizze, und ich kann Dir nicht sagen, wie ausdrucksvoll diese einfache Kontur ist. Alles ist darin. Ein anderes, noch sprechenderes Beispiel ist der große Holzschnitt »Bergère« von Millet, den Du mir voriges Jahr zeigtest und der mir stets in der Erinnerung geblieben ist, ferner z. B. die Federzeichnungen von Ostade und dem Bauern-Brueghel.
Wenn ich solche Resultate sehe, dann fühle ich am allerdeutlichsten die große Wichtigkeit der Kontur, und Du weißt, z. B. durch die »Sorrow«, daß ich mir viel Mühe gebe, mich in dieser Hinsicht hinaufzuarbeiten. Aber Du wirst, wenn Du ins Atelier kommst, sehen, daß ich, außer diesem Suchen nach der Kontur, entschieden auch Gefühl für Tonwerte habe, ebenso wie andere, und daß ich auch nichts dagegen habe, Aquarelle zu machen.
Allein diese stützen sich in erster Linie auf die Zeichnungen, und aus dem Zeichnen entspringen dann außer dem Aquarell vielerlei andere Zweige, die sich bei mir, gerade so wie bei jedem anderen, der mit Liebe arbeitet, zur gegebenen Zeit entwickeln werden. Ich habe den alten Deubel von Kopfweide noch einmal attackiert, und ich glaube, daß dieses das beste von den Aquarellen geworden ist. Eine düstere Landschaft, dieser tote Baum bei einem stillstehenden, mit Wasserlinsen bedeckten Tümpel, im Hintergrunde, wo Bahngleise einander kreuzen, eine Remise der rheinischen Eisenbahn, schwarze verräucherte Gebäude, ferner grüne Wiesen, ein Kohlenweg, und eine Luft mit jagenden grauen Wolken, einzelne mit leuchtend weißem Rande, und da, wo die Wolken sich gerade zerteilen, eine Tiefe von Blau.
Kurzum, ich habe es so machen wollen, wie, dünkt mich, der Bahnwärter in seinem blauen Kittel mit der roten Flagge es sehen und fühlen muß, wenn er denkt: »Wie trübe ist es heute.«
Ich arbeite dieser Tage mit vielem Vergnügen, obwohl ich wirklich noch Nachwehen meines Unwohlseins fühle.
Von den Zeichnungen, welche ich Dir zeigen werde, denke ich, daß sie Dir einen Beweis dafür geben werden, daß ich nicht nur auf derselben Höhe bleibe, sondern auch in einer Richtung weiterarbeite, die vernünftig ist. Was nun den Verkaufswert meiner Arbeiten betrifft, so habe ich da keine anderen Prätentionen, als daß es mich sehr wundern würde, wenn meine Arbeiten mit der Zeit nicht gerade so gut verkauft werden sollten wie die von anderen; ob das jetzt geschehen wird oder später, nun wohl, das lasse ich dahingestellt sein; allein getreu nach der Natur zu arbeiten, und zwar mit Hartnäckigkeit, das ist, dünkt mich, ein sicherer Weg, der nicht zu Wasser werden kann ......
Wenn ich sehe, wie manche Maler hier, die ich kenne, an ihren Aquarellen und Bildern so herummurksen, daß sie nicht mehr da herauskommen können, dann denke ich wohl einmal: »Mein Freund, es hapert an deinem Zeichnen.« Ich bedaure es keinen Augenblick, daß ich beim Aquarellieren und Malen geblieben bin. Ich weiß sicher, daß ich dies einholen werde, wenn ich nur noch etwas weiter schufte, so daß meine Hand beim Zeichnen und in der Perspektive nicht zaudert; aber wenn ich junge Maler aus dem Kopfe komponieren und zeichnen sehe, wenn sie dann, wiederum aus ihrem Kopfe, au hasard allerlei daraufschmieren, es sodann in einigem Abstand halten und eine tiefsinnige düstere Miene aufsetzen, um herauszufinden, welchen Dingen es um Gottes willen einigermaßen gleichen könnte, und wenn sie dann endlich, und immerfort aus dem Kopfe, irgend etwas daraus machen, dann wird mir manchmal weh und elend davon, und ich denke, daß dies doch verteufelt langweilig und unerträglich ist.
The whole thing makes me sick!
Doch die Herren fragen getreulich, nicht ohne eine gewisse protegierende Miene: »Ob ich schon beim Malen wäre?«
Nun überkommt es mich auch wohl einmal, daß ich dasitze und, sozusagen, au hasard auf einem Stückchen Papier herumspiele, aber dem messe ich nicht mehr Wert bei als einem Lumpen oder Holzschuh. Ich hoffe, Du wirst begreifen, daß ich, wenn ich noch immer ausschließlich beim Zeichnen bleibe, dies aus zwei Gründen tue. Deshalb nämlich, weil ich vor allen Dingen, coute que coute, mir eine feste Hand in der Zeichnung erwerben will, und zweitens, weil Malutensilien und Aquarell gehörige Unkosten mit sich bringen, von denen man in der ersten Zeit nichts zurückbekommt – Unkosten, die sich verdoppeln und verzehnfachen, wenn man auf einer Zeichnung arbeitet, die noch nicht korrekt genug ist. Und wenn ich mich in Schulden stürzte und mich mit Leinewänden und Papieren umgäbe, vollgeschmiert mit Farben, ohne meiner Zeichnung sicher zu sein, dann würde mein Atelier bald eine Art von Hölle werden – wie ich wirklich einmal ein Atelier gesehen habe, das mir so vorkam.
So aber komme ich immer mit Freuden in mein Atelier und arbeite mit Lust darin .......
t. à t. Vincent

18. Van Goghs Schlafzimmer in Arles. Oktober 1888. Kobe (Japan) Prinz Matsugaia

Den Haag, Sonnabend (wohl Anfang August 1882)
Lieber Theo! Noch ganz unter dem Eindruck Deines Besuches und nicht wenig erfreut, daß ich wieder ernstlich fortfahren kann zu malen, schreibe ich Dir noch ein Wort.
Ich hätte Dich am folgenden Morgen wohl noch gern zur Bahn gebracht, aber ich dachte, Du hättest mir schon so viel Zeit geschenkt, daß es indiskret gewesen wäre, wenn ich Dich noch um den folgenden Morgen gebeten hätte.
Ich bin Dir sehr dankbar dafür, daß Du einmal hier gewesen bist – ich finde es herrlich, wieder die Zuversicht auf ein Jahr geregelter Arbeit, ohne Kalamitäten zu haben; und durch das, was Du mir gegeben hast, habe ich obendrein im Malen noch einen neuen Horizont bekommen.
Ich rechne es mir als Vorrecht vor tausend anderen an, daß Du mir so viel Schlagbäume aus dem Wege räumst.
Es versteht sich von selbst, daß oft mancher der Unkosten wegen nicht vorwärts kommt, und wie dankbar ich dafür bin, daß ich geregelt arbeiten kann, nun, das kann ich Dir nicht in Worten sagen.
Um die Zeit einzuholen, um die ich später als andere begonnen habe, muß ich doppelt mein Bestes tun, doch selbst bei dem besten Willen müßte ich es aufgeben, wenn ich Dich nicht hätte.
Ich werde Dir einmal erzählen, was ich mir so alles angeschafft habe.
Erstens einen Kasten mit feuchten Aquarellfarben für Wasserfarben in Stücken oder Tuben, mit einem doppelt geschlagenen Deckel, welcher offen als Palette dient; zugleich ist Raum für etwa sechs Pinsel da.
Das ist ein Stück Material, das viel wert und beim Arbeiten im Freien eigentlich absolut notwendig ist, aber es ist eine ordentliche Ausgabe, und ich hatte es in Gedanken auf später verschoben und bisher mit losen Stücken auf Untertassen gearbeitet, die jedoch lästig mitzunehmen sind, besonders, wenn man noch andere Bagage hat.
Das ist nun ein schönes Stück, welches man für lange hat. Zugleich habe ich Aquarellfarben auf Vorrat genommen und meinen Pinselvorrat erneuert und vervollständigt.
So habe ich nun für das eigentliche Malen alles was nötig ist, und auch Farben im Vorrat, große Tuben, die viel billiger zu stehen kommen als kleine, aber Du begreifst, daß ich mich sowohl bei den Aquarell- wie bei den Ölfarben auf die einfachen Farben beschränkt habe: Ocker, Rot, Gelb, Braun, Kobalt- und Preußischblau, Neapelgelb, Terra di Siena, Schwarz und Weiß, außerdem etwas Karmin, Sepia, Zinnober, Ultramarin, Gummigutt in kleineren Tuben; der Farben, welche man selbst mischen muß, habe ich mich enthalten. Dies ist, glaube ich, eine praktische Palette mit gesunden Farben. Ultramarin, Karmin oder dergleichen fügt man hinzu für den Fall, daß es durchaus nötig ist.
Ich werde mit kleinen Dingen beginnen, aber ich hoffe, mich diesen Sommer doch noch für größere Skizzen mit Holzkohle zu üben, im Hinblick darauf, daß ich später in größerem Format malen könnte, und es ist dafür, daß ich wieder einen neuen und, wie ich hoffe, besseren Perspektivrahmen machen lasse, welcher z. B. auch auf unebenem Dünenboden feststeht, mit zwei Stützen.
Was wir in Scheveningen sahen, Sand, See und Luft, ist etwas, was ich ganz sicher in meinem Sehen auszudrücken hoffe.
Natürlich habe ich nicht alles, was Du mir gegeben hast, auf einmal ausgegeben – obwohl, das muß ich sagen, die Preise von diesem und jenem mir außerordentlich mißfielen, da, wenn man den Dingen nachgeht, mehr nötig ist, als es zunächst wohl scheint.
Wenn es mir angenehm sein würde, sofern Du mir zum 20. das Gewohnte schicken könntest, so ist es nicht deshalb, weil dann alles aufgebraucht sein wird, wohl aber, weil ich es ratsam finde, daß ich, wenn ich während der Arbeit merke, daß ich noch einzelne Dinge durchaus nötig habe, etwas in der Tasche habe. Das gibt eine große Ruhe und Ordnung in der Arbeit.
Der Aquarellkasten paßt in den Malkasten hinein, so daß ich das Erforderliche für Aquarell und zugleich für das Malen zur Not in einem Gegenstande mitnehmen kann.
Ich lege viel Wert darauf, gutes Material zu haben, und habe es gern, wenn mein Atelier gut aussieht, ohne Antiquitäten oder Teppiche und Draperien, aber durch die Studien an der Wand und durch gutes Werkzeug. Das muß durch das Arbeiten mit der Zeit kommen. Um von dem Wachtmeister zu sprechen – ich für meine Person fühle mich viel weniger als Wachtmeister denn als, z.B., etwa einen Delfter Schiffer, und ich habe nichts dagegen, daß es eine Art von gemütlicher »trekschuit« bei mir wird.
Gestern mittag war ich auf dem Boden der Papierhandlung von Schnulden auf der Laan. Weißt Du, was ich da gefunden habe? Das doppelte Ingres unter dem Namen Papier Torchon, es war eine Sorte, noch etwas rauher von Korn als das Deinige. Ich schicke Dir eine Probe, um es Dich sehen zu lassen. Es ist eine ganze Partie, alt und schon abgelagert, sehr gut. Nun habe ich nur ein halbes Buch davon bekommen, aber für später kann ich es dort immer finden. Ich war nun zu einem anderen Zwecke, nämlich wegen des Honigpapiers, das ich dann und wann verwende, dort; sehr billig aus einer nicht abgelieferten Bestellung des Kadaotus stammend.
Ich glaube, daß dieses für Kohle sehr geeignet ist, und es sind große Bogen, ein wenig getönt, ähnlich wie das Harding. Du siehst, diese Probe hat ein Korn so grob wie Segeltuch.
Was Du mitbrachtest, ist angenehmer von Farbe und herrlich z. B. für Studien von Grabenrändern und dem Boden. Ich bin sehr froh, daß ich diese neue Partie entdeckt habe ......
t. à t. Vincent
Den Haag, ohne Datum (wohl Anfang August 1882)
Lieber Theo! In meinem vorigen Briefe wirst Du eine kleine Skizze von dem bewußten Perspektivrahmen gefunden haben. Ich komme nun gerade vom Schmied, welcher die eisernen Spitzen an die Stöcke und eiserne Ecken an den Rahmen gemacht hat.
Dieser besteht aus zwei langen Pfählen; der Rahmen wird, in der Höhe oder Breite, mit starken hölzernen Pflöcken daran befestigt.
Dies macht, daß man auf dem Strande, auf der Wiese oder auf dem Acker einen Ausblick wie durch ein Fenster hat.
Die Lotlinien und Horizontalen des Rahmens, ferner die Diagonalen und das Kreuz – oder auch eine Einteilung in Quadrate – geben fest und sicher einige Hauptpunkte, mit deren Hilfe man eine genaue Zeichnung machen kann, welche die großen Linien und Proportionen angibt.
Dies wenigstens dann, wenn man Gefühl für die Perspektive hat, wenn man einen Begriff von den Gründen, dem Warum und der Weise hat, in der die Perspektive den Linien eine scheinbare Veränderung der Richtung und den Maßen und Flächen eine Veränderung in der Größe gibt. Ohne das hilft der Rahmen nichts, und man wird schwindelig, wenn man hindurchsieht.
Mich dünkt, Du wirst wohl fühlen, daß es ein herrliches Ding ist, dieses Visier auf die See zu richten, auf grüne Felder oder, im Winter, auf die beschneite Fläche, oder im Herbst auf das launige Netzwerk dünner und dicker Stämme und Zweige, oder auf eine Sturmflut.
Es setzt – bei vieler Übung und bei anhaltender Übung –- jemanden in den Stand, blitzschnell zu zeichnen, und, wenn die Zeichnung feststeht, blitzschnell zu malen.
Eigentlich ist das absolut nötig für das Malen; denn Luft, Boden, See, da muß der Pinsel hinzukommen, oder vielmehr, um diese durch das Zeichnen allein ausdrücken zu können, ist es nötig, die Behandlung des Pinsels zu kennen und zu fühlen. Ich glaube auch sicher, daß es auf mein Zeichnen noch sehr viel Einfluß haben wird, wenn ich einmal eine Zeitlang male. Im Januar habe ich das bereits probiert, dann wurde es jedoch wieder aufgegeben, der Grund hierfür war, außer ein paar anderen Dingen, entschieden auch der, daß ich noch zu unsicher im Zeichnen war. Nun ist ein halbes Jahr, ganz dem Zeichnen gewidmet, darüber hingegangen; nun wohl, mit frischem Mute beginne ich aufs neue. Der Rahmen ist wirklich ein schönes Stück Werkzeug geworden – es tut mir leid, daß Du ihn nicht noch einmal gesehen hast. Er kostet mich auch noch einen netten Batzen – aber ich habe ihn solide machen lassen, daß ich ihn nicht so bald verschleißen werde. Ich beginne also am Montag, große Kohlezeichnungen damit zu machen und kleine Studien zu malen, gelingen diese beiden Dinge, dann werden, hoffe ich, bald besser gemalte Sachen folgen.
Ich wünschte sehr, das Atelier wäre, bis Du wieder einmal zu mir kommst, ein echtes Maleratelier geworden.
Daß es im Januar nicht klappte, lag, wie Du weißt, an verschiedenen Ursachen, aber, après tout, das kann als eine Havarie an der Maschine betrachtet werden, als eine Schraube oder Stange, die nicht stark genug war und durch ein stärkeres Stück ersetzt werden mußte.
Was ich mir auch angeschafft habe, ist eine starke, warme Hose, und da ich, gerade bevor Du kamst, ein Paar starke Schuhe gekauft hatte, bin ich gegen Wind und Wetter gewappnet. Zugleich ist es meine entschiedene Absicht, durch dieses Landschaftsmalen einige Dinge der Technik zu lernen, von denen ich fühle, daß ich sie für die Figuren nötig habe, nämlich die verschiedenen Stoffe, den Ton und die Farbe, mit einem Worte, die Gesamtheit, die Maße der Dinge zum Ausdruck zu bringen. Dein Kommen hat mich veranlaßt, nun dazu überzugehen, aber schon ehe Du kamst, gab es keinen Tag, da ich nicht darüber nachgedacht hätte; nur hätte ich mich wohl noch länger ausschließlich auf Schwarz und Weiß und die Kontur beschränkt, nun aber bin ich mit einem Male im Kahn.
Adieu, lieber Kerl, nochmals einen herzlichen Händedruck und glaube mir.
t. à t. Vincent
Den Haag, Sonntagmittag (wohl Ende August 1882)
Lieber Theo! .......
Diese Woche habe ich im »Bosch« ein paar ziemlich große Studien gemalt, die ich versucht habe, weiter zu bringen und mehr durchzuarbeiten als die ersten, Die, von der ich glaube, daß sie am besten geglückt ist, ist nichts anderes als ein Stück umgegrabenen Bodens, weißer, schwarzer und brauner Sand nach einem Platzregen. Die Erdschollen fangen dann da und dort mehr Licht auf und sprechen stärker.
Als ich vor dem Stück Boden eine Zeitlang gezeichnet hatte, kam ein Gewitter mit gehörigem Platzregen, welches wohl eine Stunde dauerte. Ich war jedoch so versessen darauf, daß ich trotzdem auf dem Posten blieb und so gut wie möglich eine Zuflucht hinter einem dicken Baum suchte. Als es endlich vorbei war und die Krähen wieder auszufliegen anfingen, tat es mir nicht leid, gewartet zu haben, wegen des prächtigen, tiefen Tons, den der Waldboden nach dem Regen angenommen hatte. Da ich vor dem Sturm mit einem niedrigen Horizont begonnen hatte, also auf meinen Knien, mußte ich nun auf meinen Knien im Schlamme liegen, und wegen derartiger Abenteuer, die sich in verschiedener Form sehr oft einstellen, scheint es mir nicht überflüssig, einen gewöhnlichen Arbeiteranzug, an dem man nichts verderben kann, anzuhaben. Das Resultat war dieses Mal, daß ich das Stück Boden mit ins Atelier nehmen konnte, obgleich Mauve mir, als wir gelegentlich über eine Studie von ihm selber sprachen, wohl mit Recht gesagt hatte, daß es ein Stück Arbeit ist, die Erdschollen zu zeichnen und Tiefe hineinzubekommen. Die andere Studie aus dem »Bosch« gibt große grüne Buchenstämme auf einem Boden mit dürren Blättern und dem Figürchen eines Mädchens in Weiß. Da war die große Schwierigkeit, alles licht zu halten und Luft zwischen die Stämme, die in verschiedenen Entfernungen stehen, zu bringen, und den Standpunkt und die richtige Dicke der Stämme, wie die Perspektive sie verändert! Das so zu machen, daß man darin atmen und herumgehen kann –und den Wald riecht!
Diese zwei habe ich mit besonderem Vergnügen gemacht. Ebenso wie etwas, was ich in Scheveningen sah.
Eine große Ebene in den Dünen, morgens nach dem Regen, das Gras ist verhältnismäßig sehr grün, und darauf die schwarzen Netze in riesigen Kreisen ausgebreitet, wodurch auf dem Boden Töne von einem tiefen rötlichen Schwarz und Grau entstehen. Auf diesem düsteren Grunde saßen, standen oder liefen, wie seltsame grüne Schemen, Frauen mit weißen Mützen, und Männer, welche die Netze ausbreiteten und flickten.
Es war in der Natur so ergreifend eigenartig düster und streng, wie das Schönste, was man von Millet, Israëls oder de Groux sich denken kann. Über der Landschaft eine einfache graue Luft, mit hellen Streifen über dem Horizont.
Ich habe auch, trotz Regenschauer, auf einem Bogen geölten Torchons eine Studie davon gemacht.
Bis ich imstande bin, es darin weit zu bringen, muß noch viel geschehen, doch dies sind die Dinge, die mich in der Natur am meisten ergreifen. Wie ist es draußen doch schön, wenn alles naß ist vom Regen, vorher, während des Regens und nachher; ich dürfte eigentlich keinen Regenschauer vorübergehen lassen.
Heute morgen habe ich all die gemalten Studien einmal in meinem Atelier aufgehängt, ich wünschte, ich könnte einmal mit Dir darüber sprechen. Wie ich mir allerdings schon gedacht und worauf ich gerechnet hatte, während ich bei der Arbeit war, habe ich noch recht viel dazu kaufen müssen, und das Geld ist dabei beinahe draufgegangen.
Ich habe nun vierzehn Tage lang sozusagen von morgens früh bis abends spät gemalt, und wenn ich damit fortführe, würde es teuer zu stehen kommen, so lange ich nichts verkaufe.
Ich halte es für möglich, daß Du, wenn Du die Sachen sähest, sagen würdest, daß ich es nicht nur zeitweilig, wenn ich besonders Lust dazu hätte, sondern regelmäßig, als absolute Hauptsache durchsehen müßte, wenn es auch einige größere Unkosten mit sich brächte.
Aber wenn ich vorläufig – so außerordentlich gern ich selbst es tue – wegen der großen Unkosten wahrscheinlich nicht so viel malen werde, wie meine Lust daran und mein Ehrgeiz es wohl möchten, so rechne ich darauf, daß ich trotzdem nichts verliere, wenn ich, was ich nicht weniger gern tue, viel von meiner Zeit dem Zeichnen widme.
Jedoch, ich bin im Zweifel, denn das Malen ließ sich ziemlich gut an, und vielleicht wäre es der rechte Weg, alle Kraft daranzusetzen und sich hauptsächlich mit dem Pinsel zu quälen, aber, wie gesagt, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall – das Zeichnen mit Holzkohle ist eine Sache, von der ich sicher weiß, daß ich sie mehr als früher üben muß, auf jeden Fall habe ich genug zu tun und kann vorwärts; auch dann, wenn ich mich mit dem Malen etwas mäßige, kann ich genau so viel arbeiten.
Daß ich so zahlreiche Studien in kurzer Zeit gemacht habe, kommt daher, daß ich durcharbeite und daß ich buchstäblich den ganzen Tag durcharbeite, indem ich mir fast keine Zeit zum Essen und Trinken nehme. In verschiedenen Studien sind kleine Figürchen, ich habe auch an einer größeren gearbeitet und sie schon zweimal ganz abgekratzt, was Du vielleicht übereilt gefunden hättest, wenn Du den Effekt gesehen hättest; aber es war nicht übereilt, denn ich tat es, weil ich fühle, daß ich es bei etwas Quälen und Suchen noch besser kann, und das Bessere will ich absolut erreichen, es möge mehr oder weniger Zeit, mehr oder weniger Mühe kosten.
Die Landschaft, wie ich sie nun in Angriff genommen habe, erfordert bestimmt auch Figuren, es sind Studien für Hintergründe, die man durch und durch studieren muß, weil der Ton der Figur und die Wirkung des Ganzen davon abhängt«
Was ich so angenehm beim Malen finde ist, daß man mit derselben Mühe, die eine Zeichnung macht, etwas mit nach Hause bringt, das den Eindruck viel mehr wiedergibt und viel angenehmer zu sehen und zugleich auch richtiger ist.
Kurzum, es ist dankbarer als das Zeichnen. Allein es erfordert absolut, daß man, bevor man anfängt, die richtige Proportion und den richtigen Standpunkt der Gegenstände mit hinreichender Sicherheit zeichnen kann. Irrt man sich darin, dann wird nichts daraus.
Ich freue mich auf den Herbst, bis zu der Zeit muß ich bestimmt sorgen, wieder Farben und verschiedene Dinge im Vorrat zu haben. Ich liebe so ganz besonders die Effekte mit gelbem Laub, gegen das die grünen Buchenstämme so schön stehen und die Figuren nicht minder .......
t. à t. Vincent
Den Haag, ohne Datum (Herbst 1882)
Lieber Theo! Die Wochen gehen schnell dahin – und wir haben schon wieder Sonntag.
Ich war dieser Tage noch einige Male in Scheveningen und traf es an einem Abend sehr nett mit der Ankunft einer Pinke.
Bei dem Monument steht eine Bretterbude, wo ein Kerl auf dem Auslug sitzt. Sobald die Pinke sich deutlich sichtbar näherte, kam der Kerl mit einer großen blauen Flagge zum Vorschein, gefolgt von einer Bande kleinen Gemüses von Kindern, welche ihm nicht bis an die Knie reichten. Es war für sie augenscheinlich ein großes Vergnügen, bei dem Manne mit der Flagge zu stehen, und sie bildeten sich sicher ein, auf diese Weise bei der Ankunft der Pinke mitzuhelfen.
Ein paar Minuten, nachdem der Mann seine Flagge geschwenkt hatte, kam ein Kerl auf einem alten Pferde herbei, der den Anker holen mußte. Darauf gesellten sich zu dieser Gruppe verschiedene Männer und Frauen – auch Mütter mit Kindern –, um die Bemannung zu empfangen.
Als das Schiff nahe genug heran war, ging der Kerl zu Pferde in See und kam mit dem Anker zurück. Danach wurden die Männer auf dem Rücken von Kerlen mit hohen Wasserstiefeln an den Strand gebracht, und bei jedem neuen Ankömmling gab es einen tüchtigen Willkommlärm.
Als sie alle da waren, marschierte die ganze Herde nach Hause wie ein Trupp Schafe oder eine Karawane, über die der Kerl auf dem Kamele, ich meine auf dem Pferde, wie ein mächtiger Schatten hinausragte.
Natürlich habe ich diese verschiedenen Vorgänge mit meiner ganzen Aufmerksamkeit zu skizzieren versucht.
Ich habe auch etwas davon gemalt, nämlich die kleine Gruppe, welche ich hier für Dich hingekritzelt habe.
Sodann malte ich eine Studie von einer Marine, nichts als ein Stückchen Sand, See und Luft grau und einsam; zuweilen habe ich ein Bedürfnis nach dieser Ruhe – wo nichts ist als die graue See, mit einem einsamen Seevogel, und keine andere Stimme ertönt als das Rauschen der Wellen. Es hilft mir, mich einmal von dem Lärm der Geest oder des Kartoffelmarktes zu erholen.
Im übrigen habe ich diese Woche meistens an Skizzen und Aquarellen gearbeitet.
Das große Aquarell von der Bank habe ich auch ein Stück weiter gebracht, und dann habe ich noch eine Skizze von Frauen in dem Garten des Armenhauses und ein Stück von der Geest gemacht.
Du siehst an der beiliegenden Skizze dieser Volksgruppen, welche das eine oder andere tun, was ich suche.
Aber wie schwer ist es, Leben und Bewegung da hineinzubringen, die Figuren auf ihren Platz zu stellen und sie voneinander loszumachen. Das ist die große Frage: » moutonner«: Gruppen, Figuren, die, ein Ganzes bildend, mit den Köpfen und Schultern doch einer über den anderen wegsehen, während auf dem Vordergrunde die Beine der ersten Gestalten sich kräftig abheben und höher hinauf die Röcke und Hosenbeine wieder eine Art Durcheinander bilden, in dem aber noch viel Zeichnung ist.
Dann rechts oder links, je nach der Lage des Augenpunktes, die größere Ausdehnung oder Verkürzung der Seiten. Was die Komposition angeht, so basieren alle möglichen Szenen mit Figuren, sei es ein Markt, die Ankunft eines Schiffes, ein Haufen Volks in einer Volksküche oder im Wartesaal, sei es das Armenhaus oder das Leihhaus, seien es Gruppen, welche am Strande spazieren gehen und plaudern, auf demselben Prinzip der Schafherde – woher übrigens sicher das Wort »moutonner« kommt –, und alles läuft auf dieselben Fragen von Licht und Schatten und Perspektive hinaus. Der Effekt des Kastanienbaumes, den Du in Deinem letzten Brief beschreibst, findet sich auch hier, wie Du an der Zeichnung mit der Bank bemerkt haben wirst, allein hier sieht man nur erst ganz wenig von den neuen grünen Blättchen, obgleich ich vor kurzem auch dies beobachtete; aber sie sind hier infolge des vielen stürmischen Wetters verdorrt.
Das Laub wird, hier bei uns, vielleicht schon bald endgültig fallen, und ich hoffe, dann noch viele Studien vom Bosch zu malen, und vom Strande nicht minder; denn obwohl es da keine Effekte von Herbstblättern gibt, übt doch das eigenartige Licht der Herbstabende seine Wirkung aus, und es ist dort wie überall in dieser Zeit doppelt schön.
Ich sitze ein wenig in der Klemme mit der Farbe, und mit dem einen und anderen außerdem, aber Du weißt, ich kann auf verschiedene Manier in meiner Arbeit abwechseln, und es ist und bleibt so unendlich viel zu zeichnen; denn die Volksgruppe der beiliegenden Skizze variiert ins Unendliche und erheischt unzählige besondere Studien und Skizzen von einzelnen Figürchen, die man wie im Fluge auf der Straße auffangen muß. Auf diese Weise muß allmählich Charakter und Bedeutung hineinkommen. So habe ich unlängst eine Studie von Herren und Damen auf dem Strande gezeichnet – ein Getriebe von Spaziergängern. Ich würde es immer angenehm finden, wenn ich früher oder später, nach noch länger fortgesetzter Bemühung, Zeichnungen zu Illustrationen liefern könnte. Vielleicht entspringt das eine aus dem anderen. Weiterarbeiten ist die Frage. Ich hoffe von Herzen, daß es Dir gut geht, und ich empfehle mich sehr für alle Neuigkeiten, welche Dich und die Dinge betreffen, die Dich in Deiner Umgebung berühren.
Adieu, mit einem herzlichen Händedruck
t. à t. Vincent
Ich bin so besorgt, daß Du durch das, wovon Du schreibst, vielleicht sehr in Ungelegenheiten geraten bist, und hoffe sehr, daß es ins reine kommen wird.
Du siehst an dieser Skizze, daß ich begonnen habe, wovon ich in meinem vorigen Briefe sprach – nämlich, ich versuche nun unablässig, Szenen von Arbeitern und Fischern, die ich so sehe, zu notieren, indem ich sie zeichne oder male, und gerade das sind die Dinge, welche, glaube ich, wenn ich mich darin übe, sich als Illustrationen würden verwenden lassen. Es versteht sich von selbst, daß dafür die Typen aber noch viel weiter gebracht werden müssen!
Ich habe von der Ankunft der Pinke sicher wohl an 10 verschiedene Momente, so auch von dem Lichten des Ankers; die Zeichnung davon schickte ich Dir in dem vorigen Briefe.
Den Haag, ohne Datum (Herbst 1882)
Lieber Theo! Derweil ich Dir schreibe, habe ich meinen letzten Gulden bereits so ziemlich verbraucht.
Wohl hege ich die Hoffnung, dieser Tage von Dir zu hören, doch in Erwägung dessen, was Du mir kürzlich schriebst, halte ich es für wohl möglich, daß Du vielleicht gerade am Zwanzigsten das Gewohnte nicht entbehren kannst.
Für diesen Fall wollte ich Dich ersuchen, doch zu schicken, was Du verfügbar hast, mehr oder weniger, auch wenn es nur ein kleiner Teil davon sein kann. Freitagmittag bekomme ich Modell, einen alten Mann aus dem Armenhause, und ich möchte ihn nicht gern unbezahlt fortschicken.
Ich habe noch eine Extraausgabe gehabt, da mein Malkasten entzwei ging, als ich von einer Höhe herabsprang, um so schnell wie möglich zu meinen Sachen zu kommen – ich mußte nämlich auf dem Terrain der Rheinischen Eisenbahn, da, wo man die Steinkohlen verlädt, einem scheu gewordenen Pferde aus dem Wege gehen. Es ist dort sehr schön – ich habe, da es kein öffentliches Terrain ist, um die Erlaubnis bitten müssen, dort malen zu dürfen, und nun hoffe ich oft dort zu sein.
Vorläufig habe ich bei dieser Gelegenheit die Steinkohlenhaufen dort, an denen Kerle herumhantieren, und wo eine Karre mit einem Pferd stand, gemalt.
Ferner machte ich noch eine Studie von einem Hofje mit einer Bleiche und Sonnenblumen.
Es ist prachtvoll draußen, die Blätter haben allerlei Bronzetöne, grün, gelb, rötlich, alles warm und satt.
Wie sehr wünschte ich, daß Du die Geschichte einmal beisammen sehen könntest. Seit Deinem Besuche hat das Atelier schon ein ganz anderes Aussehen bekommen.
Es ist wahr, daß ich etwas Tüchtiges ausgeben mußte, aber nun hängt dort auch eine ganze Menge gemalter Studien.
Das Hofje und diese Kohlengeschichte waren so schön, daß ich nicht davon ablassen konnte, obgleich ich, wegen der Farben, diese Woche hatte zeichnen wollen.
Ich möchte gern, und darauf arbeite ich nun hin, solche Dinge in mein Atelier bringen, die mir jeden Morgen, wenn ich sie ansehe, das eine oder andere von draußen in Erinnerung bringen, so daß ich sofort weiß, was an diesem Tage zu tun ist, sofort zu irgend etwas Lust habe, und daß ich fühle, ich muß noch einmal hierhin oder dorthin.
Dir einmal eine gemalte Studie zu schicken – nun, ich habe nichts dagegen, allein bevor ich es tue, müssen wir ein paar Dinge verabreden.
Jemand wie Mauve – jeder Künstler – hat ganz gewiß seine eigene Farbenskala, aber niemand hat sie am ersten Tage, und in draußen gemalten Studien kommt dergleichen nicht so direkt zutage, selbst bei Malern, die viel erfahrener sind als ich.
Um nur die Studien von Mauve zu nennen, die ich sehr schön finde, gerade wegen ihrer Einfachheit und weil sie mit so viel Treue gemacht sind, nun, so fehlt ihnen doch ein gewisser Reiz, den die Bilder, die draußen entstehen, in hohem Maße haben.
Und mit mir steht es nun so, daß z. B. die Marine, welche ich zuletzt nach Hause brachte, schon ganz anders von Farbe ist als die erste und zweite, mit denen ich begann, so daß Du nach dem, was ich Dir nun schicken könnte, noch kein Urteil über mein Kolorit fällen dürftest; und wenn ich meinerseits mit dem Schicken lieber noch warten möchte, bis alles erst etwas reifer sein wird, so ist es nur deshalb, weil ich glaube, daß ich mich, was die Farbe und ebenso, was die Komposition anlangt, noch sehr oft ändern werde.
Das ist also das Erste, und das Zweite ist dies, daß Studien, welche man draußen macht, etwas anderes sind als Bilder, die dazu bestimmt sind, in die Welt hinaus zu gehen, Bilder, die aus den Studien entstehen, sich aber, meines Erachtens, doch sehr davon unterscheiden dürfen und selbst müssen; denn in dem Bilde gibt der Maler mehr eine persönliche Idee, und in einer Studie ist es seine Absicht, einfach ein Stück Natur zu analysieren, sei es, um seinem Gedanken oder seiner Konzeption zur Richtigkeit, sei es, um sich zu einem Gedanken zu verhelfen.
Studien gehören also mehr ins Atelier als in den Handel und dürfen nicht unter demselben Gesichtspunkt betrachtet werden wie Bilder. Nun, ich denke, daß Du es auch wohl in diesem Sinne betrachten und diese Dinge selbst in Erwägung ziehen wirst.
Schreibe mir jedoch noch einmal, was Du willst, das ich tun soll und wisse, daß ich es mit dem Schicken oder Nichtschicken so machen werde, wie es Deiner Meinung nach am besten ist.
Am liebsten aber hätte ich, daß Du einmal alles beisammen sehen könntest – besteht die Möglichkeit, daß Du im Laufe des Winters noch einmal kommst?
Ist das der Fall, dann nehme ich als sicher an, daß es besser ist, wenn ich nichts schicke.
Enfin. Aber Du mußt wissen, daß ich auf Dinge, die Du mir etwa im Hinblick auf die Verkäuflichkeit der Arbeiten sagen willst, recht gern achten und daß ich sie im Auge behalten will; denke nicht, daß ich Deine Meinung gering achte.
Das Studienmachen betrachte ich als Säen, und das Bildermalen ist das Ernten.
Ich glaube, daß man viel gesünder denkt, wenn die Gedanken dem direkten Kontakt mit den Dingen entspringen, als wenn man die Dinge mit der Absicht betrachtet, dieses oder jenes darin zu finden.
So ist es nun auch mit der Frage des Kolorits. Es gibt Farben, welche von selbst schön zueinander stehen – aber ich tue mein Bestes, um es so zu machen, wie ich es sehe, bevor ich darauf hinarbeite, es so zu machen, wie ich es fühle.
Und doch, das Gefühl ist eine große Sache, und ohne das würde man nichts zustande bringen.
Manchmal habe ich wohl ein Verlangen nach der Zeit der Ernte, das heißt nach der Zeit, da ich, mittels des Studiums, die Natur so in mich aufgenommen haben werde, daß ich dann mit einem Bilde selbst etwas werde hervorbringen können. Aber das Analysieren der Dinge ist mir übrigens keine Last oder etwas, was ich nicht gern täte. – Es ist schon spät, ich kann gegenwärtig so schlecht schlafen, aber es ist wohl diese prachtvolle Herbstnatur, welche mir im Kopfe steckt, und die Sorge, etwas davon zu profitieren.
Ich wünschte jedoch, ich könnte zur rechten Zeit schlafen, und tue mein Bestes dafür; denn ich werde nervös davon, aber nichts hilft.
Wie geht es Dir wohl – ich hoffe, daß Du nicht allzu viel Sorgen hast; denn das bringt einen nicht vorwärts. Ich glaube, wenn ich nicht so viel in der freiem Luft wäre und weniger Lust zum Malen hätte, würde ich schnell elend werden. Aber draußen sein und an etwas arbeiten, das einen animiert, das sind Dinge, welche die Kräfte erneuern und erhalten. Es ist nur zuzeiten, da ich übermüdet bin, daß ich mich durch und durch elend fühle, aber sonst glaube ich, daß ich, was die Gesundheit angeht, wieder obenauf kommen werde.
Adieu, empfange in Gedanken einen Händedruck und schreibe einmal, wie ich es machen soll.
Soll ich Dir eine gemalte Studie schicken oder nicht? Und wisse, daß ich jeden Tag an Dich denke und glaube mir
t. à t. Vincent
Den Haag, ohne Datum (wohl Anfang Dezember 1882)
Lieber Theo! .......
Ich habe jetzt wieder zwei Zeichnungen – die eine: ein Mann, der in der Bibel liest, die andere: ein Mann, der vor seinem Mittagsmahl, das auf dem Tische steht, sein Gebet verrichtet. Beide sind ganz gewiß von einer Stimmung, die man altmodisch nennen könnte, es sind wiederum Figuren wie das alte Männchen mit dem Kopf zwischen den Händen.
Das Tischgebet ist, glaube ich, die bessere Zeichnung, doch die beiden ergänzen einander. Auf der einen hat man einen Blick durch das Fenster auf die beschneiten Furchen.
Ich habe mit diesen beiden Zeichnungen und mit der früheren des alten Männchens dasselbe, nämlich die eigenartige Stimmung von Weihnachten und Silvester, zum Ausdruck bringen wollen.
In Holland wie in England haben diese immer noch etwas Religiöses, eigentlich haben sie es überall, wenigstens ist es auch in der Bretagne und im Elsaß so. Ob man nun gerade immer mit der Form dieser Dinge einverstanden sein muß, wollen wir dahin gestellt sein lassen – doch sicherlich ist etwas darin, wovor man, wenn es aufrichtig ist, Respekt hat, und ich meinerseits bringe dergleichen ein starkes Mitempfinden entgegen, ja ich habe sogar ein Bedürfnis danach, denn ich habe genau so gut wie irgend so ein altes Männchen den Glauben an quelque chose là-haut, auch wenn ich nicht bestimmt weiß, wie es oder was dort sein wird. Ich finde den Ausspruch von Victor Hugo sehr schön: les religions passent, mais Dieu demeure.
Und ein schönes Wort Gavarnis ist, finde ich, dieses: il s'agit de saisir ce qui ne passe pas dans ce qui passe.
Eines von den Dingen »qui ne passeront pas« ist das quelque chose là-haut, der Glaube an Gott, wenn sich seine Form auch wandelt, eine Wandlung, die ebenso notwendig ist wie die Erneuerung des Laubes im Frühling. Doch Du wirst nun hiernach wohl begreifen, daß es nicht meine Absicht ist, in den Zeichnungen irgendeine bestimmte Form des Glaubens auszudrücken – doch, daß ich die Weihnachts- und Silvesterstimmung durchaus respektiere, das will ich allerdings zeigen.
Und wenn Stimmung oder Ausdruck hineingekommen ist, dann ist es deshalb, weil ich selbst Empfinden für diese Dinge habe.
Ich fühle mehr und mehr, daß es sich schwer entscheiden läßt, welche Art des Arbeitens die beste ist. Es gibt so viel Schönes auf der einen und so vieles auf der anderen Seite, dabei auch noch so viel Verkehrtes, daß man zuweilen nicht mehr weiß, welchen Weg man wählen soll. Auf jeden Fall aber muß man arbeiten. Ich meinesteils nun glaube nicht, daß ich mich nicht irren könnte, denn ich bin mir vieler Irrungen zu sehr bewußt, als daß ich sagen möchte, dies ist die gute Art und das ist die schlechte. Das versteht sich von selbst. Aber ich bin nicht gleichgültig, und ich halte es für verkehrt, es zu sein, denn ich glaube, zu einem Streben, das Rechte zu tun, ist man auch dann verpflichtet, wenn man weiß, daß man nicht ohne Fehler zu begehen, daß man nicht ohne Reue oder Sorgen durch die Welt kommen wird. Ich las einmal irgendwo: Some good must come by clinging to the right. Was weiß ich davon, ob ich dieses oder jenes Ziel erreichen werde, wie kann ich im voraus wissen, ob sich die Schwierigkeiten werden überwinden lassen.
Man muß schweigend weiterarbeiten und den Ausgang abwarten. Verschließt sich die eine Aussicht, so öffnet sich an ihrer Stelle vielleicht eine andere – eine Aussicht muß da sein, und eine Zukunft ebenso, wenn man auch ihre Geographie nicht kennt. Das Gewissen ist der Kompaß der Menschen, und obgleich zuweilen Abweichungen der Nadel vorkommen, obgleich man, vor allem, Ungenauigkeiten begeht, selbst während man sich danach zu richten versucht, so muß man doch sein Möglichstes tun, um seinen Kurs darauf zuzuhalten .......
t. à t. Vincent
Den Haag, ohne Datum (Sommer 1883)
Lieber Theo! Heute morgen kommt ein Mann zu mir, der vor drei Wochen eine Reparatur an meiner Lampe gemacht hat und dem ich zugleich einiges irdenes Geschirr, das er selbst mir aufgedrungen hat, abgekauft habe.
Er macht mir Vorwürfe, weil ich seinen Nachbarn kürzlich bezahlt hätte und ihn nicht, und das mit dem nötigen Lärm, Fluchen und Schelten etc. Ich sage ihm, daß ich ihn bezahlen würde, sobald ich Geld erhalte, daß ich es aber im Moment nicht habe – und das ist Öl aufs Feuer. Ich ersuche ihn, fortzugehen, und endlich schiebe ich ihn zur Tür hinaus, aber er, der es vielleicht gerade darauf wollte ankommen lassen, packt mich am Nacken und wirft mich so gegen die Mauer, daß ich lang am Boden liege.
Das ist etwas, woran Du sehen kannst, mit welchen petites misères man zu kämpfen hat. So ein Kerl ist stärker als ich, nicht wahr – und die Leute genieren sich nicht. Nun, und solcher Art sind alle die kleinen Ladenbesitzer etc., mit denen man für seine täglichen Bedürfnisse zu tun hat. Sie kommen ungerufen zu einem und fragen, ob man dieses oder jenes von ihnen nehmen will und bitten um die Kundschaft, auch wenn man zu einem anderen geht – aber wenn man sie dann unglücklicherweise einmal länger als acht Tage auf die Bezahlung warten lassen muß, dann gibt es Zank und Streit. Nun, sie sind einmal so, und was kann man schließlich dagegen sagen – sie sitzen manchmal ja auch selbst in der Klemme. Ich berichte Dir diesen Fall, um Dir zu zeigen, wie notwendig es ist, daß ich etwas Geld verdiene.
Als ich nach Scheveningen ging, habe ich wieder einige Leute warten lassen müssen. Ich bin einigermaßen in Sorge, Bruder, und habe ziemlich viel Verdruß und Mühe. Ich verlange nach Deinem Kommen, weil ich mich gern entscheiden möchte, ob ich umziehen soll oder nicht. Um mich hier halten zu können, müßte ich etwas mehr verdienen – das Wenige, das mir fehlt, macht das Leben hier für mich unhaltbar. Die Arbeit glückt mir übrigens trotzdem, denn alle petites misères können weder meine Lust daran verringern, noch es dahin bringen, daß ich nicht doch das eine oder andere zustande bringe.
Bei de Bock stehen ein paar kleine Marinen, eine mit stürmischer und eine mit ruhiger See – ein Genre, in dem auch ich außerordentlich gern arbeiten möchte. Gestern machte ich eine Bauernwohnung mit rotem Dach unter hohen Bäumen.
Nun, das Malen von Figurenstudien würde mir, glaube ich, für viele Dinge von Nutzen sein; ich habe es mit einem Jungen im Kartoffelfeld und einem im Garten bei einem Rohrzaun angefangen. Doch ich müßte es energisch angreifen können. Der Vorfall von heute morgen zeigt mir, daß es meine Pflicht ist, Rat zu schaffen – ich muß mich in bezug auf das Wohnen einschränken, etwa so, daß ich, wenn sich mir hier keine Aussicht auf ein wenig mehr Bewegungsfreiheit zeigt, in ein kleines Dorf übersiedle. Das Atelier hier ist sonst praktisch genug, und an schönen Motiven fehlt es hier nicht. Die See hat man auch nicht überall.
Es ist wahr, daß ich mich, wie ich Dir sagte, nicht kräftig fühle – es haben sich jetzt Schmerzen zwischen den Schulterblättern und am Lendenwirbel eingestellt; das habe ich zuweilen zwar häufiger, aber ich weiß aus Erfahrung, daß man dann ein wenig vorsichtig sein muß, denn anderenfalls wird man zu schwach, und kann man sich nicht wieder so leicht davon erholen.
Ich gebe es so ziemlich auf. Meine Verhältnisse sind in der letzten Zeit zu drückend gewesen, und mein Plan, durch hartnäckiges, vernünftiges Arbeiten Freunde von früher zurückzugewinnen, ist fehlgeschlagen.
Theo, es wäre vielleicht gut, wenn wir einmal eine gewisse Angelegenheit besprächen – ich sage nicht, daß jetzt gleich die Rede davon sein muß, aber die Tage könnten noch düsterer werden, und für diesen Fall möchte ich eine Verabredung mit Dir treffen.
Meine Studien und alles, was an Arbeiten im Atelier ist, sind ganz und gar Dein Eigentum. Augenblicklich – ich wiederhole es – ist noch nicht die Rede davon, aber nächstens könnte man, z. B. wegen Nichtbezahlens von Steuern, doch einmal die Sachen verkaufen wollen, und im Hinblick auf diesen Fall möchte ich die Arbeiten gern in Sicherheit und aus dem Hause bringen. Es sind meine Studien, die ich für spätere Arbeiten schwer entbehren kann, Sachen, die mir viel Mühe gemacht haben.
Hier in der Straße gibt es bis heute keinen einzigen, der Steuern zahlt; trotzdem aber sind alle auf verschiedene Summen veranlagt, auch ich, die Schätzungskommission ist zweimal zu mir gekommen; ich habe ihnen nur meine 4 Küchenstühle und den ungestrichenen Tisch gezeigt und ihnen gesagt, ich könnte nach dem Gesetz nicht so hoch veranschlagt werden. Und wenn sie bei einem Maler Teppiche, Klaviere, Antiquitäten etc. fänden, dann hätten sie vielleicht nicht unrecht, einen solchen Mann als zahlungsfähig anzukreiden – ich aber könnte nicht einmal meine Farbenrechnungen bezahlen, und es gäbe bei mir keine Luxusgegenstände, wohl aber Kinder, also, es sei bei mir nichts für sie zu holen.
Darauf haben sie mir Mahnzettel geschickt, aber ich habe mich nicht darum gekümmert und ihnen, als sie einmal deshalb wiederkamen, gesagt, es sei nutzlos, sie zu schicken, weil ich einfach meine Pfeife damit anzündete. Ich hätte eben nichts, und meine 4 Stühle, mein Tisch etc, brächten doch nichts ein, sie seien neu nicht die Summe wert gewesen, zu der sie mich veranschlagen wollten.
Seitdem haben sie mich denn auch in Ruhe gelassen, jetzt schon seit Monaten und die anderen Leute hier in der Straße bezahlen auch nicht. Aber da wir nun einmal darüber sprechen, wünschte ich, ich wüßte, wo ich meine Studien nötigenfalls in Sicherheit bringen könnte. Nun, vielleicht könnte ich sie zu v. d. Weele oder irgendeinem anderen bringen, ebenso mein Malergerät.
Ich habe immer noch eine gewisse Hoffnung, daß Du, wenn Du ins Atelier kommst, Sachen finden wirst, für die sich, wenn sie auch keinen bestimmten Handelswert haben, vielleicht doch ein Liebhaber auftreiben ließe.
An fertigen Arbeiten fehlt es nicht.
Ich habe, après tout, im Grunde genommen kein Gefühl von Mutlosigkeit, im Gegenteil, ich kann dem beistimmen, was ich unlängst in Zola las: »Si à présent je vaux quelque chose, c'est que je suis seul, et que je hais les niais, les impuissants, les cyniques, les railleurs, idiots et bêtes.« Aber dessen ungeachtet ist es doch recht wohl möglich, daß ich, wenn ich hier bleibe, der Belagerung nicht werde standhalten können. Gerade, weil dies alles noch im Anfang ist, schreibe ich Dir schon jetzt davon. Der beste Ausweg wäre vielleicht, wenn man es mit einer billigeren Wohnung versuchte .......
t. à t. Vincent
Den Haag, ohne Datum (Sommer 1883)
Lieber Theo! Zu meiner Überraschung kam gestern noch ein Brief von Dir mit einliegender Banknote. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich mich darüber freute und daß ich Dir recht herzlich dafür danke. Aber die Banknote wollte man nicht wechseln, weil sie zu zerrissen war. Ich habe jedoch schließlich frcs. 10.– dafür bekommen; man hat sie nach Paris geschickt, und wenn die Bank sie zurückweist, dann muß ich die frcs. 10.–, über die ich eine Quittung ausgestellt habe, zurückerstatten, wechselt die Bank sie aber ein, dann bekomme ich später den Rest.
Du schreibst in Deinem Briefe von dem inneren Kampf, den man durchmachen kann angesichts der Frage, ob man für die unglücklichen Folgen einer guten Tat verantwortlich ist – ob man nicht besser daran täte, so zu handeln, daß einem selbst kein Unheil widerfahren kann, ob man gleich weiß, daß man dann nicht das Rechte tut – nun, diesen Kampf kenne ich auch.
Wenn man auf sein Gewissen hört – das Gewissen ist für mich das entscheidende Gebot, das Gebot aller Gebote –, dann kommt man zuweilen in Versuchung, zu glauben, daß man verkehrt oder töricht gehandelt hat, und vor allem, man gerät außer Fassung, wenn man oberflächlichere Menschen sich freuen sieht, weil sie so viel weiser sind und so viel besser durchkommen. Ja, dann hat man es oft schwer, und wenn schließlich noch Verhältnisse eintreten, die die Schwierigkeiten bis zur Springflut anwachsen lassen, dann kann es so weit kommen, daß es einem leid tut, daß man so ist wie man ist, und daß man wünscht, man wäre weniger gewissenhaft gewesen.
Ich hoffe, Du wirst von mir nichts anderes denken, als daß auch ich fortwährend denselben inneren Kampf kämpfe, und daß auch ich oft ein übermüdetes Gehirn habe, weil ich in vielen Fällen nicht weiß, wie ich mich in gewissen Fragen entscheiden soll, und was zu tun besser wäre.
Während ich arbeite, fühle ich ein unbestimmtes Vertrauen in die Kunst und glaube, daß ich es erreichen werde, aber an Tagen physischer Übermüdung oder wenn es finanzielle Hindernisse gibt, dann wird dieser Glaube weniger sicher, und dann übermannt mich der Zweifel, den ich aber zu überwinden versuche, indem ich gleich wieder tüchtig zugreife.
Und so geht es mir auch der Frau und den Kindern gegenüber – wenn ich bei ihnen bin und das kleine Kerlchen kommt auf allen Vieren zu mir gekrochen, krähend vor Vergnügen, dann zweifle ich nicht im geringsten, daß alles in Ordnung ist.
Das Kind hat mich schon sehr oft beruhigt.
Wenn ich zu Hause bin, kann ich ihn nicht los werden; bin ich bei der Arbeit, dann zieht er mich am Rock oder er arbeitet sich an meinem Bein in die Höhe, bis ich ihn auf den Schoß nehme. Im Atelier kräht er alles an, spielt stundenlang ruhig mit einem Stück Papier, einem Stück Bindfaden oder einem alten Pinsel – er ist ein Kind, das beinahe immer vergnügt ist, und wenn er sich sein Leben lang diese Laune bewahrt, dann wird er gewandter werden als ich.
Nun, was soll man darüber sagen – man fühlt nun einmal zuweilen, daß es ein gewisses Verhängnis gibt, welches das Gute verkehrt, das Verkehrte gut ausgehen läßt.
Ich glaube, daß man das Recht hat, solche Gedanken als zum Teil durch Überanstrengung hervorgerufen zu betrachten, und daß man, wenn sie einem zuweilen auch zu schaffen machen, sich deshalb nicht verpflichtet fühlen muß, zu glauben, daß die Dinge in Wirklichkeit so schwarz aussehen, wie man sie sieht; im Gegenteil, es ist dann, weil man wahnsinnig werden könnte, wenn man darüber grübeln würde, vernünftig, sich körperlich zu kräftigen, und wenn das geschehen ist, dann muß man einmal tüchtig die Hände rühren, und hilft auch das nicht, dann soll man trotzdem diese beiden Mittel immer weiter anwenden und es als etwas Verhängnisvolles betrachten, wenn die Melancholie andauert. Auf die Dauer wird man dann an Geistesstärke gewinnen und sein Leben weiterführen. Es wird immer etwas Unergründliches bleiben. Sorgen und Melancholie werden bleiben. Aber dem ewig währenden Negativen steht als das Positive die Arbeit gegenüber, die man auf diese Weise doch zustande bringt. Wenn das Leben so einfach wäre, wenn die Dinge so lägen wie in der Geschichte vom braven Hendrik oder wie in einer alltäglichen Pastorenpredigt, dann wäre es nicht so schwierig, sich einen Weg zu bahnen. Aber es ist nun einmal nicht so, es ist vielmehr weitaus komplizierter, und ein Gut und Böse an sich gibt es ebensowenig wie in der Natur ein Schwarz und Weiß.
Nun soll man aber dafür sorgen, daß man nicht dem undurchsichtigen Schwarz – dem absolut Schlechten – verfällt, und noch mehr soll man sich vor dem der Farbe der getünchten Wand gleichenden Weiß hüten, das die Scheinheiligkeit und das ewige Pharisäertum ist. Wer seiner Bestimmung und, vor allem, dem Gewissen – der allerhöchsten der erhabenen Bestimmung – mutig zu folgen und sie zu verwirklichen und wer ehrlich zu sein bemüht ist, der wird sich, glaube ich, schwerlich ganz und gar verirren können, ob es gleich nicht ohne Fehler und Kopfzerbrechen und Schwachheiten abgehen wird, und ob man das Vollkommene gleich nicht erreicht. Und dabei werden nun, glaube ich, das Gefühl eines tiefen Mitleidens und eine Mildherzigkeit in uns rege, die von umfassenderer Art sind als die abgemessenen Empfindungen, welche den Pastoren als ihre Spezialität eigentümlich sind. Mag man dann immerhin weder von der einen noch von der anderen Partei als etwas Bedeutendes geachtet, mag man zu den Mittelmäßigen gestellt werden, mag man sich selbst nur als einen ganz gewöhnlichen Menschen neben den anderen Menschen fühlen – nun, so wird man es bei alledem am Ende doch zu einer andauernden Heiterkeit bringen. Es wird einem gelingen, sein Gewissen so weit zu läutern, daß es zur Stimme eines besseren und höheren Ichs wird, dessen Knecht dann das gemeine Ich ist. Und so wird man dem Skeptizismus und Zynismus nicht verfallen, man wird nicht zu der Rotte der Spötter gehören.
Dahin kommt man aber nicht auf einmal, und ich finde wundervoll, was Michelet sagt – dieses eine Wort von M. drückt alles aus, was ich meine –: »Socrate naquit un vrai satyre, mais par le dévouement, le travail, le renoncement des choses frivoles, il se changea si complètement, qu'au dernier jour devant ses juges et devant sa mort, il y avait en lui je ne sais quoi d'un dieu, un rayon d'en haut, dont s'illumina le Parthenon.«
Nun, das gleiche zeigt sich auch bei Jesus, der zuerst nur ein gewöhnlicher Arbeiter war, sich aber zu etwas anderem hinaufarbeitete – mag es gewesen sein was es wolle –, zu einer Persönlichkeit so voller Mitleid, Liebe, Güte, Ernst, daß man noch jetzt davon angezogen wird. Ein Zimmergesell wird in vielen Fällen ein Zimmermeister, kleinlich, trocken, geizig, eitel; und wie es sich mit Jesus auch verhalten haben mag – auf jeden Fall hat er die Dinge anders aufgefaßt als mein Freund, der Zimmermann vom hinteren Hof, der sich zum Hausmelker heraufgearbeitet hat und doch sehr viel eingebildeter ist und mehr von sich selber hermacht als Jesus.
Aber ich will nicht zu sehr abirren.
Ich habe mir vorgenommen, zunächst einmal meine Kräfte wieder zu gewinnen, und ich glaube, sobald sie erst wieder einmal ein wenig über den Tiefwasserstand hinausgekommen sind, dann werden sich auch neue Gedanken für die Arbeit einstellen, die meine Arbeitsweise in eine andere Richtung, aus ihrer Trockenheit herausbringen werden. Wenn Du aber herkommst, werden wir noch einmal darüber sprechen – ich glaube, dies ist eine Angelegenheit, die sich nicht in einigen Tagen erledigen läßt ......
t. à t. Vincent

19. [Selbstbildnis als Maler. Dezember 1887 bis Februar 1888. Amsterdam. Van Gogh Museum]
[Der Text im Bildverzeichnis lautet: Armand Roulin. November 1888. Essen, Folkwang-Museum]

Den Haag, ohne Datum (Sommer 1883)
Lieber Theo! In Erwartung Deines Kommens vergeht mir fast kein Augenblick, da ich nicht mit meinen Gedanken bei Dir wäre.
Ich tue in diesen Tagen mein möglichstes, um noch verschiedene Studien zu malen, damit Du dann gleich auch von diesen etwas sehen kannst.
Und die Ablenkung, die ich in diesem Wechsel der Arbeit finde, tut mir gut; denn wenn ich es auch nicht buchstäblich so mache wie Weißenbruch, wenn ich mich nicht 14 Tage bei den Polderarbeitern einmiete, so ist doch, was ich tue, in demselben Geiste, und es hat auf jeden Fall etwas Beruhigendes, ins Grüne zu sehen.
Und außerdem hoffe ich bestimmt, auf diese Weise mit der Farbe ein Stück weiterzukommen. Es kommt mir so vor, als wären die letzten gemalten Studien fester und gediegener in der Farbe. So glaube ich, daß z. B. einige, die ich dieser Tage im Regen von einem Manne auf einem nassen, schlammigen Wege machte, die Stimmung schon besser ausdrücken.
Nun, wenn Du kommst, werden wir ja sehen. –
Die meisten sind Impressionen von Landschaften, von denen ich aber nicht behaupten will, daß sie so gut sind wie diejenigen, die zuweilen in Deinen Briefen vorkommen, denn ich stoße noch oft auf technische Schwierigkeiten – aber etwas dieser Art hat es, glaube ich, doch, so z. B. die Silhouette der Stadt, abends, wenn die Sonne untergeht, und ein Weg mit Mühlen.
Es ist im übrigen jämmerlich genug, daß ich mich, wenn ich nicht gerade bei der Arbeit bin, doch noch immer schlapp fühle, trotzdem aber glaube ich, daß es vorübergehen wird. Ich werde mir wirklich einmal Mühe geben, Kräfte auf Vorrat zu sammeln, denn ich habe es nötig, jetzt einmal tüchtig weiterzumalen, auch Figuren.
Während dieser Tage wurde beim Malen ein gewisses Gefühl für Farbe in mir wach, das anders und stärker ist als dasjenige, das ich bis jetzt empfunden habe. Es könnte wohl sein, daß das Unbehagen dieser Tage mit etwas wie einer Umwälzung in der Art meines Arbeitens, nach der ich schon häufig gesucht und über die ich viel nachgedacht habe, zusammenhinge.
Ich habe schon oft versucht, weniger trocken zu arbeiten, aber es wurde jedesmal wieder ungefähr dasselbe. Doch ist es gerade so, als wäre die geringere Entkräftung, die mich an diesen Tagen daran hindert, so zu arbeiten wie gewöhnlich, eher hilfreich als hinderlich; es ist, als käme ich, wenn ich mich gehen lasse und mit halbgeschlossenen Augen sehe, eher dahin, die Dinge als ein Beieinander von Farbflecken zu sehen, als wenn ich ihnen scharf auf die Gelenke sehe und analysiere, wie sie ineinander sitzen. Ich bin sehr neugierig, wie das weitergehen und was sich daraus entwickeln wird. Ich habe mich zuweilen schon darüber gewundert, daß ich nicht mehr Kolorist bin, etwas, was man bei meinem Temperament eigentlich bestimmt erwarten müßte – trotzdem aber entwickelte sich das bis heute wenig, und nun bin ich, wie gesagt, neugierig, wie es weitergehen wird. Daß meine letzten gemalten Studien schon anders sind, sehe ich deutlich.
Wenn ich mich recht entsinne, hast Du noch eine vom vorigen Jahre – einige Stämme im Walde.
Ich glaube nicht, daß diese durchaus schlecht ist, aber es ist doch noch nicht das, was man in den Studien der Koloristen sieht. Es sind sogar richtige Farben darin, aber trotzdem sie richtig sind, wirken sie nicht, wie sie wirken sollen, und obgleich die Farbe hier und da stark aufgetragen ist, bleibt die Wirkung nur mager. Wenn ich nun diese Studie als Beispiel nehme, glaube ich, daß die letzten, die weniger pastos gemalt sind, doch fester in der Farbe geworden sind; denn da hier die Farben mehr durcheinandergearbeitet und die Töne übereinander gemalt sind, verschmilzt alles mehr, und auf diese Weise kann man eher etwas z. B. von der Weichheit der Wolken oder vom Grase wiedergeben.
Zeitweilig habe ich mir schwere Sorgen darüber gemacht, daß ich mit der Farbe nicht weiter kam, aber jetzt habe ich wieder Hoffnung. Wir wollen sehen, wie es weiter geht. Nun kannst Du Dir also wohl denken, wie sehr ich danach verlange, daß Du kommst, denn wenn auch Du sähest, daß die Dinge sich ändern, dann wäre ich nicht mehr im Zweifel, daß wir in einem anderen Gleise sind.
Meinen eigenen Augen wage ich, was meine eigene Arbeit anlangt, nicht zu trauen. Zum Beispiel kommt es mir so vor, als wären die beiden Studien, die ich während des Regens gemacht habe – ein schlammiger Weg mit einem Figürchen –, ganz anders als manche andere Studien; ich finde, wenn ich sie ansehe, die Stimmung des trüben Regentages darin wieder, und in der Figur ist, obgleich sie nur aus einigen Flecken besteht, eine Art von Leben, dessen Ursprung nicht die Richtigkeit der Zeichnung ist: denn gezeichnet ist dies, wenn ich so sagen darf, nicht. Also ich will sagen: ich glaube, daß in den Studien jetzt etwas von dem Element des Geheimnisvollen ist, das sich einem zeigt, wenn man die Natur mit halbgeschlossenen Augen betrachtet, so, daß die Formen sich zu Farbflecken vereinfachen.
Man braucht Zeit für diese Dinge – indessen, ich sehe in der Farbe wie im Ton verschiedener Studien schon jetzt etwas Neues.
Ich denke in diesen Tagen hin und wieder an eine Erzählung, die ich einmal in einer englischen Zeitschrift las – es ist eine Malergeschichte, in der ein Mensch vorkommt, den ebenfalls schwere Zeiten entkräftet hatten; dieser geht nun in eine abgelegene Gegend, hinaus in die Torffelder, und dort, in der schwermütigen Natur, findet er sich gleichsam selbst wieder und kommt dahin, die Natur so zu malen, wie er sie fühlt und sieht.
Dies alles war in der Erzählung sehr wahr geschildert, wie mir schien, von jemandem, der etwas von Kunst versteht; es ergriff mich, als ich es las, und jetzt, in diesen Tagen, denke ich hin und wieder daran.
Nun, ich hoffe also, wir werden bald einmal darüber sprechen und gemeinsam überlegen können. Schreibe, wenn Du kannst, bald wieder einmal, und je eher Du etwas schicken kannst, um so lieber ist es mir natürlich.
Mit einem Händedruck in Gedanken.
t. à t. Vincent
Ohne besondere Veranlassung und Absicht füge ich noch etwas hinzu, was nur so ein Gedanke von mir ist.
Ich habe verhältnismäßig spät angefangen zu zeichnen – aber nun steht es vielleicht sogar so mit mir, daß ich nicht einmal darauf rechnen darf, daß ich noch sehr viele Jahre zu leben habe.
Ich denke daran, indem ich in aller Kaltblütigkeit, so wie man irgendein Ding schätzt oder veranschlagt, meine Rechnung aufstelle; aber es liegt in der Natur dieser Dinge, daß ich hier etwas Bestimmtes und Sicheres unmöglich wissen kann. Indessen, wenn man sich mit gewissen Personen, deren Leben man kennt, oder mit solchen vergleicht, in deren Leben man eine gewisse Übereinstimmung mit seinem eigenen sehen könnte, dann kann man doch gewisse Behauptungen aufstellen, die nicht unbedingt ohne Grundlage sind. Was die Länge der Zeit, die ich noch zum Arbeiten vor mir habe, anlangt, so glaube ich, ohne voreilig zu sein, annehmen zu können, daß mein Korpus wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl von Jahren quand bien même aushalten wird – eine bestimmte Anzahl, nimm einmal zwischen sechs und zehn an. Ich wage dies um so eher anzunehmen, als es momentan noch kein unmittelbares »quand bien même« gibt.
Das ist der Zeitraum, auf den ich unbedingt zähle, im übrigen aber würde ich es für eine zu unsichere Spekulation halten, wenn ich etwas an mir bestimmen wollte, da es gerade von diesen etwa zehn ersten Jahren abhängen wird, ob nach dieser Zeit noch etwas da sein wird.
Verbraucht man sich in diesen Jahren sehr, dann überlebt man die 40 nicht; konserviert man sich genügend, so daß man gewisse Erschütterungen, die den Menschen dann anzufallen pflegen, zu widerstehen und mit diesen mehr oder weniger komplizierten physischen Schwierigkeiten fertig zu werden imstande ist, dann ist man von 40 bis 50 wieder in einem frischen, verhältnismäßig normalen Fahrwasser.
Berechnungen über diese Zeit sind jedoch augenblicklich nicht am Platze, wohl aber Pläne für einen Zeitraum von, wie ich im Anfang sagte, etwa fünf bis zehn Jahren. Meine Absicht ist, mich nicht zu schonen und Schwierigkeiten oder Aufregungen durchaus nicht auszuweichen; denn es ist mir ziemlich gleichgültig, ob ich länger oder kürzer lebe: übrigens bin ich gar nicht fähig, mich selbst physisch zu leiten, so wie ein Arzt es bis zu einem gewissen Grade kann.
Ich gehe also vorwärts als ein Unwissender, der dieses eine weiß: »Innerhalb einiger Jahre muß ich eine gewisse Arbeit vollbringen«; zu übereilen brauche ich mich nicht, denn darin ist kein Heil, vielmehr, ich muß einfach in aller Ruhe und Heiterkeit weiterarbeiten, so regelmäßig und konzentriert wie möglich, so kurz und bündig wie möglich. Die Welt geht mich nur insoweit etwas an, als ich eine gewisse Schuld und Verpflichtung ihr gegenüber habe, aus Dankbarkeit – weil ich nämlich 30 Jahre in der Welt herummarschiert bin – ein bestimmtes Andenken in der Form von Zeichnungen oder Gemälden zu hinterlassen, die ich nicht machte, um diesem oder jenem damit zu gefallen, sondern um ein aufrichtiges, menschliches Gefühl darin zum Ausdruck zu bringen. Diese Arbeit also ist das Ziel – und wenn man sich auf diesen Gedanken konzentriert, dann vereinfacht sich alles Tun und Lassen in der Weise, daß es nun kein Chaos mehr, daß vielmehr alles, was man tut, eben dasselbe Streben ist. Augenblicklich geht es mit der Arbeit langsam – nun, ein Grund mehr, keine Zeit zu verlieren.
Guillaume Regamey ist jemand, der, glaube ich, keinen großen Ruf hinterlassen hat (Du weißt, es gibt zwei Regameys, F. Regamey malt Japaner und ist sein Bruder), trotzdem aber eine Persönlichkeit, vor der ich viel Respekt habe. Er starb mit 38 Jahren, und während eines Zeitraums von etwa sechs oder sieben Jahren beschäftigte er sich fast ausschließlich mit Zeichnungen, die ein sehr eigenartiges Gepräge haben, und die er hervorbrachte, als er nicht ohne physische Schwierigkeiten arbeitete. Das ist einer von vielen – ein sehr Guter unter vielen Guten.
Ich nenne ihn nicht so sehr deshalb, um mich selbst mit ihm zu vergleichen – ich bin nicht so viel wert wie er –, sondern um ein bestimmtes Beispiel einer gewissen Selbstbeherrschung und Willenskraft anzuführen, mit deren Hilfe er einen beseelenden Gedanken festhielt, welcher ihm in schwierigen Verhältnissen die Möglichkeit wies, doch in aller Heiterkeit ein tüchtiges Werk zu vollbringen.
Dergestalt sehe ich mich selbst – so nämlich, als müßte ich im Verlaufe einiger Jahre etwas tun, worin Herz und Liebe ist, und als müßte ich es mit aller Kraft meines Willens tun.
Lebe ich länger, tant mieux, aber daran denke ich nicht.
In diesen paar Jahren muß etwas getan werden –: dieser Gedanke ist mein Leitfaden, wenn ich Pläne in bezug auf die Arbeit entwerfe. Du wirst jetzt eher verstehen können, wie sehr ich danach verlangen muß, alle Kraft daranzusetzen um mir diejenige Bestimmtheit des Ausdrucks zu erwerben, die es mir ermöglicht, einfache Mittel zu verwenden. Und vielleicht wirst Du nun auch verstehen können, daß ich meine Studien nicht als einzelne Dinge, sondern immer mit dem Gedanken an das Ganze meiner Arbeit betrachte.

20. Der Gelbe Stuhl. Dezember 1888. London, Täte Gallery

Drenthe, ohne Datum (wohl Ende Oktober 1883)
Liebster Bruder! Meine Gedanken sind immerdar bei Dir, kein Wunder also, daß ich ein wenig häufig schreibe.
Und dann klären sich mir die Dinge etwas, ich wäge und erwäge mehr, sie ordnen sich und nehmen mehr Körper an. So kann ich Dir nun in aller Ruhe darüber schreiben. Es kommt mir vorläufig noch nicht sehr wahrscheinlich vor, daß Du mit G. & Co. auf gutem Fuße bleiben wirst. Es ist ein so großes Geschäft, daß es ganz gewiß lange dauert, bis man sich nicht mehr hineinschicken kann und das Verderben das Ganze durchdrungen hat. Aber, siehst Du, meiner Meinung nach dauert die Zerrüttung bereits eine sehr lange Zeit an, und deshalb sollte es mich nun nicht wundern, wenn sie schon weit vorgeschritten wäre.
Nun aber – ich wollte ja nicht so sehr über die negative Seite der Dinge sprechen – ich möchte après tout alles andere beiseite lassen und über etwas Positives mit Dir sprechen.
Einige positive Dinge, die ich nicht für gleichgültig halte, hast Du bereits erfahren. Du hast auf eine andere und bessere Weise als die meisten die Bücher von Zola gelesen, die ich für die besten über die heutige Zeit halte. Du sagtest mir einmal: »ich bin so etwas wie die Hauptperson in Pot bouille«, und ich sagte: nein.
Wenn Du das wärest, dann würdest Du gut daran tun, in ein anderes Geschäft einzutreten, indessen Du bist tiefer als er, und ich weiß nicht, ob Du au fond ein Geschäftsmann bist – au fond des fonds sehe ich in Dir den Künstler, den wahrhaftigen Künstler. Du hast, ohne daß Du sie gesucht hättest, seelische Erfahrungen gemacht, die Dich durchgepflügt haben – und nun laufen die Dinge wie sie laufen. Warum? – Wohin? Zum Beginn einer neuen Karriere von der gleichen Art? Ich bin unbedingt der Ansicht: nein – es geht da Um etwas Tieferes. Anders werden muß sie, aber dann darf sie nicht eine Wiederholung von etwas Gewesenem, sondern muß durchaus eine Neuschöpfung sein. Du bist in der Vergangenheit nicht fehlgegangen, nein, diese Vergangenheit vorausgesetzt, mußtest Du sein, so wie Du warst – diese Vergangenheit war kein Irrtum. Folgt nun daraus nicht, daß alles dieses einfach eine allgemeine Vorbereitung, das Legen einer Grundlage, kurzum ein sich Schälen war und noch nicht das Eigentliche? Warum sollte es nicht daraus folgen? Es kommt mir so vor, als verhielte sich alles dieses ganz genau so.
Ich finde, die Dinge sprechen so nachdrücklich für sich selbst, daß ich Dir unmöglich etwas sagen könnte, was nicht bereits deutlich offenbar wäre – und zwar auch Deinen eigenen Gedanken.
Und nun erscheint es mir als etwas noch besonders Merkwürdiges, daß gerade in diesen Tagen auch in mir eine Veränderung vor sich geht.
Und dies gerade jetzt, da ich in eine Umgebung komme, die mich so ungemein fesselt, die meine Gedanken in einer Weise ordnet, daß ich ganz davon erfüllt bin und Dir nun mitteilen kann, was die stille, traurige Heide in mir hervorbringt. Gerade in diesem Augenblick fühle ich etwas Besseres in mir beginnen; noch ist es nicht Wirklichkeit, trotzdem aber sehe ich in meiner Arbeit jetzt Dinge, die ich vor kurzem noch nicht hatte.
Das Malen wird mir leichter, ich habe Lust, alle möglichen Dinge in Angriff zu nehmen, die ich bis heute noch liegen ließ.
Ich weiß, die Verhältnisse sind bei alledem so ungewiß, daß es in keiner Weise sicher ist, ob ich werde hier bleiben können. Vielleicht werden die Verhältnisse alles anders machen. Aber das würde ich sehr bedauerlich finden, wenn ich es auch durchaus ruhig aufnehmen würde. Doch ich kann es nicht unterlassen, mir die Zukunft so vorzustellen, daß nicht allein ich, sondern daß wir beide, Du und ich, Maler sind und gemeinsam hier in diesem Torflande arbeiten.
Dieser Gedanke stellt sich mir in der lustigsten Weise dar. Die Sache müßte ohne alle Umstände ins Werk gesetzt werden, ohne vieles Zaudern, als »une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit.« Mehr nicht, und ich sage also nur, daß es mich nicht im allermindesten wundern würde, wenn wir in einiger Zeit beieinander wären, und zwar hier.
Ich finde, das könnte vor sich gehen, wie ein Torfstück von einer Stelle zur anderen rollt – ohne mehr Umstände zu machen. Das geht ganz glatt – und schon liegt es wieder totenstill, und kein Mensch sieht sich mehr danach um.
Allerdings, ein Mensch hat seine Wurzeln, das Verpflanzen ist etwas, das schmerzt, selbst wenn der Boden, auf den er verpflanzt wird, ein besserer wäre.
Und ist er denn nun besser??? Nun, was die Puritaner früher waren, das sind in der heutigen Gesellschaft die Maler.
Es handelt sich da nicht um eine verrückte und geschraubte Frömmigkeit oder Schwärmerei, sondern um etwas Einfach-Solides – ich spreche hier besonders von den Leuten aus Barbizon, von der Richtung ihres dem bäuerlichen Leben zugewendeten Suchens. Ich sehe in dem, was Du als Mensch bist, etwas, das zu Paris in einem Gegensafte steht; ich weiß nicht, wieviele Jahre Paris darüber hingegangen sind – ja, vielleicht steckt ein Stück Deines Herzens darin – ich habe nichts dagegen –, aber etwas, ein je ne sais quoi, ist noch vierge.
Das ist das künstlerische Element. Es ist jetzt scheinbar schwach, doch dieser neue Schuß schlägt aus, und dann wird er schnell sprießen.
Ich fürchte, der alte Stamm ist nun einmal durchhauen, und deshalb sage ich Dir –: sprieße in einer ganz neuen Richtung, denn der Stamm wird, fürchte ich, doch nicht mehr seine rechte Lebensfähigkeit haben. So kommt es mir vor. Kommt es Dir anders vor?
Dies um so mehr, als Du, wenn Du Maler wirst, selbst schon, sozusagen ohne es zu beabsichtigen, einen Grund dazu gelegt hast, und in der ersten Zeit Gesellschaft, Freundschaft und eine gewisse Umgebung haben würdest; und auch meine eigene Arbeit würde, glaube ich, durch Dich geradezu anders werden; denn meine Gedanken würden dann eine gewisse Reizung erfahren durch jemanden, der weiß, was ein Bild ist. Ich bin allzu lange aus diesen Dingen da heraus gewesen und glaube diesen Reiz deshalb recht nötig zu haben.
Ich habe Pläne, die von solcher Art sind, daß ich mich allein fast nicht an sie heranwage; welche Pläne das sind und wie das alles zusammenhängt, wirst Du sehr bald merken. Ich bin – wenn ich auch wünschte, es wäre anders, sehr empfindlich gegenüber dem, was man über meine Arbeit sagt und gegenüber der Art, wie man sich zu mir selbst verhält. Wenn ich auf Unglauben stoße, allein stehe, dann entbehre ich ein gewisses Etwas – und das bricht meine Initiative. Nun, und Du wärest gerade der Mensch, der Verständnis für meine Angelegenheiten haben würde; ich verlange keinerlei Schmeichelei oder daß man mir sagt, ich finde es sehr schön, wenn man es häßlich findet, nein, ich verlange eine intelligente Aufrichtigkeit, die sich auch über Mißerfolge nicht ärgert, die mir, wenn mir etwas sechsmal mißlungen ist und der Mut anfangen will, mir zu entsinken, sagen würde: nun mußt du es trotzdem noch zum siebenten Male versuchen. Sieh, diese Aufmunterung kann ich nicht entbehren. Und ich glaube, Du würdest das verstehen, und ich würde außerordentlich viel an Dir haben.
Und das ist etwas, dessen Du besonders dann fähig wärest, wenn Du davor stündest, es können zu müssen. Wir würden einander stützen; denn eben das würdest Du Deinerseits auch an mir haben, und das ist etwas von Wichtigkeit. Zwei Menschen müssen aneinander glauben und fühlen, daß es möglich ist und daß es sein muß; auf diese Weise sind sie ungemein stark. Sie müssen einander den Mut im Herzen erhalten. Nun, ich denke, Du und ich, wir würden einander erfassen.
Ich weiß aber nicht, ob Du das könntest, wenn Du kein Maler wärest.
Diesem gegenüber steht nun der Zweifel – und dieser ist es, den die Leute meistens zu erwecken sich bemühen.
Millet nun ist der Typus eines Mannes des Glaubens. Den Ausdruck »foi du charbonnier« gebraucht er oft, und dieser Ausdruck ist ja uralt. Man darf kein Stadtmensch, sondern muß ein Naturmensch sein – möge man im übrigen auch kultiviert, oder was auch immer, sein. Ich kann es nicht so genau sagen. Es muß ein je ne sais quoi in uns sein, das uns den Mund stopft und zur Tat hinführt, das uns schweigsam sein läßt, auch wenn wir sprechen, das uns innerlich Schweigende, sage ich, zum Handeln treibt. Auf diese Weise bringt man etwas Großes hervor.
Warum? Weil man dann etwas wie Laß-nur-geschehen, was geschehen muß, empfindet und arbeitet. Et après? Ich weiß es nicht. Ich will Dich nicht drängen, ich will nur sagen: arbeite der Natur nicht entgegen. Ich will nichts Unsinniges, ich habe nur die stille Hoffnung, daß man es, wenn man es auf vernünftige Weise anfinge, müßte möglich machen können, in See zu stechen – nicht völlig ohne, doch allerdings mit verhältnismäßig geringen Mitteln, mit so vielen, als nötig sind, um den Unterhalt zu bestreiten.
Und so sage ich Dir nun – vorausgesetzt, man riefe damit nicht unter allen Umständen irgendein Unheil ins Leben, vorausgesetzt, es wäre eine, sei es auch nur ganz kleine, Möglichkeit vorhanden:
»Folge diesem Hinweis, dieser ganz kleinen Möglichkeit – dieses Tüpfelchen ist der Weg, gehe ihn, laß das andere fahren. Laß es einfach fahren – nicht nach außen hin, behalte an Beziehungen bei, was Du nur kannst, aber bleibe entschlossen dabei, zu sagen: ich will Maler werden, und dann mag, was Hinz und Kunz sagen, von Dir abtröpfeln wie das Wasser von einem Regenmantel.«
Ich bin überzeugt, Du würdest Dich nicht wie eine Katze in einem fremden Hause, sondern wie ein in seine Heimat Zurückkehrender fühlen; Du würdest, wenn Du Maler würdest, sogleich eine große Freudigkeit empfinden und ruhiger sein als in einem neuen Geschäft oder bei G. & Co. selbst.
Wie es mit mir gehen wird für den Fall, daß Du Dich nicht entschließest Maler zu werden, weiß ich nicht. Wenn sich in Paris ein Ausweg für mich zeigte, dann müßte man natürlich zugreifen, anderenfalls müßte ich mich mit Vater zu verständigen suchen, so daß ich da unter Dach kommen und eine Zeitlang in Brabant arbeiten könnte. Aber ach, ich muß Dir doch sagen, daß ich eigentlich gar nicht daran denke, so sehr geht mir augenblicklich meine Arbeit und dann auch der Plan mit Dir im Kopfe herum, Du bist ein Kerl mit einem Willen, mit einem guten, denkenden, klaren Kopfe und einem ehrlichen Herzen, also werde Du, wenn Du für eine Zeitlang gedeckt bist, nur ruhig Maler. Und noch einmal, auch meine Arbeit würde dann entschieden einen neuen Anstoß erhalten.
Ich bin heute hinter den Ackersleuten hergelaufen, die ein Kartoffelfeld umpflügten und denen Arbeitsweiber nachgingen, um einzelne übriggebliebene Kartoffeln aufzulesen.
Es war ein ganz anderes Feld als dasjenige, das ich Dir gestern skizzierte, aber auch dieses ist eines der eigenartigsten Dinge der hiesigen Gegend; immer wieder genau dasselbe und doch immer wieder etwas ganz anderes, es sind immer dieselben Motive – gleichsam Bilder von Meistern, die in demselben Genre arbeiten, aber sich doch auch wieder voneinander unterscheiden; oh, es ist hier so eigenartig – und so still, so friedlich. Ich kann kein anderes Wort dafür finden als Frieden. Viel darüber reden, wenig darüber reden, das ist für mich dasselbe, es fügt nichts hinzu und nimmt nichts fort.
Es handelt sich darum, daß Du etwas ganz Neues wollen, daß Du selbst Dich gewissermaßen von neuem hervorbringen mußt – ganz einfach, Du hast die idée fixe: ça ira.
Nicht als ob Du dann keine Sorgen haben würdest – ja, von selbst geht es nicht, aber Du müßtest ein Gefühl haben wie: »Ich tue, was mir am einfachsten scheint, alles was nicht einfach ist, werfe ich weg, ich will die Stadt nicht mehr, ich will ins Freie, ich will kein Kontor mehr, ich will malen«. Siehst Du. Und dann kannst Du diese Dinge immerhin wie ein Geschäft behandeln, ob sie gleich tiefer, ja unendlich tief sind; aber Du mußt die Gedanken mit Entschlossenheit darauf richten. Du mußt in der Zukunft Dich und mich als Maler sehen; kommt auch das Elend, stellen sich auch Schwierigkeiten ein – Du mußt es doch sehen, Dein eigenes Werk schon sehen! Ein Stück Natur ansehen – denken: das will ich malen. Dich persönlich dieser idée fixe hingeben, Maler werden.

21. L'Arlesienne (Mme Ginoux). Nov. 1888. Vorm. Frankfurt a. M, Sammlung von Goldschmidt-Rothschild. Existiert in mehreren Fassungen
Und da werden auf einmal die Leute, selbst Deine besten Freunde, mehr oder weniger wie Fremde. Du bist gerade mit irgend etwas anderem beschäftigt – da, auf einmal, fühlst Du: Donnerwetter, ich träume, ich bin auf einem verkehrten Wege, wo ist mein Atelier, wo ist mein Pinsel? Gedanken, wie diese, sind, wenn man sie fühlt, sehr tief – man spricht natürlich nicht oder doch nur sehr wenig darüber; Du würdest einen Irrtum begehen, wenn Du jemanden um Rat fragen wolltest, denn es würde Dir nicht mehr Klarheit bringen.
Der Kunsthandel bringt gewisse Vorurteile mit sich, die, wie ich vermute, auch Dir ankleben werden – bestimmte Ansichten, wie etwa, daß das Malen eine Gabe ist. Nun ja, es ist wohl eine Gabe, aber nicht in der Weise, wie man es darstellt – man muß nämlich seine Hände ausstrecken und fest zugreifen, und dieses Zugreifen ist etwas Schwieriges, und man darf nicht warten, bis sich die Dinge von selbst offenbaren. Etwas ist ja daran, aber so wie man es darstellt, verhält es sich nicht. Übung macht den Meister. Maler wird man durch das Malen. Will man Maler werden, hat man Lust dazu, fühlt man, was Du fühlst, dann kann man es, aber dieses Können geht zusammen mit Mühsal, Sorgen, Enttäuschungen, mit Zeiten voller Melancholie und Ohnmacht und ähnlichem mehr – so denke ich darüber. Ich finde jene Ansicht dermaßen stumpfsinnig, daß ich jetzt schnell eine Skizze machte, um nicht mehr daran denken zu müssen; nimm es mir nicht übel, ich werde nicht mehr darüber sprechen, es ist die Mühe nicht wert. Mit der Welt würden wir es mit so viel gutem Mute, so viel Energie, so viel Spaß aufnehmen müssen – wir würden es nicht schwer nehmen, auch wenn wir ernste Sorgen hätten, wir würden uns immer etwas Fröhliches bewahren – wie die Schweden, von denen Du erzähltest, und wie die Alten von Barbizon. Wir würden die Dinge groß, tüchtig, breit auffassen, nicht zweifeln, nicht grübeln und uns nicht aus der Fassung bringen lassen. In diesem Plane würde ich mich zu Hause fühlen, in einem anderen würde ich immer viel, viel weniger zu Hause sein.
Es ist ein ungeheures Wagnis, doch weder Du noch ich fürchten uns davor, es zu unternehmen.
Denke also einmal darüber nach und, auf jeden Fall, schreibe bald. Besten Gruß, lieber Kerl, mit einem Händedruck in Gedanken.

22. Selbstbildnis mit verbundenem Ohr. Februar 1889. Paris, Sammlung G. Fayet
Drenthe, ohne Datum (wohl Mitte November 1883)
Liebster Bruder! Ich wollte Dir nur eben von einem Ausfluge nach Zweeloo berichten, dem Dorfe, wo Liebermann lange gewesen ist und Studien für sein Bild der Waschfrau, im letzten Salon, gemacht hat.
Auch Termeulen und Jules Bakhuijzen sind sehr lange dort gewesen.
Stelle Dir eine Fahrt durch die Heide vor, morgens um 3 Uhr, in einer offenen Karre – ich ging mit dem Manne, bei dem ich logiere und der auf den Markt nach Assem mußte, mit –, auf einem Wege oder Deich, wie sie hier sagen, auf den man, um ihn zu erhöhen, anstatt Sand Schlamm gebracht hatte. Es war noch viel interessanter als im Trekschuit.
Als es eben hell zu werden begann und die Hähne überall in den über die Heide zerstreuten Hütten krähten, wurden die einzelnen Häuschen, an denen wir vorbei kamen – sie waren von schlanken Pappeln umgeben, deren gelbe Blätter man fallen hörte – wurde ein alter stumpfer Turm mit Erdwall und Buchenhecke auf dem Kirchhofe – wurden die flachen Landschaften der Heide und der Kornäcker – wurde alles, alles genau wie die allerschönsten Corots. Eine Stille, ein Mysterium, ein Friede, wie nur er allein sie gemalt hat.
Es war indessen noch ziemlich dunkel, als wir in Zweeloo ankamen, morgens um 6 Uhr – die eigentlichen Corots sah ich noch früher am Morgen. Die Einfahrt in das Dorf war ungemein schön. Enorme Moosdächer auf Häusern, Ställen, Schafställen und Scheunen.
Die Wohnungen liegen hier sehr breit zwischen Eichen von einer prachtvollen Bronze. Im Moos Töne von Grüngold, im Boden von rötlichen, bläulichen oder gelblichen, dunklen Lila-Graus, Töne von unaussprechlicher Reinheit in dem Grün der kleinen Kornfelder, Töne von Schwarz in den nassen Stämmen, die sich von dem goldenen Regen der schwirrenden, wimmelnden Herbstblätter abheben, welche in losen Perücken, so als wären sie darauf geblasen, still, und die Luft schimmert zwischen ihnen hindurch, an Pappeln, Birken, Linden und Apfelbäumen hängen. Die Luft gleichmäßig hell, leuchtend, mit Weiß, doch einem Lila-Weiß, das nicht zu ergründen ist, einem Weiß, in dem man Rot, Blau, Gelb flimmern sieht, das alles reflektiert und das man überall über sich fühlt, das dunstig ist und sich mit dem dünnen Nebel unten vereinigt; alles zusammen bringt eine Skala feiner Graus hervor.
In Zweeloo fand ich jedoch keinen einzigen Maler – sie kämen im Winter niemals hin, sagten die Leute.
Ich hoffe, daß ich gerade diesen Winter dort sein werde.
Da keine Maler da waren, beschloß ich, statt die Rückkehr meines Hausherrn abzuwarten, zurückzugehen und unterwegs etwas zu zeichnen. So begann ich, eine Skizze von dem bewußten Apfelbaumgärtchen zu machen, in dem Liebermann sein großes Bild malte. Und dann ging es zurück, auf dem Weg, den wir in der Frühe gefahren waren. Die Gegend rund um Zweeloo ist in diesem Augenblicke ganz und gar mit jungem Korn bestellt, manchmal unabsehbar weit – das aller–, allerfeinste Grün, das ich kenne.
Darüber eine Luft von feinem Lila-Weiß, das einen Effekt gibt – ich glaube, malen läßt er sich nicht, indessen, er ist für mich der Grundton, den man kennen muß, um zu wissen, auf welcher Ursache andere Effekte beruhen.
Eine schwarze Erde, flach – unendlich – eine helle Luft von feinem Lila-Weiß.
Aus der Erde sprießt das junge Korn – dieses Korn bedeckt sie wie ein Schimmel. Das sind die eigentlich guten und fruchtbaren Striche von Drenthe – alles in einer dunstigen Atmosphäre. Denke an »le dernier jour de la création« von Brion – gestern kam es mir vor, als verstünde ich die Bedeutung des Bildes.
Der schlechte Boden von Drenthe ist ebenso, nur ist die schwarze Erde noch schwärzer, so wie Ruß, kein Lila-Schwarz, wie der andere, und melancholisch bewachsen, eine Heide, die sich immerfort zersetzt, und Torfpflanzen. Ich sehe überall die Plaggenhütten – auf der unendlichen Fläche des Moores wie lauter zufällige Dinge –, in den fruchtbaren Strichen höchst primitive Bauerngehöfte, und Schafställe mit ganz, ganz niedrigen Mauern und enormen Moosdächern und von Eichen umgeben. Man hat, wenn man einen Marsch von vielen Stunden durch diese Gegend macht, eine Empfindung, als stünde eigentlich nichts anderes als diese Erde, dieser Schimmel von Korn oder Heidekraut und die unendliche Luft. Pferde und Menschen erscheinen dann so klein wie Flöhe. Man fühlt nichts mehr, sei es an sich auch noch so groß, man weiß nur, daß Erde und Himmel da sind.
Dessenungeachtet findet man, wenn man – das Unendliche beiseite lassend – in seiner Qualität eines Pünktchens auf andere Stäubchen achtet, daß jedes Pünktchen ein Millet ist. Ich kam an einem alten Kirchlein vorüber, ganz und gar genau l'église de Créville auf dem Bildchen von Millet im Luxembourg. Hier kam statt des Bäuerleins mit dem Spaten, wie auf dem Bilde, ein Hirt mit einer Koppel Schafe die Hecke entlang. Im Hintergrunde hatte man nicht den Durchblick auf die See, aber auf das Meer jungen Kornes – das Meer der Furchen, statt des Meeres Wogen. Der erzielte Effekt ist der nämliche. Dann sah ich Pflüger, sehr beschäftigt, eine Sandkarre, Hirten, Straßenarbeiter und Mistkarren. Ich zeichnete in einer kleinen Schenke am Wege ein altes Frauchen am Spinnrade – eine dunkle Silhouette wie aus einem Märchen – eine dunkle Silhouette gegen ein helles Fenster, durch das man die helle Luft sah und einen Weg durch das feine Grün und ein paar Gänse, die Gras pickten. Und als dann die Abenddämmerung hereinbrach – stelle Dir den Frieden dann vor und diese Stille! Stelle Dir einen Weg vor mit hohen Pappeln im Herbstlaub, stelle Dir einen breiten Schlammweg vor, alles schwarzer Morast, rechts Heide bis ins Unendliche, links Heide bis ins Unendliche, die schwarzen dreieckigen Silhouetten einiger Plaggenhütten, durch deren Fensterchen vom Feuer her ein rotes Licht scheint, mit einzelnen Tümpeln schmutzigen, gelblichen Wassers, welche die Luft widerspiegeln und in denen Veenstämme vermodern – stelle Dir diesen Moorkram abends in der Dämmerung vor, mit einer weißlichen Luft darüber, also alles Schwarz gegen Weiß. Und in diesem Moorkram eine rauhhaarige Figur, der Hirt – eine Anzahl eiförmiger Massen, halb Wolle, halb Schlamm, die gegeneinander stoßen, einander verdrängen, die Herde. Du siehst es ankommen – Du stehst mitten darin – Du kehrst um und folgst ihnen. Mit Mühe und unwillig schreiten sie fort auf dem schlammigen Wege. In der Ferne zeigt sich der Bauernhof – einige Moosdächer und Haufen von Stroh und Torf zwischen den Pappeln. Der Schafstall ist in der Silhouette auch wieder wie ein Dreieck – dunkel. Die Tür steht weit offen wie der Eingang einer dunklen Spelunke. Durch die Spalten der Planken scheint das Licht der Luft von hinten durch.
Die ganze Karawane von Wollklumpen und Schlamm verschwindet in dieser Höhle – der Hirt und eine Frau mit einer kleinen Laterne schließen die Türen hinter ihnen zu.
Diese Heimkehr der Herde in der Dämmerung war das Finale der Symphonie, die ich gestern hörte.
Wie ein Traum ging dieser Tag vorüber, ich war während des ganzen Tages so vertieft gewesen in diese ergreifende Musik, daß ich buchstäblich Essen und Trinken vergessen hatte – eine Schnitte Bauernweißbrot und eine Tasse Kaffee hatte ich in der kleinen Schenke, in der ich das Spinnrad zeichnete, zu mir genommen. Der Tag war vorüber, und vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung, oder vielmehr von der einen Nacht bis zur anderen, hatte ich mich selbst über dieser Symphonie vollkommen vergessen.
Ich kam nach Hause, und als ich am Feuer saß, kam es mir so vor, als hätte ich Hunger, und da zeigte es sich, daß ich wirklich gewaltigen Hunger hatte. Da siehst Du, wie es hier ist. Man glaubt, in einer Ausstellung etwa der »cent chefs d'oeuvre« zu sein. – Was bringt man mit von einem solchen Tage? Nur eine Anzahl Kritzeleien. Doch noch etwas anderes bringt man heim – eine stille Lust zur Arbeit ......
t. à t. Vincent
Nuenen, ohne Datum (wohl Mai 1884)
Lieber Theo! Zu lange schon habe ich gewartet mit der Beantwortung Deines letzten Briefes – Du sollst sehen, wie es kam. Laß mich damit beginnen, Dir für Deinen Brief zu danken sowie für die einliegenden 200 Francs. – Sodann will ich Dir mitteilen, daß ich heute gerade so ziemlich mit der Einrichtung eines neuen großen Ateliers fertig bin, welches ich gemietet habe.
Zwei Zimmer – ein großes und ein kleines – en suite.
Hierdurch saß ich diese letzten 14 Tage ziemlich in der Arbeit. Ich glaube, daß ich dort sehr viel angenehmer werde arbeiten können als in dem kleinen Zimmerchen zu Hause, und ich habe die Hoffnung, daß Du meine Maßregeln gut finden wirst, wenn Du es siehst.
Übrigens habe ich die letzte Zeit eifrig durchgemalt an dem großen Weber, über den ich Dir zuletzt sprach, und auch eine Leinewand angefangen mit dem kleinen Türmchen, das Du kennst.
Was Du über den Salon schreibst, finde ich sehr interessant. Was Du über Puvis de Chavannes sagst, macht mir sehr viel Freude, daß Du seine Arbeit so ansiehst, und in der Schätzung seines Talentes bin ich vollkommen mit Dir einig.
Und was die Koloristen angeht – es ist mit mir après tout wie mit Dir. Ich kann mich in einen Puvis de Chavannes vertiefen, und doch schließt das nicht aus, daß ich vor einer Landschaft mit Kühen von Mauve, vor Bildern von Maris und Israëls dasselbe fühle, was Du davor fühlst.
Was meine eigene Farbe betrifft, so wirst Du in meinen hiesigen Arbeiten nicht das Silberige finden, sondern vielmehr braune Töne (Bitume und Bistre), die mir mancher, daran zweifle ich nicht, übel nehmen wird.
Du wirst selbst sehen, was daran ist, wenn Du kommst.
Ich habe so eifrig gemalt, daß ich in der letzten Zeit keine einzige Zeichnung zwischendurch gemacht habe.
Von Rappard habe ich Nachricht, daß er Ende dieser Woche kommt, was mir viel Freude macht. Ich habe die Idee, daß er in diesem Jahre noch einmal für längere Zeit zurückkommen wird.
Er bringt eine Anzahl Zeichnungen von mir mit, die ich Dir dann sofort zusenden werde.
Vielleicht werde ich in einiger Zeit selbst mit Dir einig sein, daß durch die Veränderung vom vorigen Jahre meine Stellung verbessert ist, und daß diese Veränderung gut war.
Etwas Wehmütiges wird es mir jedoch stets bleiben, daß ich damals etwas habe aufgeben müssen, was ich gern noch weiter durchgeführt hätte. Es geht mit Mutter, meiner Meinung nach, sehr gut – sie ist gestern in ihrem Fahrstuhl in meinem neuen Atelier gewesen.
Ich habe es hier in letzter Zeit mit den Leuten gemütlicher gehabt als im Anfang, was mir viel wert ist; denn man hat so durchaus das Bedürfnis danach, sich einmal eine Zerstreuung verschaffen zu können, und wenn man sich zu einsam fühlt, leidet stets die Arbeit darunter – man muß sich jedoch darauf vorbereiten, daß die Dinge nicht immer so bleiben.
Aber ich bin doch guten Mutes; es kommt mir so vor, als ob die Menschen hier in Nuenen im allgemeinen besser wären als in Etten oder Helvoirt – es ist hier mehr Aufrichtigkeit – wenigstens ist das mein Eindruck, nun ich eine Zeitlang hier gewesen bin.
Wohl gehen die Leute von einem Pfarrerstandpunkte aus in ihrem Tun und Lassen – das wohl –, aber so, daß ich, was mich betrifft, keine Skrupel habe, mich ein wenig danach zu richten.
Und an das Brabant, das man sich geträumt hat, reicht die Wirklichkeit manchmal schon sehr nahe heran.
Ich muß sagen, daß mein ursprünglicher Plan, mich in Brabant niederzulassen, der ins Wasser fiel, mich aufs neue wieder stark anzieht. Denn da wir wissen, wie so etwas zusammenstürzen kann, müssen wir sehen, ob es nicht etwa eine Illusion ist. Enfin, vorläufig habe ich genug zu tun. Ich habe nun wieder Raum, um nach Modell arbeiten zu können. Wie lange das dauern wird, das entzieht sich aller Berechnung.
Nun, besten Gruß – der Salon wird Dir gewiß viel zu tun geben, aber zugleich doch auch eine interessante Zeit sein.
Nochmals vielen Dank für das Geschickte, das ich übrigens infolge dieser Veränderung durchaus nötig hatte. Ich hoffe, daß Du einverstanden sein wirst, wenn Du siehst, wie ich mich eingerichtet habe.
Adieu, mit einem Händedruck
t. à t. Vincent
Nuenen, ohne Datum (wohl Mitte Juni 1884)
Lieber Theo! Noch oft denke ich an Deinen angenehmen Besuch, der sich, wie ich hoffe, einmal für länger wiederholen wird.
Seitdem Du von hier weg bist, habe ich ziemlich eifrig an einer Spinnerin gearbeitet, von der ich Dir eine kleine Skizze schicke.
Das Stück ist ziemlich groß, in dunklem Ton gemalt, die Figur ist in Blau, mit einem Tuche, das etwa mausefarbig ist.
Ich hoffe noch ein ähnliches von einem alten Manne zu machen, am Spulrade bei einem kleinen Fenster, wovon Du Dich vielleicht einer kleinen Studie erinnerst.
Sehr gern hätte ich, daß Du mir bald das Maß Deiner Rahmen angäbest, dann könnte ich damit beginnen. Vielleicht mache ich, wenn die Maße es erlauben, ein kleines Bild von dieser Spinnerin. Ich schreibe hier eine Stelle aus »Les artistes de mon temps« von Ch. Blanc ab:
Trois mois environ avant la mort d'Eug. Delacroix, nous le rencontrâmes dans les galeries du Palais Royal, sur les dix heures du soir, Paul Chenavard et moi. C'était au sortir d'un grand dîner, où l'on avait agité des questions d'art, et la conversation s'était prolongée entre nous deux sur le même sujet, avec cette vivacité, cette chaleur que l'on met surtout aux discussions inutiles.
Nous en étions à la couleur, et je disais:
»Pour moi, les grands coloristes sont ceux, qui ne font pas le ton local« – et j'allais développer mon theme, lorsque nous aperçumes Eugène Delacroix dans la galerie de la Rotonde.
Il vient à nous en s'écriant: »je suis sur qu'ils parlent peinture«. – »En effet«, lui dis-je, »j'étais sur le point de soutenir une proposition, qui n'est pas, je crois, un paradoxe, et dont vous êtes en tout cas meilleur juge que personne, je disais que les grands coloristes ne font pas le ton local, et avec vous je n'ai pas besoin, sans doute, d'aller plus loin«.
Eugène Delacroix fit deux pas en arrière, selon son habitude en cligant les yeux: »Cela est parfaitement vrai«, dit-il, »voilà un ton par exemple (il montrait du doigt le ton gris et sale du pavê), eh bien, si l'on disait à Paul Véronèse: peignez-moi une belle femme blonde, dont la chair soit ce ton-là – il la peindrait, et la femme serait une blonde dans son tableau«.
Um von »Rotzfarben« zu sprechen, muß man die Farben eines Bildes meiner Meinung nach nicht für sich betrachten, eine »Rotzfarbe« kann, wenn sie z. B. gegen kräftiges Braunrot, Dunkelblau oder Olivgrün steht, ein sehr zartes und frisches Grün einer Wiese oder eines Kornfeldes ausdrücken.
Und doch glaube ich, daß de Bock, der gewisse Farben »Rotzfarben« getauft hat, dieser Äußerung gewiß nicht widersprechen würde; denn ich habe ihn selbst einmal sagen hören, daß auf manchen Bildern von Corot, z. B. in Abendlüften, Töne stehen, die auf dem Bilde sehr leuchtend sind und an sich betrachtet eigentlich ein ziemlich dunkler grauer Ton sind.
Zu Hause werden sie Dir auch bald schreiben und Dir für Deinen Brief danken.
Um jedoch noch einmal auf die Frage zurückzukommen, daß man mit einer so schmutzigen Farbe, wie dem Grau der Straßensteine, eine Abendluft oder eine blonde Frau sollte malen können, so ist die Frage, wenn man dem nachgeht, eine doppelte.
Erstens hat man nämlich: eine dunkle Farbe kann hell scheinen oder vielmehr wirken, das ist eigentlich mehr eine Frage des Tons, aber was die eigentliche Farbe angeht, so wird ein Rotgrau, verhältnismäßig wenig rot, je nachdem was für Farben daneben stehen, mehr oder weniger rot scheinen. Und so ist es mit Blau und ebenfalls mit Gelb. Man hat nur ganz wenig Gelb in eine Farbe zu tun, um sie sehr gelb wirken zu lassen, wenn man diese Farbe zwischen oder neben violette oder lila Töne setzt.
Ich erinnere mich, wie jemand ein rotes Dach, auf das das Licht fiel, vermittels Zinnober und Chromgelb etc. darzustellen versuchte. Das ging nicht. Jaap Maris erreichte es in manchen Aquarellen dadurch, daß er ein ganz klein wenig mit rotem Ocker über eine rötliche Farbe lasierte, und es drückte genau das Sonnenlicht auf den roten Dächern aus. Wenn ich Zeit dazu habe, werde ich aus dem Artikel über Delacroix noch etwas abschreiben über die Gesetze, die bei den Farben stets wiederkehren.
Ich habe zuweilen gedacht, daß, wenn Menschen über Farben sprechen, sie eigentlich Ton meinen.
Und vielleicht gibt es augenblicklich mehr Tonisten als Koloristen. Dies ist nicht dasselbe, obwohl es sehr gut zusammen gehen kann.
Ich bin ganz einer Meinung mit Dir, daß man heutzutage oft sehr schwer Befriedigung findet in seinem Bedürfnis, einmal mit Menschen zu sprechen, die Rat zu erteilen wissen und von denen man lernt und Aufklärung bekommt, ohne daß sie den Schulmeister heraushängen, und die einem nicht nur einzelne große hohle Worte, die au fond entweder Totschläger oder Gemeinplätze sind, auftischen.
Enfin – die Natur ist ein Etwas, von dem man viel zu wissen bekommen kann. Besten Gruß – denke, bitte, an das Lichtmaß Deiner Rahmen.
Nuenen, ohne Datum (wohl Anfang August 1884)
Lieber Theo! Ich wollte Dir noch ein Wörtchen schreiben, derweil Du in London bist. Ich danke Dir sehr für Deinen letzten Brief und die einliegenden 150 Francs. Ich möchte sehr gern einmal dort in London mit umherwandern, am liebsten bei echtem Londoner Wetter, wenn die Stadt, besonders in gewissen alten Teilen am Flusse, Aspekte hat, die außerordentlich melancholisch sind – aber zugleich einen Charakter haben, der außergewöhnlich ergreifend ist. Manche Engländer dieser Zeit haben, nachdem sie von den Franzosen sehen und malen gelernt hatten, angefangen, das zu machen.
Von der englischen Kunst aber das zu sehen, was für Dich und für mich eigentlich das Interessanteste ist, das ist unglücklicherweise schwierig. Auf den Ausstellungen ist die Mehrzahl der Bilder meistens nicht sympathisch.
Doch ich hoffe gleichwohl, daß Dir hier und da irgend etwas begegnen wird, das Dir verständlich macht, wie ich für meinen Teil immer an manche englische Bilder denken muß – z. B. »Chill Oktober« von Millais, die Zeichnungen von Fred. Walker und Pinwell. Achte einmal auf den Hobbema der National Gallery; ein paar sehr schöne Constables wirst Du wohl nicht vergessen dort anzusehen, unter anderen »Cornfield«, und auch in South Kensington, wo der Bauernhof ist: »Valley farm«. Ich bin sehr neugierig, was am meisten Eindruck auf Dich gemacht haben wird und was Du gesehen haben wirst.
Vorige Woche war ich täglich auf dem Felde bei der Kornernte, von der ich noch eine Komposition gemacht habe.
Ich mache dies für jemanden in Eindhoven, der einen Eßsaal zu dekorieren wünschte. Er wollte dies mit Kompositionen von verschiedenen Heiligen machen. Ich gab ihm zu bedenken, ob etwa sechs Darstellungen aus dem Bauernleben von der Meierei, sowie die vier Jahreszeiten symbolisierende, nicht mehr den Appetit der braven Leute, die dort zu Tische sitzen müssen, anregen würden, als die eben erwähnten mystischen Personen. Nun hat sich der Mann, nach einem Besuche im Atelier, dafür erwärmt. Aber er selbst will die Felder malen, wird das gelingen? Ich will jedoch die Kompositionen und Bilder in kleinerem Maßstabe entwerfen.
Es ist ein Mann, den ich, wenn möglich, zum Freund haben möchte, ein gewesener Goldschmied, der sogar dreimal eine sehr ansehnliche Kollektion Antiquitäten gesammelt und verkauft hat, nun reich ist und ein Haus gebaut hat, das er wieder von Antiquitäten und mit manchen sehr schönen Eichenholzschränken etc. möbliert hat. Die Plafonds und Wände dekoriert er selbst und wirklich manchmal gut.
Im Eßsaal will er aber durchaus Malereien haben, und so hat er begonnen, zwölf Paneele mit Blumen zu bemalen. Es bleiben sechs Felder in der Breite übrig, und dafür gab ich ihm vorläufig Entwürfe von einem Sämann, einem Pflüger, einem Hirten, einer Kornernte, einer Kartoffelernte und einer Ochsenkarre im Schnee.
Ob aber etwas daraus werden wird, weiß ich nicht; denn eine feste Verabredung habe ich nicht von ihm.
Allein, er ist von diesem ersten Fach sehr eingenommen sowie von meinen Skizzen für die anderen Gegenstände. Ich verlange sehr nach Deinem Kommen.
Es gefällt mir hier noch immer, zeitweilig vermisse ich wohl manche Dinge, doch die Arbeit absorbiert mich genugsam.
Nun grüße Herrn Obach von mir, wenn Du ihn einmal triffst.
Wenn Du hierher kommst, so wirst Du alle Bauern beim Pflügen und Sporksäen finden, oder es wird gerade zu Ende damit gehen.
Ich habe prachtvolle Sonnenuntergänge auf den Stoppelfeldern gesehen.
Auf Wiedersehen
t. à t. Vincent
Nuenen, 30. April 1885
Lieber Theo! ......
Was die Kartoffelesser angeht, so ist das ein Bild, das sich in einem Goldrahmen gut macht, das weiß ich sicher. Es würde sich jedoch ebenso gut auf einer Wand machen, die mit einer Tapete von dem tiefen Ton des reifen Kornes bedeckt wäre. Ohne einen solchen Abschluß ist es indessen einfach nicht zu sehen.
Auf einem dunklen Grunde kommt es nicht zur Geltung und besonders nicht gegen einen fahlen Fond, und zwar deshalb, weil es ein Blick in ein sehr graues Interieur ist.
In der Wirklichkeit steht es sozusagen auch in einem vergoldeten Rahmen, da – mehr zum Beschauer hin – der Feuerherd liegt und der Schein des Feuers auf den weißen Wänden, was alles sich jetzt außerhalb des Bildes befindet, während es in der Natur das ganze Motiv zurückdrängt.
Man muß es also dadurch abschließen, daß man es mit einer tiefen Gold- oder Kupferfarbe einrahmt.
Wenn Du es sehen willst, wie es gesehen werden muß, dann denke bitte daran. Die Hinzufügung des Goldtons gibt zugleich gewissen Stellen Licht, wo Du es nicht erwarten würdest, und bringt das markierte Aussehen zum Verschwinden, das es bekommt, wenn man es unglücklicherweise gegen einen graugelben oder schwarzen Fond stellt. Die Schatten sind mit Blau gemalt, und auf dieses wirkt Goldfarbe.
Ich habe es gestern zu einem Bekannten von mir nach Eindhoven gebracht, der malt. In etwa drei Tagen werde ich dort bei ihm einzelne Details noch etwas fertig machen und es mit etwas Eiweiß herausholen. Der Mann, der selbst sein Bestes tut, um malen zu lernen und sich auch selbst bemüht, ein gutes Kolorit zu bekommen, war sehr davon eingenommen. Er hatte bereits die Studien gesehen, nach denen ich die Lithographie gemacht hatte, und sagte, er hätte nicht gedacht, daß ich Farbe und Zeichnung zugleich noch um so viel würde weiter bringen können. Da er auch nach Modell malt, weiß er auch recht wohl, was in einem Bauernkopf oder einer Bauernfaust steckt, und von den Händen sagt er, er hätte jetzt einen ganz anderen Begriff bekommen, wie er sie machen müsse.
Ich habe mich nämlich nicht wenig bemüht, so zu arbeiten, daß man auf den Gedanken kommt, daß diese Leutchen, die da bei ihrem Lämpchen ihre Kartoffeln verzehren, mit diesen Händen, die sie in die Schüssel stecken, selbst die Erde umgegraben haben, und es spricht also von Handarbeit und davon, daß sie ihr Essen redlich verdient haben. Ich wollte, daß es an eine ganz andere Art des Lebens erinnert, als diejenige von uns gebildeten Menschen ist. Ich wünschte denn auch durchaus nicht, daß ein jeder es nur so ohne weiteres gut oder schön fände. Ich habe den ganzen Winter hindurch die Fäden dieses Gewebes in der Hand gehabt und das endgültige Muster gesucht, und wenn es nun etwa ein Gewebe ist, das ein rauhes und grobes Aussehen hat, so sind nichtsdestoweniger die Fäden doch mit Sorgfalt und nach gewissen Regeln gewählt, und es könnte sich herausstellen, daß es ein echtes Bauernbild ist. Ich weiß, daß es das ist. Wer aber die Bauern lieber süßlich sieht, mag es tun. Ich meinerseits bin überzeugt, daß man auf die Dauer bessere Resultate erzielt, wenn man sie in ihrer Rauheit malt, als wenn man konventionelle Liebenswürdigkeit hineinbringt.
Ein Bauernmädchen ist, meiner Meinung nach, in ihrem verschossenen und geflickten Rock und ihrer Jacke, die durch Wetter, Wind und Sonne die feinsten Nuancen bekommen, schöner als eine Dame. Ziehe ihr aber ein Damenkleid an, dann ist ihr Echtes weg.
Ein Bauer ist auf dem Felde in seinem Bombardeuanzuge schöner, als wenn er sonntags in einer Art Herrenrock zur Kirche geht.
Und deshalb würde man, finde ich, auch unrecht haben, wenn man einem Bauernbilde eine gewisse konventionelle Glattheit gäbe. Wenn ein Bauernbild nach Speck, Rauch und Kartoffeldunst riecht, gut – das ist nicht ungesund; wenn ein Stall nach Mist riecht – gut, dafür ist es ein Stall; wenn ein Feld einen Duft von reifem Korn oder Kartoffeln oder – von Guano und Mist hat, so ist das gerade gesund – besonders für Stadtleute.
Von solchen Bildern haben sie Nutzen. Parfümiert aber darf ein Bauernbild nicht werden. Ich bin neugierig, ob Du etwas darin finden wirst, das Dir gefällt – ich hoffe es. Ich bin froh, da ich gerade jetzt, wo Mr. Portier gesagt hat, daß er sich um meine Arbeiten bekümmern will, etwas Importanteres habe als nur Studien. Was Durand-Ruel betrifft, so hat auch er die Zeichnungen nicht für der Mühe wert gehalten – laß ihn nun doch einmal dieses Bild sehen. Laß es ihn häßlich finden, gut, aber zeige es ihm trotzdem, damit sie sehen, daß wir Energie in unserem Streben haben. Du wirst jedoch hören: »quelle croute«! Sei gefaßt darauf, so wie ich selbst darauf gefaßt bin. Aber laß uns fortfahren, etwas Echtes und Ehrliches zu geben. Das Bauernleben zu malen, ist etwas Ernstes, und ich würde mir Vorwürfe machen, wenn ich mich nicht bemühte, Bilder zu malen, welche denjenigen, die ernst über Kunst und Leben denken, ernste Dinge zu denken geben können.
Millet, de Groux und so viele andere haben Vorbilder von Charakterfestigkeit gegeben und sich durch die Vorwürfe von sale, grossier, boueux, puant etc. so wenig stören lassen, daß es eine Schande wäre, wenn man auch nur zweifelte.
Nein, man muß die Bauern malen, indem man selbst einer der ihren ist, indem man fühlt und denkt wie sie selbst – weil man nicht anders sein kann, als man ist.
Ich denke so oft, daß die Bauern eine Welt für sich und in vieler Hinsicht recht viel besser als die gebildete Welt sind.
Nicht in jeder Hinsicht; denn was wissen sie von Kunst und anderen Dingen mehr?
Ich habe zwar noch einige kleinere Studien, Du kannst Dir aber wohl denken, daß ich durch das Größere so in Anspruch genommen wurde, daß ich außer diesem wenig anderes habe machen können.
Ich werde Dir, sobald es ganz fertig und trocken ist, das Bild in einer Kiste schicken und dann noch einige kleinere beifügen.
Ich denke, es wird gut sein, wenn ich mit der Sendung nicht lange warte, und deshalb werde ich es schicken; wahrscheinlich wird dann nichts aus der zweiten Lithographie danach, aber – enfin – ich verstehe, daß M. Portier noch sicherer gemacht werden muß, damit wir wirklich auf ihn, als auf einen Freund, rechnen können. Ich hoffe von Herzen, daß dies gelingen wird.
Ich war so vertieft ins Malen, daß ich meinen Umzug, der doch auch erledigt werden muß, buchstäblich fast vergessen hätte.
Meine Sorgen werden dadurch nicht geringer, aber das Leben aller Maler dieser Richtung ist so voll davon, daß ich wohl nicht verlangen kann, es leichter zu haben, als sie es hatten.
Und da auch sie ihre Bilder trotz allem zustande brachten, werden mich die materiellen Schwierigkeiten, wenn sie mich auch hindern, doch nicht vernichten oder erschöpfen.
Ich glaube, daß die Kartoffelesser gut gelingen; die letzten Tage sind, wie Du weißt, für ein Bild immer gefährlich, weil man, wenn es noch nicht ganz trocken ist, nicht mehr mit dem großen Pinsel darangehen darf – denn damit, die Wahrscheinlichkeit ist groß, verdirbt man es sich leicht – und weil die Veränderungen sehr vorsichtig und ruhig mit einem kleinen Pinsel gemacht werden müssen. Deshalb habe ich es einfach fortgebracht und meinem Freunde gesagt, er müsse dafür sorgen, daß ich es nicht auf diese Weise verdürbe, und ich würde die Kleinigkeiten bei ihm machen. Du wirst sehen, daß es Ursprünglichkeit hat ......
t. à t. Vincent
Nuenen, ohne Datum (wohl September 1885)
Lieber Theo! Diese Woche bin ich in Amsterdam gewesen – ich habe dort fast keine Zeit gehabt, etwas anderes als das Museum zu sehen; ich war drei Tage dort. Dienstag gegangen, Donnerstag zurück. Das Resultat ist – ich bin sehr froh, daß ich gegangen bin, und nehme mir vor, es mir nicht mehr so lange zu versagen, Bilder zu sehen.
Ich hatte es wegen der Kosten immer aufgeschoben und aufgeschoben, das und so viel anderes!
Aber daß ich mir jetzt nicht länger vorstellen kann, daß dies die richtige Manier ist, ist viel besser. Ich habe für meine Arbeit zuviel davon, und wenn ich die alten Bilder betrachte, die ich, was die Technik betrifft, ganz anders entziffern kann als früher – dann habe ich im übrigen herzlich wenig Bedürfnis nach Konversation.
Ich weiß nicht, ob du Dich erinnerst, daß links von der Nachtwache, also als Pendant der Staalmeesters, ein Bild hängt – mir war es bis heute unbekannt – von Frans Hals und Pieter Codde; etwa zwanzig Offiziere in ganzer Figur.
Hast Du darauf geachtet??? Es ist, besonders für einen Koloristen, die Reise nach Amsterdam wohl schon für sich allein wert. Es ist eine Figur darauf, die Figur des Fähnrichs, ganz in der linken Ecke, gleich am Rahmen – diese Figur ist von Kopf zu Fuß in Grau, ich will es Perlgrau nennen, ein eigenartiger neutraler Ton – vermutlich erreicht durch Orange und Blau, so gemischt, daß sie einander neutralisieren, durch das Variieren dieses Grundtones – und indem es hier etwas heller, dort etwas dunkler gemacht ist, ist mit demselben Grau gewissermaßen die ganze Figur gemalt. Doch die ledernen Schuhe sind anders im Stoff als die Beinkleider, diese anders als die Hosenfalten, diese anders als das Wams – einen anderen Stoff ausdrückend, in der Farbe ganz verschieden voneinander, doch alles in einer Familie von Grau.
In dieses Grau bringt er nun Blau und Orange – und etwas Weiß –, das Wams hat seidene Schleifen von einem göttlich zarten Blau, Schärpe und Fahne Orange, Weiß, Blau, wie die nationalen Farben damals waren – Orange und Blau gegeneinander, die herrlichste Skala –, auf einem Hintergrunde von fein gemischtem Grau, so daß sie gerade infolge der Vereinigung dieser, ich möchte sagen, zwei Elektrizitätspole – der Farbe –, vor dem Grau und Weiß einander aufheben. Ferner sind in dem Bilde andere Skalen von Orange gegen ein anderes Blau durchgeführt, ferner die herrlichsten Schwarz gegen die herrlichsten Weiß; die Köpfe – etwa zwanzig – sprühend von Geist und Leben – und gemacht! und eine Farbe! die Stellungen all dieser Leute in ganzer Figur, superbe. Aber der orange, weiße, blaue Kerl in der linken Ecke – ich habe selten eine göttlich-schönere Figur gesehen. Es ist etwas Einziges. Delacroix wäre begeistert davon gewesen – aber begeistert bis ins Unendliche. Ich stand buchstäblich auf der Stelle angewurzelt. Nun, Du kennst den Sänger, den lachenden Burschen – Büste in einem grünlichen Schwarz mit Karmin – Karmin auch in der Fleischfarbe –, Du kennst das Brustbild des Mannes in Gelb – citron amorti –, dessen Gesicht infolge des Gegeneinanders von verwegenen Tönen ein meisterliches Bronze, weinrötlich (violett?) ist.
Burger hat über die Judenbraut von Rembrandt geschrieben, wie er über den Delfter v. d. Meer schrieb, wie er über den Sämann von Millet schrieb, wie er über Frans Hals schrieb, sich hingebend und sich selbst übertreffend.
Die Staalmeesters sind vollendet – der schönste Rembrandt –, doch die Judenbraut, nicht so geschätzt – welch ein intimes, welch ein unendlich sympathisches Bild, gemalt – d'une main de feu. Siehst Du, Rembrandt ist in den Staalmeesters der Natur treu, wenn er da auch, so wie immer, ins Höhere, ins Allerhöchste, ins Unendliche geht – aber Rembrandt konnte noch etwas anderes, wenn er nicht, wie im Porträt, nach dem Buchstaben treu zu sein brauchte, wenn er dichten durfte. Poet sein, das heißt Schöpfer sein. Das ist er in der Judenbraut.
Wie hätte Delacroix auch gerade dieses Bild verstanden. Welch eine edle Empfindung, wie unergründlich tief! »Il faut être mort plusieurs fois pour peindre ainsi«, paßt wohl darauf. Über die Bilder von Frans Hals – er bleibt immer auf der Erde – kann man sprechen, Rembrandt aber geht so tief ins Mysteriöse, daß er Dinge sagt, für die es in keiner Sprache Worte gibt.
Man hat recht, wenn man von Rembrandt sagt – Magier – das ist kein leichtes Amt.
Ich habe verschiedene Stilleben eingepackt, die Du nächste Woche zusammen mit zwei Erinnerungen an Amsterdam, welche ich noch in der Eile erhaschte, und ein paar anderen Zeichnungen erhalten wirst. Ich werde Dir binnen kurzem auch ein Buch von de Goncourt, »Chérie«, schicken. De Goncourt ist immer schön, und seine Art zu arbeiten, so aufrichtig, und es ist alles so durchgearbeitet.
Ich sah in Amsterdam zwei Bilder von Israels, nämlich den Zandvoorter Fischer, und eines seiner allerletzten, eine alte Frau, zusammengesunken wie ein Paket Lumpen vor der Bettstatt, in der die Leiche ihres Mannes liegt.
Beide fand ich wieder meisterhaft. Mag man faseln von Technik was man will mit europäischen, hohlen, scheinheiligen Worten: die wahren Maler lassen sich von ihrem Gewissen, das man Gefühl nennt, ihrer Seele, ihrem Gehirn leiten; auch ist die Leinwand bange vor dem Maler und nicht der Maler vor der Leinwand ......
g. d. D. Vincent
Nuenen, ohne Datum (wohl Ende November 1885)
Lieber Theo! Das Buch von de Goncourt habe ich gestern abend erhalten; ich habe sofort angefangen, darin zu lesen, und obwohl ich es natürlich noch einmal aufs neue ruhig durchlesen muß, hatte ich heute morgen bereits einen Überblick über das Ganze – ich hatte also ein ziemliches Verlangen danach. Daß er Boucher zu sehr lobt, kann ich nicht finden.
Wüßte ich von Boucher auch nichts anderes als die Zusammenstellung dieser drei Dinge: ein reiches Blau als Luft, ein Bronzeton in den männlichen und ein perlmutterartiges Weiß in den weiblichen Figuren, und schließlich, vor allem, noch die Anekdote von der duchesse d'Orléans – schon dann würde ich zugeben, daß er ein Jemand in der Malerwelt ist. Er lobt ihn schon deshalb nicht zu sehr, weil er ihn ja tatsächlich »Canaille« nennt – in der Art, wie man, ohne den braven Bürger zu verkürzen, die Bilder von Bougereau, Perrault etc. »Canaille« nennen kann, weil ihnen ein gewisses Erschütterndes und Intimes fehlt. Nicht wahr? Goncourt lobt, meiner Meinung, Boucher durchaus nicht zu sehr, denn ich besorge keinen Augenblick, daß er z. B. die Superiorität von Rubens leugnen würde.
Rubens war noch viel produktiver als selbst Boucher und ebenso wie er, ja in noch höherem Maße, der Maler des weiblichen Körpers.
Das schließt aber bei Rubens das Erschütternde und Intime, das ich im Auge habe, keineswegs völlig aus, besonders nicht in den Porträts seiner Frau, in denen er dann ganz er selbst ist, ja sich selbst übertrifft.
Aber Chardin!
Ich hatte oft das Verlangen, etwas über den Mann zu wissen – Watteau gerade so, wie ich dachte. Tiers-état, Corot wesensgleich in seiner Bonhomie – doch mit mehr Verdruß und Unglück in seinem Leben.
Es ist ein prachtvolles Buch. La Tour geistreich und vom Schlage Voltaires.
Das Pastell ist ein Verfahren, das ich wohl kennen möchte, später werde ich es wohl auch einmal machen; wenn man einen Kopf malen kann, muß man es in ein paar Stunden lernen können.
Was er über die Technik von Chardin sagt, war mir ein großer Genuß. Es wird mir mehr und mehr meine Überzeugung, daß die wahren Maler nicht in dem Sinne fertig machen, in dem man das Fertigmachen nur allzu oft verstanden hat, das heißt, wenn man die Nase darauf legt.
Die besten Bilder, und gerade die vom technischen Gesichtspunkte aus vollendetsten, bestehen, in der Nähe betrachtet, aus nebeneinanderstehenden Farbflecken und wirken nur auf einen gewissen Abstand. Dabei ist Rembrandt geblieben trotz all den Plagen, die er deshalb zu erleiden hatte (die braven Bürger fanden v. d. Helst viel schöner, und zwar weil man sich ihn auch ganz in der Nähe ansehen kann).
Chardin ist in dieser Hinsicht so groß wie Rembrandt. Israels finde ich stets admirable, gerade in seiner Technik. Es wäre zu schön, wenn ein jeder das wüßte und so darüber dächte, würde Bonnemort sagen. Um so arbeiten zu können, muß man ein wenig zaubern können, was schwer zu erlernen ist, und das düster sarkastische Wort Michelangelos: »Meine Art ist dazu bestimmt, große Dummköpfe zu machen«, ist auch, was die Draufgänger der Farbe angeht, wahr, denn auch diese Dinge sind von den Feigen und Unselbständigen nicht nachzumachen.
Ich glaube, daß ich mit der Arbeit weiterkomme. Gestern abend passierte mir etwas, das ich Dir, so genau ich kann, erzählen werde. Du kennst die drei Kopfeichen hinter dem Garten zu Hause; ich habe mich zum vierten Male damit gequält. Ich hatte drei Tage davor gesessen mit einer Leinwand von der Größe der Hütte und des Bauernkirchhofes, die Du hast. Es waren diese Perücken von havannafarbenen Blättern – die zu modellieren, da Form, Farbe, den Ton hineinzubringen! Am Abend ging ich dann damit zu meinem Bekannten in Eindhoven, der einen ziemlich vornehmen Saal hat, wo wir es aufhingen (graue Tapete, Möbel schwarz mit Gold).
Nun wohl, ich habe niemals so sehr die Überzeugung gehabt, daß ich Dinge machen werde, die gut wirken werden, daß es mir gelingen wird, meine Farben so zu berechnen, daß ich den Effekt in der Hand habe. Dieser war Havanna, ein zartes Grün und Weiß (Grau) – sogar reines Weiß, direkt aus der Tube (Du siehst, daß ich für meine Person, spreche ich auch von Dunkelheiten, kein Vorurteil dem anderen Äußersten, ja Alleräußersten gegenüber habe).
Obgleich nun dieser Mann Geld hat, obgleich er es gern haben wollte –, ich hatte ein solches Aufleuchten guten Mutes, als ich sah, daß es befriedigte, daß es Stimmung hervorbrachte, so wie es da hing, durch den zarten, melancholischen Frieden dieser Farbenzusammenstellung, daß ich es nicht verkaufen konnte.
Aber weil es ihn gepackt hat, habe ich es ihm geschenkt, und er hat es angenommen, gerade so wie ich es meinte, ohne viel Worte, nämlich mit wenig anderem als: »Das Ding ist verdammt gut.«
Das denke ich nun selbst noch nicht, ich muß erst noch einmal etwas Chardin, Rembrandt, alte Holländer und Franzosen sehen und noch einmal gut nachdenken, weil ich es mit etwas weniger Farbe, als ich zu diesem Ding gebrauchte, noch stärker herausarbeiten will.
Was nun meinen Bekannten betrifft und seine Ansicht über Bilder – wenn jemand mit einem klar denkenden Kopf, sei es auch nur ein Jahr lang, tagaus tagein Stilleben malt und sich draußen umsieht, dann mag er noch kein Kunstkenner sein, dann fühlt er sich auch noch nicht als Maler – aber er sieht nicht weniger gut als mancher andere. Es kommt bei ihm noch hinzu, daß er von Charakter nicht wie der erste beste ist; er sollte nämlich ursprünglich Geistlicher werden – hat es im gegebenen Augenblick einfach aufgegeben – und hat es gut durchgesetzt, was in Brabant nicht gerade einem jeden glückt.
Dabei hat er etwas Großzügiges und Loyales. Dies ist etwas, worauf Zola hinweist, wenn er in einem Gespräch zwischen Mouret und dessen Schulkameraden, Mouret ernst werden und sagen läßt, es habe ihn viel Mühe gekostet, diese Zeit und ihren Einfluß zu überwinden; er wolle leben und er lebe. Viele, die einen anderen Weg einschlagen, werden rückfällig, bringen es nicht weiter als bis zu einer gewissen farblosen Methode, weil sie nicht genügend kräftige Mittel anwenden. Das ist bei ihm aber nicht der Fall, er ist ein Mann in seiner bürgerlichen Welt.
Weißt Du wohl, daß die Goncourts Radierungen und Zeichnungen gemacht haben? Du darfst nicht denken, daß ich unpraktisch bin, wenn ich Dich beständig animiere, zu zeichnen oder zu malen.
Es wird Dir auch nicht mißlingen. Auch würde das Resultat, wenn Du wolltest, nicht kleinlich sein, und gerade im Kunsthandel, gerade dem Kunstkenner in Dir würde es ein Übergewicht über sehr viele geben. Ein Übergewicht, das man eigentlich nötig hat. Ich komme noch einmal auf meinen Bekannten zurück, es ist gerade ein Jahr, daß ich ihn zum ersten Male sah, ich machte damals die große Skizze einer Wassermühle, die Du vielleicht kennst (deren Farbe übrigens gut reift).
Hier hast Du nun die Beschreibung einer Studie dieses Bekannten: einige Dächer, Rückseiten von Häusern und Fabrikschornsteine, dunkel gegen eine Abendluft.
Diese Abendluft geht am Horizont blau in Glut über, zwischen rauchfarbigen Wolken mit orange, oder besser, roten Reflexen. Die Masse der Häuser dunkel, aber doch noch warme Steinfarbe, eine Silhouette, die etwas Düsteres und Drohendes hat. Der Vordergrund ist ein leeres Terrain in der Dämmerung, schwarzer Sand, verwelktes Gras, kurzum ein Stück Gartenboden, auf dem einzelne schwarze armselige Apfelbäume stehen, hier und da ein Büschel gelber Herbstblätter daran. Dies macht er absolut ganz aus sich. Ist das nicht eine große Auffassung, eine echte, gut gefühlte Impression?
Aber in einem Jahr wird man kein Maler; das ist auch nicht nötig. Aber mitunter läuft schon ein gutes Ding mit durch, und es ist Hoffnung vorhanden – man fühlt sich nicht machtlos, wie vor einer Mauer. Ich weiß nicht, wie es mir fernerhin gehen wird. Wenn ich von diesem vorzüglichen Teufelskerl, diesem ausgezeichneten Latour lese – sapperlot, wie ist das echt, und wie hat ein solcher Kerl das Leben (abgesehen von seiner gehörigen Geldgier) angepackt – und das Malen auch!
Ich habe nun kürzlich Frans Hals gesehen, nun wohl, Du weißt, wie erfüllt ich davon war, wie ich Dir sofort ausführlich über das In-einem-Zuge-hinsetzen schrieb. Welche Übereinstimmung besteht doch zwischen den Ansichten von Latour etc. und Frans Hals, wenn sie mit Pastell, das man fortblasen könnte, das Leben darstellen.
Ich weiß nicht, was ich tun werde und wie es mir gehen wird, aber ich hoffe, die Lektionen, die ich auf diese Weise in letzter Zeit nehme, nicht zu vergessen. Auf einmal, kurz und bündig, aber mit absoluter ganzer Anspannung von allem, was man an Geist und Aufmerksamkeit hat.
Augenblicklich ist mir nichts lieber, als die Arbeit mit dem Pinsel – auch damit zeichnen, statt einen Gegenstand in Holzkohle machen. Wenn ich mich frage, wie die alten Holländer anlegten, dann sehe ich mich vor der Tatsache, daß sie verhältnismäßig wenig gezeichnet haben. Und wie erstaunlich zeichnen sie trotzdem! Ich glaube, in den meisten Fällen fingen sie an, schritten sie fort und endigten sie mit – ihrem Pinsel. Sie füllten nicht aus.
Und z. B. van Goyen; ich sah kürzlich von ihm in der Kollektion Dupper einen Eichbaum auf einer Düne im Sturm, und den Cuyp, Blick auf Dordrecht.
Eine erstaunliche Technik – aber – mit nichts und wie von selbst gemacht, nicht Palette und scheinbar höchst einfach.
Aber ob es nun das Figurenbild, ob es die Landschaft war – wie haben sich die Maler stets bemüht, die Leute davon zu überzeugen, daß ein Bild etwas anderes ist als die Natur in einem Spiegel, etwas anderes als Nachahmung, nämlich ein Neuschaffen.
Ich möchte Dir noch vieles sagen über das, was vor allem Chardin mir zu denken gibt in bezug auf die Farbe – und des Verzichtes auf den Lokalton. Ich finde es prachtvoll: »Comment surprendre – comment dire de quoi est faite cette bouche démeublée qui a d'infinies délicatesses. Cela n'est fait que de quelques traînées de jaune, et de quelques balayures de bleu!!!!«
Als ich das las, dachte ich an – den Delfter Vermeer, an das Stadtbild im Haag; wenn man das in der Nähe sieht, ist es unglaublich und mit ganz anderen Farben gemacht, als man auf ein paar Schritte Entfernung vermuten würde.
Besten Gruß, ich wollte nicht unterlassen. Dir sofort zu sagen, wie schön ich das Buch von de Goncourt finde.
g. d. D. Vincent

23. Der Garten des Hospitals in Arles. Tuschzeichnung. Frühjahr 1889.
Antwerpen, ohne Datum (wohl Anfang Dezember 1885)
Lieber Theo! Vielen Dank für Deinen Brief und die einliegenden 150 Francs. – Ich wollte Dir sagen, daß ich froh bin, hierher gegangen zu sein; vorige Woche habe ich noch drei Studien gemalt, eine mit Rückseiten alter Häuser, aus meinem Fenster gesehen, zwei im Park. Eine davon habe ich bei einem Kunsthändler ausgestellt. Ferner habe ich noch bei zwei anderen, was ich von draußen mit hierher brachte, in Kommission gegeben. Bei einem vierten kann ich einen Blick auf den Kai ausstellen, sobald es das Wetter erlaubt, ihn zu malen, weil er einen Mals hat, zu dem er etwas hinzu haben möchte. Ferner habe ich von diesem Letztgenannten auch eine Adresse bekommen, wo ich, wie er versicherte, gut empfangen werden würde.
Nun sind diese Kunsthändler nicht die größten von Antwerpen, aber trotzdem sah ich bei allen neben vielem, das mich nicht befriedigte, auch solche Dinge, die mir gefielen, z. B. bei einem ein Bild von van Goyen und eine Studie von Troyon, bei einem anderen das kleine Bild, von dem ich sagte, es sei wie Raffaëlli – es ist aber von Noormanns –, sowie einige gute Aquarelle. Bei einem anderen sah ich verschiedene gute Marinen von jungen Belgiern. Figuren sah ich sehr wenige, und ich habe deshalb die Absicht, etwas Figürliches zu machen. Die Adresse, die mir der bewußte Kunsthändler gab, ist gerade die eines der größeren Kunsthändler, Nicolié, die keine Auslagen haben, sondern ihre Ausstellungen in einem geschlossenen Hause veranstalten. Dorthin will ich jedoch mit Figuren gehen.
Sodann habe ich auch nützliche Quellen für Farben etc. entdeckt, wo ich ziemlich billig dazu kommen kann. Auch habe ich Linnig aufgestöbert, den Du mir im Sommer nanntest, als ich Dich frug, ob Du in Antwerpen Leute kenntest – aber er hat nichts als einige elende alte Bilder, malt selbst so in der Art von Vertin, schien mir aber ein decouragierter Mann zu sein – wenn er überhaupt jemals Mut gehabt hat –, den ich jedenfalls nicht sehr hoch einschätze. Alle diese Herren klagen jedoch Stein und Bein darüber, daß sie keinen Umsatz hätten – enfin, das ist nichts Neues. Ich hoffe, mir das Bild, von dem Du schriebst, baldigst ansehen zu können.
Ich habe jedoch viel mit Hin- und Herlaufen zu tun gehabt, um diese Leute aufzuspüren, und mit der Jagd nach Modellen. Dies letztere ist stets außerordentlich beschwerlich, aber ich habe sie anderswo schließlich gefunden, und so werde ich auch hier dazu kommen.
Ich habe für morgen eine Verabredung mit einem prächtigen alten Manne. Ob er kommen wird???
Heute habe ich meinen Vorrat an Farben, der mir aus Eindhoven nachgeschickt worden ist, erhalten und bezahlt – über 50 Francs.
Es ist schwer, außerordentlich schwer, bei der Arbeit zu bleiben, wenn man nichts verkauft und seine Farbe buchstäblich von dem bezahlen muß, was für Essen, Trinken und Wohnen allein, knapp gerechnet, nicht zuviel sein würde. Und dann noch die Modelle. Enfin. Dennoch ist Aussicht vorhanden und sogar gute, denn es gibt augenblicklich verhältnismäßig nur wenige, die arbeiten. Dies ist ihnen meiner Meinung nach nur zur Hälfte (zur anderen Hälfte aber allerdings) übelzunehmen; denn es ist manchmal zu arg.
Dennoch baut man Reichsmuseen für Hunderttausende und ähnliche Dinge, aber die Künstler krepieren derweilen.
Aber wie dem auch sei, es war mir ein Bedürfnis, wieder einmal einen Blick auf die Dinge zu werfen, und die Möglichkeit, etwas zu tun, ist nicht geringer, sondern eher bedeutend größer, als ich annahm. Ich habe verschiedene Photographien nach Jan van Beers gesehen, manche seiner Sachen sind doch mit sehr viel Charakter gemacht, aber ich glaube, daß jemand, wie z. B. Manet, bedeutend mehr Maler ist als van Beers und schöner und künstlerischer arbeitet. – Wenn ich hier nur etwas mehr bekannt wäre, wenn ich nur die Modelle, die ich sah, kriegen könnte! – Gestern war ich in dem Café-Konzert »Scala«, etwas wie die Folies-Bergères – ich fand es langweilig und abgeritten dort, aber – ich habe mich über die Zuschauer amüsiert.
Es waren prachtvolle Frauenköpfe dort, wirklich außergewöhnlich schöne unter den braven Bürgerleutchen auf den hintersten Bänken, und im allgemeinen finde ich es wohl richtig, wenn man von Antwerpen sagt, daß die Frauen dort schön sind.
Oh! Ich sage nochmals, wenn ich Modelle nach meiner Wahl bekommen könnte! Was mich sehr kühl läßt, sind die vielen deutschen Frauenzimmer, die man in den Cafés-Konzerts sieht – alle nach einem Modell fabriziert, möchte man sagen. Diese selbe Sorte sieht man, scheint es, heutzutage überall, gerade so wie das bayerische Bier.
Das scheint ein Artikel zu sein, der en gros exportiert wird.
Ich finde alle diese deutschen Elemente, die sich heutzutage überall einnisten, wo man auch hinkommt, schauderhaft langweilig. In Paris wird es wohl gerade so sein, daß die »Moffen« sich überall eindrängen. Enfin, es ist eine langweilige Sache, darüber zu reden.
Daß ich einige Bilder von anderen sah, hat mir allerlei Ideen für die Zeit im Frühjahr gegeben, da ich wieder draußen sein werde, zugleich hat sich meine Zuversicht, daß ich mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht, weiterarbeiten muß, gehoben.
Antwerpen ist schön in der Farbe, und schon allein wegen der Motive ist es der Mühe wert.
Ich habe eines Abends einen bal populaire von Matrosen etc. in der Nähe der Docks gesehen – es war höchst interessant, und es ging sehr anständig dabei zu. Das wird jedoch wohl nicht auf allen Bällen der Fall sein.
Hier war z. B. niemand betrunken, auch trank niemand viel.
Es waren sehr hübsche Frauenzimmer da, von denen die allerschönste eigentlich häßlich war. Ich meine eine Figur, die mich frappierte wie ein erstaunlich schöner Jordaens, Velazquez oder Goya – sie war in schwarzer Seide, vermutlich irgendeine Schenkwirtin, mit einem häßlichen und unregelmäßigen Gesicht, aber mit einem Leben und pikant à la Frans Hals. Sie tanzte ausgezeichnet mit altmodischen Manieren – einmal auch mit einer Art von wohlhabendem Bäuerlein, das einen großen grünen Regenschirm unter dem Arm hielt, selbst während es – erstaunlich flott – walzte. Andere Mädels trugen gewöhnliche Jacken und Röcke und rote Tücher. Die Matrosen, Schiffsjungen etc., außerordentlich nette Typen von Schiffskapitänen, die zusahen – riesig echt. Es tut gut, Leute zu sehen, die sich wahrhaft amüsieren.
Nun, Du siehst, daß ich nicht still sitze – aber wie entsetzlich beschwerlich es ist, court d'argent zu sein, kann ich Dir nicht genugsam sagen. Die beste Aussicht habe ich mit Figuren, weil es verhältnismäßig nur sehr wenige gibt, die sie machen, und diese Möglichkeit muß ich ausnützen. Ich muß mich hier einarbeiten, bis ich in Beziehung zu guten Figurenmalern komme, zu Verhaert z. B., und dann ist, stelle ich mir vor, das Malen von Porträts das Mittel, um etwas für größere Dinge zu verdienen.
Ich fühle die Kraft in mir, etwas zu tun, ich sehe, daß meine Arbeiten sich neben anderen Arbeiten halten, und das gibt mir eine erstaunliche Lust an der Arbeit, während ich in der letzten Zeit draußen begonnen hatte, zu zweifeln, besonders weil ich merkte, daß Portier anscheinend nichts mehr davon hält.
Wenn ich es etwas reichlicher hätte, dann würde ich wohl mehr machen können, aber ich bin, was das Produzieren betrifft, zum Teil von meinem Geldbeutel abhängig.
Ich habe auch eine Idee für ein Aushängeschild, das ich auszuführen hoffe. Ich meine z. B. für einen Fischhändler – ein Stilleben mit Fischen; für Blumenhändler, für Gemüsehändler und für Restaurants.
Mich dünkt, daß, wenn man gut arrangierte Motive nähme, in der Größe von 1 Meter zu ½ oder ¾ Meter z. B., eine solche Leinwand 50 Francs kosten dürfte, nicht mehr, zur Not auch 30 Francs, wenn es etwas Günstiges ist, und daß man versuchen müßte, einige zu machen. Soviel ist sicher, ich will gesehen werden, später werden wir unsere Hoffnungen vielleicht etwas herunterstimmen müssen, aber das werden wir möglichst hinauszuschieben suchen.
Wenn Du Zeit hast, dann schreibe mir noch einmal.
Das Ende des Monats wird sicher hart sein, es sei denn, Du kannst mich dann noch etwas unterstützen. Es hängt für mich so viel davon ab, daß ich bei der Stange bleiben kann.
Und man darf auch nicht hungrig oder elend aussehen. Im Gegenteil, man muß mitzumachen suchen, um Leben in die Bude zu bringen.
Besten Gruß und einen Händedruck
g. d. D. Vincent

24. La Berceuse (Mme. Roulin). Arles. Februar 1889. Basel, Sammlung R. Staehelin. Existiert in mehreren Fassungen

Antwerpen, ohne Datum (wohl Anfang Januar 1886)
Lieber Theo! Vorigen Sonntag habe ich die beiden großen Bilder von Rubens zum ersten Male gesehen, und weil ich mir die im Museum wiederholt und in aller Ruhe angesehen hatte, waren mir diese, die Kreuzabnahme und die Aufrichtung des Kreuzes, um so interessanter. Die Kreuzigung hat eine Eigentümlichkeit, die mir sofort auffiel, und zwar diese, daß keine weibliche Figur darauf ist. Es sei denn auf den Seitenflügeln des Triptychons.
Dadurch wird sie nicht besser. Ich muß Dir sagen, daß mich die Kreuzabnahme begeistert.
Nicht durch die Tiefe des Gefühls – wie ich sie bei Rembrandt oder in einem Bilde von Delacroix oder in einer Zeichnung von Millet finden würde.
Nichts erschüttert mich weniger als Rubens, was den Ausdruck menschlichen Schmerzes betrifft.
Laß mich, damit deutlicher wird, was ich meine, damit anfangen, daß selbst seine schönsten Köpfe der weinenden Magdalena oder der Mater dolorosa mich immer an die Tränen eines schönen Frauenzimmers erinnern, das z. B. einen Ausschlag oder dergleichen petite misère de la vie humaine erwischt hätte.
In dieser Hinsicht sind sie meisterhaft, doch etwas anderes suche man nicht darin.
Rubens ist erstaunlich im Schildern alltäglich schöner Frauen. Aber im Ausdruck ist er nicht dramatisch.
Vergleiche ihn z. B. mit dem Kopf von Rembrandt in der Sammlung Lacase, mit der Männerfigur in der Judenbraut – Du wirst verstehen, was ich meine, daß mir z. B. seine etwa acht aufgequollenen Kerle, die, in der Kreuzigung, einen tour de force mit einem schweren Holzkreuze leisten, absurd vorkommen, sobald ich mich auf den Standpunkt moderner Analyse menschlicher Leidenschaften und Gefühle stelle, daß Rubens im Ausdruck, besonders von Männern (abgesehen von seinen eigentlichen Porträts), oberflächlich, hohl, verquollen ist, ja sogar konventionell, und zwar wie Giulio Romano und noch schlimmere Leute der Dekadence.
Aber dennoch schwärme ich für ihn, weil gerade er, Rubens es ist, der – wenn seine Figuren auch manchmal hohl sind – Stimmungen von Fröhlichkeit und Freude, ebenso des Schmerzes auszudrücken sucht und auch wirklich darstellt durch die Kombination der Farben.
So in der Kreuzaufrichtung: der helle Fleck – der Körper in hellem Lichte ausgeführt – ist in seinem Zusammenhang dramatisch, als Kontrast zu dem übrigen, das so tief gestimmt ist.
Dasselbe, aber meiner Meinung nach bei weitem schöner, ist der Reiz der Kreuzabnahme, wo der helle Fleck durch die blonden Haare, das helle Gesicht und den Hals der weiblichen Figuren wiederholt wird, während die düstere Umgebung erstaunlich reich ist dank den verschiedenen tief gestimmten und durch den Ton zusammengehaltenen Massen von Rot, Dunkelgrün, Schwarz, Grau und Violett.
Delacroix hat dann aufs neue versucht, die Leute an die Symphonie der Farben glauben zu machen. Man möchte sagen, vergebens, wenn man bedenkt, wie sehr fast ein jeder unter »gut in der Farbe« die Richtigkeit des Lokaltones, die kleinliche Genauigkeit versteht, die weder Rembrandt, noch Millet, noch Delacroix, noch wer auch immer, selbst Manet nicht oder Courbet, sich zum Ziel gesetzt haben, ebensowenig wie Rubens oder Veronese.
Ich habe auch noch verschiedene andere Bilder von Rubens in verschiedenen Nischen gesehen.
Es ist sehr interessant, Rubens zu studieren, gerade weil er in seiner Technik so hervorragend einfach ist, oder vielmehr zu sein scheint, es mit so wenigem macht und mit einer so flotten Hand und ohne das geringste Zaudern malt und vor allem zeichnet. Aber das Porträt und weibliche Köpfe oder Figuren, das ist seine Stärke. Da ist er tief und auch intim.
Und wie frisch sind seine Bilder geblieben, gerade infolge der Einfachheit der Technik! Was soll ich Dir weiter sagen? Daß ich, je länger desto mehr, Lust bekomme, ohne mich zu eilen, das heißt, nervös zu hasten, ganz ruhig und einfach aufs neue noch einmal alle meine Figurenstudien von vorn anzufangen. Ich möchte es in der Kenntnis des Aktes und der Struktur des Körpers so weit bringen, daß ich aus dem Kopfe arbeiten könnte.
Ich möchte noch eine Zeitlang entweder bei Verlat oder in einem Atelier arbeiten, übrigens außerdem so viel wie möglich für mich nach Modell malen. Ich habe augenblicklich fünf Bilder, zwei Porträts, zwei Landschaften und ein Stillleben, in Verlats Malklasse in der Akademie deponiert. Ich war soeben wieder da, doch habe ich ihn wieder nicht angetroffen. Aber ich werde Dir wohl bald melden können, wie das abläuft, und hoffe es fertigzubringen, daß ich den ganzen Tag in der Akademie nach Modell malen darf, was mir alles leichter machen würde, da die Modelle so außerordentlich teuer sind, daß ich es nicht bewältigen kann.
Und ich muß etwas finden, das in dieser Hinsicht Hilfe bringt. Auf jeden Fall denke ich doch eine Weile in Antwerpen zu bleiben und nicht aufs Land zurückzukehren – es ist gut, nichts aufzuschieben, und man hat hier so viel mehr Aussicht, Leute zu finden, die sich vielleicht dafür interessieren werden. Ich fühle, daß ich etwas wage und etwas kann, und es hat sich schon viel zu lange hingeschleppt.
Ich sah dieser Tage zum ersten Male ein Fragment des neuen Buches von Zola, »L'oeuvre«, das, wie Du weißt, als Feuilleton des Gil Blas erscheint. Ich bin der Meinung, daß dieser Roman, wenn er in der Künstlerwelt durchdringt, sehr viel Gutes tun wird. Das Fragment, das ich las, fand ich sehr echt. Ich will zur Not zugeben, daß beim ausschließlichen Arbeiten nach der Natur noch etwas anderes nötig ist, Festigkeit im Komponieren, die Kenntnis des Körpers – aber après tout – ich glaube nicht, daß ich mir jahrelang absolut vergebens Mühe gegeben habe. Ich fühle eine gewisse Kraft in mir, weil ich, wohin ich auch kommen werde, immer ein Ziel haben werde – die Menschen zu malen, so wie ich sie sehe und kenne.
Ob der Impressionismus sein letztes Wort schon gesagt hat – um den Ausdruck Impressionismus beizubehalten –, ich glaube immer, daß gerade für Figuren noch viele Neue aufstehen können, und je länger desto mehr fange ich an, es wünschenswert zu finden, daß man in einer schwierigen Zeit wie der heutigen sein Heil in einem tieferen Eingehen gerade auf die hohe Kunst suche.
Denn es gibt etwas Höheres und etwas Niedrigeres, gewissermaßen – der Mensch ist mehr als der Rest, und übrigens auch bedeutend schwieriger zu machen ...
g. d. D. Vincent
Antwerpen, ohne Datum (wohl Februar 1886)
Lieber Theo! Ich schreibe Dir dieser Tage oft, und oft dasselbe, aber darin sehe ich einen Beweis dafür, daß ich vor allen Dingen eines im Kopfe habe – die Notwendigkeit, eine Zeitlang Figuren zu zeichnen, festzunageln. Ferner – es ist egoistisch, wenn Du willst – ich will meine Gesundheit wieder hergestellt sehen. Mein Eindruck der Zeit gegenüber, die ich hier zugebracht habe, ändert sich nicht – was ich hier gemacht habe, mißfällt mir verhältnismäßig sehr, aber meine Ideen haben sich umgestaltet und aufgefrischt, und das war das eigentliche Ziel, das ich mit meinem Hierherkommen erreichen wollte. Da ich jedoch, was meine Gesundheit betrifft, gemerkt habe, daß ich ihr zuviel zugetraut habe, daß ich, obgleich der Kern noch gut ist, nur noch eine Ruine bin von dem, was ich hätte sein können, so würde es mich keineswegs wundern, wenn auch Du das kräftigere Leben, das mir vorgeschrieben wird, ebenso durchaus nötig hättest.
Irre ich mich hierin nicht, dann glaube ich, daß wir nicht zu schnell zusammenkommen können, und deshalb bleibe ich bei meinen Bedenken gegen den Aufenthalt auf dem Lande. Denn wenn die Luft auch erfrischend ist, so würde ich doch die Zerstreuungen und die Geselligkeit der Stadt entbehren, von denen wir, wenn wir zusammen wären, noch so viel mehr würden haben können.
Und wenn wir nun binnen kurzem viel mehr beisammen wären, würde ich Dich in manchem enttäuschen, ja gewiß, aber nicht in allem, glaube ich, und nicht in meiner Art zu sehen. Ich will Dir zum Beginn unseres Gespräches über dieses und jenes sagen, daß ich wünschte, wir hätten beide in nicht allzu ferner Zeit, auf die eine oder andere Weise, ein festes Verhältnis mit einem Weibe; weil das hohe Zeit wird – und weil wir, wenn wir noch sehr lange damit warteten, auch nicht besser dabei fahren würden.
Doch – das alles in Ruhe. Aber das ist so ziemlich das erste Erfordernis eines kräftigenderen Lebens. Ich erwähne es, weil wir darin vielleicht eine außerordentliche Schwierigkeit zu überwinden haben werden. Es hängt viel davon ab, und da wir nun einmal dabei sind, werden wir immer wieder darauf zurückkommen müssen.
Und gerade im Umgang mit Frauen lernt man so viel für die Kunst. Schade, daß man bei alledem, was man nach und nach lernt, nicht beständig jung bleibt.
Wäre das so, dann würde das Leben zu schön sein. Hast Du die bewußte Einleitung von Chérie zu Goncourt gelesen? Ja, wenn man es bedenkt, die Fülle von Arbeit, die diese Leute geleistet haben, ist etwas Kolossales.
Es ist wirklich eine glänzende Idee, dieses gemeinschaftliche Arbeiten und Denken!
Und ich finde täglich Beweise für die Behauptung, daß eine Hauptursache des vielen Elends unter den Künstlern in ihrer gegenseitigen Uneinigkeit liegt, in dem mangelnden Zusammenarbeiten, darin, daß sie nicht gut, sondern falsch zueinander sind. Wenn wir nun in dieser Hinsicht verständiger werden, dann zweifle ich keinen Augenblick, daß wir binnen einem Jahr auf einem besseren Wege und glücklicher sein werden.
Die Arbeit will mir nicht von der Hand gehen, aber ich zwinge mich auch nicht, weil ich sie eigentlich, soviel wie möglich, ruhen lassen soll. Auch will ich mich für die erste Zeit in Paris zurückhalten, wenn sie nahe bevorstehen sollte, ohne eine Zwischenperiode, es sei denn von einem Monat; denn ich möchte gern frisch ankommen.
Es war heute – Sonntag – fast ein Frühlingstag. Ich habe heute morgen einen langen Spaziergang gemacht, allein durch die ganze Stadt, durch den Park und über die Boulevards. Es war ein Wetter, daß man draußen vermutlich die Lerchen zum ersten Male gehört haben wird.
Kurzum, es war so etwas wie Auferstehung in der Stimmung.
Doch in wie gedrückter Stimmung ist alles in den Geschäften und ebenso in den Menschen – ich glaube nicht, daß man übertreibt, wenn man, bei den verschiedenen Ausständen überall, eine düstere Zukunft voraussieht. Für künftige Geschlechter sind sie sicher nicht nutzlos; denn dann wird es eine gewonnene Sache sein. Nun aber läßt es sich für einen jeden, der in seiner Arbeit sein Brot finden muß, düster genug an, und dies um so mehr, als wir wohl voraussehen können, daß es von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Der Arbeiter gegen den Bürger – das ist ebenso gut motiviert, wie vor hundert Jahren der tiers-état gegen die beiden anderen. Am besten ist, man schweigt; denn die Bürger haben das Schicksal nicht auf ihrer Seite, und wir werden mehr noch erleben, wir sind noch lange nicht am Ende. Ist es auch Frühling – wieviele Tausende und aber Tausende laufen nicht in Trostlosigkeit umher. Ich sehe gerade so gut wie der ausgemachteste Optimist die Lerche, die in die Frühlingsluft aufsteigt. Aber ich sehe auch das junge Mädchen von kaum zwanzig Jahren, das hätte gesund sein können und die Auszehrung in den Gliedern hat – und vielleicht noch, bevor es an einer Krankheit stirbt, ins Wasser springt.
Wenn man immer in einer Gesellschaft »comme il faut« ist und unter einigermaßen begüterten Bürgern, dann merkt man das vielleicht nicht so – aber wenn man, so wie ich, eine Anzahl Jahre mit »de la vache enragée« gespeist hat, dann kann man es sich nicht wegdemonstrieren, daß das große Elend eine Tatsache ist, die ein Gewicht in die Waagschale legt.
Heilen oder retten mag man vielleicht nicht können, aber man kann diese Dinge doch mitfühlen und daran teilnehmen. Corot, der gewiß Fröhlichkeit hatte, wenn jemand sie hatte, der doch wohl wahrlich den Lenz empfand – war er nicht sein ganzes Leben einfach wie ein Arbeiter und mitfühlend mit all den Misères anderen gegenüber? Was mich besonders packte in seiner Lebensbeschreibung –: als er schon sehr alt war, im Jahre 70 und 71, sah er sicher auch noch in die klare Luft, aber – zugleich besuchte er die Ambulanzen, wo die Verwundeten lagen und krepierten.
Mögen die Illusionen schwinden – aber was bleibt? Das Sublime. Wenn man auch an allem zweifeln sollte, an Leuten wie Corot und Millet und Delacroix zweifelt man nicht. Und ich finde, daß man in Augenblicken, da man um die Natur nichts mehr gibt, noch sehr viel um Menschen gibt.
Kannst Du mir diesen Monat noch etwas schicken, viel oder wenig, dann unterlasse es nicht, und wenn es nur fünf Francs sind, und geht es nicht – dann geht es eben nicht. Ich habe aber ein großes Verlangen danach, Deine Entscheidung zu erfahren –, ob Du es wohl gutheißen würdest, wenn ich schon etwa zum 1. April nach Paris käme. Auf jeden Fall schreibe mir bald darüber. Besten Gruß und einen Händedruck.
g. d. D. Vincent

25. Das Irrenhaus von St. Remy. November 1889.
Arles, ohne Datum (wohl Mitte März 1888)
Lieber Theo! ......
In Punkto Arbeit: ich habe heute eine Leinewand von 15 fertig gemacht. Es ist eine Zugbrücke, über die ein kleiner Wagen fährt, der sich im Profil gegen den blauen Himmel abhebt. Ebenso blau der Fluß; die Ufer mit Orangensträuchern und Grün, eine Gruppe von Wäscherinnen in Miedern und bunten Hauben. Dann eine zweite Landschaft mit einer kleinen Holzbrücke und gleichfalls Wäscherinnen, schließlich eine Platanenallee beim Bahnhof; im ganzen, seitdem ich hier bin, zwölf Studien.
Das Wetter ist sehr unbeständig. Oft gibt's Wind und bewölkten Himmel, aber die Mandelbäume sieht man schon überall blühen. Ich bin recht froh, daß die Bilder zu den Indépendants kommen.
Du wirst gut daran tun, Signac zu besuchen. Ich habe mich sehr gefreut, daß Du in Deinem Brief heute schreibst, daß er auf Dich einen besseren Eindruck gemacht hat als das erstemal. Auf alle Fälle ist es mir angenehm, zu wissen, daß Du von heute an nicht mehr allein in Deiner Wohnung sein wirst. Grüße Koning von mir. Wie steht es mit Deiner Gesundheit? Mit meiner geht es besser. Eine richtige Plage ist mir nur das Essen, da ich Fieber habe und keinen Appetit. Aber das ist nur vorübergehend und muß ertragen werden. Abends habe ich Gesellschaft. Der junge dänische Maler, der hier ist, ist sehr nett. Seine Malerei ist etwas hart, korrekt und zaghaft, aber ich verüble ihm das nicht, er selber ist jung und intelligent. Er hatte seinerzeit begonnen, Medizin zu studieren. Er kennt auch die Bücher von Zola, Goncourt, Guy de Maupassant und hat Geld genug, sein Leben zu genießen. Dabei hat er den sehr ernsthaften Wunsch, etwas anderes zu machen, als er augenblicklich macht. Ich glaube, daß er gut daran tun würde, seine Heimfahrt um ein Jahr zu verschieben oder nach einem kurzen Besuch zu Hause wieder herzukommen. Aber mein lieber Bruder, Du weißt, ich fühle mich hier in Japan. Ich sage Dir nichts als das, und dabei habe ich noch nichts im gewohnten Glanze gesehen.
Und deshalb (obwohl ich mich sehr darüber kränke, daß die Ausgaben so groß sind und die Bilder nichts einbringen), deshalb zweifle ich nicht an einem endlichen Erfolg dieses gewagten Unternehmens, das meine Reise nach dem Süden ist.
Hier sehe ich Neues und lerne, und wenn ich meinen Körper mit Vorsicht behandle, versagt er mir seine Hilfe nicht.
Ich wünschte aus vielen Gründen sehr, ein kleines Häuschen zu haben, das im Falle der Erschöpfung dazu dienen sollte, die armen Pariser Droschkengäule wieder herzustellen, nämlich Dich und mehrere von unseren Freunden, die armen Impressionisten.
Neulich habe ich der Untersuchung eines Verbrechens beigewohnt, das hier vor der Tür eines Bordells begangen worden ist. Zwei Italiener haben zwei Zuaven getötet. Ich kam bei dieser Gelegenheit in eines der Bordelle in der kleinen Straße; es heißt: »des ricolettes«. Darauf beschränkt sich bisher mein Liebesleben gegenüber den schönen Arlesierinnen. Die Menge hat nahezu (sehr bezeichnend für den Südfranzosen, der nach dem Beispiel von Tartarin mehr Getue macht als etwas tut) die beiden Mörder, die im Gefängnis des Stadthauses sitzen, gelyncht. Aber der Erfolg war immerhin, daß alle Italiener und Italienerinnen, einschließlich der Savoyardenknaben, die Stadt verlassen mußten.
Ich würde Dir davon nicht erzählen, wenn ich nicht bei dieser Gelegenheit die Boulevards der Stadt voll mit aufgeregten Menschen gesehen hätte, und das war sehr schön.
Meine drei letzten Studien habe ich mit Hilfe des Perspektivrahmens gemacht, den Du bei mir kennst. Ich lege Wert auf den Gebrauch des Rahmens, und ich halte es für wahrscheinlich, daß in naher Zukunft viele Künstler sich seiner bedienen werden, ebenso wie die alten deutschen und italienischen Maler ihn sicher benutzt haben, was ich auch von den Flamen durchaus glaube.
Die moderne Anwendung dieses Instrumentes kann wohl abweichen von der alten, aber das ist schließlich dieselbe Sache mit der Ölmalerei, mit der man heute ganz andere Wirkungen erzielt, als jene beiden Erfinder der Technik Jan und Hubert van Eyck. Ich hoffe sozusagen immer darauf, daß ich nicht für mich allein arbeite. Ich glaube an die absolute Notwendigkeit einer neuen Kunst in der Farbe, in der Zeichnung und im ganzen Leben selbst, und wenn wir nur in diesem Glauben arbeiten, dann ist auch, scheint mir, Aussicht, daß unsere Hoffnung nicht trügt. Du wirst wohl wissen, daß ich Dir notwendigerweise immer Studien von mir schicken kann, bloß mit dem Einrollen ist es noch eine sehr schwierige Sache.
Ich grüße Dich bestens. Sonntag schreibe ich an Bernard und an Lautrec, da ich es ihnen feierlich versprochen habe. Die Briefe werde ich übrigens an Dich schicken.
Ich bedauere sehr die Lage von Gauguin, vor allem, weil seine Gesundheit erschüttert ist. Er hat nicht mehr Kraft genug, als daß solche Prüfungen ihm etwas Gutes bringen könnten. Im Gegenteil, sie können ihn nur erschöpfen und am Arbeiten hindern. Auf bald.
g. d. D. Vincent

26. Getreidefeld mit Zypressen bei St. Remy. Sommer 1889. London, Täte Gallery
Arles, ohne Datum (wohl Ende März 1888)
Mein lieber Theo! ......
Gauguin hat mir eine Zeile geschrieben. Er beklagt sich über das schlechte Wetter. Er leidet fortwährend. Er sagt, daß nichts ihn mehr aufreibt als der Mangel an Geld. Unter allen den verschiedenen Widrigkeiten die schlimmste; er fühlt sich verurteilt zu einer ewigen Klemme. Die letzten Tage war hier immer Wind und Regen. Ich habe zu Hause an der Studie gearbeitet, die ich im Briefe an Bernard skizzierte. Was ich wollte, waren Farben wie auf Glasfenstern und eine Zeichnung in festen Linien. Ich lese eben Pierre et Jean von Guy de Maupassant. Es ist schön. Hast Du die Vorrede gelesen, wo von der Freiheit des Künstlers die Rede ist, zu übertreiben, in seinem Buch eine Natur zu schaffen, die schöner, einfacher, tröstender ist. Auch das Wort von Flaubert wird darin erklärt: Talent ist große Geduld, und Originalität ist nichts als eine Anstrengung des Willens und intensive Beobachtung. Es gibt hier eine gotische Halle, die ich anfange, wundervoll zu finden, die Halle von St. Trophime.
Aber es hat so etwas Grausames, so Monströses für mich, etwas Beengendes wie ein Alpdruck, daß selbst dieses schöne Monument von so großem Stil wie aus einer anderen Welt ist, mit der ich gar nichts zu tun habe, noch weniger als mit dem ruhmvollen Rom eines Nero. Soll ich Dir die Wahrheit sagen und gestehen, daß auch die Menschen hier, die Zuaven, die Frauenhäuser, die entzückenden kleinen Arlesierinnen, die zur ersten Kommunion gehen, der Priester im Chorhemd, dick und bedrohlich wie ein Nashorn, die Absinthtrinker, mir ebenso aus einer anderen Welt zu sein scheinen? Damit will ich nicht sagen, daß ich mich in einer Künstlerwelt zu Hause fühlen würde, sondern im Gegenteil, daß ich mich lieber über andere Dinge lustig mache, als daß ich mit mir allein bin, und ich glaube, ich müßte sehr traurig werden, wenn ich nicht alle Sachen von ihrer lächerlichen Seite nähme.
Ihr müßt in Paris noch massenhaft Schnee gehabt haben, nach dem, was unser Freund, der »Intransigeant«, erzählt hat. Das ist übrigens nicht schlecht erfunden, daß ein Journalist dem General Boulanger rät, von nun an, um der Geheimpolizei Abwechslung zu geben, eine rosa Brille zu tragen, die – wie er meint – zum Bart des Generals besser stehen würde ......
g. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Mitte Mai 1888)
Lieber Theo! Schönen Dank für Deinen Brief mit den 100 Frs. Ich bin heilfroh, das Gesindel los zu sein. Seitdem geht es mit der Gesundheit besser. Da war vor allen Dingen das schlechte Essen. Drum schleppte ich mich so hin. Und der Wein, der war wahrhaftig ein Gift. Für 1 Fr. oder 1,50 Fr. esse ich jetzt recht gut.
Die grobe Leinewand von Tasset würde sich noch besser für meine Sachen eignen, selbst wenn die Leinewand noch dreimal so grob ist. Wenn Du diesem Herrn begegnest, dann gib Dir Mühe, zu erfahren, was er für Malgrund verwendet.
Es sollte mich nicht wundern, wenn seine Leinewand mit Pfeifenton präpariert ist. Wenn ich darüber unterrichtet wäre, würde ich, glaube ich, die Leinewand selbst präparieren. Das eilt nicht, aber versuche ein wenig, es zu erfahren. Ich habe noch 4 Meter Leinewand, 1,20 Meter breit, die ich hier gekauft habe, aber sie ist noch nicht präpariert.
Haben diese Herren noch etwas bei Deiner Rückkehr gesagt, daß sie Dich wieder auf Reisen schicken wollen? Du wirst dieser Tage den dänischen Maler, der hier war, sehen. Ich weiß nicht, ich kann seinen Namen nicht schreiben (Moriers?). Er will den Salon sehen und dann wird er in seine Heimat zurückgehen, um vielleicht in einem Jahr wieder in den Süden zu kommen.
Die drei letzten Studien waren besser und farbiger als die, die er vorher machte. Ich weiß nicht, was er später machen wird, aber er hat ein gutes Wesen, einen guten Charakter, und ich bedauere, daß er weggeht. Ich habe ihm gesagt, daß ein holländischer Maler bei Dir sei, und wenn ihn Koning auf die Butte Montmartre führen will, wird er wahrscheinlich Studien machen.
Ich habe ihm viel von den Impressionisten erzählt, die er alle dem Namen nach kannte. Hie und da hat er auch ein Bild gesehen, und er interessiert sich sehr für die Sache. Er hat eine Empfehlung für Russell. Er bessert sich hier seine Gesundheit aus, und jetzt geht es ihm wieder recht gut. Das wird für zwei Jahre vorhalten, aber dann wird es ihm gut tun, aus der gleichen Rücksicht für seine Gesundheit wieder hierherzukommen.
Was ist mit dem neuen Buch über Daumier »Der Mensch und das Werk«? Hast Du die Ausstellung der Karikaturisten gesehen?
Ich habe zwei neue Studien, eine Brücke und den Rand einer Landstraße. Viele Motive hier sind im Charakter durchaus dieselbe Sache wie in Holland. Der Unterschied liegt in der Farbe, überall gibt es hier einen Ton wie Schwefel, die Sonne steigt einem zu Kopf.
Du weißt wohl, daß wir von Renoir einen wundervollen Rosengarten gesehen haben. Ich hatte gehofft, hier ähnliche Motive zu finden, und wirklich mit den blühenden Obstgärten war dies der Fall; aber jetzt veränderte sich das Aussehen und die Landschaft ist viel wilder geworden, aber ein Grün, ein Blau! Ich muß sagen, daß einige Landschaften, die ich von Cézanne kenne, diese Sachen ganz unheimlich gut wiedergeben, und ich bedauere, die nicht vorher gesehen zu haben. Den Tag vorher habe ich ein Motiv gesehen, das ist genau wie die schöne Landschaft von Monticelli mit den Pappeln, die wir bei Reid sahen. Um die Gärten Renoirs zu finden, müßte man wahrscheinlich in die Gegend von Nizza ziehen. Hier habe ich sehr wenig Rosen gesehen, obwohl es welche gibt, vorausgesetzt, daß die Gemälde wert sind, was sie kosten. Das kann eintreten, wenn die Impressionisten steigen, und am Ende von einigen Arbeitsjahren kann man das Geld wieder herausholen.
Und am Ende werde ich ein ruhiges Zuhause haben. Ich bin neugierig, was Du von meiner Sendung sagen wirst. Ich glaube, daß es mit Frachtgut von hier nach Paris zehn Tage dauert.
Wenn darunter eine Anzahl allzu schlechter ist, so zeige sie nicht. Ich habe Dir eben alles geschickt, um Dir eine Vorstellung von den Dingen zu geben, die ich gesehen habe. Jetzt muß ich ein neues Motiv aufsuchen. Ich danke Dir von Herzen, daß Du mir so schnell geschrieben hast und drücke Dir und Koning die Hand.
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Ende Mai 1888)
Lieber Theo! Ich las in dem »Intransigeant« die Anzeige, daß Durand-Ruel eine Impressionistenausstellung macht. Da werden Sachen von Caillebotte sein, von dem ich noch nie etwas gesehen habe und ich bitte Dich, mir zu schreiben, was daran ist. Sicher gibt es da noch andere bemerkenswerte Sachen.
Heute habe ich Dir einige Zeichnungen geschickt und ich füge noch zwei andere dazu. Das sind Blicke von einem felsigen Hügel, von wo man die Crau sieht (ein gutes Weinland), die Stadt Arles und die Gegend von Fontvieilles. Der Vordergrund setzt sich wild und romantisch ab. Die fernen Perspektiven sind breit, ruhig in waagrechten Linien und aufsteigend bis zur Alpenkette, berühmt durch die heroische Kletterei des Tartarin PCA und des Alpenklubs. Dieser Gegensatz ist sehr malerisch. Die beiden Zeichnungen, die ich Dir außerdem mitschicke, werden Dir eine Vorstellung von der Ruine, die die Felsen krönt, geben ......
Es ist schon hübsch heiß, das sag ich Dir. Ich muß noch in diesem Brief um Farben bitten. Jedenfalls, wenn Du es jetzt vorzögest, sie nicht gleich zu nehmen, so machte ich vorher noch einige Zeichnungen und verlöre nichts. So trenne ich meinen Auftrag in zwei Aufträge, je nachdem der eine mehr oder weniger eilig ist.
Was immer dringend ist, das ist zu zeichnen, und was man unmittelbar mit dem Pinsel oder mit einer anderen Sache wie mit der Feder macht. Davon macht man nie genug.
Ich suche jetzt das Wesentliche herauszuholen und zu übertreiben, das banale gebe ich daneben nur andeutungsweise.
Ich bin froh, daß Du das Buch über Daumier gekauft hast, allerdings tätest Du gut daran, wenn Du die Sache vervollständigtest und seine Lithographien kauftest, denn später werden die Daumiers nicht leicht zu haben sein.
Wie geht es mit der Gesundheit? Hast Du Vater Gruby wieder gesehen? Ich glaube, daß er das Herzleiden ein wenig übertreibt, zum Nachteil des Nervensystems, das er gründlich behandeln müßte.
Am Ende wird er es sicher merken, je nachdem Du seine Verordnungen befolgst. Du wirst es mit Gruby aushalten, aber zum Unglück für uns wird Vater Gruby es nicht mit uns aushalten, denn er wird alt, und wenn man ihn am nötigsten braucht, wird er nicht mehr da sein.
Ich glaube immer mehr und mehr, daß man den lieben Gott nach dieser Welt, denn sie ist eine mißlungene Arbeit, nicht richten darf.
Was willst Du, wenn man einen Künstler liebt, dann findet man an seinen mißlungenen Arbeiten nicht viel zu kritisieren. Man schweigt. Aber man hat das Recht, bessere zu verlangen. Für uns wäre es nötig, noch andere Arbeiten von der gleichen Hand zu sehen. Denn diese Welt ist augenscheinlich in der Hetze verpaßt worden, in einem der schlechten Augenblicke, wo der Schöpfer nicht mehr wußte, was er machte oder nicht mehr den Kopf dabei hatte. Die Legende jedoch erzählt uns vom lieben Gott, daß er sich kolossal viel Mühe gegeben hat mit der Schöpfung dieser Welt.
Ich glaube, die Legende hat recht, aber dieses Studium hinkt überall, wo man hinsieht. Es gibt nur die Meister, die die Täuschung durchschauen und ebenso täuschen. Das ist vielleicht die beste Tröstung, und wenn man von da aus die Sache sieht, darf man hoffen, mit der gleichen schöpferischen Hand sich die Revanche zu holen. Von da aus gesehen, dürfen wir dieses Leben, das so kritisiert ist und aus so guten und selbst besonderen Vernunftgründen zurecht gemodelt ist, für keine andere Sache nehmen als es ist. Dann bleibt uns die Hoffnung, in einem anderen Leben besser als hier zu sehen. Ich drücke Dir und Koning die Hand.
Arles, 29. Mai 1888
Lieber Theo! ......
Mein lieber Bruder, der Glaube des Mohammedaners, daß der Tod nur kommt, wenn er kommen muß, dafür haben wir so wenig einen Beweis wie für eine unmittelbare Leitung von oben, so weit wir auch darüber nachdenken. Im Gegenteil, mir scheint es erwiesen, daß eine gute Hygiene nicht nur das Leben verlängern kann, sondern auch einen heiterer macht, hellblütiger. Eine schlechte Hygiene hingegen stört uns nicht nur das Leben, sondern mangelnde Hygiene kann uns ein Lebensende vor der Zeit setzen.
Sah ich nicht vorher mit meinen eigenen Augen einen tüchtigen Menschen sterben, einfach, weil er keinen vernünftigen Arzt hatte? Er war so ruhig und gelassen in all dem. Er sagte nur immer: »Wenn ich nur einen anderen Arzt gehabt hätte.« Er starb und zuckte die Schultern mit einem Gesichte, das ich nie vergessen werde.
Willst Du, daß ich mit Dir nach Amerika gehe? Es wäre nur billig, daß diese Herren mir die Reise bezahlen.
Mir wäre schon vieles gleichgültig, aber niemals, daß Du zunächst einmal wirklich gesund wirst. Ich glaube, Du mußt vor allem in der Natur neue Tatkraft finden und im Verkehr mit Künstlern.
Ich zöge es vor, Dich unabhängig von den Goupils zu sehen, daß Du auf eigene Rechnung mit den Impressionisten arbeitest an Stelle dieses Reiselebens mit den teuren Gemälden, die diesen Herren gehören. Als unser Onkel noch ihr Teilhaber war, ließ er sich in gewissen Jahren recht gut bezahlen, denn er wußte recht gut, was ihn das gekostet hat.
Und Du, die Lungen sind gut, aber – aber – aber.
Ein Jahr bei Gruby, dann wirst Du die Gefahr sehen, der Du jetzt entgegengehst.
Jetzt steckst Du schon mehr als zehn Jahre in diesem Paris, und das mehr als gut ist. Du wirst mir sagen, daß Detaille z. B. vielleicht schon seine dreißig Jahre in Paris ist und daß er sich wie ein i gerade hält.
Gut, mache es ebenso, wenn Du die gleichen Kräfte hast, ich widerspreche nicht, und in unserer Familie hat man ein zähes Leben.
Ich resümiere alles, was ich Dir sagen wollte. Wenn diese Herren Dich die Kastanien für sie aus dem Feuer holen lassen, dann laß Dich ganz entsprechend teuer bezahlen oder weigere Dich und stecke Dich in die Impressionisten. Du machst dann vielleicht weniger Geschäfte, aber Du kannst in der Natur leben.
Was mich angeht, ich werde sicher gesund, und der Magen ist seit dem vergangenen Monat viel, viel besser. Ich leide noch manchen Tag an unwillkürlichen Aufregungen und an Müdigkeit, aber das gibt sich.
Ich rechne darauf, einen Ausflug nach Stes. Maries zu machen, um endlich das Meer zu sehen.
Zweifellos wird die Schwester recht froh sein, nach Paris zu kommen, und es wird ihr nicht schaden, das ist sicher. Ich möchte, daß alle gleichfalls in den Süden kämen.
Ich werfe mir immer vor, daß meine Malerei nicht wert ist, was sie kostet. Trotzdem muß man arbeiten, aber wisse, wenn die Umstände es wünschenswert machten, wäre ich auch geschäftlich tätig, vorausgesetzt, daß es Dich entlastet. Ich täte es dann ohne Bedauern.
Mourrier wird Dir noch zwei Federzeichnungen geben. Weißt Du, man müßte mit diesen Zeichnungen Hefte zu sechs machen wie die japanischen Zeichenbücher.
Ich habe große Lust, so etwas für Gauguin zu machen und auch eins für Bernard. Ich habe heute hier Farbe und Leinwand gekauft, weil, wie das Wetter jetzt werden wird, es darangehen heißt. Ein Grund mehr, daß meine Bitte um Farbe nichts Eiliges hat, außer den zehn großen Tuben Weiß.
Das ist drollig, wie es jetzt an den Abenden auf dem Mont Majour aussieht. Ich sah da einen roten Sonnenuntergang, der schickte die Strahlen in die Stämme und das Blätterwerk der Fichten, die in dem Steingeröll wachsen. Er färbte mit einem orange Feuer die Stämme und das Blätterwerk, während die anderen Fichten im Hintergrund sich preußischblau abzeichneten auf einem zarten blaugrünen Himmel, ganz himmelblau. Das waren die Effekte von Claude Monet. Das war bezaubernd. Der weiße Sand und die geschichteten weißen Felsen unter den Bäumen mit blauen Schattierungen. Das ist es, was ich machen möchte. Dieser Ausblick, von dem Du die ersten Zeichnungen besitzt. Das ist so breit, und es verschwimmt auch nicht in Grau. Das bleibt grün bis auf den letzten Strich, dort blau. Und dann die Gruppierung der Hügel.
Heute gab's Sturm und Regen, das wird auch sein Gutes haben. Wenn Koning eine gemalte Studie vorzieht, dann mache es, wie es sich trifft. Überlege es Dir gut, ehe Du annimmst, worum die Goupils Dich bitten. Und wenn das eine Änderung für mich bedeutete, ich könnte jetzt, wo ich wieder gesund werde, wirklich an jedem Platz arbeiten. Ich bin jetzt mit meiner Arbeit auf nichts Bestimmtes aus.
Ich drücke Dir und Koning die Hand.
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Anfang Juni 1888)
Mein lieber Theo! Wenn die Rolle nicht zu groß ist und man sie an der Post annimmt, dann bekommst Du noch eine große Federzeichnung. Ich möchte, daß die Pissarros sie sehen, wenn sie Sonntag kommen.
Eben empfange ich einen Teil der bestellten Farben. Ich danke Dir vielmals.
Morgen reise ich in aller Frühe nach Stes. Maries ans Ufer des Mittelländischen Meeres. Ich werde da bis Sonntagabend bleiben.
Ich nehme zwei Leinwände mit, aber ich fürchte, es ist vielleicht zum Malen zu windig.
Man fährt mit der Postkutsche, das sind 50 Kilometer Wegs von hier. Man kommt durch die Camargue. Das ist Heideland, Büffelherden, Trupps kleiner weißer Pferde, die halbwild sind und sehr schön.
Ich nehme alles mit, besonders um zu zeichnen, denn es ist nötig, daß ich viel zeichne, gerade aus demselben Grund, den Du in Deinem letzten Briefe anführst. Die Sachen, die ich hier mache, haben so viel Stil. Aber ich will zu einer unwillkürlicheren, zu einer freieren und übertriebeneren Zeichnung kommen.
Ich bin wegen Deiner Reisepläne etwas unruhig und vielmehr wegen der Vorschläge, die man Dir macht. Das hetzt ab, dieses Reisen, und vor allem schüttelt es einem das Hirn mehr, als für Dich gut sein kann. Jedenfalls glaube ich daran Schuld zu haben, und sage mir immer, es sind meine Geldnöte, die Dich dazu bringen. Nein, das ist nicht gut.
Dann sage ich mir wieder, wir können dennoch vielleicht zu hoffen beginnen, daß ich einmal, vielleicht auch bald, ein oder zwei Gemälde im Monat verkaufe – denn das muß besser werden. Zieh die Verhandlungen in die Länge und sprich mit Gruby, denn ich möchte glauben, er zieht es vor, wenn Du Dich ein Jahr lang ruhig hältst. Wenn Gruby Dir sagt, eine Veränderung sei gut – aber nein, das kann nicht der Fall sein ......
Ich habe an Gauguin geschrieben, aber ihm nur gesagt, wie ich es bedauerte, daß wir, der eine vom andern, so fern arbeiteten und wie es schade sei, daß sich nicht mehrere Maler in einer Gegend zusammenfänden.
Man muß damit rechnen, daß es Jahre dauern kann, bis die Impressionistenbilder einen bestimmten Marktwert haben, und um ihm zu helfen, muß man kühl sehen, was für eine langatmige Geschichte das sein wird. Aber er hat eine so schöne Begabung, daß seine Gesellschaft für uns einen Schritt vorwärts bedeutete.
Ich habe Dir ganz ernsthaft geschrieben. Wenn Du willst, gehe ich mit Dir nach Amerika, wenn die Reise von langer Dauer ist und wenn sich das lohnt.
Wir dürfen nicht krank werden, denn wenn wir es werden, sind wir noch einsamer als der arme Portier, der jetzt gestorben ist. Diese Leute haben ihren Verkehr und sehen, wie das im Haus kommt und geht, und sie leben im Stumpfsinn. Aber wir sind so allein mit unseren Gedanken, und manchmal wünschen wir, auch stumpfsinnig zu sein.
Schon allein weil wir Körper haben, müssen wir in Kameradschaft leben. Hier zum Abschied von Koning ein paar Zeilen für ihn. Ich muß etwas unternehmen, um irgendeinen, Thomas z. B., mit Dir zusammenzubringen, damit er die Leute, die von dort weggingen, hier arbeiten lasse. Dann käme auch Gauguin ganz sicher. Ich glaube das.
Ich drücke Dir die Hand und schönen Dank für die Farben.
G. d. D. Vincent
Es ist sehr gewagt, Gauguin zu holen, aber man muß darauf hinarbeiten, und ich hoffe, Du findest Hilfe bei Tersteeg, Thomas oder bei irgend einem.

27. Iris-Stilleben. St. Remy Mai 1890.

Arles, ohne Datum (wohl Mitte Juni 1888)
Lieber Theo! Ich schreibe Dir noch ein Wort, weil ich noch keinen Brief von Dir bekam, wahrscheinlich, weil Du Dir sagtest, ich wäre wohl in Stes. Maries. Da die Hausmiete, das Anstreichen von Türen und Fenstern und die Anschaffung von Leinwand mich alles auf einmal klamm machten, würdest Du mir einen großen Dienst erweisen, wenn Du mir ein paar Tage früher Geld schicktest. Ich arbeite an einer Landschaft mit Weizenfeldern, die ich nicht für schlechter als den weißen Garten z. B. halte. Er ist in der Art der zwei Landschaften: Butte Montmartre, die bei den Indépendants waren. Aber ich glaube, das ist doch solidere Malerei und hat etwas mehr Stil.
Ich habe dann noch ein anderes Motiv, einen Bauernhof mit Mühlen, der wahrscheinlich das Gegenstück abgeben wird. Ich bin neugierig, was Gauguin macht. Ich hoffe, daß er kommen kann.
Du wirst mir sagen, es sei unnütz;, an die Zukunft zu denken, aber die Malerei kommt langsam vorwärts, und man muß vorher rechnen.
Gauguin wäre noch eher als ich gerettet, wenn er ein paar Bilder verkaufte; um arbeiten zu können, braucht man ein möglichst geregeltes Leben, eine etwas sichere Grundlage. Man muß etwas Garantie für sein Dasein haben. Wenn wir, er und ich, lange Zeit hier bleiben, würden wir zunehmend persönlichere Bilder malen, gerade weil wir bei der Arbeit den Dingen in diesem Lande immer mehr auf den Grund kämen. Ich glaube, es ist ziemlich schwer, die Gegend zu wechseln, wo ich mit dem Süden begonnen habe. Es ist besser, sich nicht von der Stelle zu rühren. Man muß immer mehr in die Seele des Landes eindringen.
Ich glaube, daß es mir jetzt eher möglich ist, meine Sachen und selbst größer Geplantes vorwärts zu bringen, als daß ich mich immer auf allzu Kleines beschränke.
Darum nehme ich immer größere Leinwände und nehme keck die Leinwand zu 30. Jede davon kostet mich hier 4 Francs. Das ist nicht teuer, wenn man an die Transportkosten denkt. Das letzte Bild schlägt alles übrige tot. Daneben bleibt nur noch ein Stilleben in Blau und Gelb bestehen, mit Kaffeekannen, Tassen und Tellern. Das hält sich noch daneben. Das kommt eben von der festen Zeichnung. Unwillkürlich erinnere ich mich dabei an Cézanne, an die Ernte, die wir bei Portier sahen, wo er die rauhe und derbe Provence gemalt hat.
Das ist jetzt eine ganz andere Sache als im Frühling. Aber sicher, ich liebe die Natur, die fast brennt, nicht weniger.
Da ist jetzt alles Gold darinnen, Bronze, Kupfer, würde man sagen, und mit dem grünen Azur des Himmels, all das bis zur Weißglut erhitzt, gibt eine wundervolle, außerordentlich harmonische Farbe mit gebrochenen Tönen à la Delacroix.
Wenn Gauguin kommen sollte, glaube ich, hätten wir einen tüchtigen Schritt vorwärts getan. Das stellte uns deutlich als Entdecker des Südens hin, und man könnte dem mit keinem Wort widersprechen.
Ich muß zu dieser Sicherheit der Farbengebung kommen, die ich in dem Bild, das die anderen schlägt, herausgebracht habe.
Ich denke jetzt daran, wie die Cézannes, die Portier hatte, allein gesehen, gar nicht so aussahen, aber wenn man sie neben andere Bilder stellte, wie das die Farben der anderen schlug.
Und auch, wie diese Cézannes sich gut im goldenen Rahmen machten, was eine ganz helle Farbenskala voraussetzt. Nun, vielleicht bin ich auf der Spur und mein Auge bildet sich nach der Natur hier. Warten wir ab, um sicher zu gehen. Das letzte Bild erträgt die rote Umgebung der Backsteine, mit denen das Atelier gepflastert ist. Wenn ich es auf die Erde lege, auf den ziegelroten, ganz, ganz roten Grund, so wird die Farbe des Bildes nicht schmutzig oder käsig. Die Natur bei Aix, wo Cézanne arbeitete, ist genau die gleiche wie hier, da ist immer die Crau. Wenn ich mit meinem Bilde nach Hause komme und mir sage, jetzt bin ich gerade an die Farbe des Vater Cézanne gekommen, so will ich nur sagen, daß Cézanne genau vom gleichen Land wie Zola ist und es darum so intim kennt. (Man muß ganz intim arbeiten, genau so berechnend, um zu gleichen Tönen zu kommen. Dann wird sich die Gesamtwirkung daneben halten, aber selbstverständlich nicht die gleiche sein.)
Ich drücke Dir die Hand. Ich hoffe, daß Du in diesen Tagen schreiben kannst.
G. d. D. Vincent

28. Der barmherzige Samariter. Nach Delacroix. Winter 1889/90. Amsterdam, Rijksmuseum

Stes. Maries, ohne Datum (wohl Ende Juni 1888)
Lieber Theo! Ich schreibe Dir endlich aus Stes. Maries am Strande des Mittelländischen Meeres. Das Meer hat eine ganz wechselnde Farbe. Man weiß nie, ist das grün oder lila, man weiß nie, ist das blau, denn die Sekunde nachher hat die wechselnde Spiegelung einen rosa oder grauen Schein angenommen.
Das ist eine drollige Sache mit der Familie, und oft dachte ich unwillkürlich an unseren Onkel, den Seemann, der hat sicher manches Mal das Gewässer hier gesehen. Ich nahm drei kleine Leinwände mit und ich pinselte sie voll. Zwei Seestücke und ein Blick von der Stadt, dann Zeichnungen, die ich Dir alle durch die Post schicke, wenn ich morgen nach Arles zurückkomme.
Ich wohne und esse hier für vier Francs den Tag, zuerst forderte man sechs.
So rasch ich kann, komme ich noch einmal zurück, um hier noch einige Studien zu machen. Der Strand hier ist sandig, ohne Klippen und Felsen wie in Holland, aber es gibt weniger Dünen, alles ist blauer.
Man ißt hier bessere Bratfische als an der Seine, nur gibt es hier nicht jeden Tag Fische zu essen, denn die Fischer gehen fort und verkaufen in Marseille, aber wenn es welche gibt, dann sind sie »schrecklich gut«. Wenn es keine gibt, so ist das Fleisch eben nicht besser und appetitlicher als das Pferdefleisch des Herrn Geraud. Gibt es keinen Fisch, so ist es eben mehr oder weniger schwer, hier etwas zu essen zu finden.
Ich glaube, es gibt kaum hundert Häuser in dem Dorf oder – dieser Stadt.
Das Hauptgebäude hinter der alten Kirche, ein antikes Fort, und dann wenige Häuser, wie auf unserer Heide oder im Moor von Drenthe. Du wirst das noch genauer auf den Zeichnungen sehen.
Ich muß meine drei gemalten Studien hier lassen, denn sie sind noch nicht trocken genug, um sie fünf Stunden ungestraft im Wagenverschlag liegen zu haben.
Aber ich rechne damit, noch einmal hierher zu kommen.
Nächste Woche möchte ich nach Tarascon gehen, um zwei oder drei Studien zu machen. Wenn Du nicht geschrieben hast, werde ich natürlich Deinen Brief in Arles erwarten.
Ein sehr schöner Gendarm kam, um mich und den Geistlichen auszufragen. Die Leute hier sind wohl nicht böswillig, denn selbst der Pfarrer hatte fast das Gesicht eines anständigen Menschen.
Nächste Woche beginnt hier die Badesaison. Die Zahl der Badegäste schwankt zwischen zwanzig und fünfzig.
Ich bleibe bis übermorgen, denn ich habe noch Zeichnungen zu machen. Ich ging eine Nacht lang am verlassenen Strand spazieren, das war nicht froh, aber auch nicht traurig, das war schön.
Das tiefe Blau des Himmels war, mit Wolken gefleckt, von noch tieferem Blau als das Blau des Grundes; die einen von ganz starkem Kobalt, die anderen von einem reineren Blau als die blaue Helle der Milchstraße.
In dem blauen Grund funkelten die Sterne hell, grünlich, gelb, weiß, rosa, noch diamantenreiner als die kostbaren Steine bei uns oder selbst in Paris, das muß man sagen: Opale, Lapis, Smaragde, Rubine und Saphire.
Das Meer ging weit und tief hinaus, die Düne war veilchenblau und fuchsrot und doch bleich mit Buschwerk, auf der Düne (fünf Meter hoch) das Buschwerk ganz preußischblau.
Ich habe noch ein paar Blätterzeichnungen, eine große Zeichnung vom letzten Tag. Auf bald, so hoffe ich, einen Händedruck für Dich.
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Ende Juni 1888)
Lieber Theo! Ich lese eben den Aufsatz von Geffroy über Claude Monet. Er sagt wirklich gute Dinge, ich möchte diese Ausstellung sehen! Wenn ich mich tröste, sie nicht zu sehen, so ist es, weil ich um mich eine Menge guter Dinge in der Natur sehe, die mir nicht die Zeit lassen, an etwas anderes zu denken, denn es ist gerade Erntezeit.
Ich hatte von Bernard einen Brief, in dem er mir sagt, er fühle sich sehr einsam, aber er arbeite trotzdem und habe dazu noch ein neues Gedicht über sich selbst gemacht, in dem er sich in der rührendsten Weise verspottet. Und er fragt, wozu soll man denn arbeiten? Nur fragt er dies beim Arbeiten. Er sagt sich, daß die Arbeit zu gar nichts diene – aber beim Arbeiten –, das ist nicht die gleiche Sache, als wenn man es beim Nichtstun sagt. Ich sähe gerne, was er macht.
Ich bin neugierig, zu erfahren, was Gauguin sagt, wenn Bernard zu ihm nach Pont Aven kommt. Ich habe ihnen einen Teil Adressen gegeben und noch anderes dazu, weil ihnen das vielleicht nützen kann.
Ich habe eine schwere Woche heftiger Arbeit hinter mir. Ich stand da im Weizen in der vollen Sonne. Ich brachte Felderstudien heraus, Landschaften und eine Säerstudie. Auf einem gepflügten Felde violette Erdschollen und gegen den Horizont ein Säer in Blau und Weiß. Am Horizont ein reifes kleines Weizenfeld, über all dem ein gelber Himmel und eine gelbe Sonne. Du merkst bei dieser einfachen Farbenzeichnung, daß die Farbe in dieser Komposition eine sehr wichtige Rolle spielt. Dann noch eine Studie; eine Leinwand zu 25, die geht mir nicht aus dem Kopf und quält mich, so daß ich mich fragte, ob man sie nicht ernst nehmen müßte und ein furchtbares Gemälde daraus machen, mein Gott, wie hätte ich dazu Lust, aber immer frage ich mich, ob ich die Kraft zur nötigen Vollendung habe.
Dann stelle ich die Studie zur Seite und wage kaum noch daran zu denken.
Das ist schon so lange mein Wunsch, einen Säer zu machen, aber die Wünsche, die ich schon lange habe, erfüllen sich nicht immer. Ich habe beinahe Furcht davor. Und doch, nach Millet und L'Hermitte bleibt nur der Säer mit der Farbe und dem großen Format.
Wollen von einer anderen Sache reden.
Ich habe jetzt ein Modell, einen Zuaven, einen kleinen Kerl mit einem Stiernacken und Tigeraugen. Ich begann das Porträt und dann habe ich wieder mit einem anderen angefangen. Das Brustbild, das ich gemalt habe, war schrecklich. In einer Uniform von Emailleblau, die Litzen in Orangerot mit zwei zitronengelben Sternen auf der Brust, ein ganz gemeines Blau, aber sehr schwer zu machen.
Einen ganz bronzenen Katzenkopf mit einer roten Mütze. Ich habe ihn gegen eine grün gestrichene Tür gesetzt und gegen die orangenen Backsteine einer Mauer, das ist schon eine brutale Verbindung von entgegengesetzten Tönen, recht unbequem durchzuführen. Die Studie, die ich fabriziert habe, scheint mir sehr schwierig, und doch möchte ich immer an solchen Volksbildern malen, selbst wenn sie grell herausschreien wie dies; daran lerne ich, und das ist es, was ich vor allem von meiner Arbeit verlange.
Im zweiten Porträt hockt er mir gegen eine weiße Mauer.
Hast Du das gesehen, Zeichnungen von Raffaelli »Die Straße«, vom Figaro letzthin herausgegeben, das Hauptstück wohl die Place Clichy mit ihrem ganzen Treiben; das ist lebendig. Der Figaro muß auch eine Nummer mit Zeichnungen von Caran d'Ache herausgeben. Ich vergaß Dir in meinem letzten Brief zu sagen, daß ich, und das sind nun schon zwei Wochen her, die Farbensendung von Tasset bekam.
Ich brauche dringend eine neue Sendung, denn für diese Felder– und Zuavenstudien habe ich nicht übel Tuben geschluckt.
Immerhin nur ein Drittel oder die Hälfte sind eilig.
Unter den Felderstudien ist eine mit Heuschobern, von der habe ich Dir den ersten Entwurf auf einer Leinwand zu 30 geschickt. Wir hatten die beiden letzten Tage strömenden Regen, und das dauert immer den ganzen Tag; das wird das Aussehen der Felder verändern. Er kam ganz unerwartet und plötzlich, während alles bei der Ernte war. Ich hoffe, nächsten Freitag einen Ausflug in die Camarguemit einem Tierarzt zu machen, da gibt es Stiere und weiße, beinahe wilde Pferde und auch rosa Flamingos.
Ich wäre nicht erstaunt, wenn das sehr schön wäre.
Mit der Leinwand ist es durchaus nicht eilig.
Ich bin so neugierig, was Gauguin macht, aber ich weiß nicht, ob es für ihn gut ist, ihn zum Kommen zu verpflichten und vielleicht, wenn man seine große Familie bedenkt, ist er wirklich verpflichtet, Großes zu wagen, um wieder das Familienoberhaupt markieren zu können. Jedenfalls möchte ich nie eine Persönlichkeit durch diese Verbindung hemmen, und wenn er Lust spürt, den fraglichen Streich zu versuchen, so kann er Gründe haben und ich möchte ihn nicht davon abbringen; vielleicht hängt er daran und dann muß man zusehen. Das wird man ja aus seiner Antwort merken.
Ich hoffe also auf bald, ich drücke Dir die Hand, danke für die Zeitung und recht viel Erfolg zu Deiner Ausstellung.
G. d. D. Vincent
Was macht Vater Tanguy, hast Du ihn letzthin gesehen? Es tut mir immer wohl, nach ihm zu fragen.
Ich kaufe bei ihm immer gerne Farbe, selbst wenn sie bei ihm ein wenig schlechter ist, vorausgesetzt, daß sie nicht teurer ist.
Arles, ohne Datum (wohl Anfang Juli 1888)
Lieber Theo! ......
Ich habe gestern und heute am Säer gezeichnet, der vollkommen umgearbeitet ist.
Der Himmel ist grün und gelb, der Boden violett und orange, sicher läßt sich aus dem wundervollen Motiv ein Gemälde machen, und ich hoffe sicher, eines Tages wird man es machen können, vielleicht ein anderer, vielleicht ich.
Die Hauptsache bleibt diese: die Christus–Barke von Eugène Delacroix und der Säer von Millet haben eine andere Handschrift.
Die Christus–Barke, ich spreche von der blau–grünen Skizze mit den roten Wolken und dem Zitronengelb für den Nimbus und die Aureole, spricht eine symbolische Sprache gerade durch die Farbe.
Der Säer von Millet ist grau, wie die Gemälde von Israëls. Kann man jetzt den Säer farbig malen, mit dem gleichzeitigen Kontrast von Gelb und Violett z. B. wie die Apollodecke von Delacroix, die ist gerade violett, ja oder nein? Sicher ja, aber macht es doch endlich. Aber das ist nun wieder wie der Vater Martin sagte: man muß das Meisterwerk machen.
Aber los! Und dann fällt man in eine volle Farbenmetaphysik à la Monticelli, woraus mit Ehren zu kommen dann verdammt schwer ist. Und das macht Euch tiefsinnig wie einen Mondsüchtigen. Wenn man doch nur etwas Ganzes zuwege brächte!
Immerhin bleiben wir mutig und verzweifeln wir nicht.
Ich hoffe, Dir diesen Versuch bald mit anderen zu schicken. Ich habe da einen Blick auf die Rhône bei Trinquetaille, wo Himmel und Fluß wie Absinth gefärbt sind; die Quais sind violett getönt, die Menschen lehnen sich auf die schwarze Brüstung; die Eisenbrücke ist intensiv blau, im blauen Hintergrund steckt eine lebhafte orange Note und starkes Veronesergrün. Das ist auch so ein ganz unfertiger Versuch, aber ich suchte darin etwas noch Schmerzlicheres und Schmerzenderes.
Nichts Neues von Gauguin, ich hoffe morgen den Brief zu bekommen; ich drücke Dir die Hand.
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Anfang Juli 1888)
Lieber Theo! Ich komme vom Mont Majour zurück, wo ich einen Tag war und der Unterleutnant mir Gesellschaft leistete. Wir stöberten den alten Garten durch und mausten herrliche Feigen. Wenn das größer wäre, könnte man an den Paradou von Zola denken. Große Rosengärten, Reben, Efeu, Feigen, Oliven, Granatbäume mit den großen Blumen vom lebendigsten Orange, Hunderten von Zitronen, Eschen und Weiden, Steineichen, halbverfallene Stufen, spitzbogige Fenster in den Ruinen, weiße Felsblöcke, die vom Geröll zusammengefallener Mauern bedeckt sind, da und dort mit Grün überzogen. Ich brachte eine große Zeichnung mit nach Hause, allerdings nicht vom Garten.
Das macht nun drei Zeichnungen. Wenn ich ein halbes Dutzend habe, werde ich sie Dir schicken.
Gestern war ich in Font-Vieilles, um Bock und Mc. Knight zu besuchen. Allerdings haben die Herren für acht Tage eine kleine Reise in die Schweiz unternommen. Ich glaube, daß die Hitze mir trotz der Moskitos und der Mücken gut tut. Die Zikaden sind ganz anders wie bei uns, so ungefähr:
Diese Zikaden, ich glaube ihr Name ist Cicada, vollführen einen ebenso starken Lärm wie die Frösche. Man sieht sie in japanischen Bilderbüchern. Dann die Schwärme goldgrüner Fliegen in den Oliven. Ich habe noch daran gedacht, ob Du daran denkst, daß ich das Porträt von Vater Tanguy, das er noch hat, gemacht habe, das der Mutter Tanguy (das sie verkauft haben), das ihres Freundes (es ist wahr, für dieses hat man mir 20 Frs. gezahlt), daß ich ohne Rabatt für 250 Frs. bei Tanguy Farben gekauft habe, bei denen er natürlich profitiert hat, endlich, daß ich doch ebenso sein Freund war wie er der meine. Und da habe ich dann alle Gründe, an seinem Recht zu zweifeln, bei mir Geld zu reklamieren, das doch wirklich durch die Studie, die er noch hat, beglichen ist, zumal ein Verkauf dieses Bildes seine Ansprüche leicht bezahlt machte.
Der Mutter Tanguy, der Xantippe und anderen Damen, gab die Natur in einer seltsamen Laune ein Gehirn aus Feuer– und Kieselsteinen. Sicher sind diese Damen in der zivilisierten Gesellschaft, in der sie sich herumtreiben, noch schädlicher als die Bürger im Institut Pasteur, die von tollwütigen Hunden gebissen wurden. Darum hätte Vater Tanguy tausendfache Gründe, seine Dame zu töten ... er tut das gerade so wenig wie Sokrates ...Und aus diesem Grunde hat Vater Tanguy noch eher Beziehungen, was die Ergebung und die Langmut betrifft, zu den frühen Christen, den Märtyrern und Sklaven, als zu den heutigen Pariser Zuhältern.
Desungehindert gibt es keinen Grund, ihm 80 Frs. zu bezahlen. Aber man hat gute Gründe, sich niemals mit ihm zu verzanken, selbst wenn er sich herumstritte. Dann setzt man ihn einfach vor die Türe und schickt ihn strikte spazieren ...
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Mitte Juli 1888)
Lieber Theo! ......
Dein Brief brachte mir jetzt eine große Nachricht. Gauguin nimmt also den Vorschlag an. Sicher wäre es besser, er trollte sich gleich hierher, um wieder sauber zu werden. Wenn er erst nach Paris geht, gerät er vielleicht erst recht in den Dreck.
Vielleicht macht er mit den Bildern, die er mitbringt, irgendein Geschäft. Das wäre sehr schön. Ich lege eine Antwort für ihn bei. Jetzt kann ich Dir sagen, daß es mich nicht allein begeistert, unten im Süden zu malen, sondern gleichfalls im Norden; denn ich fühle mich gesundheitlich seit sechs Monaten besser. So ist es, was die Ausgaben anlangt, sicherer in die Bretagne zu gehen, wo man für ganz wenig Geld Pensionen findet; ich bin wirklich bereit, in den Norden zurückzukommen, aber ihm muß es bestimmt gut tun, den Süden zu sehen, zumal man schon in vier Monaten im Norden Winter hat. Das scheint mir gewiß, zwei Menschen, die absolut die gleiche Arbeit haben, müssen, wenn die Umstände keine größeren Ausgaben erlauben, zu Hause mit Brot, Wein und ein paar Kleinigkeiten auskommen. Die Schwierigkeit ist, allein bei sich zu essen, und die Restaurants sind so teuer, weil jeder bei sich zu Hause ißt. Sicher ist, die Ricards, nicht die Leonardo da Vincis, sind nicht weniger schön, weil es davon so wenige gibt, andererseits sind die Monticellis, die Daumiers, die Corots, die Daubignys und die Millets nicht häßlich, weil sie meistens ganz schnell gearbeitet sind und es von ihnen verhältnismäßig viel gibt.
Was die Landschaften angeht, finde ich allmählich, daß gewisse Arbeiten, die ich so rasch wie noch nie gemacht habe, meine besten Bilder sind.
Ich schickte Dir doch die Zeichnung, die Ernte und die Mühlen. Es ist wahr, ich muß das Ganze noch einmal übergehen, um die Handschrift ein wenig auszugleichen, um den Farbenauftrag etwas zu harmonisieren. Aber die wesentliche Arbeit ist in einer einzigen langen Sitzung gemacht, und ich will so wenig wie möglich daran herumarbeiten.
Aber wenn ich von einer solchen Sitzung nach Haus komme, ich versichere Dir, da ist das Hirn so müde, und wenn es oft geschieht, wie in der Zeit der Ernte, dann werde ich ganz geistesabwesend und unfähig zu einer Menge gewöhnlicher Dinge.
In solchen Augenblicken ist mir die Aussicht, nicht allein zu sein, recht tröstlich.
Weiß Gott, recht oft denke ich an diesen guten Maler Monticelli, den man einen Trinker und Irren schalt, wenn ich mich selbst von dieser Hirnarbeit heimkommen sehe, wo es gilt, das Gleichgewicht der sechs wesentlichen Farben zu finden, rot, blau, gelb, orange, lila, grün.
Ein trockenes Arbeiten und Rechnen, da ist der Geist bis zum Zerreißen gespannt wie bei einem Schauspieler, der eine schwere Rolle spielt. Man muß in einer einzigen halben Stunde an tausend Dinge denken.
Danach ist dann die einzige Sache, die erleichtert und zerstreut, wenigstens in meinem Falle wie auch bei anderen, sich mit einem herzhaften Schluck zu betäuben und mächtig zu rauchen. Das ist zweifellos nicht sehr tugendhaft, aber um auf Monticelli zurückzukommen, ich möchte wohl einmal einen Trinker vor einer Leinwand oder auf den Brettern sehen. Natürlich ist das eine ganz grobe Lüge, diese ganz nichtswürdige Geschichte, ein jesuitisches Stück von de la Roquette über Monticelli. Der Kolorist Monticelli, ein Logiker, fähig die verzwicktesten Rechnungen über die Aufteilung der Farbenskala zu verfolgen und auszugleichen, hat gewiß bei dieser Arbeit sein Gehirn überanstrengt, wie auch Delacroix und Richard Wagner.
Aber wenn er, Jongkind überdies auch, vielleicht getrunken hat, so kommt es, weil er physisch stärker und erregter als Delacroix war (Delacroix war reicher), und ich glaube, daß, wenn sie nicht so gehandelt hätten, ihre revoltierenden Nerven ihnen noch andere Tänze in dem feurigen Ofen der Eingebung aufgeführt hätten. So sagen Jules und Edmond Goncourt ganz wörtlich: »Wir nahmen den stärkeren Tabak, um uns abzustumpfen.« Glaube nur nicht, daß ich mir künstlich ein Fieber unterhalte. Wisse, ich bin mitten im kompliziertesten Rechnen drinnen. Daraus geht eine Leinwand nach der anderen ganz rasch gearbeitet heraus. Aber all dieses ist schon lange vorher berechnet. Und dann, wenn man sagen wird, das ist zu rasch gemacht, so kannst Du antworten, die Leute sehen so rasch. Ich bin jetzt daran, alle Bilder ein wenig zu übergehen, ehe ich sie Dir schicke, aber während der Erntezeit war meine Arbeit nicht bequemer als die der Landleute; aber ich bin weit davon entfernt, mich zu beklagen. Das gerade ist das Kennzeichen des Künstlerlebens, daß, selbst wenn man nicht auf dem richtigen Weg ist, man sich doch beinahe so glücklich fühlt, als ob man auf dem richtigen Wege zum Ideal wäre ...
Arles, ohne Datum (wohl Mitte Juli 1888)
Mein lieber Theo! Ich schicke Dir gerade mit der Post eine Rolle mit fünf großen Federzeichnungen. Die sechste von einer Serie vom Mont Majour hast Du bereits. Eine ganz dunkle Kieferngruppe und im Hintergrund die Stadt Arles. Ich hoffe, später noch eine Gesamtansicht der Ruine beizufügen (unter den kleinen Zeichnungen hast Du bereits einen Entwurf davon).
Da ich jetzt, wo wir die Verbindung mit Gauguin erwägen, mit Geld nicht nützlich sein kann, habe ich all dieses gemacht, um durch meine Arbeit zu beweisen, wie sehr ich mir die Sache zu Herzen nehme.
Meiner Meinung nach gehören die beiden Ansichten der Crau und der Rhônelandschaft zu meinen besten Federzeichnungen. Thomas will die von der Rhône, aber dafür soll er mindestens 100 Frs. für das Stück zahlen. Allerdings habe ich Dussé die drei anderen geschenkt. Aber in diesem Falle brauchen wir dringend Geld und wir können sie ihm unter keinen Umständen geben, denn das kostet einmal so viel, und nicht jeder Mensch hätte die Geduld, sich von den Moskitos so zerstechen zu lassen und fortwährend gegen diesen widerwärtigen Mistral anzukämpfen, ganz abgesehen von den Tagen, wo ich nur etwas Brot und Milch nehmen konnte, weil es zu weit war, immer in die Stadt zurückzugehen.
Ich habe Dir schon mehrmals gesagt, wie sehr mich die Camargue und die Crau, abgesehen von dem Unterschied der Farbe und der Durchsichtigkeit der Atmosphäre, immer an das alte Holland des Ruisdael erinnern.
Ich glaube, die beiden Ansichten vom Flachland, voller Rebenfelder und Stoppeln, von oben gezeichnet, geben Dir einen Begriff davon.
Ich versichere Dir, ich bin ganz erschöpft von diesen Zeichnungen. Ich fing auch mit einer Malerei an, aber es gibt keine Mittel, bei diesem Mistral zu malen. Es ist ganz unmöglich. Was die Leinwand anbetrifft, ich verglich die neue Leinwand zu 4.50 Frs. von Tasset mit dem Preis der gleichen Leinwandsorte von Bourgeois. Da steht hinten in seinem Katalog, den ich gefunden habe, 20 Quadratmeter gewöhnlicher Leinwand zu 40 Frs., also noch einmal, da Tasset nicht mehr genommen hat, ist das genau der gleiche Preis. Bei Tasset kostet der Quadratmeter Leinwand ebenfalls 2 Frs. So können wir diese denn weiterhin nehmen. Für die Studien reicht sie vollkommen aus.
Schreibe mir bitte eine Zeile, damit ich weiß, ob die Zeichnungen in gutem Zustande angekommen sind. Man hat mich wieder auf der Post angeschrien, das Paket sei zu groß und ich fürchte, man macht vielleicht in Paris Schwierigkeiten. Trotz allem wurde es angenommen, was mich freute, denn nach dem Fest des 14. Juli wirst Du vielleicht ganz zufrieden sein, Dein Auge beim Betrachten dieser weiten Crau zu erfrischen.
Diese weiten Landstriche entzücken mich ungemein.
So war mir auch gar nicht unbehaglich zumute, trotz dieser wirklichen Widerwärtigkeiten, dem Mistral und den Moskitos. Wenn ein Blick einem solche kleine Miseren vergessen läßt, so muß schon etwas daran sein.
Du siehst aber, daß er gar nicht auf Effekt gemacht ist, beim ersten Hinschauen hat es die Handschrift einer Geographiekarte oder eines Feldzugplanes. Ich ging da mit einem Maler spazieren, der sagte, das wäre verteufelt langweilig zu malen. Allerdings, ich gehe gut fünfzigmal auf den Mont Majour, um diese Fläche zu sehen. Habe ich damit unrecht? Ich ging da einmal mit einem Menschen spazieren, der kein Maler war. Da sagte ich ihm: »Sehen Sie, das ist für mich schön und unermeßlich wie das Meer.« Und er antwortete mir, und er kennt das Meer: »Ich allerdings liebe das viel mehr als das Meer; es ist auch unendlich, und trotzdem spürt man, das ist bewohnt.«
Wie würde ich da malen, wenn dieser verfluchte Wind nicht wäre. Es ist hier zum Verzweifeln, wenn man an irgendeinem Platz seine Staffelei aufstellen will.
Malen läßt sich da nicht so wie zeichnen. Die Leinwand zittert immer; beim Zeichnen hindert mich das nicht.
Hast Du Mme. Chrysanthemum gelesen? Das erinnert mich daran, daß die wirklichen, die echten Japaner gar nichts an der Wand haben. Diese Beschreibung des Klosters oder der Pagode, wo nichts herumhängt (die Zeichnungen und Merkwürdigkeiten sind in Fächern geborgen). Und darum muß man eine japanische Sache ansehen in einem ganz hellen Zimmer, ganz kahl, das auf das weite Land hinaus geöffnet ist.
Willst Du es mit den zwei Zeichnungen von der Crau und den Rhôneufern einmal versuchen? Sie sehen gar nicht japanisch aus und dabei sind sie im Wesen japanischer als alle anderen. Schau sie Dir in einem blauen Café an, wo es gar keine Bilder gibt, oder draußen. Man müßte sie vielleicht in Rohr einrahmen, ganz dünn. Ich arbeite hier in einem leeren Raum, vier weiße Mauern und rote Backsteine als Fußboden. Ich bestehe darauf, daß Du die beiden Zeichnungen so ansiehst, denn ich möchte Dir, soweit es nur möglich ist, einen wahren Begriff von der Einfachheit der Natur hier geben ......
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Anfang August 1888)
Mein lieber Theo! ......
Ich beginne heute wahrscheinlich das Interieur des Cafés, wo ich wohne, abends bei Gasbeleuchtung.
Das ist, was man hier ein Nachtcafé nennt.
Es gibt viele hier; die bleiben die ganze Nacht offen. Die Nachtbummler können hier ein Unterkommen finden, wenn sie kein Quartier bezahlen können oder zu betrunken sind, um dort Einlaß zu finden. Alle diese Dinge, Familie, Vaterland sind vielleicht in unserer Einbildung, da wir Vaterland und Familie entbehren, entzückender als in der Wirklichkeit. Ich scheine mir immer ein Wanderer zu sein, der ein Stück Weges zieht, zu irgendeiner Bestimmung. Wenn ich mir sage, das Gewissen, die Bestimmung, das gibt es gar nicht, so scheint mir das nicht unwahrscheinlich. Wenn der Zuhälter im Bordell jemand vor die Türe setzt, so hat er eine ähnliche Logik und denkt gut und hat immer recht. Ich weiß es, und schließlich am Ende meiner Laufbahn werde ich unrecht haben, meinetwegen, ich werde dann nicht nur wissen, daß die Künste, sondern auch alles übrige nur Traum war und mein Selbst überhaupt nichts.
Um so besser für uns, wenn wir solche Leichtigkeit besitzen und uns nicht der endlosen Möglichkeit des zukünftigen Lebens widersetzen. Woher kommt es, daß bei dem Todesfall unseres Onkels das Gesicht des Toten ruhig, heiter und würdig schien? Tatsache ist, als er lebte, sah er nicht so aus, weder in seiner Jugend, noch im Alter. Oft verspürte ich, wenn ich einen Toten ansah, eine Wirkung, als ob ich ihn hätte fragen wollen, und das ist für mich ein Beweis – nicht gerade der ernsteste – für ein Dasein jenseits des Grabes.
So hat ein Kind in der Wiege, wenn man es betrachtet, das Unendliche in den Augen. Im ganzen weiß ich nichts, aber gerade dieses Gefühl, nichts zu wissen, macht das wirkliche Leben, das wir jetzt leben, einer einfachen Trajektbahn vergleichlich. Man kommt rasch vorwärts, aber man unterscheidet keinen Gegenstand genau, und vor allen Dingen sieht man nicht die Lokomotive. Es ist merkwürdig, daß unser Onkel wie unser Vater an ein jenseitiges Leben glaubten. So wie den Vater hörte ich oft den Onkel darüber sprechen. Ah! Zum Beispiel waren sie darin sicherer als wir und behaupteten immer wieder das gleiche und ärgerten sich schwer, wenn man das ergründen wollte.
Von dem zukünftigen Leben der Künstler durch ihre Werke halte ich nicht viel.
Ja, die Künstler geben sich die Fackel in die Hand, wenn sie sich treffen, so Delacroix den Impressionisten usw. Aber ist das alles?
Wenn eine gute alte Familienmutter mit ziemlich beschränkten Ideen, die durch das christliche System verquält sind, unsterblich wäre, soweit sie an Unsterblichkeit glaubt, und das ebenso ernstlich wie ich, der ich fest daran glaube, warum sollte ein schwindsüchtiger und nervöser Droschkengaul es nicht ebenso sein, wie Delacroix oder Goncourt mit ihren tiefen Gedanken.
Es scheint da nur recht, daß für die Menschen, die sich ganz leer fühlen, eine unerklärliche Hoffnung hieraus erwächst.
Das genügt. Warum soll man sich ausschließlich damit beschäftigen. Aber wenn man mitten in der Zivilisation lebt, inmitten Paris und der Künste, warum sollte man da nicht dieses Ich der alten Frau bewahren, wenn die Frauen selbst, ohne ihren instinktiven Glauben »das ist so«, nicht die Kraft fänden, zu gebären und zu handeln.
Die Ärzte werden uns sagen, daß nicht nur Moses, Mohammed, Christus, Luther, Bunyan und andere Verrückte waren, sondern geradeso Frans Hals, Rembrandt, Delacroix und alle alten guten Weiber, die, wie unsere Mutter, beschränkt waren.
Ach, das ist schwierig. Man könnte dann diese Ärzte fragen: Wo sind denn die vernünftigen Menschen?
Sind das die Zuhälter in den Bordellen, die immer recht haben? Es ist wahrscheinlich. Aber was soll man wählen? Glücklicherweise gibt es keine Wahl.
Ich drücke Dir die Hand
Arles, ohne Datum (wohl Anfang August 1888)
Lieber Theo! ......
Ich will das Bild eines Freundes, eines Künstlers, machen, der große Träume träumt, der arbeitet, wie die Nachtigall singt, weil das eben seine Natur ist. Dieser Mann wird blond sein. Ich möchte in das Bild meine ganze Bewunderung malen, alle Liebe, die ich zu ihm habe.
Ich werde ihn also, wie er ist, malen, so getreu ich nur kann, um anzufangen.
Aber damit ist das Gemälde nicht fertig. Um es zu vollenden, werde ich jetzt willkürlicher Kolorist.
Ich übertreibe das Blond der Haare. Ich komme zu Orangetönen, zum Chrom, zur hellen Zitronenfarbe.
Hinter dem Kopfe male ich an Stelle der gewöhnlichen Mauer eines gemeinen Zimmers das Unendliche. Ich mache einen Grund von reichstem Blau, das kräftigste, das ich herausbringe. Und so bekommt der blonde, leuchtende Kopf auf dem Hintergrund von reichem Blau eine mystische Wirkung wie der Stern im tiefen Azur.
Bei dem Bilde des Bauern ging ich auf die gleiche Weise vor. Allerdings wollte ich in diesem Falle nicht die mystische Wirkung eines bleichen Gestirns im Unendlichen hervorbringen, sondern ich setzte den schrecklichen Mann hin in der vollen Glut der Ernte im vollen Mittagslicht.
Darum die orange Blitze wie Feuer. Darum die Töne von altem Gold, die in den Finsternissen blitzen.
Ja, mein lieber Bruder ... und die guten Leute werden in dieser Steigerung nichts anderes als Karikatur sehen.
Aber was macht das uns, wir haben die »Erde« und »Germinal« gelesen, und wenn wir einen Bauern malen, so möchten wir zeigen, daß diese Bücher uns in Fleisch und Blut übergingen. Ich weiß nicht, ob ich den Dienstmann, wie ich ihn fühle, malen kann. Dieser Mann ist revolutionär wie Vater Tanguy. Man hält ihn für einen guten Republikaner, obwohl er die Republik, die wir genießen, herzlich verabscheut, ein wenig an der republikanischen Idee selbst zweifelt und gar nicht von ihr entzückt ist.
Aber eines Tages sah ich ihn die Marseillaise singen, und da dachte ich, 89 zu sehen, aber nicht das kommende Jahr, sondern das vor 99 Jahren. Das war wie Delacroix, Daumier, wie die alten Holländer, ganz rein.
Unglücklicherweise läßt sich das nicht stellen, und trotzdem braucht man, um das Bild zu machen, ein intelligentes Modell.
Ich muß Dir sagen, diese Tage sind, was Geld anlangt, recht schwer. Mein Leben hier ist ziemlich teuer, fast so teuer wie in Paris, wo es nicht viel ist, wenn man täglich fünf oder sechs Francs ausgibt.
Habe ich Modelle, so muß ich Beträchtliches ausstehen. Trotzdem will ich so fortmachen. Aber ich versichere Dir, wenn Du mir hie und da ein wenig mehr Geld schicktest, täte es den Bildern gut, nicht mir.
Ich habe nur eine Wahl, ein guter oder ein schlechter Maler zu werden. Ich wählte das erstere. Aber die Malerei zwingt zum gleichen wie eine Geliebte, die einen ruiniert. Man kann nichts ohne Geld machen, und man hat nie genug. Darum müßte man Malerei auf Kosten der Gesellschaft machen. Der Künstler dürfte nicht dermaßen überlastet sein.
Aber da steckt es. Man muß schweigen. Denn niemand zwingt einen zu arbeiten. Die Gleichgültigkeit gegen die Malerei ist, leider Gottes, ziemlich allgemein und wird wohl immer dauern.
Glücklicherweise ist mein Magen wieder so imstande, daß ich diesen Monat drei Wochen lang von Schiffszwieback, Milch und Eiern leben konnte.
Das kommt von der guten Hitze, die mir meine Kräfte widergibt, und sicher hatte ich nicht unrecht, jetzt in den Süden zu gehen, anstatt abzuwarten, bis mein Leiden unheilbar sei. Ja, ich fühle mich jetzt ebenso wohl wie die anderen Menschen, was ich nur für Augenblicke in Nuenen war.
Unter »anderen Menschen« verstehe ich die streikenden Erdarbeiter, den Vater Tanguy, den Vater Millet und die Bauern. Wenn man sich wohl fühlt, muß man von einem Stück Brot leben können, wenn man auch den ganzen Tag arbeitet, und noch die Kräfte haben, zu rauchen und sein Glas zu trinken; denn das ist einmal nötig, und trotzdem die Gestirne und das Unendliche in der Höhe ganz klar fühlen. Dann ist das Leben trotz allem fast verzaubert. Ach, die Leute, die nicht an die Sonne hier glauben, sind fast Gottlose. Unglücklicherweise gibt es, leider Gottes, neben der Sonne noch drei Viertel anderer Zeit mit dem verteufelten Mistral.
Der Postbote ging, weiß Gott, diesen Samstag vorbei. Ich hatte nicht gezweifelt, von Dir einen Brief zu bekommen. Aber Du siehst, trotzdem behalte ich mein ruhiges Blut.
Ich drücke Dir die Hand.
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Mitte August 1888)
Mein lieber Theo! Ich brachte den Abend mit dem Unterleutnant zu. Er ist entschlossen, Freitag von hier abzureisen. Dann hält er sich eine Nacht in Clermont auf. Von Clermont schickt er Dir ein Telegramm, um den Zug, mit dem er ankommt, anzuzeigen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies Sonntag.
Die Rolle, die er Dir bringt, enthält 35 Studien. Darunter sind viele, mit denen ich verdammt unzufrieden bin. Ich schicke sie Dir trotzdem, weil Dir das eine vage Idee von den außerordentlichen Motiven hier gibt. Darunter ist z. B. eine hingeworfene Skizze, die ich von mir machte, beladen mit Farbenkasten, der Staffelei und Leinwand, auf der sonnigen Straße von Tarascon. Dann gibt es einen Blick auf die Rhône. Da sind Himmel und Wasser absinthfarben, mit einer blauen Brücke darauf und Gestalten von schwarzen Straßenjungen. Dann gibt es einen Säer, eine Waschküche und auch anderes Zeug, das recht schlecht ausfiel und unfertig ist, besonders eine große Landschaft mit Gestrüpp. Was wurde aus dem Andenken von Mauve. Ich hörte nichts mehr davon; darum glaube ich, Tersteeg sagte etwas Unangenehmes darüber, damit wir glauben, man verweigere die Annahme, oder irgendeine andere elende Sache. Ich werde in diesem Falle natürlich nicht darüber böse sein. Ich arbeite jetzt an einer Studie, wie die da, Schiffe vom Quai herunter gesehen. Die beiden Schiffe sind rosa und veilchenfarben. Das Wasser ist ganz grün. Kein Himmel. Eine Trikolore am Mastbaum.
Ein Arbeiter mit einem Handkarren fegt den Staub weg. Ich habe davon noch eine Zeichnung. Bekamst Du die drei Zeichnungen vom Garten? Am Ende nimmt man sie nicht mehr bei der Post an, weil das Format zu groß ist. Ich glaube, ich werde nicht ein sehr schönes Frauenmodell haben. Sie hatte zugesagt, aber dann meinte sie doch, wenn sie herumbummle, besser zu verdienen.
Sie war ganz außerordentlich. Sie sah wie ein Delacroix aus. Ihre Haltung war besonders und primitiv. Ich ertrage alles mit Geduld, zumal es kein anderes Mittel gibt, durchzukommen. Aber diese ewigen Schwierigkeiten mit den Modellen sind doch widerwärtig. Ich hoffe, in diesen Tagen eine Zeichnung von Kirschlorbeer zu machen. Wenn man kitschig wie Bougereau malte, dann schämten sich die Leute nicht, sich malen zu lassen; aber ich glaube, ich verlor darum die Modelle, weil man fand, es sei schlecht gearbeitet. Auf meinen Bildern war nicht genug Malerei drauf. Da fürchten denn die netten Frauenzimmer, sich zu kompromittieren und daß man sich über ihr Bild lustig mache. Das ist schon ein Grund, den Mut zu verlieren, zumal man fühlt, daß man, wären die Leute wohlwollender, schon etwas machen könnte. Ich kann mich nicht damit trösten, daß ich sage, »die Trauben sind noch sauer«. Kein Modell mehr zu haben, verschmerze ich nicht.
Man muß sich aber gedulden und neue aufsuchen.
Wenn die Schwester kommt, um einige Zeit bei Dir zu verbringen, wird sie sich zweifellos vergnügen.
Eine ziemlich traurige Aussicht, sich sagen zu müssen, die Gemälde, die du machst, werden nie irgend etwas wert sein. Wenn die Kosten herauskämen, dann könnte ich sagen: Ich befasse mich nicht mit Geldsachen. Aber unter den jetzigen Umständen sehe ich im Gegenteil weiter darauf. Trotz allem muß man fortfahren und versuchen, Besseres zu machen.
Recht oft scheint es mir richtiger, zu Gauguin zu gehen, anstatt ihm das Leben hier anzuraten. Ich fürchte, am Ende beklagt er sich, nur gestört worden zu sein. Könnten wir hier bei uns zu Hause leben und auskommen? Immerhin ist das ein neuer Versuch. Was es in der Bretagne kostet, können wir ja berechnen, während ich hier gar nichts darüber weiß. Ich finde das Leben andauernd ziemlich teuer, und man kommt mit den Leuten gar nicht vorwärts. Hier müßte man Betten und Möbel kaufen, dann noch seine Reisekosten und alles andere.
Das heißt vielleicht mehr gewagt als gut ist, zumal Bernard und er so wenig in der Bretagne ausgeben. Man muß sich rasch entschließen, und ich meinerseits ziehe nichts vor. Man muß die einfache Frage entscheiden, wo wir billiger leben können ......
Arles, 11. September 1888
Mein lieber Theo! Ich lege Dir einen Brief von Gauguin bei, der zugleich mit einem Brief von Bernard kam. Da ist der Schrei der Verzweiflung: »Meine Schulden wachsen von Tag zu Tag.« Ich versteife mich auf nichts Bestimmtes, Du bietest ihm die Gastfreundschaft hier an und nimmst das einzige Mittel, womit er bezahlen kann, an, seine Gemälde. Wenn er noch etwas darüber hinaus erbäte, Du bezahlst ihm die Reise, so ginge er zu weit. Zum wenigsten müßte er Dir dann freiwillig die Bilder anbieten und sich an Dich und auch an mich in wärmeren Worten wenden als: »Da sich meine Schulden mehr und mehr vermehren, wird meine Reise immer unwahrscheinlicher.«
Er packte die Sache besser an, wenn er sagte: »Ich lasse lieber meine Bilder in Ihren Händen, denn Sie meinen es gut mit mir, und lieber mache ich Schulden bei Ihnen, da Sie mich lieben, als daß ich mit meinem Wirt zusammenlebe.«
Aber er hat einen schlechten Magen, und wenn man Magenübel hat, hat man auch keinen freien Willen.
Mit meinem Magen geht es jetzt recht gut. Darum fühle ich den Kopf freier, und ich möchte hoffen, etwas klarer. Ich halte es für durchaus unrichtig, daß Du, wo Du schon das Geld, das Du für die Möbel schicktest, Dir liehest, noch mit dieser Reise belastet werden sollst, besonders, wenn diese Reise außerdem mit Bezahlung von Schulden verbunden ist. Es gehört sich zum mindesten, daß, wenn wir mit Gauguin gemeinsame Börse machen, er Dir voll und ganz seine Werke zur Verfügung stellt, ohne zu rechnen, und daß man durchaus gemeinsame Sache macht. Wenn man den Geldbeutel und alle Dinge gemeinsam hat, so profitieren alle nach einigen Jahren von der gemeinsamen Arbeit. Denn wenn sich die Gesellschaft unter solchen Bedingungen machen läßt, dann wirst Du Dich, ich sage, nicht glücklicher, aber mehr Künstler und schöpferischer fühlen, als mit mir allein.
Er und ich, wir werden ganz klar fühlen, daß wir durchdringen müssen, weil unserer drei Ehre auf dem Spiel steht, und man nicht für sich allein arbeitet. So scheint mir die Sache zu gehen.
Ich sage mir, selbst wenn man sich in schlimme Dinge verwickeln sollte, müßte man trotzdem so handeln können.
Ich gebe immer weniger und weniger auf diese möglichen Reinfälle, zumal, wenn ich an die Heiterkeit denke, die wir auf den Gesichtern der Frans Hals und der Rembrandts sehen, z. B. auf dem Porträt des alten Six oder auf dem Selbstporträt oder bei den Hals in Haarlem, die wir so gut kennen, den alten Männern und den alten Weibern. Man muß heiterer sein, nicht so furchtsam.
Warum aus der Geschichte mit Gauguin so groß Geschrei machen?
Wenn er zu uns kommt, tut er gut daran, und wir wünschen doch eigentlich, daß er käme. Daran geht weder er noch wir zugrunde.
Schließlich ist sein letzter Brief ganz ruhig, obwohl er seine Ansichten uns nicht weiter erklärt.
Immerhin, will man ihm etwas Gutes erweisen, so muß er Zutrauen haben und treu sein.
Ich bin recht neugierig, was er an Dich schreiben wird. Ich antworte ihm, wie es mir um den Sinn ist, aber ich will einem so großen Künstler nicht traurige, trübsinnige oder boshafte Sachen sagen.
Aber diese Sache wird, was das Geld anbelangt, immer schwieriger.
Immerhin ist es vollständig genug; man muß sich einrichten können, bis man zu Atem kommt.
Gauguin ist verheiratet, und man muß darum wissen, daß die verschiedenen Interessen auf lange wohl nicht zusammengehen.
Darum müßte man, um sich nicht zu schikanieren, wenn wir uns zusammentun, ganz bestimmte Bedingungen festlegen.
Wenn alles für Gauguin gut geht, dann wirst Du sehen, er wird sich mit seiner Frau und seinen Kindern wieder vereinen.
Sicher wünschte ich das für ihn. Aber man muß zum Wert seiner Bilder mehr Vertrauen haben als sein Wirt. Aber er darf sie Dir nicht zu teuer berechnen, so daß Du an Stelle von Vorteilen dieser Verbindung nur Lasten und Unkosten hast.
Das dürfte nicht sein und schließlich wird es auch nicht sein.
Du mußt von ihm seine besten Arbeiten bekommen. Ich will Dir sagen, ich rechne darauf, einige Studien im Atelier zu behalten, anstatt sie Dir zu schicken. Ich glaube, fahre ich unentwegt fort, aus dem Hause hier eine wirklich künstlerische Sache zu machen, so wirst Du später eine recht moderne Sache haben, die sich halten wird ......
G. d. D. Vincent

29. Am Rande der Berge. St. Remy. Mai 1890. Amsterdam, Rijksmuseum
Arles, ohne Datum (wohl Ende September 1888)
Mein lieber Theo! Ich schrieb Dir schon heute morgen ganz früh, dann ging ich weg, um am Bild des sonnigen Morgens weiterzuarbeiten, dann kam ich nach Hause und ging wieder mit einer Leinwand weg, und die ist nun auch verarbeitet. Jetzt habe ich Lust, Dir noch einmal zu schreiben.
Denn ich hatte niemals eine solche Chance. Die Natur war ganz außerordentlich schön. Das Himmelsgewölbe ist von einem bewundernswerten Blau; die Sonne strahlt ein bleiches Gelb aus. Das ist sanft und zauberhaft wie die Verteilung von dem himmlischen Blau und Gelb in dem van der Meer van Delft. So etwas Schönes kann ich nicht malen, aber das reißt mich draußen fort, daß ich mich gehen lasse, ohne an eine Regel zu denken.
Jetzt habe ich drei Bilder von den Gärten vor meinem Hause, außerdem die beiden Cafés, die Sonnenblumen, das Porträt von Bock und mir, außerdem die rote Sonne über der Fabrik, die Sandlöcher und die alte Mühle. Wenn ich die anderen Studien beiseite lasse, so siehst Du doch, daß ich etwas fertiggebracht habe; aber meine Farben, meine Leinwand und meine Börse sind erschöpft. Das letzte Bild ist mit den letzten Tuben auf die letzte Leinwand gearbeitet. Ein Garten, natürlich grün, aber er ist eigentlich ohne Grün gemalt, nichts als Preußischblau und Chromgelb. Ich fühle mich jetzt als einen ganz anderen Menschen wie damals, als ich hierher kam. Ich zweifle nicht mehr, ich zögere nicht mehr, eine Sache anzupacken, und das könnte sich noch steigern. Aber welch eine Natur! Ich arbeite in einem Stadtgarten nahe der Straße der guten kleinen Frauenzimmer. Mourier betrat sie niemals, obwohl wir fast täglich in diesem Garten spazieren gingen, aber an der anderen Seite (es gibt deren drei). Aber Du begreifst, daß gerade das der Gegend, ich weiß nicht, etwas von Boccaccio gibt. Diese Seite des Gartens besitzt, vielleicht aus Gründen der Keuschheit oder der Moral, keine Blumenbeete außer etwas Kirschlorbeer. Da sind gewöhnliche Platanen, Tannenbüsche, eine Trauerweide und grünes Gras; aber das ist von einer Intimität. Es gibt von Manet solche Gärten. Wenn Du die Last mit all diesen Farben, Leinwand und all dem Geld, das ich ausgeben muß, ertragen kannst, so schicke es mir immer, denn was ich vorbereite ist besser als die letzte Sendung, und ich glaube, wir gewinnen, anstatt daß wir verlieren. Ob ich wohl dahin komme, ein Ganzes, das bleibt, zu schaffen? Das suche ich. –
Aber ist es wirklich ganz unmöglich, daß Thomas 200 bis 300 Francs auf meine Bilder hin leiht? Das nützte mir mehr, als 1000 Francs zu verdienen.
Ich kann es Dir nicht genug sagen, daß ich bezaubert, bezaubert, bezaubert bin von all dem, was ich sehe.
Es gibt einem Pläne für den Herbst, eine Begeisterung, daß man nicht spürt, wie die Zeit vorübergeht.
Aber wehe vor der Reaktion, vor den Stürmen im Winter!
Wie ich heute arbeitete, dachte ich viel an Bernard. Sein Brief ist ganz von Bewunderung für die Begabung Gauguins erfüllt. Er schreibt, er hielte ihn für einen so großen Künstler, daß er beinahe Furcht vor ihm habe, daß er alles, was er, Bernard, mache, im Vergleich mit den Arbeiten Gauguins schlecht finde. Und Du weißt, daß sich Bernard noch im Winter über Gauguin beklagte! Immerhin, wie es auch kommt, ist es sehr tröstlich, daß diese Künstler unsere Freunde sind und, wie ich zu glauben wage, auch bleiben werden, wie sich die Angelegenheit auch wenden will. – Ich habe so viel Glück mit dem Haus, mit der Arbeit, daß ich glaube, diese guten Dinge werden nicht allein bleiben, sondern Du wirst sie mit mir teilen, wenn Du Lust dazu hast. Vor einiger Zeit las ich einen Aufsatz über Dante, Petrarca, Giotto und Botticelli; mein Gott, welchen Eindruck das auf mich gemacht hat, als ich die Briefe dieser Leute las. Petrarca war ganz in der Nähe von Avignon, ich sehe die gleichen Zypressen und den gleichen Kirschlorbeer. Ich will etwas Ähnliches in einem der Gärten ausdrücken, der mit vollem Auftrag gemalt ist in zitronenfarbenem Gelb und Zitronengrün. Giotto hat mich am meisten erschüttert, er, der immer litt, immer voller Güte und Glut war, als lebte er in einer anderen Welt wie dieser. Giotto ist ganz außerordentlich. Ich fühle ihn stärker als die Dichter, als Dante, Petrarca und Boccaccio. Mir scheint immer, daß die Dichtung schrecklicher ist als die Malerei, obwohl die Malerei immer ein schmutziges und schmieriges Geschäft ist. Aber schließlich sagt der Maler nichts, er schweigt, und ich ziehe das vor.
Mein lieber Theo, wenn Du diese Zypressen, den Kirschlorbeer und die Sonne hier gesehen hast, der Tag wird kommen, sei ganz ruhig, so wirst Du noch öfter an die schönen Puvis de Chavannes denken, »Das verheißene Land« und anderes.
Wenn man dieses so drollige Land mit all seinen Tartarins, Daumiers und seinem komischen Akzent kennt, so findet man auch viel griechisches; es gibt eine Venus von Arles, wie es eine Venus von Lesbos gibt, und man spürt vor allem diese Jugend.
Ich zweifle gar nicht, daß Du eines Tages den Süden kennenlernst. Vielleicht besuchst Du mal Claude Monet, wenn er in Antibes ist, oder vielleicht findest Du sonst eine Gelegenheit. Aber wenn der Mistral stürmt, ist dieses Land genau das Gegenteil eines lieblichen Landes; denn der Mistral ist von großer Heftigkeit. Aber welche Vergeltung, wenn es einen Tag ohne Wind gibt! Welche Stärke der Farben, welch reine Luft, welche Vibration!
Morgen werde ich zeichnen, bis die Farben kommen; aber ich bin jetzt entschlossen, nie mehr ein Bild mit Kohle zu zeichnen, das führt zu nichts. Um gut zu zeichnen, muß man die Zeichnung mit der Farbe herausbringen ......
G. d. D. Vincent

30. Bildnis Dr. Gachet. Auvers-sur-Oise. Juni 1890. Vormals Frankfurt a. M., Staedelsches Kunstinstitut, jetzt New York, Sammlung Kramarsky
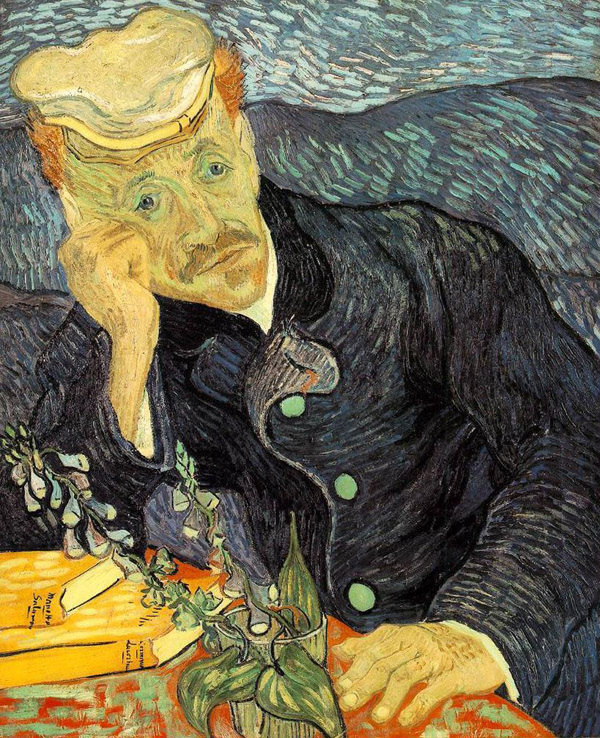
Arles, ohne Datum (wohl Anfang Oktober 1888)
Mein lieber Theo! ......
Ich glaube immer, daß Du nicht Deinen Anteil an der Sonne hast; denn Deine Pariser Arbeit bei den Goupils ist zu aufreibend. Wenn ich daran denke, habe ich eine wahre Verdienstwut; ich will dann Geld machen, immer mehr Geld, damit Du ganz frei bist.
Ich spüre, wir brennen darauf, zu verkaufen oder Hilfe zu finden, damit wir etwas Luft bekommen.
Aber vielleicht halte ich es, was wohl noch ziemlich fern ist, für allzu nahe, und wenn ich dies bedenke, dann bin ich ganz unruhig, so viel aufzugeben.
Indessen geraten die Gemälde immer besser, wenn man sich pflegt und sich wohl befindet; aber Du, Deine Arbeit und Dein Leben, das darf nicht zu sehr gestört werden. Wie geht es mit Deinen Hüftschmerzen, sind die weg?
Wie es auch sei, Du hilfst uns mehr, wenn Du Dich wohl fühlst und gut lebst.
Die Farbensendungen müssen dann einfach etwas eingeschränkt werden. Ich glaube daran, der Tag kommt, wo meine Arbeit belohnt wird. Aber vielleicht ist das noch zu entfernt, und wenn man darauf wartet, darf man auch nicht eingeengt sein.
Die Geschäfte werden ganz allein und wie im Traum gehen, rascher und besser, wenn Du Dich pflegst, als wenn Du Dich anstrengst. In unserem Alter dürfen wir schon eine gewisse Weisheit in unseren Handlungen zeigen. Ich fürchte jetzt nur das Elend und die Krankheit; all dies will ich vermeiden; ich hoffe, Du empfindest das gleiche.
Ich habe einige Gewissensbisse, diese Möbel gekauft zu haben, obwohl es gut ist, weil ich Dich deswegen um Geld bitten mußte.
Wisse es, wenn Du Dich nicht wohl fühlst oder Dich zu sehr mühst, so geht gar nichts mehr voran; aber fühlst Du Dich wohl, dann gehen die Geschäfte von ganz allein. Du wirst unendlich mehr Ideen für Deine Geschäfte haben, wenn Du gut, als wenn Du schlecht ißt.
Schreie mir halt zu, wenn ich zu weit gehe. Wenn nicht, so ist das natürlich für mich viel besser; denn ich arbeite sicher viel besser, wenn ich etwas frei werde, als wenn ich zu eingeengt lebe.
Aber glaube vor allem nicht, daß ich an der Arbeit mehr hänge als an unserem Wohlbefinden und unserer Heiterkeit.
Gauguin wird hier das gleiche empfinden und er wird sich erholen. Vielleicht kommt dann der Tag für ihn, wo er wieder Familienvater sein wird und werden kann, was er in Wirklichkeit ist. Ich bin so neugierig auf die Dinge, die er in der Bretagne gemacht hat; Bernard schrieb viel Gutes darüber. Aber in Kälte und Elend ist es schwer, eine volle Malerei herauszubringen, und schließlich und am Ende wird er seine Heimat in dem glücklicheren Süden finden.
Wenn Du die Weinberge sähest, es gibt hier Traubenbüschel von einem Kilo. Der Wein ist dieses Jahr wundervoll infolge der schönen Herbsttage, während der Sommer recht viel zu wünschen übrig ließ.
Ich bedauere, für diese Kommode Geld ausgegeben zu haben; aber das erspart uns, eine teuere zu kaufen, die wenigstens 35 Francs gekostet hätte, und wenn Gauguin kommt, so muß doch etwas da sein, worin er seine Wäsche unterbringt. Schließlich wird dann auch ein Zimmer vollkommen eingerichtet sein. Wenn wir einmal etwas reicher sind, so werde ich diese für mich nehmen und er wird eine für 35 Francs kaufen. Für diesen Preis gibt es immer welche zu kaufen, aber nicht immer zu dem Preis, wofür ich diese kaufte.
Ich dachte daran, daß die Menge von Studien Dir vielleicht zu viel Platz wegnehmen und Dich behindern würde. Man könnte sie von den Keilrahmen nehmen und sie hierher schicken, wo wir genug Platz zur Aufbewahrung haben. Ich sage das wegen einiger Arbeiten der vergangenen Jahre oder in betreff all der Dinge, die Dich hindern. Paris muß trotz allem im Herbst sehr schön sein. In der Stadt hier ist nichts los, in der Nacht alles ganz dunkel. Ich glaube, daß diese Menge Gaslicht, die doch gelb und orange ist, das Blau steigert; denn der Nachthimmel scheint mir hier sehr drollig, viel schwärzer als in Paris, und wenn ich jemals wieder Paris sehe, werde ich versuchen, die Effekte des Gaslichtes auf den Boulevards zu malen.
Auch in Marseille wird es gerade das Gegenteil sein; ich glaube, das ist schöner als in Paris.
Ich denke so viel an Monticelli, und ich meine, man muß bei der Erzählung von seinem Tod nicht nur den Gedanken, daß er als Säufer gestorben sei, in dem Sinne, daß er durch das Gift ganz heruntergekommen sei, ausscheiden, sondern man muß auch bedenken, daß das Leben hier sich viel mehr als im Norden im Freien und in den Cafés abspielt. Mein Freund, der Briefträger, zum Beispiel lebt viel in den Cafés und ist sicher mehr oder weniger ein Trinker und war es sein ganzes Leben hindurch. Aber er ist gerade das Gegenteil von einem erschöpften Menschen. Seine Erregung ist so natürlich, so klug; er räsonniert dann so großzügig wie Garibaldi, daß ich gerne annehme, die Legende von dem Absinthsäufer Monticelli war gerade so wie mit meinem Briefträger. Mein Bogen ist voll, schreibe mir so bald wie möglich.
Ich drücke Dir die Hand und viel Glück.
G. d. D. Vincent
Arles, 20. Oktober 1888
Mein lieber Theo! Schönen Dank für Deinen Brief und den 50-Francs-Schein. Du erfuhrst durch mein Telegramm, daß Gauguin gut angekommen ist. Ich habe den Eindruck, er ist viel wohler als ich selbst. Natürlich ist er mit dem Verkauf sehr zufrieden, der Dir gelang, und ich nicht weniger. Denn es gibt noch eine absolut nötige Ausgabe. Wir brauchen jetzt nicht darauf zu warten, und Du wirst sie nicht allein zu tragen brauchen. Sicher schreibt Dir Gauguin heute. Er ist als Mensch sehr, sehr interessant, und ich vertraue ganz darauf, daß wir mit ihm zusammen eine ganze Menge Dinge machen werden. Er schafft wahrscheinlich hier sehr viel und ich hoffentlich auch.
Dann glaube ich, wird für Dich die Last etwas weniger schwer sein. Vielleicht auch viel, viel weniger schwer. Ich fühle bis zum moralisch zerschmettert und physisch ausgeleert sein den schöpferischen Drang und vor allem darum, weil ich am Ende gar kein anderes Mittel sehe, jemals wieder unsere Ausgaben einzuholen.
Ich kann nichts dafür, daß sich meine Bilder nicht verkaufen.
Einmal wird der Tag kommen, da wird man sehen, daß sie mehr als den Preis der Farbe wert sind und mein ganzes erbärmliches Leben, das ich daran hängte.
Ich habe keinen andern Wunsch, als keine Schulden mehr zu haben.
Aber, mein lieber Bruder, meine Schulden sind so groß, daß, wenn sie einmal bezahlt sind, und ich glaube, daß mir das gelingen wird, dann die Anstrengung, Gemälde zu schaffen, mein ganzes Leben aufgezehrt haben wird; dann wird es mir scheinen, daß ich gar nicht gelebt habe. Dann vielleicht wird mir die Produktion immer schwerer, und mit der Anzahl der Bilder wird es auch nicht so bleiben.
Weil sie sich nicht verkaufen, ängstige ich mich, daß Du darunter leidest. Mir persönlich wäre es gleichgültig, wenn Du nicht darin allzu sehr verwickelt wärest. Man muß rechnen. Die Wahrheit ist, daß, wenn ein Mensch 50 Jahre lebt und 2000 Francs jährlich ausgibt, d. h. 100 000 Francs verbraucht, dann muß er für 100 000 Francs verdienen, also muß man 1000 Gemälde zu 100 Francs in seinem Künstlerdasein machen, und das ist sehr, sehr hart, wenn das Bild 100 Francs wert – ...... und dann ...... unsere Aufgabe ist manchmal recht schwer, aber man kann nichts daran ändern.
Wir werden Tasset schön anführen, weil wir uns zum größten Teil der billigeren Farben bedienen. Gauguin und ich. Die Leinwand werden wir uns selbst präparieren.
Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, krank zu werden, aber die Ankunft Gauguins zerstreute mich so, daß ich sicher bin, es wird vorübergehen. Vor allem darf ich während der Zeit nicht das Essen vernachlässigen, und das ist absolut alles. Und schließlich wirst Du am Ende einer Zeit meine Arbeit haben.
Gauguin brachte ein wundervolles Bild, das er mit Bernard ausgetauscht hat, Bretoninnen auf einer grünen Wiese, weißschwarz, grün und ein roter Ton und matte Fleischtöne. Seien wir nur guten Mutes. Ich glaube, eines Tages werde auch ich verkaufen, aber Dir gegenüber bin ich so im Rückstande, ich gebe alles aus und bringe nichts herein.
Dieses Gefühl bedrückt mich mitunter.
Ich bin sehr, sehr froh, daß Du mir schreibst, daß ein Holländer bei Dir bleibt, dann wirst auch Du nicht allein sein. Das ist durchaus gut, besonders, da wir bald Winter haben. Schließlich habe ich es eilig und muß bald wieder zur Arbeit hinausgehen, an ein anderes Bild zu 30.
Bald wird Dir Gauguin schreiben, und dann lege ich noch einen Brief dem seinen bei. Ich weiß natürlich nicht im voraus, was Gauguin von dem Land und unserem Leben sagen wird, aber auf jeden Fall ist er sehr mit dem guten Verkauf zufrieden, den Du für ihn machtest.
Auf bald, ich drücke Dir die Hand ganz fest.
G. d. D. Vincent
Arles, ohne Datum (wohl Anfang Dezember 1888)
Mein lieber Theo! Gauguin und ich waren gestern in Montpellier, um das Museum und vor allem den Saal Brias zu sehen. Es gibt dort viele Porträts von Brias, Delacroix, Courbet, Cabanel, Couture, Verdier, Tassaert und vielen anderen.
Dann gibt es viele Gemälde von Delacroix, Courbet, Giotto, Paul Potter, Botticelli, Th. Rousseau. Brias war ein Wohltäter der Künstler, mehr will ich davon nicht reden.
Da gibt es ein Delacroix–Porträt von einem Herrn mit Bart und roten Haaren, das eine verfluchte Ähnlichkeit mit Dir oder mir hat. Ich denke dabei an das Gedicht von Musset: »Überall wo ich die Erde berührte, kam ein Unheimlicher, schwarz gekleidet, ganz nahe zu uns, setzte sich hin und beschaute uns wie einen Bruder.« Du wirst den gleichen Eindruck davon haben; ich bin dessen sicher. Ich bitte Dich, in diese Buchhandlung zu gehen, wo man Lithographien von alten und modernen Künstlern verkauft, und die Lithographie »Tasso im Gefängnis der Tollen« nach dem Delacroix zu kaufen. Denn es scheint, daß diese Gestalt Beziehungen mit dem schönen Porträt von Brias hat.
Es gibt noch eine Studie von Delacroix, Die Mulattin (die Gauguin einmal kopierte), die Odalisken, Daniel in der Löwengrube, dann von Courbet die Dorffräuleins, eine wundervolle Frau von hinten gesehen, eine andere kauert in einer Landschaft, Die Weberin (wundervoll) und dann noch eine Menge Sachen von Courbet.
Schließlich wirst Du wissen, daß diese Sammlung existiert, oder Leute kennen, die das gesehen haben, und infolgedessen auch darüber reden können. – –
Gauguin und ich, wir reden viel von Delacroix und Rembrandt und so weiter.
Unser Zwiegespräch ist mitunter von einem außerordentlichen elektrischen Fluidum belebt, mitunter stehen wir davon auf mit müdem Kopf und wie eine elektrische Batterie nach der Entladung.
Wir waren in der vollen Magie gefangen. Fromentin sagt so fein, Rembrandt ist vor allem ein Zauberer.
Ich schreibe Dir das, da auch unsere Freunde, die Holländer de Haan und Isaacson, die Rembrandt so sehr suchten und lieben, und um Euch zu neuen Nachforschungen zu ermutigen.
Man darf darin nicht mutlos werden!
Du kennst dieses außerordentliche Männerbildnis Rembrandts in der Galerie Lacaze. Ich sagte schon Gauguin, ich sähe für mich darin einen gewissen Familienzug oder etwas von der Rasse der Delacroix oder der Seinen, nämlich Gauguins.
Ich nenne dieses Porträt immer, ich weiß gar nicht warum, den Wanderer oder den Mann, der aus der Ferne kommt.
Das ist so eine gleiche und analoge Idee, da ich Dir schon immer sagte, Du solltest Dir das Bild des alten Six, das schöne Porträt mit dem Handschuh, Deiner Zukunft wegen ansehen, und auch das Aquarell von Rembrandt, den lesenden Six am Fenster mit dem Sonnenstrahl, dieses für Deine Vergangenheit und Deine Gegenwart.
Sieh, das ist es!
Gauguin sagte mir diesen Morgen, als ich ihn frug, wie er sich fühle, »er fühle seine alte Natur wiederkehren«, und das machte mir viel Freude. Als ich vergangenen Winter erschöpft und mit einem fast ruinierten Hirn hier ankam, da habe ich auch ein wenig innerlich gelitten, ehe ich mich wieder auf den Damm bringen konnte.
Wie wünschte ich, daß Du eines Tages dieses Museum in Montpellier siehst, es gibt da so schöne Dinge. Sage Degas von Gauguin und mir, daß wir das Porträt des Brias von Delacroix in Montpellier gesehen haben. Man muß an das glauben, was ist, und es ist so, das Porträt des Brias von Delacroix gleicht Dir und mir wie ein neuer Bruder.
Wenn man das Leben auf einer Kameradschaft mit Malern aufbauen will, dann sieht man so komische Sachen, und ich endige damit, daß Du immer sagtest, wer leben wird, wird sehen. Du kannst unseren Freunden de Haan und Isaacson alles dieses sagen und ihnen selbst diesen Brief vorlesen. Ich hätte ihnen schon geschrieben, wenn ich das nötige Fluidum und die Kraft gespürt hätte.
Gauguin und ich, wir drücken Dir herzlich und kräftig die Hand.
G. d. D. Vincent
Wenn Du glaubst, Gauguin und ich, wir hätten es immer leicht mit der Arbeit, nein, die Arbeit ist nicht immer bequem, und ich wünsche unseren holländischen Freunden und Dir vor allem, daß Ihr durch die Schwierigkeiten nicht mutlos werdet.
Arles, 2. Januar 1889
Mein lieber Theo! Um Dich ganz zu beruhigen, schreibe ich Dir einige Worte im Arbeitszimmer des Assistenzarztes Herrn Dr. Rey, den Du selbst sahst.
Ich werde noch einige Tage im Hospital bleiben, darf dann darauf rechnen, in aller Ruhe in mein Haus zurückzukehren.
Jetzt bitte ich Dich nur um ein einziges, Dich nicht zu beunruhigen; denn das beunruhigt mich zu sehr. Jetzt wollen wir von unserem Freund Gauguin reden. Habe ich ihn erschreckt? Warum gibt er mir kein Lebenszeichen? Er muß doch mit Dir weggegangen sein? Er hatte das Bedürfnis, Paris wiederzusehen. Vielleicht wird er sich in Paris heimischer als hier fühlen. Sage Gauguin, er soll mir schreiben, und daß ich immer an ihn denke.
Ich drücke Dir herzlich die Hand. Ich lese immer und immer wieder Deinen Brief, der mir die Begegnung mit den Bongers erzählte, das ist ausgezeichnet. Ich bin es zufrieden, so wie ich nun bin, hier zu bleiben.
Ich drücke nochmals Dir und Gauguin die Hand.
G. d. D. Vincent
Arles, 17. Januar 1889
Mein lieber Theo! Dank für Deinen guten Brief und den 50-Francs-Schein, der darin lag. Ich fühle mich jetzt nicht fähig, Dir auf alle die Fragen, die Du darin stellst, zu antworten. Ich will mir das alles genau überlegen und einen Entschluß fassen. Aber ich muß vorher Deinen Brief noch einmal lesen, und sofort.
Aber bevor wir uns auseinandersetzen, was ich während eines ganzen Jahres verbrauchen werde, wäre es vielleicht richtig, einen Weg zu finden, für diesen laufenden Monat zu überlegen. Auf jeden Fall war das alles beklagenswert, und sicher schätze ich mich glücklich, wenn Du Deine ernste Aufmerksamkeit auf die Gegenwart und die Vergangenheit richtest.
Aber was willst Du, es ist unglücklicherweise sehr kompliziert, und zwar von mehreren Seiten her. Meine Gemälde sind gänzlich wertlos. Sie kosten mich, das ist wahr, außerordentlich viel, selbst mitunter an Blut und Hirn. Ich bestehe auf alledem nicht, und was willst Du, was ich noch sage.
Aber kommen wir auf den jetzigen Monat zurück und reden wir nur vom Geld.
Am 23. Dezember waren in der Kasse noch 20,03 Francs, am gleichen Tage empfing ich von Dir einen 100-Francs-Schein.
Hier sind die Ausgaben:
??? Tabelle An Roulin gegeben, um der Aufwartung den Monat
Dezember zu zahlen 20,– Francs
am 15. Januar desgleichen 10,– " 30,– Francs
??? Tabell im Spital bezahl 21,– Francs
den Assistenzärzten für den Verband . 10,– "
bei der Rückkehr 1 Tisch, 1 Gasofen etc., die mir geliehen waren
und die ich übernahm 20,– "
um das Bettzeug zu bleichen, das blutige Leinenzeug etc. ... 12,50 "
verschiedene Einkäufe, wie ein Dutzend Pinsel, einen Hut etc.,
nehmen wir an 10,– »
103,50 Francs
Wir sind jetzt bis zu dem Tag vor dem Verlassen des Spitals gekommen, und da habe ich mein Portemonnaie schon mit 103,50 geleert. Dazu muß man noch den ersten Tag hinzufügen, an dem ich mit Roulin im Restaurant vergnügt aß. Damals fühlte ich mich ganz sicher und dachte nicht an neue Ängste.
Das Ergebnis von all dem war, daß ich ungefähr am 8. auf dem Trockenen saß. Ein oder zwei Tage danach lieh ich mir 5 Francs. Da waren wir kaum am 10. angelangt. Ich hoffte ungefähr am 10. auf einen Brief von Dir, aber dieser Brief kam erst heute am 17. Januar. Die Zwischenzeit war ein bitteres Fasten und um so schmerzlicher, als ich unter diesen Umständen nicht gesund werden konnte.
Nichtsdestoweniger nahm ich die Arbeit wieder auf und habe im Atelier bereits drei Studien gemacht und dann das Porträt des Herrn Rey, das ich ihm zum Andenken gab.
Dieses Mal gibt es nur noch ein schwereres Elend für mich, etwas mehr Leiden und Angst. Trotzdem bewahre ich mir alle gute Hoffnung.
Aber ich fühle mich schwach und etwas unruhig und furchtsam.
Das wird vorübergehen, wenn ich wieder zu Kräften komme.
Rey sagte mir, es genüge nur, sehr beeinflußbar zu sein, um die Krise, die ich hatte, zu bekommen. Jetzt sei ich nur blutarm, aber ich müsse mich unbedingt richtig ernähren. Ich nahm mir die Freiheit, Herrn Rey zu erklären, wenn es für mich die Hauptsache sei, wieder zu Kräften zu kommen, so sei ich durch einen unerhörten merkwürdigen Zufall zu einem strengen Fasten von einer Woche gezwungen. Ob er unter diesen Umständen schon viele Irre verhältnismäßig ruhig und arbeitsfähig gesehen habe, und wenn nicht, so möge er geruhen, sich bei dieser Gelegenheit beiläufig zu erinnern, daß ich noch nicht verrückt sei.
Ist nun an diesen Ausgaben, wenn man betrachtet, daß das Haus durch diese Geschichte vollkommen außer Stand kam, alles Leinen und meine Kleider beschmutzt und blutig waren, an diesen Ausgaben etwas Unerhörtes, Extravagantes oder Übertriebenes? Wenn ich nun diesen Leuten, die beinahe gerade so arm sind wie ich, meine Schulden bei der Rückkehr bezahlte, habe ich da einen Irrtum begangen? Und konnte ich mich weiter einschränken? Endlich bekomme ich heute am 17. den 50-Francs-Schein. Damit bezahle ich zuerst dem Caféwirt 5 Francs, die ich mir geliehen hatte, dann 10 für Speisen, die ich mir in der letzten Zeit auf Kredit nahm.
??? Tabelle 7,50 Francs
mußte ich noch für die Spitalwäsche bezahlen, und dann für diese
verflossene Woche für Ausbessern der Stiefel, einer Hose, dafür zusammen
wohl etwas wie 5,– "
für Holz und Kohlen im Dezember und die folgende Zeit . 4,– "
für zwei Wochen Aufwartung im Januar 10,– "
26,50 Francs
Dann bleiben mir, wenn ich diese bezahlt habe, einfache 23,50.
Wir sind jetzt am 15. und ich muß noch 13 Tage aushalten.
Frage mich, wieviel ich täglich dann ausgeben kann. Dazu kommt noch, daß Du 30 Francs an Roulin geschickt hast, mit denen er die Miete Dezember 21,50 Francs bezahlte.
Sieh, geliebter Bruder, ich rechne mit dem jetzigen Monat. Der ist noch nicht zu Ende. Wir fügen noch die Ausgaben bei, die Dir durch das Telegramm Gauguins verursacht wurden, dem ich es ziemlich förmlich vorwarf, depeschiert zu haben. Die Ausgaben, die dadurch entstanden, sind sie geringer als 200 Francs? Behauptete Gauguin selbst, daß er meisterliche Manöver gemacht habe?
Hör zu, ich bestehe nicht weiter auf diesen absurden Dingen. Nehmen wir an, ich sei ganz außer Fassung gewesen, warum verhielt sich dann dieser berühmte Kamerad nicht ruhiger ......
Aber ich will nicht weiter auf diesem Punkt beharren.
Ich kann Dich nicht genug loben, daß Du Gauguin derart bezahlt hast, daß er die Beziehungen, die er zu uns hatte, nur loben kann.
Das ist vielleicht unglücklicherweise noch eine größere Ausgabe als es recht ist, aber schließlich sehe ich darin eine Hoffnung.
Müßte er nicht wenigstens einzusehen beginnen, daß wir ihn nicht ausgebeutet haben, daß wir im Gegenteil ihm die Existenz retten wollten, die Möglichkeit der Arbeit, und ...... und die Ehrlichkeit.
Wenn er seine grandiosen Pläne, Künstlergenossenschaften zu gründen, die er uns vorschlug, höher schätzt, und daran immer noch auf seine Art, wie Du weißt, festhält, wenn es so um seine anderen böhmischen Dörfer bestellt ist, warum soll man ihn dann nicht als unverantwortlich ansehen und für die Schmerzen und den Ekel, den er sowohl Dir wie mir unbewußt bereitete und uns in seiner Verblendung verursachen konnte.
Wenn Dir diese Behauptung allzu kühn erscheint – ich bestehe nicht darauf – aber wir wollen abwarten.
Er war früher tätig in dem, was er die »Bank von Paris« nennt, und darin hält er sich für den größten Schlaukopf. Vielleicht sind wir in diesen Punkten, Du und ich, wenig neugierig.
Immerhin widerspricht das nicht vollkommen gewissen Sätzen unseres früheren Briefwechsels.
Wenn Gauguin in Paris wäre, um sich ein wenig zu studieren oder um sich durch einen Spezialisten studieren zu lassen, bei Gott, ich weiß nicht recht, was da herauskäme. Ich sehe ihn oft Dinge tun, die wir, Du und ich, uns niemals zu tun gestatteten.
Mit seinem Gewissen muß es eben ganz anders bestellt sein. Zwei oder dreimal hörte ich Dinge der gleichen Art, die man von ihm erzählte; aber ich sah ihn ganz, ganz in der Nähe. Ich glaube, er wird durch seine Einbildung dahin gebracht, vielleicht durch seinen Ehrgeiz, aber ...... ziemlich unverantwortlich.
Schließe nicht daraus, daß ich Dir empfehle, ihm unter allen Umständen zu glauben, aber bei der Regelung seiner Rechnung sah ich, hast Du mit einem überlegenen Bewußtsein gehandelt, und ich glaube, wir brauchen nicht zu fürchten, daß wir durch ihn zu den Irrtümern der »Bank von Paris« gebracht wurden. Aber er ...... mein Gott, er mag tun, was er will, aber ob er darum unabhängig ist??? (Was mag er wohl für einen unabhängigen Charakter halten?) Seine Meinungen ...... Mag er im Augenblick seinen Weg gehen, da ihm scheint, er verstünde das besser als wir.
Ich finde das ziemlich merkwürdig, daß er von mir ein Bild von Sonnenblumen reklamiert und mir zum Tausch, so nehme ich an, oder zum Geschenk einige Studien, die er hier ließ, anbietet. Ich werde ihm seine Studien zurückschicken, die wahrscheinlich für ihn irgendwelchen Nutzen haben, was für mich nicht der Fall ist. Aber für den Augenblick behalte ich meine Bilder und behalte kategorisch die fraglichen Sonnenblumen, davon hat er bereits zwei, das mag ihm genügen. Und wenn er mit dem Tausch, den er mit mir macht, nicht zufrieden ist, so mag er das kleine Bild aus Martinique und das Porträt aus der Bretagne zurücknehmen. Aber dann sollte er mir mein Porträt und die Sonnenblumen, die er sich in Paris nahm, wiedergeben.
Mag er nunmehr auf diese Sache zurückkommen, meine Worte sind ziemlich deutlich.
Wie kann Gauguin behaupten, er fürchte, mich durch seine Gegenwart zu stören, zumal er es schwerlich leugnen kann, daß er weiß, wie ich ihn immer darum gebeten habe und wie man ihm immer wieder gesagt hat, daß ich darauf bestünde, ihn sofort wiederzusehen.
In gleicher Weise sagte ich ihm, er solle die Sache zwischen sich und mir behalten, ohne Dich zu stören; das wollte er auch nicht hören.
Ich bin es überdrüssig, all dies immer wieder zu wiederholen und derartige Dinge zu überlegen.
Ich versuchte, Dir in diesem Brief den Unterschied zu zeigen zwischen den Ausgaben, die ich persönlich mache und denen, für welche ich weniger verantwortlich bin.
Ich bin verzweifelt, daß Du gerade in dem Augenblick Ausgaben hattest, wo sie keinem nützten.
Für die Folge werde ich versuchen, meine Kräfte wiederzugewinnen; vorausgesetzt, meine Position sei haltbar. Ein Wechsel oder ein Umzug scheinen mir, gerade wegen der neuen Ausgaben, höchst bedenklich. Ob ich jemals wieder zu Kräften kommen werde? Ich harre bei der Arbeit aus; weil sie in manchen Augenblicken vorwärts geht, glaube ich, daß ich bei einiger Geduld dazu komme, durch meine Gemälde die früheren Ausgaben zu decken.
Roulin reist ab, und das schon am 21. Er geht als Angestellter nach Marseille. Die Vergrößerung seines Gehaltes ist minimal; er muß für einige Zeit seine Frau und seine Kinder verlassen, da sie ihm erst viel später folgen können, denn die Ausgaben sind für seine Familie in Marseille viel größer. Das bedeutet für ihn eine Beförderung, aber das ist für ihn ein sehr magerer Trost, den die Regierung einem solchen Beamten nach so viel Arbeitsjahren gibt.
Im Grunde glaube ich, daß ihm und seiner Frau das Herz blutet.
Roulin hat mir in dieser Woche oft gute Gesellschaft geleistet ......
...... Obwohl dieser Brief schon recht lang ist, indem ich diesen Monat zu analysieren versuchte und mich ein wenig über seltsame Phänomene beschwere, daß Gauguin es vorzog, mich nicht mehr zu sprechen, so bleiben mir doch noch einige Worte der Billigung zuzufügen.
Er versteht es vor allen Dingen wunderbar, die Ausgaben von Tag zu Tag zu regeln. Ich hingegen bin oft geistesabwesend und nur damit beschäftigt, zu einem guten Ende zu kommen. Er hingegen hat den Vorzug, immer mit dem gegebenen Tag zu rechnen.
Aber seine Schwäche besteht darin, daß er durch seine Grobheit und blöde Fehler alles, was er ordnete, wieder außer Rand und Band bringt.
Bleibt man auf dem Posten, den man einmal gewonnen hat, oder läßt man ihn im Stich? Ich verurteile niemanden und hoffe darum, auch nicht verdammt zu werden, wenn mir einmal die Kräfte fehlen. Aber wenn Gauguin wirklich ein so tugendhafter und gütiger Mensch ist, warum macht er dann solche Dinge?
Ich bin jetzt außerstande, seine Handlungen weiter zu verfolgen. Ich halte ein; aber immerhin frage ich mich, wie war das möglich? Er und ich, wir tauschten von Zeit zu Zeit unsere Ideen über die französische Kunst, über den Impressionismus aus.
Es scheint mir jetzt unmöglich oder zum mindesten unwahrscheinlich, daß der Impressionismus sich organisiert und beruhigt. Warum trifft das nicht ein, was in England seit den Präraffaeliten geschah?
Die Verbände lösen sich auf.
Vielleicht nehme ich mir all diese Dinge zu sehr zu Herzen und vielleicht habe ich eine zu große Trauer. Hat Gauguin jemals den »Tartarin in den Alpen« gelesen und erinnert er sich an Tartarins berühmten Kameraden, der eine solche Einbildungskraft besaß, daß er sich mit einem Schlag eine ganze Schweiz vorzauberte?
Erinnert er sich an den Knoten im Seil, das er oben in den Alpen fand, nachdem er gestürzt war?
Und Du, der Du erfahren willst, wie die Dinge vorfielen, hast Du schon den ganzen Tartarin gelesen?
Das lehrt Dich einigermaßen, Gauguin verstehen.
Ich meine es sehr ernst damit, daß ich Dich verpflichte, diese Seite in Daudets Buch einmal anzusehen.
Hast Du auf Deiner Reise hier die Skizze gesehen, die ich von der Postkutsche von Tarascon gemalt habe, die, wie Du Dich erinnerst, in dem Kapitel »Tartarin als Löwenjäger« vorkommt?
Erinnerst Du Dich an Bompard in Numa Roumestan und seine glühende Einbildungskraft?
Das ist so: Gauguin hat auch, wenn auch auf eine andere Art, eine vollkommen südliche Phantasie; will er im Norden etwas ausrichten, na, da wird man noch hübsche Dinge sehen können.
Nachdem wir mit aller Offenheit diese Dinge sezierten, hindert uns nichts, in ihm den kleinen Tiger Bonaparte des Impressionismus zu sehen ...... ich weiß nicht, wie ich sein Ausreißen aus Arles nennen kann. Vielleicht ist es der Rückkehr des kleinen, oben erwähnten Korporals vergleichbar oder parallel, der zog sich auch aus Ägypten nach Paris zurück und ließ immer seine Armee im Unglück sitzen. Glücklicherweise sind wir, Gauguin und ich, und andere Maler, nicht mit Mitrailleusen und anderen vernichtenden Kriegsmaschinen ausgerüstet. Ich bin fest entschlossen, so zu bleiben, wie ich bin, ausgerüstet mit meinem Pinsel und meiner Feder. Nichtsdestoweniger hat Gauguin in seinem letzten Brief mit großem Geschrei sein Fechtzeug zurückverlangt, das in dem kleinen Arbeitszimmer meines kleinen gelben Hauses liegt.
Ich beeile mich, ihm mit der Post diese Kindereien zugehen zu lassen, in der Hoffnung, er möge sich ihrer niemals zu ernsteren Dingen bedienen.
Er ist körperlich stärker als wir, seine Leidenschaften müssen auch stärker sein als die unseren; dann ist er Familienvater, hat seine Frau und seine Kinder in Dänemark sitzen und will sogleich von einem Ende der Erde ans andere und auch nach Martinique. Dieser ganze Widerstreit von Wünschen und Bedürfnissen ist schrecklich und muß ihn in manche Ungelegenheiten bringen ......
G. d. D. Vincent
Arles, 30. Januar 1889
Mein lieber Theo! Ich habe Dir gar nichts sehr Unerwartetes zu erzählen. Trotzdem will ich dich wissen lassen, daß ich vergangenen Montag meinen Freund Roulin wieder sah. Es gab immerhin etwas ......
Ganz Frankreich hat gezittert. Sicher sind in unseren Augen die Wahlen, ihre Ergebnisse und die Abgeordneten nur Symbole; aber es ist vollkommen erwiesen, daß Ehrgeiz, weltlicher Ruhm vorübergeht, aber daß bis auf heute das Klopfen des menschlichen Herzens das gleiche blieb und wir mit der Vergangenheit unserer toten Väter ebenso eins sind wie mit der kommenden Generation.
Ich bekam diesen Morgen einen sehr freundschaftlichen Brief von Gauguin, den ich ohne zu zögern sogleich erwiderte. Ich hatte gerade die Wiederholung meiner Sonnenblumen beendet, als Roulin kam, dem ich die beiden Berceusen zwischen den vier Blumenstücken zeigte.
Roulin wünscht Dir guten Tag.
Er war Sonntag bei dem Massenauflauf, als die Wahlergebnisse von Paris telegraphiert wurden. Das ganze Volk von Marseille war bis ins innerste Herz bewegt. Wer wagt es jetzt noch, Feuer für irgendeine Mitrailleuse oder ein Lebelgewehr zu kommandieren, wo die Menschen so weit vorgeschritten sind, daß sie mit ihren Herzen eine Kanonenmündung verstopfen.
Um so mehr, als die politischen Sieger dieses großen heutigen Tages, Rochefort und Boulanger, nach allgemeiner Übereinstimmung mehr Anspruch auf ein Grab als auf irgendeinen Thron haben.
So faßten wir dieses Ergebnis auf, und nicht allein Roulin und ich, noch viele andere. Roulin erzählte, er habe fast geweint, als er diese Menge in Marseille sah, die ruhig dastand; er sei fast nicht mehr zu sich gekommen, als er beim Rückschauen hinter sich ganz alte Freunde sah, die ihn zufällig erst nicht erkannten. Dann saßen sie bis spät in der Nacht beim Abendbrot zusammen.
Obwohl er sehr ermüdet war, konnte er doch seinem Verlangen, nach Arles zu kommen, um seine Familie zu sehen, nicht mehr widerstehen. Er fiel fast vor Müdigkeit um und kam ganz bleich an, um uns die Hand zu geben. Ich konnte ihm gerade die Porträts seiner Frau zeigen, was ihn freute.
Ich fühle mich sichtlich besser, immerhin ist mein Herz allzu bewegt und erhofft vieles. Denn diese Heilung erstaunt mich überaus.
Jedermann hier ist gut zu mir, die Nachbarn usw., alle sind gut und zuvorkommend wie in einer Heimat.
Ich weiß bereits, daß mehrere mich um Porträts bäten, wenn sie zu bitten wagten. Roulin, der doch ein armer Teufel und ganz kleiner Beamter ist, wurde hier sehr, sehr geachtet, und man erfuhr, daß ich seine ganze Familie gemalt habe.
Ich arbeite heute an einer dritten Berceuse. Die ist weder so korrekt gezeichnet noch gemalt wie Bouguereau, was ich fast bedauere, da ich sehr wünsche, korrekt zu sein. Aber obwohl das unglücklicherweise weder Cabanel noch Bouguereau ist, hoffe ich doch, daß es französisch sei. Heute war wundervolles, wundervolles Wetter, und ich fühle solche Lust zu arbeiten, daß ich überrascht bin. Ich will den Brief an Dich wie Gauguin schließen und Dir sagen, daß es noch gewisse Zeichen der vorhergehenden Erregung in meinen Worten gibt, aber das ist nicht erstaunlich, denn in diesem guten Tarasconer Land ist jedermann ein wenig verrückt.
Ich drücke Dir fest die Hand, ebenso de Haan und Isaacson.
Ich erwarte Deinen Brief so früh wie möglich nach dem ersten Februar.
Arles, 29. März 1889
Mein lieber Theo! Vor Deiner Abreise in diesen Tagen will ich Dir noch ein paar Worte schreiben. Es geht ganz gut, vorgestern und gestern ging ich eine Stunde in die Stadt, um Motive für die Arbeit zu suchen. Als ich nach meiner Wohnung ging, konnte ich feststellen, daß die eigentlichen Nachbarn, die ich kenne, nicht unter denen waren, die das Gesuch eingereicht hatten. Wie es auch sei, ich sehe, daß ich noch Freunde unter ihnen habe.
Herr Salles bot mir an, für mich in einigen Tagen in einem Vorort eine Wohnung zu suchen, falls es nötig sei.
Ich ließ noch einige Bücher kommen, um etwas solidere Gedanken in den Schädel zu bekommen. Ich las Onkel Toms Hütte von Beecher Stowe. Du kennst dieses Buch über die Sklaverei, auch die Weihnachtsgeschichten von Dickens, und ich habe Herrn Salles Germinie Lacerteux geschenkt. Jetzt nehme ich zum fünftenmal die »Berceuse« auf. Wenn Du sie sehen wirst, wirst Du mir bestätigen, daß es nur ein Bazarfarbendruck ist. Er hat nicht einmal das Verdienst, photographisch genau in den Verhältnissen oder in irgend etwas anderem zu sein.
Schließlich will ich ein Bild machen, wie der Matrose, der nichts von Malerei weiß, sich's vorstellt, wenn er auf offenem Meer an eine Frau auf dem Lande denkt.
Im Spital sind sie in diesen Tagen sehr zuvorkommend zu mir, das macht mich verlegen und bringt mich etwas durcheinander. Ich glaube jetzt, Du zögest es vor, Dich ohne welche Zeremonien und Gratulationsbesuche zu verheiraten; ich bin im voraus sicher, daß Du Derartiges so viel wie möglich vermeiden wirst.
Wenn Du Koning siehst, und vor allem die Cousinen Mauve und Leconte, so vergiß nicht, ihnen einen guten Tag zu wünschen.
Oh, wie scheinen mir diese drei letzten Monate sonderbar! So viel namenlose Ängste; dann wieder schien für Augenblicke der Schleier, der über die Zeit und das Schicksal gebreitet war, sich zu lüften.
Nach all dem hast Du ganz recht; selbst wenn man noch etwas hofft, soll man inzwischen doch die traurige Wirklichkeit hinnehmen. Ich will mich ganz in die Arbeit stürzen, die sich so verzögert. Ach, ich darf nicht vergessen, Dir eine Sache zu erzählen, an die ich oft dachte. Ganz zufällig fand ich in einem Aufsatz einer alten Zeitung ein Wort, das auf ein antikes Grab geschrieben ist, in der Gegend hier, in Carpentras. Hier diese uralte Inschrift aus der Zeit – nehmen wir an – der Salambo des Flaubert: »Thebe, Tochter des Elui, Priesterin der Ausiris, die sich über niemanden je beklagte.«
Solltest Du Gauguin sehen, so erzähle ihm das. Und ich dachte an eine ganz verblühte Frau, Du hast bei Dir die Studie dieser Frau, sie hatte ganz seltsame Augen. Ich war ihr zufällig begegnet.
Was will das nur heißen, »sie hat sich niemals über jemanden beklagt«? Stellt Euch eine vollkommene Zukunft vor, warum nicht? Aber vergessen wir nicht, daß so etwas in den alten Zeiten ganz real war ... »Und sie hat sich niemals über jemanden beklagt.«
Du erinnerst Dich, wie der gute Thomas am Sonntag uns besuchte und sagte: »Ach, sind es solche Frauen, die euch umgarnen?«
Nein, das ist durchaus nicht richtig mit diesem Umgarnen. Aber von Zeit zu Zeit im Leben ist man so entzückt, als wenn man in dem Boden Wurzel faßte.
Du sprichst mir jetzt vom wahren Süden, und ich sagte, am Ende scheint es mir, daß nur vollkommenere Menschen als ich hingehen dürften.
Der wahre Süden, ist es nicht das, wo man Vernunft findet? Geduld, Ruhe, Heiterkeit, um zu sein wie diese Thebe, Tochter des Elui, die sich niemals über jemanden beklagte? Darum komme ich mir wer weiß wie undankbar vor.
Dir und Deiner Frau wünsche ich zu Eurer Hochzeit Glück und Heiterkeit für Euch beide, dann habt Ihr den wahren Süden im Herzen.
Da ich wünsche, daß dieser Brief noch heute abgeht, muß ich schließen. Ich drücke Dir die Hand, glückliche Reise, viel Gutes der Mutter und der Schwester.
G. d. D. Vincent

31. Stiege in Auvers. Juni 1890. Manchester. Sammlung Herbert Cöleman
St. Remy, 9. Juni 1889
Mein lieber Theo! Vielen Dank für die Sendung an Leinwand, Farben, Pinsel, Tabak und Schokolade, die ich in gutem Zustand erhielt.
Ich bin darüber sehr froh, denn ich schmachte ein wenig nach der Arbeit. Außerdem bin ich seit einigen Tagen draußen, um in der Umgegend zu arbeiten.
Dein letzter Brief war, wenn ich mich recht erinnere, vom 21. Mai. Seitdem erhielt ich keine Nachricht von Dir, außer, daß Herr Peyron mir sagte, er habe einen Brief von Dir bekommen.
Herr Peyron beabsichtigt, nach Paris zu gehen, um die Ausstellung zu sehen; dann wird er Dir einen Besuch abstatten.
Was soll ich Dir Neues sagen? Nicht viel. Ich arbeite an zwei Landschaften; die eine ist das Land, das ich durch das Fenster meines Schlafzimmers wahrnehme. Auf dem Vordergrund ist ein Weizenfeld, an das ein Stück Erde, das durch einen Sturm verwüstet ist, angrenzt, die Mauer eines Geheges und hinter ihr das graue Laub einiger Olivenbäume, Hütten und Hügel. Oben auf dem Bild eine große weißgraue Wolke, die in das Himmelsblau untertaucht. Es ist eine Landschaft von äußerster Einfachheit, auch in der Farbengebung. Das paßt indes als Gegenstück zur Studie des Schlafzimmers, die beschädigt ist. Nicht wahr, das macht etwas aus, daß eine Sache zu Kunst wird, daß die dargestellte Sache vollkommen in dem Stil aufgegangen ist und eins wird mit der Darstellungsart.
Das ist der Grund, warum ein Stück Brot immer gute Malerei ist, wenn es von Chardin gemalt wurde.
Z. B. die ägyptische Kunst; das Außerordentliche daran ist es nicht, daß diese heiteren, ruhigen Könige so weise, mild, gütig und gut sind; sie scheinen auch nur das sein zu können, was sie sind, ewig Ackerbauer und Anbeter der Sonne.
Wie gern hätte ich auf der Ausstellung ein ägyptisches Haus gesehen, das Jules Carmier, der Architekt, rekonstruierte, angemalt in Rot, Gelb und Blau, mit einem in regelmäßige Beete geteilten Garten, die durch Ziegelsteine abgegrenzt werden, dies Wohnung von Wesen, die wir nur als Mumien kennen oder in Granit. Aber, um auf diese Lämmer von ägyptischen Künstlern zurückzukommen, die mit Gefühl und Instinkt arbeiten und all diese greifbaren Dinge einmal ausdrücken, die Güte, die unendliche Geduld, die Weisheit, die Heiterkeit, mit irgendwelchen weißen Kurven und wundervollen Verhältnissen. Da ist es einmal verwirklicht, daß die dargestellte Sache und die Art, sie herzustellen, in Übereinstimmung gebracht sind. Die Sache besitzt Stil und Haltung.
So wird auch die Magd in dem großen Fresco von Leys, wenn sie von Bracquemond gestochen wird, ein neues Kunstwerk, ebenso der kleine Leser von Meissonnier, wenn ihn Jacquemart sticht, denn die Art des Stichs wird eins mit der dargestellten Sache.
Ich wünsche die Studie des Schlafzimmers aufzubewahren. Schicke sie mir, wenn Du willst, zurück. Wenn man mir Leinwand schickt, so will ich es noch einmal malen. Zuerst wollte ich es neu aufziehen lassen, denn ich glaubte nicht, es noch einmal machen zu können. Da sich indes aber mein Kopf beruhigt, kann ich es noch einmal machen.
Unter der Anzahl der Dinge, die man einmal macht, gibt es immer welche, die man tiefer empfunden und gewollt hat und die man selbst bewahren will. Wenn ich ein Bild sehe, das mich beunruhigt, so frage ich mich immer unwillkürlich, in welchem Haus, welchem Zimmer, in welcher Zimmerecke, bei welchen Menschen nähme sich das Bild gut aus, wäre es an seinem Platz. So hängen die Gemälde von Hals, Rembrandt, Vermeer erst recht gut in einem alten holländischen Haus. So geht es auch mit den Impressionisten. Wie ein Interieur nicht vollkommen ist ohne Kunstwerk, um so weniger ein Bild, wenn es nicht in seiner ursprünglichen Umgebung aufgestellt ist, die aus der gleichen Zeit ist, in der das Bild geschaffen wurde. Ich weiß nicht, ob die Impressionisten mehr wert sind als ihre Zeit, oder vielmehr ob sie noch nicht so viel wert sind. Mit einem Wort, gibt es Seelen und Interieurs von Häusern, die wichtiger sind als das, was bisher durch Malerei ausgedrückt wurde? Ich glaube es.
Ich sah die Ankündigung einer Ausstellung von Impressionisten, genannt Gauguin, Bernard, Anquetin und andere. Ich glaube darum, da hat sich wieder eine neue Sekte aufgemacht, nicht weniger unfehlbar als die, die es bisher gab.
War es diese Ausstellung, von der Du mir sprachst, Welche Stürme in Wassergläsern!
Mit der Gesundheit geht es so einigermaßen. Ich fühle mich mit meiner Arbeit glücklicher als ich es draußen sein könnte. Wenn ich hier ziemlich lange bleibe, nehme ich ein geregeltes Leben an und mehr Ordnung wird in mein Leben kommen und weniger Reizbarkeit. Auf diese Weise habe ich etwas gewonnen, übrigens hätte ich nicht den Mut, draußen wieder anzufangen. Ich ging einmal, und noch in Begleitung, in das Dorf. Allein, schon der Anblick der Menschen und der Dinge bewirkte, daß ich einer Ohnmacht nahe kam und mich sehr schlecht befand.
Vor der Natur hält mich das Gefühl meiner Arbeit aufrecht. Aber schließlich will ich Dir sagen, in mir muß es irgendwelche zu starke Erregung gegeben haben, die mich dahin gebracht hat, und ich weiß gar nicht, was daran Schuld ist. In manchen Augenblicken sehne ich mich schrecklich nach der Arbeit und will doch gar nicht mehr von vorne beginnen. Der Arzt, der mich eben besuchte, sagte mir, er ginge erst in einigen Wochen nach Paris. Erwarte darum seinen Besuch noch nicht. Ich hoffe, Du schreibst mir bald ......
Es ist komisch, jedesmal, wenn ich versuche, nachzudenken und mir Rechenschaft über die Dinge ablegen will, warum ich hierher kam und daß das schließlich ein Unfall wie jeder andere sei, ergreift mich eine schreckliche Angst und ein Schaudern und hindert mich, weiter zu denken. Es ist wahr, das versucht vage, sich zu vermindern, aber das scheint mir auch zu beweisen, daß es in meinem Hirn, ich weiß es nicht, irgend etwas Zerstörtes gibt. Aber das ist so seltsam, sich vor nichts zu fürchten und sich an nichts erinnern zu können. Du kannst schon damit rechnen, ich tue mein Möglichstes, um wieder aktiv zu werden und werde vielleicht doch nützlich in dem Sinne, daß ich bessere Bilder als bisher machen will.
In der Landschaft hier gibt es viele Dinge, die einen oft an Rußland denken lassen, aber die Gestalten der Arbeiter fehlen.
Bei uns sieht man überall und zu jeder Jahreszeit Männer, Frauen, Kinder, Tiere bei der Arbeit. Hier hingegen nicht den dritten Teil davon, und das ist auch nicht der freie nordische Arbeiter, das scheint mit einer linkischen und schlaffen Hand zu arbeiten ohne Zug. Vielleicht ist das ein Gedanke, den ich mir zu unrecht auskünstelte, da ich nicht aus dem Land bin. Ich hoffe es wenigstens. Aber das läßt einem die Dinge etwas erkalten, an die man glaubt, wenn man den Tartarin liest; aber vielleicht starb der schon seit langen Jahren mit seiner ganzen Familie aus.
Schreib mir vor allem bald. Deine Briefe lassen mitunter lange auf sich warten. Ich hoffe, Du befindest Dich wohl. Das ist eine große Tröstung für mich, zu wissen, daß Du nicht mehr allein lebst.
Wenn es Dir den einen oder anderen Monat zu schwer fällt, mir Farben, Leinwand usw. zu schicken, dann schicke mir keine. Denn wisse es wohl, es ist mehr wert zu leben, als abstrakte Kunst zu malen.
Und vor allen Dingen darf das Haus nicht traurig und tot stehen, das zuerst und dann die Malerei.
Ich fühle mich versucht, mit einfachen Farben wieder anzufangen, z. B. mit den Ockers.
Ist denn ein van Goyen häßlich, weil er mit viel Öl und einer neutralen Farbe gemalt ist, oder ein Michel?
Mein Unterholz mit dem Epheu ist vollkommen beendigt. Ich habe große Lust, es Dir, so bald es trocken ist, aufgerollt zu schicken. Ich drücke Dir und Deiner Frau recht fest die Hand.
G. d. D. Vincent

32. Bauernhäuser in Auvers. Tuschzeichnung. Juli 1890.
St. Remy, September 1889
Mein lieber Bruder! ......
Ich schreibe Dir diesen Brief allmählich während der Zeit, wo ich müde bin, zu malen. Mit der Arbeit geht es ziemlich gut. Ich hoffe auf ein Bild, das ich einige Tage vor meinem Unfall begann – ein Mäher. Die Studie ist ganz furchtbar dick aufgetragen, aber das Motiv war schön und einfach. Ich sah in diesem Mäher eine vage Figur, wie ein Teufel, der in der Gluthitze kämpft, um mit seiner Arbeit zu Ende zu kommen. Ich sehe darin das Bild des Todes in dem Sinn, daß die Menschheit das Korn ist, das man mäht. Das ist also, wenn Du willst, das Gegenteil des Säers, den ich früher versuchte. Aber in diesem Tode liegt nichts Trauriges, es geschieht im vollen Licht, mit einer Sonne, die alles mit Licht und überreichem Gold überstrahlt.
Da stehe ich nun wieder. Ich will trotz allem nicht ermatten, und auf jeder neuen Leinwand suche ich Neues. Ach, ich möchte glauben, ich habe eine neue Zeit voller Helle vor mir. Was soll man tun, soll ich hier bleiben oder anderswohin ziehen? Ich weiß es nicht. Wenn die Krisen sich einstellen, sind sie nicht angenehm, und es ist schwer, einen Anfall wie diesen bei Dir oder anderen zu riskieren. Mein lieber Bruder, ich schreibe Dir immer während der Arbeit, ich pflüge wirklich wie ein Besessener. Ich habe eine stumme Arbeitswut in mir, mehr als je.
Ich glaube, das trägt zu meiner Genesung bei. Vielleicht widerfährt mir die Sache von der Eugène Delacroix spricht: »Ich fand die Malerei, als ich keine Zähne mehr hatte und aus dem letzten Loch pfiff.« Ich möchte, daß meine elende Kraft mich mit stummer Wut arbeiten läßt, sehr langsam, aber vom Morgen bis zum Abend, ohne aufzuhören; darin steckt wahrscheinlich das Geheimnis, im langen, langsamen Arbeiten. Was weiß ich. Aber ich glaube, ich arbeite an einem oder zwei Bildern, die nicht zu schlecht sind: Der Mäher im gelben Korn, und das Porträt auf hellem Grund, das wird etwas für die Zwanziger; vorausgesetzt, sie erinnern sich meiner im gegebenen Moment; vergessen sie mich, so ist mir das durchaus gleichgültig, wenn ich es nicht sogar vorziehe.
Ich vergesse nicht die Eingebung, die mir gewisse Belgier, wenn ich mich an sie erinnere, verschaffen. Das ist das Positive, und der Rest ist nicht von Belang.
Jetzt haben wir September, bald werden wir den vollen Herbst haben und dann den Winter. Ich will fortfahren hart zu arbeiten und dann sehen, ob gegen Weihnachten die Krise wieder kommt. Ist das vorüber, dann sehe ich kein Hindernis mehr, nach Paris zu kommen, der ganzen Spitalverwaltung zum Trotz, und länger oder kürzer nach dem Norden zurückzukehren. Jetzt wäre es wohl zu unklug, zumal ich eine neue Krisis in dem Winter, d. h. in drei Monaten, für wahrscheinlich halte. Es sind jetzt drei Wochen her, daß ich keinen Schritt vor die Tür setzte, selbst nicht in den Garten; ich werde es nächste Woche, wenn ich die Bilder, an denen ich arbeite, beendet habe, versuchen.
Aber noch einige Monate und ich verblöde und versimple dermaßen, daß mir ein Wechsel wahrscheinlich recht gut tun wird; das stelle ich mir so beiläufig vor, das ist keine feste Idee, wohlverstanden.
Aber ich meine, man darf sich mit den Leuten von dieser Bude nicht mehr einlassen als mit Hotelbesitzern; man mietet bei ihnen auf bestimmte Zeit ein Zimmer, sie lassen sich gut dafür bezahlen und damit Schluß.
Ohne dabei zu bedenken, daß sie sich vielleicht nichts Besseres wünschen als einen chronischen Kranken; man wäre darum hirnverbrannt, wenn man dem nachgeben würde. Sie erkundigen sich nach meinem Geschmack viel zu sehr danach, nicht nur was ich, sondern was Du verdienst usw. Da muß man denn dies und das markieren, ohne Lärm zu schlagen. Zwischendurch fahre ich mit diesem Brief fort. Gestern begann ich das Porträt eines Oberwärters, und vielleicht werde ich auch seine Frau machen; er ist nämlich verheiratet und wohnt in einem kleinen Haus ein paar Schritte von der Anstalt entfernt. Ein sehr interessanter Kopf ......
G. d. D. Vincent
St. Remy, 1. Februar 1890
Mein lieber Theo! Heute erhielt ich die gute Nachricht, daß Du Vater bist. Endlich ist der entscheidende Augenblick für Jo vorüber, da der Kleine gut angekommen ist; das macht mir so viel Freude, daß ich es gar nicht in Worten ausdrücken kann. Bravo, und wie wird die Mutter zufrieden sein? Gestern bekam ich auch von ihr einen ziemlich langen und frohen Brief. Da ist es nun gekommen, was ich seit langer Zeit wünschte. Ich brauche es nicht zu sagen, wie oft ich in diesen Tagen an Euch dachte, und es rührt mich tief, daß Jo die Nacht vorher noch die Güte hatte, an mich zu schreiben. Wie ist sie tapfer und ruhig in ihrer Gefahr, das rührte mich tief, das trug viel dazu bei, mich die letzten Tage vergessen zu lassen, als ich kränker war. Ich weiß dann nicht mehr, wo ich bin, und mit meinem Kopf ist es zu Ende.
Ich war außerordentlich erstaunt wegen des Artikels über meine Gemälde, den Du mir schicktest. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich unaufhörlich daran denken will, daß ich nicht so male wie er schreibt, sondern, daß ich eher so malen müßte. Der Artikel ist gerade in dem Sinne richtig, daß er versuchte, eine Lücke auszufüllen; ich glaube, der Verfasser schreibt nicht nur, um mich zu führen, sondern in gleicher Weise auch die anderen Impressionisten, und um an einer gut gewählten Stelle eine Bresche zu schlagen.
Er zeigt den anderen ein idealisiertes Gesamtbild von mir, und mir sagte er ganz einfach, hier und dort gäbe es gute Dinge, auch in meinem so unvollkommenen Werk, und das ist die tröstliche Seite, die ich schätze, und wofür ich dankbar bin. Immerhin muß man wissen, daß mein Rücken nicht mehr stark genug ist, um eine solche Sache zu vollbringen. Wenn ich den Aufsatz auf mich beziehen soll, muß ich Dir sagen, daß ich das Lob übertrieben finde; ebenso auch den Aufsatz von Isaacson, in dem er dessentwegen sagte, daß die Künstler jetzt aufhörten zu disputieren und an Stelle dessen eine ernsthafte Bewegung in den Buden vom Boulevard Montmartre beginne. Es ist schwer, jemandem zu sagen, er soll sich anders ausdrücken, malt man doch auch schon nicht so, wie man es sieht, also, ich will damit die Kühnheit Isaacsons oder die des anderen Kritikers nicht bekritteln, aber immerhin stehen wir geradezu Modell. Schließlich ist das eine Pflicht und eine Arbeit wie jede andere.
Wenn Du oder ich zu diesem oder jenem Ruf kommen, so muß man eine gewisse Ruhe und so viel Geistesgegenwart wie möglich haben. Warum sagt er nicht mit größerem Recht, was er von meinen gelben Sonnenblumen sagt, von den prächtigen Pfingstrosen und den gelben Lilien Jeannins oder den wundervollen und vollendeten Heckenrosen von Quost. Du siehst es ebenso wie ich, daß jedes Lob seine Kehrseite hat, seinen Medaillenrücken. Aber immerhin bin ich für den Aufsatz sehr dankbar oder habe vielmehr le coeur à l'aise, wie es im Chanson der Revue heißt. ......
G. d. D. Vincent
St. Remy, 14. Mai 1890
Mein lieber Bruder! Nach der letzten Unterredung mit Herrn Peyron setzte ich durch, daß ich meinen Koffer packen konnte, den ich als Frachtgut abgeben ließ. Die 30 Kilogramm Gewicht, die man mitnehmen darf, ermöglichen es, einige Rahmen, Staffeleien, Keilrahmen usw. selbst mitzunehmen.
Ich reise so, wie Du Herrn Peyron geschrieben hast. Ich bin ziemlich ruhig, und ich glaube nicht, daß etwas Störendes eintreffen kann.
Auf jeden Fall hoffe ich, vor Montag in Paris zu sein, um Deinen freien Tag in Ruhe mit Euch zu verbringen. Ich hoffe auch, bei der ersten Gelegenheit André Bonges zu sehen.
Eben beende ich ein Bild mit rosa Rosen, die auf einem grünen Fond stehen. Ich hoffe, daß die Bilder, die ich mache, uns für die Unkosten der Reise entschädigen werden.
Als ich diesen Morgen meinen Koffer aufgab, sah ich die Felder wieder. Sie waren nach dem Regen frisch und voll Blumen. Welche Dinge hätte ich hier machen können. Gleicherweise schrieb ich nach Arles, damit sie das Bett und das Bettzeug zusammen als Frachtgut aufgeben. Ich glaube, das wird nicht mehr als 10 Francs Transportkosten verursachen. Wenn Du Herrn Peyrons Brief noch nicht beantwortet hast, dann schicke ihm eine Depesche, damit ich Freitag oder Sonnabend reisen kann, um den Sonntag mit Dir zu verbringen. Auf diese Weise verliere ich am wenigsten Zeit, da meine Arbeit für den Augenblick beendet ist.
Ich fühle mich kräftig genug, um in Paris meinen großen Wunsch zu erfüllen, eine gelbe Buchhandlung (Gasbeleuchtungseffekt) zu machen; das geht mir schon lange im Kopf herum. Du wirst sehen, den ersten Tag nach meiner Ankunft bin ich wieder an der Arbeit. Ich sage Dir, mein Kopf ist zur Arbeit ganz heiter und die Pinselstriche kommen und folgen ganz logisch aufeinander. Also spätestens am Sonntag. Ich drücke Dir die Hand. Recht Gutes für Jo.
G. d. D. Vincent
21. Mai bis 29. Juli 1890
Auvers-sur-Oise, 21. Mai 1890
Mein lieber Theo und liebe Jo! Nachdem ich Jos Bekanntschaft gemacht habe, ist es mir weiterhin schwer, an Theo allein zu schreiben, aber Jo wird mir auch erlauben, hoffe ich, französisch zu schreiben, denn nach einem zweijährigen Aufenthalt im Süden kann ich wirklich so besser schreiben, was ich zu sagen habe.
Auvers ist sehr schön, besonders die alten Strohdächer, die selten sind. Ich hoffe ernsthaft, daß, wenn ich einige Bilder mache, es uns möglich ist, die Kosten des Aufenthaltes einzubringen. Denn es ist wirklich ernst und schön, dieses weite charakteristische und malerische Land. Ich habe Herrn Dr. Gachet gesehen, er scheint mir ziemlich exzentrisch zu sein, aber seine Erfahrungen, die er als Arzt machte, halten ihn im Gleichgewicht und bekämpfen sein Nervenleiden, von dem er ebenso schwer wie ich befallen zu sein scheint.
Er hat mich in einem Gasthof verstaut, wo man 6 Francs für den Tag verlangt. Ich fand dann einen, wo ich 3,50 Francs täglich bezahle. Bis ich weitere Mitteilungen erhalte, werde ich hier bleiben. Wenn ich einige Studien gemacht habe, werde ich sehen, ob es vorteilhafter ist, zu wechseln. Jedoch erscheint es mir ungerecht, daß, wenn man wie ein Arbeiter arbeitet, auch so bezahlen will und kann, man gerade das Doppelte bezahlen muß, weil man gerade Maler ist; jetzt beginne ich mit einem Gasthof zu 3,50 Francs.
Wahrscheinlich wirst Du diese Woche Dr. Gachet sehen. Er besitzt einen sehr schönen Pissarro, ein rotes Haus im Schnee und zwei Blumenbeete von Cézanne.
Dann noch einen anderen Cézanne, ein Motiv aus dem Dorf.
Ich möchte so gern mit meinem Pinsel einen Hauptstrich tun.
Ich sage Herrn Dr. Gachet, daß ich besagten Gasthof annehmbar fände, wenn ich durch seine Vermittlung 4 Francs pro Tag bezahlte, aber bei 6 Francs wäre er 2 Francs zu teuer, das könnte ich nicht ausgeben.
Er hat gut sagen, da wäre es ruhiger, genug ist genug. Sein Haus ist voll alten Trödelkrams mit Ausnahme der genannten Impressionistenbilder. Der Eindruck, den er auf mich macht, ist nicht ungünstig. Als wir von Belgien und den alten Malern sprachen, erhellte sein von Kummer gefurchtes Gesicht ein Lächeln. Ich glaube, wir werden bestimmt Freunde sein und ich werde sein Porträt malen.
Er sagte, ich müßte tüchtig drauflos arbeiten und nicht an das, was ich hatte, denken.
Ich habe in Paris deutlich gefühlt, daß der ganze Lärm da unten nicht für mich taugt. Ich bin froh, Jo, den Kleinen und Dich gesehen zu haben. Deine jetzige Wohnung ist viel besser als die frühere. Ich wünsche Euch viel Glück und Gesundheit. Ich will Euch recht bald wiedersehen und drücke Euch herzlich die Hand.
Vincent
Auvers-sur-Oise (ohne Datum, wohl Ende Mai 1890)
Mein lieber Theo, meine liebe Jo! Schönen Dank für Deinen Brief, den ich heute morgen bekam, und die 50 Frs., die darin waren. Ich sah heute Herrn Dr. Gachet wieder. Ich will Dienstag früh bei ihm malen, dann mit ihm zusammen essen. Dann will er meine Malerei ansehen. Er scheint mir sehr vernünftig zu sein, aber er ist, ebenso wie ich in meinem Malermetier, so in seiner Medizinerei entmutigt. Ich sagte ihm, ich tauschte dennoch gern sein Handwerk gegen das meine ein. Ich glaube gern daran, daß ich zum Schluß mit ihm Freund sein werde. Er sagte mir außerdem, daß, wenn meine Melancholie oder eine andere Sache zu stark würden, so daß ich sie nicht mehr ertragen könne, er mir irgend etwas geben würde, um sie zu verhindern. Ich brauchte mich nicht zu genieren und könne offen mit ihm reden. Der Augenblick, wo ich ihn nötig habe, kann sicher kommen. Bis heute geht alles gut, das kann noch besser werden. Ich glaube immer, daß das vor allem eine Krankheit ist, die ich wegen des Südens bekam. Die Rückkehr wird genügen, um all dies zu beenden.
Oft, sehr oft denke ich an Deinen kleinen Jungen und sage mir dann, wie gern sähe ich es, er wäre groß genug, um aufs Land zu kommen. Denn das ist die beste Art, Kinder hier zu erziehen. Wie wünschte ich, Du, Jo und der Junge ruhtet Euch auf dem Lande aus, statt daß Ihr gewohnheitsmäßig nach Holland reist.
Ja, ich weiß recht gut, die Mutter will den Jungen unter allen Umständen sehen. Das ist sicher ein Grund, dahin zu gehen. Wenn sie nur verstehen könnte, daß es wirklich zum Vorteil des Kleinen wäre. Hier ist man weit genug von Paris entfernt, so daß man wirklich auf dem Land ist. Aber wie hat sich das seit Daubigny verändert, aber nicht auf eine unangenehme Art. Da stehen viele Villen, verschiedene neue bürgerliche, fröhliche Besitzungen, von der Sonne bestrahlt und mit Blumen.
Das Land ist saftig, und daß sich an dem alten Fleck neue Leute einrichten, ist nicht unangenehm. Die Luft ist recht wohlig. Ich nehme eine Ruhe à la Puvis de Chavannes wahr. Keine Fabriken, sondern reichlich sprossendes, wohlgepflegtes Grün. Willst Du mir gelegentlich sagen, welche Gemälde Fräulein Bock kaufte? Ich muß an ihren Bruder schreiben, um zu danken. Außerdem will ich den Tausch zweier meiner Studien gegen je eine von ihnen vorschlagen. Ich habe eine Zeichnung von einem alten Weinberg, aus der ich ein Bild von 30 machen will, außerdem die Studie eines rosanen Kastanienbaumes und eine mit weißen Kastanienbäumen. Aber wenn es die Umstände mir erlauben, hoffe ich, ein wenig an Figuren arbeiten zu können. Vage stehen mir Gemälde vor den Augen, und es wird noch eine Zeit dauern, bis ich sie klar sehe, aber das wird allmählich kommen. Wenn ich nicht krank gewesen wäre, hätte ich schon längst Bock und Isaacson geschrieben. Meine Koffer kamen jedoch noch nicht an. Das ist dumm. Ich telegraphierte heute morgen. Ich danke Dir im voraus für die Leinwand und das Papier. Heute und gestern regnet und stürmt es, aber solche Stimmungen wiederzusehen, hat nichts Unangenehmes. Die Betten sind noch nicht angekommen. Trotz dieser Unannehmlichkeiten bin ich glücklich, nicht mehr so weit von Euch und den Freunden entfernt zu leben. Ich hoffe, es geht mit der Gesundheit gut. Es schien mir, Du hast weniger Appetit wie früher. Die Ärzte behaupten, ein Temperament wie das unsre brauche ein tüchtiges Essen. Sei Du und vor allem Jo, darin klug, besonders da diese ihr Kind stillt. Man müßte wirklich die Rationen verdoppeln. Das wäre nicht übertrieben, wenn man Kinder hat und sie stillen muß. Ohne das ist man wie ein Zug, der auf einer geraden Strecke langsam vorwärts kommt. Man hat Zeit genug, die Lokomotive zu bremsen, wenn der Weg zu abschüssig wird. Ich drücke Euch in Gedanken die Hand.
G. d. D. Vincent
Auvers-sur-Oise, 4. Juni 1890
Mein lieber Theo! Ich wollte Dir schon seit mehreren Tagen mit einem ausgeruhten Kopf schreiben, aber die Arbeit nahm mich zu sehr in Anspruch. Heute morgen kam Dein Brief, für den ich Dir, ebenso wie für den 50-Francs-Schein, danke. Ja, ich glaube, es wäre sehr schön, wenn wir alle hier acht Tage Deiner Ferien zusammen verlebten, wenn es länger nicht möglich ist. Oft denke ich an Dich, Jo und den Kleinen und ich sehe, daß die Kinder hier im Freien frisch und gesund aufwachsen. Trotzdem ist es hier schon ziemlich schwer, sie groß zu bringen, um so schwieriger ist das mitunter in Paris in einer vierten Etage. Trotzdem muß man die Dinge nehmen, wie sie sind. Herr Gachet sagt, die Eltern müßten sich natürlich gut nähren. Er spricht von zwei Liter Bier täglich und ähnlichen Maßregeln. Sicher wirst Du gern mit ihm bekannter werden. Er rechnet darauf und spricht jedesmal, wenn ich ihn sehe, davon, daß Ihr alle kommen sollt. Er scheint mir ebenso krank und nervös zu sein wie Du und ich und ist dazu noch viel älter. Er verlor vor einigen Jahren seine Frau. Aber er ist durchaus Arzt, sein Handwerk und sein Glauben halten ihn aufrecht. Wir sind schon ganz Freunde. Zufällig kannte er Brias von Montpellier. Er denkt das gleiche über ihn wie ich, nämlich, daß er in der Geschichte der modernen Malerei wichtig sei. Ich arbeite an seinem Porträt, dem Kopf mit einer weißen Mütze, seine blonden Haare in ganz hellen Tönen; das Fleisch der Hände ist auch ganz hell; ein blauer Frack, der Hintergrund kobaltblau. Er stützt sich auf einen roten Tisch, auf dem ein gelbes Buch liegt und eine Digitalis mit purpurnen Blüten steht. Dieses Bild ist aus der gleichen Empfindung entstanden wie mein Selbstporträt, das ich vor meiner Abreise machte.
Herr Gachet ist fanatisch auf das Porträt versessen. Er will, daß ich unter allen Umständen, wenn ich es kann, eins für ihn mache, und zwar genau das, das ich jetzt mache. Er kam jetzt dahin, das letzte Arlesierinnenporträt zu verstehen, das in rosa. Er schaut sich immer, wenn er mich besucht, die Studien für die beiden Porträts an. Er billigt sie, so wie sie sind, vollkommen, ganz vollkommen.
Ich hoffe, Dir bald sein Porträt schicken zu können. Außerdem malte ich bei ihm zwei Studien, die ich ihm vergangene Woche gab, eine blühende Aloe und Zypressen; am letzten Sonntag weiße Rosen, eine Weinlaube mit einer weißen Figur. Wahrscheinlich mache ich auch das Porträt seiner Tochter, die 19 Jahre alt ist und mit der sich Jo, wie ich glaube, rasch anfreunden wird.
Dann wird es ein Fest für mich sein, Eure Porträts im Freien zu malen. Das Deine, die von Jo und dem Kleinen.
Ich fand noch nichts, das als Atelier möglich wäre. Trotzdem muß ich ein Zimmer nehmen, um die Bilder hineinzustellen, die bei Dir und Tanguy zu viel Platz wegnehmen. Außerdem muß ich vieles überarbeiten. Doch ich lebe in den Tag hinein, denn es ist hier schön. Mit der Gesundheit geht es gut. Um 9 Uhr lege ich mich schlafen, aber stehe mindestens um 5 Uhr auf. Ich hoffe, es ist nicht unangenehm, nach so langer Abwesenheit sich zu finden. Ich hoffe, das wird anhalten. Meine Hand ist viel sicherer als vor meiner Reise nach Arles. Herr Gachet sagt, er halte es für unwahrscheinlich, daß das wiederkomme und alles werde gut gehen. Aber er beklagte sich auch bitter über den Zustand der Dinge. In allen Ortschaften, in die er kam, sei das Leben so schrecklich teuer geworden. Er sagt, er staune, daß die Leute, bei denen ich wohnte, mir Essen und Wohnung für das geben, und daß ich im Verhältnis zu anderen Bekannten, die hierher kamen, Glück hatte. Wenn Ihr, Du, Jo und der Kleine kommt, könnt Ihr nichts Besseres tun als im selben Gasthof zu wohnen. Hier hält uns nichts, durchaus nichts außer Gachet, aber er wird, wie ich annehme, immer unser Freund bleiben. Ich fühle, bei ihm kann ich jedesmal ein nicht zu schlechtes Bild machen, und er wird mich immer Sonntag oder Montag zum Essen einladen.
Aber wenn es für mich nett ist, bei ihm zu malen, so ist es für mich um so peinlicher, bei ihm zu essen. Der gute Mann setzt sich wegen der Mahlzeiten zu sehr zu, läßt vier oder fünf Platten auffahren. Das ist für ihn wie für mich schrecklich; denn er hat sicher auch keinen guten Magen. Was mich zurückhält, ihm meine Meinung darüber zu sagen, ist, weil ihn das an frühere Tage erinnert, wo man noch Familienessen machte, wie wir das ja auch kennen. Aber die heutige Sitte, höchstens zwei Platten zu essen, ist sicher ein Fortschritt, etwa eine Rückkehr zu der uns fernen alten Zeit. Der Vater Gachet ist vom selben Schlag wie Du oder ich. ......
...... Du wirst sehen, wie sein Haus wie der Laden eines Antiquitätenhändlers vollgepfropft ist, nicht immer mit interessanten Dingen. Aber das hat sein Gutes. Man kann daraus Blumen oder Stilleben arrangieren. Dafür sind die Dinge immer gut. Ich machte die Studien für ihn, um ihm zu zeigen, daß, wenn wir auch nicht mit Geld bezahlten, wir ihn doch immer für das, was er für uns tut, entschädigen ......
...... Gachet sagte mir auch, daß, wenn ich ihm eine große Freude bereiten will, ich für ihn die Kopie nach der Pietà (von Delacroix) malen soll. Er schaute sie sich sehr lange an. Wahrscheinlich wird er mir für die Folge wegen Modellen behilflich sein. Ich fühle, er begreift uns vollkommen und wird mit Dir und mir ohne Hinterhalt arbeiten, einfach der Kunst wegen und wegen seiner Intelligenz. Vielleicht verhilft er mir auch zum Porträtmalen, denn um dafür Kunden zu bekommen, muß man die verschiedenartigsten zeigen können. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, etwas unterzubringen. Trotzdem werden gewisse Bilder eines schönen Tages ihre Liebhaber finden. Nur finde ich, daß der Lärm, den die großen Preise machten, die in letzter Zeit die Millets erreichten, die Sache noch verschlimmert hat. Jetzt kann man noch von Glück sagen, wenn man seine Malunkosten herausschlägt. Darüber kann es einem schwindelig werden. Und wir sollen noch daran glauben, daß das einmal aufhört. Da ist es vielleicht besser, Freunde zu suchen und in den Tag hineinzuleben.
Ich hoffe, mit dem Kleinen geht es immer gut und mit Euch beiden ebenfalls. Auf Wiedersehen auf bald. Ich drücke Euch fest die Hand.
Vincent
Auvers-sur-Oise, 24. Juni 1890
Mein lieber Theo! Schönen Dank für Deinen Brief und den 50-Frs.-Schein, den er enthielt. Der Tausch mit Bock ist sehr gut, ich bin neugierig, zu sehen, was er jetzt macht.
Hoffentlich geht es mit der Gesundheit Jos besser, da Du sagtest, daß sie unwohl war. Vor allem sollte sie so bald wie möglich hierher in die schöne Natur kommen und ich verlange Euch alle wiederzusehen.
Ich lege den Brief von Peyron bei, den ich vor zwei Tagen bekam. Ich sagte ihm, es scheint mir genügend, dem Diener 10 Frs. zu geben.
Jetzt sind die Bilder von unten angekommen. Die Iris sind gut getrocknet und ich glaube, Du wirst etwas daran finden. Dann gibt es noch Rosen, ein Weizenfeld, ein kleines Bild mit Bergen und zuletzt eine Zypresse mit einem Stern.
Ich machte diese Woche das Porträt eines jungen Mädchens von 16 Jahren, ungefähr blau gegen blau. Das ist die Tochter der Leute, bei denen ich wohne. Ich gab ihr das Porträt, aber ich möchte eine andere Fassung für Dich machen, ein Bild zu 15.
Dann habe ich noch ein langes Bild, 1 m hoch zu 50 cm, ein Weizenfeld und sein Gegenstück Gehölz mit lilanen Pappelstämmen darunter, eine blühende Wiese, rosa, gelb, weiß und verschiedene grüne Töne.
Schließlich eine Abendstimmung, zwei ganz schwarze Birnbäume gegen einen gelblichen Himmel, Weizenfelder mit violettem Hintergrund, ein im dunklen Grün verborgenes Schloß.
Der Holländer arbeitet sehr eifrig, aber er bildet sich Beträchtliches über die Originalität seines Handelns ein. Er macht Studien, Bilder, wie Koning sie machte, ein wenig grau, ein wenig grün, ein rotes Dach, eine weiße Straße. Was kann man zu einem solchen Falle sagen. Hat er Geld, tut er recht daran, zu malen. Aber wenn er sich anstrengen muß, zu verkaufen, tut er mir leid, daß er Malerei macht, die dann andere für einen verhältnismäßig zu hohen Preis kaufen. Immerhin würde er durchkommen, wenn er alle Tage regelmäßig arbeitete. Aber allein oder bei Malern, die wenig arbeiten, wird er nichts Bedeutendes machen.
Ich hoffe, nächste Woche das Bild von Mlle. Gachet zu malen und vielleicht finde ich auch ein Landmädchen, das mir Modell steht. Ich bin über den Austausch mit Bock froh, zumal ich fand, daß sie als Freunde das andere Bild ziemlich teuer bezahlten.
Ich möchte gerne später auf ein paar Tage nach Paris kommen, um einmal zu Quost zu gehen, zu Jeannin und zu ein paar andern. Ich sähe gern, wenn Du einen Quost hättest, man könnte wohl einen eintauschen. Gachet will sich heute die Provencebilder ansehen.
Viel Gutes für den Kleinen, ich drücke Dir und Jo die Hand.
Vincent
Auvers-sur-Oise, 30. Juni 1890
Mein lieber Theo und Jo! Bekomme eben den Brief, in dem Du sagtest, das Kind sei krank. Ich möchte gerne zu Euch kommen, aber der Gedanke, daß ich noch unfähiger, machtloser in diesem traurigen Falle wäre, wie Ihr selbst, hält mich zurück. Aber ich weiß, wie kummervoll so etwas ist, und ich möchte Euch gern helfen. Wenn ich so unerwartet ankäme, würde ich die Verwirrung noch vergrößern. Ich teile von ganzem Herzen all Eure Sorgen. Es ist schade, daß das Haus von Dr. Gachet mit allen möglichen Sachen vollgepfropft ist, wenn das nicht wäre, könntet Ihr gut herkommen und bei ihm mit dem Kleinen wohnen, wenigstens auf einige Monate; ich glaube, die Landluft dürfte ihm sehr wohl tun.
Man sieht hier auf der Straße Kinder von Paris, die krank ankamen, und denen es jetzt gut geht.
Ihr könntet allerdings auch hier im Gasthof wohnen. Damit Du nicht alleine bist, könnte ich einige Wochen zu Dir kommen, das vergrößert die Ausgaben nicht. Ich beginne wirklich zu fürchten, man müsse den Kleinen etwas an die Luft lassen. Vor allem sieht er dann noch andere Kinder. Auch für Jo, die unsere Sorgen in allen Fällen teilt, glaube ich, wäre es gut, sie zerstreute sich von Zeit zu Zeit auf dem Lande.
Bekomme von Gauguin ziemlich melancholische Briefe. Er spricht vage davon, er sei fest für Madagaskar entschlossen, aber so vage, daß man sieht, er denkt nur daran, weil er an nichts anderes denken kann. Die Ausführung dieses Planes erscheint mir geradezu ungeheuerlich.
Hier drei Zeichnungen. Die eine stellt eine Bäuerin dar; ein großer gelber Hut mit himmelblauen Schleifen, ein ganz rotes Gesicht, ein blaues, grobes Mieder mit orange Punkten, der Hintergrund ährengelb.
Das ist ein Bild zu 30. Aber ich glaube, es ist ein wenig grob. Dann die längliche Landschaft mit den Feldern, ihre Farben sind zartgrün und gelb und blaugrün.
Dann ein Gehölz mit violetten Pappelstämmen, die wie Säulen die Landschaft durchziehen. Das Gehölz ist sehr tiefblau, und unter den grünen Stämmen liegt die beblumte Wiese, weiß, rosa, gelb-grün, hohe rotgelbe Gräser und Blumen. Die Wirte waren früher in Paris, dort waren sie immer krank und leidend, auch die Kinder. Hier war das nie der Fall, und vor allen Dingen nicht mit dem Kleinen, der mit zwei Monaten aufs Land kam. In Paris war es der Mutter schwer, ihn zu stillen, hier ging alles gut. Andererseits arbeitest Du den ganzen Tag und schläfst wahrscheinlich nicht. Ich glaube bestimmt, Jo hätte zweimal so viel Milch, wenn sie hierher käme und man könnte dann die Kuh- oder Eselsmilch entbehren, außerdem hätte Jo tagsüber Gesellschaft, sie könnte gegenüber von Dr. Gachet wohnen; Du erinnerst Dich, es steht gerade am Abhang ein Gasthof.
Was soll ich über die Zukunft sagen, vielleicht mit oder ohne die Boussod.
Es wird eben schwer sein, wie es eben sein wird. Du hast für sie mit allen Kräften gearbeitet und mit beispielloser Treue die ganze Zeit für sie geschafft.
Ich versuche, so gut zu handeln, wie ich kann, aber verhehle Dir nicht, daß ich nicht für immer mit der nötigen Gesundheit rechnen darf.
Aber wenn mein Übel wieder käme, entschuldige mich, ich liebe immer noch mit heißem Herzen das Leben und die Kunst, aber ich glaube nicht daran, daß ich je eine Frau haben kann. Ich fürchte eher, daß gegen die, sagen wir Vierzig – – doch sagen wir lieber nichts. Ich erkläre, daß ich absolut nicht weiß, welche Wendung dies noch nehmen kann.
Ich will Dir noch schreiben, daß man sich wegen des Kleinen nicht übermäßig beunruhigen braucht, da er zahnt. Man kann ihm dies erleichtern, wenn man ihn mehr zerstreut. Hier hat er Kinder, Tiere, Blumen und gute Luft.
Ich drücke Dir und Jo in Gedanken die Hand und küsse den Kleinen.
Auvers-sur-Oise, 27. Juli 1890
Mein lieber Bruder! Dank für Deinen lieben Brief und den 50-Frs.-Schein, den er enthielt.
Da es gut geht, was die Hauptsache ist, warum sollte ich, bei Gott, auf Dingen von geringer Wichtigkeit bestehen. Und wir sind noch weit entfernt davon, bis wir sie mit ausgeruhtem Kopf besprechen können. Die anderen Maler halten sich, was sie auch davon denken, instinktiv von Besprechungen über den heutigen Handel fern.
Wirklich, wir können nur unsere Bilder sprechen lassen.
Aber trotzdem, mein lieber Bruder, das sage ich Dir immer, und ich sage es noch einmal mit der ganzen Schwere, die eine hartnäckige Gedankenarbeit eingehen kann, ich sage es Dir noch einmal, ich sehe Dich immer für etwas anderes an, als für einen einfachen Kunsthändler. Durch mich hast Du selbst an dem Zustandekommen gewisser Bilder teilgenommen, die sogar in der Verwirrung bestehen bleiben.
Denn da sind wir wieder, und das ist alles oder zum wenigsten die Hauptsache, die ich Dir im Augenblick einer ziemlichen Krise sagen kann. In einem Augenblick, wo die Dinge zwischen den Händlern mit Bildern toter Künstler und denen lebender Künstler etwas gespannt sind. Nun, meine Arbeit gehört Dir. Ich setze dafür mein Leben ein, und meine Vernunft ging dabei zur Hälfte drauf. Gut, aber Du gehörst nicht zu den Menschenhändlern, das weiß ich, und Du kannst, wie ich finde, Stellung nehmen, da Du wirklich mit Menschlichkeit handelst, aber was willst Du –
(Unvollendeter Brief. Vincent starb zwei Tage später, Theo am 25. Januar 1891.)
Die Auswahl der Briefe ist mit freundlicher Genehmigung des Verlages der bei Paul Cassirer-Berlin erschienenen dreibändigen Ausgabe entnommen.
Georg Biermann,
geb. 7. 7. 1880 in Köln, gest. 3. 4. 1949 in München. Universitäten Marburg, Berlin und Rostock (Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte). Dr. phil. Von Herbst 1901 bis 1904 Studienaufenthalt in Italien (Bücher über Florenz 1903 und Verona 1904). 1905–1907 Schriftleiter im Verlag E. A. Seemann, Leipzig. 1907 Mitbegründer des Verlags Klinkhardt & Biermann, Leipzig-Berlin; Begründer und Herausgeber der »Monatshefte für Kunstwissenschaft«, des »Cicerone, Halbmonatsschrift für Sammler und Kunstfreunde«, der »Stätten der Kultur«; nach 1918 Herausgeber der Sammlung »Junge Kunst« und des »Jahrbuches für junge Kunst«. – 1912 Berufung als künstlerischer Beirat des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein nach Darmstadt, gleichzeitig Ernennung zum Professor. Organisator der Jahrhundertausstellung Deutscher Kunst 1650 bis 1800. 1919 – 20 Präsident der Kestner-Gesellschaft in Hannover. Mehrjähriger Aufenthalt am Tegernsee. Von 1927–40 in Berlin, dann in München, ab 1946 Leiter des Kunstverlages im Verlag Kurt Desch, München, gestorben im April 1949.1935 Mitbegründer des Sammelwerkes »Deutsche Kunst«. – Zwischen 1905 und 1933 zahlreiche Studienreisen in Europa. Bis 1933 ständiger Mitarbeiter der großen Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland und auch im Ausland. Wesentliche Veröffentlichungen außer den obengenannten: Heinrich von Zügel 1911. Lovis Corinth 1912. Bernhard Hoetger 1913. Deutsches Barock und Rokoko 1915. Die Miniaturen-Sammlung des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen 1917. Aus der Sammlung »Junge Kunst«: Max Pechstein, Paula Becker-Modersohn, Heinrich Campendonk, Othone Coubine,
Oskar Kokoschka.
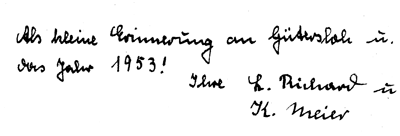
Widmung