
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
![]()
 ie Diemel entspringt im Fürstenthum Waldeck und strömt von dort in nördlicher Richtung den Bergen Westphalens zu. Der erste hier von ihr berührte Punkt, bei dem wir zu verweilen haben, ist Stadtberge oder Marsberg, der Doppelort mit doppeltem Namen – denn das hoch und freundlich gelegene Städtchen theilt sich in zwei getrennte Orte, Ober- und Nieder-Marsberg.
ie Diemel entspringt im Fürstenthum Waldeck und strömt von dort in nördlicher Richtung den Bergen Westphalens zu. Der erste hier von ihr berührte Punkt, bei dem wir zu verweilen haben, ist Stadtberge oder Marsberg, der Doppelort mit doppeltem Namen – denn das hoch und freundlich gelegene Städtchen theilt sich in zwei getrennte Orte, Ober- und Nieder-Marsberg.
Stadtberge, die 772 von den Franken erstürmte Eresburg, ist der Ort, der stets in Verbindung mit der Irmensäule genannt wird, weil von hieraus Kaiser Karl seinen Zerstörungszug gegen das Heiligthum richtete. Von diesem wird später die Rede sein, hier möge nur Raum finden, wie Tradition und Volksphantasie späterer Jahrhunderte es sich ausgemalt haben: – das sind die Quellen der Schriftsteller, auf deren Autorität hin die ungedruckte Originalhandschrift von Paullini's Geschichte von Corvei also von der Irmensäule redet: »Irmensaül ist eine dem Irmo oder Irmino dienende Saüle, worauf sein Bildniß gestanden hat. Andre machen aus Irmensul einen Saahl oder Kirche, darin man diesen Götzen verehrte; dieser Tempel ist gewesen bei Eresberg, welches nach Etlicher Meynung so viel sein soll als Ehrenberg oder Heresberg, von Hera, die Griechen sagen Ὴῤα, ist bei den Lateinern die Abgöttin Juno, da weiland die Sachsen die Hera geehrt und der Wahn beim gemeinen Pöbel gewesen, als ob diese ertichtete Göttin zwischen Weynachten und heil. drei Königen Fest in der Lufft herumflöge, masen, nach der Poeten Wahnwitz, Juno eine Regentin der Lufft seyn soll: – In diesem Mers- oder Eresberg nu in Westfahlen war ein schöner großer ansehnlicher und weit berufener Götzentempel, darin das blinde Volk die Irmensaül verehrte. Dies Götzenbild war in Gestalt eines gewaffneten Manns, der stund unter dem blauen Himmel im grünen Feld in den Blumen bis an den Leib, mit einem schwerd umgürtet. In der rechten Hand hielt er ein Pannier, darin eine rothe Rose oder Feldblume war, in der linken eine Wage. Auf seinem Helm stund ein Wetterhahn, auf dem Schild ein Leue und auf der Brust ein Bähr. (So ist die Gestalt in Holzschnitt abgebildet in den annales Circuli Westphalici Stangefol's.) Was nun zu Eresberg eigentlich für eine Religion und was für Ceremonien dazumal üblich gewesen, können wir wegen der faulen Trägheit der damahligen Scribenten nicht gründlich erwähnen. Dieß ist gewiß, daß viele Priester, sowohl Männ- als Weiber diesem Tempel gedient haben. Die Weiber zwar waren nur mit den weissagungen geschäfftig, die Männer aber Warteten der opffer und des übrigen Götzendienstes. Die Priester nahmen allezeit diese Irmensaül mit in den Krieg, und nach gehaltenem Treffen schlugen und strafften sie die Gefangene oder die sonst etwa nicht frisch gefochten hatten, nach Verdienst. Es war der Gebrauch, daß die Priesterinnen den Gefangenen im Lager mit blosen Degen entgegen lieffen, solche bey einen ehernen Rost schleppten, in die Höhe huben, die Gurgel entzwey brachen und hernach aus dem Blut ihre weissagungen nahmen. Das erhellet auch aus einem altsächsischen Lied, darin ein Sächsischer Printz sehr wehmüthig klagt, daß er wegen eines unglückseligen treffens dem Priester zum Schlacht Opffer worden:
Schol ich nun in Godes fronen Hende
in meinen allerbesten tagen
Geben werden, und sterben so elende,
das müß ich wol hochlich klagen.
Wenn mir das glücke füget hätte
des Streites einen guten Ende,
Dorfft ich nit leisten diese Wette,
netzen mit Blut die hire (heil'gen) Wände.
In dem Tempel zu Eresburg sind überaus viele Köst- ja unschätzbare Kleinodien, Kronen, Schilt, Fahnen u. d. m. von lauter Gold und silber funden worden: alles dies bekam Karl zur Beute; das Bildniß selbst, so auf der zierlichen Säule stund, hat er Vermaledeyet, zu Boden geschmissen und zermalmet. Also ist der prächtge Tempel samt dem Bild gänzlich zerschleifft und zerstört worden, worüber man drey tage zugebracht.« – Die weitere Erzählung Paullini's mitzutheilen, wie Karl die Irmensäule nach Corvei habe führen lassen, wo man sie wieder gefunden und die Inschrift daran gelesen »Vorzeiten bin ich der Sachsen Herzog und ihr Gott gewesen, mich hat das Volk Martis angebetet« – wie sie sodann nach Hildesheim gebracht mit großer Fährlichkeit wegen auflauernder Heiden – wie man am Samstag vor Laetare jährlich dort symbolisch ihren Sturz sich erneuen lasse u. s. w., verbietet trotz ihres Interesses uns hier der Raum. Naiv ist vor allem Paullini's Deutung der symbolischen Attribute der Irmensäule: von der Rose in dem Panier sagt er, die Rose »sey aus dem schweiß einer Frauen, so Jona geheißen, entsprungen. Dieses Weibes Natur soll gewesen seyn, daß sie in der Frühstund weiß, im Mittag roth, gegen Abend grün geschienen hat. Nu die grüne, als eine beständige Farbe, ist das merkmahl der Ewigkeit, als ob die nacht, der Tod ihr die unsterblichkeit gebe. Wahre Ritter schämen sich unter dem hinckenden Pöbel allhier zu kriechen, deßwegen schwingen sich ihre Sinnenflügel sternen werts, um Seel und Ruhm, Leib und Geist mit dem Burger Recht der ewigen zu beschenken.« Siehe die ganze Episode in Dr. L. Troß Westphalia, 1826, Nr. 19. –
Stadtberge ist, wie erwähnt, ein sehr freundlich liegender Ort. Die Diemel schlägt einen Bogen um den Fuß des steil aus dem Fluß aufsteigenden Hügels, auf dem die Oberstadt mit der alten Stadtkirche liegt; unten, wo der Hügel nordostwärts verläuft, liegt die Unterstadt und an deren Südseite die große Heilanstalt für Irren – ursprünglich ein Kapuzinerkloster, in welchem nach der Aufhebung ein Dr. Ruhr eine Irrenanstalt anlegte, welche im Jahre 1817 von der Regierung übernommen, mit zwei Flügeln ausgebaut und der Provinz überwiesen wurde, die seitdem ein zweites großartiges Institut dieser Art für die wachsende geistige Verstörung der Zeitgenossen in Lengerich anzulegen gezwungen war.
Die verfallende altromanische Kirche in der obern Stadt, oder besser der bescheidene Holzbau, der sich vor ihr an dieser Stelle erhob, war der Schauplatz eines tragischen Ereignisses in den Tagen Kaiser Otto's I. In den Kämpfen Otto's zur Niederbeugung der Herzogsgewalt unter die königliche Macht bot Westphalen während des Jahres 938 einen wilden Tummelplatz dar. Nach Steele an der Ruhr hatte der König einen Reichstag berufen, um über Eberhard den aufrührerischen Frankenherzog Recht zu sprechen. Eberhard war nicht erschienen, er verharrte in der Empörung, er hatte einen Theil der Sachsen, ja Thankmar, Ottos Bruder sogar zu sich herübergezogen, und dieser überfiel in dunkler Nacht die Feste Beleke, worin sich sein und Ottos Halbbruder Heinrich befand. Thankmar nahm ihn gefangen und sandte ihn gebunden wie einen Knecht Eberhard zu, als bestes Pfand des Bündnisses – die Burg Beleke ließ er plündern, verheerte die Gegend und setzte sich darauf in der alten Eresburg fest. Hier aber ereilte ihn das Strafgericht. »Der König brach mit einem Heere gegen den Bruder auf und zog gegen die Eresburg. Die Bewohner öffneten ihm freiwillig die Thore, und Thankmar blieb keine andere Rettung, als in die dem heiligen Petrus geweihte Kirche des Ortes zu flüchten. Wüthend verfolgten den Flüchtigen hierhin die Leute des Königs, vor allen die Mannen Heinrichs, die ihren Herrn zu rächen gedachten. Sie erbrachen die Thür des Heiligthums; mit bewaffneter Hand – was heilige Scheu und die Gesetze der Kirche untersagten – drangen sie in das Gotteshaus. Thankmar steht am Altar, seinen Schild und die goldene Kette, das Zeichen seiner vornehmen Geburt, hatte er zu Tode erschöpft hier niedergelegt. Dennoch läßt er noch einmal in einen Kampf sich ein. Ein Sachse, Namens Thiotbold, trifft ihn und Schmähungen und Schimpfreden begleiten den glücklichen Streich: aber sofort gibt ihn Thankmar mit noch besserem Erfolg zurück, und Thiotbold haucht am Altar im scheußlichen Kampfe den Athem aus. Immer heißer entbrennt der Streit. Tapfer vertheidigt sich noch Thankmar, bis ihn ein Wurfspeer im Rücken trifft, der durch das Kirchenfenster, das dem Altar zunächst gelegen, auf ihn geschleudert war. Regungslos sinkt er endlich am Altar; ein Krieger Otto's, mit Namen Maincia, gab ihm den letzten Stoß und raubte die goldene Kette vom Altar.«
Otto hatte von Allem, was geschah, nicht gewußt, tief beklagte er das Schicksal seines unglücklichen Bruders. Doch milderte der Schmerz um ihn des Königs Strenge nicht; vier vornehme Männer, die mit Thankmar gemeinschaftliche Sache gemacht, wurden nach fränkischem Recht gerichtet und fanden durch den Strang ihren Tod. –
Der Diemel abwärts folgend, erblicken wir bald Westheim, mit gräflich Stolberg'schem Gut und Park, und erreichen dann das malerische, am linken Ufer der Diemel liegende Warburg.
Warburg, einst Wartberg genannt, war im 10. Jahrh. Hauptort einer Grafschaft, welche aus Theilen des sächsischen Hessengau's, des Nethe-, Itter- und Patergau's bestand und deren letzter Besitzer Dodico hieß, der zu den Zeiten des Bischofs Meinwerk von Paderborn lebte. Meinwerk hatte schon lange den Wunsch gehegt, dies Gebiet der Kirche zu gewinnen – was hätte Bischof Meinwerkus der Kirche nicht gewinnen wollen? – Graf Dodico war aber so wenig der Mann, der sich der Kirche willfährig zu zeigen beflissen, daß er eine Nonne entführt und mit ihr einen Sohn erzeugt hatte, der zum Erben seiner Besitzungen bestimmt war. Als aber die Zeit gekommen, wo der junge Graf wehrhaft gemacht und durch die Umgürtung mit dem Schwerte unter die Männer aufgenommen werden sollte, da starb er, von seinem Rosse abgeschleudert und zertreten, eines elendiglichen Todes. Der gebeugte Vater erkannte darin ein Strafgericht des Himmels, er trat seine Grafschaft an den Bischof ab und starb gebrochenen Herzens 1020. Kaiser Heinrich II. bestätigte das Stift Paderborn 1021 in dem Besitz der Grafschaft, und Warburg wurde von nun an eine bischöfliche Landstadt. Der alte Grafensitz in der Stadt wurde eine bischöfliche Burg und Burgmänner wurden eingesetzt, ihn zu beschützen. Dies hat die Stadt aber nicht gehindert an einer lebendigen Entwicklung ihres bürgerlichen Gemeinwesens; sie trat 1364 zum Hansabunde und erhielt männliches Selbstbewußtsein und rang ihren Beherrschern manches Privilegium und manches Freiheitsrecht ab. So wurde sie die zweite Stadt des Fürstenthums, Hauptort der Freigrafschaft Warburg, die zum Oberamt Dringenberg, oberwaldischen Districts des Fürstenthums Paderborn, gehörte.
Mit Warburg waren Brakel und Borgentreich die vornehmsten Städte des alten Hochstifts. Man nannte die Gegend dieser drei Städte den Liliengrund, wegen seiner Fruchtbarkeit, wahrscheinlicher weil die Lilie das Wappen von Warburg war.
Außerordentlich stattlich nimmt sich Warburg in des alten Merian berühmten Werke (s. Topograpia Westfaliae S. 58) aus. Im Vordergrund zeigt sich die über Wehren rauschende Diemel mit steinerner Brücke und alterthümlichem Brückenthor; Ober- und Unterstadt liegen malerisch über die Bergseite zerstreut, hohe Kirchen und viele starke Thürme steigen aus der umschließenden Ringmauer auf, Capellen mit Thürmchen krönen die den Horizont schließenden Berghöhen. Aus dem Häusergewirr, das die Stadt bildet, sieht man viele bedeutende Bauwerke sich emporheben. In der Erläuterung bemerkt der länder- und leutekundige Matthäus unter andern: »Und brawet die Statt ein herrlich gutes Bier. Es gibt auch in der Nachbarschaft herumb Bergwerk, auß welchem Eisen und Bley insonderheit gebracht wird, damit dann die Warborger einen Handel treiben.« Nachdem Merian ferner angeführt, daß die Stadt im westphälischen »Crayßverzeichnüß« unter den Reichsstädten aufgeführt sei und in der Reichsmatrikel monatlich auf drey zu Roß und dreyzehn zu Fuß angeschlagen worden – ein Verhältniß, das jedenfalls nur sehr kurze Zeit bestanden haben kann, da die Paderbornische Landeshoheit rechtlich nie aufhörte – fährt er fort: »Sie ist ziemlich schön erbawet: aber eines ungleichen Lägers. Allda zu sehen die Newstätter und Altstätter Kirch: Item die zu den schwarzen Brüdern, St. Peters Kirch, St. Johanns Kirche und andere. Hat auch eine Kirche in der Burg und vier Thore.«
Noch heute bietet die alte Doppelstadt, die Altstadt unten am Diemelufer, die Neustadt oben über die Höhe ausgebreitet einen hübschen und malerischen Anblick; aber die Gegend hat viel an Reiz verloren, seit die Höhen entwaldet sind. Und von den alten Mauerthürmen Merians sind die meisten gebrochen, von den alten Patrizierhäusern die meisten geschwunden, nur die Kirchen und das alte Dominikanerkloster zwischen Altstadt und Neustadt, jetzt der Sitz des Kreisgerichts, treten noch hervor.

Die Warburg umgürtende Feldmark ist von sehr fruchtbarer Beschaffenheit und wird, wie die von Soest und von Magdeburg, die Börde genannt, ein bis jetzt unaufgehellter Ausdruck. Diese Fruchtbarkeit der Gegend, die Lage an einem Punkte, wo die Stadt zur Vermittlerin des Verkehrs aus dem großen westfälischen Landbusen mit Hessen und Inner-Deutschland wurde – denn sie liegt just da, wo dieser Verkehr sich den Ausgang schaffen mußte, den die Natur durch einen Flußdurchbruch nicht gegeben hatte; diese Lage also, und endlich der Einwohner Betriebsamkeit machten Warburg im Mittelalter zu einem starken, blühenden und nach Unabhängigkeit strebenden Gemeinwesen. In seiner Feldmark hatte es mehrere Dörfer, die jetzt, hauptsächlich durch den dreißigjährigen Krieg vernichtet, nur noch in dem Namen einzelner Felddistricte fortleben. Der Gewerbfleiß der Bürger richtete sich besonders auf die Erzeugung von Leder, Tuch, Leinen. Ganze Straßen waren mit Wollenwebern besetzt, welche eigenes Amt, Mühlen und Lager hatten. Zwei Vorstädte bildeten sich mit eigenen Pfarrkirchen; die Johanniter kamen und gründeten eine Niederlassung in der Stadt, und wenn, wie so häufig, Fehde und Orlog ausbrach da im berg- und schluchtenreichen Grenzlande, wenn die Sturmglocke die Bürger zur Abwehr des Feindes rief, dann hoben sich vierzehn- bis fünfzehnhundert derbe Bürgerfäuste die Wehre vom Nagel und die Pickelhaube vom Pflock. Das geschah auch eines Tages, als ein neugekürter Bischof von Paderborn von ihnen als unterthänigen Leuten ohne Weiteres Huldigung verlangte. Der Bürgermeister Heinrich von Hidessen sagte dem Bischof, daß der Hahn auf dem Thurme von Warburg in vier Herren Länder schaue (eine leise Andeutung auf den Schutz, dessen die Stadt von Hessen, Waldeck, Corvei und Braunschweig sich versehen und gewärtigen könne), und sodann ließ er seine Bürger mit ihren Wehren in geordneten Rotten eisenklirrenden Schritts an des Fürsten Herberge vorüber ziehen. – Der Bischof ward kleinlaut und weigerte sich nicht mehr, der Bürgerschaft alle Privilegien zu bestätigen. Auch Bischof Balduin gab ihnen schriftlich auf schönes Pergament: Wy willet lathen use leven borgere beyder stede to Wartberg, by oll eren olden rechte un in oll ehren Ehren un oll dyse vorschrevene Stücke wille wy usen vorschrevenen borgern bettern wo wy mogen. – Darauf erst huldigten sie.
Die ursprüngliche Burg Dodico's ward, wie der alte Meibom schreibt, schon 1199 durch Kaiser Philipp den Hohenstaufen dem Erdboden gleich gemacht. Neu aufgebaut, wurde sie von Burgmännern des Fürstbischofs gehütet, später einzelnen Familien als Lehen gegeben; wir finden als solche die von Modericke und von Canstein genannt. Im dreißigjährigen Kriege trug der Hauptthurm noch Kanonen. In den ersten Jahren des siebenjährigen Krieges wohnte ein Zweig der Familie von Spiegel darin. Um diese Zeit begannen die Franzosen das Werk der Zerstörung, indem sie das darin befindliche Holz abbrachen und zu ihrer Feldbäckerei verwendeten. Später gehörte sie den Herren von Canstein und Oer, von welchen der Oer'sche Antheil an einen Herrn von Münster überging, der denselben dem 1801 zu Paderborn verstorbenen Kammerpräsidenten von Mengersen verkaufte, welcher später den verschuldeten Canstein'schen Theil dazu erstand.
Der Burg gegenüber lag früher die älteste, die Andreas-Pfarrkirche, woran der berühmte Gobelin Persona, der Verfasser des » Cosmodromium,« Pfarrer war. (1409). Diese Kirche hatte eine dem hl. Erasmus geweihte Gruftcapelle – in einer Urkunde von 1421 wird ein Rector »St. Erasme altars gelegen in der Klucht Sankte Andreas« genannt. – Als nun in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Andreas-Pfarrkirche in Ruinen lag, die Gruftcapelle ohne Dach und Fach war, ließ der Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg im Jahre 1681 eine neue Capelle über jener erbauen; dies ist die heutige Wallfahrtscapelle zum heiligen Erasmus, die jährlich am Fest der Dreieinigkeit von einer zahlreichen Procession besucht wird. Sie besteht also aus einem Ober- und Unterbau; zu der obern Capelle führt eine doppelte Freitreppe auf der Westseite empor; die untere, die Gruftcapelle, scheint der Mitte des 12. Jahrhunderts anzugehören.
Was die Geschichte der Stadt in neueren Zeiten angeht, so sind daraus die Verwüstungen des dreißigjährigen Krieges, der unter anderm auch die Stadt um ihren Ruhm als vorzügliche Obstpflegerin brachte, und des siebenjährigen Krieges zu erwähnen.
Im siebenjährigen Kriege fand unter den Mauern eine Schlacht statt. Der französische General Chevalier du Muy hatte am 29. Juli 1760 mit einem Corps von 35,000 Mann ein Lager von Ossendorf bis zum Diemelfluß aufgeschlagen und requirirte von der Stadt Warburg in ungemessener Menge das Material zum Schlagen von Brücken über die Diemel. Die alliirten Truppen hatten dagegen das hessische Städtchen Liebenau, vier Stunden von Warburg, besetzt, unter Anführung des Prinzen Ferdinand, des Erbprinzen von Braunschweig und des hannoverschen Generals Spörte; sie rückten an der Diemel entlang vor und griffen den Chevalier du Muy am 31. Juli im Rücken und in den Flanken an. Das Treffen war sehr hartnäckig, bis Lord Gramby mit der englischen Reiterei herbeikam, welche im vollen Trabe einen Weg von zwei Stunden gemacht hatte, und sich auf die Franzosen warf, die, bereits in großer Unruhe fechtend, sich jetzt durch die Flucht zu retten suchten. Ihre Reiterei stürzte sich in die Diemel, um hindurchzusetzen und rettete sich, allein die flüchtige Infanterie, die dasselbe versuchte, war nicht so glücklich und viele ertranken im Flusse. Ihr Verlust, ohne die Kanonen und Fahnen zu rechnen, war 5000 Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen. Die Verbündeten zählten 1200 Todte und Verwundete. Uebel aber sollte der Sieg deutscher Waffen der benachbarten deutschen Stadt bekommen; der brutale Engländer belohnte den Heldenmuth seiner Cavallerie, indem er ihr Warburg zu dreistündiger Plünderung überließ.
Unter den älteren Gebäuden der Stadt ist der Mönchehof auf der Neustadt bemerkenswerth. Er gehörte der Abtei Hardehausen; über dem Eingange lies't man:
» J. Jacob Luchtgenbach abbas Hardehaus. Ao. 1605.«
Dies ist der unglückliche Abt Jacob, der in Warburg sein trauriges Grab fand.
Der damalige Landgraf von Hessen hatte die Abtei Hardehausen schon mehrmals ersucht, ihm die sogenannte Mönchsstraße in Cassel, welche dem Kloster gehörte, für einen bestimmten Kaufschilling, den der Landgraf festsetzte, zu verkaufen. Die Mönche willigten in den Verkauf nicht ein; der Landgraf bot nun endlich nur die Halbscheid dafür, mit dem Bedrohen, daß sie, wenn sie nicht damit zufrieden wären – nichts dafür haben sollten. Nun reiste der Abt Luchtgenbach mit seinem Secretair nach Cassel, um selbst diese Hälfte des zuerst gebotenen Preises in Empfang zu nehmen. Der Abt zieht damit heim – aber hessische Husaren sind schon aufgestellt, ihn unterwegs anzuhalten, um ihm das Geld wieder abzunehmen. Indeß hatte sich zum Glück der Kutscher verirrt und brachte durch einen Umweg seinen Herrn endlich wohlbehalten auf den Mönchehof nach Warburg. Hier versteckte Luchtgenbach, wie die Tradition sagt, die ganze Summe, um sie zu bewahren, in eine alte Mauer, ohne irgend Jemanden etwas davon zu sagen. Nun aber traf den Abt das Schicksal, daß ihm, als er aus der Neustädter Kirche kam, ein Stein vom Thurme auf den Kopf fiel, der ihn gleich sprachlos zur Erde niederstreckte. Kurz darauf verschied er, am 21. Februar 1635. Das versteckte Geld wurde nun hin und her gesucht, und war nicht zu finden; bei jeder baulichen Verbesserung, die auf dem Hofe vorgenommen wurde, war von nun an ein Klostergeistlicher zugegen, damit, wenn sich das Geld finden sollte, die Arbeitsleute damit nicht durchgehen könnten.
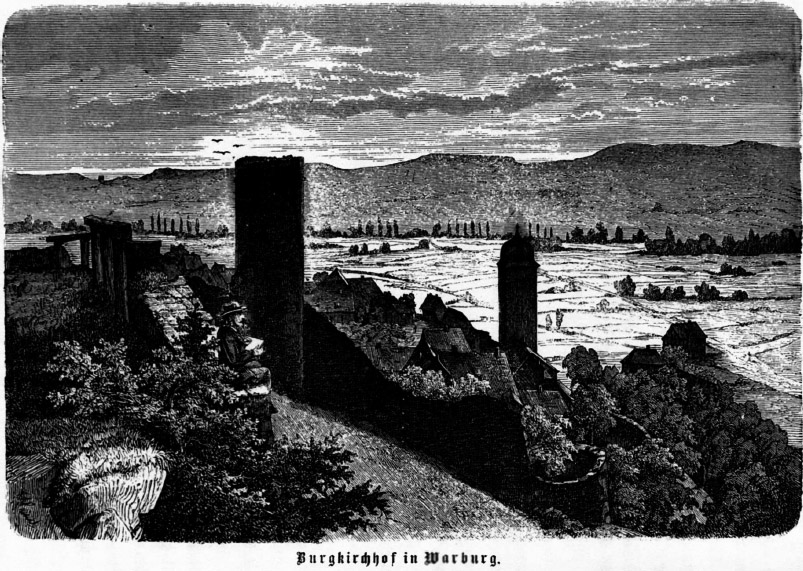
Im Jahre 1693 erlitt der Hof einen Neubau, und im Jahre 1728 ließ der Abt Lorenz Kremper das Gebäude beinahe um den dritten Theil weiter ausbauen. Damals oder nach anderen bei der früheren Reparatur vom Jahre 1693 soll nun ein Mauermeister bei Abbrechung einer Mauer das Geld bemerkt und die Arbeit so eingerichtet haben, daß man an dem Tage nicht mehr an diese Stelle zurückkam – aber des Nachts kehrt der Meister zurück, hebt den Schatz, entweicht damit und hat bis auf den heutigen Tag nichts von sich hören lassen.
Das Rathhaus steht am Eingange der Neu- in die Altstadt. Von einer Seite ruht es auf der Mauer, welche die Altstadt von der Neustadt scheidet, und nach der andern Seite, nach der Altstadt hin, auf Bogen und Pfeilern, worunter der Weg zur Altstadt hinführt. – Es wurde im Jahre 1568 der Bau angefangen und 1570 beendigt.
Unter den Kirchen ist die St. Johanniskirche zu erwähnen. Das Langhaus mit den zwei schmalen Seitenschiffen und dem Kreuzschiff zeigt romanische Ornamentik, die Fenster aber die Formen der Uebergangszeit; der später angebaute schöne lange Chor ist gothisch; der letztere ist mit sehr gut gearbeiteten Statuen des Heilands und der Apostel geschmückt, die an den Wandsäulen unter Baldachinen von zierlichster gothischer Architektur stehen; sie scheinen der Mitte des 15. Jahrhunderts anzugehören. Daß die Bürger Warburgs stolz waren auf dies Bauwerk, zeigt die an der Nordseite des Chors angebrachte Inschrift: » Anno dom. MCCCLXVI feria tertia ante penthecostes h. gloriosum opus inchoatum est in honorem S. Johannis Baptiste. Amen.« Einen Schmuck von großer Schönheit besitzt die Kirche in dem vortrefflichen Bildhauerwerk aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, welches Christus mit den schlafenden Jüngern in Gethsemane darstellt und, leider vor Wetter und Zerstörung nicht geschützt und sehr verwüstet, außen am Thore im Freien aufgestellt ist. In dem weichen anmuthigen Styl dieses schönen Sculpturwerkes erkennt Lübke, der gründliche Erforscher westphälischer Kunst im Mittelalter, den Einfluß der Kölnischen Malerschulen, die den strengen statuarischen Styl unserer ältesten Skulpturwerke im 15. Jahrhundert zu mildern begannen.
Werfen wir einen Blick auf die Umgebung von Warburg. Eine Strecke oberhalb der Stadt mündet die kleine Twiste in die Diemel, von Südwesten kommend. Das Bachthal, obwohl am rechten Ufer der Diemel liegend, gehört noch zu Westphalen, und ein Spaziergang das hübsche Thal hinauf ist nicht unbelohnend. Zuerst erreichen wir Wormeln, ein Dörflein mit einem Rittergut, das einst ein Hof des Grafen Dodico war. Später waren die Grafen von Everstein damit belehnt, die hier in der Mitte des 13. Jahrhunderts ein Kloster der »Jungfrauen des grauen Ordens,« Cisterzienserinnen oder Bernardinessen stifteten. Die Klosterkirche ist beachtenswerth, gothischen Styls, aus der Mitte des 14. Jahrhunderts herrührend. Das Dörflein Wormeln war am Ende des vorigen Jahrhunderts Schauplatz einer kleinen Revolte. Die Gemeinde hatte einen Proceß um den Zehnten wider ihre grauen Jungfrauen verloren und da die Revolution damals – es war 1797 – in der Luft lag und über dem ganzen Lande brütete, ohne doch anderswo als in Wormeln zum Ausbruch zu kommen, so erhoben sich die Bauern gegen die Militair-Execution, welche ihre Jungfrauen nachgesucht hatten. Es ging ziemlich blutig dabei her – drei Bauern blieben todt auf dem Platze, aber die Insurgenten siegten und schlugen die Paderborner Truppen in die Flucht. Die Folge war für die Gemeinde eine sehr schlimme. Der Fürstbischof lieh sich 700 Mann Executionstruppen, welche Hessen freundnachbarlichst hergab, und die sich drei Wochen lang auf Kosten der Gemeinden Wormeln und Welda gütlich thaten.
Eine Stunde von Warburg in nordöstlicher Richtung liegt das Dorf Daseburg, an dem Fuße des merkwürdigen Desenbergs.
Der Desenberg ist eine hoch aufragende freistehende Höhe von konischer Gestalt, gekrönt von verwitternden Ruinen, aus denen man eine außerordentlich weite Aussicht genießt. Der in der Umgebung gefundene Basaltstein deutet auf vulkanischen Ursprung. Die Burg ist uralt. Schon 776 geschieht ihrer Erwähnung, sie hatte damals eine fränkische Besatzung und wurde von den Sachsen vergebens belagert. Später befand sie sich im Besitze des Grafen Dodico und kam nach dessen kinderlosem Tode durch die Schenkung Kaisers Heinrich II. an das Stift Paderborn – mit Warburg und Dodico's Grafschaft, wie wir oben sahen. Kaiser Conrad widerrief die Schenkung, nahm die Burg und die ganze Grafschaft wieder an sich und belehnte damit den Erzbischof Aribo von Mainz, welch Letzterer den Grafen Bernard von Nordheim damit unterbelehnte. Bernard, oder Benno, wie er gleichbedeutend genannt wird, übertrug den Desenberg seinem Anverwandten Bruno, der darauf Hof hielt und 1046 den neuerwählten Abt Rothard von Corvei empfing, und, als er im Zweikampfe umkam, in seinem Bruder Eckbert einen Nachfolger in der Verwaltung des Desenberg fand. Da unterdessen Erzbischof Aribo von Mainz gestorben war, machte der Bischof von Paderborn sein Recht auf die Grafschaft des Dodico, oder wie sie jetzt heißt, des Bernard, so wirksam geltend, daß Kaiser Conrad dasselbe nicht allein anerkannte, sondern sogar eingestand, nur durch falsche Vorspiegelungen des Mainzer Erzbischofs und Regierungs-Unerfahrenheit zu einer Verletzung dieses Rechts veranlaßt zu sein. Dies geschah 1033 und bezog sich nur auf die Grafenrechte, nicht auf die herzogliche Gewalt, welche Bernard (Benno) vertrat. Letzterem folgte sein Sohn Otto; dieser, der zugleich (1061) Herzog von Bayern wurde, trat in Bündniß mit den Sachsen gegen Kaiser Heinrich IV. und wurde deshalb 1070 auf dem Fürstentage zu Goslar seiner Güter und seines Lebens verlustig erklärt. Der Kaiser nahm und zerstörte ihm das Schloß Hanstein an der Werra, das Schloß Desenberg ergab sich freiwillig dem Heere des Kaisers. 1074 erfolgte der Frieden, der Otto in seine sämmtlichen Besitzungen wieder einsetzte. Von seinen Söhnen erbte Heinrich, Markgraf der Friesen, die eine Hälfte des Desenberg.
Als Heinrich 1102 von den Friesen erschlagen worden war, nahm seine Wittwe Gertrud († 1117) ihren Wittwensitz auf demselben. Ihre Tochter Richenza brachte die Hälfte ihrem Eheherrn, dem Herzoge Lothar von Sachsen, dem späteren Kaiser zu. Von Lothar kam die halbe Burg durch dessen Tochter Gertrud auf deren Eheherrn Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, dem dessen Sohn Heinrich der Löwe im Besitze folgte.
Die zweite Hälfte war unterdeß von Siegfried, dem zweiten Sohne Otto's von Nordheim, dem sie zuerst zugefallen, an Graf Herrmann von Winzenburg gekommen. Dieser wurde 1152 mit seiner Frau Lutgard von einem seiner Burgmänner ermordet, worauf Heinrich der Löwe auch die zweite Hälfte für sich in Besitz nahm und das Ganze dem Grafen Wittekind von Schwalenberg als Burglehen übertrug. Wittekind aber war ein wilder Geselle; 1156 ermordete er den Grafen der Stadt Höxter, Theoderich, während dieser zu Höxter auf der Kirchhofsmauer saß und öffentlich Gericht hielt. Auf die Klage des Abts von Corvei bei Friedrich I. hielt Heinrich der Löwe über den Mörder zu Corvei öffentlich Gericht, er wurde zum – Schadenersatz verurtheilt und bis auf Widerruf nach Frankreich verwiesen. Allein der ungebändigte Wittekind störte sich daran nicht, er vertraute auf seine Veste Desenberg, ja er nahm nicht allein Theil an dem Bunde, den 1166 mehrere Fürsten gegen die Macht des Herzogs Heinrich schlossen, sondern war sogar der einzige, der von seiner Feindschaft nicht ablassen wollte, als Kaiser Friedrich I. am 1. Juli 1168 zu Würzburg die übrigen Gegner mit Heinrich dem Löwen versöhnt hatte. Dieser zwang den Trotzigen nun dadurch, daß er den Desenberg belagerte und als seine Sturmmaschinen nichts dawider vermochten, seine Bergleute aus dem Harz berief, welche Stollen in den Berg trieben, bis sie an den Brunnen geriethen und durch Abgraben desselben Wittekind zur Uebergabe zwangen. 1180 wurde Heinrich der Löwe seines Herzogthums verlustig erklärt. Von seinen Gütern erhielt der Bischof von Paderborn 1192 den Desenberg mit allen Gütern, welche einst Graf Siegfried, Otto's von Nordheim Sohn, innerhalb der Diözese Paderborn besessen hatte. Unter Bischof Bernard III. beschwerte sich der Abt von Corvei über die Beschädigungen, welche die Burgmänner zu Desenberg seinen Corveischen Gütern zugefügt hatten; es wurde demnächst durch Schiedsrichter entschieden, daß die Veste auf dem Desenberge abgebrochen und dort nie wieder eine Burg errichtet werden solle. Man schritt zur Belagerung, welche gleichzeitig von dem Bischofe von Paderborn, dem Abte von Corvei und dem Grafen Albert von Everstein unternommen wurde; indessen ebenso fruchtlos als eine zweite vom Jahre 1206, wo die beiden Kirchenfürsten und der genannte Graf sich noch durch die Hülfe des Grafen Adolph von Waldeck und Anderer verstärkt hatten. Wer in jener Zeit auf dem Desenberge wohnte, ist unbekannt – wahrscheinlich Nachkommen des wilden Wittekind. Die Spiegel finden sich erst 1275 im Besitze. Der erste von diesen, der den Desenberg bewohnte, war Ritter Herrmann Spiegel, der aus Köln stammte, wo die Spiegel zu den ältesten Geschlechtern gehörten, und den Namen nach ihrem Hause zum Spiegel in der Brigitten-Pfarre führten; danach führten sie auch drei Spiegel mit verschiedenen Tinkturen nach den verschiedenen Zweigen im Wappen.

Nachdem die Spiegel in Westphalen Fuß gefaßt, wurden sie hier ein mächtiges, weitverzweigtes Geschlecht, das sich weit um den Desenberg umher schwer fühlbar machte; namentlich zu den Zeiten des schrecklichen Friedrich von Padberg und seines Benglerbundes, dessen löbliche Thätigkeit von den Spiegeln eifrig beflissene Förderung erhielt.
Im Jahre 1417 ist Johann Spiegel Marschall von Westphalen, 1464 wird Jürgen Spiegel vom Bischofe von Paderborn mit dem Erbmarschallamt des Stifts belehnt. 1470 belagert Bischof Simon von Paderborn mit seinem Bruder Bernhard von der Lippe die Burg Desenberg, weil die dort hausenden Spiegel seine Stadt Warburg beschädigt hatten, und erobert sie mit Hülfe großer Kriegsmaschinen. Es wurde Friede geschlossen, wobei die Brüder und Vettern Spiegel, Namens Hermann, Domherr zu Paderborn, Gerd, Schoneberg und Heinrich, das Schloß Desenberg mit aller Herrlichkeit dem Stifte Paderborn zu Lehn auftrugen und es zu dessen Offenhause machten.
Die Spiegel, wie gesagt, waren stets unruhige und schlimme Nachbarn, ein vor vielen andern raub- und streitdurstiges Geschlecht; im Anfange des 16. Jahrhunderts, wo das Stegreifleben und die Heckenreiterei nicht mehr blühen wollte, geriethen sie einander selber in die Haare und fielen sich unter einander an. Es muß damals ein friedfertiges und einträchtiges Leben auf dem hohen festen Burgschlosse Desenberg gewesen sein. Die Brüder und Vettern Philipp, Werner, Simon, Johann und Mauritz konnten sich mit den Brüdern und Vettern Friedrich, Gerhard und Conrad nicht um Raum und Gelaß, Luft und Licht auf ihrer Veste vertragen. Den Gewaltthaten und dem Hadern ein Ende zu machen, befliß sich Bischof Erich von Paderborn; es gelang ihm endlich, einen Burgfrieden zwischen ihnen aufzurichten; der soll bei dem Belfried, dem Hauptthurme, anfangen und um den Berg herumlaufen, so weit das Spiegel'sche Hagenland reicht. Innerhalb dieses Kreises sollen sie und ihr Gesinde Frieden halten, bei Strafe des Handabhauens, so Einer den Andern mit gewaffneter Hand hauen oder stechen sollte. Kommt es zum Todtschlag, so wird der Bischof ohne Gnade nach Burgfriedensrecht richten. Jeder soll nach seinem Antheil für die nöthigen Wächter und Pförtner, für die Erhaltung der Gebäude sorgen; der Thurmhüter soll zugleich dem Bischofe und Stifte eidlich verpflichtet sein; bei Wahrnehmung von Fremden soll er blasen und Zeichen geben. Diesen Burgfrieden treu zu halten, müssen alle gegenwärtigen und zukünftigen Spiegel eidlich geloben.
Es scheint, daß den so zu leidlichem Friedenhalten gezwungenen Brüdern und Vettern das besänftigte Dasein auf ihrer Burg auf die Dauer unbehaglich geworden. Wenige Jahre nachher sehen wir sie nämlich ihrer hohen Stammburg den Rücken kehren und sich auf vier neuen Stammhäusern ansiedeln, auf Rothenburg, Klingenburg, Ovelgönne und Büchen. Den Desenberg ließen sie zerfallen und 1581 mußte sie Bischof Heinrich von Paderborn ermahnen, daß sie wenigstens den Thurm in Stande halten, weil doch alle Lehnsherrlichkeit ihnen nur von diesem Schlosse zustehe.
Der Desenberg spielt in der westphälischen Sage eine Rolle; es singt ein Dichter von ihm:
![]() ört, Wunder will ich melden
ört, Wunder will ich melden
Aus einer alten Mähr:
Noch lebt mit seinen Helden
Carol, der Kaiser hehr.
Wohl in dem Desenberge
Ruht er von Siegen aus,
Und zaubermächt'ge Zwerge
Bewachen ihm das Haus.
Da ruh'n auch in den Hallen
Seine Treuen lang gereiht,
In trunkenen Schlaf verfallen,
Von schwerem Bann gefeit.
Rings blanke Wehr im Kreise
Lockt schimmernd wie zum Krieg,
Sie aber athmen leise
Und träumen Streit und Sieg.
Und Carl am Felsentische,
Das Haupt vom Arm gestützt,
Im Antlitz Jugendfrische,
Inmitten der Halle sitzt.
Lang fällt in weißen Wellen
Hernieder Bart und Haar,
Mit seinen Heergesellen
Harrt er schon manches Jahr.
Oft ist's, als ob sie spüren
Des Lebens neuen Tag:
Dann geht ein freudig Rühren
Entlang das Felsgemach.
Aufstehn all' die Genossen,
Ergreifen Schild und Speer,
Doch bleibt der Blick geschlossen,
Die Seele schlummert schwer.
Dem Kaiser nur erhellet
Sich Aug' und Geist zumal,
Er ruft, daß laut es gellet:
»Sagt, Zwerge, des Jahres Zahl!«
Und horcht, und Dunkel wieder
Umschattet sein Gesicht:
»Legt, Kämpen, legt Euch nieder,
Die Zahl ist unsre nicht!«
Mit dumpfem Rasseln gleiten
Zu Boden Mann an Mann;
Sie schlafen und warten der Zeiten
Die lösen ihren Bann.
Und er sitzt wieder am Tische,
Mit weißem Bart und Haar,
Der Kaiser, voll Jugendfrische,
Das Antlitz wunderbar.
(Franz Oebecke.)
Ein anderer Dichter, der die Sage behandelt hat, J. Seiler, versichert uns, daß, wie Carl im Desenberge, auch Hermann im Hermannsberge bei Lügde und Wittekind im Wedigenstein an der Porta (nach verbreiteterer Annahme in der Babilonie) schlummern. Das Volk hat sich eben alle seine werthesten Helden in hermetischem Verschlusse conservirt, wenn man auch nicht absieht, wozu; denn wenn sie wirklich einmal hervorbrechen und Deutschland Heil und Segen bringen sollten, so läßt sich nicht leugnen, daß sie die schönsten Gelegenheiten dazu wirklich verträumt haben. Und weil sie denn in der rechten Stunde nicht kamen, so müssen wir wohl überhaupt an ihrem Kommen verzweifeln, und den deutschen Mythologen glauben, welche uns versichern, daß der in den Berg entrückte Held ursprünglich Niemand Anderes sei, als der alte Heidengott Wodan, der mit seinen Helden an den Tischen Walhallas sitzt, und seit der Einführung des Christenthums in Unthätigkeit versetzt und entschlummert ist, bis zur großen Schlacht, zum großen Weltzusammenbruch der »Götterdämmerung.«
Die Sagen von bergentrückten Helden finden sich bei allen germanischen Völkern; die Dänen lassen ihren Holger Danske in verborgenen Gewölben des Schlosses von Helsingör, die Engländer ihren Arthur, der auch, wie bei uns Wuotan, das wüthende Heer anführt, in einem der Eildonhills, die Friesen das Fräulein Marie von Jewer in einem Minengange unter der Burg zu Jewer schlummern; wie Carl der Große im Untersberge, im Donnersberge träumt, und Kaiser Friedrich, oder Kaiser Otto im Kyffhäuser, Siegfried im Bergschlosse Geroldseck, die drei Rütlimänner in einer Bergschlucht am Vierwaldstättersee, ist bekannt. Man könnte danach neben der mythologischen Erklärung auch noch die stellen, daß das Volk den Tod seiner Helden, welche sich ihm urlebendig ins Bewußtsein eingeschrieben haben, nun einmal nicht glaubt; sie sind wie eine Verkörperung seines ewig lebendig bleibenden Wesens, seines nationalen Seins und Wollens und deshalb können sie nicht gestorben sein, so lange dies letztere nicht stirbt. Merkwürdig ist, daß bis in die neuesten Zeiten die Mythe in dieser Beziehung schaffend thätig gewesen. So hat sie den Kaiser Joseph II. und Napoleon im Glauben des Volkes fortleben lassen, lange nachdem sie todt waren.
Unsere Wanderung folgt jetzt zunächst der Eisenbahn, die Westfalen in nordwestlicher Richtung erschließt. Die Bahn durchläuft hinter Warburg die Thäler des Eggegebirges. Dies zieht sich von Heerse in nördlicher Richtung zur Rechten fort, um mit dem Namen Lippischer Wald oder Teutoburger Wald das Fürstenthum Lippe zu durchstreichen und dann nordwestlich gewendet dem mittleren Emsthale zuzuziehen und etwa bei Bevergern unweit Rheine in der Fläche zu verlaufen. Einst hieß dies ganze Gebirge auf seiner etwa 24 Meilen langen Ausdehnung der Osning. Gobelin Persona nennt z. B. um das Jahr 1398 die Waldgegend zwischen Dringenberg und Paderborn den »Osing.« Einhard in seinem Leben Carls des Großen nennt die Gebirge bei Detmold Osnengi; er erzählt im 8. Capitel, im Jahre 783 habe Carl der Große den Sachsen zwei Feldschlachten geliefert, die erste an dem Berge Osnengi, bei dem Orte, der Thietmelli heiße. In einem Vergleich zwischen den Brüdern Otto und Ludwig von Ravensberg von dem Jahre 1226 wird die Gegend um Ravensberg osnyng genannt. Ohne nähere Ortbestimmung wird uns der Hosning in den Annalen von Xanten beim Jahre 850 genannt, wo Kaiser Lothar und König Ludwig der Deutsche sich mehrere Tage lang in ihm friedfertig und einträchtig an der Jagd ergötzen; ebenso kommt der Wald Osning, Osnig oder Osninc vor in Urkunden Carls des Großen und Heinrichs II. Auch die Heldensage kennt ihn: nach der Wilkinasage kommt Dietrich von Bern an den Wald Osning in eine Gastherberge und hört dort von der Burg Drachenfels und ihrem Könige Drosian an der anderen Seite des Waldes erzählen.
Nach dem heutigen Sprachgebrauche nennt man Osning oder Teutoburger Wald die Gebirgsstrecke etwa so weit, wie sie das Fürstenthum Lippe durchzieht; was von dort südlich liegt, ist die Egge, was nordwestlich, Ausläufer des Osning oder des Teutoburger Waldes. Der Begriff des Teutoburger Waldes wird auch enger gefaßt, namentlich von denen, welche die Walstätte der Hermannschlacht in die Gegend von Detmold verlegen; so sagt Clostermeyer in seiner bekannten Schrift: Die Benennung Teutoburger Wald kann nur auf denjenigen kleinen Theil des Osnings angewandt werden, welcher zwischen den beiden von der Lippe bei Neuhaus und Lippspringe, durch die Dören und unter dem Falkenberg her durch das Gebirge führenden Pässen eingeschlossen ist. Das läßt sich freilich leichter behaupten als beweisen, denn eigentlich ist die Benennung Teutoburger Wald nie als eine volksthümliche gang und gäbe gewesen, in Urkunden kommt sie nie vor, und wenn das Volk sie kennt, so ist sie ihm durch die Gebildeten vermittelt. Suchen doch andere den Teutoburger Wald ganz außerhalb des Osnings, wie wir später sehen werden; wogegen denn freilich der Ausdruck Teutmeyer (der alte Hof am Fuße der Grotenburg) spricht.
In Beziehung auf den Namen Osning ist noch zu erwähnen, daß derselbe oft Osnegge geschrieben wird; aus dem Osnegge mag, wie einige Autoren annehmen, Egge entstanden sein.
Den Namen Osning erklärt J. Grimm in seiner Mythologie (Seite 106) als heiliger Wald, Osning betrachtet er gleich Ausning und Aus, sächsisch Os, bedeutet Gott – womit denn wieder die Asen zusammenhangen mögen. Ein vaterländischer Geschichtsforscher, W. E. Giefers, hat es aber wahrscheinlich gemacht, daß in dem Theile des Osnings, welcher zwischen Driburg und Willebadessen liegt, sich das alte Nationalheiligthum sächsischer Stämme, das templum Tanfanae befand, welches Germanicus bei seinem Zuge ins Land der Marsen im Jahre 14 v. Chr. so gründlich verwüstete. Er hat sodann nachzuweisen versucht, und wie wir glauben, mit guten Gründen, daß das templum Tanfanae nur ein heiliger Wald war, den Germanicus nicht wohl anders als mit Feuer zu zerstören suchen konnte.
Nach den Römern brachen die Franken in diese Gegend ein. Von Marsberg her der Weser zuziehend kam 772 Carl in die Gegend des Tanfana-Heiligthums und fand hier die Irmensäule – höchst wahrscheinlich nichts anderes, als ein aus der Zerstörung des heiligen Hains durch die Römer übrig gebliebener Baumstamm – vielleicht eine alte heilige Eiche, deren Aeste von den Römern durch Feuer zerstört waren. Die Sachsen, sagt Rudolph von Fulda, der einzige Chronist, der uns die Irmensäule genauer beschreibt und der ungefähr 80 Jahre nach ihrer Zerstörung schrieb, die Sachsen verehren Quellen und belaubte Bäume.... truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant; patria eum Irmensul appelantes quod latine dicitur universalis columna quasi sustinens omnia. Ein sub divo, unter freiem Himmel stehender truncus ist nun wohl ohne Widerrede ein Baumstamm, der seiner Aeste beraubt ist. Will man lieber glauben, es sei eine aufrechte Säule gewesen, so läßt sich auch dagegen nichts einwenden, immer aber darf man sicher annehmen, daß die Irmensul in dem alten, von den Römern zerstörten und wieder emporgewachsenen Gebirgswalde der Tanfana sich befunden habe.
Den Ausdruck Tanfana hat man bis jetzt nicht zu erklären gewußt. Merkwürdig ist, daß tanfanare auf italienisch prügeln bedeutet... tanfa oder tanfana müßte demnach einen Stock bedeuten und Heiligthum der Tanfana könnte als Heiligthum des Stocks, der Säule gedeutet werden!
Irmensul als Alles tragende Säule mit Rudolph von Fulda zu deuten, trägt auch J. Grimm kein Bedenken. »Irmangott,« sagt er, »ist der höchste Gott, der Gott Aller, Irminmann erhöhter Ausdruck für Mensch und Irminsul die große, hohe, göttlich verehrte Säule. Daß sie einem einzelnen Gotte geweiht war, liegt nicht in dem Ausdrucke selbst.«
Doch ist J. Grimm geneigt, den Cultus eines Gottes oder eines Wesens halbgöttlicher Natur für die Irminsul in Anspruch zu nehmen. Spuren dieses Cultus klingen ihm aus der im Osnabrückschen noch vorkommenden Redensart: he ment use Herrgott heet Herm, so viel als er lasse mit sich spaßen, oder: use Herrgott heet nich Herm, he heet leve Heer un weet wal totegriepen, entgegen. Darin soll leise Sehnsucht nach der milden Herrschaft des alten heidnischen Gottes im Gegensatze zu dem strenge richtenden und strafenden christlichen Gotte unverhalten sich ausdrücken. In einigen Gegenden Hessens und Westfalens lebt unter dem Volke der Reim:
Hermen sla dermen,
Sla Pipen sla Trummen,
De Kaiser will kummen
Met Hamer und Stangen,
Will Hermen uphangen.
»Nicht unmöglich,« sagt Grimm, »daß sich in diesen, durch die lange Tradition der Jahrhunderte gegangenen und wahrscheinlich entstellten Worten Ueberreste eines Liedes erhalten haben, das zu der Zeit erscholl, als Carl die Irmensäule zerstörte. Auf den noch älteren Arminius und die Römer lassen sie sich viel weniger deuten.«
Je weniger Bestimmtes wir über die Irmensäule wissen, desto mehr hat die Phantasie alter Autoren von ihr zu berichten gewußt, wie wir oben bei Marsberg sahen. Hier möge nur der kleine Roman Raum finden, den der Geschichtsschreiber von Paderborn, Bessen, von ihr mittheilt.
»Clodoald, Gouverneur einer großen Provinz in Dänemark, hatte nach dem Tode seiner Gemahlin noch drei Kinder im Leben, nämlich zwei Söhne, Clodoald und Hyazinth, und eine Tochter Hildegardis. Letztere wurde ihm in ihrem siebenten Jahre geraubt, nach Sachsen gebracht und zur Priesterin bei der Irmensäule bestimmt. Der älteste Sohn Clodoald wurde von Seeräubern entführt, kam an einen Schäfer in Afrika, mit dessen Sohne Faustinus er in der Folge unter dem Namen Ischyrion auf Abenteuer ausging. Der unglückliche Vater Clodoald reisete mit seinem jüngsten Sohne Hyacinth überall umher, um seine verlorenen Kinder wieder aufzusuchen; besuchte auch endlich seine Verwandten in der Gegend von Eresburg. Daselbst verfolgte er einst in der Hitze der Jagd einen Eber bis in den schaudervollen Wald, worin der Götze Irmin durch Menschenopfer versöhnt wurde. Kaum hatte er den Eber erlegt, da verkündigte eine fürchterliche Stimme den Zorn des Gottes und tausend Plagen, wofern man ihm keine Genugthuung leiste. Clodoald ward auf der Stelle blind, Kräuter und Gras vertrockneten unter seinen Füßen; doch schenkte man ihm das Leben, wenn er das zum Opfer brächte, was ihm zuerst aus seinem Hause begegnen würde. Das Schicksal traf den Hyazinth. Dieser unterhandelte mit den Priestern um seine Freilassung, wird aber gleich ergriffen und zum künftigen Opfer bestimmt. Auf das Gerücht entschließen sich zwei fremde Ritter, die sich gerade in der Gegend befanden, etwas für die Rettung desselben zu wagen. Beide – es waren Ischyrion und Faustinus – schlichen sich des Abends in den schaudervollen Wald; sahen am folgenden Morgen den Zug, in welchem der unglückliche Hyazinth, mit Blumen bekränzt, zum Opferplatze geführt wurde, und stürzten sich mit ihren Waffen zwischen die zahlreiche Begleitung. Die Priester drängen sich um den Hyazinth, die Ritter fürchten, er möchte von denselben erdrückt werden, und erbieten sich für seine Befreiung mit den Thieren des Waldes zu kämpfen. Die Bedingung wird angenommen, und die Löwen und Bären, welche den Götzen bewachen und die Schlachtopfer verzehren mußten, fallen durch die Hände der Ritter. Nun schreiet man über neue Beleidigung des Gottes, und drohet mit allerlei Plagen. Hyazinth und die beiden Ritter werden in dunkle Höhlen geworfen, und sollen nächstens geopfert werden. Hildegardis, jetzt Oberpriesterin, hat Mitleid mit den Schlachtopfern, will selbe retten, wird aber entdeckt und selbst zum Schlachtopfer bestimmt. Die vier Unglücklichen sehen noch im Kerker ihrem traurigen Ende entgegen, als Carl mit seinem Heere erscheint und die Eresburg erobert. Clodoald klagt ihm sein Schicksal, läßt sich in der Religion unterrichten und wird bei der Taufe wieder sehend. Nach der Oeffnung der Gefängnisse empfängt er den Hyazinth zurück und erkennt auch seine beiden andern Kinder, Clodoald und Hildegardis, die insgesammt die christliche Religion annehmen.«
Bessen beruft sich auf einen vaterländischen Annalisten aus dem Jesuitenorden als Gewährsmann dieser Erzählung. Doch trägt sie unverkennbar das Gepräge des Ritterromans aus den Zeiten der Marquise d'Urfé oder des Amadis von Gallien und die Erfindung ist nicht glücklicher, als die der Geschichte von der schönen und leidenschaftlichen Druidenpriesterin der Irmensäule, welche Bellinis unsterbliches Meisterwerk verherrlicht.
Als Carl der Große von Eresburg her gegen die Weser vorrückte und auf dem Marsche die Irmensäule zerstörte, lagerte er sich auf einer Höhe zwischen Kleinenberg und Willebadessen, auf welcher noch heute die Spuren dieses Lagers, große Wälle, wahrzunehmen sind. Man nennt die Stelle die Carlsschanze. Bei der Zerstörung der Irmensul, erzählt nun Einhard, verweilte Carl drei Tage an diesem Orte, und dabei erreignete es sich, daß wegen fortwährender Dürre und weil alle Bäche und Quellen ausgetrocknet waren, man kein Wasser zum Trinken mehr finden konnte. Auf daß jedoch das Heer nicht länger schmachte, machte, so will die Sage, der liebe Gott, daß eines Tages, als nach der Sitte alle ruhten, an einem dem Heerlager nahen Berge eine solche Wassermasse ausbrach und sich in ein trockenes Flußbett ausströmte, daß das ganze Heer genug hatte.
Es liegt nahe, diese wunderbare Quelle noch heute in dem sogenannten Bullerborn zu suchen, der bei Altenbeken liegt und der noch im 16. Jahrhundert das auffallende Phänomen darbot, daß er periodisch strömte und dann wieder versiegte: er warf stundenlang eine große Wassermasse mit bedeutendem Getöse und Rauschen aus und lag dann stundenlang wieder trocken. Den Ausbrüchen ging ein geheimnißvolles Rauschen in den Wipfeln der Bäume, welche die Quelle umstanden, vorher. Bei trockenem Wetter arbeitete die Quelle in größeren, bei nassem in kleineren Pausen. Vom December 1630 bis zum Jahre 1638 war der Bullerborn ganz versiegt. Seitdem aber fließt er ohne Unterbrechung und Geräusch, wie jede andere ordnungliebende Quelle; die eigentliche alte Quelle hat sich in mehrere Aufsprudelungen getheilt; man sieht nur noch Ueberbleibsel von einer Terrasse und alte Bäume, welche den ursprünglichen Born einst umgaben. Das Wasser fließt in die Sage, beide heißen dann die Beke und verlieren sich bei Neuenbeken im Sande.
Der Bullerborn ist freilich drei Stunden von der Carlsschanze entfernt; bis so weit mochten aber immerhin die fränkischen Vorposten vorgeschoben sein, die Fouragierer schweifen.
Die erste Station nach Warburg ist Bonenburg. Wir verlassen hier die Bahn, um einen Blick auf das berühmte Hardehausen zu werfen, eine der berühmtesten Klosterstiftungen im Lande – von Bonenburg kaum eine halbe Stunde entfernt, und dicht an der alten Paderborn-Casseler Chaussee liegend, die einst so belebt war und jetzt so verödet ist, wie Kloster Hardehausen selber. Es war eine Cisterzienser-Abtei, gestiftet 1140 von Bischof Bernhard I. von Paderborn, der in diesem Jahre zuerst Mönche aus dem Cistercienser-Kloster Altenkamp bei Rheinberg dorthin zog. Die eigentliche Stiftungsurkunde ist vom 5. Mai 1155. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Hardehausen reich und mächtig wie irgend ein Convent im Lande und Kloster und Kirche schmückten sich mit vielen und schönen Kunstwerken. Das ist nun Alles zerstört. Am 8. Februar 1803, als Peter von Gruben, der 52. Abt, kaum ein halbes Jahr die Mitra getragen, wurde das Kloster aufgehoben und zur Domaine gemacht. Damit begann die Plünderung. Ein Pächter, Wahnschaffe, nahm Besitz von der Abtei, und wie es in jenen Tagen nun einmal feststand, daß alles Alte und Vererbte absolut schlecht und unnütz sei, so wurde wahrhaft barbarisch gehaust. Marmorne Bildsäulen aus der Kirche wurden zu Chausseesteinen verklopft, ein Altargemälde zu einer Scheibe für Schützen gemacht.
Endlich wurde die ganze Kirche, welche nach einigen dürftigen Resten zu schließen, eine reich ausgebildete Säulen-Basilika aus dem 12. Jahrhundert gewesen zu sein scheint, niedergebrochen und dem Erdboden gleich gemacht. Uebrig ist nur noch eine merkwürdige kleine achteckige Capelle, die aus zwei über einander liegenden Räumen besteht; zur oberen gelangt man auf einer außen angebrachten Freitreppe, wie bei der Schloßkapelle zu Warburg; der Stil gehört der Uebergangszeit an.
In den zu der Domäne Hardehausen gehörenden Waldungen war noch vor Kurzem ein ziemlich reicher Wildstand an Schwarzwild vorhanden, das jetzt noch in dem unfernen Forste von Marschallshagen nicht selten ist.
Die nächste Station ist Willebadessen – wieder ein altes Klosterstift, in hübscher Gegend an der jugendlichen Nethe liegend und einst den Benediktinessen gehörend. Es war 1149 gestiftet von dem großen Klosterstifter Bernhard I. von Paderborn und seinem Bruder Lutold von Oesethe, und im Jahre 1317 erhielt es vom Bischofe Theodorich II. die Erlaubniß, zu seinem Schutze das Städtlein Willebadessen neben seinen Mauern anzulegen. Im Jahre 1474 schloß es sich der Bursfelder Congregation an und reformirte so die verfallene Zucht. Aufgehoben im Jahre 1810 von der westphälischen Regierung, wurde es an den Freiherrn von Spiegel-Borlinghausen verkauft. Das Städtchen ist unbedeutend, es hat 1600 Einwohner.
Und dann eine Strecke weiter liegt rechts der Bahn wieder ein Kloster, diesmal ein hochadeliges Damenstift, Heerse, das Luthard III., Bischof von Paderborn, mit seiner Schwester Walburgis in der Mitte des 9. Jahrhunderts (868) stiftete, das sich also fast eines so hohen Alters wie Corvei rühmen kann. König Heinrich I. bestätigte die Stiftung 935. Abtei und Kirche sind nicht so zerstört wie manche andern; die Kirche ist sehr beachtenswerth. Ihre ältesten Theile, namentlich das niedere nördliche Seitenschiff sind auf einen Bau, den 1165 die Aebtissin Hogardis nach einem Brande aufführen ließ, gegründet. Sie beweisen, daß diese älteste Kirche eine flachgedeckte Säulen-Basilika war, welche später gothisch um- und übergebaut ist. Das Chor, unter dem eine geräumige Crypta liegt, ist um 15 Stufen gegen das Schiff erhöht. Im südlichen Querschiff befindet sich unten der Capitelsaal, oben der Nonnenchor. Vier schöne Marmoraltäre aus der Rococo-Zeit schmücken das Innere, sind aber grausam mit Oelfarbe überschmiert!
Einen Einblick in das Detail der Haushaltung eines solchen freiadeligen Damenstifts gewähren uns die noch vorhandenen alten Kammer- und Rentei-Register von Neuenheerse. Wir sehen daraus, daß im Jahre 1561 zur Haushaltung der »Ebbedei Hersse,« zu der »Küchen« an Gelde erfordert wurde 12 Thaler 7 Schilling 2 Deut, hauptsächlich für Fische, Käse, Salz und Zwiebeln – alles andere lieferten der eigene Besitz, die Oekonomie, die Abgabenpflichtigen. Die Summe erscheint aber nicht so gering, wenn man daneben als Preis für einen Pflug 6 Schillinge, als Lohn für die Köchin 2 Thaler angemerkt findet. Die ganze Geldeinnahme des Stifts betrug im Jahre 1561 nur 275 Thaler. – Kurz vor der Aufhebung im Jahre 1802 nahm das Stift an Früchten 5000 Berliner Scheffel und an Grundgeld und verpachteten Zehnten 2642 Thaler ein; die ganze Einnahme wurde auf 8366 Thaler, gering angeschlagen, berechnet.
Neuenheerse ist als Domaine durch Kauf das Besitzthum des Grafschaftsbesitzers Tenge zu Barkhausen geworden. Die Lage des Stifts zwischen Hügeln an den Quellen der Nethe ist sehr freundlich. Das Wassergebiet dieses Flusses bildete einst den Nethegau, über den wir eine Monographie von W. E. Giefers (Zeitschrift für vaterl. Gesch. Bd. V.) besitzen. Auch er hat als Ergebniß seiner Studien gefunden, daß der älteste Anbau dieses Landes in Dörfern, nicht in Häfen stattgefunden, wie schon A. von Harthausen nachgewiesen und daß von den urältesten Ortschaften des Nethegaus mehr als ein Drittheil im Laufe der Zeit verschwunden ist. Wahrscheinlich waren diese alten Ortschaften weniger bevölkert als die heutigen – doch dürfen wir immerhin schließen, daß unsere Gegenden in den frühesten Zeiten nicht viel weniger bevölkert waren, als heute. Das wenigstens ist mit ziemlicher Sicherheit zu berechnen, daß sehr große Striche Deutschlands erst jetzt wieder im Ganzen die Bevölkerung besitzen, welche sie vor dem dreißigjährigen Kriege hatten.
Bei Altenbeken zweigt sich der Eisenbahnstrang ab, welcher durch den Rehberg-Tunnel zunächst nach Driburg führt; doch ist auch die Fußwanderung durch die schönen stillen Wälder lohnend. Man verläßt dann die Eisenbahn schon in Buke, dem Dörflein auf einer ziemlich öden Hochebene und erreicht auf der trefflichen Chaussee nach einer halben Stunde etwa den Punkt, wo sich zuerst eine weite Aussicht aus das freundliche, von Waldbergen umkränzte Thal von Driburg öffnet, in dessen Tiefe das Städtchen und eine Strecke weit davon zur Rechten die Badegebäude liegen. Eine jäh abfallende Bergseite hinunter wendet sich dann die Chaussee in kunstreich angelegten Schlangenlinien. Endlich erreicht man den Ort und das Postgebäude, aus dessen zweitem Stock man hinter dem Hause in den hübsch angelegten Garten tritt, den die Gesellschaften der Badegäste beleben, und den man nur zu verlassen braucht, um sich nach wenig Schritten in der schönen, breiten, vierzeiligen Lindenallee zu befinden, welche zu dem Sierstorff'schen Gute führt. Dies Gut ist nämlich eins und dasselbe mit den Badeanlagen; rechts und links zu beiden Seiten der Alleen ziehen sich in zwei Reihen die großen freundlichen und umfangreichen Logirhäuser, Badehäuser, Promenadehallen und Gebäude der Verwaltung hin; die Wohnung der gräflichen Herrschaft schließt sich im selben Stile zuletzt der Reihe an; und nun öffnet sich die breite Straße, wenn man die beiden Gebäudereihen so nennen will, auf einen hübschen Park, der sich in einem engen romantischen Thale zwischen steilen, mit prachtvollen Fichtenbeständen bedeckten Bergwänden verliert.
Die Quelle sprudelt sehr reich, in einer neuen Fassung, hinter der »Wandelhalle« ihr eisenhaltiges Wasser aus – sie gewährt den stets häufiger aufgesuchten Heiltrank gegen die specifische Krankheit unserer Zeit; denn bekanntlich hat der Gott, »der Eisen wachsen ließ und keine Knechte wollte,« das Eisen ganz vorzugsweise spärlich in den Blutbestandtheilen wachsen lassen, welche die Adern der gegenwärtigen Generation füllen, und hat sie nach Ernst Moritz Arndt's Princip mithin politisch nicht ganz verantwortlich gemacht für den heutigen Lauf der Dinge in der Welt.
Driburg verdankt seine Existenz und seine Badeanlagen dem im Jahre 1842, in einem Lebensalter von zweiundneunzig Jahren verstorbenen Grafen Sierstorff, einem Manne von merkwürdiger geistiger Regsamkeit, der seiner Zeit in weiteren Kreisen durch sein Zerwürfniß mit dem Herzoge Carl von Braunschweig bekannt wurde. Er war Oberjägermeister in braunschweigischen Diensten, wurde von dem Herzoge dieser Würde entsetzt und gewann siegreich einen beim Bundestage wider den gewaltthätigen Herrn anhängig gemachten Proceß. Jenes Zerwürfniß hatte aber zur Folge, daß Sierstorff Braunschweig verließ, wodurch auch seine, mit ausgezeichnetem Kunstsinne gesammelte Gemäldegalerie später nach Driburg kam. – Ein in dem herrschaftlichen Gebäude ausgestellter großer und höchst elegant gearbeiteter Tubus, den der gräfliche Herr mit eigenen Händen gemacht hat, zeugt von seinen Kenntnissen und von seinen mechanischen Talenten. Die Sierstorff sind ein Geschlecht, welches sich mit einer merkwürdigen Energie rasch vom untersten Bürgerstande heraufgearbeitet hat. Gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts kam ein Hamacher (Faßbinder), Meister Franz Franken, aus dem Dorfe Sierstorf in die heilige Stadt Köln, siedelte sich hier an und erwarb sich die Mittel, seinen ältesten Sohn studiren und geistlich werden zu lassen; dieser geistliche Herr brachte es bis zum bürgerlichen Domherrn, 1626, ließ seinen jüngeren Bruder Jura studiren und verschaffte ihm die Hand der Tochter eines Kölnischen Bürgermeisters. Damit waren dem jungen Doctor der Rechte die Thore zu allen Ehren geöffnet – der Hamacherssohn wurde Syndicus der freien Reichsstadt und nahm den Namen Franken-Sierstorff an. Sein ältester Sohn wurde mit der Würde eines Stadtgrafen von Köln bekleidet und in den Adelsstand erhoben (1700). Von des Stadtgrafen Söhnen wurde der älteste in den Reichsfreiherrnstand erhoben; ein zweiter wurde Bischof von Antwerpen, ein anderer Canzler zu Hildesheim, und dessen Enkel, unser braunschweigischer Oberjägermeister, mit dem Grafenstande begnadigt. So sehen wir beinahe eine jede Generation um eine Staffel höher sich erheben.
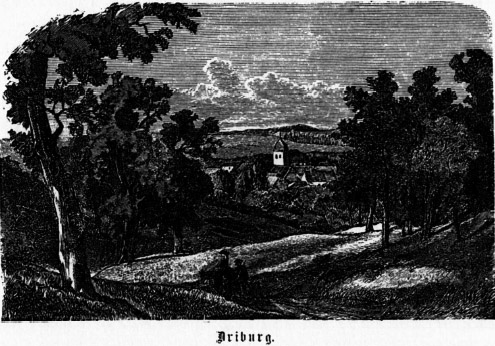
Jener Bischof von Antwerpen war ein Sammler von Gemälden, und da aus seiner Erbschaft ein höchst merkwürdiges und meisterhaftes Werk der Kunst nebst mehreren anderen Stücken sich auf den braunschweigischen Großneffen vererbte, so wurde in diesem ebenfalls der Sammeleifer entzündet und er wurde Schöpfer der kleinen, jedoch ausgezeichneten Galerie, welche nur 200 Nummern, aber darunter viele wahre Perlen der Kunst umfassend, die Hauptmerkwürdigkeit von Driburg ist. Kenner, welche die vier Gemächer im obern Stock des Sierstorff'schen Hauses durchschreiten, werden gewiß in hohem Grade überrascht sein über die ungeahnte Welt von Schönheit, die, von Künstlerhänden offenbart, sie hier in einem stillen westphälischen Bergthale umgibt. Wenn auch der Christuskopf Leonardo da Vincis, der, wenn echt, jedenfalls stark übermalt ist, wenn auch die kleine Madonna Rafael's aus seiner früheren Periode sie nicht fesselt – sie werden sich desto mehr angezogen fühlen von dem großen Erbstück des bischöflichen Oheims, einem Geschenk der Stadt Antwerpen an diesen und einem Werke, über welches sich ein ganzes Buch schreiben ließe. Es ist eine Tafel, 5 Fuß 4 Zoll hoch und nicht weniger als 7 Fuß 5 Zoll breit: der Meister ist Franz Franck, der diese humana comedia, wie man das Ganze nennen könnte, im Jahre 1635 schuf. Franz Franck gehörte einer berühmten Malerfamilie an, erhielt seine erste Ausbildung von seinem Vater, dem älteren Franck, in den Niederlanden, und brachte dann mehrere Jahre in Venedig zu, wo er unter dem Einfluß der großen Meister, deren Werke ihn hier umgaben, eine richtigere Zeichnung, mannigfaltigeren Ausdruck der Physiognomien und ein glänzenderes Colorit sich aneignete, als man sie bei vielen Niederländern seiner Zeit findet.
Der Gegenstand, welchen unser merkwürdiges Bild mit einer ganz unnachahmlichen Technik, einer idealen Schönheit der Gestalten und einem seltenen Reichthum der Phantasie darstellt, ist offenbar eine Allegorie, deren erschöpfende Deutung jedoch große Schwierigkeiten bietet. Die ganze Darstellung zerfällt in zwei Abtheilungen, eine obere und eine untere. Wir sehen im Mittelgrunde der oberen einen, wie es den Anschein hat, von den Freuden des Daseins ein wenig erschöpften jungen Mann, den Alles umgibt, was die Erde einem Sterblichen an Genüssen bieten kann: der Saft der Trauben, Blumen, schöne Gestalten – darunter eine, die sich von einem Lager erhebt, von einer unnachahmlichen Anmuth ist; aber die Göttin der Wahrheit ist ihm genaht, und scheint ihm eine Offenbarung zu machen, für welche er in einem Zustande von bedeutender Sättigung nicht recht mehr empfänglich sein mag – die nämlich, daß am Ende dies ganze heitere lustige Erdenleben unter dem waltenden Einflusse des Zeitgottes sich zu einem großen Triumphzuge in den offenen Rachen der Hölle hinein gestaltet, einem Triumphzuge, den wir auf dem untern Theile des Bildes gewahren. Neben dem jungen Manne stehen aber noch andere Gestalten, die Tugenden der Weisheit, Religion, Hoffnung, Liebe, dann dicht ihm zur Seite Hercules, wie um ihm die männliche Stärke zum Kampfe mit sich selbst zu bringen. Ganz ohne Zweifel horcht er mit voller Hingebung ihren Lehren und ist voll edler Entschlossenheit, seine Jugend nicht mehr zu vergeuden; er will sich einem würdigen und edlen Ehrgeize hingeben und nur noch leben für die Ziele des Ruhms. Aber die Wahrheit kann ihm jetzt leider eine zweite Bemerkung nicht vorenthalten. Sie zeigt ihm, was es auf sich hat mit der Welt des Ehrgeizes, die der ersten Hauptgruppe gegenüber, zur linken Seite, uns in einer zweiten Gruppe in zahlreichen Gestalten vor Augen gestellt ist. Der sich ermannende Jüngling gewahrt, daß diese von der Göttin Juno angeführte Schaar von Helden, Priestern, Richtern und vornehmen Herren mit ihren Reichthümern, Ehrenkleinodien und Orden gerade so dicht über des Teufels Rachen schwebt, wie er, unser Jüngling, selbst mit seinen gutmüthigen Freundinnen und lustigen Gesellen; wie diese der Gott der Zeit, so führt jene die Gestalt des Todes aus ihren heiteren Höhen, musicirende Teufel und hübsche Teufelinnen und schäkernde Dämonen voran, in unbekümmerter Heiterkeit und stolzer Pracht in die Hölle hinein.
Den Teufel spürt das Völkchen nie,
Und wenn er sie beim Kragen hätte!
Der ermahnte Jüngling, so aufgeklärt über das gemeinsame endliche Ziel des gesammten Erdentreibens, wird nun wahrscheinlich vorziehen, seinen bisherigen löblichen Bestrebungen treu zu bleiben, lieber, als sich den ehrgeizigen Anstrengungen der Herren da drüben hinzugeben, mit denen er seiner Zeit früh genug ein Stockwerk tiefer unten das Vergnügen haben wird zusammenzutreffen. Vielleicht aber auch wirft er sich der Religion in die Arme, ein Element, welches der Meister in der Höhe durch einige wolkengetragene Engel mit Musikinstrumenten, Blumenkränzen und Kronen darstellt, aber offenbar, als im menschlichen Leben nur schwach vertreten, blos leise andeutet.
Mit einer ganz außerordentlichen Phantasie ist der untere Theil des Bildes gemalt, der Eingang zur Hölle, der Teufel, der triumphirend auf einem Drachen aus ihrem offenen Schlunde hervorreitet, die Gestalten der Dämonen und Scheusale, die hier in allen Felsenklüften nisten, – mit einer Phantasie, welche der eines Höllenbreughel nichts nachgibt, aber einen unendlichen Vorzug vor ihr hat – sie bleibt immer innerhalb der Grenzlinien des Schönen, des durch die Kunst Darstellbaren und des edlen Maßes. Von ganz besonderer Schönheit auch sind die Tänzerinnen mit Blumenkränzen in den Händen, die den kleinen geblendeten Liebesgott auf einem Fußgestelle auf ihren Schultern tragen, die Götzendiener mit Rauchfäßchen und Narrenkappen, die auf ähnliche Weise ein buntgeschmücktes Idol tragen, und was sonst noch da unten die Spitzen des großen lustigen Zuges bildet, worin alles irdische Treiben und Streben endlich ganz gemüthlich zum Teufel geht und in die Hölle einrückt.
Man sieht, der Künstler ist ein pessimistischer Philosoph gewesen; er erblickt den Menschen zweien Dingen hingegeben: entweder der Jagd nach Vergnügen, oder den Bestrebungen des Ehrgeizes und der Habsucht... und bei beiden Beschäftigungen führen ihn Zeit und Tod gemächlich bergab und auf dem bequemen breiten Wege dem Verderben zu. Das, was als höheres ethisches Gesetz, was als Religion dies Leben emporheben könnte, damit ist es überaus schwach bestellt; der Meister, der die paar musicirenden Engel da in der Höhe über sein Bild des menschlichen Lebens malte, hat offenbar von Religion nicht viel im irdischen Treiben entdeckt! – –
An seiner westlichen Seite wird das Thal von Driburg von einem ziemlich steil aufsteigenden bewaldeten Berge, dem »Haushahn« oder Schloßberge beherrscht, welcher auf seinem Gipfel die Ruinen einer alten Burg, der Iburg, Vergl. Giefers, zur Geschichte der Burg Iburg u. der Stadt Driburg. Paderborn 1860. trägt. Der Sage nach war einst das ganze Land um den Osning oder Teutoburger Wald Besitzthum eines sächsischen Adalings; er hatte drei Burgen, die er seinen drei Töchtern, Iva oder Ida, Ravena und Teckla hinterließ, und die danach Iburg, Ravensburg und Tecklenburg genannt wurden.
Ein sächsisches Castell scheint die Iburg allerdings gewesen zu sein, das Carl der Große einnahm, neu befestigte und dem von ihm errichteten Bisthume Paderborn übergab.
Im 12. Jahrhundert, vor 1136, wurde die Iburg zum Kloster für Nonnen des Benediktiner-Ordens eingerichtet. Bischof Bernhard von Paderborn war der, welcher die Sache betrieb, Schwester Beatrix, die Abtissin von Heerse, gab aus ihrem älteren himmlischen Palmgarten die Ableger für die neue Pflanzung her, und Ländereien um die Iburg herum wurden durch Kauf oder Schenkung erworben; Heinrich der Schultheiß von Paderborn wandte ein Lehngut in Frilinctrop daran; gerührt über so viel Freigebigkeit schenken die armen Nönnchen – nos pauperes Christi in Iburg commorantes – der Frau Schultheißin Ascela einen ganzen Korb voll Schmucksachen, welche sie beim Eintritt ins Kloster haben als weltlichen Tand von sich abthun müssen, während Frau Ascela diese Dinge von ihrem Standpunkte aus zu schätzen gewußt haben wird. Es sind goldene Ohrgehänge mit Perlen und Edelsteinen besetzt, zwei goldene mit Edelsteinen besetzte Halsbänder aus kleinen goldenen Kettchen künstlich zusammengesetzt, zehn Armbänder vom feinsten Golde, alles zusammen auf 20 »Talente« geschätzt; dazu noch ein und ein Viertel Pfund Silber.
Aber nur zwanzig Jahre hielten es die Schwestern auf der Iburg aus; die Weltabgeschiedenheit und Waldeinsamkeit des Ortes klagten sie unablässig ihrem geistlichen Vater, dem Bischofe Bernhard, bis dann schon vor 1136 in ihrer Noth ihnen Hülfe ward von einem frommen Manne, Heinrich Gerdenen, der seinen Hof Gehrden dem Herrn schenkte und den Nonnen der Iburg ein Kloster darauf baute. Heinrich war ohne Kinder, seine Schwester Maregard, seine Töchter Landegard und Helmburg nahmen selbst den Schleier, die Söhne der Schwester, Werno und Basilius, wurden Geistliche zu Gehrden.
Der dem Kloster von Heinrich geschenkte Besitz nahm nun sehr rasch zu. Viele Töchter aus den benachbarten Adelsgeschlechtern nahmen in Gehrden den Schleier, die Gaben mehrten sich fortwährend; Handwerker, Hörige, Wirthe siedelten sich neben dem Kloster an, und Bischof Theodorich erlaubte 1319 demselben, zur größeren Sicherheit eine mauerumschlossene Stadt anzulegen, wie er es 1317 Willebadessen verstattet. Der Propst, die Domina und der Convent von Gehrden setzten nun die Verfassung der neu zu schaffenden Stadt auf und indem sie Rechte und Pflichten der Herrschaft und der Unterthanen abwogen, trieben sie die christliche Selbstverleugnung nicht weiter, als es mit dem Gebote der Selbsterhaltung verträglich ist: für des Propstes leiblichen Unterhalt mußte jede Hausstätte auf Ostern z. B. nicht weniger als 80 Eier liefern. Accise von Bier und Branntwein, Haus- und Hofzins, Weinkäufe, Heuer, Vorheuer, Hühner, Einzugsgelder, Fleischzehnten kamen nach und nach zusammen, um die Bürger von Gehrden mit ihrem klösterlichem Regiment ein wenig mißvergnügt zu machen; deshalb, als sie nach dem Brande von 1685 ein neues Rathhaus aufgebaut, und nun die Abtissin ihr Wappen an dasselbe hängen ließ, rissen die Bürger dies herunter, zerschlugen es und erkärten laut, daß sie nicht mehr unter dem Weiber- und Nonnenregiment stehen wollten, erklärten dies auch dem Fürstbischofe rund heraus und erlangten dessen Einwilligung, das fürstliche Wappen an ihr Rathhaus zu hängen, was am 20. Februar 1686 mit großem Jubel ausgeführt wurde... eine echt deutsche kleine Rebellion, bei der die Erhöhung des fürstlichen Wappens nicht allein das Endergebniß (das ist öfter erlebt worden), sondern das Ziel der Empörung ist!
Gehrden wurde 1810 aufgehoben und als Domaine an den Grafen Bocholtz, von diesem an denselben Oberjägermeister Grafen Sierstorff verkauft, von dem wir oben geredet haben; es bildet jetzt das Hauptgut der Familie. Das Kloster ist in einen freundlichen Landsitz umgeschaffen. Die alte aus dem 12. Jahrhundert stammende romanische Kirche ist ein einfaches, aus Tuffsteinquadern ausgeführtes Bauwerk. – Von den dort einst hausenden Nonnen scheint eine, deren Bild in den ehemaligen Klostergebäuden gezeigt wird, sich immer noch nicht zur Ruhe geben und in die Thatsache der Säcularisation schicken zu können – sie geht um, und es wandelt sie von Zeit zu Zeit die Lust an, den Lebenden Besuche zu machen, ohne sich dabei anmelden zu lassen, was nicht dazu beiträgt, einen solchen Beweis voll Höflichkeit seitens einer todten Nonne angenehmer zu machen. So saß einst der verstorbene Oberjägermeister zu Gehrden in seinem Arbeitszimmer am Schreibtische, als die todte Dame geräuschlos bei ihm eintrat, und sich still, wie um den würdigen Herrn nicht in der Arbeit zu stören, hinter ihm auf das Kanapee setzte. Der Graf faßte sich und nahm den Anschein an, als ob er ruhig weiter schreibe; als er dann sich umsah, begegnete sie starr und zornig seinem Blicke, erhob sich jedoch wieder und verließ so geräuschlos, wie sie gekommen, das Gemach.
Nachdem die Nonnen nach Gehrden abgezogen, wurde die verlassene Iburg, auf der noch die Kirche erhalten war, im Jahre 1189 vom Bischofe Bernhard II. wieder zur Burg eingerichtet. Als Burgmänner finden wir darauf die von Brakel. Dies Rittergeschlecht, das sich bald »von Driburg« schrieb, saß vielleicht auf einem zur Iburg gehörenden Burglehn oder einem eigenen Edelsitz am Fuße des Berges und um seinen Sitz bildete sich das Städtchen »To der Iburg.« Es ist übrigens auch möglich, daß die von Driburg ein von den Brakel unabhängiges Geschlecht und daß sie Edelherrn gewesen, keine Ministerialen; sie hatten einen bedeutenden Lehnhof. Heinrich von Driburg, 1179, wird zuerst genannt. Der letzte des Geschlechts war Johann, der 1437 zu Paderborn als Domherr starb und seine Güter theils dem Bischofe von Paderborn, theils der Stadt Driburg vermachte. Er liegt in der Vorhalle des Doms zu Paderborn begraben. Wilhelm von Driburg, der Stiftsherr, den um 1420 ein Mönch vergiftete, weil er für die Reform der Klöster thätig war, scheint dem Geschlechte nicht angehört zu haben.
Die Iburg wurde von den Bischöfen von Paderborn vielfach versetzt, was ihren Verfall befördern mußte, und jetzt sind fast die letzten Trümmer verschwunden. Doch hat man in neuester Zeit Verdienstliches um die Verschönerung des Platzes gethan. – Die Stadt Driburg, eine ehemalige Vogtei des Oberamts Dringenberg, jetzt zum Kreise Höxter gehörend, hat etwa 2500 Einwohner.
Von Driburg suchen wir das Städtchen Brakel und das freundliche Thal der Nethe auf, die wir bei Neuenheerse vom Kamme des Eggegebirges sich herabschlängeln sahen der Weser zu, in welche sie oberhalb Höxter bei Godelheim mündet.
Der Weg läßt zur Linken tief im Waldesdunkel verborgen ein Oertchen, die Emde genannt: gleichen Namens mit einem Theile des gräflich Bocholtz-Asseburg'schen Forstes, an dessen nördlichem Abhange ein kleiner Bach ein schmales rings von Wald umschlossenes Thal bildet. Hier ist eine Glashütte, wo man noch heute in der Art der sogenannten Kurfürstenpokale alterthümliche Gläser mit Bildern in Schmelzarbeit herzustellen versteht. Wohl hat sich traditionell aus alter Zeit die rohe Technik bis heute dort erhalten, nicht so die alte Kunst.
Aus dem Walde hervorgetreten, erblickt man bald in einem, von leicht und allmählich ansteigenden Höhen umgebenen Thale vor sich die Stadt Brakel: links in stolzer Ruhe das weithin leuchtende schöne Schloß Hinnenburg, mit seinem Thurme aus waldiger Bergkuppe ragend wie Alarco's Zinnen. Die Hinnenburg – man denkt bei ihrem Anblicke an Neuhof, das Schloß des Freiherrn von Wittekind in Gutzkow's »Zauberer,« dessen Scenerien ja diesen Regionen entlehnt sind – ist ein Sitz des alten, edlen Geschlechtes derer von der Asseburg.
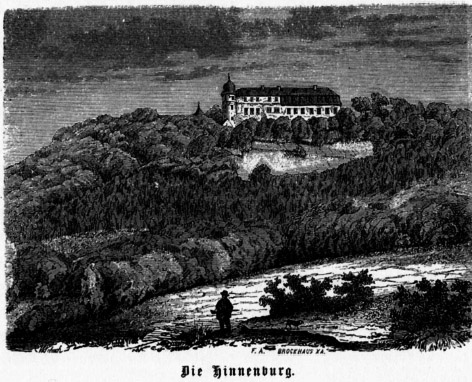
Ohne uns auf etymologische oder andere Untersuchungen einzulassen, in wiefern das im 3. Cap. von
Tacitus Germania vorkommende
Asciburgium, das bei
Ptolemaeus 2, 11, 7 genannte
![]() , oder endlich die vom Geographen Strabo erwähnte Völkerschaft, die
, oder endlich die vom Geographen Strabo erwähnte Völkerschaft, die
![]() , in Zusammenhang mit dem fraglichen Namen stehen, mag hier nur eine Stelle finden, daß ein durch seine gelehrten Forschungen berühmter Gießener Professor, Knobel, in seinen ethnographischen Untersuchungen über die Völkertafel der Genesis (Gießen 1850, S. 41) die Erhaltung des hebräischen Namens
Askenas in dem Geschlechte derer von Asseburg, einem der ältesten in Deutschland, findet. Man glaubt den alten Stammbaumfabrikanten Don Gasparo Scioppio zu hören!
, in Zusammenhang mit dem fraglichen Namen stehen, mag hier nur eine Stelle finden, daß ein durch seine gelehrten Forschungen berühmter Gießener Professor, Knobel, in seinen ethnographischen Untersuchungen über die Völkertafel der Genesis (Gießen 1850, S. 41) die Erhaltung des hebräischen Namens
Askenas in dem Geschlechte derer von Asseburg, einem der ältesten in Deutschland, findet. Man glaubt den alten Stammbaumfabrikanten Don Gasparo Scioppio zu hören!
Die Asseburg, deren vollständige und älteste Geschichte trotz verschiedener Versuche noch wenig klar gestellt ist, scheinen desselben Geschlechts mit denen von Wolfenbüttel zu sein, dagegen die in die meisten genealogischen Werke des vorigen Jahrhunderts übergegangene Annahme, als sei Gebhard von Hagen, der um's Jahr 1090 lebte, der erste, so sich von der Asseburg genannt, und somit gewissermaßen Stammvater des Geschlechtes, ein Irrthum ist. Es scheint vielmehr gewiß, daß eine von Otto dem Großen, Herzoge zu Sachsen, dem Vater König Heinrich des Finkler's, um's Jahr 904 oder von Heinrich I. selbst auf der Asse, einem südlich der Stadt Wolfenbüttel im Braunschweigischen gelegenen, waldigen Bergrücken erbaute Veste als der älteste Sitz des Geschlechtes zu betrachten ist. Wahrscheinlich ist diese Asse-Burg in den Kriegen der Sachsen mit Kaiser Heinrich IV. zerstört worden; Günzel von Wolfenbüttel scheint dieselbe wieder aufgebaut zu haben, denn er wird in einem auf die Klage der lehnsherrlichen Abtei Gandersheim, wegen unbefugten Baues, erfolgten Breve, das Papst Honorius III. im Jahre 1220 gegen ihn erließ, als Erbauer des Schlosses Asseburg genannt. Dieses genannten Erbauers Nachkommen werden in Urkunden von 1224, 27, 36, 37 von der Asseburg genannt.
Die hohenstaufische Kaiserzeit mit ihren Welfen und Ghibellinenkämpfen, die das heilige römische Reich in allen Richtungen durchtobten, scheint in ihrem Ausgange in den Asseburgern das Gelüste, sich dynastisch geltend zu machen, hervorgerufen zu haben. So wird berichtet, daß um's Jahr 1254 die von der Asseburg in eine Fehde geriethen mit dem Herzoge Albrecht von Braunschweig, dem Sohne Otto's des Knaben und Enkel Heinrichs des Löwen. Der Herzog hatte eine für ihn unglücklich ausgehende Fehde mit Wedekind, Graf zu Hoya, Bischofe von Minden, gehabt. Zum Hohne des Herzog's, so meldet die Sage, sollen die von der Asseburg auf den Schilden ihrer Knappen und Reisigen zwei Löwen (das Wappen von Braunschweig), darüber aber einen Wolf (das ihrige), jene Löwen im Nacken fassend, haben malen lassen. »Das sollte,« wie die alte braunschweig'sche Chronik sagt, »die Deutung haben, der Herzog von Braunschweig, der eitel Lewen in seinem Wapen füret, möchte sich von denen von der Asseburg, die einen Wolf im Wapen hetten, beißen lassen, were derwegen ein ohnmechtig Lewe, weil er sich keines Wolfs erwehren könnte.« Der beleidigte Herzog belagerte die Asseburg bis in's vierte Jahr. Trotz der Versuche, die der Graf Dietrich von Eberstein und der Erzbischof Conrad von Mainz durch Einfall in das herzogliche Gebiet von Göttingen zu ihrem Beistande unternahmen, sahen die von der Asseburg sich doch endlich genöthigt, ihr Bergschloß zu übergeben und mußten um ihres heraldischen Scherzes willen die braunschweigischen Lande für immer verlassen. Die Asseburg gelangte in den Besitz der Herzoge von Braunschweig, in dem sie noch heute sich befindet. Herrliche Buchen beschatten ihre letzten Trümmer.
Busso von der Asseburg, der Vertheidiger der Veste, begab sich nach ihrem Verluste 1258 nach Westphalen auf die Hinnenburg. In welchem Verhältnisse das Geschlecht zu jener Zeit zu dieser Burg gestanden, läßt sich nicht genau ermitteln. 1261 wird sie in einer Urkunde Berthold's von Brakel, »Hindeneborch,« so viel uns bekannt, zuerst genannt. Eine andere aus dem Jahre 1268 herrührende Urkunde beginnt mit den Worten: Nos Bertholdus commorans in Hindeneborch, Wernerus in Triborch, Hermannus in urbe veteri, milites dicti de Brakele. Hiernach scheint allerdings das seiner Zeit mächtige Geschlecht derer von Brakel im Besitze der Hinnenburg gewesen zu sein. Sie selbst ging, wie mehrere Complexe in jener Gegend, vom Stifte Heerse zu Lehen. Ebenso wird angegeben, daß Berthold von Brakel keine Söhne, nur zwei Töchter gehabt habe, deren eine an Berthold von Dassel, die andere aber an Burchard von der Asseburg vermählt gewesen sei. Dieser scheint entweder mit dem von der Asse vertriebenen Busso derselbe oder dessen Sohn gewesen zu sein, denn in einer Urkunde vom Jahre 1299 nennt Burchard von der Asseburg den Berthold von Brakel seinen Großvater. Andererseits liegt eine Urkunde vor, d. d. Paderborn 1289 vig. beat. Catharin. virg., worin Otto (von Rittberg), Bischof von Paderborn, und sein ganzes Capitel versprechen, den Burchard von der Asseburg und seine legitimen Erben in omnibus bonis suis antiquis schützen zu wollen. Hieraus ließe sich auf einen uralten Besitz schließen.
Der Name Hinnenburg, wie er heute lautet, scheint nach der ältesten Schreibart sich am füglichsten, wenn auch nicht sicher, als »hintere Burg« zu erklären, da nach alten Urkunden zwischen Brakel und dieser noch eine andere Burg, die Palburg oder Altenburg (ungefähr auf der Mitte zwischen beiden findet sich ein Stück Land, Oldenburg genannt) gelegen haben soll. Die vielfach, auch in Schaten's Paderbornischen Annalen vorkommende Annahme, als habe die Burg von den Hunnen den Namen, erscheint als gesucht und unbegründet. Erklärungen von »Hünen« oder »Hindin« hergeleitet, wollen auch nicht einleuchtend gelingen.
Wandern wir jetzt zu dem Schlosse selber hinauf, das mit seinem alterthümlich vorspringenden Eckthurme und seinen langen im Glanze des Abendroths weithin leuchtenden Fensterreihen die anmuthigen Thäler des alten Nethegaus beherrscht. Es erhebt sich auf bewaldeter Höhe, dem Ausläufer eines 800 Fuß über dem Meere gelegenen Bergrückens, am oberen Rande einer ziemlich schräg abfallenden Rasenblöße, die man häufig von Rudeln Dammwild belebt sieht, indeß Buchen und Eichen den Rand der Waldwiese umsäumen. Ueber diese Blöße führt der gewöhnliche steile Fußweg, der die Verbindung mit dem am Fuße des Berges liegenden Oekonomiegebäude des Vorwerks Schäferhof unterhält. Ein vielfach gewundener Fahrweg führt indeß allmählich die Höhe hinan, wechselnd durch Nadel-, vorzugsweise aber Laubholz-Partien, an malerischen Baumgruppen vorüber, hin und wieder dem Auge einen freieren Ausblick über den Rasen dem Schlosse zu gewährend. Er zieht sich endlich an der vorderen Schloßfront vorüber, an deren Ende der hohe runde Thurm der Burg schlank, doch kräftig sich erhebt, und mündet in einem weiten Unterhofe, den Stallgebäude und Remisen umgeben. Links zeigt sich in grünen Gebüschen die malerische Capelle, in der Sprache der Burg zuversichtlich »die Kirche« genannt. Es ist ein im Achteck, nach Form der alten Baptisterien, aufgeführtes Gebäude, an welches sich seitwärts ein anderes, worin das Oratorium für die Herrschaft, anschließt. Eigenthümlich ist das Dach mit der in der Mitte von vier erkerartigen Vorsprüngen sich erhebenden Spitze. Ueber das Alter derselben ist nichts Näheres bekannt, doch mag sie nach Analogien zu den ältesten Capellen auf rother Erde gehören. Zur Rechten schreitet man über den hier zum Theil abschüssig hängenden Vorhof, unter einem gewölbten Einfahrtsthore her, an dem noch die Zeichen des feudalen Fallgatters bemerkbar, in einen Binnenhof, dreiseitig hoch vom Schloß umgeben. Gegenüber dem Bau, der die beiden parallelen, aber nicht gleich langen Flügel verbindet und in welchem sich der genannte bogenartige Thorweg befindet, gestattet ein gußeisernes Gitter mit gleichem Thor in der Mitte einen freundlichen Blick über eine plateauartige, von Kastaniengruppen und Ahorn umgebene Wiesenfläche, die sich im Waldesdunkel verliert.
Trotz ihres Alters trägt die Hinnenburg theilweise genommen den Typus des 17. Jahrhunderts; denn, obschon an einem, den Thurm umschließenden Theile das mittelalterliche Gepräge nicht zu verkennen ist, so hat doch der am südlichen Flügel im 18. Jahrhundert ( magnis sumptibus, wie eine in Stein gehauene Inschrift zeigt) aufgeführte Anbau den eigenthümlich castellartigen Charakter der Burg so ziemlich genommen. Zwei dort aufbewahrte Bilder zeigen, zur Charakteristik des damaligen Geschmackes, das eine, Hinnenburg, wie es bis 1736 gewesen, das andere, wie es durch Hermann Werner von der Asseburg von 1736 an ist verschönert worden.
Im Innern des Schlosses hat man neben dem Comfort des modernen Lebens Eindruck von einem schon Jahrhunderte hindurch vornehm gehaltenen Hause. Ein Saal in Stuckmarmor mit den Bildern zweier Fürstbischöfe von Paderborn, Wilhelm Antons von der Asseburg und seines Nachfolgers Friedrich Wilhelm von Westphal; ein anderer in vollendetster Stuckarbeit, ebenfalls mit zwei Bildern in Lebensgröße über den Kaminen, dem Hermann Werner's von der Asseburg und seiner Gemahlin Theresa Sophia, geborene von der Lippe, beide Säle in der Rococozeit ausgeführt; das Eßzimmer mit seinen schönen alten Familienbildern und seinem Wandschranke, zwischen herrlichen venetianischen Gläsern Pokale in der kunstvoll getriebenen Arbeit der Zeit der Renaissance und des Rococo enthaltend, – das alles sind Räume, würdig der äußeren Stattlichkeit des stolzen Baues.
Einen reizenden Anblick gewährt die Terrasse, zu der man vom Binnenhof, das Treppenhaus quer durchschreitend, gelangt. Hier zieht ein Vorsprung, ein offener, mit Steinplatten getäfelter Altan sich vom Thurme her an der Südseite fort, theils von dunklem, hundertjährigem Taxus beschattet, theils von einem Epheudach übergrünt, das, von umwundenen Pfeilern getragen, sich rückwärts wieder an die Schloßwand klammert, deren Fenster dicht umzieht, und in einer Ueppigkeit und Fülle gedeiht, die nur am Heidelberger Schloßthurm ihres Gleichen findet. Dieser Altan ist ein Lieblingsaufenthalt aller Bewohner, da auf der einen Seite das immer grüne Laubdach des Epheus und des Taxus einen willkommenen Schutz gegen die Sonne gewährt, während man auf der andern Seite weit hinaus in das Hügelland schaut. Ueber die Waldeskronen hinweg erblickt man im Thale die Stadt Brakel, die ihren neuen Spitzthurm, mit langem, grauem Schieferdache zum Himmel streckt. Darüber hinaus theils Felder und Wiesen, dann waldbewachsene Höhen, zwischen denen die höher liegenden Parkpartien von Rheder mit ihrer reichen Färbung sich an fernhin gedehnte Waldgebirge lehnen, die mit ihren dunkelblauen Zügen den Rücken des Osnings bezeichnen, von welchem die berühmte Carlsschanze dem Auge sichtbar wird.
Entgegen dieser Richtung bietet sich nach Norden hin, weniger ausgedehnt, weniger umfassend, aber unvergleichlich anmuthig die Aussicht nach dem Sengenthal, wo ein lieblicher Wiesengrund von einem Bache, die Brucht genannt, durchschlängelt, rings von Wald umschlossen, das Auge hinunter in die tiefste Einsamkeit lockt. Hier grüßen aus duftiger Tiefe nur Wasser, Wald und Wiese und Nachts beim Vollmondschein in bewegten Nebelstreifen gewiß der geheimnißvolle Reigen lieblicher Elfentänze – wohin sollten sie kommen, wenn sie dies Thal nicht lockte? – während das sanfte Rauschen einer Mühle zu uns heraufdringt. Durch ein bei dieser Mühle angebrachtes Druckwerk wird das Wasser den Berg hinaufgetrieben; doch versieht auch ein sehr tiefer, oben befindlicher Brunnen die Burg mit Wasser.
Ein gebildeter Geschmack, der Natur und Einfachheit liebt, vereint sich überall mit einer gewissen anspruchslosen Größe und bildet aus den Gebäuden und ihrer Umgebung ein harmonisches Ganze, das wir das Ideal eines imposanten, schönen, mit künstlerischem Geiste geschmückten Edelsitzes nennen möchten.
Die Hinnenburg macht im Gegensatze zu manchem Gemachten vor allem den Eindruck des langsam, historisch Gewordenen. Sie ist wohl werth, daß ein altes Geschlecht einen solchen Sitz mit Macht durch Jahrhunderte zu behaupten suchte. Und das haben die Asseburger gethan. Wenig andere Geschlechter, selbst manche europäische Dynastien nicht, vermögen sich eines so alten Sitzes zu rühmen. Aber freilich – das Geschlecht erfreut sich auch eines besonderen geheimnißvollen Schutzes, die Asseburg sind bewehrt durch den Talisman des Zwergenkönigs – die verhängnißvollen Gläser!
»Einst wurde in der Nacht eine Frau von der Asseburg aus tiefem Schlummer geweckt. Die Augen öffnend erblickt sie eine kleine gnomenhafte Gestalt, einen Zwerg, an ihrem Bette, der dringend bittend die Aufforderung an sie richtet, allsogleich seinem Weibe in ihrer schweren Stunde Beistand zu leisten. Die Burgfrau, wohlerfahren in den Heilkünsten der Zeit, folgt bereitwillig und voll Theilnahme dem voraneilenden Zwerge durch weithin sich ziehende unterirdische Gänge muthig bis an's Bett der Kranken. Nachdem sie dieser die nöthige Hülfe geleistet, wird sie auf eben so wunderbare Weise in ihr Closet zurückgeleitet. Hier übergibt ihr der dankbare Zwerg drei Gläser und drei goldene Kugeln: ›Glück und Gedeihen gibt mein Geschenk Deinem Geschlechte; bewahret es gut; wenn zerbrochen ein Glas, dann wird dürren ein Zweig.‹«
Was aus den drei Kugeln geworden, davon erzählt die Sage nichts; zwei Gläser aber, das eine von gelblicher, das andere von röthlicher Farbe, in der Form den sogenannten Tummlern ähnlich, sind noch vorhanden bis auf diesen Tag. Beide waren im Besitze des vorigen Burgherrn der Hinnenburg, des Grafen Hermann Werner von Bocholtz-Asseburg. Derselbe schenkte das eine an den Grafen Ludwig von der Asseburg, der es auf dem Falkensteine sorgsam hütet; das andere wird auf der Hinnenburg hinter sicherem Schlosse im alterthümlichen Schreine des Archivs bewahrt.
Aber das dritte Glas? – Es ist gebrochen wie das hohe Trinkglas, »das Glück« des Lords von Edenhall. Einst sollen zwei Brüder von der Asseburg im Kreise froher Gäste in Uebermuth die verhängnißvollen Gläser herbeigeholt und aus denselben gezecht haben.
»Zum Horte nimmt ein kühn Geschlecht
Sich den zerbrechlichen Krystall,
Er dauert länger schon als recht,
Stoßt an! Mit diesem kräft'gen Prall
Versuch ich das Glück von Edenhall!«
Ein Glas kam zu Fall und die beiden Brüder kamen durch einen Sturz aus dem Wagen beim Flüchtigwerden der Pferde zu Tode. Die Linie von der Asseburg zu Wallhausen starb mit ihnen aus. Das dortige Kirchenbuch berichtet ihr vorzeitiges und tragisches Ende.
Brakel, die Stadt im Thalgrunde an der Nethe ( Nitara), ist ein uralter Ort. Es rasteten da die Mönche von Corvei, welche mit dem Körper des heiligen Vitus aus Frankreich gezogen kamen, um ihn in ihr Kloster zu bringen. Dies geschah im Jahre 836, und in der Schilderung dieses frommen Zuges, der von allen Seiten die eben bekehrten Sachsen als Zuschauer herbeizog, wird der Ort Villa Brechal genannt; dann Brakle, endlich Brakel. Die erste Erwähnung des alten Rittergeschlechts von Brakel, dem die Stadt zuständig, fällt in's Jahr 1185; zweihundert Jahre später jedoch ist dasselbe bereits erloschen.
Von Brakel aus gelangt man das Nethethal hinauf in einer halben Stunde nach Rheder, einem in Wald und Berg versteckten Dörfchen; aber schon eine bedeutende Strecke, bevor man es erreicht, blickt man zur Rechten der Chaussee in den gräflich Mengersen'schen Park hinab, der das kleine Flußthal mit seinen schönen Wald- und Rasenpartien erfüllt.
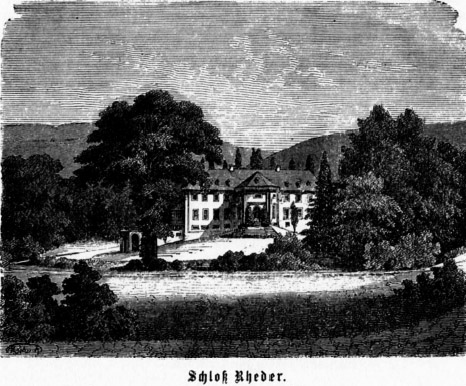
Rheder ist seit unvordenklichen Zeiten der Sitz derer von Mengersen, die vielfach in den Geschichtsbüchern des alten Hochstifts Paderborn und Westphalens genannt werden. Sie hatten ursprünglich drei Burghäuser hier, an deren Stelle jetzt der eine stattliche Sitz getreten ist.
Das hübsche um 1750 von Franz Joseph von Mengersen und seiner Gemahlin Antoinette von Spiegel erbaute Schloß, mit stattlichen Wirthschaftsgebäuden, lehnt sich an das Dorf; die hintere Front beherrscht den schönen, vierhundert Morgen umfassenden Park mit den prächtigen Durchsichten auf die rauschende Felsenmühle, die Bergrücken des Osning und die Carlschanze, von deren Zusammenhang mit der Irmensul wir erzählt haben. Die Natur hat durch die Gruppirung des Thales und der Höhen, und ganz besonders durch den Reichthum prachtvoller Waldvegetation, durch diese mächtigen alten Eichen und Buchen mit weithin sich streckendem Gezweig dem Schöpfer des Parks viel entgegengebracht. Aber man muß einräumen, daß nur ein seltener Geschmack und ein sinniges, echt poetisches Verständniß landschaftlicher Schönheit diese Baumgruppen so ordnen, diese anmuthigen Pfade durch Wald und Rasenflächen so ziehen, diese ganze Blumen- und Laubwelt so gestalten konnte. In der That ist der Schöpfer des Parks ein Poet – der Graf Joseph Bruno von Mengersen ist der Verfasser des Romans: »Irma und Nanko« (Leipzig 1845), einer Sammlung »Gedichte« (Mainz 1855), eines epischen Gedichts »die heilige Elisabeth« (Hannover 1861) und der epischen Dichtung »Cherusker und Römer« (Leipzig 1866). Die waltende Hausfrau in unserm schönen und neidenswerthen Landsitz aber ist eine Tochter des berühmten Diplomaten und Staats-Ministers Grafen Herbert von Münster, dessen Portrait Hormayr – auf seine Weise – in seinen Bildern aus dem Befreiungskriege gezeichnet hat, mit einem Rahmen dazu, der freilich viel breiter als das Bild selber ist.
Die Hauskapelle auf Schloß Rheder, deren Fenster mit Glasmalereien geschmückt sind, welche aus den kunstfertigen Händen der Dame vom Hause selber hervorgingen, besitzt ein Bild, welches eine Mengersen'sche Familiensage verewigt. Ein Vorfahr des Hauses, Johann Moritz, Obrister über ein Regiment Münster'scher Truppen, war bei Belgrad unter Prinz Eugen in die Gefangenschaft des Türken gerathen; er war schwer verwundet und der Moslem hatte die freundliche Absicht, ihn erst zu heilen und ihm dann den Kopf abschlagen zu lassen.
In seinem Kerker nun schreibt er an die Seinigen, um ihnen Kunde von seinem Schicksal zu geben und bittet den Sklaven seines Arztes um den Liebesdienst, den Brief auf irgend einem sichern Wege in die ferne Heimath zu senden. Erstaunt betrachtet der Sklave das Siegel des Briefes, die zwei Adlerflügel am Goldring, und dann fällt er dem Gefangenen zu Füßen und nennt ihn freudig seinen Herrn – er ist der tolle Küchenjunge, des Obersten Jugendspielgenosse, der wegen seiner bösen Streiche fortgejagt wurde aus des Gefangenen Vaterhause, dann auf die See ging, dort von den Piraten gefangen, und so Sklave und des »Hakim« Diener wurde. Er rettet nun den Obersten, indem er ihn in der Kleidung des Arztes aus dem Kerker führt. Die Geschichte ist unwahrscheinlich genug, um wahr sein zu können, und hat obendrein eine Moral – die, daß es nicht unräthlich ist, seine Küchenjungen zeitig ein wenig mit der Heraldik bekannt zu machen!
Der Park von Rheder hat auch seine Sage, die sich an eine alte abschüssige Bergwand knüpft, deren Fuß tief unten die Nethe bespült. Wir lassen sie in gelungener dichterischer Behandlung folgen.
Der Trompetersprung.
![]() ls jenes wüste Wetter hin über Deutschland fuhr,
ls jenes wüste Wetter hin über Deutschland fuhr,
Das dreißig lange Jahre verheert die deutsche Flur,
Da war kein Land so ferne – sein Sturm hat es durchsaust,
Da war kein Thal so enge – sein Donner hat's durchbraust!
Es lag vom Weserstrome seitab ein Dörfchen klein –
In Rheder an der Nethe, da schlug das Wetter ein,
Versprengte reis'ge Knechte von Holks verschriener Jagd,
Die haben's überfallen in einer dunkeln Nacht.
Mit Schüssen und Fanfaren den Bauer ruft man wach,
Und steckt ihm, eine Leuchte, den rothen Hahn auf's Dach;
Das war ein Rauben, Würgen, ein Fluchen, Zeterschrein,
Die Hölle feiert Sabbat beim grellen Feuerschein.
Vor allen ein Trompeter auf seinem Schecken wild
Sprengt hetzend auf und nieder, des Satans Ebenbild;
Er schmettert die Fanfare zum langen Angstgeschrei,
Begleitet Todesstöhnen mit lust'ger Melodei!
Vom Gaule schnell geworfen dort stürzt er auf ein Weib,
Das hülfeflehend fliehet, umfaßt ihr frech den Leib;
Schon ringt er sie zur Erde, da stürzt ein Greis herbei:
Es hat der alte Behler gehört der Enk'lin Schrei!
Er wirft sich auf den Reiter, er zwingt ihn in die Höh,
Das Mädchen fliegt von dannen wie ein gescheuchtes Reh.
Da reißt vom Sattelbogen das Faustrohr der Soldat:
Wie schnell die Todeskugel die Maid ereilet hat!
Dem Behler, bald bezwungen, hat man bestrickt die Hand
Und ihn am Schweif des Schecken geflochten und gespannt,
Es schwingt sich auf der Reiter, er setzt die Sporen ein,
Das Roß in wilden Sätzen fliegt über Stock und Stein.
Bald stürzt der Greis zu Boden, dann schleift das Thier ihn nach,
Bald wieder aufgerissen trifft ihn des Hufes Schlag,
Und durch die Nacht ertönet zum Hufschlag Wimmern, Schrein,
Trompetentöne schmettern hohnlachend zwischendrein.
Sie sind zum Bergsturz kommen, es geht der Schecke sacht,
Daß in dem greisen Behler die alte Kraft erwacht,
Mit einem mächt'gen Rucke hat er die Hand befreit,
Mit einem wilden Sprunge ist er dem Roß zur Seit';
Hat das Gebiß ergriffen mit eisenharter Faust,
Drängt Roß und Mann zurücke dorthin, wo's Wasser braust.
Den Schecken treibet vorwärts manch wüth'ger Sporenstoß –
Trotz Fluchen und trotz Hieben, der Behler läßt nicht los;
Ein Ruck! es bäumt das Thier sich hoch auf an Abgrunds Rand;
Ein Stoß! und Roß und Reiter im grausen Sturz verschwand. – –
Der Mund des Volkes wahret treu die Erinnerung,
Die Stelle heißt bis heute noch »der Trompetersprung.«
Und wer zur Geisterstunde dort geht am Nethegrund,
Der schlägt ein Kreuz und betet; – wohl hört er noch zur Stund'
Vom Wassergrunde gurgeln Gestöhn und Zeterschrein,
Trompetentöne schrillen hohnlachend zwischendrein!
(F. W. v. Krane.)

Ein interessanter Punkt wird vom Nethethal aus erreicht, wenn man das am linken Ufer des Flusses mündende Seitenthal der Ose oder Oese an dem von uns bereits besprochenen Gehrden her bis Dringenberg verfolgt. Dies pittoreske von seiner alten Bischofsburg überragte Städtchen erhebt sich auf einer mäßigen Anhöhe. Am steilsten senkt sich diese nach der Südseite zur sogenannten Waldemei ab, einer vortrefflichen Weide, welche von dem forellenreichen Oese-Bache in wunderlichen Windungen durchschlängelt wird. Dieser Weidegrund, von 800 Morgen Größe, streicht in bedeutender Breite am Fuße der gedachten Anhöhe in einer Länge von fast ½ Meile vorüber und breitet einen Teppich lieblichen Grüns vor dem schauenden Auge aus. Die Oese entspringt am Fuße des Klusenbergs, der ehemaligen Richtstätte, neben einer Kapelle des hl. Antonius Eremita, treibt in unmittelbarer Nähe eine Mühle, bis sie eine Stunde von der Stadt, in der Nähe des ehemaligen Klosters Gehrden, sich mit der Nethe vereinigt.
Hat man nördlich von der Stadt ein sanft sich erhebendes Kornfeld durchschritten, so nimmt den Wanderer eine anmuthige Waldgegend auf, durch welche der Weg zu der wenig entfernten Glasfabrik Siebenstern führt, einem Besuchsorte der Badegäste des nahen Driburg. Gleich im Anfange dieser Waldpartie erstreckt sich eine Wiesenschlucht nach rechts, welche von hohen Eichen umsäumt ist. Hier lag bis zum Jahre 1324 das Dorf Dringen, dessen Kirchhof als Wiesentheil sich durch die Tradition erhalten hat. Die Paderborner Bischöfe hielten sich im Mittelalter zeitweise auf der benachbarten fürstlichen Burg auf; weil aber in jener gesetzlosen Zeit die Furcht vor Raubrittern und Wegelagerern einen besondern Schutz erheischte, veranlaßte der Bischof Bernhard V., ein Graf von der Lippe, die Bewohner des Dorfes Dringen, sich zu seiner Burg herüber zu siedeln, und den Ort mit Mauern zu umgeben. Dies geschah um das Jahr 1324, und nach einer noch vorhandenen Dotationsurkunde schenkte der dankbare Bischof dem neuen Orte Stadt- und Münzrecht, Gerichtsbarkeit und andere Privilegien. Die größte Gabe bestand aber in einem Waldgebiete von 2086 Morgen, einer Weidefläche von 800 Morgen und 3 Mühlen. Diesen Grundbesitz hatte der Bischof Bernhard noch als Domprobst zu Paderborn von den im Paderbornschen reichbegüterten Grafen von Eberstein käuflich erworben und diese Güter dem Bisthume geschenkt. Zur dankbaren Erinnerung an so viele Wohlthaten feierten die Bürger der Stadt das Andenken Bernhards V. seit undenklichen Zeiten bis kurz vor der französischen Revolution jährlich auf Maria-Lichtmeß durch einen öffentlichen Aufzug. Ein junger Mann aus einer der ersten Familien wurde mit braunem Chormantel, Mitra und Stab als Bischof gekleidet und zwei mit Helm und Waffenrock geschmückte Hellebardiere wurden ihm beigegeben. In feierlichem Zuge, vom Rathe der Stadt begleitet, wurden sie zur Kirche geführt und während des Hochamts stand der Bischof zwischen den Knappen vor der Kommunionbank, hinter ihm der Magistrat. Nach beendigtem Nachmittagsgottesdienste hielt der Bischof mit seinen Begleitern zu Pferde großen Umzug durch die Stadt und Jeder, der irgend ein reitbares Thier besaß, schloß sich dem Zuge an. Unter stets wiederholter Anstimmung des Volksliedes:
»Sag', was ist all' die Welt,
Mit ihrem Gut und Geld...«
wurde vor den angesehensten Häusern Halt gemacht und Labung über Labung eingenommen. Alles war voller Jubel und Leben. Tags darauf wurde ein feierliches Todtenamt für die Seelenruhe des unvergeßlichen Bischofs Bernhard abgehalten. Vom Magistrate wurde ein Geldopfer von 2 Rthlr. auf den Altar gelegt; in früheren Zeiten bestand dasselbe aus einem Hahn, zwei Tonnen Bier und einem Käse. Weil aber der Hahn während des Seelenamts sich störsam vernehmbar gemacht und gleich dem des h. Petrus gekräht hatte, so trat in der spätern Zeit das Geldopfer und ein zweipfündiges Wachslicht an dessen Stelle. Am Mittage gab der Magistrat Freitafel auf dem Rathhause, woran der gewesene Bischof und die Bürgerschaft theilnahmen. – Dieses lange unterbliebene Erinnerungsfest wurde 1808 noch einmal wiederholt und ist seitdem nicht mehr gefeiert.
Die Stadt blühte im Mittelalter durch Handel, Kunst und Gewerbfleiß. Zum Wohlstande trugen besonders auch die Hofbeamten bei, welche dort, bei Anwesenheit des Bischofs oft Jahre lang residirten, wie auch aus den Inschriften alter, adliger Häuser erhellt. Daß aber auch die Kunst in Dringenberg gepflegt ist, beweist der hier im Jahre 1635 von dem Silberarbeiter Hans Drake verfertigte silberne Kasten, worin die Gebeine des h. Liborius im Dome zu Paderborn aufbewahrt werden und welcher von jedem Kenner als ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst gepriesen wird. Es hat ihn, wie die Inschrift bezeugt, Freiherr Friedrich Wilhelm von Westphal zu Fürstenberg aus den rings gesammelten Thalern verfertigen lassen, welche aus dem frühern, durch Christian von Braunschweig geraubten Liborikasten und anderm silbernen Kirchengeräthe geschlagen waren. Auch die bronzene Chorlampe der Kirche zu Dringenberg ist ein Werk dieses Meisters laut der Inschrift, welche auch die Namen seiner Gehülfen bewahrt hat.
Wenn man nach einem erhaltenen alten lateinischen Verse urtheilt, folgenden Inhalts:
Lippiaci generis Bernardus nomine quintus
Magnanimus Princeps atque severus erat;
Dringenbergiacae fundamina collocat arcis,
Pleraque continuo diruta castra novat –
so ist auch der ältere östliche Flügel der Burg von dem mehrgedachten Bischof Bernhard V. (1320–1339) zuerst erbaut; sonst müßte er von Bernhard IV., Grafen von der Lippe (1227–1246), stammen. Denn das Burgthor hinter der Eingangsbrücke trägt als Wappen eine Rose, bekanntlich das Wappen der Grafen von der Lippe, und einen frühern Bischof aus diesem Hause hat das Bisthum Paderborn nicht aufzuweisen. Der neuere westliche Flügel rührt von Rembert von Kerssenbrock her, welcher auch beide Flügel durch einen Zwischenthurm verbunden hat.
In der Nähe von Dringenberg liegt in einem anmuthigen Thale das Dorf Schmechten, zu Karl's des Großen Zeiten Schmathiun genannt. Ueberschreitet man jenseits dieses Dorfes ein kleines Kornfeld, so gelangt man zu dem durch Ferdinand von Fürstenberg in seinen Monumenten gefeierten eisenhaltigen Mineralbrunnen am Fuße eines von herrlichen Eichen, Stechpalmen und Wachholderbüschen gebildeten Wäldchens, durch welches der Weg nach dem unfern sprudelnden Herster Brunnen führt. Der Schmechter Brunnen wurde zur Zeit des Bischofs Ferdinand II., der sich im Jahre 1669 dieser Heilquelle gegen Stein- und Leberleiden bedient hatte, im Viereck mit Geländerdocken umgeben, wovon jetzt nur noch die Fundamente sichtbar sind. Diese Quelle ist mehrfach besungen und unter Andern von Johann Jork, Probst zu Minden; er hat dies Gedicht dem Fürsten Ferdinand II. zugeeignet. Es lautet in der wörtlichen Uebersetzung:
Born, verehrungswürdig im Schattenhaine,
Längst Apollo'n und der Genesung heilig:
Kranken Nieren hilfst Du, und reichest willig
Honig dem Munde,
Der bei weitem attischen Seim verdunkelt,
Den auf Hybla's Hügeln der Bienenschwarm sich
Emsig aus der Blume der schönsten Jahrszeit
Beutet, und einträgt;
Du, die Zier und Wonne der Waldeshöhe,
Deren äußerm Fuß mit Gezisch und Kochen
Du entspringst, beschwert mit der Eisenstufe
Reichlicher Ader:
Unsern Landesvater erhalt', den Fürsten
Ferdinandus, der mit erlauchtem Plektron
Deinen Meth besingt und mit vollen Zügen
Selber ihn trinket.
(Gehlen.)
– – Wir verlassen das Nethethal, um nordwärts gewendet das Thal der Emmer aufzusuchen, auf einem Wege, der von Brakel aus in die schönen Laubwälder führt, durch welche man zunächst nach Bökendorf gelangt.
Aus diesem freundlich gelegenen Dörflein stammte Johannes Schneeberg, Lieutenant im Götzischen Regiment, jener Reutersmann, der, wie in den Monumentis Paderb. des Fürsten Ferdinand von Fürstenberg beurkundet wird, in der Schlacht bei Lützen den Schwedenkönig Gustav Adolf erschlug und ihm seine goldene Halskette abnahm. In demselben Dorfe war einst, erzählt die Volkssage, ein Haus, das hieß das Düvelshus; darin wohnte vor undenklichen Zeiten ein Hexenmeister, der Nachts als Wehrwolf umherging und den Leuten vielen Schabernack und Schaden anthat. Der Vorfahren des Gutsherrn einer paßte ihm auf und schoß dem Wolfe eine silberne, geweihte Kugel in's Bein. Da nun am andern Tage der Hexenmeister krank an der Wunde lag, erkannte man ihn und zog ihn vor das Gericht. Da versprach er, das ganze Dorf mit einer goldenen Kette dreimal zu umziehen. Die hat er aber nicht herbeischaffen können und da hat man ihn verurtheilt und auf einem Scheiterhaufen verbrannt.
Die Gutsherrn von Bökendorf waren seit undenklichen Zeiten die Freiherrn von Haxthausen, ein uraltes, weit verbreitetes Geschlecht, das sich nach dem Rhein, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen, Hessen verzweigt hat und in einer dänischen Linie, in der Person Georg Christians von Haxthausen 1730 in Dänemark in den Grafenstand erhoben wurde. Es gehörte zu den sogenannten vier »festen Säulen« oder »Edlen Meyern« des Hochstifts Paderborn, und war mit dem Erbhofmeisteramt des Fürstenthums belehnt. Der Freiherr August von Haxthausen, der berühmte Verfasser der »Studien über Rußland,« der »Transcaukasia,« wohnte jedoch nicht hier, sondern in dem Thale, das wir eben aufzusuchen im Begriffe stehen, auf dem Schlosse Thienhausen.

Thienhausen ist eine unweit Steinheim am Fuße des Stoppelbergs liegende stattliche im Renaissance-Stile erbaute Wasserburg, die lange im Besitze der in Dänemark lebenden gräflichen Linie der Familie war und während der Abwesenheit der Herrschaft auf's Traurigste verfiel und verödete. Nach dem Erlöschen jener dänischen Grafen kam die Burg an den Freiherrn August von Haxthausen, der sie in ihrer alten Stattlichkeit wiederherzustellen strebte und ihre zahlreichen, weiten Gemächer und Corridore mit allem dem ausschmückte, was sein lebhafter Sammlereifer irgend dazu Dienliches auffand. So ward Thienhausen eine Art Museum von tausend merkwürdigen Dingen – Gemälden, alten Tapeten, gewirkten Teppichen, Majolika und Porzellan, Schreinen, Uhren, Waffen, Rococo-Gegenständen aller Art – wenn man zum ersten Male die Gemächer, die mit allem dem gefüllt sind, durchschreitet, kann man fürchten, wirr im Kopfe zu werden, über all den bunten Farben, Formen, Gestalten und curiosen Dingen, die hier auf unsere Phantasie eindringen. Einer der Säle ist ganz erfüllt von lebensgroßen Bildnissen in ganzer Figur der sämmtlichen Offiziere eines dänischen Regiments, die ein Vorfahr der Familie, welcher Oberst desselben war, sich abconterfeien ließ. Ein anderer Saal zeigt bis hoch oben zur Decke hinan Portraits von alten Ritterpferden in Lebensgröße – vielleicht die einzigen, welche je irgendwo gemalt sind. – Unter den abgebildeten Pferden ist auch der berühmte »Kranich«, der Schimmel des Grafen Günther von Oldenburg, welcher so langes Mähnen- und Schweifhaar hatte, daß es weithin über die Erde schleifte und von Knechten nachgetragen werden mußte.
Wandert man von Thienhausen an einem andern Edelhof, dem der Freiherrn von Oeynhausen, Grevenburg, vorüber dem Kloster Marienmünster zu, so erblickt man auch bald zu seiner Linken, in einer Bucht des Waldgebirges den massiven breiten Thurm, welcher den Hauptüberrest eines zweiten Stammsitzes der Schwalenberger Grafen bildet, die Ruinen der Oldenburg, jetzt den Oeynhausen zuständig. Marienmünster wurde im Jahre 1128 von Widekind III. von Schwalenberg und seiner Gemahlin Luthrud gestiftet. Sie übergaben am Schwalenberger Waldgebirge zwölf Mönchen aus dem vier Stunden entfernten Corvei einen geräumigen Bezirk zur Urbarmachung; und da die Stiftungsurkunde die Bestimmung enthält, daß von dem Stifter nur Kirchlein, Klosterhaus und Wirthschaftsgebäude zu beschaffen seien, während der Bischof von Paderborn für die Ausstattung mit erledigten Lehngütern zu sorgen habe, so dürfen wir mit Recht annehmen, daß die Stiftung eines solchen Convents von fleißigen Benediktiner-Mönchen wohl nicht just aus bloßer Frömmigkeit geschah, sondern aus der sehr zu rechtfertigenden Absicht, dem wüsten gräflichen Waldgebiet ein Stück Culturleben zu gewinnen. Die Advokatie über das Kloster, die Gerichtsbarkeit mit Königsbann, hielten sich die Stifter ja vor: und gewiß litten sie keinen Schaden, wenn sie in einem Gebiete, das ihnen früher nichts als etwa einige ohnehin nicht mangelnde Jagdbeute an Bären und Dammwild lieferte, nun ein reiches blühendes Klosterwesen zu pflücken und dessen Grundholden zu besteuern bekamen. So mochte eine solche Klosterstiftung sehr oft nur eine Art staatswirthschaftlicher Anlage öffentlicher Fonds sein, nur anders wie heute, wo wir Fabriken Vorschüsse geben und Sümpfe trocken legen lassen – damit »die Steuerkraft des Landes sich hebe« – die Steuerkraft ist immer ein Augenpunkt zärtlicher Fürsorge der Herrschenden gewesen von Widekind III. von Schwalenberg an bis auf den heutigen Tag.
Hatte Graf Widekind III. bei seinem frommen Unterfangen die kleine weltliche Nebenabsicht, welche wir ihm unterschieben, so ist diese letztere sehr befriedigend in Erfüllung gegangen. Die Abtei Marienmünster erhielt reiche Geschenke und Begabungen von allen Seiten, und die Schwalenberger Grafen waren gewiß viel bedeutendere Herren, als sie eine Schirmvogtei über Benediktiner und ihre Meyer und Hörigen in diesem Waldland ausübten, denn vorher, wo sie an derselben Stelle nur Füchse und Hirsche zu jagen und abzuhäuten fanden. Man sieht auch, daß sie Geschmack am Klosterstiften bekamen... im folgenden Jahrhundert gründeten sie an der entgegengesetzten Seite des Gebirges in Falkenhagen das Nonnenkloster Lilienthal.
Die schöne Stiftskirche zu Marienmünster ist in neuerer Zeit restaurirt worden, auch die Klostergebäude und Wirthschaftshöfe sind weniger ruinirt und zernichtet, als es bei vielen andern der Fall ist. Leider hat die Kirche durchaus keine Epitaphien und Monumente mehr, außer dem Grabstein des Stifters. Marienmünster wurde 1804 aufgehoben.
Weniger als über die Grafen von Schwalenberg ist in alten Quellen und Diplomen über die von Stoppelberg zu finden. Der Stoppelberg ist eine isolirte konische Höhe, mit dürftigen Ueberresten einer alten Burg. Nach alten Geographen gehörte zu der Grafschaft Stoppelberg das Städtchen Steinheim, ein freundlicher Ort mit 2300 Einwohnern, einem schönen Brunnen auf dem Marktplatze und einer alten Kirche, deren Säulen so weit auseinander und aus dem Loth gewichen sind, daß man versucht wird, zu glauben, der Baumeister habe sie mit Fleiß so angelegt. An den Eingangsthüren der Kirche zeigt man Einkerbungen in dem Sandstein, die von den Schweden durch das Schleifen ihrer Schwerter gemacht sein sollen.
Unter Steinheim verengt sich das Thal der Emmer ( Ambra). Man gelangt nach Wöbbel, einem Sitze derer von Donop, einer alten Familie des Lippeschen Landes, der die Sängerin der »Schönheiten von Pyrmont,« die »gekrönte Poetin« Charlotte von Donop, geboren 1723, angehörte. Zur Linken der Chaussee steigen Hügelwände empor, die mit vortrefflichen Waldungen besetzt sind; die Emmer schlängelt sich durch Wiesengründe und jenseits steigen wieder die dicht bewaldeten Hänge empor. Dann erreichen wir das hübsch liegende Dorf Schieder, an das sich die fürstlich lippesche Sommerresidenz schließt; in einem nicht großen aber wohlgepflegten Parke liegt das einfache landhausartige Schloß, ein Gebäude, das aus der Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege stammen mag. Die Laubengänge hinter dem Schlosse mit der sich über dem schmal eingedämmten Emmerbett erhebenden, von prächtigen alten Kastanien überwölbten Terrasse bilden die hübscheste Partie der ganzen Anlage. Das Ganze hat einen freundlichen, idyllischen Charakter.
Schieder war ehemals eine dem Augustinerkloster in Blomberg gehörende Meierei, und wurde von diesem 1533 an die lippeschen Grafen verkauft. Es ist außer »Thietmelle« (Detmold) der einzige Ort des Fürstenthums Lippe, welcher bereits in der Zeit Karls des Großen erwähnt wird. Die Annalisten der Karolingischen Zeit erzählen übereinstimmend, daß der große Kaiser im Jahr 784 im Spätherbste mit einem großen Heere tief in das Sachsenland gezogen sei, daß er das Weihnachtsfest in der Villa Liudihi oder Liuhidi (Lügde) neben der sächsischen Feste Skidroburg am Flusse Ambra gefeiert und von da verwüstend bis nach Rehme vorgerückt sei. Einhard berichtet die Thatsache mit den Worten: » Rex autem congregato iterum exercitu in Saxoniam profectus est, celebratoque in castro natalicio domini die super Ambram fluvium in Pago Huettagoe juxta castrum Saxonum, quod dicitur Skidroburg, ad locum vocabulo Rimi, in quo Wisura et Waharna confluunt, populabundus accessit.« Das alte sächsische Kastell Skidroburg hat aber wohl nicht auf dem Platze des jetzigen Schieder gelegen, es ist auf dem Lügde näher liegenden Hermannsberge zu suchen. Dieser Berg zeigt jetzt noch schwache Spuren einer alten Befestigung, und wir wissen, daß Graf Hermann von Schwalenberg im Jahre 1187 »nach Zerstörung der alten Schiederburg« eine neue baute, die er Hermannsburg nannte, an deren Ausbau und Vollendung ihn aber der Abt von Corvei hinderte. Leider wird, nebenbei gesagt, durch diese Notiz die gang und gäbe Vorstellung vom Zusammenhange des Hermannsbergs mit dem großen Cheruskerfürsten gänzlich zerstört.
Was ferner von Schieder, das am Ende des folgenden Jahrhunderts, 889, als Schidara in einer Corveischen Urkunde genannt wird, zu bemerken, ist, daß es ursprünglich wie Enger und Herford zum Stammerbe des sächsischen Kaiserhauses gehört hat, wahrscheinlich ihm durch die Kaiserin Mathilde aus dem alten Eigen des großen Wittekind zugebracht. Kaiser Otto III. schenkte Schieder dem Erzstifte Magdeburg. Wie nun Enger seine kirchliche Stiftung, sein Kollegiatstift zum heiligen Dionysius hatte, muß auch Schieder irgend eine geistliche Stiftung von Bedeutung gehabt haben, die von dort vielleicht schon von Otto dem Großen, vielleicht von Otto III. bei Gelegenheit jener Schenkung nach Magdeburg übertragen wurde. Denn man kann sich sonst nicht wohl die merkwürdige Angabe eines Chronisten aus dem elften (?) Jahrhundert erklären, welcher (in der Sammlung von Leibnitz I. 260) behauptet: »Im Jahre des Herrn 783 stiftete er (Karl der Große) das siebente Bisthum in Schidere, einer Villa im Gebiete von Schwalenberg, das später durch die Sachsenherzoge Bruno und Tankmar nach Ballersleve, dann von Heinrich I. nach Vrose, einem Ort Nordthüringens, und endlich von Otto dem Großen nach Partinopolis, welches ist Magdeburg, verlegt wurde.« Wiewohl spätere Autoren vielfach die Nachricht von diesem vielwandernden Bisthum Schieder wiederholt haben, so ist an die Wahrheit der Thatsache doch nicht zu denken. Ein Bisthum Schieder hätte zwischen den es umgebenden Diöcesen gar keinen Raum gehabt.

Wir sind in das Land der Lippe eingetreten, in das lachend freundliche Gebiet, in welchem die Rose herrscht, und wollen uns von Schieder aus in seine Buchenwälder vertiefen. Eine trefflich gehaltene Chaussee führt uns nach dem Städtchen Horn, dessen einzige romantische Merkwürdigkeit in seinen Schlachtschwertirern besteht. Als die wackeren Bürger von Horn einst in einer grimmen Fehde ihres Edelherrn zur Lippe diesen aus den ihn umdrängenden Feinden herausgehauen oder gar ihn aus der Gefangenschaft durch Erstürmung einer feindlichen Burg befreit hatten, behielten sie die eroberten Waffen und Rüststücke als Andenken an ihre That: die folgenden Generationen bewahrten sie als theures Vätervermächtniß auf und heute noch erscheint mit diesen Waffen bekleidet die Gilde der Schlachtschwertirer, so oft eine Feier sie veranlaßt, sich zusammen zu schaaren. Auch in Attendorn sind die Bürger im Besitze von etwa 15 Ritter- und Knappenrüstungen, in denen sie jährlich an einem bestimmten Tage den »Heidentanz« aufführen. Das historische Herkommen ist unbekannt.
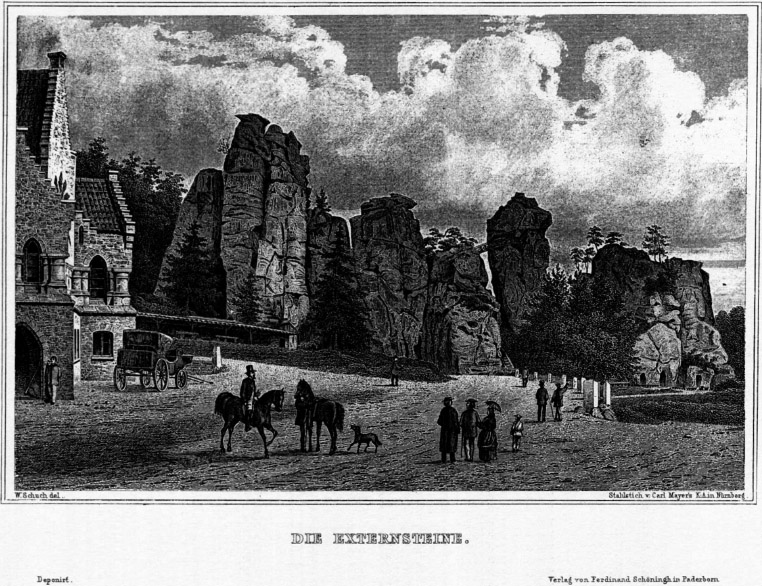
Dicht hinter Horn erheben sich die berühmten Extersteine. Wenn wir das Thor der kleinen Stadt verlassen haben, sehen wir alsbald die merkwürdigen Felsgebilde vor uns, quer vor die Chaussee gestellt, die nach Meinberg und Pyrmont führt. Sie ragen aus dem Fuße eines schmalen, baumleeren Bergrückens hervor, welcher der Knickhagen heißt und sich neben dem Hauptstock des Gebirges in derselben Richtung fortzieht. Die »Steine« – es sind ihrer im Ganzen dreizehn, bestehen aus einem feinkörnigen Sandstein und sind mit vielfachen Spalten und Rissen durchzogen, von denen die meisten von oben bis unten durch laufen und worin allerlei Gesträuch und grüne Vegetation Wurzel gefaßt hat. So gewährt die ganze Reihe der Felsen in einiger Entfernung den Anblick einer gewaltigen uralten Mauer, welche hie und da durchbrochen oder eingestürzt zu sein scheint.
Die Höhe der Steine ist verschieden – der höchste hat über dem Boden 125 Fuß – ebenso ist der Umfang sehr ungleich.
Der äußerste Felsen gegen Westen steigt zu jener Höhe von 125 Fuß steil empor, am Fuße bespült von einem kleinen See, den man aus dem die Steine durchrieselnden Bache, die Lichtheupte genannt, aufgestaut hat, zur Verschönerung der rings umher angebrachten Anlagen. Eine Treppe, die in den Felsen gehauen ist, führt auf den plattformartigen Gipfel, wo ein Tisch mit steinernen Bänken zum Ruhen einladet.
Der zweite Felsen in der Richtung nach Norden hin zeigt die groteskeste Gestalt; er überragt den ersteren, den er am Grunde fast berührt, nicht weil er höher ist, sondern weil er auf einer Erhöhung des Bodens steht. Der dritte, dicht neben dem zweiten, ist bedeutend niedriger. Auch an ihm sind Treppenstufen, die auf den Gipfel führen, angebracht, und von diesem Gipfel ist eine Brücke nach dem zweiten, zu den Resten einer alten Capelle hinübergeschlagen. Der vierte endlich steht vom dritten gerade so weit entfernt, daß er der Chaussee Raum gewährt, sich hindurch zu winden. Ein losgerissenes Felsstück ruht auf seiner Spitze und scheint jeden Augenblick die Wanderer, welche unten durch das Felsenthor schreiten, zerschmettern zu wollen, hat aber schon vor undenklichen Zeiten da gehangen. »Es hänget ein großer Stein auf der Höhe« – heißt es in der Lippeschen Chronik vom Jahre 1627, »der drauet, als wenn er jetzt fallen wolle; so der Wind stark wehet, so beweget er ihn – aber er bleibet gleichwohl hangen. Wie er aber oben angeheftet sei, das weiß Niemand als Gott selber.« –
Der fünfte Felsen ragt über die andern um etwa 15 Fuß fort, durch den Bergrücken um so viel emporgetragen; er beschließt die eigentliche und Hauptgruppe der Extersteine, die andern weiter ostwärts ragen nur noch mit den Gipfeln aus dem Bergrücken hervor.
Die eigentlichen Merkwürdigkeiten der Extersteine sind aber nicht allein ihre seltsamen grotesken Formen, sondern noch mehr die darin angebrachten Capellen und Kunstarbeiten. Das wichtigste und bedeutendste Denkmal uralter christlicher Sculptur ist das in halberhabener Arbeit an der Außenseite des ersten Felsens dargestellte Erlösungswerk. Zwar hat die Arbeit durch die Zeit und durch rohe Zerstörung von Menschenhänden gelitten, aber es ist im Ganzen genug erhalten, um die Bedeutung der einzelnen Gestalten zu erkennen. Das ganze Bild umfaßt zwei horizontal geschiedene Gruppen, von denen die obere, besser erhaltene die Kreuzabnahme, die untere aber Adam und Eva im Paradiese vorstellt. Beide Gruppen zusammen bilden gleichsam ein großes Altarbild, und sind das älteste bis jetzt bekannte deutsche Sculpturbild von so großer Ausdehnung. Die Höhe des ganzen Werkes beträgt 16 Fuß, wovon fast 12 Fuß auf die Kreuzabnahme kommen, seine Breite beträgt 12 ½ Fuß. Um so mehr ist es zu bedauern, daß solch ein in seiner Art ganz einzig dastehendes Denkmal urältester Kunst durch Verwitterung und durch Zerstörung so sehr gelitten hat, daß mehrere Figuren ganz verstümmelt und verletzt sind. Der Gestalt der heiligen Jungfrau fehlt der Kopf, der Kopf des Jüngers Johannes ist sehr beschädigt; Christus und Joseph von Arimathia haben beide den linken Arm, letzterer und Nicodemus auch die Beine verloren. Noch mehr als die obere Gruppe hat die untere gelitten, sie ist nur noch mit Mühe in manchen Theilen erkennbar. – Was den künstlerischen Werth der Arbeit angeht, so hat diesen schon Goethe anerkannt, nachdem ihm eine von Rauch verfertigte Zeichnung vorgelegt worden. »Die Composition des Bildes, sagt er, hat wegen Einfalt und Adel wirkliche Vorzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum (es ist ein Sessel) getreten zu sein, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Aufnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Vorzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Heilandes an das Antlitz der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja, durch ihre Hand sanft angedrückt wird; ein schönes, würdiges Zusammentreffen, das wir nirgends wiedergefunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In späteren Vorstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ausbrechend, sodann in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, bis sie zuletzt, bei Daniel Volterra, rücklings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden gesehen wird.«
Außer Goethe haben sich zahlreiche Kunstkenner und Kunstschriftsteller mit den Extersteinen beschäftigt. »Die Composition der Kreuzabnahme, so lautet eines dieser Urtheile, ist durchdacht und mit Freiheit hingestellt; die Figuren mit dem Kreuze füllen den quadratischen Raum aufs beste; es ist nirgends eine Leere zu bemerken, selbst die Glaubensfahne, welche Gott der Vater (?) hält, dient dazu, um die Stelle ihm gegenüber symmetrisch zu füllen. Namentlich sind die Gewänder zu loben. Sie sind mit gutem Verständniß der darunter liegenden Formen in große einfache Falten gelegt. Die Ausführung derselben ist genau, ohne ängstlich zu sein. Die langen Gewänder der Maria, so wie der gefältete Leibrock des auf dem Stuhle stehenden Mannes (Joseph von Arimathia), zeugen von einem wahrhaft feinen Kunstsinn. Die Größe der Figur Christi, die um ein ganz bedeutendes länger ist als die der übrigen Gestalten, hat man nicht ganz mit Unrecht getadelt. Mag man immerhin zur Entschuldigung des Künstlers vorbringen, er habe nur durch die Größe den Gottmenschen noch im Tode hervorheben können, so ist diese Hervorhebung doch eine gar zu stark accentuirte geworden, die das Verhältniß stört; überhaupt sind die Figuren ein wenig zu lang und hager ausgefallen – aber das lag ja einmal in dem charakteristischen Style der mittelaltrigen Kunst.« –
In demselben Felsen, an welchem sich das besprochene Bild befindet, ist eine kleine dunkle Capelle angebracht. Sie bildet ein längliches Rechteck von 34 Fuß Länge und 11 Fuß Breite; die Höhe beträgt 10 Fuß; sie hat drei Eingänge: neben einem derselben steht unter behauenem Felsenüberhange eine aus der Felswand halbhervortretende Steingestalt von Lebensgröße; in der rechten Hand hält sie einen gewaltigen Schlüssel, der sie als den Apostel Petrus bezeichnet. Die Linke scheint sich auf ein Schwert gestützt zu haben, sie ist aber verstümmelt. – Auf der Spitze des zweiten Felsens ist oben in schwindelnder Höhe eine zweite Capelle ausgehauen, deren Grundfläche 70 Fuß vom Boden entfernt ist. Letztere bildet ein längliches Rechteck von 18 Fuß Länge und 10–18 Fuß Breite. Die ganze Architektur sowohl dieser als auch der untern Capelle gehört der Byzantinik oder dem neugriechischen Baustyle an, welcher vom Anfange des 11. Jahrhunderts bis in das erste Viertel des dreizehnten bei uns der allein herrschende war. Hält man die Rundbogen der Capelle mit dem ganzen plastischen Gepräge der Sculptur-Arbeit zusammen, so sieht man sich genöthigt, das 12. Jahrhundert als Entstehungszeit dieser Werke anzunehmen. Wir haben aber auch einen ganz bestimmten Anhaltspunkt, um die Zeit der Entstehung angeben zu können, nämlich eine in der untern Capelle befindliche Inschrift, welche zu lesen ist:
Dedicatum Anno ab incarnatione Domini M.C.X.V. die IIII. Kalendas....
Die Capelle ist also 1115 eingeweiht, und so ist anzunehmen, daß die Arbeiten an den Extersteinen in den ersten Jahren des 12. Jahrhunderts begonnen sind. –
Sehen wir uns nun nach dem um, was man über die Geschichte der Extersteine erforscht und festgestellt hat. Wohl ohne Zweifel bedeutet ihr Name nichts Anderes und nichts Tiefsinnigeres als einfach Elstersteine, denn »Aeckster« ist in ganz Westphalen der Name für Elster, und wie man Falken-Eulen-Raben-Steine hat, kann man sich auch die Wortbildung Elstersteine gefallen lassen. Am verfehltesten scheint uns die Erklärung Jakob Grimms: »In den Urkunden, sagt er, steht Agisterstein, Egesterenstein. Für den vielgedeuteten Namen läge doch nichts näher als das althochdeutsche und gewiß auch altsächsische êgester, egesteren: ehegestern, vorgestern – was dem gestern vorausgeht, bezeichnet lange Vergangenheit – es sind Felsen, nicht von heute, auch nicht von gestern, sondern von vorgestern, aus grauem Alterthume.« –
Aus dem Jahre 1093 stammt die erste historische Kunde, welche uns über die Extersteine erhalten ist. Damals gehörte die Gegend umher mit den Felsen einem Adalingsgeschlechte; es sind uns die Namen Imico, und Erpho, des Imico Sohn, aufbewahrt. Imico starb, sein Sohn folgte ihm ohne Nachkommen zu hinterlassen, und nun verkaufte Imico's Wittwe, Ida, dem Abte des Klosters Abdinghof zu Paderborn, Gumbert, für vierzehn Mark Silber und andere Geschenke Imico's früheres Besitzthum. Der Bischof Heinrich II. von Paderborn bestätigte diesen Kauf und stellte darüber eine Urkunde aus, welche diese Thatsachen enthält und uns durch den Jesuiten Schaten in dessen Annalen erhalten ist. Die Extersteine kamen also an die fleißigen, für die Cultur, den Ackerbau und die Versittlichung Deutschlands überall so thätigen Benediktiner-Mönche, die auf den meisten ihrer Besitzungen mit dem Baue von Kirchen oder Capellen begannen, wobei sie gewöhnlich selber den Hammer und den Meißel führten; und so haben wir ganz einfach die Architekten wie die Bildhauer, die den Extersteinen ihre jetzige Gestalt und ihren Schmuck gaben, unter den Benediktinern von Abdinghof zu suchen. Diese sorgten denn auch für die Abwartung des Gottesdienstes in dem, dem heiligen Kreuze gewidmeten Steinkirchlein; sie stifteten später in dem Städtchen Horn eine Pfründe, deren Inhaber die Messe in der Felsenkapelle las, und den zahlreichen Wallfahrern, welche dahin zogen, die Sakramente reichte. Später siedelten sich Clausner oder Eremiten dort an – vielleicht in der unteren Capelle, die seit Ausführung der obern nicht mehr für den Gottesdienst nöthig war. Sie wohnten bis gegen das Ende des 16. Jahrhunderts dort. Die Reformation aber, welche im ganzen Lippeschen Lande Fuß faßte, machte der Andacht an den Extersteinen ein Ende, und endlich zog Graf Simon von der Lippe als Landesherr das Beneficium an den Extersteinen ein – unter dem Vorwande, wie man erzählt, daß die Clausner wie Räuber und Diebe gehaust, nachdem ihnen der Unterhalt entzogen worden. – Die Güter wurden dann der Schule zu Horn zugewiesen.
Im Jahre 1654 wurde der Großherzog Ferdinand von Toskana auf den Gedanken gebracht, die Eggestersteine durch Kauf zu erstehen. Die Verhandlungen mit der gräflich Lippeschen Regierung wurden durch einen Paderborner Domherrn und durch den Landdrosten Levin Moritz von Donop geführt. Von Seiten des Großherzogs wurden 60,000 Kronen für die Steine geboten; Lippe'scher Seits wurden aber die Verhandlungen abgebrochen, wahrscheinlich, weil man die Wiedereinführung katholischen Gottesdienstes fürchtete, wenn man einem katholischen Fürsten den Platz einräumte.
Bald nach jenen Verhandlungen ließ der Graf Herrmann Adolph zur Lippe bei den Extersteinen ein Jagdhaus erbauen und verschiedene andere Arbeiten vornehmen; in der Nähe des Hauptfelsens ließ er einen Thurm mit einer Treppe bauen; vor den drei ersten Felsen ließ er einen Platz mit einer Mauer umgeben. Nach seinem Tode 1666 verfielen diese Bauten wieder, das Jagdhaus wurde endlich abgebrochen und ein Wirthshaus an seiner Stelle errichtet, da, wo ein neueres jetzt die Wanderer, welche von den benachbarten Badeorten aus die große Merkwürdigkeit des Teutoburger Waldes besuchen, mit guten Erfrischungen labt.
In der alten Capelle aber mußte eine Zeit hindurch ein Förster mit seiner Familie wohnen, der natürlich, was ihm von der alten Einrichtung hinderlich war, beseitigte. Noch größer war die Zerstörung, als im Jahre 1756 ein fürstlicher Beamter in Horn die Erlaubniß erhielt, von dem verfallenen Mauerwerk an den Extersteinen sich die Steine zum Neubau eines Hauses zu holen. Was noch von Herrmann Adolphs Anlagen übrig war, wurde niedergerissen – wer weiß, wie viel von den alten Kunstarbeiten dabei zerstört ist!
Erst die Fürstin Pauline zur Lippe wandte im Anfange dieses Jahrhunderts neue Aufmerksamkeit den Extersteinen zu. Sie ließ rund umher aufräumen und dann an dem Felsen, der die Grotte enthält, 43 Stufen anbringen, auf denen man eine aus früherer Zeit stammende höher liegende Treppe von 45 in den Stein gehauenen Stufen erreichte, so daß nun der Gipfel zugänglich wurde. Dieser Gipfel, welcher einen Raum von 21 Fuß Länge und 8 ½ Fuß Breite bietet, wurde mit einer Art Balustrade umgeben, mit steinernen Bänken und Tisch versehen. Von dem dritten Felsen, an dem sich ebenfalls schon eine Treppe befand, wurde eine Brücke nach dem zweiten hinübergeschlagen. Die Kunststraße, welche zwischen zwei der Felsen hindurchführt, wurde 1815 vollendet. Einige parkartige Anlagen umher kamen dann hinzu, dem Ganzen eine würdigere Umgebung zu schaffen.
Man hat vielfach den Extersteinen eine Bedeutung als Tempel und Opferplatz schon in vorchristlicher Zeit zugeschrieben. Wir enthalten uns jedoch, auf dies Thema, bei dem man ohnehin über Vermuthungen nicht hinauskommt, einzugehen, und verweisen darüber auf die ziemlich reichliche Literatur, welche sich mit den Extersteinen beschäftigt. Namentlich das Werk von Giefers: Die Extersteine im Fürstenthum Lippe-Detmold, Paderborn 1851, neue Auflage 1867, dem wir hier gefolgt sind.
Nur noch eine Sage von den Extersteinen wollen wir erzählen. Sie lautet: Der Teufel hat einmal in alter Zeit, als die Andacht an den Extersteinen noch im Schwange war, die Felsen einstürzen wollen und hat sich deshalb mit aller Macht gegen sie gestemmt, hat sie aber doch nicht umwerfen können; so mächtig aber hat er dagegen gedrängt, daß sich sein Rücken, wie man noch sehen kann, tief in den Stein gedrückt, auch die lichte Lohe dabei herausgefahren ist und ihren Brandfleck an den Felsen hinterlassen hat. Jetzt indeß ist dieser nicht mehr zu sehen, da er von Erde und Buschwerk bedeckt ist.
Von dem großen Steine, der hart über der Heerstraße hängt, sagt man, er werde einst herabstürzen und eine Lippesche Fürstin zerschmettern. Nach Gisbert Frhrn Vincke's gelungener Bearbeitung der Sage hat den Stein der Teufel in seiner Wuth über den christlichen Gottesdienst an den Extersteinen dahin geschleudert. Sagen und Bilder aus Westphalen, Hamm 1857.
Wenn nicht ein schöner und preiswürdiger Gedanke, wie so mancher andere löbliche Vorsatz in dieser Welt, an dem starren und schwer in Fluß zu bringenden Realismus der Dinge gescheitert wäre, so würde sich vor den Augen des Wanderers, welcher sich von den Extersteinen her weiter in den Teutoburger Wald vertieft, jetzt ein mächtiges und imposantes Denkmal unserer Heroenzeit – jener Zeit, als auf dem Boden der rothen Erde die deutsche Geschichte ihre Taufe mit Strömen Römerbluts erhielt –, erheben, und ihm weit in die Ferne entgegenleuchten. Auf einer der Höhen in der Nähe Detmolds, der weithin sichtbaren Grotenburg, steht seit Jahren schon der Unterbau des Hermannsdenkmals vollendet. Das kolossale Standbild Armins, NachtragIm kapitolinischen Museum zu Rom befindet sich eine Marmorbüste, welche höchst wahrscheinlich den Cherusker Armin darstellt, wie Dr. Emil Braun in seiner Schrift über römische Kunstdenkmale nachgewiesen hat. Die Büste trägt das ausgebildetste deutsche Gepräge; dem gekräuselten Haare glaubt man das helle Blond anzusehen. – das 40 Schuh hoch darüber emporsteigen sollte, ist ebenfalls begonnen, und, nachdem es viele Jahre verlassen (im Detmolder Museum) gelegen, auf's Neue in Arbeit genommen, so daß seine endliche Herstellung in sichrer Aussicht steht. In der That ist es jetzt, wo die Summe, welche zur gänzlichen Vollendung noch fehlt, eine vergleichungsweise so geringe ist, wo unserem westphälischen Lande die Entwicklung der letzten Jahre eine so gesteigerte Lebensthätigkeit und damit ein gesteigertes Selbstbewußtsein gebracht hat, eine Art Ehrensache für die Söhne der rothen Erde, das einmal begonnene auch nun zu enden. Es ist ganz richtig, daß Hermann nicht mehr als Individualität im deutschen Volke lebt, daß wir keine bestimmten Fingerzeige haben, wie wir sein Standbild entwerfen, gewanden und ausstatten sollen...., und was man sonst gegen die Idee vorgebracht hat, ihn in einem mächtigen Monumente zu erhöhen. Aber diese Einwürfe sind unhaltbar, weil sie, konsequent verfolgt, die Standbilder, die man noch errichten dürfte, in einen sehr engen Kreis bannen würden. War es nicht bei Gottfried von Bouillon fast dasselbe? Ist es nicht ganz dasselbe bei den Standbildern der Jungfrau von Orleans, oder Karls des Großen, oder des Vercingetorix, oder gar bei jenen Denksäulen römischer Kaiser, mächtiger Helden wie des Ritters Roland, mit denen unsere mittelaltrigen Städte ihre freien Plätze, ihre schönen Brunnen schmückten? Fielen nicht am Ende auch alle Heiligenstatuen in unsern Kirchen fort?
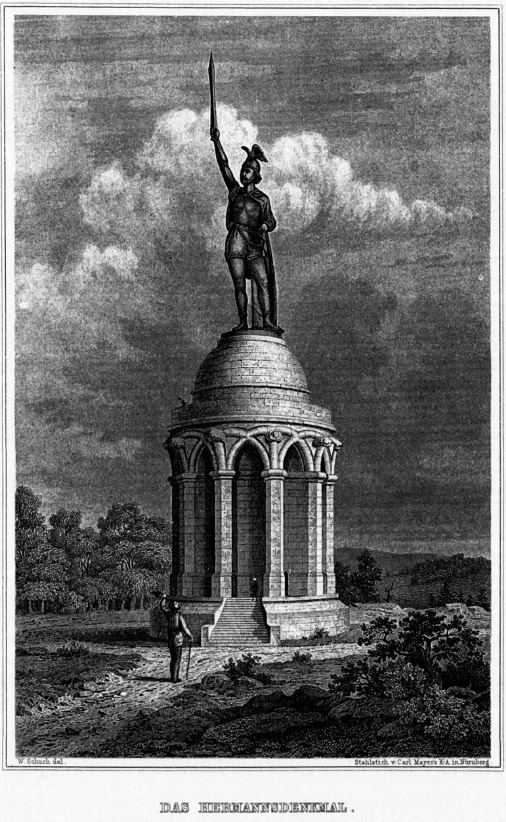
Die Idee, dem großen Cheruskerfürsten ein Denkmal zu errichten, tauchte von dem Bildhauer E. von Bandel aus Ansbach angeregt, in einer sehr ungünstigen Zeit auf, in einer Zeit, wo man in Deutschland sich in einer ganz besonders kosmopolitischen Stimmung befand – nach der Juli-Revolution, die bei uns zu jedem andern, nur nicht zur Erhöhung eines gesunden und tüchtigen Nationalgefühls führte. Das junge Deutschland beherrschte die Literatur und predigte Weltbürgerthum. Ihm schien der Mann, der am Thore der deutschen Geschichte steht, eine sehr »austrogothische« Figur; der Gedanke, ihn zu verherrlichen, wurde als romantische Grille lächerlich gemacht. Heute, Gott lob, stehen wir auf andern Standpunkten – heute,
wo zum eignen Geist
Das ganze Volk in seinem Drang sich wendet,
Und huldigend in schöner Treue preist
Was Großes in ihm selber sich vollendet –
Nicht kniend mehr vor fremder Götter Bilde
Nicht fremder Größe träumend unterthan –
heute wird man schwerlich den Gedanken, eine unsrer Waldhöhen mit einem mächtigen, an die folgenreichste Thatsache unsrer ältesten Geschichte mahnenden Denkmal zu krönen, unpassend finden, und so, das ist unser bescheidener Wunsch, möge das reiche westphälische Land des der Vollendung sich nahenden Standbildes gedenken und durch die geringen Opferspenden, von denen diese Vollendung bedingt ist, die Idee endlich zur That werden lassen.
Unsere Abbildung stellt die Denksäule dar, wie sie vor einem halben Menschenalter ursprünglich entworfen wurde – von dem Bildhauer E. von Bandel aus Ansbach, welcher den Gedanken ursprünglich angeregt hat und bis heute für ihn thätig gewesen ist. Der Grundstein zu dem Unterbau wurde am 8. Sept. 1841 gelegt, am 17. Juni 1846 der letzte Stein in die Kuppelwölbung gesetzt – das aus Quadersandsteinen aufgeführte Werk mißt 93 Fuß Höhe. Die aus getriebenem Kupfer hergestellte Statue soll bis zur Spitze des erhobenen Schwerts 90 Fuß Höhe erhalten.
Uns bleibt noch übrig, auf die mittelaltrige Vergangenheit des Fürstenthums Lippe zurückzublicken. Die Herrscher dieses kleinen blühenden Landes, voll einer dicht gedrängten betriebsamen Bevölkerung, stammen von einer edlen Familie her, die unter Kaiser Lothar dem Sachsen als an der Lippe begütert genannt wird; deshalb heißen sie Jungherrn oder edle Herrn »tho der Lippe«. Ihr ältester Sitz soll Lipperode, ein Ort jenseits des Osnings gewesen sein, und Lippstadt ihnen seine Entstehung verdanken. Die Herrschaft diesseits des Osnings, das Fürstenthum Lippe erhielten sie als ein Lehn der Paderbornischen Kirche im zwölften Jahrhundert, in welchem der Stammvater der jetzigen beiden Linien, der Fürsten von Lippe-Detmold und der von Lippe-Bückeburg, Bernhard II. auftritt. Nach ihm war das Geschlecht besonders reich an Gliedern, die sich dem Dienste der Kirche widmeten; man zählt zwei Erzbischöfe, sechs Bischöfe, sechs Dompröbste, einen Kreuzritter darunter in einem Zeitraum von 150 Jahren. Diese kirchliche Richtung mochte der Ahnherr Bernhard selbst seiner Familie gegeben haben, ein Mann, der ein so ereigniß- und thatenreiches Leben führte, daß man ihn den Lippischen Odysseus genannt hat, und in ihm den Vorwurf zu einem epischen Gedichte sehen konnte. Der Verfasser desselben hieß Justinus und verdankte seine Erziehung wie seine Stiftspfründe zu Höxter einem Gliede der Lippischen Dynastenfamilie; aus Dankbarkeit dafür scheint er den Ahnherrn derselben besungen zu haben, wie auch Dankbarkeit gegen einen spätern Bernhard eine Uebersetzung des Gedichts durch die Stiftsjungfrauen zu Lippstadt veranlaßte. Es ist nämlich in lateinischer Sprache in regelrechtem elegischen Versmaße geschrieben und erzählt, wie der Graf Bernhard, anfangs dem geistlichen Stande gewidmet, durch den Tod eines ältern Bruders zur Regierung berufen, sich in allem ritterlichen Werke ausgezeichnet, dann von Feinden aus dem Lande getrieben, durch eine List sich wieder zu seinem Rechte verholfen habe: er habe nämlich das Landvolk aufgeboten und sei damit wieder in seine Gränzen eingezogen, nachdem er den Bauern befohlen, ihre Pflugschaaren und eisernen Ackergeräthe glänzend blank zu scheuern und wie ritterliche Waffen zu erheben. Als nun seiner Feinde Späher von den besetzten Warten herab ihn anrücken sahen, glaubten sie, ein Heer gerüsteter Ritter ziehe heran, und Alles begab sich in panischem Schrecken auf die Flucht. So erhielt Graf Bernhard sein Land wieder. Er zieht darauf zum Reichstag, was seinem Sänger Veranlassung zu der schönsten Episode gibt, welche die Pracht des kaiserlichen Hoflagers, den Reichthum und die Tugenden der Großen des Reichs, den Prunk und den Glanz ihrer Gezelte, ihrer Mahlzeiten, ihrer Gewänder beschreibt. Vor dem versammelten Hofe erscheint Graf Bernhard in würdigstem Aufzuge: Justinus läßt vor ihm die Hörner tönen, die Lauten erklingen, die Flöten lispeln und die Pauken schlagen, daß Alle ob der Herrlichkeit staunen. Der Kaiser forscht, wer und von wannen die Kommenden seien, und heißt sie sich setzen; sie aber werfen ihre reichgestickten Mäntel ab, um sich darauf niederzulassen. Nachdem nun die Reichsgeschäfte beendet sind und Alle zum Fortgehen sich erheben, lassen Bernhard und seine Begleiter ihre Mäntel am Boden liegen, und daran gewohnt, spricht Bernhard: »Es ist nicht Sitte in unserm Lande, daß ein ehrlicher Mann die Sessel mit sich forttrage, auf denen er saß.« Durch solches ritterliches Gehaben erwirbt er sich bald die Gunst des Kaisers und erhält von ihm, was er am Hofe suchte, die Erlaubniß eine neue Burg in seinem Lande erbauen zu dürfen. Da errichtet er an der Lippe die Burg gleiches Namens.
Eine harte Krankheit raubt ihm nicht lange nachher den Gebrauch seiner Glieder, aber er läßt sich in einem Tragsessel umhertragen, um so bei den Kämpfen in seinen Fehden gegenwärtig zu sein. Doch erinnern ihn seine Leiden an seine frühere Bestimmung für den Dienst Gottes und der Kirche; deshalb entsagt er der irdischen Hoheit und der Herrschaft, die er seinem Sohne Herrmann anvertraut, trennt sich von seiner Gemahlin, einer Gräfin von Are, und von seinen elf Kindern, um sich in den Orden der Cistercienser zu begeben und ein Mönch in der Abtei Marienfeld im Münsterlande zu werden. Aber hier das stolze Ritterhaupt kahl geschoren unter die Obedienz drücken zu müssen und die rauhe Kutte statt des goldgestickten Sammts zu tragen, dünkt ihm bald nicht Ascese genug; er will auch noch um seines Erlösers willen aus dem Vaterlande verbannt sein und läßt sich nach Dünamünde versetzen, wo die Mönche ihn jedoch zum Abte erwählen.
Auch in Dünamünde läßt es den Lippischen Odysseus nicht lange ruhen: bald sieht ihn der römische Pontifex zu seinen Füßen knien, um die Erlaubniß des heiligen Vaters auszuwirken, das Kreuz gegen die heidnischen Liefländer predigen zu dürfen; denn er hatte in seiner neuen Heimath, am Baltischen Meere, von den harten Verfolgungen vernommen, welche über die Christen in Liefland gebracht seien. Die Bitte wird ihm gewährt und er selbst wird zum Bischofe von Semgallen ernannt; sein zweiter Sohn, Otto, der schon Bischof von Utrecht ist, während sein ältester Sohn Gerhard den erzbischöflichen Stuhl der Domkirche zu Bremen inne hat, weiht den Vater dazu mit dem heiligen Oele ein, und setzt ihm die Inful auf die hohe, von lichter Begeisterung glühende, auf die väterliche Stirn! Ein rührendes Bild, das uns Justinus entrollt! Wie lebendig dieser Bischof von Utrecht vor uns steht, der seinem eignen Vater die Mitra auf das geliebte, theure Haupt setzt! Man sieht sie vor dem Hochaltare ihrer Cathedrale, die beiden Männer, wie die hohe, von ihren Jahren ungebeugte Gestalt des Vaters vor dem Sohne kniet, wie er in frommer Andacht und voll Ehrfurcht vor der höheren Würde des schon Gesalbten zu ihm aufblickt, ein Haupt mit heldenkräftigen und doch weichen Zügen, denen eine Idee voll unendlicher Begeisterungsmacht ihr flammendes Siegel aufgeprägt hat, daß es aussieht, als ob der goldne Hintergrund, welchen das Gewand seines Sohnes bildet, der Heiligenschein sein müsse, der in voller Glorie um dies Haupt loht! Man sieht den Sohn, wie seine Hände zittern, in denen er die Inful hält, wie der Edelsteinblitzende Hirtenstab ihm an die Brust zurückgefallen ist, wie Thränen sein blühendes Gesicht netzen, als nun in Triumphesfreudigen Klängen das erhebende Tedeum durch die Gewölbe der Cathedrale schwillt! – Es war ein glücklicher Mann, dieser Bischof Otto von Utrecht! glücklicher vielleicht als ein Kaiser, der seiner Geliebten das Diadem durch die Locken schlingen kann! – – – Der Bischof Bernhard predigte nun das Kreuz, sammelte Ritter, Waffen und Rosse und stritt siegreich zu Gottes Ehre gegen die Heiden: alt und lebenssatt legte er sich zu Lehal in Liefland endlich zum Sterben hin, und hauchte seine Seele in Gottes Hände aus; seine Leiche ward nach Dünamünde gebracht und harrt dort einer fröhlichen Auferstehung. Vergl. Dr. A. Hechelmann, Bernhard II., Edelherr zur Lippe. Münster 1866, wo das Thatsächliche ermittelt und klar gestellt ist. –
Die folgenden Herrn zu der Lippe waren besonders glücklich in ihren Heirathen, welche ihnen den Besitz der Herrschaft Rheda, eines Theils der Grafschaft Schwalenberg, der Herrschaft Stoppelberg und die beiden Grafschaften Pyrmont und Spiegelberg verschafften; unglückliche Fehden brachten sie jedoch um fast alle diese Erwerbungen wieder. Doch hatte Bernhard VI. das Glück, in einer Fehde mit Herzog Heinrich von Braunschweig, der ihn bekriegte, weil er auf seiner Burg Varenholz ungetreuen Vasallen des Herzogs Schutz gegeben hatte, diesen mächtigen Feind am Odernberge, den 19. November 1404, aufs Haupt zu schlagen und den Herzog selbst gefangen zu bekommen. Dieser wurde in das feste Bergschloß auf dem Falkenberge, einer der Höhen des Osnings eingesperrt, und zwar in so harter Haft, daß er den Gebrauch seiner Glieder dadurch verlor: anno domini 1404, sagt eine alte Chronik, do wart Hinrick van Luneborch gefangen van Her Bernde van der Lippe unde wart gefort up den Valkenberg, dar helt en de Here strenglicken ein jar umb, dat he na up Krücken moste gan, do he los wart. Diese grausame Behandlung mag die Gemahlin des Gefangenen bewogen haben, persönlich bei dem Sieger um die Befreiung des Herzogs zu flehen, ein Schritt, welcher der Geschichte unbekannt, aber von dem folgenden Volksliede verherrlicht ist:
Jk sag minen Heren van Falkensteen
To siner Borg op rieden,
En Schild förte he beneven sik her,
Blank Schwerd an siner Sieden.
»God gröte ju Heren van Falkensteen;
»Sy ji des Land's en Here?
»Ei so gebet mek weder den Gefang'nen min,
»Um aller Jungfrou'n Ere!
De Gefangene, den ik gefangen hebb',
De is mi worden suer,
De liegt tom Falkensteen in dem Thoorn,
Darin sal he vervulen.
»Sal he dan tom Falkensteen in dem Thoorn,
»Sal he darin vervulen?
»Ei so wil ik wal jegen de Müren treen,
»Un helpen Leefken truren.
Un as se wal jegen de Müren trat,
Hört se sien Leefken d'rinne.
»Sal ik ju helpen? dat ik nig kan,
»Dat nimt mi Wit un Sinne.
Na Hus, na Hus, mine Jungfroue zart,
Un tröst jue arme Weysen.
Nemt ju op dat Jar enen andern Man,
De ju kan helpen truren.
»Nem ik op dat Jar enen andern Man,
»By eme möst ik slapen.
»So leet ik dan ok jo min Truren nig,
»Slög he mine arme Weysen.
»Ei so wolt ik, dat ik enen Zelter hedd,
»Un alle Jungfrou'n rieden,
»So wolt ik met Heren van Falkensteen,
»Um min fien Leefken strieden.
Oh ne, oh ne, mine Jungfrou zart;
Des möst ik dregen Schande,
Nemt ji ju Leefken wal by de Hand,
Trek ju met ut' dem Lande.
»Ut dinem Lande trek ik so nig,
»Du gifst mi dan en Schriven,
»Wenn ik nu komme in fremde Land,
»Dat ik darin kann bliven. –
As se wal in en grot Hede kam
Wal lude ward se singen:
»Nu kan ik den Heren van Falkensteen
»Met minen Worden twingen.
»Do ik dit nu nig hene segen kan,
»Do will ik doen hen schrifen,
»Dat ik den Heren van Falkensteen
»Met minen Worden kont twingen.

Die Befreiung des Herzogs wurde jedoch seiner Gemahlin nicht so leicht, wie es das Lied angibt; erst im Juni 1405 wurde er gegen das Versprechen eines Lösegelds von 100,000 Rheinischen Goldgulden und nach Stellung von zwei Landesherrn und 26 Rittern als Bürgen, nachdem er eidlich die Urfehde gelobt, seiner Haft entlassen von dem »Herrn von Falkenstein«, der in der Volksromanze so edelmüthig ist. Aber wieder in seine Burgen heimgekehrt und unter seinen Baronen, scheint der Vertrag sich ihm in ganz andrem Lichte gezeigt zu haben wie damals, als er noch in der engen Fürstenkammer auf dem Falkenberge saß, die man noch im vorigen Jahrhundert unter den Ruinen des Schlosses zeigte, als sprechenden Beweis, mit welch' unbequemen, von allem Luxus entblößten Räumen die Fürsten des fünfzehnten Jahrhunderts sich zu begnügen wußten – ein Gemach, um den leidenschaftlichsten Rococo-Liebhaber sein Steckenpferd für immer darin aufstellen zu lassen. Genug, der Hertoghe Hinrick, de toch to Rome unde leyt sick von dem eyd absolveren unde toch in des greven van der Lippe Land unde brende reyn aff dat do was, da wart nich vele gerovet. Zudem wurde die Reichsacht über Bernhard VI. und seinen Sohn Simon, die edlen Herrn zur Lippe verhängt; ganz Westphalen und Niedersachsen stand gegen sie auf und ihr Gebiet wurde mit Feuer und Schwert verwüstet. Nur der Churfürst Friedrich von Cöln, der Grossohm der Gemahlin Bernhards, einer Gräfin von Moeurs, verwandte sich für sie, und so gelang es ihnen endlich, dem völligen Untergange und der verdienten Strafe für die unritterlich grausame Behandlung ihres Gefangenen durch Vergleichsverträge zu entgehen.

Bernhard VII., der kriegerische, († 1511) verkaufte die schon früher verpfändete Hälfte von Lippstadt an den Herzog von Cleve, wodurch dieser Gebietstheil an Preußen, den Erben der Clevischen Lande gekommen ist. Unter ihm verwandelte der Böhmerkrieg das Land in eine Einöde, 60,000 raublustiger wilder Böhmen, welche der Erzbischof von Cöln, Graf Dietrich von Moeurs, als Hülfstruppen in seiner Fehde mit der Stadt Soest brauchte, fielen von Höxter her im Jahre 1447 in das Land ein; denn Bernhard VII. war der Bundesgenosse des Herzogs von Cleve, in dessen Schutz sich die angegriffene Reichsstadt während dieser berühmten »Soester Fehde« gestellt hatte. Der damals erst 18jährige Edelherr zur Lippe mußte bei diesem Einfall in eine Tonne verschlossen zu Schiffe sich die Weser hinunter retten, bis ihn schützend die Schauenburg in ihren Mauern aufnahm.
Die alten Edelherrn zur Lippe saßen auf ihren Burgen zu Lipperode, Vornholte, Blomberg und namentlich Brake, einem jetzt sehr verfallenen und wüsten, großen Burgbau aus dem 16. Jahrhundert, der in der unmittelbaren Nähe der ersten Stadt des Landes, des alten Lemgo liegt, das, einst der Hansa angehörend, in seinen Bauwerken Zeugnisse früherer größerer Bedeutung aufweist – in seinen mittelalterlichen Giebeln und in seinen Kirchen, von denen die Nicolai- und die Marienkirche beachtenswerth sind. Jene stammt aus der Uebergangsperiode, ist durch Zusatzbauten im 13. und 15. Jahrhundert erweitert und zeigt ein sehr reiches Nordportal. Die Marienkirche ist eine frühgothische Hallenkirche mit Chorfenstern voll schönen Maßwerks und Denkmälern eines Lippischen Grafenpaares. Daneben ist das Rathhaus zu Lemgo beachtenswerth, es ist ein spätgothischer Bau mit Anbauten aus der Renaissance-Zeit – einer der Giebel zeigt die Jahreszahl 1589. Auch einen »Fürstenhof« hat Lemgo; doch nicht hierher, sondern nach Detmold verlegten die Edelherrn von der Lippe im 16. Jahrhundert, in welchem sie auch den Grafentitel annahmen, ihre stehende Residenz, als die Bedürfnisse einer moderner gestalteten Regierung sie zwangen, ihren Sitz aus einer ländlichen Burg in einen größeren Ort zu verlegen. Doch haben sie in diesem Detmold – Thietmelle wird es von dem Annalisten genannt, welcher berichtet, daß hier Karl der Große einen großen Sieg über die Sachsen erfochten, der, durch eine zweite Schlacht an der Hase im Osnabrück'schen vervollständigt, im Jahre 783 die Unterjochung Westphalens entschied – sich nur bescheidene und anspruchlose Wohnsitze geschaffen. Monumente der Baukunst von Bedeutung fehlen. Ein beachtenswerthes Museum ist im Entstehen begriffen. So scheiden wir ohne viel Bilder, doch nicht ohne Erinnerungen mit fortzutragen aus der reizend freundlichen kleinen Stadt – Erinnerungen an Grabbe, den »lapidarischen Dramatiker,« der hier 1801 geboren wurde, an die treffliche Fürstin und Regentin Pauline zur Lippe, welche 1820 hier starb. –
Die schönsten Partien, die man von Detmold aus machen kann, sind die zum Falkenberge, auf die Grotenburg oder den Teut, und die, welche diesen Berg zur Linken lassend, durch die Schlucht, welche er mit seinem westlichen Nachbar bildet, dann links um die Grotenburg herum, immer durch die herrlichsten Buchenwaldungen und Eichenhaine, zum Petri-Stieg führt, wo eine schöne weitgedehnte Aussicht sich bietet auf ein reich bevölkertes und bebautes Land, dem nur die Windungen und Gestade eines großen silberwogigen Stromes fehlen, um sich kühn berühmteren Aussichten unseres Vaterlandes an die Seite stellen zu dürfen. Zunächst im Thale unten liegt das Dorf Heiligenkirchen, das aus seinem grünen Laube mit den rothen Ziegeldächern, dem hohen Thurme und der pittoresken alten Kirche freundlich hervorschaut; das schattige Thal der »Berlebecke« führt unten von Detmold her zu diesem reizend gelegenen Orte, der, einer der ältesten im ganzen Ländchen, schon 1036 in einer Urkunde vorkommt; ja Karl der Große selbst soll die Kirche den Heiligen gestiftet haben, welche ihm zu seinem Siege über die Sachsen bei Thietmelle beistanden.
Eine weit anstrengendere Partie, eine ziemlich kühne Wanderung ist die, welche uns weiter führen soll; es gilt nämlich nichts geringeres, als die erste beste der Höhen des Osnings zu erklimmen, welche das Thal von Detmold gegen die Stürme des Südwests beschirmen und dort oben von Kuppe zu Kuppe, durch Schlucht und Hain und Busch und Stein einen Weg uns zu brechen, immer dem Zuge gen Nordwesten nach, welchem die Berge folgen. So gelangen wir zu einer unsrer merkwürdigsten »Hühnenburgen,« den Wällen auf dem Tönsberg, hinter denen die Sachsen sich hielten in der Schlacht von Thietmelle. Sie ist mühsam, die Reise, aber oben auf der Höhe winkt der Lohn, der Blick in die weiteste Ferne. Seht ihr es daliegen, das bunte Panorama, mit Wies' und Wald und Berg und Burg, mit Thurm und Thor? Gen Süden dehnt, einst von ihren wilden Rossen durchflogen, die Senne sich aus, eine unendliche Ebene, sandig, wenig bebaut, mit einzelnen Dörfern und Höfen, welche der Eichenhain oder die Tannengruppe birgt. Nur gegen Südwesten hin erspäht ihr weitgedehnte Waldungen; sie hegen das alte Schloß der Grafen von Rittberg, die Holte, mit ihren neuaufgebauten Thürmchen und Giebeln.
Im Süden am Rande der Senne erblicken wir die Thürme von Paderborn und darüber emporragend die blauen, wolkengleichen Höhen der Süderländischen Gebirge; links begrenzt die Egge mit ihren waldigen Kuppen die Aussicht, rechts sieht man in eine endlose Ebene hinein und darin bei sehr heiterem Himmel die Thürme von Münster. Wenden wir uns aber und blicken gen Ost und Nord, so fällt vor allen nebst Lemgo und dem links von seinem Sparrenberge halbversteckten Bielefeld, Herford ins Auge und ein Theil des Ravensberger Landes, in dem es die zweite Hauptstadt ist, »dat hilge Hervede,« Sancta Herfordia. Wir müssen die Blicke für eine Zeitlang darauf haften lassen, schon seiner berühmten Frauenabtei wegen. An solchen Frauenstiftern war Westphalen einst auffallend reicher als an großen Männerprälaturen und Klöstern; vielleicht weil für fromme Gemüther unter den Männern die zahlreichen Domstifter ausreichten, oder auch weil in einem ohnehin schon wesentlich einsiedlerischen Volke das Bedürfniß, Asyle für anachoretisch-contemplative Männercharaktere zu schaffen, nicht so groß war. Die thürmereiche Stadt macht einen sehr freundlichen Eindruck mit ihrer hübschen, von der kleinen Werre durchflossenen, wiesenreichen Umgebung, welche außer von dem genannten Flüßchen auch noch von der Aa bewässert wird, die sich hier in die Werre ergießt. Die alte ehemalige Abtei mit ihrem großen Lehnsaal, der einst mit schönen Wandmalereien geschmückt war, liegt im Umkreise des ältesten Stadttheils, nahe bei dem Münster von St. Pusinna, einem merkwürdigen Gebäude, dessen Größe Urkunde gibt von der Macht und dem Reichthum der alten Stiftung. Das Münster gehört dem Zeitalter des Uebergangs, theilweise einer noch früheren Epoche an und ist im Wesentlichen romanischen Stils. In der Kirche auf dem großen Altar wurden einst die Aebtissinnen inthronisirt; bei dieser feierlichen Gelegenheit öffnete sich dann auch das große, sonst immer verschlossen bleibende Portal der Westseite. Für die Kunstgeschichte von Interesse ist die Ornamentik an den Knäufen der Pfeiler, welche die Gewölbe des Schiffs tragen: diese Verzierungen stellen die abenteuerlichsten, mitunter sehr unpassende Bildwerke und Verschlingungen dar. Bei der Erneuerung der Kirche im Jahre 1818 hat man leider auch die wiederentdeckten alten Frescomalereien neu übertüncht – die Tünche hat überhaupt in den letzten Jahrhunderten wahre Verheerungen in Westphalen angerichtet; in neuester Zeit deckt man in einer Unzahl von alten Kirchen Reste schöner Wandmalereien auf, so in Soest, Methler, Münster u. s. w. Die große Merkwürdigkeit der Herforder Stiftskirche ist aber der Taufstein mit seinen trefflichen Reliefs aus dem 15. Jahrhundert.

Das nahe Abteigebäude dient jetzt zu einer Fabrikanlage. Einst beherbergte es eine Reihe von hochgeborenen Frauen, unter denen Namen von hoher geistiger Auszeichnung sind. Gestiftet um das Jahr 830 von einem frommen Manne, genannt Waltgerus, von dem man weiter nichts weiß, als daß er ein Enkel des Geheimschreibers (?) König Wittekind's gewesen, von Ludwig dem Frommen und Ludwig dem Deutschen reich beschenkt, bildete die Mitra von Herford bald ein Ziel des Ehrgeizes für die Töchter der erlauchtesten deutschen Fürstenhäuser. So ist schon 911 Mathildis, die Großmutter jener ausgezeichneten Frau, welche die Gemahlin Kaiser Heinrichs I. war, zu Herford Aebtissin. Die Mutter Otto's des Großen war ebenfalls lange in Herford. Aus dem vorvorigen Jahrhundert ist besonders der Aebtissin Elisabeth Louise von der Pfalz Erwähnung zu thun, einer der gelehrtesten und geistreichsten Frauen ihrer Zeit, die in öffentlichen Disputationen gegen berühmte Gelehrte in die Schranken trat. Sie war die Tochter des böhmischen Winterkönigs, geboren 1618, und früh schon mit solchem Eifer wissenschaftlichen Studien, insbesondere der Cartesischen Philosophie ergeben, daß sie alle Bewerbungen um ihre Hand, namentlich die des Polenkönigs Wladislaw IV., zurückwies, um sich ihren theuern Büchern nicht entziehen zu müssen. Seit 1667 Aebtissin, starb sie am 11. Februar 1680 in Herford.
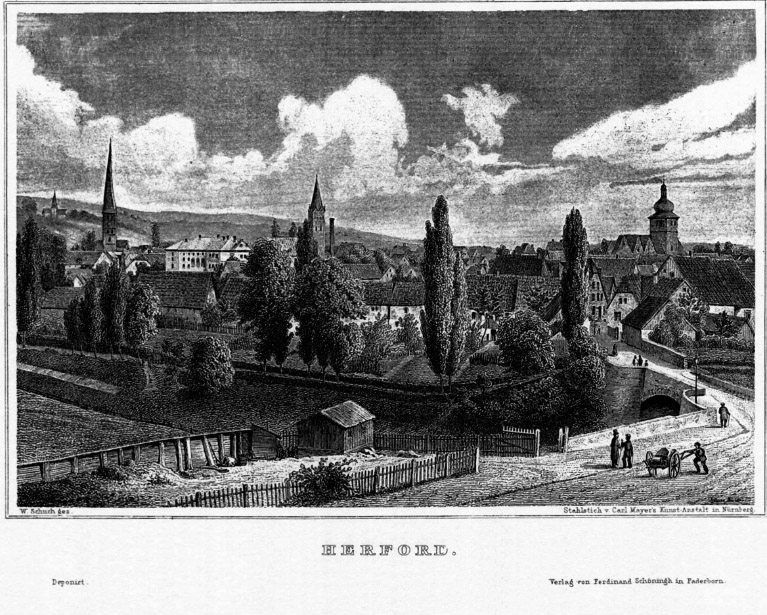
Außerordentlich zu beklagen ist die Vernichtung der Malereien des erwähnten Lehnsaals in der Abtei. Die Aebtissin Elisabeth Louise von der Pfalz hatte sie 1669 erneuern lassen. Es ist noch eine Art notariellen Reverses im Archive der Abtei vorhanden, worin es heißt, daß die durchlauchtige Frau willens sei, den großen untersten Lehnsaal zu renoviren, und die »an der Wandt stehende abgemahlten alte Bilder an Bapsten und Römischen Kaisern, jedoch an ihrer Statur und Farben ohnverrückt, auch an ihren Schriften, Charakteren und abbreviationibus ungeändert, illuminiren und ernewern zu lassen.« Besonders wird dann ein großes Wandgemälde hervorgehoben, Kaiser Karl IV. darstellend, wie er in Herford im Jahre 1377 eine Streitsache der Aebtissin Hildegundis mit dem Herzoge Albert von Sachsen-Lauenburg schlichtet: »in maaßen dasselbe an der Wandt des Sahls historischer Weise in Figuren abgebildet und die abgesprochene Sentenz von Worten zu Worten zusambt vollständigen historischen Bericht ergangener Geschichten beschrieben sich befindet.« »Damit nun,« heißt es in der Urkunde weiter, »Niemandt in die Gedanken gerathen möchte, ob wollten Ihre Hochfürstliche Durchlaucht die von Alters her daselbst angemahlte Schrift u. s. w. als eine kundige fürnehme Antiquität verändern oder supprimiren, sondern daß sie dieselbe dem Kammerschreiber (des Stifts) handtreichen lassen, damit sie nach beschehener Illumination mit der ernewerten Schrift und Abbildungen könnte conferirt, auscultirt und darauf ratione concordantiae ein Instrumentum errichtet und solches in das Abtheiliche Archivum reponirt werden.« Aus dem darauf folgenden Verzeichnisse sehen wir dann, daß Abbildungen vorhanden waren von Papst Gregor, Kaiser Konrad I., Papst Johann, Papst Nicolaus, dem Stifter Waltger, Kaiser Ludwig, Papst Adrian, Kaiser Arnulf, Papst Alexander; nähere Bezeichnungen dieser Namen mit den zu ihnen gehörenden Zahlen fehlen. Dann waren die Wappen der Aebtissinnen von 1404 bis 1649 da.
Diese ganze Pracht von Schildereien ist heute zerstört, wahrscheinlich durch die Aebtissin Johanna Charlotte, Markgräfin von Brandenburg-Schwedt, welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts große bauliche Veränderungen vornehmen ließ. Die übrigen Gemälde, welche die Gemächer der Abtei schmückten und unter denen bedeutende Kunstleistungen gewesen zu sein scheinen, sind verschleudert und verkommen.
Es ist eine wirklich eigenthümliche Erscheinung im Leben beinahe aller europäischen Culturvölker, die doch sonst in steter Entwicklung vorschritten – dieses allgemeine, mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts eintretende Aufhören jeglichen Kunstgefühls und historischen Sinnes, das uns so unendliche Verluste an allen Arten von Kunstschätzen gekostet hat! Und dabei ist es seltsam, daß der Vandalismus gerade erst dann recht zu wüthen begann, als der Geist der Gleichgültigkeit, der Verachtung der Werke der deutschen Vorzeit, welcher sich z. B. so naiv noch in dem Briefe Friedrichs des Großen an den Züricher Professor Müller über das Nibelungenlied ausspricht – als dieser Geist in unserer Literatur durch die Anregungen, welche u. a. auch Goethe gegeben, schon längst überwunden war. Dieselbe Zeit, die den »Götz von Berlichingen« hervorbrachte, die den »Fust« von Stromberg und »Otto von Wittelsbach« zu ihren Lieblingsdramen zählte und bei der der Ritterroman eine so große Rolle spielte, bei der schon Shakspeare, seit Wieland, sich einzubürgern begonnen hatte – dieselbe Zeit wüthet rücksichtslos gegen die überlieferten Denkmale ihrer nationalen Kunst! – Welche Anomalie!
Unsere Stadt hieß einst Herfordia sacra wegen der großen Anzahl ihrer Kirchen. Beachtenswerth ist die Stiftskirche St. Johann und Dionys, welche die Kleinode enthält, die 1442 mit der Uebertragung der Gebeine Wittekind's hierher gekommen sind. Darunter war auch die merkwürdige Schale aus grün-grauem, wie es scheint, Serpentinstein, eingefaßt mit stark vergoldetem Kupferrande, an dem die Worte stehen: » Munere tam claro ditat nos Africa raro.« Die Schale soll das Geschenk eines afrikanischen Königs Namens Visdai an Wittekind sein; auf der Kapsel stehen die Worte zu lesen: » Visdaj de Africa rex.« Es ist eine Art sacro catino, eine Schale, von welcher man sicherlich einst glaubte, daß sie Gift nicht vertrüge, und die deshalb auch nach einer andern Sage von Karl dem Großen an Wittekind geschenkt sein soll, damit dieser des Frankenherrschers aufrichtige Gesinnung erkenne. Sie ist 1840 als Huldigungsgeschenk an den König nach Berlin gekommen und soll aus Agalmatholith gefertigt sein.
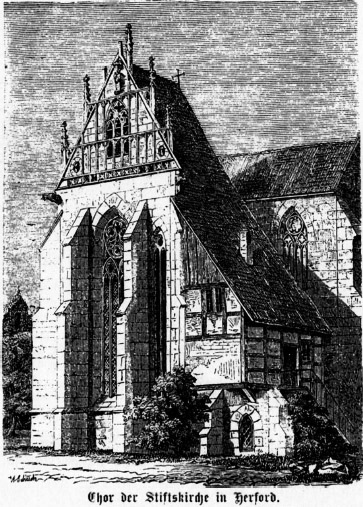
Außerhalb der Stadt auf einer Höhe liegt dann noch die Stiftskirche zu St. Marien, eines der schönsten Denkmale des gothischen Stils in Westphalen, mit zierlichstem Laubwerk der Säulencapitäle und trefflichen Glasmalereien. Zehn hochanstrebende Pfeiler tragen das stolzaufsteigende Gewölbe; das Ganze ist eine harmonische, wie aus Einem Guß hervorgegangene Schöpfung mittelalterlicher Kunst aus der Zeit ihrer höchsten Blüte. Sie entstand durch ein hier um 1011 gegründetes Frauenstift, dessen Conventualinnen ebenfalls unter der Aebtissin von Herford standen. Die heilige Jungfrau selber, in Gestalt einer Taube erscheinend, sprach das Verlangen aus, hier eine Kirche gegründet zu sehen; der Ast des Baumes, auf welchem das Wunder sich zeigte, ist in dem schönen Tabernakel des Hochaltars der Kirche noch heute zu schauen, ein beschämendes Argument für Alle, welche an der Thatsache Zweifel hegen sollten, und ein jährlicher Markt erhält außerdem das Andenken daran durch seinen Namen – er wird nämlich die »Vision« genannt. Das Stift ist 1810 aufgehoben worden; die herrliche Kirche verlor damit die Quellen zu ihrer Erhaltung, und deshalb beschloß die damalige fremdherrliche Verwaltung kurzweg das Gebäude niederreißen zu lassen. Zum guten Glück setzten sich Pfarrer und Gemeinde dagegen, und es gelang mit Aufopferung der Glocken und eines merkwürdigen großen Leuchters das prachtvolle Bauwerk vor dem Untergange zu retten. Nach der Wiederbesetzung des Landes durch Preußen ward dann auch eine völlige Renovation vorgenommen, und am 18. Juni 1825 ward das fünffache Fest der Wiederherstellung der schönen Kirche, des Jahrestags der Vision, des 500jährigen Jubiläums der Erbauung (1825), des Jahrestags der Schlacht von Waterloo und des 30jährigen Amtsjubiläums des Pfarrherrn in diesem Gotteshause gefeiert!
Die Stadt Herford war ehemals Hanse- und Freie Reichsstadt. Ihre commercielle Bedeutung konnte jedoch nicht groß sein, weil sie durch ihre Lage keine weitern Vortheile hatte, als auf der Straße aus den Niederlanden nach dem deutschen Osten einen Anhaltepunkt zu bilden – die Vortheile Mindens waren ungleich größer, da das letztere gerade an dem Punkte sich an die Weser hingestellt hatte, wo ungefähr die Mitte dieses Flusses ist, so daß hier eine natürliche Vermittelung zwischen dem obern und dem untern Stromtheil entstand, wozu noch kam, daß jene erwähnte Straße bei Minden die Weser überschritt. Dagegen ist Herford jetzt industriell sehr thätig, namentlich in der Linnenproduction. Der Herforder »Verein für Linnen aus reinem Handgespinnst« hält der modernen Maschinenarbeit gegenüber die Fahne der alten Art und Weise aufrecht und hat mit seinen Erzeugnissen einen großen Sieg auf der Pariser Ausstellung errungen – die erste Preismedaille, die einzige, welche glattes Leinen aus Westphalen erhielt; dabei wurde in Paris Alles verkauft, was der Verein übersandt hatte, ein graues Stück zu dem unerhörten Preise von 700, ein anderes zu 600 Francs. Die Wirksamkeit des Vereins ist von höchster Wichtigkeit für die Beschäftigung der ländlichen Bevölkerung, welche so dicht hier wohnt, daß man (in den Kreisen Herford und Bielefeld) 9000 Einwohner auf der Quadratmeile zählt.
Seit 1647, wo der Churfürst von Brandenburg Herford einnahm und sich huldigen ließ, gehört die Stadt zu der preußischen Grafschaft Ravensberg und zum Regierungsbezirk Minden.
Das von Herford nördlich gelegene Enger ist ein Mittelpunkt von Tradition, Sage und gelehrter antiquarischer Forschung. Wie König Arthur auf der stillen cornwallischen Insel Avallon, liegt nämlich der Westphalenheld Wittekind begraben in der stillen Oede des abgelegenen Fleckens Enger. Denn also lauten die Behauptungen sowohl unserer Geschichtschreibung als unserer Sage: 1) Enger ist die Hauptstadt des alten Herzogthums Engern; 2) sie war die Residenz und Burg König Wittekind's; 3) sie ist der Begräbnißort desselben; 4) die Kirche zu Enger ist des großen Sachsenfeldherrn Stiftung.
Untersucht man diese vier Thesen kritisch und diplomatisch etwas genauer, so wird man jedoch leider an Voltaire's » Saint empire romain, qui n'est ni saint, ni empire, ni romain« erinnert. Zuerst war das Dorf keine Stadt, wenigstens nicht seitdem man von einem Herzogthum Engern geredet hat, was seit den Karolingern der Fall ist; ja es liegt gar nicht einmal in der, mehr südlich sich erstreckenden, die Hochstifter Paderborn und Minden umfassenden Provinz Engern. Was dann die zweite Behauptung betrifft, Enger sei Wittekind's Residenz gewesen, so sagen die alten Quellen, die » Vita reginae Mathildis«, der Mönch Wittekind von Corvei und Ditmar von Merseburg weiter nichts als daß Mathilde, König Heinrichs I. Gemahlin, aus dem Stamme Wittekinds entsprossen sei und Güter in der Gegend von Enger gehabt habe. Daraus folgt denn keineswegs, daß wir uns in diese stille Gegend einen stattlichen Burgbau zu denken haben, worin König Wittekind gehaust hat, thronend auf dem Hochsitz in der Halle seiner Väter, umringt von der Tafelrunde seiner »Sattelmeier« und den classischen Meth aus gewaltigem Urhorn vertilgend. Es ist nicht einmal nachgewiesen, daß die Kaiserin Mathilde hier residirt habe: man weiß nur, daß Mathilde, Wittekinds Nachkommin, das Kloster und später Kanonikenstift in Enger errichtet hat und daß sie, nach dem Tode ihres Herrn mit ihrem Sohne Kaiser Otto I. in Unfrieden gerathen, sich nach ihren Stammgütern in Westengern, wahrscheinlich also nach dem nahen Herford, welches noch in Engern liegt und wo ihre Großmutter Aebtissin war, zurückzog; dort war sie ja auch erzogen worden, dort hatte der junge Sachsenfürst Heinrich, der später zum deutschen König gekrönt wurde, um ihre Hand geworben. Wahr dagegen ist allerdings, daß sich eine Burg im Orte befand, deren Entstehung nicht nachzuweisen ist, die lange Zeit im Besitz der Grafen von der Lippe war und deren Zerstörung durch die vereinte Macht der Bischöfe von Münster, Osnabrück und Minden in das Jahr 1302 fällt. Wahr ist ferner, daß sich nach einer Urkunde von 1420 ein Wedekindshof in Enger befand. Aber schwer fällt dawider ins Gewicht, daß kein Schriftsteller vor dem 16. Jahrhundert die Behauptung aufgestellt hat, daß in Enger eine Burg Wittekind's gelegen habe.
Daß nun drittens Enger Wittekind's Begräbnißort, scheint vom historischen Standpunkte völlig unerweislich, da kein älterer Schriftsteller des Todesortes oder des Todesjahres des alten Sachsenherzogs erwähnt. Man zeigt in Enger freilich ein Argument, welches geeignet allen Zweifel niederzuschlagen – nämlich Grab und Gebeine Wittekind's. Wären nur die Fragen nach der Echtheit erledigt! Es existirt noch (in einer Kirche in Herford) das Verzeichniß der Reliquien und Kleinode, welche das Chorherrenstift zu Enger bis zum 12. Jahrhundert besaß. Darin ist der Gebeine Wittekinds nirgends Erwähnung gethan. In späterer Zeit, als der Reliquienhandel zu blühen begann, tauchten plötzlich sämmtliche Knochen Wittekind's auf, ohne daß man weiß woher sie kamen. Im Jahre 1414 wurde das ganze Stift aus dem vereinsamten und schutzlosen, unbefestigten Enger nach Herford verlegt. Die angeblichen Königsgebeine wurden natürlich mitgenommen, und in Herford wurden sie nun wie die eines Heiligen verehrt. Im Jahre 1673 erbeutete sie hier der kriegerische Bischof Christoph Bernhard von Galen bei seinem Einfalle in die Grafschaft Ravensberg; er führte sie mit sich nach Münster, aber im folgenden Jahre sandte er sie aus freien Stücken und umsonst den Herfordern zurück, weil sie in Münster zur öffentlichen Verehrung nicht für heilig genug befunden worden! (Vielleicht weil sie nicht für echt gehalten?) Freilich protestiren auch die Bollandisten gegen die Heilighaltung des Königs Wittekind, obwohl er in der » Westphalia sancta, pia beata« seine Stelle ausführlich genug einnimmt. In unserm Jahrhundert, am 13. Oct. 1822, wurden endlich feierlich die angeblichen Gebeine Wittekinds nach Enger zurückgebracht; es sind der einzelnen Knochen 24 an der Zahl, die in einem Schreine in der Kirche sorgfältig numerirt aufbewahrt werden.
Was zuletzt die vierte jener oben erwähnten Behauptungen angeht, Wittekind sei der Gründer des Stifts zu Enger, so spricht dagegen entschieden die diplomatisch beglaubigte Geschichte; Kaiser Otto I. sagt nämlich ausdrücklich in einer Urkunde, die in Lünig's »Reichsarchiv« zu finden: » Abbatiam, cui nomen est Angerin, quam beatae memoriae domina, genitrix nostra Mathilt, in honorem St. Dionysii martyris Christi construxit etc.« NachtragEine im Jahre 1869 durch den Geh. Rath Prof. Schaaffhausen aus Bonn vorgenommene wissenschaftliche Untersuchung der in Enger aufbewahrten Ueberreste hat herausgestellt, daß sie einem Manne von höchstens 25 bis 30 Jahren angehörten: sie können also nicht die Wittekind's sein, der zuerst 777 genannt wird und 807, also 30 Jahre später, gestorben sein soll, und danach wenigstens zu einem reiferen Alter gelangte. –
Was diese Kirche, das alte Münster der Chorherren zu Enger betrifft, so gehört Chor nebst Apsis und Kreuzschiff dem spätromanischen Stile an, das Langhaus dagegen ist aus jüngerer Zeit, es ist gothisch und wahrscheinlich im 14. Jahrhundert erbaut. Das Grabdenkmal Wittekinds auf dem Chore ist in der That merkwürdig und sehenswerth. Das interessanteste Stück des aus verschiedenen Zeiten stammenden Werks bildet der obere Theil, die aus Sandstein gehaltene Gestalt des Sachsenheerführers, eine treffliche, sicherlich in das 12. Jahrhundert hinaufreichende Arbeit. Wittekind liegt in Lebensgröße da: das Gesicht ist länglich und edel geformt, das Kinn glatt, der Mund klein; das Haar über der Schläfe und Ohren niederfallend; die rechte Hand zeigt einen gekrümmten Mittelfinger, ein Gebrechen, das der alte Sachsenfürst in der That bei seinen Lebzeiten hatte. Das Ganze war ehemals sorgfältig und sauber in Farbe gesetzt, wovon noch die Spuren sichtbar; aus dieser Zeit stammt die folgende Beschreibung der Abbildung von einem Schriftsteller des 16. Jahrhunderts: »Das lange Haupthaar fällt in das Schwarze; das Haupt bedeckt eine himmelblaue Kappe, die von einem Diadem mit Edelsteinen umschlungen ist; doch ist von den Steinen jetzt nur noch die leere Fassung zu sehen. Das Unterkleid ist purpurroth, über diesem liegt ein scharlachfarbenes, mit Perlen geziertes Kleid mit goldenem Saum, der ebenfalls mit jetzt ausgebrochenen Edelsteinen besetzt gewesen zu sein scheint. Das dritte Oberkleid, der Mantel, ist himmelblau, mit goldenen Sternen geschmückt und mit prächtigem Pelzwerk gefüttert. Die rechte Hand ruht auf der Brust, die linke, im Mantel verborgen, hält das Scepter. Die vergoldeten Schuhe reichen bis an die Knöchel, laufen gegen das Ende spitz zu und haben in der Mitte eine Naht von Perlen.«
Man sieht, die alten Chorherren haben an ihrem Könige nichts gespart, um ihn herauszustaffiren. Der bunte Prunk ist heute verblichen und verschwunden, im Uebrigen aber erscheint jene Beschreibung noch ziemlich genau.
Dieser alte Denkstein ruht nun auf einer Tumba, welche augenscheinlich jünger ist; man sieht daran allerlei Wappen, Embleme und Inschriften, die sicherlich nicht älter als das 17. Jahrhundert sind. Rings am Rande der obern Platte, die den alten Bildstein trägt, liest man die Worte:
Ossa viri fortis, cujus sors nescia mortis,
Iste locus munit, euge bonus spiritus audit,
Omnis mundatur, hunc regem (qui) veneratur,
Egros hic morbis celi rex salvat et orbis.
Eine andere Inschrift lautet: » Monumentum Wittikindi Warnechini filii, angrivariorum regis, XII. Saxoniae procerum ducis fortissimi«; und eine dritte:

» Hoc collegium dionisianum in Dei opt. max. honorem privilegiis reditibusque donatum fundavit et confirmavit. Obiit anno Christi DCCCVII relicto filio et regni herede Wigberto.«
Diese drei Inschriften sind, wie gesagt, in lateinischen Buchstaben des 17. Jahrhunderts gemacht: man weiß auch, daß die zwei letzten von einem Pfarrer, der hier von 1679 bis 1715 Prediger war, herrühren; bei der ersterwähnten Inschrift jedoch erkennt man deutliche Spuren, daß sie eine Ueberarbeitung älterer abbrevirter Schrift ist, die man bei dieser Gelegenheit auch nicht ganz correct wiedergegeben hat. So muß sicherlich im zweiten Verse gelesen werden: claudit statt munit. Das ganze Monument hat aber nicht allein im 17., sondern auch schon im 14. Jahrhundert eine »Bearbeitung« erduldet. Im Jahre 1377 nämlich machte Kaiser Karl IV., der kunstsinnige Luxemburger, mit seiner Gemahlin eine Reise durch Norddeutschland. Am 15. November jenes Jahres traf er in Minden ein, wo er für eine würdige Begräbnißstätte des Chronisten Henricus de Herfordia sorgte. Wie seinen Aufenthalt in Herford eine alte Schilderei im Lehnsaal der Abtei verherrlichte, haben wir gesehen; am 18. November kam er nach Bielefeld, und hier vernahm er, daß in Enger Wittekinds Grabmal sei; er machte sich augenblicklich dahin auf, und da er das Denkmal verfallen fand, ordnete er eine Restauration an; vielleicht rührt die ganze jetzige Tumba mit Ausnahme des alten Bildsteins von ihm her.
Dieser alte Bildstein aber mahnt uns daran, daß, wenn oben durch kritische Beleuchtung Der scharfblickendste Erläuterer alles hierhin Gehörenden ist H. von Ledebur in seiner noch ungedruckten Beschreibung der Grafschaft Ravensberg, die der Westphälische Alterthums-Verein aufbewahrt. Alles und Jedes in Frage gestellt, doch an der Hand der Sage gar Manches wieder in sein altes Recht zu setzen ist. Die Sage, daß Wittekind in Enger begraben, ist nämlich doch wenigstens so alt, als dieser aus dem 12. Jahrh. rührende Denkstein, und deshalb darf diese Sage nicht für geradewegs falsch und unwahr erklärt werden; spricht doch eine historische Thatsache nicht dawider, und was noch mehr hervorzuheben, ebensowenig ist irgend ein anderer Ort, welcher Ansprüche auf Wittekinds Grab macht, vorhanden. Dazu kommt der jedenfalls auffallende Umstand, daß sich hier in dem kleinen Dorfe ein Chorherrencapitel mit einer Stiftskirche findet; was bewog die Kaiserin Mathilde, hier eine Abtei zu bauen, wenn der Ort, der sich weder durch seine Lage noch seine Bevölkerung empfahl, und der außerdem schon seine eigene Pfarrkirche in einem besondern, die Marktkirche genannten Gebäude besaß, nicht eine ganz besondere Veranlassung dazu geboten hätte? Dann finden wir noch eine Burg im Orte, deren Zerstörung im Jahre 1302 uns berichtet ist, über deren Ursprung aber nichts Licht verbreitet. Sollte man also berechtigt sein die Sage, welche diese Burg den Sitz Wittekind's nennt, Lügen zu strafen? Wohl um so weniger, weil diese Behauptung ja insofern durch die Geschichte bekräftigt wird, als die » Vita Mathildis« angibt, daß Mathilde, aus Wittekind's Stamm entsprossen, einen Besitz in Enger gehabt habe, und wohl einen großen, wichtigen Besitz, denn sonst hätte sie dort nicht eine Abtei stiften und mit dem nöthigen Gut begaben können.
In eigenthümlichem Contraste mit den in der Kirche zu Enger aufbewahrten Gebeinen steht die Sage, die in eben dieser Gegend zu den Volkstraditionen gehört und die wir weiter unten mittheilen werden: daß Wittekind noch lebe und schlummernd in der Babilonie, einem Berge, der sich aus dem Wiehengebirge, dem von Minden nach Osnabrück hin verlaufenden Höhenzuge erhebt, sitze.
Die Sagen, welche noch heute über Wittekind oder »König Wieking,« wie ihn das Volk nennt, lebendig sind, wurden mehrfach gesammelt Von Redeker und von Bögekamp. S. A. Kuhn, Westfäl. Sagen, I. 252 u. ff.; wir geben in Nachstehendem die bedeutendsten wieder, indem wir diejenigen beiseite lassen, welche offenbar vom Volke verkehrter Weise auf Wittekind bezogen werden und sich ursprünglich an die Ritter des Wedigensteins, die Edeln vom Berge, knüpften; denn beide Arten von Traditionen sind bunt durcheinandergeworfen.
Einstmals hatte Wieking Bettlerlumpen angezogen, so daß er gar unkenntlich und unscheinbar geworden. Und also ist er hingegangen, um zu erfahren, wie es im Lager Karl's aussehe. Als er nun dorthin kam, war es gerade der Tag des Herrn, und der Kaiser hatte sich mit den Seinigen im Bethause versammelt. Da hat sich Wieking gesellet zu andern Krüppeln, welche am Eingange des Heiligthums harrten, daß man ihnen ein Almosen darreichte. Als er nun, hart an die Pforte gelehnt, sich hinüberbiegt und hineinblickt in die geweihte Wohnung, da soll ihn vom Altare her das Jesuskind angelächelt haben. Als dann Karl heraustrat, ist ihm die hohe Gestalt und der gewaltige Gliederbau des fremden Bettlers aufgefallen, und er hat wohl geahnt wer es sei. Wieking ist aber in Frieden und in tiefen Gedanken heimgekehrt zu den Seinen.
An einem heißen Sommertage ritt der König Wieking in den lübbecker Bergen über die Berghöhe, worauf jetzt das Kirchdorf Bergkirchen liegt. Es war das gerade in der Zeit, als er mit Karl im Kriege lag, und der König erwog in sich, welcher Glaube wohl der wahre sei, der Glaube seiner Väter oder die neue Lehre der Franken. Und der König sprach bei sich selbst: »Ist diese die rechte, so möchte ich ein Zeichen haben, wodurch ich gewiß würde!« Es war aber gerade sehr heiß, und da sich in den Bergen kein Wasser fand, so dürstete ihn und sein Pferd nach Wasser. Und siehe! in demselben Augenblicke fing das Pferd gewaltig mit dem Hufe an zu scharren und unter demselben hervor sprang ein Quell von hellem, klarem Wasser. Und der König trank von dem Wasser und gelobte ein Christ zu werden. Dieser Quell ist noch bis auf den heutigen Tag das einzige Wasser, welches das Dorf Bergkirchen hat.
Als Wieking Christ geworden und Friede war im Lande, da beschloß er auszuruhen von den Kriegszügen und sich einen Königssitz zu erwählen, wo er beständig bliebe und die Freunde um sich her versammle. Drei Orte waren ihm besonders lieb, Bünde, der Werder zu Rehme und Enger (nach andern blos Enger und Bünde). Da befahl er, daß man an diesen Orten Kirchen bauen solle, und welche von den Kirchen zuerst fertig sei, da wolle er wohnen, in der wolle er begraben werden. Und nun fingen Alle zu gleicher Zeit mit gleich vielen Arbeitern an zu bauen. Aber der Baumeister zu Enger gebrauchte die List, den Thurm wegzulassen. Er war ein Mohr, und zum Wahrzeichen hat er seinen in Stein ausgehauenen Kopf an die Kirche gesetzt. Als man nun später den Thurmbau begann, so fiel allemal über Nacht wieder zusammen, was am Tage gebaut war. Endlich wurde ein Platz bemerkt, einige Schritte von der Kirche entfernt, welcher allein trocken war, während Alles umher bethaut lag. Drei Morgen nacheinander gewahrte man diese Wundererscheinung; da wurde beschlossen, den Thurm an diesen Platz zu bauen. Aber kaum hatte man mit dem Bau eine mäßige Höhe erreicht, als das alte Unwesen wieder begann. So ist es denn geschehen, daß der Thurm zu Enger einige Schritte von der Kirche ab vereinzelt und ganz unansehnlich dasteht.
Wieking baute nun eine Burg zu Enger. Noch wird die Stelle gezeigt, wo sie gestanden, und selbst von einzelnen Theilen derselben haben Namen und andere Erinnerungen noch heutzutage die Lage aufbewahrt. Der alte Burggraben, der Küchengarten an der Burg, die Pferdeschwemme in der Bornwiese haben noch immer die alten Benennungen; ebenso ist es mit dem Hühnerhofe. Und bei dem neuen hölzernen Hause, welches jetzt an der Stelle steht, aber immer noch jenen alten Namen trägt, erinnern sogar Ueberreste verwitterter Mauern an die Zeit des Königs. Auch weiß man, daß die Küche und das Backhaus da waren, wo jetzt Bergmann's Garten ist. Und noch im Jahre 1818 hat man hier beim Abgraben eine gemauerte Herdstelle und verwittertes Küchengeräth aufgefunden.
Von der Stadt, welche sich weithin um die Burg ausbreitete, ist das jetzige Enger nur ein geringer Ueberrest. Sie hatte sieben Thore: das Nordthor bei Nordmeier's Hofe; das Burgstädter Thor unweit der Burg selbst; das Kniggenthor an der Landstraße nach Bünde; das Niedermühlenthor an der Herforder Straße; das Bruchthor an der enger Niederung; das Lüttenthor an dem Wege nach Westerenger; das Niederthor bei Niermann's Hofe. Auch umschloß die Stadt das Marktfeld und das Opferfeld. Westerenger war die Vorstadt, und hier hatte der König ein Vorwerk, dem auch der Name geblieben ist.
Von dem Gefolge Wieking's sind die großen Sattelmeier aufgekommen. Sie begleiteten den König zu Pferde und waren auch späterhin verpflichtet, einen berittenen Mann zum Kriege zu stellen. Es sind ihrer noch jetzt 14: sieben in der näheren Umgebung von Enger (Hausgenossen, freie Bauern, Sattelmeier), und sieben weiterhin in der Umgegend von Werther, Bielefeld und Heppen (hagenfreie Bauern, auch wohl Sattelmeier neben den Erstern genannt). Ritten die sieben Sattelmeier neben dem Könige, so war es der Meier zu Hiddenhausen, der den Zug begann, und der Meier zu Häcker, der ihn schloß. Ringsmeier hatte über den Marstall die Aufsicht; Ebmeier war Wildmeister und ordnete die Jagden an; Barmeier war das Haupt der Hirten. Windmeier, ein geringerer Diener, so daß er nicht zu den Sattelmeiern gehörte, war Wiekings Jäger; ritt er aber im Gefolge der Sattelmeier mit dem König, so mußte er, wenn der Zug über einen Hof ging, absteigen und das Heck (das Zaunthor) öffnen. Noch bis auf unsere Zeit hatten die Sattelmeier manche Vorrechte. Sie waren frei vom Zehnten und genossen bei feierlichen Aufzügen, namentlich bei ihrer und der Frauen Leichenbestattung besondere Ehren. Drei Tage nacheinander werden sie, und zu sonst ungewöhnlicher Stunde, verläutet, nämlich nach 12 Uhr Mittags. Schon vom Sterbehause aus begleiten die Geistlichen den Sarg, hinter dem ein gesatteltes Pferd hergeführt wird, in die Kirche, wo man ihn auf dem Chore niedersetzt. Erst nach dem Gottesdienste geschieht dann auf dem Kirchhofe die Einsenkung.
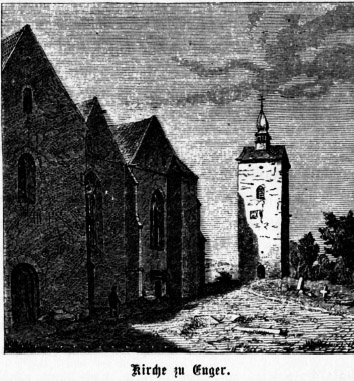
Noch jetzt weiß man die Stellen zu zeigen, wo der König gern weilte. Bei Hartwig am Steine, einem Hofe in der Nähe von Vlotho, hatte er einen Sitz in einen großen Stein aushauen lassen, und oft saß er dort und weidete seine Augen an der herrlichen Umgegend. Im Elfenbusche, einem Gehölze unweit Ebmeier, hatte er seinen Vogelherd und sein Vogelhaus. Der liebste Platz war ihm aber der hohe Esch bei Hücker, von wo man weithin schaut in das Hügelland zwischen Süntel und Osning. Da soll neben einer uralten heiligen Eiche ein Wartthurm gestanden haben, und nach dem Abbruche desselben eine Kapelle, zu der man Wallfahrten anstellte. Als endlich mit der Kapelle auch der alte Baum dahingesunken war, ist an seine Stelle eine ganz ungewöhnliche, wunderbare Buche aufgewachsen. Ein Stamm war es, der sich nahe an der Erde in sieben Schafte getheilt hatte, welche alle eine ungewöhnliche Höhe erreichten und ganz ohne Seitenzweige sich oben in ihren Wipfeln vereinigten, so daß man in der Ferne die Krone eines Riesenbaums zu sehen meinte. Zwei von diesen Stämmen sind in den zwanziger Jahren unsers Jahrhunderts, der eine durch Blitze, der andere durch Brand, zerstört worden, aber die noch übrigen fünf Stämme hießen auch fernerhin die »Heiligen sieben Buchen«, bis denn auch diese in den letzten Jahren verschwunden sind.
Auch zu Schildesche baute Wieking eine Kirche. Es wohnte von ihm dort eine Schwester, welche das Klosterleben erwählt hatte; um nun schnell hinüberzukommen, den Bau zu betreiben und die Schwester zu begrüßen, ließ er einen Richtweg hinführen, einen Fußpfad, der noch jetzt von Enger nach Schildesche führt und der »Hasenpad« heißt. Diesen Pfad wanderte der König so häufig, daß sich noch jetzt davon im Munde des Volkes das Reimwort erhalten hat:
Dat is de Hasenpad,
Den König Wieking trad.
Hasenpad heißt er von einem Diener Namens Hase, einem gewöhnlichen Boten und Begleiter Wieking's.
Als Wieking schon zu einem guten Alter gekommen war, da beschloß er einstmals, auf gar besondere Weise zu erproben, wer wohl in der Umgegend noch Anhänglichkeit an ihn habe. Zweien Freunden offenbarte er sein Vorhaben, und nun wurde von diesen bekannt gemacht, daß der König gestorben sei. Auch das Leichenbegängniß ward angeordnet. Als aber zur angesagten Stunde die Menge der Leidtragenden sich auf der Burg versammelt hatte und um den aufgestellten verschlossenen Sarg herstand, da trat plötzlich Wieking selbst wohlbehalten und fröhlich unter sie. Und alle Die, welche da umherstanden und zu seinem Leichenbegängnisse gekommen waren, machte er auf ewige Zeiten zehntfrei. Unterdessen kam noch Einer aus der Nähe von Bünde nachgelaufen; auch der erhielt dieselbe Begünstigung; allein von dem Tage an nannte man ihn »Nalop«, und so heißt sein Hof noch heutzutage. Auch Diejenigen, welche, wie z. B. Steinköhler zu Pödinghausen, unterwegs gewesen und auf die Nachricht vom Leben des Königs umgekehrt waren, erhielten einige, wenn auch geringe Vorrechte. Steinköhler wurde zur Hälfte zehntfrei. Ja selbst Schürmann zu Westerenger, welcher nur die Schuhe angezogen hatte, um sich auf den Weg zu begeben, blieb nicht ganz unbedacht. Einer seiner Kämpe wurde zehntfrei.
Endlich, als der alte Held wirklich heimgegangen war, da hat man ihn von der Babilonie, wo er starb, hingetragen nach Enger. Das Land aber, über das der Zug ging, ist von selbiger Stunde an Wittekindsland genannt und als solches zehntfrei geworden und geblieben. Zu Enger wurde er in der Kirche beigesetzt. Die Kirchthür an der Westseite, durch welche der Sarg hineingetragen wurde, ist sofort zugemauert und bis auf den heutigen Tag nie wieder geöffnet worden. Die mittlere Gegend, wo die Leiche ausgestellt war, um die Bezeugung der Liebe und Verehrung zu empfangen, heißt noch immer der Leichdehl. Der Sarg wurde dann in einem kleinen Gewölbe am Chore beigesetzt und zugleich feierlich ausgesprochen, daß das Heiligthum, worin der Held Westphalens ruht, nie andere Gebeine aufnehmen dürfe. Und so ward es unverbrüchlich gehalten, wie sehr es auch Sitte jener und der Folgezeit sein mochte, die Ruhestätte im geweihten Gotteshause jeder andern vorzuziehen.
Bei der Kirche zu Enger hatte Wieking ein Capitel gestiftet und dasselbe reichlich mit Grundstücken, Zehnten und hörigen Leuten ausgestattet. Viele Jahrhunderte lang wohnten die Capitelherren zu Enger und hielten ihren Gottesdienst an der Gruft des Königs. Als aber endlich in den Stürmen der Folgezeit die Stadt sank und verödete, so daß sie gegen das Raubgesindel umher nicht mehr Sicherheit gewährte, da that das Capitel die Ländereien aus, bestellte für den Gottesdienst einen Pfarrer und zog nach Herford. Dahin sollten nun auch Zins und Zehnten gebracht werden, allein alle Pflichtigen weigerten sich und lieferten nicht anders als zu Enger an der Kirche, beim Grabe des Königs. Da wandten sich die Capitularen zur List. Heimlich in stiller Nacht hat man die Gruft geöffnet, die theuern Gebeine entwendet und sie nach Herford entführt. Und nun mußten freilich die Gefälle, welche denselben gehörten, auch wohl dahin folgen. Wohl über 400 Jahre blieben hier die Ueberreste, bis sie endlich (1822) wieder nach Enger gebracht worden sind. Da haben die Sattelmeier sie um die Kirche getragen und darauf sind sie ihrer ersten Ruhe wiedergegeben worden.
Auch hatte der König eine Stiftung eingesetzt, wodurch Diejenigen, welchen die Hut seiner Gebeine anvertraut war, wenigstens einmal des Jahres mit ihren Hintersassen zu Einer Gesellschaft vereint wurden. Am Tage des heiligen Remigius kamen die Capitelherren, auch noch als sie in Herford wohnten, anfangs alle, in der letzten Zeit nur zwei Abgeordnete, mit den Behörden des Stifts auf dem Nordhofe bei Enger zusammen. Hier wurde ein Schmaus gehalten, welchen Nordmeier spendete und anrichtete und wozu Dreimann in Dreien die Tische und Bänke, und Riepe in Westerenger das Weißbrod brachte. Zugleich erneuten die Leute dem Capitel ihre Huldigung. Etwaige Anstände wurden geschlichtet und die Verpflichtungen bestätigt.
Zum Andenken an den König wurde bis auf die neueste Zeit jährlich zu Enger die Begräbnißfeier desselben begangen. Am Tage der Heiligen drei Könige wurde die Leiche verläutet; am folgenden Tage besorgte der Bürgermeister das Geläute zur Gruft. Darauf versammelten sich Lehrer und Schüler von Enger in der Kirche; dorthin auch kamen die Armen und nun wurde ein Gedächtnißgottesdienst gehalten. Am Schlusse desselben läutete der Küster zur Senkung und zugleich wurden unter den Schülern »Timpen«, eigens zu dieser Feier gebackene Semmeln, und unter den Armen Brod und Wurst vertheilt. Den Schluß machte ein Mahl der Geistlichen, der Lehrer, des Bürgermeisters und noch einiger Andern. Der Gottesdienst wird aber seit einer Reihe von Jahren nicht mehr gehalten, ebenso nicht mehr das Mahl.
In der Nähe der Stadt Lübbecke liegt in der Gebirgskette, die weiterhin die Porta Westphalica bildet, ein spitzer Berg, der die Babilonie genannt wird. Oben auf der Spitze nun hat früher die Burg Wiekings gestanden, von der man jetzt nur noch einzelne Steine und Mauerstücke und die Spuren eines dreifachen Walles findet. Nach einer andern Erzählung aber ist die Burg versunken und der alte König sitzt darin und harret, bis seine Zeit kommt. Eine Thür ist noch vorhanden, die von außen in den Berg und zu dem Palast führt. Allein nur selten geschieht es, daß Einer, ein besonders Begünstigter, sie erblickt.
»Es mögen jetzt«, erzählt einer unsrer Gewährsmänner, »100 Jahre sein, daß ein Mann aus Hille, Namens Gerling, welcher auf der Waghorst Schäfer war, seine Heerde an dem mehner Berge weidete. Da sah er an dem Hügel der Babilonie drei fremde lilienartige Blumen und pflückte sie. Dennoch fand er am folgenden Tage gerade an derselben Stelle wieder drei gleiche Blumen. Er brach auch diese und siehe! am andern Morgen waren sie an demselben Orte wieder aufgeblüht. Als er nun diese gleichfalls genommen und sich dann in der Schwüle des Mittags am Abhange hingesetzt hatte, so erschien ihm eine schöne Jungfrau und fragte ihn, was er da habe, und machte ihn aufmerksam auf einen Eingang in den Hügel, den er sonst nie gesehen und der mit einer eisernen Thür verschlossen war. Sie hieß ihn nun mit den Blumen das Schloß berühren. Kaum that er das, so sprang das Thor auf und zeigte einen dunkeln Gang, an dessen Ende ein Licht schimmerte. Die Jungfrau ging voran und der Schäfer folgte und gelangte durch das Dunkel in ein erleuchtetes Gemach. Gold und Silber und allerlei köstliches Geräth lag da auf einem Tische und an den Wänden umher. Unter dem Tische drohte ein schwarzer Hund, war aber still und zog sich zurück, als er die Blumen sah. Im Hintergrunde aber saß ein alter Mann und ruhte, und das war König Wieking. Als der Schäfer das Alles angesehen, sprach die Jungfrau zu ihm: »Nimm was dir gefällt und vergiß das Beste nicht!« Da legte er die Blumen aus der Hand auf den Tisch und erwählte sich von den Schätzen, was er eben fassen konnte. Und nun eilte er, das unheimliche Gemach zu verlassen. Nochmals rief die Jungfrau ihm zu: »Vergiß das Beste nicht!« Er blieb stehen, blickte zurück und sah umher, was denn wohl das Beste sei. Auch nahm er noch Einiges, was besonders köstlich schien; an die Blumen aber dachte er leider nicht. Und diese waren doch das Beste, denn sie hatten ihm ja den Eingang verschafft. Ueberzeugt, das Beste nicht vergessen zu haben, ging er mit Schätzen beladen durch die dunkeln Hallen zurück. Eben trat er an das Tageslicht heran, als das Eisenthor mit solcher Gewalt hinter ihm herfuhr, daß ihm die Ferse abgeschlagen wurde. – Dieser Schäfer liegt in der Kirche zu Hille auf dem Chore unter einem großen Steine begraben. Er hat nach jenem Ereigniß viele Jahre in großem Wohlstande gelebt. Allein den Eingang hat er nie wieder erblickt und seine Ferse ist nie heilgeworden, so daß man ihn bis an seinen Tod nie anders als mit einem niedergetretenen Schuh an diesem Fuße gesehen hat. Er hat manche Vermächtnisse nachgelassen, unter andern auch eins für die Kirche zu Hille, und die Nachkommen seiner Erben besitzen noch gegenwärtig den Aswenhof in Hille, welcher von ihm angekauft wurde.«
Die Babilonie hat einen mit dreifachen Erdwällen verschanzten Gipfel, den Resten der rohen und kunstlosen Befestigung, in welcher sich die Sachsen gegen die anstürmende Tapferkeit der Franken Karl's des Großen vertheidigt haben mögen. Spuren solcher Verschanzungen, die zwischen 772 und 785 entstanden sein werden, tragen mehre Berghöhen in dieser Gegend.
Eine andere denkwürdige Stelle ist in der Nähe von Enger die sogenannte »Hengist-Horst«, ein Feld bei dem benachbarten Dorfe Dünne. Da haben, behauptet die Sage, zwei Ritter in alten Zeiten einen Bund geschlossen; von diesem Bunde hat das nahe Städtchen Bünde seinen Namen (es führt noch in seinem Wappen zwei Ritter, welche sich die Hände reichen). Wäre hiermit etwa die Stelle angedeutet, wo Hengist und Horsa über den großen Erobererzug nach England einig wurden? Hengist wird zwar ein nordalbingischer Wieking genannt, aber soviel wir wissen, lassen die englischen Quellen – und andere haben wir nicht über die beiden Brüder – die eigentliche Herkunft ganz im Dunkeln.
Der Blick auf Herford und Enger hat unsere Wanderung aufgehalten; wir schreiten nun fürder, kommen an der Ruine der Antonius-Kapelle vorüber, die, auf dem Tönsberge im Gebüsche versteckt und umgeben von den oben erwähnten Circumvallationen, diesem langgedehnten Bergrücken seinen Namen gibt, und kommen endlich in die Schlucht hinab, in welche das Dorf Oerlinghausen sich hineinzieht. Wenn wir nicht vorziehen, in dem gastfreundlichen Gute Barkhausen einzukehren, das unten im tiefen Thale zwischen seinen Gartenanlagen und unter hohen Eichenwipfeln seine lichten Mauern und den alten feudalistischen Thurm versteckt, erklimmen wir jenseits Oerlinghausen die mehr nach Norden sich wendenden Höhen aufs Neue, folgen ihrem Zuge und gelangen so endlich auf den letzten Gipfel dieser Bergreihe, dem zu Füßen das kleine Lutterthal sich ausbreitet und uns von dem gegenüberliegenden Gebirge abschneidet. Ein schönes Panorama rollt sich hier vor uns auf: unten das freundliche Bielefeld mit seinen Leinewandbleichen und zur Rechten eine hügelichte fruchtbare Ebene, ein lachendes Gefilde, das weithin dicht besäet ist mit den rothen Dächern fleißiger Weber; unmittelbar neben uns fesseln die Ruinen des Schlosses Sparrenberg unsere Aufmerksamkeit. Auf unser Begehren öffnet sich das massive Burgthor vor unseren Schritten und wir treten in die Ringmauern der Bergfeste ein; aber es gibt wenig zu bewundern hier, als »morsche Trümmer der Vergangenheit.« Wenden wir das Auge lieber auf die freundliche Stadt und den vor uns liegenden Johannisberg mit seinen Anlagen, von wo herab man die schönste Aussicht auf die Ruine des Sparrenbergs hat.

Wir stehen hier in dem Gaue des Angerlandes, der ursprünglich Wessago hieß, später aber, nach dem Bergschloß, das seines Erbauers Rabo oder Rawe Namen trägt und weiter unten im Wassergebiete der Ems uns beschäftigen wird, die Grafschaft Ravensberg genannt wurde. Der Ort Bielefeld kommt als Bilanvelde zuerst unter Schenkungen vor, welche unter dem Abte Adalgar in der Mitte des neunten Jahrhunderts dem Stifte Corvei gemacht werden; aber ich finde nicht, wann und wodurch er unter die Jurisdiction der Ravensberger Grafen gerathen ist. Er hegte lange Zeit zwei denkwürdige Männer in seinen Mauern, Gobelin Persona (Persoen) aus Paderborn, den Verfasser einer Weltchronik: Cosmodromium, und Herrmann Hamelmann. Beide sind als Geschichtschreiber von besonderer Wichtigkeit für Westphalen bekannt. Persoen war seit 1414 Decan in Bielefeld; Hamelmann wurde 1552 als Prediger an die Collegiatkirche der heil. Maria hierher berufen. Bielefeld hat einen mehr als Europäischen Ruf durch seine Leinewand bekommen: sein Flachsbau, seine Gewebe und sein Garnhandel reichen bis in das 13. Jahrhundert hinauf, einen besonderen Aufschwung aber bekam dieser Betrieb im 16. und 17. Jahrhundert, als Philipps II. und seiner beiden Nachfolger Druck auf den Niederländern lag, daß sie Schaarenweise gezwungen wurden, ihre Heimath zu verlassen und ihren Kunstfleiß in die Fremde zu verpflanzen. So kam auch nach Bielefeld ein Theil derselben und was früher nur die blühenden Webereien in Gent, Antwerpen, Brügge u. s. w. zu liefern verstanden, wurde bald hier in gleicher Güte producirt, unter Anderem die Schleier oder die nachher sogenannte Bielefelder klare Leinewand. – Die Feste auf dem Sparrenberge ward im Jahre 1177 erbaut. In jener Zeit standen die Grafen von Ravensberg auf der Seite der Gibellinen, die von der Lippe aber auf Seite der Welfen. Bernhard von der Lippe war ein besonders thätiger Bundesgenosse Heinrichs des Löwen, und als dieser des Kaisers Rothbart Abwesenheit in Italien benutzte, um seine Feinde zu züchtigen, unter ihnen aber auch der Rabe in die Fänge des Löwen fiel (an dem Halerfelde, zwischen Hase und Dute im Osnabrückischen), da drang jener, der Lippische Verbündete, rasch in des Geschlagenen Gebiet ein, und baute auf dem Sparrenberge einen Thurm, von dessen Zinnen er das Banner mit dem Löwen wehen ließ, und den er die Löwenburg nannte. Aber Hermann, der Graf von Ravensberg, war nur vor dem Löwen geflohen, dem Nachbarfürsten wich er nicht, sondern stürmte mit seinen Mannen den Thurm, riß den Löwen nieder und erhöhte seine Sparren an dessen Stelle. Davon soll die Burg jetzt Sparrenberg heißen. Später gerieth derselbe Hermann von Ravensberg in Fehde mit dem Bischofe Hermann von Münster, der Bielefeld eroberte und zum Denkmale seines Sieges die Bürger zwang, allen in der Nähe stehenden Eichen die Köpfe abzuhauen. Sein Stadtrecht empfing Bielefeld von Münster. Seit 1286 war der Sparrenberg der Sitz eines gräflichen Amtmanns oder Drosten, vielleicht auch schon früher; als das Land unter Bergische Hoheit gekommen war, blieb die frühere Aemter-Eintheilung desselben bestehen und Herzog Wilhelm III. von Berg setzte Philipp von Waldeck auf den Sparrenberg als Drosten mit einem jährlichen Einkommen an Geld und Naturalien, worunter man am Ende des Inventars von Hunderten von Kühen, Schweinen, Hämmeln u. s. w. auch zwei jährliche Fuder Weins für die Frau Drostin aufgeführt findet. Im Jahre 1545 ward die Burg Sparrenberg von Grund aus neu aufgeführt mit Circularbefestigungen nach Albrecht Dürers Erfindung. In dieser Gestalt kam sie mit der ganzen Ravensbergischen Erbschaft 1624 an Brandenburg. Der große Kurfürst fügte neue Werke zur Befestigung hinzu und residirte, wenn er in den neuerworbenen Landestheilen sich aufhielt, auf dem Sparrenberge. Daher kommt es, daß ihm im Jahre 1672, am 26. Dezember, in diesem Schlosse von seiner zweiten Gemahlin, Dorothea von Holstein-Glücksburg, ein Sohn geboren wurde, jener Markgraf Karl Philipp, Heermeister in Sonnenburg, der des Vaters Lieblingssohn war und an dessen frühen und seiner Zeit vielfach gedeuteten Tod unter den Mauern von Casale in Piemont sich ein um so größeres Interesse knüpft, als dies tragische Ende jedenfalls durch die romanhafte Leidenschaft des Prinzen für die schöne Gräfin Salmour-Balbiani herbeigeführt war. Vergl. Schücking, Von Minden nach Köln. Leipzig. 1856. S. 53. – Der Sparrenberg wurde seit 1743 nur noch zu Gefängnissen benutzt.
Von den Kirchen Bielefelds besitzt die Nicolaikirche ein schönes Altarschnitzwerk, die Marienkirche sehr schöne Grabmonumente; wir erwähnen das, worauf der Stifter der Kirche, Graf Otto von Ravensberg, seine Gemahlin Hedwig von der Lippe und zwischen ihnen beider Sohn Ludwig im ewigen Schlummer ruhen. Die Mutter hält zärtlich ihre Hand auf dem von Locken umwallten Haupte ihres Kindes; Graf Otto trägt langes gescheiteltes Haar, das über der Stirn von einem Bande festgehalten ist; seine hohe schlanke Gestalt ist in einen Drahtpanzer gehüllt und von einem Mantel umflossen. Das Ganze ist von großer Schönheit. Aber auch die andern Epitaphien sind beachtenswerth, besonders das des Otto von Oy, der 1621 als Droste auf dem Sparrenberge starb. –
![]()