
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
![]()
 as Land der Ruhr ist der Stolz, die Krone unseres Vaterlandes; die frischen rauschenden Berggewässer des Stromes sind das silberne Stirnband dieser Krone. Es ist ein ganz anderes Reich, als das durchmessene; aus der Idylle des Lippethales, worein die Geschichte uns nur romantische Episoden wehte, treten wir über in ein Epos, das von den Kämpfen urweltlicher Gewalten spricht, die sich Porphyrcolosse zum Denkmal aufgethürmt haben. Eine tiefe Waldeinsamkeit, wo unter den hohen Buchen- und Eichenwipfeln nur der Köhler seine Meiler schürt, wo nur zuweilen eine einzelne braungelbe Zigeunergestalt schleichend das Laub der Pfade aufrascheln macht, der Arnsberger Wald zwischen Möhne und Ruhr, bildet den vermittelnden Uebergang. Er führt aus dem anmuthigen, mild-fruchtbaren Gelände des Möhnethales zu der großartigen und wildpittoresken Natur der obern Ruhrufer, wo bald dunkle Felsen, die sich über Thalkessel voll grotesker Trümmer, wie Proteus über seine Robbenheerde beugen, keine Seltenheit mehr sind, wo die Adler und die Uhus horsten, in das Land der tropfsteinglänzenden Klüfte, der von allen Höhen niederkollernden und spritzenden Bergwässer: aus den Tiefen dröhnt da das dumpfe Pochen der Hammerwerke, schwere Rauchsäulen rollen sich über die Felszacken auf oder zerstieben an den Baumwipfeln – Dante's glühende Felsen treten uns im Brandlichte der hohen Oefen entgegen. Aber hier auf dem höchsten Gipfel haben wir auch die Grenze landschaftlicher Poesie erreicht, und wir wenden uns ab von dem Uebergange des Wilden zum Wüsten, winterlich Kümmerlichen, das zuletzt mit Krüppelholz, kahlen Gipfeln, Schnee im tiefen Mai und ärmlichen Hafersaaten endigt.
as Land der Ruhr ist der Stolz, die Krone unseres Vaterlandes; die frischen rauschenden Berggewässer des Stromes sind das silberne Stirnband dieser Krone. Es ist ein ganz anderes Reich, als das durchmessene; aus der Idylle des Lippethales, worein die Geschichte uns nur romantische Episoden wehte, treten wir über in ein Epos, das von den Kämpfen urweltlicher Gewalten spricht, die sich Porphyrcolosse zum Denkmal aufgethürmt haben. Eine tiefe Waldeinsamkeit, wo unter den hohen Buchen- und Eichenwipfeln nur der Köhler seine Meiler schürt, wo nur zuweilen eine einzelne braungelbe Zigeunergestalt schleichend das Laub der Pfade aufrascheln macht, der Arnsberger Wald zwischen Möhne und Ruhr, bildet den vermittelnden Uebergang. Er führt aus dem anmuthigen, mild-fruchtbaren Gelände des Möhnethales zu der großartigen und wildpittoresken Natur der obern Ruhrufer, wo bald dunkle Felsen, die sich über Thalkessel voll grotesker Trümmer, wie Proteus über seine Robbenheerde beugen, keine Seltenheit mehr sind, wo die Adler und die Uhus horsten, in das Land der tropfsteinglänzenden Klüfte, der von allen Höhen niederkollernden und spritzenden Bergwässer: aus den Tiefen dröhnt da das dumpfe Pochen der Hammerwerke, schwere Rauchsäulen rollen sich über die Felszacken auf oder zerstieben an den Baumwipfeln – Dante's glühende Felsen treten uns im Brandlichte der hohen Oefen entgegen. Aber hier auf dem höchsten Gipfel haben wir auch die Grenze landschaftlicher Poesie erreicht, und wir wenden uns ab von dem Uebergange des Wilden zum Wüsten, winterlich Kümmerlichen, das zuletzt mit Krüppelholz, kahlen Gipfeln, Schnee im tiefen Mai und ärmlichen Hafersaaten endigt.
Im gleichen Verhältnisse werden an dem untern Ufer der Ruhr der kleineren Felsen immer weniger, die Thäler weiter, wiesengrüner, der Fluß dehnt sich und hat seiner Stimme eine Sourdine aufgesetzt, als fürchte er, das Gebirge zu wecken, das seinen Zackenkranz abgelegt und sich unter die grüne flatternde Decke gestreckt hat.
Die Gebirge der Ruhr sind eine unmittelbare Verzweigung des weiter südlich als mächtiger Gebirgsstock sich erhebenden Westerwaldes; sie sind zum Theil aus den ältesten neptunischen Gebilden zusammengesetzt und zeigen an der untern Ruhr die Glieder der Kohlengruppe, gehören im Süderlande der Grauwackenformation an. Beide Bildungen gingen wahrscheinlich der des Teutoburger Waldes lange voraus und deshalb sind die Gebirge der Ruhr, von den wiederholt die Urwelt überspülenden Fluthen desto öfter zerrissen und zerklüftet, schroffer aufsteigend und mehr vereinzelt, denn die Höhen des Osnings.
In der tiefsten Wildniß des Süderlandes liegen die Quellen der Ruhr. Auf dem rauhen Plateau von Winterberg, das 2000 Fuß über der Meeresfläche erhaben ist, und doch nicht zu den Höhen des nahen Dorfes Astenberg hinanreicht, wo einer der Berggipfel 2600 bis 2700 Fuß mißt, sprudelt sie in drei starken Quellen aus der östlichen Seitenwand des »Ruhrkopp« hervor, windet sich wie unentschlossen in den Schluchten und wühlt dann, nach Norden gewandt, sich einen Paß durch die Berge offen. Rechts in ihrem Rücken läßt sie Küstelberg, über dem eine der höchsten Höhen, der Schloßberg, einst von einer Burg gekrönt, eine Aussicht auf Waldeck und beide Hessischen Lande, bis zum Taunus und seinem Feldberg gewährt. Ein früheres Nonnenkloster in Küstelberg, dessen Bewohnerinnen das Volk »Quiselen« nennt, ist später hinabgezogen nach dem »gelinden Felde«, der jetzigen Domaine Glintfeld, wo in der milden fruchtbaren Landschaft nach Medebach und der Waldeck'schen Grenze hinaus die Pfirsiche und Aprikosen blühen, wenn in dem kaum eine Stunde entfernten Küstelberg der tiefe Schnee auf den Aesten der Birken liegt.
Wild und steil, mit Haidekraut und kurzem Buchengestrüpp über den jähen Abhängen, sind die nahe zusammen gerückten Gestade der jungen Ruhr, gleich einer Landschaftsscenerie aus dem schottischen Hochland, bis das Gebirge breiter auseinandergeschoben bei Olsberg und Bigge den Fluß in Wiesengründe und bei Ostwig in eine schöne Landschaft voll Klippen und Baumschatten führt. Doch zwei Punkte locken uns zurück in das Gebirge zur Seite dieser obern, noch nach Norden strömenden Ruhr; der erste ist rechts Bruchhausen, eine der wildesten Parthien, wo die Natur nach einem Salvator Rosa zu rufen scheint; da ist kein Berg umher ohne seine Felsrisse, das ganze von Hochwald umgebene, mit Steinblöcken besäete Thal ist wie der Bauplatz für eine Gigantenwohnung; dennoch ist der Boden fruchtbar, man hat, um ihn urbar zu machen, die Blöcke gesprengt und wüste Brocken hier und da als Einfriedigungen des eroberten Grundes stehen lassen, dem zur Seite wieder ganze Strecken noch dem alten Chaos verfallen sind. Dicht am Fuße des schroffen Issenberges liegt das Dorf und freiherrlich Gaugrebische Gut Bruchhausen, über ihm, den Hang des Berges hinan, die isolirten kolossalen Bruchhäuser Steine; wir haben vor den ähnlichen Extersteinen gestanden, aber sie sind Kinder gegen die ungeheure Moles dieser Felsgebilde; auf viele Stunden weit überragen sie gen Nordosten das Gebirge wie großartige Warten. Zuhöchst auf dem Gipfel des Issenberges liegt der Feldstein, kleiner als die übrigen und dennoch an seiner schroffsten Seite eine 160 Fuß hohe Wand bildend und über die alten Baumwipfel ragend wie Saul über das Volk Gottes, malerisch durch scharfgezackte und gespaltene Formen. Die Aussicht von ihm, gen Norden hin bis über die Thürme von Münster, wird nur durch die Schwäche des Auges beschränkt. Tiefer liegt der Goldstein, wie ein schwerer massiger Belfried, fest und steilauf gemauert, die Bastei dieser Naturfeste; dann der Rabenstein, brockenhaft, ein Stück einer riesigen Ruine und endlich am tiefsten bergab, fast an der Mitte des ganzen Hanges, der mächtigste der Viere, der Brunnenstein, eine compacte aber trümmerhafte Masse. Er ist weniger steil als die übrigen und gibt durch Risse und kleine Flächen dem Fußtritte Raum, daß man ohne Gefahr ihn ersteigen und den Brunnen, (eine nah der Kuppe auf einem Plateau befindliche Höhlung, wo sich das zusammenrieselnde Regenwasser sammelt und durch ein Felsendach geschützt nicht leicht versiegt), beschauen kann. Habichte, Falken und Käuze siedeln in den Klüften der Felsen und steigern durch ihr Gepfeife oder lautloses Umkreisen der Zacken den Eindruck des wildpittoresken Bildes. – Die Bruchhäuser Steine bestehen aus Porphyr mit großen Bruchstücken der Grauwacke dazwischen, und zeigen alle Spuren einer vulkanischen Bildung; von der Gewaltsamkeit der Eruption sprechen die Felsblöcke, die weit umher geschleudert und zerschmettert liegen.
Etwa zwei Stunden weiter ins Gebirge hinauf bringen uns nach der Pleister-Legge (Lei, Gestein,) und zu einem so schönen Wasserfall, als ihn eine Berggegend, die doch nur zweiten Ranges ist, bieten kann. Wir haben die Ruhr zu überschreiten, dann führt ein anmuthiges Thal dorthin, durchrauscht von der kleinen munteren Elpe, von grünen Laubholzhöhen beschirmt, die nur selten in Felsparthien die steinernen Rippen ihres Baues durchscheinen lassen. Nur der etwa in der Mitte des Weges liegende Ohlenberg macht eine Ausnahme und glotzt, nur am Fuße reich bewaldet, mit kahlem Schädel weit über die andern fort, wie ein verdrießlicher Alter, daß unter all den grünen Gesellen er allein noch im Mai mit schneegebleichtem Haupte stehen muß. Das Thal verengt sich, die Straße klimmt die Höhen hinan und läuft an ihnen unter dem Laubdach hin, unten rauscht über Schlacken und Gestein immer unruhiger ihre Funken spritzend die Elpe, zuletzt Schaumwellen sich nachreißend, wenn wir dem Getöse des Wasserfalles uns nahen. Nun seitwärts, eine Felswand tritt uns entgegen, eine andere neben uns, eine dritte dieser gegenüber, und ein starker über dem Mittelriff aus unzähligen Quellchen und Zuflüssen zusammengerieselter Bach stürzt senkrecht eine Höhe von vielleicht 150 Fuß hinab, in eine Garbe von Wasserstralen zersplitternd, dann noch eben so tief über Trümmer und Absätze schäumend und aufdampfend. Wir stehen auf unserer kleinen Terrasse im feinen Dunstregen, betäubt von dem Getose und Gezisch, geblendet vom auffahrenden Schaume; von allen Bergen rieseln und kollern Quellen, den fast nur als Staub unten ankommenden Bach verstärkend und mit ihm der Elpe zueilend. Ueber dem Sturze einige hundert Schritt zurück liegt das Dörfchen Wasserfall, nur sichtbar, wenn wir die ganze Höhe erklimmen, um den Sturz aus der Vogelperspective zu betrachten; das Thal schließt sich dort und streckt nur noch einen Büschel Polypenarme als Schluchten und Wege in die Berge aus, wie um sich anzuklammern in der Furcht, von dem Wasserstoße losgerüttelt zu werden.
Ueber den Dörnberg führt von hier der Weg gen Ramsbeck, zu dem in der Geschichte modernen Actienschwindels berühmtesten aller Bergwerke, wo man vor Jahren Paläste bauete und Hunderttausende verschwendete, als ob man die Minen Golkonda's besitze und daraus ein neues Paris im Sauerlande bauen wolle – während man doch in seinen alten Gruben und Stollen, in denen freilich schon venetianische Kaufleute Schätze gesucht zu haben scheinen – man nennt die ersten Anlagen »Venetianer-Baue« – nichts besaß als Blei- und Kupfer-Erze, Schwefelkies und Zinkblende und eine sehr bescheidene Zugabe von Silber. Die große, hauptsächlich von Franzosen und Belgiern gestiftete Gesellschaft ist natürlich den Weg aller solcher Unternehmungen zur Ausbeutung der Leichtgläubigkeit gegangen, nur mit dem Unterschiede von anderen, daß die Großartigkeit der Schwindelei ihr noch bei späteren Geschlechtern ein bewunderndes Andenken sichert. Jetzt hat eine neue Gesellschaft sich der Bergbauanlagen bemächtigt und beschäftigt dabei mit befriedigendem Erfolge über 2000 Menschen. Südlich von Ramsbeck ist bei dem Dorfe Silbach eine alte Silbergrube wieder aufgenommen, in der schon im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert Harzer Bergleute thätig waren. Damals wurden im Centner Blei 80 Mark Silber gefunden, stellenweise auch gediegenes haarförmiges Silber.
Wir kehren über Gevelinghausen durch die Ostwiger Schlucht an die Ruhr zurück und sehen sie bei Olsberg einen weitgekrümmten Bogen schlagen, um nun ganz nach Westen zu strömen. Die Gegend besitzt sehr reiche Schieferbrüche, die hauptsächlich in Nuttlar ausgebeutet werden. Wir erreichen hier die Eisenbahn, die ostwärts weiter zieht, um zunächst die schon erwähnte hochliegende Stadt Brilon zu kränken, von dessen Thore sie über eine Stunde weit ihren Halteplatz angelegt hat. – Ein schönes Thal voll Gärten und Wiesen zwischen den auf beiden Seiten zurückweichenden Bergen führt uns nach Velmede, und von dort zu dem Thore der Höhle, die von der Sage als Velleda's Wohnung bezeichnet wird. Die Velmeder Höhle, welche man fast an der Höhe des Berges über dem Städtchen durch eine weite Thorwölbung betritt, ist eine geräumige aus einem Bogen geschlagene Halle, so weit und kirchenähnlich, daß sie früher jährlich eine Prozession umfaßte und christliche Gebete in endlosem Gesumme und Brechungen durch die Klüfte irrten, wo einst vielleicht unsere Wodansgläubigen Väter, unter dem feuchten Gewölbe sich fester in ihre Bärenhaut wickelnd, nach dem Felsspalte starrten, aus dem die mächtige Drude hervortreten mußte. Im Hintergrunde des Gewölbes senkt sich ein schwarzer Schlund fast senkrecht hinab, und hier mag Velleda, schaudernd vorgebeugt, den Stimmen ihrer schlimmen Götter gelauscht haben; drunten flüstert und zischt es; man hört den Stein, den man in den heiligen Schlund wirft, hier, dort, zehn, zwanzig Mal anfahren und dann in die Gewässer plätschern, die unten aus zahllosen Ritzen zusammenrieseln und ihre heimlichen Wege unter der Erde ziehen. Ein muthiger Fabrikherr hat es vor Jahren unternommen, trotz der drohenden Wassertiefe und der schreckenden Zacken des Schachtes hinabzufahren und wir wissen nun, daß man unten durch eine Seitenkluft in eine Halle gelangt, weit größer und prächtiger als die obere, hochgewölbt, märchenhaft, mit Säulen, Candelabern und grotesken Gestalten aus feuchtglänzendem Tropfstein; ob dem Frevler zürnend die Midgardsschlange und das Wolfungethüm Fenris erschienen, hat er nicht entdeckt, aber seine Beschreibung läßt unsere Phantasie ahnen, daß, wie in ihren Pyramiden die zu Holz gedörrten Pharaone, hier die alten Asgardgötter, inkrustirt und zu Stein erstarrt, den tiefen Fall ihrer Größe in den leise tropfenden Steinthränen beweinen. – Ein schmaler brocklichter Pfad, schlimmer als eine Leiter, führt aus der obern Höhle in eine Seitenkluft, welche in die geheime Werkstatt der Drude leitet, eine gemachähnliche Wölbung, klein, heimlich, mit spitzen Felszacken, die den Eingang bewachen, und schwarzen schmalen Spalten, die noch weithin im Berge sich verschlingen sollen; wir aber haben den heiligen Mistel nicht zur Hand und treten wieder an das Licht des Tages hinaus, das uns die sonst nicht hervorragend schöne Gegend doppelt anmuthig nach der nächtlichen Wanderung macht. Die Bewohner des Ortes unten wissen noch manche Sage von dem »Hollenloch« und seinen weisen Frauen, den Hollen, die es einst bewohnt und bald Glück, bald Unheil über Menschen und Saaten gebracht haben sollen. Sonst nimmt die deutsche Sage nur ein Wesen, Frau Holla, an, die über die Spinnerinnen und den Flachsbau wacht, die es schneien läßt, wenn sie ihr Bett macht und die Federn fliegen, die zu Mittag als schöne weiße Frau in der Flut badet und verschwindet, und nur durch den Brunnen Sterbliche in ihre Wohnung kommen läßt. Daß aber die hohe Velleda gehaust habe in der Höhle von Velmede, ist eine Behauptung, deren Verantwortung die Sage übernehmen muß, welche es so will; wir wissen nur durch Tacitus' dürftige Angaben, daß sie, im Lande der Bructerer gebietend, auf einem Thurme wohnte, daß man sie wie ein höheres Wesen verehrte, und ein Schiff ihr zum Geschenke die Lippe hinauf zog; wir sehen trotz des mundium, worin der Germane seine Weiber hielt, sie ein Bündniß zwischen Tencteren und dem Volke der Colonia Agrippina schließen; aber wo sie in Einsamkeit, den Augen des Volkes entzogen, der Prophezie geheimnißvolle Gabe pflegte, ist so unmöglich zu bestimmen, wie das Wesen jener Gabe altgermanischer Frauen selbst, dem wir nur das an die Seite setzen können, daß ja noch heute fast allein den Frauen die Gabe des Hellsehens wird. Jedenfalls aber spielt die Velmeder Höhle im Volksaberglauben eine große Rolle. Von der Prozession zu derselben wird uns berichtet, daß man am Ostertage zuerst gegangen, die Roggenfelder mit geweihten Palmen zu bestecken, damit ihnen kein Wetter schade und daß, wenn man am Berge angekommen und nicht eher, die Glocken geläutet worden. In der Höhle riefen die Jungfern in den fast senkrecht hinuntergehenden Gang hinab: »Velleda, gib mir einen Mann!« und es antwortete aus der Tiefe: »Han!« Zu gleicher Zeit ging man zu den in der Höhle befindlichen Wasserbecken und sah zu, ob sie gefüllt oder leer waren, wonach man sich ein fruchtbares oder unfruchtbares Jahr versprach.

Die Chaussee führt durch das Ruhrthal, das Städtchen Eversberg zur Seite lassend, wo die schöne Ruine eines Schlosses der Grafen von Arnsberg uns mit ihrem runden Thurm und den hohen Fensternischen hinüberlocken möchte, nach dem Städtchen Meschede, einem der schönsten Punkte des Süderlandes, aber sich fast aller Beschreibung durch den Mangel des charakteristisch Hervorstechenden entziehend; was hilft's zu sagen, das Thal hat angenehme Dimensionen, die Berge haben anmuthig wallende Formen, sind außerordentlich schön bewaldet und reich an lieblichen Contrasten durch hochstämmiges und junges Laub- und Nadel-Holz – die Ruhr macht einen allerliebst coquetten Bogen, die daran, wie eine schmucke Dirne vor dem plätschernden Brunnen-Kübel, stehende kleine Stadt ist blanker und reinlicher als gewöhnlich; an dem Ruhrufer entlang läuft eine der ebensten und schönsten Chausseen Deutschlands! Und doch sind dies die scheinbar geringen Mittel, durch welche eine der reizendsten Gegenden gebildet wird. Meschede ist ein Ort, in dem es schwer sein muß, sich melancholischen Gedanken hinzugeben, so hell und freundlich und dem Auge wohlthuend tritt uns Alles entgegen; es ist der höchste Triumph des eigentlich Mittelmäßigen. Jedermann preist diese Gegend und mit Recht; dennoch läßt sich nichts daraus hervorheben, es gibt weder Felsen, noch Ruinen, noch bedeutende Bergformen; aber eine Klause gibt es, am Berge nächst der Chaussee, die mit ihrem Thürmchen oder Glockenstuhl an der Fichtenwand eine gar reizende Wacht hält, und ihr Glöckchen über die darunter liegende Stadt schallen läßt, wenn dem armen Bruder die Lebensmittel ausgegangen sind, wo sich dann alles beeilt, ihn wieder zu verproviantiren. Ein angenehmer Spaziergang führt an der Klause vorüber nach dem Gräflich Westphalen'schen Gute Laer, das mit seinem Wartthurme, inmitten seiner ausgedehnten Garten- und Parkanlagen, in der ohnedies schönen Lage am Ruhrufer eine neidenswerthe Besitzung bildet. Unter Anderem macht eine Reihe hoher lombardischer Pappeln hart unter dem Berghange und sich längs seiner Fichtenwand abschattirend einen hübschen Effekt.
Bald auf dem rechten, bald auf dem linken Ufer laufend, zieht von hier die Chaussee über unzählige Brücken sich durch das immer malerische Thal, über frische Auen, an bekränzten Höhen vorbei. Dann verläßt sie die Gestade des Flusses, der rechts seitab strömt, führt an dem stattlichen ehemaligen, schon 1192 gestifteten Norbertiner-Kloster Rumbeck her und zieht einen Berghang hinan bis zu dem Punkte, wo man in ein neues Stromthal hinabschaut, kaum glaubend, es sei der herrliche Fluß da unten die jüngst verlassene Ruhr; wo vor uns das schöne Arnsberg wie in Stufen übereinander gesetzt die Giebel und Thürme, die Trümmer des Schlosses von seiner Bergeshöhe erhebt. Man muß hier, an dieser Stelle der Chaussee, wo sie wieder sich zu senken beginnt, stehen und hinüberschauen, wenn irgend ein seltenes Fest, wie der Besuch seines Königs, Arnsberg illuminirt. Dann leuchtet und glänzt es in den Anlagen des »Eichholz«, die vom Fuße des Berges bis zur Spitze hinauf terrassenförmig den ganzen Hang bedecken, es ist, als wäre jede Staude, jeder Ast in zahllosen flammenden Blüthen ausgeschlagen, als schwirrten diese neckend voll Muthwillen ihre Stralenpfeile einander zu und hielten sich wie Schilde dagegen die vergoldet aufblinkenden Blätter vor; wie aus dem Schlafe geweckt tos't und gurgelt und rauscht um den Fuß des Zaubergartens die Ruhr und spiegelt das ganze magische Bild.

Arnsberg liegt auf dem Rücken einer Berghöhe, vor der die westwärts strömende Ruhr plötzlich gen Süden sich wendet, dann in einem großen Bogen umkehrend wieder nördlich strömt, und wenn sie so die Stadt zur Halbinsel gemacht, nach Nordwesten weiter rauscht. Die Stadt ist zum Theil neu und theilt sich in die untere und obere Stadt, wie sie vom rechten Ufer der Ruhr mälig die Höhe hinanklimmt, ihre letzten Häuser fast in die Baumschatten rückend, durch welche man die ohnedies höchst malerische Schloßruine noch malerischer zu machen gesucht hat. Sie ist von größter Ausdehnung, diese Ruine, die die breite Bergfläche wie ein Thurm den Rücken eines Elephanten einst überragte, und weit genug in ihrem Umkreis einem ganzen Lustwald Raum zu geben. Kaum wagt man, all die Trümmer für Fragmente eines Baues zu halten. Das Schloß wurde, von den alten Grafen von Arnsberg seit 1100 nach und nach ausgebaut, dann von den beiden letzten Churfürsten Kölns aus bayerischem Hause, Joseph Clemens und Clemens August verschönert und erweitert; im siebenjährigen Kriege von dem Erbprinzen von Braunschweig zerschossen, ward es vor etwa einem halben Jahrhundert als unwiederherstellbar der Zerstörung überwiesen und das Material zum Bau öffentlicher Gebäude verwandt; aber die älteren Einwohner Arnsbergs reden noch mit Stolz von der Pracht und den großartigen Verhältnissen ihres Schlosses: es gab einen Saal darin, in welchem vierspännige Wagen bequem wenden konnten; jährlich einmal zur Kirche umgeschaffen, nahm er eine mehrere Tausend Menschen starke Prozession auf und, wie man sagt, ohne Gedränge. Man hat von der Höhe des Schlosses aus eine sehr schöne Aussicht auf das enge Thal; uns gegenüber als schließende Wände hochbewaldete Bergrücken; von der (südlichen) Spitze der Halbinsel segnet Weddinghausen, die frühere Benediktiner-Abtei, auf die Stadt herab; unten die wirbelnde quecksilberne Ruhr, die blanken Häuser, die stäubende Chaussee. Zur andern Seite der Ruine, nach Westen hinaus, in lieblichem Contrast mit dem jenseitigen Bilde, weite ruhige Wiesenflächen; der Blick nur durch ferne Höhen mild begrenzt und gleich einer Silberschlange der im offenen Strale zitternde Fluß, sich leicht dahin windend und rechtsab wie ein glänzender Nebel am Horizonte verdämmernd. So ruht und träumt man sich in alle mögliche Romantik hinein zwischen den Trümmern des Schlosses, zwischen seinen blühenden Stauden, deren Zweige um zerfallendes Gemäuer flattern, unter den schlanken Baumwipfeln, die mit einem grauen Thurme flüstern; der hat, nachdem all die alte glänzende Herrlichkeit von ihm abgefallen, sich ein neues bescheidenes Jägerkleid aus unvergänglichem Epheu angethan. Unser Fuß ruht auf Schutt, aus welchem wilde Anemonen sprießen, und läßt Kellergewölbe wiederhallen, welche der Sage harren, die sie mit den Geistern der alten zürnenden Grafen bevölkern wird, – der Sage, welche uns das Burgverließ zeigt, worin Graf Heinrich von Arnsberg seinen Bruder verschmachten ließ, und die schon jetzt die Stelle nicht geheuer sein läßt, wo der alte Fehmgerichtsplatz im Baumhofe zur Seite des Schlosses in einen Garten verwandelt ist.
Die Geschichte nennt einen Conrad aus dem Hause der alten Werler Grafen von Westphalen, einen Verwandten Kaiser Heinrichs III. als ersten Grafen von Arnsberg. Conrad war der eigentliche Stammerbe des alten westphälischen Comitats, das im Laufe der Jahre durch Erbschaft mehrfach getheilt und zersplittert worden. Er baute zu Arnsberg eine feste Burg und seit er sie statt Werl zu seiner Residenz gewählt, tritt er in Urkunden als Graf von Arnsberg auf, oft auch noch Graf von Westphalen oder Graf von Werl genannt. Ihm folgte, als er mit seinem ältesten Sohne in Friesland erschlagen worden, sein zweiter Sohn Friedrich, der zweite Graf von Arnsberg, den wir als den »Streitbaren« bei Cappenberg kennen lernten. Als dieser 1124 ohne Söhne zu hinterlassen gestorben und mit ihm der Hauptstamm unserer alten Westphalengrafen erloschen war, folgte ihm seiner Tochter Sophie Gemahl, ein Niederländer, genannt Graf Gottfried von Kuyck, den Kaiser Lothar geächtet hatte, weil er mit seinem Bruder Hermann seinen Lehnsherrn, den Grafen Florenz von Holland erschlagen hatte; dessen Sohn und Nachfolger, Heinrich I., scheint des Großvaters Friedrich würdiger Sproß gewesen, – wir wissen von ihm, daß er einen jüngern ebenfalls Heinrich genannten Bruder fangen und im Burgverließ verhungern ließ – der Unglückliche war der Stifter geworden einer bald erloschenen Nebenlinie, der schwarzen Edelherren von Arnsberg. Wir hatten ähnliche, wenn nicht ganz so schlimme Züge brüderlicher Liebe von den Grafen von Tecklenburg zu erzählen, während von Zügen grimmen Haders zwischen Vätern und Söhnen die Chroniken voll sind. Man muß diese schrankenlose Entfesselung der rohesten Menschennatur, man muß die alten Burgverließe und Folter-Instrumente, man muß die unglaubliche sittliche Verwilderung und Liederlichkeit des Mittelalters ins Auge fassen, um Entschlüsse, wie die Gottfrieds von Cappenberg, sich aus solchen Zuständen in den Frieden des Klosters zu flüchten, nicht mehr befremdlich zu finden, während uns dagegen jene ganze Zeit immer befremdlicher erscheinen wird, je mehr unsere Cultur eine christliche Grundlage erhält.

Heinrichs I. That blieb nicht ungestraft; seine Streitsucht zog ihm der Nachbarfürsten Feindschaft zu, sie zerstörten seine Burg Arnsberg und zwangen ihn, aus seinem Lande zu fliehen; als er von dem Erzbischof von Köln in den Besitz desselben zurückgeführt worden, sühnte er seine Thaten durch die Stiftung des Klosters Weddinghausen (1170), in welchem er 1200, fast 90 Jahre alt, als Laienbruder starb; sein Erbe hatte er seinen Söhnen übergeben, von denen ihm Heinrich II. als Graf von Rittberg, Conrad II. als Graf von Arnsberg folgte. Conrads Sohn, Gottfried III., der 1238 den um seine Burg zu Arnsberg angesiedelten Hörigen städtische Freiheit gab, und die folgenden Grafen Ludwig und Wilhelm brachten ihr Leben im vergeblichen Ringen wider die übergreifende Gewalt der Kölner Erzbischöfe hin, bis Gottfried IV. im Jahre 1368 kinderlos, alt und der unendlichen Fehden müde, seine Grafschaft scheinbar im Wege des Verkaufes, in der That aber fast als Geschenk, dem Erzbisthum Köln überließ. Er zog sich nach Brühl zurück und starb dort 1371. – Als Erben der alten Westphalengrafen hatten die Grafen von Arnsberg das Recht des Vorstreits in Reichskriegen zwischen Weser und Rhein; hier waren sie die Träger der Reichssturmfahne wie die Schwaben auf fränkischer Erde.
Der Freistuhl zu Arnsberg »vor der Olei-Pforten im Baumgarten unter der Burg« verdankt seine Bedeutung als der nach dem Dortmunder angesehenste, als eine Art Appellationshof der Fehme, hauptsächlich dem Umstande, daß der Erzbischof von Köln, der oberste Stuhlherr aller Freigerichte, der seit 1368 auch noch unmittelbarer Stuhlherr über das Arnsberger Freigericht geworden, an diesem nun alle wichtigen Amtsgeschäfte vornahm und hier die meisten, zuweilen vom Kaiser selbst ausgeschriebenen Generalcapitel abhielt, so daß die »Kamer« oder der »Spegel« von Dortmund selbst, der einst die Ehre gehabt, den Kaiser Sigismund wissend zu machen, hinter Arnsberg zurücktrat. Unter den Freigrafen dieses Stuhls zeichnete sich durch Energie und Thätigkeit um 1487 Gerhard Struckelmann aus, auch Freigraf zu Eversberg und Rüthen. Er lud gegen das Herkommen, wonach »paffen, frauwen und Juden mit an westfälsch gerichte gehoren«, sogar die Abtissin von Essen vor seinen Stuhl und nahm keinen Anstand, Frankfurter Juden vor sich zu heischen, wurde jedoch dafür 1489 von einem päpstlichen Commissar in den Bann gethan. Er nannte sich »Gerhard Struckelmann, eyn gewert Richter und Frygreve des hil. romischen Richts, von keiserliker und koninckliker Gewalt und Macht, der freyengraveschoff des keiserliken Frienstoels zo Arnsberch in dem Boemhove gelegen under der Borch vor der Oleiporten«. Als solcher bekundet er 1490, daß er einen gemeinen Capitelstag gehalten, worin namentlich die verschiedene Competenz des heimlichen und öffentlichen Dings geordnet wurde. Es waren erschienen dazu mehrere hundert Freischeffen, 65 Freifrohnen, viele Freigrafen und Stuhlherren. An demselben Tage auch stellte Struckelmann ein Weisthum darüber aus, daß alle, die in der Freigrafschaft wohnen und einen »eigenen Rauch darin haben«, sie seien wissend oder unwissend, drei Mal im Jahre beim »echten Ding« erscheinen müßten. – In einer Urkunde von 1505 erkannte er, daß ein Angeklagter, Friedrich von Fürstenberg zur Waterlappe, von der Beschuldigung freizusprechen, da er so rein sei, wie er gewesen am Tage bevor »hey in dat faem quam«. Dieser Ausdruck scheint von entscheidendem Gewichte für diejenigen, welche das Wort Fehme von fama, Ruf, herleiten und im Fehmgericht das Gericht für die ob ihres Rufs angeklagten, für »verrufene Leute« sehen. Gerd Struckelmann waltete noch im Jahre 1526; doch hatte er sich in den letzten Jahren um ein bedeutendes seinen Titel gemehrt, er nannte sich jetzt, in der Orthographie nicht eben stärker geworden: »en gewert Rychter des hylgen Romesschen Rychs und eyn gehuldet unde confirmert ffrygreve der werdigen keyserlichen ffriengraveschaffen tzo Arnsberch ais tzo Hovede, der ffrienstoille tzom Eversberge, tzo Bylsteyn, tzo Ruden, tzo Balve, tzo Heytzen (Heessen) unde tzo Steinfoyrde«. Der Beisatz: ais tzo Hovede, als zu Heubte, als zu Hoeffde, zu Haubte, wird von nun an für den Arnsberger Stuhl als »Ubergericht aller Fryenstuele« gebräuchlich. Der letzte Oberfreigraf hieß Franz Wilhelm Engelhard; er sprach noch Recht im Jahre 1826, obwohl er das letzte förmliche Freigericht schon 1786 zu Allendorf gehegt; als Besoldung bezog er aus den Bezirken seiner Freistühle einiges Korn, Hühner und geringe Geldgefälle. Die Loosung der Fehme war im Laufe der Jahre so verloren gegangen, daß er selber sie nicht mehr kannte. Er starb 1885, um dieselbe Zeit, wie der letzte Freigraf von Dortmund, der Löbbeke, und der von Warburg, der von Hiddessen hieß.
Die Zerstörung des Schlosses, in dessen Burgfriedensbezirk das Fehmgeding einst tagte, gehört, wie wir oben sagten, der Zeit des siebenjährigen Krieges an, – nachdem es der Schauplatz einer merkwürdig muthigen und hartnäckigen Vertheidigung durch eine handvoll französischer Soldaten geworden. Die Stadt Arnsberg, wird darüber in einer alten Aufzeichnung berichtet, hatte zu Anfang des Jahres 1762 eine französische Besatzung von zweihundert Mann unter dem Befehl des Commandanten Muret; sie diente dazu, die Verbindungen der Franzosen in Westphalen zu erhalten und die Truppen der Verbündeten in den benachbarten Garnisonen zu beunruhigen. Daher faßte der Erbprinz Ferdinand von Braunschweig beim Ausgang des Winters den Plan, diesen Platz, dessen Besitz sich ihm als folgenreich für den bevorstehenden neuen Feldzug darstellte, mit einem starken Corps anzugreifen und zu überwältigen. Wie das Gerücht laut wurde, daß die Bundesmacht auf Arnsberg loszugehen beabsichtige, betrieben die Franzosen die Vollendung der bereits während der Winterzeit angefangenen Befestigung mit verdoppeltem Eifer und legten Brustwehren, Außenwerke und Palissaden an. Sie versahen sich mit der nöthigen Anzahl von Kanonen und schleppten zugleich alle Geschützstücke zusammen, deren sie auf dem Schloß Schnellenberg und den adligen Häusern Wocklum und Sundern habhaft werden konnten. Durch die getroffenen Vertheidigungsanstalten glaubten sie im Stande zu sein, dem Unternehmen der Feinde die Spitze zu bieten und sorglos wegen des Ungewitters, welches gegen sie im Anzuge war, überließen sie sich den Regungen ihrer nationalen Heiterkeit, ersannen allerlei Arten der Belustigung, spielten, tanzten und gaben Concerte.
Das zur Belagerung bestimmte Corps der Verbündeten setzte sich am 15. April in zwei Colonnen in Bewegung. Die Preußen marschirten unter dem Erbprinzen über Hamm, Werl, die Haar hinauf an die Ruhr, und vereinigten sich dort mit den von Lippstadt aufgebrochenen hannoverschen Divisionen, welche von den Generallieutenants von Bock und von Oheim befehligt würden. Am 17. überschritt das ganze verbündete Heer, 15,000 Mann stark, mit einem bedeutenden Artilleriezuge die Ruhr. Die Bock'schen Truppen besetzten Hövel und Hachen, der Erbprinz stellte sich bei Sundern und Hellefeld, der Generallieutenant von Oheim an der Seite nach Meschede zu auf, und so war Arnsberg gänzlich umzingelt.
Die Franzosen waren in der Stadt und der Abtei Weddinghausen verschanzt. Zufolge der an sie ergangenen Drohung, daß man die Stadt beschießen würde, wenn sie nicht geräumt werde, verließen die Belagerten ihre seitherige Stellung, um nicht die friedlichen Einwohner mit ins Verderben zu ziehen, und wichen in das Schloß, wohin nun der Schauplatz des Angriffs und der Vertheidigung verlegt wurde. Die Stadt Arnsberg, so lautete das Uebereinkommen, sollte als neutral behandelt und von beiden Seiten geschont werden. Ehe noch eine Kugel gewechselt worden war, sandte der Erbprinz Botschaft an den Commandanten der Feste, um ihn zur Ergebung zu veranlassen. Muret, der wohl einsah, daß das Schloß der ungeheuren Uebermacht der Verbündeten, welche eine Artillerie-Stärke von acht Mörsern, acht Haubitzen und vierundzwanzig Kanonen schweren Kalibers gegen dasselbe gerichtet hatten, nicht widerstehen konnte, suchte Frist zu gewinnen und gab die Erklärung, daß er, wenn bis zum 21. April kein Entsatz eintreffe, auf folgende Bedingungen zu capituliren Willens sei: 1) verlange er freien Abzug mit allen militärischen Ehren, allen Kanonen, einem verdeckten Wagen, sämmtlichem Kriegsbedarf und allen königlichen Geräthschaften; 2) dürfte von den Verbündeten während der noch übrigen Dauer des Krieges in das Schloß keine Besatzung gelegt werden; 3) könnte man zwar die Befestigungswerke schleifen, das Schloß selber aber müßte unbeschädigt bleiben; 4) sollte das Archiv und alles bewegliche Eigenthum des Kölnischen Churfürsten im Schloß durchaus geschont werden.
Der Erbprinz verwarf diese Vorschläge und verlangte unbedingte Ergebung mit Auslieferung aller Vorräthe und Heergeräthschaften. Als Muret sich dessen weigerte, begann in den Reihen der Belagerer am 19. ein so entsetzliches Feuer, daß in einigen Stunden nicht blos das Schloß, sondern auch die Hälfte der Stadt in Flammen stand. Die unglücklichen Einwohner waren vor Schrecken und Verzweiflung außer sich; der Donner der Geschütze übertönte ihr Jammergeschrei. Während die Zerstörung so um sich griff, ließ man eine zeitlang die Kanonen schweigen, und der Erbprinz benutzte den Augenblick der Pause, um seinen früheren Antrag an den französischen Coinmandanten in schriftlicher Form zu erneuern. Diesmal wurde der Besatzung freier Abzug bewilligt und nur die Forderung gestellt, daß die Munition zurückgelassen werden sollte. Muret antwortete in entschiedenem Tone: seine vorige Unterhandlung wegen der Capitulation habe blos die Erhaltung des churfürstlichen Schlosses zum Zwecke gehabt, jetzt, wo dasselbe schon halb in Asche liege, sei er entschlossen, den Kampf unter den Trümmern bis auf den letzten Mann auszuhalten. Zu gleicher Zeit strengten die Belagerten alle Kräfte an, um die in dem Schlosse wüthenden Flammen zu dämpfen, allein die Mühe, ihrer Herr zu werden, blieb eine vergebliche, weil die Verbündeten mit dem Schießen von Neuem anhuben. Kugelregen, Gluth und Rauch vertrieben die Franzosen vom Schloßhofe; und diese sahen sich nun genöthigt, in den verdeckten unterirdischen Gängen Schutz zu suchen, wo sie übrigens die Vertheidigung hartnäckig fortsetzten. Sie verriethen keine Zeichen von Entmuthigung, obgleich bis zur Mittagsstunde bereits über 2000 Kanonenschüsse auf Schloß und Stadt gefallen und außer 300 Feuerkugeln mehr als 1200 Bomben darin geworfen waren.
In seinem Erstaunen über den heldenmüthigen Widerstand des Feindes, ließ der Erbprinz der Thätigkeit des Geschützes abermals für eine Weile Einhalt thun; er kam selber bis an die Barriere und wiederholte, um der Verschwendung des Pulvers und Blei's ein Ende zu machen, seinen letzten Vorschlag, wobei er dem Kommandanten zugleich eröffnete, daß es nicht seine Absicht sei, eine so tapfere Besatzung in den Flammen umkommen zu lassen. Muret wollte indessen noch immer nichts von einer Uebergabe hören, und wie die unter dem erneuerten Bombardement einstürzenden Gewölbe die Seinigen zu verschütten drohten, sammelte er die kleine Schaar wieder in dem freien Raume der Festungswerke und mahnte sie, sich so lange zu wehren, bis jede Rettung verloren sei. Der Kampf dauerte noch über eine Stunde; da geschah es, daß die aus bloßen Faschinen aufgeführten Bollwerke nach allen Richtungen hin in Brand geriethen. Die von einem Feuergürtel umringte und in Rauch eingehüllte Besatzung kam dadurch in die Gefahr, dem Erstickungstode überliefert zu werden. Dies bewog endlich den herzhaften Kommandanten, das Zeichen zur Uebergabe der vernichteten Feste aufzustecken. Es war drei Uhr Nachmittags, als das Häuflein Franzosen sich zum Abmarsch durch das Galgenthor anschickte. Die Macht der Geschütze hatte ihre Wirkung blos an den Mauer- und Bauwerken gezeigt; Blut war wenig geflossen; man sagt, es sei auf beiden Seiten nicht ein Mann umgekommen.
Nachtrag
Wir erinnern an dieser Stelle an eine fernere fast vergessene Waffenthat des siebenjährigen Krieges, deren Schauplatz Westphalen war: die Schlacht bei Villingsen am 16. Juli 1761. Die Franzosen hatten den Erbprinzen von Braunschweig aus Hessen zurückgetrieben, und drangen in Westphalen ein, wo sie sich seines Waffenplatzes Lippstadt zu bemächtigen suchten. Zur Deckung desselben stellte sich ein Corps Hannoveraner unter den General Spörken nordwärts von der Stadt auf; der Erbprinz aber nahm eine Stellung mit dem Centrum in Dinker, den rechten Flügel nach Scheidingen, den linken über Billingsen bis an das Gut Neuenhausen und an die Lippe vorgeschoben. Die Franzosen, unter dem Herzog von Broglio und Soubise griffen am 15. Juli Abends mit heftigem Ungestüm den linken Flügel Ferdinand's zu Villingsen, wo Lord Gramby ein Corps befehligte, an, welches ihnen einen muthigen Widerstand leistete und, nachdem es Verstärkung erhalten, um 10 Uhr Abends das Heer Broglio's gänzlich schlug, wobei des Grafen Wilhelm von der Lippe-Schaumburg Feuerschlünde sehr kräftig und nachdrücklich wirkten. Ferdinand, welcher das Spörken'sche Corps an sich gezogen, wurde am folgenden Morgen, den 16. Juli, auf seinem linken Flügel, während der Prinz von Soubise seinen rechten Flügel stark beschoß, heftig angegriffen. Aber des größten Artilleristen des Jahrhunderts Batterieen schleuderten auch in diesem Treffen in die Reihen der Feinde Tod und Schrecken. Die Alliirten entrissen ihnen eine Anhöhe, auf welcher sie eine Batterie zu errichten im Begriff waren, und ihre Colonnen warfen sich mit Löwenmuth auf die Franzosen, dergestalt, daß sie in hellen Haufen über die Ahse geworfen und in die Flucht geschlagen wurden. Sie zogen sich auf das Haargebirge hinter Soest eilig zurück, und es trennten sich die Marschälle Broglio und Soubise in großer Uneinigkeit. Soubise ging über Arnsberg zum Rhein zurück, und wurde abberufen, während Broglio längere Zeit in Unthätigkeit verharrte, um sein Heer wieder zu discipliniren.
Die Verbündeten hatten nur 300 Todte, 1000 Verwundete und 200 Vermißte. Der Verlust der geschlagenen Heere belief sich auf 5000 Mann, worunter 1300 Gefangene mit 62 Officieren, 9 Kanonen, 6 Fahnen und viele Kriegsbeute.
In ehrenvoller Anerkennung der Ausdauer und Kühnheit, womit die kleine Besatzung sich stundenlang gegen einen fünfundsiebenzigfach stärkeren und an Zerstörungswerkzeugen in gleichem Grade überlegenen Feind zur Wehr gesetzt hatte, gewährte man derselben freien, ungehinderten Abzug. Eine hessische Dragoner-Abtheilung begleitete die Abziehenden bis nach Wipperfürth, wo sie von dem Corps des Marquis von Conflans aufgenommen wurden. Die Verbündeten nahmen unterdessen von der Trümmer- und Aschenstätte Besitz und ließen den Rest der Mauerwerke sprengen. Dann ging es ans Plündern, besonders ward Alles in den unteren Räumen des zerstörten Schlosses vorgefundene Kurfürstliche Gut sammt dem Archiv und was sonst an kostbaren Geräthschaften und Kircheneigenthum dorthin geflüchtet worden war, eine Beute der Soldaten. Dreiundfünfzig Häuser der Stadt lagen in Schutt, die wenigen Habseligkeiten, welche die bedrängten Einwohner aus dem Feuer gerettet hatten, verloren sie größtentheils durch den Raub!
Kurfürst Salentin von Isenburg beförderte am Ende des 16. Jahrhunderts die Erweiterung und Verschönerung der Hauptstadt, wo eine unter dem Titel von Landdrost und Räthen niedergesetzte Kanzlei die Verwaltung des Landes führte, bis der Lüneviller Frieden das Herzogthum Westphalen mit der Grafschaft Arnsberg (1802) dem Hause Hessen-Darmstadt überwies. Preußen nahm sie 1816 in Besitz.
Das alte Schloß zu Arnsberg wurde einst durch die im Westen am jenseitigen Ruhrufer auf dem Rümberge liegende Rodenburg überragt. Jetzt beschatten hochwipflige Bäume die sparsamen Trümmer dieses ehemals bedeutenden und stolzen Dynastensitzes – kaum noch sind die Grundlinien der alten Anlagen mit Vorburg, Hauptburg und Belfried zu erkennen. Das Schloß ist älter als Burg und Stadt Arnsberg, es mag zu den ältesten deutschen Befestigungen, den Wallburgen gehört haben. Das Geschlecht der Rodenburg, das hier hauste, besaß ebenfalls westlich von den Thoren der Stadt Rüthen eine Burg, die älter war als diese Stadtanlage. Es war weit und reich begütert und erlangte mit der Erbtochter Gisela von Stromberg um 1204 auch diesen Burggrafensitz, dessen, sowie des Ausganges der dortigen Linie wir oben erwähnten. Aus der Linie, die auf dem Rodenberg blieb, war Gottfried III. 1435 Landmarschall des deutschen Ordens in Liefland; sein Bruder Heinrich VII. wurde von seinem Lehnsherrn (Kur-Cöln) 1401 aufgeboten, mit ihm gegen die Hessen in's Feld zu ziehen, und dazu seine steinerne Buchse (Kanone) mitzubringen. Heinrich VIII. war der letzte seines Stammes; »gegen 1508 erschossen«, heißt es lakonisch in der Stammtafel der Rodenburg Bei A. Fahne: Die Hrn. und Frhrn. von Hövel, Köln 1860., in welcher der seltene Frauenname Palmanie oft wiederkehrt.
Die Ufer der Ruhr behalten im Ganzen, wenn wir weiter hinab ihrem Laufe folgen, denselben freundlich milden Character; wir lassen zur Rechten den Lüer- oder Arnsberger Wald; links den Weiler Breitenbruch, in dessen Nähe die berühmte Eiche, die Königin Westphälischer Wälder, im Umfange des Stammes 26 Fuß messend, gezeigt wird; berühren Hüsten und Neheim, wo die Gewässer der Möhne sich in die Ruhr ergießen, und lassen uns zu einer kleinen Abschweifung nach linkshin verführen, um einem Gebirgswässerchen zu folgen, das uns aus den Waldbergen entgegenkommt. Sind wir eine Viertelstunde aufwärts geschritten an diesem Bach – die Röhr heißt er, wenn wir nicht irren – so erheben sich vor uns die Thürme, Giebel, Zinnen und Zacken des stolzesten Grafenschlosses im Westphalenlande, das prächtige Herdringen, das inmitten seines schönen Parks einen überraschenden Anblick darbietet. Es ist an der Stelle des alten Edelsitzes Herdringen, des jetzigen Stammhauses der Hauptlinie der Fürstenberg, ganz neu von dem jetzigen Grafen Egon in den Jahren 1840–1845 und nach den Plänen des Kölnischen Dom-Baumeisters Zwirner aufgeführt, groß und schön, wie eine königliche Residenz und jedenfalls ein würdiger Sitz für ein Geschlecht so rühmlichen Namens. Es stammen die Fürstenberg ursprünglich von den Grafen von Oldenburg und wären danach also eigentlich dynastischen Ursprungs, wie ebenfalls die alten Edelherren von Grafschaft, deren Erben sie würden. Ihren Namen führen sie von der nicht weit entfernten, bei Neheim an der Ruhr liegenden Burg Vorstenberg, welche 1345 von den Grafen von der Mark und Arnsberg zerstört wurde. Seitdem nahmen sie ihren Hauptsitz in dem weiter unten an der Ruhr liegenden Waterlap. In neuerer Zeit sind Herdringen, die Adolfsburg tief im Sauerlande und Stammheim bei Mülheim am Rhein ihre Haupt-Sitze geworden. Reichsfreiherren wurden sie durch Kaiser Leopolds Diplom vom 20. Mai 1660 – Grafen durch den König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1840. Sie siegeln mit zwei rothen Querbalken in goldnem Schilde.
Es ist an ausgezeichneten Männern, an eigenthümlichen Charakteren und an Umfang des Besitzes kein anderes westphälisches Adelsgeschlecht so reich wie die Fürstenberg. Was die erstgenannten angeht, so sehen wir diese alle zunächst im Dienste der Kirche, doch hier vorzugsweise die Talente des Staatsmanns und Administrators entwickelnd. Am glänzendsten tritt dies hervor in Ferdinand von Fürstenberg, dem von uns oben erwähnten Fürstbischofe von Paderborn. Er war ein Charakter, der in seinen Grundzügen die westphälischen Race-Eigenschaften durchaus nicht verleugnete, eine strenge, feste, aristokratische Natur, wenn auch dies nicht in dem Grade wie sein Vorfahr und Vorgänger auf demselben Bischofsstuhle, Theodor von Fürstenberg, der die Jesuiten in Paderborn einführte, und der sich als sehr gestrengen Herrn, und nebenbei vortrefflichen Haushalter erwies. Bei Ferdinand von Fürstenberg sehen wir diese Eigenschaften gemildert durch sanfteren Sinn und hohe geistige Bildung. Um ganz die Verdienste dieses trefflichen Mannes, der durch jahrelangen Aufenthalt in Rom – er war Cameriere segreto des Papstes Alexander VII. – seine Ausbildung erhielt, zu schildern, müßten wir in das Detail einer Administration eingehen, welche, wie man sich ausdrückt, das goldene Zeitalter über sein kleines Land heraufführte. Wir müßten dabei das, unseren heutigen Finanzministern gewiß räthselhafte Ergebniß hervorheben, daß, während auf der einen Seite für die Hebung des Landes alles Mögliche geschah, Posten eingeführt, Fabriken angelegt, Schulden abgetragen, die arbeitenden Classen durch Bauten aller Art beschäftigt wurden, doch die Steuern so gemindert werden konnten, daß sie im Jahre 1666 z. B. so unbedeutend und gering waren, wie vielleicht nie vorher. Seinen bleibenden Ruhm verdankt Ferdinand von Fürstenberg jedoch seinen wissenschaftlichen Leistungen, seinem schönen Werke » Monumenta Paderbornensia«, welche das Resultat seiner in Rom unternommenen geschichtlichen Studien waren und deren Werth schon die große Anzahl von Auflagen andeutet, die ihnen in den Jahren 1669 bis 1714 wurde. Die schönste Ausgabe ist die von Elzevir in Amsterdam besorgte. Dann ist Ferdinand von Fürstenberg zu hohen Ehren gekommen als lateinischer Dichter; seine »Poëmata« erschienen zuerst in der 1656 in Rom veröffentlichten Sammlung, welche man nach ihrem Mäcen, dem Papst Alexander VII., die Pleias Alexandrina nannte; später gab die königliche Druckerei in Paris sie 1684 in einer prächtigen Ausgabe in Folio heraus. Als Dichter war Fürstenberg, so gesteht sein Biograph, »jedoch nicht so sehr ein großer, als klarer und scharfsinniger Geist; er ragte mehr durch die Kraft eines hellen Verstandes, als durch schöpferische Phantasie hervor. Seine eigentliche Bedeutung liegt in seinem tiefen und umfassenden historischen Wissen; neben seiner Gelehrsamkeit war er ein großsinniger, echt deutscher, für alles Edle hochbegeisterter Mann, geistig erleuchtet, wie wohl wenige seiner Zeitgenossen.«

Neben Ferdinand steht, geistig vielleicht noch bedeutender, der von uns genannte Franz Friedrich Wilhelm von Fürstenberg, den im Jahre 1763 Kurfürst Maximilian Friedrich von Cöln, Fürstbischof von Münster, an die Spitze der Verwaltung des Münsterlandes setzte, und der hier, im Sinne jener Humanitätsideen, welche in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das wohlthätige und segensreiche Wirken so manches erlauchten Fürstennamens beseelten und in Kaiser Joseph II., in Karl Friedrich von Baden ihren weitreichendsten Ausdruck fanden, – mit genialem und schöpferischem Geiste organisirte, aufbaute und verwaltete. Fürstenberg's Leben und Thätigkeit zu beschreiben, ist hier nicht die Stelle. Nur das wollen wir anführen, weil es eine noch nicht hervorgehobene Seite seines Charakters ist, daß er nicht allein von unsern westphälischen Stammeigenschaften, sondern auch von dem, den meisten frühern Gliedern der Familie Fürstenberg ehemals eigenen originalen Wesen und Seltsamkeiten ein gutes Theil mit bekommen hatte. Er war ein ganz realistischer Kopf und hielt mit westphälischer Zähigkeit an seinen Anschauungen fest. Ihm Widerstand entgegensetzen, hieß ihn seine Plane mit desto größerer Entschlossenheit und Ausdauer verfolgen machen. Der kleine Mann mit der gebogenen feinen Nase und den scharfen Zügen, der nur auf kleinen Pferden ritt oder auch wohl im Lederkäppchen und im grauleinenen Kittel über Land ging, um seiner Freundin, der Fürstin Gallitzin, auf dem westphälischen Oberhofe, ihrer Sommerresidenz einen Besuch zu machen, war eine eigenthümliche Erscheinung. Zu seinen Eigenheiten gehörte eine große Zerstreutheit; so hatte er einst den Namen eines Lieblingspferdes statt des seinigen unter eine Verordnung gesetzt; ein anderes Mal ließ er sich, so wurde uns erzählt, von einem Roßtäuscher bewogen, ihm einen Pony abzukaufen, ohne zu ahnen, daß es dasselbe Pferd sei, welches er am vorigen Tage, als alt und unbrauchbar geworden, selbst hatte verkaufen lassen. Wenn er Reisen machte, so mußte ihn ein Franziskaner-Mönch begleiten, den er als Lexikon über griechische Philosophie, namentlich den Aristoteles, welchen der Mönch so ungefähr auswendig wußte, gebrauchte. Eine andere seiner Eigenheiten war, daß nur solche Leute Gnade bei ihm fanden, welche seinen scharfen, reiherartigen Augen mit offenem, freiem und festem Blick begegneten, was mancher schüchterne und blöde Bittsteller zu seinem Schaden inne wurde. Auf der von ihm gestifteten Militairschule erhielt auch der später so berühmt gewordene Marschall Kleber eine Zeitlang seinen Unterricht. Der Minister, der jeden Morgen nach der Reitschule auch den Fechtboden zu besuchen pflegte, erkundigte sich hier eines Tages nach den Fortschritten des jungen Mannes und forderte ihn zu einem Gange auf. Kleber setzte unbedacht sogleich seine ganze jugendliche Kraft wider den kleinen, zartgebauten Herrn ein und schlug ihm das Rapier aus der Hand. Ueber diese Rücksichtslosigkeit erzürnte der Minister so, daß Kleber die Hoffnung auf eine Anstellung im Militairdienste des von Fürstenberg verwalteten Landes aufgab. Dies war die Veranlassung, daß Kleber sein Glück anderswo suchte, und auf der neu betretenen Bahn endlich der Marschall von den Pyramiden wurde.

Außer Theodor, Ferdinand und Franz von Fürstenberg hat das Geschlecht, welches Herdringen bewohnt, noch einen vierten Landesherrn oder Fürsten – wenn wir den eine Zeitlang das Münsterland mit vollkommener Machtbefugniß verwaltenden Minister hinzuzählen – hervorgebracht, den letzten Fürstbischof von Paderborn und Hildesheim, Franz Egon von Fürstenberg, der durch seine reiche testamentarisch vermachte Erbschaft den Grund zu dem großen Vermögen der Linie in Stammheim legte. Er regierte Paderborn von 1786 bis 1802 und war ein liebenswürdiger, menschenfreundlicher, wegen seiner Wohlthätigkeit allgemein verehrter Mann, wenn er auch die geistige Bedeutung seines Bruders, des Ministers oder seiner beiden Vorfahren im Fürstenthum, Theodor und Ferdinand, nicht besaß. –
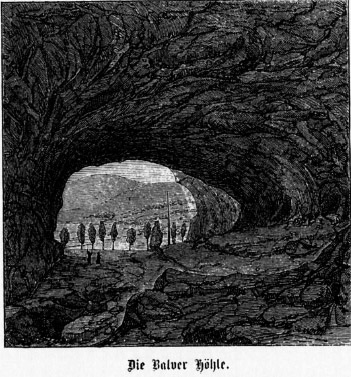
Von Herdringen scheidend und unsere Ruhrwanderung verfolgend, finden wir in Fröndenberg den nächsten, zum Verweilen einladenden Punkt. Fröndenberg ist ein ehemaliges um 1214 von einem Schedaer Mönch Bertoldus und seinem Bruder Menrikus auf dem Berge »Haßlei«, worauf jener Anfangs unter einem großen Lindenbaume seine Eremitenhütte erbaut, gestiftetes Cisterzienserkloster, das die Grafen von der Mark und die Herren von Ardey ausstatteten – mit einer 1230 vom Grafen Otto von Altena erbauten Kirche, in welcher viele der Grafen von der Mark ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, obwohl nur das Denkmal Eberhards und seiner Gemahlin Ermgarde noch vorhanden ist. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kloster zu einer freiweltlichen Abtei für adliche Fräulein, der nach den Religionsrecessen allen im Reich anerkannten Confessionen angehören durften, während die Kirche simultan war. Das alte Stift bildet die Staffage in einem Bilde von großer Lieblichkeit – Wiesenteppiche, so sanft und grün wie ein Elfenthal, von einer zahllosen Viehheerde friedlich durchweidet, der Fluß wie ein springendes Kind, über tausend Kiesel rauschend, an größeren Steinen artig Wellchen kräuselnd oder eigensinnig aufspritzend. Eine hübsche sonntäglich aussehende Brücke führt hinüber und vom Berghange jenseits steigt das Dorf amphitheatralisch bis fast an das Ufer nieder; überall lauschen freundliche Wohnungen hervor, die der Chanoinessen oben, nett und sittsam auf kleinen Flächen stehend, Gärtchen mit geschornen Buchenlauben und Centifolienbüschen zu ihren Füßen. Eine breite Treppe von behauenen Steinen führt über Terrassen den Berg hinan, bis zum stillen Kirchhofe und der höchst malerisch liegenden Kirche. Auch die umliegenden Berge schauen mit ihren milden Formen, ihrem üppigen frischen Baumwuchs fast kindlich drein und über dem Ganzen schwebt ein Hauch ländlichen Friedens, der nicht wiederzugeben ist, aber von dem sich Jeder angeweht fühlt, der von den Absätzen der Steintreppe seine Blicke über die Dächer und Gärten und Gebüsche, das ganze fröhliche Landschaftsbild streifen lassen. – Der Weg führt uns, immer die Wiesen entlang, bis zur Hönne, die hier unter Fröndenberg mündet, ein kregles Wässerchen, so kraus und zänkisch, wie ein englisches Hähnchen. Schreiten wir dies Nebenthal hinauf: wir kommen durch Menden, einst der Sitz kölnischer Erzbischöfe, und an seinem Rodenberge oder Romberge vorüber, in dessen Anlagen, an der Rückseite einer Kapelle, man ein schönes liegendes Christusbild bewundert und sich der Täuschung hingibt, im Schatten der darüber neigenden Zweige die steinerne Brust auf und niederwogen zu sehen, – dann an dem Gute Rödinghausen – eine gute Strecke weiter an der majestätischsten Felswand in dem ganzen Strich dieses Kalksteingebirges, die 200 Fuß Höhe hat, her, und nähern uns so dem Klusenstein. Es ist eine romantische Wanderschaft; das Thal klemmt sich immer wilder und düstrer endlich zur engen Schlucht zusammen; die schmale Hönne rauscht pfeilschnell unten über kantige Felsbrocken, aufbrodelnd und Streichwellen über den Fußweg schleudernd, bis endlich aus tiefem Kessel uns das Gebrause und Schäumen einer Mühle entgegen stürmen. Hier ist die Fährlichkeit überwunden, eine kühne kuppige Felswand springt vor uns auf, drüber ragen die Ringmauern und Trümmer der alten Burg, aus der ein neueres Wohnhaus wie ein wohlhabiger Pächter einer alten Ritterherrlichkeit hervorlugt. Der Weg führt etwas seitab, durch's Gebüsch, zum Eingange der Höhle, die uns wie ein schwarzes Thor entgegengähnt. Das Gewölbe ist schön und weit gespannt, eine kühne Architektonik; der erste Raum ist 200 Fuß lang. An Decke und Seitenwänden glänzen Stalaktiten von röthlicher Farbe und grotesken Bildungen; an jeder Spitze ein graulich glänzender Tropfen, der langsam fällt und die Höhle mit einem monotonen Geräusche einschläfert. Im Hintergrunde klaffen zwei dunkle Spalten auf, die man mit Fackellicht, scheu vor dem überall hervorsickernden Wasser, gebückt vor den wie Spieße niederdrohenden Tropfsteinzapfen, betritt, vorsichtig durchschreitet, endlich durchkriecht. Nach mühseliger Fahrt dämmert der Schimmer des Tages uns entgegen, wir stehen wieder in der Eingangshalle, ehe wir's gedacht und sind verwundert, einen Halbkreis beschrieben zu haben, während wir uns den Eingeweiden der Erde immer mehr zu nähern glaubten. Nehmen wir den Weg, nachdem wir aufgeathmet, über die Höhe, an den Mauertrümmern her, lassen uns einen frischen Trunk oben aus dem unergründlich tiefen Brunnen winden und schauen über das Gemäuer und die Felskante in den drunten gähnenden Schlund, um dessen Risse wie um die Burgruine eintöniges Mühlengeklapper und düstre Wipfelschatten, eine Veit Webersche Sagenpoesie schweben, wenn in der Dämmerung die große Reheverzehrende Ohreule Schufut sie umkreist. Ueber die Erbauung der Burg Klusenstein berichtet uns Levold von Northof in seiner für die Geschichte der Grafen von der Mark so wichtigen, aber auch wahrhaft grauenhaften, als den ganzen Inhalt seiner Zeit nur Fehden, Schlachten, Verwüstungen von Land und Leuten, Belagerungen von Städten, Zerstörungen und Berennungen von Burgen, blutigen Hader all überall aufweisenden Chronik: »Im Jahre des Herrn 1353, da der Graf (Engelbert) über's Meer ging, begann Gerhard von Plettenberg in Abwesenheit des Grafen die Burg und die daranliegende Stadt Rode zu gründen und zu erbauen, und gleicherweise auch die Burg Clusenstein, wie diese Bauten noch heutzutage zu sehen sind.« – Gerhard von Plettenberg war einer jener drei treuen Drosten der Grafen von der Mark, von denen Ludolf von Boenen und Rutger von Altena uns an andrer Stelle begegnen werden, und deren Vasallentreue in Rutger von Altena gipfelte. Als dieser seinem Grafen Eberhard über zwölf Jahre seiner Amtsführung Rechnung ablegte, wies er jede Entschädigung für alles, was er in seiner Herren Fehden und bei der Erbauung ihrer Burgen vorgeschossen, zurück, – und das war nichts geringes für jene Zeit, es waren neunhundert Mark. »Schaffet mir nur Ruhe bei meinen Gläubigern,« sagte der uneigennützige Mann, »denen ich für Euch noch haftbar bin, und was von der nach unsrer Rechnung mir gebührenden Summe übrig bleibt, das behaltet für Euch!« –
Klusenstein kam später durch Kauf von einer Hand in die andre und befindet sich jetzt in Privateigenthum. Doch kommt 1275 eine Gräfin Mathilde von Isenburg und Klusenstein, später Abtissin von Metelen und Nottuln, vor. Die Sage kennt eine Mathilde, die Gemahlin eines Ritters Eberhard von Klusenstein, der in den Kreuzzügen als Gefangener der Sarazenen schmachtet, während sein Feind, der schwarze Bruno, die Nachricht von seinem Tode verbreitet und um sein Weib wirbt. Sie aber entflieht dem Verhaßten und dieser nimmt ihre Burg in Besitz, bis Ritter Eberhard heimkehrt, die Feste erstürmt und in heißem Kampfe auf dem Burghofe den Räuber überwältigt und über die Ringmauer tief unten in den Abgrund schleudert.

Von Klusenstein führt das Hönnethal weiter hinauf an dem hübsch gelegenen Wirthshaus Sanssouci vorüber nach dem Städtchen Balve, in dessen Nähe die Gegend weniger wild romantisch ist, aber ebenfalls ein merkwürdiges Denkmal schaffender Naturkräfte in der »Balver Höhle« besitzt, – wie das Kalksteingebirge zwischen Ruhr und Lenne überhaupt einen auffallenden Reichthum an Grotten und Höhlen hat. Die Balver Höhle zeichnet sich durch das großartige Thorgewölbe, das ihr zur Einfahrt dient, aus. Sie besitzt viele Reste antediluvianischer Thiere – man findet Zähne urweltlicher Geschöpfe bis zu sieben Pfund Gewicht. Als die bedeutendste mit der Klusensteiner galt früher, vor Entdeckung der Dechen-Höhle, die nahe ältere Sundwicher Höhle. Der Weg dahin bringt uns in die von industriellen Anlagen, Drahtrollen, Eisenwerken und Papiermühlen belebten Thäler von Sundwich, Hemer und des Westicher Bachs, wo die werkenden russigen Gnomen, die früher unter der Decke der Kalksteinflöße in den dunklen Schluchten gehaust, jetzt mit der Lichtsuchenden Zeit zu Tage aufgestiegen und hier ihr emsiges Treiben und Schaffen fortzusetzen scheinen. Sundwich liegt wie unter und zwischen die Felsen geschoben; links von ihm die Höhe mit den zwei kleineren Grotten, seitwärts davon die große, seit einem Besuche des damaligen Kronprinzen im Jahre 1817 sogenannte Prinzenhöhle. Sie ist durch nachhelfende Arbeiten in den engsten Klüften leicht zugänglich gemacht und durch ein Eingangsthor geschützt. Ihre Länge vom Eingange bis zum erkundeten Ende mag mit den bald aufsteigenden, bald sich senkenden Windungen 1500 Fuß betragen; einzelne Räume haben mehr als 80 Fuß Länge und 30 Fuß Höhe; es sind weite schauerliche Hallen, in welchen das stille unbelauschte Leben des Gesteins über Nacht seine Tempel sich gewölbt hat: es sind schweigende verödete Cathedralen, von denen die Sage will, daß um Mitternacht die Todten darin zur Messe gehen und ihre blauen Wachslichtlein entzünden; die Heiligenbilder, die Orgel, der Taufstein stehen umher, von der spukhaft regellosen Schöpfungslust, den fancies des Tropfsteins, gebildet: nur die Beter sind fort, denn der Hahnenschrei ist herübergedrungen aus den Gehöften des Dorfes. – »Die Natur, sagt eine Beschreibung, fährt noch immer fort, an den Stalactiten zu schaffen; denn das aus der Decke rinnende Wasser bildet um sich kleine Röhren von einer flimmernden Kalkmaterie, die sich unter einander verbinden und scheidet auf dem Boden Ansätze aus, die sich den von oben kommenden nähern und so allmählich zu den wunderbaren Figuren zusammenschießen. Den merkwürdigsten Bildungen hat man Namen gegeben – nach der Reihenfolge: Kandelaber, Vorhang, Altar, Damoclesschwert, Butterkerne, Bienenkorb, Hand, Wallfischrachen, Tempel, Friedhof, Löwenklau, Mutter mit dem Kind, Kurfürst und sein Hofnarr. So bilden sich an einigen Stellen ganze Lager von crystallartigem Spath, der wie Schmelz blitzt, an andern Draperien und Festons wie Tücher und Franzen, die sich über einander schichten. Kurz, diese Höhle kann sich den Baumanns-, Biels- und Liebensteiner Höhlen an die Seite stellen.« Wie die letztere durchströmt sie in einer Tiefe von 25 Fuß ein Bach, dessen kleine Wellen durch die zurückgeworfenen Fackelstrahlen dem Wanderer den blitzenden Gruß der geheimnißvollen Tiefe emporsenden. Auch diese Höhle ist reich an fossilen Merkwürdigkeiten, z. B. an Schädeln und Knochen des großen Höhlenbären.
Etwa zehn Minuten von der Sundwicher Höhle entfernt liegt das Felsenmeer; der Weg führt über eine Art Plateau, das rechts die Höhen des Balver Waldes begrenzen; die Straße läuft anfangs in einem Terrain-Einschnitt, steigt dann empor und plötzlich hebt sich wie eine Springfluth, die im Weiterrauschen versteinert ist, aus dichtem Gebüsch die Wogenbrandung des Felsenmeers uns entgegen; eine tiefe Einsenkung des Bodens mitten in der Feldfläche umfaßt im Umkreise einer halben Stunde wirre wilde Massen von dunkelgrauen Felsen, die wie Löwen sich übereinander geworfen haben und ruhen, oder schroff, wandsteil emporstehen. Man gewahrt in den zackigen Rissen und Brüchen, wo sie wie durch Beilschläge auseinandergeklaubt sind, das Wirken einer mehr als titanenhaften Kraft; und dennoch diese Stille, diese Oede bei so viel Kraft, die man sonst nicht ohne helllautes lärmendes Leben sich denken kann. Es liegt etwas Unheimliches, Spukhaftes in dieser lautlosen Ruhe, die über den Werken der Gewalt schwebt und tief unten in der Hölle brütet. Die Hölle ist der tiefste Grund dieses Felsenmeers, zu dem man eines Ariadnefadens bedarf, um sich hineinzuwagen durch das Labyrinth der Massen, die oft vielhäuptig wie Cerberus-Ungeheuer in den Weg sich stellen, um die gefahrdrohenden verschütteten Eisengruben herum, an tiefaufklaffenden Schlünden her. Es ist eine eng zusammen geklemmte Grotte, zu der man endlich gelangt; es gehört Muth dazu, den verlassenen Eisenschacht zu befahren, nur bis an den Rand der dunklen grandiosen Tiefe, die am Ende der Grotte vor uns aufgähnt; zerreibt nur ein kleiner Stein, verschiebt nur eine Kante der Felsstücke sich, dann malmt der ganze grausige Bau uns über dem Haupte zusammen. Ich wüßte nicht, was in unserm Lande an Wüstheit dem Felsenmeer an die Seite zu stellen wäre: aber wie fast immer hat auch hier die Natur mildernde Schleier sich über das starrende Antlitz geworfen; sie mag ihrem zagen Kinde nirgends einen Todtenschädel zeigen; sie steckt ihn in diesem ihrem Beinhaus hinter die üppige Vegetation, die mit Stauden und Kräutern und Moosen zu überdecken strebt, was sie erreichen kann. Um einzelne Felsstücke klammern sich mächtige Wurzeln und ziehen mit krausem Geäst an den steilen Wänden herunter, bis sie den Grund gefaßt haben, aus dem sie Nahrung für die oben auf dem Scheitel stolz und hoch prangende Buche saugen. – Das Felsenmeer ist nicht allein von der Natur gebildet; es ist ein nach allen Seiten und Tiefen hin von Fluthen sowohl als später von Eisenerzsuchenden Menschenhänden durchwühltes Kalksteinlager. Die Hölle mag eine Tiefe von 250 Fuß haben, vom obersten Felsensaume an gerechnet.
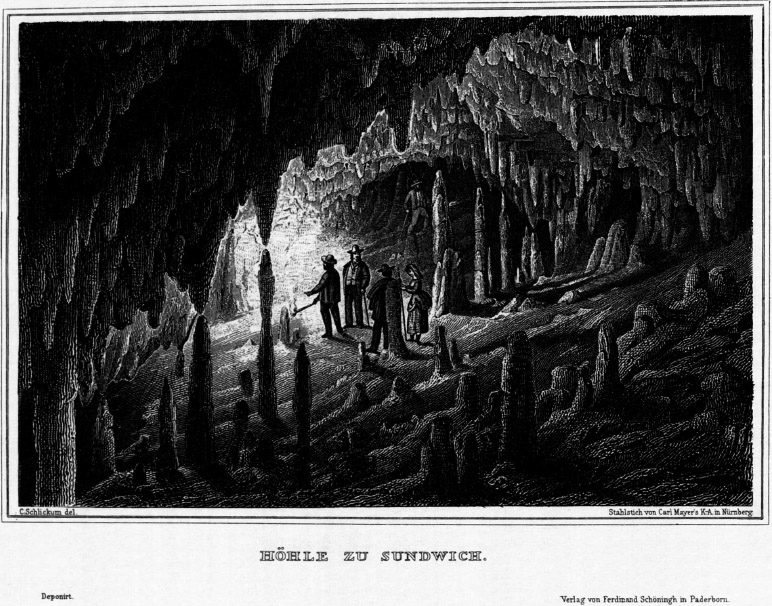
Die Wanderung zum Felsenmeer hat uns der Lenne zu nahe gebracht, als daß wir nicht hinabsteigen sollten in das schöne Thal dieses Flusses. Die Lenne ist der Ruhr, was die Ahr dem Rhein, ihre wildeste, unerzogenste, aber auch ihre schönste Tochter, das Kind ihrer blühendsten Tage. Aus dem südwestlichen Hange der Astenberger Kuppen kommend, hat sie von der Quelle an bis nach anderthalbstündigem Lauf 1500 Fuß Gefälle. Zunächst strömt sie in derselben Richtung an dem Städtlein Schmallenberg vorüber, in dessen Nähe das altberühmte Kloster Grafschaft liegt, das der heilige Anno II. von Köln, der Held des Annoliedes, als » Monasterium sancti Alexandri Martyris« in Grafschaft stiftete, und dem er wie seinen Stiftungen in Siegburg und Saalfeld die Regel Benedikts von Nursia gab. Es liegt da oben im Bereich des hohen Astenbergs eine reizende Burgruine, genannt Norderna, nicht fern vom Einfluß der Nettelbeck in die Lenne; auf derselben hauste damals zu Anno's Zeiten ein Geschlecht von Edelherren von »Graschaph«, wohl mit den benachbarten Sain eines Stammes und Herkommens; auf ihrem Gebiete und dicht unterhalb ihrer Burg Wilzenberg wurde in Folge eines Vertrags zwischen Anno und Frau Kunitza von Graschaph und ihren Söhnen Timon und Hartrald die Stiftung errichtet. Diesem Geschlechte fiel auch die Schirmvogtei des Klosters zu, die es übte, bis 1573 die Fürstenberg zu Schnellenberg in dies Verhältniß traten. In den ältesten Zeiten wurde in das von Siegburg aus besetzte Kloster, wie es bei vielen andern Stiftern (Corvei, Cappenberg, Scheda, Clarholz) ebenfalls Regel wurde, gewöhnlich nur Leuten von adlicher Geburt der Eintritt verstattet. Aber trotz des alten Sympathiebundes zwischen den Heiligen und den Rittern sind doch die Ritter nicht immer geeignet, gute Heilige zu werden – und sicherlich waren es nicht die im Kloster Graschaff – denn so sollte, nicht Grafschaft, der Name lauten. Der Erzbischof von Köln, Hermann von Hessen, fand dort im Jahre 1506 einen solchen Zustand vor, daß er sich entschließen mußte, die acht adlichen Herren, die noch im Kloster wohnten, sammt und sonders zu beseitigen und fortzusenden, um das Gotteshaus mit Mönchen, die im Kloster Brauweiler an ernstere Zucht gewohnt, ganz neu zu besetzen; diese schlossen sich 1508 der Bursfelder Congregation an. Das noch jetzt stehende große Klostergebäude mit Abtei und Gasthaus wurde vom Prälaten Ambrosius Bruns (seit 1727) gebaut; von dessen Nachfolger Josias eine schöne und prachtvolle Kirche; man hat dabei von Bischof Anno's Bau blos den, um 1629 nur höher ausgeführten Thurm stehen lassen. Das große und reiche Kloster – die Kirche hatte für 60 Conventualen Chorstühle – wurde 1804 aufgehoben; da die Dorfgemeinde, später auch der Ankäufer des Klosters und seines Areals (der Freiherr von Fürstenberg-Vorbeck erstand es für 86,000 Thaler), sich weigerten, die Kirche zu übernehmen, so wurde dieser schöne und mächtige Bau nach kaum 90 Jahren des Bestehens, niedergebrochen. –
Von Schmallenberg dem westlichen Laufe der Lenne folgend, gelangen wir nach Altenhundem; haben die bewaldeten Bergwände zur Rechten und Linken des Flusses ihm bisher seine Richtung wenig beirrt, so stellen sie jetzt sich plötzlich ihm so entgegen, daß er gekrümmt zu starkem Bogen nordwärts hinabströmen muß, just an der Stelle, wo die Sieg-Ruhr-Eisenbahn in sein Thal eintritt. Die ganze Gegend ist in ihrer weltentrückten Stille desto reicher an Sagen, die sich an ihre Berghöhen, Burgruinen und Höhlen knüpfen. Und vorzugsweise mit den Hünen auf dem Wilzenberg, dem hohen Lemberg bei Saalhausen, der Norderna, oder dem Schatz im Schloßberg bei Winterberg, oder dem Teufelsstein, oder dem kleinen Volke der Hollen, das ehemals die Felsenlöcher bewohnte, beschäftigen. Nicht gar weit von Altenhundem, bei Kirchhundem, liegt ein Teich, der heißt der Krähenpfuhl; da hat in alten Zeiten ein Schloß gestanden, in welchem ein gottloser wüster Cavalier wohnte, der durch seine Jäger Mädchen rauben ließ, die sie ihm auf sein Schloß brachten. Eines dieser Mädchen aber leistete ihm einen so unüberwindlichen Widerstand, wie die schöne Maid Fitzwalter einst dem liederlichen König Johann ohne Land, und endlich erbarmte sich der Himmel ihrer, denn ein furchtbares Gewitter zog herauf, ein Blitzstrahl traf das Schloß, daß es unter rollendem Donner mit Mann und Maus versank und an seiner Stelle ein tiefer Pfuhl entstand. Am andern Morgen fand des Mädchens Mutter den Leichnam ihres Kindes auf den Wellen schwimmend; dieser ist in Kirchhundem begraben worden, man hat ihn später unverwest gefunden wie den einer Heiligen, und der Pfarrer hat eiserne Stangen um das Grab machen lassen, um die Stätte der Nachwelt zu bezeichnen.
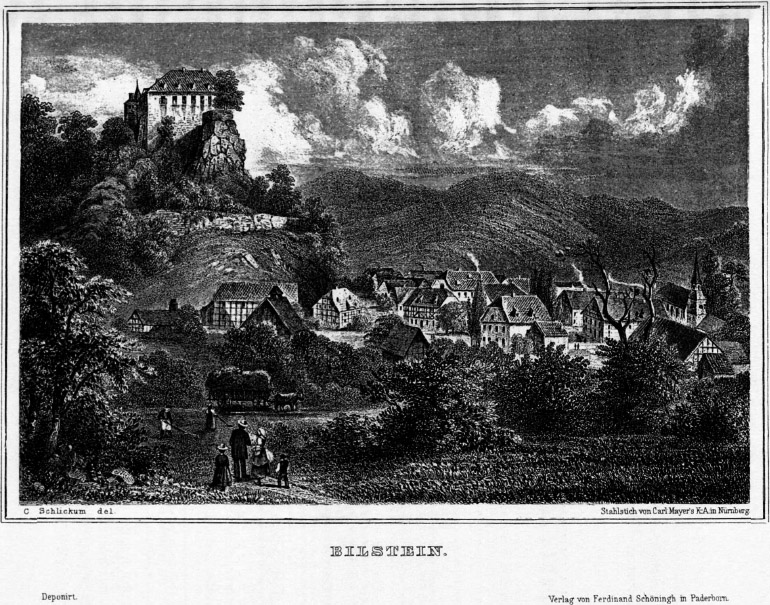
Bei Altenhundem führt ein Weg über einen niedern Bergrücken in das kleine Thal von Bilstein; dies bildete einst ein besonderes Land, beherrscht von Dynasten, die wahrscheinlich eines Blutes mit dem Herrn auf der Wilzenburg und zu Graschaph waren. Johann von Bilstein ward 1283 vom Erzbischofe Siegfried von Köln zum Marschall in Westphalen ernannt. Ein anderer Johann von Bilstein scheint etwa um 1370 seine Herrschaft dem Grafen von der Mark verkauft zu haben – das Geschlecht verschwindet von nun an spurlos aus den Urkunden, und es saßen seitdem Burgmänner des Grafen von der Mark auf Bilstein, bis in der Soester Fehde eine Belagerung durch Kölnische Lehnsmannen unter Dietrich Grafen zu Sain die Feste zur Uebergabe zwang. Seitdem ward die Herrschaft Bilstein wie das nahe Fredeburg und Waldenburg zum Besitze der Kirche von Köln in Westphalen geschlagen, und mit Drosten oder Amtmännern besetzt; seit 1583 sind dies als Erbdrosten die von Fürstenberg. Jetzt Domäne und Forsthaus, blickt Bilstein in das breite sonnige Thal und das Dörfchen an seinem Fuße mit einem Air heruntergekommener Aristocratie; es steht noch mit Thurm und Wappen festen Fußes auf dem schroffen Felsen, der den Stürmen der Zeit trotzt; aber die alte Bedeutung ist dahin, sein Junkerthum ist grau und alt geworden, wie viele Dinge sonst noch, auch außerhalb dieser stillen Thäler!
Bleiben wir unserer Richtung westwärts treu, so gelangen wir von Bilstein sehr bald in das schöne Thal der Bigge, die von Süden, von dem Städtchen Olpe kommend durch ihr Waldgebirg sich Bahn bricht, um das alte Attendarra, Attendorn zu erreichen und dann bald darauf sich der Lenne zu vermählen. Attendorn ist ein winkliges Bergstädtlein, in dem wir schon seines Schnellenbergs wegen verweilen müßten, eines der schönst gelegenen Schlösser Westphalens, noch dazu durch die Erinnerung an den Erzbischof Gebhard Truchseß von Waldburg denkwürdig, der hier um 1583 mit seiner schönen Agnes von Mansfeld ein sorglos heiteres Leben führte und – nicht ohne Erfolg – Alles that, die Clerisei rings umher zur Nachahmung seines Beispiels zu verführen. Die Volkssage verflicht den Erzbischof in die Erklärung, welche man dem Spottnamen »Kattenfillers«, den die Attendorner im Lande tragen, gibt. Gebhard Truchseß soll nämlich nebst den gleich ihm Abgefallenen vor den empörten Attendornern auf den Bilstein geflohen sein, wo er von den letzteren belagert wurde. Bei dieser Belagerung ließ sich einst an einem Thurmfenster eine Katze erblicken, auf welche sich nun alle Bolzen und Geschosse richteten, weil die Attendorner glaubten, es sei der Truchseß in seiner Schlafmütze; das arme zerschossene Thier schrie ganz entsetzlich und die Belagerten spotteten: Kattenfillers! Attendorn selbst aber wurde im 30jährigen Kriege von den Schweden belagert; die Attendorner jedoch trugen alle ihre Bienenstöcke zusammen und schleuderten sie den Stürmenden auf die Köpfe, daß sie jählings fliehen mußten. Daher wird zum Andenken an dies Ereigniß jährlich am Frohnleichnamsfest ein Waffentanz in Attendorn aufgeführt, der, weil sich alles künstlich durcheinanderschlingt, großes Geschick erfordert; man legt bei demselben die von den Schweden erbeuteten Waffen an. So die Sage. In der That aber sind die bei dem Tanz gebrauchten Waffen mittelaltrige und ist die ganze Sitte wohl mit dem Umstande in Verbindung zu bringen, daß Attendorn einst berühmt war durch seine Waffenschmiede, eine Industrie, die sich seit dem 30jährigen Kriege nach Solingen übertrug. Die Sage von der Glocke zu Attendorn s. in Firmenich, Völkerstimmen I. 355 und Kuhn, I. 163.
Was aber den Spottnamen betrifft, mit dem wir eben die Einwohner Attendorn's belegt sahen, so erinnert er uns an ein Allgemeineres, an der Sauerländischen Männer Talent, für den Nachbarn humoristische Namen und Bezeichnungen aufzubringen, so daß fast keinem einzigen dieser Städtlein und Orte die spöttische Nachrede fehlt. Den Attendornern sagt dieser Volkshumor noch nach, der einzige Christ im Städtlein sei der Jude Moses. In Brilon, heißt es, stirbt kein Bürgermeister noch Pfarrer, es sei denn, daß sie durch die Bodenluke fielen; es soll heißen: Keiner halte es lange da aus. »Die erste Stadt der Welt ist Rom, die zweite Brilon und die dritte wiederum Brilon«, heißt es ebenfalls. Dazu ist Brilon im Volksmunde auch noch »Klein-Rom« wegen des dicken Thurmes und der dicken Glocke und des Sankt Petrus vor dem Rathhause. Die Winterberger salzen den Schnee, so daß er sich hält bis Johanni; die Brunscappeler feiern Kirchweih drei Tage vor dem ersten Schnee. Man redet von Mescheder Wind und von der Arnsberger Sonne, die dort höher scheint, als in der übrigen Welt, und behauptet: wenn die Butterfrau aus Wennigloh und der Jude von Hachen ausbleibt, so hat Arnsberg Fasten. Es drückt sich in dem Allen der munter gesellige Sinn des Sauerländers aus, der in Städten und Dörfern, nicht, wie der Bewohner des nördlicheren Westphalens auf einzelnen Höfen angesiedelt, offeneren, zutraulicheren und lebhafteren Wesens als dieser ist, sich mehr dem Verkehr mit seines Gleichen und geselligem Lebensgenuß hingibt und die mißtrauische Zurückhaltung gegen alles Fremde, die den Bewohnern unserer Ebenen anhaftet, nicht kennt.
Attendorn gehörte früher einem Amte Waldenburg an; den festen Punkt in diesem Gebiete, die Burg Waldenburg, mußte Erzbischof Siegfried von Köln 1289 an Berg abtreten, drum schuf er sich einen neuen, indem er durch Johann von Plettenbracht, seinen Marschall in Westphalen, eine neue Burg auf dem Schnellenberg erbauen ließ – etwa 1291 bis 1294. In der neuen Feste saßen Burgmänner verschiedenen Stammes, die von Plettenbracht, die Voigte von Elspe, neben ihnen ein Geschlecht, das sich von Schnellenberg schrieb. Im Jahre 1594 kaufte der Drost Caspar von Fürstenberg die Rechte dieser Burgmänner, der Voigt von Elspe und der Schnellenberg, die erloschen und denen die von Schüngel gefolgt waren, an sich, ließ, was sie von Bauten da oben auf der Bergeshöhe errichtet hatten, niederreißen und das neue schöne Schloß hinsetzen, das heute freilich wieder zur halben Ruine geworden ist. Die Burg war reichsunmittelbar; die Fürstenberg zu Schnellenberg gehörten ihretwegen zum Canton Wetterau des rheinischen Kreises der Reichsritterschaft, und deß zum Zeichen prangte über dem Portal des freiadlichen Hauses Schnellenberg der Reichsadler.

Vom reizenden Thal der Bigge, das bald mit dem der Lenne zusammenstößt, scheidend, nehmen wir die Wanderung an den Ufern der letzteren dort wieder auf, wo wir sie verlassen, bei Altenhundem. Es rauscht die Lenne zunächst bei dem Dörfchen Gräfenbrück an einer schroffen, senkrecht aufsteigenden Felswand am rechten Ufer vorüber, die einst die Peperburg trug; an ihrem Fuße gähnt hohen Eingangs eine düstere Grotte vor uns auf, von ihrem Gipfel erblickt man die hellste und reizendste Landschaft. Trümmer liegen oben, der Schutt einer starken Burg, von der Zeit gebrochen wie die einige tausend Schritt seitwärts liegende Burg zu Borchhausen. Eine andre Trümmer blickt von jenseits Elspe herüber, darunter dies freundliche Dorf selbst aus seinen Laubholzwipfeln und Gärten. Alle drei waren einst Burgen des mächtigen Geschlechts der Voigte von Elspe, das, dem Wappen nach eines Stammes mit den Plettenberg, um 1420 etwa durch die Erbtochter Aleid von Hundemen genannt Peypersack die Peperburg erhielt; 400 Jahre später hat man Schatzgräberei in den Kellern des verschollenen Geschlechts angestellt, um mit der Wünschelruthe ein Goldkalb zu entdecken. – An Gräfenbrück vorbei, wo die drei Thäler der Aspe, Veischede und Lenne in einem geschlossenen Rundbilde ihren unvergleichlichen Reiz entfalten, führt die Straße an altbewaldeten Wänden und hohen Felsen her, und an dem rasch voran rauschenden und plätschernden Strome entlang, der sich zu sputen scheint, als könn' er nicht früh genug all seine Märchen und Elementargeheimnisse und Herrlichkeiten der fernen Ruhr erzählen, wie ein beschenktes Kind, das seiner Mutter seine Freude zu zeigen läuft. Da kommt von der linken Seite, unter dem freundlichen Bamenol mit seinen zwei alten Rittersitzen, die Bigge auf ihn zugestürmt und schwatzt und gurgelt, aber unser Fluß rauscht weiter und hört sie nicht: er weiß ja, was sie zu erzählen hat, das sind Geschichten und Mären aus den Ruinen, aus den Bergen und den Klüften, wie ihrer die Lenne viel schönere kennt. Hat doch die Lenne gar einst den leibhaftigen Satanas über sich her nach Westphalen hinein fliegen sehen, einen Sack voller Adlichen unter dem Arm, so voll, daß über der Mark und dem Hellweg einzelne herauspurzeln, über dem Münsterlande aber der Sack birst und sie alle herunterfallen, die von Schüngel, von Schade, de Gryper, de Byter, dat Strick, de Pepersack, Waschpenning, Springinsleben oder Ziegenbart, Supetut, de Onbescheydene, Springerus Rodenstert, Schnapümme, Schudüvel, de Duivel, Jagetho, Packstroh und wie alle die Ehrennamen heißen, welche die Naivetät des vierzehnten Jahrhunderts für seine ritterlichen Beherrscher und Dränger erfand. –
Wenn die Lenne durch ein erweitertes Thal an dem 1759 Fuß hohen »heiligen Stuhl«, einer früher als Wallfahrtsort von unermüdlichen Gläubigen oft erklommenen bewaldeten Kuppe, vorübergeströmt ist, führt sie zu dem wie in abgeschlossenem Waldgrunde liegenden Dorfe Lennhausen, einer höchst romantischen Partie durch seine Burgruine, seine Eichengruppen, seine am Walde über dem Orte hängende Kapelle, die wie ein getreuer Eccard warnend an dem Pfade in die wilde Berg- und Waldeinsamkeit steht. Einzelne Höfe und Güter beleben von Lennhausen an die weiteren Ufer; bei dem Dorfe Rönkhausen zieht die Chaussee nach Arnsberg von dem rechten Gestade unseres Flusses die Höhen des Homertgebirges hinan, auf dem in der Nähe von Lenscheid, wo die Sage ein versunkenes Grafenschloß weiß, in der »wilden Wiese«, der Schomberg von seinem 2015 Fuß über der Meeresfläche erhabenen Gipfel eine der weitesten und schönsten Aussichten unsres ganzen Landes bietet. Wir aber folgen dem Flusse, an seiner rechten Seite, an den näher und dichter jetzt das Thal eindämmenden, an Höhe die Berge des Rheins weit überragenden Wänden her, die mit violetter röthlich schimmernder Haide sich bekleidet haben, worüber wie wildgeworfene Schnüre die gelben sich schlängelnden Pfade laufen; nur das Haupt deckt ihnen der wogende grüne Waldschleier, der das ganze linke Gestade einhüllt. Auf Pasel, das rechts seine Strohdächer im Eichengebüsche versteckt, folgt links das mächtige Schwarzenberg, vor dem der Fluß in rascher Wendung zur Seite weicht, um es dann schützend und vertheidigend wie ein treuer Ministeriale fast zu umkreisen.

Eine gewaltige Felswand dämmt sich vom linken Ufer her dreist weitvorschreitend in das Bette des Flusses, der gehorsam seinen Bogen um die übermächtige Steinwehr schlagen muß, daß sie zur Halbinsel wird; auf der hohen Spitze der Wand ragt, halb in Trümmern, halb zu einer Försterwohnung restaurirt, mit verwitterten Mauern und Thürmen und neueren Ziegeldächern das alte Schwarzenberg empor und lockt zum Erklimmen des steilen Pfades bergauf, obwohl es im Innern uns nichts zu zeigen hat, als die alterthümliche kirchengroße Küche mit den hohen Bogenfenstern, dem gewaltigen Kamm, der altromantischen Wendelstiege in der Ecke und dem Schmuck des an den Zacken alter Hirschgeweihe aufgehangenen Jagdgeräths an den Wänden. Schwarzenberg gegenüber streckt das andre Ufer ebenfalls einen Arm aus, und beide bilden so ein Felsgewinde, dem die Lenne zögernd sich naht, als bange ihr vor all den Krümmungen und Schmiegungen. Die beste Aussicht auf diese schönste Strecke des Flußlaufes gewährt die schwindelnde Höhe des Krop oder »Graf Engelberts-Stuhl«, ein Sitz, den die Natur an der Kante eines hohen Felsens anbrachte, von wo herab man die Lenne tief unter sich fünfmal in neuer Windung aufglänzen sieht. Es ist ein herrliches Landschaftsbild, das der Blick von diesem Lieblingsplatze Engelberts von der Mark überschweift, nach Osten bis an die Höhen der Homert, während uns im Rücken nach Westen und Südwesten das Ebbegebirge seine blauen Giebel zeigt; den Fluß hinunter hemmt das Auge der hohe Hemberg; unten, eine kurze Strecke über Schwarzenberg, bildet sich die lieblichste Staffage in dem alten Dörfchen Pasel; zwei Burgruinen liegen an beiden Seiten des Schlosses und der Lenne in tiefem Wald- und Ackergrunde, wie die Sage will, durch eine Höhle unter dem Strome her in alten Zeiten verbunden. Die Burg Schwarzenberg wurde 1301 durch Rutger von Altena, den Truchseß Eberhards II. von der Mark, auf Geheiß seines Lehnsherrn erbaut, – in crastino B. Remigii castrum Swartenbergh construxit atque firmavit, heißt es in Levold von Northofs Chronik, als ob es in einem Tage geschehen! Später sind die Burgmannshäuser, die es wie vorgeschobene Werke decken, jene beiden Ruinen, entstanden. Ein Arm des Ebbegebirges trennt Schwarzenberg von dem nordwestlich eine Strecke unter ihm liegenden Städtchen Plettenberg, das an der Vereinigung der fruchtbaren Thäler der Else, Oester und Grüne »platt am Bracht« oder Berge liegt und seinen Namen davon ableitet. Der mittelaltrige Stolz Plettenberg's, die neun Thurmspitzen der Kirche, die 1345 der Lütticher Bischof Engelbert von der Mark erbaute, die sieben Thürme der Ringmauern, die hochzinnige Burg des Geschlechts von Plettenberg und seine Burgmannshäuser sind gebrochen und haben den bescheidenern Anlagen der Eisenhämmer, der Papierfabriken, der Industrie weichen müssen, die jedoch ohne lebhaften Betrieb sind; nur die Kirche, jetzt mit drei Thürmen und der Burghof des Kobbenrod-Hauses mahnt noch an die alte Zeit. Plettenberg liegt eine Strecke von der Lenne entfernt in einem von hohen bewaldeten Bergen umgebenen Thalkessel; in seinem Rücken, nach Westen zu, ist eine Kapelle mit dem kleinen Glockenthurm grade so hoch einen Waldhügel hinangeklommen, um die lachend anmuthige Landschaft von da herab mit seinem Segen besprechen zu können; eine reichere Sicht bietet die Spitze der unfernen hohen Molmert. Der Name Plettenberg kommt zuerst vor um 1187; die Familie der »van der Moelen zu Plettenberg« theilte sich frühe in viele Linien, von denen die zu Lennhausen und zu Schwarzenberg, auf dem sie schon um 1345 als Burgmänner saßen, die namhaftesten sind; ihre Besitzungen waren weit über ganz Westphalen verbreitet; es gehörten zwei erbliche Kammerherrenstellen dazu, und unter andern ein kölnisches Lehn bei Soest, ein »Botenlehn,« wofür der Vasall, wenn der Erzbischof nach Soest kam und Gericht halten wollte, die Beisitzer, Grafen und Schöffen zusammenrufen mußte (gebotenes d. i. gebotetes Ding), auch die Verpflichtung hatte, in den erzbischöflichen Palast 7 Bettstellen mit Streu, und ebenso viele Matrazen und Kissen zu liefern. – Um 1293 bis 1311 war Johann von Plettenbracht Marschall von Westphalen, ein rühmlich thätiger Mann, der die Städte Hallenberg, Osterfeld und Belecke erbaute. Es ist uns die Art und Weise erhalten, wie dies geschah, und wir sehen daraus, auf welchem Wege einige von unseren kleinen Städten, entstanden sind. Osterfeld war ein großer Haupthof, zu dem 30 Mansen, Absplisse, auf welchen kleinere, davon abhängige Höfe angelegt waren, gehörten. Diese Mansen lagen nach altwestphälischer Sitte zerstreut; in Folge der Fehden und Mordbrennereien jener Zeit waren sie aber sämmtlich wüst und öde. Johann von Plettenbracht ließ nun statt dieser Höfe dreißig Plätze rund um den Haupthof ausmessen, groß genug, um eine Hausstelle für den Colonen zu bieten und noch eine zweite für einen »Mundmann« oder Heuerling. Da aber 60 Häuser nicht ausreichten, um eine wehrfähige Stadtbevölkerung zu beherbergen, so wurden noch 25 neue Mansen aus Waldland geschaffen, noch 25 Hausplätze hinzugefügt, das Ganze mit Mauer und Graben umgeben, und die Stadt war fertig. Es fehlte weiter nichts als die Bestimmung dessen, was jeder der Colonen an die Herrschaft zu zehnten und zu zahlen hatte und das, als die Hauptsache, wurde natürlich nicht vergessen.
Das Merkwürdigste bei dieser Schöpfungsgeschichte einer westphälischen Stadt ist jedenfalls das, daß nicht alle Bauerschaften sich so in städtische, wehrhafte Gemeinwesen zusammenzogen und zu Schutz und Trutz an einander rückten. Es ist wirklich fast unerklärlich, daß in den Zeiten völliger Rechtlosigkeit, wo unaufhörliche Fehden und Raubzüge unser Land verheerten, der Bauer seiner alten, ganz vereinzelt und schutzlos liegenden Hofesstätte treu blieb, und, wenn ihm Mordbanden zehn Mal sein Haus niedergebrannt hatten, es zum elften Male geduldig wieder da aufbaute, wo es nun einmal schon in den Zeiten der Cimbern und Teutonen gestanden hatte. In allen andern deutschen Ländern war das Entstehen von Städten die Folge jener Zustände – in Westphalen allein blieb »die Bauernschaft«, das Wohnen sicut fons aut nemus placuit und – möglichst weit entfernt vom Nachbar!
Einen bedeutenden Aufschwung erhielt die Familie Plettenberg am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts dadurch, daß Friedrich Christian von Plettenberg zum Fürstbischof von Münster erwählt wurde. Er erstand die Herrschaft Wittem und die Herrlichkeit Nordkirchen, womit das Erbmarschallamt des Fürstenthums Münster verbunden war. Der Kaiser verlieh nun (1724) den Reichsgrafentitel und die Reichthümer wurden so groß, daß, als des Bischofs Neffe, Franz Joseph, nach Italien reiste, sein Vater Ferdinand von Plettenberg-Nordkirchen ihm 32 Wagen mit Silberzeug, Gemälden u. s. w. nach Holland und von da zu Schiffe nach Italien voraussandte. Der Sohn starb jedoch auf der Hinreise in Wien, die ganze Sendung wurde in Rom verkauft. Als besondere Vorrechte der Grafen Plettenberg wurden aufgezählt, daß den Besitzer von Nordkirchen allein der fürstliche Geheimerath mit »Sie« anredete, und daß er allein mit 6 Pferden bei Hofe auffahren durfte. – Der letzte männliche Erbe der Plettenberg-Nordkirchen, der Graf Maximilian Friedrich, († 1813) soll auf seinen Schloßgräben mit Kronthalern sogenannte Ricochetwürfe gemacht und ganz unermeßliche Summen vergeudet haben.
So viel von dem Geschlechte, welches ehemals auf Schwarzenberg hauste, im Allgemeinen; leider ist es den Genealogen bis jetzt nicht gelungen, für den wahrhaft großen Mann, den es hervorbrachte, die Stelle zu finden, wo er in die Stammtafeln desselben einzufügen, mit andern Worten, wann und wo er geboren ist. Wir haben schon oben von dem Heermeister Walter von Plettenberg geredet. Seine Wahl zum Heermeister des deutschen Ordens fällt in das Jahr 1494. Er hat eine Stätte gefunden in dem deutschen Pantheon, der Schöpfung König Ludwigs von Baiern, und dieser sagt über ihn in seinen Walhalla-Genossen: »Zwiespalt, öfters blutiger, zerrüttete seit dreizehn Jahren Livland, als Walter von Plettenberg, ein Westphale, des deutschen Ordens Heermeister daselbst wurde. Einigkeit, wozu es seiner großen Klugheit bedurfte, stellte er her und Ordnung; hierauf zog er nach Rußland, von Moskaus Zar Genugthuung zu holen wegen dessen schauderhaften Einfalls unter dem vorigen Heermeister. Mit 4000 besiegte Plettenberg 40,000; nur Seuche zwang ihn zum Rückzuge. Abermals fielen die Russen ein und ein neuer Zug in ihr Land geschah. Wie eine Heerde Schafe das kleine Ordensheer nach Moskau zu führen, hatte der Zar sich gerühmt, aber zur Flucht, zum Frieden wurde er gezwungen. Zum Reichsfürsten mit Sitz und Stimme auf dem Reichstage ernannte der Kaiser Livlands Heermeister. In Krieg und Frieden waltete Walter von Plettenberg, vom Hochmeister fast unabhängig, weise, ruhmvoll.« –
Die Regierungszeit Walters von Plettenberg als Heermeister von Livland fällt in die Epoche des Niedergangs des großen Ordens der Marianer, aber sein mächtiger Herrschergeist wußte diesen zu neuer Blüthe emporzuheben. Der verdienstvollste Theil seiner Wirksamkeit ist wohl sein Herrschen und Walten in dem so arg heimgesuchten, ihm untergebenen Lande; seine gesetzgeberische Thätigkeit, welche das sogenannte Ritterrecht fixirte, daß es von nun an allgemeines Landrecht für alle Stände wurde; seine Maßregeln zur Hebung und Verbesserung der Lage des gedrückten Bauernstandes, sowie zur Belebung des Verkehrs und Handels, zur Herstellung öffentlicher Sicherheit, u. s. w. Der Ruhm seines Namens knüpft sich jedoch hauptsächlich an jene großen Schlachten, die Tage von Maholm und von Pleskow, an denen Plettenberg mit seinem kleinen Haufen über die unermeßlichen Heere des Zaren Iwan Wassiljewitsch Siege erfocht, welche vielleicht die glorreichsten sind, die der an Siegen so reiche Orden je erkämpfte. Bei Pleskow war das Heer der Russen 130,000 Mann stark; es waren Truppen, welche mit einer wilden und hartnäckigen Tapferkeit stritten, welche mit solcher todesverachtenden Ausdauer ihre wüthenden Angriffe wiederholten, daß das livländische Fußvolk des Heermeisters, von dem langen Kampfe ermüdet, endlich auf den Knieen liegend stritt. Und doch überwand sie Walter zuletzt mit seinen 7000 Reitern, seinen 1500 deutschen Landsknechten und seinen 5000 lettischen und kurischen Bauern; er brachte ihnen eine Niederlage bei, daß 40,000 Russen und Tartaren auf dem Platze blieben (13. September 1502). Das Andenken an den großen Heermeister erhalten die Ruinen des von ihm aufgebauten Ordensschlosses zu Wenden und das Schloß zu Riga, das Plettenberg ganz neu erbaute, und über dessen innerem Hofe die Statue des glorreichen Erbauers oben hoch in den Lüften schwebt. Der siegreiche und große Ordensmeister ahnte bei diesem Werke wohl nicht, daß er mit seinem stolzen Neubau nur für die Residenz des heutigen kaiserlich-russischen Generalgouverneurs von Esth-, Liv- und Kurland sorge!
In einem geräumigen Thale, um Waldberge und Felswände, von denen herab jede Regenzeit rauschende Giesbäche sendet, an Dörfern, Rittersitzen und Ruinen her, durch eine herrliche immer wechselreiche Gegend voll der schönsten Bergformen windet sich die Lenne nach Werdohl hinab, wo die Fesse mündet, und ihr freundliches Seitenthal dem Blicke auf waldige Höhen mit Fabrikanlagen, Hammerwerken und wohlhabenden Gehöften darunter öffnet; Werdohl gegenüber, am linken Ufer, liegt in stiller Einsamkeit auf einem Berge Pungelscheid, das Haus, worin der Vater König Theodors I. von Corsica geboren. Das Thor und mehrere Trümmer stehen noch; im Umkreise der Burg, ihrem Thore nah, liegt ein Bauernhaus, über dessen Thüre man ein altes Wappen der Familie Neuhoff (drei hängende Kettenglieder) eingemauert findet, die seit 1465 als Nachfolger des älteren Geschlechts derer von Pungelscheid hier hauste und unten in Werdohl ein Drostenhaus zu ihrer Aufnahme hatte. Um das Jahr 1680 bis 1693 wohnte auf diesem Hause Pungelscheidt Herr Dietrich Steffen von Neuhoff zu Pungelscheidt, Herr zu Gelinde, Kurbrandenburgischer Droste zu Nienrade und Cleve, auch märkischer Justizrath, »ein Herr von vielen Wissenschaften und bei Jedermann in großem Ansehn.« Derselbe hatte mit Anna Elisabeth, Steffen von Neuhoff zum Neuhoff und der Adolpha von Ascheberg zur Ruschenburg Tochter, zehn Kinder, von denen der älteste Sohn ein Jahr nach des Vaters Tode 1694 unbeweibt starb, und der zweite Sohn, Leopold Wilhelm, Hauptmann bei den Truppen Christoph Bernhards von Galen, des kriegerischen Bischofs von Münster, auf das väterliche Erbe verzichten mußte, so daß der dritte, Franz Bernhard Johann, Herr zu Pungelscheidt, Rade, Ebach, Gelinde, Muckhausen und Sassenrade, preußischer geheimer Regierungsrath, Droste zu Neuenrade, Altena und Iserlohn »den Stamm fortpflanzte.« Was aber den enterbten zweiten Sohn, Leopold Wilhelm, angeht, so hatte er sich »in seinen noch jungen Jahren mit einer Bürgerlichen aus Viset an der Maas bei Lüttich vermählt. Die Unzufriedenheit seiner Familie mit dieser Heirath, die ihn von der Nachfolge in den Familienbesitzungen ausschloß, veranlaßte ihn endlich, seine Heimath ganz zu verlassen und nach Frankreich zu gehen, um dort Kriegsdienste zu nehmen. Er hat auch das Commando über ein Fort, welches einen Theil der Fortificationen von Metz ausmacht, erhalten. Allda hat er in seiner Ehe zwei Kinder erzeugt, nämlich den Baron, welcher jetzo auf der Insel Corsika eine ganz besondere Person spielt, und eine Tochter, die den Grafen von Trevoux geheirathet hat.« Es ist also nicht, wie irrig behauptet worden, die Burg Pungelscheidt das Geburtshaus König Theodors I. von Corsika und Capraja; es ist blos der Stammsitz des Geschlechts, das dem merkwürdigen Manne das Leben geben sollte, den wir mit echt westphälischer Zähigkeit eine Reihe von Jahren hindurch immer von neuem um eine chimärische Krone ringen sehen, welche bei einem wilden, leidenschaftlichen, stets unter sich getheilten Volke gar nicht zu behaupten war; gesetzt auch, Theodor von Neuhoff wäre nicht ein Fremder, ein Protestant gewesen und hätte die Aufschneidereien, die seltsamen Gewohnheiten und Sitten des Abenteurers abgelegt gehabt, um sich dem nationalen Geiste und dem Wesen des Volkes, dem er gebieten wollte, näher zu stellen.
Die Quellen über das Leben Theodors sind zumeist französischen Ursprungs, und diese zeigen ihn wohl im Ganzen in einem ungünstigeren Lichte, als er es verdient, weil es ja die mit der Republik Genua verbündete französische Macht war, welche er auf Corsika bekämpfte. So ist denn die Vorstellung, welche man sich gewöhnlich von ihm macht, auch wohl eine gefärbte, und jedenfalls ist in diesem Manne eine ganz außergewöhnliche Thatkraft, eine bewundernswürdige Intelligenz, und die Unerschöpflichkeit an Muth, Selbstvertrauen und in der Auffindung neuer Mittel zum Zweck, anzuerkennen. Uns fehlt der Raum, dies durch eine Skizze seines bewegten und Abenteuer-erfüllten Lebens zu rechtfertigen; es ist uns höchstens verstattet, wie wir unsere Leser an die Wiege seines Geschlechts geführt, sie auch zu seinem fernen einsamen Grabe zu führen. Er hatte sich nach dem Scheitern seiner letzten Unternehmung gegen Corsika nach London begeben; hier aber regten sich seine Gläubiger gegen ihn, so daß er sich in eine Freistätte flüchten mußte, um gegen die Constabler sicher zu sein. Nun wurde ihm vorgespiegelt, der Minister Lord Granville wünsche ihn zu sprechen. Er beging darauf die Unvorsichtigkeit, sein Asyl zu verlassen, und alsbald wurde er verhaftet und in das Schuldgefängniß der Kingsbench gebracht. Lord Horace Walpole, der im Grunde an ihm wohl nur jenen Antheil nahm, den er allen Curiositäten widmete, ersuchte Hogarth, den gefallenen Monarchen heimlich für ihn abzumalen, und veröffentlichte in der Zeitschrift: »The World« einen Aufsatz, um zu Gunsten des Gefangenen eine Unterzeichnung in Gang zu bringen. Allein diese trug nur 40 Pfund ein: so schlecht, bemerkt Walpole in seinen Denkwürdigkeiten, sei der Ruf Sr. Majestät! Obschon jedoch, fährt er dann fort, diese Summe Theodors Verdienst weit überstiege, so sei sie doch so tief unter seiner Erwartung geblieben, daß er sie zwar angenommen, aber einen Anwalt zum Herausgeber des Journals geschickt habe, um diesem deshalb, daß er sich mit seinem Namen solche Freiheit erlaubt, eine Klage anzuhängen! Man erzählt bekanntlich, Theodor von Neuhoff habe die Männer, welche ihm jene kleine Summe überreichten, mit königlicher Würde empfangen, das Großmeisterkreuz seines Ordens »von der Befreiung« auf der Brust, sitzend auf einem Thron, zu dem er den Himmel seines Bettes umgeschaffen gehabt habe. Doch ist diese Erzählung wohl nur der Einfall irgend eines humoristischen englischen Journalisten. – Nachdem der ehemalige König sechs Jahre im Gefängnisse der Kingsbench zugebracht, machte er sich die »Insolvenzakte« zu Nutzen und überließ, um den Bestimmungen derselben zu genügen, den Gläubigern seine ganze Habe, nämlich das Königreich Corsika, welches denn auch feierlich zu ihrem Behuf einregistrirt wurde. Sobald er darauf in Freiheit gesetzt worden, nahm er eine Sänfte und begab sich zum portugiesischen Gesandten, den er aber nicht zu Hause traf; da er nun keinen halben Schilling hatte, um die Träger zu bezahlen, so beredete er sie, ihn zu einem Schneider auf Soho Square zu bringen, den er kannte und diesen bewog er, ihn zu beherbergen. In dessen Hause ist denn der König von Corsika auch gestorben. Walpole ließ ihm auf dem St. Anna-Kirchhofe in Westminster einen Grabstein setzen und schmückte denselben mit der bekannten Inschrift: »Das Grab, der große Lehrer, macht Helden und Bettler, Galeerensklaven und Könige gleich.« Aber Theodor erfuhr dies, bevor er starb; das Schicksal überhäufte ihn schon bei seinen Lebzeiten mit seinen Prüfungen: es schenkte ihm ein Königreich und versagte ihm Brod. Eine Schwester Theodors, Catharina Amalia von Neuhof vermählte sich am 16. Aug. 1736 mit Dr. Joseph B. Maria Garibaldi, den Theodor mit der Nachricht seiner Thronbesteigung an seine zu Peddenöh bei Ruggeberg in der Mark wohnende Mutter gesandt hatte und der später als Arzt nach Nizza zog. Etwas vom Blute Theodors steckt also in den Adern des vielgenannten Enkels dieses Dr. Garibaldi.
So viel von König Theodor – es ist merkwürdig, daß die zwei thatkräftigsten Männer, welche Westphalen jemals hervorgebracht hat, und die freilich beide ins Ausland wandern mußten, um einen Schauplatz für die Entwicklung ihrer Energie zu finden, so ganz denselben Erdfleck zur Heimath hatten.
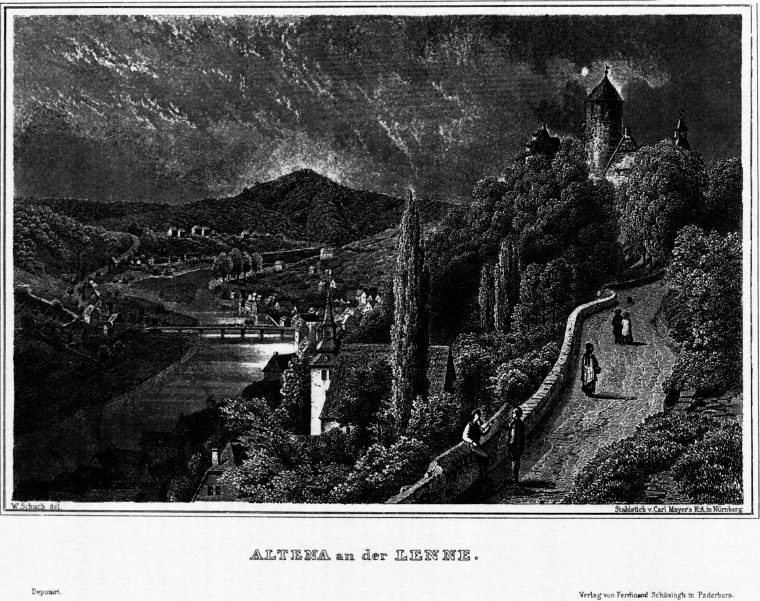
Von Werdohl, das eine neue, wie ein Schmuckkästchen zierliche gothische Kirche besitzt, wandern wir, links hinter uns das romantische Ebbegebirge mit den Quellen der Volme und der Wupper, mit der 2045 Fuß hohen Nordhalle lassend, nach Altena, einst dem größten Ort der Grafschaft Mark, der sich in einer Länge von ¾ Stunden am rechten Ufer der Lenne und im Thale der Nette um seinen Schloßberg hinzieht. Ein überraschend schönes Landschaftsbild – man mag von einer der Brücken, die den Fluß überjochen, zu den blühenden Gärten der hohen Berghänge und der malerischen Schloßruine hinaus, oder von einer der umgebenden Höhen hinabblicken auf die drei Stadttheile, die Freiheit, das Mühlendorf, die Nette, mit den langen Reihen ihrer saubern, glänzenden Häuser, auf die Wiesenufer des Flusses, die romantischen Anlagen des »Hühnengraben«, und die überall versäeten Drahtrollen und Fabriken. Den schönsten Anblick auf die verwitterten Thürme der Burg gewährt die Berghöhe, welche man die Kluse nennt; wie noch wehrhaft erscheint da die alte Feste auf ihrer »Wulfsegge«, die ganze Gegend liegt vor uns, von der die alte Reimchronik von Altena singt:
Man sieht hier lauter Berg und Thal,
Die Bäume stehn hier ohne Zahl,
Das schönste Wasser quillt herfür,
Die meisten habens vor der Thür.
Wan es kömpt in die Meyen Zeit,
Sicht man daran seine Lust und Freudt,
Die Bäume die blühen, die Vögel die singen,
Das thut in Berg und Thal erklingen;
Es gibt hier Vögel mannigerley,
Feldhüner sein auch woll' dabey,
Hirsche, Rehe und wilde Schwein
Sind mehr als uns beliebig sein u. s. w.
Die Kapelle, wovon die Kluse ihren Namen führt, eine Stiftung des Grafen Engelbert von der Mark zu Ehren Sankt Margaretha's und Barbara's, ist verschwunden; nur der nahe Brunnen des Eremiten Einhard sprudelt noch, wenn auch ohne die geheimnißvolle Wirkung, von der Steinen erzählt und die einst jährlich am Ostermontage eine große Prozession hinaufführte.
Auf der Burg selbst bemerkt man eine älteste Baupartie, mit dem südöstlichen Thurme und eine neuere, die nordwestliche Seite; außerdem zeigt man den Rittersaal, das Verhörzimmer, das Burgverließ und den 300 Fuß tiefen Schloßbrunnen. Der große Thurm diente zuletzt zu Gefängnissen; im vorigen Jahrhundert hatte das Schloß noch seinen Commandanten und eine kleine Besatzung. Heute ist eine Diakonissenanstalt da oben eingerichtet. Als Erbauer Altena's nennt die Sage zwei Söhne des berühmten Römergeschlechts der Orsini, welche von Kaiser Otto III. das Land um Lenne und Wupper gekauft und auf der »Wulfsegge« da ein Schloß gebaut haben sollen, wo Schutz suchend ein Haselhuhn auf und in des einen Römers Schooß geflattert sei. Der Graf von Arnsberg habe die Feste seinen Marken »all te na« genannt, aber ihre Mauern schon zu hoch und fest gefunden, um mehr thun zu können, als ihr durch seine verspottete Beschwerde den Namen zu geben. Später sollen beide Brüder das Schloß Altenberge an der Dhün erbaut haben und die Stammväter der Häuser Mark und Berg geworden sein. Die Geschichte nennt sie Adolph und Eberhard, leitet aber ihren Ursprung von den alten Vögten des Kölner Kapitels über dessen rechtsrheinische Besitzungen, über Deutz, Werden, Essen u. s. w. ab, die sich im elften Jahrh. Vögte oder Grafen von Berg zu nennen begonnen, während Huvil der älteste Geschlechtsname sein soll. Man setzt die Erhaltung oder wahrscheinlicher Erneuerung von Altena durch Adolph I. und Eberhard in das Jahr 1108; die von Altenberge muß kurz darauf stattgefunden haben, wenn nicht diese Burg der viel ältere Stammsitz jenes fränkischen Geschlechts der Grafen von »Huvil« oder vom Berge war, von dem Altena und Mark eine Nebenlinie wurde; wir sehen nämlich bald nachher unter Kaiser Lothar, der 1126 zu regieren begann, beide Brüder in den Besitz der zwei Burgen sich theilen und Eberhard, nach einem Heereszuge gegen Brabant, zerknirscht über das vergossene Blut, von seiner Burg und aus seinem Lande verschwinden, bis ihn, den Pilger nach Sant Jago di Compostella und zu den Gräbern der Apostel in Rom, endlich ein Zufall als Hirten der Säue des fränkischen Klosters Morimont wiederfinden läßt. Eberhard wird darauf mit Adolph der Stifter der Abtei Altenberge Die Quelle der Erzählung ist Northof, der sie aus Altenberge erhielt – die älteste Aufzeichnung befindet sich in einem aus diesem Kloster in das Prov.-Archiv zu Düsseldorf gelangten um 1276 geschriebenen Codex. Die Erzählung selbst s. bei v. Steinen, I. 98 und sonst vielfach. –. Jedenfalls ist das Schloß Altena das Stammhaus des starken Geschlechts durchweg ritterlicher und ruhmreicher Grafen, welche durch Klugheit und Tapferkeit das schöne Gebiet der Westphälischen Mark unter ihre Herrschaft brachten und es so bald mit den ihnen zufallenden Besitzungen von Cleve, Berg, Jülich und Ravensberg verbanden, daß sie eine der mächtigsten Dynastien Deutschlands wurden und ihre Töchter auf dem Throne von Frankreich sahen. Mit Adolph III. um 1226 vertauschten sie den Namen von Altena mit dem von der Mark; Mark ist ein Rittersitz an der Ahse in der Nähe von Hamm, den Adolph III. dem Besitzer Rabod sammt seinem Wappen abgekauft haben soll, weil seit dem Frevel des verwandten Friedrich von Isenburg ihm der Name und die rothe Rose im goldenen Schilde des gemeinsamen Ahnherrn befleckt geschienen.
Es sind diese Grafen von Altena, dann von der Mark das merkwürdigste und hervorragendste Geschlecht unseres Landes; sie sind unter den andern Dynasten, welche als Nachkommen von Adalingen auf weithin sich erstreckendem ererbtem Grundbesitz saßen, und denen, welche ihre Gewalt über bedeutende Gebiete von der herzoglichen Gewalt oder dem Grafenamt, mit denen das fränkische Königthum sie bekleidet hatte, herleiteten – unter ihnen sind sie die Emporkömmlinge, die von einem beschränkten und engen Hausgut ausgehend sich zu den mächtigsten Aller und zum eigentlichen Mittelpunkte der Geschichte unseres Landes aufschwangen. Durch sie alle geht eine, oft freilich gewaltthätige und rücksichtslose Erbweisheit, die fortschreitend zu gewinnen weiß und allem Gut, das ihr Eigen wird, haucht ihr Geist eine eigenthümliche Expansionskraft, einen rastlosen Ausdehnungsdrang ein; dabei haben sie die Gabe, sich ausgezeichnete und eifervolle Diener ihrer Interessen aus ihren Vasallen zu gewinnen; alle aber sind sie Männer, streitbare, entschlossene, in den Mitteln nicht wählerische – wer war es damals? – und hochgemuthete Männer; und um die einzelnen Gestalten ihres Hauses legt sich (allein in unsrem Lande) etwas von dem idealen Glanze und der von Dichtern so oft verherrlichten Größe mittelaltrigen Ritterthums.
Wer die Verhältnisse des Mittelalters kennt, der weiß, wie elend, jammervoll und beklagenswerth die Gesammtheit der Zustände war, welche wir mit dem hochtönenden Worte Ritterthum und Burg- und Adelsleben bezeichnen. Er weiß, wie das arme Ministerialenvolk, dies ganze Geschlecht ritterbürtiger Stifts- oder Dynastenknechte in seinen Felsburgen ohne Raum und Licht die Tage zubrachte oder im mühsamen Felddienst sich für den Herrn plagen und schinden mußte, oder – alles um des lieben Brodes willen – auf die miserabelste Buschklepperei ausging, das Handwerk, welches von allen am wenigsten einen goldenen Boden hatte. Er weiß, wie unfrei diese Menschenklasse war, wenn sie nicht, wie die bei weitem geringere Zahl der Geschlechter vom freien Boden eines Oberhofes oder eines ererbten Besitzes ausgingen, sondern als eigentliche Dienstmannen eines Herrn im Feld- oder Burgendienst die Ritterbürtigkeit gewonnen hatten, welche ihre Herren nicht abhielt, sie oder ihre Wittwen oder ihre Kinder ganz wie Leibeigene zu vertauschen und zu verhandeln. Man muß die Schilderungen unseres alten Carthäuser-Mönchs Werner Rolewink von Laar lesen, um einen Blick in die Zustände der Vorfahren unseres westphälischen Adels insbesondere zu thun, und als Illustration dazu die Bilder des Soester sogenannten Nequamsbuches ansehen (im Soester Stadtarchiv), welche Junker in Ausübung ihres ritterlichen Handwerks zeigen, und daneben auch, auf dem letzten Blatt, den Lohn, den ihnen der Nachrichter irgend einer bis zur Schonungslosigkeit erbitterten Stadtgemeinde zahlt.
Inmitten solcher Zustände nun zeigt sich uns allein das Herrengeschlecht von Altena umflossen von dem Glanze, den wir dem mittelaltrigen Ritterthum beilegen. Sie waren es, die etwas von dem Glanze und der Poesie der Hohenstaufenzeit in das wüste Westphalen brachten. Denn sie waren Ghibellinen, mit den Hohenstaufen verwandt, mit ihnen in vielfacher Berührung und an ihren Kriegszügen und Friedens-Hochzeiten theilnehmend. Daheim in ihrem Lande aber hielten sie Ritterspiele und Turniere, sie hielten hier Hof inmitten ihrer treuen Vasallen. Sie brachen Burgen und bauten ihrer noch mehr; sie gründeten Stifter und wallfahrteten zum heiligen Lande; wenn Niedersachsen den wandernden Minnesänger gekannt hätte, so würden gewiß in ihren Burghallen die goldenen Saiten erklungen sein,
»so hell wie einst vom Staufen die Ritterharfe klang.«
Aber der Fuß eines Heinrich von Ofterdingen, eines Walther von der Vogelweide oder eines Hartmann von der Aue hat nie den Boden der rothen Erde betreten; es ist nachgewiesen, daß Heinrich von Veldecke kein Sauerländer, sondern ein Niederländer war; und der einzige Antheil, den die Dichtkunst an unsern Märkischen Grafen genommen hat, beschränkt sich auf jene berühmt gewordenen Verse zum Preise Adolphs VI.:
Sein nein was nein gerechtigh,
Sein jha was jha vollmächtigh,
Er was seines Worts gedächtigh,
Sein Mundt, sein Grundt eindrechtigh,
Ein Prinz aller Prinzen Spiegel,
Sein Wort das was sein Siegel,
Seins Mudt's gar unverzagt,
Wer hat ihn auß dem Feldt gejagth? –
Wir nannten als ersten dieser Grafen Adolf I. Der Umfang seines Gebiets mag sich, nachdem er mit seinem Bruder Eberhard das Kloster Altenberge gestiftet und dieser auf sein übriges Erbgut zu Gunsten Adolfs verzichtet hatte, auf die Burg Altena und das waldige Gebirgsland zwischen Lenne, Wupper und Dhün beschränkt haben. Als sein Todesjahr wird 1152 angenommen.
Ihm folgte sein ältester Sohn Adolf II., von 1152 bis etwa 1170, während sein zweiter Sohn Bruno II. Erzbischof von Köln wurde, von 1121 bis 1139. –
Die dritte Generation bilden Engelbert, Graf von Berg, Eberhard, Graf von Altena, Friedrich, Erzbischof von Köln, Bruno III., Erzbischof von Köln, Adolf, Abt zu Werden.
Es tritt also in dieser Generation eine neue Theilung und Scheidung zwischen Altena und Berg ein; wir folgen hier der westphälischen Linie des Hauses. In dieser ist Eberhard I. der dritte Graf von Altena. Er stirbt 1179. Seine Söhne sind:
Friedrich, vierter Graf von Altena; Adolf, Erzbischof von Köln; Arnold, abgefunden mit Isenburg und Nienbrügge und Vater des Grafen Friedrich von Isenburg, welcher den Erzbischof Engelbert erschlug. Friedrich starb etwa 1198.
Ihm folgt Adolf III. Er half die Reichsacht an dem Vetter Friedrich von Isenburg vollziehen, gewann dabei einen großen Theil der Besitzungen dieses Vetters, erkaufte im Norden derselben Lünen und das Haus Mark, legte auf den zum Haus Mark gehörenden Wiesen 1226 die Stadt Hamm an, erbaute die Feste Blankenstein, diese aus der zerstörten Isenburg, und war der eigentliche Schöpfer der Grafschaft Mark – wir sahen oben, daß er zuerst den Namen von der Mark führte, nebst dem Schilde mit dem weiß und roth geschachten Balken in Silber. Er starb 1249.
Sein ältester Sohn und Nachfolger war Engelbert I. Er führte in Kampf und Fehde ein rastlos bewegtes Dasein; den Dortmundern feind, besiegte er diese in der Schlacht auf dem Wulfeskampe; dann lag er in langem Hader mit den Erzbischöfen von Köln, Engelbert von Falkenburg und Siegfried von Westerburg; »endlich ist, wie von Steinen schreibt, Graf Engelbert, als er wegen seiner Vormundschaft über den Grafen von Tecklenburg um Allerheiligen ungefähr in die Grafschaft Tecklenburg hat reiten wollen, durch Hermann von Loen verrätherischer Weise, (daher ihn auch Gert van der Schüren einen Struickrover nennt) angefallen, verwundet und 1277 auf das Schloß Bredefort gebracht worden, wo er dann bald darauf, nämlich den fünften Tag nach Martini nicht sowohl von den empfangenen Wunden als Verdruß gestorben ist. Sein Körper, welcher hernach mit Gewalt von Bredefort geholet wurde, ist im Cappenberge beigesetzet.«
Eberhard II., genannt der wilde Eberhard, sein Sohn, folgte ihm; er rächte des Vaters Tod an dem Ritter von Loen, dessen Schloß Bredefort er bis auf den Grund zerbrach; weilte dann am Hofe Kaiser Rudolfs, kehrte zurück, um sich mit dem Erzbischof von Köln in langer Fehde zu tummeln, und brach eine große Anzahl von Burgen, die seiner Macht Trotz boten und ihm im Wege standen, »weil sie Raubnester sein«, nieder: Volmarstein, Raffenberg, die Isenburg bei Essen, Werdohl, Fürstenberg, Hohen-Syburg u. s. w., brandschatzte das Stift Osnabrück, in dem seine Feinde, obwohl sie stärker waren als er, doch vor dem Schrecken seines Namens die Flucht ergriffen – und zog König Adolf von Nassau zu, um ihm in Thüringen Heeresfolge zu leisten. Im Jahre 1300 war er mit Kaiser Albrecht in den Niederlanden, stand diesem in seinem Kriege wider die rheinischen Erzbischöfe bei und erhielt zum Lohn die Reichshöfe Dortmund, Westhoven, Elmenhorst, Brakel, die von seinem Gebiet umschlossen waren. Der Fehden, die er weiter in Westphalen führte, meist wider die kirchlichen Landesherrn, sind unzählige und ein späterer Schriftsteller nennt ihn deshalb Flagellum Episcoporum, homo ferox, furibundus, depopulator Westphaliae, homo turbulentus, hostis ecclesiae u. s. w., wogegen man schon das mit Recht geltend macht, daß ein solcher Wüthrich nicht der Günstling Kaiser Rudolfs von Habsburg gewesen sein könne; denn Levold von Northof erzählt: »die vertrauten Diener des Königs sagten, der König könne nicht traurig sein, so lange dieser junge Mann sich bei ihm befinde. Er war nämlich lieblich anzuschauen und gewandt in der Rede und der König selber ertheilte ihm zuletzt den Ritterschlag.« – »Ich meinestheils halte, daß er ein trefflicher Regent gewesen«, setzt dem allen der gründliche Dietrich von Steinen hinzu. – Eberhard starb 1308 und liegt, wie wir oben sahen, in Fröndenberg neben seiner Gattin Ermgarde von Berg begraben.
Ihm folgte sein ältester Sohn Engelbert II., Graf von der Mark und Arenberg, vermählt mit der Erbtochter Mathilde von Arenberg, Burggräfin zu Köln, die ihm 1298 zu Hamm unter großen und glänzenden Festlichkeiten und Ritterspielen angetraut worden. Das Geschlecht der heutigen Herzoge von Arenberg, deren Stammvater Engelberts dritter Sohn Eberhard wurde, ist also eine Nebenlinie unsres Märkischen Hauses und hat bis auf unsre Zeit den Titel Graf von der Mark beibehalten – zu ihnen gehören jene Grafen von der Mark, die die Eber der Ardennen hießen, jener spätere, der durch seinen Briefwechsel mit Mirabeau bekannt wurde. – Graf Engelberts erstes Regierungsjahr wurde durch die Schlacht auf dem Halerfelde denkwürdig. Der Graf von der Mark hatte sich mit dem Bischofe Conrad von Münster wider den von Osnabrück, Ludwig von Ravensberg verbündet; außer jenen waren noch viele andere Dynasten und Herren ausgezogen zur Fehde wider den Osnabrücker, der, ein kleines Männlein von Gestalt, doch ein Löwe im Streit – corpore Zachaeus, animo Judas Maccabaeus – sich ihnen auf dem Halerfelde unfern Tecklenburg zum Kampfe stellte, und ihnen trotz ihrer Uebermacht eine gründliche Niederlage beibrachte. – Im Gewirr der Schlacht aber gerieth Graf Engelbert in furchtbares Gedräng. Er stürzte mit seinem Rosse und dabei brach er das Bein, und wie David über Goliath warf der Bischof Ludwig selber sich auf den am Boden liegenden Feind – dieser ergreift ihn am weißem Obergewande und als nun ein gewaltiges Ringen entsteht, schlägt ein Fleischer von Osnabrück mit seiner wuchtigen Waffe dazwischen, um seinem Herrn beizustehen, aber so unglücklich und blind ist der Schlag geführt, daß er den Bischof trifft und tödlich verwundet; Ludwig starb am dritten Tage nach seinem großen Siege. Graf Engelbert entkam und nahm, von seinem Beinbruch genesen, von neuem und diesmal siegreich den Kampf gegen das Stift Osnabrück auf. Im Jahre 1322 nahm er den früheren Verbündeten, den Bischof von Münster auf der Zugbrücke von Hamm mit 70 bis 80 Reitern gefangen; wir werden unten sehen, wie er der Zerstörer von Volmarstein wurde. Er starb 1328, und ist ebenfalls in Fröndenberg bestattet.
Von seinen acht Kindern folgte der älteste Sohn als Adolf IV. Zu seinen Hauptthaten gehört eine in einem Kriege wider das Erzstift Köln vorgenommene gründliche Zerstörung von Menden, und ein großer Sieg über die Peterlinge (die Stiftsvasallen) bei Recklinghausen, ferner eine siegreiche und überaus blutige Schlacht wider die Bürger von Lüttich, die sich wider seinen Bruder Engelbert, ihren Bischof, empört hatten. Er starb 1347 und ist in Fröndenberg neben seinen Vätern bestattet.
Es folgt Engelbert III. von der Mark, der hervorragendste von allen seines Geschlechts. Seine ersten Fehden entbrannten mit Arnsberg und Dortmund, dann folgen seine Züge nach dem heiligen Lande und zu den deutschen Ordensrittern in Preußen, um mit ihnen wider die Russen zu streiten. Ueberall in diesem Kampfe siegreich soll er zur Feier seiner Waffenthaten in Königsberg sechshundert Ritter zur Tafel geladen, sie mit sechszehn Gerichten bewirthet und seine Gäste mit seinen Rittern selbst bedient und dafür einen Aufwand von 1300 Schildthalern gemacht haben. Unter den Fehden, welche die darauf folgenden Jahre seiner Regierung ausfüllten, nahm die von uns erwähnte wider Dortmund am meisten großartige Verhältnisse an. Wir sahen Engelbert dort als Rächer der hingerichteten Agnes von Virbeke auftreten; Dietrich von Steinen berichtet uns, nicht dies allein, sondern ein Spottgedicht der Dortmunder:
Graf Engelbert von der Marke
Mackt sick mit frembden Gude starke,
Hey en het nein hilgen Henden,
Hey let niet liggen of hangen an den Wenden,
Hey doet tho den Vogelen int Nest gripen,
Fraget nit darna off sy schreyen oder pipen u. s. w.
habe den Grafen in die Reihen der Feinde Dortmunds getrieben. Doch waren der gegenseitigen Beschwerden mehr als genug, um den gewaltigen Orlog zu entzünden, in welchem, wie oben gesagt, die Dortmunder so wacker mit ihren Kanonen von den Wällen feuerten. Doch auch die Belagerer hatten Kanonen: aus einer aufgeworfenen Schanze, die er Rodenburg nannte, warf Graf Engelbert am ersten Tage 12 große Kugeln in die Stadt, an einem andern Tage 33, dann wieder 22; darauf innerhalb 14 Tagen 283 Kugeln, deren einige 50 Pfund wogen. Wir kennen den für die Unabhängigkeit der Stadt Dortmund vortheilhaften Ausgang der Fehde und bemerken hier nur noch, daß sie uns zum ersten Male in Westphalen die Anwendung des Schießpulvers in größerem Maßstabe zeigt (1387 – also 40 Jahre etwa nach seiner ersten Anwendung durch die Engländer bei Crecy).
Aus einer alten niederdeutschen Aufzeichnung über eine andere Fehde müssen wir den Schluß ziehen, daß Graf Engelbert nicht allein Artillerie, die 50pfündige Geschosse schleuderte, führte, sondern auch seine Streiter uniformirt hatte. Ein Ritter, Herr Berent de Wulf von Lüdinghausen, besaß vier Söhne. Als sie zu Manne gekommen waren, gab ihnen der Vater nichts; sie möchten sich hinwenden, wo sie wollten; so tasteten sie zu auf der Landstraße, auch im Lande von der Mark hatten sie einen Zutast gethan. Graf Engelbert schrieb an Herr Berent, daß seine Söhne in seinem Lande zugegriffen; das sollten sie lassen, oder er werde sein Feind werden. Ritter Berent schrieb ihm wieder, wolle er sein Feind werden, so wolle er dem Boten zehn alte Schilde zahlen. Darauf schlug der Graf Engelbert das Haus zum Botzeler auf, dicht am Wulffesberg und legte 60 Gewappnete hinein und fing ihm die vier Söhne ab und legte sie in die Hacht (Gefängniß). Herr Berent aber überredete seine Freunde, deren er 80 Gewappnete aufgebracht, daß sie des Grafen Wimpel und Kleidung anlegten, die er vorher bereiten lassen. So ritten sie wider Botzeler an, und von der Besatzung für des Grafen Leute gehalten, überrumpelten sie die Burg, schlossen die Gefangenen los, schleppten alles was in der Burg war, auf den Wulffesberg und verbrannte dieselbe. – Die Fehde endete durch einen Schiedsspruch: we Schaden hedde, de mochte Schaden behalden.
Im Jahre 1349 stellte Graf Engelbert zu Hamm vor der Osterpforte ein Turnier an, welches drei Tage währte. In synen andern Jayr, erzählt Gert van der Schüren, als hie ein Grave von der Marke geworden waß, beriep hie einen heirlichen Hoff und Steetspyll thom Ham buiten der Osterportten up dem Sande, dair seer ville herrlicke Manne und keisteler Frauwen und Jouffrauwen tho geladen waren und die Hoff duyrde biß an den derden Dach. – Gerühmt als ein schöner, kluger, gnädiger, freigebiger und tapferer Herr, der Gerechtigkeit und Tugend geliebt und in Glück und Unglück sich gleich geblieben, starb er 1391 im 60. Jahre seines Alters zu Wetter. Der Tod ersparte ihm so einen neuen gewaltigen Kampf wider ein Heer ergrimmter Feinde, die durch sein eisernes Walten erbittert, sich just zusammenschaarten um sich zu rächen. Er selbst noch sorgte vor seiner Auflösung für den Schutz seiner Leiche, wenn sie in ihre Ruhestätte zu Fröndenberg übergeführt würde und von den geistlichen Gebieten von Köln oder Paderborn aus der Bund der Bengler sie angreifen sollte. Fünfhundert Gewappnete umgaben sie auf dieser letzten Fahrt und hatten bei Menden in einem harten Strauß den todten Herrn zu beschützen.
Engelbert III. starb ohne Kinder zu hinterlassen. Doch hatte sein jüngerer Bruder Adolf, der von der Mutter Margaretha, der Erbtochter von Cleve her, als Adolf V. Cleve besessen, Söhne erzeugt, deren zweiter jetzt in der Mark folgte. Dies war:
Dietrich, der letzte Graf von der Mark in Westphalen, ein junger an Hoffnungen reicher Fürst, der durch seine und seiner Vasallen Tapferkeit in der Schlacht zwischen Kellen und Cleve wider Wilhelm von Berg den Ausschlag gab. Aber in der Verfolgung dieses Sieges, bei der Belagerung von Elberfeld und im Erstürmen dieser Stadt, traf ihn die Kugel eines sächsischen Schützen, im März 1398, und damit verlor die Mark für immer den eigenen Fürsten. Denn nun fiel das Land an Dietrichs älteren Bruder Adolf VI. von Cleve, den wir bald sich auf dem Schauplatze großartigerer Weltverhältnisse bewegen sehen. Er reitet 1399, um sich mit Agnes, des späteren römischen Kaisers Ruprecht Tochter zu vermählen, mit einem Gefolge von 1500, gleich den Vasallen seines Oheims Engelbert III. uniformirten Rittern in Heidelberg ein; er wird 1437 Herzog von Cleve und tritt in vielfache Beziehungen zu Frankreich und zu Burgund. Wir haben oben die Verse, die über ihn im Schwange waren, angeführt und nennen als seinen Nachfolger nur noch jenen Junker von Cleve »Johannken mit den Bellen«, den wir so mannlich und seiner Ahnen von der Mark würdig in die Soester Fehde eingreifen sahen.
An Cleve und Mark schließt sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte Berg-Jülich und Ravensberg, bis mit dem schwachsinnigen Gemahl der unglücklichen Jacobäa von Baden, mit Johann Wilhelm 1609 das Geschlecht erlischt, als Erbschaft seinem Lande den berühmten Erbfolgestreit hinterlassend, der sich durch die historische Ohrfeige, die der eine der Erbprätendenten Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg bei einem Bankette zu Düsseldorf dem andern, Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg gab, so sehr verbitterte. Der wilde durch Religionshader vergiftete Kampf dauerte, bis 1666 eine friedliche Theilung zu Stande kam, worin Brandenburg Cleve und Mark nebst Ravensberg, die Pfalz aber Jülich und Berg erhielt.
Für uns Westphalen liegt die Hauptbedeutung der Reihe kluger, und ohne Ausnahme markiger Männer, die von unsrem Altena ausgingen, darin, daß sie durch ihre oft wilde Energie innerhalb unseres Landes ein großes geschlossenes weltliches Gebiet schufen. Dies ist der Grund, weshalb es der Reformation möglich wurde, sich innerhalb Westphalens zu behaupten, während sie in den geistlichen Territorien unseres Landes überall sehr bald wieder unterliegen mußte – mit Ausnahme von geringen Strecken, die am östlichen Saum liegend den aus Osten kommenden Einflüssen zunächst ausgesetzt waren. –
Wie für die Geschichte Westphalens, ist Altena aber auch für die blühende Industrie unsres Landes ein höchst wichtiger Punkt. Es ist besonders die Eisen-Industrie, welche hier seit je und bis auf unsre Tage eifrige Pflege fand. Die Fabrikation des Osemunds und des Drahtes hat seit uralter Zeit in diesen Thälern geblüht und würde in den letzten Jahrhunderten bereits einen noch weit größeren Aufschwung erhalten haben, wenn sich dem nicht die seltsamen nationalökonomischen Prinzipien jener Epoche widersetzt hätten, denen zufolge man nicht wie heute: viel und wohlfeil, sondern: wenig und theuer zu produziren für löblich und gewinnbringend hielt. Von diesem Grundsatz geleitet, sorgte die hohe Obrigkeit dafür, daß vier Monate im Jahre hindurch die Hämmer und Drahtrollen still standen – unterdeß mußten die Arbeiter sich beim Ackerbau oder bei andern Beschäftigungen schadlos zu halten suchen! Aber auch während der »Campagne«, wie der technische Ausdruck ist, gab es noch eine Menge »Stillstandstage« und »Stillstandszeiten«, in welchen die Arbeit ruhen mußte; namentlich wurde der Freitag zu einem zweiten Sabbath gemacht; zwei Predigten, welche die Geistlichkeit an diesem Tage abhielt, machten ihn dazu. Heute sind alle die Hemmnisse der freien Thätigkeit beseitigt. In den Kirchen Altenas wird nicht mehr am Freitage zweimal gepredigt, die »Reidemeister«, welche die Drahtfabrication (Reidung) betreiben, sind nicht mehr gezwungen, ihr Produkt für einen festgesetzten Preis nur an eine mit dem ausschließlichen Monopol beliehene Stapelgesellschaft zu verkaufen; die »Zöger« sind nicht mehr eine Art Leibeigene der Reidemeister; keine »Klovenmeister« oder obrigkeitliche Aufseher mischen sich mehr in die Technik des Betriebes; desto großartiger ist der Aufschwung der Industrie geworden – heute darf man den Werth des allein im Kreise Altena jährlich produzirten Eisen- und Stahldrahts in guten Jahren auf viel mehr als eine Million Thaler schätzen.
Eine Geschichte aber aus jenen Zeiten des gefesselten Betriebsfleißes ist für die Bürger von Altena zu rühmlich, als daß sie hier nicht Platz finden sollte. Den Drahtziehern war Militairfreiheit bewilligt, und sie mußten dieserhalb von den Werbeoffizieren um so stärkere Nachstellung erleiden, je mehr denselben der stattliche Wuchs der riesenhaften Männer in die Augen stach. Zuletzt kam der Heißhunger des zu Hamm stehenden, mit seinem Canton auf die Grafschaft gewiesenen Regiments nach einem so vorzüglichen Kanonenfutter in einer höchst merkwürdigen Weise zum Ausbruch. Der General von Wolffersdorf nahm sich vor, das Sauerland mit dem Hellwege in militairischer Hinsicht auf einen und denselben Fuß zu setzen. Um indeß ohne alles Aufsehen die Oertlichkeit und die Leute genauer kennen zu lernen und, was er vorhatte, einzuleiten, ritt er zuerst selbst mit einem Offizier von Hamm nach Altena. Dort sah er nun mit eigenen Augen die riesigen Männer, wie sie mit nervigtem Arme die Hämmer schwangen, als wären es Federposen, wie leicht ihre Bewegung, wie groß, stark und schlank ihr Körperbau war, und wie aus dem geschwärzten Gesichte feurige und muthige Augen blickten. Der General, dem bei diesem Anblick das Herz von seiner heimlichen Absicht voll und immer voller ward, konnte sich nicht enthalten, die Worte fallen zu lassen; »Schöne, kräftige Leute! Schade, daß sie nicht Soldaten sind!« Es folgten noch einige: Leider! Leider! so daß man Unrath merkte. Das Gerücht verbreitete sich im Volke wie ein Lauffeuer und erregte eine dumpfe Gährung; Nothwehr im Falle der Gewalt wurde beschlossen, Nothwehr bis zum Aeußersten. Und er kam wirklich, der General, mit seiner Leibkompagnie, um selbst eine Aushebung vorzunehmen. Er schlug den Weg nach Neuenrade hin ein, über den Wicksberg, an dessen Fuß Altena liegt; er hoffte mit seiner heranrückenden Macht, von der Höhe herab, die Stadt einzuschüchtern. Aber die kräftigen Altenaer ließen sich im Gefühl ihrer Stärke und ihrer gerechten Sache nicht angst machen. Kaum hatten sie auf den Höhen des Wicksberges den Hammschen General mit seinen Soldaten und den blitzenden Gewehren und den Bajonetten gesehen, als sie zu ihren Wehren rannten. Sie, die an Feueressen lebten und glühendes Eisen zwangen, waren nun Enackskinder und Cyklopen. An Unterwerfen wurde nicht gedacht, Gewalt mußte mit Gewalt vertrieben werden. Mit allen Kirchenglocken wurde Sturm geläutet, und von allen Seiten schrie es in und durcheinander. – Wolffersdorff rückte mit seinen Soldaten vom hohen Wicksberge aus vor; seiner Sache gewiß, rückte er näher und näher. Von dieser Seite her führt aber nur eine enge Gasse in die Stadt, in welcher kaum ein zweirädriger Wagen durchkann, und kaum drei Menschen neben einander zu gehen im Stande sind. Diesen schmalen Paß, ein wahres Thermopylä, hatten die Altenaer Drahtzieher besetzt, vom Anfang bis zum Ende. Glühende lange Stangen hielten sie vor, wie diese kalt wurden traten funkensprühende andere an die Stelle. Die Alten blieben in den Feueressen am Glühen: die Jungen im Kampfe. Die Weiber gossen von den Dächern und den an der Bergwand sich hinziehenden Gärten siedendes Wasser den Soldaten auf die Köpfe und die Kinder trugen es kochend vom Feuerheerd hinzu. Das Läuten aller Glocken, das Geschrei der empörten Städter, das Rufen und Schimpfen tönte im wilden Lärm durcheinander. Der Kampf dauerte zwei Stunden; die Altenaer wichen nicht – und der General von Wolffersdorf kam nicht in die Stadt! Von beiden Seiten wurden viele verwundet; vorzüglich von Seiten der Soldaten, denen das spritzende, heiße Wasser Brandflecken beigebracht hatte. Zum Glück hatten sie nicht scharf geladen; an solchen Widerstand war nicht gedacht, der Held des siebenjährigen Krieges glaubte sich nur zeigen zu dürfen, um Alles gehorsam und unterwürfig zu finden. Aber er hatte sich geirrt, er mußte schimpflich unverrichteter Sache mit seinen verwundeten Soldaten abziehen. Die Altenaer aber jubelten und jauchzten, und am nächsten Sonntage wurde ein Dankfest gehalten und der Text war: »Weil du wider mich tobst und dem Uebermuth vor meinen Ohren herausgekommen ist, so will ich dir einen Ring durch die Nase legen und ein Gebiß in dem Maul, und ich will dich den Weg wieder zurückführen, den du gekommen bist«.
Die Sache machte im ganzen Lande Aufsehen und es wurde viel davon gesprochen. So viel Mühe man sich auch Seitens des Regiments gab, sie zu vertuschen, so wollte es doch damit nicht gelingen. Die Behörden zu Altena zeigten den ganzen Hergang dem Könige an. Dieser ertheilte zwar keinen Bescheid darauf; an den General-Lieutenant von Wolffersdorf erließ er aber folgende Kabinets-Ordre:
»Mein lieber General-Lieutenant von Wolffersdorff! Es ist speciell angezeigt worden, welche Disturbationen Er in dem Städtchen Altena in der Grafschaft Mark gemacht hat. In Erwägung Seiner sonstigen Meriten will ich diese mauvaise Geschichte für diesmal pardonniren, werde Ihn aber nach Spandau schicken, wenn Er je eine ähnliche Abnormität sich sollte zu Schulden kommen lassen.
Sans-Souci, den 11. August 1770.
Friedrich.«
Unter Altena bis zu dem Thal der Grüne, verengert sich das Lennethal und wird immer reicher an den schönsten und interessantesten Partien; gewaltige Felswände, freundliche Häusergruppen spiegeln sich im Flusse, der Thurm von Letmathe und sein Rittersitz taucht vor uns auf in dem schönsten aller Thäler, senkrecht stehen am rechten Gestade zwei Steincolosse von 150 Fuß Höhe, den schroffen Bergen des linken Ufers gegenüber; man nennt sie Mönch und Nonne und findet eine schmale Grotte in dem letztern. Unterhalb Letmathe, am Saume eines weiten Bergkessels, steht auf kühner Höhe eine feste Bauerwohnung, deren Fenster den herrlichsten Anblick auf den Fluß gewähren; die Lenne durchfließt unten das geräumige Thal von Letmathe, Genna und Oestrich und sendet Arme seitwärts, um Mühlen und Metallfabriken zu treiben, die unter Baumgruppen versteckt nur hie und da mit einzelnen weißglänzenden Landhäusern sichtbar werden, umher Wald, Fluren oder verwitterte Felsenmassen und Steinbrüche, aus denen die Sprengungen herüber donnern, und über den grauen Klippen oder dem frischen Baumgrün wirbelt der Rauch empor, den schwarz, wolkenhaft geballt, die hohen Röhren der Essen emporsenden. In neuester Zeit haben der hohe Damm der Bahn nach Iserlohn und großartige Industrie-Anlagen der landschaftlichen Schönheit dieses Punktes Eintrag gethan, wie ebenfalls Limburg durch solche Anlagen außerordentlich viel verloren hat.
Endlich nach einer Wanderung von drei Stunden trägt uns die steinerne Bogenbrücke über die Lenne an's linke Ufer, nach Limburg, und wir stehn in einer Gegend, deren Reize zu beschreiben ein vergeblich Unternehmen wäre. Die Landschaftspartie von Altena bis Limburg ist wohl die schönste Westphalens; es sind zwei Kleinode, zwei Edelsteine, jene Punkte, welche der Silberreifen der Lenne einfaßt, welchen dunkle Blätter aus dem Buche alter Historie als Folien untergelegt sind. Eine Gegend wie diese kann nicht beschrieben werden, weil sie wie Musik auf uns wirkt, durch alle Poren des Gemüths auf alles Seelenleben eindringend und es in jeder Regung erfassend; dies Ausathmen von Musik einer schönen Natur ist es, was man den unnennbaren Reiz einer Landschaft nennt, was man Zauberhaftes darin fühlt, das unsrer festesten Individualität wie mit einer schmerzlichen Sehnsucht nach Auflösung in das All, nach einer vollen Hingabe an die Natur droht. Das Betrachten von Werken der Kunst kann ermüden, wie der Gedanke ermüdet; sie heischen ein intellektuelles Arbeiten der Seele; die Natur ermüdet nie, denn sie trägt und wiegt unser bewußtes und unbewußtes gesammtes Seelenleben wie aus den Harmonien der Musik. Die Weisheit der Kindeseinfalt, die Poetenintuition der Sage hat zuerst diese Musik der Natur entdeckt und belauscht; die Sage hat den Ausdruck dafür in der Fiktion geschaffen, daß aus dem Lurley in den Untergang hinabziehende Töne klängen, daß aus den Elementen, aus dem rauschenden Strome, der Nixe schwermüthiges Lied töne; sie läßt die Geistertöne der Glocke von Arragonien durch die Sommernacht einer Huerta von Valladolid schwirren; die romantische Poesie lernte von ihr, das Klingen der Sonnenstrahlen im Gelaub der Wälder, die Aeolsharfentöne des Windes in einsamen Felsbuchten zu belauschen. – Ein zweites, worin die Musik der Natur einen Ausdruck gefunden, sind die Weisen der Volkslieder. Das ist das Geheimniß des namenlos ergreifenden Zaubers, der in diesen so einfachen und doch so tief poetischen Klängen liegt. In die Musik einer schönen, farbenreichen, freudigen Natur wird auch das Lied des in ihr angesiedelten Volkes lebendig bewegt und froh sich einfugen; in der grandiosen Oede von Landschaften, wie sie Hochschottland und der weite Norden besitzt, tönt es so einfach wehmüthig und doch so durchschauernd wie eine geheimnißvolle Prophezie vom nahen Tode, wie eine mahnungreiche Geschichte von ewigem Scheiden und Sterben. Die jetzt meist untergegangenen Volkslieder des einst so heidenreichen nördlichen Münsterlandes sind so durchdringend schwermüthig wie der einsame Schrei des Kibitzes, der über die Heide hinfährt; aber die Phantasie hat in der Oede desto schrankenloseren Raum zu ihren Schöpfungen gefunden und aus dem Rahmen der einfachen Weisen steigt vorgebildet die ganze Welt der spätern Romantik auf, mit ihren Königskindern, ihren Seefahrern, ihren Prinzen, die um Hirtinnen freien.

Wollen wir sie belauschen, die Musik der Natur, die Stimmen der Wasserfeien, die Melodien des Elements, so müssen wir uns auf die Brücke von Limburg setzen, wenn es Nacht ist, wenn der Mond geisterweckend seine Strahlenpfeile in die krausen Wellen der kleinen Wehren hinabschießt; über die Breite der Lenne, scheint es, ist eine Reihe von Metallglöcklein gespannt und die Feien läuten sie, sie läuten mit allen Glocken die Mondnacht ein; das ist für das lebendig rührige Geschlecht was der Sonntag den Menschen; dazwischen hört man sie lachen und jauchzen und wehklagen und seufzen, ohne Rast ohne Ruh ihrer Wasserorgeln Cadenzen durchlaufend, eine wundersame Vesper, über welche die Strahlenmonstranz am Himmel von oben her ihren Segen ausgießt. Man kann sich nicht losreißen von dieser sonderbaren Musik, die unverkennbar, keine Dichter-Phantasie, in unser Ohr dringt; man möchte ihr lauschen, bis im Glanz des Morgens das Thal von Hohenlimburg vor uns auftauchte. Dann freilich, beim Tageslichte würde man vergessen auf der Wasser Rauschen, Singen und Läuten zu horchen. Man vergäße es über der Schönheit dieses Landschaftsbildes. Es ist nichts als zwei Reihen hoher Berge, dazwischen ein Fluß, an seinem linken Ufer eine Stadt und über der Stadt ein Schloß; aber aus diesen fünf Dingen, wie aus fünf nichtsbedeutenden Buchstaben das schönste Wort, ist die schönste, die ergreifendste Rede zusammengesetzt, die der Schöpfer zum Menschen sprechen kann, wenn er uns einmal in's Herz prägen will: es ist nicht wahr, was sie sagen, der große Pan sei todt!
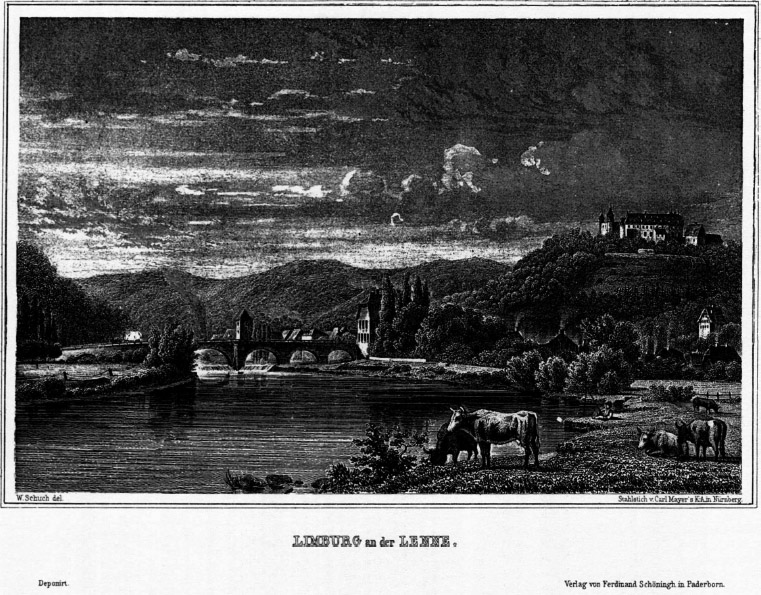
Aber ich vergesse, daß ich den Cicerone hier machen muß und hinaufführen auf das Schloß Hohenlimburg. Geebnete Pfade durch sorgfältig gepflegte Anlagen leiten bis zu der Terrasse, wo eiserne Geschütze unter hohen Linden in die friedliche Landschaft drohen; dann öffnet sich das feste Burgthor mit seinen Adler- und Falkenklauen, seinen eisenbeschlagenen massiven Eichenbohlen vor uns, und nachdem wir einen Blick auf die Wappen darüber geworfen, treten wir durch den langen gewölbten Thorweg in das Innere. Das Wohngebäude links, vom Grafen Mauritz Casimir in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hergestellt, ist einfach; außer ihm sind einige Thürme in den Ecken, eine Wohnung des Kastellans die einzigen Baulichkeiten, welche die auffallend hohe Ringmauer umschließt; aber von dem Zinnengang, welcher diese Ringmauer krönt, wo man überrascht einen neuen Ort, die Nahmer, wie vom Schlosse zu Altena die Nette, entdeckt, hat man eine Aussicht, welche an die erinnert, deren man von der großen Terrasse des Heidelberger Schlosses genießt. Auffallend ist überhaupt die Aehnlichkeit zwischen Limburg und Heidelberg, wenn auch Heidelberg so viel großartiger ist durch Strom und Stadt, nicht durch die Formationen seiner weniger schönen Berge. Jedenfalls träumt man sich unwillkürlich zurück in die fröhliche Musenstadt, wenn man auf der Lennebrücke über das breite Flußthal nach den blauen Ruhrbergen und den Ruinen von Hohensyburg ausschaut; es ist als läge die üppige Neckarebene vor dem Auge da, begränzt von den azurnen Höhenzügen des Hardtgebirges. Vor allem andern freundlich liegt Limburg selbst zu unsern Füßen, wenn wir auf der Gallerie der Schloßmauer, in ihrem Belvedere stehn; doch ist der Ort, einst so blank und niedlich, als habe ein Kind seine Stadt aus der Nürnberger Schachtel zwischen Baumgruppen und Blumengärtchen zusammengestellt, jetzt sehr durch seine Fabriken verunstaltet.
Das Schloß ist von dem Grafen Heinrich von Limburg in den Niederlanden um das Jahr 1230 erbaut worden. Es hatten, sahen wir oben, die Brüder Friedrich und Arnold von Altena ihr Erbe sich getheilt: Arnold bekam außer Isenburg und Nienbrügge Rechte zu Limburg an der Lenne. Wir werden weiter unten erzählen, wie Arnold's Sohn Friedrich den heiligen Engelbert erschlug und zur Strafe geächtet und seiner Güter beraubt wurde; »da ist sein Sohn Theodorich sagt ein alter Chronist, bei dem Herzogen von Limburg und Grafen von dem Berge, seiner Mutter Bruder, aufgewachsen und männlich worden. Da gedachte gemeldter Herzog Heinrich von Limburg, wie er seinen Vettern in sein väterliches Erbe, welches Graf Adolph ingenommen hatte, wiederumb insetzen möchte, machte sich derwegen auf mit einem ansehnlichen Kriegsheer, kame auf die Lehnne, bauete daselbst auf einem hohen Berg ein Schloß oder starke Festung, welches er nach seinem Namen und Schlosse Limburg nennete. Er hatte daselbst so mennigen Kriegsman, als Steine und Balken am Hause seyn und das Schloß sollte allezeit seyn und bleiben den Grafen von dem Berge zu sicherer Zuflucht ab und an zu ziehen und offen zu stehen.«
Nun wurde Theodorich der Ahn eines Grafengeschlechts von Neu-Limburg, das 1459 mit dem Grafen Wilhelm erlosch, dessen Erbtochter Margarethe die Besitzung an ihren Gemahl Gumprecht von Nüwenar brachte, bei dessen Stamme sie bis 1573 blieb, wo eine Erbtochter Magdalene von Nüwenar, mit Graf Arnold von Teklenburg vermählt, Limburg diesem letztern Hause zubrachte, dessen Enkel aus der Rhedaschen Linie seitdem im Besitz geblieben und jetzige Standesherren der Grafschaft sind; das Schloß dient ihnen zum neidenswerthen Sommeraufenthalt.
Ein höchst romantischer Weg führt von Limburg an der Höhe, die einst die Feste Raffenberg trug, an den Felsen der Hünenpforte und des nahen Weißensteins her nach Hagen. Auf dem Raffenberge, erzählt die Sage, hauste einst ein arger Raubritter, Graf Humbert, der seinen Rossen die Hufeisen verkehrt unterschlagen ließ, um seine zahlreichen Feinde zu täuschen. Von einem Heere derselben belagert, trotzte er auf die Stärke seiner Burg und die Menge seiner Vorräthe; da sagte ein altes Mütterchen den Belagerern: Nehmt einen Esel, so man drei Tage hat dürsten lassen und führt ihn an den Berg; wo er stehen bleiben und mit den Füßen scharren wird, liegt der Brunnen, aus dem Röhren das Wasser in die Burg leiten. Der Alten Wort bewährte sich und der Burgherr ward auf's Trockne gesetzt; da ließ er durch einen Herold sagen, er wolle sich ergeben, wenn man sein Gemahl frei abziehen lasse mit dem, was sie in dreien Malen aus dem Schlosse tragen könne. Dies ward ihm gewährt, und sieh, die Gräfin, ein starkes Weib, kam zum ersten Male mit dem Gemahl auf den Schultern, zum andernmale mit dem Sohne, der eben so arg wie der Vater, und zum drittenmale mit einer solchen Last von Gold und Geschmeide, daß sie am Fuße des Berges angekommen elendiglich zusammenstürzte. – Ein andrer Weg zieht am rechten Ufer der Lenne durch Elsey nach Hohensyburg. Wir schreiten über die Lennebrücke, der gegenüber auf der Berghöhe einst das Schloß Eickel stand und jetzt das Monument Möllers, dann links ab dem einst hochadlichen freiweltlichen Damenstift Elsey zu. Ueber das Pfarrhaus zu Elsey breitet die Erinnerung an die beiden Möller eine idyllische Poesie, die vergessene und doch so rührende Poesie des Landpredigerlebens, die hinter den rebenumsponnenen Fenstern der stillen sommerlichen Studierstube, unter der blühenden Geisblattlaube des trauten Familienmales, an dem von Heimchen umzirpten Heerde der blankgescheuerten Küche wohnt, wie es die Dichter unserer sentimentalen Literaturperiode so sinnig geschildert haben. Man denkt dabei an Vossens Luise; wer Johann Friedrich Möller kannte, denkt bei seinem Namen an eine realere Gestalt, an Justus Möser. In derselben Zeit wurzelnd, aus gleicher Denkrichtung patriotische Phantasien nährend, mögen beide zusammen genannt werden, wenn Westphalen die Männer aufzählt, auf welche es stolz ist. Möllers Geist beweisen die Kinder seines Geistes, seine Schriften; sein nachhaltiges Wirken seine andern Kinder, die guten freundlichen Leute von Elsey. – Er war es, der in den Drangsalen des Jahres 1806 die Befürchtungen der Grafschaft Mark von der Krone Preußen losgerissen zu werden, aussprach und des Königs hochherziges beruhigendes Wort zur Antwort darauf erhielt.
Bevor wir nun das nahe Ruhrthal wiedergewinnen, folgen wir dem Eisenbahnstrang, der nach Iserlohn führt, um die Dechenhöhle zu sehen, die größte Naturmerkwürdigkeit unseres Landes, wie die Extersteine seine größte historische Merkwürdigkeit sind. Wir kommen nach Letmathe zurück, wo die schöne Ebbinghaussche Anlage die Stelle der alten Burg Letmathe einnimmt – man kann den Geist der Gegenwart nicht besser symbolisirt sehen als durch diese moderne, lichte, gastliche, blumenumgebene Schöpfung, die sich auf der Stätte der engen, winkligen, dunklen Feudalburg erhebt. Die Höhle öffnet sich eine kurze Strecke hinter dem Orte, in dem schönen dicht bevölkerten Thal der Grüne; erst 1868 hat bei Gelegenheit der Eisenbahnarbeiten ein Zufall sie entdecken lassen, und kurz nachher lockten die Beschreibungen der ersten Besucher, deren eine wir folgen lassen, von fern und nah die Schauer herbei:
»Wir betraten, ein Jeder sein Grubenlicht in der Hand, die weiten Gänge der Höhle, die sich, in einer Länge von nahezu 900', durchschnittlich 15' breit und 9' hoch, längs der Bahnlinie hinziehen. Gleich der erste Eindruck, der sich unser bemächtigte, war der des Großartigen und Erhabenen: wie klein doch der Mensch und das Erdenleben gegenüber der rastlos fortwirkenden Natur, die hier, von Niemanden gesehen und gekannt, vielleicht seit Jahrtausenden durch kleine, dem Auge kaum bemerkbare Antropfungen die wunderbarsten Formen schuf. Uns ergriff es wie ein Gefühl der eigenen Schwäche und Nichtigkeit, als seien die weiten Hallen mit schwebenden Schatten der Geister uralter Vergangenheit erfüllt. Weithin tiefe, fast schauerliche Stille, nur unterbrochen durch die hier und da vorsichtiger suchenden Schritte oder die unwillkürlichen Bewunderungsrufe, zumal der Besucherinnen: ›Nein, feenhaft, einzig, wunderbar! So etwas hätte man nicht gedacht!‹«
Der Reichthum der verschiedenartigsten wundersamen Formen und Bilder stellt sich, wie wir in diesen kühlen Steingrotten und Hallen weiter vorschreiten, in der That so überraschend, in solcher Verschwendung dar, daß das Auge, wie verwirrt über die geheime Pracht der Tiefe, unstet von einem schönen Punkte zum andern schweift. Ueberall Neues und Seltenes in bald imposant großartigen, bald wunderlieblichen Bildungen.
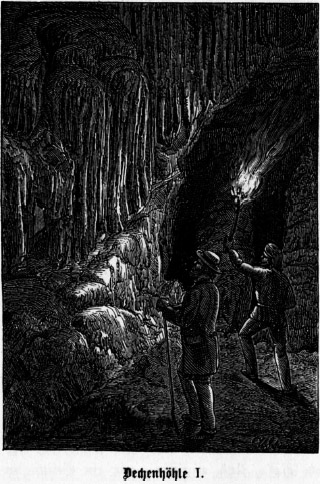
Dort ragen mächtige Stämme empor, ihr Geäst über sich wölbend und zu breitem Dache verzweigend, wuchernd wie die indische Sykomore, die jeden Ast, den sie in den Boden senkt, zu einem neuen Stamme verwandelt. Da liegen kannellirte Säulenschäfte zu Boden, da dräut es wie ein ganzer Wald ungeheurer Eiszapfen auf uns nieder. Da entsenden durchbrochene Kuppeln ihre Kronleuchter oder zierliche Ampeln, daran krauses Gewinde und seltsames Schlinggewächs emporrankt. Hier ist es, an Wänden und Decken, als hätten Genien den Stein mit Stickereien bedeckt, ihn wie einen Teppich gewebt, wie die feinsten Spitzen gehäkelt. Und wie rosig schimmert dort das Licht hinter den transparenten Vorhängen, als müßte sich uns da ein neues, noch schöneres Zaubergemach enthüllen. Wir meinen, die reiche dekorative Architektur der Mauren zu sehen, wie sie der Wanderer noch heutzutage in den Wundersälen der Alhambra erstaunt betrachtet. Und, vielleicht noch mehr wie dort, wiegt es hier, »tief unter der Erd',« den Geist in poetische Träume und umfängt ihn wie eine Märchenwelt.
Als ein besonders schönes Phänomen erschien uns die sogenannte »Orgel« mit ihren übereinander geordneten Reihen Pfeifen, welche, die Illusion zu vollenden, mit einem Stabe gestrichen, ähnlich einer Schalmei, fast die volle Oktave durchklingen lassen. Gleich interessant sind: die wirklich kolossale »Kanzel«, ein die sitzende Figur eines alten Ritters darstellender Block, worin man, nach der Umgebung, leicht einen »alten Barbarossa« erkennen mag, u. s. w. In einer etwas höher gelegenen Nebengrotte sehen wir das mit klarem rheingrünem Wasser gefüllte »Bassin«.
Wie nach und nach die ganze Höhle durch auf hohen Leuchtern aufgestellte Lichter erleuchtet wurde, so erschienen besonders die eben genannten Punkte: Orgel, Kanzel, Bassin etc. durch Magnesiumlicht in blendender Helle und es gewährte einen ganz grotesken Anblick, wie das Licht in fliegenden Strahlen um diese seltsame Welt auf- und niederspielte, noch einige phantastische Reflexe warf, und nun wieder Alles in jähe Nacht versank.

Ein sehr hübscher Anblick war es auch, wie ein Theil der Gesellschaft, im irren Schein der Lichter, die aus der höheren, »zweiten Abtheilung« zurückführende Gallerie hinabstieg. Nach anderthalbstündigem Umherwandern nähern wir uns wieder dem Ausgange und mit einem letzten Rückblicke den geheimen Mächten der Tiefe Lebewohl sagend, schauen wir freudig des Tages goldenes Licht. Wohl meinen wir da, wie wir die bunt wechselnden Bilder durch die Erinnerung spielen lassen, einen wunderbaren Traum gelebt zu haben, sahen wir nicht noch um uns die Wände vielgestaltig überdeckt und am Boden die roheren Stalaktitenformen, wie Kegel, Muscheln, Bienenkörbe etc., unbeachtet umherliegen – Alles reine, greifbare Wirklichkeit. Wir freuen uns, eine neue, unstreitig bedeutsame Sehenswürdigkeit auf rother Erde kennen gelernt zu haben, und voll gerechten Stolzes auf die schöne Heimath fügen wir in unser Denkbuch ein frisches Ehrenblatt für's »malerische und romantische Westphalen«.
Seit diese Zeilen geschrieben wurden, ist die Höhle weiter durchforscht, zu Ehren eines um den Bergbau und die geographische Wissenschaft verdienten Mannes die »Dechen-Höhle« genannt und ausführlich beschrieben worden. Führer zur Dechenhöhle von Pr. Fuhlrott, Iserlohn, Bädeker 1869. Vergl. auch: »Ein Tag in den Höhlen Westphalens« von K. Vogt, Gartenlaube Jahrg. 1869. Eine Gasleitung für 150 Flammen bringt Licht bis in ihre tiefsten Gründe. Als einen der schönsten Punkte darin haben wir noch das Venusbad hervorzuheben, eine reizende Grotte, halb versteckt zwischen schimmernden Säulen und durchscheinenden Spitzenvorhängen, mit krystallhellem ründlichem Wasserbecken, so klar, friedlich und einladend, daß man es nach der Göttin der Schönheit genannt hat, die freilich die Tochter der leuchtenden Meeresfluth und des hellen Sonnenlichtes der Oberwelt ist. Jedenfalls ist es ein Punkt, wo die beschreibende Prosa gern einhält, um der Poesie Raum zu geben, wenn sie so wie die nachstehenden Verse von E. Rittershaus es thun, die Interpretin des Eindrucks wird, den die märchenhafte Welt um uns her macht:
— — — — — — — — —
Hell war der Tag. Am grünen Tannenzweig
Hing klarer Thau; noch stand des Waldes Reich
Im bunten Schmuck. An dem Wachholderstämmchen
Tiefblaue Beeren, Vogelkirschen dort,
Und an dem Birkenbusch an Waldesbord
Ein jedes Blatt gleich einem goldnen Flämmchen.
Hell war der Tag, doch was dem Blick er bot,
Was war es? Nur der buntgeschmückte Tod!
Auf dem Paradebett des Sommers Leiche!
Die Lichter her! Dort ist der Höhle Thor,
Schon blitzt es schimmernd aus dem Spalt hervor –
Auf! Frisch gewagt die Fahrt zum Gnomenreiche!
Wir treten ein. Jahrtausende hindurch
War fest verschlossen diese Felsenburg –
Ha, welche Pracht! Schau nach der Decke droben!
Ein Domgewölb' von funkelndem Krystall –
Und dort ein eisgewordner Wasserfall,
Ein Schleier dort, von der Natur gewoben.
Ein Palmenwald, dort eine Orgel gar,
Und hier ein Wasserbecken, silberklar
Darin die Fluth und silberklar die Säulen,
Die es umsteh'n! Und hier von blankem Kalk –
O, schaut nur – eines Bischofs Katafalk!
Und dort – o seht – sind es nicht Riesenkeulen?
So schafft Natur: im hellen Sonnenglanz
Da droben schafft sie bunten Blüthenkranz
Und Laub und Frucht, schafft das Vergänglich-Schöne.
Sie ruft die Sänger in den grünen Hain –
Da kommt der Herbst und Alles schlummert ein!
Verwelkt die Pracht, verstummt des Liedes Töne!
Dort, wo sie schaffend in die Tiefen steigt,
Dahin kein Strahl des Sonnenballes reicht,
Da weiß sie Ewig-Schönes zu gestalten!
Da baut sie diese mächt'gen Säulen auf,
Krystall der Sockel und Krystall der Knauf,
Da bietet Trotz sie allen Zeitgewalten!
Dort oben auf dem Berg' – wie lang ist's her? –
Da standen dort mit Schild und scharfer Wehr
Die Mannen Wittekind's, zum Thale lugend
Nach Kaiser Karl und seiner Kämpfer Spur –
Und unter ihren Füßen schuf Natur,
Langsam zum Dom die Stalaktiten fugend.
Dann auf dem Hügel heller Hörnerklang!
Auf stolzem Rappen sprengt hinab den Hang
Der Burgherr, ihm zur Seite seine Reiter.
»Mein ist dies Alles! Mein durch meine Kraft!« –
Und unter seinen Sohlen wirkt und schafft
Mutter Natur an ihrem Werke weiter.
Held Wittekind, der Ritter – längst verweht
Die letzte Spur, doch herrlich prangend steht,
Was die Natur geschaffen in den Tiefen.
Wir treten ein in ihr Studirgemach;
Wir zieh'n hervor, die unter'm Säulendach
In Nacht und Dunkel manch' Jahrtausend schliefen,
Die Zeugen alter Zeit! Es rufet dreist
Ein Sonntagskind – es heißt der Menschengeist:
»Empor! Empor! Ihr sollt mir Rede stehen!
Erzählen sollt ihr mir von dem, was war!
Genug geträumt! Mit Augen, hell und klar
Will ich, Natur, jetzt in dein Lehrbuch sehen!«
Stein und Gebein – und doch ein reicher Schatz!
Das Reich der Vorzeit – aus den Trümmern hat's
Neu aufgebaut der Geist der Welt von heute!
Wir sehn's: Aus Moorgrund sprossen Farn und Schwamm;
Schwerhufig stampft des Mammuths Fuß den Schlamm;
Bär und Hyäne jagen nach der Beute.
Die Lichter flirrten. – Nun zurück zum Pfad...

Das nahe Iserlohn zeigt uns eines der freundlichsten Städtebilder, wenn wir die Höhe des Akenbrock (den Schützenhof) ersteigen und die hochliegende Stadt (sie liegt 800 Fuß über der Meeresfläche) auf ihrem Plateau am Fuße des Frönnenbergs überschauen. Auf einem erhöhten Kalkfelsen ruhend zeigt sich ein Theil mit malerisch zerstreuten Gebäudegruppen, mit seinen Dächern von rothen oder schwarzen Ziegeln und Schiefern wie eine Hoch- oder Oberstadt, und den dichten Kern des Orts umgeben zahllose Einzelhäuser in einer grünen Gartenwelt, die sich mit ihren hübschen Baumgruppen und Gartenhäusern und kleinen Villen und Parkanlagen weithin nach Norden, nach dem sogenannten Tirol hin ausdehnt. Das ganze anziehende Bild, dessen Mittelpunkt drei stattliche Thürme bezeichnen, ist von den schöngezeichneten Linien der nahen Bergzüge umgeben. Namentlich ziehen im Süden die letzten hohen Ausläufer der süderländischen Ketten das Auge an.
Iserlohn ist ein alter Mittelpunkt westphälischer Industrie, und wenn es in alter Zeit auch nie sehr volkreich gewesen scheint und nach dem dreißigjährigen Kriege nicht 1200 Einwohner zählte, so hat doch eben dieselbe Industrie durch ihren heutigen Aufschwung seine Einwohnerzahl auf über 16,000 Seelen gesteigert und es vor vielen unsrer Städte wohlhabend gemacht. Entstanden auf dem Grund und Boden eines Sitzes der Herren von Loen (später Burgmänner von Rüthen; Loe ist Wald und Iserlohn Eisenwald) hat es anfangs diesen Grundherren gehört, und als ihren Wohnsitz bezeichnet die Tradition den Ort vor der Stadt, der noch jetzt die Burg heißt. Den letzten dieser Herren zu Iserlohn überfiel Graf Friedrich von Isenburg, nahm ihn gefangen und sperrte ihn in den in neuerer Zeit abgetragenen sogenannten »runden Thurm« neben der Kirche, den er ihm eigens zum Gefängniß bauen ließ – ein; darin ist der arme Grundherr nach fünf Jahren Todes verblichen, ohne den Trost, zu ahnen, wie gründlich er an seinem Verfolger, der bekanntlich auf dem Rade endete, gerächt werden sollte. Iserlohn aber ist seitdem der Mark annectirt geblieben; sie hatten eine feste Faust, diese märkischen Grafen, die nicht leicht wieder sich entschlüpfen ließ, was sie einmal erfaßt. In der Mitte des 13. Jahrhunderts verlieh Graf Engelbert I. Iserlohn die Stadtrechte. Die Soester Fehde, von der wir erzählt haben, gab seinem Aufblühen einen harten Stoß. Es hatte der Junker von Cleve des Bischofs von Köln Bundesgenossen, die Dortmunder geschädigt und geschlagen: der Erzbischof rächte sich dadurch, daß er des Junkers von Cleve und der Mark Stadt Iserlohn verbrannte und verwüstete – nach der einfachen und doch so eigenthümlichen Logik jener viel gepriesenen Zeit und ihrem Rechtssatz vom geschlagenen Juden. Im Jahre 1616 war Iserlohn durch Brand und Pest so verödet, daß die wenigen übrig gebliebenen Frauen ihre Spinnrocken auf den Markt trugen, um sich da eines geselligen Zusammenseins bei der Arbeit zu erfreuen und die einzigen sieben Junggesellen sieben Linden pflanzten, von denen noch eine zu sehen sein soll. Die Reformation führte 1526 der Prediger Joh. Varnhagen aus jenem Geschlechte der Varnhagen und der Schnidewindt von Ense (bei Werl) ein, welchem der berühmte Biograph Blücher's, Bülow's und unseres Theodor von Neuhof angehört. Es haben die Varnhagen seitdem eine Reihe Iserlohnische Pfarrherrn geliefert. – Eine Scene, welche uns alle Gräuel des 30jährigen Krieges vor Augen bringt, erzählt die Iserlohner Chronik: Es hatte der kaiserliche General von Bönninghausen sich vor der Stadt gelagert. Der Bürgermeister der Stadt, Duisburg genannt, hatte dem kaiserlichen Heerführer, der in Iserlohn aufgewachsen und erzogen war, einst als Knaben wegen kindischen Fürwitzes eine Zurechtweisung ertheilt. Als er jetzt mit diesem wegen der Kapitulation unterhandelte, entstand Tumult in der Stadt und die Bürger schossen auf die Kaiserlichen. Im jähen Zorn griff nun der General, der seinen alten Groll nicht vergessen, zu einer Hellebarde und erschlug damit den Bürgermeister. Die Leiche ließ er aufknüpfen, die drei Töchter des Erschlagenen aber wurden herbeigeschleppt und gezwungen, drei Mal um die Leiche zu tanzen. Dann sollten sie im Zelte des Generals mit ihm auf das Wohl des Vaters trinken; hier aber ergriff die älteste, ein Mädchen von 21 Jahren, das abgeschnallte Schwert des Wütherichs und führte damit einen Hieb nach ihm, der nur leicht seine rechte Schulter verwundete. Sie wurde dafür unter dem Baume, der ihres unglücklichen Vaters Körper trug, lebendig verbrannt; die andern Töchter wurden mißhandelt, halb nackt nach Hause gejagt und die Stadt der Plünderung preisgegeben. Man zeigt als Stelle des Geschehenen noch auf dem »Jungfernbläck« eine alte Buche, unter der weder Kraut noch Gras wächst. –
Iserlohn hatte einst zahlreiche Burgmannshöfe, der Familien von Letmathe, Ohle, Wulf von Lüdinghausen, Varnhagen von Ense, zur Megede, u. s. w.; sie sind sämmtlich vom Erdboden verschwunden wie die alten Mauerthürme auch. Die einzigen alten Bauwerke der Stadt sind die Kirchspiels- und die Stadtkirche. Die Kirchspielskirche ist seltsamer Weise fünfeckig in ihrem Grundriß angelegt, und daher entstand vielleicht mehrerer localpatriotischer Autoren Ansicht, sie sei ein alter Heidentempel gewesen, wie auch klärlich ein in der Höhe des Glockenstuhls in den Thurm eingemauerter Hundekopf mit Sonne, Mond und Sternen umher darthue. Ein andrer eingemauerter Kopf stelle Wittekind dar.
Es ist möglich, daß die Stiftung unsrer Kirche in die Zeiten Wittekinds hinaufreicht; das Gebäude aber ist schwerlich älter als das 13. Jahrhundert und weit unansehnlicher als die Stadtkirche, die, erhöht auf einem Felsen liegend, mit ihren Doppelthürmen ein bedeutend stattlicherer Bau ist. Sie wird zuerst 1330 als »Capella unserer lewen frouven ope dem hilligen berge« genannt, und ist mit einem Anbau von 1431 später zur Stadtkirche erwachsen. Eine geharnischte Statue an der Nordecke des Chores und des Hauptschiffes hält man für die Engelberts III.; bemerkenswerth ist, daß der Schild dieser Statue, von der man weiß, daß sie 1710 »von Neuem illuminiret worden,« die deutschen Farben roth-schwarz-gold zeigt. Eine andere Abbildung Engelberts III., eine Reiterstatue, befindet sich in dem Dorfe Valbert bei Olpe. Sie war früher in der uralten, vor 1072 schon vorhandenen und 1870 abgebrochenen Kirche aufgestellt; der hohle Bauch des Pferdes diente als kleines Archiv, das die wichtigeren Urkunden enthielt. – – Dringend zu rathen wäre die Freistellung der Kirche nach Süden hin.
Wie das nahe Fröndenberg die Geburtsstätte des großen Juristen Gothofredus Antonius, ist Iserlohn Geburtsort des berühmten Staatsrechtslehrers Joh. Stephan Pütter, der 1725, sowie des Pfarrers Joh. Dietrich von Steinen, des Verfassers der Westphälischen Geschichte, der einige Jahre früher hier geboren wurde.
In der Geschichte der Industrie-Entwicklung Iserlohns spielt als ältestes Gewerbe das der Panzerschmiede die hervorragendste Rolle, wenn auch heute nur noch die Panzerglocke im Thurme der Stadtkirche an sie erinnert. Schon im 13. Jahrhundert war die Panzerarbeit durch eine Zunftverfassung geregelt; dann kam die Osemundfrischerei aus Schweden über Lübeck nach Iserlohn; es folgt seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts die Kratzendrahtfabrication, die sich zuerst der Märkte in Holland und den Nordseehäfen, dann derer in Spanien und Portugal bemächtigte. Schnallen, Nadeln und Bronzewaarenfabrication kam bald hinzu, und daneben entwickelte sich der Bergbau, namentlich auf Galmei, der schon in den ältesten Zeiten betrieben, doch erst 1749 zur Gründung einer Messinggewerkschaft führte, endlich die Weberei von Sammt, Seide und Bändern. Uebrigens vertheilt sich die gewerbliche Thätigkeit auf den ganzen Kreis; sie gipfelt in der Witteschen Näh- und Stricknadelfabrik, die wöchentlich 10 Millionen Stück Nähnadeln, 400,000 Stück Fischangeln und 1000 Groß Stricknadeln verfertigt. Als einer der Hauptförderer der Iserlohner und Westphälischer Industrie überhaupt ist der Name eines ursprünglich blutarmen, weder des Schreibens noch Lesens kundigen Arbeiters, C. D. Piepenstock zu nennen, der sich durch Fleiß, Betriebsamkeit und Sparsamkeit vom Hausirer mit selbstgemachten Haarnadeln, die er in Holland absetzte, zum großen Industrie-Baron, zum Gründer höchst bedeutender Werke aufschwang, während sein Sohn Hermann 1839 eines der größten unsrer Eisenwerke, die berühmte Hermannshütte bei Hörde in's Leben rief. –
Wir nehmen von Iserlohn Abschied, indem wir zum Schluß seines Sagenreichthums erwähnen. Nach einer dieser Sagen hatte König Wittekind neben dem Sitze auf Hohensyburg noch eine Burg zu Iserlohn; auf derselben weissagte ein heidnisches Orakel, zu dem man aus weiter Gegend sich um seine Sprüche wandte. Die Burg stand, östlich von der Stadt, an einem Platze, der noch heute die Königsburg genannt wird; es führte von da nach Syburg ein besonderer Weg, der Königsweg, und noch immer sprengt zu gewissen Zeiten der alte Heidenherzog mit feurigen Rossen über jenen Weg nach Syburg und gen Soest. Zuweilen aber begegnen sich zwei Geisterwagen im Norden der Stadt: der von Soest kommende setzt dann seinen Weg fort, der von Hohensyburg verschwindet in dem Berge, welcher »die Säuler« heißt.
Wenden wir uns jetzt zu unserer Ruhr zurück, und nehmen wir die Verfolgung ihrer Ufer bei Villigst wieder auf – das weiter aufwärts liegende Ardei, neben dem auf einem bewaldeten Bergvorsprung sich schwache Spuren der Burg des längst erloschenen Dynastengeschlechts von Ardei befinden, hat nicht genug, um so weit hinauf zu locken. Villigst, früher Vilgeste, erhebt sich in anziehender Lage am linken Ufer – es hatte einst einen berühmten Freistuhl und ein altes Burghaus derer von Sobbe, denen darin eine erloschene Bastardlinie des Hauses von der Mark folgte. Jetzt besitzt das schöne Gut die Familie von Elverfeld. Bedeutsamer ist das Städtchen Schwerte, Hermann Fley's, genannt Stangefol, des Verfassers der annales circuli Westphalici (gest. 1655) Geburtsort. Die Stadtkirche besitzt einen höchst sehenswerthen Hochaltar mit einem Schnitzwerk, das neben dem der Petrikirche zu Dortmund zu den umfangreichsten Kunstarbeiten dieser Art gehört. In fünfzehn Feldern und sechs Reihen ist die ganze heilige Geschichte von der Verkündigung bis zur Himmelfahrt Christi dargestellt, um das Bild der heiligen Jungfrau im Mittelfelde geordnet; das Ganze ist von reichster gothischer Architektur umgeben, die einzelnen Figuren sind vergoldet oder in hellen Farben polychromirt. » An. dom. 1523 up paschen is düsse Taffel upgericht« steht an der Südseite zu lesen – den Namen des Künstlers kennen wir nicht, ebensowenig wie den des Urhebers des Dortmunder Werks oder der schönen Schnitzarbeiten der Kirche zu Vreden; für die vortrefflichen Holzschnitzereien an den Chorstühlen zu Cappenberg mit ihrem derben, vom Geiste der Opposition durchwehten, mittelalterlichen Humor haben wir dagegen den Künstlernamen des Meisters Gerlach und die Jahreszahl 1512; wie wir auch wissen, daß Heinrich Stavoer der Meister des Schnitzwerkes in der Kirche zu Enger war. Schwerte ist, wie Iserlohn, ein Mittelpunkt westphälischer Volkssagen, von Wehrwölfen und von Bündnissen mit dem Teufel und von verrückten Grenzsteinen, von der weißen schatzhütenden Jungfrau und dem versunkenen Schloß, das alle hundert Jahre in einer Vollmondsnacht auf der Wandhofer Haide hell erleuchtet, von Jubel und Musik erfüllt, sichtbar wird. S. Gerhard Löbker, »Wanderungen durch das Ruhrthal, Münster 1852.«
Weiter abwärts zeigt sich uns am rechten Ufer des Flusses Westhoven, der alte Reichshof, wohl schon in sächsischen Zeiten der Oberhof, auf dessen Grund und Boden die Feste Hohensyburg angelegt war, dessen Wehrfester da oben in der Burg den Befehl führte und den nach der Einnahme der Feste wohl schon Kaiser Karl einzog und zur villa regia machte. Kaiser Albrecht verhandelte diese 1300 an Eberhard von der Mark. Wir haben dann noch Haus Ruhre und das alte Schloß Husen zu nennen und erreichen nun Hohensyburg.

Wo aus der Oeffnung des süderländischen Gebirges kommend die Lenne in offenem breitem Wiesenthale sich in die Ruhr stürzt, da rauscht diese an einer hohen jähen Bergwand vorbei, auf deren Rücken die Ruinen von Hohensyburg liegen, noch den Belfried, zwei weite Gemächer und Stücke der Ringmauer zeigend; am nördlichen Abhange der Bergwand, auf öder Halde steht das Dorf Syburg, eine dürftige Erinnerung an Wittekinds große Stadt! Es ist öde auf dieser Halde, wenn man aus den Ruinen zurückkommt, in denen man die Blicke weithinab in die Lande hat schweifen lassen, weit hinauf in verschollene Zeiten, bis sie auf den mächtigsten Gestalten unserer Geschichte haften geblieben; auf der tiefern Halde ist der Blick engbeschränkt, der Abendwind haucht Haarrauchnebel darüber, einen fahlen Leichenschleier; der heilige Petersbrunnen, der Wunder that in anderen Zeiten, steht träge quellend; durch die alte Kirche inmitten kleiner Grabsteine pfeift leise der Zugwind, drinnen nichts als Leichensteine, Sterbewappen und das Todtengeläute der Zeit, das schallende Tiktak der Thurmuhr. Keine Spur mehr von dem alten Schmucke, der an den Tag erinnerte, an welchem in dieser Kirche, wie die Sage will, Karl der Große mit seinen Paladinen und Herzogen auf dem Chore stand und Gebete murmelnd den gewaltigen Bart wiegte, während der Pontifex von den sieben Hügeln, Leo III. mit einem unzählbaren Gefolge von Fürsten in der Kirche umherschritt und die Wände salbte und segnete und die Stätte weihte, wo das blinde Heidenvolk eine Irminsul oder ein Krodobild, den »Krottenteufel« verehrt hatte. – Daß Karl die Syburg, mit der Eres- und Iburg der Sachsen Hauptfeste, im Jahre 775 erstürmt und daß sie im folgenden Jahre wieder von ihnen belagert, von Karl entsetzt wurde, ist historisch und bekannt. Sie scheint Wittekinds persönliches Eigen gewesen und mit ihrem Oberhofe zum Reichshofe gemacht worden zu sein, so daß aus Wittekinds Gefolgsmännern und Untersassen freie Reichsleute wurden, bis sie 1300 an Graf Eberhard von der Mark abgetreten wurden. – Was jenen Götzen Krodo betrifft, der übrigens deutscher Mythe nicht angehört, und dessen Name wohl nur Adjektivbezeichnung eines andern Gottes ist, (Krodo, Groto, de Grote?) so glaubt Stangefol, er sei fränkischen Wesens und von einer Drude sein Dienst eingeführt: »war selbiges Bild einem alten Kornschneider oder Mähder gleich gekleydet, mit einem Schurz umbgürtet, hat in der rechten Hand ein Faß voll Rosen, in der linken, so ausgestreckt in die Höhe, ein Wagenrad, stund mit großen rawen Haren am bloßen Kopf mit bloßen Füßen auf einer Seulen und einem rauhen scharffeckigen Fisch, genannt Perca, eine Bärße und war die Brust ihm offen.« Ob jenes Rad, der Gottheit Attribut, Veranlassung zu der Sage von der Zerstörung eines Wasserrads gegeben, wodurch Karl die erste Uebergabe der Burg erzwungen, ist ebenso schwer zu entscheiden, wie die Richtigkeit von der Anwesenheit Leo's in Syburg, seine Weihungen und Taufhandlungen im Sankt Petersbrunnen, seine Schenkung des Hauptes der heiligen Barbara an die Kirche. Augenscheinlich ist es übrigens, daß sowohl die Kirche späterer Zeit, als der Karls angehört, wie, daß die Burg nicht die alte sächsische Feste mehr sei; sie muß innerhalb der Umwallungen der letztern unter der Regierung Heinrich IV. entstanden sein, wurde ein Reichs- und Burglehn der Ritterfamilie von Syburg und unter Rudolf von Habsburg vom Grafen Eberhard von der Mark 1287 als Raubnest mit den Schlössern Isenburg, Ruenthal und Volmarstein zerstört. S. Ueber Hohensyburg. Von J. Fr. Möller. Dortmund 1814. Er brach die Burg nieder und verwandte das Eisenwerk und leichtere Material zum Bau seiner Burg in Hörde.
Die Siegburg der Sachsenzeit haben wir uns als eine der Wallburgen zu denken, deren Westphalen so viele besitzt, das Süderland z. B. in seiner Hünenburg bei Meschede, der »schetliken Borg« bei Freienohl, der Hünenburg bei Rumbeck, dem Rodenberg bei Arnsberg, der besonders wohlerhaltenen bei Balve, dem Hause Wocklum gegenüber u. s. w. Sie erheben sich stets wie Syburg auf Höhen, welche in ein Flußthal vorspringen; aus ihrer Anzahl läßt sich fast schließen, daß beinahe jede größere Gemeinde des Sachsenvolks, wenn die Natur ihr eine günstige Stelle bot, sich solch eine Wallburg schuf, und man denkt dabei an die Bauernburgen einer späteren Zeit in Siebenbürgen. Natürlich hatten die starken Grenzburgen, wie Eresburg und Syburg, auch Mauerbefestigungen und geschlossene Gebäude zur Unterbringung der Vertheidiger; die Eresburg konnte längere Zeit die königliche Familie beherbergen. Kannten die Sachsen doch auch schon steinerne Wurfgeschosse gegen Burgen und Faschinen, die Annalen von Lorsch wenigstens erzählen von jenem Versuch der Sachsen, 776, nachdem sie Eresburg wieder genommen, auch »Sigiburgum« zu erstürmen: »als sie sahen, daß die Steine nichts ausrichteten, da banden sie Reisbündel, um die Wälle mit Sturm zu nehmen. Doch auch das war umsonst, denn der Himmel zeigte alsbald zwei leuchtende Schilde, schrecklich anzusehen, die im rothen Feuerglanze über der neuerbauten Kirche standen, so daß die Heiden in unsäglicher Furcht die Flucht ergriffen.« – –
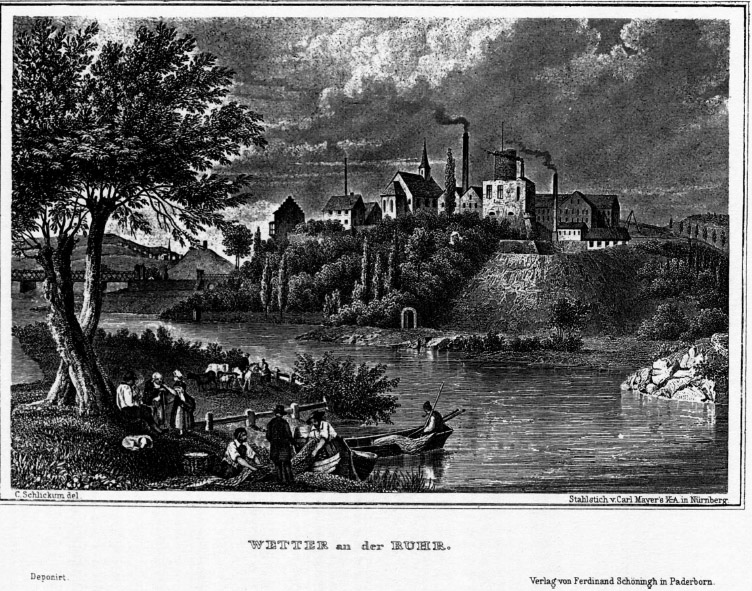
Aus neuerer Zeit ist von Syburg nur zu berichten, daß es im Sommer 1857 Zeuge einer patriotischen Festfeier wurde. Es galt die Einweihung eines Denkmals, das westphälische Männer hier einem um das Vaterland hochverdienten Beamten, dem verstorbenen Oberpräsidenten unserer Provinz, Freiherrn Ludwig Vincke errichtet hatten. In Gestalt eines gothischen Thurmes mit einer Gedenktafel ist es dicht neben den Ruinen der alten Burg erbaut und bietet von seiner Plattform herab eine schöne umfassende Aussicht, in deren Kreis auch das Rittergut Haus Busch fällt, – das Gut, wo der letzte Sproß einer Linie des alten Ministerialengeschlechts von Syburg, das so lange die alte Burg da oben hütete, endete und sein neueres Stammerbe seinem Schwiegersohne, dem durch das Denkmal Gefeierten, hinterließ.

Es folgt Herdecke mit dem Kaisberge und der Ruhrbrücke – unglücklichen Angedenkens durch den verhängnißvollen Einsturz im Jahre 1824. Der Kais- oder Kaisersberg trägt seit 1869 das Stein-Denkmal, einen 90 Fuß hohen Thurm, der durch die Bemühungen eines Comités unter dem Vorsitz Harkort's, errichtet wurde. Der Thurm gewährt vielleicht die prachtvollste Aussicht am ganzen Ruhrstrom. Er erhebt sich Angesichts der altberühmten Burg zu Wetter, in deren Mauern Stein vier Jahre lang als Vorstand des märkischen Bergwesens (von 1784–1788) wohnte, und ist das erste Denkmal, welches auf deutscher Erde dem wahrhaft ritterlichen Manne errichtet ward. Das gereicht der Grafschaft Mark und den wackeren Männern, die an der Spitze des Unternehmens standen, zur Ehre!
Herdecke selbst, ein ziemlich düster aussehender Ort, besitzt ein altes hochliegendes Stift, zu dem man mit Treppen aus der Stadt hinaufsteigt. Hat man die Höhe erreicht, so sieht man zunächst vor sich die alte Stiftskirche, rechts davon die reformirte und mehr rückwärts die katholische Kirche. Umher gruppiren sich die Abtei, die Curien der Stiftsdamen und andere Gebäude. Die Stiftskirche, mit einem elenden hölzernen Dachreiter versehen, sieht öde und verfallen aus, auch zeigt sich das Innere sehr verwüstet. Von dem ältesten Bau aus der karolingischen Zeit finden sich keine Reste mehr; die jetzige Kirche bildet eine gewölbte Pfeiler-Basilica ohne Kreuzschiff, etwa aus dem Jahre 1200. Die Sage läßt an der Stelle des Stifts eine heilige Eiche der Hertha sich erheben und »Hertha's Eiche« soll »Herdecke« sein. Leider hat nur J. Grimm gezeigt, daß es keine Hertha, nur eine Nerthus gab. Richtiger mag sein, daß die Stifterin des Klosters Frederuna hieß, auch, daß sie eine Verwandte Karls des Großen war. Eine andere fromme Frau, Alswet, betheiligte sich an dem Werke durch Schenkungen und beide Namen deuten auf alte, wie es scheint, karolingische Zeiten hin. In den frühesten Tagen des Mittelalters wird, wie andere Klosterstiftungen, auch die zu Herdecke ihren wohlthätigen Einfluß zur Verbreitung christlicher Gesittung, Bildung und Humanität ausgeübt haben. In der späteren Zeit aber wurde auch hier aus Frederunens Kloster eine Versorgungsanstalt für die Töchter des benachbarten Adels. Die Fräulein kamen aus den Burgen der wilden Fehde- und Raubritter ins Kloster und blieben mit der Heimath in steter Verbindung. Wie toll es zuweilen herging, zeigt ein von Kindlinger (Geschichte von Volmestein S. 352) aus einer Heessenschen Rechnung vom Jahre 1281 mitgetheilter Ausgabeposten: III Fl. dede ich (der Rentmeister) mynen heren (dem verschwenderischen Diedrich von Volmestein IV.) do he red ... mit Lob. van Varsen und Joh. van Summeren to Horde ... und reden vort den avend to Heyrdecke in dat Closter. Dar vunden se Nevelinghe van dem Hardenberge und Bernd Ovelaker, und Ostinge und Herman van dem Vorste; und bleven drey Nacht to Heyrdecke, und danßeden und tereden in dem Clostere. – Solche Besuche der lustigen Vettern mußten allerdings einen üblen Einfluß auf die guten Klosterfrauen ausüben! – Die Reformation spaltete das Stift in eine lutherische, eine reformirte und eine katholische Abtheilung. Die drei Confessionen bestanden, mit getrenntem Gottesdienste, aber noch immer zu einem Capitel vereinigt, bis zur Aufhebung des Stiftes und bis zur Union von 1826. Die drei Kirchen stehen noch da als ein Denkmal der Religionstrennung und eines Religionsfriedens, wie wir ihn heute kaum noch kennen.
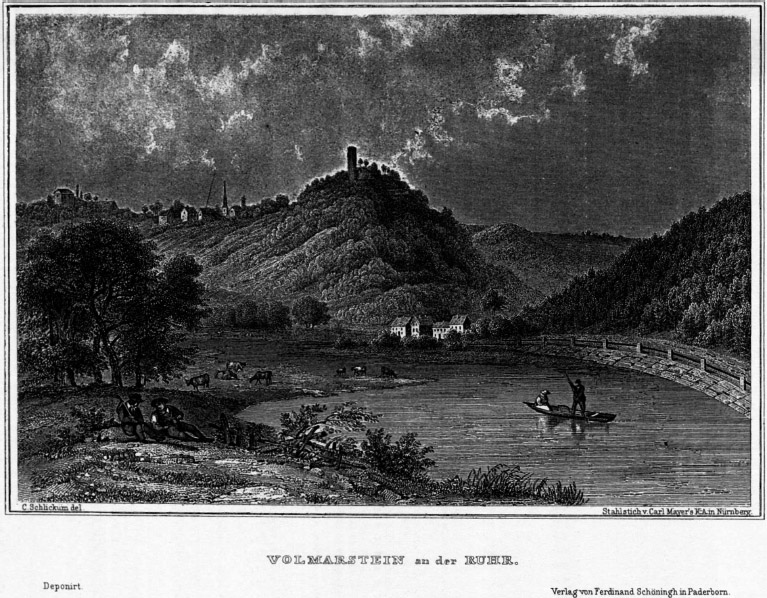
Die Ruhr strömt in silbernen Windungen, rechts die Höhen des Ardeygebirges bespülend und schlägt jetzt ihren Bogen um die Freiheit Wetter, die von dem alten Schloß überragt wird, das, einst eine Burg der Grafen von der Mark, in späterer Zeit ein Amtshaus, heute eine Eisengießerei des Volksmanns Harkort in sich aufgenommen hat. Unmittelbar darauf, Wetter gegenüber und am linken Ufer folgt das schöne Volmarstein.
Volmarstein, in wenigen Trümmern erhalten, steht auf einem Felsen an der Ruhr, da wo ein älteres Bette der Volme gemündet haben muß. Sitz des alten, vielleicht schon altsächsischen Geschlechts der Edlen von Volmarstein, ward es zuerst, wie oben gesagt. 1287, dann, neu erbaut, im Jahre 1324 abermals zerstört. Diese Zerstörung steht im Zusammenhange mit jener Reihe großer Kämpfe in Folge der zwiespältigen Kaiserwahl von Friedrich dem Schönen von Oesterreich und Ludwig dem Bayer, die seit 1314 in Deutschland tobten, und auch hier im nordwestlichen Deutschland ihren Nachhall fanden. Der Graf von der Mark Engelbert II., sonst fast immer mit Heinrich von Virneburg, dem Erzbischofe von Köln, verfeindet, hatte doch mit diesem zusammen zu Friedrich dem Schönen gehalten, der ihm die Schutzherrschaft über Dortmund zugesagt. Als aber der Bayer in der Schlacht bei Ampfing mit Hülfe des tapferen Schweppermann gesiegt, da wandte sich Graf Engelbert auf die Seite des Stärkeren und half dem Kaiser, den Erzbischof Heinrich, der sich in seiner festen Stadt Soest verschanzt hatte, für seine Anhänglichkeit an den Habsburger strafen. So begann er die Fehde gegen des Bischofs treue Vasallen, die Dynasten von Volmarstein. Im Sommer des Jahres 1324 erschien er mit großer Heeresmacht vor Volmarstein und umschloß es mit seinen Schaaren, zu denen als Helfer König Johann von Böhmen, die Grafen von Hennegau, Holland und Berg stießen. Trotz dieser Macht hielt der junge, damals noch minderjährige Burgherr, Theodorich III. die Veste zwei Monate lang bis zum 25. Juli. Weder der Erzbischof Heinrich, noch sein Neffe Ruprecht von Virneburg, der Marschall von Westphalen, die mit Heeresmacht bei Soest und Werl standen, wagten den Entsatz. Am St. Jakobi-Tage zog siegreich der Graf Engelbert in die Burg ein und zerbrach sie. Das ist der kurze Bericht des Zeitgenossen Levold von Northof über das traurige Ende von Volmarstein. Hören wir noch, wie Gert van der Schüren dasselbe nach Northof erzählt: In den Jair duysent CCC ind XXIV up den Maenedag voer unses Hern Himmelfarts Dag bestalde Greve Engelbrecht dat Slott Volmensteyn ind up Sente Jacobs Dag darnae quam hey darinne, und thoebraeck dat. In wulke Belegh de Koning van Bohem unde die Greve van Hennegawen, uit oer selfs Bewegen quamen, ind sy ind oick die Greve van den Berge stonden daer den Greven van der Marke truwelicken by, bis then Ende thoe, ind die Ertzbisschop tho Cölne ind die Greve van Virnenberg lagen disse Tyt lang tho Soist und tho Werle, inde hadden Volmeststein gerne onsatt, hedden sy gekont.
Der lange Widerstand, welchen die Burg der vereinigten Macht eines Königs und mehrerer mächtigen Fürsten leistete, beweist ihre Stärke. Wie die treuen Volmarsteinschen Burgleute und Vasallen sich vertheidigt, welche Proben der Tapferkeit sie abgelegt, welche Noth sie erduldet und wie sie nach oft getäuschter Hoffnung auf Entsatz endlich überwältigt wurden, das wird uns leider nicht berichtet. Levold von Northof, welcher mit dem Grafen Engelbert in enger Verbindung stand und zwei Jahre nach der Begebenheit mit demselben nach Rom reiste, wußte gewiß Manches darüber; aber er ist hier wie in seiner ganzen Chronik trocken kurz, und überläßt es unserer Phantasie, sich die näheren Umstände des tragischen Entscheidungskampfes nach Belieben auszumalen. Die Familie von Volmarstein aber sah sich der Burg ihrer Väter und ihrer alten Herrschaft für immer beraubt. Die Grafen von der Mark konnten zwar die Eroberung nicht sofort in ihr Eigenthum verwandeln, sie ließen aber dieselbe nicht wieder aus den Händen, und wußten später durch Pfandschaften und Kauf sich auch den gehörigen Rechtstitel zu verschaffen.
Das Geschlecht der Volmarsteine bestand nach der Zerstörung der Burg noch gegen hundert Jahre. Es war ein besonderes Glück, daß gerade in dem Augenblicke, als alle Stammgüter verloren gingen, sich Theodorich III. eine Zuflucht auf das Erbe seiner Mutter, der Gostie von Rinkenrode darbot. Die frühere Geschichte Gostiens bietet ein Beispiel von der Habsucht und Gewaltthätigkeit der Zeit und ihrer verkommenen Ritterschaft. Der letzte Rinkenrode, Ritter Gerwin, welcher auf der Burg Heessen bei Hamm wohnte, hatte dort, in Drensteinfurt und der Umgegend sehr ausgedehnte Güter. Gostie war ein einziges Kind und hatte deshalb früh Vieler Augen auf sich gezogen. Ein verwegener Ritter, Bernard Bitter, raubte am Montage vor Johanni 1297, wie uns Northof erzählt, die Jungfrau auf dem Wege von Fröndenberg nach Heessen und vermählte sie seinem Bruder Engelbert, obwohl sie noch Kind war. Der Vater, in Verbindung mit dem Grafen Engelbert von der Mark, griff die Räuber an und erzwang die Herausgabe seiner Tochter. Später gab er sie dem Theodorich II. von Volmarstein als Gemahlin. Jetzt nach Zerstörung der Burg kehrte sie als Witwe mit ihren Kindern nach der Burg ihres Vaters zurück und wohnte zu Heessen oder auch zu Steinfurt. Mit dem Verluste der Herrschaft Volmarstein trat das Geschlecht auch aus dem Range des höheren Adels: die folgenden Volmesteine nennen sich nicht mehr Edelherren ( vir nobilis, dominus). Theodorich III. 1324–1350 war nur Knappe und starb, ehe er zur Ritterwürde gelangte. Sein Sohn Theodorich IV. 1350–1396 ist Ritter. Dieser hinterläßt eine Tochter Neise oder Agnes und einen Sohn Johann 1396–1429. Johann starb kinderlos als letzter des Volmarsteinschen Stammes. Agnes aber vermählte sich mit dem Ritter Godert von der Reck zu Heeren. So gelangte das Geschlecht von der Reck in den Besitz der Rintenrodeschen Güter und dessen, was von den Volmarsteinschen Besitzungen noch geblieben war, der Lehnkammer. Bei v. Steinen ist die noch in späterer Zeit sehr lange Reihe der Reckschen Vasallen zu lesen. Die Nachkommen der Agnes von Volmarstein und des Godert von der Reck existiren noch heute als Grafen von der Reck-Volmarstein. S. Jahresbericht des Gymn. Laurentianum. Arnsberg 1856. Ueber Gerwin v. Volmarstein, den Stifter des Klosters Waldsassen in Bayern C. Bruschius, de Monast. Germ. I. 242.
Das Volmethal, das sich bei Volmarstein mündet, ist reich an Sagen; da ist die Finkinger Lei, eine Felswand mit einer kleiner Höhle, worin einst die Zwerge hausten, treue Hirten und emsige Diener in Küche und Stall für den gegenüberliegenden Finkinghof; einem der Zwerge, der besonders treu sein Vieh gepflegt und gehütet, legte der Hofherr zum Danke einst einen neuen Anzug auf den Pfosten des Hofthores, als jener die Heerde hindurchtrieb; da ward der Zwerg traurig, denn er glaubte, man wolle seiner los sein, nahm den Anzug und entfernte sich und mit ihm verschwanden die Zwerge für immer. – Bei Dahl war einst ein Schloß, Bollwerk geheißen, der Dynastenfamilie von Dale gehörend, die hochnothpeinliches Gericht darin hegte mit spanischer Jungfrau und Verließen voll scharfer Messerklingen: darin hat auch der Blaubart gehaust, ein gar gewaltiger Unhold gegen Nachbarn und Untersassen; noch sind die Ueberbleibsel von Thürmen und Mauern sichtbar. Weiter hinauf im Goldberg bei Hagen hat man in alten Zeiten Gold und Silber gegraben, was eine Lehnsurkunde zwischen Erzbischof Adolph von Köln und Arnold von Altena von 1200 erhärtet. In jener Zeit kam eines Tages ein armes unbekanntes Weib mit einem Säugling, einem wunderschönen Knaben nach Hagen, und des Dorfes Vorsteher nahm sie freundlich auf, gewährte ihr eine Hütte und ließ sogar ihren Knaben, den er lieb gewann, mit seiner einzigen Tochter erziehen. Als der Sohn der fremden Frau nun groß und ein schmucker Bergmann geworden und mit ihm seine Liebe zu des Vorstehers Kind gewachsen war, da entschloß er sich endlich, um das Mädchen bei dem Vater zu werben; der aber versetzte, schnöde seine Armuth höhnend, daß er seine Tochter nur durch einen kostbaren Schmuck aus Gold und Diamanten gewinnen könne. – Das war eine harte Antwort, denn woher sollte der Sohn der fremden armen Frau einen Goldschmuck bekommen? Hoffnungslos ging er an seine Arbeit und befuhr den Schacht und führte das Fäustel – aber sein Arm wurde kraftlos und sein junges Blut stockte in den düstern Felsenkammern vor Traurigkeit. Eines Morgens nun, als er aus seiner Hütte schritt und an einem hohlen Baume vorbeikam, sah er einen Glanz daraus hervorleuchten; er schaute näher hin und – war es ein Traum? da lag das kostbare Geschmeide von Golde strotzend, von Diamanten blitzend, in dem hohlen Baume! – Er nimmt es und stürmt damit zum Vater seiner Geliebten – der wundert sich nicht minder, aber hält sein Wort und verlobt ihm seine Tochter. Nun war ein böser Mensch in Hagen, der Sohn eines reichen Försters; der war des Bräutigams Nebenbuhler gewesen, und als sich das Gerücht von dem Goldschmuck verbreitete, da betheuerte er, das Kleinod seie sein, und brachte zwei Zeugen, die schwuren, daß der Bergmann ihn darum beraubt habe. Das Wahre an der Sache war, daß der junge Förster heimtückisch den Schmuck hatte in den hohlen Baum am Wege gelegt, um seinen Feind verderben zu können. Dieser wurde nun auch verurtheilt; er wird aus einen Scheiterhaufen gebunden, der Holzstoß entzündet, und bald hüllt ihn die Lohe und der Qualm ein, aus dem eine weiße Taube aufflattert und zum Himmel emporsteigt, bis sie den Augen entschwindet.
Darauf verhüllen schwarze Donnerwolken die Luft; wuthschäumend tritt die Mutter des Gemordeten aus ihrer Hütte hervor, einen Korb voll Mohnsaamen auf ihrem Haupte, um das die wildaufgelösten Haare flattern; so schreitet sie durch den niedergießenden Regen eines furchtbaren Gewitters den Goldberg hinan, geht drei Mal im Kreise um den Hügel und spricht dabei zu dreien Malen einen schrecklichen Fluch aus: verfluchtes Gold, das meinen Sohn gemordet, sei verwünscht in den Abgrund, soviel tausend Jahre als Mohnkörner auf meinem Kopfe sind! Und bei den letzten Worten stürzt sie den Korb und dann sich selbst in den Schacht hinab: aus dem fahren rothe und blaue Flammen empor, die Erde erbebt und Schacht und Stollen stürzen donnernd zusammen. Seitdem ist jede Spur von Gold daraus verschwunden.
Von Volmarstein an weiter hinab zeigt uns die Ruhr eine Reihe wenig wechselnder aber heiterster und anziehendster Landschaftsbilder. An Malinkrodt, dem Stammhaus des alten Geschlechts, das nach ihm sich nannte, an Hove vorbei, strömt sie nach Witten, NachtragWitten war bis zum Untergange des deutschen Reichs eine unmittelbare Reichsherrschaft, deren erste Begründung vielleicht schon in die Römerzeiten fällt. Die älteste Straße vom Rhein gen Osten, der Hellweg, Heerweg, ging bei Witten über die Ruhr, und den Flußübergang schützte schon sehr frühe jedenfalls eine Befestigung. Der Besitzer der Herrschaft Witten hatte sie zu erhalten und zu schirmen; daraus erklärt sich die Ausstattung mit reichem Besitz und vielen Rechten, deren die auf dem Hause Berge sitzenden Grundherren, (von Witten, von Stael, von Brempt, von der Recke) genossen. Das Haus Berge, ein stattlicher Gebäude-Complex liegt unterhalb der Stadt Witten auf einem Felsen 50 Fuß über der Ruhr, am rechten Flußufer. Es waren nicht weniger als 20 Rittersitze und noch 6 Mannlehen damit verbunden, deren Insassen wohl ursprünglich unter die Herren von Witten als Mannschaft zum Schutz und Schirm des Ruhrübergangs gestellt worden. Die Bewohner der Herrschaft waren freie Reichsleute und mit vielen Privilegien begabt. – Sehenswerth ist in Witten der unmittelbar an der Ruhr liegende schöne und große Lohmann'sche Park, dessen Anlagen sich an den Ruhrbergen hinaufziehen, bis empor zum »Helenenthurm«, einem ausgezeichneten Aussichtspunkte. das hart am rechten Ufer liegt, einst eine Burg und Freiheit derer von Witten, jetzt ein großer, reger Fabrikort; fast gegenüber zur Linken auf der Höhe das Gut Steinhausen, in Gartenanlagen und Gebüschen, eine reizende neidenswerthe Besitzung; das weißglänzende Herrenhaus liegt auf der Stelle einer Burg, die von den Edlen von Witten erbaut und im 15. Jahrh. von den Dortmundern zerstört worden ist: Anno 1434, heißt es in der Dortmunder Chronik, hadde wy van Dortmundt 12 Leddern-Wagen und voeren dahmit over de Ruhr wol mit 700 Man und 50 Ruiters und braken Herrmann von Witten dat Steenhueß nedder. – Danach kam Steinhausen an die Familie Stael von Holstein, von dieser an die Freiherrn von Elverfeldt. Hinter Steinhausen erblickt man, versteckt von einer Bergwand, unten am Ufer, fast vom Flusse bespült, die malerischen Trümmer von Hardenstein, einem Rittersitze derer von Hardenberg, von ihnen ebenfalls an die Stael von Holstein übergegangen, die aber bald von dort Steinhausen bezogen. – Ueber den einstigen räthselhaften Bewohner Hardensteins mag hier folgen, was Gobelin Persona über ihn in seinem Cosmodromium erzählt: zur Zeit Kaisers Wenzeslaus hat sich ein Erdmängen, welches sich König Goldemer nennete, einem gewissen Manne, welcher mit nichts, als weltlichen Händeln beschäftigt war, Namens Neveling Hardenberg Neveling von Hardenberg kommt in Urkunden 1396–1419 vor; er war der vorletzte Herr des alten Geschlechts, das auf Hardenstein wohnte., aus der Grafschaft Mark bürtig, und unweit der Ruhr auf einem Schlosse wohnhaft, vertraulich zugesellet. Besagter Goldemer redete mit ihm und andern Menschen, er spielete sehr lieblich auf Saitenspiel, imgleichen mit Würfeln, setzte dabei Geld auf, trank Wein und schlief oft bei Neveling in einem Bette. Als nun viele, so wol Geist- als Weltliche, ihn besuchten, redete er zwar mit allen, aber also, daß es besonders den Geistlichen nicht immer wohl gefiel, indem er durch Entdeckung ihrer heimlichen Sünden dieselbe oft schamroth machte. Neveling, welchen er Schwager zu nennen pflegte, warnete er oft für seinen Feinden, und zeigete ihm, wie er deren Nachstellungen entgehen könnte. Auch lehrete er ihn, sich mit diesen Worten zu kreuzigen und zu sagen: Unerschaffen ist der Vater; Unerschaffen ist der Sohn; Unerschaffen ist der Heilige Geist. Er pflegte zu sagen: die Christen gründeten ihre Religion auf Worte, die Juden auf köstliche Steine, die Heiden auf Kräuter. Seine Hände, welche mager, und wie ein Frosch und Maus, kalt und weich im Angrif waren, ließ er zwar fühlen, keiner aber konte ihn sehen. Nachdem er nun drey Jahr bei Neveling ausgehalten hatte, ist er, ohne jemand zu beleidigen, weggegangen. Dieses habe ich zu der Zeit von vielen gehört, nach 26 Jahren aber von Neveling selber verstanden. Es hatte aber Neveling eine schöne Schwester, um welcher willen viele argwohnten, daß sich dieses Erdmängen bei ihm aufgehalten hatte.
Eine fernere Nachricht über König Goldemer theilt v. Steinen, der sie bei Reiner von Laer, in dessen Familiengeschichte fand, mit; darin heißt es:
Von dem Hause Hardenstein wird die heydnische Fabel erzählt, daß sich vorzeiten ein Erdmängen aufgehalten; welches sich König Volmar genennet und diejenige Kammer bewohnet hätte, welche von den heydnischen Zeiten an bis auf den heutigen Tag Volmars Kammer heißet. Dieser Volmar mußte jederzeit einen Platz am Tische und einen für sein Pferd im Stalle haben, da denn auch jederzeit die Speisen, wie auch Haber und Heu verzehret wurden, von Menschen und Pferde aber sahe man nichts als Schatten. Nun trug es sich zu, daß auf diesem Hause ein Küchenjunge war, welcher begierig seyende, diesen Volmar, wenigstens seine Fußstapfen, zu sehen, hin und wieder Erbsen und Asche streuete, um ihn solchergestalt fallend zu machen. Allein es wurde sein Vorwitz sehr übel bezahlet; denn auf einen gewissen Morgen, als dieser Knabe das Feuer anzündete, kam Volmar, brach ihm den Hals und hieb ihn zu Stücken, da er die Brust an einen Spieß steckte und briet, etliches röstete, das Haupt aber nebst den Beinen kochte. Als der Koch bey seinem Eintritt in die Küche dieses erblickte, wurde er sehr erschrocken und durfte sich fast nicht in die Küche wagen. Sobald die Gerichter fertig, wurden solche auf Volmars Kammer getragen, da man denn hörete, daß sie unter Freudengeschrei und einer schönen Musik verzehret wurden. Und nach dieser Zeit hat man den König Volmar nicht mehr verspüret, über seiner Kammerthür aber war geschrieben: daß das Haus künftig so unglücklich seyn solte, als es bishero glücklich gewesen wäre, auch daß die Güter versplittert und nicht ehnder wieder zusammen kommen sollten, bis daß drey Hardenberge von Hardenberg im Leben sein würden. Der Spieß und Rost sind lange zum Gedächtniß verwahret, aber 1651, als die Lotharinger in diesen Gegenden hauseten, weggeplündert worden, der Topf aber, der auf der Küche eingemauert ist, ist noch vorhanden. – Steinen fügt diesem hinzu: »Ich habe den Topf, in welchen ohngefähr 4 Maaß gingen und welcher von gelbem Metall, aber unten zerbrochen war, selber auf der Abtei zu Fröndenberg gesehen, als ihn die verwitwete Frau von Laer, geborene von Keppel, für etlichen Jahren von Hardenstein weg und mit sich nach Holland nahm.« Die Abbildung, welche Steinen davon liefert, zeigt jedoch keinen Kochtopf, sondern einen Bierkrug mit Henkel, also jedenfalls ein sehr apokryphes Gefäß. Wir müssen überhaupt bemerken, daß Reiner von Laer, der die Geschichte seiner Familie in Quart 1679 im Haag herausgab, nicht allerdings ein zuverlässiger Schriftsteller ist: dieß zeigt sich schon durch die von ihm entworfene Ahnentafel, an deren Spitze er höchst ungenirt Minister König Philipp August's von Frankreich, Präsidenten des Gerichtshofs der Provence, Bischöfe von Marseille und andere hohe Personen grauer Urzeiten stellt. Die Familie von Laer war eine Zeitlang im Besitze des Hardensteins, und ist später in Holland ausgestorben.
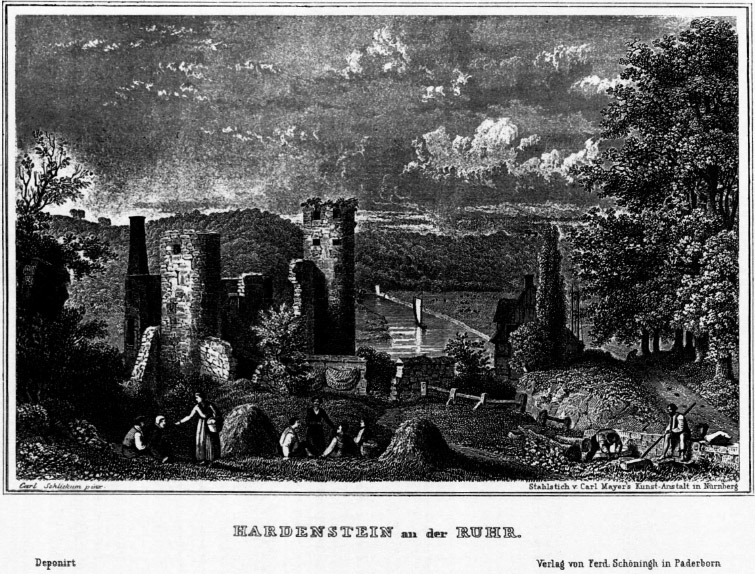
In der Nähe von Hardenstein liegt eine jener Zechen, welche in so großer Menge den Kohlenreichthum des Ardeys und der Ruhrufer ausbeuten und auch ohne Erzadern und Stufen Goldminen für das ämsig betriebsame Land sind. Von Witten an wird die Ruhr schiffbar, und trägt auf Wimpelflatternden Fahrzeugen den Reichthum ihrer Gestade in vielen Millionen Centnern dem Rhein, dem Westen und Süden Deutschlands und den Niederlanden zu; diese Barken, die Kohlendepots, die Eisenhämmer und andre Anlagen einer großartigen Industrie machen von nun an bis zur Mündung bei Ruhrort den Fluß zur Pulsader eines bewegten lauten Lebens. Zunächst in der lieblichen Landschaft von Hardenstein bis Hattingen; man kommt an Herbede vorüber, sieht weiter unten im Thale auf frischen Wiesenflächen die Burg Kemnade, um 1008 von einer Gräfin Imma von Stypel erbaut, dann Sitz derer von Kemnade, rechts das Dörfchen Stypel mit Gärten, Baumgruppen und idyllischem Kirchthurm malerisch auf dem Hang des Berges gelagert, links endlich die Ruinen von Blankenstein, einen festen hohen Thurm und niedre Ringmauertrümmer. Neben den Ruinen, hoch oben auf der Bergfläche liegt der freundliche Flecken Blankenstein; vor ihm auf dem Terrain, das von den schmucken Wohnungen bis an den Rand des abschüssigen Berghanges, welchen unmittelbar die Ruhr bespült, sich dehnt, ist mit sinnigem Geschmack eine Gartenanlage geschaffen, welche wie selten eine andre die Natur begünstigte. Es ist der Gethmannsche Garten mit seinen Grotten und Hügeln und Belvederes, 250 Fuß hoch über dem rauschenden Strom, der sich unten durch das breite ausgedehnte Thal schlängelt, daß man fast Stundenweit hinauf und hinab seinem Laufe folgen kann. Die Berge umher sind reich bewaldet oder bebaut, unten die saftigsten Wiesengründe, im Flusse schäumende Wehren, Schleusen mit Pappelgruppen, tosende Stahlhämmer, eine Eisenbahn für die nahe Karl-Friedrich-Zeche, rechts auf der nahen Höhe die Ruinen von Blankenstein, in der Ferne die Trümmer von Altendorf, des Klyffs, Hattingen und der Isenberg. Das Schloß Blankenstein ward im Jahre 1227 von Ludolph von Boenen, dem schon früher genannten Vasallen der Grafen von der Mark erbaut. Als Friedrich von Isenberg's That durch Heinrich von Molenark, den Nachfolger auf dem Stuhle des heiligen Engelbert, gerächt war, verlieh dieser, wie wir schon oben erwähnten, des Mörders Land und Leute an Adolph von Altena; für ihn baute aus den Trümmern der geschleiften Burg auf dem Isenberg der Ritter von Boenen den Blankenstein, den wir mehrere Jahrhunderte hindurch von Burggrafen und Drosten, zuweilen auch von den Landesherrn selbst bewohnt finden. Im Jahre 1664 wurde die Veste nach dem Willen des neuen Landesherrn, des Churfürsten von Brandenburg, eingerissen. Unterhalb Blankenstein fließt die Ruhr träger an den Trümmerspuren der Burg Ruendael vorüber, gebaut von den von Hardenberg, 1287 von den Grafen von der Mark zerstört; in dem Thalgrunde umher soll es nicht geheuer und einst Crodo verehrt worden sein; das aus Stein gemeißelte Haupt des Gottes, das hier gefunden ward, wird in Bonn aufbewahrt: im Jahre 1803 wurde eine altgermanische Grabstätte mit vielen Urnen, Gebeinen, Geschirren und Waffenstücken entdeckt, als man eine neue Kohlenniederlage bereitete. Links, dem Ruendael gegenüber liegt das Haus Bruch; dann folgt die Ruine des Klyffs, Cliv's ( clivis), im vorigen Jahrhundert erst dem Verfall überlassen, unmittelbar danach das freundliche Städtchen Hattingen, lebhaft, gewerkthätig, nach dem Fluß hinab sich drängend, als wolle es den Ruß seiner Kohlenöfen in den blinkenden Wellen abwaschen. Hattingen wird schon im 10. Jahrh. als ein Reichshof genannt; Kaiser Heinrich II. schenkte ihn im 11. Jahrh. der Abtei Deutz; auch die Burg Klyff ging bei dem Abte von Deutz zu Lehen. Sonst ist von Hattingen noch zu berichten, daß es im 30jährigen Kriege gewaltige Feldherren aufzunehmen hatte, 1622 den Spanier Don Gonzalez Fernando de Cordua und 1625 Tilly. Das Thal weitet sich bei Hattingen, die Berge am rechten Ruhrufer werden flacher, und sinken zu Hügeln herab; nur die Höhen des linken behalten steilere Wände; auf einer derselben, unterhalb der Stadt, liegt die Ruine der Isenburg, der einstige Sitz der Altenaischen Nebenlinie, den nebst Nienbrügge an der Lippe der entsetzte Erzbischof Adolph I. von Köln, des Altenaer Grafen Engelbert I. Sohn, am Ende des 12. Jahrh. erbauete oder neu befestigte und seinem jüngeren Bruder Arnold gab, der sie auf seinen Sohn Friedrich vererbte. Nach Friedrichs Mordthat belagerten die Kölner Stiftsmannen die Veste im Jahre 1226; Friedrich hatte des Reiches Acht und der Bann auf heimlichen Pfaden nach Rom und in die Irre getrieben und seine für unbezwinglich geltende, wohlbesetzte Burg wurde genommen, verbrannt und die Besatzung gehängt. Ueber die Beschaffenheit des Bau's finde ich folgende Nachricht: das Schloß bestand aus zwei Gebäuden; das erste, die untere Burg hatte acht Thürme mit breiten Steinmauern und Wohnungen für 400 reisige Knechte, Ställe für die Rosse u. s. w. Von dieser Unterburg stieg man über fünfzehn Treppen, durch einen gewaltigen Thurm mit Zugbrücke und Fallgatter zur obern Burg, des Schloßherrn Wohnung, die vier Thürme flankirten, einer vorn an der Fronte beschützte; dieser, gen Norden gerichtet, deckte auch den einzigen Zugang, der über die Zugbrücke vor demselben führte: tiefe Gräben umzogen die Ringmauern. Auch in diesem Gebäude fanden über 400 Menschen Raum; aus seinen Hallen sah man über die ganze Ruhrgegend fort. In der Mitte zwischen beiden Häusern lag der Brunnen, wie die Keller tief in den Felsen gehauen; trocknete anhaltende Dürre ihn aus, dann mußte man zum Wasserschöpfen 214 Stufen von der untern Burg zur Ruhr hinab. – Es ist heute jedoch sehr schwer, sich im Geiste diesen alten Prachtbau von einer Fürstenburg des zwölften Jahrhunderts wieder aufzurichten und sich ein Bild des alten Zusammenhangs der Bautheile zu machen. Nur so viel ist klar, daß das Ganze sich auffallend langhin erstreckte, gewaltig in seinen Verhältnissen war und in einem ungeheuren Bergfried gipfelte – die umher liegenden Trümmer desselben gleichen zerrissenen Felsblöcken.
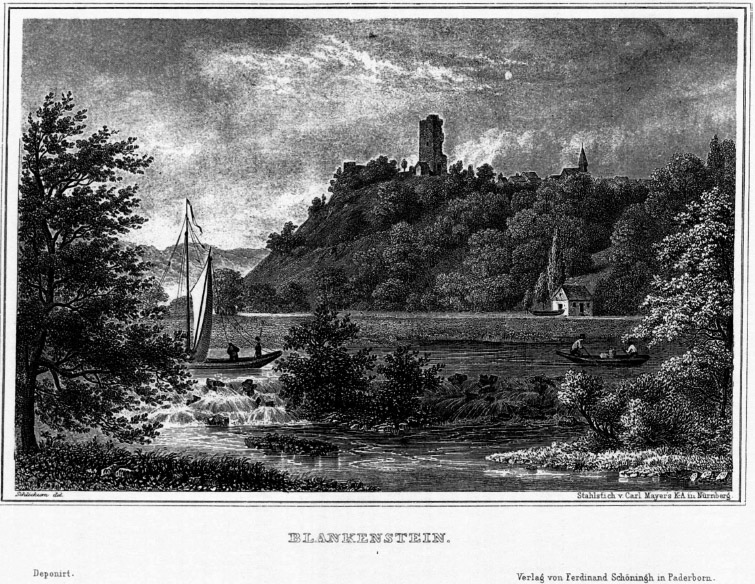
An der Stelle der alten Dynastenherrlichkeit winkt dem Wanderer, der den Isenberg ersteigt, jetzt gastlich ein bürgerlicher Wirthshausbau mit Aussichtthurm und Balcon.
Unterhalb Hattingen, rechtsab, auf dem rechten Ufer der Ruhr und dem Wege nach Dahlhausen liegt der Horkestein; man thut diesem alten Block wohl nicht zu sehr Unrecht, wenn man ihn für einen Opferstein unsrer heidnischen Väter ausgibt und in den noch erkennbaren Einkerbungen desselben die Rinnen erblickt für den Abfluß des Blutes, der Himmel weiß welcher hingeschlachteten Geschöpfe Gottes. Was Hork, Horken bedeutet, ist bis jetzt noch nicht enträthselt.
Wir kommen an Berghügeln, deren Gipfel einst fast sämmtlich Burgen, Sitze ausgestorbener Geschlechter trugen, entlang (Bruch, Horst, Altendorf) über die alte Grenzscheide der Grafschaft Mark nach Steele, das einst dem kleinen (2 Quadratmeilen großen) Gebiete der Abtei Essen gehörte. Aus den Tagen der Klosterherrschaft besitzt es das ansehnliche Schloß, das im Jahre 1761 und den folgenden Franziska Christina, des heil. Röm. Reichs Fürstin und Abtissin der kaiserlichen freiweltlichen Stifter Essen und Thorn, geborne Pfalzgräfin bei Rhein und Herzogin in Bayern, die Schwester Karl Theodors von Pfalz-Bayern, erbauen ließ. Ursprünglich dem Jesuitenorden bestimmt, wurde der Bau, da bei seiner Vollendung der Orden der Gesellschaft Jesu aufgehoben war, den katholischen Waisen des Stifts gewidmet und ist jetzt vielleicht das schönste Waisenhaus, welches Deutschland besitzt; es enthält Räume für 120 Zöglinge. Die Hülle der edlen Stifterin ruht in der Kirche ihrer Schöpfung, die ihr Testament zu ihrer Universalerbin einsetzte. Das Städtchen Steele ist auf dem Grunde eines alten Oberhofes entstanden, auf welchem schon 924 Kaiser Otto I. eine Reichsversammlung – » universalis populi conventus« – abhielt. Es folgt Rellinghausen, in seiner Nähe die Burg Baldenei, eine zweite in Trümmer liegende Isenburg, wie die obere einst Sitz Friedrichs von Isenburg, wenn ihn seine Schirmvogteirechte in die Nähe von Essen führten, und das Schloß Schellenberg. Auf Baldenei saßen die von Leyte, Schirmherrn von Rellinghausen, Erbkämmerer von Essen und Erbmarschälle von Werden; auf Schellenberg aber saß eine Linie der Vitinghof, genannt Schell zu Schellenberg.
Wir verlassen die Ruhr hier, um einen Blick auf das eine Stunde landeinwärts liegende Kohlenstaubgeschwärzte Essen zu werfen, die Stadt der hochragenden dampfumwirbelten Essen. Esse oder Asse ist Esche; diese Namen trug vor tausend Jahren in der ursprünglichern Form Assinde oder Essende ein Oberhof, dessen Anerbe Alfred sich dem geistlichen Stande widmete und ins Kloster Corvey eintrat, aus dem er zum Bisthume von Hildesheim gelangte. Auf seinem väterlichen Hofe erbaute er ein steinernes Kirchlein, dem hl. Quintinus gewidmet, das vor Jahren abgebrochene »Quintinchen« dicht an der heutigen Stiftskirche; und daneben errichtete er ein Frauenkloster nach Sanct Benedicts Regel, dessen erste Vorsteherin seine Schwester Gerswinda wurde. Als 873 der neuerbaute Dom zu Köln geweiht und dabei eine Synode gehalten wurde, las Bischof Alfred der Versammlung dort die Stiftungsurkunde vor, die uns in einer Abschrift aus dem 10. Jahrhundert noch erhalten ist. Und da diese Synode am Tage der Martyrer Cosmas und Damianus gehalten wurde, gab der Bischof diese Heiligen seiner Stiftung zu Patronen. Das ursprüngliche Kloster lag auf der südöstlichen Seite der Stadt in der Nähe des Brunnens, der noch jetzt der Alfredsbrunnen heißt. Nachdem Alfred 877 in Essen gestorben, ward er, wohl auf sein Verlangen, unter dem »krausen Bäumchen«, einer uralten Linde, in der Nähe von Rellinghausen beigesetzt. – Als das Stift ungefähr 50 Jahre bestanden und Abtissin die Schwester König Heinrichs I., des Städtegründers war, Agina oder Hagona nennt sie eine lateinische Chronik, ließ diese zum Schutz wider die Ungarneinfälle, in denselben Tagen, worin auch Soest sich ummauerte, das um die Klosterstiftung entstandene Dorf Assende oder Essen mit Mauer und Pfahlhecke umgeben; das war der Anfang der Stadt, die also mit Soest die älteste Westphalens ist. Als erste Abtissinnen werden aufgeführt Gerswinda, Adelwiff, Gerswinda II., Pinnusa, Agina und Ludgardis, beide Töchter Otto des Erlauchten von Sachsen und Schwestern König Heinrichs I., Gerberge, Tochter Heinrichs I., Hattwigis und ferner Adelheid, die Tochter Kaiser Otto's I. und jener italienischen Königstochter Adelheid, die Kaiser Otto sich von seinem romantischen Zuge in's Lombardenland heimgebracht.
In den Tagen, als diese letztgenannte Kaiserstochter zu Essen Alfreds Stift regierte, geschah es, daß in dessen Mauern ein junges Herz sich bergen mußte, um eine Leidenschaft zu vergessen, die den strengen Eltern zu wenig geborgen geblieben war. Die Novize war Mathilde, die Nichte der Abtissin, Kaiser Otto's II. und der griechischen Prinzessin Theophanie Tochter. Theophaniens Günstling am Kaiserhofe zu Aachen war der Pfalzgraf Ezzo, der Sieger über den übermüthigen Frankenkönig Lothar, ein Mann von glänzenden Eigenschaften im Kriege wie im Frieden. Mathilde liebte Ezzo; er nährte die gleiche Leidenschaft, er hatte sie ihr gestanden, und beide hatten vergessen, daß eine tiefe Kluft sie trenne; damit sie ihrer inne werde und sich eines Besseren besinne, hatte Theophanie ihre Tochter der Tante Abtissin gen Essen zugesendet. Diese that, was in ihrer Macht stand, sie durch Gebet und strenge Zucht zu heilen – doch wie es scheint so vergebens, daß des armen Kaiser-Kindes Glück um nichts gemindert war, als sich plötzlich in eigenthümlicher Weise sein Schicksal wendete. Kaiser Otto III., Mathildens gekrönter Bruder, war ein Freund des Schachspieles und Ezzo war oft sein Partner. Einst waren sie drei Partieen eingegangen und dabei sollte der Preis für Ezzo, wenn er sie gewinne, die Gewährung jeder Bitte sein, die er vom Kaiser verlange.
»Drei Spiele laß uns spielen, seit Monden spiel ich sie,
Und spielte schon mit Vielen und traf den Meister nie.
Kannst Du mich drei Mal schlagen, gewinnen Spiel um Spiel,
Will ich Dir nichts versagen und wär' es noch so viel.
Das liebste Pfand erdenke, wonach das Herz Dir ringt,
Wie gern ich es Dir schenke, wenn mich Dein Spiel bezwingt!«
Da schlug das Herz dem Grafen: er wußt' ein liebes Pfand –
Gar selten ließ ihn schlafen, daß es so hoch ihm stand.
Herrn Otto saß zu Essen sein Schwesterlein Mathild,
Die konnt er nicht vergessen, noch sie des Jünglings Bild.
Erwerben nimmer mocht er, als ein geringer Graf,
Die edle Königstochter, das scheucht' ihm so den Schlaf.
Zwar darf er jetzt nicht trauern, denn Hoffnung ist genug;
Der König schiebt zwei Bauern voran im ersten Zug.
Doch nimmt vielleicht die Stunde sein Glück, sein Leben hin;
Da zog er aus dem Grunde hervor die Königin.
Er hätte gern geblutet für sie im Schlachtensturm;
Da raubt er unvermuthet dem König seinen Thurm.
Für sie dem kühnsten Kaufer sich in den Weg gestellt;
Da nahm er auch den Laufer und rückt' ihm scharf ins Feld.
Für sie im tiefsten Zwinger erlitten Ungemach;
Da schlug er gar den Springer und bot ihm Schach auf Schach u. s. w.
Und das Glück stand so ihm bei bis an's Ende. Da jubelte sein Herz, in sein Auge traten die Thränen der Freude, und vor allen Rittern des Hofes sprach er es aus, was er verlange. Die Chronik, die uns diese wahre Geschichte erzählt, hat uns die Mienen Otto's und der stolzen im Purpur geborenen Kaiserin-Mutter nicht beschrieben, die sie bei diesem hochfliegenden Verlangen des jungen Mannes gemacht. Wir wissen nur, daß Theophanie ihren Sohn bestimmte, an seinem kaiserlichen Worte nicht zu deuteln und zu mäkeln. Der Pfalzgraf aber sprengte mit einem Schildknappen von dannen in das Waldesdunkle Land der Westphalen; er kam vor der Klosterpforte an, als die Morgensonne sich erhob und die frommen Jungfrauen aus der Frühmesse heimkehrten. Im Namen des Kaisers verlangte er Einlaß. Er hatte ja einen Brief des Kaisers an die Frau Abbatissa, und während er sein im Spiel gewonnenes Kaiserkind jubelnd umarmte, mußte die Abtissin widerstrebend einwilligen, sie als seine Braut mit ihm ziehen zu lassen in die Kaiserpfalz zu Aachen. Beide wurden später die Stifter der berühmten Abtei Brauweiler.
Auf die Abtissin Adelheid folgte Mechtildis II., Kaiser Otto's I. Tochter, die Stifterin des freiadlichen Stifts Rellinghausen, das eine Pröpstin aus dem Mutterstift Essen verwaltete und das ganz nach dessen Regel lebte; sie starb 997. Ihr folgte Sophia, die Tochter Heinrichs II. und dieser Theophanie, Tochter des großen Schachspielers, des Pfalzgrafen Ehrenfried oder Ezzo, dem seine Gattin Mathilde noch den Sohn Herimann, der Erzbischof von Köln und die Tochter Richeza, welche Königin von Polen wurde, geschenkt hatte. Theophanie, nach der griechischen Großmutter genannt, baute die Krypta der Stiftskirche und starb 1060.
Wir sehen also, in diesen ersten Jahrhunderten ist die Abtei Essen eine Art Hauspfründe für die Töchter des Sächsischen Kaiserhauses.
Neben dem Zuwachs an reichen Besitzungen der Abtei, besonders am Niederrhein, bilden die Verhältnisse zu den verschiedenen Schirmvögten den Gegenstand, um welchen sich die Geschichte der Stiftung bewegt; dabei tritt ganz besonders als Quälgeist und Dränger der schlimme Friedrich von Isenburg, den wir in Iserlohn kennen lernten, hervor – seine Verhältnisse zu Essen legten den Keim, aus dem sein tragisches Schicksal sich entwickelte. Nach seinem Tode ließ sich die Abtissin mit der Vogtei selbst belehnen; es war der erste Schritt zur reichsfürstlichen Würde. Mit dem Anfange des 13. Jahrhunderts vollzog sich zugleich die Umwandlung des eigentlichen Klosters in ein freiweltliches Stift; während Kaiser Heinrich schon 1231 die Abtissin princeps abbatissa nannte, findet sich in einer päpstlichen Bulle von 1247 der Ausdruck saecularis ecclesia Essendiensis. Die unvermeidlichen Streitigkeiten mit der aufblühenden Stadt erfüllen die Zeit des 14. Jahrhunderts und ziehen sich durch alle folgenden; die Stadt stützte Ansprüche auf die Reichsunmittelbarkeit, die ihr schon Kaiser Karl IV. 1377 zuerkannt hatte, auf vielfache kaiserliche Privilegia. Dann kamen die durch die Reformation erzeugten Reibungen; damals soll eine der Abtissinnen die neue Lehre angenommen, sich mit dem Bürgermeister verheirathet haben und in der lutherischen Kirche beigesetzt sein. Der Streit, den das Stift um die Landeshoheit mit der Stadt führte, konnte sich jetzt nur noch verschärfen und verbittern. Daraus erklärt sich denn auch wohl, daß die Fürstinnen von Essen – obwohl der Reichthum des Stifts so groß war, daß er für die Aufnahme von 52 Stiftsfräulein und 20 Stiftsherren ausreichte, – doch wenig Freude an der Residenz in der Stadt fanden und nicht für einen ihrer würdigern Wohnsitz dort sorgten. Das noch vorhandene Abtei- (jetzt Gerichts-)Gebäude ist 1691 nothdürftig ausgebaut und seitdem ist nichts Bedeutendes mehr dafür geschehen. Die letzte Fürstin lebte am Hofe ihres Bruders, des Churfürsten von Trier, und zu Schönbornslust bei Coblenz. Neue Nahrung fand der lange Streit zwischen Stift und Stadt durch das Urtheil des Reichskammergerichts von 1670, wodurch der Fürstin die Landeshoheit zuerkannt wurde, während der Bürgerschaft so viele Rechte und Befreiungen z. B. von der Huldigung und von Steuer und Schatzung, vorbehalten blieben, daß die Stadt von nun an allerdings aus der Reihe der Reichsstädte gestrichen, aber denjenigen Städten zugesellt war, welche man civitates mixtae nannte, Freistädte unter einem Landesherrn. Essen behielt z. B. alle niedre und hohe Justiz, nur blieben der Fürstin das Begnadigungsrecht, die Bestätigung der Todesurtheile und deren Vollstreckung durch den fürstlichen Scharfrichter. Dagegen wurde das Richtschwert auf dem Rathhause bewahrt; und als Fürstin Cunigunde, die letzte dieser regierenden Frauen, um 1787 versuchte, ein neues Beil mit ihrem Namenszuge darauf einzuführen, erfolgte lauter Protest von Seiten der Stadt.
Die erwähnte Fürstin Cunigunde, geborne Prinzessin in Polen und Litthauen und Herzogin zu Sachsen starb 1826 zu Wien, nachdem das Hochstift säcularisirt und am 3. August 1803 in preuß. Landeshoheit übergegangen war. Als seit 1806 zu Gunsten Joachim Murats von Napoleon aus den Ländern Cleve und Berg ein Großherzogthum Berg geschaffen worden, hatten die französischen Machthaber wegen alter Rechte, welche Cleve auf die Stifter Essen, Werden und Elten besessen haben sollte, diese letztern zu dem neuen Staate geschlagen und seitdem ist Essen administrativ von Westphalen getrennt und dem bergischen Lande zugetheilt geblieben. –
Das Münster zu Essen, eine der für die Kunstgeschichte merkwürdigsten Kirchenanlagen, besteht eigentlich aus zwei Kirchen, der des heil. Johannes des Täufers und der Hauptkirche, welche durch einen Zwischenhof mit kleinen Säulenhallen an den Seiten verbunden sind. Das eigentliche Münster, erbaut in den Jahren 1265–1316, ist eine dreischiffige Hallenkirche, die so wie der Chorabschluß gothisch ist, während die Kreuzarme und die Krypta romanisch sind – der östliche Theil der Krypta ist zudem von merkwürdiger, höchst alterthümlicher Architektur.
Der westliche Anschluß an das Mittelschiff der Kirche, das ursprünglich für die Stiftsdamen bestimmte Chor, zeigt große Aehnlichkeit mit der Anlage des karolingischen Münsters zu Aachen, es trägt in hohem Grade zu dem fremdartigen und phantastischen Eindrucke, den das ganze Bauwerk macht, bei. Im Aeußern wird dasselbe durch einen achtseitigen Oberbau überstiegen, der gleichfalls dem Münster zu Aachen nachgebildet und um so interessanter ist, weil einige Theile hier in ihrer Ursprünglichkeit erhalten sind, während sie in Aachen im 12. und 13. Jahrhundert verändert und entstellt wurden.
Die Kirche in Essen verdient in hohem Grade eine gründliche Restauration.
Das Münster besitzt eine »goldene Kammer« mit reichen alten Kirchengeräthen von interessantester Arbeit, darunter eine 14 Pfund schwere Monstranz, einen großen Leuchter vom Jahre 998, ein »goldenes Evangelienbuch«, ein großes Schwert mit einer von Goldplatten überzogenen Scheide und werthvolle Paramente. –
Essen selbst ist eine häßliche Stadt, der nur die vor ihren Thoren liegenden villenartigen Häuser reicher Industriellen einigen Schmuck geben. Sie ist so schwarz vom Kohlenstaub wie London von seinem Nebelqualm. Der Bergbau auf Kohlen, dessen Mittelpunkt Essen ist, wird schon um 1317 erwähnt; von 1663 an läßt sich in den Urkunden des städtischen Archivs seine Entwicklung verfolgen; von der Einführung der Dampfmaschinen an beginnt sein riesenhafter Aufschwung, den schon die Schiffbarmachung der Ruhr wesentlich gefördert hatte, eine Unternehmung, welche, unmittelbar nach dem siebenjährigen Kriege von einem Schullehrer und Berggeschworenen J. G. Möser in Blankenstein angeregt und betrieben, im Jahre 1780 zur Beschiffung der Ruhr mit Kohlennachen bis Hardenstein gelangte und dann mit zäher westphälischer Ausdauer viele Jahre hindurch fortgesetzt, endlich durch die energische Theilnahme des Oberpräsidenten v. Vincke vollendet und durchgeführt wurde. Ist aber die Ausbeutung des Kohlenreichthums der Gegend um Essen zu riesenhaftem Aufschwunge gediehen, noch riesenhafter erscheint uns die Ausbeutung der Maschinenkräfte, welche mit dieser Kohle genährt werden – in dem weltberühmten Industrie-Colosseum, welches an der Westseite von Essen liegt, in der größten aller Fabriken, welche menschliche Betriebsamkeit geschaffen hat – in dieser merkwürdigen Anstalt, wo wie im Mittelalter sich das Handwerk mit der Kunst, so heute die Fabrikation sich auf's engste mit der Wissenschaft verbindet und verschmilzt. Wir brauchten den Namen des Schöpfers dieser Anstalt nicht zu nennen, die Welt kennt ihn; aber wir wollen ihn nennen, um einmal in diesem Buche, in welchem so viel die Rede gewesen von den alten Kaisern und ihrer oft so melancholischen Herrlichkeit, auch die frohe Herrlichkeit unsres neuen glorreichen Kaisers und seines Kanzlers erwähnen zu können und zu sagen: wo man die großen Namen von 1870 und 1871 nennt, da muß man auch den Namen Krupp's nennen; des Mannes, dessen Energie, Ausdauer und Scharfsinn es gelang, jene Waffen von Alles zerschmetternder Wirkung zu schaffen, welche die beispiellose Heeresrüstung unsres Volkes so glänzend vervollständigten.
Die Fabrik Krupps ist 1827 gegründet; ihr erster großer Erfolg in der ihr damals noch eigenen Kunst, große Stahlblöcke durch Guß herzustellen, wurde 1851 erzielt oder wenigstens bekannt; damals sandte sie zu einer Ausstellung nach London einen Block von 45 Centnern; heute werden von ihr Blöcke von tausenden von Centnern hergestellt. Das erste Geschütz aus Gußstahl, einen gezogenen Dreipfünder, brachte Krupp 1846 nach Berlin; das 1867 in Paris ausgestellte Riesengeschütz wiegt tausend Centner. Tausend Morgen Areal nimmt auch die Oberfläche des Etablissements ein, mit fast 3 Meilen Eisenbahn-Strängen zur innern Verbindung, mit 15 Telegraphenbüreaus; der jährlich ausgezahlte Lohn an die mehr als 10,000 Arbeiter beträgt 3 Millionen Thaler; für die Schulen, die Krankenanstalten, die Pensionen derer, die 25 Jahre lang ihm ihre Kräfte widmeten, sorgt der Fabrikherr auf's Ausgiebigste. Es ist ein eigenes Polizeicorps und eine Feuerlöschcompagnie militairisch organisirt; ein Stallmeister befehligt die Roßschalke und die Menge der wirklichen Pferde, die nöthig bleiben außer den imaginären 6000 Pferden, mit deren Kraft die Dampfmaschinen die Räder schwingen, die Kurbeln drehen, die Feuer schüren, die ungeheuren Dampfhämmer von nie dagewesener Schwere auf und nieder stampfen lassen. Der Dampfmaschinen sind 160, die täglich ihre 14,000 Scheffel Kohlen verzehren; der Gesammtwerth der Jahresproduktion soll 12,000,000 Thaler sein; und alle diese Verhältnisse sind in fortwährender rascher Fortentwickelung und Ausdehnung begriffen und wachsen so durch ihre Riesenhaftigkeit in unser Gebiet, das des Romantischen hinüber, denn bei solchen Schöpfungen wird auch die Industrie poetisch und wird es namentlich dann, wenn auf ihren Grundlagen Schloßbauten und Parkanlagen entstehen, so zaubergärtenhaft wie der neue Wohnsitz Krupps weiter unten an der Ruhr, zu Bredenei bei Werden.
Wir werfen, bevor wir das Ruhrthal ganz verlassen, noch einen Blick auf die Nachbar-Abtei Essens, auf »Werethina«, die Stiftung des heiligen Ludgerus, dem auf sein Gebet ein Orkan an dieser Stelle den undurchdringlichen Urwald lichtete, auf daß er Raum gewinne zu seiner neuen Anlage, und Ueberfluß von Holz auch für sein Bauwerk. Es war um dieselbe Zeit (etwa 798), wo er auch die Abtei Helmstedt gründete. Das Münster zeigt die romanische Anlage einer Basilika, wenn auch das dreischiffige Innere der Kirche die Zeit des Uebergangs in die Gothik verräth. Merkwürdig ist die von vier Säulen getragene Krypta, die den steinernen Sarg des heiligen Ludgerus enthält, der am 25. März 809 zu Billerbeck starb, zuerst in seiner Bischofsstadt Mimigardeford beigesetzt und dann auf seines Bruders, des Bischofs Hildegrim von Chatons Geheiß gen Werden geführt wurde, wie er im Leben es selbst angeordnet hatte – die Stiftung nämlich war ein Privateigenthum Ludgers, die ersten Schenkungen sind persönlich ihm gemacht und die nächsten Vorsteher derselben waren sämmtlich aus seinem edlen friesischen Geschlechte. Der Körper des Heiligen selbst ruht jedoch nicht mehr in der Krypta, sondern in einem silbernen Sarge auf dem Altare, hinter dem Altarblatt; dort, in der Krypta, halten an seiner früheren Grabstätte nur noch die uralten Statuen der vierzehn Nothhelfer Wacht. Ein altes karolingisches Kunstwerk, ein Kreuz befindet sich in der Sakristei. An den Chorlettnern verkünden Inschriften die Größe des Ordens des heiligen Benedikt, dessen Regel in Werden galt: wir lesen da, daß dem Orden angehörten 15,700 durch Gelehrsamkeit und Frömmigkeit hervorragende Aebte, 4,600 Bischöfe, 243 Mönche aus Fürstenhäusern und eine unzählige Menge canonisirter Heiligen. – Das große Conventsgebäude dient jetzt zur Strafanstalt.
Während die benachbarte Abtei Essen durch ihre Verbindung mit dem Sächsischen Kaiserhause sich zu einer glänzenden Stellung und reichen Besitzungen aufschwang, erwarb auch Werden bald Güter und Rechte in der Nähe und in der Ferne, namentlich in Westfriesland und dann auch die Landeshoheit über einen vielleicht eine Quadratmeile großen Besitz; dazu ist es von hervorragender Bedeutung geworden für die deutsche Culturgeschichte. In Werden entstand die Lebensgeschichte Ludgers von seinem Neffen, dem Abte und Bischofe Altfried und ergänzend dazu ist uns ein Cartularium Werthinense aufbewahrt, welches alle die Schenkungen, Kauf- und Tauschverträge enthält, die in Ludgers Gegenwart selbst abgeschlossen und von ihm und den Zeugen vollzogen sind. Die darin gesammelten 61 Urkunden sind ein treuer Spiegel der damaligen Zeit- und Ortsverhältnisse, der Rechtsformen, in denen verhandelt wurde, der uralten Orts- und Personennamen, der Fluß- und Flurbezeichnungen – es liegt eine Fülle von Material in diesem alten Codex, wie es kaum irgendwo sonst zu finden. Er wird heute aufbewahrt auf der Universitäts-Bibliothek zu Leyden, unter den Handschriften des Isaac Vossius und ist abgedruckt in Lacomblet's Niederrheinischem Urkundenbuch. Die Beschaffenheit des Codex und der Character der Schrift deuten auf das 9. und 10. Jahrhundert. Sodann steht Werden in nächster Beziehung zu zwei wichtigsten Denkmälern unserer Literatur, zu des Ulfilas gothischer Bibelübersetzung und zu der altsächsischen Evangelienharmonie, dem Heliand. Das ausgezeichnetste und vollständigste Manuscript des Ulfilas, der berühmte Codex argenteus wurde seit je in Werden aufbewahrt, bis man ihn im 30jährigen Kriege nach Prag flüchtete, wo ihn 1648 die Schweden erbeuteten, um ihn nach Upsala zu bringen. Man muß annehmen, daß der merkwürdige Codex in Italien in die Hände Ludgers gekommen – 782 hatte Ludger eine Reise nach Rom und nach Benevent gemacht, um hier des heiligen Benedikt Ordensregel kennen zu lernen – oder daß er in den Besitz Kaiser Karls übergegangen, und daß dieser ihn einer neuen kirchlichen Stiftung übergab, welche vorzugsweise berufen war, den niederdeutschen Volksstamm zu bilden, dessen Mundart, wie Grimm nachgewiesen hat, damals noch so nahe verwandt mit der gothischen Sprache war.
Der Heliand ist in der Mitte des 9. Jahrhunderts im altsächsischen Dialekt geschrieben, ein Gedicht, dessen uralte Laute nicht an unser Ohr schlagen, ohne daß wir wie die ureigenste Illustration dazu das in Fels gehauene Bildwerk der Externsteine vor uns sehen. Die Sprache des Heliand aber, die auf den Landstrich zwischen Münsterland und Ruhr deutet, erlaubt uns anzunehmen, daß er in der ältesten Priester-Bildungsschule dieses Landstrichs, in Werden entstanden. NachtragDer neueste Herausgeber des »Heliand«, M. Heyne (Bibliothek der ältesten deutschen Literatur-Denkmäler, Paderborn 1866, Band II) nimmt das Münsterland als Entstehungsort des Gedichtes an.
In den späteren Jahrhunderten hat Werden diese literarische Bedeutung bald verloren. Auch das religiöse Leben sank unter den, nur aus adlichen Geschlechtern genommenen Stiftsherren immer tiefer, bis im 15. Jahrhundert – 1490 – die Reformation des Ordens eintrat, welche auch in Werden die klösterliche Zucht wieder hob. Es endete das Stift unter denselben Umständen und im selben Zeitpunkt wie das Nachbarstift Essen. –
Um einen Ueberblick über die freundliche Lage der Stadt zu gewinnen, besucht man am besten die es beherrschenden Höhen auf dem südlichen Ufer. Man kommt am ehemaligen Pfarrhofe vorüber, dessen Garten die freieste Aussicht bietet über die Stadt, den Fluß, der an seinen zwei Inseln vorüberströmt und rauschend über Wehren schießt, und das von Chausseen durchzogene Thalgelände. Der mächtige Thurm, welcher uns am Ende der Stadt in's Auge fällt, ist ein Rest der alten Befestigungen. Eine vielleicht noch schönere Aussicht bietet die weiter abwärts liegende Villa, die »Engelsburg« von ihren Anlagen aus.
Aber wir müssen die Ruhr hier verlassen; Haus Oeft, der Sitz des Grafen von der Schulenburg, das hübsche Kettwig, das so verlockend am Fuße seiner bewaldeten Bergwand liegt, das Schloß Hugenpot, das malerische Landsberg mit seinen Thürmen und seiner wahrhaft idyllischen Umgebung – es ist das Stammhaus der Grafen von Landsberg-Velen und Gemen – dann das ehemalige Kloster Saarn, in welchem jetzt eine königliche Gewehrfabrik untergebracht ist – alles das liegt schon jenseits der Grenze des Westphalen- und Sachsenlandes. Schon ist der Dialekt, der um uns geredet wird, ein anderer und zeigt uns, daß wir das Land der Sigambrer oder der ripuarischen Franken betreten haben – wenn auch weiter im Bergischen noch kleine Sprachinseln des westphälischen Dialekts auftauchen, die Ansiedlungen der Nachkommen von ausgewanderten Arbeitern aus der Mark, die sich einst vor der Preußischen Conscription in das Bergische zu flüchten pflegten.
Versetzen wir zunächst uns zurück in das Thal der Volme, zuerst nach Hagen, dem mächtig aufblühenden Fabrikort und dann auf die Enneper Straße, die in den Tagen vor der Erfindung des Dampfrosses vielleicht die belebteste Deutschlands war; sie führt an dem Flüßchen Ennepe entlang und an unzähligen Eisenhämmern vorüber, wo fast aus jeder Baumgruppe, unter jedem geschwärzten Dache her Hammerschläge und der Schall arbeitender Maschinen in den Lärm des ganzen Thales einstimmen. Wir gelangen nach Gevelsberg und seinem Stifte, einem zur Sühne errichteten ehemaligen Cisterziensernonnenkloster. In seiner Nähe, in einem Hohlwege »im Lindengraben« genannt, stand bis 1836 ein Steinkreuz zur Erinnerung an die That, welche am 7. November 1225 in der Abenddämmerung hier verübt wurde, und die so unselige Folgen für unser ganzes Land haben sollte, die Ermordung des Erzbischofs Engelbert von Köln. Engelbert, ein geborener Graf von Berg, geboren 1185, früh dem geistlichen Stande bestimmt, als junger Stiftsherr zu Köln doch ziemlich weltlichen Sinnes und eines ehrgeizigen Characters sich erweisend, wurde 1216 zum Erzbischof von Köln erwählt und nahm sich nun mit ernster Energie der verworrenen Angelegenheit seines Stiftes und Landes an; er war ein Mann, der zum Herrscher von der Natur bestimmt schien, eine hohe Heldengestalt von seltener männlicher Schönheit, von durchdringendem Verstande und ebenso schneller Beurtheilungs- als raschentschlossener Thatkraft. So mußte seine neue Stellung ihm bald den weitreichendsten Einfluß in allen Angelegenheiten des Reichs verschaffen; er wurde Reichsverweser, als Kaiser Friedrich II. 1221 jenseits der Alpen verweilte und Pfleger des jungen Königs Heinrich, den er 1222 zu Aachen krönte; er waltete des Reichs in diesen Tagen mit solchem Lobe, daß Herr Walter von der Vogelweide von ihm sang:
Preiswerther Bischof Kölns, ihr mögt wohl fröhlich sein,
Ihr habt dem Reich so wol gedient, wir räumen's ein,
Daß euer Lob stieg wunderhoch empor und schwebt allein.
Kann nun ein feiger Neider nicht von eurem Werth genesen,
Fürstenmeister, laßt euch das nicht kümmern, achtet's klein,
Getreuer Königspfleger, hoch ist euer Wesen,
Kanzler zu Kaisers Ehren, wie er nie gewesen,
Elftausend Mägde, dreier Könige Kämmrer auserlesen.
Dieser mächtige und hochgebietende Mann nun war im Jahre 1218 auch noch zum Besitze der ganzen, so dicht an seine Stiftslande sich schließenden Grafschaft Berg gekommen; denn in diesem Jahre war auch sein älterer Bruder, Graf Adolf, vor Damiata in Aegypten gestorben, nachdem schon sein Vater auf dem Kreuzzuge Friedrichs des Rothbart's erlegen, sein Oheim Adolf nach tapfrem Kampfe in den Gärten von Damascus durch das Schwert der Ungläubigen umgekommen war. Der letzte Graf von Berg hatte nur eine Erbtochter hinterlassen, Irmgard, vermählt mit Heinrich, dem Erben des Herzogthums Limburg. Es hätte nun die Grafschaft Berg an diesen, Herzog Heinrich von Limburg, fallen müssen; wir sahen auf diese Weise Arnsberg an Gottfried von Kuyck, Bentheim an Arnold von Güterswyck, Tecklenburg zweimal an Bentheimer Grafen, Stromberg an die Rodenberg fallen; aber Erzbischof Engelbert, der mit den Herzogen von Limburg schon früher in vielerlei Span und Hader gerathen, legte seine mächtige Hand auf das bergische Erbe. Erst nach seinem Tode sollte es an Heinrich von Limburg fallen – bis dahin hielt Engelbert neben der geistlichen Hochwürde auch noch den weltlichen Besitz der Grafschaft Berg mit all ihren reichen Einkünften und ihren zahlreichen Vasallen und Dienstleuten fest. Wir wissen von keinem Beispiel solcher geistlichen und weltlichen Doppelstellung eines Fürsten in der Geschichte unsres Reichs. Die Limburger, mit Cleve verbündet, warfen zwar das Fehdebanner auf, hatten aber nicht die Macht, an der Sache etwas zu ändern und wurden gezwungen, sich zu fügen.
Mit um so größerer Thatkraft konnte jetzt Engelbert wie am Rhein so auch in den westphälischen Landen die Besitzungen der Kirche zu vermehren, und die Herzogsgewalt der Erzbischöfe von Köln über diesen Theil Sachsens zur Anerkennung und durchgreifendster Wirkung zu bringen suchen. Dazu gehörte die Gewinnung von möglichst vielen festen Punkten; er hatte sich 1217 schon die Burg Padberg zwischen Brilon und Stadtberge zum Offenhaus für die Kölner Kirche gewonnen, er befestigte Brilon, Attendorn, ließ sich Marsberg übertragen, faßte festen Fuß an der Weser in Helmershausen und Kruckenberg; er erschien häufig selbst in Westphalen, hielt Provinzialconcilien ab, saß als Herzog zu Gericht, umgeben von den Bischöfen, Grafen, Aebten und Dynasten des Landes, entschied ihre Streitigkeiten, suchte mit gewaltiger Hand den Landfrieden aufrecht zu halten und die Schwachen wider die Mächtigen zu schirmen – und waltete des Rechts dabei in einer Weise, daß die Sage ja später die Einführung der Fehmgerichte mit seinem Namen verband, während als sicher angenommen werden darf, daß er ihre Entwicklung begünstigte und ihnen den Rückhalt der Kölnischen Herzogsgewalt gab, ohne den sie sich schwerlich wider die Macht all der Landesherren um sie her aufrecht erhalten hätten.
Zu den Aufgaben, die er sich gestellt, mußte natürlich auch die gehören, die Kirchen und ihre Stiftungen vor den Bedrängungen ihrer Schirmherren zu schützen und die Ansprüche ihrer Vögte niederzuhalten. Unter diesen hatte vor vielen andern das Stift Essen zu leiden, dessen Schirmvogtei als Reichslehen den Grafen von Altena zustand; in Engelberts Tagen wurde sie ausgeübt von einer Nebenlinie des Hauses Altena. Graf Engelberts I. von Altena Bruder Everhard hatte diese Linie gestiftet; ihr gehörte die Burg Isenburg und Nienbrügge an der Lippe; und um 1220 hauste auf der stolzen hochragenden, alle Burgen des Landes an Größe und Stärke übertreffenden Isenburg Everhards Enkel, Friedrich, anfangs dem geistlichen Stande bestimmt und Domherr zu Köln, dann nach eines älteren Bruders Tod zur Erbfolge berufen. Er war ein roher, gewaltthätiger Mann – grade solche Laien, die früher dem Clerus angehört, waren wie der Mönch Cäsarius von Heisterbach, der Lebensbeschreiber Engelberts versichert, die schlimmsten von allen. Schon die Soester Kirche hatte den Schutz des Papstes wider ihn angerufen; gegen die von Essen aber handelte er mit einer schrankenlosen Willkür, die nur mit dem Verderben des ganzen Stiftes hätte enden können. – Graf Friedrich von Isenburg schien des Glaubens zu leben, daß mit ihm, dem nahen Verwandten und Blutsfreunde, der mächtige Prälat von Köln, der für seine Brüder schon so treu und freigebig gesorgt, niemals ernstlich in's Gericht gehen werde. Und so legte sich Friedrich von Isenburg denn keine Zügel an, bis Papst Honorius III. und der Kaiser Friedrich II. dem Erzbischofe anbefahlen, seinem Schalten und Walten über die Stiftsgüter endlich gründlich Einhalt zu thun. Erzbischof Engelbert versuchte dennoch durch Glimpf und Güte zum Ziele zu kommen. Aber Friedrich hatte einen besondern Grund, sich dem mahnenden Erzbischofe aufsässig und verstockt zu zeigen. Er war der Gatte der Sophia, der Schwester jenes Herzogs Heinrich von Limburg, dem Engelbert die Grafschaft Berg vorenthalten hatte; er stand unter dem Einfluß dieser Frau und ihrer nächsten Verwandten ... mochte immerhin Erzbischof Engelbert Friedrichs Brüdern Dietrich zur Inful von Münster, Engelbert zur Inful von Osnabrück, der zahlreichen Sippe zu den reichsten Pfründen verholfen haben – die Entziehung der Grafschaft Berg wog schwerer. Des Erzbischofs mächtiges Walten in Westphalen hatte diesem dazu zahlreiche Feinde geweckt, die in Friedrich von Isenburg den Haß und den Wiedervergeltungstrieb schürten. Zu Anfang November 1225 kam der Erzbischof nach Soest zur Berathung der Landesangelegenheiten und zur Schlichtung der Essener Sache. Der Tag blieb fruchtlos. In dem Grafen Friedrich kochte der Groll wider den Erzbischof; dieser bedrohte ihn mit der Entziehung der Schirmvogtei über Essen, ohne ihn dadurch zu einem friedlichen Austrage und zur Unterwerfung unter billige Bedingungen bringen zu können. Wir wissen nicht, ob unter einem Theile der Versammlung, der am meisten durch des Erzbischofs Vorgehn gereizt worden, eine Verschwörung wider sein Leben entstand; man nahm später es an, und die ganze Wirksamkeit des großen Kirchenfürsten war jedenfalls so, um es für jene Zeit erklärlich erscheinen zu lassen, daß sie ihm auf allen Seiten eine solcher Entschlüsse fähige Feindschaft erweckt. Friedrich wenigstens hat schon zu Soest den Beschluß gefaßt, durch die Ermordung des Erzbischofs der Entziehung seines Reichslehens zuvorzukommen und dort die dazu tauglichen Dienstmannen, etwa 25, auszusuchen begonnen. Er ging alsdann scheinbar, um des Friedens willen, auf des Erzbischofs Vorschläge ein; man wollte nun zu Martini in Köln die völlige Ausgleichung zu Ende führen. Engelbert brach mit schwachem Gefolge auf von Soest und begab sich heim – zunächst auf den Weg nach Schwelm, wo er am 8. November eine Kirche weihen wollte. Auf dem Ritte dahin folgte ihm Friedrich; er setzte bei Westheim durch die Ruhr; dann stieß er während des Tages drei Mal zu ihm, um ihm eine Strecke weit das Geleit zu geben; zuletzt nicht mehr auf seinem Zelter, sondern auf seinem gewappneten Streitrosse erscheinend. So kam man um die Abenddämmerung dem Orte nahe, wo Graf Friedrich die Schaar seiner Dienstleute im Hinterhalte liegen hatte; während die meisten von den kölnischen Dienstleuten schon früher mit den Köchen vorausgeeilt waren, um das Nachtlager in Schwelm zuzurüsten; nur wenige ritten noch mit ihrem Herrn; unter ihnen war der Graf Konrad von Dortmund; ein Junker von Hemmersbach führte dem Erzbischofe das Streitroß nach.
Den vor ihnen, oben auf der Höhe des Gevelsberges versteckten Dienstleuten sandte Graf Friedrich jetzt noch seine Mannen Heribert von Sweren und Heribert von Rinkerode zu, um sie anzuführen; als der Erzbischof in einen tiefen Hohlweg gekommen, besetzten die da oben auf Rinkerodes gellenden Pfiff den Ausgang; mit gezogenen Schwertern stürzten die Mörder dem Reisezug entgegen; während der Erzbischof sich eilig auf sein Streitroß warf, wurde er in's Knie gehauen; Graf Konrad von Dortmund, der unerschrocken die ritterliche Wehre schwang, wurde schwer an der Stirn getroffen, dann durch einen zweiten Stoß zwischen den Schultern verwundet; sein Fall gab den übrigen Begleitern des Erzbischofs das Zeichen zur Flucht ... die Entwicklung der weitern Katastrophe aber mag uns die Dichtung schildern:
I.
Der Anger dampft, es kocht die Ruhr,
Im scharfen Ost die Halme pfeifen,
Da trabt es sachte durch die Flur,
Da taucht es auf wie Nebelstreifen,
Da nieder rauscht es in den Fluß.
Und stemmend gen der Wellen Guß
Es fliegt der Bug, die Hufe greifen.
Ein Schnauben noch, ein Satz, und frei
Das Roß schwingt seine nassen Flanken,
Und wieder eins, und wieder zwei,
Bis fünf und zwanzig stehn wie Schranken:
Voran, voran durch Haid und Wald,
Und wo sich wüst das Dickicht ballt,
Da brechen knisternd sie die Ranken.
Am Eichenstamm, im Ueberwind,
Um einen Ast den Arm geschlungen,
Der Isenburger steht und sinnt
Und naget an Erinnerungen.
Ob er vernimmt, was durch's Gezweig
Ihm Rinkerad, der Ritter bleich,
Raunt leise wie mit Vögelzungen? –
»Graf, flüstert es, Graf, haltet dicht,
Mich dünkt, als woll' es euch bethören;
Bei Christi Blute, laßt uns nicht
Heim wie gepeitschte Hunde kehren!
Wer hat gefesselt eure Hand,
Den freien Stegreif euch verrannt?« –
Der Isenburg scheint nicht zu hören.
»Graf, flüstert es, wer war der Mann,
Dem zu dem Kreuz die Rose
Die Rose ist hier als das Wappen von Berg genommen. paßte?
Wer machte euren Schwäher dann
In seinem eignen Land zu Gaste?
Und, Graf, wer höhnte euer Recht,
Wer stempelt euch zum Pfaffenknecht?« –
Der Isenburg biegt an dem Aste.
»Und wer, wer hat euch zuerkannt,
Im härnen Sünderhemd zu stehen,
Die Schandekerz in eurer Hand,
Und alte Vetteln anzuflehen
Um Kyrie und Litanei?« –
Da krachend bricht der Ast entzwei
Und wirbelt in des Sturmes Wehen.
Spricht Isenburg: »mein guter Fant,
Und meinst du denn, ich sei begraben?
O laß mich nur in meiner Hand –
Doch ruhig, still, ich höre traben!«
Sie stehen lauschend, vorgebeugt;
Durch das Gezweig der Helmbusch steigt
Und flattert drüber gleich dem Raben.
II.
Wie dämmerschaurig ist der Wald
An neblichten Novembertagen,
Wie wunderlich die Wildniß hallt
Von Astgestöhn und Windesklagen!
»Horch, Knabe, war das Waffenklang?« –
»Nein, gnäd'ger Herr, ein Vogel sang,
Von Sturmesflügeln hergetragen.« –
Fort trabt der mächtige Prälat,
Der kühne Erzbischof von Köllen,
Er, den der Kaiser sich zum Rath
Und Reichsverweser mochte stellen,
Die ehrne Hand der Clerisei, –
Zwei Edelknaben, Reis'ger zwei,
Und noch drei Aebte als Gesellen.
Gelassen trabt er fort, im Traum
Von eines Wunderdomes Schöne,
Engelbert hatte zuerst den Plan der Erbauung des Kölner Domes gefaßt.
Auf seines Rosses Hals den Zaum,
Er streicht ihm sanft die dichte Mähne,
Die Windesodem senkt und schwellt, –
Es schaudert, wenn ein Tropfen fällt
Von Laub und Ast, des Nebels Thräne.
Schon schwindelnd steigt das Kirchenschiff,
Schon bilden sich die krausen Zacken –
Da, horch, ein Pfiff und hui, ein Griff,
Ein Helmbusch hier, ein Arm im Nacken!
Wie Schwarzwildrudel bricht's heran,
Die Aebte fliehn wie Spreu, und dann
Mit Reisigen sich Reis'ge packen.
Ha, schnöder Strauß! zwei gegen zehn;
Doch hat der Fürst sich losgerungen,
Er peitscht sein Roß und mit Gestöhn
Hat's über'n Hohlweg sich geschwungen.
Die Gerte pfeift – »Weh, Rinkerad!« –
Vom Rosse gleitet der Prälat
Und ist in's Dickicht dann gedrungen.
»Hussah, hussah, erschlagt den Hund,
Den stolzen Hund!«' und, eine Meute,
Fährt's in den Wald, es schließt ein Rund,
Dann vor- und rückwärts und zur Seite;
Die Zweige krachen – ha, es naht –
Am Buchenstamm steht der Prälat
Wie ein gestellter Eber heute.
Er blickt verzweifelnd auf sein Schwert,
Er löst die kurze breite Klinge,
Dann prüfend untern Mantel fährt
Die linke nach dem Panzerringe;
Und nun wohlan, er ist bereit,
Ja, männlich focht der Priester heut,
Sein Streich war eine Flammenschwinge.
Das schwirrt und klingelt durch den Wald,
Die Blätter stäuben von den Eichen,
Und über Arm und Schädel bald
Blutrothe Rinnen tröpfeln, schleichen;
Entwaffnet der Prälat noch ringt,
Der starke Mann, da zischend dringt
Ein falscher Dolch ihm in die Weichen.
Ruft Isenburg: »es ist genug,
Es ist zuviel!« und greift die Zügel;
Noch sah er, wie ein Knecht ihn schlug,
Und riß den Wicht am Haar vom Bügel.
»Es ist zuviel, hinweg geschwind!« –
Fort sind sie und ein Wirbelwind
Fegt ihnen nach wie Eulenflügel. – –
Des Sturmes Odem ist verrauscht,
Die Tropfen glänzen an dem Laube,
Und über Blutes Lachen lauscht
Aus hohem Loch des Spechtes Haube;
Was knistert nieder von der Höh'
Und schleppt sich wie ein krankes Reh?
O armer Knabe, wunde Taube!
»Mein gnädiger, mein lieber Herr,
So mußten dich die Mörder packen?
Mein frommer, o mein Heiliger!«
Das Tüchlein zerrt er sich vom Nacken,
Er drückt es auf die Wunde dort
Und hier und drüben, immer fort,
Ach, Wund' an Wund' und blut'ge Zacken!
»He hollah ho!« – dann beugt er sich
Und späht, ob noch der Odem rege;
War's nicht, als wenn ein Seufzer schlich,
Als wenn ein Finger sich bewege? –
»Ho hollah ho!« – »Hollah hoho!«
Schallt's wiederum, deß war er froh,
»'s sind unsre Reuter allewege!« –
III.
Zu Köln am Rheine kniet ein Weib
Am Rabensteine unter'm Rade,
Und über'm Rade liegt ein Leib,
An dem sich weiden Kräh' und Made;
Zerbrochen ist sein Wappenschild,
Mit Trümmern seine Burg gefüllt,
Die Seele steht bei Gottes Gnade.
Den Leib des Fürsten hüllt der Rauch
Von Ampeln und von Weihrauchsschwelen –
Um seinen qualmt der Moderhauch
Und Hagel peitscht der Rippen Höhlen;
Im Dome steigt ein Trauerchor,
Und ein Tedeum stieg empor
Bei seiner Qual aus tausend Kehlen.
Und wenn das Rad der Bürger sieht,
Dann läßt er rasch sein Rößlein traben,
Doch eine bleiche Frau die kniet,
Und scheucht mit ihrem Tuch die Raben;
Um sie mied er die Schlinge nicht,
Er war ihr Held, er war ihr Licht –
Und ach, der Vater ihrer Knaben!
Auffallend sind die nächsten Thatsachen, nachdem das rückkehrende Gefolge des Erzbischofs dessen, von den Raubgesellen nach der Ermordung gar noch ausgeplünderte Leiche aufgefunden hat. Der Pfarrer von Schwelm verweigert derselben die Niedersetzung in seiner Kirche; man bringt sie zur Feste Neuenburg, dem Herrschersitz der Grafen von Berg. Aber die Dienstmannen verweigern ihr den Einlaß; sie, obwohl des Erzbischofs Burgmänner, fühlen doch so sehr, daß ihre Feste dem Herzoge von Limburg gehört und zu Eigen ist, daß sie ihre Thore schließen vor dem todten Feinde Limburgs. So wird die Leiche in's Kloster Altenberge gebracht, und hier erst zeigt sich, wie fürchterlich die Mörder gewüthet; es werden an ihr hier nicht weniger als sieben und vierzig Verwundungen gefunden. Und dann, nachdem der Erschlagene nach Köln übergeführt, beginnt das Walten der Vergeltung, ein Jahrelanges entsetzliches und ganze Striche Westphalens schwer heimsuchendes Walten. Wenige Tage nachdem die That geschehen, erscheinen Edle und Dienstmannen der Kölner Kirche, um Klage zu erheben vor dem Könige Heinrich in seiner Burg zu Nürnberg. Der König selbst saß zu Gerichte, die Kläger zeigten die zerrissenen blutbefleckten Kleider ihres Herrn und forderten laut und ungestüm Gerechtigkeit; unter des Königs Rittern aber erhob sich ein heftiger Streit darüber, ob der Mörder sofort zu ächten sei oder ob er erst vor des Reiches Gericht zu heischen. Dieser Streit ging in Tumult und Verwirrung über, Schwerter wurden entblößt, alle stürzten dem Ausgange zu und drängten sich stürmisch die Treppe hinunter, so daß diese brach und einstürzte und an fünfzig Menschen, unter ihnen drei und zwanzig Ritter erdrückt wurden und elend um's Leben kamen. Ueber Isenburg wurde dennoch die Reichsacht ausgesprochen und kurz nachher auf einem Tage zu Frankfurt erneuert, wohin man die Leiche selber in einem Trauerzuge, geleitet von des Stiftes Mannen mit entblößten Schwertern vor den König und die versammelten Fürsten getragen: wieder wurden die blutigen Kleider gezeigt; der junge, dreizehnjährige König brach dabei in bitterliche Thränen aus und beweinte den Erschlagenen wie ein Sohn seinen Vater, ein Unmündiger seinen Schützer. Die Acht wider Friedrich von Isenburg wurde verschärft durch die Aussetzung eines Lohnes von 1000 Mark für den, welcher den Geächteten finge. Die Brüder desselben, die Bischöfe von Münster und Osnabrück, wurden von einem Legaten des Papstes auf einem Kirchentage zu Lüttich von ihren Würden suspendirt und zur Aburtheilung nach Rom gesandt. Einige der Helfer Friedrichs, deren man habhaft wurde, erlitten unbarmherzige Strafe. Die Isenburg wurde erobert und von Grund aus zerstört; ebenso Nienbrügge; Friedrichs Weib Sophia, die sich zu ihrem Bruder Heinrich von Limburg geflüchtet, starb mit ihrem jüngsten Kinde an gebrochenem Herzen. Friedrich selbst aber trieb sich flüchtig und unstät in der Irre umher; als Kaufmann verkleidet kam er mit zwei Begleitern nach Lüttich; hier wurde er erkannt, gefangen und von dem Ritter von Gennep, der ihn bestrickt, für 2100 Mark ausgeliefert. Man führte ihn in Ketten nach Köln, wo er nach drei Tagen auf einem Hügel vor dem Severinsthor seine fürchterliche Strafe mit bewundernswürdiger Standhaftigkeit, ohne unter den Radstößen des Henkers einen Laut der Klage von sich zu geben, erlitt. Auf's Rad geflochten lebte er bis zum folgenden Morgen, unaufhörlich betend und die Umstehenden auffordernd, Fürbitte zu thun für seine arme Seele. Vergl. Dr. J. Ficker, Engelbert der Heilige, Köln 1853.

Wie Westphalen, wo so viele Große des Landes unter dem Verdacht der Theilnahme an der Schuld standen, zu leiden hatte an den Folgen der ruchlosen That, übergehen wir; es ist merkwürdig, wie den größten Vortheil dabei das Haus der Altenaschen Grafen selbst hatte, deren ältere Linie in Graf Adolf III. sich als eifrigen Vollstrecker der Reichsacht wider den unglücklichen Vetter erwies und fast alle seine Besitzungen mit Ausnahme der Vogteien an sich brachte, um so das mächtigste Geschlecht in Westphalen zu werden. Mit den Quadern des niedergebrochenen Nienbrügge festigte sich Graf Adolf seine neue Stadt Hamm – aus den Steinen der mächtigen Isenburg schuf er sich sein trotziges Blankenstein, und mit kluger Zunge gewann er Engelbert's Nachfolger auf dem Stuhle von Köln die schönsten Belehnungen mit den Gütern des Aechters ab. –
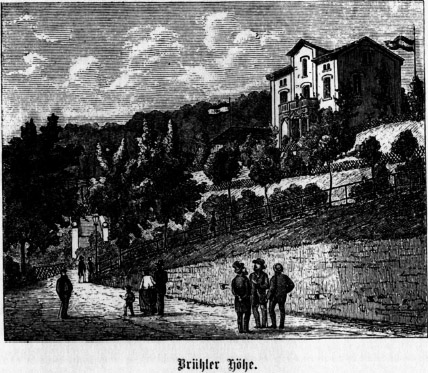
Bis Gevelsberg gekommen, ist es schwer auf die kurze Weiterwanderung zu verzichten, und uns einen, wenn auch nur flüchtigen Blick in das Land jenseits der Höhen, die die Gränze unsres eigentlichen Gebiets bilden, zu versagen. An der »Klutert«, einer bedeutenden, seitwärts in der Nähe von Vörde sich öffnenden Höhle, die sich stundenweit in's Gebirg erstreckt mit einem Gewirr von über 60 Gängen, doch grade nicht sehenswürdiger ist als jene, in deren Tiefen wir früher drangen, und dann an einem eben so heilsamen als freundlichen Mineralbrunnen vorüber, immer durch ein lachendes eng bevölkertes Höhenland, bringt die Chaussee uns in das gewerbreiche Schwelm. Der Gesundbrunnen wurde im Jahre 1706 an dem Rothenberge, auf den Gründen des Hauses Matfeld oder besser Martfeld entdeckt; die fürstliche Kammer zu Cleve hielt die Besitzer dieses Gutes an, für seine Fassung und die Errichtung von Badelocalen und Gasthäusern zu sorgen, und so fand die Heilquelle auch bald Aufnahme; nach und nach mit zweckmäßigen und eleganten Häusern und Parkanlagen umgeben, sah sie noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in jedem Sommer zahlreiche Kurgäste um sich versammelt, namentlich die Gelehrten und Poeten Westphalens. – Haus Martfeld ist ein alter Sitz einer Familie von Ilem, nach deren Aussterben es 1687 an die Stael von Holstein zu Steinhausen, dann an die Gysenberg kam; nach mancherlei Besitzwechsel ist es jetzt in die Hände derer von Elverfeld gelangt.
Nur eine kurze Wegstrecke noch und wir sind in dem berühmten Thale der Wupper. Durch die endlosen Häuserreihen von Barmen, wo Stadt und Land einen freundlichen Kampf mit einander führen, bald die Stadt ihre schweren Häusertruppen vorschiebt, bald das Land mit Garten, Wies' und Bosquet dazwischen dringt und seine Herrschaft behauptet – durch die belebten Straßen des unmittelbar an Barmen sich anschließenden älteren Elberfeld, das – dennoch auch modernen Charakters – durch keine historische Erinnerung und durch kein großes Denkmal alter Kunst, wohl aber durch einzelne neue Gebäude, wozu wir vor allen das Rathhaus mit seinem Freskenschmuck im Innern zählen, uns fesseln kann, erreichen wir, uns zur Rechten wendend, die Höhe, welche gen Nordwesten das Wupperthal begränzt, die Haardt, und suchen hier, um eine Uebersicht zu gewinnen, den Thurm der »Elisenhöhe« zur Fernsicht aus. Eine ähnliche mag sich kaum an einer Stelle des Continents wieder bieten; denn eine Gegend so dicht bevölkert, wie dies Wupperthal, das vor uns liegt mit dem schmalen Strome in der Mitte, mit seinen Städten und Flecken und dichtgedrängten Siedlungen, Fabriken, Mühlen, Bleichen und großartigen neuen Eisenbahnanlagen, mag nur sich wieder finden, wo der Schottische Clyde durch die Manufacturbezirke von Glasgow strömt. – Elberfeld war einst ein Rittergut der Dynasten von Elverfeld mit einem Schlosse von großem Umfange, das 1421 erst dem Lande Berg einverleibt wurde, worauf thätige Ansiedler um das Schloß her sich anbauten, bis ein Ort entstand, der 1619 Stadtrechte erhielt. Auf den Höfen und Grundstücken, welche unter der Gesammtbenennung »das Barmen« 1244 durch Kauf von dem Grafen Ludwig von Ravensberg an die Grafen von Berg kamen, wurden, ebenso wie in Elberfeld, am Ende des 15. Jahrh. die Garnbleichereien eingeführt, womit damals bereits die Bewohner von Werden, Hattingen und Witten sich Wohlstand erworben hatten; 1527 erhielten Elberfeld und Barmen ein ausschließliches Privilegium von dem Landesherrn Johann von Berg dafür. Das ist der erste Anfang der Industrie des Wupperthales, die jedoch erst nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's I. von Preußen blühenden Aufschwung bekam, als sich die rüstigsten und kräftigsten jungen Männer der gewerbthätigen Grafschaft Mark hierher flüchteten, um dadurch den Soldaten-Aushebungen zu entgehen; (Berg war seit 1629 Pfalz-Bayerisches Territorium.) Noch im ersten Decennium des vorigen Jahrhunderts bestand Barmen blos aus 36 »Höfen« und etwa 200 ebenfalls zerstreut stehenden und meist kleinen andern Häusern, was noch nicht wohl der Anfang einer Stadt genannt werden kann. Von da an aber entwickelte es eine solche Regsamkeit und selbstschöpferische Kraft, daß es schon bald nachher aus mehreren ansehnlichen Flecken – Gemarke, Wupperfeld, Rittershausen, Wichlinghausen – bestand, und jetzt zu einer zwei Stunden weit im Thale der Wupper sich hinziehenden Fabrik- und Handelsstadt ersten Ranges herangewachsen ist und 65,000 Einwohner zählt. – Die Zunahme Elberfelds war während desselben Zeitraums nicht minder groß und nur darum nicht so auffallend, weil, wie wir oben gesehen haben, es schon lange vorher eine Stadt war. Elberfeld übertrifft, wenn auch nicht in demselben Maße als es älter ist, die freundlichere blanke Schwesterstadt Barmen noch jetzt an industrieller Wichtigkeit, an Reichthum und Einwohnerzahl, welche letztere sich gegenwärtig auf 66,000 belaufen mag.
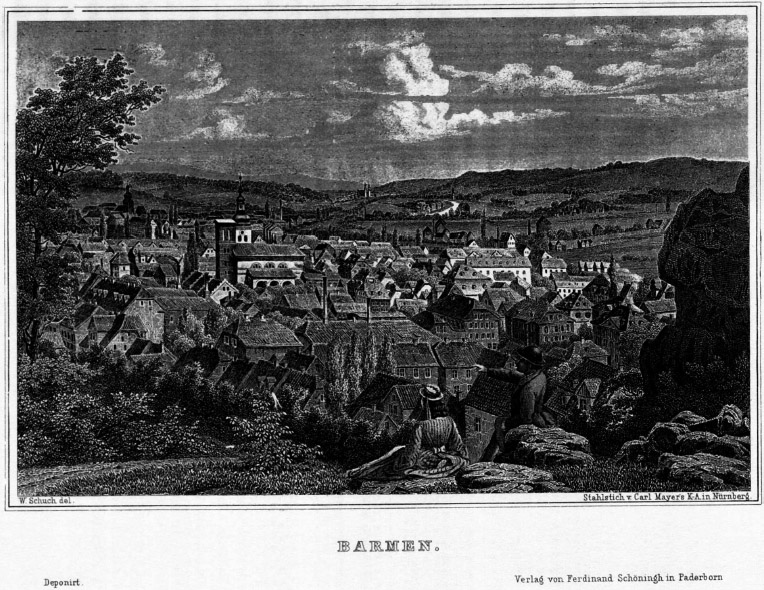
Wir sind in doppelter Abirrung aus dem Gebiete der Romantik in das Reich der Industrie, von der rothen Erde in das grüne Hügelland von Berg gerathen; ziehen wir uns deshalb zurück, zunächst in das romantische tiefe Thal von Beyenburg oberhalb Barmen, dann weiter in Westphalen hinein, in die wildschönen Schluchten des Ebbegebirges, über ein trotziges, einsames Höhenland, immer dem Südosten zu, bis wir endlich von einer hohen Wasserscheide, die, von Winterberg her sich nach Südwesten ziehend, das Thal der Lenne von dem der Eder, das der Bigge von dem der Sieg trennt, zuletzt noch einen Blick in's Thal dieses letztern Flusses werfen. Wir stehen auf der Chaussee, die von Meinerzhagen über Olpe nach Siegen führt, auf der Höhe bei Krombach. Das Land der Sieg liegt vor uns wie ein Garten; schmale Thäler, hohe Berge, unter der Decke von Wald oder wogenden Kornfluren; Krombach, theils verwittert, theils neu und schmuck gebaut in reizender Lage unter Obstbaumhainen am Berghange; weiter unten im Thale eine Menge von Hüttengruppen mit moosigem Strohdach, Hochöfen mit ihren Kohlenschuppen und der Hüttenbesitzer freundliche Häuser daneben. Die Thäler der Sieg und der kleinsten Bäche sind durch die schönsten saftigsten Wiesen ausgezeichnet, die man sehen kann – der Siegener Wiesenbau ist ja berühmt nah und fern: über ihnen, bis an den Gipfel beackert, stehen die Hauberge, die 15 Jahre lang Holzung für den Kohlenbedarf der Eisenschmelzen des Landes tragen, dann, mit Ausnahme einzelner Samenbäume, abgeholzt und zu Aeckern umgeschaffen werden – nicht durch den Pflug, sondern durch das Feuer, das an den gelockerten Rasen, das Moos und Haidekraut der rasirten Bergflächen und Hänge gebracht wird, damit die Asche den Boden dünge. Man sieht dann im Frühjahr und Herbst dichten Rauch wie schwarzgelbe Nebelschichten in den Thälern stehen; die höchsten Gipfel nur schweben über dem Gewölb, so einsam ernst, als dächten sie und blickten, voll Sinnens über ihre stürmischeren Geburtstage in vulkanischen Zeiten dem feuerschürenden Geschlechte auf ihren Halden zu. An dunklen Abenden macht die Menge der kleinen Feuer, die an den Abhängen flammen, deren rother Schein wie ein blutiger Glast auf den Seiten der einzelnen Rauchsäulen liegt, bis diese sich höher in schwarze Wolken verdichten, einen magischen Eindruck.

Der Kreis Siegen ist nach außen hin von einer meist ununterbrochenen Kette hoher Gebirge umschlossen, die ihre Quellen fast alle dem Innern zusenden, wo übrigens die Thalpunkte noch immer eine Erhöhung von etwa 1000 Fuß über der Meeresfläche haben. Die südlichen Grenzen werden durch die Höhen des eigentlichen Westerwaldes und der »Kalteiche« gebildet; von ihnen und den andren Grenzgebirgen laufen zusammenhängende Ketten nach allen Richtungen hin durch das Innere des Kreises, wo das Gebäu, der Pfaffenhayn, Giller, Kindelsberg, die Alteburg, Martinshard, Eisernhard u. s. w. am höchsten sich aufrecken. Die Thäler dazwischen sind anmuthig geformt, von mäßiger Ausdehnung, wenige so schmal und kesselförmig, daß sie, wie das Dorf Grund, (Stillings Geburtsort) im Winter die Sonne nicht mehr bescheint. In diesen Thälern wohnt ein fleißiges Volk, ein reges Leben; was das etwas rauhe Klima und der magre Boden versagen, ersetzen die erzglänzenden Früchte, die im Schooße der Erde keimen, tief unter Grauwacke, Schiefer oder Basalt.
Besuchen wir zuerst von Krombach aus den Stahlberg bei Müsen an der Martinshard. Das offene Thal beleben wie überall im Siegerlande Pochwerke und Erzschmelzen und russige Essen, Bergleute in rothen, Eisenockergefärbten Grubenkleidern, schwere Karren, von gewaltigen Ochsen gezogen, die das Erz zu den Oefen, andere, die das fertige Eisen in die Ferne bringen. An der Grube reicht euch ein freundlicher Steiger die Kleider, den Schurz und die dichte Filzmütze für die unterirdische Fahrt; in einen kühnen Knappen verwandelt sprecht ihr Novalis': »Der ist der Herr der Erde, der ihre Tiefen mißt«, als Segenssprüchlein und fahrt dann wohlgemuth, mit Grubenlichtern versehen, in das Stollenmundloch unfern Müsen an, durchschreitet auf schwanken Brettern, unter denen das Wasser seinen Abzug hat, den langen hallenden Stollen, bis ihr die Fäustelschläge der Bergleute hört und aus der fernen Nacht die rothen Grubenlichter schimmern seht. Die Fahrt geht, wenn ihr bis in die letzte der »Teufen« wollt, auf schwankenden Leitern durch zehn Etagen, eine wundersame Welt Erzschimmernder, Nachtbrütender Hallen, von gewaltigen Pfeilern getragen, in denen das Hammergepoch, das Rauschen herabrieselnder Wasser, der Felsensprengende Erzschuß im fernen Gange, tausendfach wiederhallt. »Ueber hundert Bergleute arbeiten für den Betrieb der Grube und fördern etwa 4000 Tonnen Stahlstein, 4500 Centner Bleierze, 150 Centner Kupfererze, ferner Spießglanzbleierze und eine geringe Quantität Silbererze jährlich zu Tage; die Ausbeute mag in den letzten 20 Jahren 150,000 Thaler betragen haben.« So war es vor 30 Jahren. Jetzt, wo das Land der Sieg durch zwei Eisenbahnen aufgeschlossen ist, entwickeln sich die Verhältnisse nach ganz anderem Maßstabe. Der Aktienverein, der sich zur Ausbeutung gebildet hat, gewann 1870: 1362 Pfund Silber, 826 Centner Blei und 621 Centner Kupfer, dazu 300,000 Centner Roheisen. – Die Gänge setzen im Grauwackenschiefer auf; die Gangmasse der meisten ist Quarz, Schwerspath, Spatheisenstein, mit welchem Bleiglanz, Spießglanzbleierz, Fahlerz, Kupferkies, Blende und Kobaltkies in mehr oder minder bedeutender Menge brechen. Der Betrieb des Stahlbergs ist sehr alt; die erste Erwähnung desselben geschieht in einer Urkunde zwischen dem Grafen von Nassau und einem Edlen von Hainchen von 1313.
Nordöstlich von Müsen liegt Hilchenbach mit der romantischen Kirche Jung Stillings; über den nahen Ginsberg, auf dem Trümmer eines alten Berghauses liegen, und dessen Gipfel eine herrliche Sicht auf die Kuppen und Thäler des Siegerlandes und die sieben Berge am Rheine bietet, dann auf Fußpfaden berghinab, durch den schönen Hochwald kommt man in das reizend liegende Dörfchen Grund, in tiefem Waldthal unter Obstbäumen und Gärtchen, eine liebliche Idylle, ein stilles Gartengehege für eine weiche, träumerische, von so zarten Farben überhauchte Menschenblüthe wie Jung Stilling war. Das Haus, worin Stillings Eltern lebten, ist eine bescheidene verfallene Dorfwohnung; an einem gegenüberstehenden Wirthschaftsgebäude sieht man den Namen Eberhard Stilling in den Stein gehauen. Auf der Höhe, wo die Chaussee nach Siegen sich in das Dorf hinabsenkt, erinnert jetzt ein einfaches Denkmal an den Mann mit dem milden Auge, dessen Blicke nach etwas »jenseits dieser Welt« auszuschweifen, und zurückzukommen schienen mit der »Kunde der Geister«.
Wir lassen links hinter uns den 1900 Fuß hohen Ederkopf, auf dem dicht nebeneinander die südwärts gewendete Lahn, die westwärts strömende Sieg und die Eder entspringen, welche nordöstlich in das waldige Bergland dahinzieht, um in das dahinter liegende Gebiet der Fürsten von Sayn, die zu Wittgenstein und Berleburg, auf hohen schönliegenden Schlössern ihre Sitze haben, zu strömen. Gehen wir vom Dorfe Jung Stillings aus der Chaussee nach, die durch emsig bebaute Thalflächen gen Süden führt, bis in der Ferne auf hohem Bergrücken das alterthümliche und verwitterte Siegen sichtbar wird. Den Gipfel der Höhe krönt das alte Schloß; die Stadt zieht jenseits den Bergrücken hinab bis in's Thal der Sieg, über welche zwei steinerne Brücken führen; dicht am Ufer des Flusses liegt das neue Schloß, geräumig, von hohen Mauern geschützt, mit einer hübschen Kirche und einfachen Räumen, die jetzt als Local der Behörden dienen. Es ward im Anfange des vorigen Jahrhunderts von Graf Friedrich Wilhelm Adolph aus der reformirten Linie Nassau-Siegen erbaut, während das alte Schloß die Residenz der katholischen Linie war. Unter der Schloßkapelle, in der fürstlichen Familiengruft, zu der man unter der Frontkolonnade durch ein schweres eisernes Thor hinabsteigt, ruhen neben andern Gebeinen Nassau-Siegen'scher Fürsten die Ueberreste des merkwürdigsten und größten von ihnen allen in reich verziertem Mausoleum – es sind die von Johann Moritz von Nassau-Siegen, der am 17. Juni 1604 zu Dillenburg geboren wurde und 1679 zu Cleve sein vielbewegtes Leben schloß. Er hatte in den ersten Jahren des 30jährigen Krieges seine Studien auf den Hochschulen zu Basel und Genf unterbrochen um, erst 16 Jahre alt, als Freiwilliger in das niederländische Heer einzutreten. In den Kämpfen wider die Spanier, wider Spinola und seine Räuberschaaren in der Pfalz und am Rhein, dann in den Treffen bei Grol (1627), Herzogenbusch (1629) und im weitern Verlaufe des Krieges zum Tage von Rheinberg (1633) hatte er sich Ruhm und Ehren erworben; im Jahre 1636 ernannte ihn die holländische westindische Compagnie auf fünf Jahre zum Generalgouverneur und Ober-Admiral aller ihrer Besitzungen in Brasilien. In diesem Lande, wo er nun acht Jahre lang verwaltete, eroberte und organisirte, war seine Regierung musterhaft durch Staatsklugheit, Weisheit und Toleranz. Er wurde der Erbauer von Freiburg, Boavista, Recief, Moritzstadt und Moritzschloß; er erbaute die erste Sternwarte in der neuen Welt. Die Ergebnisse seiner, den Naturwissenschaften zugewandten Studien legte er nieder in der zu Amsterdam 1643 gedruckten Historia naturalis Brasiliae und einem im Berliner Museum befindlichen handschriftlichen Werke, von seiner eigenen Hand geschrieben. Als 1644 sich unter den Direktoren der westindischen Compagnie kurzsichtige Eifersucht und politische Motive geltend machten, welche dahin führten, daß Johann Moritz aus seiner Stellung abberufen wurde, war der baldige Verfall der Colonie die Folge dieser stupiden Maßregel. Der Fürst aber wurde von den Generalstaaten zum Generallieutenant ihrer Cavallerie ernannt; in dieser Stellung erbaute er sich das Moritzhaus im Haag, welches noch heute die Antiquitäten und Kunstschätze der holländischen Residenzstadt enthält. Aber nur drei Jahre blieb Johann Moritz in dieser letzteren, da der große Kurfürst von Brandenburg ihn zu seinem Statthalter in den Landen Cleve, Mark und Ravensberg ernannte. Zehn Jahre später kam noch die Verwaltung des Fürstenthums Minden hinzu. Das Walten unseres großen Staatsmannes erstrebte nun mit dem glücklichsten Erfolge das, was diesen durch den 30jährigen Krieg so stark mitgenommenen Ländern zunächst noth that, die Rettung aus Zuständen voll unsäglicher Verwirrung und Elend, und sodann ihre organische Verbindung mit dem brandenburgisch-preußischen Staatswesen. Die hier erworbenen Verdienste des großen Statthalters wurden 1652 gelohnt durch das Herrnmeisterthum des Johanniter-Ordens zu Sonnenburg. Ohne sein Ansuchen wurde er zugleich vom Kaiser Ferdinand III. mit den übrigen Gliedern des Hauses Nassau in den Reichsfürstenstand erhoben, den Elephanten-Orden, den man auf allen seinen Bildnissen sieht, hat ihm 1657 der König von Dänemark verliehen.
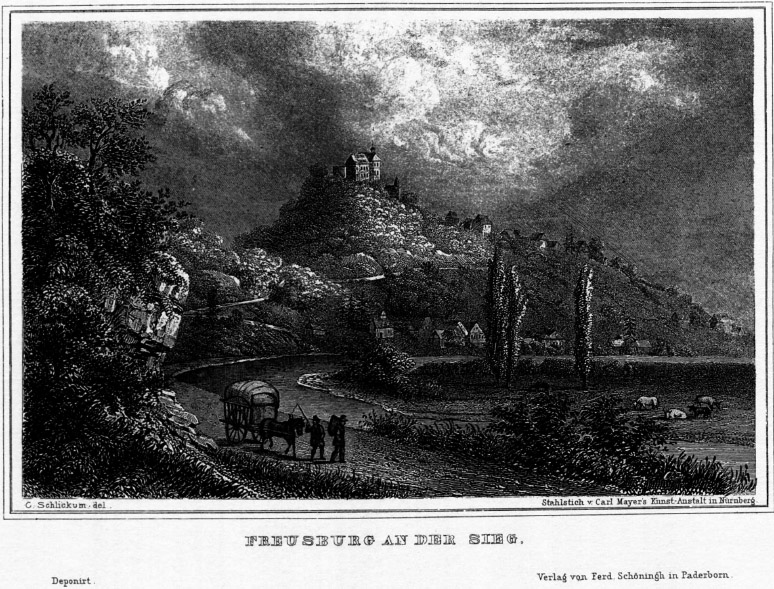
Als die Niederländer in ihren Krieg mit dem Bischof Christoph Bernhard von Galen geriethen, wurde Johann Moritz mit der Führung ihrer Truppen betraut und drängte den kriegerischen Kirchenfürsten siegreich zurück. Im Jahre 1672 rettete er Amsterdam selbst durch die heldenmüthige Vertheidigung des zwei Stunden davon entfernt liegenden Forts von Muiders, das mit Hülfe der Wasserfluthen, die durch die durchstochenen Deiche sich um den Ort ergossen, wider ein Heer von 140,000 Franzosen unter Condé und Turenne behauptet wurde. In der blutigen Schlacht von Senef (1674), in welcher er als Feldmarschall commandirte, gewann Johann Moritz die letzten Lorbeern; er zog sich bald nachher nach seinem Statthaltersitz in Cleve zurück, wo er in seiner bescheidenen Wohnung, »zu Berg und Thal,« Bergenthal, am 20. Dezember 1679 starb. Als Erinnerung an ihn bewahrt noch die Nikolaikirche zu Siegen eine von ihm geschenkte silberne Taufschüssel auf, welche er von einem bekehrten Afrikanischen Könige am Congo erhielt, und die wegen einer hieroglyphischen Randschrift merkwürdig ist. Johann Moritz hat auch den Thurm dieser Nikolai-Kirche mit einer offenen bequem zu ersteigenden Gallerie versehen lassen, welche ein prachtvolles Panorama überschauen läßt.
Siegen ist bekanntlich, wie es die neueste Forschung unzweifelhaft festgestellt, der Geburtsort von P. P. Rubens, der hier am 28. Juni 1577 das Licht der Welt erblickte.
Schmucke neue Gebäude außerhalb der alten Stadtmauern, Gartenanlagen und Baumpflanzungen machen das Thal der Sieg äußerst freundlich; weiter hinab wird es von immer höhern Bergen umgeben, die theils felsig, theils von Eichen- und Buchenwaldungen bedeckt, von Dörfern, Mühlen und Hüttenwerken umlagert, ihren Fuß auf den Teppich frischgrüner Wiesen stellen. Rechts abwärts liegt der Hohenseelbach mit seinen Säulenfelsen, sechsseitigen Riesenkrystallen, die den abgeschnittenen Kegel des Berges überragen, und tönen wie eine gewaltige Aeolsharfe, wenn der Wind den hellen Silberklang des Basalts weckt. Siegen gegenüber am linken Ufer der Sieg steht der Heusling mit der schönen Aussicht auf die Thürme und Schlösser und schieferbedeckten Häuser der steilen Bergstadt, das lebenerfüllte Sieg- und das Weißthal und die Ferndorf, auf den Kindelsberg und die Martinshard gen Norden und Osten; auf den Giebelwald mit hochragenden Fichten; im Südwesten seitwärts daneben das gebogene Horn der Gemswart, von der man sagt, daß sich ihre gerade Felsenspitze an einem Ostermorgen bei Sonnenaufgang nach Nordosten geneigt habe, um für einen Ritter in Schelden, der mit einem andren Ritter im Rechtsstreite lag, so ein Zeugniß, ein Gottesurtheil abzugeben.
Die Ufer der Sieg werden abwärts immer schöner, höher und steiler, auf den Kuppen ihrer Berge mächtige Basaltmassen tragend; auf einem steilen Berggipfel, dessen Fuß der Fluß benetzt, liegt die alte noch bewohnbare Veste Freusburg, die letzte, die wir ersteigen, um ihrer Aussicht auf das Siegthal, das Städtchen Kirchen, die Höhen des Siegerlandes und des Westerwaldes willen; sie ist ein Schloß der Grafen von Sayn, in der Sayn-Altenkirchenschen Hälfte des Siegener Landes, die einst Sachsen-Eisenach und nach ihm Brandenburg-Onolzbach besaß. Die Geschichte ihrer alten Besitzer bietet eine wirre Genealogie dar, fast ebenso kraus, wie jene der frühern Herrn der Grafschaft Siegen, die schon den Grafen von Laurenburg gehörte, als sie 1159 anfingen, sich von Nassau zu schreiben. Vielfach unter verschiedene Linien getheilt, sah sie sich 1806 unter Wilhelm Friedrich von Oranien-Nassau vereinigt, der aber durch einen Staatsvertrag 1815 seine Nassauischen Länder (gegen das Großherzogthum Luxemburg) an die Krone Preußen abtrat, welche endlich 1817 aus dem ganzen Siegerlande einen Kreis bildete und ihn zum Regierungsbezirk Arnsberg schlug. –
Wir stehen am Ende unsrer Wanderung; die Wünschelruthe in unsrer Hand, die von der alten Domstadt Minden bis hierher, über die eigentlichen Marken des Vaterlandes hinaus, auf so manchen hellsprudelnden Quell der Poesie und Romantik wies, ist müde geworden und will nicht frisch wie früher mehr anschlagen. Aber weigert sie auch den Dienst als Quellenfinderin, wir bedürfen ihrer nicht, um einen Born immer in frischem Strömen zu finden, den Born des Heimathgefühls und der Heimathliebe in uns selber. Wie der Gedanke den starren Stoff, der innere Sinn die That, hebt das Heimathgefühl das Vaterland in das Reich der Poesie hinauf. Seid ihr ohne dieses Gefühl, hat das Leben es in euch erstickt, so wirft euch der Zufall auf einer fremden Erde, in einer fremden Welt umher, die euch feindlich kalt, dem sehnsüchtigen Suchen eurer Seele stumm bleibt und euch weiter schleudert wie eine Welle, einem fernen unbekannten Ocean zu – arme Cosmopoliten mit einem armen Surrogatgotte, dem Pan! Ist dies Gefühl dagegen euch treu geblieben, so wurzelt euer Sein auf einem von Poesie überschleierten Grunde, über dem wie ein süßer Tuft das Illusionenreiche Träumen eurer frühesten Tage, alle die frommen Wünsche und Empfindungen eurer reinsten heiligsten Lebensstunden liegen. Eurem Sein, eurem ganzen Leben bleibt mit dem Heimathgefühl etwas wie der Schutz der Mutterbrust.
L. Schücking.
![]()