
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
§ 1. Philal. Es gibt eine Art von Sätzen, welche unter dem Namen von Maximen oder Axiomen als die Prinzipien der Wissenschaften gelten, und man hat sich, weil sie durch sich selbst evident sind, begnügt, sie eingeborene zu nennen, ohne daß, soviel ich weiß, jemals jemand versucht hätte, die Ursache und den Grund ihrer außerordentlichen Klarheit, die uns sozusagen zwingt, ihnen unsere Zustimmung zu geben, ersichtlich zu machen. Gleichwohl ist es nicht unnütz, in eine Untersuchung hierüber einzutreten und zuzusehen, ob diese große Evidenz jenen Sätzen allein eigen ist, wie auch zu prüfen, bis zu welchem Grade sie zu unseren übrigen Erkenntnissen beitragen.
Theoph. Diese Untersuchung ist sehr nützlich und sogar wichtig. Aber Sie dürfen nicht glauben, daß sie gänzlich vernachlässigt worden ist. Sie werden an hundert Stellen finden, daß die Scholastiker von diesen Sätzen gesagt haben, sie seien ex terminis evident, sobald man die Termini, d. h. die Ausdrücke versteht, so daß sie also überzeugt waren, daß ihre Überzeugungskraft in dem Verständnis der Termini, d. h. in der Verknüpfung zwischen den zu diesen gehörigen Ideen gegründet sei. Die Geometer aber haben viel mehr geleistet: denn sie haben sehr häufig unternommen, die Axiome zu beweisen. Proklus schreibt schon dem Thales von Milet, einem der ältesten aller bekannten Geometer, die Absicht zu, Sätze, welche Euklides nachher als evident vorausgesetzt hat, zu beweisen. Man berichtet, daß Apollonius andere Axiome bewiesen hat, und Proklus tut es auch. Der verstorbene Roberval wollte, als er schon ein Achtziger oder nahezu ein Achtziger war, neue Elemente der Geometrie veröffentlichen, wovon ich Ihnen, wie ich glaube, schon einmal geredet habe. Vielleicht hatten die »neuen Elemente« Arnaulds, welche damals Aufsehen erregten, ihn mit dazu bestimmt Über Antoine Arnaulds »Elements de Géométrie«, eine kritische Darstellung und Revision der Elemente des Euklid s. Sainte Beuve, Port Royal, 5e édit., III, 556 f.. Er trug etwas davon in der Kgl. Akademie der Wissenschaften vor, und einige machten dagegen Einwendungen, daß er mit Voraussetzung des Axioms: » Gleiches zu Gleichem hinzugefügt, gibt Gleiches«, jenes andere Axiom, das man als gleich evident anzusehen pflegt, daß nämlich wenn man Gleiches von Gleichem abzieht, Gleiches bleibt, beweisen wollte. Man behauptete, daß er entweder beide Sätze voraussetzen oder beide beweisen müßte. Ich aber war nicht dieser Meinung und glaubte, es sei schon immer etwas gewonnen, wenn man die Zahl der Axiome vermindert hätte Vgl. oben S. 39 f.. Und zweifelsohne geht die Addition der Substraktion voraus und ist einfacher, weil die beiden Ausdrücke in der Addition, einer wie der andere, gebraucht werden, was bei der Substraktion nicht der Fall ist. Arnauld tat das Gegenteil von dem, was Roberval tat: er machte noch mehr Voraussetzungen als Euklid. Was nun die Maximen anbetrifft, so versteht man darunter bisweilen festgestellte Sätze, mögen sie nun evident sein oder nicht. Das mag für Anfänger, die durch große Bedenklichkeit aufgehalten werden würden, gut sein; aber wenn es sich um die Begründung der Wissenschaft handelt, so liegt der Fall anders. In dieser Weise sieht man die Sache oft in der Moral, ja selbst in der Logik, in den Topiken an, wo man einen guten Vorrat solcher Sätze findet, die jedoch zum Teil ziemlich unbestimmt und dunkel sind. Übrigens habe ich schon längst öffentlich und privatim ausgesprochen, daß es wichtig sei, alle unsere sekundären Axiome, deren man sich gewöhnlich bedient, dadurch zu beweisen, daß man sie auf die ursprünglichen, d. h. die unmittelbaren und unbeweislichen Axiome zurückführt, die ich letzthin und auch sonst die identischen genannt habe.
§ 2. Philal. Die Erkenntnis ist durch sich selbst evident, wenn man sich der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der Ideen unmittelbar bewußt wird. § 3. Aber es gibt Wahrheiten, die man nicht als Axiome anerkennt, und die doch nichtsdestoweniger durch sich selbst evident sind. Sehen wir einmal zu, ob die vier Arten der Übereinstimmung, von denen wir unlängst gesprochen haben (Kap. 1, § 3 und Kap. 3, § 7), nämlich die Einerleiheit, die Verknüpfung, die Relation und das wirkliche Dasein, uns solche liefern. § 4. Was die Einerleiheit oder die Verschiedenheit betrifft, so haben wir soviel evidente Sätze, als wir deutliche Ideen haben, denn wir können die eine von der anderen verneinen, wie z. B. wenn wir sagen: der Mensch ist kein Pferd, das Rote ist nicht blau usw. Übrigens ist es ebenso evident, zu sagen, was ist, ist; als zu sagen, ein Mensch ist ein Mensch.
Theoph. Allerdings, und wie ich schon bemerkt habe, ist es ebenso evident, auf ekthetische Weise S. oben Anm. 418. im besonderen zu sagen: A ist A, als im allgemeinen zu sagen: Man ist das, was man ist. Aber es ist, wie ich gleichfalls bereits bemerkt habe, nicht immer sicher, wenn man die Gegenstände verschiedener Ideen wechselseitig voneinander verneint. Wenn z. B. jemand sagen wollte: Das Dreiseitige (oder das, was drei Seiten hat) ist nicht dreiwinklig; weil in der Tat die Dreiseitigkeit nicht die Dreieckigkeit ist; oder, wenn jemand gesagt hätte: » Die Perlen des Slusius (von denen ich vorlängst gesprochen habe) S. oben Anm. 64 (Buch III). sind nicht Linien der kubischen Parabel«, so würde er sich geirrt haben, und doch würde seine Behauptung gar vielen evident erschienen sein. Der selige Hardy, Rat am Pariser Châtelet, ein ausgezeichneter Mathematiker und Orientalist und sehr bewandert in den alten Mathematikern, der Herausgeber des Kommentars des Marinos zu den Data des Euklid, war dermaßen überzeugt davon, daß der schiefe Schnitt des Kegels, den man Ellipse nennt, von dem schiefen Zylinderschnitt verschieden sei, daß der Beweis des Serenus ihm fehlerhaft erschien, und ich konnte ihm durch meine Gegenvorstellungen in dieser Hinsicht nichts abgewinnen; auch war er damals, als ich ihn sah, fast im Lebensalter Robervals, und ich ein noch sehr junger Mann: ein Unterschied, der mir ihm gegenüber keine große Überzeugungskraft geben konnte, obwohl ich sonst sehr gut mit ihm stand. Beiläufig zeigt dies Beispiel, was ein Vorurteil auch bei gescheiten Leuten vermag, denn das war er wirklich; wie denn von ihm in Descartes' Briefen mit Achtung gesprochen wird. Ich habe dies aber nur angeführt, um zu zeigen, wie man sich täuschen kann, indem man eine Idee von der anderen verneint, ohne sie zuvor, da wo es nötig ist, tief genug zergliedert zu haben Claude Hardy († 1678); die von ihm besorgte erste griechische Ausgabe der euklidischen »Data« mit latein. Übersetzung und Erläuterungen ist Paris 1625 erschienen. Das Werk des Severus von Antissa über den Zylinder- und Kegelschnitt kam zuerst 1696 in Pistoja zusammen mit dem des Apollonius von Perga heraus; soweit Hardy von ihm Kenntnis hatte, scheint diese sich – wie Schaarschmidt bemerkt – auf Mersennes Synopsis (Paris 1644) zu stützen. Mit Descartes stand Hardy in freundschaftlichem persönlichen und brieflichen Verkehr..
§ 5. Philal. Hinsichtlich der Verknüpfung oder Koëxistenz haben wir sehr wenig an sich selbst evidente Sätze; gleichwohl gibt es dergleichen, und solch ein durch sich selbst evidenter Satz scheint der zu sein, daß zwei Körper nicht zugleich an demselben Orte sein können.
Theoph. Viele Christen bestreiten dies, wie ich schon bemerkt habe; ja auch Aristoteles und alle diejenigen, die nach ihm wirkliche Verdichtungen im strengen Sinne annehmen, bei denen ein und derselbe Körper in seiner Gesamtheit auf einen kleineren Raum, als den, welchen er vorher erfüllt hatte, eingeschränkt wird, sowie diejenigen, die – wie es der verstorbene Comenius Die Physik des Comenius (1592-1671), die in dem Werk »Physicae ad lumen divinae reformatae Synopsis« Amstd. 1633 dargestellt ist, versucht Paracelsische und Aristotelische Anschauungen miteinander zu verschmelzen. in einem kleinen, eigens dazu geschriebenen Buche getan hat, – die moderne Naturlehre durch die Erfahrung mit der Windbüchse einschränken möchten, können dies nicht zugeben. Wenn Sie den Körper für eine undurchdringliche Masse nehmen, so wird Ihr Satz wahr sein, weil er alsdann identisch oder doch nahezu identisch sein wird; aber man wird Ihnen alsdann leugnen, daß der wirkliche Körper von solcher Art sei. Zum mindesten – wird man sagen – könnte Gott ihn anders machen, so daß man diese Undurchdringlichkeit, nur als der natürlichen Ordnung der Dinge entsprechend, zugesteht, die Gott eingerichtet, und von der die Erfahrung uns überzeugt hat, obgleich man übrigens zugeben muß, daß sie auch der Vernunft sehr gemäß ist.
§ 6. Philal. Was die Relationen der Modi anbetrifft, so haben die Mathematiker bloß über die Relation der Gleichheit mehrere Axiome gebildet, wie das, das Sie eben erwähnt haben, daß, wenn man Gleiches von Gleichem abzieht, der Rest gleich bleibt. Es ist aber, denke ich, nicht weniger evident, daß eins und eins gleich zwei sind; und daß, wenn man von den fünf Fingern der einen Hand zwei fortnimmt und ebenso zwei von den fünf Fingern der anderen Hand, die Zahl der übrigbleibenden Finger beiderseits die gleiche sein wird.
Theoph. Daß eins und eins zwei macht, ist eigentlich gesprochen keine Wahrheit, sondern ist die Definition von Zwei. Freilich ist hierin dies wahr und evident, daß es die Definition eines möglichen Gegenstandes ist. Was das Axiom des Euklides in seiner Anwendung auf die Finger der Hand betrifft, so will ich zugeben, daß das, was Sie von den Fingern sagen, ebenso leicht zu begreifen ist, als es sich von A und B einsehen läßt; aber man wählt eben, um nicht ein und dieselbe Sache oft zu wiederholen, eine allgemeine Bezeichnung, unter die man nachher nur zu subsumieren braucht. Sonst wäre dies so, wie wenn man die Rechnung in bestimmten Zahlen den allgemeinen Regeln vorzöge, wodurch man weniger erlangen würde, als möglich ist. Denn es ist von größerer Wichtigkeit, die allgemeine Aufgabe zu lösen: Zwei Zahlen zu finden, deren Summe eine gegebene Zahl gibt, und deren Differenz gleichfalls eine gegebene Zahl gibt, als nur zwei Zahlen zu suchen, deren Summe zehn und deren Unterschied sechs ausmacht. Denn verfahre ich bei der zweiten Aufgabe nach der Rechnungsart der Zahlenlehre vereint mit der der Buchstabenrechnung, so wird sich die Rechnung, wie folgt, gestalten: Es sei a + b = 10; a – b = 6. Addiert man nun die rechte Seite zu der rechten und die linke zu der linken, so ergibt sich a + b + a – b = 10 + 6, d. h. (da + b und – b einander aufheben) 2 a = 16 oder a = 8. Zieht man weiterhin die eine rechte Seite von der anderen rechten, die eine linke von der anderen linken ab, so ergibt sich (da a -b abziehen dasselbe ist, als -a + b dazu addieren), a + b – a + b = 10-6, d. h. 2 b = 4, oder b = 2. Ich hätte also in der Tat die verlangten a und b, welche gleich 8 und 2 sind, und die die Aufgabe lösen, d. h. deren Summe 10 und deren Differenz 6 ausmacht. Aber ich besitze damit noch nicht die allgemeine Methode für irgendwelche beliebige andere Zahlen, die man an Stelle von 10 oder 6 setzen könnte; eine Methode, die ich doch mit derselben Leichtigkeit, wie die zwei Zahlen 8 und 2, hätte finden können, wenn ich x und v an Stelle der Zahlen 10 und 6 gesetzt hätte. Denn verfährt man ebenso wie vorher, so wird man erhalten a + b + a – b = x + v, d. h. 2 a = x + v, oder a = ½ (x + v); und ferner a + b – a + b = x – v, d. h. 2 b = x – v, oder b = ½ (x – v). Diese Rechnung gibt den allgemeinen Lehrsatz oder Kanon, daß, wenn man zwei Zahlen sucht, deren Summe und Differenz gegeben ist, man für die größere der verlangten Zahlen nur die Hälfte der aus der gegebenen Summe und Differenz gewonnenen Summe, für die kleinere nur die Hälfte der Differenz zwischen der gegebenen Summe und Differenz zu nehmen hat. Man sieht auch, daß ich auf die Buchstaben hätte verzichten können, wenn ich die Zahlen wie Buchstaben behandelt hätte, d. h. wenn ich, statt 2 a = 16 und 2 b = 4 zu setzen, geschrieben hätte 2 a = 10 + 6, und 2 b = 10-6, was ergeben haben würde a = ½ (10 + 6) und b = ½ (10-6). Ich hätte alsdann in der besonderen Berechnung selbst die allgemeine Rechnungsweise gehabt, indem ich die Zeichen 10 und 6, wie wenn es die Buchstaben a und v gewesen wären, als allgemeine Zahlen genommen hätte, um auf diese Weise eine allgemeinere Wahrheit oder Methode zu erhalten; und nehme ich dann wieder dieselben Zeichen 10 und 6 für die Zahlen, welche sie in der Regel bezeichnen, so habe ich nunmehr ein sinnliches Beispiel vor mir, das mir sogar als Probe dienen kann. Wie nun Vieta die Buchstaben an Stelle der Zahlen gesetzt hat, um eine größere Allgemeinheit zu erlangen, so habe ich die Zahlzeichen wieder in die Algebra selbst einführen wollen, weil sie geeigneter sind als die Buchstaben. Ich habe dies bei großen Rechnungen von bedeutendem Nutzen gefunden, um Irrtümer zu verhüten, ja auch um Proben, wie z. B. die Neunerprobe, ohne das Resultat abzuwarten, mitten in der Rechnung anzustellen, wenn an Stelle der Buchstaben lediglich Zahlen vorkommen Die Bezeichnungsweise, auf die Leibniz hier anspielt, besteht darin, daß die Koeffizienten bestimmter Gleichungen nicht durch Buchstaben, sondern durch Zahlen, die indessen eine rein symbolische Bedeutung haben, wiedergegeben werden – ein Gedanke, der der Ausgangspunkt der Theorie der Determinanten geworden ist. Näheres bei Cantor, Gesch. der Mathematik3, III, 105 ff.; sowie bei Couturat, La Logique de Leibniz, Appendice III. – Zur »Neunerprobe« vgl. Band I, S. 21.. Dies Verfahren läßt sich oft anwenden, wenn man in der Stellung der Zahlzeichen mit Geschick verfährt, so daß die Voraussetzungen sich im besonderen Fall als wahr ausweisen; des Nutzens gar nicht zu gedenken, der darin liegt, daß man dabei Zusammenhänge und Gesetze bemerkt, welche die Buchstaben allein dem Geiste niemals so leicht enthüllen könnten, wie ich dies schon anderswo gezeigt habe, da ich gefunden, daß eine gute Charakteristik eines der größten Hilfsmittel des menschlichen Geistes ist.
§ 7. Philal. Was das wirkliche Dasein betrifft, das ich als die vierte Art der Übereinstimmung aufgezählt hatte, die man an den Ideen bemerken kann, so kann uns dasselbe kein Axiom liefern, denn wir haben nicht einmal eine demonstrative Erkenntnis der Wesen außer uns, Gott allein ausgenommen.
Theoph. Man kann immerhin sagen, daß der Satz: ich bin, von höchster Evidenz, oder auch, daß er eine unmittelbare Wahrheit ist, da er ein Satz ist, der durch keinen anderen bewiesen werden kann. Denn wenn man sagt: Ich denke, also bin ich, so heißt dies nicht eigentlich das Dasein durch das Denken beweisen, denn denken und denkend sein, ist ganz dasselbe, und wenn man sagt: ich bin denkend, so sagt man damit schon: ich bin. Indessen können Sie diesen Satz mit einigem Grunde aus der Zahl der Axiome ausschließen, denn es ist ein faktischer, auf eine unmittelbare Erfahrung begründeter Satz, nicht aber ein notwendiger, dessen Notwendigkeit in der unmittelbaren Übereinstimmung der Ideen eingesehen wird. Im Gegenteil: nur Gott allein sieht, wie die beiden Bestimmungen » Ich« und »Dasein« miteinander verbunden sind, d. h. warum ich da bin. Versteht man aber unter Axiomen allgemeine, unmittelbare oder unbeweisbare Wahrheiten, so kann man sagen, daß der Satz: » ich bin« ein Axiom ist, und auf jeden Fall kann man behaupten, daß er eine primitive Wahrheit ist, oder auch unum ex primis cognitis inter terminos complexos, d. h. einer der ersten erkannten Sätze, der sich in der natürlichen Ordnung unserer Erkenntnisse findet; denn es kann sein, daß jemand niemals daran gedacht haben mag, diesen Satz ausdrücklich zu bilden, der ihm gleichwohl eingeboren ist.
§ 8. Philal. Ich hatte immer geglaubt, daß die Axiome wenig Einfluß auf die übrigen Teile unserer Erkenntnis ausüben. Aber Sie haben mich eines anderen belehrt, da Sie mir sogar einen wichtigen Nutzen der identischen Sätze gezeigt haben. Erlauben Sie mir indes, Ihnen die Meinung, die ich über diesen Punkt hatte, nochmals vorzutragen, denn Ihre Erläuterungen können dazu dienen, auch andere von ihrem Irrtum zurückzubringen. § 8. Es ist eine berühmte Schulregel, daß alle Beweisführung von schon Bekanntem und Zugegebenem ausgeht (ex praecognitis et praeconcessis) S. oben Anm. 13 (Buch IV).. Nach dieser Regel scheint man jene Maximen als Wahrheiten ansehen zu müssen, die dem Geiste vor den übrigen bekannt sind, während man die übrigen Teile unserer Erkenntnis als von den Axiomen abhängige Wahrheiten anzusehen hätte. Ich dagegen glaubte gezeigt zu haben (Buch 1, Kap. I, daß jene Axiome nicht das zuerst Erkannte sind, da ein Kind viel eher erkennt, daß die Rute, die ich ihm zeige, nicht der Zucker ist, den es gekostet hat, als es irgendein beliebiges Axiom erkennt. Sie haben jedoch einen Unterschied zwischen den besonderen Erkenntnissen oder faktischen Erfahrungen und zwischen den Prinzipien einer allgemeinen und notwendigen Erkenntnis gemacht (bei welcher letzteren man, wie ich anerkenne, auf die Axiome zurückgehen muß), wie auch zwischen zufälliger und natürlicher Ordnung.
Theoph. Ich hatte noch hinzugefügt, daß in der natürlichen Ordnung eher gesagt werden muß: ein Ding ist, was es ist, als: es ist kein anderes, denn es handelt sich hier nicht um die Geschichte unserer Entdeckungen, die bei verschiedenen Menschen verschieden ist, sondern um die Verknüpfung und natürliche Ordnung der Wahrheiten, welche immer dieselbe ist. Ihre Bemerkung aber, daß nämlich, was das Kind sieht, nur eine Tatsache ist, verdient noch weitere Überlegung, denn die Erfahrungen der Sinne geben nach Ihrer eigenen unlängst gemachten Bemerkung keine absolut gewissen Wahrheiten, noch solche, bei denen jede Gefahr einer Täuschung ausgeschlossen ist. Denn wenn es erlaubt ist, metaphysisch mögliche Erdichtungen zu machen, so könnte sich der Zucker auf unmerkliche Weise in eine Rute verwandeln, um das Kind, wenn es unartig gewesen, zu strafen, wie sich, wenn es artig gewesen ist, das Wasser bei uns am Weihnachtsabend in Wein verwandelt. Aber immerhin – werden Sie sagen – wird der Schmerz den die Rute verursacht, niemals das Vergnügen sein, welches der Zucker gibt. Ich antworte: das Kind wird ebenso spät darauf kommen, einen ausdrücklichen Satz daraus zu machen, als das Axiom zu bemerken, daß man in Wahrheit nicht behaupten könne, daß das, was ist, zu gleicher Zeit nicht sei, – obwohl es des Unterschiedes von Lust und Schmerz sich sehr wohl bewußt sein kann, ebensowohl als des Unterschiedes von Bewußtsein und Nichtbewußtsein.
§ 10. Philal. Indessen gibt es eine Menge anderer Wahrheiten, welche ebenso wie jene Maximen durch sich selbst evident sind. Z. B. ist der Satz: Eins und zwei ist gleich drei, ebenso evident als das Axiom, das besagt, daß das Ganze allen seinen Teilen zusammengenommen gleich ist.
Theoph. Sie scheinen vergessen zu haben, daß ich Ihnen mehr als einmal gezeigt habe, daß der Satz: Eins und zwei ist drei, nur die Definition des Ausdrucks drei ist; so daß, wenn man sagt, daß eins und zwei gleich drei sind, man damit nichts anderes sagt, als daß eine Sache sich selbst gleich ist. Was jenes Axiom betrifft, daß das Ganze allen seinen Teilen zusammengenommen gleich ist, so hat Euklid sich desselben nicht ausdrücklich bedient. Auch bedarf dieses Axiom einer Einschränkung; denn man muß hinzufügen, daß diese Teile selbst keinen gemeinsamen Teil haben dürfen, denn 7 und 8 sind Teile von 12, aber geben zusammen mehr als 12. Büste und Rumpf zusammengenommen sind mehr als der Mensch, insofern die Brust beiden gemeinsam ist. Euklid aber sagt: das Ganze ist größer als sein Teil, wobei keine weitere Vorsicht nötig ist. Und wenn man sagt, daß der Körper größer ist als der Rumpf, so macht dies nur insofern einen Unterschied gegen das Axiom des Euklides, als dieses Axiom sich auf das Notwendige beschränkt; aber indem man ein bestimmtes Beispiel für es anführt und ihm gleichsam einen Körper gibt, so erreicht man damit, daß das Verstandesmäßige auch sinnlich faßbar wird. Denn wenn man sagt, dies bestimmte Ganze sei größer, als dieser sein bestimmter Teil, so ist dies in der Tat der Satz, daß ein Ganzes größer ist als sein Teil, doch sind seine einzelnen Züge stärker aufgetragen und dadurch hervorgehoben: so wie der, der A B sagt, auch A sagt. Man muß also hier das Axiom und das Beispiel nicht als in dieser Hinsicht verschiedene Wahrheiten zueinander in Gegensatz stellen, sondern das Axiom gleichsam als in dem Beispiel verkörpert und als seine Wahrheit ausmachend ansehen. Etwas anderes ist es, wenn die Evidenz nicht im Beispiele selbst ersichtlich ist und die Behauptung, die in dem Beispiel ausgesprochen wird, eine Folge und nicht bloß eine Subsumption (ein spezieller Fall) des allgemeinen Satzes ist, wie dies auch hinsichtlich der Axiome vorkommen kann.
Philal. Unser gelehrter Verfasser sagt hier: Ich möchte diejenigen, welche jede andere Erkenntnis, als die der Tatsachen, von allgemeinen angeborenen und aus sich evidenten Prinzipien abhängig sein lassen, fragen, welches Prinzip sie nötig haben, um zu beweisen, daß zwei und zwei vier ist? Denn seiner Ansicht nach erkennt man die Wahrheit derartiger Sätze ohne die Hilfe irgendeines Beweises. Was sagen Sie dazu?
Theoph. Ich sage, daß ich Sie auf diesem Felde wohl gerüstet erwartet habe. Daß zwei und zwei vier ist, ist keine völlig unmittelbare Wahrheit: wenn nämlich vier soviel bedeutet, als drei und eins. Man kann diese Wahrheit demnach beweisen, und zwar folgendermaßen.
Definitionen.
|
1. Zwei ist eins und eins,
|
Axiom.
Wenn man Gleiches an die Stelle von Gleichem setzt, so bleibt die Gleichheit bestehen.
Beweis.
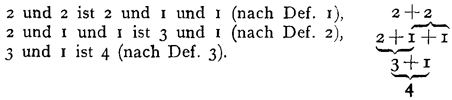
Also (nach dem Axiom) ist 2 und 2 = 4. Was zu beweisen war.
Ich hätte, statt zu sagen, daß 2 und 2 2 und 1 und 1 ist, auch sagen können, daß 2 und 2 gleich 2 und 1 und 1 ist, und so das übrige. Aber man kann dies, der größeren Vollständigkeit halber, überall gleichzeitig mit darunter verstehen, und zwar auf Grund eines anderen Axioms, wonach jedes Ding sich selbst gleich oder wonach das, was dasselbe ist, auch gleich ist.
Philal. So wenig nötig dieser Beweis auch im Hinblick auf seinen allbekannten Schlußsatz sein mag, so dient er doch dazu, ersichtlich zu machen, wie die Wahrheiten von den Definitionen und Axiomen abhangen. Ich sehe mithin schon voraus, was Sie auf mehrere Einwürfe gegen die Anwendung der Axiome erwidern werden. Man macht den Einwurf, daß es eine zahllose Menge von Prinzipien geben müßte, aber dies gilt nur, wenn man Folgesätze, welche sich mit Hilfe irgendeines Axioms aus den Definitionen ergeben, zu den Prinzipien zählt. Und da der Definitionen oder Ideen unzählige sind, so müssen es die Axiome, in diesem Sinne genommen, auch sein, selbst wenn man mit Ihnen annimmt, daß die unbeweislichen Grundsätze identische Axiome sind. Sie werden auch durch die Anwendung auf verschiedene Beispiele unendlich mannigfaltig, im Grunde genommen aber kann man die Sätze: A ist A, B ist B als ein und dasselbe Prinzip ansehen, das nur verschieden ausgedrückt ist.
Theoph. Überdies kann ich, da es verschiedene Grade der Evidenz gibt, Ihrem berühmten Autor nicht zugeben, daß alle jene Wahrheiten, welche man Prinzipien nennt, und die man als durch sich selbst evident ansieht, weil sie den ersten, unbeweisbaren Axiomen so nahe stehen, voneinander wirklich ganz unabhängig sind und daher gegenseitig voneinander kein Licht und keinen Beweis empfangen können. Denn man kann sie immer entweder auf die Axiome selbst oder auf andere, den Axiomen näherliegende Wahrheiten zurückführen, wie jener Satz, daß zwei und zwei vier ist, Ihnen gezeigt hat. Auch habe ich Ihnen eben schon erzählt, wie Roberval die Zahl der euklideischen Axiome verringerte, indem er mitunter ein Axiom auf ein anderes zurückführte.
§ 11. Philal. Der scharfsinnige Schriftsteller, welcher zu unseren Unterredungen die Veranlassung gegeben hat, gesteht, daß die Maximen ihren Nutzen haben; er glaubt aber, daß dieser eher darin besteht, den Widerspenstigen den Mund zu stopfen, als die Wissenschaften zu begründen. Ich möchte gern – so sagt er –, daß man mir irgendeine dieser Wissenschaften zeigte, die sich auf diesen allgemeinen Axiomen aufbaut und von der sich nicht dartun ließe, daß sie nicht ebensogut auch ohne Axiome bestehen könnte.
Theoph. Die Geometrie ist ohne Zweifel eine von diesen Wissenschaften. Euklid wendet die Axiome ausdrücklich in den Beweisen an, und jenes Axiom: daß zwei homogene Größen einander gleich sind, wenn die eine weder größer noch kleiner als die andere ist, ist die Grundlage der Beweise des Euklid und des Archimedes hinsichtlich der Größe krummliniger Figuren. Archimedes hat Axiome angewendet, deren Euklid nicht bedurfte, z. B. daß von zwei Linien, von denen jede ihre Krümmung stets an derselben Seite hat, diejenige die größere ist, welche die andere umschließt. Auch kann man in der Geometrie die identischen Axiome nicht entbehren, wie z. B. das Prinzip des Widerspruchs oder die indirekten Beweise. Was die anderen Axiome betrifft, welche sich daraus beweisen lassen, so könnte man, ganz streng genommen, auf sie verzichten und die Folgerungen unmittelbar aus den identischen Sätzen und Definitionen ziehen, aber die Länge der Beweise und die endlosen Wiederholungen, in welche man dann verfiele, würden eine furchtbare Verwirrung verursachen, wenn man immer wieder ab ovo anfangen müßte, – während man bei Voraussetzung der schon bewiesenen Mittelsätze leicht weiter kommt. Diese Voraussetzung schon bekannter Wahrheiten ist besonders hinsichtlich der Axiome von Nutzen; denn diese kehren so oft wieder, daß die Geometer sich ihrer in jedem Augenblick bedienen müssen, ohne sie zu zitieren, so daß man sich täuschen würde, wenn man glaubte, daß sie nicht mitwirken, weil man sie vielleicht nicht immer am Rande angeführt sieht.
Philal. Unser Autor hält uns indessen das Beispiel der Theologie entgegen. Aus der Offenbarung, sagt er, stammt unsere Kenntnis dieser heiligen Religion, und die Maximen wären, ohne deren Hilfe, niemals imstande gewesen, uns mit ihr bekannt zu machen. Die Erleuchtung kommt uns also unmittelbar aus den Sachen selbst oder unmittelbar aus der unfehlbaren Wahrhaftigkeit Gottes.
Theoph. Das ist ebenso, als ob ich sagte, die Medizin gründet sich auf die Erfahrung, also dient die Vernunft dabei zu nichts Vgl. hierzu z. B. Gerh. VII, 198: »Alles, was wir mit Gewißheit erkennen, beruht entweder auf Beweisen oder auf Erfahrungen: und in beiden Fällen regiert die Vernunft. Denn die Kunst, Erfahrungen anzustellen und sie zu gebrauchen, stützt sich selbst auf sichere Vernunftgründe, sofern sie nämlich nicht vom bloßen Glück oder Zufall abhängt.«. Die christliche Theologie, welche die wahre Medizin der Seelen ist, gründet sich auf die Offenbarung, welche der Erfahrung entspricht; aber um daraus ein vollständiges Ganze zu machen, muß man die natürliche Theologie hinzufügen, die aus Axiomen der ewigen Vernunft gewonnen wird. Ist nicht selbst jener Grundsatz, daß die Wahrhaftigkeit ein Attribut Gottes ist, auf welchem, wie Sie anerkennen, die Gewißheit der Offenbarung beruht, eine aus der natürlichen Theologie hergenommene Maxime?
Philal. Unser Verfasser verlangt, daß man zwischen dem Mittel, eine Erkenntnis zu erlangen, und dem, sie zu lehren, oder auch zwischen lehren und mitteilen unterscheide. Nachdem man die Schulen errichtet und Professoren angestellt hatte, um Wissenschaften, welche andere erfunden hatten, zu lehren, so bedienten diese Professoren sich jener Maximen, um die Wissenschaften dem Geiste ihrer Schüler einzuprägen und diese mittels der Axiome von gewissen besonderen Wahrheiten zu überzeugen; den ersten Erfindern aber haben umgekehrt die besonderen Wahrheiten dazu gedient, die Wahrheit, ohne die allgemeinen Maximen, zu finden.
Theoph. Ich wünschte, daß man uns das Verfahren, das man hier vorgibt, durch das Beispiel einiger besonderer Wahrheiten gerechtfertigt hätte. Erwägt man indes die Sache genau, so wird man sie in der Begründung der Wissenschaften nicht bestätigt finden. Wenn der Erfinder nur eine besondere Wahrheit findet, ist er nur zur Hälfte Erfinder. Hätte Pythagoras nur die Beobachtung gemacht, daß das Dreieck, dessen Seiten 3, 4, 5 sind, die Eigenschaft habe, daß das Quadrat seiner Hypotenuse denen seiner beiden Katheten gleich sei (d. h. daß 9 + 16 25 mache): wäre er darum der Entdecker jener großen Wahrheit gewesen, welche alle rechtwinklige Dreiecke umfaßt und die bei den Geometern zu einer Maxime geworden ist? Allerdings kann häufig ein durch Zufall ins Auge gefaßtes Beispiel einem geistreichen Manne zur Veranlassung dienen, eine allgemeine Wahrheit zu suchen; aber sie zu finden macht oft noch Schwierigkeit genug. Außerdem ist dieser Weg des Entdeckens nicht der beste, noch derjenige, der von denen, welche ordentlich und methodisch verfahren, vorzüglich angewandt wird; vielmehr benutzen diese ihn nur bei solchen Gelegenheiten, wo bessere Methoden mangeln. So haben manche geglaubt, daß Archimedes die Quadratur der Parabel dadurch gefunden habe, daß er ein parabolisch geschnittenes Stück Holz wog und daß diese besondere Erfahrung ihn die allgemeine Wahrheit finden ließ; wer aber den Scharfsinn dieses großen Mannes kennt, sieht wohl ein, daß er einer solchen Hilfe nicht bedurfte. Selbst wenn indessen dieser empirische Weg der besonderen Wahrheiten die Veranlassung gewesen wäre, alle Entdeckungen zu machen, so wäre er doch nicht genügend gewesen, um sie zu geben; und die Entdecker selbst sind lebhaft befriedigt gewesen, die Maximen und allgemeinen Wahrheiten zu bemerken, wenn sie zu denselben haben gelangen können; sonst wären ihre Entdeckungen sehr unvollkommen gewesen. Alles also, was man den Schulen und den Professoren zuschreiben kann, besteht darin, daß sie die Maximen und die anderen allgemeinen Wahrheiten gesammelt und geordnet haben: und wollte Gott, daß man es noch mehr und mit mehr Sorgfalt und Auswahl gemacht hätte, dann würden die Wissenschaften sich nicht in so schlechtem Zusammenhange und in so großer Verwirrung befinden. Übrigens gebe ich zu, daß zwischen der Methode, deren man sich zur Unterweisung in den Wissenschaften bedient, und der, durch welche man sie findet, oft ein Unterschied besteht, das ist aber nicht der Punkt, um welchen es sich hier handelt. Bisweilen bietet, wie ich schon bemerkt habe, der Zufall Gelegenheit zu Entdeckungen dar. Wenn man diese Veranlassungen bemerkt und ihr Andenken der Nachwelt aufbewahrt hätte (was sehr nützlich gewesen wäre), so wären diese Einzelheiten ein sehr wichtiger Teil der Geschichte der Wissenschaften gewesen, aber sie wären nicht geeignet gewesen, um die Systeme der Wissenschaften auf sie zu gründen. Mitunter sind auch die Entdecker zwar rationell, aber auf großen Umwegen zur Wahrheit fortgeschritten. Ich finde, daß bei wichtigen Fällen die Schriftsteller dem Publikum einen Dienst geleistet hätten, wenn sie in ihren Schriften die Art, wie sie auf die Spur ihrer Versuche geleitet wurden, aufrichtig angemerkt hätten; wenn aber das System der Wissenschaft nach diesem Maße hätte gebaut werden sollen, so wäre dies ebenso, als wenn man bei einem fertigen Hause das ganze Baugerüst, das der Baumeister zur Aufrichtung desselben nötig gehabt hat, stehen lassen wollte. Die guten Methoden des Unterrichts sind immer von der Art, daß die Wissenschaft auf ihrem Wege mit Sicherheit hätte gefunden werden können, und wenn sie alsdann nicht bloß empirisch sind, d. h. wenn die Wahrheiten durch Gründe oder durch Beweise, aus den Ideen selbst, gelehrt werden, so wird dies immer durch Axiome, Theoreme, Richtsätze (Canones) und andere solche allgemeine Sätze geschehen. Etwas anderes ist es, wenn die Wahrheiten Aphorismen sind, wie die des Hippokrates, d. h. faktische Wahrheiten, welche entweder im allgemeinen oder mindestens in den meisten Fällen richtig sind, und die durch Beobachtung gewonnen werden oder sich auf Erfahrung stützen, für die man aber völlig überzeugende Gründe nicht besitzt Über den Begriff der Aphorismen« vgl. Band I Anm. 27.. Aber darum handelt es sich hier nicht, denn diese Wahrheiten werden nicht durch die Verknüpfung der Ideen selbst erkannt.
Philal. Das Bedürfnis nach Maximen hat sich nach der Ansicht unseres geistreichen Autors auf folgende Art geltend gemacht. Da die Schulen als Probierstein der Geschicklichkeit der Gelehrten die Disputierkunst aufgestellt hatten, so schrieben sie demjenigen den Sieg zu, der den Kampfplatz behauptete und dem das letzte Wort blieb. Um aber ein Mittel zu haben, die Widerspenstigen zu überführen, mußte man die Maximen aufstellen.
Theoph. Die Schulen der Philosophie hätten ohne Zweifel besser daran getan, die Praxis mit der Theorie zu verbinden, wie es die Schulen der Medizin, der Chemie und der Mathematik machen, und lieber demjenigen den Preis zu erteilen, dessen Tun, besonders in der Moral, nicht dessen Reden das beste gewesen wäre. Da es indessen Gegenstände gibt, wo die Rede selbst schon ein Effekt, ja mitunter der einzige Effekt und das Meisterstück ist, aus dem sich die Geschicklichkeit jemandes erkennen läßt, wie in den metaphysischen Gegenständen, so hat man in einigen Fällen recht gehabt, die Geschicklichkeit der Gelehrten nach dem Erfolg zu beurteilen, den sie in ihren Vorträgen gehabt haben. Bekanntlich haben sogar zu Anfang der Reformation die Protestanten ihre Gegner zu Unterredungen und Disputationen herausgefordert, und die öffentliche Meinung hat bisweilen nach dem Erfolg dieser Dispute ihren Schluß zugunsten der Reformation gezogen. Man weiß auch, was die Kunst zu reden und den Gründen Licht und Kraft zu verleihen, kurz, wenn man sie so nennen kann, die Disputierkunst in einem Staats- oder Kriegsrate, an einem Gerichtshofe, bei einer ärztlichen Konsultation, ja selbst in einer Unterhaltung vermag. Man ist genötigt, zu diesem Mittel seine Zuflucht zu nehmen und sich in diesen Fällen mit Worten statt mit Taten zu begnügen, – eben deshalb, weil es sich hier um ein zukünftiges Ereignis oder eine zukünftige Tatsache handelt, bei der es zu spät wäre, wenn man die Wahrheit erst durch den Erfolg erfahren wollte. Daher ist die Kunst des Disputierens oder des Kämpfens mit Gründen (unter welche ich hier das Anführen von Autoritäten und Beispielen befasse) von sehr großer Wichtigkeit, aber unglücklicherweise ist sie sehr schlecht geregelt, weshalb man oft entweder gar keine oder falsche Schlüsse macht. Daher habe ich mehr als einmal den Plan gefaßt, Anmerkungen zu den Kolloquien der Theologen zu machen, über welche wir Berichte haben, um die Fehler, welche man darin bemerken kann, und die Mittel, die man gegen sie anwenden könnte, zu zeigen. In Beratungen pflegen gewöhnlich, wenn diejenigen, welche die meiste Macht haben, nicht einen sehr sicheren Verstand haben, Autorität oder Beredsamkeit die Oberhand zu behalten, auch wenn sie gegen die Wahrheit gerichtet sind. Mit einem Worte: die Kunst, zu beraten und zu disputieren, müßte völlig umgestaltet werden. Was den Vorteil desjenigen anbetrifft, welcher zuletzt spricht, so findet er fast nur in freien Umgangsgesprächen statt, denn bei Beratschlagungen gehen die Stimmen der Ordnung nach, mag man nun mit dem im Range Letzten anfangen oder endigen. Freilich ist es gewöhnlich Sache des Präsidenten, anzufangen und zu endigen, d. h. den Vorschlag zu machen und den Ausschlag zu geben, aber den letzteren gibt er nach der Mehrheit der Stimmen. In den akademischen Disputationen aber ist der Respondent oder Verteidiger derjenige, welcher zuletzt spricht, und er behauptet den Kampfplatz nach stehender Sitte fast immer. Es handelt sich darum, ihn auf die Probe zu stellen, nicht, ihn zu widerlegen, sonst hieße dies als Feind auftreten. Die Wahrheit zu sagen, handelt es sich bei diesen Gelegenheiten fast gar nicht um die Wahrheit, daher man zu verschiedenen Zeiten entgegengesetzte Thesen auf dem nämlichen Katheder verteidigt. Man zeigte dem Casaubonus einmal den Saal der Sorbonne und sagte ihm: Das ist der Ort, wo man so viele Jahrhunderte lang disputiert hat. Er antwortete: Was hat man denn herausgebracht?
Philal. Gleichwohl hat man verhindern wollen, daß die Disputation ins Unendliche gehe, und ein Mittel schaffen wollen, um zwischen zwei gleich erfahrenen Gegnern eine Entscheidung zu treffen, damit der Streit sich nicht in eine endlose Reihe von Syllogismen verliere. Dies Mittel nun bestand darin, gewisse allgemeine, meist durch sich selbst evidente Sätze einzuführen, die derart beschaffen waren, daß sie von allen Menschen mit völliger Übereinstimmung angenommen wurden, und die daher als allgemeine Maßstäbe der Wahrheit betrachtet werden und die Stelle von Prinzipien einnehmen mußten (wenn die Disputierenden keine anderen aufgestellt hatten): Prinzipien, über die man nicht hinausgehen durfte und an die man sich beiderseits zu halten verpflichtet war. Nachdem diese Maximen so den Namen von Prinzipien empfangen hatten, die man bei der Disputation nicht verleugnen durfte, und die den Streit endeten, nahm man sie – meinem Autor nach – irrtümlicherweise für die Quelle der Erkenntnisse und für die Grundlagen der Wissenschaften.
Theoph. Wollte Gott, daß man sie in Streitigkeiten so gebrauchte; dagegen wäre nichts einzuwenden, denn man würde doch etwas entscheiden. Und was könnte man Besseres tun, als den Streit, d. h. die bestrittenen Wahrheiten auf evidente und unbestreitbare Wahrheiten zurückzuführen? Würde man sie dadurch nicht auf demonstrative Weise begründen? Und wer kann zweifeln, daß diese Prinzipien, die den Streit durch Feststellung der Wahrheit endigen würden, zugleich die Quellen der Erkenntnisse wären? Denn wenn eine Schlußfolgerung bündig ist, so bleibt es sich gleich, ob man sie stillschweigend in seinem Studierzimmer anstellt oder öffentlich auf dem Katheder darlegt. Ja selbst wenn diese Prinzipien mehr Forderungen als Axiome wären – die Forderungen nicht im Sinne des Euklid, sondern des Aristoteles genommen, d. h. als Voraussetzungen, die man einstweilen zugestehen will, bis sich die Gelegenheit darbietet, sie zu beweisen –, so würden sie doch immer den Nutzen haben, daß alle übrigen Fragen dadurch auf eine kleine Anzahl von Sätzen zurückgeführt werden würden. Ich bin also außerordentlich erstaunt, hier aus irgendwelchem Vorurteil heraus etwas ganz Lobenswertes getadelt zu sehen: ein Fehler, dessen sich, wie man an dem Beispiel Ihres Autors sieht, die gescheitesten Leute aus Unachtsamkeit schuldig machen. Unglücklicherweise geht es bei den akademischen Disputationen ganz anders zu. Statt allgemeine Axiome aufzustellen, tut man alles Mögliche, um sie durch nichtige und schlecht verstandene Distinktionen abzuschwächen und gefällt sich darin, gewisse philosophische Regeln anzuwenden, mit denen man zwar dicke Bücher füllt, die aber recht unsicher und unbestimmt sind, und denen man nach Belieben durch irgendwelche Distinktionen ausweichen kann. Das ist nicht das Mittel, die Streitigkeiten zu schlichten, sondern sie endlos zu machen und den Gegner schließlich zu ermüden. Es ist so, als wenn man ihn an einen dunklen Ort führte, wo man blindlings darauf losschlägt, und niemand über die Streiche urteilen kann. Eine wundervolle Erfindung für die Respondenten, welche sich verbindlich gemacht haben, gewisse Thesen zu verteidigen! Es ist ein Schild des Vulkan, der sie unverwundbar, ein Helm des Orkus oder Pluto, der sie unsichtbar macht. Sie müssen sehr ungeschickt oder sehr unglücklich sein, wenn man sie trotzdem beim Irrtum ertappen kann. Freilich gibt es Regeln, die Ausnahmen haben, besonders in Fragen, bei denen viele Umstände mit in Betracht kommen, wie in der Jurisprudenz. Um aber in diesem Fall den Gebrauch der Regeln sicher zu machen, müssen diese Ausnahmen ihrer Zahl und ihrem Sinne nach, soviel als möglich, bestimmt sein; und dann kann es vorkommen, daß die Ausnahme wieder selbst ihre Unterausnahmen, d. h. ihre Repliken hat, und die Replik Dupliken usw.; aber alles zusammengenommen müssen alle diese Ausnahmen und Unterausnahmen, wohl bestimmt und mit der Regel verbunden, die Allgemeinheit ergeben. Davon liefert die Jurisprudenz sehr bemerkenswerte Beispiele. Wenn aber diese mit Ausnahmen und Unterausnahmen beladenen Arten von Regeln bei den akademischen Disputationen in Anwendung gebracht werden sollten, so müßte man immer mit der Feder in der Hand disputieren, indem man gleichsam ein Protokoll darüber hielte, was von der einen und der anderen Seite gesagt wird. Und dies wäre auch sonst nötig, wenn man beständig in strenger Form durch mehrere Syllogismen hindurch, die zeitweilig mit Distinktionen vermischt wären, disputieren wollte, wobei das beste Gedächtnis von der Welt in Verwirrung geraten müßte. Aber man hütet sich, sich diese Mühe zu geben, in Syllogismen formell fortzuschreiten und sie zu registrieren, wenn die Wahrheit, um deren Entdeckung es sich handelt, keine Belohnung verspricht; ja man würde, selbst wenn man es wollte, nicht zum Ziele gelangen, es sei denn, daß die Distinktionen ausgeschlossen oder besser geregelt würden.
Philal. Dennoch ist, wie unser Verfasser bemerkt, die Schulmethode auch in die Unterredungen außerhalb der Schulen eingeführt worden, um auch hier den Nörglern den Mund zu stopfen, und hat hier eine schlimme Wirkung gehabt. Denn sobald man die vermittelnden Ideen besitzt, kann man deren Verknüpfung ohne Hilfe der Maximen, und ehe sie vorgebracht worden sind, erkennen, und dies würde für aufrichtige und verträgliche Leute genügen. Aber da die Methode der Schulen die Leute berechtigt und ermuntert hat, sich evidenten Wahrheiten zu widersetzen und ihnen solange Widerstand zu leisten, bis sie gezwungen sind, sich selbst zu widersprechen, so darf man sich nicht wundern, daß sie sich nicht schämen, auch in der gewöhnlichen Unterhaltung das zu tun, was in den Schulen ein Gegenstand des Ruhmes ist und als Vorzug gilt. Der Verfasser fügt hinzu, daß vernünftige Leute, in anderen Teilen der Erde, soweit sie durch die Erziehung nicht verdorben worden sind, große Mühe haben würden, zu glauben, daß eine solche Methode jemals von Personen befolgt worden sei, die die Wahrheit zu lieben behaupten und die ihr Leben im Studium der Religion oder der Natur hinbringen. Ich will hier nicht untersuchen, sagt er, wie sehr diese Unterrichtsweise geeignet ist, den Geist der Jugend von der Liebe und aufrichtigen Verfolgung der Wahrheit abzuwenden, ja sogar in ihr Zweifel zu erwecken, ob es wirklich irgendwelche Wahrheit in der Welt gibt oder wenigstens eine solche, die es verdient, daß man sich ihr hingibt. Aber was ich stark glaube, fügt er hinzu, ist, daß, die Orte ausgenommen, welche die peripatetische Philosophie in ihren Schulen zugelassen haben, wo sie viele Jahrhunderte lang geherrscht hat, ohne die Welt etwas anderes als die Disputierkunst zu lehren, man diese Maximen nirgends als die Grundpfeiler der Wissenschaften und als bedeutende Hilfen zur Förderung in der Erkenntnis der Dinge betrachtet hat.
Theoph. Euer gelehrter Autor behauptet, daß die Schulen allein geneigt sind, Maximen zu bilden und doch ist das der allgemeine und sehr vernünftige Instinkt des menschlichen Geschlechts. Das können Sie aus den Sprichwörtern schließen, welche bei allen Nationen in Gebrauch sind, und die in der Regel nur Maximen sind, über welche die öffentliche Meinung übereingekommen ist. Wenn indessen urteilsfähige Leute etwas aussprechen, was uns wahrheitswidrig erscheint, so muß man ihnen die Gerechtigkeit widerfahren lassen, zu vermuten, daß der Fehler mehr in ihren Ausdrücken als in ihren Ansichten liegt: und dies bestätigt sich bei unserem Autor, bei dem ich beginne, das Motiv zu verstehen, das ihn gegen die Maximen einnimmt. In der Tat ist es in den gewöhnlichen Unterredungen, wo es sich nicht, wie in den Schulen, um eine Sache der Übung handelt, eine Schikane, sich nur dann zu ergeben, wenn man wirklich überführt worden ist. Sonst aber ist es bei weitem gefälliger, die Obersätze, die sich von selbst verstehen, zu unterdrücken und sich mit Enthymemen zu begnügen; ja oft genügt es, ohne Prämissen zu bilden, den einfachen Medius terminus oder die vermittelnde Idee vorzubringen, da der Geist alsdann die Verknüpfung, auch ohne daß man sie ausdrücklich formuliert, hinlänglich faßt. Dies geht auch ganz gut, sofern diese Verknüpfung unbestreitbar ist; aber Sie werden mir auch zugeben, daß man häufig zu schnell dazu fortgeht, sie als wahr vorauszusetzen, und daß dann daraus Paralogismen entstehen, so daß es sehr oft besser wäre, beim Ausdruck auf die Sicherheit zu sehen, statt ihr die Kürze und Eleganz vorzuziehen. Indessen hat die Voreingenommenheit unseres Verfassers gegen die Maximen ihn vermocht, deren Nutzen für die Begründung der Wahrheit gänzlich zu verwerfen, ja sie geht so weit, daß er sie für die Unordnungen in der Unterredung mitverantwortlich macht. Es ist freilich richtig, daß die jungen Leute, welche sich an die akademischen Übungen gewöhnt haben, in denen man sich ein wenig zu viel mit der bloßen Übung und nicht genug damit beschäftigt, aus der Übung ihre größtmögliche Frucht, nämlich die Erkenntnis zu gewinnen, – im praktischen Leben Mühe haben, sich dessen zu entschlagen. Und eine ihrer Schikanen besteht darin, sich der Wahrheit nicht eher ergeben zu wollen, als bis man sie ihnen ganz und gar greifbar gemacht hat, obwohl die Aufrichtigkeit und selbst der gesellschaftliche Takt sie verpflichten sollte, nicht in dieser Weise auf das äußerste zu dringen, wodurch sie unbequem erscheinen und eine üble Meinung von sich erwecken. Man muß zugestehen, daß dies ein Fehler ist, mit dem die Gelehrten sich häufig behaftet finden. Indessen besteht der Fehler nicht darin, daß man die Wahrheiten überhaupt auf Maximen zurückführen, sondern daß man dies zu unrechter Zeit und ohne Not tun will: denn der menschliche Geist übersieht viel auf einmal, und man hemmt ihn, wenn man ihn zwingen will, bei jedem Schritt, den er tut, anzuhalten und alles, was er denkt, zum Ausdruck zu bringen. Es ist dies gerade so, als wollte man bei seiner Verrechnung mit einem Kaufmann oder mit einem Wirte diesen nötigen, um sicherer zu gehen, alles an den Fingern herzuzählen. Das zu fordern, müßte man entweder dumm oder eigensinnig sein. In der Tat findet man mitunter, daß Petron recht gehabt hat zu sagen, adolescentes in scholis stultissimos fieri Im ersten Kapitel des Satyricon (Sch.).; daß sie an den Orten, welche die Schulen der Weisheit sein sollten, bisweilen stumpf werden oder den Verstand ganz einbüßen. Corruptio optimi pessima. Aber noch öfter werden sie eitel, händelsüchtig und unverschämt, störrig und unbequem; und das hängt oft von der Gemütsart ihrer Lehrer ab. Übrigens finde ich, daß es bei der Unterredung viel größere Fehler gibt, als den, zu viel Klarheit zu verlangen. Denn gewöhnlich fällt man in den entgegengesetzten Fehler und gibt oder fordert nicht Klarheit genug. Ist das eine unbequem, so ist das andere schädlich und gefährlich.
§ 12. Philal. Auch die Anwendung der Maximen ist dies mitunter, wenn man sie mit falschen, schwankenden und unsicheren Begriffen verbindet, denn dann dienen die Maximen dazu, uns in unseren Irrtümern zu bestärken und sogar Widersprechendes zu beweisen. Wer sich z. B. mit Descartes eine Idee von dem, was er Körper nennt, als von einem lediglich ausgedehnten Dinge macht, der kann mittels der Maxime: was ist, ist, leicht zeigen, daß es keinen leeren Raum, d. h. keinen Raum ohne Körper, gibt. Denn er kennt seine eigene Idee, er erkennt, daß sie das ist, was sie ist, und keine andere Idee; da nun Ausdehnung, Körper und Raum für ihn drei Worte sind, welche ein und dieselbe Sache bezeichnen, so ist es für ihn ebenso wahr, zu sagen, daß der Raum Körper ist, als zu sagen, daß der Körper Körper ist. § 13. Ein anderer aber, dem Körper ein ausgedehntes solides Ding bedeutet, wird ebenso schließen, daß der Satz: der Raum ist nicht Körper, gerade so sicher ist, wie irgendein anderer Satz, den man durch die Maxime: Unmöglich kann etwas zugleich sein und nicht sein, beweisen kann.
Theoph. Der schlechte Gebrauch, den man von den Maximen macht, darf nicht dazu führen, ihren Gebrauch überhaupt zu tadeln. Alle Wahrheiten sind dem Übelstande unterworfen, daß man, indem man Falsches mit ihnen verbindet, aus ihnen Falsches, ja selbst Widerspruchsvolles schließen kann. In unserem Beispiele bedarf es auch gar nicht jener identischen Axiome, denen man hier den Grund des Irrtums und des Widerspruchs aufbürdet. Dies würde sich zeigen, wenn die Beweisführung derer, die aus ihren Definitionen schließen, daß der Raum Körper, oder nicht Körper ist, auf eine strenge Form gebracht würde. Es liegt sogar etwas zu viel in dem Schluß: der Körper ist ausgedehnt und solide, folglich ist die Extension, d. h. das Ausgedehnte, kein Körper und die bloße Ausdehnung kein körperliches Ding, denn ich habe schon bemerkt, daß es in den Ideen überflüssige Bestimmungen geben kann, die den Inhalt der Sache selbst nicht vermehren, wie wenn z. B. jemand sagte, unter einem Triquetrum verstehe ich ein dreiseitiges Dreieck, und daraus schlösse, daß nicht jede dreiseitige Figur ein Dreieck sei. So könnte auch ein Cartesianer sagen, daß die Idee des soliden Ausgedehnten von derselben Art sei; sie enthalte nämlich eine überflüssige Bestimmung, wie in der Tat, wenn man die Ausdehnung für etwas Substantielles nimmt, jedwede Ausdehnung solide sein oder auch jede Ausdehnung körperlich sein muß. Was den leeren Raum betrifft, so wird ein Cartesianer freilich das Recht haben, aus seiner Idee oder der Art von Idee, die er sich davon macht, zu schließen, daß es keinen solchen gebe: vorausgesetzt nur, daß seine Idee richtig ist; aber ein anderer wird nicht im Rechte sein, wenn er aus seiner Idee sogleich ohne weiteres schließt, daß es einen solchen geben kann, wie ich in der Tat, obschon ich nicht für die cartesische Ansicht bin, doch glaube, daß es keinen leeren Raum gibt, und finde, daß man in diesem Beispiel nicht sowohl von den Maximen als vielmehr von den Ideen einen schlechten Gebrauch macht.
§ 15. Philal. Wenigstens scheint es, daß, welchen Gebrauch man auch von den Maximen in Urteilen, die nur die Worte betreffen, machen mag, sie uns doch jedenfalls nicht die geringste Erkenntnis von den Substanzen, die außer uns existieren, geben können.
Theoph. Ich bin ganz anderer Meinung. Jene Maxime z. B., daß die Natur immer die kürzesten oder wenigstens die bestimmtesten Wege einschlage, genügt für sich allein, um von fast der ganzen Optik, Katoptrik und Dioptrik Rechenschaft zu geben, d. h. von allen Wirkungen des Lichts in der äußeren Welt, wie ich dies früher einmal gezeigt habe, und worin Molineux mir in seiner Dioptrik, welche ein sehr gutes Buch ist, durchaus zugestimmt hat Vgl. hierzu den Schluß des »Specimen dynamicum«, Band I, S. 271 f. Die Ableitung der optischen Gesetze aus dem Prinzip, daß der Lichtstrahl, um von einem Punkt zum andern zu gelangen, den einfachsten und leichtesten Weg wählt, findet sich in einer Abhandlung durchgeführt, die Leibniz im Jahre 1682 in den »Acta Eruditorum« veröffentlicht hat (vgl. Band I, Anm. 210). – Molyneux' »Dioptrica nova« ist London 1692 erschienen..
Philal. Wir behaupten jedoch, daß, wenn man sich der identischen Prinzipien bedient, um Sätze zu beweisen, in denen Worte vorkommen, welche zum Ausdruck zusammengesetzter Ideen, wie Mensch oder Tugend, dienen, der Gebrauch dieser Prinzipien äußerst gefährlich ist und die Menschen veranlaßt, das Falsche wie eine offenbare Wahrheit zu betrachten und anzunehmen. Denn die Menschen glauben, daß, wenn man dieselben Ausdrücke beibehält, die Sätze sich auf die nämlichen Dinge beziehen, wenn auch die Ideen, die durch diese Ausdrücke bezeichnet werden, sehr verschieden sind: so daß, da man hier wie gewöhnlich die Worte für die Dinge nimmt, die Maximen in der Regel dazu dienen, widersprechende Sätze zu beweisen.
Theoph. Welche Ungerechtigkeit, die armen Maximen für etwas zu tadeln, was dem schlechten Gebrauch und dem Doppelsinn der Ausdrücke zugeschrieben werden muß! Mit demselben Rechte könnte man die Syllogismen tadeln, weil man bei doppelsinnigen Ausdrücken falsch schließt. Aber der Syllogismus ist daran unschuldig, denn man hat alsdann in der Tat vier Termini gegen die Regeln der Syllogismen. Mit demselben Rechte könnte man auch die Rechnung der Arithmetiker oder der Algebristen tadeln, weil man, wenn man aus Versehen X für V oder a für b setzt, aus ihr falsche und widersprechende Schlußfolgerungen gewinnt.
§ 19. Philal. Wenigstens möchte ich die Maximen dann für wenig nützlich halten, wenn man klare und deutliche Ideen hat; ja andere wollen sogar, daß sie dann schlechterdings nutzlos sind; sie behaupten, daß, wer in diesen Fällen das Wahre und Falsche ohne diese Art von Maximen nicht unterscheiden kann, es auch durch ihre Vermittlung nicht werde tun können; und unser Verfasser (§§ 16 und 17) zeigt sogar, daß man auf Grund ihrer nicht entscheiden kann, ob dieses oder jenes Wesen ein Mensch ist oder nicht.
Theoph. Wenn die Wahrheiten sehr einfach und evident sind und den identischen Sätzen und Definitionen ganz nahe stehen, so hat man kaum nötig, von den Maximen ausdrücklich Gebrauch zu machen, um aus ihnen diese Wahrheiten herauszuziehen, denn der Geist wendet sie unbewußt an und zieht ohne Zwischengedanken sofort seine Schlußfolgerung. Aber ohne die schon erkannten Axiome und Lehrsätze würden die Mathematiker große Mühe haben, vorwärts zu kommen, denn bei den langen Schlußketten ist es gut, von Zeit zu Zeit anzuhalten und sich gleichsam Meilensteine mitten am Wege zu machen, die auch anderen dazu dienen sollen, ihn zu bezeichnen. Sonst würden diese langen Wege zu unbequem werden, ja verwirrt und dunkel erscheinen, ohne daß man etwas darin unterscheiden und die Stelle, wo man ist, hervorheben könnte. Es hieße dies, sich in dunkler Nacht ohne Kompaß aufs Meer zu wagen, ohne den Grund, noch das Ufer, noch die Sterne zu sehen; es hieße auf weiter Steppe wandern, wo es weder Bäume, noch Hügel, noch Bäche gibt; es wäre wie eine zum Längenmaß bestimmte Kette mit Ringen, die aus einigen hundert unter sich ganz gleichen Ringen bestände, ohne irgendeine Unterscheidung (wie eine solche beim Rosenkranze oder mittels größerer Körner oder größerer Ringe oder anderer Einteilungen, die die einzelnen Füße, Ellen, Ruten usw. bezeichnen können, angewandt wird). Der Geist, der die Einheit in der Vielheit liebt, fügt somit einige der Folgerungen zusammen, um daraus vermittelnde Schlüsse zu bilden: und dies ist der Nutzen der Maximen und Lehrsätze. Mittels ihrer wächst also die Lust und Klarheit des Schließens, erhöht sich das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit, während die Wiederholungen sich vermindern. Wenn ein Mathematiker bei einer Rechnung die beiden geometrischen Maximen, daß das Quadrat der Hypotenuse dem der beiden Katheten gleich, und daß die sich entsprechenden Seiten ähnlicher Dreiecke proportional sind, nicht voraussetzen wollte, im Glauben, daß er diese beiden Lehrsätze, weil man ihren Beweis durch die Verknüpfung der in ihnen enthaltenen Ideen gewinnt, leicht entbehren könnte, indem er an ihrer Stelle die Ideen selbst setzte, so würde er sich von seinem Ziel weit entfernt finden. Damit Sie aber nicht denken, daß der nützliche Gebrauch dieser Maximen sich auf die bloß mathematischen Wissenschaften beschränkt, so werden Sie finden, daß er in der Rechtswissenschaft nicht geringer ist und daß eines der vorzüglichsten Mittel, sie leichter zu gestalten und ihren weiten Ozean wie auf einer geographischen Karte zu überschauen, darin besteht, eine Fülle besonderer Entscheidungen auf allgemeinere Prinzipien zurückzuführen. So wird man z. B. finden, daß eine Menge von Gesetzen, von Digesten, von Aktionen und Exzeptionen, von denen, welche man in factum nennt, von der Maxime abhängen: ne quis alterius damno fiat locupletior, d. h. niemand darf aus dem Schaden, der einem anderen dadurch entstehen würde, Vorteil ziehen, was man freilich ein wenig genauer ausdrücken müßte. Allerdings muß man unter den Rechtsregeln einen großen Unterschied machen. Ich spreche von denen, die gut sind, und nicht von gewissen durch die Rechtslehrer eingeführten unverständlichen Regeln ( brocardica), die unbestimmt und dunkel sind, obschon auch diese Regeln oft gut und nützlich werden könnten, wenn man sie verbesserte, während sie jetzt mit ihren endlosen Distinktionen ( cum suis fallaciis) nur dazu dienen, Verwirrung hervorzurufen Die »Brocardica« bezeichnen allgemein Rechtssentenzen; nach dem Vorbild der in solchen Sentenzen verfaßten Kirchengesetze des Bischof Burkard (Brocard) von Worms (um 1000 n. Chr.); hier im Text sind sie als vage juristische »Gemeinplätze« genommen. Ein etwas abweichender Gebrauch des Begriffs findet sich in einem Brief Leibnizens an Kestner (Dutens IV, P. 3, S. 264).. Die brauchbaren Regeln sind nun entweder Aphorismen oder Maximen, und unter Maximen begreife ich sowohl Axiome als Lehrsätze. Sind es Aphorismen, welche durch Induktion und Beobachtung, nicht aber durch Räsonnement a priori entstehen, und welche tüchtige Gelehrte nach einer Übersicht des bestehenden Rechtes festgestellt haben, so hat der Satz des Rechtsgelehrten [Paulus] in dem Titel der Digesten, welcher von den Rechtsregeln handelt, statt: non ex regula jus sumi, sed ex jure quod est regulam fieri, d. h. man zieht die Regeln aus einem schon bekannten Rechte, um sich dessen besser zu erinnern, aber man gründet nicht das Recht auf diese Regeln Der zitierte Rechtsgelehrte, dessen Name im Leibnizschen Manuskript fehlt, ist Paulus, wie aus den Digesten L. XVII hervorgeht; das zweite Zitat aus den Pandekten findet sich in den Institutiones L. IV, Tit. VI de actionibus (Ausgabe von J. H. Brehmer, Halae 1728, 40, p. 634, wo schon bemerkt ist, daß die Lesart sane uno casu festzuhalten sei, der dann auch die neueren Herausgaben sämtlich folgen.) (Sch.). Es gibt aber Fundamentalmaximen, die das Recht selbst begründen und die die Klagen, Exzeptionen und Repliken etc. ausmachen: Maximen, welche, wenn sie durch die reine Vernunft gelehrt werden und nicht von der willkürlichen Macht des Staates stammen, das Naturrecht bilden; und eine solche ist die eben erwähnte Regel, welche den Vorteil auf anderer Leute Kosten verbietet. Auch gibt es Regeln, bei denen Ausnahmen selten sind, und die folglich als allgemeingültig angesehen werden. Von dieser Art ist die Regel der Institutionen des Kaisers Justinian im § 2 des Titels von den Klagen, wonach, wenn es sich um körperliche Dinge handelt, der Kläger nicht im Besitze ist, einen einzigen Fall ausgenommen, von dem der Kaiser sagt, daß er in den Digesten angemerkt sei. Aber man ist noch dahinter, diesen zu suchen. Allerdings wollen einige statt sane uno casu lesen sane non uno, und aus einem Fall kann man zuweilen deren mehrere machen.
Bei den Medizinern behauptet der verstorbene Barner, welcher uns durch Herausgabe seines Prodromus Hoffnung auf einen neuen Sennert oder ein den neuen Entdeckungen oder Meinungen angepaßtes System der Medizin gemacht hatte, daß die Methode, die die Ärzte in ihren Systemen der Heilkunde gewöhnlich beobachten, darin bestehe, die Heilkunst auseinanderzusetzen, indem man eine Krankheit nach der anderen gemäß der Ordnung der Teile des menschlichen Körpers oder sonstwie behandelt, ohne allgemeine Vorschriften der Praxis gegeben zu haben, die mehreren Krankheiten und Symptomer. gemeinsam wären, wodurch sie zu unendlich vielen Wiederholungen genötigt wären: dergestalt, daß man ihm zufolge drei Viertel des Sennert wegstreichen und die Wissenschaft durch allgemeine Sätze unendlich abkürzen könne: vor allen Dingen durch solche, denen das πρῶτον des Aristoteles zukomme, d. h. die reziprok sind oder sich dem annähern Daniel Sennert (1572-1637), berühmter Arzt und Naturforscher, seine »Epitome scientiae naturalis« ist zuerst in Wittenberg 1618 erschienen. Der »Prodromus Sennerti novi« von Jacob Barner erschien 1674.. Ich glaube, er hat recht, wenn er diese Methode anrät, vor allem hinsichtlich der Vorschriften, bei denen die Medizin sich auf Vernunftgründe stützt; in dem Maße aber, als sie empirisch ist, ist es weder so leicht noch so sicher, allgemeine Sätze zu bilden. Ja es kommen sogar gewöhnlich in den besonderen Krankheiten Komplikationen vor, so daß diese Krankheiten gleichsam Substanzen sind, die wie eine Pflanze oder ein Tier eine besondere Geschichte für sich verlangen, d. h. es sind Modi oder Seinsweisen, denen das zukommt, was wir von den Körpern oder Substanzen gesagt haben, wie denn ein viertägiges Fieber ebenso schwer zu ergründen ist, wie das Gold oder Quecksilber. Daher ist es unbeschadet der allgemeinen Vorschriften nützlich, für die verschiedenen Arten der Krankheiten Kurmethoden und Heilmittel, die mehreren Symptomen und Komplikationen von Ursachen genügen, aufzusuchen, und vor allem die zu sammeln, welche die Erfahrung bewährt hat. Dies hat Sennert nicht genügend getan, denn tüchtige Sachkenner haben die Bemerkung gemacht, daß die Zusammensetzungen der Rezepte, die er vorschlägt, oft mehr aus dem Kopfe nach Abschätzung gebildet als durch die Erfahrung bewährt sind, wie es sein müßte, wenn man seiner Sache sicherer sein sollte. Ich glaube also, daß das Beste sein wird, beide Wege zu verbinden, und sich in einem so schwierigen und wichtigen Gegenstande, wie die Medizin es ist, nicht über Wiederholungen zu beklagen; denn hier fehlt uns, wie ich finde, gerade das, was wir meiner Meinung nach in der Jurisprudenz zu viel haben, nämlich Bücher über die besonderen Fälle und Repertorien dessen, was schon beobachtet worden ist. Denn ich glaube, daß der tausendste Teil der Bücher der Rechtsgelehrten uns genügen könnte; daß wir aber in Sachen der Medizin nicht zu viel hätten, wenn wir tausendmal mehr genau detaillierte Beobachtungen besäßen. Die Rechtsgelehrsamkeit nämlich stützt sich hinsichtlich dessen, was nicht ausdrücklich durch die Gesetze oder das Gewohnheitsrecht bestimmt wird, völlig auf Vernunftgründe. Denn man kann hier seine Entscheidung stets aus dem Gesetz oder, wenn das Gesetz versagt, aus dem Naturrecht mit Hilfe der Vernunft gewinnen. Auch sind die Gesetze jedes Landes fest begrenzt und bestimmt oder können es doch werden, während in der Medizin die Erfahrungsprinzipien, d. h. die Beobachtungen, nicht genug vervielfältigt werden können, um der Vernunft mehr Veranlassung zu bieten, das, was die Natur uns nur halb zu erkennen gibt, zu entziffern.
Übrigens wüßte ich niemand, der die Axiome in der Art anwendet, wie der gelehrte Autor, von dem Sie reden, es darstellt (§ 16, 17), wie wenn z. B. jemand, um einem Kinde zu zeigen, daß ein Neger ein Mensch ist, sich des Prinzips »Was ist, ist« bediente, indem er sagte: Ein Neger hat eine vernünftige Seele, nun ist die vernünftige Seele und der Mensch ein und dasselbe, wäre er also mit einer vernünftigen Seele begabt und doch kein Mensch, so würde es falsch sein, daß das, was ist, ist, oder es würde dann ein und dasselbe Ding zu gleicher Zeit sein und auch nicht sein. Denn ohne diese Maximen zu brauchen, die hier nicht hergehören und nicht direkt zum Schlußverfahren gehören, wie sie denn auch dabei nichts fördern, wird sich jedermann begnügen, so zu schließen: Ein Neger hat eine vernünftige Seele; jeder, der eine vernünftige Seele hat, ist ein Mensch, folglich ist der Neger ein Mensch. Und wenn jemand in der vorgefaßten Meinung, daß eine vernünftige Seele dort, wo sie nicht in die Erscheinung tritt, auch nicht vorhanden ist, schließen wollte, daß die eben erst geborenen Kinder und die Blödsinnigen nicht zur Gattung Mensch gehören – wie in der Tat der Verfasser berichtet, mit ganz verständigen Personen, die es leugneten, darüber verhandelt zu haben, – so glaube ich nicht, daß der schlechte Gebrauch der Maxime »Unmöglich kann etwas zu derselben Zeit sein und nicht sein« diese Leute zu dieser Annahme verleitet hat, oder daß sie bei diesem Schlusse auch nur an diese Maxime denken. Die Quelle ihres Irrtums läge vielmehr in der Ausdehnung des von unserem Autor vertretenen Prinzips, nach dem nichts in der Seele ist, dessen sie sich nicht bewußt ist: wobei jene so weit gehen würden, die Seele selbst abzuleugnen, wenn andere dieselbe nicht bemerken.