
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es war einmal – – – –
Es war einmal eine Zeit, da hatten die Musen und Grazien ihren Göttersitz noch auf Erden aufgeschlagen, und zwar dort, wo nach der Legende das Glück zu Hause gewesen sein soll: im alten aristokratischen Wien.
Hier war ja immer der Himmel offen und hing voller Geigen; in den Adelspalästen, bei Musikfesten allgemein zugänglich, dirigierte Vater Haydn seine »Schöpfung«, wie Gottvater selber; Ritter Gluck veroperte den ganzen griechischen Olymp, und am höchsten in allen Himmeln tönte die Zauberflöte Mozartscher Musik, diese melodische Seele des barocken Wiens: Damen im Reifrock und Herren mit Degen und Haarzopf, Spitzenjabot und goldgestickter Seidenweste bewegten sich im höfisch-abgemessenen, galanten Schritt des Menuetts.
In diese kunstvoll verschnörkelte Welt des Barocks war der junge Genius vom Rhein, Herr Ludwig van Beethoven, als ein erfrischendes Lenzgewitter hereingebrochen, ein Naturelement, das wie Pan den erstaunten Götterkreis betritt und eine Revolution bewirkt, von der Musik aus. Der neue Mensch. Schon äußerlich wirkt er auffallend: sein unbekümmertes Gebaren, seine lässige Haltung auch in der Kleidung nach der »freieren Weise der überrheinischen Mode« – für die einen abstoßend, für die anderen »originell«, jedenfalls höchst bedeutsam; eine Persönlichkeit, um die man nicht herumkann; ein Genius, der eine Sendung trägt, wenn man auch die Tragweite noch nicht abzuschätzen vermag. Eine Wende stand bevor. Und der Adel selbst, noch ganz von Barocktraditionen beherrscht, für Haydn und Mozart begeistert, jubelt dem jungen Stürmer und Dränger zu und wird damit zum Träger des Umsturzes – die Romantik erwacht. Die berühmten Freitagskonzerte im Palais Lichnowsky sind der Ausgangspunkt des neuen Ruhms: das Flügelrauschen des sich entfaltenden Genius ward hier von aufhorchenden und bezauberten Herzen vernommen; hier folgten bewundernde Blicke seinem Flug nach unbekannten Höhen – – – –
*
Das Gefühlsbarometer stand auf Sturm an einem jener Freitagsmorgen, als der hochedelgeborene und in exklusiven Kreisen bereits viel gefeierte Herr Komponist und Klaviervirtuose sorgfältiger als sonst Toilette machte, um sich in das Palais Lichnowsky zu begeben, wo sich regelmäßig eine erlesene Gesellschaft zu den Freitagskonzerten einfand.
Der Diener war davongelaufen; der Meister hatte vergangene Nacht lange gearbeitet und das Abendessen vergessen; als er gegen Mitternacht sich endlich erhob und vergebens an dem Glockenzug riß, daß es gellend durchs Haus tönte, trat er selbst in die Küche hinaus. Hier fand er den Diener eingeschlafen und das Nachtmahl auf dem Herde kalt. Es gab einen heftigen Wortwechsel; der unwillige Herr versetzte in seiner Erregung dem Widerspenstigen eine Ohrfeige, die zwar sofort mit einem Pflaster von fünf Gulden geheilt wurde, aber der aufgebrachte Meister hatte bei dem unliebsamen Auftritt eine kleine Kratzwunde im Gesicht erhalten, die am Morgen noch nicht verschwunden war. Dafür war der Diener verschwunden, der sich in aller Frühe mit seinen Siebensachen auf und davon gemacht und den gewalttätigen Herrn im Stich gelassen hatte; der mochte nun läuten und schelten aus Leibeskräften, was er konnte, er mußte sehen, wie er nun allein fertig werden würde, und das war nicht einfach für den Künstler, der sich nur schwer mit dem Alltag abfand.
Das Frühstück zwar pflegte er selbst in einer Glasmaschine zu bereiten, er hielt auf guten starken Kaffee, wohlabgezählte sechzig Bohnen die Tasse, die er in eigener Verwahrung hielt, aus Furcht, bestohlen zu werden; er war mißtrauisch, und das nicht immer mit Unrecht.
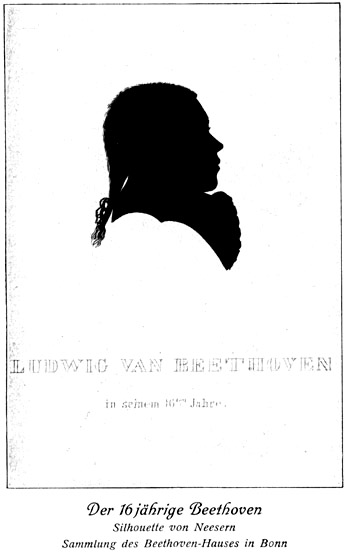
Indessen der Kaffee kochte und in der Maschine brodelte bis zum schließlichen Überlaufen, indem er Wolken würzigen und belebenden Duftes in dem Raum verbreitete, begann der Meister seine gewohnten Wasserbegießungen über Kopf, Brust und den ganzen Körper hinunter, bis der Fußboden in Wasser schwamm; er stampfte wie ein Nilpferd unter dem wohligen Naß, heulend, singend, komponierend. Das gehörte zu seinen täglichen Morgenübungen.
Dann rasch Seifenschaum ins Gesicht; der Bart hatte sich schon tagelanger Ungeschorenheit erfreut und umwucherte mit freiheitlicher Ungezügeltheit Kinn und Wangen des bräunlichen Gesichts, stachlich wie eine Kaktuswaldung. Aber mitten im Einseifen hatte der summende Meister eine hübsche musikalische Eingebung, die eiligst zu Papier gebracht werden wollte; also schnell ans Pult, wo er sich in die Idee vertiefte, und dann war auch schon die äußere Welt wieder vergessen: die überkochende Kaffeemaschine, der sprossende Bart, der Seifenschaum – – – als er sich wieder besann, war der Kaffee übergelaufen, die Seife im Gesicht vertrocknet – man mußte von neuem beginnen. Nun aber rasch! In der Übereile hantierte er etwas ungeschickt mit dem kleinen Wandspiegel, den er des besseren Lichtes wegen am Fensterhaken befestigen wollte: patsch! lag das Ding am Boden – in Scherben.
Wütend riß er an der Klingelschnur; die Glocke gellte zwar wie zum Jüngsten Gericht, aber kein Diener erschien. Richtig, der Kerl war ja ausgerissen! »Himmel, alle vierzehn Nothelfer, stehet mir bei!« In der Verzweiflung denkt er an seinen Freund, den Musikliebhaber Baron Zmeskall, der bei solchen Gelegenheiten immer den Nothelfer spielt, vierzehn in einer Person oder einer von den vierzehn: er behandelt seine Wiener Freunde als bloße Instrumente, auf denen er spielt, wie's ihm gefällt; eigentlich aber ist er in seiner Hilflosigkeit dem praktischen Leben gegenüber auf ihre Dienste angewiesen, und sie dienen ihm in Ehrfurcht vor seinem Genius.
Ein paar Zeilen an den Baron sind rasch hingeworfen; er muß ihm seinen Diener zur Aushilfe schicken, seinen Spiegel leihen, nachdem der eigene zerbrochen ist, ja, und dann noch eins: da die letzten fünf Gulden als Schadloshaltung für die Ohrfeige in die Hand des entwichenen Dieners geflossen sind, muß auch damit der Freund aushelfen. In launigen Worten und scherzhaft gemeinten Anreden, wie: geliebtester Conte di Musica – nicht Musikgraf, sondern Freßgraf – Dineen-Graf, Suppeen-Graf, Baron Dreckfahrer und ähnlichen Titulaturen, die er sich gegen den Getreuen angewöhnt hat – anders tut es der Meister nicht –, setzt er ihm die Lage auseinander: »– – ja, liebster Conte, vertrauter Amico, die Zeiten sind schlecht, unsere Schatzkammer ausgeleert, die Einkünfte gehen schlecht ein, und wir, Euer gnädigster Herr, sind gezwungen, uns herabzulassen und Euch zu bitten um ein Darlehen von 5 Gulden, welches wir Euch binnen einigen Tagen wieder zufließen werden lassen – – –«
Das wäre also soweit gut getan – aber da ist wieder der Rat teuer: durch wen soll der Brief geschickt werden, da kein Diener zur Hand ist? Wo den Spiegel schnell hernehmen?
Seufzend fügt er sich in das Unvermeidliche; die Scherben werden mühsam aufgelesen und die größeren Stücke notdürftig in den Rahmen gesteckt; für den ersten Augenblick geht es ja. Die Erbärmlichkeiten des kleinen Alltagslebens pflegt der Meister wohl mit seinem grimmigen Humor zu quittieren, wie er es eben in den Zeilen an Zmeskall getan; aber eigentlich wird er sich jetzt recht tief seiner Verlassenheit bewußt, der Mißmut gewinnt Oberhand.
Am liebsten wäre er nun gar nicht mehr in das Freitagskonzert gegangen und würde sich statt dessen in das Reich seiner Muse geflüchtet haben, wo ihm Trost und Vergessen über all die äußere Misere sicher zuteil wird. Nur der Umstand, daß heute bei Lichnowsky seine neuen Trios zur Aufführung gelangen, bestimmt ihn zu guter Letzt, sich doch fertig anzukleiden.
Aber da hat er erst recht seine liebe Not. Zwar hat er sich nach und nach auch in seiner Tracht ganz und gar der vornehmen Gesellschaft, in der er verkehrt, angepaßt; gegen seine frühere Gewohnheit hält er jetzt auf gewählte, ja elegante Kleidung mit einem Stich ins Neumodische. Er zeigt sich gern in Werther-Tracht, so hat ihn einer der Freunde, Herr von Mähler, ein Maler-Amateur, porträtiert, mit einer Lyra in der Hand – und wenn er in feine Gesellschaft geht, trägt er sich nach der herrschenden Sitte: blauen Frack, weiße Seidenstrümpfe, Schnallenschuhe; nur statt des Jabot eine große, kunstvoll geschlungene Halsbinde von lieber Hand – – – Diese Halsbinde ist das Zeichen der neuen Zeit, zum Unterschied von Haydn, der noch ganz Rokoko ist mit gepuderter Perücke und Seitenlocken.
Der Anblick der schönen Halsbinde, mit der er nun Staat macht, erweckt Gefühle der Wehmut; Tränen entstürzen seinen Augen, eine unbeschreibliche Traurigkeit kommt über ihn. Leonore, die teuerste Freundin seiner Bonner Jugend! Sie hat das Kunstwerk gearbeitet, es ist ein Angebinde von ihrer Hand, das sie ihm in die Fremde nachgesandt hat. Wieviel zärtliche Gedanken hat sie in das Werk ihrer Nadel mitverwoben, welche teuren Schatten ruft das seidenweiche Ding in seiner Erinnerung – – –! Wie ein liebender Arm legt es sich zärtlich um den Hals, er fährt damit über die Wangen, eine verstohlene Träne abzuwischen; er lächelt fast, als spürte er eine linde, streichelnde Hand, die alle Trauer, alle Tränen fortnimmt. Bonn, seine Heimat, sein Rheinland ist nicht vergessen, und noch weniger vergessen ist der Engel Leonore – – – Glühende Kohlen sammelt das Denken an sie auf Haupt und Herz. Im Zwist war er fortgegangen, mit bitterbösen Worten: junge Liebe; der Rest ist Leid. Nun ist alles weit, weit zurück: die Eifersucht, die ihn gequält, der Rivale Franz Wegeler, Medizinstudent, arm wie er und gleich ihm fast Kind im Hause der Hofrätin Breuning, der Mutter Leonorens; die stille Liebe, die ihm aus den Augen der Jugendfreundin, aus gelegentlichen scheuen Versen und hundert kleinen Aufmerksamkeiten entgegenblühen wollte, und die er zu wenig bedacht und bedankt hatte, als bis er fort war, und schließlich erfahren mußte, daß der beargwöhnte Freund nach langem geduldigem Werben Erhörung gefunden und die ferne Geliebte heimzuführen im Begriffe sei. Da brach das Eis; er schrieb beiden rührende Briefe, in denen er sich seiner Heftigkeit anklagte; denn er liebte sie beide, den Freund und die Freundin, und mußte sich sagen, daß es seine eigene Schuld war, wenn alles so kam, und doch kaum Schuld, denn es war Bestimmung: er hatte zu wählen zwischen dieser Liebe und zwischen seiner Göttin Kunst, die ihn hinausdrängte ins Große und Weite, auf die Bahn des Ruhms, und so ward dem Herzen der bittere Verzicht.
Das war der Grund der plötzlichen Tränen und Wehmut, die ihn immer beschlich, wenn er Leonoren gedachte; die Weste, die sie ihm einmal gestickt, war unmodisch geworden, sie wurde als teures Andenken aufbewahrt. Er wollte ein Stück ihrer kunstfertigen Hände tragen wie einen Talisman, und so hatte sie ihm diese Binde geschickt. Das war Gruß aus der Ferne und doch fühlsame Nähe, ein Sinnbild entschwundenen Jugendglücks, alles was ihm davon geblieben war, und eigentlich noch etwas mehr: eine Leidensseligkeit im Herzen, darin das Idealbild Leonorens in nie verwelkender Jugendschöne und Verklärung thronte, nun schon selbst irgendwie Verkörperung seiner Muse, sein Engel Leonore.
Wenn er hätte wissen können, daß ihm heute bei Lichnowsky jene andere irdische Verkörperung seiner Muse entgegentreten würde, die noch tieferes Glück und tieferes Leid ihm bescheren und das Engelsbild Leonorens verdunkeln sollte, ja, daß ihm diese weibliche Schicksalsbotschaft in der Dreizahl der Grazien erschiene, um ihm eine folgenschwere Bedeutung zu künden – er hätte vielleicht erst recht gezaudert, in das Freitagskonzert zu gehen und wäre in seiner eigenwilligen, störrischen Laune daheimgeblieben. Denn er besaß ein stolzes Herz, das er der Göttin Kunst verschrieben, und fürchtete für seine mühsam behauptete Ruhe im Dienst dieser strengen Göttin. Ansonsten sagten ihm Frauen nicht viel, obzwar er viel umschwärmt war, und sich mehr zu sanften, leidenden Frauennaturen, wie die Fürstin Christiane Lichnowsky, hingezogen fühlte, die gewissermaßen eine mütterliche Herrschaft über ihn führten.
Leise ging die Tür auf, ein schmaler blasser Jüngling glitt ins Zimmer, sein Schüler Ferdinand Ries.
Unerwünschter Besuch!
Der Meister wandte sein Gesicht weg und drückte sich ganz an den zerbrochenen Spiegel heran, eifrig bemüht, die große Halsbinde zu einem kunstvollen Knoten zu schlingen; er nahm keine Notiz von dem jungen Menschen, der sich gleich am Klavier zu schaffen machte und in Notenheften blätterte; der Meister tat, als ob er sein Eintreten gar nicht bemerkt hätte, eigentlich aber wollte er seine Gemütsbewegung verbergen; der Junge sollte nicht sehen, daß er Tränen vergossen hatte.
Das Stundengeben war Frondienst für den Genius, in den Stunden der Muse war es ihm eine unerträgliche Qual; er hätte Ries längst zum Kuckuck geschickt, so lästig war er ihm, aber der Junge war ja der Sohn des alten Bonner Hausfreundes und Hofmusikers Franz Ries, der in den Tagen der Not, als die Mutter Beethoven starb und alle Habseligkeiten ins Leihhaus und auf den Trödelmarkt wanderten, die Familie wie ein sorgender Vater unterstützte, zumal der eigene Vater die Not noch vergrößerte und seinen Kummer in den Weinschenken ertränkte – – – oh, diese traurigen Bonner Tage, an die ihn nun auch der junge Ries gerade in der Stunde der Wehmut durch sein höchst ungelegenes Erscheinen erinnern mußte! Vater Ries hatte ihm den Sohn Franz zur weiteren Ausbildung geschickt; die Dankbarkeit für den alten Ries legte dem Meister eine Pflicht für den Sohn auf, die er heilig nahm, obzwar der Schüler die Launen und Eigenheiten des Meisters mit in Kauf nehmen mußte und keine ganz leichte Lehrzeit hatte.
»Ich kann Ihnen heute keine Stunde geben«, brummte endlich der Meister, um sich die lästige Anwesenheit vom Halse zu schaffen.
»Ich gehe schon«, sagte leise der Junge. Die Trauer der Stimme fiel dem Lehrer auf; er wandte sich um.
»Nein, bleiben Sie!« befahl er in einem barschen Ton, dahinter sich die Weichheit des Gefühls verschanzte, und plötzlich wieder ganz verändert, voll Teilnahme, fast erschrocken: »Ja, um Himmelswillen, wie sehen Sie nur aus? Sind Sie übernächtig, sind Sie krank, weil Sie so blaß aussehen?«
Der junge Mensch wurde plötzlich rot und sah scheu und verlegen zu Boden. »Nichts, nichts«, hauchte er und griff nach einer Stuhllehne, als wollte er sich vor Schwäche stützen.
Der Meister schien zu erraten: »Haben Sie schon gefrühstückt?«
»Nein«, kam die Antwort etwas zögernd.
»Ja, warum sagen Sie denn das nicht gleich, Sie Unglücklicher,« fuhr ihn der Meister an, »hier ist Kaffee, Brot und Butter, greifen Sie zu und stärken Sie sich!« Und er schenkte dem Jungen gleich selbst die Tasse voll und bemerkte, daß sich Ries mit kaum beherrschtem Heißhunger über die Reste des Frühstücks herstürzte und rasch einige große Bissen hinunterschlang.
Der Lehrer beobachtete ihn eine Weile, und als der Junge sich gestärkt hatte, sagte er mit tiefem Ernst: »Ferdinand, Sie verbergen mir etwas!«
Nun ergoß sich eine neue Welle der Verlegenheit über das Gesicht des jungen Mannes, der zuerst beschämt schwieg.
»Ferdinand!« begann der Meister wieder mit mahnender Stimme: »Verstecken Sie sich nicht vor mir! Seien Sie aufrichtig! Ich bin der Freund Ihres Vaters und vertrete jetzt seine Stelle bei Ihnen. Reden Sie also offen, ich habe ein Recht, Sie zu fragen, und Sie haben die Pflicht, klar und offen zu antworten, als ob Sie beichten würden: Wann haben Sie zum letzten Male gegessen?«
Ries zögerte noch eine Weile und sagte dann mit niedergeschlagenen Augen: »Vorgestern.«
Da schlug auch schon der Meister mit der Faust dröhnend auf den Tisch: »Nun da haben wir's ja! Geht es Ihnen schlecht?! Haben Sie kein Geld? Heraus mit der Sprache!«
Nach einigem Hin und Her gestand der Junge, daß er von allen Mitteln entblößt sei und bereits seit einiger Zeit empfindlichen Mangel leide. Der Vater könne ihm nur wenig schicken, seit Monaten habe er nichts mehr von zu Hause erhalten, aber er wollte nicht mahnen, denn er wisse, daß es auch in Bonn nicht am besten stünde, seit der gute Fürst von den Franzosen verjagt und die Hofkapelle aufgelöst worden sei. Er habe dem Vater nicht zur Last fallen wollen, der durch den gewaltsamen Umsturz der Verhältnisse selbst in große Bedrängnis geraten sei und für eine große Familie zu sorgen habe; er habe den Vater darum in der Meinung gelassen, daß es ihm gut gehe und daß er durch Erteilung von Nebenunterricht genug für den eigenen Lebensunterhalt verdiene. Dem sei aber leider nicht so.
Nun brach erst recht das Unwetter los.
»Unseliger! Warum eröffnen Sie sich mir nicht? Verdiene ich kein Vertrauen?! Wenn Sie es nicht dem Vater sagen, um ihm unnötigen Kummer zu ersparen, so hätten Sie es doch mir sagen müssen, mir, der ich genau weiß, was Not ist, und der ich in solchen Zeiten selbst einen Helfer in Ihrem Vater gefunden habe. Bin doch ich jetzt der Erste und Nächste, der Ihnen beizuspringen hat, oder wollen Sie mir die höchst erwünschte Gelegenheit vorenthalten, eine Schuld an Ihrem Vater abzutragen? Sie Undankbarer, Sie Ungeratener, ei ja, Sie Nichtswürdiger, der Sie es jetzt verdienen würden, daß ich Sie nicht mehr meinen Schüler nenne, Sie – – Sie – – – Sie – – –! Kennen Sie mich, Ihren Lehrer, den Freund Ihres Vaters so schlecht?! Solange ich etwas habe, sollen meine Freunde nicht darben müssen!«
Aufschluchzend von Ergriffenheit und Dankbarkeit stürzte der Schüler vor dem Meister auf die Knie und wollte ihm die Hand küssen.
Unwillig wehrte ihn der Meister ab: »Dummes Zeug, lassen Sie diese Possen! Aber merken Sie sich: als ich so alt war wie Sie, ist es mir nicht besser gegangen. Ich hatte, als meine gute Mutter starb, nicht nur für meine Brüder zu sorgen, sondern auch für meinen Vater, Gott habe ihn selig! Ich war sozusagen Familienvater mit siebzehn Jahren. Indessen, hören Sie wohl, ein junger Mensch ist nicht arm, auch wenn er nichts zu beißen hat. Also Kopf hoch! Und wie mir Ihr Vater beistand, als wäre er mein eigener Vater gewesen, so will ich jetzt an Ihnen handeln. Sehen Sie den Brief hier? Gehen Sie damit ins Bürgerspital, Sie wissen ja, und sagen Sie dem Baron Zmeskall, daß ich ihm ganz teuflisch gewogen bin; Sie werden dort etwas empfangen, kommen Sie damit ins Palais Lichnowsky. Also Gott befohlen! Es war doch gut, daß Sie heute morgen erschienen sind; danken Sie dem Himmel, daß er Sie zur rechten Zeit hergeführt hat.«
Damit entließ er den hochbeglückten Schüler, der eilends davonstürzte und im Herzen den guten Meister pries, dem er fortan als treuester Famulus anhing.
Fertig angekleidet, verließ bald darauf der Meister seine Behausung. Den Kopf zurückgeworfen, Hut im Nacken, die Hände mit dem Elfenbeinstock auf dem Rücken gekreuzt, lenkte er seine Schritte nach dem Palais in der Alstergasse. Er ging nicht schnell und ging immer gradaus, ohne eines Haares Breite von seinem Weg abzuweichen. Die Passanten mußten zur Seite treten, er tat es nicht. Und sie wichen aus. Manch einer blieb stehen und sah ihm verwundert nach. Er war nicht groß und erschien doch mächtig. Der muß wer sein, dachte der eine oder andere, daß ihm die Leute Platz machten, obschon sie kaum wußten warum. »Der ist wer«, das fühlte auch der Unbekannte.
Der Meister hatte es wirklich nicht eilig. Voll Selbstbewußtsein schritt er dahin. Keine Spur von Weichheit oder Wehmut war ihm anzumerken, wenn er unter die Leute ging. Er fühlte sich als Großer unter Großen, als Fürst unter Fürsten, mit denen er wie mit seinesgleichen verkehrte, wenn er sie nicht gar geringschätzig behandelte.
Nur wenn er ein hübsches Mädchen kommen sah, blieb er wohl stehen und sah ihm nach und ging dann still lächelnd weiter. Der Blick ging ein wenig nach oben und ruhte sinnend auf dem Horizont, in unbestimmter Ferne, wo wie eine leichte Vision der Engel Leonore schwebte. Dieser faszinierende, ideale Blick und dieses glückliche sonnenhafte Lächeln in dem trotzigen Gesicht, das man sonst häßlich nennen würde: es war ein eigentümliches Widerspiel, das den Reiz des Ungewöhnlichen hatte. »Der muß wer sein – – – –«
Stürmisch hatte der Freitag begonnen, aber allmählich wendete er sich ins Rosenrote und Himmelblaue. Daß sich das Gewölk freundlich zerteilen und das liebliche Gestirn der Venus ihn holdselig anlächeln werde, konnte der Meister allerdings nicht voraussehen. Aber in der Regel ereignet sich das Unvorhergesehene. Das gehörte nun einmal zu seinem Schicksal.