
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Herbst ist schön, goldig prangt das Laub, in den Weinbergen schmettert das Winzerhorn. Lust und Lachen, daß die Luft erklingt.
Da ist kein Bleiben in der Stadt.
Erfrischt und neugestärkt von der Badekur, hat sich der Meister gleich nach seiner Wiener Heimkehr zu einem Herbstausflug aufgemacht und ist zu Schiff unterwegs nach Ofen-Pesth, wo frischer Lorbeer seiner harrt und unter dem Lorbeerbaum der Kunst die Liebe thront.
Als er im Sommer nach Teplitz fuhr, waren ihm in den Reisewagen noch zwei Manuskriptbündel nachgeworfen worden, die Pester Theatertexte, damit es ihm in der Badeerholung nicht an Arbeit fehle. Nun kommen diese vertonten Festspiele zur Aufführung.
Nicht diese Gelegenheitsschöpfungen sind es, die ihn auf den neuen Reiseweg locken: die Herzensfrau nach den Jahren der Trennung, wo nur Briefe als Surrogat des Seelenaustausches dienen mußten, wiederzusehen, drängt es ihn. Und Franz tüchtig zu schelten, daß er ihn auf der Teplitzer Reise so schnöde im Stich ließ.
Die Schiffreise ist kurzweilig und reich an Wechselbildern. Dabei denkt Ludwig an den Rhein; der Vergleich heimelt an und läßt ihm das Fremdartige vertraut erscheinen. Römische Trümmerfelder, Burgruinen, die schmucke Krönungsstadt Preßburg gleiten in sanftem Zug vorüber, Auen, Wälder, Donauberge, die dicht an den Strom herantreten, und endlich das überwältigend schöne Stadt- und Flußbild bei der Ankunft in Ofen-Pesth. Hoch am Berge liegt die alte Feste von Ofen und spiegelt sich mit ihren Bastionen, ihren Gärten und vornehmen kleinen Palästen im heiter glänzenden Strom; auf der flachen Pesther Seite ziehen Avenuen mit promenierenden Menschen, Karossen, Reitern festlich hin, die prächtige Schauseite der jungen werdenden Hauptstadt, die sich eben zur feierlichen Eröffnung ihres neuen Theaters rüstet. Der Meister meint, ein so schönes Stadtbild noch nie gesehen zu haben; selbst Bonn am Rhein sinkt daneben schier ins Bedeutungslose. Das will viel sagen.
So langsam die Fahrt auf dem Wasser in der alten Schachtel geht, so schnell dünkt sie ihm. Viel zu schnell, je näher das ersehnte Ziel herankommt.
Seltsam, wie ihm jetzt unruhig zumute wird. Wenn er könnte, würde er jetzt den eilenden Schritt hemmen. Er fürchtet sich beinahe vor dem ersten Wiedersehen. In Gedanken war ihm die ferne Geliebte so nahe – jetzt mit zunehmender Nähe entschwindet ihm das holde Bild.
»Wie werden wir einander gegenübertreten?« Die Erinnerung an Martonvásár ist so frisch, als wäre sie von gestern. Aber nun fühlt er, daß Jahre dazwischen liegen. Und daß eine Atmosphäre von Fremdheit zwischen ihm und der Geliebten entstanden ist, die erst überwunden werden muß. Eine Scheu bemächtigt sich seiner; Herzklopfen, Bangigkeit befällt ihn, als das Schiff sich wendet, um anzulegen; Strom, Berg und die in der Abendsonne leuchtenden Fenster kreisen um ihn; alles dreht sich wie im Wirbel, Schwindel erfaßt ihn: die Welt vergeht vor seinen Augen.
Die Menschenmenge auf dem Schiff stößt und drängt vorwärts; Geschrei und Tumult um ihn her; der schmale Landungssteg schwankt: endlich, auf festem Grund, hat man erst recht das Gefühl, als müßte man umsinken.
Da fühlt er sich von rückwärts kräftig angepackt; zwei Arme schlingen sich um ihn, und eine starke Stimme schreit ihm ins Ohr:
»Servus, Bruderherz!«
Ludwig wendet sich rasch herum und blickt in ein rundes lachendes Männergesicht: Franz von Brunszvik, der ihm herzlich die Hände schüttelt und ihn stürmisch willkommen heißt.
Der Empfang scheucht alle Bangigkeit fort.
Der Heiduck in Husarenuniform hat rasch das Gepäck verstaut, und nun in die offene Kutsche hinein; in scharfem Trab geht es vierspännig den steilen Weg hinauf nach Ofen, an mächtigen Mauerquadern vorbei, dann durch still-vornehme Gassen, über den stimmungsvollen Platz mit der gotischen Matthiaskirche und wieder durch stille Zeilen mit kleinen Palastfronten. Vor einer derselben hält der Wagen; livrierte Bediente springen heraus und reißen den Kutschenschlag auf: endlich am Ziel, in dem kleinen Ofener Palais der Familie Brunszvik, wo Ludwig lang erwarteter Gast ist.
Bald nach der Ankunft sammeln sich die Familienmitglieder im Parterresalon, der nach der Gartenseite offen ist und ein schimmerndes Bild über den Fluß, über Gärten, Weinberge, Waldkuppen und die weite dunstige Ebene jenseits des Stroms erschließt bis zu farbigen Tinten des Horizontes.
Hier findet die Begrüßung statt.
Ludwig ist nicht der einzige, der unter der spannenden Erwartung des Wiedersehens leidet und hochklopfenden Herzens diesem fast peinlichen, ja gefürchteten Augenblick entgegensieht.
Theresa hat nicht weniger unter der nämlichen Folter gelitten.
»Wär' nur das erste schon vorüber!« Dieser Stoßseufzer war ehrlich und als Sympathiezeichen gemeinsam.
Aber was man so intensiv fürchtet, pflegt oft ganz harmlos zu verlaufen.
Die Gräfin-Mutter trat ihm in der Mitte des Salons mit einem halben Schritt entgegen und begrüßte den Gast mit einer Liebenswürdigkeit, die bei aller kühl betonten Distanz zugleich unendlich zu verbinden wußte:
»Willkommen, herzlich willkommen in unserem bescheidenen alten Hause; meine Kinder haben sich schon sehr gefreut, ihren Lehrer wiederzusehen!«
»Ihren Freund und Meister«, setzte Franz verbessernd hinzu.
Josephine und ihr Gatte Graf Deym umringten ihn wie einen lieben alten Bekannten mit einem Schwall von herzlichen Worten; Theresa stand im Hintergrund, groß, schlank, etwas blaß, die Linke ans Herz gepreßt, die Rechte, die sie ihm zum Gruß reichte und die er küßte, zitterte ganz leise; was die Lippen verschweigen mußten, besagte der Händedruck.
Der lähmende Bann war gebrochen; Pipschen und Franz sorgten schon für den ungezwungenen Herzenston; die Fremdheit war vorüber, es war wie damals auf Martonvásár, und als ob alles erst gestern gewesen wäre.
Den beiden Herzen, die es unmittelbar anging, erschien Ofen, der gesellschaftliche Sammelpunkt der Aristokratie des Landes, nicht der geeignete Ort für eine intime Aussprache. So war es denn auch gleich beschlossen, daß man nach der Eröffnung des Pesther Theaters ins stille Martonvásár zurückkehren wolle, und daß Ludwig natürlich mitkommen solle.
Hier in Ofen saß nun der Meister unter diesen edlen, vornehmen Menschen, die ihn trotz der Gräfin-Mutter als einen der ihrigen behandelten und den Ton mit ihm auf innige Freundschaft und Verehrung gestimmt hatten. Teplitz und der dortige Personenkreis, ebensogut wie die neuen Wiener Freunde sanken ins Vergessen, ins tiefe, tiefe Nichts. Alle kleinen Tändeleien und Verwirrungen, die zuweilen glühende Kohlen über seinem Herzen sammelten, schienen nichts als der rasch verwehte Spuk eines flüchtigen Sommernachtstraums, der seine Seeleneinsamkeit mit kindischen Gaukeleien umwoben hatte. Vorüber, vorüber! Hier war seine eigentliche Heimat, die Seelenheimat, unter diesen großdenkenden, feinen Menschen, die ohne Arg und ohne Falsch waren. War man in ihren Kreis aufgenommen, dann gehörte man auch schon zur Familie; es gab keinen Unterschied mehr.
Alle fanden, daß Ludwig kräftig und blühend aussehe; wenn er von Krankheit sprach und von einer Teplitzer Kur, dann nahm man es als eine Sache, die jede Bedeutung verloren hatte und die sein Aussehen Lügen strafte.
Allerdings, wenn er in der Unterhaltung manches überhörte und eine verkehrte Antwort gab, dann wechselten sie verstohlen schmerzliche Blicke, die zu Theresa gingen und bedauernd sagen wollten, daß sein Gehör katastrophal abgenommen habe; sie tat, als merkte sie nichts, obschon ihr Gesicht manchmal leidensvoll dreinsah.
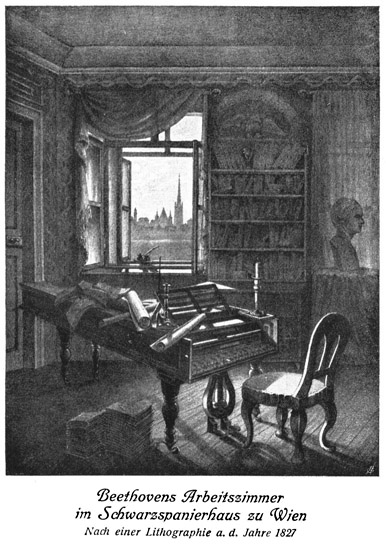
Peinlich war es, wenn Gäste kamen – in Ofen waren immer Gäste zugegen, die gesellschaftlichen Verpflichtungen währten vom Morgen bis tief in die Nacht. – Immer wieder dieses Bedauern: wie traurig für den großen Künstler, das Gehör zu verlieren! Der armen Theresa ging es jedesmal wie ein Messerstich durchs Herz, und gewiß jeder Tag brachte ihr ein paar Dutzend solcher Messerstiche bei. Ein Glück, daß der Meister selbst diese Äußerungen nicht hörte.
Und dann diese Qual am Klavier: Ludwig nahm oft einen falschen Akkord, eine Dissonanz, und schien es selbst nicht zu merken!
Und wieder ein Glück, daß es in der Gesellschaft niemand zu merken schien, die scharenweise herbeiströmte, um den berühmten Künstler zu ehren und persönlich zu sehen.
Es blieb nur wenig Zeit zu Spaziergängen; aber Ludwig nützte diese wenige Zeit aus, meistens begleitet von Franz und den Schwestern.
In Ofen fühlte er sich zu Hause wie in Heiligenstadt.
Nur daß hier zum Ländlichen noch die aristokratische Note kam und den Reiz erhöhte.
Auf der alten Bastei gab es Stimmungen wie in den alten Rhein- und Moselstädtchen. Empire atmete das Regierungsgebäude mit dem Reliefband auf der Stirne von Ferenczi. Dann einsame Straßen mit einstöckigen Häusern wie in einer stillen Residenz. Wappenschilder über steinernen Torbogen. Höfe mit Blumen, Oleander, Efeu, Wein, weißen Veranden, hohen Fenstern, biedermeierlich wie in Wien. An einem Patrizierhause klassizistische Reliefmedaillons: Virgil, Cicero, Quintilian, Sokrates, Livius; an einem anderen die Hand Gottes, aus einer Wolke ragend und segnend; hier Empirevasen als Portalverzierung; dort ein schön gemeißeltes Torbild in klassischer Haltung; dann ein Türkenkopf; und schließlich Winzerhäuser, Heurigenschänken, Weingärten, alles wie in der Wiener Gegend. Dazu Zigeunermusik. Eine Taube auf stilisiertem Bäumchen als Gasthauszeichen »Zur weißen Taube«. Eine andere Gaststätte mit dem romantischen volksliederartigen Beinamen: »Die Marmorbraut«.
Und hier soll man sich nicht zu Hause fühlen!
Ein Lieblingsgedanke steigt auf: »Ein kleiner Hof, eine kleine Kapelle, nur dem Dienst großer, reiner Kunst geweiht –« hier wäre der Ort und wären die Menschen: enthusiastisch, begeisterungsfroh, für alles Schöne entflammt.
Er ist von der Huldigung dieser Gesellschaft schier benommen.
Der Jubel bei der Festaufführung seiner Gelegenheitskompositionen, obschon künstlerisch ein Nebenschauplatz wie der Ort selbst, übersteigt alles bisher Erlebte.
Theresa ist glücklich, den Meister von der leuchtenden Woge der Kunstfreude in dieser erlesenen Gesellschaft, die die Blüte des Landes ist, emporgehoben und nach Würde und Verdienst gefeiert zu sehen.
Schließlich sehnt man sich von diesem Höhepunkt nach Landstille, besinnlicher Einkehr, Einsamkeit.
Man rüstet zur Heimkehr nach Martonvásár und scheidet gerne, obschon mit Bedauern, doch in Erwartung eines heimlichen Glücks unter den alten Linden.
Wie wohltuend diese Ruhe, diese stimmungsvolle Abgeschiedenheit, dieser selige Nachgenuß festlicher Tage.
Zum zweitenmal in Martonvásár, dahin sich das Herz in Lebensstürmen und quälendem Heimweh so oft gesehnt und in Liebesleid verzehrt hat!
Es hat den Meister einst von hier in Tatendurst und Schaffenslust fortgetrieben; jetzt kehrt er zurück, ein Ruhbedürftiger, ein Heimgekehrter, den es verlangt, sein zerquältes Haupt im Schoß der Liebe zu verbergen, in der heiligen Stille des alten Parks das Gleichmaß des zerrissenen Herzens wiederzufinden.
Er hat kein Heim, kaum eine Heimat – und findet sie hier: und weiß doch zugleich, daß er auch hier ein Verbannter ist.
Was im bewegten Leben von Ofen nicht möglich war: der Stimme des Herzens zu lauschen, hier wird es endlich den Liebenden zuteil; hier gehören sie sich selber an.
Wie in alter Zeit wandeln Theresa und Ludwig allein durch die hohen Baumzeilen nach dem Lindenplatz und sitzen dort, von keinem Hörer belästigt, in Herzenszwiesprach allein.
Es ist wohl nicht mehr ganz dasselbe wie früher. Die Zeit und Erfahrung hat manches Hoffnungssegel zerfetzt und manchen Mast des stolzen Lebensschiffes geknickt. Eine schwere Fracht von Tränen und Bitternissen hat es bis zum Tiefgang beschwert, schier zum Sinken. Aber immerhin ist es noch seetüchtig, wenn auch nicht mehr ganz intakt.
Wovon die Liebenden sich unterhalten und nicht genug erzählen können, sind die Leiderfahrungen in den Jahren der Trennung und der Sehnsucht.
Die Vergangenheit macht elegisch; die Gegenwart aber machte den Meister bitterböse; die Zukunft stimmte ihn wieder versöhnlich.
»Unser Bund ist im Himmel geschlossen, Theresa,« sagte er in ernster Zwiesprache, »aber der Himmel machte ein unfreundliches Gesicht. Meine Hoffnungen von damals sind Ruinen geworden – in Ruinen können wir keine Heimstätte aufschlagen. Ich glaubte mich am Ziel: die Jahresrente, mein Schaffen – es hätte für uns beide gereicht zu einem vielleicht bescheidenen, aber würdigen Dasein. Aber der Krieg und der Staatskrach, die Entwertung der Rente und schließlich deren Zahlungseinstellung – du siehst, es hat mich verfolgt!«
Theresa sieht das alles, aber sie sieht noch mehr. Was sind doch alle diese Verluste an irdischen Gütern, die nicht unersetzlich sind, gegen das furchtbare Schicksal des Meisters, seine Ertaubung nämlich, die ihn, den Musiker, härter treffen muß als jeden anderen Sterblichen, und die ihn zum tragischen Helden, ja zum Märtyrer bestimmt.
Daran muß Theresa vor allem denken; sie leidet um seinetwillen und ist jetzt in doppelter Weise ergriffen, von Schmerz und Freude zugleich ganz seltsam bewegt, weil er in allen materiellen Sorgen um sie so völlig des eigentlichen und größten Unglücks vergessen, das ihn persönlich betroffen und am meisten seine Zukunft bedroht: sein verhängnisvolles Leiden – – –
Sie möchte ihm einen Trost geben und seine Sorgen erleichtern. Darum deutet sie in zarten Worten an, er möge sich um sie keinen Kummer bereiten, sie sei zufrieden mit dem Los, das ihr nun einmal beschieden, und bereit, allen Wünschen und Hoffnungen auf eheliches Glück zu entsagen, der Seelenbund bliebe desto reiner bestehen – – –
Da war es aber bei diesen leisen Andeutungen, als ob ihn ein Blitz getroffen hätte.
Er zuckte schmerzlich zusammen und stand wie vernichtet da. Eine unsägliche Trauer malte sich in seinem Gesicht, daß es nun vollends zur tragischen Maske wurde und Theresa bestürzt und ergriffen ihn voll Teilnahme nach dem Grund dieser plötzlichen Niedergeschlagenheit fragte.
»So will mich auch mein Engel verlassen – –« sagte er dumpf. »Du liebst mich nicht mehr ...«
»Um Gottes willen, nein! So war es nicht gemeint!« Theresa hatte alle Mühe, den Geliebten zu beruhigen und ihn seiner Schwermut zu entreißen, was erst nach Tagen und unendlichen Erweisen ihrer tröstenden Liebe gelang.
Sie wollte ihn erinnern, daß die Verwirklichung des gemeinsamen Glücks nicht in der Ferne zu suchen sei, wenn er sich entschließen könne, auf Martonvásár zu leben, wie es ihm die Geschwister schon damals bei der heimlichen Verlobung vorgeschlagen hatten.
Ein kleiner Hof, eine kleine Kapelle – der Gedanke wäre zu erwägen, von hier aus in der »Sozietätsrepublik edler Menschen« müßte er ins Leben gerufen werden, ein Adelskomitee als Patronanz mit Ofen als Musenhof – – oh, welches schwelgerische Gedankenglück!
Theresa, indem sie diesen Plan aufgriff, ließ zwar durchblicken, daß durch die schlimmen Zeitumstände auch ein großer Teil des Brunszvikschen Vermögens verlorengegangen sei; darum habe man das Wiener Palais aufgegeben und die kostspieligen Aufenthalte in der Residenz einschränken müssen; die alten glänzenden Zeiten seien eben vorbei – trotzdem aber seien die Erträgnisse des Gutes groß genug, um die Existenz zu sichern, auch für Ludwig, wenngleich sie begreife, daß ein Meister wie er, sich nicht in Landeinsamkeit im tiefen Ungarn vergraben könne, sondern die große Welt brauche, die Reichshauptstadt, das Leben – – –
Aber auch dieser erneute wohlgemeinte Antrag hatte eine unerwartete Wirkung. Er raufte sich bei dieser Andeutung verzweifelt die Haare:
»Warum bin ich nicht geblieben, damals, als ihr alle mich hier festhalten wolltet? O Glück! Ich habe es nicht erkannt, und ich habe es von mir weggestoßen! Und was mir ein Glück erschien, war mein Unglück gewesen. Theresa, der Vertrag, der mir die Jahresrente sichern sollte, ist mein Verhängnis geworden. Er bindet mich an Wien, wenn ich nicht meine Rechte preisgeben will; er hindert mich, meinen Wohnsitz bei euch aufzuschlagen, wohin es mich verlangt, und an eurer Seite zu leben und mit euch glücklich zu sein. Martonvásár, Heimat meiner Seele, Zielpunkt meiner Sehnsucht, Haus meiner Liebe – ich habe es verwirkt mit diesem Vertrag! O unseliges Dekret, verführerisch wie eine Sirene, dagegen ich mir hätte die Ohren mit Wachs verstopfen sollen und mich festbinden wie Ulysses, um nicht zu unterschreiben.«
»Du wärest nach Kassel gegangen,« erinnerte Theresa sanft, »insofern war der Vertrag mit den Wiener Protektoren kein Unglück; durch ihn bist du uns erhalten geblieben. Die schlimme Zeit geht vorüber, wir brauchen den Mut nicht sinken lassen. Ich bin voll Vertrauen!«
»Liebste! Ich muß trotzdem fort, ins ferne Ausland – ich habe Freunde in England, Kunstreisen müssen das Fehlende hereinbringen, ich denke an Haydn, der dort gefeiert war; noch ist es Zeit für mich, noch ist es nicht zu spät – fürchte nichts, Teuerste! Wenn ich wiederum komme, dann will ich Herr sein über all diesen Kleinkram des Alltags und dann, dann Geliebte, will ich bei dir beheimatet sein, und wir sollen nicht ängstlich fragen dürfen, ob Stand oder Besitz es erlauben – – – Noch eines obliegt mir vorher: meine Gesundheit zu festigen; die Badekur hat mir wohlgetan, ich glaube, mein Gehör hat sich gebessert, ich habe schon schlechter gehört – der Arzt gebietet mir die Wiederholung im nächsten Jahr, von der ich mir das Äußerste verspreche; also gestärkt will ich zum großen Sieg ausholen – ich weiß es, er ist unser; eine innere Gewißheit sagt es mir!«
Der Himmel, der den Bund segnete, war wieder hell und heiter über den Liebenden und hing voller Musik. Beim Abschied wurde Ludwig aufs neue schwermütig, und voll düsterer Ahnung sagte er: »Wann werde ich Martonvásár wiedersehen?!«
Doch heiter erwiderte Theresa: »Kommst du nicht nach Martonvásár, so komme ich nach Wien!«
Darüber war er wieder ganz fröhlich und leichten Herzens, so schwer ihm auch der Abschied diesmal wurde.
Vor Eintritt des schlechten Herbstwetters war der Meister nach Wien zurückgekehrt, an Leib und Seele gestärkt, voll Tatkraft und Entschlossenheit, mit eigener Kraft sein Glück zu zimmern und »dem Schicksal in den Rachen zu greifen«, wie er es schon einmal heldenhaft getan.
»Ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht! Oh, es ist so schön, das Leben tausendmal leben.«
Aus dem Wellental der pessimistischen Verneinung war er wieder auf den Wellenberg der lebensfrohen Bejahung emporgestiegen.
Das hatte Martonvásár bewirkt, das lindenumrauschte Heiligtum, wo die Vestalin, die keusche Hüterin der seligen Flamme, herrschte, die unsterbliche Geliebte!
Der Winter brachte einige gesundheitliche Rückschläge, die dem Meister allen frisch gewonnenen Lebensmut wieder raubten. Er sehnt die schöne Jahreszeit herbei, von der er alles hofft. Malfatti hat ihm einen mehrmonatigen Aufenthalt in den böhmischen Bädern vorgeschrieben. Endlich ist der Frühling da – eine zweite Hoffnung winkt, diesmal Goethe zu begegnen.
In Teplitz ist große Zusammenkunft der Hocharistokratie, eine Entrevue gekrönter Häupter und aller Fürstlichkeiten, aus politischen Gründen. Goethe war aus Karlsbad gekommen, um den hohen Herrschaften seine Aufwartung zu machen und begrüßt hier endlich auch den Fürsten der Töne, Beethoven.
Arm in Arm spazieren sie über die Blumenpromenade, wo ihnen die Fürstlichkeiten begegnen.
Goethe macht sich sofort los und steht mit abgezogenem Hut unter devoten Verbeugungen zur Seite, während Beethoven bloß leicht den Hut lüftet und geradewegs durch das Spalier der hohen Herrschaften hindurchgeht, die ihm alle recht freundlich danken.
Er wartet dann auf Goethe und sagt ihm mißbilligend:
»Ich habe gewartet, weil ich Euch ehre und achte; aber jenen habt Ihr gar zuviel Ehre angetan!«
Er freut sich, ihn mit diesen Worten geneckt zu haben, und findet, daß ihm die Hofluft doch mehr behage, als einem Dichter zieme:
»Wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen sein sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können, was wolle man da noch über die Lächerlichkeiten der Virtuosen reden?!«
Auch Goethe war enttäuscht. Die formlose, ungeschliffen erscheinende Persönlichkeit Beethovens stieß ihn ab; sie war seiner Natur ganz entgegengesetzt. Wohl schreibt er an seine Frau Christiane:
»Zusammengefaßter, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreife recht gut, wie er gegen die Welt wunderlich stehen muß.«
Noch weniger findet er sich in seine Musik. Beethoven hat ihm vorgespielt, aber diese ungeheure Welt ist dem Dichter fremd. Er hat eine unüberwindliche Abneigung, geradezu Furcht vor dem dämonischen, unfaßbaren Wesen dieser Musik. Er findet, daß sie sich immer ins Elementarische verliert, was für Teufelszeug! Und faßt sein Urteil zusammen:
»Wer so auf der Klippe steht, muß sterben oder verrückt werden, da ist keine Gnade!«
Jedenfalls, mit den ästhetischen Unterhaltungen über Musik, die Bettina so verlockend vorgezaubert hat, wird es nichts. Kometenhaft wandeln die beiden Größen aneinander vorüber, ihren entgegengesetzten Zielen zu auf Bahnen, die sich zwar kreuzen, doch nur um wieder weit auseinander zu laufen.
Die hohen Herrschaften sind abgereist, es wird still in Teplitz; ein neuer Gast ist angekommen, mit dem sich der Meister besser versteht, Amalie, die karitative Muse.
Obschon selber zart von Gesundheit und leidend, erscheint sie als der helfende Engel, der sich des Einsamen annimmt.
Sie kommt nicht ohne stille Hoffnung, obschon sie nicht verrät, daß sie eigentlich nur seinetwegen kommt.
Er fühlt sich körperlich elend, und obzwar er ihr von Herzen dankbar ist, läßt er seiner oft recht schwer erträglichen Laune allzu freien Lauf. Er beansprucht viel Geduld und Nachsicht, und sie nennt ihn nicht mit Unrecht »ihren Tyrannen«.
Er ist ganz verstört darüber und weiß es nicht, daß er oft unausstehlich ist. Aber daran ist seine Leber und Galle schuld, die schlecht funktionieren.
Tagelang muß er das Bett hüten; Amalie sorgt für den Speisezettel unter Beachtung der nötigen Diät, schickt ihm das geeignete Essen durch die Hotelküche, macht die Rechnung und verkehrt mit ihm durch Zettel, da sie nicht zu bewegen ist, allein sein Zimmer zu betreten und ans Krankenlager zu kommen. Aber ansonsten packt sie die Geschichte recht praktisch an; er ist dankbar und demütig und denkt wieder daran: »daß Heiraten doch glücklich machen kann!«
Das Teplitzer Liebesidyll geht zu Ende; Amalie wird zur erkrankten Mutter abberufen. Sie nehmen Abschied in dem Gefühl, daß es endgültig ist, freundschaftlich ohne Wunsch, ohne Hoffnung, nur mit dem resignierten Gewinn einer lieben Erinnerung.
Immerhin sitzt bei dem leidenschaftlichen Ludwig die Sache etwas tiefer. Die anspruchslose Art der liebenden Fürsorge hat ihn gefangengenommen. Er fühlt betreuende Liebe, die nichts als Wohltat ist, und nicht einmal hohe Verehrung, kaum ideale Gefühle fordert. Es war wie ein Ausruhen. Die Mütterlichkeit in dieser zarten Neigung hat ihn gefangengenommen; sie ist es, deren der Hilfsbedürftige jetzt am dringendsten bedarf; sie ist das Geheimnis von Teplitz, das er mit schmerzlichem Verzicht seinem Tagebuch anvertraut:
»Ergebenheit, innigste Ergebenheit in dein Schicksal – – – o harter Kampf! Du darfst nicht Mensch sein für dich, nur für andere; für dich gibt es kein Glück mehr als in dir selbst, in deiner Kunst – o Gott, gib mir die Kraft, mich zu besiegen, mich darf ja nichts an das Leben fesseln. Auf diese Art mit Amalie geht ja alles zugrunde!«
Keine Untreue gegen Theresa weiß er; wenn er in seine Kunst flüchtet, so erscheint ihm das Bild der Unsterblichen, die als seine Muse sinnt unter den träumenden Linden von Martonvásár und seiner harrt, und der er doch nicht sagen möchte, wie elend ihm ist, während er vor Amalie keine solche Scheu kannte, die seiner Hinfälligkeit näher stand als dienende Liebe. Was ihm Teplitz sein konnte, verkörpert sich in Amalie.
Seine Seele betet allerdings zu einer höheren Göttin, die in Einsamkeit thront, seine Kunst, wohin ihm Amalie nicht hätte folgen können, und das war das Sterbliche an ihr. Dort in jener idealen Region ist seine tiefste Zuflucht, und dort begegnet er Theresa. Sie ist die Herrscherin über sein Seelenreich, und alles andere ist untergeordnete Episode. Dort in jenem unbegrenzten Reich hat er neue Schöpfungen gereift, seine siebente und achte Symphonie, deren heiterer Klang nichts weiß von den Schlingen und Verstricktheiten des Alltags; sie schweben in absoluten Sphären und sind den Wechselfällen des äußeren Geschicks nicht unterworfen. So frei und unabhängig ist sein Geist, der in den Gefilden des unendlich Schönen beheimatet ist und hier Theresa begegnet. Die beiden neuen Symphonien sind Huldigung für sie, seine Muse. In diese Sphäre hinein dringt kaum ein Nachklang der realen Welt und der empfundenen Schmerzen, und wenn ein düsterer Klang sich meldet, so wird er mit dem ihm eigentümlichen tragischen Humor und dem befreienden Lachen des Überwinders gelöst und in höhere Seligkeit verwandelt, die wieder nur ein Loblied der unsterblichen Geliebten ist, der Göttin seiner Einsamkeit, die seine Kunst segnet und sein Lied begeistert.
Die Achte wird in Linz vollendet, wohin er von Teplitz aus reist, um die restlichen schönen Herbsttage beim Bruder Johann zu verbringen, der sich wieder eines Besseren besonnen und ihn eingeladen hat.
Auf die erhebende Versöhnungsszene folgt alsbald ein häßliches Satyrspiel, womit in der Regel solche Familientage enden. Der Bruder Johann steht im Begriffe, seine Wirtschafterin Therese Obermeyer, die ihm eine erwachsene Tochter in die Ehe bringt, zu ehelichen, und dachte dieses Fest durch die Anwesenheit des berühmten Bruders zu verherrlichen.
Ludwig tobt vor Entrüstung, und es wiederholen sich Szenen, ähnlich jenen, die sich bei der Verheiratung des Bruders Karl ereignet haben. Aber alle Auftritte haben nur den Erfolg, daß Johann seine Therese Obermeyer erst recht heiratet, ganz wie bei Karl. Darin sind sich die Brüder durchaus ähnlich. Daß Johann eine vom »dienenden Stand« heiratet, empfindet Ludwig als kein geringeres Unglück als die Ehe Karls mit einer leichtsinnigen Frauensperson. Er betrachtet es geradezu als persönliche Beleidigung. Voll Ärger und Bitterkeit verläßt er Linz noch vor der Hochzeit des Bruders. Er kann sich nicht in die Art der Brüder finden, weil sie nicht wie er den Sinn für das Edle und Hohe haben. Das zeigt am deutlichsten die Wahl der Frauen.