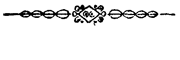|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Während Maria Theresia mit ihrem Gemahl in Italien von einem Feste zum andern zog und Karl VI. sich durch Jagdparthieen die Sorgen um Staatsgeschäfte zu verscheuchen suchte, (ernster bekümmerte sich um die Letzteren seine Gemahlin Elisabeth Christina) wurde ein Feldzug gegen die Türken mit eben so viel Unglück geführt, als er mit Leichtsinn begonnen worden war. Der schlimme Ausgang dieses Krieges legte die Verwirrung am Wiener Hofe, die Schwäche der österreichischen Macht aller Welt offenkundig dar.
Der Vertrag vom 6. August 1726, in welchem Rußland auf Karls VI. Wunsch die Garantie des Wiener Friedens übernommen hatte, verband den Kaiser zu gleicher Gewährleistung in Beziehung auf die europäischen Besitzungen Rußlands, und beide Theile zur Stellung eines Hülfsheeres von 30,000 Mann. Als nun Rußland im Jahre 1736 der Pforte den Krieg erklärte, war der Kaiser gehalten, jenem das versprochene Hülfsheer zu senden. Er ging übrigens noch weiter, als jene Verpflichtung verlangte. Eine neue Uebereinkunft zwischen Oesterreich und Rußland setzte fest, daß Ersteres an der Unternehmung selbst Antheil nehmen und daß der Krieg nach einem beiderseits verabredeten Plane geführt werden sollte. Der Kaiser hatte dabei seinen besondern Beweggrund und verhehlte denselben nicht, als die Seemächte, welche Grund genug hatten, eine Theilung der Türkei zu befürchten, sich eine Erklärung ausbaten. Ausdrücklich bemerkte er in seiner Erwiederung, daß er sich »für den großen Aufwand des Krieges gegen Frankreich, der ihm allein zur Last gefallen sei, und für den Verlust in dem Friedensschlusse von 1735 anderweitig zu entschädigen suche;« beigefügt war die Unterstellung, welche seine Absicht noch deutlicher aussprach, »es müsse den Seemächten selbst wünschenswerth sein, wenn seine Macht eine Vergrößerung erhalte und in den Stand gesetzt werde, der vereinigten Macht Frankreichs und Spaniens die Spitze zu bieten.«
War es dem Kaiser, wie nicht zu bezweifeln, ernstlich darum zu thun, diese Absicht zu erreichen, so konnte zweierlei unmöglich entschuldigt werden, – erstens, daß man es nicht für unredlich hielt, nach dem festen Beschluß des Krieges noch die diplomatische Komödie eines Vermittlungsversuches auf dem Kongreß zu Niemerow aufzuführen, um die Seemächte zu beschwichtigen und die Türken hinzuhalten, und zweitens, daß man leichtsinnig genug war, den durchaus unzulänglichen Zustand des Heeres nicht zu verbessern. Vergeblich hatte der mit der Führung des Krieges betraute General-Feldmarschall Seckendorf diesen Zustand, welchen er genau kennen gelernt, dem Wiener Hofe in den grellsten Farben geschildert, – die gänzliche Verwahrlosung der Festungen, Kasernen und Lazarethe, den Mangel an Munition, Pontons, Schiffen und Proviant u. s. w. Dazu kam nun noch der andere wesentliche Uebelstand, daß Seckendorf der, bei manchen Fehlern, besonders Eigennützigkeit und Herrschsucht, doch immerhin ein brauchbarer Feldherr war (Eugen selbst hatte ihn empfohlen), als Protestant und Günstling der Kaiserin nicht wenige Feinde in Wien hatte; und eben von Wien aus (vom Hofkriegsrath) empfing er alle Befehle zu seinen Operationen! Mußte schon dies Verhältniß an und für sich seine Selbstthätigkeit lähmen, so fand er im Heere nicht minder große Hindernisse. Das Heer zählte auf dem Papiere 122,514 Mann (die leichten Truppen, die Artillerie und die Donauflotte nicht eingerechnet), war jedoch in der Wirklichkeit blos 26,000 zu Fuß und 15,000 zu Roß stark und besaß, was das Schlimmste war, eine viel zu große Menge von Befehlshabern, von denen Einer auf die Autorität des Andern eifersüchtig, Alle unter sich uneins und dem General-Feldmarschall abgeneigt waren. Die Stellung des Letzteren wurde noch schwieriger, als am 21. Juni 1737 der Herzog von Lothringen bei ihm eintraf, welcher den Krieg »als Volontär« mitmachen wollte, aber nach der in Wien deßhalb ausgefertigten Instruktion mit allen Ansprüchen eines en chef commandirenden Generals behandelt werden mußte; dabei sollte Seckendorf dem Schwiegersohn des Kaisers gewissermaßen als Lehrer zur Seite stehen und darauf sehen, daß demselben kein Leid zustieße, wenn den Prinzen »eine lobwürdige Ruhmbegierde zu Mehrerem, als nicht sein soll, verleitete.« Eine mißliche Aufgabe! Und in der That wurde das gute Vernehmen zwischen dem Feldmarschall und dem Prinzen bald genug gestört, wenn gleich der Letztere bei dem Feldzuge nur eine passive Rolle spielte.
Weniger Leichtsinn, als die Unfähigkeit, sich zu großartiger Auffassung der Verhältnisse zu erheben, war es endlich, was den Wiener Hof die Wichtigkeit eines nationalen Elementes übersehen ließ, welches bereit war, sich ihm anzuschließen. Der Erzbischof von Ochryda in Macedonien und der Patriarch von Pechia in Albanien hatten nämlich dem Kaiser insgeheim die Zusage gegeben, daß die christliche Bevölkerung daselbst, so wie seine Armee die Gränze überschritte, dieselbe unterstützen und sich zugleich von der türkischen Herrschaft losreißen würde. Dies Anerbieten war nun dem Kaiser allerdings willkommen, er versprach den beiden Kirchenfürsten, sie unter seinen Schutz zu nehmen, ja er wollte sogar dem griechischen Kultus freie Religionsübung gewähren. Bei dem ganzen Kriegsplan rechnete er mit voller Zuversicht auf den Ausbruch der Empörung. Aber der kühne Erzbischof hatte noch einen andern Plan, vor dessen Großartigkeit der Kaiser zurückbebte; – jener wollte mit dem Sieg des Kreuzes auch eine Wiedergeburt der griechischen Nation; frei und selbstständig sollte diese als wichtige Zwischenmacht in Bosnien, Serbien, Albanien, Makedonien und auf dem Peloponnes dastehen, das geistliche Haupt zugleich ihr weltliches sein, aber im Lehensverband mit dem deutschen Reiche, unter Oberlehnsherrlichkeit des römischen Kaisers, der dem Fürsten des wiedergebornen Griechenlands Sitz und Stimme auf dem deutschen Reichstage anweisen sollte. Der Vorschlag – wie mancher damit verwandte hatte deutschen Kaisern, z. B. einem Heinrich VI., vorgeschwebt! – war unter den obwaltenden Umständen, bei der Erschlaffung der osmanischen Streitkraft und der Bedrängung der Türkei auf andrer Seite durch Rußland, nichts weniger als chimärisch; er war es auch, abgesehen davon, deßhalb nicht, weil das nationale Element, durch das religiöse gehoben und gehalten, Wunder vollbringen kann. Aber Karl VI., – so wundergläubig er sonst war, konnte an ein solches nicht glauben; im ganzen Wörterbuch des spanischen Ceremoniels fehlte gerade das Wort Nationalität. Und dann, wie gesagt: er war müde; die pragmatische Sanktion hatte ihn vor der Zeit alt gemacht, er erwog, gab Zusagen im Allgemeinen, womit den Griechen nicht gedient sein konnte, suchte hinzuhalten. Am Ende mußten sie mißtrauisch werden und lieber auf den ganzen Plan von vorne herein verzichten, als sich aufs Ungewisse hin ihrerseits preisstellen. Und so regte sich denn auch, als ein kaiserliches Streifkorps in Albanien eindrang, keine Hand zur Unterstützung desselben, wie der Kaiser so fest gehofft. Welches Spiel hatte Karl VI. aus der Hand gegeben!
Ich habe mich über die zu Grunde liegenden Verhältnisse bei Beginn des Türkenkrieges weitläufiger ausgesprochen, als ich es über den letzteren selbst thun werde. Es handelte sich mehr darum, einen auch für die Schilderung der nächsten Folgezeit wichtigen Blick in die Verhältnisse des Wiener Hofes zu gewinnen, als das Interesse für eine Kriegsgeschichte in Anspruch zu nehmen, welche dem Plan dieses Werkes ferner liegt, und bei welcher der Gemahl Marien Theresiens keineswegs hervortritt und bald ganz verschwindet. Hier nur die Umrisse der Ergebnisse!
Der Anfang des Feldzuges von 1737 ließ sich immerhin günstig an. Die Hauptarmee zog im Juli über die Morava; Nissa wurde eingeschlossen und ergab sich den Kaiserlichen am 28. Juli, über welchen Erfolg Karl VI. nicht wenig erfreut war. Es charakterisirt ihn, übrigens, daß er, als ihm Seckendorf vorstellte, den gewonnenen Platz befestigen zu lassen, statt der Entscheidung darüber, blos den Befehl ertheilte, die dortigen Moscheen niederzureißen bis auf eine, welche zur katholischen Kirche geweiht werden sollte. Noch währte in Wien die allzuvoreilige Freude über diesen ersten Erfolg, als auf dem Kriegsschauplatz selbst ein Mißgriff und Unfall den andern drängte. Daß Franz Stephan sich von demselben entfernte, um von Toskana Besitz zu ergreifen, war außer Belang. Aber Khevenhüller versäumte, Widdin zu nehmen. Der Prinz von Hildburghausen, welcher mit dem zweiten Heere nach Bosnien gezogen war, (– ein drittes rückte unter Wallis in die Walachei) belagerte Banyaluka vergeblich und wurde geschlagen. Khevenhüller zog sich nach Persa-Pakanka, dann über die Donau nach Orsowa und Mehadia zurück, – die Hauptarmee unter Seckendorf gegen Sabacz und Belgrad. Nissa übergab der feige General Dorat am 15. Oktober den Türken wieder; er büßte dafür mit seinem Kopf. Alle Schuld wurde nun auf Seckendorf gewälzt; seine Feinde, die geistlichen und weltlichen, triumphirten. Er sah sich plötzlich vom Kommando abberufen und nach Wien verlangt; dort wurde er verhaftet und angeklagt. Bevor man seine Strafbarkeit untersuchte, bezeichnete ihn der Hof in einem Circularschreiben an die kaiserlichen Gesandten als einen überwiesenen Verräther, was er keineswegs war. Man setzte selbst den Haß des Volkes in Wien gegen ihn in Bewegung und benutzte dann den Ausbruch dieses Hasses, um Seckendorf, unter dem Vorwand: man wolle ihn schützen, – aus Wien zu entfernen. Ohne den Spruch eines Kriegsgerichts zu erhalten, aber auch ohne seine Titel und seine Würden zu verlieren, wurde er bis zum Tode des Kaisers zu Gräz in Haft gehalten.
Statt Seckendorfs wurde zuerst Philippi, dann Königseck Oberfeldherr. Auch der neue Feldzug begann glückverheißend, ohne glücklicher zu enden wie der erste. Die kaiserliche Armee, bei welcher sich abermals Franz Stephan, jetzt Großherzog von Toskana, als »Volontär«, aber mit allen Ehren und Ansprüchen eines Generalissimus befand, siegte am 28. Juni 1738 bei Kornia, entsetzte Neu-Orsowa und schlug die Türken bei Mehadia. Da sie jedoch durch diese Siege bedeutend geschwächt und nicht durch frische Truppen ergänzt wurde, so mußte sich Königseck, als sich der Großvezier mit einem bedeutend stärkeren Heere näherte, in die Linien von Belgrad zurückziehen, worauf die Türken, – ohnehin bereits Meister von Neu-Orsowa, – Semendria nahmen.
An die Stelle Königsecks, welcher zurückberufen wurde, trat nun Feldmarschall Wallis, – unter noch ungünstigeren Umständen. Das feindliche Heer war gerade doppelt so stark als das kaiserliche, das Letztere noch dazu im üblen Zustande, und auf den Befehl des Hofkriegsraths in Wien verließ Wallis seine sichere Stellung. Bei Krozka erlitt er am 23. Juli eine furchtbare Niederlage, welche seinen schleunigen Rückzug bis Belgrad und über die Donau zur Folge hatte. Nun verlor er die Besinnung; der Feind, um so mehr ermuthigt, belagerte Belgrad, wo ein Feigling, General Sukkow kommandirte, und beim ersten Schuß der Türken dem Oberfeldherrn sagen ließ, daß er sich nicht länger halten könne. Diese Nachricht entmuthigte Wallis noch mehr und zwar in dem Grade, daß er von der kaiserlichen Vollmacht: den Frieden zu unterhandeln, die er in Händen hatte, Gebrauch machen zu dürfen glaubte. Aber wie! Kaum sollte man es glauben, daß ein Feldherr die Schleifung der wichtigsten Festung zum Präliminarartikel machte. Nicht zu übersehen ist es, daß der französische Gesandte bei der Pforte, der Marquis von Villeneufve, hiebei auf's Allergeschäftigste die Hand im Spiele hatte; es war die alte Operation Frankreichs bei den Osmanen gegen Oesterreich, wohlbekannt seit einer so langen Reihe von Jahren, und dennoch konnte Villeneufve seinen Geschäftseifer so ganz und gar ungehindert walten lassen; – ein Beweis, wie maßlos die Verwirrung am kaiserlichen Hofe war!
Allerdings erregten die Berichte des Feldmarschalls Wallis über den Stand der Dinge nach Wien keine geringe Bestürzung beim Hofkriegsrath und bei den Majestäten, insbesondere bei der Kaiserin. Der Generalfeldzeugmeister Schmettau wurde mit dem Auftrag: Belgrad und Peterwardein zu retten, zur Armee zurückgeschickt. Schmettau gab auch wirklich noch nichts verloren, wenngleich die Armee durch die Pest bedeutend gelichtet war und unter den allzuvielen Befehlshabern fortwährend Uneinigkeit und Eifersucht herrschten. Er warf sich nach Belgrad, um es bis zum letzten Augenblick zu vertheidigen. Das Schlimmste bei dieser Sachlage war nun noch die Eifersucht Oesterreichs auf das Waffenglück Rußlands, welche dem französischen Gesandten willkommen war, um durch rasche Vermittlung eines Separatfriedens beide Mächte zu trennen. Vollends wurde alles verdorben durch die Eifersucht von Wallis auf Neipperg. Der Kaiser hatte Wallis befohlen, die bereits erwähnte Vollmacht dem Generalfeldzeugmeister Neipperg zu übergeben und allen Bestimmungen des Letzteren nachzukommen. Dadurch empfindlich gekränkt, ließ Wallis nun Neipperg ohne alle Nachricht über den Stand der Armee und die neue Lage der Dinge in Belgrad, ja selbst ohne die über die Anerbietungen, welche er – Wallis – selbst bereits den Türken gemacht, ins feindliche Lager zum Großvezier abgehen, wo Neipperg, der unvorsichtig genug gewesen war, nicht einmal sicheres Geleite zu verlangen, als Gefangener behandelt wurde und aus Furcht, sein Leben zu verlieren, am 1. September 1739 den schmählichen Präliminarfrieden unterzeichnete, den der französische Gesandte im Namen seines Hofes sogleich garantirte. Die Hauptbedingungen desselben waren die Uebergabe von Belgrad und Sabacz (mit Schleifung der äußeren Festungswerke) an die Türken, so wie die Abtretung Serbiens und der Walachei; endlich, was wohl das Schmählichste, daß schon fünf Tage nach Abschluß des Präliminarfriedens jene Schleifung der äußeren Werke Belgrads vorgenommen werden sollte. Und wirklich wartete man nicht einmal die Ratification des Kaisers ab, sondern räumte bereits am 4. September den Türken das Kaiserthor und die Alexanderkaserne in Belgrad ein; worauf denn auch die Uebereinkunft über die Schleifung der Festungswerke binnen sechs Monaten abgeschlossen und sowohl von Neipperg als von Villeneufve unterzeichnet wurde. Erst nachdem dies geschehen war, nämlich am 18. September, schloß Neipperg im türkischen Lager vor Belgrad den Definitivfrieden; der mit diesem Geschäft beauftragte Bevollmächtigte des Kaisers kam zu spät. Am 22. Oktober fügte sich der Kaiser in das Unvermeidliche; er ratificirte den Frieden, dessen Dauer für sieben und zwanzig Jahre bestimmt war.
Wallis und Neipperg hatten unverantwortlich gehandelt. Sie wurden vor ein Kriegsgericht gestellt und bis in's Jahr 1740 gefangen gehalten. Im Grunde waren sie, wenn gleich im hohen Grade strafbar, doch nur der Ausdruck der gänzlichen Rathlosigkeit, welche am Wiener Hofe herrschte, ein Endpunkt von bestehenden Verhältnissen, gegen welche sich kein Rekurs ergreifen ließ.
Den Kaiser traf der Schlag um so härter, je größer seine Hoffnungen gewesen waren. Jede Frucht von Eugen's Siegen über die Türken, der Zauber des Glaubens an Unüberwindlichkeit der österreichischen Waffen auch an dieser Seite war dahin. Karl VI. sah, wie der letzte schimmernde Schein seiner Autorität verschwunden war; er konnte es sich nicht mehr verhehlen, daß die Mächte die Schwäche jenes Erzhauses Oesterreich durchschauten, vor welchem sie einst gezittert hatten. Nach solchen Erfahrungen stand es – bei einer durchaus unhaltbaren Kriegsmacht und bei der Zerrüttung der Finanzen, so wie bei der Verwirrung in der Regierung, die aus dem Mangel an einem Prinzip und an einer durchgreifenden Energie eines überwältigendes Geistes bei hundertfältigen, kleinlichen, sich kreuzenden Privatinteressen entsprang, – stand es so zu sagen jedem nächsten Angriff eines Mächtigen hülflos preisgegeben da. Nicht zu verkennen, nicht wegzuläugnen war noch dazu der bedeutende Einfluß, welchen die französische Diplomatie seit den letzten Ereignissen in der Türkei gewonnen hatte. Welche Aussicht in die Zukunft! Was nützten nun alle jene zahllosen Opfer, die Karl VI. dem leitenden Gedanken seines Lebens, der pragmatischen Sanktion gebracht? Selbst der Gemahl Marien Theresiens! der Enkel des Helden Karl von Lothringen hatte es für passend gehalten, als »Volontär« jenen Türkenkrieg mitzumachen, und wie schön hätte seinen angenehmen Zügen der Lorbeer gestanden! Er war nur nicht der Mann, den Griff darnach durch Noth und Tod zu thun. Er war in der That durch das geisttödtende Ceremoniel des Wiener Hofes allzufrüh verwöhnt, als daß seine Persönlichkeit sich aus den Normen loszuringen vermocht hätte, welche jedes entschiedene Hervortreten, jede selbstständige Richtung einer Persönlichkeit verboten. So achtbar Franz Stephan's Charakter in sittlicher Beziehung war, und so wenig sich gar manche Anlagen, welche den Privatmann zieren, bei ihm verkennen ließen, – sein Mangel an Energie war nicht weniger deutlich als entmuthigend in Bezug auf die Verhältnisse, in die er nach dem Tode des Kaisers eintreten sollte. Ueberdieß hatte sich nicht blos die öffentliche Meinung von ihm abgewandt, sondern auch bei Hof war seine Stellung eine sehr ungünstige geworden. Der hohe Adel betrachtete ihn als einen Fremdling. So Manche, welche sich bei dem bestehenden Zustand, da dem Egoismus, der Kabale und Intrigue jedes Einzelnen der größte Spielraum gegeben war, sehr wohl befanden, sahen nicht ohne Mißvergnügen und Besorgniß, wie die junge Erzherzogin immermehr ihre eigene, diese und jene Partikularinteressen durchkreuzende Politik zu verfolgen begann. Man ließ es an Gegenminen nicht fehlen. Man sprach am Ende sogar davon, daß der Kaiser die Absicht habe, in seinem letzten Willen zu Gunsten seiner zweiten Tochter Maria Anna einige wichtige Aenderungen in der pragmatischen Sanktion vorzunehmen. Und allerdings zeigte sich späterhin bei Eröffnung des Testaments, daß er seiner Gemahlin die Freiheit gelassen, die Mitregierung zu führen. Allerdings stand auch die früher erzählte Reise Franz Stephans und Marien Theresiens nach Toskana mit der veränderten Stimmung am Hofe gegen Jenen im Zusammenhange.