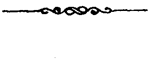|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
 An einem Frühlingsvormittage des Jahres 1749 machte sich unter einem Theile der regelmäßigen Morgenbesucher des Bärengrabens in Bern, der zu jener Zeit am Ausgange der Schauplatzgasse lag und sich damals noch einer größern Anzahl ständiger Stammgäste zu erfreuen hatte als heut zu Tage, eine ungewöhnliche Bewegung bemerklich. Während sonst die ehrbaren Burger gravitätisch in Schlafrock und Pantoffeln dahergewandelt kamen, um behaglich über das Grabengeländer gelehnt sich durch den Anblick des vielgeliebten Wappenthieres auf das Tagewerk vorzubereiten, gingen sie jetzt wie in unruhiger Erwartung getrieben hin und wieder, jeden neuen Ankömmling schon von Weitem gleichsam mit Blick und Miene ausfragend. Drunten begannen die Mutzen ihre hochbewunderten Künste, um sich die gewohnten Morgenbrödchen ihrer Verehrer zu verdienen; die Alten produzirten Bittemännchen und Drehtänze, die Jungen schlugen so drollige Purzelbäume, wie sie nur der hoffnungsvollsten Bärenjugend gelingen können; aber das wollte Alles nicht hinreichen, die Aufmerksamkeit der am Geländer Auf- und Niedergehenden diesmal anzuziehen und festzuhalten. Im Gegentheil wendeten sich die Blicke der eifrig mit einander
Sprechenden unablässig nach dem Erdgeschosse des nächsten Eckhauses hinüber, obwohl dort durchaus nichts Besonderes zu erschauen war, wenn man nicht etwa den schwarzen Schild über der Thüre, der in weißer Schrift verkündete, daß hier der ehrsame Meister Hänni seine Perrücken- und Haarkräuslerkunst betreibe, als Merkwürdigkeit gelten lassen wollte. In jener Blüthezeit der männlichen Haarzöpfe, Perrücken und kunstvoll geflochtenen und gekämmten Damenfrisuren war das nun freilich kein so unbeachtenswerther Gegenstand; doch war er heute, was er seit Jahren gewesen, und männiglich bekannt, daß Meister Hänni der geschickteste, aber auch der theuerste und deshalb nur von der Noblesse frequentirte Haarkünstler der alten Zähringerstadt sei. In allem dem konnte also auch kein Grund zu dem ungewöhnlichen Verhalten der Bärengrabengäste vorhanden sein.
An einem Frühlingsvormittage des Jahres 1749 machte sich unter einem Theile der regelmäßigen Morgenbesucher des Bärengrabens in Bern, der zu jener Zeit am Ausgange der Schauplatzgasse lag und sich damals noch einer größern Anzahl ständiger Stammgäste zu erfreuen hatte als heut zu Tage, eine ungewöhnliche Bewegung bemerklich. Während sonst die ehrbaren Burger gravitätisch in Schlafrock und Pantoffeln dahergewandelt kamen, um behaglich über das Grabengeländer gelehnt sich durch den Anblick des vielgeliebten Wappenthieres auf das Tagewerk vorzubereiten, gingen sie jetzt wie in unruhiger Erwartung getrieben hin und wieder, jeden neuen Ankömmling schon von Weitem gleichsam mit Blick und Miene ausfragend. Drunten begannen die Mutzen ihre hochbewunderten Künste, um sich die gewohnten Morgenbrödchen ihrer Verehrer zu verdienen; die Alten produzirten Bittemännchen und Drehtänze, die Jungen schlugen so drollige Purzelbäume, wie sie nur der hoffnungsvollsten Bärenjugend gelingen können; aber das wollte Alles nicht hinreichen, die Aufmerksamkeit der am Geländer Auf- und Niedergehenden diesmal anzuziehen und festzuhalten. Im Gegentheil wendeten sich die Blicke der eifrig mit einander
Sprechenden unablässig nach dem Erdgeschosse des nächsten Eckhauses hinüber, obwohl dort durchaus nichts Besonderes zu erschauen war, wenn man nicht etwa den schwarzen Schild über der Thüre, der in weißer Schrift verkündete, daß hier der ehrsame Meister Hänni seine Perrücken- und Haarkräuslerkunst betreibe, als Merkwürdigkeit gelten lassen wollte. In jener Blüthezeit der männlichen Haarzöpfe, Perrücken und kunstvoll geflochtenen und gekämmten Damenfrisuren war das nun freilich kein so unbeachtenswerther Gegenstand; doch war er heute, was er seit Jahren gewesen, und männiglich bekannt, daß Meister Hänni der geschickteste, aber auch der theuerste und deshalb nur von der Noblesse frequentirte Haarkünstler der alten Zähringerstadt sei. In allem dem konnte also auch kein Grund zu dem ungewöhnlichen Verhalten der Bärengrabengäste vorhanden sein.
Dagegen lag dieser in einer Mittheilung, die der Thorwart am Aarberger Thurme den Gevattern und Basen seiner Nachbarschaft gemacht und was dann im Fernern mit derselben zusammenhing. Am vorgestrigen Abend nämlich kam, so lautete der Bericht, ein junger, fremder Herr durch das Thor geritten, von so durchaus vornehmem Aussehen, daß der Thorwart sich gar nicht getraute, ihn um seinen Paß, um woher und wohin zu befragen. Das muß wenigstens der Abgesandte einer fürstlichen Hoheit sein, hatte er gedacht, wenn es nicht eine solche erlauchte Person selbst ist, die sich das Vergnügen macht, allein zu reisen, oder deren Gefolge erst nachkommen wird. Aber als der Fremde schon vorbeigeritten, hatte er seinen Schimmel wieder umgelenkt und den Thorwart nach einer Herberge gefragt. Dieser nannte ehrerbietigst die goldene Sonne und den Distelzwang als die Gasthäuser, in denen vornehme Reisende abzusteigen pflegten. Der Fremde jedoch erwiderte, er begehre vor Allem nach der Zunftherberge, in der sich die Haarkräusler und Perrückenmacher zum Abendtrunke einfänden. Aha, dachte der Thorwart, die gewünschte Herberge nennend und einen bedeutungsvollen Blick auf die braunen Haare des Fremden werfend, die sich in üppiger Fülle unter dem kleinen Hute hervorrollten, hab's auf den ersten Blick getroffen; meine Augen sind nicht umsonst seit dreißig Jahren im Dienste gewesen. Der will incognito bleiben und sich seine Haare färben lassen oder so was, bevor er sich in Gesellschaft zeigt. Na, wollen sehen, ob es ihm gelingen wird. Bin auch kein Dummkopf, ich.
Und um dem Selbstgefühle, das durch die letzten Worte leuchtete, alsbald die richtige Geltung zu verschaffen, trat der Thorwart an das nächste Haus und ließ seine Finger pochend auf ein kleines Fenster fallen. »Schwerenoth, Gevatter,« rief er, sein Gesicht hart an die Scheiben drückend, einem Manne zu, der drinnen in der niedrigen Stube mit unterschlagenen Beinen auf einem Tische saß und emsig die Nadel handhabte, »habt Ihr den vornehmen Fremden nicht bemerkt, der eben vorbeigeritten ist?«
»Wer ist's … was gibt's?« fragte der Andere, rasch von seinem Sitze herabspringend und das Fenster öffnend; »ah … oh, nein, die verdammte Arbeit sitzt mir am Halse, daß ich kaum aufblicken darf. Den auf dem Schimmel meint Ihr?«
»Pscht … nicht zu laut,« machte der Thorwart mit geheimnißvoller Geberde; »doch wenn ich Euch rathen darf, so werft Zwirn und Nadel bei Seit' und geht zum kleinen Anker hinunter; dort wird er absteigen. Wär' mein Junge nicht fort, ich würd' selbst hingehen.«
»Ah so, so …« rief der ehrsame Meister leise, indem er eilfertig mit beiden Armen in den Rock fuhr und Hut und Stock zusammensuchte, »etwas Verdächtiges, etwas für die Speckkammer, meint Ihr, Gevatter Heinz?«
»Nichts nutz,« sagte der Thorwart mit pfiffiger und zugleich überlegener Miene, »fehlgeschossen, Nachbar, weit fehlgeschossen; doch marschirt nur gleich ab, trinkt einen Schoppen beim Anker und haltet die Augen offen. Ihr wißt, ein solcher Gang hat Euch schon manchmal mehr eingetragen, als Nadel und Scheere die ganze Woche lang, Meister Bölzlein.«
Der dienstfertige Schneider vergeudete keine Zeit mehr mit Fragen; getraute er sich doch zum mindesten eine ebenso feine Spürnase zu, als er sie seinem Gevatter zugestehen mochte, und so langte er denn auch richtig schon vor dem Anker an, als der Fremde eben vom Pferde stieg. Er saß auch bereits in der Gaststube hinter seinem Glase, als dieser eintrat und sich ebenfalls eine Kanne Wein bestellte. »Ihr habt da ein sauberes Pferd, gnädiger Herr,« sagte der Wirth zu dem Reisenden; »doch scheint es etwas ermüdet zu sein.«
»Es ist ein braves Thier, ja,« erwiderte der Fremde, dem bei den Worten des Wirthes ein feines Lächeln über das Antlitz flog, »es hat eben auch einen weiten Weg gemacht.«
»Hundert Kronen werth unter Brüdern, denk' ich.«
Der Fremde trommelte eine Weile mit den Fingern auf die Fensterscheiben; dann wendete er sich wieder gegen den Wirth und sagte mit vornehmer Nachlässigkeit: »Ich habe das Thier nicht mehr nothwendig für die nächste Zeit; ist's Euch anständig, so könnt Ihr's haben um den genannten Preis, obwohl er zu niedrig ist.«
»Ist's Euer Ernst, gnädiger Herr?«
»Versteht sich, mein voller Ernst, Herr Wirth.«
»Gut … ich nehm' es,« sagte dieser rasch mit übelverhehlter Freude; »in einer Viertelstunde sollt Ihr das Geld haben, Junker.«
»Damit braucht Ihr Euch gar nicht zu eilen … gedenk ich doch die Nacht in Eurer Herberge zuzubringen. Wollt Ihr mir vor der Hand ein Gemach anweisen lassen, Herr Wirth?«
Als dieser von dem dienstfertigen Geleite, das er dem Fremden nach dem besten Gemache des ganzen Hauses gegeben, in die Gaststube zurückkehrte, schritt er einige Male mit raschen Schritten auf und nieder, sich vergnügt die Hände reibend, und nahm dann eine schwere Zinnkanne von dem braunen Büffet herab. »He, Meister Bölzlein,« schmunzelte er, das blanke Geschirr auf den Tisch stellend, »heut' trinkt Ihr ein Glas mit mir … heut' vermag ich's.«
»Ihr habt einen guten Handel gemacht … he? Ah!«
»Hundert Kronen Profit so gut als einen Rappen, mein' ich, und wenn ich das Pferd noch diesen Abend wieder verkaufe.«
»Hundert Kronen,« schrie Meister Bölzlein, indem er alle Finger seiner beiden Hände aus einander spreizte, als wollte er sie in einem Haufen Geldes versenken, »hundert Kronen! Alle Wetter, das sind viele Füchse in einer Falle. Wenn das der Fremde vermuthen könnt'!«
»Vermuthen?« machte der Wirth mit einer fast geringschätzigen Miene; »vermuthen, sagt Ihr? … Glaubt Ihr denn, ein solcher Herr, wie der da droben, kenne den Werth eines Pferdes nicht besser, als Ihr ein Nadelöhr? Aber was scheeren sich diese deutschländischen Grafen und Fürsten um lumpige hundert Kronen, wenn sie gerade eine Laune haben. Ich wette darauf, es hat den gnädigen Herrn nur geärgert, daß das Thier einige Ermüdung zeigte … das hatt' ich weg, ehe er vom Sattel gestiegen war.«
»Ah … drum habt Ihr ihn gleich frisch an diesem Punkte angebohrt.«
»Na … trinkt ein's, Meister Bölzlein; für was wäre man Wirth zum kleinen Anker, wüßte man nicht, wo solche Praktiken sich brauchen ließen. Wißt Ihr doch auch, wo die Schneiderhölle liegt … he? Ha, ha!«
Der Schneider leerte sein Glas und lachte mit dem pfiffigsten Gesichte, das er aufzutreiben vermochte, zur Gesellschaft mit; wie alle klugen Leute, wollte er nicht den Schein auf sich fallen lassen, als ob er sich nicht so gut wie Andere auf seinen eigenen Vortheil verstände. Dann aber sagte er weiter: »Und Ihr haltet den Herrn wirklich für einen deutschländischen Grafen oder Fürsten und dergleichen?«
»Und Ihr zweifelt daran,« erwiderte der Wirth, indem sich wieder ein Zug der Geringschätzung um seinen Mund legte; »aber habt Ihr denn keine Augen im Kopfe? Oder habt Ihr an unsern gnädigen Herren schon solche vornehme Manieren gesehen? Solche, solche … ja, wie soll's unsereins ausdrücken! Nein, die bringen's ihr Lebenlang nicht zu Stande, sie mögen stolzieren und sich spreizen, wie sie wollen.«
»Aber er hat auch nicht einen einzigen Goldring am Finger,« entgegnete Bölzlein, während er sein Auge auf ein kleines Reifchen sinken ließ, das einen seiner eigenen Finger umspannte; »ich hab' genau Achtung gegeben, sobald er den Handschuh zog.«
»So, und Ihr meint, solche Herren brauchen derartigen Plunder auf allen Straßen herumzutragen, besonders wenn sie auch einmal für sich allein sein wollen? … Wie war's denn mit dem französischen Marquis, der vor einem Jahre fast zwei Monate in meinem Hause logirte … he? Uebrigens haltet davon, was Ihr wollt, Bölzlein, das ist Eure Sache; aber ich denk', wenn der Fremde nur auf einem Ziegenbock eingeritten und dafür beim Distelzwang drüben abgestiegen wäre, so ließet Ihr ihn schon ohne Widerrede für einen Kaiserprinzen gelten.«
Obgleich nun dieser Ausfall weder sehr zart noch rücksichtsvoll war, so hatte doch Meister Bölzlein schon der Weinkanne wegen, die auf dem Tische stand, Grundes genug, um jeder unliebsamen Meinungsverschiedenheit mit dem Ankerwirth auszuweichen. Daneben war er auch sonst noch froh über die Entdeckung und ließ seine ohnehin nicht sehr ernst gemeinten Zweifel um so lieber fallen, als er nun seinem Gevatter Thorwart in der Verbreitung einer großen, geheimnißvollen Neuigkeit zuvorzukommen gedachte. – Der Ankerwirth dagegen legte sein Gesicht in ebenso ernste als geheimnißvolle Falten, als schon nach kaum einer Stunde ein Trüppchen sonst selten bei ihm gesehener Gäste nach dem andern die Gaststube zu füllen begann. Bis zur Feierabendstunde hatte das große Geheimniß die Runde gemacht und am folgenden Morgen blieb nur noch die Räthselfrage zu lösen, was wohl den fremden Prinzen auf so seltsame Weise nach einer löblichen Stadt Bern geführt haben möge. Daß da Gewichtiges verborgen lag, bezeugte schon der Umstand, daß er dem Ankerwirthe ein Pferd, das unter Brüdern seine tausend Kronen gelte, geschenkt habe, nur damit dieser, der dem Fremden durch Zufall auf die wahre Spur gekommen, weder seinen Rang noch Namen verrathe. –
Im Verlaufe des Tages nahm die Sache jedoch eine Wendung, die nun erst das Bedenklichste erreichte und die kühnsten Vermuthungen in die Schranken rufen mußte. Bisher war es wohl öfters vorgekommen, daß sich hohe Personen aus diesem oder jenem Grunde vorübergehend unter angenommenem Namen in der Stadt aufgehalten; aber jetzt kam wie ein Blitz aus heiterm Himmel die Kunde hergeflogen, der fremde Prinz sei bei dem Meister Hanni am Bärengraben als angeblicher Geselle eingetreten – natürlich weil er, wie recht und billig, in die Verschwiegenheit des Ankerwirthes trotz des kostbaren Pferdegeschenkes kein Vertrauen gesetzt habe. Aber was nun da herauskommen werde, das möge der Himmel wissen! – »So, meint ihr,« erwiderten jedoch die Pfiffigen auf diesen verzweifelnden Ausruf rathloser Neugier; »werden denn beim Meister Hanni nicht alle Rathsherrenzöpfe der Stadt geflochten und dabei alle Geheimnisse und Affairen eines löblichen Standesregimentes verhandelt? Denkt ihr, ein fremder Prinz werde bei einem geheimen Aufenthalte in unserm Lande andere Absichten haben, als solche Dinge zu erfahren, ganz abgesehen davon, daß er in seiner angenommenen Rolle nun auch wohl noch in die Gemächer der vornehmen Frauen einschleichen kann? … Ja, der hat eine feine Nase; aber bedenklich ist's in einer Zeit, wo der Kriegsteufel an allen Enden spuken will und es selbst in unsern eigenen Mauern nicht mehr sauber aussieht. Wir werden noch etwas erleben können!« –
Das nun waren die Vorgänge, welche die Gemüther der Frühbesucher des Bärengrabens an jenem Morgen in so ungewöhnliche Aufregung versetzten und ihre Blicke mit gespannter Neugier an Thür und Fenster des ehrsamen Meisters Hänni bannten. Aber alles Schauen und Spähen blieb vergeblich, von dem geheimnißvollen Gesellen war nichts zu entdecken, und die unbefriedigte Augenlust wußte sich auf keine andere Weise zu entschädigen, als daß die verschiedenen Gerüchte und Vermuthungen über den Unbekannten nun immer eifriger und lauter zur Sprache kamen.
Diesem bunten Gerede hatte schon seit einiger Zeit ein alter, aber rüstig und stattlich aussehender Herr zugehört, der an einem Theile des Grabengeländers auf- und niederschritt, ohne sich in die Unterhaltung der ehrsamen Burger einzumischen. Manchmal jedoch, wenn er auf seinem gemessenen Gange der Gruppe näher kam und die weit ausfliegenden Vermuthungen und Pfiffigkeiten hörte, murmelte er etwas unter dem weißen Schnurrbarte hervor, das wie »alberne Tröpfe« oder »dummes Pack« und dergleichen klang. Allmälig jedoch wurden seine Schritte unmerklich langsamer und seine scharfen Blicke begannen selbst bisweilen nach den Fenstern des Meisters Hänni hinüberzuschweifen; der ansteckende Reiz der Neugier und des Geheimnisses fing auch bei ihm an, sich geltend zu machen, wenn gleich seine Gedanken, wie sich's für eine Standesperson der Republik gebührte, andere Wege einschlugen, als diejenigen des Packes der niedern Burger. »Was, Prinz?« brummte er in einem fast knurrenden Tone in sich hinein, »sauberer Prinz das … kann mir's vorstellen. Aber warum sollt's nicht einer der revolutzenden Taugenichtse sein, die sich aus allen Winkeln herbeischleichen wollen? Kann sein, kann sein … aufpassen. Rappelt's ja schon lange genug bei unsern Strudelköpfen. Können nachsehen einmal … wird nichts schaden.« Damit zog der Graubart eine mit blitzenden Steinen besetzte Uhr aus der Tasche der Atlasweste, jedoch nur, um sie sofort wieder mit einem halb verdrießlichen Gesichte in ihr Versteck zurückzuschieben. »Ist noch nicht Zeit, kaum halb acht vorbei,« fuhr er in seiner brummigen Weise fort, »doch kann ihn auch einmal zu Haus flechten lassen, den Zopf, und drüben den Befehl geben, er soll den Burschen selbst zur Jule schicken … wird noch besser sein.« Mit diesem Entschlusse verließ der Alte den Bärengraben und schritt gemessenen Ganges der Thüre Meister Hänni's zu.
Dieser hatte sich eben zum Frühstücke niedergesetzt, fuhr aber augenblicklich wie ein aufgescheuchtes Reh empor, als sein Kunde eintrat. »Um Vergebung, gnädiger Herr Oberst,« sagte er ihm entgegentretend und zugleich seiner Frau zuwinkend, die Tassen wegzuräumen: »ist's denn schon an der Zeit, oder geht meine Uhr falsch?«
»Nichts da, bleib' Er sitzen, Meister Hänni,« erwiderte der Oberst mit einer Stimme, deren Schall an den Wänden hinzitterte, als müsse er einen Ausgang in's Freie suchen; »kaum halb acht vorbei … kann aber nicht kommen zur Stunde … Geschäfte zu Haus.«
»Und Euer Gnaden befehlen?«
»Er schickt ja seinen Gesellen gegen Mittag zu meiner Tochter … was? … Gut, der soll etwas früher kommen als gewöhnlich und dann auch bei mir anklopfen.«
»Es ist ein neu eingetretener; François, der Schlingel, ist mir davongelaufen; bitte deshalb auch das gnädige Fräulein um Nachsicht.«
»Ein neuer? … schöne Geschichten,« schrie der Oberst; »schick' Er ihn her, Meister, Punkt zehn Uhr zehn Minuten … verstanden? … werd' das Fräulein avertiren.«
Der Meister machte seinen Bückling, während der alte Soldat seinen langen Rohrstock auf den Boden stieß, als müsse er ein Siegel auf seinen Befehl drücken, und dann wieder abmarschirte.
Als der Oberst seine Wohnung erreicht, stieg er über die breite Steintreppe einem Gemache zu, das mit seiner Fensterseite nach dem grünen Aarstrome und dem Hochgebirge ging. Es war das ein Aufenthalt, ganz durchweht von jenem eigenthümlichen Reize, der dem Auge nur in den Gemächern feinfühliger Frauen entgegentritt. Beim ersten Anblick scheinbarer Zufall in aller Anordnung, der das Ernste mit dem Spielenden, das Glänzende mit dem Unscheinbaren in buntem Wechsel zusammengewürfelt; aber alsbald dämmert dem Blicke des Beschauenden jener tiefere Ordnungssinn auf, der jedem Gegenstande seine Stelle angewiesen, als wäre er auf derselben emporgewachsen und könnte an einem andern Platze gar keinen Raum mehr finden; über Alles liegt dazu der Abglanz jener zierlichen Sauberkeit ausgegossen, der auch das Unbedeutende schmückt, wie die Sonne den dürftigen Strauch vergoldet. Der Oberst betrat dieses Gemach selten und nur in Ausnahmsfällen; er habe stets Angst darin, sagte er, von dem tausendfachen Krimskrams etwas zu zerbrechen oder zusammenzutreten. So blieb er auch jetzt hart an der Thüre stehen, als scheue er sich, weiter vorzutreten, rief aber dabei einen so dröhnenden Morgengruß, daß die Saiten der Harfe, die in der Mitte des Gemaches an einem weißen Marmortische lehnte, vor dem Schalle erzitternd leise zusammenklangen. Dieser grüßende Kommandoruf galt einer jungen Dame, die in weitem, blendend weißem Morgenkleide an einem der Fenster saß, das, dicht von Schlingpflanzen umsponnen, nur ein grünlich dämmerndes Licht auf die jugendliche Gestalt herabfallen ließ. Diese erhob sich rasch, um dem Eintretenden lächelnd entgegenzugehen. »Schon so früh, Papa,« sagte sie, die großen, träumerischen Augen verwundert aufschlagend, »gewiß hat mir das einen fröhlichen Tag zu bedeuten.«
»Na, Dummheiten,« erwiderte der Oberst, während sich doch seine strengen Züge milderten beim Anblicke des feinen Antlitzes, das ihm wie ein milder Stern entgegenschimmerte, »na, freilich sollst einen frohen Tag haben … wie immer, Jule. Aber was ich sagen wollt' … heut' kommt ein neuer Friseur zu dir … etwas früher als andere Tage. Der andere sei zum Teufel gegangen.«
»Und blos deshalb habt Ihr Euch bemüht, Papa?«
»Versteht sich, Kleine, warum denn nicht,« erwiderte der Oberst in einem Anfluge von Verlegenheit vor dem mit wachsender Verwunderung an ihm hangenden Blicke der Tochter; »bin droben gewesen beim Bärengraben und hab's da vernommen … ist aber noch etwas anderes dabei.«
»Ach,« fiel das Fräulein lächelnd ein, »am Ende handelt es sich gar um den verzauberten Prinzen.«
»Was, Prinzen,« schrie der Oberst, »wer fackelte dir schon von den Dummheiten?«
»Werdet nicht böse, Papa … nur Mädeli hat mir davon geplaudert.«
Der Oberst schwieg eine Weile, während er mit dem Stocke hastig aber leise auf den Boden stieß. »Albernes Weibergeschwätz, versteht sich,« fuhr er dann mit gedämpfterer Stimme fort; »weiß wohl wie sich die Prinzen verkleiden und was es zu bedeuten hat … konnt's genug sehen in Versailles, bis ich's satt bekam und mich davonmachte. Aber gleichwohl, wo so viel Rauch, kann auch ein Feuerlein sein, gleichviel welches, deshalb will ich wissen, woher der Bursche kömmt, Jule, und was er eigentlich hier zu treiben beabsichtigt.«
»Den Friseur meint Ihr doch, Papa?«
»Versteht sich … Dummheiten.«
»Und wer soll ihn denn das fragen, Vater?«
Der Oberst wußte aus langer Erfahrung augenblicklich, wenn es ihm das eigene Gefühl auch nicht sagte, daß er seine Tochter in irgend welcher Weise verletzt, sobald sie das kindlich gewohnte Papa mit der ernstern Benennung Vater vertauschte; jetzt jedoch empfand er auch, ohne vorher in seinem Eifer daran gedacht zu haben, was es zu bedeuten habe, und sagte daher rasch: »Nicht du, Jule, versteht sich. Du läßt den Burschen, wenn er anrückt, eine Weile warten und da soll ihn Mädeli unterhalten unterdessen. Wird's gern thun bei einem Prinzen … verstanden? … Na, nachher soll er auch bei mir vorbeikommen.«
Der alte Herr hatte diese Worte mit halblachendem Munde gesprochen, aber die Tochter sah seinen befehlenden Blick dabei noch leuchten, als er bereits zur Thüre hinausgeschritten. Einen Augenblick blieb sie, ihm nachschauend, stehen, dann ging sie, die Hände leise vor sich hin faltend, wieder langsam dem Fenster zu. Drunten auf der Aare glitt in leichtem Laufe ein Schifflein vorbei, aus dem frohes Jauchzen und Jodeln erklang; es waren Leute aus den Bergen, die wohl in die Fremde zogen, um dort das Brod zu suchen, das ihnen der rauhe Boden ihrer Heimath nicht gewähren konnte. Das Fräulein blickte und horchte ihnen nach, bis das Schifflein in der Flußwindung verschwunden war. »O ihr Glücklichen,« flüsterte sie dann leise, »könnt' ich mit euch ziehen, in die weite, fremde Welt hinaus.«
Es wäre nicht leicht zu sagen, ob der alte Oberst von seiner Umgebung mehr geachtet als gefürchtet wurde; er gab denjenigen, die von ihm abhängig waren, reichliche Ursache zu Beidem, und gewiß war es, daß selbst die kindliche Liebe seiner Tochter sogar in ihren spätern Jahren nicht ohne einen Beisatz jenes Gefühles geblieben war, das mehr einem unbedingten Gehorsam, als einer unbefangenen warmen Anhänglichkeit zur Wurzel diente. Dagegen genoß er bei den Bessern seiner Standesgenossen um seiner streng aristokratischen Gesinnungen, seiner geraden Offenheit und unerschütterlichen Rechtschaffenheit willen einer hohen Achtung; selbst bei der niedern Burgerschaft stand er vor manchem Einflußreichern seines Standes in Ansehen, obwohl er nie weder ein höchstes bürgerliches Amt bekleidet, noch auch trotz seiner Abstammung aus einem der ältesten Geschlechter nur nach einem solchen getrachtet hatte. In dieser Sphäre war es namentlich die fast sprichwörtlich gewordene Unverbrüchlichkeit seines Wortes, die ihm Respekt verschaffte; denn wer einmal eine Zusage oder ein Versprechen von ihm erhalten hatte, und wäre er der Geringste der Geringen gewesen, der konnte sicherer darauf bauen, als auf Anderer Brief und Siegel. Ausschließliche Furcht und bittern Haß hegten nur zwei Menschenklassen gegen ihn, und beide hatten auch ihre triftigen Gründe dafür. Auf der einen Seite waren dies diejenigen seiner patrizischen Standesgenossen, die aus französischen Diensten heimgekehrt, französische Sitte und Leichtfertigkeit zur Geltung bringen wollten; der Oberst selbst hatte zwar seine militärische Laufbahn ebenfalls im Dienste Frankreichs begonnen, sich aber bald mit Abscheu von dem sittenlosen Treiben abgewendet und, in brandenburgisch-preußischen Dienst getreten, dort noch unter dem alten Dessauer den besten Theil seiner Schule durchgemacht. So blieb er denn sein Lebenlang der geschworene Feind alles Franzosenthums und wies dabei mit gerechtem Stolze auf seine zwei Söhne hin, die jetzt ebenfalls in preußischen Diensten unter den Fahnen des großen Fritz die ächte Soldatenprobe bestehen konnten. Die andere Klasse seiner entschiedenen Feinde bestand aus den politisch Unzufriedenen, die für die mindere Burgerschaft auf Kosten des Patriziates größere Rechte forderten und die gerade jetzt sich wieder eifrig zu rühren begannen. Zur Ausrottung dieser Revolutzer, in denen der Alte die verkörperte Hölle selbst erblickte, würde er weder Feuer noch Schwert gescheut haben, und er machte nach seiner Art auch nirgends ein Hehl aus diesen Gesinnungen.
Unter diesen Umständen konnte das ungewöhnliche Interesse, das der Vater an dem fremden Haarkräusler zu nehmen schien, für seine Tochter kein großes Räthsel bleiben. Daß er nicht an die über denselben verbreiteten Gerüchte glaubte, hatte er deutlich gesagt und das war auch selbstverständlich; aber fast ebenso gewiß war es, daß er in der Verbreitung dieser Gerüchte nicht einen bloßen, lächerlichen Zufall, sondern eine tiefer verborgene Absicht erblickte. Er vermuthete in dem Fremden entweder einen verkappten Revolutzer, von denen er seit einiger Zeit tagtäglich mit wachenden Augen träumte, oder gedachte vielleicht, wenn diese Annahme sich nicht erwahren sollte, denselben zu einem seiner Späherwerkzeuge zu machen; denn daß er sich auch mit solchen zu umgeben anfing, war der still beobachtenden Tochter ebenfalls nicht entgangen.
Das Eine wie das Andere hatte gleich viel Verletzendes für den reinen, milden Sinn des Fräuleins, und je mehr sie darüber nachsann, um so peinlicher wurde ihr der Gedanke, wie rücksichtslos der Vater sie selbst habe mißbrauchen wollen, einen unbekannten Menschen, mochte er nun dieser oder jener sein, in sein eigenes leidenschaftliches Thun hereinzuziehen. Hatte sie doch sonst genug zu leiden davon, wie sehr sie auch stets bemüht war, sich von all' diesem Kämpfen und Streiten ferne zu halten; aber wie sollte sie sich erwehren? – An einen offenen Widerstand gegen die Befehle des Vaters wagte sie nicht zu denken, der kindliche Gehorsam lag durch Erziehung und Gewohnheit zu tief begründet in ihrer Seele, als daß sie sich plötzlich zu einem solchen Schritte hätte entschließen können; dafür aber reifte allmälig fast wider ihren Willen der andere Entschluß, nun doch zu thun, was der Vater ihr anfänglich zugemuthet und lieber den Haarkräusler so weit schicklich selbst auszufragen, als es dem Mädeli zu übertragen. Durch die Nöthigung, sich auf so ungewohnte Weise in ihren Gedanken mit dem Unbekannten beschäftigen zu müssen, war unmerklich eine Art Theilnahme für ihn entstanden, und leise sagte sie, als sie über ihr Verhalten glaubte in's Reine gekommen zu sein, vor sich hin: »Kann ich ja dann doch nach eigenem Gutdünken meinen Polizeibericht erstatten.«
Unbefangenheit und Ruhe wollten jedoch dem Fräulein immer noch nicht zurückkehren mit diesem Entschlusse, und je näher die Stunde heranrückte, um so unruhiger wurde sie; es legte sich ein Schatten auf ihr Gemüth, der fort und fort dunkler wurde und endlich wie eine trübe Vorahnung ihre ganze Seele erfüllte. Julia versuchte sich Vorwürfe darüber zu machen und das drückende Gefühl wegzuschelten. »Was hast du dich um einen hergelaufenen Haarkräusler zu kümmern,« sagte sie laut, »ist doch gewöhnlich nicht viel zu verderben an solch windigem Volke, und sollte mehr an diesem sein, als an den meisten seiner Genossen, so wird er schon selbst sich zu helfen wissen. Gewiß, da ist jetzt auch wieder nur das einfältige Gerede der Leute und die dadurch veranlaßte Laune des Vaters Schuld gewesen; wie du so thöricht sein kannst, Julie!« Aber all' diese gewöhnlichen Trostmittel gegen eine unsichere Erwartung wollten nicht mehr verfangen und nur mit Mühe vermochte das Fräulein ein ängstliches Erschrecken zu verbergen, als das Mädchen den fremden Gesellen meldete.
Julia empfand beim ersten Anblicke des Eintretenden, daß ihre Unruhe nicht vergeblich gewesen. Sie hätte gerne eine Art Zierpuppe gesehen, wie sie in diesem Stande häufig vorkommen, die gerade durch das Gesuchte und Auffallende ihres Putzes den müßigen Stadtklatsch hervorgerufen haben mochte; nun aber stand ein junger, zwar sauber, aber einfach gekleideter Mann vor ihr, über den die Natur ihr reichstes Füllhorn männlicher Schönheit schien ausgegossen zu haben. Juliens erster Gedanke war, als er sich mit leisem Erröthen vor ihr verneigte: Nun haben Beide recht, die Leute und mein Vater; dem Stande, den er angibt, kann er nicht angehören, darin ist er weder erzogen, noch dafür geboren. Sie warf noch einen Blick auf die schlanke und doch kräftig gebaute Gestalt, auf das fein gebildete und doch eine selbstbewußte Entschlossenheit wiederspiegelnde Antlitz, von dem vor ihrem prüfenden Auge das leise Erröthen bis über die helle, von dunkelgelockten Haaren umrahmte Stirn hinanglitt, und wendete sich dann ab, um die eigene Gluth zu verbergen, die auf ihre Wangen stieg. Der Redelaut schien tief in ihrer Brust festgeklemmt und die wenigen Worte, die sie sprechen wollte, mußte sie sich erst leise in Gedanken vorsprechen; aber wie gewöhnlich und alltäglich sie auch waren, sie traten vielfach anders über die Zunge, als das Fräulein beabsichtigt hatte. – »Ihr seid also der neue … Herr, der bei Meister Hänni eingetreten ist!« – Die gewöhnliche Anrede des bürgerlichen Er und das Wort Geselle hatten sich fast unbewußt noch auf den Lippen umgewandelt in höflichere Formen. »Zu dienen, gnädiges Fräulein, und wenn Ihre Güte mir einige freundliche Nachsicht gewähren möchte, so hoffe ich wohl, meinen Dienst bald zu Ihrer Zufriedenheit versehen zu können!« Welch ein reiner Klang der Stimme und welch eigener, wehmüthig-froher Aufblick des großen, dunkeln Auges hatten dieser Antwort das Begleit gegeben! – Aber war es das, oder war's die schon sich andeutende, alle widerstrebenden Schleichwege abschneidende Offenheit in den Worten des Fremden, was den unheimlichen Druck so plötzlich von der Seele des Fräuleins hob? Sie wußte es selbst nicht und gab sich auch keine Rechenschaft darüber, warum sie nun sofort mit ihrer gewohnten Freundlichkeit erwidern konnte: »Meinetwegen braucht Ihr nicht in Sorge zu sein; ich habe nicht Ursache, einen allzuhohen Werth auf meine Frisur zu legen.« Unter dieser Erwiderung hatte sie selbst das von feinen Golddrähten geflochtene Netz, das ihre Haare umspannte, losgelöst und ließ sich auf einem Stuhle nieder.
»Und doch darf ich wohl behaupten, noch keinen schönern Haarschmuck gesehen zu haben,« erwiderte der Friseur, seine Hand an die niederfallende Seidenfluth legend; »da freilich wird meine geringe Kunst der Natur nicht Stand zu halten vermögen, gnädiges Fräulein.«
Julie zuckte leise zusammen unter seiner ersten Berührung. Sie fühlte ganz deutlich, wie von seiner Hand ein warmer Strom ausfloß, der sich gleich einem milden Hauche über ihr ganzes Wesen ergoß, und unwillkürlich mußte sie die Augen erheben, um ihm in's Antlitz zu blicken. Die Blicke begegneten sich und blieben eine lange Weile an einander hangen wie festgebannt. Die dunkle Gluth seiner Augen schien sich tief niedertauchen zu wollen in den blauen Spiegel des entgegenschauenden, und ihr war es, als könnte sie hinter dem nächtlichen Glanze in weiter, dämmernder Ferne einen schimmernden Stern emporsteigen sehen. Als sie die Blicke wieder von einander wendeten, war es nicht mehr das Gefühl der Verlegenheit, welches das leise Erröthen von Neuem auf die Wangen trieb, sondern ein Gefühl unnennbaren Behagens, ein ertönendes Singen und Klingen in der Tiefe der Seele, gleich dem verwehenden Gesange der Lerche, die, dem Menschenauge nicht mehr erreichbar, im Duftmeere dahinschwebt. Das lang anhaltende Schweigen, das nun erfolgte, war auch nicht die herumtastende Unruhe, die vergeblich nach einem Worte sucht, es war vielmehr eine träumerische Ruhe, die nichts sucht und nichts begehrt und in sich selber glücklich ist. Und als das Fräulein endlich wieder zu sprechen anfing, that sie es nicht, um dem Befehle des Vaters, an den sie in diesem Augenblicke gar nicht mehr dachte, gehorsam sich zu erzeigen, sie that es vielmehr, um einem eigenen Befehle zu gehorchen, der ihr ganz vernehmlich zurief: Du mußt dir das Räthsel lösen lassen … er kann es, er allein, der dir Alles, Alles sagen wird.
»Ihr seid ein Deutscher,« begann sie, »Eurer Sprache nach, mein Herr.«
»Aus Köln am Rhein, gnädiges Fräulein.«
»Ach, darin liegt es, meine selige Mutter war eine geborene Rheinländerin und deshalb wohl haben mich die Anklänge Eurer Aussprache schon beim ersten Worte so freundlich angemuthet.«
»Eine Rheinländerin? 's ist ein schönes Land, mit seinen Städten, Schlössern und Ruinen, die sich in dem herrlichen Strome beschauen; habt Ihr's noch nie gesehen, gnädiges Fräulein?«
»Ihr habt Heimweh danach, wie es scheint, und doch ist unser Land wohl nicht minder schön.«
»Es ist meine Heimath,« sagte er leiser, »die ich nicht gerne verlassen habe.«
»Darauf mußtet Ihr Euch wohl für einige Zeit schon gefaßt machen, als Ihr Euern Beruf erwähltet, mein Herr.«
Julia bemerkte erst an dem augenblicklichen Zögern der Erwiderung, daß sie unbewußt eine verfängliche Frage gethan haben mochte, und schon wollte sich ein Gefühl der Reue regen, daß es wenigstens jetzt schon geschehen; aber alsbald antwortete er ruhig: »Ich habe den Beruf erst seit einem halben Jahre erlernt, gnädiges Fräulein, und muß Euch deshalb nochmals um gütige Nachsicht bitten, wenn Ihr mich langsam und unbehülflich findet.«
»Seltsam!«
»Seltsam mag Euch das wohl erscheinen,« lautete die Antwort, auf diesen nur leise vor sich hin gehauchten Ausruf; »kommt es mir doch selbst manchmal vor, wie ein Traum … wie ein dunkler, schwerer Traum, mein gnädiges Fräulein.«
Der wehmüthige Klang der Stimme, mit dem diese Worte gesprochen waren, bebte in Julia's Ohren nach, wie der verschwimmende Ton einer Trauerglocke. Hier stand sie mit einem Schritte an der Enthüllung eines Geheimnisses, das ihr Gemüth so unvermuthet vorbeschäftigt hatte; aber sie wußte ja schon genug und schwieg, während sich ihre Blicke langsam und träumerisch zu Boden senkten. Ja, sie wußte es mit plötzlicher und erschreckender Klarheit, daß noch ein Schritt weiter sie an die Entschleierung eines schmerzvoll empfundenen Unheiles führen würde, und das mochte sie jetzt nicht in seiner deutlichen Gestalt anschauen … jetzt nicht in diesem Augenblicke. Einmal mußte sie's erfahren, auch das wußte sie deutlich; aber es war noch immer früh genug, wohl zu früh, wann es kommen mochte. Das Herz sträubt sich stets, bei der Empfindung eines unerwarteten Glückes, sei dieses ein bewußtes oder unbewußtes, plötzlich wieder dem Schmerze seine Pforten zu öffnen, und so schwieg auch das Fräulein in fast ängstlicher Selbstbehütung, bis der Friseur zur Seite trat und schüchtern sagte: »Wenn ich Euch um den Spiegel bitten dürfte, gnädiges Fräulein.«
Das eigene Bild, das ihr aus dem geschliffenen Krystalle entgegentrat, verscheuchte die traumhaften Schatten wieder, die sich hervorgedrängt, obwohl sie sich selbst jetzt fast wie ein Traumbild erschien. »Bin ich das wirklich selbst?« rief sie nach einer Pause lächelnd und zugleich über den Ausruf wie eine dunkle Rose erglühend, »wahrhaftig, Ihr seid ein seltsamer Haarkünstler, mein Herr! … Nein, nein,« fuhr sie jedoch mit einer abwehrenden Handbewegung den Spiegel dem verlegen vor ihr Stehenden zurückgebend, fort, »es ist gut so … ich bin zufrieden, verlaßt Euch drauf.«
Sie erhob sich und wollte dem grünen Fenster zugehen; aber sie mußte nach dem ersten Schritte stehen bleiben und sich an die weiße Marmorplatte des Tisches lehnen. »Ihr habt nun noch zu meinem Vater zu gehen,« sagte sie leise, ohne aufzublicken; »mein Mädchen wird Euch draußen den Weg weisen.«
»Und ich darf wiederkommen … Ihr seid zufrieden mit meinem Dienste, gnädiges Fräulein?«
»Gewiß, gewiß,« erwiderte sie rasch, »morgen zur nämlichen Stunde oder etwas später, wenn es Euch gelegen ist, und so dann alle Tage. Und noch Eines,« fügte sie hinzu, als er langsam sich der Thüre zuwendete, »mein Vater scheint manchmal etwas barsch, bis man sich das angewöhnt hat; aber böse ist's nicht gemeint.«
»Nehmt meinen herzlichsten Dank, gnädiges Fräulein … Julia!«
Sie schaute betroffen auf, der sich bereits schließenden Thüre nach und legte dann mit langem, nachdenklichem Sinnen die Hand über die Augen. »Julia? … Wer hatte den Namen ausgesprochen? Hab' ich es selbst gethan oder er? … Nein, er ist's gewesen, gewiß … es klingt mir ja noch der Ton seiner Stimme im Ohre nach. Aber wie ist er dazu gekommen … hast du eine Unvorsichtigkeit, eine Thorheit begangen? … Nein,« gab sie sich laut die Antwort auf diese Selbstanfragen … »und wenn es doch wäre, so trag' ich keine Schuld daran … ich nicht.«
Sie wendete sich langsam wieder dem Spiegel zu, um nochmals ihr Bild zu beschauen. Ja, es war eine Veränderung vorgegangen mit ihr seit einer kurzen halben Stunde – sie war eine Andere geworden; aber wo lag er denn, dieser Wechsel? – An dem Haarschmucke allein konnte es nicht liegen, er war in all' seinen Touren bis in die kleinsten Formen herab der nämliche geblieben; und doch … und doch bildete er einen so ganz andern, hellern Rahmen als bisher um die Stirne, fast wie von einem verborgenen Lichte angeschimmert. Aber auch die Augen, Wangen und Mund – waren sie nicht wie von einem neuen Glanze erfüllt, von einer frischen Blüthe angehaucht? – »Gewiß, du bist recht hübsch, Julie,« sagte sie, den Spiegel lächelnd gegen die Wand zurücklehnend, »und es fehlt nichts weiter mehr, als daß du dir zu deinen übrigen Vorzügen nun auch noch ein Stück Eitelkeit erwirbst.«
Dieses heitere, sich selbst neckende Spiel mußte jedoch bald wieder ernsteren Gedanken und Gefühlen weichen und mit wachsender Unruhe bedachte das Fräulein, was sich im Gemache des Vaters zutragen möchte. Sie hörte im Geiste die beiden Männer sprechen mit einander, den rauhen befehlenden Ton des Vaters und den vollen melodischen Klang der Stimme des Fremden, der nicht fragen, nur Antwort geben durfte; aber bald verstummte er und blieb auch diese schuldig oder gab das Wort trotzig zurück von einem dunkelleuchtenden Blicke begleitet. Der Oberst fuhr mit heftiger Geberde vom Stuhle auf und schrie dem Verwegenen eine Drohung in's Gesicht – was entgegnete dieser darauf? – Julie, die unter diesen Vorstellungen langsam sich der Thüre genähert hatte, beugte sich in horchender Stellung nieder, als müßte nun ihr äußerliches Ohr vernehmen, was sie dem innerlichen nicht mehr zu beantworten getraute; aber heftig erschrocken fuhr sie zurück, als draußen ein Geräusch entstand und eine Hand auf die Klinke drückte.
Der Schrecken verflog beim Anblicke des fröhlichen Gesichtes ihres hereintretenden Mädchens, aber doch mußte sie sich Gewalt anthun, um ruhig zu erscheinen, obwohl die Zofe sichtlich genug mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt war. »Herr Jesis,« rief das muntere Ding, noch unter der Thüre, »nun hab' ich doch recht, trotz Eueres Auslachens, gnädiges Fräulein; das ist gewiß und wahrhaftig ein Prinz oder ein Graf, oder wie die schönen fremden Herren heißen mögen, das hab' ich mir wohl gedacht.«
»Du bist ein thörichtes Kind,« erwiderte das Fräulein; »aber wo bleibst du denn so lange, daß du dich gar nicht sehen läßt?«
»Habt Ihr mich gerufen? Wahrhaftig, ich hab' es nicht gehört. Aber wie Euch die neue Frisur prächtig steht, Herr des Himmels, prächtig sag' ich, gnädiges Fräulein.«
»Du hattest wohl an der Hausthüre oder auf der Straße so wichtige Geschäfte, daß du mich nicht hören konntest. Ist der Vater schon ausgegangen?«
»Nein bewahre, so eben ist der … na, ich sag' einmal der fremde Prinz aus seinem Zimmer gekommen, der gnädige Herr hat ihm das Geleit gegeben bis an die Treppe hinaus. Und der hat Euch wirklich und wahrhaftig mit eigenen Händen die herrlichen Touren geflochten? Das bedeutet Glück, gnädiges Fräulein, großes Glück sag' ich; ich wollt' Häuser darauf bauen.«
Julie kehrte sich ab und lehnte ihre Stirne leise gegen die kühlen Fensterscheiben. »Mein Vater hat den Haarkräusler an die Treppe begleitet? Hast du es denn selbst gesehen?«
»Ob ich es gesehen habe?« rief das Mädchen, während es sich, von der Herrin unbeachtet, auf der Fußspitze vor dem Spiegel hin- und herwiegte, »gesehen hab' ich's freilich, denn ein wenig neugierig bin ich schon gewesen. Der gnädige Herr hat auch noch etwas nachgerufen von Soldaten und er möge sich besinnen darüber.«
»Soldaten? Was sollte das zu bedeuten haben?« sagte das Fräulein leise vor sich hin – »und was den Vater zu einer solchen Höflichkeit konnte bewogen haben, die doch eben nicht seine Sache ist? … Geh' hinüber, Mädeli,« befahl sie der Zofe, »und frage den gnädigen Herrn, ob er mir noch einen Auftrag zu geben habe vor seinem Ausgange.« Sie bereute diesen Befehl, sobald das Mädchen das Zimmer verlassen – denn was sollte sie dem Vater antworten, wenn er nun ihrerseits die anbefohlenen Erkundigungen erwartete? – Aber es war zu spät und in wenigen Augenblicken schon hörte sie den Obersten auf ihr Zimmer zuschreiten.
Das Fähnlein seiner Laune mußte sich indessen nach einem äußerst günstigen Winde gerichtet haben. Er schrie das Mädchen draußen an, wie ihm nun der Goldprinz gefallen und ob es bereits eine tüchtige Angel ausgeworfen habe nach ihm. Er wolle, fügte der Oberst mit einem etwas derben Soldatenwitz hinzu, schon helfen den Fisch an's Land ziehen, sobald derselbe nur einmal angebissen.
Wie sehr nun auch dem Fräulein diese heitere Stimmung des Vaters erwünscht sein mußte, so empfand sie doch plötzlich einen seltsam stechenden Schmerz ob den Worten, die sie hörte, und ihr Gesicht glühte mit einem Male wieder auf, wie ein vom Morgenstrahle überleuchteter Rosenbusch. Dieses Erröthen blühte noch immer fort, als der Oberst in's Zimmer trat, ja es erhöhte sich sogar bei seinem Anblicke wie von einem verhaltenen Zorne genährt und auf die Wangen getrieben. »He da, Jule,« rief der gnädige Herr lachend, während er mit dröhnenden Tritten viel weiter in das Gemach vorschritt, als es sonst seine Gewohnheit war, »du machst ja ein Gesicht wie … na, wie eine flunkernde Morgensonne würd' ein Liebhaber sagen, was?«
»Ihr seid sehr heiter gelaunt, Vater.«
»Na … gleichviel diesmal, ob Vater oder Papa; war aber auch ein Kapitalspaß, das … nicht Kleine? … Ein armer Teufel, dieser neugebackene Prinz, ein armer Teufel; könnt' mich dauern, wenn er nicht solch' ein Butterherz im Leibe trüge … weiß, wie das thut, hab's selbst erfahren. Aber offen und gradaus und ein Prachtbursch daneben … was?«
»Darüber hab' ich ihn nicht genauer angesehen,« erwiderte das Fräulein leise, »wofern Ihr den Friseur meint, Papa.«
»Würd' dir auch wenig genug nützen, dein Besehen,« schrie der Oberst, »was verstehst du von solchen Dingen! Sechs Fuß, im höchsten Fall eine Linie drunter, und gewachsen wie eine Rothtanne; alle Wetter, und dabei mit Kamm und Bürste hantieren. Aber will nicht, hab' schon zu viel Blut an dem Einen gesehen, sagt' er … Dummheiten.«
Der Oberst hatte die letzten Worte mehr vor sich hin, als gegen seine Tochter gewendet gesprochen, und doch streiften sie das Roth von ihren Wangen so plötzlich ab, wie im Vorfrühling eine windgehetzte Schneewolke den Sonnenschein von den aufblühenden Wiesen streicht. »Schon zu viel Blut gesehen?« flüsterte es bange in ihr … »armer Mann, und das wäre der dunkle, schwere Traum, von dem du gesprochen hast!«
Der Oberst ging selbst eine Weile nachdenklich auf und nieder, während er bei jedem Schritte mit seinem Stocke leise auf den Boden stieß. Endlich sagte er, ohne jedoch aufzublicken: »Wahr ist's schon, es gibt manchmal kuriose Geschichten, ganz kauderwelsche Geschichten, und alle Wetter … sie können Jedem passiren, so oder so … hm, hm. Na, Jule,« fuhr er, mit der Hand über sein Gesicht streifend und sich an seine Tochter wendend, wieder mit seiner dröhnenden Stimme fort: »Jetzt geh' ich … he, bist böse, was?«
»Nein, Papa, ich wüßte nicht, warum ich das sein sollte.«
»Schwerenoth, das will ich auch meinen. Aber noch eins, halt; den Friseurgesellen da kannst in Ruh' lassen mit Weiberfragen … taugt nichts … Dummheiten.«
»Das war schon heute meine Meinung, Vater,« sagte das Fräulein, ihre Stirn auf die Hand lehnend, und fügte dann, dem Abgehenden nachblickend, leise hinzu: »Ist's mir doch, als würd' ich ohne Frage schon zu viel erfahren müssen.«
Nun waren freilich wenige Berner und noch weniger Bernerinnen geneigt, die einmal erregte Neugierde in gleicher Weise wie die schöne Julie zu zügeln; im Gegentheil gab der Fremde bald in immer weitern Kreisen zu rathen und zu fragen. Unter den Stammbesuchern des Bärengrabens zwar konnte die goldene Prinzen-Mähr ihren Glanz nicht auf die Dauer retten, als der Ankerwirth selbst kein Interesse mehr an derselben hatte und erzählte, der Fremde habe ihm auf einen gegebenen Wink eben einen Possen spielen helfen, um dem überall herumschnüffelnden Bölzlein Eines anzuhängen; drum habe er den Schimmel auch weder gekauft, noch viel weniger geschenkt erhalten, sondern der Kreuzwirth von Fraubrunnen, der denselben dem müden und wohlaussehenden Reisenden zur Miethe bis Bern anvertraut, habe ihn schon am folgenden Morgen wieder abgeholt und in eigener Person zum Aarbergerthor hinausgeritten. Das gab nun freilich lange Gesichter und manch' geheimen Aerger gegen den Fremden und den Ankerwirth; aber wer nicht als der Leichtgläubigste ausgelacht werden wollte, mußte sich drein ergeben oder auf Kosten des armen Bölzlein und des Thorwarts selbst mitlachen. Damit war die Sache jedoch keineswegs abgethan und die Neugierde zog blos ein feineres Röcklein an, um vom Bärengraben eine Runde durch die Gemächer der vornehmen Frauen- und Töchterwelt zu machen, und überall fand sie als willkommener Gast offene Thüren, wo sie anklopfen mochte. So kam es, daß der bald allbeschäftigte Geselle des Meister Hänni am Abend froh war, sich von seinen vielen Arbeitsgängen ermüdet auf sein Kämmerlein zurückzuziehen, von wo dann bis in die tiefe Nacht bald wehmüthige, bald hoffnungssüße Geigentöne auf den stillen Bärenplatz herabklangen; manchmal auch erhob sich ein Lied da droben von bebenden Zithertönen begleitet, dem die ganze Nachbarschaft in der Runde die Fenster öffnete, um es als erquickenden Schlafgruß in's Haus hereinzulassen. Doch das war auch so ziemlich Alles, was man von dem räthselhaften Fremden in sichere Erfahrung bringen konnte; denn wie mancher kluge Mund ihm auch den langen Tag hindurch eine wohlüberdachte Frage gestellt und wie manches schöne Auge groß aufblickend, gleichsam ein stummes Bittgesuch stellend, an ihm gehangen – es wußte nach Wochen noch Niemand mehr von ihm zu sagen, als daß er aus Köln gebürtig und Theobald Mayer heiße. Aber, wurde gewöhnlich beigefügt, er werde gute Gründe haben, jeder weitern Antwort so vorsichtig wie er's thue auszuweichen; denn ein gewöhnlicher Haarkräusler sei er von Jugend auf nun und nimmermehr gewesen.
Eine gab es wohl in der Stadt, die, wie sie vorausgeahnt, auch ohne Fragen mehr erfuhr, als alle ihre neugierigen Bekannten und Standesgenossinnen; aber was sie wußte, wagte sie ja kaum in den muthigsten Stunden ihres Herzens sich leise vorzuerzählen, und es ging schon ein banges Erzittern durch ihre Seele, wenn sie den Namen des Fremden nur zufällig und flüchtig von Andern nennen hörte. Hier war also dessen Geheimniß wohl geborgen, tief verbunden mit einem andern Geheimniß, das in Juliens Herzen keimte und emporblühte, wie draußen an den einsamen Borden des Flusses die duftigen Frühlingstriebe. –
Unter solchen Umständen mußte die müßige Plaudersucht wohl oder übel nach neuer Nahrung ausgehen und diese wurde denn auch unversehens und in schreckenerregendem Maße dargeboten. Mit den ersten Sommertagen nämlich begannen da und dort dunkle unheimliche Gerüchte aufzutauchen, die bald wie eine dunkle Wetterwolke sich über die ganze Stadt ergossen, bald nur wie lichtscheue Nachtvögel in einzelnen Häusern und Straßen derselben herumflatterten. Einmal hieß es, die Bauernschaft der benachbarten Aemter und Landvogteien rüste sich im Geheimen, die Stadt nächtlicherweise mit Raub und Brand heimzusuchen und, des Kindes im Mutterleibe nicht schonend, die Mauern derselben dem Erdboden gleich zu machen; ein andermal lautete der Bericht, es sei nur auf die Baretli und großen Häuser abgesehen und wer von der mindern Burgerschaft Kopf und Herz am rechten Flecke habe, werde mithelfen dabei; der dritte Tag hinwieder brachte die Kunde, es sei eine französische Heerschaar bereits durch das Münsterthal bis gegen Biel vorgedrungen, die dem Patriziate helfen wolle auf den Trümmern der alten Republik einen Königsthron zu errichten. Woher diese Gerüchte kamen, wollte Niemand sagen noch wissen, sie waren am hellen Tage plötzlich auf offener Straße da oder kamen in die verschlossene Schlafkammer geschlichen wie schwere Nachtträume; soviel nur war gewiß, daß sie aller Orten Unruhe, Angst und Schrecken verbreiteten. In den Werkstätten begann die Arbeit zu stocken, die Männer suchten ihre Waffen hervor, um sie in schlagfertigen Zustand zu setzen, und die Frauen, die sich auf den Straßen zeigten, huschten eilfertigen Schrittes davon, als ob ihnen ein unsichtbarer Feind auf der Ferse folge. Zwar zogen auch die obrigkeitlichen Ausrufer in feierlicher Amtstracht mit Handglocke und Trommel durch die Stadt, um die Burgerschaft zur Ruhe und gewohnten Hantierung zu ermahnen, indem auf die Entdeckung der Erfinder oder absichtlichen Verbreiter der »einfältigen« Gerüchte, wie es hieß, ansehnliche Belohnungen gesetzt wurden; aber daß den Standeshäuptern und Regimentsfähigen selbst diese Gerüchte nicht so einfältig vorkamen, wurde am deutlichsten durch den Umstand bewiesen, daß sie bald nur noch in voller Bewaffnung auf der Straße erschienen und wie in Tagen höchster Kriegsgefahr die Schultheißen mit dem Sponton in der Hand auf's Rathhaus zogen. Auch sah man schon einzelne Carossen, die mit Frauen und Kindern der Vornehmen zu den Stadtthoren hinausfuhren.
Die allgemeine Verwirrung nahm zu, als man eines Morgens früh rasch sich vergrößernde Gruppen durch die Hauptstraßen ziehen sah, die vor den ansehnlichsten Häusern stehen blieben, mit aufmerksamen Blicken die Thüren oder Vorsäulen derselben untersuchten und dann schweigend wieder weiter zogen. Der Haarkräusler Theobald, der in den letzten Tagen schon manche seiner schönen Kunden durch die Flucht verloren, wurde auf einem Gange, den er in's Freie beabsichtigt, durch dieses seltsame Treiben angelockt, an eine der Gruppen heranzutreten. »Was gibt es da Neues zu schauen?« fragte er den nächst vor ihm Stehenden, hätte jedoch seine Anfrage fast bereut, als der Angeredete den Kopf wendete und er in demselben den ehrsamen Meister Bölzlein erkannte. Dieser schien indessen jeden rachsüchtigen Gedanken, den der Vorgang im kleinen Anker bei ihm erregt haben mochte, zu vergessen über der Angst, die wie ein bleiches Gespenst aus allen seinen Mienen hervorblickte, und leise antwortete er, den Zeigefinger erhebend: »Ah … seht Ihr's nicht, Herr … dort auf der Thüre? …«
»Nein, … da bemerke ich nichts Besonderes.«
»Die drei Kreuzlein, mit rother Kreide gezeichnet?«
»Nun ja … vermuthlich der muthwillige Versuch eines Schuljungen!«
»Nein, nein,« schüttelte der Schneider ängstlich den Kopf, »Ihr werdet's schon sehen beim nächsten Rathsherrenhause, kommt nur mit.«
Der Zug setzte sich in Bewegung, um bei dem nächsten Hause, über dessen Thüre ein Wappen in Stein ausgehauen war, wieder Halt zu machen, ohne daß sich Jemand Mühe gegeben hätte, die dazwischen liegenden unbewappneten Häuser in Augenschein zu nehmen. Und wirklich, hier waren abermals einige Kreuzzeichen bemerkbar an der Thüre, einzig mit dem Unterschiede, daß diese mit schwarzer Kreide oder Farbe gezeichnet waren. »Und jetzt,« flüsterte Meister Bölzlein seinem Begleiter zu, indem er sich schüttelte, wie von einem grimmigen Froste erfaßt, »merkt Ihr nun, was es zu bedeuten hat? …«
»Nein, klüger bin ich noch nicht geworden … ich muß Euch schon um Aufklärung bitten, Meister.«
»Ah … Aufklärung,« machte Bölzlein, indem er sich scheu nach allen Seiten umblickte, »wer die geben könnt' in diesen Unglückstagen!«
»Eine Meinung werdet Ihr doch haben, wie diese Leute, da Ihr den Zeichen eine Bedeutung beizumessen scheint.«
Der ehrsame Meister ließ seine Augen abermals ängstlich herumgehen. »Eine Meinung?« flüsterte er dann, »die hab' ich freilich und sie geht dahin, daß die Rathsherren ihre Häuser haben ankreiden lassen, damit die Franzosen, die uns einen König bringen sollen, wissen, woran sie seien und nur die Häuser der mindern Burger mit Mord und Plünderung heimsuchen.«
»Ach, so ist's gemeint,« machte Theobald halb spöttisch, halb ärgerlich die Achsel zuckend, »da thut Ihr am Besten, Meister, Ihr kreidet Euere eigene Thüre ebenfalls an.« Mit diesem Bescheid wendete er sich nach einem Seitengäßchen, um in die nächstliegende Hauptstraße zu gelangen.
Aber hier wiederholte sich das nämliche Spiel, indem hart an ihm vorbei eine Gruppe zog, die an einem der nächsten Häuser stehen blieb. Theobald erkannte unter den schweigsamen Männern den Ankerwirth und beschloß, sogleich sich an diesen um bessere Auskunft zu wenden, als er von Meister Bölzlein erhalten; aber auch das sonst stets von einem pfiffigen Lächeln durchleuchtete Antlitz war jetzt in düstere Falten gelegt. »Am Besten ist's, Herr,« erwiderte der Ankerwirth auf die an ihn gerichtete Frage, indem er seinen ehemaligen Gast ein wenig auf die Seite zog, »am Besten ist's, man fragt nicht zuviel über diese Geschichten und macht sich im Stillen seine Meinung darüber; dann kann uns später, geh' es wie es wolle, wenigstens Niemand haftbar machen dafür.«
»Ich vermag Euch nicht zu verstehen.«
»Nun ja, Euch gegenüber kann ich mich schon deutlicher aussprechen,« erwiderte der Ankerwirth, doch erst nachdem er noch einen prüfenden Blick auf seinen Begleiter geworfen. »Ihr seid fremd in der Stadt und ich möcht' auch nicht, daß Euch ein unverschuldetes Leid widerführe. Gestern sind viele freche Gesellen vom Lande in der Stadt gewesen, sie zogen vereinzelt oder nur zwei zu zwei überall herum und am Abend haben sich auch einige in meiner Wirthschaft zusammengefunden … ich habe da manches Wort gehört, das gerade nicht für meine Ohren berechnet war.«
»Und weiter?«
»Und weiter glaube ich, daß die Rathsherrenhäuser über Nacht mit diesen Dingern da bezeichnet worden sind, damit die Bauernbanden, wenn ihnen die Ueberrumpelung der Stadt gelingen sollte, wissen, wo sie zunächst mit Raub und Mord einzubrechen haben.«
»Glaubt Ihr an solche Plane und ist das Euer Ernst?«
»Mein voller Ernst, Herr … wahrhaftig, jetzt ist's nicht Zeit zum spaßen.«
»Nun, beim Himmel,« rief Theobald, »dann ist's schlimm bestellt, wenn Jeder das Gegentheil der Meinung des Andern behauptet und am Ende doch Keiner weiß, wo die Geschichten hinaus wollen!«
»Ich hab' Euch meine Ansicht gesagt,« erwiderte der Wirth kurz abbrechend; »haltet davon, was Euch beliebt, Herr.« –
Theobald fühlte sich betroffen von dem Ernste des Mannes, den er noch nie ernsthaft gesehen, und nachdenklich begann er, ohne eigentlich zu wissen, was er wollte, die Straße abwärts zu gehen. Die Gerüchte, wie sie bisher die Stadt aufgeregt, waren ihm zu fremdartig und bunt vorgekommen, als daß sie seinen muthigen Sinn hätten beunruhigen können, und dies um so weniger, als er auch an jenem Orte, an dem seine Gedanken Tag und Nacht mit tausend Ohren lauschten, noch keine besondere Aengstlichkeit bemerkt hatte. Aber jetzt schienen denn doch die Dinge eine bestimmtere Gestalt annehmen zu wollen und Theobald fiel mit einem Male die Erinnerung schwül aufs Herz, daß in der großen catilinarischen Verschwörung zu Rom die Häuser Derjenigen, die dem Untergange geweiht werden sollten, ebenfalls mit solchen unscheinbaren Merkmalen bezeichnet worden waren. Warum sollte ein solches Mittel nicht auch hier angewendet werden und der Ankerwirth mit seiner Vermuthung das Ziel getroffen haben? – Seine Schritte beschleunigten sich über dieser Vorstellung und ohne Anhalt lenkte er am Münster vorbei in die Straße, in welcher das Haus des Obersten lag. Fast eine ganze Reihe dieser Straße bestand aus vornehmen Patrizierhäusern, die ohne Ausnahme mit den verhängnißvollen Zeichen, bald roth, bald schwarz, beschrieben waren; das Haus des Obersten trug seine Signatur mit zwei Kreuzen in rother Farbe. Es war noch lange nicht die Stunde, in der Theobald sonst als Haarkräusler durch diese Thüre zu treten pflegte; aber jetzt hatte ihn plötzlich eine so mächtige Unruhe erfaßt, daß er auf die Klinke drückte und schon die breite Treppe hinanstieg, ohne daran zu denken, wie er sein allzufrühes Erscheinen rechtfertigen wolle, wenn er darüber befragt werden sollte. Als er sich dem Gemache des Obersten näherte, dachte er daran und war, mit leisen Tritten an der Thüre vorüberschreitend, froh, daß sich der alte Herr nicht blicken ließ; »bei Julien,« sagte er leise vor sich hin, »wird sich's schon geben … am Ende darf ich ihr wohl auch mittheilen, was mich nun einmal erschreckt hat und beunruhigt.« –
Und es gab sich sogar noch schneller und leichter, als er erwartet hatte. Das Fräulein saß wie an jenem ersten Morgen an dem von grünem Laubwerke halbverhüllten Fenster, das Gesicht nachdenklich auf die kleine Hand gestützt; bei dem Eintritt Theobalds erhob sie sich jedoch rasch und rief sichtbar erfreut: »Gottlob, daß Ihr da seid, Theobald; ich habe schon den ganzen Morgen mit großem Verlangen gewartet.«
»Und ich … ich fürchtete viel zu früh zu kommen, Fräulein Julia, es ist noch lange nicht zehn Uhr.«
»Ach, um so besser, dann mögt Ihr länger hier bleiben; mir ist's so bange heute, auch um Euretwillen, Theobald … gewiß, ich weiß mir selbst keinen Rath zu geben.«
»Auch um meinetwillen? – Aber,« ersetzte er den ernstern Ton mit einem Lächeln, »wie sollte denn die Unerschrockenste ihres Geschlechtes sich unnützen Befürchtungen hingeben können!«
»Laßt Euern Scherz, Theobald … ich seh' es Euern Augen an, daß Ihr Euch doch zwingen müßt dazu; und wahrlich, auch ich habe weder Lust noch Ursache zum Fröhlichsein. Der Vater ist bald nach Mitternacht in die Rathsversammlung abgeholt worden und bis diesen Augenblick noch nicht zurückgekehrt. Das ist in meinem Leben nie geschehen!«
»Um Mitternacht Rathsversammlung!« rief Theobald, »und er hat Euch auch keine Nachricht geben lassen, ob er sich noch dort befindet?«
»Schon in der ersten Morgendämmerung ist der Rathsbote mit der Weisung gekommen, daß ich das Haus nicht verlassen solle, bis der Vater zurückgekehrt sei.«
Theobald stand mit nachdenklichem Schweigen an den Tisch gelehnt, bis das Fräulein wieder sagte: »Um Gotteswillen, so sprecht doch … Euer Schweigen ängstigt mich in's tiefste Herz hinein; erzählt mir wenigstens, was in der Stadt vorgeht, Theobald.«
»Nein, beunruhigt Euch nicht, Fräulein,« erwiderte er langsam; »und doch … was hilft es, meine eigene Unruhe verbergen zu wollen … ich darf es auch nicht thun! Seht, Julia, es machte mich unsäglich glücklich, daß Ihr nicht, wie viele andere Frauen schon von einem bloßen Schatten erschreckt, die Stadt verließet … es kam mir bisher immer auch vor, als hättet Ihr Euch vor keiner Gefahr zu fürchten; jetzt hingegen muß ich selbst wünschen, daß Ihr Euern Cousinen schnell nach Neuenburg folgt.«
»Und Ihr rathet mir das, Theobald?«
»Diese mitternächtliche Rathssitzung ängstigt mich; denn solches mag nur in Zeiten dringender Gefahr vorkommen.«
»Ihr habt noch andere Gründe, Theobald,« sagte das Fräulein, nachdem sie ihn mit einem langen fragenden Blicke angeschaut, »ich seh' es Euch deutlich an, und sonst würdet Ihr mit Euerm Rathe wenigstens zuwarten bis der Vater zurückgekommen; doch ist's mir auch lieb, wenn ich jetzt nichts Weiteres erfahren muß, das meine Angst vermehren könnte. Aber ich kann die Stadt nicht verlassen, wo du und der Vater zurückbleiben … jetzt nicht, Theobald.«
»Julia!«
»Theobald!«
Er lag vor ihr auf den Knieen und lehnte sein glühendes Antlitz auf ihren Schooß; sie saß still, ohne Abwehr, ihre beiden Hände wie in seliger Andacht gefaltet auf sein Haupt gelegt. »O Julia, was machst du aus mir,« rief er, sein Gesicht erhebend; »ich Unglückseliger, der durch die geöffneten Pforten des Himmels schauen darf, nur um die Qualen seiner Verdammniß zu vermehren.«
»Sei nicht ungerecht, Theobald,« erwiderte sie leise, »ein Augenblick des Glückes gibt die Kraft, jedes kommende Unglück zu ertragen.« Sie ließ die Hände auf seine Schultern sinken, neigte das Gesicht herab und die Welt verschwand den Beiden in ein dufthauchendes, wogendes Blüthenmeer. –
Mit trunkenen Blicken sich wieder erhebend, rief er hochaufathmend: »Du hast Recht, Julia, ein solcher Augenblick wiegt das Elend eines ganzen Lebens auf; aber warum soll es nur ein einziger Augenblick sein in dieser endlosen Reihe … warum, Julia?«
»Du weißt es,« erwiderte sie, seine Hand gegen ihre Stirne drückend; »einmal mußte es so kommen, Theobald … ich hab' es längst gewußt; nun aber ist es mir auch wieder wohl und alle Angst von meinem Herzen genommen.«
Er schaute sie lange träumerisch an, wie sie ruhig vor ihm saß, der Lilie gleich, die ihre duftige Blüthe, weder vor dem drohenden Gewitter, noch vor dem sengenden Sonnenstrahle zu bergen vermag; und doch fühlte seine Hand wie ihre Stirne glühte und wie ein leises Schüttern durch ihre Glieder bebte. »Und wenn wir uns deinem Vater anvertrauen,« flüsterte er endlich, »und gerade jetzt vielleicht, Julia? … In Zeiten der Gefahr erst hat schon mancher Mann den andern schätzen gelernt!«
Sie schüttelte das Haupt mit einem wehmüthigen Lächeln, das aber sogleich verschwand, als er langsam seine Hand aus der ihrigen zurückzog. »Ich weiß, was du denkst,« sagte sie, ihn mit ihren sanften Augen anblickend; »aber du thust mir Unrecht, Theobald. Oder warum willst du den kurzen Traum meines Glückes stören, bevor mir der Tag den süßen Schlaf verscheucht? … Nein, sprich nicht, mein Freund, ich weiß, es bleibt mir nichts, als Ergebung, und drum glaube mir, es ist eine starke Kraft von Nöthen, ein ganzes Leben lang hoffnungslos dulden und entsagen zu müssen.«
»Nicht hoffnungslos … die Hoffnung wenigstens mußt du mir lassen und dir selbst bewahren, Julia!«
»Hoffen und Entsagen … ja, Theobald. Hörst du, das sind die Schritte des Vaters vor der Thüre.«
Sie hatte rasch die Hand an ihre Haare gelegt und das zusammenhaltende Netz losgerissen; aber noch rollte die hellschimmernde Fluth erst langsam über die Schultern herab, als der Oberst in seiner Amtstracht, in Sammtmantel und Baret in's Zimmer trat. Statt des kleinen Paradedegens hing eine lange Klinge an seiner Seite und neben den Schoßenden der Weste blickten zwei Pistolengriffe hervor. Sein Gesicht sah ernst, fast drohend aus.
Unter der Thüre blieb er stehen und schaute die Beiden an, als müßte er sich erst besinnen, was das zu bedeuten habe oder wo er sich befinde; Julia wollte sich erbleichend erheben um ihm entgegenzugehen; aber Theobald, der scheinbar unbefangen eine ihrer niederfallenden Flechten ergriffen, hielt sie mit einem sanften Drucke der Hand zurück und trat dann selbst gegen den Obersten vor. »Wenn meine Anwesenheit stören sollte,« sagte er sich verbeugend, »so kann ich vor die Thüre treten, gnädiger Herr, bis Ihr mit dem Fräulein gesprochen. Erlaubt mir nur einen Augenblick, ihr Haar zusammenzuschlingen.« Er schaute dabei dem Vater in's Gesicht, während er sich so vor die Tochter stellte, daß diese von seiner Gestalt fast verdeckt wurde.
»Ah – nein – bleib' Er nur,« rief der Oberst; »schon so spät – was?«
»Das Fräulein hat mich auf heute etwas früher bestellt, gnädiger Herr.« – »Schon gut, mach' Er schnell fertig und komm' Er dann auch zu mir hinab … verstanden? – Du bleibst hier Jule, bis ich wieder zurückkomme.«
Die Thüre fiel heftig in ihre Angeln und Theobald wendete sich mit einem fragenden Blicke nach dem Fräulein zurück. »Nein, nein,« flüsterte sie erröthend, »er hat nichts bemerkt.« –
Aus dem Gemache der Tochter getreten, mußte Theobald stehen bleiben, um neue Kraft zu gewinnen, bevor er vor den Vater trat. Der Sturm der Gefühle, die so unerwartet aus ihrer still eindämmenden Haft befreit worden, brauste über ihm zusammen und drohte ihn mit sinnverwirrendem Gewölke zu umhüllen. Was hatte er in einer kurzen Stunde erlebt und was konnten die nächsten Augenblicke bringen! »Aber vorwärts,« rief er sich leise zu, »und verliere dich selbst nicht, Theobald.«
Bei seinem Eintritte in das Gemach stand der Oberst vor einem offenen, reichgefüllten Waffenschranke, von dem er sich langsam gegen den Jüngling wendete; in der Hand hielt er eine Kugelbüchse, von schön eingelegter Arbeit, deren Schloß er sorgfältig zu prüfen schien. – »Hör' Er, Meyer,« begann er mit leiserer Stimme, als es sonst seine Gewohnheit war; »Er wollte nicht Soldat werden wie ich's Ihm gerathen, obwohl Er früher mit allerlei Waffen wohl umzugehen gelernt. Jetzt muß Er's wider Willen thun … ich such' Ihm gerade Gewehr und Säbel aus … Da, das ist ein tüchtig Stück … eine englische Kugelbüchse;« damit reichte er Theobald die Waffe entgegen, während er ihm mit scharfem Blicke in's Gesicht schaute. – »Ich muß Euch um deutlichere Erklärung bitten, gnädiger Herr,« erwiderte der junge Mann, mit unwillkürlichem Wohlgefallen die Büchse betrachtend, »zum Soldaten habe ich jetzt so wenig wie früher Lust … der gnädige Herr weiß warum.«
»Na meinetwegen,« erwiderte der Oberst, indem er in den Schrank zurück nach einem Degen griff, »gilt es ja auch nicht einen Jugendfreund und Gefährten zu treffen; aber einen Rebellen und Mörder wird er doch über'n Haufen schießen können wie einen Hund … was?«
»Ich versteh' Euch immer noch nicht; oder sollt' es wirklich Ernst gelten mit dem Bauernaufstande?«
»Bauernaufstand? Dummheiten! … Aber hör' Er,« fuhr der Oberst nach einigem Besinnen fort, »hat Er irgend eine Ursache, sich über mein Haus zu beklagen, Meyer, über mich selbst oder über meine Tochter?«
Theobald mußte bei dieser Frage, die mit einem scharfen, lauernden Blicke begleitet war, die Augen niederschlagen; doch rasch erwiderte er: »Nein, das hab' ich nicht … Ihr wißt es selbst, gnädiger Herr.« – »Schon gut … ich weiß; Er hat mir bei seiner Ankunft seine Verlegenheit mitgetheilt und ich hab's, wie versprochen, in's Reine gebracht, daß Ihn keine Polizei weiter darnach fragte … was? … Meine Tochter wird Ihn auch nicht gequält haben … denk' mir's. Nun geh' Er einen Augenblick die Treppe hinunter und seh' Er, ob nicht zwei rothe Kreuze an die Hausthüre gemalt sind.«
»Ich habe sie schon bei meinem Eintritte bemerkt, gnädiger Herr, und ich weiß, daß auch an andern Häusern solche Zeichen angemalt wurden.«
»So, das weiß Er?« fragte der Oberst, indem seine grauen Augen in unheimlichem Glanze aufblitzten, »und weiß Er denn auch, was es zu bedeuten hat … was?«
»Nein, das weiß ich nicht; ich habe nur gehört, wie diese Kreuze mit einem Franzoseneinbruche oder einem Bauernaufstande in Verbindung gebracht werden wollten.«
»Dummheiten!« – Der Oberst kam langsam an dem Tisch, hinter dem er bisher gestanden, herumgegangen und sagte dann, hart vor Theobald stehen bleibend: »Hör' Er, lügen kann Er nicht und drum ist Er auch kein Hallunke … das hatt' ich im ersten Augenblick weg. Also kann man Ihm auch etwas anvertrauen – was?«
»Ich hab' Euch am ersten Tage gesagt, wer ich bin, gnädiger Herr.«
»Eines Thürhüters Sohn, aber mit dem jungen Edelmann erzogen und dann die Dummheiten … schon gut, ich weiß es. Nun hör' Er: in der nächsten Nacht sollte eine Verschwörung ausbrechen in der Stadt, die Regimentsfähigen ermordet und das Regiment in die Hände der Mörder übergehen … verstanden? die rothen Kreuze an den Thüren bedeuten Mord und Brand, die schwarzen wollen es gnädigst mit dem Tode der Bewohner bewenden lassen … Schurken … was?«
»Ist es möglich!« rief Theobald; »und die Verschwörung ist entdeckt und vereitelt?«
»Oh … unter solchem Hundepack sind Feigheit und Verrath immer zu Haus; in diesem Augenblick werden die Rädelsführer in aller Stille abgefaßt, um schnell …« Der Oberst machte, statt den Satz zu vollenden, eine scharfe Handbewegung durch die Luft, die freilich deutlicher sprach als alle Worte.
Theobald fühlte einen fröstelnden Hauch über sein Herz gehen, als er das kalte Lächeln bemerkte, das dabei wie eine blutdürstige Schlange um den Mund des Mannes spielte, und langsam legte er die Waffe, die er bisher in der Hand gehalten, wieder auf den Tisch zurück. Der Oberst schien es nicht zu beachten und fuhr daher nach einem Augenblicke fort: »Die Rädelsführer … ja, abgethan; aber wir wissen noch nicht, wie weit die Schelmerei Wurzeln getrieben; darum nehme Er die Büchse, Meyer, und diese Klinge da und geh' zum Rathhaus hinüber, dort wird Er das Weitere vernehmen … ich komme bald selbst nach.«
»Gnädiger Herr,« erwiderte Theobald nach kurzem Besinnen, »ich bin mit den Verhältnissen der hiesigen Bürgerschaft zu wenig bekannt, als daß ich mit gutem Gewissen Euerm Ansinnen Folge leisten könnte; Ihr werdet das von mir, dem Fremden, begreiflich finden. Aber gebt mir die Waffen mit der Erlaubniß, mich an Eurer Hausthüre aufzustellen; ich schwör' Euch, es wird kein Feind die Schwelle überschreiten, er müßte denn über meine Leiche gehen.«
Der Oberst hatte den Sprecher über diese Worte bald verwundert bald drohend angeschaut. »Ist das sein Ernst? … Er will nicht?« – rief er endlich.
»Nicht anders als ich gesagt habe,« erwiderte Theobald ruhig; »gebt mir die Erlaubniß zu meinem Anerbieten, gnädiger Herr.«
Der Oberst hob rasch den Degen, den er in der Hand gehalten, empor, ließ ihn aber augenblicklich wieder sinken und warf ihn in den Schrank zurück.
»Art läßt nicht von Art,« schrie er dann, auch die Büchse wieder zurückstellend; »pack Er sich, Sohn des Thürhüters!«
Als Theobald mit einem Herzen voll Glück und Leid, voll Zorn und Wehmuth die Stadt aufwärts schritt, sah er über die Kreuzgasse vier Rathsherren auf das Rathhaus zugehen, die mit bloßen Degen einen Gefangenen in ihrer Mitte führten. Dieser schien unvermuthet, doch nicht ohne hartnäckigen Widerstand überwältigt worden zu sein; der Hausrock, den er trug, war an vielen Stellen zerrissen und das Gesicht von einem Schusse verbrannt. Theobald kannte den Mann, der ihm schon früher durch körperliche Schönheit und durch die Größe seiner Gestalt, aber zugleich auch durch ein barsches prahlerisches Wesen aufgefallen; es war der Lieutenant Fueter bei der Stadtgarnison, und die Verschwörung hatte also selbst bei diesen berufenen Wächtern des Gesetzes und der Ordnung Eingang gefunden; dieser Gedanke schien auch auf das kleine Trüpplein Burger, die sich in bunter Bewaffnung vor dem Rathhause eingefunden, einen bedenklichen Eindruck zu machen; denn man sah da und dort einen von ihnen um die Ecke schleichen und nicht wieder zum Vorschein kommen. Das unbewaffnete Volk, das sich in dichten Haufen herbeidrängte, verhielt sich ruhig, offenbar überrascht und noch unentschlossen, auf welche Seite es sich zu schlagen habe. Als der Gefangene in's Rathhaus geführt war, trat aus demselben der Schultheiß, mit allen Zeichen seiner hohen Würde geschmückt, auf die breite Treppe heraus, um die Menge an ihre Pflichten gegen die Obrigkeit zu erinnern und sie zur Wachsamkeit und zum Gehorsame aufzufordern; aber er hatte seine Rede kaum begonnen, als eine drohende Stimme rief: »Schweig du, wir wissen längst, daß du ein glattes Maul hast.« Der ganze Haufe brach in ein unehrerbietiges Gelächter aus. Doch erhob sich keine Hand, als bald noch ein zweiter, dritter Gefangener von bewaffneten Mitgliedern des Rathes herbeigeführt wurden, und für Theobald schien dies ein deutlicher Beweis, daß die Verschwörer ebenso wenig als der Schultheiß die wärmere Anhänglichkeit der großen Masse besaßen. Er selbst hatte keine Lust, dem unheimlichen Schauspiele länger zuzuschauen und wollte sich hinwegdrängen; aber zwischen fast banger Erwartung und bald aufloderndem Ingrimme blieb er wieder stehen, als eben in dem Augenblicke der Vater Juliens hoch zu Roß auf den Platz hereinbog. Die an dieser Stelle dichtgedrängten Schaaren mußten dem Reiter freiwillig Raum geben oder sie konnten ihm mit leichter Mühe den Weg versperren und durch das Eine oder Andere ihre Gesinnung gegen den neuen Ankömmling zu erkennen geben. Er sah trotzig, sogar herausfordernd aus, der alte Graubart, und sogleich rief er auch mit seiner dröhnenden Stimme: »Alle Wetter, Platz gemacht Bursche; was habt ihr hier Maulaffen feil, holt eure Gewehre oder packt euch sonst zum Schinder, meinetwegen.« Aber wie unhöflich das auch klang, das Gedränge wich halb lachend halb ehrerbietig aus einander und da und dort rief es: »Ja, Platz gemacht, dem da … aus einander.«
In Theobald gewann bei diesem Anblicke das Gefühl des Zornes die Oberhand. Wäre der Oberst von der Menge bedroht worden oder in Gefahr gerathen, er würde sich ohne Besinnen den Angreifern entgegengeworfen und sich eher haben in Stücke zerreißen, als dem Alten ein Leides geschehen lassen; aber jetzt, da Alles zur Seite wich, hätte er ihm selbst in die Zügel fallen und ihn für seine brutale Rücksichtslosigkeit verantwortlich machen mögen. Das ist immer der Weg, den plötzlich erregte, noch nicht im Sonnenstrahle ruhiger Ueberlegung gereifte Gefühle einschlagen, sie tasten an der äußern Erscheinung herum wie der Blinde, der das Licht des Auges durch die Hand ersetzen muß. Aber bei Theobald trat noch das bittere Gefühl einer gänzlichen Ohnmacht und Hülflosigkeit gegen diesen Mann hinzu, der sein ganzes Lebensglück in Händen hielt und ach … es ohne Abwehr mit rauhem Fuße zertreten mußte, wie den Wurm, der auf seinem Wege kroch. Der Jüngling hob bei dieser Vorstellung, ohne daran zu denken, was er that, die zornig geballte Faust empor und in dem nämlichen Augenblicke streifte auch das scharfe Auge des Obersten nach ihm hinüber. Mit einem verächtlichen, fast grinsenden Verziehen des Gesichtes zuckte er die Achseln und ließ seine Blicke wieder nach einer andern Richtung schweifen. Ueber Theobalds Gesicht flog eine dunkle Gluth hinweg, um alsbald einer erschreckenden Blässe Platz zu machen. Mit starren Blicken verfolgte er den Reiter, bis dieser, sich aus dem Sattel schwingend, die Rathhaustreppe hinangestiegen und durch das große Portal verschwunden war; es hatte sich ein ganzer Schwarm herbeigedrängt, um ihm das Pferd zu halten. »Ja … Canaille …« murmelte Theobald und suchte sich dann ohne der Stöße zu achten, die er dabei ertheilen mußte, einen Ausweg durch das Gedränge zu bahnen.
Er schritt die Straße abwärts dem Thore zu, kaum beachtend wie zu beiden Seiten Thüren und Verkaufsbuden geschlossen waren und selbst die Fensterladen bis in die obersten Stockwerke hinauf in ihre Haken gezogen wurden. Was kümmerten ihn Angst und Furcht dieser Menschen, deren Wille von jedem Windhauche sich biegen ließ. Zu seinem bittern Unmuthe war nun noch die beschämende Vorstellung getreten, daß der Oberst glauben werde, ihn über einer Geberde ohnmächtigen Zornes ertappt zu haben, die dem Uebermüthigen erlaube, der Geringschätzung die Verachtung beizugesellen, und so bemächtigte sich seiner immer mehr jene ingrimmig verzweifelnde Stimmung, in der es kräftige Menschen drängt, unheilbringend und zerstörend in das Leben einzugreifen. »Hättest du von dieser Verschwörung gewußt,« rief es in ihm, »so wäre dir Gelegenheit geboten worden, gegen den unmenschlichen, Alles verhöhnenden Uebermuth dieser Aristokraten mannhaft anzukämpfen; sie hätten in dir wenigstens einen Gegner fürchten müssen, so lange du ihren Streichen nicht erlegen wärest; jetzt bist du ihnen nichts als ein Wurm, über den sie achtlos hinweggehen oder verächtlich die Ferse auf ihn setzen.« Er war auf die Brücke gekommen, die zum Thore führt, und beugte sich über das Geländer, um in den hochgehenden Strom hinabzuschauen. Die Wasser schossen wildfluthend heran und brachen sich aufschäumend an den mächtigen Steinpfeilern; aber die ganze Brücke war fortwährend von einem unheimlichen Schüttern durchbebt und wer über dieselbe ging, beeilte seine Schritte, als wollte er einer drohenden Gefahr entrinnen. »Einmal werdet ihr doch noch zusammenbrechen vor diesen lebendigen Schneewassern des Hochgebirges,« rief Theobald in den schäumenden Strudel hinunter – »ihr ahnt es und zittert, ihr stolzen, herzlosen Stützen des alten Bauwerkes.« – »Das solltet Ihr nicht wünschen, Herr,« sagte eine Stimme, »es will sonst aller feste Grund wanken.« Es war der Wärter am nahen Thore, der neben Theobald stand. »Uebrigens wenn Ihr noch hinaus wollt, wie ich denke,« fügte er leiser bei, »so beeilt Euch; ich erwarte jeden Augenblick den Befehl zum Thorschlusse.«
»Wie, mitten am Tage?«
Der Alte hob die Achseln ein wenig in die Höhe und sagte scheu umherblickend: »Thut wie Ihr wollt, Herr. Mancher möcht' froh sein, er wäre so nah' hier, wie Ihr's seid.«
Theobald nickte und schritt durch den hallenden Schwibbogen in's Freie. Er hatte den Thorwärter wohl verstanden; aber was lag es ihm in diesem Augenblicke daran, für einen Verschwörer angesehen zu werden? »Ja, wär' ich's,« rief er abermals laut vor sich hin, »ich weiß es, sie selbst würde mich segnen, wenn ich diese starren Bande sprengen könnte, die auch ihr Leben, ihr Wünschen und Hoffen wie zermalmende Ketten umspannen.« Er gedachte die Höhe hinanzusteigen, die sich längs dem Flusse erhebt, um, durch das stille Sommerland streifend, die Qual seiner Gedanken zur Ruhe zu bringen; aber kaum war er einige Schritte gegangen, als rascher Hufschlag hinter ihm über die Brücke herandröhnte. Es waren zwei Reiter, in deren Einem er von Weitem schon den Obersten erkannte. »Nein, der soll mich jetzt nicht sehen,« dachte Theobald in einer plötzlichen Anwandlung jenes bittern Schamgefühles, das die Scene vor dem Rathhause in ihm erweckt, »jetzt nicht; ja hätt' ich die Büchse zur Hand, die er mir heute als Dienstpfand geben gewollt!«
Kaum zehn Schritte vor ihm stand die Herberge zum Klösterli, die sich auf dem steilen Aarborde erhebt und dort hinein verschwand er, während die beiden Reiter mit verhängten Zügeln die Straße hinanjagten.
Hinter dem Hause, gegen Fluß und Stadt gewendet, lag eine stille Sommerlaube und in diese ließ sich Theobald eine Kanne Wein bringen. Es war ein Plätzlein, um die Eindrücke der letzten Stunde noch einmal in geordneten Reihen an sich vorübergehen zu lassen. Tief zu Füßen fluthete der Strom an den jäh abfallenden Felsen heran, jenseits erhob sich im Halbrunde die Stadt, aus der kein Ruf, kein Laut heraustönte, und hüben und drüben ergoß sich der üppige Sommertag. Was ging hinter jenen Mauern vor, die so schweigend, so starr und kalt in die zitternden Lüfte aufstiegen? – Vorüber, fast am äußersten Ende der langen Häuserreihe, die der Flußwindung folgend sich dahin bog, stand ein breites Haus mit hochragendem Giebel, als müßte er über alle Nachbarn weg weithin das Land überschauen. Aus der Tiefe kletterten Klebebäume an der Mauer empor, deren oberste Zweige noch ein Fenster umrankten. Dort, ja dort lag der Glückstraum seines Lebens, der einen verhüllenden Schleier über allen Schmerz vergangener Tage breitete und das Land der Zukunft in rosigem Morgenschimmer auftauchen ließ; aber er durfte die Hand nicht ausstrecken nach diesem Traume, wenn das süße Bild nicht plötzlich in schwarze Nacht versinken sollte. Und warum darfst du es nicht, Theobald, da sie dir ihre Liebe unverhüllt dargebracht, wie eine reine Opferflamme, die nur für dich angezündet wurde, nur dir leuchtet und dir einzig angehört? Was bist du dem Manne noch schuldig, der unter dem Schilde des Vaterrechtes diese duftige Blüthe zertritt, wie er auch dich, dein besseres Theil und deinen freien Willen zertreten möchte? Darfst du diesem Einzelnen gegenüber nicht das nämliche Recht dir nehmen, das sich die Verschwörer gegen den ganzen Stand, dem er angehört, zu nehmen berechtigt hielten? – Aber nein, das kannst du nicht, gab er sich selbst die Antwort, das darfst du um ihretwillen nicht, die in einem solchen Kampfe erliegen und untergehen würde, wie der stille Stern hinter den kämpfenden Wolken untergeht. O, daß mir ein freundlicher Gott einen Wink gäbe, mir einen Weg aus diesem Labyrinthe zeigte – aber es gibt keinen solchen Weg, Theobald – keinen! –
Aus solchen Gedanken, die ihn immer düsterer umspannen, wurde Theobald durch die Ankunft eines Trupps bewaffneter Männer aufgestört, die sich unter eifrigem Gespräche an die Tische vor der Laube setzten. Der Einsame erhob sich, um weiterzugehen; aber als er hinter der Laubwand hervortrat, rief eine erfreute Stimme: »Wie, Ihr seid's, Herr Theobald … dem Himmel sei Dank, ich fürchtete schon, es sei Euch ein Unglück begegnet.« Der Rufer war Niemand anders als der ehrsame Meister Hänni selbst, der bis an die Zähne bewaffnet seinem Gesellen die Hand entgegenstreckte. – »Ich habe einen Gang in's Freie gemacht, es war mir nicht mehr geheuer in der Stadt,« erwiderte Theobald, dem ein unabwehrbares Lächeln über das kriegerische Aussehen seines sonst so friedfertigen Herrn auf die Lippen stieg, »aber was wollt denn Ihr hie außen, werther Meister?«
»Daran habt Ihr wohlgethan,« sagte leise der Haarkräusler, »wollte Gott, ich wäre auch los und ledig wie Ihr, und könnte meine eigenen Wege gehen.«
»Aber was habt Ihr denn vor?«
»Sie haben da droben auf der Burgdorfer Straße den Hauptrebellen eingefangen, wißt Ihr, den kleinen Hauptmann Henzi, und den sollen wir in die Stadt führen, wenn sie ihn herabbringen.«
»Und für den einzigen kleinen Hauptmann sind Eurer so viele nothwendig, Meister?«
»Ja, wißt Ihr, Herr Theobald, Ihr habt ganz recht, es ist nicht geheuer in der Stadt,« erwiderte der Haarkräusler, ohne sich Mühe zu geben, seine Aengstlichkeit zu verbergen; »man weiß nicht, wie viele drinnen bereit sind, dem Mordbrenner davonzuhelfen.«
»Aber diese ganze Schaar da steht treu zur Obrigkeit?«
»Es sind alles redliche Burger … fleißige Handwerksleute, die ihr Brod von unsern gnädigen Herren verdienen müssen, wie ich, Herr Theobald.«
»Und wer hat den Henzi gefangen genommen?«
»Zwei Rathsherren, sagt man; meiner Treu, seht, da bringen sie ihn schon.«
Und in der That kamen den Weg herab langsam die zwei Reiter gegangen, die vor kaum einer halben Stunde vorübergaloppirt. Sie waren von den Pferden gestiegen und ließen einen kleinen, aber gewandt und kräftig aussehenden Mann zwischen ihnen hergehen, indem der Eine den blanken Degen, der Oberst eine gespannte Pistole in der Faust trug. Der Gefangene war unbewaffnet, doch hing ihm noch das leere Degengefäß zur Seite. Vor dem Wirthshause wurde Halt gemacht und die Drei traten zu der bewaffneten Schaar auf den freien Vorplatz heran.
Theobald wäre diesem Schauspiele lieber ausgewichen, aber es bot sich kein Ausweg mehr dar, und so zog er sich wieder an die Laubwand zurück, um wenigstens dem Blicke des Obersten zu entgehen. Dieser schrie den Bewaffneten zu, sich vor dem Ausgange am Hause aufzustellen und ihre Gewehre schußfertig zu halten; dann warf er sich erschöpft an einem Tische nieder und wischte sich den Schweiß von der Stirne.
»Am besten ist's nun,« sagte er zu seinem Begleiter, nachdem er ein wenig ausgeathmet, »Ihr geht mit einigen dieser braven Männer selbst nach dem Rathhause hinein, um genaue Weisung zu holen. Ich werde für unsern Hauptmann Sorge tragen, indessen … was?«
»Zu Befehl, Herr Oberst.« Der Mann steckte seinen Degen in die Scheide, nahm sich zwei der Bewaffneten zum Geleite und schritt auf die Straße hinaus.
»Ihr habt über Durst geklagt!« fuhr dann der Oberst zu seinem Gefangenen fort, indem er eine der aufgestellten Flaschen ergriff und ein Glas einschenkte, »da trinkt; war wohl eine heiße Jagd … nicht?«
Der Hauptmann nahm das Glas, um dasselbe mit einer leichten Verbeugung gegen den Spender auf einen Zug leerzutrinken.
»Noch Eins?« rief der Oberst, wie es schien belustigt von diesem Anblicke; »einen guten Zug habt Ihr, Hauptmann, wahr ist es.«
»Ich dank' Euch.«
Der Gefangene wendete sein Gesicht, ohne sich von der Stelle zu rühren, der Stadt zu und Theobald konnte nun aus seinem Verstecke hervor bemerken, wie seine klugen braunen Augen mit forschenden Blicken an den Häuserreihen auf und nieder gingen; den Fluß abwärts blieben sie an der Stadtmauer haften, die dort wohl eine Viertelstunde entfernt in einem Thurme endigt, der fast in seinem ganzen Umfange vom Wasser umspühlt wird. Es waren daselbst mehrere Personen zu erkennen, die außerhalb der Mauer am Flusse standen, vielleicht Fischer oder auch Leute, die zur Thurmwache aufgestellt waren, denn sie blieben unbeweglich an ihrer Stelle stehen. Der Oberst trank nun selbst mit sichtlichem Behagen einen Becher und rief dabei den wachehaltenden Männern unten zu, sie sollten sich ihre Mühe nicht verdrießen lassen; sei die Geschichte einmal vorbei, so würden zum guten Schlusse wohl ein paar der großen Stückfässer im Rathhauskeller angestochen werden. Der Gefangene nickte leise mit dem Kopfe, als wär' er einverstanden mit dieser fröhlichen Aussicht, während Theobald fast zornig in sich hineinrief: »Warum holst du dir den letzten Trunk nicht drunten im Strome? Ein Sprung, und du bist der Quälerei der Menschen entronnen!«
»Noch ein Glas, Herr Oberst, wenn ich bitten darf,« sagte der Hauptmann.
»Ha, hab's gedacht,« rief der Alte, »noch zwei, wenn's Euch schmeckt.« Der Gefangene legte seinen Hut, den er bisher unter dem linken Arme gehalten, auf den Tisch, trank das große Glas wieder bis zur Neige und beugte sich dann vorwärts, als wollte er's sorgsam niederstellen; aber der Becher klirrte auf den Boden und der Mann schoß wie ein aufschnellender Federball über den steilen Flußrand in die Fluthen hinunter. Ein Schrei der Ueberraschung und Bestürzung erfolgte, es knallte ein Schuß; aber mit bebender Hand schleuderte der Oberst die rauchende Pistole über den Felsenrand dem verwegenen Flüchtlinge nach.
Theobald stürzte aus seinem Verstecke hervor mit den Andern der Stelle zu, von welcher der Gefangene verschwunden war. Die Wasser waren in Folge eines warmen Föhnes, der im Gebirge geherrscht, hoch angeschwollen und trüb gefärbt, mit Reisig und mancherlei Treibholz bedeckt; von dem Hauptmanne war nichts mehr zu entdecken – die wilde Fluth schien ihn augenblicklich in die Tiefe gezogen zu haben.
Der Oberst stand starr, mit vorgestreckten Händen über den Abhang gebeugt, und hätte nicht sein unstäter, verzweifelnder Blick das Leben verrathen, das in ihm kochte, würde man ihn für eine graue Steinsäule haben halten können. Theobald erhob unwillkürlich den Finger und deutete auf einen dunkeln Fleck, der sich schon ziemlich entfernt in stetiger Richtung der Brücke zubewegte. »Er ist's, er schwimmt,« schrie der Oberst aus seiner Erstarrung emporfahrend; »he, wer kann schwimmen von euch … wer wagt sich dran? Hölle und Teufel, daß ich im Wasser sinke wie ein Mühlenstein!«
»Und dort am untern Ende der Stadt scheinen ihn gute Freunde zu erwarten, wenn ihm die Kräfte so weit reichen,« rief Theobald, dem ein wildverworrener Sturm von Schadenfreude, Mitleid, Furcht und hoffendem Muthe das Herz erfaßte; »er hat den Brückenpfeiler glücklich ausgewichen.«
Der Oberst heftete sein Auge auf die Gruppe, die weit unten am Mauerthurm in Bewegung gerathen, mit einem rothen flatternden Tuche auf den Fluß hinauswinkte. Er schien mit einem Blick den weiten Umweg zu bemessen, der über die Brücke in fast stundenweitem Umkreise die Stadt hinan zu dieser Stelle führte; dann wendete er sich mit bebenden Lippen an seine Umgebung zurück. »Ist Keiner unter euch,« rief er mit dumpfer Stimme, »der sich dran wagt, meine Ehre – eure Ehre zu retten – was? Zwanzigtausend Kronen für den Gefangenen – mein ganzes Vermögen – Hab und Gut – Keiner?« –
Nein, es regte sich Keiner; die Männer blickten einander mit ängstlichen Geberden an oder schauten dumpf in die treibenden Wogen hinaus.
»Und Ihr da, Meyer!« sagte der Oberst leiser, »wie?«
Theobalds Gesicht war plötzlich bleich und fahl geworden, wie dasjenige des alten Mannes selbst, und nur aus seinen Augen brach eine dunkle brennende Gluth hervor. »Ja, ich will mein Leben für Eure Ehre wagen,« rief er, »nicht um Eure Goldkronen; aber gegen das Versprechen, Euerm Kinde, Eurer Tochter den freien, ungehemmten Willen zu lassen!«
Der Oberst blickte mit großen, erstaunten Augen auf und sagte langsam, als müßte er sich über seine Worte besinnen oder als traute er dem gesunden Verstande des jungen Mannes nicht mehr: »Versteht sich, den ungehemmten Willen soll meine Jule schon haben und Ihr die versprochenen Kronen obendrein, Meyer.«
»Wohlan denn … gedenkt Eures Wortes,« rief Theobald das Oberkleid von den Schultern streifend und einen Blick den Fluß hinabwerfend, wo der Flüchtling bereits die Brücke hinter sich gelassen; »bleib ich unten, so bringt Julien meinen letzten Gruß, Herr Oberst.«
Dieser streckte plötzlich die Hand aus, als ob er den Sprungfertigen noch zurückhalten wolle, nicht aus Mitleid und Besorgniß, denn es ging ein grimmiges Zucken und Beben über sein Gesicht, da er wohl erst mit dem letzten Worte Theobalds den vollen Sinn und die Tragweite seines Versprechens erfaßt haben mochte; aber er kam zu spät und es achtete seiner auch Niemand in dem Augenblicke, wo die trüben Fluthen bereits über dem kühnen Schwimmer zusammenschlugen.
Aber nicht lange bedeckten sie ihn; nach einer kurzen ängstlichen Pause tauchte er zur nämlichen Stelle, auf der er niedergesunken, wieder empor und glitt dann flußabwärts, wie ein schlanker Kahn, der mühelos gerudert wird.
Schon bei einbrechendem Abend war die ganze Stadt in ein buntes Kriegslager verwandelt. An allen vier Thoren, vor dem Zeughause und an der Kreuzgasse gegenüber dem Rathhause standen zahlreiche und regelmäßig sich ablösende Wachtposten, während ebenso zahlreiche Streifpatrouillen da und dort ein Haus umzingelten oder einen Gefangenen durch die Straßen führten. Die Verschwörung war vollständig und widerstandslos niedergeschlagen. So lange das Haupt und die Seele derselben, Herr Hauptmann Henzi, nicht in festem Gewahrsam gewesen, hatte das Zünglein der Waage in bedenklicher Weise geschwankt und manche vornehme Rathsherrenfrau stand am Mittage am Kochherde, nicht um ein fröhliches Mahl, sondern um große Töpfe siedenden Wassers zu rüsten, mit dem sie die befürchteten Angreifer ihres Hauses von den Fenstern herab zu begrüßen gedachte. Die Masse der mindern Burger und Einsassen hatte um diese Zeit eine Haltung angenommen, die solche Vorkehren nur zu sehr rechtfertigte; wußte man doch, daß das Aarbergerthor und die ganze befestigte Mauerlinie bis zum Thurme an der Aare hinab sich in Händen der Verschwörer befand mit all' den Waffenvorräthen, die dort aufbewahrt lagen.
Aber als Nachmittags die Kunde durch die Stadt flog, der Hauptmann Henzi sei bei einem verzweifelten Fluchtversuche und erst nach grimmigem Kampfe mitten in der Aare von dem Haarkräuslergesellen des Meisters Hänni festgenommen worden, da hatte sich die Lage mit einem Schlage gewendet. Die Straßen bedeckten sich plötzlich wie auf ein gegebenes Zeichen mit bewaffneten Schaaren, die nach dem Rathhause zogen, um sich dort unter die Befehle der Baretliherren zu stellen, und in kaum zwei Stunden stand die Stadt gerüstet, wie in den Nothtagen langvergangener Heldenzeit. Bald jedoch mußte die Einsicht die Oberhand gewinnen, daß nun selbst diese Rüstungen überflüssig geworden. Vom Lande her, von dem man befürchtet, daß es mit der Verschwörung im Bunde stehe, kamen alle ausgeschickten Kundschafter mit der Botschaft zurück, daß die Bevölkerung weit und breit sich wie ein Mann erhebe, um dem Regimente der gnädigen Herren und Obern zu Hülfe zu eilen, und in der Stadt waren ja die Verschwörer gefangen oder von ihren eigenen Freunden verrathen und im Stiche gelassen. So kam es denn, daß die ganze Waffenerhebung bald ein mehr heiteres und lebenslustiges, als Gefahr und Tod drohendes Aussehen gewann, wie ja der Mensch stets nach kaum überstandener Noth wieder am eifrigsten dem frohen Genusse seines Daseins nachjagen mag. Und für diesen Genuß wurde reichliche Vorsorge getroffen. Neben jedem Standposten, an den Thoren, am Zeughause und an der Kreuzgasse lag ein mächtiges Weinfaß, das seit einem halben Jahrhundert heute zum erstenmale wieder die feuchte Nacht des Rathhauskellers mit dem milden Tageslichte vertauscht, und vor all' jenen Häusern, die am Morgen mit den verhängnißvollen Kreuzen bezeichnet gewesen, standen nun lange Tische mit leckeren Speisen bedeckt. Daran saßen die vornehmsten und holdesten Frauen, um mit eigener Hand die vorüberziehenden Patrouillen zu bedienen und neugierig mit ihnen über die Vorgänge des Tages zu discuriren.
Eine Hauptrolle spielte, wie leicht zu begreifen, in all' diesen Gesprächen der muthige Haarkräuslergeselle Theobald, und wieder flog sein Name von Mund zu Mund, wie am ersten Tage seiner Ankunft in der Stadt. Und wie damals rankten sich auch heute seltsame, für Viele fast unglaubliche Gerüchte an ihm empor, während Manches, um das einst Meister Bölzlein verspottet worden, nun plötzlich wieder neue Glaubwürdigkeit gewann. Daß der Haarkräusler den durch seine gewandte Körperkraft und Verwegenheit bekannten Rebellenhäuptling mitten in dem reißenden Flusse überwältigt, ohne der Kugeln zu achten, die von dem schon nahen untern Aarthurm ihm entgegenpfiffen, konnte man noch begreiflich finden, obwohl es von Tausenden keinem Zweiten gelungen sein möchte, blos mit einem Arme die wilden Strudel zu durchrudern, und mit der andern Hand den sich sträubenden Gegner festzuhalten; fast übermenschlicher Kraft und Gewandtheit bedurfte es dazu. Aber unbegreiflicher lautete doch etwas Anderes, was namentlich der Meister Hänni mit ebenso geheimnißvollem Gesichte als hohem Selbstgefühl Jedem erzählte, der ihn anhören mochte. Und es hörten ihm Viele zu, Manche drei, vier Mal, gleichsam als könnten sie das Unglaubliche durch ein öfteres Wiederholen ihrem Begriffsvermögen gewöhnlicher und zugänglicher machen. Als nämlich der Theobald mit seinem Gefangenen an's Ufer gestiegen, habe der Oberst ihn alsogleich ein wenig beiseits gezogen und mit einem Gesichte, aus dem in jeder Miene ängstliche Erwartung gesprochen, gefragt: ob er nun seine Tochter nicht sogleich zur Gemahlin begehre? – Darauf aber habe der Theobald sich noch erst eine Weile besonnen und dann erwidert: je nachdem; darüber müsse das Fräulein befragt werden; begehre sie ihn, so werde er nicht Nein sagen.
Diese Geschichte nun würde unbedingt und ohne Besinnen in's Gebiet der Fabel verwiesen worden sein, wären nicht so viele unbetheiligte Zeugen zu ihrer Bestätigung vorhanden gewesen. Wer den Obersten genauer kannte, war wohl überzeugt, daß er sich selbst in die Aare gestürzt oder sich eine Kugel durch den Kopf gejagt hätte, wenn der seiner Obhut anvertraute Gefangene entwischt wäre; aber daß der standes- und geschlechtsstolze Patrizier einem Haarkräuslergesellen seine einzige Tochter anerboten hätte – nimmermehr; da mußten noch verborgene Gründe obwalten und am Ende war doch etwas Wahres gewesen an den frühern Prinzen-Gerüchten. Drum auch mochte, besser unterrichtet als Andere, der Oberst gleich anfangs für den Fremden bei der Polizei Fürsprache eingelegt haben, wie nun mit einem Male ruchbar wurde. Immerhin, schlossen die Männer diese Gespräche, auch ein Prinz hätte sich der holden Julie nicht zu schämen, und die Frauen meinten unverholen, einen schönern Gemahl würde sie nie finden können, ob Prinz oder Haarkräusler.
Während Theobald auf solche Weise gefeiert und glücklich gepriesen wurde, saß er selbst in banger Unruhe auf seinem einsamen Kämmerlein, mit dem unabwehrbaren Zweifel ringend, ob er seine That nicht mehr zu bereuen, als sich derselben zu freuen habe. Das Letztere einmal mochte ihm nicht gelingen, wie sehr er auch sich Mühe gab, die dunkel heranziehenden Schatten wegzuscheuchen. War es ihm ja doch kaum möglich, klar zu werden, was ihn eigentlich zu der That bewogen hatte, da der Augenblick, in dem er den Entschluß gefaßt und die Ausführung begonnen, wie ein dumpfer, verworrener Traum hinter ihm lag. War es am Ende nicht blos das schadenfrohe Verlangen, den Uebermuth des Aristokraten zu demüthigen und seinen Stolz zu brechen? – »Nein, das war es nicht, Theobald,« rief er aus seinem Sinnen sich erhebend, »zur Befriedigung eines kleinen Rachegelüstes wärest du nicht fähig, die Noth eines alten Mannes zu benützen; gewiß nicht. Nein, es war vielmehr das Mitleid mit seiner hülflosen Verzweiflung, es war deine unnennbare hoffnungslose Liebe zu Julien, die dich trieb, und nichts Anderes.« – »Aber,« fuhr er nach einer Weile fort, »bist du auch wahr gegen dich selbst? Du wußtest ja, daß ihre Liebe dir voll und ganz angehört; sie hat dir dieselbe aus freien Stücken entgegengebracht und mit dem starken Muthe des Entsagens eingestanden, während du … was Theobald? … während du, um ihres blos äußerlichen Besitzes willen, einen Mann, der dir in deinem ganzen Leben kein Leid's gethan, der mit Muth und Entschlossenheit für seine Meinungen eingestanden, dem Henker überliefert hast! … wird dieser Gedanke nicht stets sich wie ein gespenstischer Schatten zwischen dich und dein Glück, zwischen deine Liebe und Julie stellen? … Ah, Theobald, als du in jener Unglücksstunde deinen Freund und Wohlthäter erstochen, konntest du den Allwissenden zum Zeugen anrufen, daß keine Absicht, daß nur ein unglückseliger Zufall deine Hand geführt, und doch legte sich diese That wie ein Fluch auf dein Leben, um dich aus den Bahnen, die dir so freundlich geebnet waren, gleich einem wesenlosen Schemen hinwegzuschleudern. Und jetzt? …«
Von unendlicher Bangigkeit erfüllt, mußte er sich auf sein Bett werfen, als könnte der ruhende Leib der Seele eine Stütze bieten in dem Kampfe gegen die dunkeln Ahnungen, die sie bestürmten; aber es mochte ihm wenig helfen, daß er sich zu überreden suchte, der Flüchtling würde ja schon in den Fluthen der Aare seinen Tod gefunden haben, oder er gehe nun nur dem Loose entgegen, das er selbst Andern zu bereiten gedacht; immer wieder stand plötzlich das edle, mehr von Wehmuth als Zorn erfüllte Antlitz vor ihm, mit dem der Hauptmann sich mühsam aus den Wellen hebend ihm zugerufen: »Was willst du mir anhaben, fremder Mann? Willst du kein Scherge menschlicher Ungerechtigkeit sein, so überlasse mich dem Beschlusse des ewigen Richters!« – »Hättest du es gethan!« sprach es in Theobald, während sich zugleich ein anderes Bild vor sein inneres Auge drängte, das ihm mit unheimlich leuchtenden Blicken und krampfhaft zuckenden Zügen entgegenschaute. Es war das Gesicht des Obersten, als dieser ihn, fast ohne sich um den zurückgebrachten, halbbewußtlosen Gefangenen zu kümmern, mit der Frage auf die Seite zog: wie die Bedingung, unter der er das Wagstück unternommen, eigentlich zu verstehen sei? – Theobald gab offenen Bescheid, aber er sah auch, wie der Vater Juliens sich erst zusammenbog, und dann wieder sich langsam emporrichtete, bevor er zur Antwort kam. »Ich hab' Ihn vorhin nicht recht verstanden,« hatte drauf der Oberst gesagt, »doch mein Versprechen hat Er, und es soll gehalten werden. Will die Jule seine Frau werden, soll Er Bericht haben; nachfragen wird Er nicht, Meyer … was? …« –
Der dumpfe bebende Ton, mit dem diese Worte gesprochen waren, klang in den Ohren Theobalds in anderer Weise nach, als in denjenigen seines Meisters, und zur Erinnerung an denselben gesellte sich nun auch noch der qualvolle Gedanke, daß er das heiligste Herzensgeheimniß Juliens verrathen und sie dadurch vielleicht unsäglichem Leide preisgegeben habe; zwar nahte sich wohl die süßflüsternde Hoffnung, sie werde in ihrer Liebe die Kraft gewinnen, den Kampf um einen glückverheißenden Sieg zu bestehen, aber auch dieser Trost vermochte den an Leib und Seele Erschöpften nicht mehr aufzurichten und als ihm endlich der Schlaf die Augen schloß, brachte selbst dieser milde Besänftiger aller Qualen nur bange, unheilschwangere Träume mit. –
Gleichwohl stand die Sonne schon hoch über den benachbarten Giebeln der Stadt, als Theobald durch ein Pochen an seiner Thüre geweckt wurde. Es war der Meister Hänni, der, in der einen Hand einen mächtigen Blumenstrauß, in der andern ein versiegeltes Papier haltend, unter feierlichen Bücklingen in die Kammer seines Gesellen trat. An der Thüre blieb er stehen und schien mit verlegenen Blicken das geringe Geräthe und die mit einer vergilbten Tapete bekleideten Wände des Gemaches zu mustern, bevor er zu Worten kommen konnte; aber auch als er zu sprechen anfing, schwankte seine sonst so geläufige Zunge, als ob sie sich fürchtete, den richtigen Ausdruck zu verfehlen. »Ich möchte Euch um die Ehre bitten, Herr … Herr,« sagte er, »für die Zeit, die Ihr noch etwa in meinem Hause verweilet, die grüne Stube im ersten Stockwerke zu beziehen; es ist die beste, die ich Euch anbieten kann.«
»Was gibt es, Meister,« rief Theobald den Mann, der ihm in seiner feierlichen Unbehülflichkeit wie eine Fortsetzung der kaum verscheuchten Traumbilder erschien, verwundert anblickend; »ich muß mich wohl verschlafen haben.«
»Bitt' um Verzeihung, daß ich Euch gestört habe,« erwiderte der Meister; »das Frühstück hätte wohl noch warten mögen; aber hier schickt Euch meine Frau diese Blumen zum Glückwunsche und da ist ein Brief für Euch … Herr …«
»Ein Brief … wer hat ihn gebracht?«
»Der schwarze Jakob, wißt Ihr, der Reitknecht des gnädigen Herrn, des Obersten; ich dachte, es werde Eile haben … gute Botschaft kommt nie zu früh.«
»Ich danke Euch, Meister,« erwiderte Theobald leise, »und werde bald hinunterkommen.«
Der Brief zitterte in seiner Hand, als er die starren, wie mit einem Degenknaufe geschriebenen Buchstaben der Aufschrift betrachtete, und vor seinen Augen zog ein schattenhaftes Flimmern beim Anblicke des großen Familiensiegels; er meinte, ein höhnisches, drohendes Gesicht hinter dem geschlossenen Helmvisire, mit dem das Wappen gekrönt war, hervorstarren zu sehen. Er wendete das Papier einige Male hin und her, indem er vor sich hin murmelte: »Dein Richterspruch, Theobald … Tod oder Leben, Seligkeit oder Verdammniß; gleichviel. Du mußt dein Geschick kennen lernen.«
Als er das Siegel mit einem raschen Zuge losgelöst und seine Blicke die ersten Zeilen überflogen hatten, sprang er empor, um wie ein Trunkener durch das Gemach zu schwanken. Dabei preßte er das Blatt gegen seine Brust und rief mit zitternder Stimme: »O Julia, vergib mir, daß ich einen Augenblick an dem Starkmuthe deiner Liebe zweifeln konnte … du Herrliche, du Hochherzige, der mein Leben und Sterben, mein letzter Athemzug gehören soll.«
Er warf sich wieder auf einen Stuhl und drückte beide Hände auf die Augen, als wären sie, von einem plötzlichen Glanze geblendet, nicht mehr im Stande, das helle Tageslicht zu ertragen.
So saß er lange vor sich hingebeugt, ehe er wagte, den Brief zu Ende zu lesen. Und er that wohl daran, diesen Augenblick des reinen, unvergällten Glückes in seiner ganzen Seligkeit durchzukosten, bevor er dem Zweifel gestattete, einen Schatten über das rosige Morgenland seiner Hoffnungen auszugießen; denn ach, wie wenige Augenblicke ungetrübten Glückes zählt das Menschenleben, dieser seltsame Traum des Daseins, der mit einer Klage beginnt, um mit einem Seufzer zu Ende zu gehen! – Theobald mußte diesem unabänderlichen Geschicke sich ebenfalls unterwerfen, als er endlich das Blatt wieder vor die Augen hob, so wenige Worte außer den schon gelesenen dasselbe auch enthalten mochte. – »Es hat seine Richtigkeit,« schrieb der Oberst, »meine Jule hat mir Alles eingestanden, sie will Ihn zum Manne haben. Mein Wort hat Er auch, Meyer, und so soll die Hochzeit vor sich gehen, sobald die Rebellengeschichte abgethan. Tag und Stunde werden Ihm angezeigt; vorher hat Er sich um nichts zu bekümmern, ich werde die Sache besorgen, wie sich's gebührt.« Der Leser hielt wieder inne und legte erbleichend die Stirn in seine Hand. Es war nicht der stolze, barsche Ton, mit dem ihm der künftige Schwiegervater sein Lebensglück gleichsam vor die Füße warf, was ihn erschütterte; wußte er doch, daß der Mann einen edlern Kern in sich barg, als die rauhe Schale auf den ersten Anblick vermuthen ließ; es war auch nicht die deutliche Weisung, Julien vor dem Hochzeitstage nicht mehr sehen zu dürfen, gehörte eine solche Einschränkung ja sogar zu der wunderlichen Standesetikette; aber ein einziges Wort, das ein vorauseilender Blick aus der nächsten Zeile aufgefangen, hatte ihm einen Augenblick den Muth benommen zum Weiterlesen. Doch auch dieser bitterste Tropfen mußte gekostet werden. »Beiliegend eine Anweisung auf die zwanzigtausend Kronen,« lautete der Schluß, »die Ihm mein Geldwechsler sogleich ausbezahlen wird. Er mag sich daraus gebührlich ausstaffiren auf den Hochzeitstag. Bis dahin sein wohl affektionirter etc.«
Theobalds Augen blieben eine Weile starr, wie festgebannt auf dieser Stelle haften, während nur ein leises, bitteres Zittern sich um seinen Mund bewegte; aber als er endlich, das Papier wieder zusammenfaltend, sich erhob, war auch dieses verschwunden und ruhigen Schrittes ging er der Thüre zu.
Er stieg die Treppen hinunter, ohne bei seinem harrenden Meister anzuklopfen, und auch auf der Straße schritt er fürbaß, so wenig auf manchen ehrerbietigen Gruß achtend, als die Gruppen bemerkend, die flüsternd zusammenstanden, um ihm nachzuschauen. Er sah und dachte an nichts anderes, als wie er dem Obersten, ohne absichtlich zu verletzen, doch mit unverhohlener Festhaltung seines eigenen Selbstgefühles, das Blutgeld zurückzugeben habe, das er nie verlangt und um das er nicht gedient hatte. »Ja, das Blutgeld,« sagte er laut, als er sich dem väterlichen Hause Juliens nahte, »und es ist jetzt auch deine Pflicht, Theobald, dem alten Manne deutlich zu machen, wie sehr er sein eigenes Fleisch und Blut durch eine solche beabsichtigte Mitgift selbst geschändet habe! Nein, nein, du hochfahrender Aristokrat, du sollst wissen, wo deinem menschenverachtenden Stolze eine Grenze gezogen sein muß, mag kommen darüber was da will!«
Unter solchen Gedanken ließ er den schweren Messinghammer auf die Thüre fallen; aber zu seiner Verwunderung mußte er zwei-, dreimal pochen, bis sich langsam stolpernde Schritte die Treppe herab hören ließen. Theobald kannte den Alten wohl, es war ein Invalide, der im Dienste des Obersten zum Krüppel geschossen, nun das Gnadenbrod des Hauses aß und dessen Hauptgeschäft sonst freilich in der jetzt arg vernachlässigten Thürhut bestand. »Bomben und Feldschlacht, Ihr seid es?« rief der Stelzfuß sich vor dem Ankömmling augenblicklich in militärische Positur werfend und dann mit erhobener Hand steif wie eine Salzsäule stehen bleibend; »Ihr habt die Ordre verpaßt, gnädiger Herr … ich auch, halten zu Gnaden … der Oberst ist wohl schon zwei Stunden abgereist mit dem Fräulein.«
»Abgereist mit dem Fräulein?« rief Theobald, »und wohin denn Christian?«
»Halten zu Gnaden,« erwiderte der Alte, »werden das besser wissen, als ich.«
»Kein Wort weiß ich.«
»Schock Granaten,« schrie der Alte mit einer Stimme, die derjenigen des Obersten nachgebildet war, wie ein Ei dem andern; »hat Euch denn der Schlingel, der schwarze Jakob, den Brief meiner Herrschaft nicht gebracht, gnädiger Herr?«
»Einen Brief hab' ich wohl erhalten, ja.«
»Na, dann haltet mich alten Mann nicht zum Besten, gnädiger Herr … darin muß es ja gestanden haben.«
Theobald schaute den Alten schweigend an, während der Verdacht in ihm aufstieg, dieser habe Weisungen holen müssen, bevor er die Thüre geöffnet, und daher auch möchte die Zögerung entstanden sein. Dieser Gedanke trieb ihm das Blut wie einen brausenden Gluthstrom nach dem Gesichte und schon streckte er die Hand aus, um sich im Hause selbst darüber Gewißheit zu verschaffen, als die Straße herauf scharfer Hufschlag erklang. Es war der Reitknecht des Obersten, der augenblicklich von einem schweißtriefenden Pferde sprang.
»He, Jakob,« rief der Alte vor die Thüre stelzend, »gut daß du da bist … sollst gleich Bericht geben dem gnädigen Herrn; wo hast du …«
»Wird ohne deinen Befehl geschehen,« erwiderte der Reitknecht mürrisch; wendete sich dann aber sogleich die Mütze ziehend gegen Theobald und sagte ehrerbietig: »der Oberst hat mir noch befohlen, Euch in seinem Namen zu vermelden, es würd' ihm eine Ehre sein, wenn Ihr während seiner Abwesenheit zu Euern Spazierritten über seine Pferde verfügen wolltet … Steh' also jeden Augenblick zu Befehl, Junker.«
Wie vorhin den thürhütenden Stelzfuß, blickte nun Theobald mit schweigender Betroffenheit den Reitknecht an, der in steifer Ehrerbietigkeit vor ihm stehen blieb und endlich sagte: »Wenn Ihr meine Thiere, die Pferde meiner Herrschaft, noch nicht kennt, so befehlt nur, was Ihr gerne reitet, Junker; ich denke die braune Leda, ungarische Zucht und reine Race, prächtiges Feuer … das möcht' Euch gerade behagen, gnädiger Herr. Oder auch …«
»Laßt nur,« erwiderte Theobald, »heute wenigstens werd' ich nicht reiten. Ihr habt die Herrschaft begleitet, Jakob?«
»Bis gegen Münsingen hinauf, etwa zwei Stunden weit, Junker.«
»Und sie werden lange fortbleiben?«
Der Reitknecht schaute verwundert auf. »Kann nicht dienen, Junker, vielleicht vierzehn Tage, drei Wochen … hat mir Mädeli gesagt.«
»Ein Landaufenthalt also!«
»Ohne Zweifel, Junker, wie Euch wohl bekannt sein wird.«
»Gut, Jakob,« sagte Theobald, dem die Reden und das ehrerbietige Thun dieser Leute, die bisher Tag um Tag achtlos an ihm vorbeigegangen, wie ein neckischer, verwirrender Traum vorkam. »Ihr könnt etwa morgen nachfragen … vielleicht reiten wir dann.«
»Zu Befehl, Junker.«
Theobald kehrte sich langsam ab und wollte gehen; aber der Stelzfuß, der indeß schweigend bei Seite gestanden, legte wieder die Hand an seinen Dreieckhut und rief mit kräftiger Stimme: »Halten zu Gnaden, bin länger im Dienst als der Schwarze da und kenn' die Parole. Der gnädige Herr woll' uns fortan tituliren, wie es gegen geringe Dienstleute bräuchlich ist; alle Wetter … geht nicht mehr anders.« – »Ich versteh' Euch nicht, Christian,« sagte Theobald. – »Granaten … gnädiger Herr,« schrie der Alte, »nehmt's mir altem Soldaten nicht übel; ein Er bin ich, nichts weiter, der Schwarze da auch. Alle Wetter, der Oberst würd' uns, wenn er's hörte. Für mein zu spät kommen an der Thür hab' ich schon Pardon verlangt … dacht' nicht, daß Ihr oder sonst Jemand Wichtiges käm', gnädiger Herr, und hatt' mich ein wenig auf's Faulbett gelegt.«
»Schon recht Christian …, beruhige Er sich darüber.«
»So gilt's, dank' Euch,« rief der Alte mit seinem Stelzbeine auf das Pflaster stampfend; »aber noch Eines,« fügte er leiser hinzu, »seine Ehre hat unser Eins bei Alledem und drum würd's mich alten Burschen freuen, wenn Ihr nun das Geheimthun ließet, gnädiger Herr; hilft doch nichts mehr.«
»Geheimthun, Christian?«
»Na, zu Gnaden halten, gnädiger Herr,« erwiderte der Alte mit treuherzigem Gesichte, »wißt, bin ein alter Soldat und hab' meine Kompliment vom Korporal gelernt, bis ich selbst ein solcher Schwernöther geworden; bin aber auch da nicht viel weiter gekommen, gnädiger Herr. Freut mich nur, daß ich sowas noch erleben konnt', in diesem Hause. Ist doch ein gar zu gutes, prächtiges Frauenbild, unser Fräulein.«
Theobald, der kaum wußte, was er that und wie ihm geschah, warf nochmals einen langen fragenden Blick auf die beiden Männer, die ihm ehrerbietig ihre Grüße boten, und begann dann wieder die Straße aufwärts zu gehen. Dabei zog er unwillkürlich den Hut tief über die Augen herab, als ob er von der ganzen Welt nichts sehen oder sich vor ihr verbergen möchte, während ein verworrenes Heer von Gedanken wie ein lärmender, bald höhnender, bald freundlich lachender Maskenzug an ihm vorüberstürmte. Was sollte das zu bedeuten haben? wagte man ein freches Spiel mit ihm zu treiben oder war es wohlgemeinter Ernst, dessen Absicht er noch nicht begreifen konnte? – Der Oberst hatte ihm seine Tochter zugesagt in jenem barschen Tone, den er gegen geringe Leute oder Untergebene zu gebrauchen pflegte; aber diese Untergebenen selbst richteten in seinem Namen Aufträge aus mit einer Ehrerbietung, die sie nur ihrer Herrschaft zu erweisen gewohnt waren und auch blos von dieser empfangen haben konnten. Braut und künftiger Schwiegervater verschwanden, ohne dem Bräutigam eine Spur ihrer Wege zurückzulassen und doch war es offenbar, daß sie selbst vor ihren Dienstboten kein Geheimniß gemacht aus dem neu entstandenen Verhältnisse, ja daß eine solche Geheimhaltung überhaupt nicht in der Absicht des Obersten lag, sonst würde er seine Pferde schwerlich zu offenem Gebrauche anerboten haben. Und was meinte der Stelzfuß mit dem Geheimthun, wo kein Geheimniß mehr zu bewahren war? – Theobald legte bei dieser Selbstfrage die Hand auf die Stirne, während die Lippen ein bitteres Lächeln umkräuselte. Er erinnerte sich des müßigen Klatsches, der ihn in den ersten Tagen seiner Herkunft verfolgt, und wie eine eiskalte Hand griff der Gedanke an sein Herz, daß nun die Farce zu seiner blutigen Verspottung fortgespielt werden möchte; doch nein, beruhigte er sich alsbald wieder, dazu haben die beiden Bursche da drunten zu unbefangen, zu ehrerbietig sich benommen; das könnte ja dem Vater auch nichts nützen, ohne seine Tochter selbst dem nämlichen Spotte preiszugeben – jetzt nicht mehr, nachdem es so weit gekommen. Ach Julia, warum kein Wort, keinen Blick von dir! –
Als Theobald zu Hause angelangt, wieder nach seinem Gemache hinaufsteigen wollte, trat ihm oben an der ersten Treppe die höfliche Meisterfrau entgegen, die ihn unter Erröthen und Knixen zur offen stehenden »grünen Stube« führte. Es war das Prunk- und Paradegemach des Haarkräuslers und nun recht freundlich mit frischen Blumen ausgeschmückt. »Ich hab's wohl gedacht, mein Mann werde sich ungeschickt benommen haben, heut' früh,« sagte die Meisterin lächelnd und nicht ohne deutliche Befriedigung auf die eben vollendeten Anordnungen ihres Haustempels blickend, »aber Ihr müßt ihm verzeihen, Junker Theobald, wer konnte das wissen, da Ihr immer geheim gethan habt uns geringen Leuten gegenüber. Freilich, freilich, mir hat immer was schwanen wollen, wenn ich Euch ansah, wie gar herrlich und schön Ihr seid, stattlicher, wie gar keiner unserer gnädigen Herrn; gewiß, gewiß, werthester Junker.«
»Abermals und auch hier,« rief Theobald, den über der fortwährend knixenden Beredtsamkeit seiner sonst nicht eben herablassenden Hauswirthin eine unwillkürliche Lachlust anwandelte, »und habt Ihr denn nicht selbst gewußt, daß ich ein hoher Herr bin, Frau Susanne?«
»Ach, gnädiger Herr,« erwiderte die Meisterin mit feinem Lächeln, »des Bölzleins und seines Geredes wegen hätt' ich's freilich nie geglaubt, obschon der Himmel wissen mag, wie er's am ersten Tage erfahren konnte; aber Ihr wolltet es ja nicht leiden und da mußte unser Einer Respekt haben vor Euern Gründen, das gebührte sich.«
»Und jetzt Frau Susanne … woher habt Ihr bessere Kundschaft?«
»Ach, gnädiger Herr, wie Ihr noch immer zu spaßen beliebt; meint Ihr, der schwarze Jakob …«
»Der Reitknecht des Obersten, der heut' den Brief gebracht?«
»Ei, freilich, der hat kein Hehl daraus gemacht, daß der Oberst ihm selbst erzählt, wie Euer gnädiger Herr Vater, ein reicher, mächtiger Reichsherr draußen in Deutschland, einst sein Kriegskamerad gewesen und wie Ihr nur des Fräulein Julia wegen … ja, was die jungen gnädigen Herren nicht Alles ausdenken in ihrer Liebe! …«
»Gut, Frau Susanne,« sagte Theobald, sein erröthendes Gesicht abwendend, »grüßet mir den Meister; ich danke Euch für Eure Freundlichkeit.« –
Zehn Tage vergingen, nachdem Theobald sich auf das Begehren seiner Meisterleute in der grünen Stube einquartirt, bevor er wieder zum ersten Male die Schwelle derselben überschritt, um das Haus zu verlassen. – Während dieser ganzen Zeit hatte er weder von Julien, noch dem Obersten ein Lebenszeichen vernommen, obwohl der schwarze Jakob sich regelmäßig wie die Uhr jeden Morgen einstellte, um sich zu erkundigen, ob dem Junker nicht ein Ausritt beliebe. Es verursachte dem guten Burschen sichtlich schweren Kummer, jedesmal einen abschlägigen Bescheid zu erhalten, und doch trug er daran selbst die Schuld, freilich ohne eine Ahnung darüber zu haben; denn diese Schuld bestand auch nur darin, daß er auf leises Anfragen schon am ersten Morgen mit unbefangener Freudigkeit bestätigte, was die Meisterin über ihre sichere Kunde von der hohen Herkunft ihres vormaligen Gesellen ausgesagt. »Ja, ja,« hatte der ehrliche Schwarze zum Schlusse seines Berichtes gemeint, »Euer gnädiger Herr Vater muß ein trefflicher Kriegsmann gewesen sein, Junker; und unser Herr Oberst hat auch erzählt, wie oft er auf Eurem Schlosse fröhlich zu Gaste gewesen sei. Der Christian hat schon einen rechten Aerger, daß er Euch nicht gleich wiedererkannt, als Ihr in's Haus kamet, obwohl Ihr damals, als er mit unserm gnädigen Herrn in Deutschland war, noch in der Wiege werdet gelegen haben, Junker; doch des prächtigen Schlosses und der großen Jagden, welche da veranstaltet wurden, vermag er sich noch gut zu erinnern.«
Diese Entdeckung brachte auf Theobald einen eigentümlich einschüchternden Eindruck hervor, wie es sonst weder offene Gewalt noch Gefahr vermocht hätten. Wie sollte er sich wehren gegen diesen Kunstgriff des standesstolzen Aristokraten, der ein schon vorhandenes Gerede benutzte, um wenigstens vor dem großen Haufen die nicht standesgemäße Liebe und Verbindung seiner Tochter zu vertuschen? – Oft wollte es ihn sogar bedünken, als dürfe er dem alten Herrn nicht einmal grollen darüber, zumal auch Julie vor manchem schmerzlichen Pfeile des Vorurtheils dadurch geschützt werden konnte; bald aber kam er sich wieder wie ein Vertauschter vor, der mit allen Mitteln gegen einen schmählichen Verrath, den man an ihm begangen, ankämpfen müsse, nur um sich selbst zurückzugewinnen. Und gewiß war es auch blos die Befürchtung, der geliebten Dulderin, die für ihre Liebe schon so viel gewagt, vermehrtes Leid zu bereiten, was ihn abhielt, das über ihn geworfene Netz mit festem Griffe durchzureißen. »Warte zu,« suchte er sich zu beruhigen, »bis sie, fremder Gewalt entrückt, unter deinem Schutze steht, dann wirst du thun, was deine Ehre erheischt.« Ach, wie für manche Bitterkeit schloß schon der Gedanke, der Herrlichen, der Reinen bald angehören zu können, den süßesten Trost in sich.
So verbrachte Theobald die Tage auf seinem Gemache verborgen, um wenigstens nicht vor mehr Menschen als durchaus nothwendig war, durch sein zustimmendes Schweigen Theilnehmer an dem betrüglichen Spiele zu werden; aber das bunte militärische Treiben, das sich vom Morgen bis zum Abend unter seinen Fenstern entfaltete, ließ auch noch einen andern Gedanken nicht zur Ruhe kommen bei dem Einsamen, die Erinnerung nämlich an den unglücklichen Verschwörer, der die Ursache dieses unablässigen Trommelschlages und Pfeifenklanges geworden. Und je banger die Sehnsucht nach Julien, das Verlangen, über ihre Lage Nachricht zu erhalten, sich bei Theobald regte und je peinlicher er das Benehmen ihres Vaters empfand, um so qualvoller kam ihm auch die Ueberzeugung, daß er an dem gefangenen Hauptmanne ein schweres Unrecht begangen; denn wie manchen schmerzlichen Schlag mochte dieser von der stolzen Aristokratie empfangen haben, bevor er sein Leben zur offenen Bekämpfung derselben aufs Spiel gesetzt! – Du hast kein Recht, dich über die Unbill zu beklagen, die dir angethan wird, sprach es unablässig in ihm; du hast es an diesem Unglücklichen verdient … Scherge menschlicher Ungerechtigkeit. –
Eines Abends kam der Meister Hänni mit der Nachricht, daß der Hauptmann Henzi mit noch zwei andern Verschwörern, dem großen Stadtlieutenant Fueter und dem Kaufmanne Wernier, zum Tode verurtheilt seien und bereits morgen hingerichtet werden sollten. Obwohl dieser Ausgang von Anfang an vorauszusehen gewesen, machte die Kunde doch eine erschütternde Wirkung auf Theobald. – »Und auf die Schuld, die du an diesem Blute trägst, wirst du dein Lebensglück aufbauen,« rief er erbleichend aus; »du träumst von beseligender Liebe, während vielleicht das letzte Wort des Sterbenden deinen Namen verflucht. Suche wenigstens seine Verzeihung, da dir Anderes nicht mehr möglich ist, wenn dich nicht sein blutiger Schatten mit ewiger Reue verfolgen soll! O Julia, meine Liebe hat dich theuer erkauft!« –
Das waren die Gedanken, die Theobald nach eingebrochener Nacht seit langen Tagen wieder zum erstenmale aus dem Hause trieben. Er war entschlossen, den zum Tode Verurtheilten, den er vor jener Stunde der Gefangennahme kaum gesehen, um Verzeihung anzuflehen; aber seine Schritte wurden unsicher und schwankend, als er dem Gefangenwärter die schmalen Steintreppen des Thurmes hinan nachfolgte, und sein Herz pochte, als ginge er selbst einem hülflosen, gewaltsamen Tode entgegen.
Und leichtern Gemüthes wurde er auch nicht, als sich bei seinem Eintritte in das nur von einem trüben Lämpchen erhellte Gefängniß der Gefangene sogleich erhob, um ihm mit einem wehmüthigen Lächeln auf dem bleich gewordenen feinen Gesichte die Hand entgegenzureichen. Theobald hätte ein augenblickliches Aufflackern wilden Hasses leichter ertragen, als diese milde Ruhe, mit welcher der Gefangene sagte: »Ein unerwarteter Besuch, wahrlich; aber darum nicht weniger willkommen, mein Herr.«
»Ihr kennt mich also,« rief Theobald in der tiefsten Seele ergriffen von dem melodischen Klange dieser Stimme und den ruhigen, edlen Gesichtszügen; »wollte Gott, wir hätten uns nie gesehen vor diesem Augenblicke.«
»Wir haben unsere Bekanntschaft freilich auf seltsame Weise gemacht,« erwiderte der Gefangene, »doch wüßt' ich nicht, weshalb Ihr ein besonderes Bedauern darüber haben solltet.«
»Ich komme, um Eure Verzeihung zu erlangen. Gebt mir den Trost, daß Ihr mir keinen Haß, keinen Groll tragt über die Schuld, die ich an Euch begangen habe.«
»Haß und Groll gegen Menschen hab' ich mein Leben lang nicht gekannt; warum sollt' ich solche im Angesichte des Todes gegen Euch gefaßt haben, junger Mann? … Euch überrascht es, einen Rebellen so etwas sagen zu hören! … Und doch hab' ich nie eine andere Sprache geführt; ich hasse und verabscheue üble Gewohnheiten, Gesetze und Zustände, weil in diesen die Quellen alles Bösen liegen; aber den einzelnen Menschen, der von diesen Verhältnissen umsponnen wird, daß er selten sein besseres, eigenmenschliches Selbst zu finden vermag, den hab' ich stets nur bedauern, nur beklagen können.«
»Euer Trost trifft nicht einmal ganz zu für mich,« sagte Theobald nachdenklich; »ich habe Euch gefangen genommen und mir dadurch mittelbar eine Mitschuld an Eurem Verderben aufgebürdet, ohne durch die Macht gewohnter Verhältnisse zu der That bewogen worden zu sein. Ich habe sie ganz aus freien Stücken begangen.«
»Glaubt Ihr das?« rief der Gefangene trübe lächelnd; »wär's so, dann müßt' ich Euch beneiden um diese That, wie um ein seltenes, höchstes Lebensglück, nach dem ich stets fruchtlos und vergeblich gerungen. Aber nein, nein, Ihr täuscht Euch; der Mensch handelt nie voll und unbeirrt aus freiem Willen; denn schon in dem Augenblicke, wo dieser Wille einen Entschluß in der Seele hervorrufen will, wird er bewußt oder unbewußt durch eine Reihe von Ursachen bestimmt, die außer uns bestehen und über die wir nicht gebieten, denen wir nur gehorchen können.«
»Bis zu einem gewissen Grade muß ich Eurer Ansicht recht geben, obwohl sie von den Verkündern unbeschränkter Freiheit so wenig getheilt wird, als von den Verfechtern bevorzugter Rechte und absoluter Gewalt.«
»Und dennoch hab' ich recht, und zwar nicht blos bis zu einem gewissen Grade,« fuhr der Hauptmann eifrig fort, »da nur auf diesem Wege eine sittliche Weltordnung zu begreifen und eine gerechte Beurtheilung der Menschen möglich ist; denn eben weil die sittliche Kraft des Einzelnen, der freie Wille, nie frei und unbeirrt zu wirken vermag, hängt auch der besten That das Unvollkommene an, aus dem dann die Schuld, die Strafe, das Verhängniß entspringt. Und so liegt die Schuld meines Unterganges nicht in Euch, noch bei Jenen, die mir das Urtheil gesprochen, sondern eben in der Unvollkommenheit meiner Handlungen, die sich nach unabänderlichen Gesetzen rächen muß. Wie sollt' ich nun einem Menschen grollen, da ich weiß, daß Jedem aus der Unvollkommenheit seiner eigenen Thaten sein Verhängniß folgt, wie mir selbst? Ob sich dieses dann mehr innerlich oder äußerlich vollzieht, kann ja doch nur dem blöden Auge gedankenloser Kurzsichtigkeit einen Unterschied gewähren.«
Theobald lehnte sich von Mitleid und Bewunderung ergriffen schweigend an die Mauer zurück. Was konnte er einem Manne erwidern, der, schon auf der Schwelle der Ewigkeit stehend, das Leben mit dieser Ruhe, mit dieser Klarheit und Ergebung maß? Wie gering mußten da die eigenen Bekümmernisse erscheinen und wie verhängnißvoll trat doch auch wieder das scheinbar Geringe und Zufällige in die festgeschlossene Kette des Schicksals ein! – »Ihr habt recht,« sagte er endlich leise, »das Verhängniß entspringt dem Menschen aus der Unvollkommenheit seiner eigenen Handlungen.«
»Gewiß, gewiß,« erwiderte der Gefangene stehen bleibend, nachdem er eine Weile ebenfalls schweigend den engen Raum auf- und niedergeschritten, »und mir ist auch im Leben nichts Eitleres erschienen, als jene eigensüchtige Ueberhebung, mit der ein Mensch glaubt, dem andern Verzeihung oder Gnade gewähren zu können. Was bedeuten diese Worte in unserm stammelnden Munde, während sich die eigene Schuld wie der Schatten der ewigen Gerechtigkeit über unserm Haupte erhebt? Wer Verzeihung glaubt suchen zu sollen, sieht oder ahnt diesen Schatten und meint ihm entfliehen zu können; aber es wird ihm nicht gelingen, dem Armen, nie.«
»Und doch find' ich nicht nur Trost, sondern gewiß auch hülfreiche Kraft in der Ueberzeugung, daß Ihr ohne einen Rachegedanken gegen mich aus diesem Leben scheiden werdet;« sagte Theobald; »ist ja doch die versöhnende Liebe, die in der Verzeihung liegt, der reinste Abglanz des Göttlichen, wie es im Menschen erscheint.«
»Die Liebe, ja,« entgegnete der Hauptmann, »sie wirft ein milderndes Licht auf die starre Nothwendigkeit, aber sie vermag diese nicht aufzuheben, wie die Sonne die Gletscher unserer Gebirge nur zu vergolden, aber nicht zu schmelzen vermag … glaubt es mir, wenn Euch die Erfahrung nicht schon die Lehre gegeben. Wie müßte sie uns sonst den herbsten Schmerz dieses Daseins bereiten!« –
Den sonst so ruhigen Klang der Stimme hatte bei diesen letzten Worten ein hörbares Zittern durchklungen, als sich vor der Thüre ein Geräusch vernehmen ließ. »Mein Weib, meine arme Melanie!« rief der Hauptmann leise aus.
Theobald trat rasch hervor, um den Gefangenen in seine Arme zu schließen, während unaufhaltsame Thränen aus seinen Augen schossen. – »Ja geht,« flüsterte der Verurtheilte, die Umarmung erwidernd; »sie kennt Euch und weiß die Bitterkeit ihres Schmerzes noch nicht zu ertragen.«
»Gebt mir nochmals den Trost, edler, unglücklicher Mann, daß Ihr versöhnt von mir scheidet,« rief Theobald.
»Geht mit Gott,« antwortete der Hauptmann, »und tragt das Unvermeidliche, dem Ihr nicht entfliehen werdet, ohne Menschengroll, wie ich es trage.«
Die Beiden hielten sich noch umschlungen, als die Thüre aufging und eine schwarzgekleidete Frau, von zwei in lautes Weinen ausbrechenden Knaben gefolgt, in das Gefängniß trat. Einen Augenblick blieb sie zurückbebend stehen, die großen, dunkelglühenden Augen auf Theobald gerichtet, um sich dann mit leidenschaftlicher Geberde ihrem Manne entgegenzustürzen. – »Wer ist dieser Mensch? … wie kommt er zu dir?« rief sie die eine Hand ausstreckend. »Kennst du ihn denn nicht mehr, diesen …«
»Still, Melanie,« entgegnete der Hauptmann rasch, das schmerzvolle Weib an seine Brust ziehend und die Hand auf ihren Mund legend, »er ist ein Kind des Unglücks, wie ich, wie du es bist, Melanie.« –
Theobald stieg die Wendeltreppen des Thurmes hinab wie von einem dumpfen Traume umfangen, aus dem ihm nichts deutlich mehr entgegentrat, als die dunkelblitzenden Blicke der armen, bleichen Frau und die letzten Worte des Gefangenen: »Er ist ein Kind des Unglücks, wie ich und du, Melanie.« – Und wie plötzlich aus einem Traume geweckt schrak er auf, als ihm, zu Hause angelangt, der Meister Hänni schon auf der Treppe mit freudigem Gesichte einen Brief überreichte. – »Der schwarze Jakob hat ihn gebracht; es werde wohl eine fröhliche Botschaft sein, hat er gemeint,« sagte der Meister; »die Herrschaft sei diesen Abend wieder angelangt und auch die beiden Junker, die Söhne des Obersten, seien mitgekommen.« Theobald starrte das Blatt mit dem großen, behelmten Siegel und den feinen Schriftzeichen der Aufschrift lange an, als ob er sich nicht getraute, dasselbe für sich in Empfang zu nehmen, und winkte dann dem Meister, ihn allein zu lassen.
Es waren die leichten, wie hingehauchten Handzüge Juliens, in denen ihm sein Name entgegentrat. Er drückte das Blatt an die Lippen, legte es wieder auf den Tisch und preßte es abermals an Mund und Augen, während er schmerzlich ausrief: »O Gott, Julie, warum gerade heute, warum in dieser Stunde dieses Lebenszeichen von dir, da ich von einem Sterbenden komme! … Doch trage das Unvermeidliche in Glück und Leid, wie er es thut.«
»Mein Theobald,« schrieb Julie, »ich habe dir im Namen meines Vaters seinen Willen mitzutheilen. Morgen Mittag sollen wir durch das Wort des Priesters verbunden werden. Du kannst mir glauben, daß ich die wichtigste Stunde meines Lebens lieber an einem andern Tage gefeiert hätte; aber wir wollen uns als gehorsame Kinder erweisen, vielleicht daß wir dadurch den Segen des Himmels für unsere Liebe gewinnen mögen. Meine zwei Brüder werden dich zur feierlichen Handlung abholen. Bis in den Tod deine Julia.«
Theobald blickte unbeweglich und bleich wie eine Leiche auf diese Zeilen, bis sie in einer zitternden Thräne vor ihm zusammenschwammen; aber es waren nicht Freude oder Schmerz allein, es war ein bitterer Zorn der Seele, der diese Thränen in seine Augen trieb. – »Ja,« rief er endlich aus, »du hältst dein Wort, harter, stolzer Mann; sobald die Rebellion abgethan, sagtest du, soll ich dein Eidam werden und du glaubst, es sei dies geschehen mit den fallenden Häuptern der drei Unglücklichen. Aber hüte dich, auch du wirst dem Verhängnisse nicht entgehen, das sich an deine Thaten heftet!«
Es war eine lange, bange Nacht, die er mit schlaflosen Augen zu durchwachen hatte; aber er wehrte dem Schlafe, der sich manchmal auf die müden Lider senken wollte, als fürchte er sich vor den Träumen, die schon drohend vor dem wachen Blicke vorüberwehten. Er versenkte sich in die schmeichelnden Hoffnungen eines reichen Liebesglückes, das ihm nun doch kein Menschenwille mehr zerstören konnte, und wenn sich unheildrohende Gestalten herandrängen wollten, rief er leise aus: »Hebt euch weg von mir; der Sterbende hat mir verziehen und drum tret' ich den Lebenden ohne Furcht entgegen.« –
Aber diese mühsam ringende Zuversicht wurde bis in ihre letzten Wurzeln erschüttert, als am frühen Morgen schon die Trommeln ertönten und die kriegerischen Schaaren sich unter Theobalds Fenstern zu einem langen Zuge nach dem Gefängnißthurme zusammenordneten. Die Trommeln verhallten allmälig in der Ferne, aber dafür erhob sich der melancholische Klang eines Glöckleins, der mehr denn eine Stunde in die sonnige Morgenluft hinauswimmerte und wohl aus manchem mitleidigen Herzen die leisen Worte lockte: »Gott sei den armen Sündern gnädig!« Endlich verklang auch der letzte Schlag des Glöckleins und Theobald warf sich, das Gesicht mit beiden Händen verhüllend, auf seinem Bette nieder. –
So lag er noch, als vor dem Hause des Meister Hänni eine geschlossene Carosse von zwei stattlichen Pferden gezogen anhielt, aus der zwei junge Männer in glänzendem Soldatenkleide stiegen und sich nach dem Junker Theobald erkundigten. Der Meister flog zur grünen Stube hinan und eine Viertelstunde später führte er den bisherigen Bewohner derselben unter manchem Bücklinge und Segenswunsche zu den harrenden Offizieren heraus. – »Der Junker Theobald weiß sich nicht zu fassen in seinem Glücke,« sagte er, der schnell davonrollenden Carosse stolz nachblickend, zu seiner Frau; »ich habe ihn fast mit Gewalt wie ein Kind umkleiden müssen; als ich hinaufkam, hat er mich wie schlaftrunken angeschaut, bevor er begriff, was ich wollte von ihm.«
»Recht bleich und angegriffen sieht er schon aus,« erwiderte die Meisterin; »aber der Schönste ist er dennoch von den Dreien.« –
Der Meister hatte recht gesehen; Theobald wußte sich nicht zu fassen und noch als er mit seinen zwei Begleitern nach kurzer und schweigsamer Fahrt vor einem Seiteneingange des Münsters anhielt, mußte er gewaltsam seine Gedanken sammeln, um sich deutlich zu machen, was eigentlich vorgehen sollte. Der Sturm widerstreitender Empfindungen, der nach langen Tagen peinlicher Ungewißheit so plötzlich über ihn hereingebrochen, hatte seine sonst rüstige Kraft erschöpft für den Augenblick. Juliens Brüder nahmen ihn höflich in die Mitte und traten mit ihm durch die Kirchenthüre. Der weite, in einem kühlen Zwielichte dämmernde Raum war menschenleer und nur von tief anschwellenden Orgeltönen angefüllt; aber im nämlichen Augenblicke öffnete sich auch die gegenüberstehende Thüre und Theobald konnte nur mit Mühe einen lauten Ausruf zurückhalten, als er in dem einfallenden Lichtstreifen Julien erkannte, die, von ihrem Vater geführt und von einem Geistlichen in vollem Ornate gefolgt, von jener Seite hereintrat.
Die beiden Gruppen näherten sich langsam dem Altare, der ungefähr in gleicher Entfernung zwischen ihnen in der Mitte stand. Vor demselben angekommen, wichen die bisherigen Begleiter plötzlich einen Schritt zurück, der Geistliche stieg die Stufen hinan und Theobald und Julia standen Auge in Auge gesenkt ihm allein gegenüber.
Sie war bleich wie die weiße Rose, die von dem schmucklosen Myrthenkranze festgehalten neben ihrer Schläfe herabnickte, aber von jener duftigen, fast überirdischen Schönheit überhaucht, die sich manchmal auf das Antlitz guter Menschen legt, sobald sie zur letzten Ruhe eingeschlummert, als der erste verklärende Morgenstrahl eines neuen, schönern Lebens. Es glitt auch kein Erröthen auf ihre Wangen, als sie Theobald die Hand entgegenreichte; sie schaute ihn nur an mit einem langen trübschimmernden Blicke, der deutlicher denn alle Worte sagte: »Wie schwer mußt du um mich gelitten haben, mein Lieber!« Dann senkten sich ihre Augen und mit einem leisen Drucke der zitternden Hand zog sie ihn neben sich auf die Knie vor dem Altare nieder. Die Orgel verstummte und die Stimme des Geistlichen erhob sich. Er sprach von der Heiligkeit, von der göttlichen Einsetzung des ehelichen Lebens und von den hohen Pflichten, die zwei Menschen mit ihrer Verbindung zu demselben einzugehen haben. Theobald hörte diese Rede nur wie einen weithinverhallenden Schall an seinem Ohre vorüberziehen; während er deutlicher fühlte, wie Juliens Hand in der seinigen immer heftiger erzitterte und mit einer fieberischen Gluth erfüllt wurde. Aber als der Geistliche mit erhobener Stimme sie aufforderte, zu bezeugen, daß sie in Glück und Leid, in Leben und Sterben in treuer Liebe zusammenhalten und nach dem göttlichen Worte Eines sein wollten, fiel Juliens »Ja« mit demjenigen Theobalds zusammen, wie der reine Klang der Silberglocke. –
Die feierliche Handlung war beendigt. Die tiefen Orgeltöne begannen wieder anzuschwellen und Theobald erhob sich, um seiner Anvermählten den Arm zu reichen; aber im Augenblicke schon stand der Oberst zwischen ihr und ihm und hatte Julien an der Hand gefaßt. Ihre Brüder waren ebenfalls vorgetreten und hatten den Neuvermählten wieder in ihre Mitte genommen. Er streckte, verwundert um sich schauend, beide Arme aus, wie zur Abwehr, und beugte sich vorwärts, Julien entgegen; sie hob langsam den Finger an den Mund und flüsterte angstvoll: »Nicht hier, Theobald; geh' mit meinen Brüdern, wie ich dem Vater folge. Unser Bund ist im Angesichte Gottes geschlossen, er wird uns auch zusammenführen!«
Der Oberst zog stramm und aufrechtgehend die an seinem Arme schwankende Tochter der Thüre zu, durch die er mit ihr eingetreten; Theobald schritt wie im Traume zwischen ihren Brüdern wandelnd zur entgegengesetzten hinaus, wo mit offenem Schlage der Wagen wartete, der sie hergebracht. Aber als die beiden Begleiter ihn zugleich an der Hand faßten, um ihm einsteigen zu helfen, schob er sie zurück und fragte, ob ihn die Fahrt zu Julien bringen werde, oder warum man ihm ihre Begleitung vom Altare weg verweigert habe? – »Ei, ei, Herr Schwager,« lautete die mit einem kalten Lächeln ertheilte Antwort; »Ihr scheint noch sehr wenig mit den standesgemäßen Sitten unserer Stadt vertraut zu sein. Vorerst werdet Ihr nach getroffener Anordnung Euern Aufenthalt auf einem Schlosse im Aargau nehmen und dorthin sind wir eben im Begriffe Euch zu begleiten.«
»Und Julia?«
»Wird sobald es schicklich erscheint, nachfolgen. Das müssen wir dem Familienhaupte überlassen, wie gebräuchlich.«
»Aber ich bin augenblicklich zu einer solchen Fahrt noch gar nicht vorbereitet,« erwiderte Theobald zögernd, »da ich von solchen Herkömmlichkeiten allerdings nicht unterrichtet war. Hab' ich doch nicht einmal von meinen Hausleuten Abschied genommen.«
»Bah,« rief einer der Herren unwillig, »das hättet Ihr allenfalls heute thun können, aber seit Ihr der Gemahl unserer Schwester geworden, würde sich ein solcher Abschiedsbesuch wahrhaftig seltsam ausnehmen. Für alles Uebrige braucht Ihr nicht zu sorgen. En avant, wir haben heute noch ein schönes Wegstück vor uns.«
Sie stiegen ein und der Wagen rasselte die Stadt abwärts, über die Brücke durch das Thor an dem verhängnißvollen Gasthause zum Klösterli vorbei. Auf der Höhe des letztern angekommen, fuhr er an einem langen Zuge von Männern, Frauen und Kindern vorüber, die von einigen Bewaffneten begleitet wurden. – »Was bedeutet das,« fragte Theobald leise, als er in der Schaar die Wittwe des unglücklichen Hauptmanns mit ihren zwei Knaben wiedererkannte, »was wollen diese Leute?«
»Es sind einige der Rebellen und die Angehörigen Anderer, die in die Verbannung ziehen.« –
Theobald drückte sich erbleichend und mit geschlossenen Augen in die dunkle Wagenecke zurück. Aber wenn er auch mit klaren Blicken ausgeschaut, er hätte doch nicht wahrnehmen können, wie zur nämlichen Minute am andern Ende der Stadt ebenfalls ein Wagen durch das Thor rollte, der in entgegengesetzter Richtung nach Süden fuhr. Derselbe war wie der nordwärtsfahrende mit dem Wappen des Obersten geschmückt und führte gleich diesem eine schweigende Gesellschaft von dannen – den Obersten selbst und seine Tochter, die auch in eine Wagenecke zurückgelehnt, ihre still rinnenden Thränen mit dem Schleier zu verbergen suchte.
Die Zwei fuhren den ganzen Nachmittag und die Nacht hindurch ohne Unterbrechung; als sie in der Morgenfrühe eine Anhöhe erreicht, sahen sie vor sich in der Tiefe den Spiegel des Genfersee's aufschimmern. Die drei nach Norden Ziehenden dagegen fuhren um Mitternacht durch ein hallendes Bogenthor, hinter dem der Wagen Halt machte. »Endlich am Ziele,« rief einer der Brüder Juliens; »steigt aus, Schwager.«
»Und wo sind wir denn,« fragte Theobald aus seinem dumpfen Brüten aufschreckend; »ich vermag nichts zu erkennen in dieser Finsterniß.«
»Auf dem Schlosse Aarburg … dem festesten im Gebiete unserer ganzen Republik, mein Herr.«
»Aber wie denn … ich glaubte, Aarburg werde nur noch als Staatsgefängniß benützt; nicht so?« …
»Allerdings, indessen nicht für gewöhnliche Verbrecher! Doch steigt nur aus, der Kommandant des Schlosses ist ein vertrauter und ergebener Freund unsers Hauses.« –
Fast zur nämlichen Stunde kehrte in Bern der Meister Hänni von einer der Bürgerwachen, die er jeden andern Abend beziehen mußte, nach Hause zurück. »Nun weiß ich,« erzählte er, kaum durch die Thüre getreten, seiner harrenden Frau, »warum unser Herr Theobald nicht mehr heimgekommen nach der Hochzeit und warum diese selbst so plötzlich und still gefeiert worden ist. Der Krieg ist wieder ausgebrochen in Deutschland draußen und der Junker hat augenblicklich mit seinen beiden Schwägern zum Heere abreisen müssen. Die Drei sind Kriegskameraden zusammen, wie es einst ihre Väter waren. Man hat ihm den Soldaten immer angesehen, wenn er so hochaufrecht dastand, dem Herrn Theobald.«
»Und seine gnädige Frau, die Julia?«
»Die zieht, bis der Kriegssturm vorüber ist und sie ruhig zu ihrem Gemahle reisen kann, auf eines der Landgüter ihres Vaters im Waadtlande drinnen.«
»Die armen Leute!« seufzte die Meisterin mitleidig, »so vornehm und schön Beide sind, so haben sie nun doch auch schon ihr Kreuz; wer weiß, ob sie einander nur wiedersehen in diesem Leben, wenn der Junker Theobald in den Krieg ziehen muß!«
Ein Jahr später, die Frühblumen hatten verblüht und an den alten Mauern von Aarburg rankte schon da und dort eine wilde Rose aus dem zerklüfteten Gesteine sich an eines der eisenvergitterten kleinen Thurmfenster empor, stand eines Morgens der Befehlshaber der Festung vor der schweren Thüre einer Gefangenenzelle. Eine Weile horchte er und murmelte dann: »Ich wollt', es wär' abgethan.« Als er in die Zelle trat, erhob sich der Bewohner derselben und strich langsam die üppigen, aber schon leicht ergrauenden Haare aus der Stirne, unter der zwei dunkle, trübflimmernde Augen lagen. »Ich hab' Euch zwei Botschaften zu bringen, Herr Meyer,« sagte der Kommandant; »Julia ist gestorben … Gott habe sie selig; und der geheime Rath von Bern will Euch in Gnaden Eure Freiheit schenken, jedoch unter dem Beding, daß Ihr innerhalb vier Tagen das Gebiet einer löblichen Eidgenossenschaft zu verlassen habt und dasselbe bei Todesstrafe nie wieder betreten werdet.«
»Todt!« rief der Gefangene nach langem Schweigen leise vor sich hin; »todt … eine Lüge, wie das Leben.«
»Hier habt Ihr den Beweis,« erwiderte der Kommandant, ein Papier hervorziehend, »daß sie seit vierzehn Tagen in der Schloßkapelle von Vuifflans begraben liegt. Ihr habt eine Stunde Bedenkzeit, ob Ihr das gnädige Anerbieten des Rathes annehmen wollt oder vorzieht, hier zu bleiben.«
Der Gefangene blickte lange ohne eine Wimper zu zucken in das gereichte Blatt und flüsterte dann in seinem leisen Tone: »Vuifflans? … dein Vater hat mir sein Versprechen gehalten; ich halte das meinige … Eines mit dir im Leben und Sterben, Julia. Ich nehme die Gnadenbedingung an, Herr Kommandant.« –
Noch am nämlichen Tage schickte der Kommandant durch einen besondern Boten einen Bericht an den geheimen Rath nach Bern. In demselben wurde mitgetheilt, der Haarkräusler Theobald Meyer aus Köln, der wegen der Listen, durch die er eine hohe Standesfamilie der Republik in Kummer und Schande zu bringen beabsichtigt, zu lebenslänglicher Haft verurtheilt gewesen, habe zwar die ihm angebotene Gnade willig angenommen, sei aber dem Hatschierer, der ihn über die Grenze zu bringen beauftragt worden, alsbald entsprungen und habe sich in die Aare gestürzt. Bis zur Stunde habe seine Leiche noch nicht aufgefunden werden können.