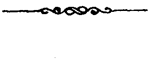|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
 Des Peter Michele's auf dem Hübeli führten ein gar stilles und einsames Leben. Das nicht große, aber schmucke und nette Heimwesen lag abseits vom Dorfe auf der Anhöhe, deren diesseitiger Abhang mit allerlei Strauchwerk, besonders mit einem wahren Haselnußwalde bedeckt war, wodurch das dahinter liegende Haus ein noch einsameres Ansehen gewann. Die beiden Eheleute arbeiteten ihr Berggütlein fast ganz allein, nur in den großen Werken hielten sie einige Taglöhner. Im Winter saß die Frau am Spinnrade, der Mann besorgte Stall und Vieh und was eben sonst zu besorgen war. An den Sommersonntagen gingen sie ihren Aeckern und Wiesen nach, überlegend, was die nächste Woche gethan werden sollte, und am Abend saßen sie hinter dem Hause auf dem Bänklein. Gar viel wurde da nicht geredet; sie schauten nach dem Abendroth, das über den dunkelnden Bergen schwamm, und blickten hinauf zu den Sternen, wie einer nach dem andern hervorguckte, bis zuletzt das ganze Himmelsgewölbe mit tausend und aber tausend Lichtern funkelte. Vom Thale herauf tönte noch allerlei lebendiges Geräusch durch die sinkende Nacht, von rasselnden Wagen auf der Landstraße und lauten frohen Menschenstimmen. Drunten an der Halde, hinter der großen Haselhecke, trieb sich
singend und kreischend, jubelnd und rufend das junge Völklein herum, das mit seinem Versteckens- und Fangspielen in dem bequem gelegenen Strauchwerke nicht zu Ende kommen konnte. Manchmal schlüpfte auch so ein naseweises Bürschlein, das sich bereits für groß und keck hielt, die Hecke herauf, ein anderes kleines Büblein mit sich schleppend und von weitem rufend: »Peter Michele, willst du nicht einen bösen Buben kaufen? … Du hast ja doch keinen!« – Das gab dann allemal ein lautes Geschrei und Gelächter hinter der Hecke; die beiden Leute aber standen wohl von ihrem Bänklein auf und gingen hinein oder auf die andere Seite des Hauses. Ueber solche Vorfälle sprachen sie nichts mit einander; aber den Gedanken, die so still und mächtig den verborgensten Winkel des menschlichen Herzens durchziehen, konnten sie dabei doch nicht wehren, Vergangenes und Künftiges vor die Seele zu führen. –
Des Peter Michele's auf dem Hübeli führten ein gar stilles und einsames Leben. Das nicht große, aber schmucke und nette Heimwesen lag abseits vom Dorfe auf der Anhöhe, deren diesseitiger Abhang mit allerlei Strauchwerk, besonders mit einem wahren Haselnußwalde bedeckt war, wodurch das dahinter liegende Haus ein noch einsameres Ansehen gewann. Die beiden Eheleute arbeiteten ihr Berggütlein fast ganz allein, nur in den großen Werken hielten sie einige Taglöhner. Im Winter saß die Frau am Spinnrade, der Mann besorgte Stall und Vieh und was eben sonst zu besorgen war. An den Sommersonntagen gingen sie ihren Aeckern und Wiesen nach, überlegend, was die nächste Woche gethan werden sollte, und am Abend saßen sie hinter dem Hause auf dem Bänklein. Gar viel wurde da nicht geredet; sie schauten nach dem Abendroth, das über den dunkelnden Bergen schwamm, und blickten hinauf zu den Sternen, wie einer nach dem andern hervorguckte, bis zuletzt das ganze Himmelsgewölbe mit tausend und aber tausend Lichtern funkelte. Vom Thale herauf tönte noch allerlei lebendiges Geräusch durch die sinkende Nacht, von rasselnden Wagen auf der Landstraße und lauten frohen Menschenstimmen. Drunten an der Halde, hinter der großen Haselhecke, trieb sich
singend und kreischend, jubelnd und rufend das junge Völklein herum, das mit seinem Versteckens- und Fangspielen in dem bequem gelegenen Strauchwerke nicht zu Ende kommen konnte. Manchmal schlüpfte auch so ein naseweises Bürschlein, das sich bereits für groß und keck hielt, die Hecke herauf, ein anderes kleines Büblein mit sich schleppend und von weitem rufend: »Peter Michele, willst du nicht einen bösen Buben kaufen? … Du hast ja doch keinen!« – Das gab dann allemal ein lautes Geschrei und Gelächter hinter der Hecke; die beiden Leute aber standen wohl von ihrem Bänklein auf und gingen hinein oder auf die andere Seite des Hauses. Ueber solche Vorfälle sprachen sie nichts mit einander; aber den Gedanken, die so still und mächtig den verborgensten Winkel des menschlichen Herzens durchziehen, konnten sie dabei doch nicht wehren, Vergangenes und Künftiges vor die Seele zu führen. –
Als die Beiden einander geheirathet, war Michele bereits in bestandenem Alter und Cätherle eben auch über die gewöhnlichen Mädchenjahre hinaus. Sie hatten einander seit vielen Jahren gerne gesehen und waren zusammen gegangen; aber Cätherle wollte nicht Hochzeit machen, bis die alte Peterin gestorben wäre. Das verdroß Michele anfänglich, aber allmälig fügte und gewöhnte er sich an diesen Widerstand, mußte er ja selbst gestehen, daß seine Mutter eine wunderliche alte Frau sei, der eine Söhnerin den rechten Tramp schwer zu treffen hätte. Endlich starb sie, und nun hatte Cätherle gegen die Hochzeit nichts mehr einzuwenden. Das so lange verschobene Fest wurde aber in so großer Stille begangen, daß die Leute im Dorfe sagten, es sei gar keine rechte Hochzeit gewesen. Das neugierige junge Volk, das sich oben im Dorfe versammelt hatte, um den Brautzug vom Hübeli herabkommen zu sehen, ward bitterlich getäuscht, als es vernahm, die beiden Brautleute seien schon am frühen Morgen mutterseelallein auf dem Fußweg nach des Sigersten Haus hinuntergegangen, um beim Beginn des Läutens gleich bei der Hand zu sein. Auch nach der Kirche wurde von einem Hochzeitsfeste, wie es sonst landesgebräuchlich, wenig bemerkt, weder bekränzte Leute und Rosse, noch Musik oder knallende Freudenschüsse. Die Brautleute gingen einzig vom Sigrist und seiner Frau begleitet nach dem Bären hinüber und tranken da zusammen zwei Maaß Zehnbatzigen, dann kehrten sie wieder, noch lange vor Abend, auf dem Fußwege nach dem Hübeli zurück. Was sollten sie auch mehr? Nahe Verwandte hatten sie keine im Dorfe und Jugendbefreundete auch nicht mehr. Michele und Cätherle waren schon lange so allein für sich gegangen, nachdem ihre Altersgenossen, Eines nach dem Andern, vor Jahren geheirathet hatten.
Jetzt waren sie endlich auch Mann und Frau, und bald mußten selbst die Dörfler sagen, das Hübeli-Cätherle sei gar nicht mehr so apart wie früher, man meine fast, es junge wieder; hätt' es nur zur rechten Zeit geheirathet, so wär's eine hübsche und manierliche Frau geworden. Michele selbst glaubte, Cätherle sei das auch so noch, und auf dem Hübeli fehlte weder zufriedenes Glück noch frohe Arbeit.
Das ging so etwa ein Jahr, da brachte Cätherle ein Mädchen zur Welt. Die Freude war groß, aber das Leid nicht minder, als das Kind schon nach wenigen Tagen getauft werden mußte. Die Hebamme meinte, das Kleine werde nicht alt, und wirklich starb es auch schon auf dem Heimwege von der Taufe. Es war ein gar kleines und schwächliches Kindlein gewesen. Cätherle weinte und wollte sich fast nicht drein schicken; auch dem Michele lag's schwer auf dem Herzen. Er hörte, daß im Dorfe allerlei Gerede ging. So hatte selbst des Sigristen Frau gesagt, das Kind sei nicht größer gewesen als ein ordentlicher Krebs; aber so geh' es, des Peter Michele's haben nicht Hochzeit gehalten wie andere Leute und werden wohl auch keine Kinder bekommen wie andere. Andere Frauen sagten sogar, das sei eben die gerechte Strafe des Himmels; Cätherle habe keine Schwiegermutter gewollt und müßte jetzt auch keine Kinder haben. Michele hütete sich, seiner Frau von diesen Dingen zu sagen, obwohl er jetzt wieder mehr als früher an seine Mutter denken mußte; aber bevor die Wöchnerin das Wochenbett verlassen konnte, hatte sie von dem Gerede schon mehr erfahren, als Michele selbst. Die Hebamme wußte fast jeden Tag etwas Neues zu erzählen, und sie glaubte sich sehr klug und verständig, wenn sie sagte: »Etwas Dümmeres gibt's doch nicht auf der Welt als die Menschen. Da sagen sie jetzt, das kleine Kind habe einen Kopf gehabt nicht größer als eine welsche Baumnuß und statt der Füßlein einen handlangen Fischschwanz. Selbst die Oberbäuerin habe sie gestern gefragt, ob das auch wahr sei. Es sei eben erschrecklich; die Leute seien einfältiger als Bohnenstroh.« –
Solche Erfahrungen waren nicht geeignet, die sonst schon einsamen Bewohner auf dem Hübeli mit den Leuten drunten im Dorfe in größern Verkehr zu bringen. Sie lebten ihr stilles Leben fort und sprachen nicht einmal viel unter einander selbst von der Hoffnung oder dem Wunsche, den Jedes im Herzen trug. Uebrigens lag sichtbarlicher Segen auf ihrem Fleiße, und bei der eingezogenen Sparsamkeit wuchs von Jahr zu Jahr ein behaglicher Wohlstand.
Aber eine so rechte Freude darüber konnte doch in den Herzen nicht Raum fassen, je mehr in denselben die Hoffnung erlosch, die das erste Leid noch beschwichtigt hatte. Da endlich – die Hochzeit lag schon wie ein halbvergessener Traum hinter den alternden Eheleuten, gestand Cätherle seinem Manne fast zagend ein doch glückseliges Geheimniß, dessen Enthüllung beide mit frohem Bangen entgegensahen. Als nach dem stillen Winter der Frühling in's Land ging, war's der schönste und glücklichste, der noch je die Bäume vor dem Hause auf dem Hübeli mit Blüthen bedeckt hatte. Cätherle trug Tag für Tag ein wackeres Büblein im Schatten derselben herum, so rund und pausbackig, wie man's nur irgend sehen wollte. Aus dem frohen Gesichtchen strahlten zwei helle blaue Augen, und der kleine Mund schrie so kräftig, daß Michele meinte, sein eigenes Mundstück sei ein wahres Narrenwerk dagegen. Wie der Winter nochmals gekommen und wieder vergangen, war der kleine Ruedele ein Büblein, wie auf dem Hübeli noch keines gewesen, und wie es drum in der ganzen weiten Welt kein anderes geben konnte. Er brauchte nur den lallenden Mund zu öffnen, so gab's für die Aeltern irgend ein Wunder zu hören; das Mememem und Tututud waren die lieblichsten und anmuthigsten Reden, und etwas Geschickteres als das gelegentliche Umpurzeln oder entenartige Herumwackeln konnt' es ja doch auch nicht geben.
Immerhin, als der kleine Ruedele sechs Jahre alt geworden, war er ein liebes, stilles und sinniges Büblein. Im Sommer saß er stundenlang unterm Schatten des großen Birnbaumes im Gärtchen, oder plätscherte an dem kleinen Bächlein herum, das durch den Baumgarten herabrieselte, oder auch ging er mit auf die Aecker und Wiesen und schaute nachdenklich den Arbeitenden zu. An die Halde hinunter zu den wilden Dorfkindern war er noch nie gekommen. Im Winter konnte er halbe Tage lang ruhig neben dem Spinnrade sitzen und Vater und Mutter mit seinen klugen Reden und Fragen in Verlegenheit und Verwunderung setzen. Daher kam über die Mutter allmälig Angst und Bekümmerniß, ein so kluges Kind könne nicht alt werden und müsse bald sterben, sie habe das schon tausendmal gehört. – Diese Besorgniß wuchs von Tag zu Tag, da der kleine Ruedele so bleich wurde und keine Nahrung recht anschlagen wollte, wie Cätherle meinte. Und doch wurde ja nichts gespart oder verweigert, was der Liebling nur immer begehren mochte. Manches Herrenkind in der Stadt bekam das ganze Jahr nicht soviel Zuckerbrod zu sehen, als Ruedele in Einer Woche hatte, und Cätherle tätschelte den ganzen Tag allerlei gute Sachen für den Kleinen. Aber es wollte Alles nicht helfen und anschlagen; Ruedele blieb mager und bleich, und endlich einmal hörte die Mutter, wie er im Schlafe leise wimmernde Töne vernehmen ließ. Am Morgen wußte zwar Ruedele nichts davon, auch klagte er nicht über Schmerzen; aber die Mutter hatte keine Ruhe mehr. Er sei krank, vielleicht sterbenskrank, das müsse ja ein Blinder sehen; er klage nur nicht, weil er eben das geduldigste und verständigste Kind auf Gottes Erdboden sei. Dem Vater wurde über diesen Reden selbst bange, und er war bereit, zum Doktor zu gehen; er selbst hatte zwar noch nie gedoktert, aber mit einem Kinde mußte es wohl anders sein.
Der Doktor gab ihm auch sogleich eine große Flasche Arznei mit, schwarz und bitter wie Tinte, und versprach, am Abend selbst zu kommen und die Sache zu untersuchen. Das gab große Betrübniß auf dem Hübeli. Da der kleine Kranke sagte, er wisse nicht, was ihm fehle, es thu' ihm auch nichts weh, nur das schwarze, bittere Wasser mache ihm übel, schüttelte der Doktor bedenklich den Kopf und meinte, das sei ein sonderbarer Fall, solche geheime Krankheiten seien eben oft gerade die gefährlichsten. Jedenfalls müsse der Kleine im Bette bleiben und seine Mittel fleißig gebrauchen. Cätherle weinte heiße Thränen, und Ruedele weinte mit der Mutter. Draußen lag warmer, goldener Sonnenschein, der ganze Baumgarten stand voll gelber und blauer Blumen, von den Bäumen zwitscherten und sangen die Vögel, in die Stube herein summte das leise Rauschen des kleinen Bächleins, an dem der Vater dem Büblein ein lustiges Wasserrad gebaut hatte – ach, wie wär' er so gerne da hinausgegangen, statt im Bette zu liegen und die schwarzen, bittern Wasser zu trinken! – Bat er aber die Mutter, ihn doch hinauszulassen, er wolle ja gesund und nicht krank sein, so weinte sie und klagte: »Du armes, armes Kind, du weißt eben nicht, wie's mit dir steht.«
Das waren recht traurige Zeiten für den kleinen Dulder. Der Doktor brachte immer neues bitteres Wasser, und je länger Ruedele davon trank, um so bleicher und magerer wurde er. Einmal im Herbste kam Ruedele's Gotte, die drüben im Seethal daheim war. Sie hatte ein großes Bedauern mit dem bleich und traurig daliegenden Kinde, das gar nicht mehr das gleiche Büblein sei, wie vor einem Jahre. Aber zu dem Doktor hätte sie nun einmal kein Zutrauen mehr, der kenne gewiß die Krankheit nicht. Drüben im obern Seethal sei ein berühmter, wie weit und breit keiner, sie ginge zu dem; am besten wär's, wenn Michele hinüberführe und das Büblein gleich mitnähme. In diesem Rathe lag eine tröstliche Hoffnung für Cätherle, und Michele mußte sogleich in's Dorf hinunter, um ein Fuhrwerk zu bestellen. Am folgenden Morgen, als die Sonne kaum hinter den Bergen emporgestiegen war, fuhr er schon auf der Landstraße das Thal aufwärts; Ruedele lag in Tücher und Kissen eingewickelt im Wägelchen, wie er auch gebeten hatte, neben dem Vater sitzen zu dürfen. Gleichwohl war dieses wieder seit Langem der erste frohe Tag für den Kleinen. Die großen schönen Häuser, an denen sie vorbeifuhren, der wilde Bach, der hundertmal größer, als der daheim, von einem hohen Felsen herabbrauste, die Kirchthürme, noch einmal so groß als der im Dorfe drunten, – das war ja eine Wunderpracht da draußen in der Fremde! Und endlich, als sie um den Berg herumkamen, – wie das da drunten so weiß und weit da lag und im Sonnenscheine glitzerte, wie ein großes Schneefeld. Ruedele war vor Erstaunen und Verwunderung außer sich, als ihm der Vater sagte, das alles sei lauter Wasser, viel tiefer als der Kirchthurm daheim, und man könne in einem großen, langen Kasten darüber wegfahren ohne Angst zu haben. Nein, das hätte Ruedele doch nicht wagen mögen; sein Herz klopfte vor Bangen, als auf dem hellen Wasser hinter den Bäumen hervor etwas Schwarzes erschien, wovon der Vater sagte, das sei eben ein Schiff, in dem die Leute über den See fahren. Ruedele konnte keinen Blick wegwenden, bis der dunkle Fleck, immer kleiner und kleiner werdend, in nebelhaftem Schimmer verschwunden war.
Der Vater mußte sich selbst wundern, wie das Büblein so frisch und munter war. Das bleiche Gesichtlein war röthlich angehaucht, und die blauen Augen schauten hell und fröhlich unter tausenderlei Fragen nach all' den Wunderdingen aus. Nur als sie endlich gegen das Dorf heranfuhren, in dem der Doktor wohnte, wurde Ruedele wieder still und fragte ängstlich, ob er von dem nun auch noch so bitteres Wasser trinken müsse, wie von dem Doktor daheim. Da der Vater auf diese Frage keinen rechten Trost wußte, legte sich Ruedele wieder traurig auf seine Kissen zurück.
Der Doktor, ein großer, freundlicher Herr mit einem klugen Gesichte, hörte Michele's Bericht über seines Bübleins Krankheit geduldig an, während Ruedele schüchtern und ängstlich nach den großen Gläsern an der Wand ausschaute, in denen gewiß die bittern Wasser eingeschlossen standen. Dann aber wurde er von dem Doktor freundlich herangerufen und über allerlei Dinge ausgefragt; auch der Vater mußte noch über Manches Antwort geben, wovon er fast meinte, der Doktor brauchte es gar nicht zu wissen, das gehöre ja nicht zur Krankheit. Endlich sagte der Doktor: »Hört, guter Freund, Arzneien will ich Euch keine geben, aber einen guten Rath, und wenn Ihr den richtig befolgt, wird's wohl das Beste sein. Einmal sorgt dafür, daß Ruedele mit Euch am Tische ißt und zwar nichts Anderes, als was Ihr selbst habt. Daneben gebt ihm brav Milch zu trinken, frisch von der Kuh weg, und dann laßt ihn mit andern Kindern herumspringen, so viel es ihm Freude macht. Ihr werdet sehen, über's Jahr ist der Kleine frisch und gesund, wie ein Fisch im Wasser.«
Michele war in großer Verlegenheit über diesen Bescheid. Es wollte ihm vorkommen, als ob der Doktor die Sache gar oberflächlich nähme, und als er beim Fortgehen draußen im Baumgarten einen ganzen Haufen Kinder erblickte, die sich ziemlich wild herumtummelten, dachte er: Mich wundert's nicht; der weiß nicht, wie's Einem ist, wenn man nur ein einziges Kind hat. – Desto froher war Ruedele, daß der Vater keine bittern Wasser mit heim bekommen hatte. Mit neuem Vergnügen bewunderte er die schönen Häuser an der Landstraße, die Leute, die darauf gingen und gar nicht gekleidet waren, wie die daheim auf dem Hübeli, und endlich wieder den See, der nun in der bereits auf den Berg sinkenden Sonne wie ein weites, mächtiges Feuer glühte.
Als die Heimkehrenden vom Breitholze gegen das Thal herabfuhren, stand dort am Wege ein Hausirmannle aus dem Baselbiet, das manchmal auf dem Hübeli einkehrte. Es wolle noch nach Lenzburg diesen Abend, sagte es. Michele lud das Mannle ein, mitzufahren bis da hinunter; er war froh, Jemanden zu finden, dem er sein volles, bedrücktes Herz ausschütten konnte. Die Hoffnung, die er auf den neuen Doktor gebaut, war gänzlich erloschen und damit auch der letzte Rest des Vertrauens zu demjenigen daheim im Dorfe. Der Eine hatte Das, der Andere Jenes gesagt und befohlen; es war aber klar, die Krankheit verstand keiner von Beiden, der neue vielleicht noch weniger, als der alte.
Ganz der gleichen Ansicht war der Baselbieter. – »Das ist all' Eins,« sagte er; »in den gelehrten Büchern der Herren steht noch nicht Alles geschrieben, was unser Einer alle Tage erfahren kann, wenn man heute da und morgen dort ist und in so manches Haus kommt. Sagt zum Exempel so einem Herrn etwas von bösen Wünschen, durch welche doch schon manches gute Menschenkind zu Grunde gerichtet wurde, so lachen sie euch aus und sagen, das seien Narrenpossen. Aber ich weiß das besser, und du kannst's auch wissen, denn wer hat keine bösen Menschen? Weißt du zum Exempel noch, wie es dir und deiner Frau gegönnt wurde, als das kleine Mädchen starb? … Warum sollt' es euch jetzt nicht mißgönnt werden, da ihr ein anderes Kind habt, und dazu noch ein so liebes und verständiges? – Der Böse aber ist stark im Menschen, das steht schon in aller heiligen Schrift zu lesen.«
Michele kam es vor, als ob ihm mit jedem dieser Worte ein neues Licht aufgehe. Und es war wohl auch so. Die Rede hatte nur die Gedanken aufgeweckt, die schon unklar in ihm gelegen hatten. Er dachte daran, wie es beim Tode des kleinen Cätherle gegangen, wie böse Leute damals eine geheimnißvolle Schuld auf ihn und seine Frau hatten wälzen wollen. Wer hatte so etwas zuerst gedacht oder gesagt, da es Niemand Wort haben und Jeder auf den Andern schieben wollte? – Der böse Feind hat es gethan, antwortete eine laute Stimme in Michele's Innerm, der böse Feind, der unser Glück auch jetzt wieder verderben will. – »Aber,« fragte der beklommene Vater nach sorgenvollem Schweigen den Hausirer, »aber wie ist da zu helfen?« – »Ja,« erwiderte das Mannle, »ich wüßte vielleicht Einen, obwohl er nicht leicht zugänglich ist. Da hinten in den Solothurner Bergen kenn' ich einen Mann, der dir so gut würde helfen können, als er schon hundert Andern geholfen hat. Aber es ist schwer, zu ihm zu kommen, oder wenigstens ihn zu bewegen, sich in solche Händel zu mischen. Die Doktoren passen ihm eben auf, wie der Stoßvogel der Taube; aus guten Gründen. Wenn du's indessen verlangst, will ich zu ihm gehen und dir dann Bericht machen, ob du selbst kommen dürfest.« – Michele wußte seinen Dank über diese unerwartete Hülfe in der Noth nicht besser zu erkennen zu geben, als daß er dem Baselbieter zum Abschied einen Thaler in die Hand drückte mit der Versicherung, daß ihn kein Geld reuen solle, wenn dem Kinde nur geholfen werden könne.
Für das mit großer Sehnsucht auf die Heimkehrenden harrende Cätherle war die Aussicht auf die neue Hülfe ein wahrer Herzenstrost. Auf den Doktor im Seethale dagegen ward es bitterböse. Wenn der für ein krankes Kind kein besseres Mittel wisse, als was man in jedem Stalle haben könne, so solle er das Doktern lieber bleiben lassen. Was das für eine Vernunft wäre, von einem solchen Kinde zu verlangen, daß es nichts Anderes esse, als die Großen und Gesunden, und gar noch, daß es mit den wilden Grotzen da drunten herumspringen solle. Es glaube einmal, Ruedele wäre schon lange nicht mehr am Leben, wenn er mit dem wilden Volke hätte umgehen müssen. – So wurde denn mit großer Ungeduld der Hausirer erwartet, der auch nach einigen Tagen den Bericht brachte, Michele könne selbst zu dem Mann in den Solothurner Bergen gehen. Da und da wohne derselbe, in dem alleinstehenden Häuschen auf der Waldwiese, links ab hinter der Schafmatt. –
Schon gegen Mittag des folgenden Tages kam Michele an das einsame Häuschen des alten Bannwarts, eine kleine ärmliche Wohnung, deren niedrige Fenster von dem tief herabhängenden Strohdache beinahe verdeckt wurden. Vor der Thüre lag lang ausgestreckt ein grauzottiger Hund, der dem Ankömmling drohend entgegenknurrte, bis ihn eine laute Stimme von innen heraus zur Ruhe verwies. Michele trat fast zaghaft durch einen niedrigen, schwarzrauchigen Gang in eine kleine Stube, in der ein eisgrauer Mann hinter einem großen aufgeschlagenen Buche saß. – »Alle guten Geister seien mit dir!« sagte der Alte, von seinem Buche aufblickend, mit leiser Stimme. »Du bist der Mann da aus den Thälern herab, der ein krankes Kind hat.« – Michele bejahte diese Anrede und wollte sogleich von dem Befinden Ruedele's Bericht geben; es war ihm, er könnte einen beklemmenden Druck vom Herzen werfen, wenn er nur zur Rede komme; aber der Alte unterbrach ihn nach wenig Worten und sagte, eine große beschriebene Tafel zur Hand nehmend: »Wenn ich das nicht schon Alles so gut und besser als du wüßte, guter Freund, so wär' keine große Hoffnung, daß ich deinem Kleinen helfen könnte; aber die Sache verhält sich so.« Dann fing er, nur dann und wann einen scharfen Blick nach Michele hinüberwerfend, an zu erzählen, wie bei den Aeltern die ersten Befürchtungen für des Kindes Gesundheit entstanden, was sie dabei gedacht und gethan, und wie die Krankheit ihren Verlauf genommen, Zug für Zug, daß dem Zuhörer ein kalter Schauer über die Glieder rieselte. Als der Alte am Schlusse feierlich fragte: »Oder sage mir, ist es nicht so?« war Michele kaum im Stande, ein beklommenes »Ja« hervorzubringen. Es war ihm, als müßt' er vor dem Allwissenden in's Gericht gehen.
Nach einer langen Pause, deren drückende Stille durch den nachtönenden Pendelschlag einer unsichtbaren Uhr noch vermehrt wurde, erhob der Alte sein Gesicht mit einem zufriedenen Lächeln von dem Buche und fuhr freundlicher und zutraulicher fort: »Du darfst nicht verzagen, guter Mann; die bösen Kräfte sind stark über deinem Kinde, aber wenn du den rechten Willen und das Vertrauen hast, so mag geholfen werden.« – Michele versicherte demüthig, daß er alles Vertrauen zu der übernatürlichen Kunst des Alten habe, und that dann, wie ihm der Hausirer angerathen. Er zog ein Bündelchen Geld aus seiner Busentasche und legte dasselbe still auf einen kleinen Schrank, der neben der Thüre stand. Der Alte schien auf dieses Thun nicht zu achten. Er stand schweigend auf, um in ein hinteres Stübchen zu gehen; als er zurückkam, stellte er ein schwarzes, angefülltes Säcklein auf den Tisch. Dann trat er langsamen Schrittes gegen Michele heran, faßte seine Hand und sprach ernst: »Versprich mir, zu thun, was ich dir sage.« – Michele versprach, in Allem zu gehorsamen, was zur Gesundheit seines Kindes dienen könne. – »Nun denn,« fuhr der Alte fort, »es gibt mancherlei böse Geister in Luft und Wasser, in Feld und Wald. Derjenige, der dein Kind verderben will, ist ein schwarzer Waldgeist; aber ich erkenne noch nicht, ob er in Menschen- oder Thiergestalt einhergeht. Mit den Blättern, die jetzt noch an den Bäumen hängen, ist seine Gewalt gekommen; wenn sie abfallen, muß er überwunden werden. Nun gib Acht: Sobald du nach Hause kommst, bringt ihr Ruedele's Bettlein, das jetzt neben dem euern steht, in's Hinterstübchen. In diesem aber müßt ihr sorgfältig jede Oeffnung verschließen, auch das Schlüsselloch muß von außen mit dem ersten Blatte aus der Offenbarung Johannis verklebt werden; der Kleine darf das Stübchen nicht verlassen und keine lebende Seele zu ihm hineingehen, außer du und deine Frau. Auch dürft ihr während der Zeit kein Almosen durch die Thüre geben. Sind endlich die Bäume kahl und die letzten Blätter abgefallen, so nehmt ihr diese Wurzeln in dem Säcklein da, sie sind in heiligen Nächten an einsamen Kreuzwegen im Wald ausgegraben. Um Mitternacht, wenn Ruedele schläft, werft ihr sie in den Ofen. Vorher aber muß deine Frau zwei Brodmännlein backen, wie sie solche sonst für das Büblein gemacht hat; das eine davon werft zu den brennenden Wurzeln und verschließt den Ofen, das andere aber gebt ihr am Morgen, nachdem ihr die Nacht mit Beten zugebracht, Ruedele zu essen. Davon wird er gesunden, wenn der böse Geist in Menschengestalt wirkt. Hilft es nicht, so geht er in Thiergestalt umher, und dann müßt ihr wieder zu mir kommen. Aber noch Eins: ihr dürft mit keinem Menschen von mir reden, außer etwa mit dem Hausirer. Nun geh' und schau' dich nicht um!«
Mit diesen Worten gab der Alte seinem athemlosen Zuhörer das schwarze Säcklein in die Hand und schob ihn zur Thüre hinaus. Michele taumelte wie im Traume die Wiesen abwärts und eilte hastig zwischen den dunkeln Tannenwäldern davon. Erst als ihm aus der Ferne die Thürme von Aarau durch den hellen Herbsttag entgegenleuchteten; wagte er stillzustehen und Athem zu schöpfen. Es war ihm, als ob er aus einem gespenstischen Traume erwache und in das freundliche Morgenlicht schaue; aber die Offenbarungen dieses Traumes waren zu einem um so festern Glauben erwachsen, je unheimlicher und ängstigender sie im Augenblicke gewesen waren. Als Michele zu Hause, immer noch von einem bangen Schauer vor der Macht des allwissenden Alten erfüllt, seinen Bericht erstattet, konnte Cätherle vor freudiger Dankbarkeit die ganze Nacht kein Auge schließen, daß der Noth des geliebten Kindes ein so mächtiger Beistand gefunden war.
Schon am folgenden Tage ward Ruedele in das Hinterstübchen gebracht. Er weinte zwar bitterlich, daß er nicht mehr bei seinen Aeltern schlafen und nicht einmal mehr in die Stube hinausgehen durfte; aber da ihm die Mutter sagte, welche Freude er ihr und dem Vater mache, wenn er nur bis zum Winter recht folgsam sein wolle, legte er das bleiche Gesicht ergeben auf das Kissen zurück. So lag er bald geduldig den ganzen Tag im Bette seiner stillen Klause, oder er saß auch am Fensterlein und schaute wehmüthig in's Thal, wie die Nebel langsam heraufwallten und drüber weg in langen Zügen die Vögel über den Wald flogen; oder er ergötzte sich an dem Klange der Glöcklein, die von der weidenden Heerde herübertönten. Nicht mehr lange, so kamen düstre Tage mit Regengüssen und Stürmen, welche die gelben Blätter von den Bäumen schüttelten. Der kleine Gefangene freute sich im Stillen, wie die Zweige vor seinem Fenster von Tag zu Tag kahler wurden; wenn nur erst einmal der Schnee kömmt und es Winter wird, dachte er, dann fängt die Mutter wieder an zu spinnen, und dann darf ich auch wieder in die Stube und dabei sitzen.
Mit nicht geringerer Sehnsucht schauten die Aeltern nach den Vorboten des herannahenden Winters aus. Endlich erschienen kalte Frostnächte, und bald wehte der Wind das letzte herabgesunkene Blatt über den gefrornen Boden dahin; die Vogelnester, die sommerlang im Laube verborgen gewesen, hingen unbedeckt und zerzaust an den kahlen Zweigen, während ihre lustige Brut schon längst über die Berge davongezogen. Jetzt sollte das letzte Erlösungswerk gethan werden. Mit großer Sorgfalt und gläubigem Sinn wurden die zwei Brodmännchen gebacken und das eine der mitternächtig angezündeten Gluth der Wurzeln überliefert, die, trocken und harzig, lechzend emporlohten. Ruedele war längst unter dem Brausen des Novembersturmes mit der süßen Hoffnung eingeschlummert, daß nun der Winter da sei, und er bald wieder in der Stube neben dem Spinnrade sitzen und bei seinen Aeltern schlafen könne.
Die Aeltern saßen wachend und betend in der Stube. Mit heimlichem Grausen hörten sie das Heulen des Windes, der in schweren Stößen gegen die Fenster heranbrauste, als ob böse Geister Einlaß verlangten. Sie beteten immer eifriger, mit lauter Stimme, bis der Tag leise heraufdämmerte und sich der Sturm zu legen begann. Da gingen sie mit klopfendem Herzen an die Thüre des Hinterstübchens. Drinnen war's stille, das Kind schlief noch immer; als aber Michele die Thüre leise öffnete, quoll ihm ein dumpfer Qualm durch die schmale Oeffnung entgegen. »Der böse Geist,« schrie Cätherle entsetzt zurückweichend. Ueber Michele selbst kam ein noch entsetzlicherer Gedanke, als die Furcht vor dem Bösen; er stieß die Thüre taumelnd auf und rief mit bebender Stimme den Namen seines Kindes. Aber Ruedele lag lautlos mit geschlossenen Augen in seinem Bette; die leise geöffneten Lippen bewegten sich zu keiner Antwort, zu keiner Klage mehr. –
Aus einer kaum bemerkbaren Ritze, die am Ofen durch die schwere Harzgluth entstanden, kräuselte noch immer ein leichtes Räuchlein hervor. –
Der erste Schnee dieses Jahres legte seine kühle Decke auf ein kleines Grab, an dem zwei einsame, trostlose Aeltern standen. An milden Sommerabenden sitzen sie noch immer mit grauen Häuptern auf dem Bänklein hinter ihrem Hause und schauen schweigend zu den Sternen empor, nach deren stiller Heimath sie sich hinübersehnen. Die Sterne irdischer Hoffnung und Freude sind für sie längst niedergegangen.